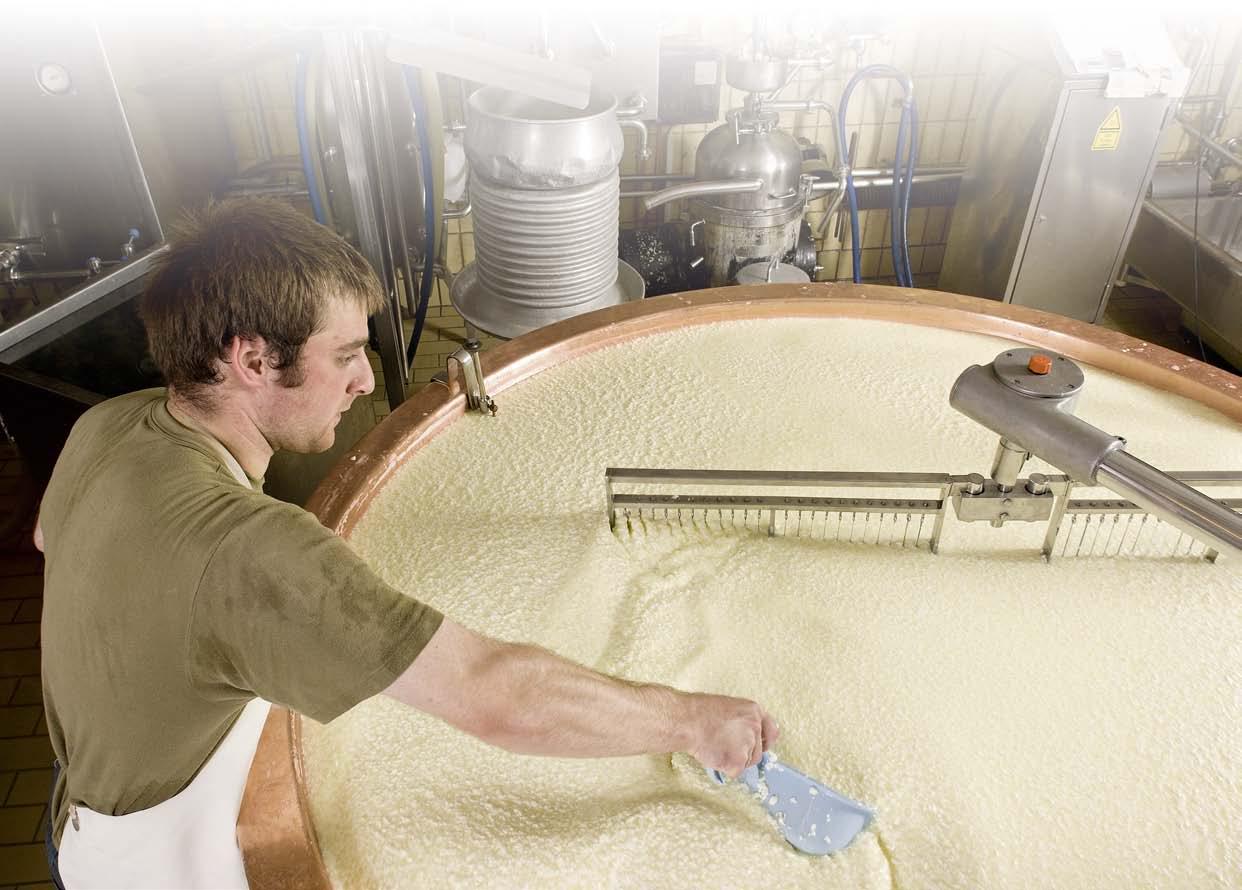2011 a grar B ericht
Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
Telefon: 031 322 25 11
Telefax: 031 322 26 34
Internet: www.blw.admin.ch
Copyright: BLW, Bern 2011
Gestaltung
Artwork, Grafik und Design, St. Gallen
Fotos
Agrarfoto
Bundesamt für Landwirtschaft BLW
Christof Sonderegger, Fotograf – Gabriela Brändle, ART – Getty Images
– Peter Mosimann, Fotograf
– Peter Studer, Fotograf
Philip Büchler
SRF / P. Mosimann, «Ab auf die Alp»
Switzerland Cheese Marketing AG
Bezugsquelle
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern
Bestellnummern:
Deutsch: 730.680.11 d
Französisch: 730.680.11 f
Italienisch: 730.680.11 i
www.bundespublikationen.admin.ch
2 Impressum
–
–
–
–
–
–
10.11 1500d 860275668
3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis n Vorwort 6 n 1. Bedeutung und Lage der Landwirtschaft 9 n 1.1 Ökonomie 9 1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1.1.1.1 Strukturentwicklungen 10 1.1.1.2 Wirtschaftliche Kennziffern 12 1.1.1.3 Bundesausgaben 16 1.1.2 Märkte 18 1.1.2.1 Milch und Milchprodukte 19 1.1.2.2 Tiere und tierische Erzeugnisse 23 1.1.2.3 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte 28 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 36 1.1.3.1 Sektor-Einkommen 2010 36 1.1.3.2 Schätzung des Sektor-Einkommens 2011 38 1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 41 1.1.4.1 Einkommen und Arbeitsverdienst 42 1.1.4.2 Weitere betriebswirtschaftliche Kennzahlen 45 n 1.2 Soziales und Gesellschaft 47 1.2.1 Soziales 48 1.2.1.1 Einkommen und Verbrauch 48 1.2.1.2 Ausbildung und Arbeit 50 1.2.2 Gesellschaft 57 1.2.2.1 Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft 57 n 1.3 Ökologie und Ethologie 63 1.3.1 Ökologie 63 1.3.1.1 Flächennutzung und Produktionsmittel 64 1.3.1.2 Klima 66 1.3.1.3 Energie 82 1.3.1.4 Luft 86 1.3.2 Ethologie 89 n 2. Agrarpolitische Massnahmen 93 n 2.1 Produktion und Absatz 93 2.1.1 Übergreifende Instrumente 95 2.1.1.1 Qualitätspolitik 95 2.1.1.2 Branchen- und Produzentenorganisationen 95 2.1.1.3 Absatzförderung 98 2.1.1.4 Kennzeichnung von Landwirtschaftsprodukten 101 2.1.1.5 Qualitätssicherung 104 2.1.1.6 Instrumente des Aussenhandels 105
4 Inhaltsverzeichnis 2.1.2 Milchwirtschaft 109 2.1.3 Viehwirtschaft 114 2.1.4 Pflanzenbau 121 n 2.2 Direktzahlungen 125 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 126 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 133 2.2.2.1 Flächenbeiträge 133 2.2.2.2 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 134 2.2.2.3 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 135 2.2.2.4 Hangbeiträge 136 2.2.2.5 Neuerungen 2011 137 2.2.3 Ökologische Direktzahlungen 138 2.2.3.1 Ökobeiträge 138 2.2.3.2 Ethobeiträge 150 2.2.3.3 Sömmerungsbeiträge 151 2.2.3.4 Beiträge für den Gewässerschutz 153 2.2.3.5 Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 155 2.2.3.6 Neuerungen 2011 156 n 2.3 Grundlagenverbesserung 157 2.3.1 Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen 158 2.3.1.1 Strukturverbesserungen 158 2.3.1.2 Soziale Begleitmassnahmen 161 2.3.1.3 Gemeinschaftliche Projektinitiativen 162 2.3.1.4 Agrotourismus 163 2.3.1.5 Meliorationen als Teil einer ganzheitlichen Raumorganisation 164 2.3.1.6 Einfluss der Bewirtschaftung auf Naturgefahren 166 2.3.2 Landwirtschaftliches Wissen – forschen, beraten, bilden 170 2.3.2.1 Landwirtschaftliches Wissens- und Innovationssystem 170 2.3.2.2 Forschung 172 2.3.2.3 Beratung 176 2.3.2.4 Berufsbildung 177 2.3.3 Produktionsmittel 179 n 2.4 Spezialthemen 180 2.4.1 Finanzinspektorat 180 2.4.2 Vernetzung der Agrar-Datenbanken 182
5 Inhaltsverzeichnis n 3. Internationale Aspekte 185 n 3.1 Internationale Entwicklungen 185 3.1.1 Abkommen mit der EU in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelund Produktsicherheit sowie öffentliche Gesundheit 186 3.1.2 Freihandelsabkommen mit Ländern ausserhalb der EU 188 3.1.3 Agrarabkommen Schweiz – EU 189 3.1.4 Protokoll Nr. 2 191 3.1.5 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 191 3.1.6 WTO 194 3.1.7 OECD 197 3.1.8 FAO 201 3.1.9 Genetische Ressourcen / Agrobiodiversität 203 3.1.10 Internationaler Getreiderat und Lebensmittelhilfe-Übereinkommen 205 n 3.2 Internationale Vergleiche 207 3.2.1 Produzenten- und Konsumentenpreise – Vergleich mit den Nachbarländern 207 3.2.2 Schweizer Milchbetriebe im Vergleich mit Österreich und Deutschland 212 n Mitarbeit am Agrarbericht 2011 216 n Stichwortverzeichnis 218 n Anhang A1 Tabellen A2 Rechtserlasse, Begriffe und Methoden A59 Abkürzungen A60 Literatur A62
Vorwort
Die letzten Jahre waren geprägt durch steigende Herausforderungen für Gesellschaft und Wirtschaft. Finanz-, Wirtschafts-, Nahrungsmittel- und zuletzt vor allem Schuldenkrise sind Stichworte dazu. Eine grosse Herausforderung für die Schweiz ist die Stärke des Schweizer Frankens. Davon betroffen ist auch die Land- und Ernährungswirtschaft. Direkte Auswirkungen gibt es für den Export von Nahrungsmitteln, indirekt nimmt der Druck auf die Nahrungsmittelproduktion in der Schweiz zu, insbesondere durch den in den letzten Monaten stark gestiegenen Einkaufstourismus. Der Bundesrat hat in seinem Paket zur Unterstützung des Werkplatzes Schweiz von Ende August eine Aufstockung der Beiträge für den Export von verarbeiteten Nahrungsmitteln um 10 Mio. Fr. beschlossen. Das Parlament hat diese Massnahme in der Herbstsession gutgeheissen. Die Massnahmen des Bundes können aber nur subsidiären Charakter haben. Die Frankenstärke ist eine Herausforderung für die Akteure der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei dürfte die wechselkursbedingte Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit für die Land- und Ernährungswirtschaft erst in den nächsten Monaten vollumfänglich spürbar werden. Entsprechend sind alle gefordert, einen Beitrag zur Bewältigung der schwierigen Situation zu leisten.

Im Agrarbericht stehen nicht die aktuellen Ereignisse im Mittelpunkt, sondern die Berichterstattung über die Auswirkungen der Agrarpolitik im vergangenen Jahr. Dabei bilden Ökonomie, Soziales und Ökologie – die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – die Grundlage der Berichterstattung.
Für das Berichtsjahr 2010 zeigt sich im ökonomischen Bereich ein Rückgang des Arbeitsverdienstes je Familienarbeitskraft um 5 % gegenüber 2009. Damit ist der Arbeitsverdienst zum zweiten Mal hintereinander rückläufig. Er liegt aber im Vergleich der letzten zehn Jahre über dem Durchschnitt. Gemäss den Schätzungen der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ist für das laufende Jahr eine Stabilisierung der Einkommen zu erwarten. Für die nächsten Jahre gilt es auch für die Landwirtschaft, mit innovativen und kreativen Ideen die Produktivität weiter zu steigern. Das Wissen und Können in der Schweizer Landwirtschaft ist gross, so dass sie ihren Beitrag zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen leisten kann. Die wirtschaftliche Bedeutung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wie Direktverkauf, Arbeiten für Dritte oder Agrotourismus hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Rund 8 % der Einnahmen entfallen auf einem durchschnittlichen Betrieb auf diese Aktivitäten. Im Agrarbericht 2011 wird das Anbieten von sozialen Dienstleistungen durch Landwirtschaftsbetriebe näher vorgestellt. Die Ergebnisse eines Projektes der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART zeigen, dass diese Dienstleistungen eine Diversifikationsstrategie für Betriebe darstellen können. Neben den sozialen Kompetenzen, der geeigneten Situation eines Familienbetriebs und dem Einverständnis aller Mitglieder für eine derartige Arbeit, bedarf es einer ausgeprägten Bereitschaft, sich auf ein solches Vorhaben einzulassen. Damit soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft ihre Bedeutung halten und ausbauen können, sind gemäss der Studie aber weitere Anstrengungen notwendig, so in der Qualitätssicherung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Entlastung von Betreuenden und der Tarifgestaltung.
6 Vorwort
Grosse Anstrengungen sind auch notwendig, um die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen zu können. Das Thema Klima ist im ökologischen Bereich ein Schwerpunkt der Ausgabe 2011 des Agrarberichts. Das Klima hat einen grossen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion. Trockenheit oder Nässe können zu beträchtlichen Ernteeinbussen führen, wie z.B. letztes Jahr in Russland und der Ukraine. Die wetterbedingten Ernteausfälle in bedeutenden Exportregionen der Welt hatten auch einen wesentlichen Anteil an den stark schwankenden Preisen für landwirtschaftliche Rohstoffe in den letzten Jahren. Eine weit vorausschauende Politik ist beim Klima besonders wichtig, denn heutiges Unterlassen wird sich erst viel später auswirken. Das BLW hat deshalb eine Klimastrategie Landwirtschaft ausgearbeitet, die ehrgeizige Ziele setzt. Noch wichtiger als hohe Ziele sind aber konkrete Massnahmen, um die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft zu senken und Anpassungen an den Klimawandel rechtzeitig in die Wege zu leiten. Das BLW wird diese wichtigen Fragen zusammen mit Partnern aus Forschung und Privatwirtschaft weiter bearbeiten. Für die nahe Zukunft gilt die volle Aufmerksamkeit aber vor allem der Agrarpolitik 2014–2017 (AP 14–17). Die Vorlage ist in der Vernehmlassung auf ein grosses Interesse gestossen. Insgesamt sind 687 Stellungnahmen eingegangen. In der Mehrheit ist die Vorlage auf Zustimmung gestossen. Auch das Herzstück der AP 14–17, das weiterentwickelte Direktzahlungssystem, ist von einer Mehrheit begrüsst worden. Allerdings gehen die Meinungen zu einzelnen Punkten recht weit auseinander. Die umstrittenen Fragen gilt es sorgfältig zu analysieren und für die Botschaft kohärente Lösungen zu entwickeln. Zusätzlich sind für die Botschaft aber auch die veränderten Wechselkursverhältnisse mit in die Überlegungen einzubeziehen. Der Bundesrat wird die Botschaft zur AP 14–17 voraussichtlich anfangs 2012 zuhanden des Parlamentes verabschieden.
Bernard Lehmann Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft
7 Vorwort
8
1. Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

1.1 Ökonomie
Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen, damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann. Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung. Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe, über die Strukturentwicklungen, über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.
9 1.1 Ökonomie
1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
1.1.1.1 Strukturentwicklungen
Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft wird der Fokus auf die Zahl der Betriebe und deren Grössenverhältnisse und auf die Zahl der Beschäftigten gelegt. Die folgenden Abschnitte orientieren über die Veränderungen dieser beiden Strukturmerkmale.
n Betriebe
Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends ging die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe insgesamt um rund 11 500 Einheiten oder jährlich um 1,8 % zurück. Mit 1,6 % noch etwas tiefer war die Abnahmerate zwischen 2009 und 2010.
Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen
Die Entwicklung nach Grössenklassen zwischen 2000 und 2010 zeigt, dass die Wachstumsschwelle sich nach oben verschoben hat. Sie liegt aktuell bei 30 ha. Das heisst, dass die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 30 ha ab- und über diesem Wert zunehmen.
In den einzelnen Regionen war die Abnahmerate zwischen 2000 und 2010 ähnlich gross.
10 1.1 Ökonomie
Merkmal Anzahl Betriebe Veränderung pro Jahr in % 2000 2009 2010 2000–2010 2009–2010 Grössenklasse 0–3 ha 8 371 6 648 6 659 –2,3 0,2 3–10 ha 18 542 13 146 12 655 –3,7 –3,7 10–20 ha 24 984 19 865 19 305 –2,5 –2,8 20–25 ha 7 244 6 794 6 761 –0,7 –0,5 25–30 ha 4 430 4 760 4 671 0,5 –1,9 30–50 ha 5 759 6 937 7 050 2,0 1,6 >50 ha 1 207 1 884 1 964 5,0 4,2 Region Talregion 31 612 26 708 26 297 –1,8 –1,5 Hügelregion 18 957 16 468 16 221 –1,5 –1,5 Bergregion 19 968 16 858 16 547 –1,9 –1,8 Total 70 537 60 034 59 065 –1,8 –1,6 Quelle: BFS
Tabelle 1 Seite A2
Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nach Regionen
Die Abnahmerate war bei den Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben zwischen 2000 und 2010 insgesamt ähnlich hoch. Differenzen zeigen sich zwischen den Regionen. Bei den Haupterwerbsbetrieben waren die Abnahmeraten mit 2 % in der Tal- und Hügelregion doppelt so hoch wie in der Bergregion. Anders präsentiert sich das Bild bei den Nebenerwerbsbetrieben. Dort ist die Abnahmerate in der Bergregion mit 3,3 % mit Abstand am höchsten, gefolgt von der Talregion mit 1,4 % und der Hügelregion mit 0,7 %.
n Beschäftigte
Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist mit einer Reduktion der Anzahl Beschäftigten verbunden.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
Im Jahrzehnt 2000–2010 ist die Zahl der Beschäftigten insgesamt um rund 36 500 Personen gesunken. Wie bei den Betrieben betrug die Abnahme 1,9 % pro Jahr. Dabei war der Rückgang bei den familieneigenen und familienfremden Arbeitskräften prozentual praktisch gleich hoch, absolut ging die Anzahl der familieneigenen Arbeitskräfte um 30 000, diejenige der familienfremden um 6 500 zurück. Im letzten Jahr hat die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte wieder leicht zugenommen.
11 1.1 Ökonomie
Merkmal Anzahl Betriebe Veränderung pro Jahr in % 2000 2009 2010 2000–2010 2009–2010 Haupterwerbsbetriebe Talregion 23 536 19 655 19 261 –2,0 –2,0 Hügelregion 13 793 11 629 11 402 –1,9 –2,0 Bergregion 11 910 10 930 10 771 –1,0 –1,5 Total 49 239 42 214 41 434 –1,7 –1,8 Nebenerwerbsbetriebe Talregion 8 076 7 053 7 036 –1,4 –0,2 Hügelregion 5 164 4 839 4 819 –0,7 –0,4 Bergregion 8 058 5 928 5 776 –3,3 –2,6 Total 21 298 17 820 17 631 –1,9 –1,1 Quelle: BFS
Merkmal Anzahl Beschäftigte Veränderung pro Jahr in % 2000 2009 2010 2000–2010 2009–2010 Familieneigene 165 977 138 860 136 209 –2,0 –1,9 davon: Betriebsleiter 74 724 57 136 56 238 –2,8 –1,6 Betriebsleiterinnen 2 346 2 898 2 827 1,9 –2,4 Familienfremde 37 816 30 928 31 253 –1,9 1,1 Total 203 793 169 788 167 462 –1,9 –1,4 Quelle: BFS
Tabelle 2 Seite A2
1.1.1.2 Wirtschaftliche Kennziffern
n Bruttowertschöpfung
Die Schweizer Wirtschaft erreichte im Berichtsjahr eine Bruttowertschöpfung von 520 Mrd. Fr. Das sind rund 14 Mrd. Fr. oder 2,7 % mehr als im Vorjahr. Der Anteil des Primärsektors lag bei 1,1 %. Davon entfielen gut zwei Drittel auf die Landwirtschaft.
der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen
2
3
n Aussenhandel
Der Schweizer Aussenhandel hat sich nach dem schwierigen, durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise geprägten 2009 im Berichtsjahr wieder etwas erholt. So waren die Ein- und Ausfuhren mit 183,1 Mrd. Fr.
203,3 Mrd. Fr. um 8 % resp. 9 % höher als im Vorjahr. Die Handelsbilanz schloss 2010 mit einem Exportüberschuss von 20,2 Mrd. Fr. ab, das sind 1,8 Mrd. Fr. mehr als 2009. Entwicklung
Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen hat sich im Berichtsjahr insgesamt positiv entwickelt. Gegenüber 2009 blieben die Importe stabil und die Exporte konnten weiter ausgebaut werden. Die Handelsbilanz bei den Landwirtschaftsprodukten schloss zwar auch 2010 mit einem Importüberschuss ab, aber mit 3,7 Mrd. Fr. war er so tief wie noch nie.
Im Berichtsjahr stammten rund 77 % der Landwirtschaftsimporte aus der EU. 62 % der Exporte wurden in den EU-Raum getätigt. Die Handelsbilanz mit der EU bei den Landwirtschaftsprodukten schloss 2010 mit einem Importüberschuss von 4,0 Mrd. Fr. ab.
12 1.1 Ökonomie
Entwicklung
Sektor 2000 2008 2009 2 2010 3 Anteil Veränderung 2010 2008/10 In Mio. Fr. in % in % Primärsektor 6 363 6 460 6 001 5 850 1,1 –9,4 davon Landwirtschaft nach LGR 4 830 4 573 1 4 105 3 878 0,7 –15,2 Sekundärsektor 107 852 142 119 133 611 141 068 27,2 –0,7 Tertiärsektor 281 559 365 576 366 281 372 614 71,7 1,9 Total 395 774 514 155 505 894 519 533 100,0 1,0
Halbdefinitiv
1
Provisorisch
Schätzung
Quelle: BFS
2000/02 2008 2009 2010 2000/02–10 Mrd. Fr. % Einfuhren total 137,2 197,5 168,8 183,1 33,5 Landwirtschaftsprodukte 8,5 12,2 11,5 11,5 35,3 davon aus EU 27 6,4 9,4 8,9 8,8 37,5 Ausfuhren total 137,0 216,3 187,2 203,3 48,4 Landwirtschaftsprodukte 3,5 7,6 7,5 7,8 122,9 davon in EU 27 2,5 4,9 4,8 4,8 92,0 Quelle: OZD
bzw.
des Aussenhandels
Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2010
Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Deutschland eingeführt, gefolgt von Italien und Frankreich. Praktisch zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern. Gut die Hälfte der wertmässigen Ausfuhren in die EU gingen 2010 in die drei Länder Deutschland, Frankreich und Italien.
Die Handelsbilanz mit den umliegenden EU-Ländern sowie mit Spanien und den Niederlanden wies im Berichtsjahr Importüberschüsse aus. Die schlechteste Bilanz wies die Schweiz mit Italien aus. Einen Exportüberschuss von 155 Mio. Fr. wies die Schweiz 2010 im Verkehr mit den übrigen EU-Ländern aus.
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2010
Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)
Früchte (8)
Gemüse (7)
Lebende Pflanzen, Blumen (6)
Ölsaaten, Fette, Öle (12, 15)
Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)
Getränke (22)
Tierfutter, Abfälle (23)
Nahrungsmittel (20, 21)
Milchprodukte (4)
Tabak und Diverses (13, 14, 24)
Genussmittel (9, 17, 18)
Quelle: OZD
Quelle: OZD 1 500 1 000 1 500 2 000 1 000 2 500 500 0 500 in Mio. Fr. Einfuhren Ausfuhren Import- bzw. Exportüberschuss übrige Länder Niederlande Spanien Österreich Italien Frankreich Deutschland 1 153 1308 155 1 010 657 312 51 353 693 381 369 977 862 318 1 744 1 243 501 1 727 750 2 091 1 229
2 500 2 000 1 000 1 000 1 500 1 500 500 2 000 500 0 in Mio. Fr. Einfuhren Ausfuhren Import- bzw. Exportüberschuss
1 687 119 1 464 2280 816 441 803 362 582 712 130 1 020 1 009 1 568 630 575 11 634 4 580 361 128 5 587 491 96 1 044 683 1726 1 598 236 450 214 52 1 291 1 239 13 1.1 Ökonomie
Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke, tierische Produkte (inkl. Fische), Genussmittel (Kaffee, Tee, Gewürze) sowie Nahrungsmittelzubereitungen eingeführt. Die wertmässigen Getränkeeinfuhren setzten sich vor allem aus rund 64 % Wein, 15 % Mineralwasser und etwa 10 % Spirituosen zusammen. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» waren 41 % dem Sektor Fleisch, 29 % dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.
2010 wie im Vorjahr wurden vor allem Genussmittel und Getränke exportiert, gefolgt von Nahrungsmittelzubereitungen, Tabak und Diverses sowie Milchprodukte. Unter den Genussmitteln waren es vorwiegend Kaffee mit 1 282 Mio. Fr. (2009: 1 025 Mio. Fr.) sowie Schokolade und kakaohaltige Nahrungsmittel mit 773 Mio. Fr. (2009: 743 Mio. Fr.). Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bildeten die Lebensmittelzubereitungen, Kaffee-Extrakte, Suppen und Saucen.
Die Handelsbilanz nach Produktekategorien wies im Berichtsjahr vor allem bei tierischen Produkten inkl. Fische (–1 568 Mio. Fr.) und Früchten (–1 009 Mio. Fr.) Importüberschüsse aus. Wesentlich tiefer lag der Importüberschuss bei den Getränken (–128 Mio. Fr.). Exportüberschüsse wurden 2010 bei Genussmitteln, Tabak und Diverses sowie Milchprodukten erzielt.
n Selbstversorgungsgrad
Der Selbstversorgungsgrad wird definiert als Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch. Es wird unterschieden zwischen einem Selbstversorgungsgrad brutto und einem Selbstversorgungsgrad netto, wobei beim Selbstversorgungsgrad netto berücksichtigt wird, dass ein Teil der Inlandproduktion auf importierten Futtermitteln beruht.
Nahrungsmittel Total netto Pflanzliche Nahrungsmittel
Das Schwergewicht der Schweizer Landwirtschaft liegt auf der tierischen Produktion, was auch den verhältnismässig hohen Selbstversorgungsgrad in diesem Bereich erklärt. 2009 lag der Inlandanteil bei tierischen Produkten mit 95,2 % über zwei Prozentpunkte höher als 2008 (92,9 %) und sogar gut 4 Prozentpunkte höher als 2007 (91,0 %). Der Anteil bei pflanzlichen Produkten stieg 2009 ebenfalls um 2 Prozentpunkte gegenüber 2008 auf 47,9 %. Insgesamt lag 2009 der Selbstversorgungsgrad brutto mit 63,3 % fast zwei Prozentpunkte höher als 2008 (61,4 %). Der Selbstversorgungsgrad netto lag 2009 bei 56,0 %, also 1,2 Prozentpunkte höher als 2008.
14 1.1 Ökonomie
2000 Entwicklung des Selbstversorgungsgrades kalorienmässiger Anteil in % Quelle: SBV 0 20 40 60 80 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tierische Nahrungsmittel Nahrungsmittel Total brutto
14
A13
Tabelle
Seite
n Entwicklung von Preisindices
Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Basis 2000/02 = 100) ist nach dem Anstieg auf 105,3 % 2008 in den darauf folgenden zwei Jahren deutlich gesunken. Im Berichtsjahr lag der Index bei 92,8 %.
Im Gegensatz zum Produzentenpreisindex haben die anderen Indices seit Beginn des Jahrtausends zugenommen. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke legte in den Jahren 2000/02 bis 2008 um 7,0 Prozentpunkte zu. Seither ist die Tendenz wieder leicht sinkend (2010: 105,6 %).
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel
Importpreisindex für Nahrungsmittel Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke Produzentenpreisindex Landwirtschaft
Quellen: BFS, SBV
Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel stieg bis 2008 auf 110,6 % an. In den letzten beiden Jahren ging er leicht auf 108,0 % zurück. Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut, Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden. Beide waren 2010 rückläufig. Ersterer etwas mehr, da vor allem die Futtermittelpreise sanken.
Der Importpreisindex für Nahrungsmittel entwickelte sich ziemlich parallel zum Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel. Der Anstieg war aber im Vergleich dazu etwas steiler und erreichte 114,5 % 2008. Seither ist der Index wieder auf 108,9 % gesunken.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Preishausse 2007/08 am Weltmarkt auch in den Schweizer Produzenten- und Konsumentenpreisen niedergeschlagen hat.
15 1.1 Ökonomie
2000 – 02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Index (200 0 / 0 2 =100)
70 85 80 75 95 90 105 100 110 115 120
1.1.1.3 Bundesausgaben
n Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung
2007 wurde beim Bund das Neue Rechnungsmodell (NRM) eingeführt. Der Systemwechsel in der Rechnungslegung führte u.a. zu Veränderungen bei den Ausgaben nach Aufgabengebieten. Diese sind deshalb nicht mehr mit denjenigen früherer Jahre vergleichbar. Die Reihe wurde aber bis 2004 zurück gerechnet (vgl. Graphik).
Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 59 266 Mio. Fr., was einer Zunahme von rund 1 Mrd. Fr. gegenüber 2009 entspricht. Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3 666 Mio. Fr. aufgewendet, 26 Mio. Fr. oder rund 1 % weniger als 2009. Nach sozialer Wohlfahrt (18 454 Mio. Fr.), Finanzen und Steuern (10 102 Mio. Fr.), Verkehr (8 225 Mio. Fr.), Bildung und Forschung (6 067 Mio. Fr.) und Landesverteidigung (4 395 Mio. Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung an sechster Stelle.
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag 2010 bei 6,2 %.

16 1.1 Ökonomie
2004 in Mio. Fr. in % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 2005 2006 2007 2008 2010 2009 3 750 3 608 3 645 3 601 3 551 3 666 3 692
Tabelle 52
Seite A58
Im Berichtsjahr wurden die letzten Änderungen im Rahmen der Agrarpolitik 2011 umgesetzt. Die Exportsubventionen liefen 2010 aus und die Beiträge an die Obstverwertung wurden wesentlich reduziert. Zudem war der Bedarf für Marktentlastungsmassnahmen bei den Beihilfen für Schlachtvieh und Fleisch geringer als im Vorjahr. Die Ausgaben zugunsten der Milchwirtschaft sind aufgrund eines Nachtragskredites zur Stabilisierung des Milchmarktes in der Höhe von 10,5 Mio. Fr. nur geringfügig tiefer ausgefallen (–6 Mio. Fr.).
Gesamthaft nahmen die Ausgaben im Bereich Produktion und Absatz gegenüber 2009 um 43 Mio. Fr. ab.
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Anmerkung: Mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM) im Jahr 2007 erfolgte ein Systemwechsel in der Rechnungslegung des Bundes. Aufgrund dieses Strukturbruchs sind Vorjahresvergleiche nicht mehr möglich.
Quellen: Staatsrechnung, BLW
Für Direktzahlungen hat der Bund im Berichtsjahr 27 Mio. Fr. mehr ausgegeben als 2009. Den stärksten Zuwachs verzeichneten bei den allgemeinen Direktzahlungen die Hangbeiträge wegen den höheren Ansätzen und bei den ökologischen Direktzahlungen die regionalen Programme und Massnahmen auf Grund der Mehrbeteiligung.
Die Ausgaben im Bereich Grundlagenverbesserung haben gegenüber dem Vorjahr um gut 2 Mio. Fr. zugenommen. Diese geringfügige Zunahme resultiert aus Mehraufwendungen bei den landwirtschaftlichen Strukturverbesserungsmassnahmen im Zusammenhang mit Projekten, die mit den Stabilisierungsmassnahmen (Stufe 2) initiiert worden waren.
Bei den weiteren Ausgaben ist die Senkung um knapp 12 Mio. Fr. im Wesentlichen auf zwei Effekte zurückzuführen. Zum einen sanken die Ausgaben für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte (Schoggigesetz) um 16 Mio. Fr. Andererseits mussten im Bereich der Verwaltung rund 4 Mio. Fr. mehr eingesetzt werden. Diese Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf einen Nachtragskredit zugunsten des Projektes ASA 2011 (Agrar-Sektor-Administration) in der Höhe von 1,9 Mio. Fr. sowie eine Mittelabtretung aus dem IKT-Wachstumskredit des Bundes in der Grössenordnung von 3,4 Mio. Fr. zurückzuführen.
17 1.1 Ökonomie
Ausgabenbereich 2005 2006 2007 2008 2009 2010 in Mio. Fr. Produktion und Absatz 677 606 548 536 471 428 Direktzahlungen 2 464 2 553 2 596 2 546 2 742 2 769 Grundlagenverbesserung 178 201 175 184 170 172 Weitere Ausgaben 289 285 282 285 308 297 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 608 3 645 3 601 3 551 3 692 3 666
1.1.2 Märkte
Ein später Saisonstart und ein feuchter, wechselhafter Frühling und Frühsommer liessen das Jahr 2010 wenig vielversprechend beginnen. Entsprechend war die Futterproduktion erschwert und Menge und Qualität der Weizenernte geringer. Bei den Zuckerrüben und Kartoffeln waren die Erträge geringer als im Vorjahr, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Die Obst- und Rebkulturen profitierten vom sonnigen Herbst mit kühlen Nächten. Die Traubenernte war denn auch qualitativ hochwertig. Insgesamt machten die Erlöse des Pflanzenbaus 44 % des Gesamtproduktionswerts des landwirtschaftlichen Sektors 2010 aus. Für die Viehwirtschaft (46 % des Gesamtproduktionswerts) erwies sich das Jahr 2010 wie bereits das Vorjahr als schwierig. Nach einer leichten Erholung der Wirtschaft Anfang Jahr erschwerte der im Lauf des Jahres sinkende Eurokurs die Exporte von Schweizer Produkten stark. So sank der Milchpreis im Berichtsjahr weiter. Der Schweinemarkt schliesslich war geprägt durch eine anhaltende Überproduktion und schlechte Preise. Der restliche Anteil der Produktion, der sich aus landwirtschaftlichen Dienstleistungen (spezialisierte Arbeiten im Ackerbau und Tierhaltung) und nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten zusammensetzt, blieb im Vorjahresvergleich praktisch unverändert (10 % des Gesamtproduktionswerts). Der Produktionswert des gesamten Sektors betrug im Berichtsjahr 10,3 Mrd. Fr. Im Jahr 2009 belief sich dieser Wert auf 10,7 Mrd. Fr.
Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2010
Total 10,3 Mrd. Fr.
Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3 %
Landw. Dienstleistungen 6 %
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2 %
Wein 4 %
Obst 5 %
Gemüse- und Gartenbau 14 %
Futterpflanzen 12 %
Kartoffeln, Zuckerrüben 3 %
Getreide 4 %
Milch 21 %
Rindvieh 12 %
Schweine 9 %
Geflügel, Eier 4 %
Sonstige tierische Erzeugnisse 1 %
Quelle: BFS
Der Wert der Erzeugung von tierischen und pflanzlichen Produkten sank insgesamt um 4 % im Vergleich zu 2009. Der Pflanzenbau ging dabei mit fast 5 % etwas stärker zurück, vor allem aufgrund der geringeren Erzeugung in den Bereichen Gartenbau, Obst, Wein und Zuckerrüben. Bei der Viehwirtschaft ist die Entwicklung wie im Vorjahr in erster Linie auf die Lage auf dem Milchmarkt und auf dem Schweinemarkt zurückzuführen.
18 1.1 Ökonomie
Tabelle 15
Seite A14
1.1.2.1 Milch und Milchprodukte
Der Wirtschaftsstandort Schweiz konnte sich überraschend schnell Ende 2009 und im Frühjahr 2010 von der weltweiten Wirtschaftskrise erholen. Die Nachfrage nach Agrarprodukten stieg wieder an und der ProKopf-Konsum von Milchprodukten nahm im Berichtsjahr um rund 0,5 % zu. Diese Entwicklung liess jedoch den Produzentenpreis für Milch nicht ansteigen, weil auch die Produktion von Verkehrsmilch leicht höher war. Der Absatz von Milchprodukten, insbesondere im Ausland, wurde im Verlauf des Berichtsjahres wegen des starken Frankens zunehmend schwieriger.
n Produktion: Rekordhohe Milcheinlieferungen
Die Gesamtmilchproduktion im Jahr 2010 betrug 4,11 Mio. t, wovon rund 668 000 t für die Selbstversorgung verwendet oder auf dem eigenen Betrieb verfüttert wurden. Die Milcheinlieferungen inkl. diejenigen der Freizone rund um Genf (Zonenmilch) und der Milch aus dem Fürstentum Liechtenstein (FL) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % auf 3,438 Mio. t. Die Produktion von Käse und Butter nahm in der gleichen Zeitspanne ebenfalls zu, während die Produktionsmenge von Konsummilch, Rahm und von Milchpulver rückläufig war.
Entwicklung der Milcheinlieferungen (inkl. Zonenmilch und Milch aus FL)
n Verwertung: Käse und Butterproduktion steigen
Bei der Herstellung der verschiedenen Milchprodukte werden unterschiedliche Anteile von Inhaltsstoffen der Milch benötigt. So wird z.B. bei der Käseproduktion je nach Fettstufe der Käse Milchfett abgeschöpft oder zugefügt. Deshalb wird die Verwertung der vermarkteten Milch nach den Inhaltsstoffen der Milch in Milchäquivalenten (MAQ) angegeben. Ein MAQ entspricht 73 g Eiweiss oder Fett, das heisst einem Kilogramm durchschnittlicher Milch mit einem Gehalt von 33 g Eiweiss und 40 g Fett. Das MAQ dient somit als Massstab zur Berechnung der in einem Milchprodukt verarbeiteten Milchmenge. Nach wie vor fliessen 43 % der MAQ in die Käse- und Quarkherstellung, welche damit die wichtigsten Verwertungsarten sind.

19 1.1 Ökonomie
2000 /02 2005 2006 2007 2008 2010 2009
in t Quelle:
3 000 000 3 100 000 3 200 000 3 300 000 3 400 000 3 500 000
TSM
Milchverwertung nach Milchäquivalent 2010
Butter 16,9 %
Dauermilchwaren (Kondensmilch, Milchpulver, Rahmpulver etc.) 10,7 %
übrige Frischmilchprodukte (Speiseeis, Milchgetränke, Dessertprodukte etc.) 2,9 %
Jogurt 3,3 %
Konsumrahm 7,8 %
andere Verwertung (z.B. hochprozentige Eiweisspulver)
3,4 %
Käse 42,3 %
Quark 0,5 %
Konsummilch 12,3 %
Quelle: TSM
Die Käseproduktion verzeichnete 2010 eine Zunahme um 3 000 t oder 1,7 % gegenüber 2009 und erreichte 181 328 t. Hartkäse weist mit insgesamt 69 765 t (+193 t) bzw. 38,5 % immer noch den grössten Anteil auf. Grössere Mengenzunahmen sind bei Weichkäse mit 6,7 % (+500 t), sowie Halbhartkäse mit 2,0 % (+1 103 t) und Frischkäse mit 2,9 % (+1 276 t) zu verzeichnen. An der Spitze der meistproduzierten Käsesorten stehen Le Gruyère AOC und Emmentaler, von denen rund 28 200 t bzw. 27 100 t hergestellt werden. An dritter Stelle folgt Mozzarella mit einer Jahresproduktion von 18 800 t. Mozzarella weist ausserdem das stärkste Wachstum mit beinahe 10 % auf. Die Produktion von Milchpulver und Milchpulverkondensat verminderte sich trotz der hohen Milcheinlieferungen um 3 300 t oder 5,4 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Rückgang ausschliesslich auf die Minderproduktion von Magermilchpulver zurückzuführen ist. Die Butterproduktion nahm als Folge der hohen Milcheinlieferungen wiederum zu. Sie betrug 48 511 t (+616 t) oder 20 % mehr als im Durchschnitt der Jahre 2000/02. Stabil geblieben ist die Herstellung von Jogurt mit rund 141 000 t. Wie im Vorjahr hat die Herstellung von Milchgetränken mit 65 712 t (–8,8 %) weiter abgenommen.
n Aussenhandel: Handelsbilanz bleibt positiv
Die Handelsbilanz der Schweiz mit Milch und Milchprodukten schloss auch im Berichtsjahr positiv ab. Beim Joghurt konnten insgesamt 6 905 t exportiert werden, rund 1 400 t mehr als im Vorjahr, während sich die Importe um 900 t auf rund 10 600 t ausdehnten. Bei Käse, Milchpulver, Butter und Rahm überstiegen hingegen die exportierten Mengen deren Importe.
Der Käseexport stieg im Berichtsjahr um 2,3 % auf 58 379 t. Der Käseimport betrug 46 892 t und wies eine Zunahme von 6,0 % auf. Wertmässig wurden 2010 Käse für 559 Mio. Fr. exportiert und Käse im Wert von rund 372 Mio. Fr. importiert. Die Schweiz führte rund 82 % bzw. 47 700 t Käse in EU-Länder aus, wobei Deutschland mit 20 742 t und Italien mit 14 380 t die Hauptabnehmer waren. Der Rückgang bei der Exportmenge in die EU betrug 688 t. Wie in den Vorjahren weist der Hartkäse mit 35 662 t den höchsten Exportanteil auf. Beim ausländischen Konsumenten am beliebtesten war Emmentaler, wovon insgesamt 19 339 t exportiert wurden. Der grösste Teil des Emmentalers (54 %) konnte nach Italien abgesetzt werden. In Übersee am gefragtesten war Le Gruyère AOC. Davon konnten 3 040 t in die USA verkauft werden.
Die Importe aus der EU lagen bei 46 834 t und wuchsen gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2000/02 um 15 725 t. Praktisch die gesamte Menge der 2010 von der Schweiz importierten Käse stammte aus der EU. Wiederum wurde der grösste Teil aus Italien (17 512 t), Frankreich (13 123 t) und Deutschland (10 365 t) eingeführt. Die bedeutendsten Importanteile wiesen mit einer Menge von 17 416 t die Frischkäse sowie mit 8 191 t die Weichkäse auf. Während die Importe von Weichkäse um 117 t oder 1,4 % leicht gesunken sind, verzeichneten Hart- und Halbhartkäsesorten gesamthaft eine Zunahme um 326 t oder 2,3 %. Die Importe von Frischkäse erhöhten sich wie schon im Vorjahr deutlich um 2 134 t (+14 %). Bei den Frischkäsen war Italien mit 7 142 t Hauptlieferant, während 5 200 t oder knapp zwei Drittel der eingeführten Weichkäse aus Frankreich stammen. Gestiegen sind mit 12,2 % auch die Importe von Schmelzkäse (Conveniencekäse als Vorfabrikat für die verarbeitende Lebensmittelindustrie) auf total 3 260 t.
20 1.1 Ökonomie
Total 3 437 622 t Milch
Käsehandel Schweiz – EU
Der Verbrauch von Butter konnte 2010 durch die inländische Butterproduktion mehr als gedeckt werden. Vorwiegend wegen der hohen Milcheinlieferungen und den Absatzproblemen bei einzelnen Käsesorten hat sich die Butterproduktion stark ausgedehnt und lag bei 48 511 t. Aus diesem Grund und wegen des kleinen Teilzollkontingents für Butter beschränkten sich die Importe 2010 auf 220 t.
Trotz der ungünstigen Wechselkurse konnten 4 200 t Butter exportiert werden, was etwa der Vorjahresmenge entspricht. Nachdem 2009 noch 5 354 t Rahm vorab aufgrund ausserordentlicher Entlastungsmassnahmen ausgeführt wurden, fiel die Exportmenge im Berichtsjahr auf 2 745 t.
n Verbrauch: Stabiler Konsum
Der Pro-Kopf Konsum von Milch und Milchprodukten schwankt seit mehreren Jahren nur noch in geringem Mass. Erhöht hat sich der Verbrauch von Käse und von Rahm. Mit einem Konsum von 21,5 kg pro Kopf wurde gegenüber dem Vorjahr 0,5 % mehr Käse verzehrt. Der Rahmkonsum stieg um 0,1 kg auf 8,3 kg pro Kopf. Der Pro-Kopf-Konsum von Jogurt hingegen nahm um 0,5 kg auf 18,2 kg (–1,6 %) ab. Butter, Milchgetränke und Konsummilch wiesen ebenfalls etwas tiefere Verbrauchszahlen auf.
n Produzentenpreise: weiter unter Druck
Der durchschnittliche Produzentenpreis für Milch ist im Berichtsjahr weiter gesunken, wenn auch weniger markant als im Vorjahr. Der mittlere Produzentenpreis belief sich auf 61,79 Rp./kg, was gegenüber 2009 einen Rückgang um rund 3 Rp. bedeutet.
Die Schweizer Milchwirtschaft ist abhängig von den ausländischen Märkten, weshalb der durchschnittliche Milchpreis von den internationalen Preisentwicklungen und speziell von der Absatzsituation in der EU beeinflusst wird. Im Zuge der Erholung der Märkte hätte sich die Absatzsituation für Milch und Milchprodukte sowohl im In- als auch im Ausland eigentlich verbessern sollen. Zusätzlicher Antrieb für den Export wurde von dem geringeren Abstand zu den ausländischen Milchpreisen erwartet, insbesondere zum durchschnittlichen Milchpreis in der EU. Die Milchpreisdifferenz zur EU betrug 2010 im Schnitt 20 Rp./kg, rund 5 Rp./ kg weniger als 2009. Der starke Schweizer Franken hatte jedoch zur Folge, dass die günstige Ausgangslage keine positive Wirkung auf die Produzentenpreise ausüben konnte.
21 1.1 Ökonomie
in t CH-Importe aus
CH-Exporte in die EU Quelle: OZD 0 50 000 45 000 40 000 35 000 25 000 30 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2009
der EU
Milchpreisvergleich Schweiz / International 2008 bis Frühjahr 2011
Durchschn. Milchpreis CH (4,0 % Fett, 3,3 % Protein, inkl. MwSt)
Durchschn. Milchpreis EU (4,2 % Fett, 3,4 % Protein, ohne MwSt)
USA
Neuseeland
n Konsumentenpreise: rückläufige Tendenz
Quellen: BLW, www.milkprices.nl
Die durchschnittlichen Konsumentenpreise der meisten Milch und Milchprodukte gingen im 2010 zurück. Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr waren vereinzelt bei Frischmilchprodukten und Hartkäse zu verzeichnen. 1 kg Gruyère mild kostete 17.87 Fr. (+0.05 Fr./kg) und für Sbrinz mussten 23.98 Fr./kg (+0.23 Fr./ kg) bezahlt werden. Die Mehrzahl der Käsesorten kostete die Konsumentinnen und Konsumenten 2010 indes weniger. So bezahlten sie beispielsweise für Emmentaler surchoix einen durchschnittlichen Preis von 20.28 Fr./kg (–0.60 Fr./kg), für Appenzeller surchoix 19.50 Fr./kg (–0.58 Fr./kg) und für Tilsiter mild 15.13 Fr./kg (–0.38 Fr./kg).
Die hohe Butterproduktion führte dazu, dass die Konsumentenpreise im Berichtsjahr rückläufig waren. Der durchschnittliche Preis für Vorzugsbutter lag bei 2.96 Fr. pro 200 g (–3 Rp.). Die mittleren Preise für Jogurt sanken um rund 3 Rp. pro Becher zu 180 g auf 0.64 Fr. Beim Konsumrahm waren Preissenkungen zwischen 14 und 24 Rp. pro Liter zu
22 1.1 Ökonomie
Rp. / kg
10 20 30 40 50 60 70 80 90 März 08 Mai 08 Jul 08 Sept 08 Nov 08 Jan 09 März 09 Mai 09 Jul 09 Sept 09 Nov 09 Jan 10 Mai 10 Jul 10 Sept 10 Nov 10 Jan 11 März 11 März 10
beobachten. Konsumentenpreisindizes für Milch und Milchprodukte Index (Dez. 201 0 =100) Quelle: BFS 85 115 110 105 100 95 90 2000 / 02 2006 2008 2010 Rahm Milch Käse andere Milchprodukte Butter
1.1.2.2 Tiere und tierische Erzeugnisse

Für die Viehhalter und Viehhalterinnen war das Berichtsjahr wirtschaftlich zum zweiten Mal in Folge ein schwieriges Jahr. Die durchschnittlichen Produzentenpreise für Schweine sanken um 12 %, für Lämmer um 6 % und für Kühe um 4 % gegenüber 2009. Augenfällig ist das Wachstum von 10 % des Konsums von Rindfleisch im Vergleich zu 2000/02 und dasjenige von Geflügelfleisch um 19 %. Seit Jahren wächst der Geflügelfleischmarkt, wovon sowohl die inländische Landwirtschaft als auch die Verarbeitungsindustrie profitieren. Die Geflügelfleischproduktion erhöhte sich gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2000/02 um die Hälfte und erreichte rund 44 000 t. Diese positiven Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum, mit der in den letzten Jahren steigenden Präferenz einer breiten Schicht der Bevölkerung für Schweizer Produkte und mit dem seit langem zunehmenden Geflügelfleischkonsum. Über alle Fleischarten betrachtet stammen 80 % des konsumierten Fleisches aus der einheimischen Produktion.
n Produktion: Schweine-, Geflügel- und Ziegenbestände steigen
Die Bauern und Bäuerinnen hielten im Berichtsjahr unverändert rund 1,6 Mio. Stück Rindvieh. Allerdings sank der Bestand an Milch- und Mutterkühen infolge des Preisdrucks auf dem Milchmarkt um 8 000 auf 700 000 Stück. Der Schweinebestand stieg wie schon in den Vorjahren und lag bei 1,588 Mio. Stück (+2,0 %). Da in den letzten zehn Jahren 5 800 Schweinehalter die Haltung von Schweinen aufgab, gibt es in der Schweiz noch rund 8 800 Halter. Weiterhin beliebt sind die Ziegen, deren Bestand im Berichtsjahr auf 87 000 Tiere (+2,2 %) stieg. Der Schafbestand stieg um 2 000 auf 434 000 Stück (+0,5 %). Dank der guten Lage auf dem Geflügelfleisch- und Eiermarkt wuchs der gesamte Geflügelbestand auf 8,9 Mio. Stück oder um 2,3 %.
23 1.1 Ökonomie
Als Folge der Entwicklung der Viehbestände stieg wie schon im Vorjahr die Produktion aller Fleischarten zusammen um 3,6 %. Die Schweinefleischproduktion nahm um fast 5 % auf knapp 250 000 t SG zu und die Rindfleischproduktion erhöhte sich um beinahe 2 % und belief sich auf über 111 000 t SG. Das inländische Schweinefleisch deckte 95 % (+1 %) und das Rindfleisch 84 % (–1 %) des Konsums in Privathaushalten und in der Gastronomie. Die anhaltend gute Nachfrage nach Geflügelfleisch führte zu einer Ausdehnung der inländischen Produktion um über 6 % auf gut 44 000 t Verkaufsgewicht. Erstmals wurde mehr als 50 % des konsumierten Geflügelfleisches in der Schweiz produziert. Demgegenüber sank die Produktion von Pferdefleisch um 7 % auf 748 t oder um mehr als einen Drittel gegenüber der Menge im Durchschnitt der Jahre 2000/02 (1 164 t). Die Schaffleischproduktion wuchs entgegen dem Trend der Vorjahre um 2 % auf 5 477 t. Die Eierproduktion kletterte 2010 um knapp 5 % auf 752 Mio. Stück. Obschon die zusätzlich produzierten Eier gut verkauft werden konnten, waren die Produzentenpreise rückläufig. Diese sanken für Freilandeier auf 23 Rp./Ei und für Bodenhaltungseier auf rund 22 Rp./Ei. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die ausländischen Konsumschaleneier günstiger eingekauft werden konnten. Weil die Importmenge gleichzeitig einen leichten Rückgang um 2,5 Mio. Stück verzeichnete, wuchs der Anteil Schweizer Eier an den verkauften Konsumeiern auf 75 %. Berücksichtigt man die Eiprodukte in der Verbrauchsstatistik, so produzierten die inländischen Legehennenhalterinnen und -halter die Hälfte der konsumierten Eier und Eiprodukte.
n Aussenhandel: Rindstrockenfleisch ist das wichtigste Exportprodukt
Die Ausfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen betrug im Berichtsjahr 2 745 t und lag damit rund 430 t oder knapp ein Fünftel höher als 2009. Mehr als 95 % wurden in die EU-Länder verkauft. Nach wie vor das wichtigste Exportprodukt ist Rindstrockenfleisch mit über 1 800 t, das fast ausnahmslos nach Frankreich (1 350 t) und Deutschland (477 t) ausgeführt wird. Die Wurstwarenexporte stiegen erneut um 34 t auf 236 t (+17 %), hingegen fielen die Exporte von Fleischkonserven und Zubereitungen um 35 % auf 213 t. Diese Produkte wurden grossmehrheitlich nach Deutschland (164 t) und in geringerem Umfang nach Italien und der Tschechischen Republik ausgeführt. Zusätzlich führte die Schweiz mehr als 21 000 t Schlachtnebenprodukte aus, die vorab in der Tiernahrungskonservenindustrie verwendet werden. Der Handelswert der schweizerischen Fleisch- und Schlachtnebenproduktexporte betrug im Berichtsjahr insgesamt knapp 68 Mio. Fr. und lag 8 Mio. Fr. höher als im Vorjahr.
24 1.1 Ökonomie
Entwicklung der Fleisch- und Eierproduktion Index (200 0 / 0 2 = 100) Quellen: Proviande / Aviforum 60 150 140 130 120 100 110 80 70 90 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Geflügelfleisch Rindfleisch Schaleneier Schweinefleisch Schaffleisch Pferdefleisch
Herkunft der Fleischimporte 2010
Schweizer Firmen importierten 2010 insgesamt 119 069 t Fleisch, Fleischerzeugnisse und Schlachtnebenprodukte. Der Handelswert belief sich auf 841 Mio. Fr. (unverzollt, an der Grenze). Gegenüber dem Vorjahr sank die Menge um 2 %, während der Handelswert um rund 3 % zunahm. Die wichtigsten Lieferländer waren Deutschland mit 38 092 t (32 %), Brasilien mit 19 897 t (17,2 %) und Italien mit 9 079 t (7,6 %). Insgesamt stammten 81 976 t (68,8 %) der Importe aus EU-Ländern. Geflügel- und Rindfleisch mit Einfuhren von 53 933 t bzw. 19 542 t waren die dominierenden Fleischsorten. Ausserdem wurden 69 023 t Fische und Krustentiere mit einem Handelswert von 670 Mio. Fr. importiert.
Deutschland bleibt sowohl für Rind- als auch für Schweinefleisch der wichtigste Lieferant der Schweiz. Mehr als ein Drittel des eingeführten Geflügelfleisches kommt aus Brasilien, hauptsächlich als gefrorene Ware. Die weltweit grössten Exportländer Australien und Neuseeland liefern rund 80 % des importierten Schaffleisches. Praktisch sämtliches importiertes Ziegenfleisch stammt aus Frankreich. Die Wurstwaren aus Italien bleiben im Inland sehr begehrt: Rund 3 000 t wurden 2010 in die Schweiz verkauft. Ausserdem wurden etwa 1 700 t deutsche und 1 300 t französische Fleischkonserven und Zubereitungen in Schweizer Haushalten und in der Gastronomie abgesetzt.
Auf den 1. Januar 2010 wurden die Beihilfen für den Viehexport abgeschafft. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 555 Rinder und Kühe exportiert, gegenüber 5 531 Stück im Vorjahr. 317 Tiere, also mehr als die Hälfte, konnten nach Italien verkauft werden. Aus dem Ausland stammen 4 294 Tiere der Rindergattung, wovon 3 313 Stück oder 77 % aus Frankreich importiert wurden. Käufer in der Schweiz bezogen 3 939 Esel und Pferde aus dem Ausland, 578 Tiere oder 17 % mehr als im Vorjahr. Die Zunahme ist auf die Erhöhung des Zollkontingents um 500 Einheiten auf 3 822 Tiere im 2010 zurück zu führen. Davon stammten 41 % aus Deutschland und knapp 40 % aus Frankreich. Die Anzahl ausgeführter Pferde und Esel sank um 6 % auf 1 559 Stück. Bei Schafen und Ziegen erhöhten sich die Importe um 55 % auf 580 Stück, während die Exporte um 75 % auf 213 Stück zurückgingen. Zu diesen Entwicklungen dürfte die Schwäche des Euros beigetragen haben.
Die Einfuhren von Schaleneiern (inkl. Bruteier und im Veredelungsverkehr eingeführte Schaleneier) erhöhten sich um 2,3 % auf 34 336 t. Nahezu jedes dritte importierte Ei wurde in den Niederlanden gelegt. Die Eiprodukteherstellungsbetriebe schlugen gut die Hälfte der eingeführten Eier maschinell auf und die daraus hergestellten Eiprodukte fanden Absatz in der Lebensmittelindustrie und in der Gastronomie. Zudem wurden 7 831 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine in die Schweiz eingeführt.
25 1.1 Ökonomie
in % andere Länder Australien Neuseeland Frankreich Deutschland Brasilien Quelle: OZD 0 100 90 70 80 60 50 30 40 20 10 Rindfleisch Schweinefleisch Geflügelfleisch Schaffleisch Ziegenfleisch
n Verbrauch: Steigender Fleischkonsum
Nachdem der Fleischkonsum im 2009 rückläufig war, lag er im Berichtsjahr gut 3 % (427 138 t) über dem Vorjahreswert. An der Spitze stand Schweinefleisch (201 919 t), gefolgt von Rindfleisch (89 254 t) und Geflügelfleisch (87 665 t). Ausserdem wies der Konsum von Fischen und Krustentieren wie im 2009 eine Wachstumsrate von 3 % auf. Die insgesamt verzehrte Menge lag bei 70 292 t. Einzig beim Kalbfleisch ging der Konsum um 380 t auf rund 25 100 t zurück.
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern
Die gute Konsumentenstimmung als Folge der günstigen Wirtschaftslage und sinkender Ladenpreise hat sich positiv auf den Verbrauch niedergeschlagen. Der Pro-Kopf-Konsum von verkaufsfertigem Fleisch nahm im Berichtsjahr um 2,3 % auf 53,59 kg zu. Schweinefleisch bleibt nach wie vor mit 25,33 kg pro Kopf sehr beliebt. In der Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten stehen auch Rindfleisch (11,20 kg) und Geflügelfleisch (11 kg). Der Verbrauch von Kalbfleisch verminderte sich auf 3,15 kg pro Kopf (–2,3 %). Während Geflügelfleisch eine Zunahme des Pro-Kopf-Konsums von annähernd einem Fünftel gegenüber dem Mittelwert der Jahre 2000/02 verzeichnete, sanken der Verbrauch von Kalb- und Schaffleisch im gleichen Zeitraum um einen Fünftel. Der Eierkonsum blieb mit 189 Stück pro Kopf gegenüber dem letzten Jahr praktisch unverändert.
n Produzentenpreise: Anhaltend rückläufiger Trend
Als Folge der Mehrproduktion bei fast allen Tierkategorien blieben die Produzentenpreise für Schlachtvieh und Schweine fast ausnahmslos unter dem Vorjahresniveau. Weil die Preise schon im Vorjahr beträchtlich gesunken waren, erlitten die Viehhalterinnen und Viehhalter zum Teil erhebliche Einbussen. Mit einem Durchschnitt von Fr. 3.80 je kg SG lagen die Preise für Schlachtschweine 12 % tiefer als im vorhergehenden Jahr. Gegenüber 2008 sanken die durchschnittlichen Schweinepreise um rund Fr. 1.20/kg SG, die Bankviehpreise um 80 Rp./kg SG, die Kuhpreise um 70 Rp./kg SG, die Lammpreise um Fr.1.60/kg SG und die Kälberpreise um Fr. 1.10/kg SG.
26 1.1 Ökonomie
Index (200 0 / 200 2 = 100)
80 120 115 110 100 105 90 85 95 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2010 2009 Geflügelfleisch Rindfleisch Pferdefleisch
Quellen: Proviande / Aviforum
Schaleneier Schweinefleisch Kalbfleisch Schaffleisch
Entwicklung der Produzentenpreise Schlachtvieh und Schweine
Kälber Handelsklasse T3, QM Lämmer Handelsklasse T3 Muni Handelsklasse T3, QM
n Bruttomargen Fleisch
Kühe Handelsklasse T3, QM Fleischschweine, QM ab Hof
Proviande
Gegenüber dem Vorjahr nahm der Jahresdurchschnitt der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung aller Fleischkategorien ab. Am stärksten vom Rückgang betroffen waren Schweinefleisch (–9,4 %), gefolgt von Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren (–6,1 %) sowie Rind- und Lammfleisch mit Einbussen von je rund 5,7 %.
27 1.1 Ökonomie
Fr / kg SG Quelle:
2.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 4.00 6.00 2000 / 02 12.53 12.31 7.64 5.18 4.57 2005 13.20 10.30 7.97 6.16 4.02 2006 14.43 10.34 8.44 6.35 3.85 2007 14.47 10.45 8.73 6.77 4.04 2008 14.57 11.31 8.93 7.08 4.96 2010 2009 13.31 13.48 10.30 9.71 8.09 8.16 6.62 6.36 4.29 3.80
Verteilung von Fleisch Index (Februa r –April 199 9 = 100) Quelle: BLW 90 170 160 150 140 120 130 100 110 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2010 2009 Lammfleisch Kalbfleisch Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren Rindfleisch Schweinefleisch
Entwicklung der Bruttomargen Verarbeitung und
1.1.2.3 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte
n Ackerkulturen
Offenes Ackerland nimmt ab
Das offene Ackerland und das gesamte Ackerland (offenes Ackerland zuzüglich Kunstwiesen, überdecktes Gemüse, Saatgut [ohne Getreide und Kartoffeln]) sind wie die landwirtschaftliche Nutzfläche rückläufig. Der Vergleich der Mittelwerte der Jahre 2000 bis 2002 mit jenen der Jahre 2008 bis 2010 zeigt, dass das offene Ackerland um 5,3 %, das gesamte Ackerland um 1,1 % und die landwirtschaftliche Nutzfläche um 1,5 % abgenommen haben. Der überproportionale Rückgang des offenen Ackerlandes erklärt sich mit dem Anstieg der Kunstwiesenfläche, die in der Betrachtungsperiode um rund 10 % auf rund 130 000 ha zugenommen hat. Mit einem Zuwachs von rund 13 % auf 46 000 ha hat innerhalb der offenen Ackerfläche der Silo- und Grünmais markant zugelegt. Ausgehend von einer geringeren Anbaufläche verzeichnen auch die Ölsaaten (30 %) und die Zuckerrüben (10 %) Flächengewinne. Der Rückgang der Brotgetreidefläche ist auf die Liberalisierung der Marktordnung – 2001 wurde die Preis- und Abnahmegarantie durch den Bund aufgehoben – und leistungsfähigere Getreidesorten zurückzuführen. Die wirtschaftliche Attraktivität von Futtergetreide hat infolge der mittels Direktzahlungen nur teilweise kompensierten Reduktion des Grenzschutzes für Futtermittel zugunsten der Tierhaltung abgenommen, was sich im Rückgang der Futtergetreidefläche manifestiert. In den letzten zehn Jahren haben Nutzungen für die Wiederkäuerfütterung zu Lasten des Getreidebaus Anteile am Ackerland gewonnen. Trotz der Ausdehnung der Kunstwiesenfläche erreichten 2010 die Heuimporte mit über 150 000 t Heu eine Rekordmarke.

28 1.1 Ökonomie
1 provisorisch
Seit 2006 entspricht die inländische Brotweizenproduktion in Abhängigkeit der Erntequalität in etwa dem Bedarf. Ergänzungsimporte sind innerhalb des Zollkontingentes Brotgetreide von 70 000 t möglich. Überschüsse an backfähigem Brotgetreide deklassiert der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) auf eigene Kosten zu Futtergetreide. 2005 lancierte der SGPV eine Kampagne zugunsten der Produktion von Futterweizen. Diese war erfolgreich und die Produktion erhöhte sich markant. Seit 2007 ist die Ernte aber wieder rückläufig. Die Körnermaisproduktion hängt von den Erntemengen im Wiesenfutterbau ab. Fallen die Wiesenfuttererträge unterdurchschnittlich aus, wird zur Körnerproduktion angebauter Mais vermehrt frisch verfüttert oder als Silage konserviert. Die Erntemenge von Triticale hat sich stabilisiert. Am unteren Ende der Skala verzeichnet Dinkel kontinuierliche Produktionszunahmen.
1 provisorisch
Entwickelten sich die Weltmarktpreise für Weizen im ersten Semester 2010 stabil, so erhielten sie zur Jahresmitte infolge der Trockenheit und der damit einhergehenden Ernteausfälle in Russland und der Ukraine Auftrieb. Die von den beiden Ländern verhängten Exportverbote festigten die höheren Preise bis zum Jahresende. Mitte Februar 2011 wurde die höchste Notierung erreicht bis die Preise aufgrund von höher geschätzten Lagerbeständen und einer tieferen Verbrauchserwartung an der Warenterminbörse in Paris innert Monatsfrist von rund 270 Euro auf nahezu 200 Euro/t zurückgingen. Das Niederschlagsdefizit in Anbaugebieten der USA, China, Russland und Europa stärkte in der Folge die Weizennotierungen wieder.
29 1.1 Ökonomie
des Ackerlandes in 1 000 ha übriges Ackerland Freilandgemüse Kartoffeln Zuckerrüben Raps Silo- und Grünmais Kunstwiesen Futtergetreide Brotgetreide Quelle: SBV 0 450 400 350 300 250 150 200 100 50 2000/02 2005 2006 2007 2008 2009 20101
Nutzung
Getreidemarkt
Entwicklung der Getreideproduktion in 1 000 t
0 600 500 400 300 100 50 200 2000 / 02 2005 2006 2007 2008 2009 20101 Brotweizen Gerste Körnermais Futterweizen Triticale Hafer Roggen Dinkel
Quelle: SBV
Entwicklung der Preise von Weichweizen an der MATIF1 Paris
Notierung Weizen in Fr./t Notierung Weizen in Euro/t Eurokurs in Fr.
1 MATIF = Marché à Terme International de France
Reuters
Die Preisentwicklung an den internationalen Märkten und der transparente Berechnungsmodus zur Bemessung des Kontingentszollansatzes anlässlich der vierteljährlichen Prüfung bewirkten, dass im vierten Quartal 2010 wegen der per 1. Januar 2011 erwarteten Zollsenkung relativ wenig Brotgetreide importiert wurde. Mit Importen von rund 64 000 t wurde das Zollkontingent im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft. Nach der Reduktion der Grenzbelastung für Brotgetreide von 23 Fr./100 kg auf 18.30 Fr./100 kg per 1. Januar 2011 sowie von 18.30 Fr./100 kg auf 14 Fr./100 kg per 1. April 2011 nahmen die Importe zu. Ende April waren die ersten beiden Zollkontingentsteilmengen von insgesamt 40 000 t ausgeschöpft. Infolge rückläufiger Rohstoffpreise und Wechselkurse wurde die Grenzbelastung per 1. Juli 2011 auf 17.80 Fr./100 kg erhöht. Im Bereich Futtergetreide konnten die Preisbewegungen der Einzelfuttermittel an den internationalen Märkten durch das Schwellenpreissystem absorbiert werden.
Viel Bewegung auf dem Zuckermarkt
Vor der von 2006 bis 2009 umgesetzten EU-Zuckermarktreform wurde der Bedarf der inländischen verarbeitenden Industrie zur Versorgung des Inland- und der Exportmärkte vorwiegend mit aus der EU importiertem Zucker ergänzt. In der EU ging die Zuckerproduktion als Folge der Reform markant zurück, ohne dass die präferenziellen Einfuhren aus den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP) wie erwartet anstiegen. Die Zollpräferenzen der EU sind für die AKP-Staaten derzeit von mässiger Attraktivität, weil seit Ende 2010 die Weltmarktpreise für Zucker über den Marktpreisen in der EU liegen.
Die geringe Versorgung des EU-Marktes mit Zucker und die über dem Niveau der EU liegenden Weltmarktpreise für Zucker wirkten sich auf den Schweizer Markt aus. Das Geschäft mit dem Export von Getränkegrundstoffen verlor infolge der Preisrelationen an Bedeutung, weshalb der Bruttoverbrauch an Zucker (Inlandbedarf für Direktkonsum und Verarbeitung) gegenüber den Vorjahren von rund 500 000 t auf 350 000 t abnahm und entsprechend auch die Einfuhrmengen zurückgingen.
30 1.1 Ökonomie
Euro bzw. Fr. pro t Fr. pro Euro Quelle:
0 400 350 200 300 250 50 100 150 0 6.0 4.5 3.0 1.5 01.01.2010 01.02.2010 01.03.2010 01.04.2010 01.05.2010 01.06.2010 01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011
In den Jahren 2005 und 2006 war Brasilien hinter Deutschland und Frankreich drittwichtigstes Herkunftsland von Zuckerimporten (mit rund 1 700 t bzw. 800 t). Aufgrund des Rückgangs der EU-Zuckerproduktion stiegen die präferenziellen Weisszuckerimporte aus Brasilien 2007 auf 85 000 t an, wodurch Brasilien zum zweitwichtigsten Herkunftsland hinter Deutschland avancierte. Da Brasilien als weltgrösster Zuckerexporteur Importe aus anderen Entwicklungsländern verdrängen kann, wurde dem Land im Bereich Zucker der Status Entwicklungsland Ende 2007 aberkannt und damit die präferenziellen Bedingungen für Exporte in die Schweiz. Von 2008 bis 2010 fielen die jährlichen Importe aus Brasilien von 27 000 t auf weniger als 1 t Weisszucker zurück.
Die sogenannte «Doppel-Null-Lösung» des Protokolls Nr. 2 zwischen der Schweiz und der EU schliesst die Ausrichtung von Exporterstattungen und die Erhebung von Zöllen für Zucker in Verarbeitungsprodukten im Deckungsbereich des Protokolls aus. Dies erfordert in etwa paritätische Zuckerpreise auf dem Schweizer und dem EU-Markt, um vergleichbare Rahmenbedingungen für die Lebensmittelindustrien beidseits der Grenze sicherzustellen. Die Schweiz stellt diese Parität mittels periodischer Prüfung und gegebenenfalls Anpassung der Grenzbelastung für Zucker her. Nachdem die Zollansätze per Januar 2010 auf null gesenkt wurden, wird seit Dezember 2010 auch kein Garantiefondsbeitrag mehr erhoben. Somit sind die Interventionsmöglichkeiten erschöpft und die Finanzierung des Pflichtlagers für Zucker mittels zweckgebundener Abschöpfung an der Grenze in Frage gestellt.
Ölsaatenmarkt
Seit Ende des Leistungsvertrags mit dem BLW im Jahr 2009 ist der «Produktionspool Ölsaaten» des SGPV für die Marktregulierung zuständig. Der Pool wird zu zwei Drittel durch die Produzenten und zu einem Drittel durch die Ölwerke finanziert.
Der Konsum von Fetten und Ölen zu Speisezwecken setzt sich in der Schweiz wie folgt zusammen:
Speiseöl: 84 000 t
Speisefett: 35 000 t
Margarinen/Minarinen: 21 000 t
Butter: 42 000 t
Quelle: SwissOlio
31 1.1 Ökonomie
in 1 000 t übrige Welt ärmste Entwicklungsländer (PMA) Entwicklungsländer ohne PMA Brasilien EU andere Deutschland Frankreich Quelle: OZD 0 350 250 300 200 100 150 50 2000/02 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Entwicklung der Einfuhren von Kristallzucker1
1 Tarif-Nr. 1701.9999
Was den Konsum von pflanzlichen Ölen betrifft, so behält das Sonnenblumenöl seinen Spitzenplatz mit einem Marktanteil von 33 %, auch wenn dieser seit mehreren Jahren rückläufig ist (2004 waren es noch 41 %). Parallel dazu wird mehr Rapsöl (23 %, Tendenz steigend) und Palmöl (19 %) konsumiert. Auch beim Olivenölkonsum ist ein Aufwärtstrend zu beobachten; der Marktanteil von Olivenöl beträgt fast 10 %.
Kartoffelmarkt
Nach der ausserordentlichen Ernte von 2009, die eine finanzielle Unterstützung des Bundes zur Überschussverwertung notwendig machte, trug das Produktionsniveau 2010 den Marktbedürfnissen besser Rechnung. Innerhalb eines Jahres ging die Gesamtproduktion um ungefähr 100 000 t zurück und lag 2010 bei 421 000 t, was einem Ertrag von 387 dt/ha entspricht. Sowohl die Anbaufläche (10 874 ha) als auch die Anzahl der Produzenten (6 100) sind weiterhin leicht rückläufig.
Die Ernte des Jahres 2010 wurde folgendermassen verwertet:
mit privater Finanzhilfe:
Quelle: Swisspatat
Die WTO-Abkommen verlangen einen Marktzugang von 5 %. Dies entspricht 22 250 t Kartoffeln. 2010 wurde das Teilkontingent für Speisekartoffeln für eine Gesamtmenge von 6 300 t temporär erhöht.
Anbaufläche bleibt stabil
Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl. Mehrfachanbau pro Jahr) betrug im Berichtsjahr 14 700 ha. Diese Fläche entsprach dem Durchschnitt der vier Vorjahre.
Die Apfel- und Birnenflächen betrugen 2010 wie schon im Vorjahr rund 4 200 ha, bzw. 830 ha. Die Apfelsorten Gala, Braeburn und Pinova legten wie gewohnt um einige Hektaren zu. Ausserdem sind beachtliche Flächen und Zuwachsraten bei den Sorten Jazz/Scifresh, DIWA/Milwa, Pink Lady und Mairac zu beobachten. Sie wurden auf einer Fläche von 248 ha angebaut; das entspricht 39 ha mehr als im Vorjahr. Steinobst war weiterhin im Trend: Dessen Fläche dehnte sich gegenüber dem Vorjahr um 42 ha auf 1 529 ha aus. Vor allem Aprikosen und Kirschen waren vom Flächenzuwachs betroffen. Die Beerenfläche betrug wie in den Vorjahren rund 700 ha.
Die Rebfläche der Schweiz betrug im Berichtsjahr 14 942 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr um 122 ha zu. Der Grund für die Zunahme ist die Berücksichtigung der Rebfläche von 135 ha aus der Grenzzone von Genf, deren Trauben zu Genfer bzw. Schweizer Weinen verarbeitet werden können. Ohne die Grenzzone hätte die Fläche also um 13 ha abgenommen. Insgesamt waren 6 326 ha (+81 ha) mit weissen und 8 616 ha (+41 ha) mit roten Trauben bestockt. Die Rebsortenverteilung blieb mit 42 % weissen und 58 % roten Sorten stabil.
Im Berichtsjahr wurden 341 000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 131 000 t Tafelobst geerntet. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich beim Gemüse um eine Ertragssteigerung von 7 % und beim Obst um eine Ertragseinbusse von 6 %.
32 1.1 Ökonomie
Speisekartoffeln: 183 000 t Kartoffelprodukte: 154 000 t Pflanzkartoffeln: 24 000 t Verfütterung
18
t Verfütterung
000
normal: 42 000 t
n
Spezialkulturen
Variable Selbstversorgungsgrade bei Gemüse
Die Marktvolumina der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen 556 000 t bzw. 179 000 t. Das Gemüsevolumen war 4 % grösser und das Obstvolumen 3 % kleiner als im Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Selbstversorgungsgrad von Schweizer Gemüse betrug 61 % und derjenige von Obst 74 %. Diese Prozentwerte entsprachen ungefähr den Werten der Vorjahre.
Während Lagergemüse in der Regel Selbstversorgungsgrade von mehr als 90 % aufweisen, sind diejenigen von Frischgemüse wesentlich tiefer. Im Zeitverlauf verhalten sich die Selbstversorgungsgrade von Frischgemüse und Lagergemüse ebenfalls unterschiedlich. Nachfolgend werden diese Unterschiede anhand von Tomaten und Karotten dargestellt.
Einfuhren, Inlandmengen und Selbstversorgungsgrade von runden Tomaten und Fleischtomaten im Jahr 2010
2010 wurden 26 000 t runde Tomaten und Fleischtomaten eingeführt und 35 300 t in der Schweiz produziert. Dies entsprach einem Selbstversorgungsgrad von 58 %. Die Selbstversorgungsgrade von Frischgemüse ändern sich in der Regel sehr stark im Verlauf des Jahres. Bei den Tomaten dominieren im Winterhalbjahr die Importe. Die wöchentlichen Selbstversorgungsgrade sind entsprechend tief. Im Frühling werden die ausländischen Tomaten allmählich von den Schweizer Tomaten abgelöst und im Sommer dominieren die einheimischen Tomaten. Während der effektiven Bewirtschaftungsperiode (Einfuhrregelung), die ungefähr der eigentlichen Schweizer Tomatensaison entspricht, betrugen die wöchentlichen Selbstversorgungsgrade im Durchschnitt 90 %. Im Herbst werden die Inlandtomaten wieder allmählich von den Importen abgelöst.
Einfuhren, Inlandmengen und Selbstversorgungsgrade von Karotten der Lagersaison 2010/11
33 1.1 Ökonomie
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 Woche: 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 in t in % Importmenge Inlandmenge Selbstversorgungsgrad Quellen: KIC (BLW) und Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau 0 2 500 2 000 1 500 500 1 000 0 100 80 60 40 20 effektive Bewirtschaftungsperiode
22 2010 24 2010 26 2010 28 2010 30 2010 32 2010 34 2010 36 2010 38 2010 40 2010 42 2010 44 2010 46 2010 48 2010 50 2010 52 2010 2 2011 4 2011 6 2011 8 2011 10 2011 12 2011 14 2011 16 2011 18 2011 20 2011 Woche: in t in % Importmenge Inlandmenge Selbstversorgungsgrad Quellen: BLW (KIC), SZG 0 2 500 2 000 1 500 500 1 000 0 100 80 60 40 20 effektive Bewirtschaftungsperiode
In der Lagersaison 2010/11 wurden 4 600 t Karotten eingeführt und 56 000 t in der Schweiz produziert. Dies entsprach einem Selbstversorgungsgrad von 92 %. Zu Beginn der Karottensaison dominierten während wenigen Tagen die Importkarotten. Sehr schnell wurden sie von den Schweizer Karotten abgelöst. Während der effektiven Bewirtschaftungsperiode, welche 49 Wochen dauert, betrug der Selbstversorgungsgrad 96 %. Erst am Saisonende gab es wieder nennenswerte Importmengen während rund 4 Wochen. In diesem Zeitraum, in dem frei eingeführt werden konnte, betrug der Selbstversorgungsgrad 56 %.
Im Berichtsjahr lag das Erntevolumen beim Wein mit 1,031 Mio. hl rund 7 % tiefer als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind die nur schwach oder bisweilen unvollständig ausgebildeten Trauben und die kleineren Beeren. Insgesamt wurden 497 146 hl Weisswein und 533 792 hl Rotwein produziert.
Vollversorgung mit Kernobstsaft-Produkten noch knapp gewährleistet
2010 verarbeiteten die gewerblichen Mostereien 65 175 t Mostäpfel und 10 547 t Mostbirnen aus dem Inland. Dies entspricht bei den Mostäpfeln 60 % und bei den Mostbirnen 45 % des Durchschnitts der vier Vorjahresernten. Im Rahmen des WTO-Zollkontingentes für Kernobstsaftprodukte wurden 33 t Mostäpfel und 76 t Mostbirnen eingeführt. Gemessen an der durch den SBV im August 2010 herausgegebenen Vorernteschätzung verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Minus von 27 % und bei den Mostbirnen ein solches von 19 %. Der inländische Bedarf an Apfel- und Birnensaftprodukten wurde per Ende 2010 gemessen an der Normalversorgung bei den Mostäpfeln zu 102 % und bei den Mostbirnen zu 130 % gedeckt.
Der Konsum ungegorener Obstsaftgetränke ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 2 % gesunken und liegt auf dem Stand von 2006. Der Obstgetränkeausstoss bei den teilweisen und ganz gegorenen Obstsaftgetränken betrug lediglich 44 % im Vergleich zur Ersterhebung im Jahr 1980.
Einfuhren von Gemüse und Obst nehmen leicht zu
Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst, welche in der Schweiz angebaut werden können, beliefen sich 2010 auf 216 000 t bzw. 48 000 t. Das waren 1 % mehr Gemüse und 7 % mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Die Exporte lagen in der Höhe der Vorjahre und waren mit 1 100 t Gemüse und 1 100 t Obst unbedeutend.
Im Berichtsjahr nahmen die Weineinfuhren im Vergleich zum Vorjahr erneut zu und zwar um 1,7 % auf 1,940 Mio. hl. Davon wurden 1,679 Mio. hl innerhalb des Zollkontingentes eingeführt. Das Zollkontingent von 1,7 Mio. hl wurde somit erneut nicht ausgeschöpft. Die Weissweinimporte registrierten mit einem Gesamtvolumen von 366 749 hl eine Zunahme von 11 626 hl oder 3,3 %. Dabei stieg der Anteil der Einfuhren an Flaschenweinen um 7,6 %, während derjenige an Offenweinen um 2 % zunahm. Beim Rotwein mit einer Gesamteinfuhrmenge von 1,382 Mio. hl nahmen die Flaschenimporte zu (+6,3 %) während die Offenweineinfuhren um 5,3 % zurückgingen. In diesen Zahlen sind alle Weineinfuhren einschliesslich Verarbeitungswein und Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz berücksichtigt.
Der Gemüse- und Obstkonsum bleibt stabil
2010 betrug der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse 71 kg, derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 23 kg. Die Konsumwerte entsprachen fast dem Durchschnitt der vier Vorjahre.
Der Gesamtverbrauch an Wein betrug (inkl. Verarbeitungsweine und exportierte bzw. wiederausgeführte Weine) im Berichtsjahr 2,803 Mio. hl, was einer Abnahme um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Konsum von Schweizer Wein lag mit 1,062 Mio. hl um 3,2 % über der Vorjahresmenge. Damit konnte ein Teil der Verluste aus dem Jahr 2009 wieder wett gemacht werden. Der Konsum von ausländischen Weinen nahm um 0,8 % zu und erreichte 1,740 Mio. hl. Der Marktanteil von Schweizer Wein nahm um 0,5 % zu und erreicht neu 38 %.
34 1.1 Ökonomie
Anstieg der Preise und der Bruttomarge bei Gemüse
Gemüse wurde 2010 teurer. Im Vergleich zu 2009 stiegen der durchschnittliche Einstands- und Endverkaufspreis der beobachteten Gemüsesorten um 18 Rp./kg auf 1.44 Fr./kg bzw. um 23 Rp./kg auf 3.29 Fr./ kg. 2010 überstieg die Bruttomarge auf den ausgewählten Gemüsesorten den im Vorjahr beobachteten Wert um 5 Rp./kg und belief sich auf 1.85 Fr./kg.
Es ist jedoch anzumerken, dass sowohl der Einstands- und Endverkaufspreis als auch die Bruttomarge im Jahr 2010 die Durchschnittswerte des Zeitraums zwischen 2000 und 2005 überschritten (+21 Rp./kg, +27 Rp./kg bzw. +6 Rp./kg). Die höchste Bruttomarge auf Gemüse seit 2000 wurde im Jahr 2008 beobachtet. Sie lag bei 1.93 Fr./kg.
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter Gemüse
Einstandspreis für Früchte praktisch unverändert, Konsumentenpreis steigt
Der durchschnittliche Einstandspreis für Früchte blieb 2010 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (–2 Rp./kg, 1.80 Fr./kg), während der Endverkaufspreis um 14 Rp./kg auf 4.43 Fr./kg stieg. 2010 überstieg das Preisniveau den Durchschnitt des Zeitraums zwischen 2000 und 2005. Der Einstandspreis war um 4 Rp./kg höher und der Endverkaufspreis um 39 Rp./kg. Die Bruttomarge erreichte ihrerseits beinahe ihr 2006 beobachtetes Rekordniveau von 2.64 Fr./kg seit 2000 und betrug 2.63 Fr./kg.
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter Früchte
35 1.1 Ökonomie
in Fr / kg
Quelle: BLW
1.00 1.50 2.00 3.00 2.50 3.50 Ø 2000 – 05 2006 2007 2008 2009 2010 Bruttomarge Einstandspreis Verkaufspreis
Berücksichtigte Gemüse: Tomaten, Blumenkohl, Karotten, Zwiebeln, Chicorée, Gurken und Kartoffeln
in Fr / kg
Quelle: BLW
1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 2.50 5.00 4.50 3.50 Ø 2000 – 05 2006 2007 2008 2009 2010 Bruttomarge Einstandspreis Verkaufspreis
Berücksichtigte Früchte: Äpfel, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Nektarinen, Erdbeeren, Orangen
1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors
n Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme. Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR), welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird. Die LGR wurde 2007 teilrevidiert. Alle hier ausgewiesenen Zahlen beruhen auf der neuen Methodik. Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (vgl. Abschnitt 1.1.4).
1.1.3.1 Sektor-Einkommen 2010
Im Jahr 2010 betrug das Nettounternehmenseinkommen 2,640 Mrd. Fr. Im Vergleich zu den Jahren 2007/09 war es um 248 Mio. Fr. oder 8,6 % tiefer. Gegenüber 2009 sank es weniger stark, nämlich um 86 Mio. Fr. (–3,2 %). Im Vergleich zum Dreijahresmittel 2007/09 sanken die Erlöse (landwirtschaftliche Produktion –570 Mio. Fr. resp. –5,2 %) stärker als die Kosten (vor allem Vorleistungen –137 Mio. Fr. resp. –2,1 % und Abschreibungen –30 Mio. Fr. resp. –2,8 %).

36 1.1 Ökonomie
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen, in Mio. Fr.
1 Halbdefinitiv, Stand 12.9.2011
2 Provisorisch, Stand 12.9.2011
3 Schätzung, Stand 12.9.2011
4 wird in der Literatur und in der Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet
Die Zahlen werden auf- oder abgerundet, wodurch die Summe der Komponenten gegenüber der Totale oder Salden abweichen kann.
Sonstige Subventionen Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen)
Nettounternehmenseinkommen
1 Halbdefinitiv, Stand 12.9.2011
2 Provisorisch, Stand 12.9.2011
3 Schätzung, Stand 12.9.2011
15–16
A14–A15
37 1.1 Ökonomie
2000/02 2007 2008 2009 1 2010 2 2011 3 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs 10 749 10 674 11 229 10 679 10 291 10 251 – Vorleistungen 6 250 6 485 6 655 6 687 6 472 6 470 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 4 499 4 189 4 574 3 993 3 819 3 781 – Abschreibungen 2 056 2 216 2 283 2 287 2 232 2 129 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2 443 1 973 2 291 1 706 1 587 1 651 – sonstige Produktionsabgaben 114 143 139 149 150 171 + sonstige Subventionen (produktunabhängige) 2 407 2 707 2 655 2 837 2 876 2 915 Faktoreinkommen 4 737 4 536 4 807 4 394 4 313 4 396 – Arbeitnehmerentgelt 1 139 1 244 1 276 1 239 1 251 1 257 Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen 3 598 3 292 3 531 3 155 3 063 3 139 – gezahlte Pachten 205 201 203 204 203 203 – gezahlte Zinsen 246 244 270 239 230 232 + empfangene Zinsen 33 14 17 13 11 11 Nettounternehmenseinkommen 4 3 180 2 861 3 076 2 726 2 640 2 715
Quelle: BFS
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Angaben zu laufenden Preisen in Mio. Fr. Quelle:
0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2000 / 02 2007 2008 20091 20102 20113
Entwicklung der
BFS
Tabellen
Seiten
1.1.3.2 Schätzung des Sektor-Einkommens 2011
Die Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes 2011 liegt mit 10,251 Mrd. Fr. um 4,5 % tiefer als das Dreijahresmittel 2008/10. Gegenüber dem Vorjahr dürfte der Rückgang allerdings nur 0,4 % betragen. Trotz der Probleme auf dem Milch- und Schweinemarkt wird die tierische Produktion parktisch gleich hoch eingeschätzt wie letztes Jahr. Der leichte Rückgang beim Pflanzenbau ist vor allem auf die gegenüber letztem Jahr tieferen Erträge im Futterbau zurückzuführen.
Die pflanzliche Produktion (4,440 Mrd. Fr.; inbegriffen produzierender Gartenbau) wird 2011 gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 3,8 % und gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % tiefer geschätzt.
Beim Getreide nahm die Anbaufläche 2011 weiter ab. Gute Erträge und gute Qualität trugen jedoch dazu bei, dass die Erlöse höher als 2010 ausfallen dürften. Ausserdem wird damit gerechnet, dass die Preise 2011 ähnlich hoch sein werden wie 2010. Der Wert der Getreideernte 2011 wird zwar 1,8 % unter dem Dreijahresmittel, jedoch 5,7 % über dem Vorjahreswert veranschlagt.
Die ersten Rübenuntersuchungen deuten auf eine sehr gute Ernte hin. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Vertragsmenge und die hohen Zuckergehalte der Rüben dürften 2011 zu einem wesentlich höheren Produktionswert gegenüber 2010 führen. Die erneute Ausdehnung der Rapsanbaufläche und die guten Erträge lassen eine höhere Produktionsmenge als im Vorjahr erwarten. Die Produzentenpreise inklusive der Anbaubeiträge sollten höher als im Vorjahr ausfallen. Die Tabakernte wird als gut eingeschätzt. Der Produktionswert der Handelsgewächse dürfte insgesamt für 2011 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2008/10 um 2,9 % tiefer ausfallen, hingegen gegenüber dem Vorjahr um 11,4 % zulegen.
Die Raufutterproduktion wird dieses Jahr tiefer ausfallen. Dies ist vor allem auf die trockenheitsbedingten tieferen Erträge beim Heu zurückzuführen. Die höhere Anbaufläche für Silomais und die guten Aussichten für hohe Erträge dürften die Verluste durch die Heuernte teilweise kompensieren. Der Produktionswert der Futterpflanzen wird dieses Jahr 13,4 % unter dem Dreijahresmittel 2008/10 geschätzt. Der Wert 2011 liegt 12,2 % unter demjenigen des Vorjahres.
Nach dem guten letzten Jahr wird der Produktionswert für den Gemüsebau dieses Jahr tiefer als 2010 geschätzt. Bedingt durch den schönen und trockenen Frühling gab es schon sehr früh viel Ware auf dem Markt mit entsprechendem Preisdruck. Ende Mai und im Juni sorgte dann der EHEC-Erreger noch für zusätzliche Absatzprobleme bei den Gurken, Salaten und Tomaten. Im Vergleich zum Mittel der drei Vorjahre resultiert für den Gemüsebau zwar nur ein um 0,7 % tieferer Produktionswert, gegenüber dem Vorjahr dürfte er aber um 4 % zurückgehen.
Beim produzierenden Gartenbau wird 2011 gegenüber dem Vorjahr eine geringe Zunahme des Produktionswertes erwartet. Positiv auf das Ergebnis dürfte sich die weitere Ausdehnung des Anbaus von Weihnachtsbäumen auswirken, negativ hingegen die Frankenstärke, welche die Preise bei Zierpflanzen und Blumen unter Druck setzt. Der Produktionswert 2011 wird 0,9 % tiefer als das Mittel der drei Vorjahre geschätzt, gegenüber dem Vorjahr dürfte er hingegen um 0,4 % steigen.
Bei den Kartoffeln zeichnet sich im Vergleich zur kleinen Vorjahresernte eine ähnlich gute Ernte wie 2009 ab. Dazu trägt nach mehrjährigem Rückgang eine leichte Ausdehnung der Anbaufläche bei. Die Produzentenpreise dürften dagegen tiefer als im Vorjahr sein. Der Produktionswert 2011 wird 3,4 % tiefer als das Dreijahresmittel 2008/10 geschätzt, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies aber einer Steigerung um 1,7 %.
Beim Frischobst werden 2011 bei den Äpfeln und Birnen höhere Erträge als 2010 erwartet. Die Preise dürften hingegen tiefer zu liegen kommen. Als Summe der beiden Effekte wird der Wert von Frischobst 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 % höher geschätzt, gegenüber dem Dreijahresmittel 2008/10 wären es 5,7 %. Bei den Weintrauben für den Frischkonsum und für die Verarbeitung zu Wein ausserhalb des Bereiches Landwirtschaft wird im Berichtsjahr gegenüber 2010 eine höhere Ernte bei stabilen Preisen erwartet. Diese Position dürfte deshalb um 6,2 % zulegen. Frischobst und Weintrauben bilden zusammen die Position Obst. Dafür wird 2011 ein um 3,3 % höherer Wert als im Durchschnitt der Periode 2008/10 geschätzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um 10,6 %.
38 1.1 Ökonomie
Der Produktionswert des Weins beruht teilweise auf den Veränderungen der Vorräte der beiden Vorjahre, welche qualitativ sehr gut waren, so dass die Preise trotz Importdruck mehrheitlich gehalten werden konnten. Dazu wird gegenüber 2010 eine leicht erhöhte Weintraubenernte erwartet. Der Produktionswert des Weins im Jahre 2011 dürfte im Bereich des Dreijahresdurchschnitt 2008/10 zu liegen kommen, was eine Erhöhung um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde.
Die tierische Produktion (4,787 Mrd. Fr.) wird 2011 im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre um 6,6 % tiefer eingeschätzt. Gegenüber dem Vorjahr dürfte sie dagegen nur ganz leicht um 0,1 % zurückgehen. Ein um 3,0 % höherer Produktionswert als im Vorjahr wird für die Position Rinder veranschlagt. Nachdem bei den Schweinen bereits 2010 gegenüber 2009 ein wesentlicher Rückgang zu verzeichnen war, muss für das Jahr 2011 mit einem nochmals tieferen Produktionswert gerechnet werden. Die Ursache dafür sind die weiter gefallenen Preise als Folge der Zunahme bei der Produktion. Weiter zulegen dürfte der Produktionswert für Geflügel. Leicht höher wird dieser Wert auch bei den Schafen eingeschätzt. Der Milchmarkt hat weiter mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Buttervorräte sind hoch und der Käseexport leidet unter der Frankenstärke. Trotzdem war der durchschnittliche Milchpreis 2011 bis August leicht über der entsprechenden Vorjahresperiode. Die Schätzung geht deshalb davon aus, dass der Produktionswert 2011 das Niveau 2010 halten kann. Die Eierproduktion wird auf dem Vorjahresniveau geschätzt, die Produzentenpreise dagegen dürften leicht sinken. Entsprechend dürfte es praktisch keine Veränderung des Produktionswertes zwischen 2010 und 2011 geben.
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen (659 Mio. Fr.) wird 2011 im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre um 1,3 % höher geschätzt. Gegenüber dem Vorjahr wäre er 0,6 % höher. Der Produktionswert der landwirtschaftlichen Dienstleistungen, welche insbesondere Lohnarbeiten für Dritte beinhalten (z.B. Saat und Ernte) hat, bis in den letzten Jahren kontinuierlich zugelegt, was auf eine steigende Spezialisierung der Produktionsabläufe in der Landwirtschaft hindeutet.
Der Wert der nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten (364 Mio. Fr.) dürfte 2011 gegenüber dem Dreijahresmittel 2008/10 um 6,3 % und gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % zunehmen. In dieser Position sind Tätigkeiten enthalten wie die Verarbeitung von Mostobst, Fleisch oder Milch auf dem Hof oder Dienstleistungen wie Strassenrand- und Landschaftspflege, die Haltung von Pensionstieren (Pferde) sowie die Übernachtungen von Touristen (Schlafen im Stroh).
Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2011 auf 6,470 Mrd. Fr. veranschlagt, was 2,0 % unter dem Dreijahresdurchschnitt 2008/10 liegt. Gegenüber dem Vorjahr sind sie allerdings praktisch gleich hoch. Dabei dürften die Ausgaben für Futtermittel insgesamt tiefer ausfallen als im Vorjahr. Der Wert der zugekauften Futtermittel wird zwar höher als im Vorjahr geschätzt, dies als Folge eines gestiegenen Einsatzes und höherer Preise. Dem stehen aber beträchtlich tiefere Werte für die hofeigene Futterproduktion entgegen. Nach dem Hoch von 2008 und dem Rückgang von 2009 stiegen die Preise für Erdölerzeugnisse seit 2010 wieder, so dass die Ausgaben für Energie und Schmierstoffe im Vergleich zu den Jahren 2008/10 um 5,2 % und im Vergleich zum Vorjahr gar um 8,8 % gewachsen sind. Eine ähnliche Bewegung ist bei den Düngemitteln zu beobachten. Nach der sehr starken Teuerung der Düngemittel im Jahre 2008 nahmen die Preise 2009 und 2010 ab, bevor sie im Jahre 2011 wieder gestiegen sind. Die Ausgaben für Düngemittel dürften sich von 2010 auf 2011 um 5,5 % erhöhen. Die Kosten für Saat- und Pflanzgut sind im Dreijahresmittel um 4,7 % gesunken, was auf tiefere Preise und geringeren Einsatz zurückzuführen ist. Es wird geschätzt, dass parallel zu den Tierbeständen der Bedarf an tierärztlichen Leistungen und Medikamenten eher hoch bleibt und entsprechend diese Kosten nur unwesentlich ändern werden. Die Ausgaben für den Unterhalt der Maschinen und Geräte sowie für die Instandhaltung von baulichen Anlagen dürften gegenüber 2008/10 um 0,6 % bzw. 2,0 % sinken. Hingegen wird geschätzt, dass die Ausgaben für sonstige Waren und Dienstleistungen 2011 gegenüber dem Dreijahresdurchschnitt um 1,7 % steigen werden, was insbesondere auf die erhöhten Wasserkosten infolge des trockenen Frühlings zurückzuführen sein dürfte.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (3,781 Mrd. Fr.) wird 2011 um 8,4 % tiefer eingeschätzt als im Dreijahresmittel 2008/10. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr dürfte allerdings nur 1,0 % betragen.
39 1.1 Ökonomie
Die Abschreibungen (2,129 Mrd. Fr.) werden 2011 im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre um 6,1 % und gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % tiefer veranschlagt. Die tieferen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr sind zu einem beträchtlichen Teil Effekt einer bereits früher beschlossenen methodischen Anpassung. Dieser Sondereffekt wirkt sich entsprechend auch auf die Höhe des Nettounternehmenseinkommens aus.
Die sonstigen Produktionsabgaben (171 Mio. Fr.) dürften 2011 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2008/10 um 17,1 % und gegenüber dem Vorjahr um 13,9 % höher ausfallen. Dies ist vor allem auf die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze auf den 1. Januar 2011 zurückzuführen. Die sonstigen Produktionsabgaben setzen sich zusammen aus den übrigen Produktionsabgaben (Motorfahrzeugsteuer, Stempelgebühr und Grundsteuer) sowie der Unterkompensation der Mehrwertsteuer.
Die sonstigen Subventionen (2,915 Mrd. Fr.) beinhalten alle Direktzahlungen, den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite, Betriebshilfe) und die übrigen von Kantonen und Gemeinden erbrachten laufenden Beiträge. Nicht enthalten sind die Gütersubventionen, welche bereits im Produktionswert zu Herstellungspreisen berücksichtigt wurden (z.B. Anbaubeiträge und Zulagen für silagefreie Fütterung bei der Milchproduktion). Die sonstigen Subventionen dürften 2011 gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 4,5 % höher ausfallen. Gegenüber dem letzten Jahr dürfte der Anstieg 1,4 % betragen.
Das Arbeitnehmerentgelt (= Angestelltenkosten) wird für 2011 auf 1,257 Mrd. Fr. geschätzt, was ungefähr dem Durchschnitt der Jahre 2008/10 und auch der Summe von 2010 entspricht. Die Abnahme der Angestellten in der Landwirtschaft (–1,9 % gegenüber 2008/10, in Jahresarbeitseinheiten ausgedrückt) dürfte durch den Anstieg der Lohnkosten (inkl. Sozialbeiträge der Arbeitgeber) wettgemacht werden.
Die gezahlten Pachten (203 Mio. Fr.) stagnieren seit Jahren und bleiben auch 2011 gegenüber dem Dreijahresmittel 2008/10 praktisch auf derselben Höhe (+0,1 %). Die gezahlten Schuldzinsen (232 Mio. Fr.) werden 2011 gegenüber dem Dreijahresmittel um 6 % tiefer veranschlagt, was zum grossen Teil auf die Abnahme der Hypothekarzinssätze zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorjahr bleibt diese Position aber praktisch gleich.
Als Nettounternehmenseinkommen verbleiben 2,715 Mrd. Fr. Das sind 3,5 % weniger als das Dreijahresmittel 2008/10. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Schätzung des Sektoreinkommens um 74 Mio. Fr. höher (+2,8 %). Ohne den Sondereffekt bei den Abschreibungen wäre das Sektoreinkommen allerdings tiefer und nur ungefähr gleich hoch wie letztes Jahr.
40 1.1 Ökonomie
1.1.4
Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung von Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren, wie z.B. jener zur finanziellen Stabilität, wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe. Im Tabellenanhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt.

41 1.1 Ökonomie
Begriffe und Methoden Seite A59
1.1.4.1 Einkommen und Arbeitsverdienst
n Landwirtschaftliches Einkommen 2010 tiefer
Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel aller Regionen
Die Rohleistung blieb 2010 im Vergleich zum Mittel der Jahre 2007/09 praktisch konstant (–0,3 %). Die Abnahme gegenüber 2009 betrug 2,1 %. Dies ist auf die mehrheitlich tieferen Produzentenpreise im tierischen und pflanzlichen Bereich sowie auf einen für einzelne Kulturen ungünstigeren Witterungsverlauf zurückzuführen. Zugenommen haben hingegen die Direktzahlungen (+3,4 %).
Die Fremdkosten lagen 2010 um 3,2 % über dem Dreijahreswert 2007/09. Gegenüber dem Vorjahr blieben sie praktisch konstant (–0,2 %). Die Sachkosten im Pflanzenbau sind infolge tieferer Düngerpreise gesunken (–4,4 %). Auch die Sachkosten in der Tierhaltung liegen unter dem Vorjahreswert (–1,6 %). Der Hauptgrund liegt hier bei tieferen Kosten für den Tierzukauf. Andererseits sind höhere Abschreibungen für Maschinen und Gebäude zu verzeichnen (+2,3 resp. 2,5 %), während die Schuldzinsen aufgrund der gesunkenen Zinssätze erneut abgenommen haben (–5,5 %).
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohleistung und Fremdkosten. Es entschädigt einerseits die Arbeit der Familienarbeitskräfte und andererseits das im Betrieb investierte Eigenkapital. 2010 lag das landwirtschaftliche Einkommen 10,8 % unter dem Mittelwert der Jahre 2007/09 und 8,5 % unter dem Vorjahresniveau.
Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen hat gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre zugenommen (+7,0 %), im Vergleich zu 2009 ist es aber nur leicht angestiegen (+0,4 %).
Aus der Veränderung des landwirtschaftlichen und ausserlandwirtschaftlichen Einkommens resultiert eine Abnahme des Gesamteinkommens um 5,7 % gegenüber 2007/09 und eine Abnahme von 5,8 % gegenüber 2009.
Das landwirtschaftliche Einkommen lag 2010 gegenüber 2007/09 in der Tal- und Hügelregion um 13,2 % bzw. 8,8 % tiefer, in der Bergregion nahm es um 6,9 % ab. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen stieg in der Talregion um 0,9 %, in der Hügelregion um 10,9 % und in der Bergregion um 13,7 %. Entsprechend nahm das Gesamteinkommen in der Talregion um 9,7 % und in der Hügelregion um 2,8 % ab, während es sich in der Bergregion nicht verändert hat (+0,1 %).
42 1.1 Ökonomie
in Fr . pro Betrieb
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 2000 / 02 2007 2008 2009 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Landwirtschaftliches Einkommen 18 806 56 203 1.29 FJAE 23 417 61 143 1.24 24 131 64 147 1.23 26 204 60 305 1.22 2010 26 308 55 182 1.22 Familien-Jahresarbeitseinheiten
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabellen 17–26
Seiten A16–A26
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Regionen
Der Anteil der Direktzahlungen an der Rohleistung betrug 2010 18,2 % in der Talregion, 25,2 % in der Hügelregion und 39,3 % in der Bergregion. Damit nahm der Anteil in allen drei Regionen leicht zu. Die Einkommenssituation unterscheidet sich stark nach Betriebstyp (11 Produktionsrichtungen).
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2008/10
43 1.1 Ökonomie
Tabellen 17–20
Seiten A16–A19
Einkommen nach Region Einheit 2000/02 2007 2008 2009 2010 2007/09–2010 % Talregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20,01 21,22 21,63 21,66 22,17 3,1 Familienarbeitskräfte FJAE 1,25 1,17 1,18 1,17 1,16 –1,1 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 67 865 72 834 78 570 72 074 64 627 –13,2 Ausserlandw. Einkommen Fr. 17 197 22 961 24 877 26 565 25 016 0,9 Gesamteinkommen Fr. 85 061 95 795 103 447 98 639 89 643 –9,7 Hügelregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 17,96 19,29 19,24 19,55 19,71 1,8 Familienarbeitskräfte FJAE 1,26 1,23 1,20 1,21 1,21 –0,3 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 50 826 55 520 58 809 55 379 51 567 –8,8 Ausserlandw. Einkommen Fr. 20 580 23 804 24 221 27 049 27 748 10,9 Gesamteinkommen Fr. 71 406 79 324 83 030 82 428 79 314 –2,8 Bergregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18,68 19,81 19,70 20,23 20,55 3,2 Familienarbeitskräfte FJAE 1,37 1,34 1,34 1,33 1,33 –0,5 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 41 789 47 046 45 663 45 258 42 804 –6,9 Ausserlandw. Einkommen Fr. 19 725 23 801 22 806 24 711 27 032 13,7 Gesamteinkommen Fr. 61 514 70 848 68 469 69 969 69 837 0,1 Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Betriebstyp Landw. Familien- Landw. Ausserlandw. GesamtNutzfläche arbeitskräfte Einkommen Einkommen einkommen ha FJAE Fr. Fr. Fr. Mittel alle Betriebe 20,73 1,22 59 878 25 548 85 426 Ackerbau 25,51 0,92 65 292 31 064 96 356 Spezialkulturen 13,28 1,26 86 818 24 026 110 844 Verkehrsmilch 21,05 1,32 56 166 21 931 78 097 Mutterkühe 20,12 1,1 41 250 36 981 78 231 Anderes Rindvieh 17,64 1,23 33 056 27 933 60 989 Pferde/Schafe/Ziegen 12,99 1,06 26 216 36 452 62 668 Veredlung 11,71 1,11 70 336 32 624 102 960 Kombiniert Verkehrsmilch/ Ackerbau 28,83 1,27 74 402 19 030 93 432 Kombiniert Mutterkühe 24,93 1,15 49 930 33 684 83 614 Kombiniert Veredlung 21,64 1,28 84 690 21 941 106 631 Kombiniert Andere 22,89 1,23 61 545 24 732 86 277 Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART Tabellen 21a–21b Seiten A20–A21
Im Durchschnitt der Jahre 2008/10 erzielten die Betriebstypen Spezialkulturen und bestimmte kombinierte Betriebe (Veredlung, Verkehrsmilch/Ackerbau) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen. Diese erwirtschafteten zusammen mit dem Ackerbau und der Veredlung auch die höchsten Gesamteinkommen. Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen anderes Rindvieh und Pferde/Schafe/Ziegen. Dazwischen liegen die spezialisierten Verkehrsmilchbetriebe. Ihre Ergebnisse sind in allen Einkommenskategorien unterdurchschnittlich.
n Arbeitsverdienst 2010 tiefer als 2007/09
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte. Gegenüber dem Dreijahresmittel 2007/09 sank der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) 2010 um 3,4 %. Im Vergleich zu 2009 nahm er um 2,6 % ab. Damit hat der Arbeitsverdienst im Vergleich zum Vorjahr weniger stark abgenommen als das landwirtschaftliche Einkommen. Der Grund dafür liegt im gesunkenen Zinsanspruch für das Eigenkapital (tieferes Zinsniveau der Bundesobligationen).
Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen unterschiedlich hoch. Im Durchschnitt ist er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion. Auch die Quartile liegen weit auseinander. So erreichte 2008/10 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 16,1 % und derjenige im vierten Quartil 207,9 % des Mittelwertes aller Betriebe der Region. In der Hügelregion war die Streuungsbandbreite noch grösser (3,9 % und 203,9 %). In der Bergregion war der Arbeitsverdienst im ersten Quartil sogar negativ, jener des vierten Quartils lag jedoch bei 222,7 % des Mittelwerts.
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 2008/10: nach Regionen und Quartilen
Arbeitsverdienst 1 in Fr. pro FJAE 2
1 Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen: 2008: 2,93 %; 2009: 2,22 %; 2010: 1,65 %.
2 Familien-Jahresarbeitseinheiten: Basis 280 Arbeitstage
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
In der Tal- und Hügelregion übertraf 2008/10 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe im Durchschnitt den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung um 34 000 Fr. resp. 11 700 Fr. In der Bergregion verfehlte das vierte Quartil das Niveau des entsprechenden Vergleichslohns um 1 400 Fr. Im Vergleich zur Periode 2007/09 hat sich damit die relative Situation des vierten Quartils in allen Regionen verbessert.
44 1.1 Ökonomie
Median Mittelwerte Region 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil (0–25 %) (25–50 %) (50–75 %) (75–100 %) Talregion 47 613 8 249 36 578 59 357 106 740 Hügelregion 34 949 1 487 27 319 43 845 78 022 Bergregion 24 001 –1 623 17 656 31 821 60 400
Tabellen 22–25 Seiten A22–A25
Vergleichslohn 2008/10, nach Regionen Region
1 Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten
Quellen: BFS, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Zu berücksichtigen gilt, dass die landwirtschaftlichen Haushalte ihren Lebensunterhalt nicht nur aus dem Arbeitsverdienst bestreiten. Ihr Gesamteinkommen, einschliesslich des ausserlandwirtschaftlichen Einkommens, liegt wesentlich höher als der Arbeitsverdienst. So beträgt das Gesamteinkommen der Betriebe in der Bergregion im ersten Quartil, die einen negativen Arbeitsverdienst ausweisen, 2008/10 rund 43 000 Fr. Den Lebensunterhalt finanzieren sie vor allem aus dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen, das sich auf 38 000 Fr. beläuft.
1.1.4.2 Weitere betriebswirtschaftliche Kennzahlen
n Finanzielle Stabilität
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens. Kombiniert man diese Kennzahl mit der Eigenkapitalbildung, lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen. Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält – finanziell nicht existenzfähig.
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt.
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit …
Eigenkapitalbildung
Positiv
Negativ
Fremdkapitalquote
Tief (<50 %)
… guter finanzieller Situation
… ungenügendem Einkommen
Hoch (>50 %)
… beschränkter finanzieller Selbständigkeit
… bedenklicher finanzieller Situation
Quelle: De Rosa
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild. Zwischen 39 und 42 % der Betriebe befinden sich in einer finanziell guten und zwischen 33 und 40 % befinden sich in einer finanziell schwierigen Situation (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung). Das Dreijahresmittel 2008/10 präsentiert sich damit vor allem in der Talregion schlechter als 2007/09, während sich die Situation in der Hügel- und Bergregion kaum verändert hat.
45 1.1 Ökonomie
Vergleichslohn
Fr. pro Jahr
72
66
Bergregion 61
1
Talregion
729 Hügelregion
330
810
Beurteilung der finanziellen Stabiliät 2008 /10 nach Regionen
n Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
Die Investitionen der ART-Referenzbetriebe haben 2010 im Vergleich zu 2007/09 zugenommen (+3,6 %), während der Cashflow (–2,5 %) gesunken ist. Aus diesen beiden Zahlen resultiert ein tieferes CashflowInvestitionsverhältnis (–6,1 %). Die Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen minus Privatverbrauch) war wesentlich tiefer als in der Referenzperiode (–34,8 %), dies aufgrund des gesunkenen Gesamteinkommens und gleichzeitig stabilem Privatverbrauch. Die Fremdkapitalquote lag auf demselben Niveau wie in den Vorjahren.
Entwicklung von Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
1 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2 Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
46 1.1 Ökonomie
Anteil Betriebe in %
0 10 20 40 30 50 60 100 90 80 70 Talregion Hügelregion Bergregion bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle Situation 24 42 26 40 21 16 18 18 18 15 22 39
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Merkmal 2000/02 2007 2008 2009 2010 2007/09–2010 % Eigenkapitalbildung Fr. 11 787 14 627 16 746 14 941 10 069 –34,8 Investitionen 1 Fr. 45 376 45 333 48 400 51 448 50 148 3,6 Cashflow-Investitionsverhältnis 2 % 93 100 100 97 93 –6,1 Fremdkapitalquote % 41 45 44 44 44 –0,8
1.2 Soziales und Gesellschaft
Das Soziale ist eine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. In der Berichterstattung über die agrarpolitischen Auswirkungen nehmen die sozialen Aspekte deshalb einen eigenen Platz ein.
Im Folgenden werden die Einkommen und der Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART dargestellt, die Resultate der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung SAKE im Vergleich zur übrigen Bevölkerung sowie soziale Dienstleistungen in landwirtschaftlichen Familienbetrieben.

47 1.2 Soziales und Gesellschaft
1.2.1 Soziales
1.2.1.1 Einkommen und Verbrauch
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Bauernfamilien sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen. Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem als Mass für die Leistungsfähigkeit der Betriebe. Bei der sozialen Dimension steht die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte im Vordergrund. Daher wird das ausserlandwirtschaftliche Einkommen der Bauernfamilien ebenfalls mit in die Analyse einbezogen. Untersucht werden dabei sowohl das Gesamteinkommen als auch die Entwicklung des Privatverbrauchs.
n Gesamteinkommen und Privatverbrauch nach Region
Das Gesamteinkommen, das sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen zusammensetzt, lag im Durchschnitt der Jahre 2008/10 je nach Region zwischen 69 400 und 97 200 Fr. pro Haushalt: Die Haushalte der Bergregion erreichten gut 70 % des Gesamteinkommens der Haushalte der Talregion. Mit durchschnittlichen ausserlandwirtschaftlichen Einkommen von 24 800 bis 26 300 Fr. hatten die Bauernfamilien eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle. Diese machte bei den Haushalten der Talregion 26 % des Gesamteinkommens aus, bei jenen der Hügelregion 32 % und bei denjenigen der Bergregion 36 %. Die Haushalte der Hügelregion wiesen mit 26 300 Fr. absolut die höchsten ausserlandwirtschaftlichen Einkommen aus.
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Betrieb nach Region 2008 /10
Quelle: Zentrale Auswertung, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Die Eigenkapitalbildung – der nicht konsumierte Teil des Gesamteinkommens – macht je nach Region zwischen 12 bis 18 % des Gesamteinkommens aus. Der Privatverbrauch liegt jeweils über der Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens. Er ist entsprechend der Höhe des Gesamteinkommens bei den Haushalten der Talregion absolut am höchsten und bei jenen der Bergregion am tiefsten.
Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Haushalt lag 2010 mit 81 500 Fr. unter jenem der Jahre 2007/09 mit 86 400 Fr. Der Privatverbrauch pro Haushalt hat 2010 im Vergleich zu 2007/09 dennoch leicht um 400 Fr. zugenommen und lag bei 71 400 Fr.
48 1.2 Soziales und Gesellschaft
in Fr.
0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Talregion Hügelregion Bergregion Privatverbrauch Landwirtschaftliches Einkommen Ausserlandwirtschaftliches Einkommen
n Gesamteinkommen und Privatverbrauch nach Quartil
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Verbrauchereinheit nach Quartil 1 2008/10
1 Quartile nach Arbeitsverdienst je Familien-Jahresarbeitseinheit

2 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr Quelle: Zentrale Auswertung, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Die Haushalte des ersten Quartils erreichten 39 % des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Haushalten des vierten Quartils. Beim Privatverbrauch war die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer: Er lag bei den Haushalten des ersten Quartils bei 65 % des Verbrauchs der Haushalte des vierten Quartils.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte 2008/10 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken. Die Eigenkapitalbildung war negativ. Zehren diese Betriebe längerfristig von der Substanz, so müssen sie früher oder später aufgegeben werden. In den übrigen Quartilen war der Privatverbrauch geringer als das Gesamteinkommen: Er lag bei den Betrieben des zweiten Quartils bei 94 % des Gesamteinkommens, bei den Betrieben des dritten Quartils bei 82 % und bei den Betrieben des vierten Quartils bei 68 %.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit war 2010 in allen Quartilen im Vergleich zu den drei Vorjahren 2007/09 tiefer: Im ersten Quartil um 1 400 Fr., im zweiten um 800 Fr., im dritten um 1 300 Fr. und im vierten Quartil um 2 300 Fr. Der Privatverbrauch pro Verbrauchereinheit hat 2010 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2007/09 im ersten und im dritten Quartil zugenommen (500 resp. 1 000 Fr.), beim zweiten und vierten Quartil abgenommen (300 resp. 200 Fr.).
49 1.2 Soziales und Gesellschaft
1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil Alle Betriebe Gesamteinkommen pro VE 2 (Fr.) 15 414 20 361 27 060 39 888 25 652 Privatverbrauch pro VE (Fr.) 17 717 19 052 22 100 27 072 21 474
1.2.1.2 Ausbildung und Arbeit
Ausbildung und Arbeit sind ein wichtiger Teil des Lebens und bestimmen die soziale Lage massgeblich. Sie sind deshalb im Rahmen der Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft eines der zentralen Themen, bei denen periodisch eine Bestandesaufnahme aufgrund repräsentativ durchgeführter Erhebungen gemacht wird.
n Schweizerische Arbeitskräfteerhebung als Grundlage
Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) ist eine Erhebung, die seit 1991 jährlich vom Bundesamt für Statistik durchgeführt wird. Sie beschreibt die Struktur und die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung sowie das Erwerbsverhalten in der Schweiz. Erhoben werden nebst den Daten bezüglich den Arbeitsbedingungen auch solche betreffend Haushalt- und Wohnsituation. Eine Person wird jeweils stellvertretend für einen Haushalt kontaktiert: Von 1991 bis 2009 wurde die Befragung einmal jährlich im zweiten Quartal durchgeführt, seit 2010 kontinuierlich während des ganzen Jahres. Die zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählten Personen (bis 2001: 16 000 Personen, von 2002 bis 2009: 35 000, ab 2010: 105 000) werden telefonisch befragt. Die Grundgesamtheit der SAKE ist die ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Die Ergebnisse der Stichprobe werden jeweils auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet.
Die für die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft wichtigsten Ergebnisse sind nachfolgend in den Abschnitten Haushalt- und Wohnsituation sowie Ausbildung und Arbeitssituation aufgeführt. Diese jährlichen Daten stammen von der SAKE 2010. Verglichen wird die Situation folgender fünf Berufskategorien von Erwerbstätigen aus der Stichprobe:
– Bauern/Bäuerinnen (533 Männer und 259 Frauen);
– Gewerbetreibende des zweiten Sektors (1 108 und 185);
– Übrige Selbständige (2 001 und 2 140);
– Landwirtschaftliche Arbeitnehmende (93 und 53);
– Übrige Arbeitnehmende (16 123 und 16 220).
Als erwerbstätig gilt, wer während der Referenzwoche mindestens eine Stunde gegen Entlöhnung gearbeitet oder wer als Familienmitglied unentgeltlich auf dem Familienbetrieb mitgearbeitet hat.
Im Agrarbericht 2002 wurden erstmals Resultate der SAKE-Spezialauswertung für das Jahr 2001 veröffentlicht, 2007 zum zweiten Mal für das Jahr 2006. Dabei wurden im Abschnitt Ausbildung und Arbeitssituation die Resultate nach Männern und Frauen getrennt aufgezeigt wie auch in der aktuellen Ausgabe 2011 –soweit möglich. Allfällige Veränderungen und Entwicklungen zwischen den Ergebnissen der Jahre 2001, 2006 sowie 2010 werden im Text erwähnt.
50 1.2 Soziales und Gesellschaft
n Haushalt- und Wohnsituation
In diesem Abschnitt werden die Resultate der Kenngrössen «Alter der erwerbstätigen Personen«, «Anzahl Personen im Haushalt» sowie «Besitzverhältnisse» aufgezeigt.
Alter der erwerbstätigen Personen
Bauern/Bäuerinnen
Gewerbetreibende
Übrige Selbständige

Landw. Arbeitnehmende
Übrige Arbeitnehmende
Bei der Kategorie «Bauern/Bäuerinnen» sind mit 14 % am meisten über 65-Jährige noch erwerbstätig, bei den anderen Gruppen der Selbständigerwerbenden sind es 10 %. Die Gruppe der 15- bis 39-Jährigen ist bei den Selbständigen allgemein weniger stark vertreten als bei den Arbeitnehmenden. Im Vergleich mit 2001 sowie 2006 ist 2010 bei den «Bauern/Bäuerinnen» der Anteil der 15 bis 39-Jährigen gesunken (2001: 34 %, 2006: 30 %, 2010: 24 %).
51 1.2 Soziales und Gesellschaft
100 20 40 0 60 80 in %
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
65
15 – 39 Jahre 40 – 64 Jahre
+ Jahre
Anzahl Personen im Haushalt
1 Person
2 Personen
3 + 4 Personen
5 und mehr Personen
Bauern/Bäuerinnen
Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landw. Arbeitnehmende
Übrige Arbeitnehmende
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
Knapp 30 % der Gruppe «Bauern/Bäuerinnen» wohnen in Haushalten mit fünf und mehr Personen. Das ist ein markanter Unterschied zu den anderen Berufskategorien (ohne landwirtschaftliche Arbeitnehmende), bei welchen der Anteil um 10 % liegt. Auf der anderen Seite wohnen bloss 6 % der «Bauern/Bäuerinnen» in einem Ein-Personen-Haushalt, bei den übrigen Gruppen sind es um 15 %.
Besitzverhältnisse
(Mit-) Eigentümer von Haus / Wohnung
Bauern/Bäuerinnen
Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landw. Arbeitnehmende
Übrige
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
Bei den Besitzverhältnissen zeigt sich, dass über 80 % der Kategorie «Bauern/Bäuerinnen» Eigentümer bzw. Miteigentümer sind. Bei den anderen Gruppen der Selbständigerwerbenden sind 60 % Eigentümer, bei den Arbeitnehmenden rund 40 %.
n Ausbildung und Arbeitssituation
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die Kenngrössen «Höchste abgeschlossene Ausbildung», «Besuch von Weiterbildungskursen», «Arbeitszeit pro Woche», «Arbeit am Wochenende» sowie «Ferientage» dargelegt, soweit möglich jeweils unterschieden nach Männern und Frauen.
52 1.2 Soziales und Gesellschaft
100 20 40 0 60 80 in %
100 20 40 0 60 80 in %
Arbeitnehmende
Mieter / Pächter / Bewohner
Höchste abgeschlossene Ausbildung
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen
Sekundarstufe I Sekundarstufe II
Tertiärstufe
Sekundarstufe I: Obligatorische Grundschule (neun Jahre)
Bauern/Bäuerinnen
Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landw. Arbeitnehmende
Übrige Arbeitnehmende
Sekundarstufe II: Berufliche Grundbildung mit oder ohne Berufsmaturität; Allgemein- und berufsbildende Mittelschulen (z.B. Fachmittelschulen, Handelsmittelschulen); Maturitätsschulen (Gymnasien)
Tertiärstufe: Höhere Berufsbildung (eidg. Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen sowie höhere Fachschulen) und Hochschulen (universitäre Hochschulen, Fachhochschulen)
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
Ins Auge sticht hier der grosse Teil mit einer höheren und universitären Berufsausbildung bei den übrigen selbständigen Männern (über 30 %). Bei der Gruppe «Bauern/Bäuerinnen» nimmt dagegen die Sekundarstufe II (also z.B. Lehrabschluss) den höchsten Anteil ein. Über 20 % der befragten Bäuerinnen geben die obligatorische Grundschule als höchste abgeschlossene Ausbildung an. Ganz allgemein ist bei der höchsten abgeschlossenen Ausbildung nach wie vor ein Geschlechterunterschied feststellbar: Die befragten Männer haben höhere Ausbildungsabschlüsse als die befragten Frauen.
Besuch von Weiterbildungskursen (in den letzten vier Wochen)
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen Männer Frauen
Männer Frauen
keinen Kurs mindestens einen Kurs
Bauern/Bäuerinnen
Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landw. Arbeitnehmende
Übrige Arbeitnehmende
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
Unter Weiterbildungskursen werden hier nur Formen der beruflichen Weiterbildung verstanden. Die Resultate der männlichen Selbständigen sind ähnlich hoch: Zwischen 10 und 15 % haben mindestens einen Kurs besucht. Während bloss 3 % der befragten Bäuerinnen einen Kurs besuchten, haben über 15 % der übrigen weiblichen Arbeitnehmenden in der Referenzperiode in ihre Weiterbildung investiert. Ein Vergleich mit früheren Jahren ist nicht möglich, da die Referenzperiode geändert hat.
53 1.2 Soziales und Gesellschaft
100 20 40 0 60 80 in %
100 20 40 0 60 80 in
%
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen
1 – 19 20 – 39 40 – 49 50 und mehr
1 in Stunden pro Woche normalerweise geleistete Arbeitszeit
Bei der Arbeitszeit pro Woche werden nur die Stunden der Erwerbsarbeit (Haupterwerb) berücksichtigt –Haushaltsarbeiten werden nicht angerechnet, da die SAKE hier bloss die entlöhnte Arbeit erfasst. Auffallend ist die lange Arbeitszeit der Männer aus der Gruppe «Bauern/Bäuerinnen»: Knapp 70 % von ihnen arbeiten normalerweise über 50 Stunden pro Woche. Bei den anderen selbständigerwerbenden Männern sind es um 40 %. Auch die wöchentliche Erwerbsarbeitszeit ist stark geschlechterabhängig: Männer arbeiten allgemein länger als Frauen. Dies erklärt sich mit dem Teilzeiteffekt, das heisst Frauen arbeiten häufiger nicht Vollzeit. Würden Haushalts- und Betreuungsarbeiten ebenfalls berücksichtigt, würde sich bei den Frauen der Anteil mit 50 und mehr Stunden Arbeitszeit deutlich erhöhen. Bei den Männern der Kategorie «Bauern/ Bäuerinnen» arbeiten 2010 etwa gleich viele 50 und mehr Stunden pro Woche wie 2006, aber mehr als 2001: Damals lag der Anteil jener Bauern, die 50 und mehr Stunden pro Woche arbeiten, noch bei rund 60 %. Bei den Bäuerinnen hingegen ist die Verteilung der hier erfassten Arbeitszeit zwischen 2001 und 2010 etwa gleich geblieben.
Arbeit am Wochenende
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen
Männer Frauen Männer Frauen nie
manchmal Samstag oder Sonntag (unentgeltlich oder entlöhnt)
normalerweise Samstag oder Sonntag
normalerweise Samstag und Sonntag
Bauern/Bäuerinnen
Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landw. Arbeitnehmende
Übrige Arbeitnehmende
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
54 1.2 Soziales und Gesellschaft
Arbeitszeit pro Woche1
100 20 40 0 60 80 in % Bauern/Bäuerinnen Gewerbetreibende
Selbständige
Arbeitnehmende
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
Übrige
Landw. Arbeitnehmende Übrige
100 20 40 0 60 80 in %
Während bei der Kategorie «Gewerbetreibende» 36 % der Männer sowie 38 % der Frauen und bei der Gruppe «übrige Selbständige» 26 % der Männer sowie 46 % der Frauen nie an Wochenenden arbeiten, sind es bei der Gruppe «Bauern/Bäuerinnen» nur 2 % (Männer) resp. 9 % (Frauen). Gegen 70 % resp. 60 % der befragten Bauern und Bäuerinnen geben an, dass sie normalerweise auch am Samstag und Sonntag arbeiten.

Ferientage
Bauern/Bäuerinnen
Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landw. Arbeitnehmende
Übrige Arbeitnehmende
25 5 10 0 15 20 Durchschnittliche Anzahl Ferientage
Quelle: BFS (SAKE 2010, jährliche Daten)
Bei der Anzahl Ferientage werden nur die Angaben der Vollzeiterwerbstätigen berücksichtigt. Eine Aufteilung nach Männer und Frauen war nicht möglich. Die Gruppe «Bauern/Bäuerinnen» macht mit jährlich im Durchschnitt rund acht Tagen klar am wenigsten Ferien. Die Gewerbetreibenden kommen auf 20, die übrigen Selbständigen auf 22 Tage. Die übrigen Arbeitnehmenden haben durchschnittlich 23 Tage Ferien pro Jahr. Für Bauern und Bäuerinnen – insbesondere für jene mit Nutzvieh – ist es im Gegensatz zu den anderen selbständig Erwerbenden nicht einfach, den Betrieb vorübergehend zu schliessen. Die durchschnittliche Anzahl Ferientage der Gruppe «Bauern/Bäuerinnen» ist zwischen 2001 und 2010 von sechs auf acht gestiegen.
55 1.2 Soziales und Gesellschaft
n Fazit
Der grösste Unterschied zwischen der Gruppe «Bauern/Bäuerinnen» und den Vergleichsgruppen besteht nach wie vor bei den Ferien und der Wochenendarbeit. So gingen die Befragten der Kategorie «Bauern/ Bäuerinnen» 2010 im Durchschnitt acht Tage pro Jahr in die Ferien, die übrigen Gruppen durchschnittlich 20 und mehr Tage. Bei den «Bauern/Bäuerinnen» arbeiten bloss 2 % (Männer) resp. 9 % (Frauen) nie an Wochenenden, bei den Vergleichsgruppen sind es weit mehr. Auffallend gross ist auch der Unterschied bei der Arbeitszeit: Fast 70 % der Männer aus der Gruppe «Bauern/Bäuerinnen» arbeiteten 2010 normalerweise 50 und mehr Stunden pro Woche. Bei den anderen selbständigerwerbenden Männern waren es rund 40 %. 2001 lag die normale wöchentliche Arbeitszeit der befragten Bauern erst für rund 60 % bei 50 Stunden und mehr, 2006 hingegen für 72 %. Bei den Bäuerinnen ist die Verteilung der Arbeitszeit stabil geblieben. Bei der Arbeitszeit und beim Bereich Ausbildung sind allgemeine geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen: Die befragten Frauen sind häufiger Teilzeit erwerbstätig und weisen öfters weniger hohe Ausbildungsabschlüsse auf als die befragten Männer.
56 1.2 Soziales und Gesellschaft
1.2.2 Gesellschaft
1.2.2.1 Soziale Dienstleistungen in der Schweizer Landwirtschaft
Mit Sozialen Dienstleistungen in landwirtschaftlichen Familienbetrieben sind alle Betreuungs-, Pflege-, Erziehungs- und Bildungsangebote gemeint, die in landwirtschaftlichen Haushalten erbracht werden. Im Einzelnen geht es um folgende Angebote:
– Betreutes Wohnen und betreutes Arbeiten für Menschen mit Behinderungen;
– Familienbetreuung von Kindern und Jugendlichen;
– Time-outs und befristete pädagogisch motivierte Aufenthalte für Jugendliche;
– Betreuung und Pflege für ältere Personen;
– Menschen in Phasen von Rehabilitation und Ressourcenstärkung, z.B. nach einer Suchterkrankung;
– Schule und Erlebnispädagogik auf dem Bauernhof.
Einen besonderen Wert haben diese Angebote, weil sie den Kontakt zur Tier- und Pflanzenwelt, das Erleben von Tages- und Jahreszeitenrhythmus und die Beteiligung (je nach Kräften und Fähigkeiten) an den anfallenden Arbeiten erlauben. Die Tätigkeiten in der Landwirtschaft sind jahreszeitlich vorgegeben, sie strukturieren den Tag und befriedigen zentrale Bedürfnisse der Menschen. Landwirtschaft ermöglicht Menschen mit kognitiven oder psychischen Einschränkungen die Teilhabe an einer sinnstiftenden Arbeit. Bildungsprozesse können auf einem Landwirtschaftsbetrieb anschaulich und unmittelbar erlebbar vermittelt werden. Sofern die notwendigen Kompetenzen vorhanden sind oder organisiert werden können, sind auch Pflegeplatzierungen in der Landwirtschaft denkbar. Schliesslich bietet eine landwirtschaftliche Familienstruktur – sofern sie intakt ist – auch die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aus besonderen sozialen Situationen im Rahmen von kurz- oder langfristigen Pflegeplatzierungen einzugehen. Typisch für die Betreuungsleistungen in der Schweizer Landwirtschaft ist, dass sie meist in Zusammenarbeit mit Fachleuten einer vermittelnden und unterstützenden Organisation erbracht werden (sogenannte Netzwerkorganisationen, NWO). Sie begleiten die betreuten Personen sozialpädagogisch, wobei hinsichtlich der Qualität und der Intensität in der Begleitung grosse Unterschiede bestehen. Diese NWOs unterstützen die landwirtschaftlichen Familien bei der Betreuungsarbeit, z.B. durch Einführungs- und Weiterbildungskurse, SOS-Management etc.
Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft sind ein Teilaspekt von «Green Care». Unter diesem Begriff werden verschiedene Aktivitäten verstanden, welche Naturaspekte zur Förderung von Wohlbefinden, Lebensqualität, Gesundheitsförderung sowie auch zu Betreuung und Therapie einsetzen. Als Beispiele zu nennen sind Reittherapien für Behinderte oder die Gartentherapie.
n Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft in Europa
Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft erfahren gegenwärtig vermehrt Aufmerksamkeit. Sie sind aus vielen Ländern und unter vielen Begriffen bekannt, so als «Soziale Landwirtschaft» in Deutschland, «Groene Zorg» in den Niederlanden, «Social Farming» oder «Care Farming» in Grossbritannien. 2005 wurde eine europäische Praxisgesellschaft «Farming for Health» gegründet (vgl. http://www.farmingforhealth.org). Diese Arbeitsgemeinschaft organisiert regelmässig Tagungen zur Thematik. Im Rahmen der EU-Forschungsförderung wurde die COST-Action 866 unterstützt. Diese hatte zum Ziel, den Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Themen der Sozialen Landwirtschaft im Zusammenhang mit der Verbesserung der menschlichen Gesundheit und Lebensqualität zu fördern (vgl. http://www.umb.no/greencare).
Im sechsten Rahmenprogramm der EU für Forschung und technologische Entwicklung erhielt das Projekt «Social Services in Multifunctional Farms (SoFar)» eine Förderung. SoFar war ein länderübergreifendes Projekt, das Stärken und Schwächen von sozialer Landwirtschaft in verschiedenen Ländern untersucht und Schlussfolgerungen für eine Strategieentwicklung in den untersuchten Ländern gezogen hat. Es dauerte von 2006 bis 2009 (vgl. http://www.sofar-d.de).
57 1.2 Soziales und Gesellschaft
n Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft in der Schweiz – Ergebnisse einer Befragung
In der Schweiz gibt es keine systematische und umfassende Erfassung von sozialen Dienstleistungen, die von Landwirtschaftsbetrieben erbracht werden. Entsprechend fehlten auch genaue Informationen über die Verbreitung und Bedeutung sozialer Dienstleistungen in der Landwirtschaft.
Die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART hat im Rahmen des Arbeitsprogrammes 2008 bis 2011 mit einer Befragung untersucht, wo und in welcher Form in der Schweiz soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft erbracht werden. Insgesamt wurden der ART von den Netzwerkorganisationen 536 Betriebe gemeldet, die soziale Dienstleistungen erbringen, dazu kamen 15 Betriebe, die auf andere Art und Weise ausfindig gemacht werden konnten. Diesen 551 Betrieben wurde ein Fragebogen zum Thema soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft zugestellt. Ausgefüllt kamen 202 zurück, was einer Rücklaufquote von 37 % entspricht.
Die Betriebe verteilen sich wie folgt auf die fünf Typen von sozialen Dienstleistungen:
1 Neun Betriebe konnten keiner Kategorie zugeordnet werden. Die Verteilung über die Kategorien ist stark von den ermittelten NWO abhängig. Betriebe mit Aktivitäten «Schule auf dem Bauernhof» wurden nicht aktiv gesucht, da mit diesen Aktivitäten vielfach keine Erwerbsabsichten verbunden sind.
Durchschnittlich werden in einem Familienbetrieb seit mehr als neun Jahren soziale Dienstleistungen erbracht. Die betreuten Personen waren aktuell (in den letzten 12 Monaten vor der Befragung) zu drei Vierteln männlich und zu einem Viertel weiblich. In über 90 % der Fälle werden ein bis zwei Personen betreut, meist jedoch nur eine. Wichtige Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche aus schwierigen sozialen Situationen und Menschen mit Behinderungen. Es werden aber auch Rehabilitationsprogramme für Erwachsene mit Suchterkrankungen und Time-Outs für Jugendliche angeboten.
n Betriebe
mit sozialen Dienstleistungen weisen eine höhere Diversifikation auf
Die Betriebsstruktur der 202 Betriebe mit sozialen Dienstleistungen wurde mit Daten der Stichprobe aus der Zusatzbefragung zur Agrarstrukturerhebung des BFS (2005) verglichen.
Insgesamt bewirtschafteten die 202 Betriebe mit sozialen Dienstleistungen ungefähr gleich viel landwirtschaftliche Nutzfläche wie diejenigen der Stichprobe. Höher ist hingegen der Anteil der Spezialkulturen und 25 % der Betriebe produziert nach den Richtlinien des biologischen Landbaus gegenüber 10 % in der Stichprobe.
Deutlich wird bei diesem Vergleich auch, dass Betriebe mit sozialen Dienstleistungen häufiger selber vermarkten, deutlich häufiger Holz be- oder verarbeiten sowie Agrotourismus betreiben. Betriebe mit sozialen Dienstleistungen sind also deutlich stärker diversifiziert. In der Zufallsstichprobe des BFS gehen dagegen deutlich mehr Bewirtschafter/innen und/oder deren Partner/innen einer ausserbetrieblichen Tätigkeit nach (55 %). In Betrieben mit sozialen Dienstleistungen sind es «nur» 39 %.
58 1.2 Soziales und Gesellschaft
Betreuung von Kindern und Jugendlichen 85 Betreuung von Menschen mit Behinderungen 59 Rehabilitation und Ressourcenstärkung nach Erkrankung 32 Schule und Erlebnispädagogik auf dem Bauernhof 14 Pflege von älteren Personen 3 Total 193 1
n Grosser Zeitaufwand für die Betreuungsleistungen
Die befragten Personen wenden im Durchschnitt 27 Stunden pro Woche für Betreuungsleistungen auf. Der Medianwert liegt bei 17 Stunden. Dies bedeutet, dass die Hälfte der befragten Personen 17 oder weniger Stunden einsetzt und der deutlich höhere Mittelwert durch eine Minderheit von befragten Personen entsteht, die weit mehr als 27 Stunden aufwenden. Neben der befragten Person helfen weitere Personen bei der Betreuung mit, in erster Linie ist dies der Partner oder die Partnerin, sowie weitere Personen. Insgesamt werden für die Betreuungsleistungen im Durchschnitt 48 Stunden aufgewendet, der Medianwert liegt bei 30 Stunden.
Die Betreuungsleistungen werden von Bäuerinnen und Bauern wahrgenommen. Dabei leisten die Bäuerinnen rund 60 % der Arbeit. In fast 90 % der Fälle wird die Betreuungsarbeit rund um die Uhr und in über 70 % an sieben Tagen in der Woche geleistet. Rund 50 % der betreuten Menschen bleiben länger als ein Jahr auf dem Hof, wobei dies stark von der Betreuungsform abhängt.
Arbeitszeitaufwand für soziale Dienstleistungen pro Woche
59 1.2 Soziales und Gesellschaft Diversifikation und ausserbetriebliche Tätigkeiten Betriebe mit Sozialen Stichprobe BFS Dienstleistungen in % in % Diversifikation Direktverkauf 34 23 Be- und Verarbeitung von Holz 25 3 Agrotourismus 19 7 Vertragliche Arbeiten 21 19 Verarbeitung 18 17 Erzeugung erneuerbarer Energie 3 4 Handwerk 1 3 Anderes 13 5 Ausserbetriebliche Tätigkeit (Bewirtschafter/in und/oder Partner/in) 39 55 Datenquelle BFS: Zusatzbefragung zur Agrarstrukturerhebung, BFS 2005, N=10 693
Mittelwert Median in Std. in Std. Befragte Person 26,8 17,0 Partner/die Partnerin 17,3 10,0 andere Haushalts- und Familienangehörige 2,9 0,0 Angestellte 0,7 0,0 weitere Personen 0,3 0,0 Total 48,1 30,0
n Finanzielle Aspekte
Zwei Drittel der befragten Betriebe geben an, eine Buchhaltung zu ihren sozialen Dienstleistungen zu führen. Die Angaben der Betriebe in der Befragung zu Kosten und Erlösen sozialer Dienstleistungen variieren stark und nicht alle befragten Personen waren bereit, diese Fragen zu beantworten. Die untenstehenden Zahlen sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren.

Betreuungsleistungen pro Jahr und Jahreserlös
Aus den Angaben geht hervor, dass eine beträchtliche Zahl an Betreuungstagen einem relativ bescheidenen Nettoerlös gegenübersteht. Schwierig in Bezug auf den Betreuungsaufwand ist allerdings die Unterscheidung von effektiver Betreuungszeit und notwendiger Präsenzzeit. Der Nettoerlös aus sozialen Dienstleistungen trägt bei den befragten Haushalten im Durchschnitt knapp einen Viertel zum gesamten Haushalteinkommen bei. Diese letzte Frage beantworteten aber nur noch 79 von 202 befragten Personen.
60 1.2 Soziales und Gesellschaft
Einheit Mittelwert Median Tage mit Betreuungsleistungen Tage 262 300 Bruttoerlös pro Jahr Fr. 27 371 20 000 Nettoerlös pro Jahr Fr. 14 194 10 040
n Positive und negative Effekte der Sozialen Dienstleistungen
Die Bäuerinnen und Bauern bewerten die Beziehung zur betreuten Person überwiegend positiv. So erfährt die Aussage im Fragebogen «Ich habe eine gute Beziehung zu ihm resp. zu ihr» eine hohe Zustimmung. Eher kritisch sieht es bei der Aussage aus «Es kommt von ihm/ihr viel zurück». Die Befragten sind ausserdem der Ansicht, dass die betreute Person gut in die Familie integriert ist.
In der Befragung wurde auch versucht herauszufinden, welche Effekte die Erbringung sozialer Dienstleistungen bei den Bauernfamilien auslösen. So wurde gefragt, ob die Arbeit auf dem Hof damit interessanter geworden, die Befriedigung bei der Arbeit gestiegen sei und die Arbeitszeit besser genutzt werden könne. Insgesamt wird eine positive Wertung vorgenommen, allerdings eher auf moderater Ebene. Gleichzeitig geben die befragten Personen aber auch an, dass die Belastung zugenommen habe. Im Detail wurde gefragt, ob die Arbeitsbelastung, die psychische Belastung oder die Konflikte innerhalb der Familie zugenommen hätten. Durchschnittlich wird vermerkt, dass die Belastungen teilweise zugenommen hätten. Am häufigsten wird dabei die zusätzliche Arbeitsbelastung erwähnt.
n Begleitung durch Netzwerkorganisationen
Die betreuten Personen werden durch Behörden entweder direkt oder über Netzwerkorganisationen in den Familien platziert. Ein Viertel der befragten Personen gibt an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Kontakt mit den Behörden oder mit dem Sozialamt gehabt zu haben; über 90 % gibt aber an, im gleichen Zeitraum Kontakt mit der Netzwerkorganisation gehabt zu haben. Während der Kontakt mit den Netzwerkorganisationen allgemein als sehr gut eingestuft wird, wird die Zusammenarbeit mit den Behörden kritischer wahrgenommen. Auch die Arbeit der Fachpersonen der Netzwerkorganisationen wird insgesamt positiv bewertet.
n Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft in der Schweiz – Ergebnisse von Workshops
Das Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) führte im Jahr 2010 in Zusammenarbeit mit ART verschiedene Workshops durch, in denen die aktuelle Situation von sozialen Dienstleistungen in der Landwirtschaft in der Schweiz analysiert, Verbesserungspotenziale diskutiert und Handlungsmöglichkeiten entwickelt wurden.
Zu den drei Workshops, die 2010 stattfanden, wurden Fachleute aus den verschiedensten Bereichen eingeladen. Dazu zählten Landwirtinnen und Landwirte, die soziale Dienstleistungen erbringen, Personen, die entsprechende Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen, Fachpersonen der Netzwerkorganisationen sowie Behörden- und Verbandsvertreter. Die Teilnehmenden der Workshops waren sich einig, dass für soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft eine Nachfrage besteht und auch bei Landwirtschaftsbetrieben noch zusätzlich Potenzial auf der Angebotsseite da ist. Folgende Massnahmen könnten dazu beitragen, dieses Potenzial besser zu nutzen und bestehende Defizite zu verringern:
– Transparenz zwischen allen Beteiligten verbessern, das heisst Offenlegung von Anforderungen, Entschädigungen, Regelungen und Zuständigkeiten;
– Kommunikation und Vernetzung zwischen allen involvierten Personen verstärken;
– Zentrale Koordinationsstelle aufbauen und betreiben;
– Qualitätssicherungssysteme verbessern; – Ausbildung auf- und ausbauen;
Finanzierungsmodelle vereinfachen und neue Formen entwickeln.
61 1.2 Soziales und Gesellschaft
–
Besondere Bedeutung wurde der Qualitätssicherung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Entlastung von Betreuenden zugemessen. Qualität könnte mit bestehenden Labels gesichert werden, oder es könnte ein eigenes Label zu sozialen Dienstleistungen in der Landwirtschaft erarbeitet werden. Damit soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft besser wahrgenommen und anerkannt werden, sollte eine verstärkte und einheitliche Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Ein erster Schritt dazu ist der Aufbau und Betrieb einer Internetseite über soziale Dienstleistungen im grünen Bereich (vgl. www.greencare.ch). Verbesserungen der Rahmenbedingungen rund um die sozialen Dienstleistungen in der Landwirtschaft könnten helfen, Überlastungssituationen der Anbietenden zu vermeiden, die Entlohnung fair zu gestalten und eine Entwicklung der beteiligten Akteure zu ermöglichen.
n Fazit und Ausblick
Soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft können eine Diversifikationsstrategie für Betriebe darstellen. Neben den notwendigen Kompetenzen und der geeigneten Situation eines Familienbetriebs und dem Einverständnis aller Mitglieder für eine solche Arbeit, bedarf es einer ausgeprägten Bereitschaft, sich auf ein solches Vorhaben einzulassen. Menschen zu betreuen ist mit Erfolgserlebnissen, aber auch mit Rückschlägen verbunden. Dies wirkt sich in der heutigen Form von sozialen Dienstleistungen direkt auf einer sehr persönlichen Beziehungsebene aus. Der Entscheid zu dieser Art Arbeit bedarf gründlicher Abklärungen und sie muss mit grösster Sorgfalt geplant werden. Dazu gehört, Referenzen über die Netzwerkorganisationen einzuholen und deren Leistungen vor Vertragsabschluss gründlich zu prüfen. Nebst Einführungs- und Weiterbildungsangeboten ist die jederzeitige Verfügbarkeit einer fachlichen Beratung unabdingbar. Wird rund um die Uhr betreut, sind Entlastungen an Wochenenden besonders hilfreich.
Soziale Dienstleistungen bieten Landwirtschaftsbetrieben eine Möglichkeit, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Die Anforderungen für diese Art der Diversifikation sind allerdings hoch und dem Ausbau dürften Grenzen gesetzt sein, obwohl die Bäuerinnen und Bauern grundsätzlich in der Lage sind, Betreuungsleistungen zu erbringen. Damit die Qualität der erbrachten Leistungen hoch bleibt und weitere Betriebe für diese Art der Dienstleistung gewonnen werden können, sind eine Reihe von begleitenden Massnahmen notwendig. Ein erster Schritt dazu könnte darin bestehen, die Transparenz innerhalb der aktiv Beteiligten und die Kommunikation gegen aussen zu verbessern. Für die Familienbetriebe wäre es sinnvoll, die Charakteristiken der Familie in einer Art Portfolio gegen aussen darstellen zu können. Dieses könnte dazu beitragen, dass eine zu betreuende Person eine ideale Familie zu ihrer Betreuung findet. Eine zweite Massnahme könnte darin bestehen, die Qualität der geleisteten Arbeit durch die Netzwerkorganisationen sowie durch die Familienbetriebe weiter zu entwickeln, indem Qualitätssicherungssysteme aufgebaut und systematisch implementiert werden. Drittens wäre es wünschbar, wenn die Akteure von sozialen Dienstleistungen die Weiterentwicklung und Sicherung solcher Leistungen durch eine eigene Gesellschaft/Plattform weiter vorantreiben könnten. Diese könnte das Heft für die Weiterentwicklung entsprechender Angebote selbst in die Hand nehmen und vorantreiben.
62 1.2 Soziales und Gesellschaft
1.3 Ökologie und Ethologie
1.3.1 Ökologie
Am Anfang des Kapitels Ökologie steht die Darstellung der Entwicklung verschiedener Indikatoren zur Nutzung des Kulturlandes und zum Einsatz von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln (vgl. Abschnitt 1.3.1.1). Im Anschluss werden entsprechend dem vierjährigen Zyklus nach 2003 und 2007 zum dritten Mal die Themen Klima, Energie und Luft vertieft betrachtet. Die Landwirtschaft ist sowohl Mitverursacherin als auch Betroffene des Klimawandels. Einerseits nimmt sie durch die Freisetzung von Treibhausgasen bzw. Speicherung von Kohlenstoff direkt Einfluss auf die Entwicklung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre, andererseits beeinflussen Klimaänderungen die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen massgebend. Die Klimastrategie Landwirtschaft zeigt diese Zusammenhänge auf und benennt die relevanten Bereiche bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Der Abschnitt 1.3.1.2 Klima orientiert sich an der Klimastrategie und enthält Hintergrundinformationen zu ausgewählten Aspekten.
Im Abschnitt 1.3.1.3 Energie werden der landwirtschaftliche Energiebedarf und die Produktion erneuerbarer Energie in der Landwirtschaft näher unter die Lupe genommen.
Im Abschnitt 1.3.1.4 Luft wird auf die Bedeutung von Dieselruss und Geruch im Zusammenhang mit der Landwirtschaft eingegangen.

63 1.3 Ökologie und Ethologie
1.3.1.1 Flächennutzung und Produktionsmittel
Entwicklung des Anteils der Fläche mit umweltschonender Bewirtschaftung
Quelle:
1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume, vor 1999 nur zu Beiträgen berechtigte ökologische Ausgleichsflächen
Quelle: BLW
64 1.3 Ökologie und Ethologie
in % der LN umweltschonende Bewirtschaftung1 davon Bio
1993 bis 1998: IP+Bio; ab 1999: ÖLN 0 100 90 70 80 60 50 40 30 20 10 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anrechenbare ökologische
in 1 000 ha Berggebiet Talgebiet
BLW 1
Ausgleichsflächen1
0 140 120 100 80 60 40 20 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Entwicklung des Tierbestandes in 1 000 GVE 1 Übrige Schweine Rindvieh
1 GVE: Grossvieheinheit 0 1 600 1 400 1 000 1 200 800 600 400 200 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: BFS
Entwicklung des Mineraldüngerverbrauchs
Entwicklung des
Veredelung
1 Abfälle aus in der Schweiz verarbeiteten Agrarrohstoffen (z.B. Ölsaaten, Braugerste)
Entwicklung der Pflanzenschutzmittelverkäufe
Quelle: SBV
Bis 2005 basierten die Angaben zu den Pflanzenschutzmittelverkaüfen auf Daten der Mitgliedsfirmen der Schweizerischen Gesellschaft für Chemische Industrie. Seit 2006 sind die Daten für alle Firmen, die Pflanzenschutzmittel verkaufen, verfügbar. Diese Werte sind nicht direkt vergleichbar mit der Statistik bis 2005.
Quellen: Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie, BLW
65 1.3 Ökologie und Ethologie
in 1 000 t Stickstoff (N) Phosphat (P2O5)
0 80 70 60 50 40 30 20 10 199092 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: SBV/Agricura
in 1 000 t CH Futtergetreide Kuchen CH Ölsaaten CH andere
Kraftfutterverbrauchs
von Importen1 Importfuttermittel
0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (prov.) 199092
in t Wirkstoff Insektizide Rodentizide Wachstumsregulatoren Fungizide Herbizide
0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Pflanzenschutzmittelverkäufe der SGCI-Firmen
1.3.1.2 Klima
n Klimastrategie Landwirtschaft
Das sich verändernde Klima stellt eine der grossen globalen Herausforderungen dieses Jahrhunderts dar. Die steigenden Temperaturen und die veränderten Niederschlagsverhältnisse haben Folgen für die Wetterereignisse, das pflanzliche Wachstum, den Wasserhaushalt von Regionen, die Verbreitung von Arten, die menschliche Gesundheit, und vieles mehr. Dies zieht Veränderungen in der Produktion von Nahrungsmitteln, in der Energiegewinnung, in Siedlungsstrukturen und in verschiedenen Wirtschaftszweigen wie z.B. im Tourismus nach sich. Um die Erwärmung der Erde zu begrenzen und irreversible Schäden an Ökosystemen zu verhindern, sind Gesellschaft und Politik wie auch Wirtschaft und Technik gefordert, neue Ansätze zu entwickeln. Auch die Anpassung an die sich verändernden Lebensbedingungen braucht neue Ideen und Efforts.
Internationale Verhandlungen für ein griffiges Abkommen sind im Gang
Mit der Unterzeichnung der UNO-Rahmenkonvention zum Schutz des Klimas (UNFCCC) im Jahr 1992 hat sich die Schweiz verpflichtet, einen Beitrag zur Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen zu leisten. Um die Massnahmen zum Klimaschutz der UNO-Rahmenkonvention zu konkretisieren, wurde am Weltklimagipfel 1997 das Kyoto-Protokoll verabschiedet. Darin vereinbaren 192 Vertragsstaaten, wie viele Treibhausgase sie emittieren dürfen, und zu welchen Emissionsreduktionszielen sie sich verpflichten.
Das Kyoto-Protokoll verlangt von den Vertragsparteien, rechtzeitig Verhandlungen über weiter gehende Reduktionsziele aufzunehmen. An der Klimakonferenz 2010 anerkannte die Staatengemeinschaft das Ziel, den globalen Temperaturanstieg unter der kritischen Schwelle von 2 °C zu halten. Dazu sind weltweit einschneidende Reduktionsanstrengungen erforderlich. Bis Ende des 21. Jahrhunderts dürfen je nach Bevölkerungswachstum pro Kopf jährlich noch 1 bis 1,5 t Kohlendioxid-Äquivalente (CO2eq) ausgestossen werden. Bis Mitte Jahrhundert sind die weltweiten Treibhausgasemissionen gegenüber dem Stand von 1990 mindestens zu halbieren. Für die Industriestaaten bedeutet dies gemäss dem Weltklimarat (IPCC) eine Absenkung des Emissionsniveaus um 85 bis 95 %. Aber auch die Entwicklungsländer müssen einen substanziellen Beitrag leisten.
Der Anteil der landwirtschaftlichen Produktion an den weltweiten Emissionen beträgt ungefähr 14 %. Werden zusätzlich die Emissionen aus der Nutzung fossiler Kraftstoffe für den landwirtschaftlichen Betrieb, aus der Herstellung von Agrochemikalien und der Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft hinzugezählt, fällt der Anteil mit 17 bis 32 % noch wesentlich höher aus. Die landwirtschaftliche Produktion wird deshalb in den kommenden internationalen Verhandlungsrunden ein wichtiges Thema sein. Es soll ein Arbeitsprogramm lanciert werden, welches spezifisch auf die Herausforderungen und Möglichkeiten bezüglich Treibhausgasemissionsminderung in der Landwirtschaft ausgerichtet ist. Zudem ist es wahrscheinlich, dass die Diskussion um das umfassende und obligatorische Ausweisen von Emissionen aus der land- und forstwirtschaftlichen Landnutzung wieder aufgegriffen wird. Die Schweiz setzt sich für eine Senkung der landwirtschaftlichen Emissionen ein, wobei die Nachhaltigkeit und die Ernährungssicherheit gewährleistet bleiben müssen.
66 1.3 Ökologie und Ethologie
Nationale Klimapolitik wird neu festgelegt
Die Klimapolitik der Schweiz stützt sich hauptsächlich auf das CO2-Gesetz, das seit 1. Mai 2000 in Kraft ist und im Einklang mit dem Kyoto-Protokoll die CO2-Emissionen aus fossilen Energien für den Zeitraum 2008–2012 begrenzt. Derzeit ist eine Vorlage zur Revision des CO2-Gesetzes mit neuen Reduktionszielen und mit Massnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2012 in der parlamentarischen Beratung. Die Vorlage umfasst neu alle Treibhausgase, also auch die vorwiegend aus der Landwirtschaft stammenden Gase Methan und Lachgas. Im Gegensatz zu den anderen Sektoren sind für die Landwirtschaft in der Botschaft keine verbindlichen emissionsreduzierenden Massnahmen vorgesehen. Hingegen wird auf die Klimastrategie Landwirtschaft und die mögliche Umsetzung von Massnahmen im Rahmen der Weiterentwicklung der Agrarpolitik verwiesen.
Viele Auswirkungen der Klimaänderung lassen sich selbst bei einer raschen und weitreichenden Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen nicht vollständig verhindern. Es ist deshalb vorgesehen, dass nebst der Reduktion der Treibhausgasemissionen auch die Anpassung an die Folgen der Klimaänderung ein Bestandteil der künftigen Schweizer Klimapolitik sein soll. Verschiedene Sektoren und Politikbereiche sind betroffen, wobei zahlreiche Schnittstellen zu landwirtschaftlichen Fragen, insbesondere bezüglich der Wassernutzung (Trinkwasser, Energieproduktion, Bewässerung), des Raumbedarfs (Hochwasserschutz, Biodiversität, landwirtschaftliche Produktionsgrundlage) oder zum Monitoring (z.B. Früherkennung von Schadorganismen) bestehen. Auf Bundesebene wird zurzeit eine Anpassungsstrategie erarbeitet, welche Möglichkeiten zur Nutzung von Synergien und Lösungen für Zielkonflikte aufzeigen soll.
Klimastrategie Landwirtschaft setzt Schwerpunkte
Um eine Gesamtsicht über die Beziehungen zwischen Klima und Landwirtschaft zu gewinnen, kommende Herausforderungen und Chancen durch den Klimawandel frühzeitig zu erkennen und daraus entsprechende Schritte ableiten zu können, wurde vom BLW unter breiter Mitwirkung von Verwaltung (Bund, Kantone), Forschung, Beratung und Verbänden eine Klimastrategie erarbeitet. Die Ende Mai dieses Jahres veröffentlichte Strategie legt den Fokus auf die Landwirtschaft, in Anlehnung an das Diskussionspapier «Land- und Ernährungswirtschaft 2025» werden jedoch auch vor- und nachgelagerte Bereiche inkl. der Konsum von Lebensmitteln einbezogen. Sie richtet sich an die Landwirtschaft und das landwirtschaftliche Wissenssystem (Forschung, Bildung, Beratung). Darüber hinaus werden auch die Bereitsteller von Produktionsmitteln (Landtechnik, chemische Industrie, Pflanzen- und Tierzucht etc.), der nachgelagerte Bereich (Handel, Verarbeitung und Konsum etc.) und weitere relevante Kreise angesprochen.
Die Klimastrategie gibt der schweizerischen Land- und Ernährungswirtschaft im Hinblick auf ihre Bemühungen zur Minderung ihrer Treibhausgasemissionen und bei ihrem Anpassungsprozess Leitlinien vor und setzt langfristige Vorgaben und Schwerpunkte in Form von Ober- und Teilzielen. Durch eine vorausschauende Anpassung an den Klimawandel soll es der Landwirtschaft gelingen, ihre Produktion und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen langfristig zu steigern. Bezüglich Reduktion der Treibhausgasemissionenbesteht das Ziel aus zwei aufeinander aufbauendenTeilen: Im ersten Teil soll der Ausstoss an klimaschädlichen Gasen in der Landwirtschaft bis 2050 um mindestens einen Drittel reduziert werden. Im zweiten Teil wird die Entwicklung der Konsummuster mit einbezogen: Im Bereich Ernährung (Produktion und Konsum) soll eine Reduktion von insgesamt zwei Dritteln erreicht werden. Das Ziel ist ambitiös, im langen Zeitraum aber realistisch. Es beinhaltet den Aspekt der Ernährungssicherheit und leitet sich aus dem 2-Grad-Ziel ab, das die internationale Staatengemeinschaft verfolgt. Damit leistet die Land- und Ernährungswirtschaft ihren Beitrag an eine nachhaltige Gesellschaft.
Das Oberziel wird auf Teilziele zu relevanten Bereichen herunter gebrochen. Es handelt sich um wichtige Stellschrauben des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel.
67 1.3 Ökologie und Ethologie
Relevante Bereiche für die Minderung von Treibhausgasemissionen und die Anpassung an den Klimawandel
Treibhausgasemissionen
Landwirtschaft inkl. Vorketten nachgelagert
Düngermanagement Tierproduktion
Bodenbewirtschaftung
Energienutzung Energieproduktion
Verarbeitung
Handel
Minderung und Anpassung
Trockenheit Starkniederschläge Standorteignung
Hitzestress Schadorgansimen Preisvolatilitäten
Konsum Entsorgung
Landwirtschaft inkl. Vorketten nachgelagert
Auswirkungen des Klimawandels

Quelle: BLW
Im Folgenden wird eine Auswahl dieser Bereiche genauer beleuchtet. Nach einer Präsentation der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft werden Ansätze zu deren Minderung in der Tierproduktion und der Bodenbewirtschaftung vorgestellt. Bei den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft wird auf die Vegetationslänge (Aspekt der Standorteignung) und die Trockenheit eingegangen.
68 1.3 Ökologie und Ethologie
n Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft
Wichtigste Treibhausgase aus der Landwirtschaft sind Methan und Lachgas
Die Treibhausgasemissionen werden mit Hilfe von standardisierten Methoden nach den Vorgaben der Klimakonvention im nationalen Treibhausgasinventar erfasst. Gemäss diesem Inventar hat die schweizerische Landwirtschaft 2009 5,6 Mio. t CO2eq emittiert, was gut 10 % der Gesamtemissionen der Schweiz entspricht. Höhere Anteile gehen auf das Konto von Verkehr (rund 30 %), Industrie und Haushalte (je rund 20 %). Im Unterschied zu den meisten Wirtschaftssektoren ist der Anteil der Landwirtschaft an den fossilen CO2-Emissionen gering. Hingegen ist die Landwirtschaft bei den Methan- und Lachgasemissionen die Hauptverursacherin: Knapp 85 % der Methanemissionen und 80 % der Lachgasemissionen stammen aus der Landwirtschaft.
Die Emissionen von Methan (CH4) sind auf die Verdauung durch die Nutztiere (insbesondere Wiederkäuer) sowie die Hofdüngerbewirtschaftung zurückzuführen, wobei Letztere auch zu den Lachgasemissionen beiträgt. Direkte und indirekte Emissionen von Lachgas (N2O) entstehen ausserdem durch die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Böden, insbesondere durch die Ausbringung von stickstoffhaltigen Düngern. Stickstoffverluste in Form von Stickoxid, Nitrat und Ammoniak bilden die Ursache für indirekte Lachgasemissionen.
Darüber hinaus stehen weitere Treibhausgasemissionen in Verbindung mit der Landwirtschaft. Die Emissionen in Form von Kohlenstoffdioxid (CO 2), welche bei der Verbrennung fossiler Treib- und Brennstoffe entstehen, werden gemäss den Vorgaben der Klimakonvention in der Kategorie «Energie» bilanziert. 2009 wurden diese Emissionen für die Schweiz inkl. Forstwirtschaft auf 0,6 Mio. t CO2 beziffert. CO2 wird auch – beeinflusst durch Landnutzung (Bodenbearbeitung, Düngung, Fruchtfolge) und Landnutzungsänderungen – von landwirtschaftlichen Böden aufgenommen oder freigesetzt. Die entsprechenden Emissionen werden unter der Kategorie «land use, land use change and forestry» (LULUCF) aufgeführt. Für das Jahr 2009 wies die Schweiz Netto-Emissionen von 0,8 Mio. t CO2 aus.
Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, nach Gas und Kategorie gemäss nationalem Inventar der Schweiz 2009
(LULUCF)
Produktion
Die Bilanzierung im Inventar erfolgt aus einer Produktionsperspektive und nach dem Territorialprinzip, d.h. die Emissionen werden dem direkten Verursacher belastet und es sind nur die Emissionen, die in der Schweiz entstehen, enthalten. Im Sinne einer umfassenden Betrachtung müssen auch die grauen Emissionen, die mit der Herstellung und Bereitstellung von Vorleistungen verbunden sind (z.B. Dünger), bzw. der Saldo aus Importen minus Exporten (z.B. bei den Futtermitteln) dazugerechnet werden.
69 1.3 Ökologie und Ethologie
Mio. t CO 2 eq
0 1 3 2 4 7 6 5 Grünland
Energieeinsatz
Landwirtschaftliche
CO2 N2O CH4 Ackerland Energienutzung Bewirtschaftung Böden Bewirtschaftung Hofdünger Verdauung Nutztiere 0,3 0,4 0,6 2,1 2,5 0,6 0,3
Quelle: BAFU
Landnutzung
fossil
Schliesslich fallen auch in den der landwirtschaftlichen Produktion nachgelagerten Bereichen, in Verarbeitung, Handel, Konsum und Entsorgung, relevante Emissionen an, welche es für eine Aufstellung aller mit der Ernährung im Zusammenhang stehender Emissionen zu berücksichtigen gilt. Gerade beim Nahrungsmittelkonsum ist auch die Import-Export-Statistik von Bedeutung. Gemäss einer Studie des BAFU (2011) verursacht die Endnachfrage nach Nahrungsmitteln in der Schweiz im Inland Emissionen in der Höhe von rund 5,8 Mio. t CO2eq. Weitere 8,6 Mio. t CO2eq fallen im Ausland an. Insgesamt weist die Ernährung gemäss der Betrachtung aus einer Konsumperspektive einen Anteil von 17 % an den insgesamt rund 91 Mio. t CO2eq durch die inländische Endnachfrage verursachten Treibhausgasemissionen auf.
Treibhausgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft sind insgesamt rückläufig
Zwischen 1990 und 2009 haben sich die landwirtschaftlichen Emissionen in Form von Methan und Lachgas um gut 8 % verringert. Dieser Rückgang ist insbesondere auf die Reduktion des Rindviehbestandes und auf den verminderten Einsatz von mineralischen Stickstoffdüngern zurückzuführen. Die Abnahme ist im Wesentlichen vor 2003 erfolgt. Zwischen 2004 und 2008 kann, bedingt durch eine entsprechende Entwicklung der Rindviehzahlen, eine leichte Zunahme beobachtet werden. 2009 haben die Werte im Vergleich zum Vorjahr wieder abgenommen.
Entwicklung von Treibhausemissionen, Rindviehbestand und Mineraldüngereinsatz in der Schweiz
Kyotoziel (Gesamtemissionen)
Unterschiedliche Emissionen im internationalen Vergleich
Bei den Anteilen an Treibhausgasen aus der Landwirtschaft (ohne energiebedingte CO 2-Emissionen und Emissionen aus Landnutzungsänderungen) zeigen sich im Vergleich einzelner OECD-Länder erhebliche Differenzen. Während in Neuseeland die Landwirtschaft im Jahr 2008 über 45 % zu den gesamten Treibhaushausgasemissionen betrug, waren es in Japan nur 2 %. Die Schweiz lag mit einem Anteil von gut 10 % im Mittelfeld.
70 1.3 Ökologie und Ethologie
Index (199 0 = 100) Quelle: BAFU 65 105 100 95 85 90 75 70 80 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Gesamtemissionen Schweiz Methan Landwirtschaft Lachgas Landwirtschaft
Rindviehbestand Mineraldüngereinsatz
Anteil der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen an den Gesamtemissionen in ausgewählten Ländern der OECD, 2008
Japan Deutschland Italien
Österreich
Frankreich Schweiz Australien
Neuseeland USA
50 10 20 0 30 40 in %
Ökobilanzierung von Landwirtschaftsbetrieben zeigt keinen grundsätzlichen Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit
Um das Treibhauspotenzial und andere potenzielle Umweltwirkungen von Schweizer Landwirtschaftsbetrieben zu untersuchen, startete das BLW im Jahr 2004 das Projekt «Zentrale Auswertung von Ökobilanzen landwirtschaftlicher Betriebe» (Hersener et al., 2011). Die untersuchte Einheit des Projekts war der landwirtschaftliche Betrieb, die Systemgrenze wurde am Hoftor gezogen. Für alle Betriebe lag neben dem ökologischen Datensatz ein umfangreicher Satz an ökonomischen Daten aus der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten vor. In der Auswahl der Betriebe wurden verschiedene Betriebstypen, Landbauformen (ÖLN, Bio) und Regionen (Tal, Hügel, Berg) berücksichtigt. Von insgesamt 105 Betrieben wurden die Daten des Betriebsjahrs 2008 ausgewertet. Die betrieblichen Ökobilanzen wurden mit Hilfe der durch Agroscope ART an die schweizerische Landwirtschaft angepasste Ökobilanzierungsmethode SALCA berechnet. Im Folgenden wird nur auf die Ergebnisse der Umweltwirkung «Treibhauspotenzial» von Verkehrsmilchbetrieben eingegangen. Vor einer abschliessenden Beurteilung eines Systems müssen allerdings auch die anderen Umweltwirkungen betrachtet werden.
Die Studie fand, dass mit der Produktion von einem Kilogramm Milch – einem der wichtigsten Produkte der Schweizer Landwirtschaft – im Schnitt 1,3 kg CO2eq erzeugt wurden. Die Emissionen aus dem Anbau und Zukauf von Kraft- und Raufutter sowie aus der Aufzucht der Jungtiere sind hier mit eingerechnet. BioMilch und Milch von ÖLN-Betrieben unterschieden sich nicht bezüglich ihres Treibhauspotenzials. Betriebe, die hohe Milchmengen produzierten, hatten ein tendenziell tieferes Treibhauspotenzial pro kg Milch als Betriebe mit tiefen Milchmengen. Entscheidend dafür war, dass sich das Grund-Treibhausgaspotenzial eines Tieres auf eine grössere Milchmenge verteilte.
Ein grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen Arbeitsverdienst und Klimaschutz war nicht vorhanden: Zwischen ökonomischem Erfolg, gemessen am Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft, und Treibhauspotenzial konnte über die gesamte Stichprobe gesehen kein Zusammenhang festgestellt werden.
71 1.3 Ökologie und Ethologie
Quelle: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Zusammenhang zwischen dem Treibhauspotenzial und dem Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft für Verkehrsmilchbetriebe
Das Treibhauspotenzial der untersuchten Betriebe zeichnete sich durch eine hohe Variabilität aus, auch innerhalb desselben Betriebstyps. Die Gründe für das gute oder schlechte Abschneiden innerhalb der Betriebstypen waren vielfältig, allgemein gültige Empfehlungen lassen sich daher nicht direkt ableiten. Um das tatsächliche Optimierungspotenzial zu identifizieren, müssen die Betriebe individuell analysiert werden.

1.3 Ökologie und Ethologie
Treibhauspotenzial kg CO 2 eq pro ha LN Quelle: Hersener et al., 2011 2 000 0 20 000 18 000 16 000 14 000 10 000 12 000 4 000 8 000 6 000 –25 000 0 25 000 50 000 75 000 100 000 BIO ÖLN BIO ÖLN Treibhauspotenzial kg CO 2 eq pro MJ verd. Energie 0,2 0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 –25 000 0 25 000 50 000 75 000 100 000 Arbeitsverdienst Fr. je Familienarbeitskraft Arbeitsverdienst Fr. je Familienarbeitskraft
n Reduktion von Treibhausgasen
Natürlicher Futterzusatz reduziert Methanemissionen von Wiederkäuern
Ein beträchtlicher Anteil der landwirtschaftlichen Treibhausgase stammt vom Methan, das bei der Verdauung in den Mägen von Wiederkäuern entsteht. In einem mehrjährigen Versuch der ETH werden zurzeit verschiedene für die Schweiz typische Rationen sowie in der Schweiz kultivierbare Futterpflanzen auf ihr Methanbildungspotenzial in unterschiedlichen Wiederkäuer-Produktionssystemen hin getestet. In diesem Rahmen wird auch das Methanreduktionspotenzial natürlicher Futterzusätze geprüft. Die Daten zur Erhebung der Methanemissionen der Tiere werden an der ETH Forschungsstation Chamau in Respirationskammern erhoben. In diesen Kammern wird der gesamte Gaswechsel (CO2, O2 und CH4) der Tiere quantifiziert. Gleichzeitig werden Futterverzehr und -verwertung sowie Milch- und Mastleistung erhoben. Damit kann sichergestellt werden, dass getestete Strategien zur Methansenkung nicht aufgrund einer schlechteren Futterverwertung respektive nur mit tieferer Leistung erreicht werden.
Entgegen den Erwartungen erwies sich das Methanbildungspotenzial der Grassilagemast im Vergleich zur Maissilagemast als nur wenig höher. Unter den getesteten Zusätzen scheint die Zugabe von Tannin-Extrakt aus der Rinde einer Akazienart (natürliches Handelsprodukt) besonders Erfolg versprechend. Gegenüber einer Ration ohne diesen Zusatz konnte bei Mastmuni eine Methansenkung von bis zu 36 % erreicht werden. Hingegen haben die natürlichen Zusätze Knoblauch, Maca und Lupinen zu keiner signifikant niedrigeren Methanemission geführt.
Der zugesetzte Tannin-Extrakt konnte die Methanemissionen auch nach einer Fütterungsdauer von etwa 11 Monaten noch deutlich senken. Somit muss keine Adaptation der Pansenmikroben auf diesen Zusatz befürchtet werden. Beim Einsatz von Tanninen sind auch keine höheren Methanemissionen aus der Gülle zu befürchten, denn diese waren mit denen aus der Gülle der Tiere vergleichbar, welche keine Zusätze erhielten. Zu den Pflanzen, welche erhöhte Mengen an Tannin enthalten, gehören neben gewissen Akazien u.a. auch der Hornklee und die Esparsette. Anbau und Verfütterung von solchen Futterpflanzen und Extrakten könnte daher eine interessante Lösung darstellen. Ihre möglicherweise methansenkende Wirkung ist zurzeit allerdings noch nicht belegt.
Ganzheitliche Ansätze im Tierhaltungssystem zur Reduktion von Emissionen
Im biologischen Landbau werden zur Minderung der Treibhausgasemissionen aus der Rinderhaltung Ansätze verfolgt, die ökologische, sozioökonomische und tierethische Aspekte berücksichtigen. In der Milchproduktion wird das Ziel einer artgerecht gefütterten, früh fruchtbaren, gesunden und langlebigen Kuh angestrebt, die ihren Grund-Treibhausgasausstoss auf eine hohe Lebensleistung von Milch und Fleisch verteilen kann und so auf ein tiefes Treibhauspotenzial pro Produkte-Kilogramm kommt.
Im Projekt «pro-Q» des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) wurde die Milchleistung von Kühen in Abhängigkeit der Laktationszahl untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Milchleistung erst nach 4–5 Laktationen ihr Maximum erreicht. Die durchschnittliche Schweizer Milchkuh ist heute jedoch nur während 3,3 Laktationen produktiv. Bei einer Erhöhung der Nutzungsdauer um eine Laktation auf 4,3 könnte die Remontierungsrate von heute 30 % auf 23 % gesenkt werden. Dies wäre eine effiziente Strategie, um die produktbezogenen Treibhausgasemissionen in der Rinderhaltung zu verringern. Nach zwei Jahren der Begleitung im Rahmen des Projektes konnte bei den teilnehmenden Biobetrieben die Nutzungsdauer von 3,3 signifikant auf 3,5 Laktationen angehoben werden (Ivemeyer et al., 2008).
In den letzten 25 Jahren ist die durchschnittliche Milchleistung pro Kuh in der Schweiz um fast 70 % gestiegen. Dies war möglich durch beachtliche Erfolge in der Züchtung und durch die Intensivierung der Fütterung – mehr Kraftfutter in der Ration – auch im Biolandbau. Das FiBL-Projekt «Feed no Food» untersucht nun, ob der Anteil an Kraftfutter in der Ration gesenkt werden kann, ohne dass Tiergesundheit und Leistungsparameter unserer heutigen Hochleistungskühe darunter leiden. Dieser Ansatz ist interessant, weil so die Tiere keine Konkurrenz um energiereiches Getreide für die menschliche Ernährung darstellen.
73 1.3 Ökologie und Ethologie
In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen zur Vollweidestrategie der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL) sowie zur Grasmilch von IP Suisse, welche primär auf die Nutzung der schweizerischen Futtergrundlage von Wiesen und Weiden setzen. Im Vordergrund stehen hier das Senken der Kosten sowie eine bei den Konsumierenden anerkannte Milchqualität, welche sich von der unter Preisdruck stehenden Massenmilch unterscheidet. Eine konsequent verfolgte low-input-Strategie könnte neben den anderen Aspekten der Nachhaltigkeit auch für das Klima eine vielversprechende Alternative zur kraftfutterbasierten Hochleistungsstrategie sein.
Der Boden als Quelle und Senke für Kohlenstoff
Global stellen die Böden einen wichtigen Humus- und damit Kohlenstoffspeicher dar, der mit der menschlichen Nutzung und dem Klima in Beziehung steht. Historisch haben die meisten Böden durch die Urbarmachung Humus verloren und damit CO2 an die Atmosphäre abgegeben. Auch die heutige Bewirtschaftung der Böden beeinflusst die Stoffkreisläufe und Humusgehalte. Damit stellen genutzte Böden je nach Art und Intensität der Bewirtschaftung potenzielle Quellen oder Senken für atmosphärisches CO2 dar.
Bewirtschaftete Moorflächen. Eine bedeutende landwirtschaftliche CO2-Quelle, die auch im nationalen Treibhausgasinventar ausgewiesen wird, stellen die entwässerten ehemaligen Hoch- und Flachmoore der Schweiz dar. Insbesondere die Jura-Gewässerkorrekturen und die darauf folgende intensive Landbewirtschaftung im Seeland haben zu einer Absenkung der Oberfläche durch Torfzehrung und Sackung geführt, Prozesse die heute noch stattfinden. Dieser Torfverzehr durch Oxidation der organischen Bodensubstanz (Humus) dauert so lange an, bis der Wasserspiegel erreicht ist. Insgesamt sind im Seeland seit der ersten Entwässerung 1864 je ha zwischen 350 und 770 t Kohlenstoff verloren gegangen und damit der Atmosphäre jährlich 9 bis 20 t CO2 zugeführt worden (Leifeld et al., 2011). Ähnlich starke Effekte weisen auch entwässerte Hochmoore in den Voralpen auf, wo die bisherigen Verluste zwischen 120 und 650 t Kohlenstoff je ha (434 – 2 351 t CO2) betragen. Mit diesen Emissionen gehören entwässerte ehemalige Moorlandschaften zu den bedeutendsten Treibhausgasquellen landwirtschaftlich genutzter Gebiete. Möchte man verhindern, dass solche Gebiete weiterhin grosse Mengen an CO2 emittieren, müssten sie durch die Anhebung und Regulierung des Grundwasserstandes renaturiert werden. Bei der Renaturierung ist allerdings zu beachten, dass es vorübergehend zu erhöhten Methanemissionen kommen kann, die jedoch durch eine gute Grundwasserregulierung niedrig gehalten werden können.
Bewirtschaftung von Grünland. In der Grünlandwirtschaft hängen die Humusgehalte im Boden stark von der Nutzungsintensität (Düngung, Schnitthäufigkeit) ab. Die Wirkung der Nutzungsintensität auf den im Boden verbleibenden Kohlenstoff wurde durch Agroscope ART in einem langjährigen Feldversuch auf einem ertragreichen Standort im Schweizer Mittelland (Oensingen, SO) untersucht. Über mehrere Beobachtungsjahre wurden Abgabe und Aufnahme von CO2 durch eine Wiese kontinuierlich gemessen und daraus die Veränderung des Kohlenstoffvorrats im Boden berechnet (Ammann et al., 2009). Die Ergebnisse für die ersten 6½ Jahre nach Ansaat zeigen, dass sich eine intensive Nutzung mit vier bis fünf Schnitten und starker, hauptsächlich organischer Düngung im Gegensatz zu einer extensiven Nutzung (3 Schnitte) ohne Düngung positiv auf die Entwicklung des Kohlenstoffvorrats im Boden auswirkt. Diese Veränderung im Kohlenstoffvorrat konnte durch direkte Messung des Bodenkohlenstoffgehalts bestätigt werden. Verantwortlich dafür sind die verstärkte Bildung von unterirdischer Biomasse aufgrund der erhöhten Pflanzenproduktivität sowie der Eintrag von organischem Material mit der Düngung im intensiven und die erhöhte Bodenatmung im extensiven System. In der gesamten Treibhausgasbilanz wird diese positive Wirkung der intensiven Bewirtschaftung allerdings durch die Emission von N2O aus der Düngung und die CO2-Emission der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen etwas vermindert.
74 1.3 Ökologie und Ethologie
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Landnutzung und deren Änderung, wie z.B. die Umstellung von Acker auf Grünland, über die Veränderung der CO2-Bilanz für die Klimaentwicklung wichtig sein können. Aus Sicht des Klimaschutzes kann eine intensive Nutzung, wenn sie an den Standort angepasst ist, gegenüber einer Extensivierung von Vorteil sein. Für eine Treibhausgasbilanz des gesamten Grünland-Produktionssystems (Milch und Fleisch) müssen zusätzlich der Methanausstoss der Wiederkäuer, welche das Futter der Wiese verwerten, sowie andere Emissionen bei der Stallhaltung und auch der Energieverbrauch für die Herstellung der Produktionsmittel mit in die Berechnungen einbezogen werden.
Ackerbau. Im Ackerbau spielen neben der Fruchtfolge vor allem Art und Menge der Dünger sowie die Bewirtschaftung der Ernterückstände eine entscheidende Rolle für die Veränderung des Boden-Kohlenstoffvorrats. Die organische Düngung führt den vom Feld exportierten und in der Ernte gespeicherten Kohlenstoff teilweise zurück. Der biologische Landbau ist stärker als der konventionelle darauf angewiesen, dass besonders viele der in organischen Düngern enthaltenen Nährstoffe dem System Boden-Pflanze wieder zugeführt werden. Damit hat diese Landbauform in Bezug auf den Bodenkohlenstoff gegenüber dem konventionellen Anbau mit hauptsächlich mineralischer Düngung eine vorteilhafte Wirkung. Bei vergleichbarem Hofdüngereinsatz unterscheiden sich allerdings die zeitlichen Veränderungen der Kohlenstoffgehalte von biologisch und konventionell bewirtschafteten Flächen langfristig nicht, wie Daten von ART aus dem gemeinsam mit dem FIBL durchgeführten, langjährigen DOK-Versuch zeigen (Leifeld et al., 2009). In allen Bewirtschaftungsvarianten nahm der Bodenkohlenstoffgehalt zwischen 1977 und 2004 deutlich ab, am wenigsten bei den rein organisch gedüngten Feldern und am meisten bei den Feldern ohne Düngung. Die unterschiedlichen Ausgangswerte im Jahr 1977 entstanden durch die Inhomogenität des Versuchsfeldes und nicht durch die Bewirtschaftungsvarianten.
Bodenkohlenstoffgehalte von fünf Bewirtschaftungsvarianten in den Jahren 1977 und 2004 im DOK-Versuch
NOFERT ungedüngte Kontrolle
konventionell mit Mineraldünger
biologisch-dynamisch
biologisch-organisch
konventionell mit Mineraldünger und Mist
1977 2004
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
75 1.3 Ökologie und Ethologie 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008
g C / m 2
Kumulative Veränderung des Kohlenstoffvorrats im Grünland in Oensingen, SO
– 600 0 – 200 – 400 400 200 800 600 1 000 1 200 Wiese intensiv Wiese extensiv
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
t C / ha, 0–20 cm
0 60 50 40 30 20 10 NOFERT CONMIN BIODYN BIOORG CONFYM
CONMIN
BIODYN
BIOORG
CONFYM
Reduzierte Bodenbearbeitung. Die pfluglose Bodenbearbeitung gilt allgemein als klimafreundlich, weil die Biomasse von Wurzeln, Ernterückständen und organischer Düngung länger im Kohlenstoff-Pool des Bodens bleibt als bei einer Bearbeitung mit dem Pflug. Zudem kann Treibstoff eingespart werden, wenn der Boden nicht gewendet wird. Im biologischen Landbau ist der pfluglose Anbau eine besondere Herausforderung, dient doch die tiefe Bodenbearbeitung auch der Unkrautregulierung. Im Rahmen des Projekts «Klimaneutraler Acker- und Gemüsebau» untersuchte das FiBL, wieweit eine Reduktion der Bodenbearbeitung im biologischen Landbau möglich ist, und wie sie sich auf Ertrag, Kohlenstoffgehalt im Boden und Klimabilanz auswirkt. In einem Langzeit-Feldversuch in Frick (AG) wurde der Boden im Verfahren mit reduzierter Bodenbearbeitung nicht mehr gewendet, sondern nur noch in Tiefen von 10–15 cm gelockert. Mit Hilfe von breitflächig schneidenden Grubberscharen wurden dabei Unkrautwurzeln durchschnitten. Die nachfolgende (zapfwellengetriebene) Bodenbearbeitung sorgte für eine gute Saatbettbereitung. In dem seit 2002 laufenden Versuch konnten die Humusgehalte in der obersten Bodenschicht (0–10 cm) mit diesem Ansatz um 17 % erhöht und die Pflanzenerträge gegenüber dem Pflugverfahren stabilisiert und im Schnitt über alle Jahre sogar um 13 % gesteigert werden (Gadermaier et al., 2011). Diese Resultate sind ermutigend. Laufende Versuche auf rund einem Dutzend Betriebe im Mittelland und in der Westschweiz sollen weitere Erkenntnisse liefern.
Anwendung von Biokohle. Eine Technik, die weltweit auf wachsendes Interesse stösst, ist die Anwendung von Biokohle (Biochar), einem Pyrolyseprodukt verschiedener organischer Ausgangsmaterialien (Holz, Stroh, Grünschnitt etc.) ähnlich normaler Holzkohle. Die Idee geht auf die Ureinwohner am Amazonas zurück, die in traditionellen Kohlemeilern Holz sowie pflanzliche und tierische Abfälle zu Holzkohle verschwelt und danach zur dauerhaften Fruchtbarmachung der nährstoffarmen Böden genutzt haben. Biokohle wird dem Boden zur Verbesserung von Nährstoffhaushalt, Wasserrückhaltung, Bodenstabilität und mikrobieller Aktivität zugesetzt. Auch können durch Biokohle die stabilen Boden-Kohlenstoffvorräte gesteigert (C-Sequestrierung) und dadurch CO2-Emissionen dauerhaft kompensiert werden, da Teile der Biokohle über mehrere 1 000 Jahre im Boden erhalten bleiben können.
Je nach angebauter Kultur werden, vorerst meist in wissenschaftlichen Experimenten weltweit, einmalig oder in langjährigen Abständen zwischen 10 und 120 t Biokohle pro ha in den Boden eingetragen. Biokohlezugabe kann auch den Ertrag von Ackerkulturen stimulieren, und in verschiedenen Studien wurde bereits beobachtet, dass die Treibhausgasemissionen aus Böden (N 2O, CH4) abnehmen. Auch in Voruntersuchungen im Labor bei Agroscope ART wurde festgestellt, dass Biokohle bei schweizerischen Landwirtschaftsböden die Emission von N2O stark hemmt. Allerdings können die zugrunde liegenden Mechanismen noch nicht erklärt werden. Es gilt nun zu prüfen, wieweit sich Biokohle zur Verbesserung der Treibhausgasbilanz und Bodenverbesserung auf verschiedenen Standorten eignet, und in welchem Umfang sie zu wirtschaftlichen Bedingungen und in der erforderlichen Qualität zur Verfügung gestellt werden könnte, aber auch welche mögliche Nebenwirkungen, wie der Eintrag von Verunreinigungen, allenfalls zu beachten sind.
n Auswirkungen des Klimawandels und Anpassungsmöglichkeiten
In der Schweiz wird es wärmer, eventuell auch trockener
Anhand der über 100-jährigen Klimadaten von MeteoSchweiz ist die Erwärmung in der Schweiz eindeutig nachweisbar. Konkret bedeutet das, dass es in der Schweiz heute ca. 1,5 °C wärmer ist als Ende der sechziger Jahre. Auch die Anzahl der Hitzetage (mit Maximaltemperatur über 30 °C) im Mitteland hat seit den sechziger Jahren deutlich zugenommen, die Anzahl von Frosttagen (mit Temperaturen unter 0 °C) hingegen hat abgenommen.
Aufgrund aktueller Klimamodelle ist davon auszugehen, dass die mittleren Temperaturen in der Schweiz auch während den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen. Wegen der Trägheit des Klimasystems ist ein zusätzlicher Temperaturanstieg um 1,8 bis 2,8 °C (je nach Saison und Ort) bis Mitte des 21. Jahrhunderts weitgehend unvermeidbar. Für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts ist die Entwicklung der Treibhausgasemissionen jedoch entscheidend für die klimatische Entwicklung. Gegen Ende des 21. Jahrhunderts könnte der Temperaturanstieg deshalb noch ausgeprägter sein (OcCC, 2007).
76 1.3 Ökologie und Ethologie
Im Gegensatz zur Temperatur weist die Niederschlagsverteilung in der Schweiz eine sehr hohe räumliche und zeitliche Variabilität auf. Das hat zur Folge, dass Beobachtungsdaten kaum signifikante Niederschlagstrends des mittleren Niederschlags während der letzten Jahrzehnte aufweisen.
Auch die Niederschlagszenarien bis 2050 und darüber hinaus zeigen kein einheitliches Bild für die Schweiz. Tendenziell kann man aufgrund der Klimamodelle davon ausgehen, dass vor allem im Sommer mit einer Abnahme der mittleren Niederschläge gerechnet werden muss (OcCC, 2007).
Früherer Frühling
Wachstum und Entwicklung von Pflanzen werden stark von klimatischen Verhältnissen beeinflusst. Der wichtigste Einflussfaktor ist die Temperatur, aber auch Tageslänge, windbedingte Abkühlung («chilling») und Wasserverfügbarkeit spielen eine Rolle für den Verlauf der Vegetationsentwicklung.
Um den Zeitpunkt des Frühlingsanfangs zu messen, haben die Experten der Phänologie den Frühlingsindex entwickelt. Mit dessen Hilfe lässt sich der zeitliche Verlauf der Vegetationsentwicklung im Vergleich zu den Vorjahren beschreiben. Dabei werden Pflanzen und phänologische Phasen betrachtet, die für den Frühling typisch sind. Dies sind beispielsweise die Blattentfaltung der Buche, die Blüte der Buschwindröschen oder auch der Nadelaustrieb der Lärche.
Im Jahr 1951 hat die heutige MeteoSchweiz ein nationales phänologisches Beobachtungsnetzwerk gegründet, welches an rund 80 Stationen, verteilt über die Regionen und Höhenlagen, diejenigen 10 Phasen beobachtet, welche im Jahr jeweils zuerst auftreten. Um den Frühlingseintritt zu charakterisieren, wird die Abweichung vom mittleren Eintrittstermin der Normperiode (1961–1990) bestimmt.
Frühlingsindex: Abweichungen von der Normperiode
Jahre mit spätem Frühlingsbeginn Jahre mit frühem Frühlingsbeginn
5-jähriges gewichtetes Mittel
Bis Ende der achtziger Jahre kam der Frühling meistens spät. In den folgenden Jahren hat sich die Vegetation – mit Ausnahme des Jahres 2006 – früher als normal entwickelt. Die steigenden Temperaturen und ein damit verbundener früherer Beginn der Vegetationsperiode bringen auf den ersten Blick Vorteile für die Landwirtschaft. Allerdings ist noch unklar, wie sich der vorverschobene Frühlingsanfang auf die Entwicklung von Krankheiten, Schädlingen, Unkräutern, Wasserverfügbarkeit sowie auf die Intensität, Häufigkeit und Wirkung von Spätfrösten auswirken wird.
77 1.3 Ökologie und Ethologie
Anzahl Tage Quelle: Meteo Schweiz – 9 12 9 6 3 – 3 0 – 6 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006
Anpassung an veränderte Wachstumsperioden notwendig
Ein früher Vegetationsbeginn wegen steigender Temperaturen könnte die potenzielle Wachstumsperiode des Grünlands je nach Region und Höhenlage bis zum Jahr 2050 um 15 bis 20 Tage verlängern (Calanca und Holzkämper, 2010). Für die Auswertung wurde die Vegetationszeit als die Jahreszeit definiert, in welcher das Tagesmittel der Temperatur über 5 °C liegt. Wachstumsunterbrüche infolge Trockenheit wurden nicht berücksichtigt.
Entwicklung der durchschnittlichen Länge der Vegetationszeit von Wiesen und Weiden im Schweizer Mittelland
Beobachtungen der letzten 150 Jahre (mit geglättetem Verlauf) Projektion für den Zeitraum 2011–2050 (durchgezogen: geglätteter Verlauf des Medians der betrachteten Modellketten; gestrichelt: Unsicherheitsbereich)
Bei den Sommerkulturen wie z.B. bei Mais, ist bei den heute üblichen Sorten und Aussaatterminen infolge der beschleunigten Pflanzenentwicklung mit einer Verkürzung der Wachstumsphase zu rechnen. Je nach Region kann diese Verkürzung bis 2050 bis zu 30 Tage betragen. Für diese Berechnungen wurde die Aussaat auf den 10. Mai terminiert. Der Zeitpunkt der Reife wurde auf Grund der wirksamen Temperatursumme (1 600 Tag-Grade) bestimmt. Die wirksame Temperatursumme wird berechnet, indem alle Tagesmitteltemperaturen über 6 °C ab der Aussaat addiert werden. Noch kürzere Entwicklungszeiten wurden für 2003 als Folge des Hitzesommers berechnet. Kürzere Entwicklungszeiten bedeuten beim Getreide Mindererträge, wie sie im Jahr 2003 in zahlreichen Regionen festgestellt wurden.
Diese Befunde der Klimafolgeforschung bei Agroscope ART zeigen, dass Kulturpflanzen auf künftige Veränderungen des Klimas empfindlich reagieren. Die landwirtschaftliche Praxis wird sich an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen, wenn sie das zunehmende Risiko von Ertragsausfällen und sinkender Ertragssicherheit nicht eingehen will. Im Vordergrund stehen die Anpassung des Bewirtschaftungskalenders, die Wahl von für wärmere Bedingungen besser geeigneten Sorten und Kulturen sowie die Umstellung auf eine an den Klimawandel angepasste Fruchtfolge. Die Forschung ist gefordert, hierzu die notwendigen Entscheidungsgrundlagen und das entsprechende Pflanzenmaterial für die Praxis zur Verfügung zu stellen.
78 1.3 Ökologie und Ethologie
1850
Anzahl Tage
180 230 220 210 200 190 250 240 270 260 280 1900 1950 2000 2050
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Durchschnittliche Länge der Entwicklungszeit von Mais (Aussaat bis Reife) an ausgewählten Standorten der Schweiz
Trockenheit und Bewässerung – eine zunehmende Herausforderung
Trockenheit in der Landwirtschaft bedeutet, dass der Gehalt des Bodens an verfügbarem Wasser so tief liegt, dass Wachstum und Ertrag der Kulturen eingeschränkt sind. Diese Situation entsteht, wenn das aus dem Boden verdunstete Wasser nicht durch Niederschläge ersetzt wird und das Verhältnis von aktueller (ET) zu potenzieller (ETp) Evapotranspiration sinkt. Die potenzielle Evapotranspiration gibt die aufgrund der meteorologischen Bedingungen maximal mögliche Verdunstungsrate an. Das Verhältnis (ET/ETp) eignet sich gut als Mass für Trockenheit. Unterschreitet das Verhältnis den Wert von 0,8, so ist mit deutlich negativen Auswirkungen auf Acker- und Futterbau zu rechnen. Dieser Schwellenwert wurde gemäss den Berechnungen von Agroscope ART im Mittel der Jahre 1980–2006 während der Vegetationsperiode insbesondere in den westlichen Regionen, im Wallis und in Tälern Südbündes unterschritten (Fuhrer und Jasper, 2009). Ein Trend zur Verstärkung des Phänomens in diesen Gebieten konnte aber nicht festgestellt werden. Hingegen nahm in dieser Zeitperiode die Länge der Perioden mit Werten unter 0,8 in Ackerbaugebieten der nordöstlichen Landesteile und in der Zentralschweiz zu, was bedeutet, dass auch die von Trockenheit betroffene Fläche zugenommen hat. Für Grünland sind die Trends weniger ausgeprägt.
Entwicklung der Trockenheitsperioden für das Ackerland
79 1.3 Ökologie und Ethologie
Anzahl Tage
Situation
Heutiges Klima (Mittel 1981–2010) Projektion 2021–2050
2003
0 180 160 140 120 80 100 60 40 20
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Basel Bern Payerne Sion Zürich Magadino
Kein Trend Zunehmend
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Der Trend hin zu zunehmender Trockenheit während der Sommermonate dürfte sich infolge des von Klimamodellen berechneten Anstiegs der Temperaturen und der Abnahme der Niederschläge weiter verstärken.
Gegen Ende dieses Jahrhunderts könnte jedes zweite Jahr ein extremes Trockenjahr werden, mit ungenügenden Niederschlägen und einer hohen Verdunstung im Sommer. Allerdings sind die Szenarien der Klimamodelle für den Niederschlag wesentlich unsicherer als jene für die Temperatur.
Der Bedarf an Wasser für die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen wird künftig ansteigen. Der potenzielle Bewässerungsbedarf für das Ackerland, der gemäss der Berechnungen von Agroscope ART zur Vermeidung von Ertragseinbussen schweizweit benötigt würde, betrug in der Periode 1980–2006 durchschnittlich 79 Mio. m3 (Fuhrer, 2010). Verluste durch ineffiziente Bewässerungssysteme sind dabei nicht berücksichtigt. Bei einer durchschnittlichen Effizienz von 70 % würde die Menge entsprechend höher ausfallen. Für die gesamte Landwirtschaftsfläche gemäss Arealstatistik 1992/97 (Acker- und Grünland sowie Spezialkulturen) betrug der Mittelwert 154 Mio. m3. Das entspricht etwa einem Viertel des Wassers, welches als Trinkwasser verbraucht wird.
Gegen Ende dieses Jahrhunderts, bei Verhältnissen wie im Sommer 2003, könnte eine massive Steigerung der Bewässerungsmenge um das vierfache der heutigen Durchschnittsmenge zur Sicherung der Erträge notwendig werden (Fuhrer, 2010). Agroscope ART hat die für ein Trockenjahr wie 2003 benötigte Menge an Bewässerungswasser berechnet, räumlich analysiert, und mit dem Bedarf im Durchschnitt der Jahre 1980–2006 verglichen. Dabei wird ersichtlich, dass die prozentuale Steigerung in den heute noch weniger trockenen Gebieten des östlichen Mittellandes bis zum Bodensee am grössten ist.
Benötigte Bewässerungsmenge 2003 im Vergleich zum Durchschnitt für die Jahre 1980–2006
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Der gesteigerte Wasserbedarf der Landwirtschaft in einem künftigen, wärmeren und trockeneren Klima kann in Gebieten mit begrenzten Wasservorräten (speziell in Fliessgewässern) zu Engpässen in der Wasserverfügbarkeit bzw. zu Verteilungskonflikten zwischen verschiedenen Wassernutzern (Landwirtschaft, Haushalte, Industrie, Energieversorgung, Gewässerökologie, Schifffahrt etc.) führen. Eine beliebige Steigerung der Bewässerung ist auch in der wasserreichen Schweiz nicht möglich. Um mit der Ressource Wasser haushälterisch umzugehen, müssen die Bewässerungssysteme effizienter werden. Zu nutzen sind auch die Möglichkeiten zur Steigerung der Wasserrückhalte- und -speicherfähigkeit des Bodens, etwa durch eine reduzierte Bodenbearbeitung. Auch die Bedeutung von wassersparenden Produktionsmethoden und von Kulturen mit einem geringeren Wasserbedarf wird zunehmen.
80 1.3 Ökologie und Ethologie
Unterschied in % <100 100 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 500 >500
n Fazit
Die Landwirtschaft ist sowohl als Verursacherin von Klimagasen wie auch als vom Klimawandel Betroffene gefordert. In der Landwirtschaft sind viele Konzepte zur Verringerung der Treibhausgase geeignet, auch die Auswirkungen des Klimawandels besser zu bewältigen, und umgekehrt. Zentraler Ansatz dabei ist der effiziente Einsatz der knapper werdenden Ressourcen. Systeme, die an den Standort angepasst sind und mit möglichst kleinräumig geschlossenen Stoff- und Energiekreisläufen arbeiten, kommen diesen Anforderungen sehr nahe. Dazu gehört auch, ackerfähige Standorte möglichst für die menschliche Ernährung zu nutzen und die Rindviehhaltung auf Standorten zu betreiben, welche nicht anderweitig verwendet werden können. Auch ein sorgsamer Umgang mit organischem Material und die Pflege des Bodens als Kohlenstoffund Wasserspeicher nützt sowohl der Produktion unter veränderten klimatischen Bedingungen als auch der Verringerung der Klimagase.

Da es sich beim Klimawandel um ein globales Problem handelt, müssen bei den Lösungen zu Treibhausgasminderung und Klimawandelanpassung auf nationaler Ebene die internationalen Wechselwirkungen immer mitberücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist die Senkung der landwirtschaftlichen Produktion in der Schweiz nicht grundsätzlich geeignet, um globale Treibhausgasemissionen zu reduzieren – die von den Konsumentinnen und Konsumenten nachgefragten Produkte würden in diesem Fall aus dem Ausland importiert. Umgekehrt kann es aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll sein, ein landwirtschaftliches Produkt aus dem Ausland zu beziehen, wenn dieses an einem Standort ausserhalb der Schweiz klimaschonender produziert werden kann. Um den Klima-Fussabdruck verschiedener Produkte und Herkünfte vergleichen zu können, braucht es Studien mit international einheitlichen Methoden. Eine solche Grundlage ist wichtig, damit die Konsumierenden ihren Beitrag zum Klimaschutz erkennen können.
In der Klimastrategie Landwirtschaft werden mögliche Handlungsfelder und -optionen vorgestellt und der Rahmen für die weitere Konkretisierung und Umsetzung skizziert. Die Folgearbeiten stehen unter den Aspekten «Verbessern der Rahmenbedingungen», «Ausbau der Wissensbasis» und «Lancieren eines Beteiligungsprozesses». So wird es darum gehen, bei der Überprüfung von Instrumenten der Agrarpolitik die Erkenntnisse aus der Klimastrategie zu berücksichtigen, der Thematik in der Forschung mehr Gewicht zu geben und Projekte der Praxis zu begleiten. Das Engagement aller Akteure rund um die Land- und Ernährungswirtschaft ist erforderlich, um die ambitiösen Ziele zu erreichen.
81 1.3 Ökologie und Ethologie
1.3.1.3 Energie
Im Folgenden werden die Entwicklungen von Energieeinsatz und -effizienz in der Landwirtschaft dargestellt. Der Energieeinsatz in der Landwirtschaft setzt sich zusammen aus dem direkten Einsatz (beispielsweise Diesel oder Strom für den Betrieb der Maschinen) und dem indirekten Einsatz. Letzterer umfasst den Energiebedarf für die Herstellung, Verwendung und den Unterhalt von Produktionsmitteln wie Dünger, Futtermittel, Gebäude und Maschinen, die so genannte graue Energie.

Weiter wird die Produktion von erneuerbarer Energie in der Landwirtschaft aufgezeigt. Die Möglichkeiten sind vielfältig (Biomasse, Solar, Wind, Kleinwasserkraft). Der Beitrag geht näher auf die solare Wärme- und Stromproduktion sowie die Energieproduktion in Biogasanlagen ein. Neben der Holznutzung gehören die Solarenergie (Sonnenkollektoren und Photovoltaik) und Biogasanlagen zu den wichtigsten heute verbreiteten Formen von landwirtschaftlicher Energieproduktion.
n Energieverbrauch steigt, Energieeffizienz bleibt stabil
Der landwirtschaftliche Energieverbrauch ist im Dreijahresschnitt von 2007 bis 2009 gegenüber 1990/92 um 11 % gestiegen. Dies ist auf die Zunahme der direkt eingesetzten Energie zurückzuführen, deren Anteil am gesamten Energieverbrauch in diesem Zeitraum von 50 % auf 56 % angewachsen ist. Beim direkten Energieverbrauch geht etwa je die Hälfte auf den Treibstoff- und auf den Stromverbrauch zurück. Der Treibstoffverbrauch (+33 %; +2 570 MJ/ha) ist seit 1990/92 allerdings stärker gestiegen als der Stromverbrauch (+13 %; +1 150 MJ/ha).
Den grössten Anteil an der grauen Energie machen nach wie vor Gebäude und Maschinen mit ca. 80 % aus. Bei der grauen Energie hat der Energieverbrauch gegenüber den frühen neunziger Jahren bei den Maschinen (+8 %; +580 MJ/ha) und über die eingeführten Futtermittel (+220 %; +556 MJ/ha) zugenommen. Eine starke Abnahme ist in diesem Zeitraum beim Energieverbrauch für Dünger (–33 %; –1 050 MJ/ha) zu verzeichnen.
82 1.3 Ökologie und Ethologie
Entwicklung des landwirtschaftlichen Energieverbrauchs
Da sich die Produktion, genauer die in den Agrarerzeugnissen enthaltene Energie, im Gleichschritt mit dem Energieverbrauch gesteigert hat, ist die Energieeffizienz im Schnitt der Jahre 2007 bis 2009 mit einem Faktor von 0,4 gleich geblieben wie in den frühen neunziger Jahren.
83 1.3 Ökologie und Ethologie
in M J / ha
Energie Graue Energie Elektrizität Treibstoff Gebäude Maschinen Dünger Eingeführtes Saatgut Eingeführte Futtermittel Pestizide Quelle: Agridea 0 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1980 1985 1990 1995 2000 2005
der Energieeffizienz in der Landwirtschaft in M J / ha Quelle: Agridea 0 40 000 30 000 25 000 35 000 20 000 15 000 10 000 5 000 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Energie in Agrarerzeugnissen (MJ / ha)
Energie für die Produktion (MJ / ha) Energieeffizienz (A / B) in % 0 80 70 40 60 50 10 20 30
Direkte
Entwicklung
A)
B)
n Produktion erneuerbarer Energie aus der Landwirtschaft legt zu
Solarenergie. Der Energieertrag aus thermischen Sonnenkollektoren ist in der Schweiz von weniger als 100 Gigawattstunden (GWh) (1990) auf knapp über 450 GWh (2009) angestiegen. In der Landwirtschaft wurden 2009 gemäss der Markterhebung zur Sonnenenergie 47 Röhren- und Flachkollektorenanlagen (850 m2), sowie 35 Anlagen zur Heutrocknung (10 500 m2) installiert. Im Vergleich zu 2008 wurden sowohl 11 Röhren- und Flächenkollektoren als auch 11 solare Heubelüftungsanlagen mehr gebaut.
Die ersten Anlagen zur solaren Heutrocknung wurden in den frühen achtziger Jahren erstellt. Sie sind eher auf grösseren Betrieben installiert. Anfang der neunziger Jahre lag der Zuwachs noch bei jährlich über 200 Anlagen, von 1999 bis 2001 sank er auf durchschnittlich 35 neue Anlagen pro Jahr und von 2002 bis 2007 auf 10 Anlagen pro Jahr. Seit 2008 ist der Anlagenbau wieder im Steigen begriffen. Insgesamt sind gemäss der Teilstatistik Sonnenkollektoren für die Heubelüftung 3 462 Anlagen (entspricht einer Fläche von 860 000 m2) in Betrieb, welche einen Wärmeertrag von 110 GWh abwerfen. Durch die Nutzung werden jährlich 19 GWh Strom und 50 GWh Heizöl ersetzt.
Neu erstellte solare Heubelüftungsanlagen in der Schweiz
Die Photovoltaik legt in den letzten Jahren bedeutend zu. 2009 wurden schweizweit Module mit einer Gesamtleistung von 37 000 Kilowatt Peak (kWp) verkauft. Im Jahr 2009 waren gesamthaft 71 400 m2 installiert, was einem Energieertrag von 50 GWh entspricht. In der Landwirtschaft wurden 2009 108 Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 5 385 kWp erstellt. 2008 waren es zwar 29 Anlagen mehr, ihre Gesamtleistung war jedoch mit 3 430 kWp geringer.
Biogas. Landwirtschaftliche Biogasanlagen produzieren aus Biomasse klimaneutrale Energie in Form von Strom, Wärme und Gas. Dazu werden hauptsächlich Gülle und Mist, manchmal mit Zusätzen von Ernterückständen, Grüngut und Reststoffen aus der Nahrungsmittelindustrie, verwendet. In der Schweiz wurden die ersten landwirtschaftlichen Biogasanlagen in den späten siebziger Jahren gebaut. Seither hat sich vieles geändert. Zwar hat die Anzahl der Anlagen von 102 im Jahr 1990 auf 75 im Jahr 2009 abgenommen, doch sind die Anlagen einiges grösser und effizienter geworden. Im Jahr 1990 wurden insgesamt 17 GWh Biogas produziert, 62 % davon konnten tatsächlich genutzt werden; 2009 waren es 113 GWh mit einem Ausnutzungsgrad von 74 %. Der grösste Teil (37,5 GWh) wurde 2009 in Strom umgewandelt, 32,8 GWh wurden zur Beheizung des Fermenters gebraucht, 8,1 GWh wurden anderweitig als Wärme genutzt. Seit 2008 wird landwirtschaftliches Biogas auch in das Erdgasnetz eingespeist. Im 2009 belief sich diese Menge auf 5,7 GWh.
84 1.3 Ökologie und Ethologie
Anzahl Quelle: Bundesamt für Energie 0 100 90 80 70 50 60 40 30 20 10 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 98 89 92 11 9 6 8 64 36 35 37 14 15 24 35
Vor dem Hintergrund der laufenden Energiediskussion um die Problematik von Atomenergie, knapper werdenden Erdölressourcen und Klimawandel nimmt das Interesse an Biogas weiter zu. Allerdings bedeutet der Bau einer Biogasanlage eine grössere Investition, welche mit einem unternehmerischen Risiko verbunden ist. Ob die Produktion von landwirtschaftlichem Biogas weiter wachsen wird, hängt zu einem grossen Teil davon ab, ob die Anlagen wirtschaftlich betrieben werden können. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Standort. Er ist für die Transportkosten von Substraten, sowie für die Möglichkeit zur Nutzung der Wärme entscheidend. Ins Gewicht fallen auch die Verfügbarkeit von Substraten und die Konditionen zu deren Entsorgung. Diese entwickeln sich wegen der grossen Nachfrage zurzeit eher ungünstig. Auch der gesetzliche (Raumplanungsgesetz, Umweltschutzgesetz, Nährstoffbilanz) und der wirtschaftlich-politische (Einspeisevergütung) Rahmen beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich. Aufgrund all dieser Bedingungen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Trend zu grösseren, gemeinschaftlich betriebenen Anlagen weiter fortsetzt (siehe auch ART-Bericht 676, 2007).
n Fazit
Der sparsame Energieeinsatz und die Produktion erneuerbarer Energien gewinnen an Bedeutung. Bestrebungen im Bereich Energienutzung führen dazu, dass CO 2-Emissionen vermieden werden können. Dazu gehören ein gezielter Einsatz von effizienten Maschinen und Geräten, die energetische Optimierung von Gebäuden und das Nutzen anfallender Wärme. Die Steigerung des Einsatzes und der Produktion erneuerbarer Energien (Biomasse, Solar, Wind, Kleinwasserkraft) kann darüber hinaus zu einem Ersatz von fossilen Energieträgern beitragen. Das nachhaltig nutzbare Potenzial zur Energieeinsparung sowie zur Produktion und Nutzung erneuerbarer Energien in der Landwirtschaft soll erfasst und ausgeschöpft werden. Die Landwirtschaft soll einen Grossteil ihres Energiebedarfs erneuerbar decken und soweit sinnvoll zur Versorgung anderer Energiebezüger mit erneuerbaren Energien beitragen. Damit können nicht nur die Ziele der Klimastrategie Landwirtschaft erreicht werden. Es kann ein Beitrag zur sicheren Versorgung mit erneuerbaren Energien geleistet werden, und in der Landwirtschaft können Betriebskosten gesenkt, bzw. alternative Einkommensquellen generiert werden. Insbesondere die anfallenden Hofdünger und die grossen Dachflächen in der Landwirtschaft bieten sich zur Energieproduktion an.
85 1.3 Ökologie und Ethologie
1.3.1.4 Luft
In den vergangenen Jahren war die Landwirtschaft hin und wieder im Zusammenhang mit Luftverschmutzung in den Schlagzeilen. Z.B. als Quelle von unangenehmen Gerüchen in der Nachbarschaft von Wohnquartieren oder als Emittentin von Feinstaub, weil Traktoren von der Partikelfilterpflicht ausgenommen sind. Auf die Ammoniakemissionen, ein weiteres wichtiges Thema in Bezug auf die Belastung der Luft durch die Landwirtschaft, wird hier nicht eingegangen. Diese werden im Agrarbericht 2012 im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Stickstoffhaushalt eingehend behandelt.
n Dieselruss aus der Landwirtschaft: auf der Suche nach einer Lösung
Dieselruss entsteht bei inhomogener Verbrennung in Motoren und wird zusammen mit den Abgasen ausgestossen. Die feinen Russpartikel können beim Einatmen in die Lunge eindringen und von dort in die Lymph- und Blutbahnen gelangen. Dieselruss enthält krebserregende Bestandteile und kann daher zum Risiko für die menschliche Gesundheit werden. Zwar kann man davon ausgehen, dass sich die Situation in den letzten Jahren aufgrund schadstoffärmerer Motoren und Partikelfiltern stark verbessert hat. Schätzungen gehen davon aus, dass die Emissionen 2010 gegenüber 2005 bei den Strassenfahrzeugen um 27 % und im Offroad-Bereich (Land- und Forstwirtschaft, Baumaschinen, Industrie, Schifffahrt, Schiene, Militär) um 40 % zurückgegangen sind. In der Landwirtschaft, welche von der 2009 bei Baumaschinen eingeführten faktischen Partikelfilterpflicht nicht betroffen ist, beträgt die geschätzte Reduktion 21 %.
Vom Umweltziel, welches für die gesamten Dieselrussemissionen 100 t und für die Landwirtschaft 20 t pro Jahr vorsieht, sind jedoch alle Sektoren noch weit entfernt. Für das Jahr 2010 wird der Ausstoss von Dieselruss auf insgesamt knapp 1 500 t geschätzt. Davon stammen 311 t (21 %) aus der Landwirtschaft.

86 1.3 Ökologie und Ethologie
Entwicklung der Dieselrussemissionen
Partikelfilter sind eine äusserst wirksame Massnahme, um die Dieselrussemissionen zu reduzieren. Der Bundesrat hat in seiner Antwort auf die Motion von Siebenthal 10.3405 zu Partikelfiltern in der Landwirtschaft im September 2010 festgehalten, dass er bei land- und forstwirtschaftlichen Maschinen die EU-Regelungen übernehmen und vorerst keine strengeren Vorschriften erlassen will. Der Zeitplan für emissionsreduzierende Massnahmen bei den land- und forstwirtschaftlichen Maschinen soll sich insbesondere nach dem Kriterium der wirtschaftlichen Tragbarkeit für die schweizerische Landwirtschaft richten. Hier liegt denn auch die Schwierigkeit: Neue Traktoren mit Partikelfiltern sind bereits seit einigen Jahren auf dem Markt erhältlich, jedoch teuer, da die Filter noch nicht serienmässig eingebaut sind. Bei alten Motoren ist die Nachrüstung mit Partikelfiltern möglich, bringt aber ebenfalls sehr hohe Kosten mit sich. Zudem können sich technische Probleme ergeben (ART-Bericht Nr. 677, 2007).
Falls die europäischen Grenzwerte für den Offroad-Bereich, wie zurzeit diskutiert, um einen Partikelanzahlgrenzwert ergänzt werden, müssen zur Erreichung der Grenzwerte zwingend geschlossene Partikelfiltersysteme eingesetzt werden. Diese serienmässigen Lösungen werden zu einer weiteren Verbreitung der Partikelfilter auch in der Landwirtschaft führen. Eine solche Lösung hätte wirtschaftliche und technische Vorteile, da die Filter direkt von den Motorenherstellern kommen und dadurch Filter und Motor optimal aufeinander abgestimmt sind.
n Wenn die Landwirtschaft riecht
«Wie stark darf eine Umweltinvestition riechen? Eine zeitweilig stinkende Biogasanlage sorgt für Proteste aus der Nachbarschaft. Der Betreiber hat mit mässigem Erfolg einen Filter einbauen lassen. Die Behörden sind derweil etwas ratlos, da es keine Grenzwerte für Gestank gibt.»
«Es herrscht dicke Landluft: Eine Gemeinde sucht nach Rezepten gegen schlechte Gerüche aus Biogasanlage, Schweinestall und Feldrandkompostierung»
«Wenn Sie sagen, eine Biogasanlage verursacht keine Gerüche, dann muss ich Ihnen sagen, hier verstehe ich mehr als Sie. Die Anlage, die wir in unserer Gemeinde hatten, macht darum keine Gerüche mehr, weil wir sie mit eingeschriebenem Brief schliessen mussten, es war für die Nachbarn nicht mehr zumutbar.»
So tönt es aus Regionalzeitungen und Ratsdebatten. Gerüche aus der Landwirtschaft werden mit dem fortschreitenden Siedlungsbau in ländlichen Gebieten zum Problem. Während es bisher vor allem Gerüche aus Schweine- und Geflügelställen waren, welche die Nachbarschaft verärgerten, hat das Thema mit dem vermehrten Bau von landwirtschaftlichen Biogasanlagen eine neue Aktualität erreicht.
87 1.3 Ökologie und Ethologie
in t / Jahr Rest (Schiene, Militär) Schifffahrt Industrie Baumaschinen Forstwirtschaft Landwirtschaft Strassenfahrzeuge Quelle: BAFU 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2005 2010
Zum Messen von Geruchsimmissionen gibt es bisher kein geeignetes Messgerät ausser der menschlichen Nase. Dementsprechend sind für Geruch auch keine Immissionsgrenzwerte festgelegt. Um die Bevölkerung vor übermässigen Geruchsbelästigungen zu schützen, sieht das Umweltschutzgesetz, und darauf abgestützt die Luftreinhalteverordnung (LRV), ein zweistufiges System vor. In der ersten Stufe müssen Emissionen, so weit als technisch-betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar, vorsorglich begrenzt werden. Das heisst, dass bei der Errichtung von Anlagen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden müssen (FAT-Bericht Nr. 476, 1995). Wenn trotz allen vorsorglichen Massnahmen übermässige Geruchsimmissionen entstehen, werden in der zweiten Stufe verschärfte Emissionsbegrenzungen, allenfalls mit Sanierungsfristen, notwendig.
Bei der Berechnung von Mindestabständen wird davon ausgegangen, dass sich der Geruch in alle Richtungen ausbreitet. Dies ist in der Realität jedoch selten der Fall. Die hauptsächlichen und die sporadischen Windrichtungen, Umlenkung im umbauten Raum und tageszeitlich bedingte Kaltluftströme sind (mikro) klimatische Phänomene, die einen grossen Einfluss auf die Geruchsausbreitung haben. Es gibt zwar Modelle zur Berechnung der Ausbreitung von Gerüchen, aber meistens gibt es zu wenige kleinräumig aufgelöste Daten, um gute Voraussagen machen zu können. Auch die Einflussfaktoren auf die Geruchsquellstärke sind in der Tierhaltung noch zu wenig erforscht.
Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht einerseits für bestehende Anlagen; hier wird ein Analyseinstrument benötigt, mit welchem die Belastung durch Geruch mit geringem Aufwand beurteilt und die Wirkung von Massnahmen zur Geruchsverminderung abgeschätzt werden kann; und andererseits für Erweiterungsund Neubauten, wo es eine Aktualisierung und Ergänzung der Grundlagen für die Mindestabstandsempfehlung braucht. Denn eine vorausschauende Standortwahl und eine umsichtige Planung sind wichtiger denn je, damit Konflikte zwischen landwirtschaftlichen Anlagebetreibern und Anwohnern und daraus resultierende teure Nachrüstungen vermieden werden können. In diesem Zusammenhang wird auch die Politik gefordert sein, einerseits der Zersiedelung der Landschaft keinen Vorschub zu leisten und andererseits den landwirtschaftlichen Betrieben ein Wachstum zu ermöglichen.
n Fazit
Für die Reduktion von Luftschadstoffen und schlechten Gerüchen aus der Landwirtschaft gibt es bereits heute technische Lösungen. Diese sind jedoch noch teuer und dadurch zu wenig gebräuchlich, um eine nennenswerte Wirkung zu erzielen. Zwar ist absehbar, dass die Technologien mit zunehmender Verbreitung günstiger werden. Die Investitionskosten in der Landwirtschaft sind jedoch hoch, und bestehende Anlagen und Maschinen werden meist über Jahrzehnte hinaus benutzt. Entsprechend tief ist die Erneuerungsrate und damit die Verbreitung neuerer, sauberer Technologie. Bei diesen Zeithorizonten ist eine vorausschauende und umsichtige Planung umso wichtiger, wenn es um neue Investitionen geht. Dazu gehört auch, dass die Landwirtschaft die Bedürfnisse der übrigen Gesellschaft in der Planung angemessen berücksichtigt.
88 1.3 Ökologie und Ethologie
1.3.2 Ethologie
n Beteiligung bei den Tierhaltungsprogrammen RAUS
und BTS
Im Rahmen der Direktzahlungen an die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen fördert der Bund mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. Das RAUS-Programm enthält hauptsächlich Bestimmungen zum Auslauf auf der Weide oder im Laufhof bzw. beim Geflügel im Aussenklimabereich. Das BTS-Programm beinhaltet vor allem qualitative Vorgaben für die einzelnen Bereiche der geforderten Mehrbereichsställe, in denen sich die Tiere frei bewegen können. Seit 2009 werden die bis anhin geltende BTS- und RAUS-Verordnung in der Ethoprogrammverordnung zusammengefasst. Die Teilnahme an einem solchen Programm ist freiwillig. Die im Folgenden genannten Prozentzahlen beziehen sich auf die Grundgesamtheit aller Direktzahlungsbetriebe bzw. aller dort gehaltenen Nutztiere.
Das RAUS-Programm wurde 1993 eingeführt. Von 1993 bis 2000 stieg die Beteiligung von 4 500 auf 30 000 RAUS-Betriebe an. 2010 beteiligten sich 36 600 Betriebe (2008: 37 600) an diesem Programm. Dieser Rückgang zwischen 2008 und 2010 ist insbesondere auf die geringere Teilnahme der spezialisierten Schweinezuchtbetriebe zurückzuführen, die seit 1. Januar 2009 nur noch für jene säugenden Zuchtsauen RAUS-Beiträge erhalten, denen Auslauf gewährt wird. Das BTS-Programm ist seit 1996 in Kraft. Von 1996 bis 2000 nahm die Beteiligung von 4 500 auf 13 000 BTS-Betriebe zu. Die Betriebsbeteiligung lag 2010 bei 19 700 (2008: 18 900).

89 1.3 Ökologie und Ethologie
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS und BTS
Der prozentuale Anteil der nach den RAUS-Bedingungen gehaltenen Nutztiere stieg zwischen 2000 und 2010 von 51 auf 72 % (2008: 73 %). Beim BTS-Programm nahm der Anteil in der gleichen Zeitspanne von 23 auf 46 % zu. Diese Werte sind Durchschnittszahlen der verschiedenen Nutztiergruppen (bis 2008: Rindvieh, übrige Raufutterverzehrer, Schweine, Geflügel; ab 2009: Rindergattung, Pferdegattung, Ziegengattung, Schafgattung – nur bei RAUS, Schweinegattung, Kaninchen, Nutzgeflügel).
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS, nach Tierkategorie
Übrige Raufutterverzehrer bis 2008: Pferde, Ziegen, Schafe, Kaninchen; ab 2009 je eine eigene Tierkategorie
Quelle: BLW
Wird die Beteiligung am RAUS-Programm nach Nutztiergruppen differenziert, stellt man bei der Rindergattung zwischen 2000 und 2010 eine Zunahme von 52 auf 77 % fest. Die Pferde-, Ziegen- und Schafgattung sowie die Kaninchen sind seit 2009 gemäss neuer Ethoprogrammverordnung je eine eigenständige Tierkategorie, vorher gehörten sie zur Gruppe der übrigen Raufutterverzehrer. Bei den Pferden lag die Beteiligung 2009 und 2010 bei 82 %, bei den Ziegen bei 76 %, bei den Schafen bei 84 % und bei den Kaninchen bei 2 %. Bei den Schweinen stieg die Beteiligung von 37 bis auf 63 % (2008) und ging dann auf 50 % (2009 sowie 2010) zurück. Der Rückgang ist hauptsächlich dadurch bedingt, dass seit 1. Januar 2009 nur noch für jene säugenden Zuchtsauen RAUS-Beiträge ausgerichtet werden, denen Auslauf gewährt wird.
90 1.3 Ökologie und Ethologie
GVE-Anteil in % RAUS BTS Quelle:
0 80 70 60 50 40 30 20 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2009
BLW
GVE-Anteil in % Rindergattung Pferdegattung Ziegengattung Schafgattung Schweinegattung Kaninchen Nutzgeflügel übrige Raufutterverzehrer
0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2000 2008 2009 2010
Tabellen 39–40 Seiten A43–A44
Die Entwicklung der Beteiligung beim Nutzgeflügel setzt sich aus den unterschiedlichen Entwicklungen bei den Legehennen und bei den Mastpoulets zusammen. Währenddem die Beteiligung bei den Legehennen bis 2010 stetig zunahm (2010: 71 %), endete der Anstieg bei den Mastpoulets 1999 bei 42 %; seither ist ein klarer Rückgang festzustellen (2010: 10 %). Diese Entwicklung wurde durch die Einführung der minimalen Mastdauer von 56 Tagen bei den Poulets ausgelöst. Durch die im Vergleich zur konventionellen Produktion wesentlich längere Mastdauer stiegen die Produktionskosten und folglich auch der Preis am Markt erheblich. Entsprechend ging die Nachfrage nach RAUS-Poulets zurück.
Entwicklung der Beteiligung bei BTS, nach Tierkategorie
Übrige Raufutterverzehrer bis 2008: Ziegen, Kaninchen; ab 2009 je eine eigene Tierkategorie und neu Pferde
Wird die Beteiligung am BTS-Programm nach Nutztiergruppen unterschieden, stellt man bei der Rindergattung zwischen 2000 und 2010 eine im Vergleich zum RAUS-Programm wesentlich geringere Zunahme von 19 auf 42 % fest. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass die Investition in den meisten Fällen sehr hoch ist (Laufstall), so dass diese in der Regel erst bei einer notwendigen Ersatzinvestition getätigt wird. Seit 2009 gibt es auch ein BTS-Programm für die Pferdegattung, die Teilnahme beträgt seither 12 %. Die Ziegengattung und die Kaninchen sind seit 2009 je eine eigenständige Tierkategorie, vorher zählten sie zur Gruppe der übrigen Raufutterverzehrer. Die BTS-Beteiligung bei den Ziegen (35 %) ist ebenfalls geringer als beim RAUS-Programm; bei den Kaninchen hingegen ist sie (2010: 26 %) ein Mehrfaches höher als bei RAUS.
Bei den Schweinen wurde das BTS-Programm erst 1997 eingeführt. Die Beteiligung stieg zwischen 2000 und 2008 von 40 auf 65 % an, seit 2009 sank sie leicht auf 64 %. Die hohe BTS-Beteiligung beim Geflügel (2009 und 2010: 86 %) ist zu einem grossen Teil auf den Markterfolg der Labels zurückzuführen, welche die besonders tierfreundliche Stallhaltung von Legehennen und Mastgeflügel fördern.
91 1.3 Ökologie und Ethologie
GVE-Anteil in % Rindergattung Pferdegattung Ziegengattung Schweinegattung Kaninchen Nutzgeflügel übrige Raufutterverzehrer
0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2000 2008 2009 2010
Quelle: BLW
92
2. Agrarpolitische Massnahmen
2.1 Produktion und Absatz
Artikel 7 LwG hält prioritäre Ziele für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse fest: Die Landwirtschaft soll nachhaltig und kostengünstig produzieren sowie aus dem Verkauf der Produkte einen hohen Markterlös erzielen. Damit bekräftigt das LwG die Wichtigkeit der wirtschaftlichen und handelsbezogenen Aspekte der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die bereits auf Verfassungsebene festgehalten sind. Der Bund verfügt über verschiedene Instrumente zur Unterstützung der Schweizer Landwirtschaft bei der Erreichung dieser Ziele. Es bestehen Instrumente in den Bereichen Qualität, Absatzförderung, landwirtschaftliche Bezeichnungen sowie Ein- und Ausfuhr, welche über alle Produktionsbereiche hinweg Gültigkeit haben. Diese werden mit spezifischeren Instrumenten für die Milch-, Vieh- und Weinwirtschaft sowie den Pflanzenbau ergänzt.

93 2.1 Produktion und Absatz
n Finanzielle Mittel 2010
2010 wurden für Massnahmen zu Gunsten der Produktion und des Absatzes 428 Mio. Fr. aufgewendet, das sind 9 % weniger als im Vorjahr. Der Rückgang betrifft die Milchwirtschaft, die Viehwirtschaft und vor allem den Pflanzenbau. Im Bereich Milchwirtschaft waren 274 Mio. Fr. budgetiert. Diese Minderaufwendungen sind auf den Abbau der Marktstützung und die Umlagerung der Mittel zu den Direktzahlungen im Rahmen der AP 2011 zurückzuführen. Zur Stabilisierung des Milchmarktes wurden aber die Mittel in der Milchwirtschaft 2010 um 18,5 Mio. Fr. gegenüber dem Budget nachträglich erhöht. Im Bereich Viehwirtschaft wurden deutlich weniger finanzielle Mittel für saisonale Marktentlastungsmassnahmen beansprucht als in anderen Jahren. Im Pflanzenbau wurden 2009 fast alle Verarbeitungsbeiträge zum letzten Mal ausbezahlt. Es wurden lediglich die Verarbeitungsmassnahmen von Obst teilweise weitergeführt. Aufgrund der geringeren Anbauflächen wurden weniger Mittel für die Zuckerproduktion benötigt. Die Absatzförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, eine strategische Achse zur Erhöhung der Marktanteile von schweizerischen Agrarprodukten, wurde auf gleichem Niveau weitergeführt.
Ausgaben für Produktion und Absatz
n Ausblick
Im Budget 2011 sind die üblichen Mittel für die Marktentlastung im Fleischbereich und für die Unterstützung der Zuckerproduktion eingestellt, weshalb das Budget für die Viehwirtschaft und den Pflanzenbau
2011 höher ausfällt als die unterdurchschnittlichen Aufwendungen 2010. Für die Milchwirtschaft hat das Parlament 4 Mio. Fr. mehr für 2011 bereit gestellt als im Vorjahr ausgegeben wurden.
94 2.1 Produktion und Absatz
Ausgabenposten 2009 2010 1 2010 2011 1 Mio. Fr. Absatzförderung 56 56 56 55 Milchwirtschaft 298 274 292 296 Viehwirtschaft 18 14 10 14 Pflanzenbau (inkl. Weinbau) 99 79 70 77 Gesamt 471 423 428 442
1 Budget Quellen: Staatsrechnung, BLW
Tabellen 27–31 Seiten A27–A30
2.1.1 Übergreifende Instrumente
2.1.1.1 Qualitätspolitik
In der Bundesverfassung (Art. 104) heisst es, dass der Bund für eine auf den Markt ausgerichtete Produktion zu sorgen hat. Dies verlangt u.a. eine Ausrichtung der politischen Rahmenbedingungen und Instrumente auf die Marktbedürfnisse bezüglich Qualität. Das bestehende Instrumentarium erlaubt es dem Bund u.a., die Produzenten und Branchen in den Bereichen Kennzeichnung und Qualitätssicherung zu unterstützen, damit sie die Wertschöpfung ihrer Produkte verbessern können.
Qualitätsstrategie
Angesichts der sich öffnenden Grenzen ist die konsequente Verfolgung einer Qualitätsstrategie ein vielversprechender Weg für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft. Einerseits sollen den Konsumentinnen und Konsumenten hochwertige Lebensmittel garantiert werden. Anderseits soll die Qualität der land- und ernährungswirtschaftlichen Produkte und Prozesse besser in Wert gesetzt und die Branche bei einer nachhaltigen Entwicklung unterstützt werden. Kurz: «Wettbewerbsfähigkeit durch Qualität» soll als Maxime der schweizerischen Land- und Ernährungswirtschaft verankert werden. Um der Qualitätsstrategie Form zu verleihen, haben sich im Verlauf des letzten Jahres Vertreterinnen und Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette der Land- und Ernährungswirtschaft in einem vom BLW moderierten Prozess mehrfach getroffen und nebst den Eckpunkten der Qualitätsstrategie wichtige Projekte zu deren Umsetzung beschlossen.
Eine Charta zur Qualitätsstrategie wurde den interessierten Kreisen zur Konsultation unterbreitet. Sie fand breite Zustimmung und konnte anfangs 2011 bereinigt werden. Wann und wo die Charta zur Unterschrift gelangen wird, soll noch im laufenden Jahr festgelegt werden. Weiter haben die Werkstattteilnehmenden bekräftigt, dass bei der Pflege bestehender und Erschliessung neuer Märkte verstärkt zusammengearbeitet werden soll. Um eine gemeinsame Basisstrategie für die Vermarktung zu entwickeln und gemeinsame Kommunikationsmassnahmen zu erarbeiten, soll ein Strategischer Marketing-Ausschuss eingesetzt werden. Als weiteres Element wird geprüft, ob die Dachmarke des Tourismus – die Goldblume – auch für die Ernährungswirtschaft eingesetzt werden soll. Hier hat das BLW gemeinsam mit Vertretern der Land- und Ernährungswirtschaft sowie von Schweiz Tourismus die nötigen Vorarbeiten geleistet. Um dieses vielversprechende Projekt nun weiter vorantreiben zu können, ist ein gemeinsamer Wille der verschiedenen Glieder der Wertschöpfungskette Voraussetzung.
2.1.1.2 Branchen- und Produzentenorganisationen
Branchen- und Produzentenorganisationen können gemäss Art. 8 LwG Selbsthilfemassnahmen ergreifen, um die Qualität der Produkte zu fördern oder die Produktion und das Angebot den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Gemäss Art. 9 LwG können solche gemeinsam entschiedenen Massnahmen vom Bundesrat ausgedehnt bzw. allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn davon auszugehen ist, dass ihr Funktionieren durch Unternehmen, die nicht Mitglieder sind und sich deshalb nicht an den Massnahmen beteiligen (sogenannte Trittbrettfahrer), gefährdet werden könnte. Damit die Allgemeinverbindlichkeit zu Stande kommt, müssen die Voraussetzungen, welche in der Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen (SR 919.117.72) beschrieben sind, erfüllt sein. Grosses Gewicht haben dabei die Repräsentativität der Organisationen sowie das öffentliche Interesse an der Massnahme. Begehren zur Anpassung von Produktion und Angebot werden nur gutgeheissen, wenn sie nicht durch strukturelle Probleme, sondern durch eine ausserordentliche Situation bedingt sind.
95 2.1 Produktion und Absatz
n
Geltende Ausdehnungen von Selbsthilfemassnahmen im Jahr 2010
Branchen-/Produzentenorganisation
Massnahme
Interprofession du Gruyère Sanktionierung von Qualitätsabweichungen
Branchenorganisation Milch BOM Mengenführung der Molkereimilch
Schweizer Milchproduzenten SMP Beiträge für Marktforschung, Basiswerbung, Verkaufsförderungsmassnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmassnahmen
Schweizerischer Bauernverband SBV Beiträge für Marketingkommunikation
GalloSuisse
Emmentaler Switzerland
Beiträge für Marketingkommunikation
Beiträge für Werbung, Public Relations, Messen und Ausstellungen
Interprofession du Vacherin Fribourgeois Beiträge für Werbung, Public Relations, Messen und Ausstellungen
Schweizer Rindviehproduzenten SRP Beiträge zur Finanzierung eines Ausrottungsprogramms der Bovinen Virus-Diarrhoe (BVD)
Branchenorganisation Milch BOM Beiträge zur zeitlich befristeten Förderung des Butterabsatzes
n Branchenorganisation Milch sucht nach Lösungen für den Milchmarkt
Die zunehmende Liberalisierung des Milchmarktes und die damit verbundene Aufhebung der Milchkontingentierung am 1. Mai 2009 führten am 29. Juni 2009 zur Gründung der Branchenorganisation Milch (BO Milch). Das Ziel dieser Branchenorganisation ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Milchsektors zu stärken. Um die Herausforderungen des Milchmarktes zu meistern, haben die Delegierten an der Versammlung vom 27. November 2009 ein Modell zur Mengenführung von Molkereimilch und Massnahmen zur Finanzierung von Entlastungsmassnahmen bei der Butter beschlossen. Auf Begehren der BO Milch hatte der Bundesrat am 17. Februar 2010 dieses Modell zur Mengenführung bis Ende 2010 auch für Nichtmitglieder verbindlich erklärt. Ebenfalls hat der Bundesrat den befristeten Einzug von Beiträgen zur Förderung des Butterabsatzes für Nichtmitglieder obligatorisch erklärt.
Umsetzungsschwierigkeiten bei der Milchmengenführung
Das dreistufige Mengenführungsmodell mit Vertrags-, Börsen- und Abräumungsmilch sollte dazu beitragen, eine möglichst grosse Milchmenge unter stabilen Vertragsverhältnissen auf den Markt zu bringen und eine marktgerechte Versorgung sicherzustellen. Die Verträge mussten zwischen Molkereimilchverarbeitern und ihren Lieferanten (Produzentenorganisationen, Produzenten-Milchverwerter-Organisationen und Direktlieferanten) abgeschlossen werden. Mit einer Indexsteuerung der gesamten Vertragsmenge wollte die BO Milch ein Marktgleichgewicht herstellen. An der Börse musste die vertragslos erzeugte Milch gehandelt werden, damit die Preisbildung transparent war. Als letzte Stufe, bei sehr tiefen Milchpreisen an der Börse, hätte die Marktabräumung beschlossen werden können.
Im September 2010 hatte die BO Milch die beschlossenen Instrumente analysiert und aus der Erkenntnis die Möglichkeiten und Grenzen einer nationalen Mengensteuerung diskutiert. Im weitgehend liberalisierten System sollen die Marktakteure für die Mengensteuerung mehr Eigenverantwortung übernehmen und somit einen Beitrag zur Marktstabilität leisten. Dazu ist das Vertragswesen durch erhöhte Verbindlichkeit und Transparenz zu stärken. Mit verbindlichen Rahmenbedingungen soll ein Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Wertschöpfung über alle Stufen geleistet werden. Kernelement der Massnahmen ist die produktspezifische Bezahlung des Rohstoffes Milch in Abhängigkeit der am Verkaufspunkt realisierten Wertschöpfung. Diese Abstufung des Milchpreises wird als Segmentierung bezeichnet. Die Segmentierung der Milchmengen soll direkt in jedem Milchkaufvertrag festgelegt werden. Mit der damit angestrebten Transparenz beim Milchkauf erhalten die Produzenten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Mengenplanung.
96 2.1 Produktion und Absatz
Neuer Anlauf der BO Milch
Die Delegiertenversammlung vom 3. Mai 2011 hat neue Selbsthilfemassnahmen beschlossen und entschieden, dem Bundesrat ein Begehren zur Ausdehnung dieser Massnahmen auf Nichtmitglieder zu stellen. Angenommen hat die Versammlung einen Standardvertrag, der zwingend für den ersten und den zweiten Milchkauf in der Branche anzuwenden ist. Dieser Vertrag muss Milchmengen und -preise regeln sowie schriftlich abgeschlossen werden. Weiter muss die vereinbarte Milchmenge im Vertrag in drei Segmente (A, B und C) unterteilt werden; die Anteile je Segment richten sich nach den hergestellten Milchprodukten und deren Wertschöpfung. Ausserdem wurde die Finanzierung von Entlastungsmassnahmen im Bereich Butter sowie die ergänzende Finanzierung der Ausfuhren von Milchrohstoffen in verarbeiteten Produkten beschlossen.
n Bericht Bourgeois «Massnahmen zur Verstärkung der Instrumente des Agrarmarktes»
Am 1. Oktober hat der Nationalrat den Bundesrat beauftragt, in Beantwortung des Postulates Bourgeois vom 3. Juni 2010 (10.3374) einen Bericht über mögliche Massnahmen zur Stärkung der marktwirtschaftlichen Instrumente im Agrarsektor zu erstellen. Das Postulat formuliert fünf Forderungen, deren Inhalt sich auf drei Hauptthemen bezieht: (1) die Möglichkeiten, die Markttransparenz, die Preisweitergabe und die Margenverteilung im Agrarmarkt zu verbessern; (2) die Möglichkeiten, den Produzentenorganisationen weitreichende Befugnisse zur Schaffung von Interventionsfonds zu erteilen; (3) die Möglichkeiten, die Vertragsbildung in den Lebensmittelketten zu fördern, um die Produzenten gegen die negativen Auswirkungen der Preisschwankungen auf den Märkten abzusichern. Das Postulat verlangt zudem, dass die Behandlung dieser Fragen mit einem Vergleich der entsprechenden Instrumente in der EU und in den Nachbarländern verknüpft wird.
Aus den Analysen im Bericht geht hervor, dass die Anliegen des Urhebers des Postulats international geteilt werden. Diese betreffen die Stellung der landwirtschaftlichen Produzenten in den Lebensmittelketten, ihre Verhandlungsposition angesichts einer immer geringeren Anzahl Käufer, die Qualität der verfügbaren Informationen über das Angebot, die Nachfrage und die Preisbildung sowie die Weitergabe von Preiserhöhungen und -nachlässen auf den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette. Der internationale Vergleich zeigt auch, dass die Schweiz einen breiten Mix aus Instrumenten zur Berücksichtigung der Anliegen des Urhebers des Postulats bereit hält.
Der Bundesrat vertritt die Ansicht, dass die vom Gesetzgeber vorgesehenen Instrumente – namentlich die Marktbeobachtung, die Bestimmungen über die Branchen- und Produzentenorganisationen sowie die Verträge – einen nützlichen Beitrag zur Markttransparenz leisten und den Produzentinnen und Produzenten eine breite Palette an Möglichkeiten bieten, um ihre Verhandlungsstärke innerhalb der Land- und Ernährungswirtschaft zu festigen. Das Schwergewicht liegt demnach beim richtigen Einsatz der bestehenden Instrumente seitens der Produzentinnen und Produzenten bzw. ihrer Organisationen.
97 2.1 Produktion und Absatz
2.1.1.3 Absatzförderung
Seit 1999 unterstützt der Bund die Absatzförderung für Schweizer Landwirtschaftprodukte im Rahmen des damals neu geschaffenen Artikel 12 des LwG. Dieses WTO-kompatible Instrument trägt zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft bei zunehmendem Konkurrenzdruck im Inland sowie auf den Auslandmärkten bei.
Die Absatzförderung wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Heute kann eine deutliche Professionalisierung des schweizerischen Agrarmarketings im In- und Ausland festgestellt werden und verschiedene koordinierende Massnahmen des Bundes haben zur effektiven Bündelung der Kräfte geführt. Diese wird vor allem durch die Zuordnung der Bundesmittel auf die einzelnen Produkt-Marktbereiche aufgrund deren Investitionsattraktivität erreicht. Der Bund unterstützt die Absatzförderung für Landwirtschaftsprodukte nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das heisst, dass die Projektträgerschaften mindestens die Hälfte der anfallenden Marketingkosten aus eigenen Mitteln bestreiten müssen.
Mittelverteilung 2010
Lebende Tiere und Embryonen 1,1 % Honig 0,2 %
Eier 1,8 %
Wein 2,5 %
Getreide 0,6 %
Obst 4,0 %
Pilze 0,4 %
Gemüse 1,5 %
Fleisch 8,3 %
Milch und Butter 14,1 %
Käse 39,3 %
Kartoffeln 1,1 %
Ölsaaten 0,7 %
Zierpflanzen 0,7 %
Export Pilotprojekte (Budget) 0,7 %
Überregionale Projekte 4,9 %
Gemeinsame Massnahmen 5,5 %
PMB übergreifende Massnahmen 7,2 %
Öffentlichkeitsarbeit 4,8 %
Quelle: BLW
Um die Wirkung und die Zielausrichtung der Absatzförderung zu überprüfen, betreibt das BLW eine Wirkungskontrolle. In diesem Zusammenhang führt das BLW u.a. alle zwei Jahre eine repräsentative Umfrage durch. Dabei werden die Affinität der Konsumentinnen und Konsumenten für Schweizer Produkte und der Einfluss der Herkunft der Landwirtschaftsprodukte auf deren Kaufentscheidungen untersucht. Die Resultate der aktuellen Befragung bestätigen, dass bei den tierischen Produkten nach wie vor eine sehr hohe Präferenz für Schweizer Produkte besteht. Eier, Fleisch, Milch und Käse führen die aktuelle Rangliste der Präferenz für Schweizer Produkte mit Werten von 60 % und höher an. Aber auch bei Gemüse, Obst, Beeren und Kartoffeln wird zunehmend darauf geachtet, dass die Erzeugnisse aus der Schweiz stammen. Im Jahr 2002 hatten erst rund 46 % der Bevölkerung bei diesen Produkten auf die Schweizer Herkunft geachtet, heute sind es wesentlich mehr.
98 2.1 Produktion und Absatz
Tabelle 27 Seite A27
Bevorzugung von Schweizer Produkten 2010
Eier (463)
Milch und Frischmilchprodukte (490)
Fleisch (ohne Wurstwaren) (473)

Kartoffeln (469)
Käse (488)
Gemüse (487)
Honig (371)
Wurstwaren (444)
Obst / Beeren (485)
Pilze (398)
Kartoffelprodukte (352)
Obstsaft (404)
Speiseöl (479)
Getreideprodukte (445)
Wein (396)
Schnittblumen (341)
Topfpflanzen (264)
Spirituosen (277)
Ausserdem kennen rund 50 % der Schweizer Bevölkerung das Kennzeichen «Schweiz. Natürlich.» und wissen, dass dieses als gemeinsames Erkennungsmerkmal der Marketingkommunikation für Schweizer Landwirtschaftsprodukte wirbt. Rund die Hälfte aller Schweizerinnen und Schweizer erinnert sich spontan (nicht gestützt) an eine Werbekampagne für Nahrungsmittel, welche mit diesem Claim wirbt. Am häufigsten, nämlich von 17 % der Befragten, wurde die Werbung «Schweizer Fleisch – alles andere ist Beilage» genannt. 10 % der Befragten führten spontan die Milchwerbung an.
Super-kombination.
99 2.1 Produktion und Absatz
100 0 20 40 60 80 in %
immer / fast immer meistens ab und zu
Quelle: Demoscope
selten nie weiss nicht / keine Antwort
n Marktoffensive im Ausland
Innerhalb der Qualitätsstrategie haben die Branchenakteure der Land- und Ernährungswirtschaft die «Marktoffensive» als eine der drei Handlungsachsen beschlossen, die es umzusetzen gilt. In diesem Sinne ergreifen Marketingorganisationen aus verschiedenen Produktionsbereichen mit der Unterstützung des BLW Initiativen, welche den Export von Schweizer Landwirtschaftsprodukten weiter erleichtern und die Unternehmen bei der Aneignung von nötigem Knowhow für die Erschliessung neuer Märkte im Ausland unterstützen.
Mit der finanziellen Unterstützung von Pilotprojekten können das Umfeld und die Bedürfnisse exportierender Unternehmen ermittelt und geeignete Instrumente bzw. Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, um neue Märkte effizienter zu erschliessen. Es werden Anreize für die Branchenorganisationen verschiedener Produktionsbereiche und die ihnen angeschlossenen Unternehmen geschaffen, damit diese erste Exporterfahrungen sammeln bzw. das spezifische Knowhow für einen neuen Markt erwerben können.
Exportmassnahmen als Ergänzung zur Absatzförderung
Die für die Erschliessung neuer Märkte erforderlichen Massnahmen ergänzen das Instrumentarium zur Absatzförderung und setzen vor der Kommunikation an. Denn Unternehmen haben zahlreiche Vorkehrungen zu treffen, bevor sie in einen neuen Markt exportieren können. Oft muss das Produkt anhand von Marktstudien bei den Konsumentinnen und Konsumenten getestet und bisweilen gar sein Rezept angepasst werden. Die Suche und Auswahl des geeigneten Geschäftspartners ist für ein Unternehmen, das sich in den Export wagt, eine entscheidende Etappe. Zudem muss das Unternehmen sein Angebot bekannt machen und seine Produkte an Fachmessen präsentieren. Um Zutritt zu einem Zielmarkt in einem anderen Land zu erhalten, muss ein Unternehmen sich auf die Einhaltung von im Drittland gültigen Normen (z.B. Hygienenormen) kontrollieren lassen und den Beweis der Konformität mit den Anforderungen erbringen. Die Etappen der Markterschliessung können so mehrere Jahre in Anspruch nehmen, bevor bezüglich der Exportmenge greifbare und dauerhafte Ergebnisse erzielt werden. Und es kann durchaus auch vorkommen, dass dieser Prozess nach mehreren Investitionsjahren in Ermangelung von Resultaten abgebrochen werden muss. Mit einer staatlichen Starthilfe für Exportprojekte, die von einer Branchenorganisation gemanagt und koordiniert werden, könnten die gewünschten Ergebnisse schneller erzielt und das Unternehmensrisiko geschmälert werden. Eine Finanzhilfe der öffentlichen Hand, die gemäss dem Subsidiaritätsprinzip gesprochen würde, könnte mehr Unternehmen dazu ermuntern, sich an eine Markterschliessung heranzuwagen und sich dieses spezifische Knowhow im Exportbereich anzueignen. So wären die Unternehmen besser gewappnet, um ihr Produktionsvolumen beizubehalten oder gar auszubauen und der zunehmenden Öffnung der Märkte standzuhalten. Die EU und verschiedene europäische Länder wie Deutschland, Österreich und Holland verfügen bereits über solche Exportförderungsinstrumente für ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Im Rahmen der Agrarpolitik 2014–2017 sollten solche spezifischen Instrumente auch in der Schweiz eingeführt werden können.
100 2.1 Produktion und Absatz
Schaffung des Infoportals agroexport@blw.admin.ch
Die ersten Export-Pilotprojekte wurden im Juni 2009 mit Herstellern von Käsespezialitäten und Fleischerzeugnissen lanciert. 2010 starteten dann zwei Projekte in den Bereichen Bio-Produkte und Tiergenetik. Heute sind es insgesamt vier Marketingorganisationen, welchen elf Unternehmen angeschlossen sind, die Erfahrungen innerhalb der Pilotprojekte sammeln.
Nach den ersten Rückmeldungen zur Projektentwicklung im Jahr 2010 haben die Bundesämter BLW, SECO, BVET und BAG beschlossen die Arbeiten innerhalb der Bundesverwaltung und mit den Branchenverbänden in einer Arbeitsgruppe «Marktöffnung» zu koordinieren. Zum einen geht es darum, die Aktivitäten in Zusammenhang mit Exportprojekten sowohl bei bereits erschlossenen Märkten wie auch in potenziellen «neuen» Zielländern abzustimmen. Zum anderen dient die Arbeitsgruppe als Informationsplattform. So soll beispielsweise die Kommunikation mit den Branchenverbänden im Zusammenhang mit Verhandlungen zu Freihandelsabkommen intensiviert werden oder die Verwaltung kann über die Exportbestrebungen der Unternehmen informiert werden. Den Branchen und Unternehmen wird damit eine zentrale Plattform für alle Anliegen im Zusammenhang mit Exportprojekten zur Verfügung gestellt. Fragen und Anliegen können per E-Mail unter folgender Adresse an das Infoportal gesendet werden: agroexport@blw.admin.ch.
2.1.1.4 Kennzeichnung von Landwirtschaftsprodukten
n Aktueller Stand des GUB/GGA Registers
Das BLW hat 2010 zwei GUB/GGA Eintragungsgesuche gutgeheissen. Am 31. März wurde im Schweizerischen Handelsblatt das Gesuch um Eintragung von «Absinthe», «Fée verte» bzw. «La Bleue» als geschützte geografische Angabe (GGA) publiziert. Das geografische Gebiet, in dem diese Spirituose produziert wird, erstreckt sich über den gesamten Bezirk Val-de-Travers im Kanton Neuenburg. Im Anschluss an die öffentliche Auflage des Pflichtenhefts gingen 42 Einsprachen aus dem In- und Ausland ein. Am 13. Juli wurde das Gesuch zur geschützten Ursprungsbezeichnung (GUB) «Bündner Bergkäse» öffentlich aufgelegt, was 14 Einsprachen – alle aus denselben Motiven – nach sich zog.
Beim BLW gingen drei neue Eintragungsgesuche ein: zwei GUB für Zuger Kirsch und Glarner Alpkäse und eine GGA für Zuger Kirschtorte. Das Gesuch um Eintragung von Tomme vaudoise als GGA wurde von der gesuchstellenden Gruppierung zurückgezogen.
Daneben wurden Änderungsgesuche eingereicht für die Pflichtenhefte von Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse (GUB), Walliser Roggenbrot (GUB) und Walliser Raclette (GUB) sowie St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (GGA) und Walliser Trockenfleisch (GGA). Ausserdem hat das Bundesgericht in seinem Urteil vom 10. Dezember 2010 die Verfügung des BLW bestätigt, den Zusatz von Schweinsrüssel in der Saucisson vaudois (GGA) nicht zuzulassen.
Derzeit werden die Eintragungsgesuche für Boutefas, Jambon de la borne und Huile de noix vaudoise als GUB sowie für Glarner Kalberwurst als GGA geprüft. Das einzige ausländische Eintragungsgesuch – für Café de Colombia als GGA – wird gegenwärtig geprüft, und für das Eintragungsgesuch von Bois du Jura als GUB fehlt noch immer die Rechtsgrundlage, die eine Eintragung von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen ermöglichen würde.
101 2.1 Produktion und Absatz
GUB/GGA Register am 31. Dezember 2010
Bezeichnung Schutz Betriebe Unternehmen Zertifizierte Zertifizierte ZertifizieProduktions- Produktions- rungsstelle menge menge 2009
102 2.1 Produktion und Absatz
2010 Anzahl Anzahl t t Käse L’Etivaz GUB 69 1 383 445 OIC Emmentaler GUB 4 146 197 25 723 27 058 OIC Gruyère GUB 2 288 242 28 420 28 164 OIC Sbrinz GUB 135 13 1 566 1 534 ProCert Tête de Moine GUB 299 10 2 213 2 151 OIC Formaggio d’alpe ticinese GUB 40 210 260 OIC Vacherin fribourgeois GUB 1 070 100 2 400 2 536 OIC Vacherin Mont-d’Or GUB 191 18 547 550 OIC Berner Alpkäse/Hobelkäse GUB 38 472 1 205 1 129 OIC Walliser Raclette GUB 290 18 - 815 OIC Bloderkäse-Werdenberger GUB - 7 - 0,03 ProCert Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse Fleischwaren Bündnerfleisch GGA 24 958 914 ProCert Longeole GGA - - - - OIC Saucisse d’Ajoie GGA 11 55 56 OIC Walliser Trockenfleisch GGA 29 507 485 OIC Saucisson neuchâtelois GGA 12 124 121 OIC Saucisse neuchâteloise Saucisson vaudois GGA 15 806 1 099 ProCert Saucisse aux choux vaudoise GGA 35 780 651 ProCert Spirituosen Eau-de-vie de poire du Valais GUB 193 19 92 814 Liter OIC 100 %-iger Alkohol Abricotine/Eau-de-vie GUB 12 2 - - OIC d’Abricot du Valais Andere Erzeugnisse Rheintaler Ribel GUB 7 2 29 36 ProCert Cardon épineux genevois GUB 3 1 69 75 ProCert Walliser Roggenbrot GUB 57 78 756 714 OIC Munder Safran GUB 20 0,00033 0,00049 OIC Poire à Botzi GUB 4 0 41 35 ProCert St. Galler Bratwurst/ GGA - 22 - 2 620 OIC St. Galler Kalbsbratwurst IGP ProCert SQS q.inspecta Quelle: BLW
n Biolandbau – Trendwende in Sicht
Während mehreren Jahren wurde, trotz Wachstum des Biomarktes, eine Stagnation oder gar eine leichte Abnahme sowohl bei der Anzahl Schweizer Biobetriebe als auch bei der biologisch bewirtschafteten Fläche beobachtet. Für das Jahr 2011 zeichnet sich nun eine Trendwende ab: erstmals seit 2004 sind wieder mehr Neuanmeldungen als Aussteiger zu verzeichnen. Die Zahl der Neuanmeldungen für den Biolandbau hat sich per 1. Januar 2011 im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt. 2010 produzierten 5 521 Betriebe nach Bio-Suisse-Richtlinien. Mit den ca. 400 nach Bioverordnung des Bundes produzierenden Betrieben macht dies rund 11 % aller Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz aus. Auch der Biomarkt entwickelte sich erfreulich: Er setzte sein dynamisches Wachstum fort und steigerte den Umsatz um 6,1 % auf 1,639 Mrd. Fr. Diese positive Marktentwicklung, die sich auch in den Produzentenpreisen und in den Betriebsergebnissen wiederspiegelt, ist der Hauptmotor für die nun wieder zunehmende Umstellung auf Bio. Doch erfolgt das Wachstum des Gesamtmarktes nach wie vor zu einem grossen Teil mit Importware. Rückwirkend auf Anfang 2010 hat der Bundesrat die Flächenbeiträge für die biologisch bewirtschafteten Spezialkulturen sowie für die übrige offene Ackerfläche um jeweils 150 Fr. pro ha auf 1 350 Fr. beziehungsweise 950 Fr. erhöht. Bio Suisse, der Dachverband der Schweizer Biobauern, hat zudem verschiedene Massnahmen lanciert, um mehr Bauern zum Umsteigen zu motivieren. Auch diese positiven Signale lassen erwarten, dass wieder vermehrt Betriebe auf den Biologischen Landbau umsteigen werden.
n Besserer Schutz für Berg- und Alpprodukte
Seit dem 1. Januar 2007 reserviert die Berg- und Alpverordnung (BAIV; SR 910.19) die Begriffe «Berg» und «Alp» für landwirtschaftliche Erzeugnisse und daraus hergestellte Lebensmittel aus dem Berggebiet und der Alpwirtschaft und schützt damit die Konsumentinnen und Konsumenten vor Täuschung. Die BAIV bietet den Produzenten und Verarbeitern ein Instrument zur Angebotssegmentierung und Produktdifferenzierung und schützt sie vor unlauterem Wettbewerb. Echte Erzeugnisse aus dem Berggebiet und aus der Alpwirtschaft sollen künftig noch besser geschützt werden. Mit der Revision der Verordnung, die per 1. Januar 2012 in Kraft treten soll, werden in erster Linie die Anforderungen an die Kontrolle und Zertifizierung der Berg- und Alpprodukte präzisiert. Neu sollen auch Alpkäse und andere Alpprodukte dem Kontrollverfahren unterstehen und zertifiziert werden. Das Kontrollverfahren soll einfach, aber effizient ausgestaltet werden und die Authentizität und Glaubwürdigkeit der Alpprodukte weiter verbessern. Neu sollen auch Übersetzungen der in der Schweiz gebräuchlichen Sprachen sowie abgeleitete Begriffe besser geschützt werden. Damit soll verhindert werden, dass Phantasiebezeichnungen wie z.B. «Alp Beef» oder «Mountain Tea» zur Umgehung der Berg- und Alpverordnung verwendet werden können. Ebenfalls wird die Verwendung der Bezeichnung «Alpen» eingeschränkt. Die Bezeichnung «Alpen» darf für Milch und Milchprodukte sowie Fleisch und Fleischprodukte nur noch verwendet werden, wenn diese die Anforderungen der BAIV erfüllen und zertifiziert sind. Im europäischen Kontext ist die BAIV bislang einzigartig. Sie könnte durchaus als Modell für eine gemeinsame, länderübergreifende Definition von Berg- und Alpprodukten im europäischen Berggebiet dienen.
103 2.1 Produktion und Absatz
2.1.1.5 Qualitätssicherung
Um die Einhaltung verschiedener privat oder öffentlich-rechtlich definierter Qualitätsanforderungen sicherzustellen, braucht es spezifische Qualitätssicherungsmassnahmen wie z.B. Kontrollen, Zertifizierungen und Akkreditierungen. Diese Massnahmen verlangen von den einzelnen Akteuren grosse Anstrengungen, welche zwar vom Markt gefordert, aber nicht immer durch diesen abgegolten werden. Mit dem Ziel einer konsequenten Ausrichtung der schweizerischen Land- und Ernährungswirtschaft auf die Qualitätsstrategie macht es Sinn, wenn der Bund sich an der Finanzierung von Qualitätssicherungsdiensten beteiligt. Die gesetzliche Grundlage zur Unterstützung der Qualitätssicherung (Art. 11 LwG) ist vorhanden. Sie lässt jedoch Ermessens- und Interpretationsspielraum bezüglich der Möglichkeit der Finanzierung von kollektiven Qualitätssicherungsdiensten offen. Mittelfristig ist deswegen die Erarbeitung einer Verordnung vorgesehen, welche die Transparenz in Bezug auf die Kriterien und die Mittelverteilung gewährt.
Um festzulegen, unter welchen Voraussetzungen eine Finanzierung gewährt wird und welche Aktivitäten im Rahmen eines Qualitätssicherungsprogrammes finanziert werden, hat das BLW erste Pilotprojekte im Bereich der Qualitätssicherung mitfinanziert. Für die Jahre 2009 und 2010 wurde ein SwissGAP-Projekt im Bereich Früchte und Gemüse sowie Kartoffeln gutgeheissen und ein weiteres Pilotprojet zur Kontrolle des Qualitätssicherungsprogramms QM-Schweizerfleisch wurde im Jahr 2010 mitfinanziert. Angesichts des Subsidiaritätsprinzips und des Bestrebens, dass öffentliche Gelder direkt den Landwirten zugutekommen sollten, ist die Finanzierung des Bundes primär auf die Beteiligung der Produzenten an Qualitätssicherungssystemen ausgerichtet mit dem Hauptziel, die Qualitätssicherungskosten für die Landwirte zu senken.

104 2.1 Produktion und Absatz
2.1.1.6 Instrumente des Aussenhandels
n Änderungen bei den Rechtsgrundlagen und Vollzug der Einfuhrregelungen
Die Einfuhrregelungen bleiben weiterhin ein wichtiges Instrument für die Schweizer Landwirtschaft im Aussenhandelsbereich. Nachdem in den Vorjahren etliche Vereinfachungen für Importeure und beim Vollzug umgesetzt wurden, stand im Jahr 2010 die Vorbereitung der Neugestaltung der Agrareinfuhrverordnung im Vordergrund. In dieser Verordnung gibt es Regelungen zu über 1 500 Zolltarifnummern. Über 20 % dieser Nummern werden auf den 1. Januar 2012 geändert, da im schweizerischen Generaltarif eine Revision des internationalen Harmonisierten Systems umgesetzt wird. Somit besteht ein guter Anlass, die Verordnung ebenfalls neu zu strukturieren und einer Totalrevision zu unterziehen. Ein wichtiges Ziel dabei ist, mit einer neuen Darstellung und mit dem konsequenten Ausschreiben der Tarifnummern in der achtstelligen Form die heutigen Möglichkeiten der Suche in der elektronischen Verordnungsfassung und im Internet zu erleichtern. Insbesondere soll die Suche im elektronischen Gebrauchstarif, der unter www.tares.ch veröffentlicht ist, vereinfacht werden. Zum Beispiel steht in der Verordnung die Nummer 0102.1010: wir übertragen mit Copy-Paste die Nummer ins Suchfenster des Tares und erhalten die Auskunft, dass es sich um «reinrassige Zuchttiere der Rindviehgattung innerhalb des Zollkontingents eingeführt» handelt.
Neben der Vorbereitung auf die Totalrevision der Agrareinfuhrverordnung wurden einige Änderungen bereits im Berichtsjahr umgesetzt. Erwähnenswert ist das schrittweise Herabsetzen des Zollansatzes für Zucker, das dazu führte, dass Zucker ab dem 1. Dezember 2010 zollfrei in die Schweiz eingeführt werden konnte. Auch die Zollbelastungen von Getreide zur menschlichen Ernährung und von verarbeitetem Getreide (Mehle) wurden gesenkt. Erhöht wurde hingegen das Zollkontingent für Pferde, und zwar unbefristet um 500 Tiere pro Jahr. Die Beispiele zeigen, dass der Agrarschutz im Sinne eines verstärkten Wettbewerbs in der Landwirtschaft und deren nachgelagerten Stufen weiter gesenkt wurde.
Die Änderungen bei den Einfuhrregelungen sind im Bericht des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen 2010 detailliert aufgeführt. Im Rahmen dieses Berichts wird auch die Zuteilung der Zollkontingentsanteile veröffentlicht. Auf der BLW-Webseite unter dem Thema Ein- und Ausfuhr (www.import.blw.admin.ch) ist diese «Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingentsanteile» und der Bericht unter «Weiterführende Informationen» zu finden.
Ergebnisse der Versteigerungen für die Kontingentsperiode 2010
Ein bedeutender Teil des Vollzugs der Einfuhrregelungen ist die Verteilung der Zollkontingente. Bei Zollkontingenten, die nicht mit dem einfachsten Verfahren, also in der Reihenfolge der Zollanmeldungen («Windhund an der Grenze») verteilt werden können, wird oft das Versteigerungsverfahren angewendet. Bei dieser Verteilmethode wird ein Zollkontingent entweder ganz oder in mehrere Tranchen aufgeteilt und zu verschiedenen Zeitpunkten vor oder während der Kontingentsperiode zur Versteigerung ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgt jeweils im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sowie auf der BLW-Webseite und kann auch mit einem Newsletter per E-Mail abonniert werden. Das BLW führte für die Kontingentsperiode 2010 rund 100 Versteigerungen durch, verteilt auf verschiedene Teilzollkontingente und Einfuhrperioden (vgl. Tabelle).
105 2.1 Produktion und Absatz
Ergebnisse der Versteigerungen für die Kontingentsperiode 2010
Produktbereich und Versteigerungsprodukte
1 Stk.: Stück, kg br.: Bruttogewicht in Kilogramm, kg net: Nettogewicht, kg ÄQ: Äquivalente der Frischware bei Verarbeitungsprodukten, deren Nettogewicht mit fixen Faktoren umgerechnet wird, kg 82 %MFG: kg netto Butter mit einem Milchfettgehalt von 82 %, Einfuhren unter Tarifposition 0405.9010 werden mit dem Faktor 1,21 in kg 82 %MFG umgerechnet
2 Zollkontingente Nr. 21 und Nr. 31 (autonomes Zollkontingent mit Zuteilung aufgrund der Exportleistung)
Quelle:
106 2.1 Produktion und Absatz
Fleisch inkl. Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukte und Zuchttiere Geflügelfleisch kg br. 46 500 000 1,98 100 5 68 Schweinefleisch kg br. 3 050 000 1,00 100 5 25 Fleisch von Tieren der Schafgattung kg br. 5 355 000 2,74 90 6 45 Fleisch von Tieren der Ziegengattung kg br. 330 000 0,50 100 2 14 Fleisch von Tieren der Pferdegattung kg br. 5 180 000 0,34 100 5 16 Kalbfleisch kg br. 382 500 8,30 90 4 24 Kalbslebern kg br. 135 000 0,19 90 5 8 Nierstücke / High-Quality-Beef kg br. 4 365 000 11,40 90 13 65 Schlachtkörper Verarbeitungskühe kg br. 6 210 000 0,93 90 9 16 Verarbeitungsfleisch von Kühen kg br. 45 000 1,64 90 1 19 Zungen kg br. 189 000 0,02 90 5 3 Ochsenmaul kg br. 171 000 0,13 90 4 5 Rindfleisch (Koscher) kg br. 311 700 0,06 100 5 2 Rindfleisch (Halal) kg br. 350 000 1,56 100 4 7 Schaffleisch (Koscher) kg br. 20 700 0,10 100 5 2 Schaffleisch (Halal) kg br. 175 000 1,61 100 4 6 Luftgetrockneter Schinken aus EU kg br. 3 507 200 8,13 100 1 82 Luftgetrocknetes Trockenfleisch EU kg br. 1 410 350 7,96 100 1 55 Wurstwaren aus der EU kg br. 4 086 500 3,70 100 1 94 Dosen- und Kochschinken kg br. 71 500 7,34 100 1 121 Rindfleischkonserven kg br. 770 000 0,43 100 1 11 Milchpulver kg net 300 000 0,51 100 2 3 Butter kg 82 %MFG 100 000 0,15 100 1 2 Tiere der Rindviehgattung Stk. 1 200 91,23 100 2 16 Pflanzliche Produkte Schnittblumen kg br. 200 000 0,90 2 1 27 Kartoffelhalbfabrikate zur Saucenund Suppenherstellung kg ÄQ 330 000 0,02 100 1 2 andere Kartoffelhalbfabrikate kg ÄQ 1 150 000 0,02 100 1 6 Kartoffelfertigprodukte kg ÄQ 2 500 000 0,63 100 1 23 Erzeugnisse aus Kernobst kg ÄQ 244 000 0,45 38 1 12 Obst zu Most- und Brennzwecken kg net 172 000 0,01 100 1 2
BLW Einheit 1 Versteigerte Menge Zuschlagspreis, Durchschnitt Versteigerter Anteil am gesamten (Teil-) Zollkontingent Versteigerungen 2010 Teilnehmer je Ausschreibung Anzahl Einheiten Fr./Einheit % Anzahl Anzahl, bzw. durchschnittliche Anzahl
Im Fleischbereich wurden 2010 wie im Vorjahr von gegen 100 Betrieben Sicherstellungen in Form von Bankgarantien und Solidarbürgschaften für rund 22 Mio. Fr. geleistet. So konnten sich die Firmen von der Verpflichtung befreien, vor der Einfuhr der Waren zum Kontingentszollansatz (KZA) den Zuschlagspreis zu bezahlen. Die Sicherstellungen erlaubten den Firmen nicht nur, umgehend die ersteigerten Kontingentsanteile auszunützen, dank ihnen wurde auch die Verwaltung bei der Kontrolle der Einfuhren und Zahlungen entlastet und Verfahren zur Nachforderung von hohen Einfuhrabgaben verhindert.
Weitere Vollzugstätigkeiten bei der Ein- und Ausfuhr
Das BLW hat 2009 vom Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) die Aufgabe übernommen, Echtheitszeugnisse für den Export von Bündnerfleisch auszustellen. Auf dem in der BLW-Webseite integrierten Portal «Ausfuhr von Agrarprodukten» kann das BLW deshalb den Ausnützungsstand des EU-Zollkontingents für Schweizer Bündnerfleisch genau angeben. Im 2010 wurde das Nullzollkontingent von 1 200 t bereits Ende Juli ausgeschöpft, während im Vorjahr die volle Menge erst Mitte Oktober exportiert war. Um die Echtheit des Schweizer Bündnerfleischs zu bestätigen, brauchte es 53 Zertifikate.
Viele Einfuhren von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie z.B. Wein oder diverse Erzeugnisse aus Fleisch sind bewilligungspflichtig. Oft sind sie zusätzlich mit Zollkontingenten mengenmässig beschränkt, das heisst, nur eine bestimmte Menge darf zum günstigeren Kontingentszollansatz (KZA) importiert werden. Aufgrund von besonderen Verhältnissen, namentlich für Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen, kann das BLW und bei kleineren Mengen auch die Zollverwaltung bewilligungsfreie Einfuhren zulassen. Unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. bei Gratisabgabe der Produkte zur Degustation, ist es möglich, die Einfuhr zum KZA zu gestatten. In enger Zusammenarbeit mit dem SECO und der Zollverwaltung konnte das BLW im Jahr 2010 gegen 50 derartige Anträge bewilligen, das sind 50 % Bewilligungen mehr als 2009. Von dieser Praxis dürften auch Schweizer Exporteure profitieren, denn sie können ähnliche Erleichterungen erwarten, wenn sie ihre Produkte im Ausland präsentieren wollen.
n Ein- und Ausfuhren von verarbeiteten Agrarprodukten
Mit dem Ziel, das agrarpolitisch bedingte Rohstoff-Preishandicap der schweizerischen Nahrungsmittelindustrie auszugleichen und damit den Absatz von Schweizer Rohstoffen abzusichern, besteht an der Grenze ein Preisausgleichssystem für verarbeitete Agrarprodukte («Schoggigesetz»). Importzölle verteuern die in den importierten Verarbeitungsprodukten enthaltenen Grundstoffe auf das inländische Preisniveau, während Ausfuhrbeiträge bestimmte Grundstoffe in Verarbeitungsprodukten beim Export verbilligen.
Das «Schoggigesetz» ist nur indirekt ein agrarpolitisches Instrument, es gleicht jedoch agrarpolitisch bedingte Preisunterschiede aus. In den letzten Jahren konnte das ordentliche Budget den Bedarf für den Rohstoffpreisausgleich nicht mehr decken, worauf insbesondere mit Nachtragskrediten und Kürzungen der Ausfuhrbeitragsansätze reagiert wurde. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Bund aus Budgetgründen zukünftig nicht mehr immer einen vollständigen Preisausgleich für die betroffenen Rohstoffe gewährleisten kann. Zudem ist festzustellen, dass diese Exportsubventionen, wie auch andere Rückerstattungen, unter internationalem Druck stehen. Im Abschnitt 3.1 Internationale Entwicklungen wird diese Problematik thematisiert.
Bereits anfangs 2010 war klar, dass mit dem ordentlichen Budget von 70 Mio. Fr. nicht der vollständige Preisausgleich für die erwarteten Mengen gewährleistet werden konnte. Deshalb wurden bundesseitig vom 1. Mai bis 31. Dezember 2010 nur noch 50 % des Rohstoffpreisausgleichs gewährleistet. Damit zumindest diese Teilkompensation garantiert werden konnte, wurde ein Nachtragskredit eingereicht, der im Dezember 2010 vom Parlament gutgeheissen wurde.
107 2.1 Produktion und Absatz
Die Schweiz weist für die verarbeiteten Agrarprodukte wertmässig eine positive Aussenhandelsbilanz aus. Nach hohen Zuwachsraten in den Vorjahren (+96 % von 2005 bis 2008) waren die Exporte in den letzten drei Jahren relativ konstant (+7 % von 2008 bis 2010). Auch die Einfuhren verblieben in den letzten drei Jahren auf praktisch gleich hohem Niveau. Der mit Abstand wichtigste Handelspartner für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte ist die EU mit einem Exportanteil von 66 % und einem Importanteil von 81 %.
108 2.1 Produktion und Absatz
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten Mio. Fr. Quelle: EZV 0 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 2005 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Ausfuhren Einfuhren Entwicklung Schoggigesetz-Budget Mio. Fr. Quelle: EZV 0 200 180 160 140 100 120 80 60 40 20 1991/92 2010 2009 2006 2007 2008 Nachtragskredit Ordentliches Budget
2.1.2 Milchwirtschaft
Seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 hat sich der Milchmarkt weltweit etwas entspannt, so dass die internationalen Preise gestiegen sind. Die inländische Milchproduktion blieb im Berichtsjahr gegenüber 2009 auf hohem Niveau konstant. Aufgrund der Absatzprobleme beim Milchfett wuchsen die Lagerbestände an Butter zwischenzeitlich auf über 10 000 t an. Der starke Schweizer Franken erschwerte ausserdem den Export von Käse und Milchprodukten und erhöhte in der Folge den Druck auf den Produzentenmilchpreis.
Seit der Aufhebung der staatlichen Milchkontingentierung auf den 1. Mai 2009 werden in der Branche Massnahmen beraten, welche die Stärkung der vertraglichen Beziehungen auf dem Milchmarkt sowie eine Milchmengenführung zum Ziel haben. Aufgrund unterschiedlicher Interessen der Marktakteure ist es eine grosse Herausforderung, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden. Dies hat u.a. dazu geführt, dass parlamentarische Vorstösse eingereicht wurden, die vom Bundesrat verbindlichere Rahmenbedingungen zur Stabilisierung und Stärkung des Milchmarktes fordern.

Massnahmen für den Schweizer Milchmarkt 2010
Produkt Käse Butter Magermilch Milchpulver Konsummilch, Rahm, Frischmilchprodukte
1 Grenzschutz besteht jedoch gegenüber Nicht-EU Ländern
Quelle: BLW
109 2.1 Produktion und Absatz
Massnahme Grenzschutz 1 n n n n Zulagen n Meldepflicht n n n n n Milchverwertung, Milchproduktion und Milchkaufverträge
n Finanzielle Mittel und statistische Kennzahlen 2010
Gemäss Staatsrechnung 2010 wendete der Bund für Zulagen in der Milchwirtschaft und die Leistungsvereinbarung mit der Administrationsstelle, der TSM Treuhand GmbH, 291,9 Mio. Fr. auf. Als Folge der Aufhebung der Inlandbeihilfen für Butter und Ausfuhrbeihilfen für Käse reduzierte sich der Betrag gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Mio. Fr. oder 2,1 %. Im Berichtsjahr wurden 15 Rp./kg zu Käse verarbeiteter Milch gewährt. Insgesamt wurden 256,3 Mio. Fr. an Zulagen für verkäste Milch ausbezahlt. Die Ausgaben für die Zulage für Fütterung ohne Silage (3 Rp./kg verkäste Milch) erreichten 32,7 Mio. Fr. Für den Vollzug der Milchpreisstützungsverordnung durch die TSM wurden 2,9 Mio. Fr. bzw. 1,0 % des Milchkredits verwendet. Die Inspektionsstelle des BLW führt im Bereich Milch und Milchprodukte regelmässig Kontrollen bei Milchverwertern durch, die Zulagen geltend machen. Im Berichtsjahr wurden 308 Milchverwertungsbetriebe kontrolliert. In 141 Fällen wurden Beanstandungen festgestellt und in 59 Fällen ein Verwaltungsverfahren eingeleitet, von denen Mitte 2011 rund 90 % abgeschlossen waren.
Mit einer Leistungsvereinbarung wird die TSM beauftragt, eine Reihe von Milchdaten und die Gesuche um Auszahlung für die Zulagen für verkäste Milch sowie für die Zulagen für Fütterung ohne Silage zu erfassen. Das Aufgabengebiet umfasst die Bearbeitung von Stammdaten von Milchverwertern und -produzenten als auch von monatlichen und jährlichen Verwertungs-, Vertrags- und Produktionsdaten. Die TSM übermittelt dem BLW zweimal wöchentlich die Informationen über die auszuzahlenden Zulagen je Gesuchsteller. Die zu diesem Zweck von der TSM betriebenen Fachapplikationen ermöglichen eine transparente und sichere Verwaltung der verschiedenen Milchdaten.
Die Milchpreisstützungsverordnung hält zudem fest, dass die TSM Milchverwerter sanktioniert, welche ihre Vertrags-, Produktions-, Verwertungs- und Direktvermarktungsdaten trotz Mahnung nicht melden.
Im Milchjahr 2009/10 (1. Mai 2009 bis 30. April 2010) gab es 14 718 Betriebe mit Milchproduktion im Talgebiet und 11 716 Betriebe im Berggebiet. Gegenüber dem Milchjahr 2008/09 ist damit die Zahl der Milchproduktionsbetriebe um 2,6 % zurückgegangen. Die durchschnittlichen Milcheinlieferungen lagen bei 153 734 kg je Talbetrieb und bei 88 807 kg je Bergbetrieb. Dies entspricht einer Zunahme um 2,3 bzw. 4,6 %. Die durchschnittliche Einlieferung je Kuh erhöhte sich um 203 kg oder 3,6 % auf 5 890 kg. Durchschnittliche
Im Milchjahr 2009/10 haben die ganzjährig bewirtschafteten Milchproduktionsbetriebe rund 3,3 Mio. t und die Sömmerungsbetriebe rund 0,09 Mio. t Milch vermarktet. Die Hälfte der 26 434 Milchproduzenten haben weniger als 100 000 kg Milch vermarktet. Ihr Anteil an der Gesamtproduktion erreichte rund 23 %.
872 Produzenten haben mehr als 350 000 kg Milch vermarktet, mit einem Anteil an der Gesamtproduktion von 13 %.
110 2.1 Produktion und Absatz
Einlieferungen
in kg
je Betrieb
0 180 000 160 000 140 000 100 000 120 000 80 000 60 000 40 000 20 000 2000 / 01 2002 / 03 2004 / 05 2006 / 07 2008 / 09 2009 / 10 Talgebiet Schweiz (ohne Sömmerungsgebiet) Berggebiet
Quelle: BLW
Tabelle 28 Seite A28
Prozentualer Anteil vermarktete Milch nach Grössenklasse der Einlieferungen
n Milchproduktion nach dem 1. Mai 2009
Seit der Aufhebung der Milchkontingentierung am 1. Mai 2009 besteht keine staatliche Beschränkung der produzierten Milchmenge mehr. Die Milchproduzenten haben aber die Pflicht für die von ihnen vermarktete Milchmenge einen Vertrag mit ihrem Erstmilchkäufer abzuschliessen. Der Bund hat somit keine Aufgaben mehr bezüglich der Mengenkontrolle, wie dies noch für das Milchjahr 2008/09 der Fall war. Die Überprüfung der Einhaltung des Produktionspotenzials 2008/09 und der korrekten Verwertung der bewilligten Mehrmengen bei den 38 Ausstiegsorganisationen beanspruchte im Berichtsjahr viel Zeit. 15 Ausstiegsorganisationen wurde das rechtliche Gehör gewährt, weil sie das Produktionspotenzial deutlich überschritten hatten. Insgesamt hat das BLW gegen 24 Organisationen Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 LwG ergriffen. Gegen diese Entscheide haben 9 Organisationen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht hatte bis August 2011 noch keine Entscheide gefällt.
Auf Wunsch der Molkereimilchverwerter publiziert das BLW seit Juli 2009 monatlich einen Molkereimilchpreisindex (Basis 2005 = 100, oder 71,04 Rp./kg). Es handelt sich dabei um eine vergangenheitsbezogene Grösse, welche die Entwicklung der Preise für Detailhandelsprodukte (Konsummilch und -rahm, Butter), für Industrieprodukte (Mager- und Vollmilchpulver, Industriebutter) und für Milch in den angrenzenden Ländern abbildet. Der Molkereimilchpreisindex wird von der BO Milch für die Bestimmung des Richtpreises für Molkereimilch herangezogen. Die Festlegung des Richtpreises liegt in der alleinigen Kompetenz der BO Milch. Der Molkereimilchpreisindex betrug im 2010 durchschnittlich 91,53 Punkte.
Mit dem Rahmpreisindex wird seit Januar 2010 die Entwicklung des Einstandspreises von Rahm, der von den Verarbeitern übernommen wird, monatlich ausgewiesen. Das BLW erhebt die Rahmpreise bei den Butterproduzenten. Die wichtigsten Rahmkäufer melden den durchschnittlichen, gewichteten Einstandspreis und die entsprechenden Mengen. Der Index wird auf der Basis des Rahmpreises von Dezember 2009 berechnet (Basis Dezember 2009 = 100, oder 10.92 Fr./kg Milchfett). Im Januar 2011 erreichte der Rahmpreisindex 95,94 Punkte.
111 2.1 Produktion und Absatz
Anteil vermarktete Milch in % Milchjahr 1999 / 2000 Milchjahr 2004 / 2005 Milchjahr 2009 / 2010 Quelle: BLW 0 25,0 20,0 10,0 15,0 5,0 21–25 000 25 001–50 000 50 001–75 000 75 001–100 000 100 001–125 000 125 001–150 000 150 001–175 000 175 001–200 000 Vermarktete Milch je Betrieb (kg) 200 001–225 000 225 001–250 000 250 001–275 000 275 001–300 000 300 001–325 000 325 001–350 000 > 350 000
n Milchkaufverträge
Ein Instrument der Milchmengenplanung ist die Pflicht für alle Milchproduzenten, einen Milchkaufvertrag abzuschliessen. Artikel 36b des LwG legt zusammenfassend fest, dass Produzentinnen und Produzenten nur dann Milch abliefern dürfen, wenn sie einen Vertrag von mindestens einem Jahr abschliessen, der eine Vereinbarung über Milchmenge und -preise enthält. Direktvermarkter sind für die vermarktete Milch von der Vertragspflicht ausgenommen. Die öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen Milchkaufverträge gelten für den ersten Milchverkauf (Milchproduzent – Erstmilchkäufer). Mit der Vertragspflicht und den verbindlichen Vertragsklauseln wird der Zweck verfolgt, den spekulativen, kurzfristigen Milchkäufen Einhalt zu bieten und den Produzentinnen und Produzenten eine begrenzte Preis- und Absatzsicherheit zu geben. Die Inspektionsstelle des BLW hat im Rahmen ihrer Kontrollen die Umsetzung von Artikel 36b LwG Anfang 2010 bei über 100 Erstmilchkäufern überprüft. Sie stellte unterschiedliche Umsetzungen fest und teilweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Verträge vorhanden, obschon vorgängig Vertragsdaten an die TSM gemeldet wurden. Im Anschluss an das erste Monitoring hat das BLW zusammen mit Branchenvertretern Umsetzungsempfehlungen präzisiert und den Organisationen mitgeteilt.
Mit der am 1. Oktober 2010 von Nationalrat Jacques Bourgeois eingereichten Motion «Stärkung der Milchkaufverträge» (10.3813) soll der Bundesrat beauftragt werden, die Anwendung des Gesetzesartikels zu prüfen, die Vertragspflicht auf die zweiten Milchkäufer auszudehnen, Mindeststandards in den Verträgen festzulegen und auf nationaler Ebene einen Mindestanteil an sogenannter A-Milch (Milch im höchsten Preissegment) in den Verträgen verbindlich zu erklären. Begründet wird der Vorstoss damit, dass Artikel 36b LwG nicht wie vorgesehen angewendet wird und dass der Mangel an klar festgelegten Rahmenbedingungen den Marktakteuren freie Hand lässt, die Spielregeln nach ihrem Gutdünken und je nach Marktlage zu ändern.
Der Bundesrat lehnt die Motion ab, hält in seiner Antwort jedoch fest, dass einige Forderungen des Motionärs zur Stabilisierung des Milchmarktes und zur Stärkung der vertraglichen Beziehungen zwischen Milchverarbeitern und ihren Lieferanten beitragen könnten. Es ist deshalb sinnvoll, dass Standardverträge für den Milchkauf im Sinne von Selbsthilfemassnahmen nach Artikel 8 LwG zunächst in der Branchenorganisation Milch (BO Milch) diskutiert und ausgearbeitet werden. In einem solchen Prozess gilt es, die gemeinsamen Interessen aller Stufen der Wertschöpfungskette zu identifizieren, um tragfähige und praxisbezogene Standards festlegen zu können. Die BO Milch kann beurteilen, ob die vertragliche Festlegung eines minimalen Anteils von Milch im höchsten Preissegment auf nationalem Niveau zielführend ist. Auch Standards für weitere Vertragselemente, wie Kündigungsfristen, ausserordentliche Kündigungsmöglichkeiten und Sanktionen kann sie festlegen. Wenn die Voraussetzungen nach Artikel 9 LwG erfüllt sind, kann die BO Milch dem Bundesrat bei Bedarf ein Begehren stellen, damit die beschlossenen Standardverträge auch für Nichtmitglieder allgemeinverbindlich erklärt werden.
n Branchenorganisation Milch
Die BO Milch ist die Plattform der schweizerischen Milchwirtschaft. Mitglieder sind rund 50 nationale und regionale Organisationen der Milchproduzenten und der Milchverarbeiter sowie Einzelfirmen der Industrie und des Detailhandels. Die Mitglieder vereinigen rund 90 % der Schweizer Milchmenge. Die BO Milch bezweckt gemäss Statutenauftrag die Stärkung der Wirtschaftlichkeit ihrer Mitglieder aus der Schweizer Milchwirtschaft durch Erhalt und Förderung der Wertschöpfung und der Marktanteile in den in- und ausländischen Märkten. Die konkreten Massnahmen der BO Milch sind in Kapitel 2.1.1.2 beschrieben.
112 2.1 Produktion und Absatz
n Milchmengensteuerung
Mit der am 16. Juni 2010 von Nationalrat Andreas Aebi eingereichten Motion «Milchmengensteuerung für marktgerechte Milchmengen» (10.3472) soll der Bundesrat beauftragt werden, der Organisation der Schweizer Milchproduzenten (SMP) auf Gesuch hin die «Allgemeinverbindlichkeit» (Ausdehnung auf Nichtmitglieder) für ein Mengensteuerungsmodell zu erteilen. Das Modell sieht vor, dass die Basismilchmenge pro Handelsorganisation oder pro Verarbeitungsunternehmung für Direktlieferanten, gemäss den Lieferrechten des Milchjahres 2008/09, ohne Mehrmengen, festgelegt wird. Gestützt auf eine jährliche Mengenplanung sollen die SMP bei den PO/PMO bzw. Verarbeitungsunternehmungen auf über dieser Menge gemolkener Milch eine Abgabe von bis zu 30 Rp./kg Milch erheben, wenn das Produktionswachstum grösser ist als das Wachstum der Nachfrage zu guter Wertschöpfung.
Der Bundesrat lehnt die Motion ab, weil sie zu einem Angebotsmonopol führen und folglich die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern würde. Trotz ablehnendem Antrag des Bundesrates hat der Nationalrat die Motion in der Herbstsession 2010 angenommen. Der Ständerat hat nach einer intensiven Debatte die Motion Aebi in der Frühjahrssession 2011 an seine vorberatende Kommission zurückgewiesen. Den gleichen Beschluss fasste der Ständerat zur Motion seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben, welche den Bundesrat einlädt, Selbsthilfemassnahmen der BO Milch längstens während zweier Jahre zu unterstützen.
n Auswertungsplattform Milchdaten
Das Projekt «Auswertungsplattform Milchdaten» (AMD) wird wegen technischen Schwierigkeiten bei der Software und sich noch im Aufbau befindendem Knowhow beim Betreiber sistiert. Wenn das Projekt Astat-2 dereinst erfolgreich beendet sein wird und ab diesem Zeitpunkt für die Auswertung der Milchdaten echte Bedürfnisse entstehen, so kann auf die archivierten Dokumente von AMD zurückgegriffen werden. AMD hat dem Nachfolgeprojekt Astat-2 sowie weiteren Business Intelligence (BI) Projekten im EVD mit seiner Pionierarbeit im BI-Tool-Bereich massgeblich den Weg geebnet.
113 2.1 Produktion und Absatz
2.1.3 Viehwirtschaft
Die Viehwirtschaft muss sich stets neuen Herausforderungen stellen, sei dies aus tierseuchenpolizeilichen, wirtschaftlichen, politischen oder zootechnischen Gründen. So wurden im Berichtsjahr bestehende Massnahmen evaluiert und einige neue Massnahmen beschlossen.
Der Bundesrat hat am 12. Mai 2010 entschieden, dass importiertes Kaninchenfleisch aus in der Schweiz nicht zugelassener Haltungsform, insbesondere aus der Käfighaltung, am Verkaufspunkt deklariert werden muss. Die Kennzeichnungspflicht tritt erst am 1. Januar 2012 in Kraft, damit den Marktakteuren im In- und Ausland Zeit für eine mögliche Anpassung bleibt.
Eine vom EVD beauftragte Arbeitsgruppe, bestehend aus acht Vertretern von nationalen Dachverbänden der Schlachtvieh- und Fleischbranche, hat die Einfuhrbestimmungen für Fleisch analysiert und Optimierungen vorgeschlagen. Sie hat in ihrem Bericht vom 6. Oktober 2010 den Einbezug der Branche in die Marktbeurteilung sowie in die Festlegung der Einfuhrmenge und der Einfuhrperiode weiterhin als zweckmässig beurteilt. Punktuelle Verbesserungen sollen bei der Informatik und bei den Ausnützungsvorschriften der zugeteilten Zollkontingentsanteile realisiert werden. Die Arbeitsgruppe schlägt als Hauptlösung vor, einen Teil der Fleischeinfuhren wieder nach Kriterien einer Inlandleistung zu verteilen. Für Rind- und Schaffleisch soll dieser Anteil 50 % und für Geflügel-, Pferde- und Ziegenfleisch 33 % betragen. Die restlichen Importkontingente sowie die weiteren Fleischkategorien sollen wie bislang versteigert werden. Die Produzentenvertreter unterstützen eine Änderung des Importsystems nur unter der Bedingung, dass die finanziellen Bundesmittel zu Gunsten der Landwirtschaft nicht gekürzt werden. Der Bericht der Arbeitsgruppe wurde vom Bundesrat im zweiten Quartal 2011 zusammen mit der Unterlage zur Agrarpolitik 2014–2017 in die Vernehmlassung geschickt.
Die Tiergesundheit ist für die Schweizer Viehwirtschaft von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Im Berichtsjahr wurde die Ausrottung der Bovinen Virus Diarrhoe (BVD) bei Tieren der Rindergattung weitergeführt. Unter den neugeborenen Kälbern sind anteilsmässig immer weniger infizierte Tiere zu verzeichnen. Auf 1 000 neugeborene Kälber kommen nur noch 2 infizierte Tiere. Das Programm zur Ausrottung der BVD geht bis Ende 2011 weiter, um auch die letzten infizierten Kälber zu finden und zu eliminieren. Ebenfalls weiter bekämpft wurde die Blauzungenkrankheit. Diese Krankheit trat im Oktober 2007 zum ersten Mal in der Schweiz auf. Um den hohen Standard der Tiergesundheit zu erhalten, war die Impfung seither obligatorisch, wobei die Kantone 2010 Ausnahmen auf Gesuch hin gewährten. Gegen die Blauzungenkrankheit braucht es 2011 keine staatliche Impfkampagne mehr. Grund dafür sind die erfolgreichen Impfkampagnen 2008–2010, welche die Blauzungenkrankheit in der Schweiz weitgehend getilgt haben.
Das bilaterale Agrarabkommen mit der EU bedingt u.a. die stetige Nachführung der veterinärhygienischen Vorschriften der Schweiz, damit die Gleichwertigkeit der Bestimmungen erhalten werden kann. Davon ist auch die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten betroffen. Sie umfasst u.a. die Verwertung als Tierfutter, die Vergärung in Biogasanlagen und die Verwendung zu technischen Zwecken. Die Verordnung über die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte wurde total revidiert und trat am 1. Juli 2011 in Kraft. Der Bundesrat hat auch das Verbot der Verfütterung von Speiseresten beschlossen, weil die mit der EU vereinbarte Übergangsfrist auf diesen Zeitpunkt ausgelaufen war.
114 2.1 Produktion und Absatz
Massnahmen 2010
Tier/Produkt
Massnahme
Grenzschutz n n n n n n n n
Marktabräumung ab öffentlichen
Märkten n n n
Einlagerungsaktion n n n
Verbilligungsaktion n n n n
Aufschlagaktion n
Verwertungsbeiträge Schafwolle n
Höchstbestände n n n n
Tierverkehr-Datenbank n n n n n n
Infrastrukturbeiträge für öffentliche
Märkte im Berggebiet n n n
Tierzuchtförderung n n n n n n n n
Erhaltung gefährdeter Schweizer Rassen n n n n n n n n
Quelle: BLW
Das bedeutendste Stützungselement für den inländischen Fleischmarkt ist der Grenzschutz mit Zöllen und Kontingenten. Als Massnahme zur temporären Preisstabilisierung auf dem Fleisch- und Eiermarkt richtete das BLW Beihilfen aus. Zur Absatzsicherung müssen ferner Schlachtviehhändler in befristeten Perioden im freien Verkauf nicht absetzbare Tiere auf öffentlichen Märkten übernehmen.

115 2.1 Produktion und Absatz
Rinder Kälber Schweine Pferde Schafe Ziegen Geflügel Bienen Eier
n Finanzielle Mittel 2010
Für Massnahmen in der Viehwirtschaft (ohne Ausgaben für die Tierverkehrskontrolle) und für die Beiträge zur Entsorgung von tierischen Nebenprodukten wurden 57,9 Mio. Fr. verwendet.
Der Betrieb der Tierverkehr-Datenbank (TVD) im Rahmen der Tierverkehrskontrolle kostete 9,2 Mio. Fr. Er wurde durch die Gebühreneinnahmen von 10,5 Mio. Fr. vollständig gedeckt. Für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten richtete die identitas AG im Auftrag des BLW 47,7 Mio. Fr. aus. Etwa ein Drittel dieses Betrags kam den Rindviehhaltern zugute und etwa zwei Drittel den Betrieben, die Tiere der Rinder-, Schaf-, Schweine- und Ziegengattung schlachteten.
Mittelverteilung 2010
Total 92,4 Mio. Fr.
Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 2,2 %
Inlandbeihilfen Schlachtvieh und Fleisch und Infrastrukturbeiträge im Berggebiet 1,2 %
Tierzuchtförderung 37,3 %
Finanzhilfe Qualitätssicherung Fleisch 0,2 %
n Massnahmen auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt
Beiträge Schafwolle 0,8 %
Leistungsvereinbarung Proviande 6,7 %
Entsorgung tierische Nebenprodukte 51,6 %
Quelle: Staatsrechnung
Die Genossenschaft Proviande erfüllt seit dem Jahr 2000 verschiedene Aufgaben auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt. Mit einer Leistungsvereinbarung gestützt auf Artikel 51 LwG hat ihr der Bund die Aufgaben übertragen, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.
Neutrale Qualitätseinstufung
In grossen Schlachtbetrieben muss Proviande die Qualität der geschlachteten Tiere neutral einstufen. Als gross gilt ein Betrieb, wenn er mehr als 120 Schweine oder rund 23 Stück Grossvieh pro Woche schlachtet. Unter gewissen Bedingungen stuft Proviande auch in mittelgrossen und kleinen Betrieben die Qualität der Schlachtkörper ein. Der Klassifizierungsdienst von Proviande hat im Berichtsjahr in 32 Betrieben die Schlachtkörperqualität eingestuft.
Den Ergebnissen der Qualitätseinstufung ist zu entnehmen, dass der Anteil von vollfleischigen und sehr vollfleischigen Muni gegenüber 2009 um knapp 3 % und gegenüber 2005 um 12 % gestiegen ist, und zwar zu Lasten der mittelfleischigen Muni. Die optimale Fütterung und Mast sowie der Einsatz geeigneter Mastrassen hat sich auf die Fleischigkeit der Tiere positiv ausgewirkt. Dieselbe Beobachtung gilt auch für Kälber mit einem Anstieg der sehr vollfleischigen und vollfleischigen Kälber um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 5,2 % gegenüber 2005.
116 2.1 Produktion und Absatz
Tabelle 29 Seite A28
Verteilung der Schlachtkörper auf die Fleischigkeitsklassen 2010
C Fleischigkeitsklasse: H T A X
C = sehr vollfleischig, H = vollfleischig, T = mittelfleischig, A = leerfleischig, X = sehr leerfleischig
Quelle: Proviande
Überwachung von öffentlichen Märkten und Organisation von Markentlastungsmassnahmen
Vor Beginn des Kalenderjahres erstellt Proviande in Übereinkunft mit den Kantonen und den bäuerlichen Organisationen ein Jahresprogramm für öffentliche Schlachtvieh- und Schafmärkte. Dieses beinhaltet Ort und Datum des Marktes sowie die Tierkategorien, die aufgeführt werden können. Das BLW muss dem Jahresprogramm zustimmen. Sowohl bei den durchgeführten Kälber- und Grossviehmärkten als auch bei der Zahl aufgeführter Tiere ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme zu verzeichnen. Bei den Tieren der Schafgattung sind die Zahlen hingegen rückläufig. Auf 331 überwachten Märkten der Schafgattung (–2 %) sank die Zahl der aufgeführten Tiere um 3 920 Tiere oder 4,5 %.
Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten 2010
Das Angebot an Schlachtkälbern überstieg saisonbedingt im Frühling und Sommer die Nachfrage. Zur Stützung der Kälberpreise lagerten deshalb gegen 60 Schlachtbetriebe 247 t Kalbfleisch ein, welches sie im Herbst wieder auslagerten und für die Verarbeitung verwenden konnten. Das BLW zahlte 1,0 Mio. Fr. (ca. 4 Fr. je kg) an die Lagerkosten und an den Wertverlust infolge des Einfrierens.
Merkmal Einheit Kälber Grossvieh Tiere der Schafgattung Überwachte öffentliche Märkte Anzahl 274 728 331 Versteigerte Tiere Anzahl 40 915 59 269 82 527 Durchschnittliche Anzahl Tiere pro Markt Anzahl 149 81 249 Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen % 15,9 15,1 34,0 Zugeteilte Tiere (Marktabräumung) Anzahl 0 758 5 720 Quelle: Proviande
117 2.1 Produktion und Absatz
in %
0 80 70 60 50 40 30 20 10
Kühe
Gitzi Lämmer Kälber Muni
n Massnahmen auf dem Eiermarkt
Besonders nach Ostern sinkt die Nachfrage nach Eiern markant. Um die Auswirkungen saisonaler Marktschwankungen zu mildern, stellte das BLW 2010 nach Anhörung der interessierten Kreise 2 Mio. Fr. für Verwertungsmassnahmen zur Verfügung. Die Eiprodukthersteller schlugen im Berichtsjahr 17,7 Mio. inländische Konsumeier auf und verwerteten Eiweiss und Eigelb in der Industrie. Damit wurde der Konsumschaleneiermarkt entlastet. Die Eierverkäufer ihrerseits verbilligten 11,5 Mio. Konsumeier zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten. Pro aufgeschlagenes Ei war ein Beitrag von 9 Rp. und pro verbilligtes Ei ein Beitrag von 5 Rp. vorgesehen. Weil die beantragten Beiträge sowohl für die Aufschlags- als auch für die Verbilligungsaktionen den maximal zur Verfügung stehenden Kredit von 2 Mio. Fr. überschritten, mussten die Beiträge pro Ei proportional gekürzt werden. Insgesamt nahmen 14 Firmen an der Aufschlagaktion und 9 Firmen an der Verbilligungsaktion teil.
n Massnahmen für die Schafwollverwertung
Gestützt auf die am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Verordnung über die Verwertung der inländischen Schafwolle setzte das BLW die finanziellen Mittel in erster Priorität für innovative Projekte zur Schafwollverwertung ein. In zweiter Priorität erhielten Selbsthilfeorganisationen Beiträge für die Verwertung der inländischen Schafwolle. Diese Organisationen müssen die eingesammelte Wolle mindestens sortieren, waschen und zur Weiterverarbeitung zu Endprodukten abgeben, wobei nur das Waschen ausnahmsweise im Ausland erfolgen darf.
Das BLW unterstützte 2010 sechs innovative Projekte zur Schafwollverwertung mit einer Gesamtsumme von rund 0,5 Mio. Fr. Fünf Selbsthilfeorganisationen haben 82,5 t Schafwolle gesammelt, sortiert und diese gewaschen zur Weiterverarbeitung zu Endprodukten im Inland abgegeben. Der finanzielle Beitrag des Bundes für gewaschene Wolle betrug 2 Fr. je kg, was für das Jahr 2010 einen Betrag von rund 0,17 Mio. Fr. ergab.
n Massnahmen im Bereich Tierverkehr
Die Gesamterneuerung der Tierverkehr-Datenbank (TVD) zeigte ihre ersten Früchte: Am 3. Januar 2011 nahm die neue TVD über das Portal Agate (www.agate.ch) plangemäss ihren Betrieb auf. Aufgeschaltet wurden die TVD Equiden sowie die TVD Schweine. Wegen Verzögerungen konnten bei den Equiden noch nicht alle Funktionalitäten aufgeschaltet werden. Das Wichtigste funktioniert jedoch und die Equideneigentümer können sich und ihre am 31. Dezember 2010 lebenden Equiden registrieren sowie Geburten und Importe melden. Dass der Eigentümer meldepflichtig ist, ist ein Novum im Bereich der TVD und auf die bestehenden Verhältnisse in der Equidenhaltung zurückzuführen. Der Halter ist nämlich oft nicht der Eigentümer. Bei den Schweinen müssen neu gruppenweise die Zugänge (ohne Geburten) gemeldet werden (Anzahl Schweine, Datum, Herkunftsbetrieb). Diese beiden Neuerungen für Equiden und Schweine wurden im Rahmen der Erhaltung der Äquivalenz im tierischen Bereich mit der EU realisiert. Neu ist auch, dass beauftragte Dritte die Meldungen von Meldepflichtigen tätigen können, was vor allem von Schweinehändlern genutzt wird. Die Aufschaltung der fehlenden Funktionalitäten bei der TVD Equiden wurde Ende April 2011 realisiert; die bestehende TVD – vorab das ganze Meldewesen im Rindviehbereich – soll voraussichtlich Ende 2011 auf die neue TVD migriert werden.
Im Zusammenhang mit der neuen Passpflicht für Equiden wurden auf Gesuch hin bis Mitte 2011 vom BLW 13 ausstellende Stellen anerkannt.
Die Applikation AniCalc wurde Mitte September 2010 um das Modul GVE Rechner ergänzt. Mit AniCalc werden die GVE-Werte pro Tierhaltung während der Referenzperiode (vom 1. Mai bis zum 1. Mai des Folgejahres) zwecks Bemessung der rinderabhängigen Direktzahlungen berechnet. Der GVE-Rechner ergänzt dieses Informationssystem, indem die GVE-Werte vom Tierhalter oder von den kantonalen Stellen für einen frei definierbaren Zeitraum in der Vergangenheit berechnet werden können.
118 2.1 Produktion und Absatz
n Förderung der Tierzucht Bundesbeiträge zur Förderung der Tierzucht können nur an anerkannte Tierzuchtorganisationen ausgerichtet werden. Die Gesetzesgrundlage für die Anerkennung von Zuchtorganisationen bildet Artikel 144 LwG. Die Ausführungsbestimmungen sind in der Verordnung über die Tierzucht festgehalten. Diese regelt die Voraussetzungen, welche eine Zuchtorganisation bei Tieren der Rindvieh-, Schweine-, Schaf- und Ziegengattung sowie bei Equiden, Kaninchen, Geflügel, Honigbienen und Neuweltkameliden erfüllen muss, um vom BLW für zehn Jahre anerkannt zu werden.
Nachdem im Jahr 2009 alle grossen Zuchtorganisationen anerkannt wurden, konnten 2010 18 weitere Zuchtorganisationen anerkannt werden. Dabei stellten Zuchtorganisationen für die Gattung Equiden den grössten Anteil an Gesuchen.
An 25 Zuchtorganisationen wurden Beiträge für die Herdebuchführung, die Leistungsprüfungen, Zuchtwertschätzungen, genetische Bewertungen sowie Beiträge für die Durchführung von Projekten zur Erhaltung der Schweizer Rassen von insgesamt 34,4 Mio. Fr. ausgerichtet. Gesamtbeiträge an eine Zuchtorganisation unter 30 000 Fr. (Förderschwelle) wurden nicht ausbezahlt.
70,6 % der Mittel wurden für die Rindviehzucht, weitere 10 % für die Schweinezucht, 5,9 % für die Schafzucht, 5,2 % für die Pferdezucht, 4,9 % für die Ziegen- und Milchschafzucht, 0,1 % für die Neuweltkamelidenzucht sowie 3,3 % zur Erhaltung von Schweizerrassen eingesetzt. Erstmals richtete das BLW 0,2 % der bewilligten Mittel für die Bienenzucht aus.
Mittelverteilung 2010
Schweinezucht; 3 399 027 Fr.; 9,9 %
Ziegen- und Milchschafzucht; 1 796 358 Fr.; 5,2 %
Rindviehzucht; 24 304 246 Fr.; 70,6 %
Schafzucht; 2 016 025 Fr.; 5,9 %
Erhaltung Schweizer Rassen;
1 127 592 Fr.; 3,3 %
Pferdezucht; 1 701 860 Fr.; 4,9 %
Bienen und Neuweltkameliden; 95 833 Fr.; 0,3 %
Quelle: Staatsrechnung
119 2.1 Produktion und Absatz
Total 34,4 Mio. Fr.
Tabelle 30 Seite A29
Erhaltung gefährdeter Schweizer Rassen
Seit 2001 ist die Fachstelle «tiergenetische Ressourcen Nutztiere» im BLW zuständig für die Koordination der in der Schweiz getroffenen Massnahmen zur Erhaltung der Rassenvielfalt. 2010 wurden neun bewilligte Erhaltungsprojekte für Schweizer Rinder-, Pferde-, Schaf-, Ziegen- und Bienenrassen durchgeführt und vom BLW begleitet. Die Fachstelle betreut zudem das European Farm Animal Biodiversity Information System (EFABIS), ein Programm für das Monitoring der Hauptnutztierrassen in der Schweiz. Gestützt auf Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung über die Tierzucht und nach Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung richtet das BLW seit 2010 einen Beitrag an die Langzeitlagerung von tiefgefrorenem Probematerial tierischen Ursprungs aus. Damit verfügt die Schweiz neu über eine nationale Genbank mit Sperma von Schweizer Rassen der Gattungen Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde. Im Rahmen der Weiterbearbeitung des Nationalen Aktionsplans (NAP) zur Bekämpfung der Erosion und zur nachhaltigen Nutzung tiergenetischer Ressourcen organisierte das BLW zusammen mit der Schweizerischen Vereinigung für Tierproduktion im Mai 2010 einen Workshop mit anerkannten Zuchtorganisationen und ausländischen Referenten zur Diskussion der Zuchtziele und zur Eruierung des Handlungsbedarfs. Im Oktober 2010 fand der zweite runde Tisch mit Stakeholders für tiergenetische Ressourcen statt. Die Fachstelle arbeitet auch international aktiv zusammen mit dem European Regional Focal Point (Plattform für den Informationsaustausch über Erhaltungsprojekte) sowie mit der FAO bei der Erarbeitung von Grundlagen für die Erhaltung tiergenetischer Ressourcen. 2010 war das Jahr der Biodiversität. Zur Feier dieses Anlasses gab die Post eine Sonderbriefmarke mit dem Bild der gefährdeten Pfauenziege heraus, welche von der damaligen Bundespräsidentin Doris Leuthard enthüllt wurde.
Überprüfung der Zuchtorganisationen
Zur Kontrolle des verordnungs- und rechtskonformen Einsatzes der Mittel zur Förderung der Tierzucht werden anerkannte Zuchtorganisationen überprüft: Ziel ist es, alle Zuchtorganisationen innerhalb von fünf Jahren mindestens einmal vor Ort zu kontrollieren. 2010 wurden zehn anerkannte Zuchtorganisationen überprüft. Die Inspektion wurde mit einem Bericht bestätigt, welcher allfällige Mängel darlegte und Anweisungen zu deren Behebung unterbreitete.
120 2.1 Produktion und Absatz
2.1.4 Pflanzenbau
Ergänzend zum Grenzschutz wird ein für die Versorgung der Bevölkerung angemessener Pflanzenbau mit Anbaubeiträgen im Ackerbau, Verarbeitungsbeiträgen für Obst und Beiträgen für die Umstellung auf innovative Kulturen gefördert. Weil der Pflanzenbau zur Ernährung von Mensch und Tier im Zentrum steht und eher wenig Innovationen im Bereich nachwachsender Rohstoffe festzustellen sind, haben die Beiträge für die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe, die sowohl zur Ernährung als auch zu industriellen Zwecken eingesetzt werden können, in anerkannten Pilot- und Demonstrationsanlagen an Bedeutung eingebüsst.
Massnahmen 2010
Kultur
Massnahme
Grenzschutz 1 n n n n n n n n
Verarbeitungsbeiträge n 2
Anbaubeiträge n n n n 3
Beiträge für Umstellung n 5 n 5 und Pflanzung
innovativer Kulturen 4
1 Je nach Verwendungszweck bzw. Zolltarifposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung
2 Betrifft nur Teile der Erntemenge (Marktreserven Kernobstsaftkonzentrate)

3 Nur für Kartoffeln, Mais und Futterpflanzen
4 Betrifft nur bestimmte Kulturen
5 Die Beiträge werden letztmals im Jahr 2011 ausbezahlt
Quelle: BLW
121 2.1 Produktion und Absatz
Getreide Körnerlegumi
-
nosen Ölsaaten Kartoffeln Zuckerrüben Saatgut Gemüse, Schnittblumen, Weinbau Obst
n Finanzielle Mittel 2010
Die im Berichtsjahr für den Pflanzenbau ausgerichteten Marktstützungen sanken gegenüber dem Vorjahr von 99 Mio. Fr. auf 70 Mio. Fr. Durch den Verzicht auf Exportförderungsmassnahmen und eine noch konsequentere Ausrichtung der Stützungen auf die Produktion entfielen im Berichtsjahr 95 % der Mittel auf die Anbauförderung, 4 % auf die Verarbeitung und Verwertung und 1 % auf diverse Fördermassnahmen. Im Vorjahresvergleich gingen die aufgewendeten Mittel für die Ackerkulturen um knapp 13 Mio. Fr. und für die Obstverwertung um rund 16 Mio. Fr. zurück. Im Bereich Ackerbau wurden 2009 aufgrund der sehr hohen Kartoffelproduktion noch ausserordentliche Beiträge für die Überschussverwertung gewährt. Indes reduzierte die Branchenorganisation Zucker wegen der Rekordernte 2009 die Zuckerquote, was 2010 zu einer kleineren Rübenanbaufläche und damit zu geringerem Mittelbedarf führte.
Ausgaben für die Obstverwertung 2010
Total 2,89 Mio. Fr.
Marktanpassungsmassnahmen bei Obst und Gemüse (Umstellung)
Verwertung von Äpfel und Birnen
67 %
24 %
Anderes 9 %
Quelle: BLW
Im Berichtsjahr betrug die Unterstützung für die Obstverwertung 2,89 Mio. Fr. Das Eidgenössische Parlament hat beschlossen, per 31. Dezember 2009 keine Exportbeiträge mehr zu gewähren. Deshalb sind die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen.
n Mehlzoll (Berechnungsmodus, Importe)
Mit Beschluss vom 16. Mai 2007 reduzierte der Bundesrat die sehr hohen Zollansätze für verarbeitetes Getreide zur menschlichen Ernährung per 1. Juli 2008 von 143 bis 148 Fr./100 kg auf 65 Fr./100 kg. Für Dinkel mit geringerer Mehlausbeute wurde ein höherer Ansatz gewährt. Bereits im Mai 2007 stellte der Bundesrat für den 1. Juli 2009 einen weiteren Schritt zur Reduktion der Zollansätze in Aussicht.
Witterungsbedingt fiel die Menge und die Qualität der Weltgetreideernte 2007 unterdurchschnittlich aus, weshalb an den internationalen Märkten eine Preishausse einsetzte. Um die Preiswirkungen auf die inländischen Brotwaren zu begrenzen, ermächtigte der Bundesrat mit einer Änderung der Agrareinfuhrverordnung das EVD, den Kontingentszollansatz für Brotgetreide auf einen Referenzpreis auszurichten. Gleichzeitig koppelte der Bundesrat die Zollansätze für verarbeitetes Getreide zur menschlichen Ernährung an den Rohstoff und ermächtigte das EVD, diese zu bestimmen und um einen Zuschlag von maximal 20 Fr./100 kg zu erhöhen.
122 2.1 Produktion und Absatz
31
A30
Tabelle
Seite
Auf das Begehren der Branche hin verschob das EVD den Inkraftsetzungstermin vom 1. Juli auf den 1. Oktober 2009 und verzichtete dann zwecks einer neuerlichen Situationsanalyse auf eine Änderung. Nach einer Ankündigung, dass die Anwendung des Bundesratsbeschluss vierteljährlich geprüft werde, koppelte das EVD per 1. Juli 2010 die Zollansätze für verarbeitetes Getreide zur menschlichen Ernährung an die Grenzbelastung der Rohstoffe und gewährte einen Zuschlag von 20 Fr./100 kg. Damit sank u.a. der Normalansatz für Weichweizenmehl von 65 Fr./100 kg auf 50.70 Fr./100 kg und von Hartweizengriess von 65 Fr./100 kg auf 23.40 Fr./100 kg.
Gemäss Aussenhandelsstatistik wirkte sich die Reduktion des Grenzschutzes für verarbeitetes Getreide zur menschlichen Ernährung bislang nicht auf die Nettoimporte aus. Die jährlichen Nettoimporte an Weichweizenmehl belaufen sich seit 2008 auf rund 400 t, was bezogen auf einen Weizenbedarf von rund 430 000 t und einer mittleren Mehlausbeute von 75 % einem Marktanteil von etwa 1,2 % entspricht.
n Kartoffeln (Kontingentierung)
Im Dezember 2009 war unklar, ob die ägyptische Regierung die amtlichen Dokumente zur phytosanitären Lage in ihren Anbaugebieten liefern würde. Deshalb wurde die Eröffnung des Kontingents von Speisekartoffeln, das Ägypten im Rahmen des Freihandelsabkommens gewährt worden war, ein erstes Mal auf den 15. Februar 2010 verschoben. Da keine Zustellung der Dokumente erfolgte, wurde der Entscheid schliesslich vorläufig zurückgestellt. Ende 2010 übermittelte Ägypten für die Kampagne 2010/11 schliesslich die Liste der Gebiete, in denen die Kartoffelbraunfäule (Ralstonia solanacearum) nicht vorkommt. Die Änderung der BLW-Verordnung, dank der Importe aus diesem Land – unter Auflagen – bewilligt werden konnten, trat am 15. Januar 2011 in Kraft. Noch am selben Tag wurde das ägyptische Jahreskontingent von 2 690 t eröffnet. Das WTO-Teilzollkontingent Nr. 14.1 konnte am 1. Januar 2011 für 6 500 t Speisekartoffeln, 2 500 t Saatkartoffeln und 9 250 t Industriekartoffeln eröffnet werden. Einfuhren, die unter dem ägyptischen Kontingent laufen, werden im WTO-Kontingent abgebucht, wenn die Verwendungsperioden der beiden Kontingente zusammenfallen.
Da die Verkaufszahlen besser ausfielen als erwartet und überraschenderweise neue Verträge abgeschlossen wurden, ersuchte die Branche geschlossen um eine Kontingentserhöhung von 5 000 t Veredelungskartoffeln. Diese wurde im Februar 2011 gewährt. Die vorübergehende Kontingentserhöhung ist in der AEV (SR 916.01) geregelt. Von dieser Möglichkeit kann bei Knappheit auf dem Binnenmarkt Gebrauch gemacht werden. Im Rahmen dieser Bestimmung und zur Sicherstellung, dass die Abwicklung der Anträge der Branche um vorübergehende Kontingentserhöhungen gänzlich konform ist mit dem administrativen Verfahren – einschliesslich der Veröffentlichung der Verordnungsänderung in der Amtlichen Sammlung – hat sich die Branche verpflichtet, ihre Prognosen zu verbessern. Künftig wird sie sich bei der Entscheidungsfindung auf regelmässige Ernteeinschätzungen stützen.
n Schweizer Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB) beim Wein
Damit die Ziele der Agrarpolitik 2011 (AP 2011) erreicht werden konnten, musste die Gesetzgebung für die Weinbranche angepasst werden. Einige produktionsrelevante Bestimmungen wurden geändert, um der Marktsegmentierung zu entsprechen und mit der Entwicklung der EU-Gesetzgebung leicht Schritt halten zu können. Die wichtigsten Ziele waren die Harmonisierung der Weinklassierung von der Produktion bis zum Verkauf (Wein mit KUB, Landwein, Tafelwein) und die stärkere Differenzierung von Wein mit KUB.
Dazu legte der Bund für Wein mit KUB Kriterien fest betreffend die Abgrenzung des Produktionsgebiets, die Wahl der Rebsorten, die für die Bezeichnung anerkannten Anbaumethoden, den natürliche Zuckergehalt, den Höchstertrag je Flächeneinheit sowie die Analyse und organoleptische Prüfung. Die Kompetenz, die KUB im Bereich der Weinwirtschaft zu regeln und die Anforderungen für diese sieben Kriterien festzulegen, liegt bei den Kantonen. Ihnen wurde eine Frist bis zum 1. Juni 2009 eingeräumt, um ihre Bestimmungen über Wein mit KUB anzupassen.
123 2.1 Produktion und Absatz
Auf der Grundlage der kantonalen Gesetze, die von den Kantonen an das Bundesrecht angepasst und dem BLW übermittelt wurden, sowie der entsprechenden Listen der KUB konnte das Schweizer Verzeichnis der KUB aktualisiert werden. Dieses schützt die KUB auf nationaler Ebene, namentlich gegen jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung. Auf internationaler Ebene dient es als Referenz für den gegenseitigen Schutz von KUB mittels bilateraler Abkommen, wie beispielsweise jenes zwischen der Schweiz und der EU (Agrarabkommen von 1999).
Mit der Umsetzung dieser Gesetzesänderungen durch die Kantone konnten die Authentizitätsregeln der KUB gestrafft werden, da neu das Produktionsgebiet der Trauben mit der Bezeichnung übereinstimmen muss, was die Zahl der KUB drastisch gesenkt hat: im Februar 2006 waren es 658, im März 2011 nur noch 74. Die Festlegung der Anforderungen, anhand derer die Eigenheiten der KUB zum Ausdruck gebracht werden sollen, wurde von den Kantonen unterschiedlich gehandhabt. Einige Kantone haben die nötigen Gesetzesänderungen bis heute nicht vollzogen. Folglich sind ihre KUB im Verzeichnis nicht aufgeführt und die Winzerinnen und Winzer können den Namen des Kantons oder eines Produktionsgebietes dieses Kantons zur Bezeichnung ihres Weins nicht verwenden. Ihr Wein des Jahrgangs 2011 muss unter der Bezeichnung «Landwein» oder «Tafelwein» vermarktet werden.
Das aktualisierte Verzeichnis kann auf der Website des BLW unter «Weine und Spirituosen» eingesehen werden.
124 2.1 Produktion und Absatz
2.2 Direktzahlungen
Die Direktzahlungen sind eines der zentralen Elemente der Agrarpolitik. Mit ihnen werden die von der Gesellschaft verlangten Leistungen gefördert. Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen.
Ausgaben für die Direktzahlungen
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich. Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben.

125 2.2 Direktzahlungen
Ausgabenbereich 2009 2010 2011 1 Mio. Fr. Allgemeine Direktzahlungen 2 190 2 201 2 186 Ökologische Direktzahlungen 566 597 613 Kürzungen 15 10 Total 2 742 2 789 2 799
1 Budget Quelle: BLW Tabelle 32 Seite A31
2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen
n Förderung gemeinwirtschaftlicher und besonderer Leistungen
Das Erbringen der gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft wird durch die allgemeinen Direktzahlungen gefördert. Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere. Diese Beiträge haben das Ziel, die Nutzung und Pflege der landwirtschaftlichen Nutzfläche sicherzustellen. In der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen. Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse und die tieferen Erträge in diesen Regionen berücksichtigt. Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).
Mit Öko-, Etho-, Gewässerschutz- und Sömmerungsbeiträgen (Oberbegriff: Ökologische Direktzahlungen) werden die Landwirte über finanzielle Anreize motiviert, besondere Leistungen zu erbringen, welche die allgemeinen gesetzlichen Vorgaben und den ÖLN übersteigen.
Die Ökobeiträge umfassen die Beiträge für den ökologischen Ausgleich, für die Öko-Qualität, für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) sowie für den biologischen Landbau. Mit den Ethobeiträgen fördert der Bund die Tierhaltung in besonders tierfreundlichen Stallhaltungssystemen (BTS) sowie den regelmässigen Auslauf der Nutztiere im Freien (RAUS). Die Gewässerschutzbeiträge bewirken die Reduktion von Nitrat- und Phosphorbelastungen in Gewässern und die Sömmerungsbeiträge werden für die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung der Sömmerungsflächen ausgerichtet.

n Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2010
Die Direktzahlungen betrugen 2010 2,789 Mrd. Fr. Pro Betrieb wurden durchschnittlich 53 866 Fr. ausbezahlt. Den Berg- und Hügelregionen kamen 57,0 % der gesamten Direktzahlungssumme zugute.
126 2.2 Direktzahlungen
Direktzahlungen 2010
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich. Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs. Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Anteil der Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung von Referenzbetrieben nach Regionen 2010
127 2.2 Direktzahlungen
Beitragsart Total Talregion Hügelregion Bergregion 1 000 Fr. Allgemeine Direktzahlungen 2 201 118 849 928 585 382 754 489 Flächenbeiträge 1 221 166 634 852 291 410 294 904 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 510 283 203 488 148 775 158 020 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 354 306 8 727 109 139 236 441 Allgemeine Hangbeiträge 104 044 2 862 36 058 65 125 Hangbeiträge für Rebflächen in Steilund Terrassenlagen 11 318 Ökologische Direktzahlungen 597 345 234 027 129 187 112 127 Ökobeiträge 249 710 128 677 62 088 58 945 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 128 715 75 444 31 623 21 647 Beiträge nach der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) 61 978 21 434 16 986 23 557 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 29 336 21 227 7 579 530 Beiträge für den biologischen Landbau 29 680 10 570 5 899 13 211 Ethobeiträge 225 632 105 351 67 099 53 182 Beiträge für Besonders Tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) 61 729 35 035 17 964 8 729 Beiträge für Regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) 163 903 70 315 49 135 44 453 Sömmerungsbeiträge 101 275 Beiträge für Gewässerschutz- und Ressourcenprogramme 21 339 Kürzungen 9 839 Total Direktzahlungen 2 789 234 1 083 956 714 569 866 617 Direktzahlung pro Betrieb 53 866 48 961 50 837 55 602
Quelle: BLW
Merkmal Einheit Total Talregion Hügelregion Bergregion Betriebe Anzahl 3 202 1 358 998 846 LN im Ø ha 21,06 22,17 19,71 20,55 Allgemeine Direktzahlungen Fr. 45 346 39 541 45 237 55 342 Öko- und Ethobeiträge Fr. 9 014 10 018 9 338 6 972 Total Direktzahlungen Fr. 54 360 49 559 54 575 62 314 Rohleistung Fr. 250 181 304 343 234 042 174 501 Anteil Direktzahlungen an der Rohleistung % 21,7 16,3 23,3 35,7 Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabellen 42a–43 Seiten A47–A49
Die Förderung der Bewirtschaftung unter erschwerenden Bedingungen in der Hügel- und Bergregion führt dazu, dass die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis ansteigt. Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
n Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zahlreiche Anforderungen zu erfüllen. Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen, wie Rechtsform, zivilrechtlicher Wohnsitz usw., andererseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend wie beispielsweise ein minimaler Arbeitsbedarf, das Alter der Bewirtschafter, das Einkommen und Vermögen. Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen, die unter den Begriff «Ökologischer Leistungsnachweis» fallen. Die Anforderungen des ÖLN umfassen: eine ausgeglichene Düngerbilanz, ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen, eine geregelte Fruchtfolge, ein geeigneter Bodenschutz, eine gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. Mängel bei den massgebenden Vorschriften haben Kürzungen oder eine Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge.
n Agrarpolitisches Informationssystem
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem). Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen, welche die Kantone zusammentragen und übermitteln und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart (Massnahme) gespiesen. Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge. Weitere Funktionen des Systems bestehen in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen und der Beantwortung zahlreicher agrarpolitischer Fragen.
Von den 57 153 über der Erhebungslimite des Bundes liegenden und 2010 in AGIS erfassten Betrieben beziehen deren 51 781 Direktzahlungen.
n Auswirkungen der Begrenzungen und Abstufungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus. Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro StandardArbeitskraft (SAK), bei den Abstufungen um die Degressionen nach Fläche und Tieren.
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2010
128 2.2 Direktzahlungen
Begrenzung Betroffene Kürzung Anteil am Beitrag Anteil am Total Betriebe der betroffenen DZ Betriebe Anzahl Fr. % % pro Standard-Arbeitskraft 166 296 674 4,31 0,01 auf Grund des Einkommens 1 228 6 852 750 9,68 0,25 auf Grund des Vermögens 236 4 670 033 52,47 0,17 Total 11 819 457 0,42 Quelle: BLW
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen von 11,8 Mio. Fr. zur Folge, wovon rund 11,5 Mio. Fr. auf Kürzungen infolge Überschreitung der Einkommens- und Vermögensgrenzen zurück zu führen sind. Sowohl die Anzahl der betroffenen Betriebe wie auch die Kürzungssumme haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.
Wirkung der Abstufung der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl 2010
Insgesamt sind 5 145 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen. Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenen Massnahmen. Die Reduktionen betragen total rund 25,4 Mio. Fr. Gemessen an allen Direktzahlungen, die abgestuft sind, beträgt der Anteil sämtlicher Reduktionen rund 0,9 %. Die Beitragsdegressionen wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus, wo die Abstufungen bei 3 531 Betrieben (rund 6,9 % aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen. Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 1 169 von der Kürzung dieser Beiträge betroffen, da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken. Von der Beitragsreduktion betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen. So werden z.B. die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei 2 519 Betrieben (ohne Doppelzählungen) um 10,3 % (BTS) bzw. um 8,4 % (RAUS) reduziert. 329 Bio-Betriebe erhalten um 8,3 % herabgesetzte Direktzahlungen.
129 2.2 Direktzahlungen
Massnahme Anzahl ha oder Fr. % % GVE Flächenbeiträge 3 531 54,1 16 935 878 7,0 0,61 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 1 169 70,0 2 264 120 5,4 0,08 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 728 70,4 1 027 999 5,2 0,04 Allgemeine Hangbeiträge 14 45,0 8 283 2,7 0,00 Hangbeiträge für Rebflächen in Steilund Terrassenlagen 0 0,0 0 0,0 0,00 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 13 51,0 53 853 8,7 0,00 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 13 52,5 19 679 7,6 0,00 Beiträge für den biologischen Landbau 329 51,9 416 252 8,3 0,01 Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 1 881 82,2 2 133 772 10,3 0,08 Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien 2 065 78,0 2 525 086 8,4 0,09 Total 5 145 25 384 922 7,4 0,91 Quelle: BLW
Betroffene Betriebe berechtigende Fläche oder Tierbestand pro Betrieb Kürzung Anteil am Beitrag der betroffenen Betriebe Anteil am ausbezahlten Beitrag (alle Betriebe)
n Vollzug, Kontrollen, Beitragskürzungen und Sonderbewilligungen
Die Kontrolle des ÖLN wird gemäss Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert. Diese ziehen akkreditierte Organisationen, die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten, zum Vollzug bei. Die Kantone müssen die Kontrolltätigkeit stichprobenweise überprüfen. Direktzahlungsberechtigte Bio-Betriebe müssen die Auflagen des Biolandbaus (inkl. RAUS-Anforderungen) erfüllen. Sie werden von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle jährlich überprüft. Die Kantone überwachen diese Kontrollen.
Die Verordnung über die Koordination der Inspektionen auf Landwirtschaftsbetrieben regelt, nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben. Mindestens alle vier Jahre sind die Vorgaben der Direktzahlungsverordnung beim ÖLN, den Öko- und Ethobeiträgen zu prüfen. Mindestens alle 12 Jahre sind die für die Ausrichtung der Direktzahlungen massgebenden Strukturdaten wie Fläche, Bewirtschaftungsart oder Tierzahlen und die Einhaltung der Vorgaben der Sömmerungsbeitragsverordnung zu prüfen. Zudem sind jährlich mindestens 2 % der Betriebe einer stichprobenweisen Kontrolle zu unterziehen. Auf Betrieben ohne Mängel soll in der Regel nicht mehr als eine Kontrolle, auf Bio-Betrieben nicht mehr als zwei Kontrollen pro Jahr vorgenommen werden.
Bei einer mangelhaften Erfüllung der für die Direktzahlungen massgebenden Vorschriften werden die Beiträge nach einheitlichen und verbindlichen Kriterien gekürzt. Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren hat dazu eine entsprechende Richtlinie erlassen.
2010 waren insgesamt 51 781 Landwirtschaftsbetriebe beitragsberechtigt. Davon wurden 21 247 (41,0 %) durch die Kantone bzw. durch die von ihnen beauftragten Kontrollstellen auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert. Wegen Mängeln beim ÖLN wurden bei 2 365 Betrieben (4,6 % der Betriebe) die Beiträge gekürzt.
Gemäss Bio-Verordnung müssen alle Bio-Betriebe jedes Jahr kontrolliert werden. Wegen Mängeln erhielten 3,4 % der Biobetriebe gekürzte Beiträge.
Beim BTS-Programm wurden durchschnittlich 46,3 % und beim RAUS-Programm 43,3 % der beitragsberechtigten Betriebe kontrolliert. Die Kontrollen werden in der Regel zusammen mit den ÖLN-Kontrollen vorgenommen. Der effektive Prozentsatz ist deshalb höher. Beim BTS-Programm wurden bei 2,3 %, beim RAUS-Programm 2,7 % der beteiligten Betriebe die Beiträge gekürzt.
Gesamthaft wurden bei 5 607 Betrieben Mängel festgestellt, was Beitragskürzungen von rund 6 Mio. Fr. zur Folge hatte.
Zusammenstellung der Beitragskürzungen 2010
Mangelhafte Aufzeichnungen, nicht tiergerechte Haltung der Nutztiere, andere Gründe (fehlende Bodenproben, abgelaufener Spritzentest), nicht ausgeglichene Düngerbilanz, ungenügende Puffer- und Grasstreifen, Auswahl und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, nicht rechtzeitige Anmeldung, nicht angemessener Anteil ÖAF.
Schnittzeitpunkt oder Pflegemassnahmen nicht eingehalten, falsche Angabe der Anzahl Bäume, Verunkrautung, falsche Flächenangaben, unzulässige Düngung, nicht rechtzeitige Anmeldung, und Pflanzenschutz.
Quelle: Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Beitragskürzungen
130 2.2 Direktzahlungen
Kategorie Anzahl Anzahl Anzahl Fr. ÖLN 51 781 21 247 2 365 2 655 792 ÖAF 49 136 - 842 672 007
Beitrags- berechtigte Betriebe Kontrollierte Betriebe Betriebe mit Kürzungen Kürzungen Hauptgründe
Tabellen 44a–44b Seiten A50–A51
Zusammenstellung der Beitragskürzungen 2010
nicht rechtzeitige Anmeldung, Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung, unzulässige Pflanzenschutzmittel Verstoss Fütterungsvorschriften, Hobbybetriebe nicht nach Bio-Vorschriften, Tierhaltung, Gewässerschutz, Aufzeichnungen, im BioLandbau nicht zugelassene Dünger und Pflanzenschutzmittel, nicht rechtzeitige Anmeldung, falsche Angaben.
Einstreu unzweckmässig, nicht rechtzeitige Anmeldung, kein Mehrflächen-Haltungssystem, Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften, mangelhafter Liegebereich, falsche Angaben, mangelhafte Stallbeleuchtung.
Mindestmastdauer bei Geflügel nicht erreicht, Liegebereich mit Spalten/Löcher, Tierschutz, zu kleine Weidefläche, verspäteter Einzug in RAUS-Stall, zu wenig Auslauftage, nicht rechtzeitige Anmeldung, mangelhafte Aufzeichnungen, nicht alle Tiere einer Kategorie nach den Vorschriften gehalten, falsche Angaben, ungenügender Laufhof.
Unter- oder Überschreitung des Normalbesatzes, unsachgemässe Weideführung, Nutzung nicht beweidbarer Flächen, Verstösse gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften nicht rechtzeitige Anmeldung, Ausbringen nicht erlaubter Dünger, andere Elemente (Überlieferung Milchkontingent) falsche
Angaben zum Tierbestand, fehlende Dokumente, nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Erschweren von Kontrollen, falsche Angaben betreffend Sömmerungsdauer, fehlende Daten, unerlaubter Herbizideinsatz, Wiederholungsfälle.
falsche Flächenangaben, falsche Tierbestandesangaben, andere Elemente (falsche Angaben ÖLN, weniger als 50 % betriebseigene Arbeitskräfte, nicht rechtzeitige An-/ Abmeldung eines Programmes, Kontrollen erschwert), falsche Angaben zum Betrieb oder Bewirtschafter, falsche Angaben zur Sömmerung.
keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
1 Im Gegensatz zu den übrigen landwirtschaftlichen Betrieben, ist bei Biobetrieben eine zweimalige Kontrolle pro Jahr möglich.
Quelle: Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Beitragskürzungen
131 2.2 Direktzahlungen
Kategorie Anzahl Anzahl Anzahl Fr. Extenso 14 603 4 526 27 8 824 Bio 5 641 5 788 1 194 130 068 BTS 19 910 9 222 457 314 826 RAUS 36 795 15 947 989 760 604 Sömmerung 7 187 962 98 261 931 Grunddaten - - 391 655 315 Gewässerschutz - - 183 474 071 Natur- und - - 42 43 341 Heimatschutz Umweltschutz - - 19 31 310 Total - - 5 607 6 008 089
berechtigte Betriebe Kontrollierte Betriebe Betriebe mit Kürzungen Kürzungen Hauptgründe
Beitrags-
n Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz
Im Rahmen des ÖLN ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gewissen Restriktionen unterworfen. Unter bestimmten Umständen und in begründeten Fällen können Landwirte Sonderbewilligungen beantragen, um Kulturen mit zusätzlichen Mitteln zu schützen. Gestützt auf Ziffer 6.4 des Anhangs der Direktzahlungsverordnung können die kantonalen Fachstellen für Pflanzenschutz Sonderbewilligungen erteilen. 2010 wurden 1 888 Sonderbewilligungen für 4 447 ha LN erlassen. Die Anzahl Sonderbewilligungen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Es werden jedoch Fluktuationen bei den Unterkategorien festgestellt. Namentlich waren es in 2010 die Sonderbewilligungen, die den Produzenten des Kartoffel- und Getreidebaus erteilt wurden. Im Obstbau ist zudem die Feuerbrandbekämpfung die Hauptursache für Sonderbewilligungen.
Erteilte Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz 2010
1 Mit anderen als der im Anhang der Direktzahlungsverordnung (DZV) aufgelisteten Produkte.
2 Zur Bekämpfung der Blattläuse im Tabak haben die Kantone FR und JU eine regionale Sonderbewilligung erteilt, die in der Tabelle nicht berücksichtigt wird.
3 Erteilte Sonderbewilligungen für Pflanzenschutzmassnahmen, die in den anerkannten spezifischen Richtlinien ausgeschlossen sind.
Quelle: BLW
132 2.2 Direktzahlungen
Total Bewilligungen Fläche Kategorie Anzahl % der Betriebe ha % der Betriebe mit Sonder- betroffenen bewilligung Fläche Applikationen mit Pflanzenschutzmittel während des Winterbehandlungsverbots 140 7,42 447,27 10,06 Einsatz von Insektiziden und nematiziden Granulaten 297 15,73 955,58 21,49 Getreide: Bekämpfung der Getreidehähnchen 1 159 8,42 546,73 12,30 Kartoffeln: Bekämpfung der Kartoffelkäfer 1 431 22,83 934,87 21,02 Leguminosen, Sonnenblumen, Tabak: Bekämpfung der Blattläuse 2 25 1,32 70,99 1,60 Übrige Schädlingsbekämpfung im Ackerbau 182 9,64 507,18 11,41 Dauergrünland: Flächenbehandlung 131 6,94 327,11 7,36 Einsatz Totalherbizide 444 23,52 518,13 7,36 Gemüsebau 3 1 0,05 0,6 0,01 Obstbau 3 77 4,08 137,85 3,10 Weinbau 3 1 0,05 0,25 0,01 Total 1 888 100,00 4 446,56 100
2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen
Im Rahmen der Umsetzung der AP 2011 wurden 2009 verschiedene Direktzahlungen angepasst. Die Umlagerung von der Marktstützung hin zu Direktzahlungen brachte bei verschiedenen Beitragsarten neue, in der Regel höhere Beitragsansätze. 2010 wurden nur wenige Beitragsansätze verändert.
2.2.2.1 Flächenbeiträge
Die Flächenbeiträge fördern die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie den Schutz und die Pflege der Kulturlandschaft, die Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und die Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen. Die Flächenbeiträge werden mit einem Zusatzbeitrag für das offene Ackerland und die Dauerkulturen ergänzt.
1 Der Zusatzbeitrag für offenes Ackerland und Dauerkulturen beträgt Fr. 640 pro ha und Jahr; auch er unterliegt der Flächenabstufung
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25 %. Insgesamt handelt es sich um rund 5 000 ha, welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden. Schweizer Betriebe, die heute Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone zukaufen oder pachten, erhalten keine Direktzahlungen.
Flächenbeiträge 2010 (inkl. Zusatzbeitrag)
Im Beitragsjahr 2010 wurde der Zusatzbeitrag für offene Ackerflächen und Dauerkulturen um Fr. 20 auf Fr. 640 erhöht.
Der Zusatzbeitrag wurde für insgesamt 263 061 ha offenes Ackerland und 18 854 ha Dauerkulturen ausgerichtet.
133 2.2 Direktzahlungen
Ansätze 2010 Fr./ha 1 – bis 40 ha 1 040 – 40 bis 70 ha 780 – 70 bis 100 ha 520 – 100 bis 130 ha 260 – über 130 ha 0
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Fläche ha 477 011 257 280 284 842 1 019 134 Betriebe Anzahl 22 004 14 011 15 573 51 588 Fläche pro Betrieb ha 21,7 18,4 18,3 19,8 Beitrag pro Betrieb Fr. 28 852 20 799 18 937 23 672 Total Beiträge 1 000 Fr. 634 852 291 410 294 904 1 221 166 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 637 514 292 451 295 553 1 225 518 Quelle:
BLW
Tabellen 33a–33b Seiten A32–A33
2.2.2.2 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere
Die Massnahme hat zum Ziel, mit der Milch- und Fleischproduktion auf Raufutterbasis einen Beitrag zur Versorgungssicherheit auf dem Grünland zu leisten und gleichzeitig die Flächen im Grasland Schweiz durch die Nutzung zu pflegen.
Bei der Festlegung des massgebenden Tierbestands für die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere gibt es zwei Kategorien. Bei Tieren der Rindergattung und Wasserbüffeln wird der mittlere Bestand aufgrund der Daten der Tierverkehr-Datenbank berechnet. Als Referenzzeit gilt der 1. Mai des Vorjahres bis zum 30. April des Beitragsjahres. Bei den übrigen Raufutter verzehrenden Nutztieren gilt als massgebender Tierbestand die Anzahl Tiere, die während der Winterfütterung (Referenzperiode: 1. Januar bis Stichtag des Beitragsjahres) auf einem Betrieb gehalten werden. Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe, Ziegen, Bisons, Wasserbüffel, Hirsche, Lamas und Alpakas. Die Beiträge werden in Abhängigkeit der vorhandenen Dauergrün-, Kunstwiesen-, Mais- und Futterrübenfläche bezahlt. Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE) und sind je ha begrenzt (Förderlimite). Die Begrenzung ist abgestuft nach Zonen. Für Flächen mit Mais und Futterrüben erhöht sich der Tierbestand, bis zu dem Beiträge ausbezahlt werden, um die Hälfte der Ansätze der Grünfläche.
Die RGVE sind in drei Beitragsgruppen aufgeteilt. Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung, Bisons, Wasserbüffel, Milchziegen und Milchschafe werden Fr. 690 und für die übrigen Ziegen und Schafe sowie Hirsche, Lamas und Alpakas Fr. 520 je RGVE ausgezahlt. Bei den Verkehrsmilchproduzenten werden pro 4 400 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE in Abzug gebracht. Für diese vom Milchabzug betroffenen RGVE werden Fr. 450 je RGVE ausgerichtet. Total wurden 510 Mio. Fr. ausbezahlt.
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2010
134 2.2 Direktzahlungen
Begrenzung der Förderung RGVE/ha Grünfläche – in der Talzone 2,0 – in der Hügelzone 1,6 – in der Bergzone I 1,4 – in der Bergzone II 1,1 – in der Bergzone III 0,9 – in der Bergzone IV 0,8
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Zu Beiträgen berechtigende RGVE Anzahl 397 356 286 634 276 857 960 846 Betriebe Anzahl 16 802 13 321 15 057 45 180 Zu Beiträgen berechtigende RGVE pro Betrieb Anzahl 23,6 21,5 18,4 21,3 Beiträge pro Betrieb Fr. 12 111 11 168 10 495 11 294 Total Beiträge 1 000 Fr. 203 488 148 775 158 020 510 283 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 203 492 148 837 157 262 509 591 Quelle: BLW
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2010
Merkmal Einheit Betrieb mit Betrieb ohne Vermarkteter Milch Vermarkteter Milch
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar pro RGVE rund 180 Fr. weniger RGVE-Beiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch. Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z.B. Zulage für verkäste Milch).
2.2.2.3 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen. Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung), werden bei dieser Massnahme auch soziale, strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt. Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere. Die Begrenzung der Beiträge ist die gleiche wie für die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere (Förderlimite).
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 2010
135 2.2 Direktzahlungen
Betriebe Anzahl 25 950 19 230 Tiere pro Betriebe RGVE 28,9 15,1 Abzug aufgrund Beitragsbegrenzung der Grünfläche RGVE 2,3 1,1 Milchabzug RGVE 23,2 0,0 Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE 26,6 14,0 Beiträge pro RGVE Fr. 440 621 Quelle: BLW
Ansätze pro RGVE 2010 Fr./GVE – in der Hügelzone 300 – in der Bergzone I 480 – in der Bergzone II 730 – in der Bergzone III 970 – in der Bergzone IV 1 230
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Zu Beiträgen berechtigende RGVE Anzahl 90 626 286 003 276 565 653 194 Betriebe Anzahl 3 054 13 293 15 038 31 385 RGVE pro Betrieb Anzahl 29,7 21,5 18,4 20,8 Beiträge pro Betrieb Fr. 2 857 8 210 15 723 11 289 Total Beiträge 1 000 Fr. 8 727 109 139 236 441 354 306 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 8 512 109 191 234 837 352 540 Quelle: BLW
2.2.2.4 Hangbeiträge
n Allgemeine Hangbeiträge: Zum Ausgleich erschwerender Flächenbewirtschaftung
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung in Hanglagen der Hügel- und Bergregion ausgeglichen. Sie werden nur für Wies-, Streu- und Ackerland sowie für Dauerkulturen ausgerichtet. Wiesen müssen jährlich mindestens einmal, Streueflächen alle ein bis drei Jahre geschnitten werden. Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt.
Beiträge für Hangflächen 2010
Von den insgesamt 214 000 ha LN Hangflächen werden knapp 2/3 der Kategorie Neigung 18–35 % zugeordnet. Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert leicht von Jahr zu Jahr. Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab, die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben.
Im Beitragsjahr 2010 wurden die Beitragsansätze für die Kategorie «Neigung 18–35 %» um Fr. 40 und für die Kategorie «Neigung über 35 %» um Fr. 110 angehoben.
n Hangbeiträge für Rebflächen: Zur Erhaltung der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei, Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten. Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden, wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden. Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden nur für Flächen mit einer Hangneigung von 30 % und mehr ausgerichtet. Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig.
136 2.2 Direktzahlungen
Ansätze 2010 Fr./ha – Neigung 18 bis 35 % 410 – Neigung über 35 % 620
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Zu Beiträgen berechtigende Flächen: – Neigung 18–35 % ha 4 740 62 007 70 886 137 633 – über 35 Neigung ha 1 481 17 148 58 161 76 790 Total ha 6 221 79 154 129 047 214 422 Betriebe Anzahl 2 160 12 592 14 562 29 314 Beitrag pro Betrieb Fr. 1 325 2 864 4 472 3 549 Total Beiträge 1 000 Fr. 2 862 36 058 65 125 104 044 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 2 488 32 049 56 479 91 015 Quelle: BLW
Ansätze 2010 Fr./ha – für Flächen mit 30 bis 50 % Neigung 1 500
für Flächen mit über 50 % Neigung 3 000
für Flächen in Terrassenlagen 5 000
–
–
Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2010 Einheit
Der Anteil der beitragsberechtigten Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 30 %.

2.2.2.5 Neuerungen 2011
Für das Beitragsjahr 2011 wurden keine Änderungen vorgenommen.
137 2.2 Direktzahlungen
Zu Beiträgen berechtigende Flächen total: ha 3 707 Steillagen 30 bis 50 % Neigung ha 1 857 Steillagen über 50 % Neigung ha 360 Terrassenanlagen ha 1 490 Anzahl Betriebe Anzahl 2 672 Fläche pro Betrieb (in ha) ha 1,4 Beitrag pro Betrieb (in Fr.) Fr. 4 236 Beiträge Total (in 1 000 Fr.) 1 000 Fr. 11 318 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 11 581 Quelle: BLW
2.2.3 Ökologische Direktzahlungen
2.2.3.1 Ökobeiträge
Die Ökobeiträge fördern besondere ökologische Leistungen, deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen. Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten, bei denen sie freiwillig mitmachen können. Die einzelnen Programme sind voneinander unabhängig; die Beiträge können kumuliert werden.
Verteilung der Ökobeiträge auf die verschiedenen Programme 2010
Total 250 Mio. Fr.
ÖQV 25 %
Biologischer Landbau 12 %

Extenso 12 %
Ökoausgleich 51 %
Quelle: BLW
138 2.2 Direktzahlungen
Tabellen 34a–34b Seiten A34–A35
n Ökologischer Ausgleich
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert werden. Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei. Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen gefördert und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN angerechnet werden, während andere Elemente beim ÖLN nur anrechenbar sind.
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Beim ÖLN anrechenbare Elemente Beim ÖLN anrechenbare Elemente mit Beiträgen ohne Beiträge
extensiv genutzte Wiesen extensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte Wiesen
Waldweiden (Wytweiden, Selven)
Streueflächen einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen
Hecken, Feld- und Ufergehölze
Buntbrachen
Rotationsbrachen
Ackerschonstreifen
Wassergräben, Tümpel, Teiche
Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle
Trockenmauern
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt
Saum auf Ackerland weitere, von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN Hochstamm-Feldobstbäume
Extensiv genutzte Wiesen
Die Flächen dürfen nicht gedüngt und während sechs Jahren in Abhängigkeit der Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt werden. Das späte Mähen soll gewährleisten, dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird. So bleibt auch zahlreichen wirbellosen Tieren, bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion. Die Fläche der extensiven Wiesen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Die Beiträge für extensiv genutzte Wiesen und Streueflächen sind einheitlich geregelt und richten sich nach der Zone, in der sich die Fläche befindet.
139 2.2 Direktzahlungen
Tabellen 35a–35d Seiten A36–A39
Ansätze 2010 Fr./ha – Ackerbau- und Übergangszonen 1 500 – Hügelzone 1 200 – Bergzonen I und II 700 – Bergzonen III und IV 450
Beiträge für extensiv genutzte Wiesen 2010
Wenig intensiv genutzte Wiesen
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden. Für die Nutzung gelten die gleichen Vorschriften wie bei den extensiv genutzten Wiesen. Für wenig intensiv genutzte Wiesen werden in allen Zonen Fr. 300 pro ha ausbezahlt.
Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen 2010
Streueflächen
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten, welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden.
Beiträge für Streuefläche 2010
140 2.2 Direktzahlungen
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 18 990 10 350 10 265 39 605 Fläche ha 30 902 12 788 18 922 62 612 Fläche pro Betrieb ha 1,63 1,24 1,84 1,58 Beitrag pro Betrieb Fr. 2 383 1 258 972 1 724 Total Beiträge 1 000 Fr. 45 258 13 024 9 981 68 263 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 43 428 12 361 9 625 65 414 Quelle: BLW
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 4 582 5 448 8 066 18 096 Fläche ha 3 961 4 969 15 237 24 166 Fläche pro Betrieb ha 0,86 0,91 1,89 1,34 Beitrag pro Betrieb Fr. 259 274 567 401 Total Beiträge 1 000 Fr. 1 189 1 492 4 572 7 253 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 1 346 1 626 4 790 7 762 Quelle: BLW
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 1 944 1 945 3 348 7 237 Fläche ha 2 079 1 549 3 785 7 413 Fläche pro Betrieb ha 1,07 0,80 1,13 1,02 Beitrag pro Betrieb Fr. 1 556 780 705 953 Total Beiträge 1 000 Fr. 3 025 1 516 2 360 6 900 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 3 046 1 514 2 331 6 891 Quelle: BLW
Hecken, Feld- und Ufergehölze
Als Hecken, Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-, Hoch- oder Baumhecken, Windschutzstreifen, Baumgruppen, bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze. Zu einer Hecke gehört ein Krautsaum, der in Abhängigkeit zur Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt wird. Die Beiträge für Hecken, Feld- und Ufergehölze (einschliesslich Krautsaum) betragen in der Tal- und Hügelzone Fr. 2 500, in den Bergzonen I und II Fr. 2 100 und in den Bergzonen III und IV Fr. 1 900.
Beiträge für Hecken, Ufer- und Feldgehölze 2010
Buntbrachen
Als Buntbrachen gelten mehrjährige, mit einheimischen Wildkräutern angesäte, ungedüngte Streifen von mindestens 3 m Breite. Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter. In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung. Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung. Für Buntbrachen werden Fr. 2 800 pro ha ausgerichtet. Die Beiträge gelten für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone.
für Buntbrache 2010
Rotationsbrachen
Als Rotationsbrachen gelten ungedüngte ein- bis zweijährige, mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen, die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen. In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel, Hasen und Insekten Lebensraum. In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich. Für die Rotationsbrachen werden in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone Fr. 2 300 pro ha ausgerichtet.
141 2.2 Direktzahlungen
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 6 260 3 499 1 756 11 515 Fläche ha 1 578 905 351 2 834 Fläche pro Betrieb ha 0,25 0,26 0,20 0,25 Beitrag pro Betrieb Fr. 629 609 412 590 Total Beiträge 1 000 Fr. 3 938 2 132 723 6 793 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 2 203 884 199 3 285 Quelle: BLW
Beiträge
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion 1 Total Betriebe Anzahl 1 651 307 4 1 962 Fläche ha 1 540 222 2 1 764 Fläche pro Betrieb ha 0,93 0,72 0,39 0,90 Beitrag pro Betrieb Fr. 2 614 2 028 1 083 2 519 Total Beiträge 1 000 Fr. 4 315 623 4 4 942 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 4 248 654 5 4 906
BLW
1 Hier handelt es sich um Betriebe, die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften Quelle:
Beiträge für Rotationsbrache 2010
1 Hier handelt es sich um Betriebe, die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften.
Ackerschonstreifen
BLW
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben. Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite, extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen wie Getreide, Raps, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Soja, nicht jedoch Mais. In allen Zonen wird ein einheitlicher Beitrag von Fr. 1 300 pro ha bezahlt.
Beiträge für Ackerschonstreifen 2010
Saum auf Ackerflächen
Säume sind mit einheimischen Wildkräutern angesäte, streifenförmige, jährlich nur zur Hälfte gemähte Dauergesellschaften, die auf der Ackerfläche oder Dauerkulturfläche angelegt werden. Sie müssen mindestens 3 m und dürfen maximal 12 m breit sein. Während mindestens zwei Vegetationsperioden bleiben sie am gleichen Standort bestehen. Für Säume werden von der Ackerbauzone bis und mit der Bergzone 2 Fr. 2 300 pro ha ausgerichtet.
Beiträge für Saum auf Ackerland 2010
142 2.2 Direktzahlungen
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion 1 Total Betriebe Anzahl 319 64 1 384 Fläche ha 423 83 1 508 Fläche pro Betrieb ha 1,33 1,30 1,40 1,32 Beitrag pro Betrieb Fr. 3 052 2 994 3 220 3 043 Total Beiträge 1 000 Fr. 973 192 3 1 168 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 1 130 228 6 1 364
Quelle:
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 56 20 6 82 Fläche ha 30 9 1 40 Fläche pro Betrieb ha 0,54 0,44 0,09 0,49 Beitrag pro Betrieb Fr. 708 573 119 632 Total Beiträge 1 000 Fr. 40 11 1 52 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 47 10 1 58 Quelle:
BLW
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 193 58 1 252 Fläche ha 47 12 0 59 Fläche pro Betrieb ha 0,25 0,21 0,19 0,24 Beitrag pro Betrieb Fr. 564 472 437 542 Total Beiträge 1 000 Fr. 109 27 0 137 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 66 13 0 80 Quelle: BLW
Hochstamm-Feldobstbäume
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume, die nicht in einer Obstanlage stehen, sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven. Pro angemeldetem Baum werden Fr. 15 ausgerichtet.
Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume 2010

143 2.2 Direktzahlungen
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 15 225 11 472 5 144 31 841 Bäume ha 1 106 678 840 376 266 862 2 213 916 Bäume pro Betrieb ha 72,69 73,25 51,88 69,53 Beitrag pro Betrieb Fr. 1 090 1 099 778 1 043 Total Beiträge 1 000 Fr. 16 598 12 606 4 003 33 207 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 16 576 12 672 4 006 33 253 Quelle: BLW
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen 2010
Total 131 119 ha
Waldweiden 2 % andere ÖAF 1 %
Extensiv genutzte Weiden 17 %
ÖAF im Ackerland 6 %
Feld- und Ufergehölze 2 %
Extensiv genutzte Wiesen 48 %
Streueflächen 6 % Wenig intensiv genutzte Wiesen 18 %
Quelle: BLW
Verteilung der ökologischen Ausgleichsflächen nach Regionen 2010 1
144 2.2 Direktzahlungen
Elemente Talregion Hügelregion Bergregion ha % der LN ha % der LN ha % der LN Extensiv genutzte Wiesen 30 902 6,17 12 788 4,85 18 922 6,55 Wenig intensiv genutzte Wiesen 3 961 0,79 4 969 1,89 15 237 5,28 Streueflächen 2 079 0,41 1 549 0,59 3 785 1,31 Feld- und Ufergehölze 1 578 0,31 905 0,34 351 0,12 Buntbrachen 1 540 0,31 222 0,08 2 0,00 Rotationsbrachen 423 0,08 83 0,03 1 0,00 Ackerschonstreifen 47 0,01 12 0,00 0 0,00 Saum auf Ackerfläche 30 0,01 9 0,00 1 0,00 Extensiv genutzte Weiden 4 168 0,83 4 847 1,84 13 230 4,58 Waldweiden (ohne bewaldete Fläche) 30 0,01 223 0,08 2 188 0,76 Wassergräben, Tümpel, Teiche 176 0,04 43 0,02 24 0,01 Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle 211 0,04 37 0,01 140 0,05 Trockenmauern 7 0,00 4 0,00 12 0,00 Rebflächen mit hoher Artenvielfalt 217 0,04 24 0,01 1 0,00 Weitere ökologische Ausgleichsflächen 140 0,03 40 0,02 83 0,03
1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume und ohne standortgerechte Einzelbäume
Quelle: BLW
n Öko-Qualitätsverordnung
Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern, unterstützt der Bund auf der LN ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen mit Finanzhilfen. Die Anforderungen, welche die Flächen für die Beitragsberechtigung gemäss der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) erfüllen müssen, werden durch die Kantone festgelegt. Der Bund überprüft die kantonalen Vorgaben auf Grund von Mindestanforderungen. Entsprechen die kantonalen Anforderungen den Mindestanforderungen des Bundes und ist die regionale Mitfinanzierung gewährleistet, leistet der Bund Finanzhilfen an die von den Kantonen ausgerichteten Beiträge an die Landwirte. Die Finanzhilfen des Bundes betragen 80 % der anrechenbaren Beiträge. Die restlichen 20 % müssen durch Dritte (Kanton, Gemeinde, Private, Trägerschaften) übernommen werden. Beiträge für die biologische Qualität und die Vernetzung sind kumulierbar. Die Verordnung beruht auf Freiwilligkeit, finanziellen Anreizen und der Berücksichtigung regionaler Unterschiede bezüglich der Biodiversität.
Anrechenbare Ansätze
Für die biologische Qualität Für die Vernetzung (Fr. pro ha und Jahr (Fr. pro ha und Jahr bzw. pro Baum und Jahr) bzw. pro Baum und Jahr) Tal–Bergzone II Bergzonen III–IV Tal–Bergzone II Bergzonen III–IV
1
Betrag wird zu je maximal 50 % für die Flora- und die Strukturqualität ausgerichtet.
Eine ökologische Ausgleichsfläche trägt vor allem dann zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei, wenn sie bestimmte Zeigerarten und Strukturmerkmale ausweist und/oder gemäss den Lebensraumansprüchen der Ziel- und Leitarten bewirtschaftet wird. Während sich der Bewirtschafter einer ökologischen Ausgleichsfläche für die biologische Qualität direkt anmelden kann, braucht es für die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen ein Konzept, das mindestens eine landschaftlich und ökologisch begründbare Einheit abdeckt.
145 2.2 Direktzahlungen
Extensiv genutzte Wiesen, wenig intensiv genutzte Wiesen und Streueflächen 1 000 700 1000 500 Extensiv genutzte Weiden und Waldweiden (Wytweiden und Selven) 500 1 300 1 500 300 Hecken, Feld- und Ufergehölze 2 000 2 000 1 000 500 Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt 1 000 1 000 1 000 500 Hochstamm-Feldobstbäume 30 30 5 5 Einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen 5 5 Weitere ökologische Ausgleichsflächen auf landwirtschaftlicher Nutzfläche 1 000 500
Der
36
Tabelle
Seite A40
Beiträge 1 gemäss Öko-Qualitätsverordnung 2010
1 Kürzungen, Rückforderung und Nachzahlung nicht berücksichtigt
2 Hochstamm umgerechnet (1 Stück = 1 Are)
Der markante Anstieg der Beitragssumme ist einerseits auf die Erhöhung der Beiträge im Rahmen der AP 2011 und andererseits auf die gute Akzeptanz der Programme zurückzuführen.
Beiträge 1 für biologische Qualität und Vernetzung 2 2010
Wenig intensiv genutzte Wiesen, Streueflächen
1 Kürzungen, Rückforderung und Nachzahlung nicht berücksichtigt
2 Da es Flächen gibt, die gleichzeitig Beiträge für die Qualität und die Vernetzung erhalten, dürfen die Spalten «biologische Qualität» und «Vernetzung» nicht addiert werden.
Quelle: BLW
146 2.2 Direktzahlungen
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 11 164 8 456 10 168 29 788 Fläche 2 ha 25 922 21 678 44 447 92 046 Fläche 2 pro Betrieb ha 2,32 2,56 4,37 3,09 Beitrag pro Betrieb Fr. 1 920 2 009 2 317 2 081 Total Beiträge 1 000 Fr. 21 434 16 986 23 557 61 978 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 18 401 15 309 21 193 54 902
Quelle:
BLW
Merkmal Einheiten Biologische Vernetzung Qualität Extensiv genutzte Wiesen,
Betriebe Anzahl 17 104 20 008 Fläche ha 27 969 34 674 Extensiv genutzte Weiden, Waldweiden Betriebe Anzahl 1 708 5 205 Fläche ha 4 455 9 729 Hecken, Feld- und Ufergehölze Betriebe Anzahl 2 488 5 029 Fläche ha 607 1 131 Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt Betriebe Anzahl 119 61 Fläche ha 182 88 Hochstammfeldobstrbäume Betriebe Anzahl 8 156 12 855 Baum Stück 500 205 661 828 Andere Elemente Betriebe Anzahl 6 995 Fläche ha 1 590
ÖQV Flächen mit Qualität (inkl. Hochstammbäume)
in % der LN 11–20 >20
0 1–5 6–10
Werte pro Gemeinde
Sömmerungsgebiet
ÖQV Flächen mit Vernetzung (inkl. Hochstammbäume)
Quelle: BLW, GG25 © Swisstopo 2011
in % der LN 11–20 >20
0 1–5 6–10
Werte pro Gemeinde
Sömmerungsgebiet
Quelle: BLW, GG25 © Swisstopo 2011
147 2.2 Direktzahlungen
n Extensive Produktion von Getreide und Raps
Diese Massnahme hat zum Ziel, den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren, Fungizide, chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide zu fördern. Der Beitragsansatz bemisst sich auf Fr. 400 pro ha.

Beiträge für Extensive Produktion von Getreide und Raps 2010
Aufteilung der Extensofläche 2010
5 %
34 %
61 %
148 2.2 Direktzahlungen
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 9 046 5 019 538 14 603 Fläche ha 53 349 18 980 1 325 73 654 Fläche pro Betrieb ha 5,90 3,78 2,46 5,04 Beitrag pro Betrieb Fr. 2 347 1 510 985 2 009 Total Beiträge 1 000 Fr. 21 227 7 579 530 29 336 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 20 791 7 707 577 29 075 Quelle: BLW
Quelle: BLW Total 73 654 ha Brotgetreide
Raps
Futtergetreide
Tabelle 37 Seite A41
n Biologischer Landbau
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders naturnahe und umweltfreundliche Produktionsform. Um Beiträge zu erhalten, müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der Bio-Verordnung erfüllen. Ausnahmen von der Gesamtbetrieblichkeit bestehen für den Weinbau und für Obstanlagen.
Beim biologischen Landbau wird auf chemisch-synthetisch hergestellte Produktionsmittel, wie Handelsdünger oder Pestizide, gänzlich verzichtet. Dies spart Energie und schont Wasser, Luft und Boden. Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig, die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen. Insgesamt erreicht der Biolandbau eine höhere Effizienz in der Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit des Produktionssystems.
2010 umfasste der biologische Landbau 10,7 % der gesamten LN.
Beiträge für den biologischen Landbau 2010
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche nach Region 2010
Bergregion 59 %
149 2.2 Direktzahlungen
Ansätze 2010 Fr./ha – Spezialkulturen 1 350 – Offene Ackerfläche ohne Spezialkulturen 950 – Grün- und Streueflächen 200
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 1 169 1 273 3 199 5 641 Fläche ha 23 109 22 288 65 048 110 445 Fläche pro Betrieb ha 19,77 17,51 20,33 19,58 Beitrag pro Betrieb Fr. 9 042 4 634 4 130 5 262 Total Beiträge 1 000 Fr. 10 570 5 899 13 211 29 680 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 9 258 5 453 13 226 27 937 Quelle: BLW
Quelle: BLW Total 110 445 ha Hügelregion
Talregion
%
20 %
21
Tabelle 34a
Seite A34
2.2.3.2 Ethobeiträge
Unter dem Begriff Ethoprogramme werden die Programme «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» und «Regelmässiger Auslauf im Freien» zusammengefasst (vgl. auch Abschnitt 1.3.2).
n Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen, welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen.
BTS-Beitragsansätze 2010 Fr./GVE
Über 120 Tage alte Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, über 30 Monate alte Tiere der Pferdegattung und über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung 90
Schweine, ohne Saugferkel 155
– Zuchthennen und -hähne, Legehennen, Junghennen und -hähne, Küken, Mastpoulets, Truten und Kaninchen 280
Per 1. Januar 2010 wurde der Ansatz für Kaninchen auf 280 Fr. je GVE erhöht.
BTS-Beiträge 2010
Die Zunahme der Beitragssumme ist im Wesentlichen auf den Anstieg der nach den BTS-Vorgaben gehaltenen Tierzahl zurückzuführen.
n Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren, auf einer Weide oder in einem Laufhof bzw. in einem Aussenklimabereich, der den Anforderungen der RAUS-Verordnung entspricht.
RAUS-Beitragsansätze 2010 Fr./GVE
Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel, Tiere der Pferdegattung, über ein Jahr alte Tiere der Schaf- und der Ziegengattung, Weidelämmer sowie Kaninchen 180
nicht säugende Zuchtsauen 360
übrige Schweine, ohne Saugferkel 155
Zuchthennen und -hähne, Legehennen, Junghennen und -hähne, Küken, Mastpoulets und Truten 280
150 2.2 Direktzahlungen
–
–
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 9 299 6 178 4 433 19 910 GVE Anzahl 297 637 156 741 85 844 540 222 GVE pro Betrieb Anzahl 32,01 25,37 19,36 27,13 Beitrag pro Betrieb Fr. 3 768 2 908 1 969 3 100 Total Beiträge 1 000 Fr. 35 035 17 964 8 729 61 729 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 34 191 17 343 8 356 59 890 Quelle: BLW
–
–
–
–
Tabelle 38
Seite A42
RAUS-Beiträge 2010
Die Zunahme der Beitragssumme ist im Wesentlichen auf den Anstieg der nach den RAUS-Vorgaben gehaltenen Tierzahl zurückzuführen.
2.2.3.3 Sömmerungsbeiträge
n Nachhaltige Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege der ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden. Das Sömmerungsgebiet wird mit rund 300 000 GVE genutzt und gepflegt. Der Viehbesatz wird nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Nutzung festgelegt. Man spricht dabei vom sogenannten Normalbesatz. Ausgehend vom Normalbesatz werden die Beiträge nach Normalstoss (NST) ausgerichtet. Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen.
151 2.2 Direktzahlungen
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 13 553 10 888 12 354 36 795 GVE Anzahl 385 742 269 913 245 135 900 790 GVE pro Betrieb Anzahl 28,46 24,79 19,84 24,48 Beitrag pro Betrieb Fr. 5 188 4 513 3 598 4 454 Total Beiträge 1 000 Fr. 70 315 49 135 44 453 163 903 Total Beiträge 2009 1 000 Fr. 70 104 48 881 44 075 163 060 Quelle: BLW
Ansätze 2010 Fr. – Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe pro GVE (56–100 Tage Sömmerung) 330 – Für Schafe ohne Milchschafe pro NST bei ständiger Behirtung 330 bei Umtriebsweide 250 bei übrigen Weiden 120 – Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 330 Sömmerungsbeiträge 2010 Merkmal Beiträge Betriebe GVE oder NST 1 000 Fr. Anzahl Anzahl Kühe, Milchziegen und Milchschafe 13 844 1 323 41 978 Schafe ohne Milchschafe 5 628 920 24 440 Übrige Raufutter verzehrende Tiere 81 803 6 628 243 126 Total 101 275 7 187 Total 2009 98 008 7 197 1 1 Bei dieser Zahl handelt es sich um das Total der beitragsberechtigten Sömmerungsbetriebe (ohne Doppelzählungen) Quelle: BLW Tabelle 38 Seite A42
Tabellen 41a–41b Seiten A45–A46
Die Beiträge wurden für das Beitragsjahr 2010 ausser bei «übrigen Schafweiden» um Fr. 10 pro Normalstoss bzw. RGVE erhöht. Seit dem Beitragsjahr 2003 werden differenzierte Sömmerungsbeiträge für Schafe (ohne Milchschafe) nach Weidesystem ausgerichtet. Mit den höheren Beiträgen für die ständige Behirtung und Umtriebsweide werden einerseits die höheren Kosten berücksichtigt, andererseits wird, in Analogie zu den Ökobeiträgen, der Anreiz für eine nachhaltige Schafalpung erhöht. Eine ständige Behirtung bedeutet, dass die Herdenführung durch einen Hirten mit Hunden erfolgt und die Herde täglich auf einen vom Hirten ausgewählten Weideplatz geführt wird. Bei einer Umtriebsweide hat die Beweidung während der ganzen Sömmerung abwechslungsweise in verschiedenen Koppeln zu erfolgen, die eingezäunt oder natürlich klar abgegrenzt sind.
Schafsömmerung nach Weidesystem 2010
Entwicklung der Sömmerung 2008–2010: Betriebe, gesömmerte Tiere in Normalstössen nach Tierkategorien
152 2.2 Direktzahlungen
Weidesystem Betriebe Tiere mit Beiträge Beiträgen Anzahl NST 1 000 Fr. Ständiger Behirtung 108 9 130 2 959 Umtriebsweide 229 5 567 1 388 Übrigen Weide 563 8 888 1 079 Kombination von Weidesystemen 20 855 202 Total 920 24 440 5 628 Total 2009 907 24 275 5 386 Quelle: BLW
Jahr 2008 2009 2010 Tierkategorie Einheiten Milchkühe Betriebe 4 577 3 924 3 854 Stösse 114 579 106 118 104 602 Mutter- und Ammenkühe und andere Kühe Betriebe 1 654 2 289 2 263 Stösse 25 114 32 044 32 343 Anderes Rindvieh Betriebe 6 242 6 183 6 171 Stösse 117 073 123 294 123 816 Tiere der Pferdegattung Betriebe 1 000 968 963 Stösse 4 403 4 421 4 376 Schafe Betriebe 995 993 995 Stösse 25 963 25 297 25 252 Ziegen Betriebe 1 508 1 434 1 411 Stösse 5 827 5 817 5 928 Andere gesömmerte Tiere Betriebe 240 196 194 Stösse 468 465 532 Ein Stoss = 1 GVE * Dauer / 100 Quelle: BLW
2.2.3.4
Beiträge für den Gewässerschutz
n Abschwemmungen und Auswaschung von Stoffen verhindern
Seit 1999 ermöglicht Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes dem Bund, Massnahmen der Landwirtschaft zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in ober- und unterirdische Gewässer zu fördern. Das Schwergewicht des Programms liegt bei der Reduktion der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen, in denen der ÖLN, der Biolandbau, Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso, ökologischer Ausgleich) nicht genügen.
2010 waren insgesamt 31 Projekte in der Umsetzung: 25 Nitratprojekte, 4 Phosphorprojekte und 2 Projekte im Bereich Pflanzenschutzmittel (PSM).
Gemäss der Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet, für ober- und unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen. Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen für die Betriebe mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen maximal 80 % für Strukturanpassungen und bis 50 % für Bewirtschaftungsmassnahmen.
2010 wurden 8,12 Mio. Fr. ausbezahlt.

153 2.2 Direktzahlungen
Überblick über die Projekte 2010
Kanton Region, Geplante Stoff Projektgebiet Projektierte Beiträge
Die Zunahme der gewährten Beiträge im Vergleich zu 2009 ist auf eine höhere Beteiligung von Betrieben, auf die Verlängerung von Projekten und auf Beitragsanpassungen zurückzuführen.
154 2.2 Direktzahlungen
Gemeinde Projektdauer Gesamtkosten 2010 Jahr ha Fr. Fr. AG Baldingen 2004–2015 1 Nitrat 69 593 200 30 190 AG Birrfeld 2002–2013 1 Nitrat 813 4 239 900 264 884 AG Wohlenschwil 2001–2013 1 Nitrat 62 703 396 77 620 AG Klingnau 2007–2012 Nitrat 101 486 600 28 542 AG Hallwilersee 2001–2010 Phosphor 1 200 2 209 970 127 871 FR Avry-sur-Matran 2000–2011 1 Nitrat 37 405 739 34 164 FR Courgevaux 2003–2015 1 Nitrat 27 164 838 37 319 FR Domdidier 2004–2016 1 Nitrat 30 195 588 30 581 FR Fétigny 2004–2016 1 Nitrat 63 1 526 110 162 078 FR Lurtigen 2005–2010 1 Nitrat 286 1 218 964 130 414 FR Torny (Middes) 2000–2012 1 Nitrat 45 369 853 28 084 FR Salvenach 2005 2 Nitrat 13,5 202 334FR Neyruz 2010–2015 Nitrat 8,1 66 432 11 072 GE Charmilles 2008–2013 PSM 202 480 700 6 571 LU Baldeggersee 2000–2010 1 Phosphor 5 600 18 800 782 2 525 594 LU Sempachersee 2005–2010 1 Phosphor 4 905 17 577 455 1 886 943 LU Hallwilersee 2001–2010 1 Phosphor 3 786 7 312 967 1 196 043 NE Valangin 2009–2014 Nitrat 178 1 235 668 3 74 574 SH Klettgau 2001–2012 1 Nitrat 357 4 049 470 226 127 SO Gäu I und ll 2000–2014 1 Nitrat 1 508 4 339 000 527 910 VD Bavois 2005–2010 1 Nitrat 37 178 985 15 993 VD Bofflens 2005–2010 1 Nitrat 112 580 100 78 844 VD Boiron / Morges 2005–2010 1 PSM 2 250 1 313 100 162 773 VD Bussy sur Moudon 2009–2015 Nitrat 34 404 100 54 489 VD Curtilles 2009–2015 Nitrat 28,5 298 400 –26 408 VD Morand/Montricher 2000–2013 1 Nitrat 403 1 082 996 231 483 VD Neyruz-sur Moudon 2009–2014 Nitrat 20 132 000 6 516 VD Thierrens 1999–2011 1 Nitrat 17 333 570 26 738 VD Sugnens 2007–2012 Nitrat 16 129 900 17 298 VD Peney-le-Jorat / Villars-Tiercelin 2009–2014 Nitrat 28 306 000 44 828 ZH Baltenswil 2000–2011 1 Nitrat und PSM 130 712 000 45 328 Total 63 734 867 8 117 280 Total 2009 6 770 230 1 Verlängerung der Projekte vereinbart 2 Projekt im Rahmen einer Güterregulierung mit einmaligem Beitrag im Jahre 2005 3 Mit baulichen Strukturmassnahmen Quelle: BLW
2.2.3.5 Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen (Ressourcenprojekte)
Gemäss den Artikeln 77a und 77b LwG fördert der Bund ab 2008 die Verbesserung der Nutzung von natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft mit Beiträgen. Die Zielbereiche sind die für die landwirtschaftliche Produktion benötigten Ressourcen wie Stickstoff, Phosphor und Energie, die Optimierung des Pflanzenschutzes sowie der verstärkte Schutz und die nachhaltigere Nutzung des Bodens, der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft und der Landschaft.
Die Massnahmen müssen über die Anforderungen der Gesetze, des ÖLN oder anderweitiger Förderprogramme des Bundes wie der Öko-Qualitätsverordnung hinausgehen.
– Die ökologische Verbesserung soll nicht durch die Reduktion der inländischen Produktion sondern durch eine Steigerung der Effizienz beim Ressourceneinsatz erreicht werden.
Die auf sechs Jahre befristeten Beiträge sollen neuen Techniken und Organisationsformen sowie strukturellen Anpassungen zum Durchbruch verhelfen, die Verbesserungen in diesen Bereichen bringen und zu deren Einführung eine finanzielle Unterstützung notwendig ist.
– Die Wirkung der Massnahmen muss nach Abschluss des Projekts beibehalten werden.
Das BLW beteiligt sich mit bis zu 80 % an den anfallenden Kosten. Die Restfinanzierung des Projekts muss durch eine Trägerschaft sichergestellt werden.
– Die Teilnahme an den Massnahmen ist freiwillig.
Die ersten Ressourcenprojekte befinden sich in der Umsetzung; weitere sind in Erarbeitung.
Natürliche Ressource / Projekte in Umsetzung 2010 Projekte mit Start 2011 Zielbereich
Stickstoff
Kantone Thurgau, Luzern, Freiburg, Kantone Graubünden, Waadt, Bern, Kantone Appenzell I. Rh., Neuenburg, Glarus Appenzell A. Rh., Solothurn, Aargau, Zentralschweizer Projekt (Kantone Obwalden, Nidwalden, Uri, Schwyz, Zug)
Bodenfruchtbarkeit
Kantone Basel-Stadt, Bern, Kanton Solothurn
Biodiversität Smaragd Oberaargau Förderung der Ackerbegleitflora (diverse Kantone)
Quelle: BLW
2010 wurden für Ressourcenprojekte Beiträge in der Höhe von Fr. 13 221 952 ausgerichtet. Im Verlaufe des Jahres konnten fünf zusätzliche Projekte in den Bereichen Stickstoff und Biodiversität gutgeheissen werden, welche ab 2011 lanciert werden.
155 2.2 Direktzahlungen
–
–
–
2.2.3.6 Neuerungen 2011
Ökologischer Ausgleich
Die Kriterien, die zum Beitragsausschluss für ökologische Ausgleichsflächen führen, werden um nachfolgenden Bereich ergänzt: Keine Beiträge für den ökologischen Ausgleich werden ausgerichtet für erschlossenes Bauland, dessen Überbauung vor Ablauf der Verpflichtungsdauer für die ökologische Ausgleichsfläche beginnt oder dessen Pachtdauer kürzer ist als die Verpflichtungsdauer für die ökologische Ausgleichsfläche.
156 2.2 Direktzahlungen
2.3 Grundlagenverbesserung
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion sowie die Erfüllung der multifunktionalen Aufgaben.
Finanzhilfen für Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen
Stabilisierungsmassnahmen
3 einmalige Reduktion infolge Ausgleich zu Gunsten Direktzahlungen
4 Nicht über den Zahlungsrahmen Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen gesteuert
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt:
– Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Produktionskosten;
– Erleichterung der täglichen Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte;
– Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im ländlichen Raum;
– Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen;

– Effiziente und umweltgerechte Produktion;
– Ertragreiche, resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte;
– Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt;
– Genetische Vielfalt.
157 2.3 Grundlagenverbesserung
Massnahme 2009 2010 2011 1 Mio. Fr. Beiträge Strukturverbesserungen 82,8 2 85,0 2 83,0 Investitionskredite 47,0 47,0 13,0 3 Betriebshilfe 1,8 2,2 2,0 Umschulungsbeihilfen 0,2 0,05 0,8 Beratungswesen und Forschungsbeiträge 4 18,0 18,4 18,2 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge 4 2,1 1,6 3,2 Pflanzen- und Tierzucht 38,1 37,6 38,1 Total 190,0 191,9 158,3 1 Budget
Sonderkredit
2 inkl.
Quelle: BLW
2.3.1 Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
2.3.1.1 Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert, insbesondere im Berggebiet und in den Randregionen. Im Interesse der Öffentlichkeit werden zudem ökologische, tierschützerische und raumplanerische Ziele umgesetzt, wie der naturnahe Rückbau von Kleingewässern, die Vernetzung von Biotopen oder der Bau von besonders tierfreundlichen Stallhaltungssystemen.

Investitionshilfen für Strukturverbesserungen werden als Hilfe zur Selbsthilfe für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt. Es stehen zwei Instrumente zur Verfügung:
Beiträge mit Beteiligung der Kantone, vorwiegend für gemeinschaftliche Massnahmen;
Investitionskredite in Form von rückzahlbaren, zinslosen Darlehen, vorwiegend für einzelbetriebliche Massnahmen.
Mit Investitionshilfen werden die landwirtschaftlichen Infrastrukturen gefördert. Sie ermöglichen die Anpassung der Betriebe an die sich ändernden Rahmenbedingungen. Durch die Senkung der Produktionskosten und die Förderung der Ökologie wird die Wettbewerbsfähigkeit einer nachhaltig produzierenden Landwirtschaft verbessert. Auch in anderen Ländern, insbesondere in der EU (GAP 2. Säule), sind landwirtschaftliche Investitionshilfen wichtige Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raums. Allerdings werden in der EU die Beihilfen ausschliesslich als Beiträge ausgerichtet.
n Finanzielle Mittel für Beiträge
Für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten wurden im Jahr 2010 Beiträge im Umfang von 85 Mio. Fr. ausbezahlt. Ausserdem genehmigte das BLW neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 89,9 Mio. Fr. Damit wurde ein Investitionsvolumen von 428,2 Mio. Fr. ausgelöst. Die Summe der Bundesbeiträge an die genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen», da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Tranche zugesichert wird.
158 2.3 Grundlagenverbesserung
–
–
Tabellen 45–46, 50a Seiten A52, A56
Genehmigte Beiträge des Bundes 2010
Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
Wegebauten
Massnahmen Boden-Wasserhaushalt
Wasserversorgungen
Wiederherstellungen und Sicherungen
Periodische Wiederherstellung PWI
andere Tiefbaumassnahmen
Projekte zur regionalen Entwicklung PRE Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere
Alpgebäude
andere Hochbaumassnahmen
Quelle: BLW
Ausbezahlte Beiträge des Bundes an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten
Quelle: BLW
159 2.3 Grundlagenverbesserung
25 0 5 10 15 20 Mio. Fr. Talregion Hügelregion Bergregion
6 % 23 % 71 %
2003–2010 Mio. Fr.
0 20 40 60 80 100 120 2000/02 93 2003 102 2004 94,5 2005 85 2006 107,5 2007 92,4 2008 88,5 2009 82,8 2010 85
n Finanzielle Mittel für Investitionskredite
Im Jahre 2010 bewilligten die Kantone für 2 047 Fälle Investitionskredite im Betrag von 327 Mio. Fr. Von diesem Kreditvolumen entfielen 79,6 % auf einzelbetriebliche und 12,2 % auf gemeinschaftliche Massnahmen. Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite, so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren, gewährt werden.
Investitionskredite 2010
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden hauptsächlich als Starthilfe sowie für den Neu- oder Umbau von landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomiegebäuden eingesetzt. Sie werden in durchschnittlich 13,4 Jahren zurückbezahlt.
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen, Bauten und Einrichtungen für die Milchwirtschaft und für die Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte sowie der gemeinschaftliche Kauf von Maschinen / Fahrzeugen unterstützt.
Im Jahre 2010 wurden den Kantonen neue Bundesmittel von 47 Mio. Fr. zur Verfügung gestellt und zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt. Das Umlaufvermögen des seit 1963 geäufneten Fonds de roulement beträgt 2,348 Mrd. Fr.
Investitionskredite 2010 nach Massnahmenkategorien, ohne Baukredite
Kauf Betrieb durch Pächter Wohngebäude
Ökonomiegebäude
Diversifizierung
Gemeinschaftliche Massnahmen1
andere Hochbaumassnahmen2
1 Gemeinschaftlicher Kauf von Maschinen und Fahrzeugen, Starthilfe für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, Gem. Einrichtungen und Bauten für die Verarbeitung / Lagerung landw. Produkte, Gem. Anlagen für die Produktion erneuerbarer Energie aus Biomasse
2 Produzierender Gartenbau, Gewerbliche Kleinbetriebe
Quelle: BLW
160 2.3 Grundlagenverbesserung
Anzahl Mio. Fr. Anteil % Einzelbetriebliche Massnahmen 1 797 260,3 79,6 Gemeinschaftliche Massnahmen, ohne Baukredite 197 39,8 12,2 Baukredite 53 26,9 8,2 Total 2 047 327,0 100,0 Quelle: BLW
140 0 20 40 60 80 100 120 Mio. Fr.
Talregion Hügelregion Bergregion Starthilfe
Bodenverbesserungen 48 % 27 % 25 %
Tabellen 47–48, 50b Seiten A53–A56
2.3.1.2 Soziale Begleitmassnahmen
n Betriebshilfe
Die Betriebshilfe wird in Form von zinslosen Darlehen gewährt und dient dazu, eine vorübergehende, unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben. In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen, indirekten Entschuldung.
Im Jahr 2010 wurden in 172 Fällen insgesamt 30,8 Mio. Fr. Betriebshilfedarlehen gewährt. Das durchschnittliche Darlehen betrug 179 282 Fr. und wird in 13,5 Jahren zurückbezahlt.
Betriebshilfedarlehen 2010
2010 wurden den Kantonen 2,163 Mio. Fr. neu zur Verfügung gestellt. Seit dem Inkrafttreten des Neuen Finanzausgleichs (NFA) entspricht die kantonale Beteiligung mindestens der Höhe der neuen Bundesmittel. Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt. Das Umlaufvermögen des seit 1963 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufneten Fonds de roulement beträgt zusammen mit den Kantonsanteilen rund 222,6 Mio. Fr.
Im
n Umschulungsbeihilfen
Die Umschulungsbeihilfe erleichtert für selbständig in der Landwirtschaft tätige Personen den Wechsel in einen nichtlandwirtschaftlichen Beruf. Sie beinhaltet Beiträge an Umschulungskosten und Lebenskostenbeiträge für Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter, die das 52. Altersjahr noch nicht beendet haben. Die Gewährung einer Umschulungsbeihilfe setzt die Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs voraus. Im Jahre 2010 wurden in zwei Fällen 236 700 Fr. zugesichert. Insgesamt wurden auf Basis der zugesicherten Umschulungsbeihilfen der Vorjahre an eine in der Umschulung stehende Person 48 910 Fr. ausbezahlt. Die Umschulungsdauer beträgt, je nach Ausbildung, ein bis drei Jahre. Das Ausbildungsspektrum der Umschulung ist breit und reicht von sozialen Berufen wie Physiotherapeut, Katechet oder Krankenschwester bis hin zu handwerklichen und kaufmännischen Berufen (Zimmermann, Schlosser, Koch oder Agrokaufmann).
Die Gründe für die geringe Beteiligung an diesem Programm mögen anfänglich in der fehlenden Bekanntheit gelegen haben, später in den ungünstigen wirtschaftlichen Aussichten, dann aber auch in der hohen Hürde der definitiven Betriebsaufgabe und in der Voraussetzung der Umschulung in einen anerkannten Beruf.
161 2.3 Grundlagenverbesserung
Anzahl Mio. Fr. Umfinanzierung bestehender Schulden 140 25,534 Überbrückung einer
31 5,213 Darlehen bei Betriebsaufgabe 1 0,090 Total 172 30,837 Quelle: BLW
ausserordentlichen finanziellen Belastung
Jahr
49,
Seiten A55–A56 Tabelle 51 Seite A57
Tabellen
50b
2.3.1.3 Gemeinschaftliche Projektinitiativen
Gemeinschaftliche Projektinitiativen in ländlichen Regionen sind vor allem auf folgende Projekttypen ausgerichtet:
Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE);
ökologische Vernetzungsprojekte gemäss Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV);
Projekte zur Förderung der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Bevor PRE im Detail geplant werden, sollen die Ideen auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft werden. Seit Ende 2006 unterstützt der Bund solche Vorabklärungen mit einem finanziellen Beitrag. Sinngemäss wird damit bei den anderen beiden Projekttypen die Bearbeitung des Umsetzungsgesuchs unterstützt.
Inzwischen sind beim BLW über 260 Projektskizzen eingereicht worden. Nach erfolgreichem Abschluss der Vorabklärung beginnt bei den PRE und den Ressourcenprojekten die Detailplanung für die Umsetzung des Projekts. Die Umsetzung der Vernetzungsprojekte erfolgt ohne Beteiligung des Bundes auf kantonaler Ebene.
Gemeinschaftliche Projektinitiativen seit November 2006
Gemeinschaftliche Projektinitiativen seit Nov. 2006
Gemeinschaftliche Projektinitiativen mit Ausrichtung auf ein Projekt zur regionalen Entwicklung (PRE)
Eingereichte Projektskizzen für die bisher ein Unterstützungsbeitrag zugesichert wurde (mit unterschiedlichem Projektfortschritt, unterteilt in Vorabklärung, Detailplanung oder Umsetzung); Stand März 2011.
Projektstand: in Vorabklärung Projekt in Detailplanung (Grundlagenetappe) oder Umsetzung keine Umsetzung als PRE / sistiert
Quelle: BLW
162 2.3 Grundlagenverbesserung
–
–
–
Stand: März 2011 Eingereichte Projektskizzen 263 Unterstützung zugesichert 209 Ausrichtung: – Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE) 88 – Ökologische Vernetzung (ÖQV) 87 – Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 25 – Andere 9
2.3.1.4 Agrotourismus
Agrotourismus als landwirtschaftnahe Tätigkeit ermöglicht ein zusätzliches Einkommen und damit Wertschöpfung in landwirtschaftlichen Betrieben. Den Ausbau dieses Betriebszweiges unterstützt der Bund mit zahlreichen Massnahmen. Die Investitionen können im Rahmen der Strukturverbesserungen einzelbetrieblich unter dem Begriff der Diversifizierung oder gemeinschaftlich über die Projekte zur regionalen Entwicklung gefördert werden. Mit der Absatzförderung werden Teile der Kommunikation unterstützt. Auch die Direktzahlungen kommen indirekt dem Agrotourismus zu Gute. Hier geht es um die Erhaltung einer attraktiven Landschaft als bedeutendes Kapital des Tourismus.
Die Vielfalt an agrotouristischen Angeboten in der Schweiz ist gross und geht weit über die eigentliche Beherbergung von Gästen hinaus. Der tiefe Organisationsgrad und die Verzettelung der Angebote schwächen die Position des Agrotourismus. Die vom Bund ausgerichtete Unterstützung der Kommunikationsmassnahmen kann dadurch nicht optimal genutzt werden. Die wichtigsten Organisationen des Agrotourismus sind deshalb mit dem BLW zur Überzeugung gelangt, dass eine nationale Organisation geschaffen werden muss. In der Folge hat das BLW einem Finanzhilfegesuch entsprochen, den Prozess zur Gründung einer nationalen Plattform «Agrotourismus Schweiz» zu unterstützen. Für die Konzeption und fachliche Begleitung wurde die Schweizerische Fachhochschule für Landwirtschaft (SHL) beauftragt. Die neue nationale Plattform «Agrotourismus Schweiz» konnte am 31. Mai 2010 als Verein gegründet werden.
Im Vorfeld der Gründung von Agrotourismus Schweiz hat das BLW diverse «Hearings» mit Fachleuten aus Praxis, Beratung, Bildung, Forschung, Tourismus und Verwaltung durchgeführt. Es ging darum, Bedürfnisse, Anliegen und Schwierigkeiten der Akteure besser kennenzulernen. Für die weitere Entwicklung im Agrotourismus sollen die nötigen Massnahmen auf die Ausrichtung des Tourismus in der Schweiz abgestimmt und bezüglich Raumplanung, Agrarpolitik, Pärke oder neue Regionalpolitik besser koordiniert werden. Agrotourismus soll in eine umfassende Tourismusstrategie Schweiz eingebettet sein und einen wesentlichen Beitrag zum «Naturnahen Tourismus» leisten.

163 2.3 Grundlagenverbesserung
2.3.1.5 Meliorationen als Teil einer ganzheitlichen Raumorganisation
Meliorationsprojekte sind in den letzten Jahren immer mehr zu einem Ausgangspunkt für eine ganzheitliche Planung von landwirtschaftlichen, ökologischen und raumplanerischen Anliegen geworden. Am Beispiel der Gesamtmelioration Boswil im Freiamt, Kanton Aargau, soll dies nachfolgend aufgezeigt werden.
Bei Projektbeginn war die Landwirtschaft in Boswil gekennzeichnet durch ein zerstückeltes Grundeigentum und ein schlecht angelegtes Flurwegnetz, dessen Wege sanierungsbedürftig waren. Das Pachtland war sehr kleinstrukturiert und alles andere als arrondiert, was die Bewirtschaftung zusätzlich erschwerte. Die Natur wies ein ökologisches Defizit auf und die Landschaft war arm an prägenden Strukturelementen wie Hecken, Obstbäume oder frei fliessende Bäche. Die vielen Quell- und Grundwasserfassungen waren ungenügend gesichert.
Die Gesamtmelioration Boswil wurde am 30. November 1999 mit dem Einleitungsbeschluss durch die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer gestartet. Parallel zum Neuzuteilungsverfahren wurde im Kanton Aargau der Nutzungsplan Kulturland revidiert. Dies brachte dem Unternehmen den grossen Vorteil, dass fast alle ökologischen Elemente längerfristig gesichert werden konnten.
n Landumlegung und ökologische Verbesserungen in einem Schritt
Der Erwerb einer Liegenschaft von ca. 10 ha durch die Bodenverbesserungsgenossenschaft (BVG) knapp ausserhalb des ursprünglichen Beizugsgebietes darf als Glücksfall für das Projekt bezeichnet werden. Die entsprechenden Flächen wurden nachträglich ins Verfahren einbezogen und dienten als Realersatz für den Landbedarf der Kleingewässer und die Renaturierung der Bünz. Der allgemeine Landabzug für die Ergänzung des Wegnetzes wurde differenziert nach Bedarf in den verschiedenen Teilgebieten vorgenommen. Er betrug zwischen null und zwei Prozent.
Im Rahmen des Generellen Projekts der Gesamtmelioration Boswil sind 15 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche als ökologische Ausgleichsflächen ausgeschieden worden. Diese sind Teil des revidierten Kulturlandplans, welcher sich auf das kommunale Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) abstützt und die massgebenden Vorgaben und Elemente aus dem regionalen Landschaftsentwicklungsplan (LEP) berücksichtigt. Auch die Bünzrenaturierung auf einer Länge von 2,8 km wäre ohne die Landausscheidung durch die Melioration kaum möglich gewesen. Mit der Renaturierung wurde eine ganzheitliche Gestaltung der Bünzebene mit den neuen landschaftlichen Elementen ermöglicht, wie Kleingewässer, Vernetzungsstreifen, extensiv genutzte Quellschutzflächen. Mit geschicktem Landmanagement konnten ausserdem zwölf Quell- und Grundwasserfassungen der Gemeinde in öffentliches Eigentum gebracht und mit Schutzzonen langfristig gesichert werden.
Durch die kombinierte Auflage von Neuzuteilungsentwurf und Kulturlandplan bekamen die Grundeigentümer die Möglichkeit, die Lage ihrer neuen Grundstücke und gleichzeitig die vorgesehene mögliche Nutzung einzusehen. Dieses offene Verfahren hat sich bestens bewährt. Gegen die umfangreichen ökologischen Elemente im revidierten Kulturlandplan wurde bei der öffentlichen Auflage nur eine einzige Einsprache eingereicht.
n Integration von raumplanerischen Anliegen
Gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung (Art. 16a Abs. 3) können spezielle Landwirtschaftszonen für Bauten und Anlagen der bodenunabhängigen Produktion ausgeschieden werden. Der Kanton Aargau hat die notwendigen Grundlagen für die Ausscheidung solcher Zonen im Richtplan festgesetzt.
Die Gemeinde schied in der kommunalen Nutzungsplanung sogenannte LEILA-Standorte aus. Der Begriff LEILA steht für «Landwirtschaftliches Entwicklungsgebiet und Intensiv-LAndwirtschaftszone». Diese Standorte wurden gestützt auf eine detaillierte Grundlagenerhebung «Entwicklungskonzept Landwirtschaft» als integraler Bestandteil des Meliorationsprojekts festgelegt.
164 2.3 Grundlagenverbesserung
Die LEILA-Standorte bezeichnen Räume, wo betriebliche Entwicklungen mit Bauten und Anlagen über die innere Aufstockung grundsätzlich möglich sein sollen. Bei den Gebietsbezeichnungen handelt es sich um symbolische Standortbezeichnungen, die im konkreten Bedarfsfall im Rahmen eines vereinfachten Planungsverfahrens (Gestaltungsplan) mit der Ausscheidung einer Speziallandwirtschaftszone verbindlich festgelegt werden müssen.
Mit dieser Lösung wird die Beurteilung wichtiger raumrelevanter Fragen wie Natur und Landschaft, Wildtierkorridore, Ortsbild oder Erschliessung, in einer «Positiv»-Planung unabhängig eines konkreten Projekts (z.B. Bau eines Schweinestalls) vorweggenommen. Die Prüfung aller übrigen umweltrelevanten bzw. rechtlichen Aspekte wie Höchstbestandesverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt im Baubewilligungsverfahren.

Im Rahmen der laufenden Gesamtrevision des kantonalen Richtplans ist vorgesehen, analog LEILA die Grundlagen zu Speziallandwirtschaftszonen um das Thema «Entwicklungsstandorte Landwirtschaft» zu erweitern.
Die Gesamtmelioration Boswil zeigt beispielhaft, dass die heutigen Meliorationen zu einem unverzichtbaren Instrument zur Lösung vielschichtiger Probleme in den Gemeinden geworden sind. Wünschenswert wäre, dass noch mehr solche multifunktionale Projekte durchgeführt würden.
165 2.3 Grundlagenverbesserung
2.3.1.6 Einfluss der Bewirtschaftung auf Naturgefahren
n Einbindung der Landwirtschaft in eine ganzheitliche Risikobewertung
Die nationale Plattform für Naturgefahren (PLANAT) hat vor bald zehn Jahren mit ihrem Leitsatz «Von der Gefahrenabwehr zur Risikokultur» einen Paradigmenwechsel eingeleitet und dazu einen ganzheitlichen Umgang mit Gefahren und Risiken, einen Risikodialog und ein integrales Risikomanagement gefordert. Neben der Gleichwertigkeit der Massnahmen im Risikokreislauf Prävention, Intervention, Wiederinstandstellung (vgl. folgende Abbildung) geht es darum, organisatorische und raumplanerische, baulich-technische und biologische Schutzmassnahmen aufeinander abzustimmen. Bis anhin ist dabei die Rolle der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Infrastrukturen als Teil der Gefahrenprävention noch wenig wahrgenommen worden.
Risikokreislauf
· Warnung Information
Einsatz
· Alarmierung Rettung
Schadenwehr
Vorsorge
· Organisation · Mittelplanung
Einsatzplanung Ausbildung
· Finanzielle Vorsorge (versichern)
Prävention
Raumplanerische
Massnahmen
· Baulich-technische Massnahmen
Biologische Massnahmen
Gefahrenund Risikobeurteilung
· Info/Verhaltensanweisungen
BegrenzendesAusmasses
Instandstellung
Prov. Instandstellung
· Ver- und Entsorgung
Transportsysteme
Kommunikation
· Finanzierung
Rechtliche Regelungen (Notrecht)
·
Regeneration
Wiederaufbau
Definitive Instandstellung
· Rekonstruktion
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit Finanzierung
Prävention, Intervention, Wiederinstandstellung
Quelle: Bevölkerungsschutz
In einem Projekt, durchgeführt durch die Abenis AG (Ingenieure + Planer) in Zusammenarbeit mit der Flury&Giuliani GmbH (Agrar- und regionalwirtschaftliche Beratung) wurde erstmals systematisch, eingebettet in die Gesamtstrategie der PLANAT, die mögliche Beeinflussung der Naturgefahren durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung im Hinblick auf eine Anpassungsstrategie zur Gefahrenminderung und -vermeidung untersucht. Die vertiefte Literaturrecherche hat gezeigt, dass Naturgefahrenereignisse durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht verhindert werden können, die Landwirtschaft aber einige Möglichkeiten hat, die Intensität und Häufigkeit von Naturgefahren zu verringern oder zu erhöhen. Die Landwirtschaft kann situationsbezogen zur vorbeugenden Gefahrenminderung und Schadenreduktion beitragen und leistet bereits heute einen Beitrag dazu. Die Gefahrenprävention kann beispielsweise die Optimierung des Hochwasserrückhalts in der Fläche, die Vermeidung von Erosion und Rutschungen sowie die Verminderung von Schneegleiten beinhalten.
166 2.3 Grundlagenverbesserung
Ereignisauswertung Ereignisauswertung VerringernderVerletzlichkeit
Vorbeugung Bewältigun g
Ereignis
n Wirkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Infrastrukturen
Die Studie zeigt, dass vor allem Massnahmen zur Verbesserung des Wasserrückhalts im Boden die Handlungsoptionen des vorbeugenden Hochwasserschutzes wesentlich erweitern können. So kann die Landwirtschaft durch bodenschonende und konservierende Bodenbearbeitungsverfahren und die Vermeidung von Bodenverdichtungen die natürliche Wasserspeicherkapazität des Bodens erhöhen. Das Volumen wie auch die Spitze des Hochwasserabflusses in Flüssen kann dadurch während Niederschlagsereignissen um bis zu 10–15 % reduziert werden. In bestimmten Fällen lassen sich Hochwasserrisiken auch durch gezielte Notfallentlastungen in Überflutungsräume oder Flutkorridore vermindern. In diesen Fällen kann die Landwirtschaft durch die Bereitschaft, Flächen für die temporäre Überflutung zur Verfügung zu stellen, zur Gefahrenprävention beitragen. Diese Flächen können beispielsweise im Rahmen einer Gesamtmelioration ausgeschieden werden. Eine nicht dem Standort angepasste landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder unsensibel disponierte Infrastrukturanlagen können aber auch zu einer Verschärfung einer bestehenden Naturgefahrensituation führen (vgl. folgende Abbildungen).
Einflussfaktoren und Wechselwirkungen in alpinen Wildbacheinzugsgebieten
+ verstärkende Wirkung
– abschwächende Wirkung
+/– beide Wirkungen möglich
167 2.3 Grundlagenverbesserung
Quelle: PLANAT
Spitzenabfluss Oberflächenabfluss Geschiebetransport Erosion Erosion +/–+/–+/–+/–+/–+/–+/–+/–+ +
Einflussfaktoren und Wechselwirkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung in grossräumigen Flusseinzugsgebieten im Mittelland und im Alpenvorland
Bodenverdichtung
Oberflächenabfluss
Infiltrationskapazität
+ verstärkende Wirkung
– abschwächende Wirkung
+/– beide Wirkungen möglich
Spitzenabfluss
Materialeintrag
Quelle: PLANAT
Einflussfaktoren und Wechselwirkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung in Hang- und Hangfussbereichen
Vegetationszusammensetzung
Bodenverdichtung
Durchwurzelungseigenschaften Oberflächenabfluss
Bodenrutschung Erosion
Konzentrierter Abfluss
+ verstärkende Wirkung – abschwächende Wirkung
+/– beide Wirkungen möglich
Quelle: PLANAT
168 2.3 Grundlagenverbesserung
Bodenbedeckung
Erosion
Verschlämmung
+/– +/–+/–+ + + + + –+
Wasserrückhalt Wasserrückhalt Spitzenabfluss
Mud flow
durch Oberflächenwasser +/–+/–+/–+ + + + + + + +
Überschwemmung
n Wirkungen des heutigen Förderinstrumentariums
Wichtige agrarpolitische Instrumente, welche die landwirtschaftliche Bewirtschaftung beeinflussen, sind die Direktzahlungen und die Strukturverbesserungen. Diese Instrumente sind bisher aber nicht explizit auf die Prävention von Naturgefahren ausgerichtet. Dennoch tragen sie zur Naturgefahrenprävention bei. Bei den Direktzahlungen ist das zentrale Element die Bindung des Bezugs an den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN). Konkret wirken sich verschiedene Bewirtschaftungsauflagen des ÖLN, wie die Anforderungen eines geeigneten Bodenschutzes, der Erosionsverminderung oder der geregelten Fruchtfolge, hemmend auf den Oberflächenabfluss und die Erosion aus. Ebenfalls von Bedeutung sind die Beiträge für abflussbremsende Strukturelemente wie Ackerschonstreifen, Säume auf Ackerland oder Hecken und Gehölze. Im Zusammenhang mit den Naturgefahren Erosion, flachgründige Rutschungen, Schneegleiten und Naturbrand wirken sich vor allem die Anreize zur Flächenbewirtschaftung (Flächen- und Hangbeiträge, Sömmerungsbeiträge) hemmend auf die Naturgefahren aus, indem sie der Vergandung und Verbuschung von Grenzertragsflächen entgegenwirken. Die Bewirtschaftung solcher Flächen hängt zudem massgeblich von der Erschliessung ab, welche mit Investitionshilfen für Strukturverbesserungsmassnahmen gefördert wird. In der Graslandnutzung kritischer zu beurteilen sind die tierbezogenen Direktzahlungen, welche zwar ein Anreiz zur Haltung von Raufutter verzehrenden Tieren und damit zur Flächenbewirtschaftung sind, gleichzeitig aber auch die Gefahr einer Intensivierung der Flächennutzung mit sich bringen. Mit der zunehmenden Mechanisierung besteht auch im Grasland die Gefahr von schädlichen Bodenverdichtungen.
n
Vorschläge
zur Verbesserung der Naturgefahrenprävention in der Landwirtschaft
In der Studie werden u.a. Vorschläge bei den Direktzahlungen gemacht. So sollen die Sömmerungsbeiträge explizit an die effektiv beweidete Fläche gebunden werden, was heute nicht der Fall ist. Dadurch kann eine flächendeckende Bewirtschaftung besser gewährleistet werden. Zusätzlich sind standortspezifische Anreize, wie sie z.B. die Ressourcenprogramme bieten, weiter auszubauen, da die Naturgefahren meist einen direkten Standortbezug haben.
Die Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems kommt den Vorschlägen der Studie entgegen. Im weiterentwickelten System sollen Anreize zur flächenspezifischen Bewirtschaftung ausgebaut und neu Landschaftsqualitätsbeiträge eingeführt werden, die es erlauben standortgebunden strukturfördernde Elemente zu fördern, welche bei der Naturgefahrenprävention eine wichtige Rolle spielen.
n Ausblick
Die Förderung von gefahrenvermeidenden und -vermindernden Bewirtschaftungsformen fügt sich in die Strategie «Nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung 2025» ein, insbesondere in die Schwerpunkte «nachhaltige Ressourcennutzung» und «Förderung der Attraktivität des ländlichen Raumes». Ein enger Bezug besteht auch zur Klimastrategie Landwirtschaft, welche zurzeit vom BLW entwickelt wird. Die Resultate der Untersuchung zeigen auch, welchen Einfluss landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Infrastrukturen auf den Wasserhaushalt eines ganzen Einzugsgebiets haben. Es liegt daher auf der Hand, dass im Rahmen des integralen Einzugsgebietsmanagements auch die quantitativen Aspekte der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bezüglich Wasserressourcen, Gewässer und Wasserinfrastrukturen berücksichtigt werden.
169 2.3 Grundlagenverbesserung
2.3.2 Landwirtschaftliches Wissen – forschen, beraten, bilden
2.3.2.1 Landwirtschaftliches Wissens- und Innovationssystem AKIS
Im Landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssystem (AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation System) vereinigen sich Kenntnisse und Erfahrungen über die landwirtschaftliche Produktion, Veredelung und Lagerung der landwirtschaftlichen Rohstoffe und Nahrungsmittel bis hin zu Aspekten der menschlichen Ernährung, Einflüssen der Umwelt auf die Landwirtschaft sowie derjenigen der Landwirtschaft auf die Umwelt, Natur und Landschaft. Öffentliche Forschung, Bildung und Beratung sind Dienstleister im AKIS. Ziel dieses Systems ist es, Wissen zu erarbeiten, aufzuarbeiten, zu verbreiten, auszutauschen und anzuwenden, um damit Innovationen in der Land- und Ernährungswirtschaft zu fördern.
In den Jahren 2010 und 2011 haben sich verschiedene Institutionen weiter entwickelt, um die aktuellen und kommenden Herausforderungen bewältigen zu können. Zudem lancierte das BLW 2010 eine Studie «Wettbewerbliches Vergabeverfahren im Bereich der landwirtschaftlichen Beratung». Die Absichten des Bundesrates, in der Forschung und in der Beratung Budgets zu kürzen, führten zu intensiven Diskussionen.
n Weiterentwicklung von Bildungs- und Forschungsinstitutionen
An der ETH kommt es beim Umbau des bestehenden Departementes Agrar- und Lebensmittelwissenschaften zu einer themenbedingten Auftrennung zwischen traditioneller Agronomie und den Lebensmittelwissenschaften. Das Institut für Agrarwissenschaften (ehemals Institut für Pflanzen-, Tier- und Agrarökosystem-Wissenschaften) wird bis Ende 2011 zusammen mit dem bisherigen Departement Umweltwissenschaften ein neues Departement gründen, das den Arbeitstitel Umweltsystemwissenschaften (D-USYS) trägt. Zum D-USYS wird auch das Institut für Umweltentscheidungen gehören, das die Sozialwissenschaften vereint. Das Institut für Lebensmittelwissenschaften, Ernährung und Gesundheit wird Teil des neuen Departementes Gesundheit und Medizintechnik (D-HEST). Die strategische Initiative «Welternährungssystem» (World Food System) bleibt von zentraler Bedeutung und wird als Kompetenzzentrum departementsübergreifend arbeiten. Die ETH bekräftigt, dass die neue Organisation zu mehr Schlagkraft in relevanten Wissenschaftsgebieten und zu mehr Attraktivität im Wettbewerb um die besten Talente bei Studierenden und Professoren führen soll. Die Erforschung einer nachhaltigen Nahrungsmittelversorgung sowie die Ausbildung entsprechender Fachleute erhält damit gemäss ETH ein besonderes Gewicht.
Die Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL) erhält eine neue Trägerschaft: Der Konkordatsrat und das Berner Parlament haben beschlossen, die bisherige Trägerschaft – ein Konkordat aller Schweizer Kantone und Liechtensteins – aufzulösen. Die SHL wird Anfang 2012 vom Kanton Bern übernommen und in die Berner Fachhochschule integriert. Bern hat sich gleichzeitig zu einer gebäulichen Erweiterung der SHL verpflichtet. Diese ist im Bau und wird Ende 2012 bezugsbereit sein.
Im Zuge der Umsetzung ihrer Strategie 2015, im Hinblick auf die Kantonalisierung und zur Bewältigung des anhaltenden Wachstums, hat die SHL ihre interne Organisation und Führung vollständig erneuert. Sie hat nun eine ausgeprägte Linienorganisation mit fünf Abteilungen, welche für die Lehre, die Weiterbildung, die angewandte Forschung und die Dienstleistungen zuständig sind. Die Abteilungen Agronomie, Forstwirtschaft, Food Science & Management, Masterstudien und studiengangsübergreifende Disziplinen erbringen nun ihre Leistungen im Rahmen eines Leistungsauftrags mit Globalbudget weitgehend autonom. Gleichzeitig wurden die drei Bachelorstudiengänge in Agronomie, Forstwirtschaft und Food Science & Management einer organisatorischen und inhaltlichen Reform unterzogen. 180 Personen haben 2010 ein Studium in Zollikofen begonnen, 100 schlossen ihre Ausbildung mit einem Bachelordiplom ab, unter ihnen die ersten Agronominnen mit Vertiefung in Pferdewissenschaften.
170 2.3 Grundlagenverbesserung
n Konsolidierungsprogramm und Aufgabenüberprüfung
Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 2012–2013 (KOP 2012/13) beantragte der Bundesrat, den Beitrag für die landwirtschaftliche Beratung um einen Drittel zu kürzen und den Beitrag für das Nationalgestüt nach Ablauf des bestehenden Leistungsauftrages per Ende 2011 ganz zu streichen. Dieser Antrag führte zu heftigen Reaktionen der Kantone und der Pferdebranche sowie von Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Dies bewog den Bundesrat, eine Übernahme des Gestüts durch eine private Trägerschaft, verbunden mit einer Teilfinanzierung des Bundes, ins Auge zu fassen. Im Zusammenhang mit dem sehr guten Rechnungsabschluss 2010 des Bundes beschloss der Bundesrat im Januar 2011, auf verschiedene Budgetkürzungen, u.a. jene bei der Beratung und beim Gestüt, zu verzichten. Agroscope ist seit Jahren finanziellem Druck ausgesetzt. Die wiederholten Sparrunden der vergangenen
15 Jahre führten bei Agroscope zu verschiedenen Reorganisationsschritten (Reduktion von sieben auf drei Einheiten, Integration des Gestüts) und einer relativ schlanken Organisation. Trotzdem werden ohne Gegenmassnahmen selbst konstante Budgets zu einem Personalabbau führen. Es drohen jedoch noch weitere Sparrunden:
– Mit dem «Projekt Laborportfolio» stehen Kürzungen (ohne Einbezug ETH) um 20 bis 50 Mio. Fr. bei den bundeseigenen Laboreinrichtungen zur Diskussion. Es geht bei diesem Projekt um die Analyse der bestehenden Situation der Labors des Bundes und deren Optimierungspotenzial sowie Alternativen in der Leistungserbringung (Kooperationen, Auslagerungen). Unter der Federführung des EFD wird eine detaillierte Planung und Spezifizierung des Vorgehens der Strategieentwicklung und -umsetzung für die Labors des Bundes entwickelt.
Im Rahmen der strategischen Planung und unter Federführung des Staatssekretariats für Bildung und Forschung soll im Bereich der Ressortforschung eine Priorisierung nach Schwerpunkten und Programmen vorgenommen und die Ressortforschung des Bundes insgesamt gestrafft werden. Der Bund erhofft sich davon ab 2014 Entlastungen von jährlich rund 30 Mio. Fr. Wie viel davon auf Agroscope entfällt, ist noch Gegenstand von Abklärungen. Bei linearer Kürzung geht es um rund 8 Mio. Fr.
Nachdem ein Bericht der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates die freie Vergabe des Auftrags im Bereich der landwirtschaftlichen Beratung an AGRIDEA kritisiert hatte, lancierte das BLW eine Untersuchung zu einer möglichen Ausschreibung des Mandats. Die Studie kam zum Schluss, dass eine Aufteilung und demzufolge eine Ausschreibung möglich sei. Dadurch würden die Kosten in den einzelnen Leistungsbereichen ersichtlich.
n Neue Leistungsauftragsperiode 2012–2013
In den Jahren 2010 und 2011 werden die Leistungsaufträge 2012–2013 des Bundes an Agroscope, das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und AGRIDEA erarbeitet. Das BLW hat im Hinblick auf die Leistungsaufträge und die daraus abgeleiteten Arbeitsprogramme seine Kontakte mit den Nutzniessern der Leistungen von Agroscope, FiBL und AGRIDEA intensiviert mit dem Ziel, von ihnen zu wissen, welche Leistungen in der Praxis nachgefragt werden. Es führte zu diesem Zweck einen Workshop mit den Kantonen durch. In der Folge wurde eine Arbeitsgruppe «Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen in Agrarforschung und Beratung» (AG BuKaF+B) gebildet. Diese soll in einem ersten Schritt die Leistungsaufträge für Agroscope, FiBL und AGRIDEA prüfen und vervollständigen. Darüber hinaus wird sie Ansprechpartner des BLW für die Ausgestaltung der Beziehungen innerhalb des AKIS sein. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus je drei kantonalen Vertretern von Beratung, Ausbildung und Landwirtschaftsämtern (KOLAS) zusammen.
171 2.3 Grundlagenverbesserung
–
n AKIS international: von der Wissensvermittlung zum lernenden Netzwerk
Das Standing Committee on Agricultural Research der europäischen Staaten (SCAR) rief vor zwei Jahren eine Arbeitsgruppe AKIS ins Leben. Ausgangspunkt war eine Kritik an den bestehenden Landwirtschaftlichen Wissenssystemen, sie seien fragmentiert, unterlägen einem rein produktionsorientierten und linearen, auf blosser Wissensvermittlung und -übernahme basierten Denkansatz und würden deshalb Innovationen zu wenig fördern. Obwohl diese Systeme institutionell gut eingebettet seien und effizient arbeiteten, seien sie nicht fähig, die neuen Herausforderungen und den gesellschaftlichen Wandel aufzufangen.
Das neue AKIS soll die Beteiligung weiterer Akteure erlauben, neue Initiativen entwickeln und lernende Netzwerke ermöglichen. Während die traditionellen Systeme immer noch davon ausgehen, dass es einen Bestand an Wissen gibt, der von der Forschung über die Bildung und die Beratung zu den Bauernfamilien gelangen soll, liegt beim lernenden Netzwerk der Fokus auf dem Prozess, Lernen und Innovationen zwischen den beteiligten Akteuren zu ermöglichen. Wissen unterliegt so einem ständigen Wandel und kann von den verschiedensten Akteuren angepasst, angewendet und umgesetzt werden.
2.3.2.2 Forschung
n Neue Verordnung für die landwirtschaftliche Forschung
Schon ein kurzer Blick auf die Agroscope-Homepage offenbart, wie vielfältig und umfangreich die Aufgaben und Tätigkeiten der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten sind. Von der Entwicklung einer hochspezifischen Anwendung für den Ackerbau über betriebswirtschaftliche Auswertungen bis hin zu komplexen Laboranalysen wird vieles gemacht, was einen Bezug zur Landwirtschaft und zum Agrar- und Ernährungssektor hat. Um diese Vielfalt und Breite etwas besser zu überblicken, hat Agroscope ihre Aufgaben und Tätigkeiten neu gegliedert. Die revidierte Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung (Nr. 915.7 der Systematischen Sammlung des Bundesrechts) prägte die drei Begriffe «Forschung und Entwicklung», «Politikberatung» sowie «Vollzugsaufgaben». Was wird damit bezweckt?
An der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik sind die Aufgaben und Tätigkeiten von Agroscope durch einen problemorientierten und praxisnahen Ansatz gekennzeichnet. Dies hat den Vorteil, dass die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten einerseits disziplinäres und andererseits inter- und transdisziplinäres Wissen auf sich vereinen. Das ermöglicht zugleich eine anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung auf hohem Niveau, vorwärts- und rückwärtsschauende Expertentätigkeiten sowie die wissenschaftliche Unterstützung der staatlichen Vollzugsaufgaben im Zusammenhang mit der Agrarpolitik. Die neuen Begriffe betonen jedoch auch den Wissensaustausch zwischen Forschungsgemeinschaft, Verwaltung und Praxis. Dieser Wissensaustausch ist von zentraler Bedeutung, um künftige Herausforderungen im Bereich Landwirtschaft und Ernährung zu meistern.
Die Aufgaben und Tätigkeiten der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten werden auch mit den neuen Begriffen nicht immer klar zuzuordnen sein. Wichtig ist jedoch der gegenseitige Nutzen dieser Aufgabenund Tätigkeitsbereiche. Er schärft das Profil und damit auch die Profilierung von Agroscope als Kompetenzzentrum des Bundes in der Agrarforschung.
172 2.3 Grundlagenverbesserung
n Problemorientierte Systemforschung: Lösungen ermöglichen
Neue Forschungserkenntnisse setzen sich einfacher durch, wenn sie einem Kundenbedürfnis entsprechen. Insofern ist es richtig, dass die aktuelle agrarwissenschaftliche Forschung hauptsächlich problemorientiert stattfindet. In der landwirtschaftlichen Forschung, bei der biologische Systeme im Mittelpunkt stehen, beschränken sich Probleme und Fragestellungen selten auf eine einzelne Disziplin. Somit sind Lösungen oft nur dort zu finden, wo mehrere Fachdisziplinen zusammenarbeiten, also im interdisziplinären Ansatz. Kommen noch die Interessen von Kundinnen und Kunden sowie Nutzerinnen und Nutzern hinzu, werden sie eher im transdisziplinären Ansatz gefunden. Das heisst, die Forschung muss ihre Zusammenarbeit über die rein wissenschaftliche Arbeit hinaus bis hin zu verschiedenen Stakeholdern ausdehnen, um zur angestrebten Lösung des Problems zu gelangen.
Mit dem Systemansatz stehen die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Systemelementen im Vordergrund und weniger das einzelne Produkt oder der einzelne Prozess. Die problemorientierte und praxisrelevante Forschung ist im Kern stets disziplinenübergreifend, da wichtige Probleme der realen Welt immer Aspekte enthalten, welche die Grenzen der Einzelwissenschaft überschreiten. Je nach Problemstellung sind folglich die Grenzen des Systems sehr unterschiedlich und bezogen auf die Fragestellung sinnvoll zu wählen. Nur so ist ein grösstmöglicher Erkenntnisgewinn für die Forschung, aber auch für die Anwendung gewährleistet. Je nach Systemgrenze können überdies Erkenntnisse der einen Wissenschaftsrichtung in einer anderen genutzt werden. Ausserdem kann die problemorientierte Grundlagenforschung der einen Fachrichtung die Forschung eines anderen Gebiets weitertreiben. Damit entsteht gerade bei der problemorientierten Systemforschung ein Umfeld, das Innovation begünstigt.
n AlpFUTUR – Zukunft für die Sömmerungsweiden
Neben den drei eigenen Forschungsprogrammen ProfiCrops, NutriScope und AgriMontana, die Agroscope seit 2008 fach- und standortübergreifend durchführt, ist sie in weitere Projekte eingebunden, in denen jeweils gleich mehrere Ansprechgruppen und Forschungsinstitutionen sich einem Problem widmen und Lösungen erarbeiten. Aufgrund von Entwicklungen im näher gelegenen Ausland und in Randgebieten der Schweiz ist es etwa angebracht, sich mit der Zukunft von Sömmerungsgebieten zu beschäftigen; das sind vorwiegend Alpweiden, die ausschliesslich im Sommer mit Tieren bestossen werden. Es sind typischerweise Gebiete mit hoher Biodiversität und altüberlieferten alpwirtschaftlichen Nutzungspraktiken. Sömmerungsweiden dienen der Erholung, dem Tourismus, können vor Naturgefahren schützen und verkörpern das Schweizer Selbstverständnis. Doch wie sehen in Zukunft die Nutzung, die Natur, die Besiedelung auf einem Achtel der Schweizer Landesfläche aus? Was geschieht dereinst mit diesen Alpgebieten und den dort vorhandenen Arbeitsplätzen? Ist es im Sinne der Öffentlichkeit, solche Flächen weiterhin zu nutzen, oder soll man sie der Vergandung überlassen, wie dies beispielsweise in Norditalien bereits grossflächig geschieht? Was wären die Auswirkungen auf die Schweizer Tourismusindustrie, die übrige Wirtschaft und die Infrastruktur in Gebieten wie dem Oberwallis, dem Diemtigtal, dem Unterengadin oder in Obwalden?
Das Forschungsprojekt AlpFUTUR ist im Verbund mit zahlreichen Institutionen angelegt. Sein Ziel ist es, für einen mittleren Zeithorizont von 10 bis 40 Jahren Perspektiven bezüglich Nutzung der Schweizer Sömmerungsgebiete aufzuzeigen. Das Projekt beurteilt den politischen Handlungsbedarf und diskutiert Handlungsoptionen. Auch hier ist die Systemforschung nicht wegzudenken, denn die Ökologie ist als Forschungsgebiet von diesen Fragestellungen genauso betroffen wie die Agronomie, die Ökonomie und die Sozialwissenschaften. Deshalb gehen in AlpFUTUR 15 aufeinander abgestimmte Teilprojekte interdisziplinär die einzelnen Fragen an.
173 2.3 Grundlagenverbesserung
Bei Projekten der Verbundforschung müssen allerdings die gemeinsamen Fragestellungen und Ziele der beteiligten Partner präzise festgelegt sein. Ferner sind eine Auswahl geeigneter Fachpersonen sowie Teamentwicklung unerlässlich. Denn der Erfolg eines Forschungsprogramms steht und fällt mit der Motivation der Forschenden, sich konstruktiv einzubringen. Motivationstreiber sind die wissenschaftliche Neugier, die Überzeugung, einen nutzbringenden Beitrag leisten zu können, und die Aussicht auf Forschungsgelder. Die «Chemie» zwischen den Mitgliedern des Forschungsprogramms muss stimmen. Voraussetzungen dafür sind u.a. eine gemeinsame Sprache und ein Vertrauensverhältnis unter den Beteiligten, welches erlaubt, Daten auszutauschen und gemeinsam zu publizieren. Die Komplexität der Verbundforschung zeigt sich auch, wenn es darum geht, wer den Lead hat in der internen und externen Kommunikation, bei der Arbeitsorganisation und bei der Zuständigkeit der Finanzierung. Die Aufteilung der Forschungsbeiträge wird in jedem Projekt abgestimmt, ebenso sind die Prozesse der Konsensbildung und der Integration der Forschungsresultate keine Selbstläufer.
Im Projekt AlpFUTUR werden diese Aufgaben zentral von Agroscope und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) koordiniert.
Auch der problemlösungsorientierte, transdisziplinäre Ansatz ist bei AlpFUTUR deutlich zu erkennen, indem es Anliegen aus der Praxis aufnimmt, die in Gesprächen beispielsweise mit Vertreterinnen und Vertretern der Land- und Alpwirtschaft, der Kantone und der Bundesämter erfragt wurden. Regelmässige Koordinationstreffen und eine begleitende Gruppe von Expertinnen und Experten stellen zudem sicher, dass dieses Projekt möglichst konkrete Lösungen für die verschiedenen Ansprechgruppen bringt. Mit diesem Vorgehen hat AlpFUTUR allerdings hohe Erwartungen geweckt. Nun müssen substanzielle Ergebnisse erarbeitet und insbesondere auch zielgruppengerecht kommuniziert werden.

174 2.3 Grundlagenverbesserung
n FusaProg – ein Codewort mit Nutzen
Die problemlösungsorientierte Systemforschung zeichnet sich ausserdem dadurch aus, dass sie hoch spezialisierte Grundlagenforschung für den direkten praktischen Nutzen in der landwirtschaftlichen Praxis umzusetzen weiss.
Besonders eindrücklich illustriert dies Agroscope im Bereich der Fusarienforschung. Schimmelpilze der Gattung Fusarium gehören weltweit zu den wichtigsten Schadpilzen in Getreide und Mais. Trotzdem ist wenig über sie bekannt. Sie führen zu Ertragseinbussen, Qualitätsverlust und vermindern die Keimfähigkeit des Saatgutes. Ihre giftigen Stoffwechselprodukte, sogenannte Mykotoxine, belasten das Erntegut und können die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden. In Nordamerika betrug Ende der 1990er-Jahre der durch diese Art von Schimmelpilzen verursachte jährliche Verlust bei Weizen und Gerste rund eine Milliarde USDollar. Für Europa gibt es bislang keine Angaben darüber, weil entsprechende Untersuchungen fehlen. Erstaunlich ist die grosse Vielfalt der Fusarien, die hier gemäss aktueller Forschung von Agroscope im Getreide vorhanden ist. Allein auf Mais sind bis heute in der Schweiz 16 verschiedene Arten bekannt. Gleichzeitig erschwert diese Vielfalt ihre Bekämpfung enorm.
Mehrjährige Feldstudien von Agroscope in Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau konnten darlegen, dass Fusarium graminearum in der Schweiz die häufigste Fusariumart auf Weizen ist. Sie produziert vor allem das Mykotoxin Deoxynivalenol, welches das Immunsystem schwächt und zu Brechreiz führt, sowie Zearalenon, ein starkes Östrogen, das insbesondere in der Schweinezucht Fruchtbarkeitsstörungen verursacht. Die Untersuchungen im Aargau haben zudem gezeigt, dass neben der Witterung die Vorfrucht, die Bodenbearbeitung und die Getreidesorte einen grossen Einfluss auf die Stärke des Befalls und die Mykotoxinbelastung des Weizens haben. Deshalb wird der Fusarienbefall neuerdings mit einem von der Forschung entwickelten Überwachungsprogramm in Schach gehalten. Das Programm nennt sich FusaProg und steht der landwirtschaftlichen Praxis und Beratung zur Verfügung. Damit kann jeder Landwirtschaftsbetrieb die momentane Fusarienbelastung in der Schweiz und das Infektionsrisiko prüfen. Sofern zu Beginn der Saison die parzellenspezifischen Angaben wie Sorte, Bodenbearbeitung oder Vorfrucht erfasst wurden, berechnet FusaProg täglich aktualisierte Prognosen über das Belastungsrisiko der entsprechenden Parzelle. Somit kann der Betrieb die geeigneten Bewirtschaftungsmassnahmen durchführen, die Vermehrung der Fusarien verhindern und ihre schädigende Wirkung auf Tier und Mensch so gering wie möglich halten.
Das Beispiel verdeutlicht, dass der Weg von der Problemstellung bis zur verbesserten Anbaupraxis oft ein sehr langer ist. Ausgehend von einem Praxisproblem, das eine nationale Bedeutung hat, dem aber eine globale Dimension innewohnt, wurde die Grundlagenforschung in Angriff genommen und dabei der Blick systemisch zusätzlich auf Dimensionen wie Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Sortenwahl und Umweltwirkungen, etwa die Witterung, gerichtet. Erst diese Inter- und Transdisziplinarität erlaubte es, den Weg vom Problem bis zur Verbesserung in der Praxis zu Ende zu gehen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur internationalen Forschung auf dem Gebiet der Fusarien zu leisten.
So schafft die problemorientierte Systemforschung von Agroscope einen Mehrwert für alle Akteurinnen: Forschung, Verwaltung, Politik, Gesellschaft und die landwirtschaftliche Praxis. Die gewählten Methoden und Techniken sind vielfältig und den einzelnen Problemen angepasst. Die zur Problemlösung gewählten Systemgrenzen werden unterschiedlich und bezogen auf die Fragestellung sinnvoll gewählt. Trotz oder gerade wegen der vielseitigen Projekte zeigt sich anhand dieser Beispiele: Die problemorientierte Systemforschung von Agroscope ist mehr als die Summe ihrer Teile.
175 2.3 Grundlagenverbesserung
2.3.2.3 Beratung
Die landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung in der Schweiz ist auf zwei Stufen organisiert. Die Direktberatung der Bauernfamilien geschieht vor Ort in erster Linie durch die kantonalen Beratungsdienste. Diese sind je nach Kanton Teil des Bildungs- und Beratungszentrums, des Landwirtschaftsamtes oder eines kantonalen Bauernverbandes. In einigen spezifischen Wissensgebieten wie Bienen, Geflügel oder Alpwirtschaft sind Beratungsdienste von landwirtschaftlichen Organisationen tätig.
Unterstützung für die Beratungsdienste bietet die AGRIDEA. Dieser von allen Kantonen und ca. 50 landwirtschaftlichen Organisationen oder Institutionen getragene Verein entwickelt Beratungsmethoden, bildet Beratungskräfte aus und weiter, bereitet Informationen auf und stellt sie als Merkblätter, Broschüren, Publikationen oder EDV-Programme zur Verfügung. Schliesslich leistet AGRIDEA in unzähligen Arbeitsgruppen, Foren, Plattformen und Fachgruppen Netzwerkarbeit für das gesamte Wissens- und Innovationssystem.
Zu erwähnen sind im gesamten Wissens- und Innovationssystem auch weitere Akteure, die in Beratung und Informationsaustausch unterschiedlich stark aktiv sind: Agroscope, Fachhochschulen, das FiBL, Verbände, Medien oder die Privatwirtschaft.
Ausgaben des Bundes für die Beratung 2010
Quelle:
n Neue Führungsstruktur bei der AGRIDEA
Seit Anfang 2011, als die neue Geschäftsleitung operativ ihre Arbeit aufnahm, stehen die beiden Standorte Lausanne und Lindau der Beratungszentrale AGRIDEA unter einer gemeinsamen Führung.
AGRIDEA umfasst neu die folgenden fünf Departemente, die je unter der Leitung eines Mitglieds der Geschäftsleitung stehen: die drei thematischen Bereiche «Unternehmen und Familie», «Landwirtschaftliche Produktion und Umwelt» sowie «Ländliche Entwicklung, Märkte, International»; dazu den Querschnittbereich «Bildung und Information» sowie die «Internen Dienste». Wie bei den Departementen gilt auch bei den dazu gehörigen Gruppen, dass sie standortsübergreifend arbeiten und die Leitung und deren Stellvertretung je zwischen den beiden Standorten Lausanne und Lindau aufgeteilt sind. Entsprechend bedürfen auch sämtliche internen Prozesse einer Vereinheitlichung. AGRIDEA versteht sich als Unternehmen, das seinen Kunden die bestmöglichen Leistungen zum Wohl der Schweizer Landwirtschaft anbietet.
176 2.3 Grundlagenverbesserung
Empfänger Mio. Fr. Beratungszentrale (AGRIDEA) 9,5 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen 2,0 Gemeinschaftliche Projektinitiativen 0,7 Total 12,2
Staatsrechnung
2.3.2.4 Berufsbildung
n Berufliche Grundbildung
Die neue dreijährige Berufslehre steht im zweiten Jahr der Einführung. Damit laufen während einer Übergangsfrist von drei Jahren das alte und neue Ausbildungssystem parallel, was alle Direktbetroffenen wie Lernende, Eltern, Lehrmeisterfamilien, Lehrpersonen und Schulleitungen vor anspruchsvolle Herausforderungen stellt.
Die Zahlen per anfangs September 2010 zeigen einen erfreulichen Trend: Die Zahl der Lernenden in der dreijährigen Grundbildung (Eidg. Fähigkeitszeugnis, EFZ) nimmt zu und beträgt um 950 Lehrverhältnisse pro Lehrjahr. Die ungefähr 150 jungen Berufsleute, die den Beruf Landwirt EFZ als Zweitberuf erlernen wollen und direkt ins zweite Lehrjahr eintreten, tragen wesentlich zur Steigerung der Lehrverhältnisse bei. Der Abschluss «Landwirt EFZ mit Schwerpunkt Biolandbau» wird von ungefähr 50 Lernenden anvisiert. Die gesamtschweizerisch ungefähr 100 Lehrverhältnisse pro Lehrjahr der neuen zweijährigen Lehre (Eidg. Berufsattest, EBA) entsprechen den Erwartungen.
Die Einführung der neuen Berufslehre ist mehrheitlich positiv verlaufen. Die Zusammenarbeit zwischen den involvierten Akteuren (kantonale Bauernverbände, Schulen und Bildungsämter) ist sehr konstruktiv. Nach wie vor gilt der Grundsatz: Berufsbildung ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (Berufsverbände).
Der neue Lernort «Überbetriebliche Kurse» (ÜK) wird generell als Aufwertung der betrieblichen Bildung beurteilt. Die Lernenden absolvieren in den beiden ersten Ausbildungsjahren je 4 Tage überbetriebliche Kurse (beim EBA sind es je 3 Tage pro Lehrjahr). Die Bildungsinhalte sind auf die Praxis ausgerichtet und beinhalten Themen wie Unfallprävention, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit. Hinzu kommen der korrekte Einsatz von Maschinen (u.a. Motorsäge), Geräten und technischen Einrichtungen sowie der Umgang mit Nutztieren. In den überbetrieblichen Kursen erlangen die Lernenden zusätzlich zur betrieblichen Bildung praktische Kompetenzen. Die Kurse werden durch speziell ausgebildete Berufsbildner und Berufsbildnerinnen, Lehrpersonen der Berufsfachschulen oder durch Fachexpertinnen und -experten (Unfallprävention) erteilt.
Der handlungsorientierte Unterricht wertet die Ausbildung an der Berufsfachschule auf. Er fördert insbesondere die Verzahnung zwischen betrieblicher und schulischer Bildung. Der interkantonale Lehrbetriebswechsel (auch über die Sprachgrenzen) entspricht nach wie vor einer prioritären Zielsetzung der landwirtschaftlichen Berufsbildung. Dies setzt eine intensive Koordination in fast allen Bereichen voraus wie Lektionenverteilung auf die einzelnen Lehrjahre, Bildungsinhalte im allgemein bildenden Unterricht, überbetriebliche Kurse, Lehrmittel u.a.m.
Im Jahr 2010 wurde das Qualifikationsverfahren (Prüfungen) auf der Grundlage der Bildungsverordnung und des Bildungsplans entwickelt. Das Produkt davon ist die Wegleitung über das Qualifikationsverfahren im Berufsfeld Landwirtschaft. Im Winterhalbjahr wurden über 500 Prüfungsexpertinnen und -experten ausgebildet. Sie stellen in den durchführenden Kantonen qualitativ hoch stehende Prüfungen sicher und leisten damit einen wesentlichen Beitrag an die Qualitätssicherung. Im Frühjahr 2011 fanden auf Stufe EFZ die ersten vorgezogenen Teilprüfungen in Tierhaltung und Mechanisierung statt. Die Lernenden, die das Eidg. Berufsattest anstreben, traten nach Ablauf der zwei Lehrjahre dann bereits zur Schlussprüfung an.
177 2.3 Grundlagenverbesserung
n Höhere Berufsbildung
Auf Stufe der Höheren Berufsbildung (Tertiär B) sind zwei Entwicklungen im Gang:
Die Berufsprüfung (Eidg. Fachausweis) und die Meisterprüfung (Eidg. Meisterdiplom) müssen sich der neuen landwirtschaftlichen Grundbildung im Berufsfeld Landwirtschaft anpassen. Die Bildungsinhalte der Betriebswirtschaft, des Marktes und des Rechts (Agrarrecht, Personalrecht) werden gestärkt. Es ist wichtig, dass diese Reformarbeiten abgeschlossen sind, sobald die ersten Absolventinnen und Absolventen der neuen Berufslehre in die berufliche Weiterbildung einsteigen wollen. Die Berufs- und Meisterprüfung sind nach wie vor sehr praxisorientierte Berufsabschlüsse. Sie richten sich auf die Qualifikation in Betriebsleitung und Unternehmensführung aus. Zudem besteht das Ziel, die Durchlässigkeit innerhalb des Berufsfelds, das heisst zwischen dem Beruf Landwirt und den landwirtschaftlichen Spezialberufen, deutlich zu erleichtern. Im gleichen Zug gilt es, neue gesetzliche Vorgaben des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) einzuhalten.
Die Höheren Fachschulen (Diplom HF) sind im Trend. Bereits wurden in mehreren Kantonen entsprechende Abklärungen getroffen und Entscheide über die Einführung der entsprechenden Schulen gefällt. HF-Absolventinnen und -absolventen (Agro-Techniker und Agro-Kaufleute) können attraktive Funktionen im ganzen Bereich der Agrarwirtschaft einnehmen. Die Gesetzgebung stellt auch hier hohe Anforderungen an die Akkreditierung der Schulen und an die Qualitätssicherung über den Kompetenznachweis.

178 2.3 Grundlagenverbesserung
2.3.3 Produktionsmittel
n Gentechnisch veränderte Organismen in Futtermitteln
Das dritte Jahr in Folge konnten die Importeure auf dem Weltmarkt Futtermittel ohne gentechnisch veränderte Bestandteile einkaufen und einführen. Gemäss den Analysenergebnissen konnte die Situation bei Heimtierfuttermittel gegenüber den Vorjahren verbessert werden. In der Periode 2009–2010 wurde unbeabsichtigt GVO-verunreinigte Leinsaat importiert. Diese weder in der EU noch in der Schweiz zugelassene Leinsaat wurde in Kanada und den USA für den Anbau sowie für die Verwendung als Nahrungs- und Futtermittel zugelassen. Aufgrund der Ausnahmeregelung von Artikel 21b Abschnitt 2 der Futtermittelverordnung konnten 739 t (10 Posten) bereits eingeführter Leinsaat mit Spuren von gentechnischen Verunreinigungen mit entsprechender Bewilligung als Futtermittel verwendet werden. Eine Bewilligung wurde nur für jene Posten erteilt, welche weniger als 0,5 % gentechnische Verunreinigungen enthielten. Dieser Grenzwert war bei 24 t (2 Posten) bereits eingeführter Leinsaat überschritten. Diese beiden Posten mussten vernichtet werden.
Bei der Einfuhr dem Zoll gegenüber gemeldete GVO-haltige Futtermittelimporte
Untersuchungen von Nutztierfuttermitteln auf GVO-haltige Bestandteile durch Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
Untersuchungen von Heimtierfuttermitteln auf GVO-haltige Bestandteile durch Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
179 2.3 Grundlagenverbesserung
Jahr Importierte Futtermittelmenge gemeldete GVO-haltige gemeldete GVO-haltige total Futtermittel Futtermittel in t in t in % 2006 373 228 60 0,02 2007 486 743 55 0,01 2008 461 039 0 0 2009 380 018 0 0 2010 455 271 0 0 Quellen: BLW, OZD
Jahr durch den Zoll erhobene falsche durch ALP erhobene falsche Proben beim Import Angaben Proben des Marktes Angaben Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 2006 79 0 300 0 2007 93 0 260 3 2008 93 0 242 0 2009 96 0 241 0 2010 60 0 237 1 Quelle: Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
Jahr kontrollierte Heimtier- falsche Futtermittel Angaben Anzahl Anzahl 2006 114 10 2007 97 9 2008 116 4 2009 138 8 2010 109 1 Quelle: Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
2.4 Spezialthemen
2.4.1 Finanzinspektorat
Das Jahresprogramm des Finanzinspektorates wird aufgrund von internen Risikoanalysen, Erfahrungswerten und einer Mehrjahresplanung erarbeitet. Um Lücken und Doppelspurigkeiten im Prüfprogramm zu vermeiden, wird es auf die Aktivitäten der Eidgenössischen Finanzkontrolle abgestimmt und von ihr genehmigt.
n Revisionstätigkeiten
Rechenschaftsablage im Berichtsjahr
Im Berichtsjahr wurden folgende Revisionstätigkeiten unternommen:
Revision des Direktzahlungssystems in drei Kantonen;
Abschlussrevision Geschäftsjahr 2009 der Buchungskreise BLW und Agroscope;
Zwischenrevisionen im Amt inkl. Forschungsanstalten;
Dienststellenrevision in einem Fachbereich des BLW
Prüfungen von sechs EU-Forschungsprojekten;
Revision von Absatzförderungsmassnahmen bei einer Partnerorganisation;
Nachfolgeprozess von abgeschlossenen Revisionen.
Sämtliche Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit den Standards für die berufliche Praxis des Institute of Internal Auditors (IIA) sowie des Schweizerischen Verbandes für Interne Revision (SVIR) vorgenommen.
Im Bereich der Direktzahlungen wurden im vergangenen Jahr in drei Kantonen die Finanzflüsse zwischen Bund und Kanton sowie die Zahlungen an die Bewirtschaftenden revidiert. Zusätzlich wurde ein Nachfolgeprozess der gemachten Feststellungen und Beanstandungen aus vorhergehenden Revisionen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass in einem Kanton bei Verstössen nach wie vor nicht konsequent die für den Vollzug verbindliche Richtlinie zur Kürzung der Direktzahlungen angewandt wird. Wir haben dem BLW empfohlen, die Aufsicht über den Vollzug des Kantons gezielt auf die festgestellten Schwachstellen auszurichten. In einem weiteren Kanton konnte festgestellt werden, dass die Begrenzung der Direktzahlungen aufgrund der massgebenden Einkommens- und Vermögenslage nun verordnungskonform vollzogen wird. Noch nicht erledigt war hingegen die nachträgliche Verifikation aller Betriebe, bei denen aufgrund der neuen Datengrundlage erstmals Abzüge vorgenommen werden mussten. Weiter erachtete das Finanzinspektorat die vom Kanton für die Abwicklung der Direktzahlungen zur Verfügung gestellten Personalressourcen als zu knapp, um die Vollzugsaufgaben vollumfänglich erfüllen zu können; dies vor allem im Bereich der Oberaufsichtsfunktion. Im dritten Kanton waren bis September 2010 rund 60 % der Parzellen neu vermessen und die Daten mit den Flächen der Landwirtschaft abgeglichen und bereinigt worden. Die Vermessung hätte bis Ende 2010 vollständig abgeschlossen sein sollen; die Bereinigung aller Flächen der Landwirtschaft dürfte indes noch bis ins Jahr 2012 dauern. Somit wird der Kanton die Vorgabe des Bundes nicht vollumfänglich einhalten können. Die Kontrollen gemäss Öko-Qualitätsverordnung wurden verstärkt und sollten voraussichtlich 2011 erstmals verordnungskonform umgesetzt werden können. Auch hier musste bemängelt werden, dass die gemäss Verordnung verlangte Oberkontrolle noch nicht den Vorgaben entspricht.
Die Abschlussrevision 2009 und die Zwischenrevisionen im Amt und bei Agroscope erfolgten risikoorientiert und anhand der gemachten Feststellungen anlässlich von Dienststellenrevisionen und Revisionen vor Ort bei Agroscope. Die Rechnungsführung ist ordnungsgemäss; die Grundsätze der Rechnungs- und Haushaltführung werden eingehalten. Die Revisionen im Bereich von EU-mitfinanzierten Forschungsprojekten bei Agroscope zeigten, wie bereits in den Vorjahren festgestellt, dass ein direkter Nachvollzug der eingesetzten Personalressourcen mit den im Buchhaltungssystem aufbereiteten Daten nur bedingt möglich ist.
180 2.4 Spezialthemen
–
–
–
–
–
–
–
In einem Fachbereich des BLW wurde eine Dienststellenrevision durchgeführt. Die geprüften Massnahmen werden vom Fachbereich kompetent betreut. Die Aufgaben sind klar definiert und die Prozesse ausreichend beschrieben sowie nachvollziehbar. Es besteht Weiterentwicklungspotential bei der Bewirtschaftung der «Fonds de roulement» in den Kantonen, der Oberaufsicht über den Vollzug der Massnahmen durch die Kantone, der Dokumentation der geprüften Gesuche, beim Controllingkonzept für den Bereich landwirtschaftlicher Hochbau sowie bei der Evaluation der Massnahmen.
Im Bereich der Absatzförderungsmassnahmen wurde bei einer Partnerorganisation eine Revision durchgeführt. Die Rechnungsstellung gegenüber dem BLW entsprach dabei den vertraglichen Vereinbarungen und den effektiv erbrachten Leistungen; die Ordnungs- und Rechtmässigkeit konnte bestätigt werden.
Folgeprozess
Im Rahmen des Folgeprozesses wurde der Umsetzungsstand offener Empfehlungen aus 10 Revisionen bei den betroffenen Fachbereichen sowie bei 8 Kantonen (Direktzahlungsrevisionen) überprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Empfehlungen weitgehend umgesetzt worden sind. Die noch nicht umgesetzten oder in Bearbeitung stehenden Empfehlungen werden im laufenden Jahr nochmals auf ihren Umsetzungsstand hin überprüft.
n Inspektionstätigkeiten
Kontrolltätigkeit im Berichtsjahr
Die Inspektionsstelle BLW führt für die Fachbereiche des BLW Kontrollen in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Gesetzgebung von Produktion und Absatz durch. 2010 wurden 367 Kontrollen in den folgenden Bereichen durchgeführt:
– Milch mit 308 Kontrollen;
– Früchte und Gemüse, Schnittblumen, Kernobstsaftkonzentrat, Fleisch, Eier, Kartoffeln, Marktanpassungsund Umstellungsmassnahmen mit 59 Kontrollen.
Die Überprüfung von Vertrags-, Produktions- und Verwertungsdaten im Bereich Milch im Zusammenhang mit der Auszahlung von Zulagen und Abgaben (Milchkontingentierung) erfolgte nach der internationalen Norm ISO/IEC 17020, akkreditierte Inspektionsstelle Typ B. Für die übrigen Kontrollbereiche wurden die gleichen Qualitätsnormen angewandt.
Grundlage für die Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe im Bereich Milch bildet eine periodisch aktualisierte Risikoanalyse und ein mit dem zuständigen Fachbereich vereinbarter Jahresgesamtauftrag. Im Berichtsjahr haben 1035 Betriebe Zulagen im Gesamtbetrag von 289 Mio. Fr. erhalten. Von diesen Betrieben wurden 30 % kontrolliert; davon mussten 141 Betriebe beanstandet werden. 59 Fälle wurden zur Weiterbearbeitung und Entscheidfindung an den zuständigen Fachbereich weitergeleitet.
Widerhandlungen
Abklärungen und Befragungen im Zusammenhang mit Widerhandlungen gegen die Landwirtschaftsgesetzgebung werden in Zusammenarbeit mit eidgenössischen und kantonalen Untersuchungsbehörden, mit privaten Organisationen und anderen Rechtshilfestellen vorgenommen. Im Berichtsjahr wurden zwei Abklärungen durchgeführt.
181 2.4 Spezialthemen
2.4.2 Vernetzung der Agrar-Datenbanken
Das Programm «ASA 2011»
Das Programm «ASA 2011» (AgrarSektorAdministration) unterstützt die Zusammenarbeit der Kantone und des Bundes organisatorisch, namentlich im Bereich der Informations- und Datenverarbeitung. Im Vordergrund steht dabei eine effiziente Vollzugspraxis mit zukünftig reduziertem finanziellen Aufwand. Das Programm soll letztlich zu einer Vereinheitlichung der Systemlandschaft führen. An «ASA 2011» sind Interessengruppen seitens Bund und Kantone beteiligt: das BLW, das BVET, das Generalsekretariat des EVD, das BAG und das BFS. Aus den Kantonen sind es die Ämter für Landwirtschaft, Veterinärwesen, Gewässerschutz und Informatik sowie die Kantonschemiker. Der SBV ist ebenfalls eingebunden und nimmt als Dachorganisation die bäuerlichen Interessen wahr.
Agate und seine Systeme
Mit dem Internetportal Agate (www.agate.ch) erhalten Benutzer und Benutzerinnen mit einer einmaligen Registrierung Zugriff auf ihre eigenen Daten. Zudem haben Landwirte und Landwirtinnen, Tierhalter und Tierhalterinnen, Mitarbeitende kantonaler Ämter oder von Bundesbehörden und weitere Berechtigte auf dieser Seite die Möglichkeit, Informationen und Daten aus dem Primärsektor abzurufen.
Im Jahr 2010 wurden zahlreiche Arbeiten und Projekte im Programm «ASA 2011» weitergeführt, sodass bisherige und neue Anwendungen laufend zusammengefügt werden können. Bis heute sind Systeme in den Bereichen Landwirtschaft und Veterinärwesen über das Portal Agate zugänglich und verknüpft.
Das Internetportal Agate konnte plangemäss am 3. Januar 2011 gestartet werden und wird mit täglich rund 380 Besuchen (Spitzenwert bis 8 000) rege benutzt. Zudem existiert ein Informationsdienst (Helpdesk), der die Anwender unterstützt.
– Ebenfalls zu Beginn 2011 konnte in Agate ein Teil der Tierverkehrsdatenbank TVD integriert werden. Pferdeeigentümer und Schweinehalter registrieren bzw. melden seither ihre Tiere bzw. deren Zugänge. Die Schweineschlachtbetriebe können Schlachtinformationen abrufen und ergänzen. Ab Anfang 2012 ist auch geplant, die Bewegungsmeldungen der Rinder auf der TVD via Agate abzuwickeln.
Im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2011 wurde Acontrol, das Programm für Kontrollen auf Schweizer Landwirtschaftsbetrieben, ebenfalls auf Agate zur Verfügung gestellt. Mit Acontrol werden keine neuen Kontrollen eingeführt, sondern es wird eine Übersicht über alle Kontrollen und Vollzugsmassnahmen geschaffen. Die Koordination der Kontrollen und der Informationsaustausch zwischen den diversen involvierten Ämtern und Kontrollorganisationen werden dank Acontrol erleichtert und führen auch auf den landwirtschaftlichen Betrieben zu einer Entlastung. Vorab sind es verschiedene kantonale Landwirtschafts- und Veterinärämter, die mit dieser Anwendung arbeiten, später werden alle Anwender zugeschaltet. Aus Datenschutzgründen ist der Zugriff auf Acontrol nur mit einer eindeutigen Erkennung des Benutzenden möglich.
Das System Asan, das die Geschäftsprozesse der kantonalen Veterinärdienste koordiniert, wird im Laufe des Jahres 2011 den Betrieb aufnehmen.
– Die Kantonssysteme werden etappenweise im Portal Agate integriert. Landwirte, die dieses System nutzen, können somit über Agate sowohl auf ihr Kantonssystem als auch auf alle anderen Daten aus Acontrol, Asan und der TVD zugreifen. Mit dem System LAWIS wird im Verlauf des Jahres 2011 gestartet. Sukzessive werden auch die anderen kantonalen Systeme wie Agricola, Acorda, GELAN und das Walliser System in Agate vernetzt.
182 2.4 Spezialthemen
–
–
–
Weitere Projekte
Mit dem Projekt GIS-ASA werden die landwirtschaftlichen Flächen für die Berechnung der Direktzahlungen statt wie bisher numerisch, neu geometrisch (grafisch) mit einem Geografischen Informationssystem (GIS) erfasst. Das System soll Landwirten ermöglichen, ihre bewirtschafteten Flächen direkt im Internet auf einer Karte erfassen zu können. Die Konzeptarbeit wird zurzeit abgeschlossen. Die eigentliche Entwicklung des Systems ist von September 2011 bis Februar 2013 geplant.
Die bundesseitigen Anpassungsarbeiten zu «AGIS 2011» sind angelaufen. Dies betrifft einerseits die notwendigen Spezifikationen der Datenmodelle. Andererseits wird ein neuer Übertragungskanal für eine sichere Datenübermittlung aus den Kantonen an AGIS zum Einsatz gelangen.
183 2.4 Spezialthemen
184
3. Internationale Aspekte
3.1 Internationale Entwicklungen
Aufgrund des mangelnden politischen Willens zum Abschluss der Doha-Runde sind die Verhandlungen auf multilateraler Ebene ins Stocken geraten. Vor diesem Hintergrund setzten die Grossmächte vermehrt auf den bilateralen Weg. So hat die EU, die sich bisher auf den Ausbau ihrer Beziehungen im Mittelmeerraum konzentriert hat, ein Abkommen mit Südkorea abgeschlossen und verhandelt aktiv mit Indien und dem Mercosur, dem grossen südamerikanischen Handelsblock. Die USA sind bemüht, ihre Abkommen mit drei wichtigen Ländern zum Abschluss zu bringen. Auch Japan, China, Indien und weitere asiatische Grossmächte verfolgen diese Strategie. Während es immer unwahrscheinlicher wird, dass es in den nächsten zwei Jahren bei der WTO zu konkreten Resultaten kommt, werden der Handel und die Liberalisierung auf anderen Wegen vorangetrieben. Damit auch der Schweiz, deren Wirtschaft zur Hälfte exportabhängig ist, keine Nachteile erwachsen, hat sie sich der Strategie der Grossmächte angeschlossen. Da viele ihrer künftigen Partner wettbewerbsstarke Exporteure von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind, wird auch die Marktöffnung in diesem Bereich ein Thema sein. Das neue Umfeld mit Staaten wie Indien, China, Russland, ja sogar dem Mercosur wird wohl in einer Öffnung bestehen, die auf Sektorebene genauso umfassend ist wie jene, welche die Schweiz im Rahmen der Verhandlungen der Doha-Runde eingeräumt hat. Ist ein Partner bereit, der Schweiz seinen Dienstleistungssektor zu öffnen, wird er im Gegenzug unweigerlich weitgehenden Zugang zum Schweizer Agrarmarkt für seine Exportprodukte fordern. Unser wichtigster Handelspartner ist jedoch nach wie vor die EU, mit der die Beziehungen über die letzten zwölf Monate vertieft wurden. Das Abkommen über den gegenseitigen Schutz der geografischen Angaben (GUB und GGA) oder die Überarbeitung zahlreicher Punkte des Agrarabkommens von 1999 sind offenkundige Beispiele für die Annäherung im Landwirtschaftsbereich. Alle wichtigen bilateralen Verhandlungen – auch jene im Hinblick auf ein Abkommen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Produktsicherheit und öffentliche Gesundheit – sind heute an Verhandlungsfortschritte bei den institutionellen Fragen geknüpft (Übernahme des Acquis, Überwachung, Rechtsprechung, Streitbeilegung). Bis die Gespräche über diese Themen zu einem Abschluss gelangen, haben die Schweiz und die EU bei den Bedingungen, die den gegenseitigen Handel in den Bereichen Pflanzenschutz, Biolandbau und Saatgut regeln, bereits Verbesserungen herbeigeführt. Ein Eckstein des internationalen Schutzes von landwirtschaftlichen Spezialitäten stellt das Abkommen über die geografischen Bezeichnungen dar; seine Auswirkungen werden sich auch in anderen Abkommen niederschlagen.

185 3.1 Internationale Entwicklungen
Angesichts der Preistrends an den Weltmärkten sollte die Schweizer Landwirtschaft die Lage dazu nutzen, neue Märkte für ihre Qualitätsprodukte, die den Grundätzen der nachhaltigen Entwicklung entsprechen, zu erschliessen. Denn genau hier sind die Vorteile der Schweizer Agrarproduktion angesiedelt. Auf internationaler Ebene wächst das Bewusstsein dafür, dass eine nachhaltige Landwirtschaft einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt: sie ist Dreh- und Angelpunkt eines «grünen Wachstums». Von der Ressourcenknappheit ist die landwirtschaftliche Produktion ganz besonders betroffen. Dieses Thema, dem noch vor rund zehn Jahren kaum Beachtung geschenkt wurde, steht heute im Zentrum des Interesses von Organisationen, indem sie die Umwelt- und Agrarpolitiken weltweit untersuchen – darunter an prominenter Stelle die OECD. Auch die Entscheidung der Vereinten Nationen, 2012 in Rio erneut eine Nachhaltigkeitskonferenz zu veranstalten («Rio+20»), ist ein eindrücklicher Beweis dafür, dass die Staaten gewillt sind, einen starken institutionellen Rahmen zu schaffen für die nachhaltige Entwicklung und die Politiken, die diese unterstützen – einschliesslich der Agrarpolitik.
3.1.1 Abkommen mit der EU in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel- und Produktsicherheit sowie öffentliche Gesundheit
Die Schweiz und die EU haben am 4. November 2008 Verhandlungen über ein Abkommen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel- und Produktsicherheit sowie öffentliche Gesundheit (FHAL&GesA) eröffnet. In den darauffolgenden Monaten gab es drei horizontale Verhandlungsrunden sowie zahlreiche Expertentreffen. Im Bereich «Marktzugang im Agrarbereich» wurden fünf weitere Verhandlungsrunden durchgeführt, wobei die Verhandlungen bis 2010 gut vorangekommen sind.
n Institutionelle Fragen bringen Verhandlungen ins Stocken
Die FHAL&GesA-Verhandlungen sind in der Zwischenzeit ins Stocken geraten. Dies hat zwei hauptsächliche Gründe. Einerseits bestehen Differenzen über den Verhandlungsgegenstand, da die Verhandlungsmandate der beiden Parteien in einigen Punkten voneinander abweichen. So bildet für die EU der sogenannte Konsumentenschutz-Acquis einen Bestandteil des angestrebten Abkommens. Für die Schweiz ist eine Lösung im nicht-harmonisierten Bereich unerlässlich, weil sonst keine echte Reziprozität beim Marktzugang gewährleistet werden kann.
Andererseits verknüpft die EU alle Verhandlungsbereiche mit den horizontalen institutionellen Fragen. Hierbei geht es grundsätzlich um vier Aspekte: (i) Anpassung der Abkommen an die Weiterentwicklungen des relevanten EU-Rechts, (ii) Auslegung der Abkommen, (iii) Überwachung der Anwendung der Abkommen, (iv) Streitbeilegung. Der Bundesrat hat sich bereit erklärt, diese Themen zu diskutieren, eine allfällige Lösung muss jedoch die Souveränität beider Parteien und das gute Funktionieren der jeweiligen Institutionen respektieren.
Im August 2010 sprach sich der Bundesrat anlässlich einer Klausursitzung für die Fortführung des bilateralen Wegs aus. Zur Klärung der institutionellen Fragen wurde – wie zwischen Bundespräsidentin Doris Leuthard und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso im Juli 2010 vereinbart – eine informelle Arbeitsgruppe Schweiz-EU eingesetzt. Im Dezember 2010 nahm der Bundesrat einen Zwischenbericht der informellen Arbeitsgruppe zur Kenntnis, der eine Auslegeordnung über die Positionen der EU und der Schweiz präsentierte. Im Januar 2011 kam der Bundesrat zum Schluss, dass ein gesamtheitliches und koordiniertes Vorgehen unter Einbezug aller aktuellen bilateralen Dossiers am meisten Erfolg verspricht. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass hierzu auch die institutionellen Fragen gehören. Anlässlich der Gespräche im Februar 2011 von Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey mit José Manuel Barroso, dem Präsidenten der Europäischen Kommission sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, wurde beschlossen, diesen Ansatz weiter zu vertiefen und zu präzisieren.
186 3.1 Internationale Entwicklungen
Am 4. Mai 2011 hat der Bundesrat an einer Klausur die Debatte über die europapolitische Strategie der Schweiz weitergeführt. Dabei beschloss er, zwei Mandate, insbesondere zur Auslegung der bilateralen Abkommen und zur Überwachung deren Anwendung, an verwaltungsexterne Experten zu erteilen. Die bisherigen Diskussionen und die in Auftrag gegebenen Gutachten sollen die Grundlage für die Entscheide des Bundesrats hinsichtlich der nächsten Schritte bilden.
Auf welche Weise das Abkommen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel- und Produktsicherheit sowie öffentliche Gesundheit in den ganzheitlichen koordinierten Ansatz integriert werden soll ist noch nicht bestimmt. Deshalb ist zurzeit der Kalender für weitere Verhandlungen auch nicht bekannt. Sowohl der Bundesrat wie auch Vertreter der EU haben aber ihr substanzielles Interesse an diesem Abkommen bekräftigt und wollen die Verhandlungen weiterführen.
n Parlament nimmt Stellung zu den Verhandlungen mit der EU
In der Sommersession 2011 hielten die Räte eine ausserordentliche Session zu «Europapolitik und Bilaterale III» ab. Dabei wurden einige Vorstösse behandelt, die die Verhandlungen über ein FHAL&GesA betreffen. Am 6. Juni hat der Ständerat als Zweitrat der parlamentarischen Initiative Joder (09.515), die einen Grundsatzbeschluss zu den Verhandlungen der Schweiz mit der EU und der WTO in Sachen Agrarfreihandel forderte, keine Folge gegeben. Der Nationalrat hat am 9. Juni folgende drei Motionen angenommen:
– die Motion Joder (10.3473), die verlangt, die Verhandlungen mit der EU in den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittel abzubrechen;
– die Motion Darbellay (10.3818), die verlangt, die Verhandlungen mit der EU zu stoppen, «so lange ein Abschluss der Doha-Runde der WTO nicht zustande kommt»;
– die Motion Favre Laurent (11.3464), die verlangt, «bei der Vorbereitung allfälliger Bilateraler III das Kapitel ‹Marktzugang für Agrarprodukte› und das Gesundheitsprogramm, soweit es die Schweizer Normen zur Herstellung von Zigaretten tangiert, vom künftigen Verhandlungsmandat auszuschliessen».
Die drei Vorstösse gelangen nun an den Ständerat, der sie in einer der folgenden Sessionen beraten wird.
n Erste Einlagen in die Bilanzreserve
Am 18. Juni 2010 stimmten National- und Ständerat einer Änderung des LwG zu, mit der eine Bilanzreserve für die Finanzierung der Begleitmassnahmen bei einem Abkommen mit der EU oder bei einem Abschluss der WTO-Doha-Runde eingerichtet werden sollte. Am 1. Januar 2011 trat der entsprechende Artikel 19a des LwG in Kraft. Er sieht vor, dass die Erträge aus Einfuhrzöllen auf Landwirtschaftsprodukten und Lebensmitteln von 2009 bis 2016 der Spezialfinanzierung gutgeschrieben werden. In der Staatsrechnung 2010 wurde die «Spezialfinanzierung Begleitmassnahmen FHAL/WTO» erstmals ausgewiesen und mit den Einfuhrzöllen von 2009 und 2010, insgesamt 1,178 Mrd. Fr., ausgestattet.
187 3.1 Internationale Entwicklungen
3.1.2 Freihandelsabkommen mit Ländern ausserhalb der EU
Die Schweiz verfügt gegenwärtig, neben der Europäischen Freihandelsassoziations-Konvention (EFTA-Konvention) und dem Freihandelsabkommen mit der EU, über ein Netz von 24 Freihandelsabkommen mit 33 Partnern ausserhalb der EU. Die Abkommen werden normalerweise im Rahmen der EFTA, in Einzelfällen aber auch bilateral verhandelt und abgeschlossen.
Der Wohlstand der Schweiz hängt zu einem grossen Teil vom internationalen Handel mit Gütern und Dienstleistungen sowie von der grenzüberschreitenden Investitionstätigkeit ab. Die stete Verbesserung des Zugangs zu ausländischen Märkten ist deshalb ein Ziel der schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik. Das beste Mittel, dieses Ziel zu erreichen, ist der multilaterale Ansatz im Rahmen der WTO. Mit dem Abschluss von Freihandelsabkommen wird der multilaterale Weg ergänzt. Schweizer Unternehmen soll mindestens gleichwertiger Zugang zu internationalen Märkten ermöglicht werden wie ihren wichtigsten ausländischen Konkurrenten, beispielsweise aus der EU, den USA und aus Japan. Da diese Länder vor einiger Zeit angefangen haben ihr Netz an Freihandelspartnern auszuweiten, ist der Abschluss von Freihandelsabkommen ein wichtiges Instrument zur Aufrechterhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz geworden. Die Freihandelsabkommen beinhalten Bestimmungen über den Warenverkehr in denen insbesondere der Abbau von Zöllen und anderer Handelsbeschränkungen geregelt wird. Davon betroffen sind auch Basis- und verarbeitete Agrarprodukte. Zusätzlich berücksichtigen Freihandelsabkommen in der Regel den Schutz des geistigen Eigentums sowie die Beseitigung nicht tarifärer Handelshemmnisse. Umfassende Abkommen (sogenannte Freihandelsabkommen der zweiten Generation) enthalten zusätzliche Vereinbarungen für den Handel mit Dienstleistungen, für Investitionen und für das öffentliche Beschaffungswesen.
15 % der Gesamtexporte gehen zu nicht-EU Freihandelspartnern, was über einem Viertel der Schweizer Exporte nach Märkten ausserhalb der EU entspricht. Der Handel mit EFTA-Freihandelspartnern weist im Vergleich zu den Handelsströmen mit allen anderen Handelspartnern signifikant höhere Zuwachsraten auf. Während der weltweite Aussenhandel der Schweiz von 1988 bis 2008 pro Jahr durchschnittlich um 5,7 % zugenommen hat, wuchs der Handel der Schweiz mit Freihandelspartnern im Durchschnitt der ersten vier Jahre nach Inkrafttreten des jeweiligen Freihandelsabkommens um über 10 % pro Jahr.
n Freihandelsabkommen im Rahmen der EFTA
Bei EFTA-Abkommen sind die Bestimmungen über den Handel mit verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten im Hauptabkommen enthalten, das zwischen der EFTA und dem entsprechenden Handelspartner abgeschlossen wird. Der Handel mit Basisagrarprodukten hingegen ist in bilateralen Abkommen, also zwischen der Schweiz und dem entsprechenden Handelspartner, geregelt. Dieser Ansatz ermöglicht es, massgeschneiderte Konzessionen auszuhandeln und gewährleistet die autonome Weiterentwicklung der Agrarpolitiken der einzelnen EFTA-Mitgliedsländer.
Am 1. Oktober 2010 ist das Freihandelsabkommen mit Serbien, am 1. November 2010 jenes mit Albanien und am 1. Juli 2011 jene mit Peru und Kolumbien in Kraft getreten. Zudem wurden mit folgenden Partnern EFTA-Freihandelsabkommen abgeschlossen, aber noch nicht umgesetzt: Arabischer Golfkooperationsrat, Ukraine und Hong Kong. Aktuell laufen Verhandlungen mit Algerien, Indien, Thailand, Indonesien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro sowie der Zollunion Russland/Weissrussland/Kasachstan. Mit Vietnam sollen die Verhandlungen in der zweiten Jahreshälfte 2011 eröffnet werden. Ausserdem stehen die Schweiz und die EFTA-Staaten mit anderen potenziellen Partnern wie beispielsweise Georgien, Malaysia, den Zentralamerikanischen Staaten und Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) in Kontakt, um die Errichtung oder Vertiefung von Freihandelsbeziehungen zu diskutieren.
188 3.1 Internationale Entwicklungen
n Bilaterale Freihandelsabkommen
Die Schweiz hat bilaterale Freihandelsabkommen mit den Färöer-Inseln und Japan abgeschlossen.
Anfangs 2011 wurden die Verhandlungen zu einem bilateralen Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China eröffnet.
n Neuverhandlung der EFTA-Konvention
Die EFTA-Staaten haben im Auftrag ihrer Minister eine Aktualisierung der EFTA-Konvention in Angriff genommen. Ziel dieses Vorgehens ist eine weitgehende Liberalisierung des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen den EFTA-Staaten. So wurden zahlreiche Exportmöglichkeiten eruiert, die es über umfassende Konzessionen zu konkretisieren gilt. Die Verhandlungen auf technischer Ebene wurden im Frühling 2011 aufgenommen und werden voraussichtlich bis Ende Jahr andauern. Die nicht tarifären Aspekte sowie die Struktur der Konvention werden bei dieser Gelegenheit ebenfalls überarbeitet.
3.1.3 Agrarabkommen Schweiz – EU
Während die Verhandlungen über ein Abkommen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel- und Produktsicherheit sowie öffentliche Gesundheit aufgrund von diversen Faktoren ins Stocken geraten sind, wird das bestehende Agrarabkommen Schweiz-EU weiterhin von beiden Parteien gezielt weiterentwickelt und die Beziehungen im Agrarbereich damit weiter ausgebaut. Am 10. November 2010 fand der 10. Gemischte Ausschuss (GA) zum Agrarabkommen unter Vorsitz der Europäischen Kommission in Brüssel statt. Mit der Inkraftsetzung der Entscheide 1/2010 und 2/2010 des GA am 1. Januar 2011 wurden weitere Grundsteine für den verbesserten gegenseitigen Marktzugang gelegt. So wurde insbesondere der Handel von Vermehrungsmaterial von Weinreben und zusätzlichen Pflanzensorten erleichtert.
Die Parteien sind sich einig, die begonnenen Arbeiten zur Anpassung von Anhang 7 (Handel mit Weinbauerzeugnissen) und Anhang 8 (Spirituosen) an die revidierten EU-Verordnungen in der nächsten Zeit zum Abschluss zu bringen. Gleiches gilt für Anhang 9 (Biologische Erzeugnisse), der aufgrund der Einführung eines neuen EU-Importregimes für biologische Erzeugnisse aus Drittstaaten ebenfalls angepasst werden soll. Das neue Importregime, das im Jahr 2013 in Kraft treten soll, sieht vor, dass biologische Erzeugnisse aus Drittländern, welche von einer von der EU anerkannten und in ein dafür bestimmtes Verzeichnis aufgenommenen Zertifizierungsstelle zertifiziert wurden, hindernisfrei auf den europäischen Markt gelangen. Dies bedeutet eine Vereinfachung gegenüber der heutigen Praxis, gemäss derer für jedes Produkt resp. jede Produktegruppe aus einem Drittland eine Einzelermächtigung beantragt werden muss.
Im Bereich Pflanzenschutz (Anhang 4) wurde das Vorhaben zur Schaffung eines gemeinsamen phytosanitären Raumes weiter konkretisiert. Mit der damit einhergehenden Abschaffung der Grenzkontrollen soll im Abkommen neu ausdrücklich festgehalten werden, dass die phytosanitären Kontrollen bei Drittlandwaren, analog zum Veterinärbereich, grundsätzlich am Ersteintrittspunkt vorgenommen werden. Die Revision soll das aktuelle Sicherheitsrisiko der aufwendigen Nachkontrollen von unkontrollierten Drittlandwaren ausschliessen und somit ein verbesserter Schutz der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produktion garantieren.
Beide Parteien sind des Weiteren bestrebt, die Abschaffung der Grenzkontrollen für Futtermittel (Anhang 5) sowie Saatgut (Anhang 6) im Abkommen zu verankern.
189 3.1 Internationale Entwicklungen
n Abkommen über den gegenseitigen Schutz der GUB und GGA
Basierend auf der Absichtserklärung im Agrarabkommen Schweiz-EG von 1999 hatten die Schweiz und die EU im Oktober 2007 Verhandlungen zur gegenseitigen Anerkennung der geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB/AOC/AOP) und geschützten geographischen Angaben (GGA) aufgenommen.
Diese konnten am 1. Juli 2010 mit der Paraphierung eines Abkommensentwurfs abgeschlossen werden. Danach wurden von beiden Parteien die internen Genehmigungsverfahren initiiert. Nach dessen Genehmigung durch den Bundesrat auf Seiten der Schweiz und durch den Ministerrat auf Seiten der EU im Januar 2011, konnte das Abkommen am 17. Mai 2011 von BR Johann N. Schneider-Ammann, dem Vertreter der ungarischen Ratspräsidentschaft, Landwirtschaftsminister Sándor Fazekas, und EU-Landwirtschaftskommissar Dacian Cioloş in Brüssel unterzeichnet werden.

Im Abkommen verpflichten sich die Schweiz und die EU, ihre geographischen Angaben gegenseitig anzuerkennen und nach verschiedenen Übergangsfristen gegen jegliche Nachahmung oder missbräuchliche Verwendung zu schützen. Damit erhalten die in der Schweiz beziehungsweise in der EU registrierten GUB und GGA auf dem Gebiet der jeweils anderen Partei denselben rechtlichen Schutz wie im Ursprungsgebiet. Das Abkommen sieht, nach Durchlaufen eines klar geregelten Verfahrens, auch die Aufnahme von neu registrierten Bezeichnungen vor. Vorerst werden 818 EU-Bezeichnungen auf dem Schweizer Territorium geschützt. Für die Schweiz handelt es sich um 22 Bezeichnungen, deren Schutz aber auf ein Gebiet mit etwa 500 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten ausgeweitet wird. Auch wirtschaftlich sehr relevante Exportprodukte wie Bündnerfleisch und Gruyère fallen darunter. Der Schweizer Gruyère wird damit europaweit zum einzigen «Gruyère AOC». Demgegenüber wurde die Schweizerische Bezeichnung «Emmentaler» sowie die EU-Bezeichnungen, die die Begriffe «Emmentaler» oder «Emmental» enthalten, vorläufig aus dem Abkommen ausgeklammert.
Das Abkommen ist sowohl national, als Element der Qualitätsstrategie, wie auch international, im Rahmen des WTO-Engagements, ein wichtiges politisches Signal für einen verbesserten Schutz von geographischen Angaben beider Parteien.
Auf Seiten der EU bedarf es nun noch der Zustimmung des europäischen Parlaments bevor es in Kraft treten kann. Danach wird es als neuer Anhang in das Agrarabkommen Schweiz-EU von 1999 integriert und aufgrund des geänderten Trilateralisierungsabkommens auch im Fürstentum Liechtenstein Anwendung finden.
190 3.1 Internationale Entwicklungen
3.1.4 Protokoll Nr. 2
Im Protokoll Nr. 2 des Freihandelsabkommens Schweiz-EG von 1972 sind die Bestimmungen über den Handel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen zwischen der Schweiz und der EU geregelt. Das Protokoll Nr. 2 wurde 2005 im Rahmen der Bilateralen Abkommen II revidiert.
Das Protokoll Nr. 2 erlaubt es der Schweiz, im europäischen Handel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten Preisnachteile bei Agrarrohstoffen auszugleichen, indem sie für exportierte Verarbeitungsprodukte Ausfuhrbeiträge gewährt und bei der Einfuhr Zölle erhebt. Diese Preisausgleichsmassnahmen dürfen die Preisdifferenzen der Agrargrundstoffe zwischen der Schweiz und der EU nicht überschreiten. Das Protokoll Nr. 2 enthält die für die Preisausgleichsmassnahmen massgeblichen Referenzpreise und Preisdifferenzen. Diese werden mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Dieses Protokoll Nr. 2 ist auch Gegenstand der Verhandlungen mit der EU über ein FHAL&GesA. Jenes wird bei vollständigem Agrar-Freihandel mit der EU abgeschafft.
Per 1. Februar 2011 wurden die seit 1. Februar 2010 gültigen Referenzpreise im Rahmen des Protokoll Nr. 2 revidiert und so wieder an die aktuellen Verhältnisse auf den Märkten der Schweiz und der EU herangeführt. Auf dieser Basis wurden die Schweizer Importzölle für verarbeitete Agrarprodukte angepasst. Exportseitig gilt es zu beachten, dass die Schoggigesetz-Ausfuhrbeitragsansätze für Ausfuhren in die EU die vereinbarten Referenzpreisdifferenzen nicht übersteigen dürfen. Aufgrund des für einen vollständigen Preisausgleich nicht ausreichenden «Schoggigesetz-Budgets» (siehe Kapitel 2.1.1.6) wurden vom 1. Januar bis 30. April 2011 nur 70 % und ab 1. Mai 2011 nur 90 % der Rohstoffpreisdifferenz beim Export ausgeglichen.
3.1.5 Gemeinsame Agrarpolitik der EU
n Europäische und Schweizer Agrarpolitik mit ähnlichen Schwerpunkten
In der EU ist Landwirtschaftspolitik seit ihrer Gründung eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) hat sich in vier Jahrzehnten stark gewandelt. Ursprünglich auf Verstärkung der Selbstversorgung orientiert zielt die GAP heute auf die Unterstützung einer multifunktionalen Landwirtschaft und die Förderung des ländlichen Raumes. Die schweizerische Agrarpolitik hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht wie die GAP; die beiden Agrarpolitiken weisen darum heute in vieler Hinsicht Gemeinsamkeiten auf. Dies zeigt sich unter anderem in der weitgehenden Umlagerung der Marktstützung in entkoppelte Direktzahlungen und deren Bindung an Umweltleistungen, die sogenannte Cross-Compliance (Einhaltung von Umwelt-, Tierwohl- und Lebensmittelsicherheitsstandards), die mit dem in der Schweiz vorausgesetzten ökologischen Leistungsnachweis verglichen werden kann. Weitere Ähnlichkeiten sind die Förderung der Bereitstellung von öffentlichen Gütern, die besondere Unterstützung benachteiligter Gebiete sowie der Schwerpunkt, sich an der Qualität als zukünftigen Kern der Landwirtschaftspolitik zu orientieren. Instrumentell sind die GAP und die Schweizer Agrarpolitik somit in weiten Teilen vergleichbar; das Stützungsniveau ist in der EU jedoch deutlich tiefer als in der Schweiz.
191 3.1 Internationale Entwicklungen
n Kommission macht Vorschläge zur Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik
Die aktuellen Bestimmungen der GAP gelten bis 2013 und die Vorbereitungen der nächsten Reformetappe laufen zurzeit auf Hochtouren. Im November 2010 hat die Kommission eine erste Mitteilung zur Weiterentwicklung der GAP zwischen 2013 und 2020 veröffentlicht. Darin identifiziert sie dieselben Herausforderungen für die nächsten Jahre wie die Schweiz in der Strategie für die Land- und Ernährungswirtschaft 2025: – Ernährungssicherung
– Umwelt und Klimawandel
– Räumliche Ausgewogenheit und Vielfalt der ländlichen Gebiete.
Eine stärkere Fokussierung der Direktzahlungen auf konkrete Ziele ist in der EU wie in der Schweiz eine Voraussetzung für die politische Akzeptanz der Agrarpolitik. Eine effiziente und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen ist zudem zentral zur Bewältigung der globalen Herausforderungen und steht im ureigensten Interesse einer produzierenden Land- und Ernährungswirtschaft.
Für die Begegnung dieser Herausforderungen soll das derzeitige System mit zwei Säulen (1. Säule: Direktzahlungen und Märkte; 2. Säule: Entwicklung des ländlichen Raums) beibehalten werden.
In Bezug auf die Direktzahlungen (1. Säule) wird in der Mitteilung aufgeführt, dass die Unterstützung anhand objektiver, gerechter und für die Steuerzahler leicht verständlicher Kriterien neu konzipiert und besser ausgerichtet werden muss. Ähnlich wie im Schweizer Direktzahlungssystem unterscheidet die Kommission dabei zwischen wirtschaftlichen oder sozialpolitischen («Einkommensstützungselement») und ökologischen Kriterien (Förderung der erbrachten öffentlichen Güter). Der künftigen Direktzahlungsregelung sollen keine historischen Referenzen (Betriebsprämien, die auf der Basis der früher entrichteten Produktstützungen errechnet wurden) mehr zugrunde liegen, sondern es wird eine gerechtere Mittelverteilung zwischen den Ländern angestrebt. Diese soll auf folgenden Kriterien basieren:
regional einheitliche Basisprämie pro Hektare (Grundsicherung der Einkommen);
zusätzliche Basiszahlung mit einer «Ökologisierungskomponente» in Bereichen wie Klima und Biodiversität (Greening);
Integration eines Erschwernisausgleiches in der zweiten Säule mit einer zusätzlichen flächenbezogenen Zahlung;
Weiterführung der Möglichkeit, begrenzte gekoppelte Zahlungen für besonders empfindliche Sektoren auszurichten;
Änderung/Vereinfachung der Regelung für Kleinlandwirte.
Zudem wird die Einführung einer Obergrenze für Direktzahlungen an Grosslandwirte («Deckelung») in Erwägung gezogen, um die Verteilung der Zahlungen zwischen den Landwirten zu verbessern.
Die Marktinstrumente der ersten Säule (z.B. öffentliche Intervention, Beiträge an private Lagerhaltung) sollen mit reduzierten Mitteln weitergeführt werden.
Auch in der zweiten Säule sollen die Themen Umwelt, Klimawandel und Innovation horizontal in alle Programme einbezogen werden. Als neues Element der künftigen Politik zur ländlichen Entwicklung soll zudem ein Instrumentarium für das Risikomanagement eingeführt werden.
192 3.1 Internationale Entwicklungen
–
–
–
–
–
Nebst diesen grundsätzlichen Änderungen hat die Kommission die drei folgenden Optionen für die künftige Ausrichtung der GAP skizziert:
1. Behebung der dringendsten Mängel der GAP durch schrittweise Änderungen. Dazu soll die GAP in demjenigen Bereich angepasst und verbessert werden, der am stärksten in der Kritik steht, das heisst bei der Frage der gerechten Verteilung der Direktzahlungen. Die Vorteile dieser Option sind die Stabilität und die Kontinuität sowie die Möglichkeit der langfristigen Planung für die Lebensmittelversorgungskette.
2. Gestaltung einer umweltfreundlicheren, gerechteren, effizienteren und wirkungsvolleren GAP. Bei dieser Option soll die Politik im Wesentlichen überarbeitet werden, um sie nachhaltiger zu gestalten und eine bessere Balance zwischen den verschiedenen politischen Zielen, den Landwirten und Mitgliedstaaten zu finden. Als Vorteile werden mehr Ausgabeneffizienz und ein stärkerer Fokus auf den Mehrwert für die EU aufgeführt.
3. Schwerpunktverlagerung weg von marktbezogenen Massnahmen und Einkommensstützung hin zu Umwelt- und Klimazielen. Hierbei würde die Einkommensstützung schrittweise eingestellt und die Finanzmittel klar auf Umwelt- und Klimathemen im Rahmen der Politik des ländlichen Raums fokussiert. Mit dieser Lösung sollen regionale Strategien gefördert werden.
Die Kommission zeigt eine Präferenz für die zweite Option. Die Mitteilung eröffnete die institutionelle Debatte und ebnet den Weg für die 2011 vorgesehenen Anpassungsvorschläge der Gesetzgebung der Kommission.
Die Landwirtschaft als grösster Ausgabenposten der EU steht unter starkem Druck. Im Juni 2011 hat die Kommission den Finanzrahmen für 2014–2020 veröffentlicht und dabei bestätigt, dass sie weiterhin an einer starken GAP interessiert ist; wenn auch mit gewissen Kürzungen. So sind Reduktionen des Agrarbudgets zwischen 5 bis 10 % vorgesehen. Hingegen sollen den Landwirten auch zusätzlich zur Verfügung gestellte Mittel im Rahmen der Nothilfereserve, der Europäischen Globalisierungsfonds, der Forschungsgelder und der Nahrungsmittelhilfe zugutekommen.
n Unterschiedliche Reaktionen der EU-Mitgliedstaaten
Eine grosse Mehrheit der Mitgliedstaaten erachtet die Mitteilung der EU-Kommission als gute Grundlage für die weiteren Diskussionen. Die Forderung nach einer starken, mit genügend finanziellen Ressourcen bestückten GAP, wird von einer Vielzahl der Mitgliedstaaten unterstützt.
Inhaltlich unterscheiden sich die Positionen hingegen in diversen Punkten. Die osteuropäischen Mitgliedstaaten streben eine ambitionierte Reform an, die insbesondere eine ausgewogenere Verteilung der Direktzahlungen und somit eine Minderung der Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten vorsieht. Am stärksten setzt sich in dieser Hinsicht Polen ein; der gewichtige Agrarproduzent fordert eine Einheitsprämie. Im Gegensatz dazu stehen Deutschland und Frankreich, die keine Umverteilung wünschen und sich gegen eine nationale Obergrenze für Direktzahlungen einsetzen. Die beiden Gründungsmitglieder der EG teilen diese Haltung mit Österreich, sowie auch die Forderung, dass besondere Nachteile ausgeglichen werden müssen und die Bewirtschaftung unter schwierigen Bedingungen (u.a. Berggebiete) weiterhin notwendig sei und gefördert werden müsse. Die ökologische Ausrichtung der GAP wird von den drei Ländern zwar begrüsst, jedoch dürfe dies nicht durch vermehrten administrativen Aufwand umgesetzt werden. Die nördlichen Mitgliedstaaten (u.a. Schweden, Dänemark, Holland und Grossbritannien) verlangen vordringlich eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und Marktorientierung. Insbesondere Grossbritannien erachtet eine tiefgreifende Reform als notwendig und nähert sich hiermit indirekt der Position Polens an. Die Reform soll gemäss Grossbritannien sogar die Weiterführung des Direktzahlungssystems als solches zur Diskussion stellen.
193 3.1 Internationale Entwicklungen
n EU-Parlament stützt den Kommissionsvorschlag
Aufgrund des neuen EU-Vertrages hat das Europäische Parlament erstmals ein volles Mitspracherecht bei der zukünftigen Agrarpolitik. Mit einer Antwort auf das Konsultationspapier der Kommission hat das EUParlament im Juni 2011 seine Positionen für die Zukunft der GAP abgesteckt. Es stellt sich mehrheitlich hinter das Konzept der Kommission. So soll ein Teil der Direktzahlungen verstärkt an umweltfreundliche Massnahmen wie die Senkung von CO2-Emissionen und Energieverbrauch gebunden werden und Umweltprogramme sollen ausgebaut werden. Gleichermassen sprachen sich die Abgeordneten kategorisch gegen Kürzungen des Agrarbudgets aus und befürworten das unter den Mitgliedstaaten umstrittene Kommissionsvorhaben, Obergrenzen für Zahlungen bei Grossbetrieben einzuführen.
Mehr Informationen zur Weiterentwicklung der GAP nach 2013 finden sich unter: http://ec.europa.eu/ agriculture/cap-post-2013/index_de.htm.
3.1.6 WTO
n Verlauf der Verhandlungen in der Doha-Runde seit September 2010
Die Verhandlungen um die WTO Doha-Runde durchlaufen seit September 2010 eine problematische Phase. Es besteht eine grundlegende Diskrepanz zwischen dem erklärten politischen Willen, die Verhandlungsrunde zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und dem tatsächlichen Verhandlungsverlauf in Genf. So legten die Staatschefs der G-20 Länder anlässlich des Gipfeltreffens von Seoul im November 2010 ein Bekenntnis zu einem schnellen, ausbalancierten und ambitionierten Abschluss der Doha-Runde ab. Auch in einer Konferenz der Handelsminister unter Leitung von Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann anlässlich des Treffens des Weltwirtschaftsforums in Davos Ende Januar 2011 wurde das Bekenntnis zum Abschluss der Doha-Runde erneuert. In der aus diesen Bekenntnissen entstandenen Dynamik hatte der WTO-Generaldirektor Pascal Lamy das Ziel vorgegeben, bis Ostern 2011 über ein neues Paket an Verhandlungstexten in allen Bereichen zu verfügen. Für den Agrarbereich konnte trotz intensiver Diskussionen kein entscheidender Fortschritt erreicht werden. Aus diesem Grund legte der Agrarverhandlungsführer, der neuseeländische Botschafter David Walker, lediglich einen Statusbericht vor. Darin werden im Agrardossier im Wesentlichen neun offene Punkte aufgezeigt, in denen eine Einigung der Verhandlungspartner notwendig ist. Auch in anderen Verhandlungsfeldern, allen voran den Industriegüterverhandlungen, konnte der für einen Durchbruch notwendige Fortschritt nicht erzielt werden. In der Folge schloss sich nach Ostern 2011 eine für die DohaRunde kritische Phase an, in der auch über Alternativen zu einem Abschluss der Verhandlungsrunde als Gesamtpaket diskutiert wurde. Die Schweiz hat sich in dieser Phase als Mitglied der sogenannten «Friends of the System»-Gruppierung für eine Fortführung der Verhandlungen stark gemacht. Die Hauptkonfliktlinien liegen vor allem zwischen den USA auf der einen und den aufstrebenden Staaten (wie China, Indien oder Brasilien) auf der anderen Seite und beziehen sich auf die Frage, in welchem Rahmen diese Staaten Konzessionen im Bereich Marktzugang gewähren müssen.
Ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang nicht ausser Acht gelassen werden kann ist derjenige, dass die USA, als einer der wichtigsten entwickelten Handelsblöcke, massive Schwierigkeiten hat, bereits fertig verhandelte regionale Freihandelsabkommen mit Kolumbien, Südkorea und Panama durch den Kongress ratifizieren zu lassen. Die EU hingegen ist aktiv in Verhandlungen mit relevanten Partnerländern (z.B. Indien, Mercosur) und hat ein regionales Freihandelsabkommen mit Südkorea vereinbart.
Zum Redaktionsschluss dieses Berichts ist es nach wie vor offen, wie sich die Verhandlungen der WTO Doha-Runde fortführen lassen und ob ein erstes Paket an der Ministerkonferenz von Dezember 2011 abgeschlossen werden kann.
194
3.1 Internationale Entwicklungen
n Trade policy reviews: Japan, Australien, Kanada, EU
Im vergangenen Jahr wurde die Handelspolitik einer Reihe von bedeutenden WTO-Mitglieder überprüft. Diese Überprüfung erfolgt in regelmässigen Abständen und gibt einerseits einen Überblick über die Änderungen in der Handelspolitik, darunter der Agrarhandelspolitik, der WTO-Mitglieder und bietet andererseits auch die Möglichkeit für andere Mitglieder, Fragen zu stellen und auf Defizite und Probleme hinzuweisen. Im besonderen Fokus der Aufmerksamkeit standen die Überprüfungen der Handelspolitik Japans, Australiens, Kanadas und der EU.
Japan
In der Überprüfung der Handelspolitik Japans (die vor den Naturkatastrophen und der Reaktorkatastrophe stattfand) ist die tragende Rolle Japans im internationalen Handelssystem erneut deutlich geworden. Japan hat einige Anstrengungen unternommen, weitere Liberalisierungen durchzuführen und so seinen durchschnittlichen angewandten Zollsatz weiter gesenkt (im Mittel auf 5,8 %). Zudem verfolgt Japan aktiv die Verhandlungen um das sogenannte Trans-Pacific-Partnership-Abkommen (TPP) mit der Perspektive, diesem Abkommen zu einem späteren Zeitpunkt beizutreten. Nichtsdestotrotz verfolgt Japan in einigen Bereichen seiner Handelspolitik eine sehr defensive und protektionistische Herangehensweise, darunter im Bereich des Agrarschutzes und der tiergesundheitspolizeilichen Massnahmen. Japan wurde bei der Überprüfung der Handelspolitik für diese Herangehensweise, in Folge derer auch die Schweiz beim Export von Fleischprodukten Schwierigkeiten mit Japan hat, stark kritisiert. Japan verweist in seiner Antwort auf die Risikobeurteilung seiner Behörden und auf die bilateralen Gespräche, geht aber auf die Kritik nicht direkt ein.
Australien
Australien verfügt im Allgemeinen über eine relativ liberale Handelspolitik und hat einen Grossteil seiner Zölle bereits markant gesenkt (im Mittel auf 3,1 %). Im Agrarbereich tritt Australien als offensiver Exporteur auf und wendet selbst nur relativ wenige, den Handel beeinflussende Instrumente an. Australien ist sehr aktiv bei den Versuchen, die WTO Doha-Runde zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen; ebenso engagiert sich Australien bei den Verhandlungen um das sogenannte Trans-Pacific-Partnership-Abkommen (TPP). Im Agrarbereich hat die Schweiz die von Australien erhobenen Exportabgaben kritisiert. Australien hat in seiner Antwort darauf verwiesen, dass diese Exportabgaben unter anderem für Forschung und Entwicklung sowie für Programme der Tier- und Pflanzengesundheit eingesetzt werden und ein Auslaufen der Abgaben nicht in Sicht ist.
Kanada
In der Überprüfung der Handelspolitik Kanadas wurde von vielen WTO-Mitglieder die konstruktive Rolle Kanadas in den WTO-Doha-Verhandlungen lobend erwähnt. Kritisch beleuchtet wurden unter anderem der hohe Grenzschutz Kanadas bei einigen Produktgruppen, darunter Nahrungsmittel und Getränke. Hier zeichnet sich ein ambivalentes Bild. Einerseits ist Kanada bedeutender Exporteur von Agrarrohstoffen, darunter Getreide oder Rindfleisch, und andererseits hält Kanada einen markanten Grenzschutz für Milchprodukte, Geflügel oder Eier aufrecht. Insbesondere der Grenzschutz im Bereich der Milchprodukte wurde von anderen WTO-Mitglieder kritisiert. Auch wenn Kanada kürzlich seine WTO-Konzessionen bezüglich Importquoten im Milchbereich teils neu verhandelt hat, so ist grundsätzlich keine Änderung des Grenzschutzes geplant. Kanada verweist in seinen Antworten darauf, dass die Regulierungen in Konformität mit den WTO-Verpflichtungen sind. Ebenso haben verschiedene Mitglieder, darunter die Schweiz, die Rolle von Staatshandelsunternehmen im Agrarbereich hinterfragt.
195 3.1 Internationale Entwicklungen
Am 6. und 8. Juli 2011 fand in Genf unter Leitung des chilenischen Botschafters Mario Matus die zehnte reguläre WTO-Überprüfung der EU-Handelspolitik statt. Es war zudem die erste Überprüfung der EU als solche seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Die EU erhielt von über 30 Mitglieder mehr als 1 200 Fragen. Mehrere Mitglieder unterstrichen, dass die EU trotz positiver Teilnahme eine stärkere Führungsrolle in den Doha-Verhandlungen übernehmen solle. Die EU bestätigte, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sei und bekräftigte, dass das multilaterale Handelssystem der WTO ihre Priorität bleibe (trotz bilateraler Freihandelsverhandlungen). Die an die EU gerichtete Kritik bezog sich unter anderem auf die Zollstruktur der EU, die von vielen WTO-Mitglieder als zu kompliziert betrachtet wird. Des Weiteren wurden auch die immer noch sehr hohen Zölle für Agrargüter kritisiert. Die EU erklärte, dass keine unilaterale Senkung der Zölle im Rahmen der revidierten Agrarpolitik vorgesehen sei und der einzige Weg für eine Zollsenkung der Abschluss der Doha-Runde sei. Die EU sei aber weiterhin bereit, ihre Reduktionsverpflichtungen gemäss Agrarmodalitäten als Teil des WTO-Doha-Paketes, welches auch Themen wie zum Beispiel das Register für geographische Herkunftsangaben sowie die Erweiterung der Gültigkeit des Schutzes von geographischen Herkunftsangaben umfassen müsse, zu akzeptieren. Ein weiteres Thema von Interesse war das Allgemeine Präferenzsystem (GSP) der EU. Die seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen vereinfachten Ursprungsregeln unter dem GSP wurden gelobt. Auch der Vorschlag der EU-Kommission für ein revidiertes Präferenzsystem erhielt grösstenteils positive Rückmeldungen der WTO-Mitglieder. Die EU erklärte, dass das Ziel des revidierten GSP sei, sich mehr an die Bedürfnisse der ärmsten Länder zu richten und folglich fortgeschrittene Entwicklungsländer bzw. Schwellenländer davon auszuschliessen.
Die Fragen an die EU betrafen auch zu einem substanziellen Anteil den Agrarsektor. Darin wurden von Exporteuren wie Australien oder Brasilien die internen Stützungsmassnahmen, aber auch die Exportsubventionen und deren verzerrende Wirkung auf die Weltagrarmärkte kritisiert. Ebenso wurden umfangreiche Fragen zum Schutz der geographischen Herkunftsangaben in der EU und in bilateralen Freihandelsabkommen gestellt. Insbesondere Australien nimmt dabei eine sehr skeptische Haltung ein.
196 3.1 Internationale Entwicklungen EU
3.1.7 OECD
n Steigende Preise und hohe Preisvolatilität an den globalen Agrarmärkten
Bekannte und neue Einflussfaktoren
Die Preise auf den globalen Agrarmärkten zeigten im letzten Jahrzehnt einen deutlich steigenden Trend auf. Die Getreidepreise erhöhten sich beispielsweise um das zweieinhalbfache, die Zuckerpreise vervierfachten sich sogar. Die Gründe sind weitgehend bekannt. Wachsende Weltbevölkerung, höhere Kaufkraft und vermehrter Fleischkonsum in Schwellenländern sowie zunehmende Biotreibstoffproduktion führten weltweit zu einer wachsenden Nachfrage nach Agrarrohstoffen. Das Angebot, eingeschränkt durch begrenzte Landwirtschaftsfläche und Wasserverfügbarkeit, abnehmende Ertragssteigerung und vermehrt auftretende Wetterextremereignisse, konnte nur ungenügend Schritt halten. Die Folge der Angebotsknappheit waren steigende Preise. Gemäss dem OECD-FAO-Agricultural Outlook 2011–2020, der die Preise für die nächsten zehn Jahre prognostiziert, ist keine Trendwende in Sicht. Die fundamentalen Nachfrage- und Angebotsfaktoren dürften dafür sorgen, dass die Preise auch im kommenden Jahrzehnt tendenziell weiter steigen: Das Getreide bis 2020 um 20 % und das Fleisch sogar um 30 % im Vergleich zum letzten Jahrzehnt.
Die Preise sind aber in den letzten Jahren nicht nur stark gestiegen, sondern haben auch stärker geschwankt als in der ganzen Zeitspanne seit der Erdölkrise in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Nach einem Boom 2007 und 2008 und einem darauf folgenden Preissturz sind die Preise 2010 und 2011 erneut stark gestiegen (vor allem für Getreide, Ölsaaten, Zucker). In den letzten Monaten sind sie wieder leicht gesunken.
197 3.1 Internationale Entwicklungen
US D / t Quelle: OECD-FAO-Outlook 2011–2020 0 800 700 600 300 400 500 100 200 2000 2005 2010 2015 2020 Weizen Mais Reis Ölsaaten Zucker Geflügel Rindfleisch Schweinefleisch Vollmilchpulver Fisch Fischöl Fischmehl Pflanzenöl Ölsaatenmehl 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2000 2005 2010 2015 2020 0 4 500 4 000 3 500 1 500 2 500 2 000 3 000 500 1 000 2000 2005 2010 2015 2020 Nominelle Preistrends diverser Agrargüter bis 2020
Preisentwicklung wichtiger Agrargüter seit 2000
Eine hohe Preisvolatilität ist zwar charakteristisch für Agrarmärkte, da diese geprägt sind von schwachen Angebots- und Nachfrageelastizitäten und biologisch vorgegebenen Produktionszyklen. Letztere sind dafür verantwortlich, dass die Produzenten nur mit zeitlicher Verzögerung auf Nachfrageänderungen reagieren können. Die Zunahme der Preisschwankungen in den letzten Jahren ist gemäss OECD und FAO jedoch auf weitere Ursachen zurückzuführen. Tiefe globale Lagerstände, volatile Erdölpreise und damit hohe Düngerpreise sowie schwankende Wechselkurse haben die Volatilität angeheizt. Ebenso verunsicherten die Märkte kurzfristige Angebotsschocks aufgrund von Dürren in Russland und China sowie Überschwemmungen in Kanada, China und Australien. Die Einführung von Exportrestriktionen in wichtigen Exportländern wie Russland und der Ukraine verstärkten die Ängste bezüglich Angebotsknappheit zusätzlich ebenso wie politische Unruhen in Nordafrika. Die OECD und FAO erwarten, dass diese Faktoren die Preisvolatilität auch zukünftig hoch halten werden. Unter Umständen könnten neue Ursachen, wie die verstärkten Auswirkungen des Klimawandels, die Situation sogar noch verschärfen. Umstritten ist unter Experten indessen, wie spekulative Termingeschäfte auf die Preisvolatilität einwirken. Verstärkende Wirkung (z.B. durch die Blasenbildung) werden ebenso genannt wie keine oder sogar preisstabilisierende Effekte (z.B. durch das Bereitstellen zusätzlicher Liquidität).
Problematik und Handlungsfelder
Volatile Preise erschweren die Planung und Investitionsentscheide aller Akteure der Ernährungswirtschaft und können zu schwankenden Einkommen insbesondere bei den Produzenten führen. Besonders betroffen von stark steigenden Nahrungsmittelpreisen sind zudem die Konsumenten in Entwicklungsländern, welche bis drei Viertel ihres Einkommens für Lebensmittel aufwenden. Es besteht deshalb ein berechtigtes Interesse, die Preisschwankungen auf den Märkten in einem verträglichen Ausmass zu halten. Jedoch dürfen markteingreifende Massnahmen die Preisbildung nicht so stark beeinflussen, dass Änderungen der Fundamentalfaktoren sich in den Preisen nicht mehr niederschlagen. Die Produzenten müssen Nachfrageänderungen rechtzeitig erkennen und angebotsseitig entsprechend reagieren können.
198 3.1 Internationale Entwicklungen
Index (200 0 / 0 2 = 100) Quelle: FAO 0 450 400 350 300 150 200 250 50 100 1/2000 6/2000 11/2000 4/2001 9/2001 2/2002 7/2002 12/2002 5/2003 10/2003 3/2004 8/2004 1/2005 6/2005 11/2005 4/2006 9/2006 2/2007 7/2007 12/2007 5/2008 10/2008 3/2009 8/2009 1/2010 6/2010 11/2010 4/2011 Zucker Öl Getreide Milch Fleisch Food Price Index
Angesichts der steigenden Nachfrage auf den Agrarmärkten fordern die OECD und die FAO, dass in Zukunft wieder mehr in die globale Landwirtschaft investiert werden muss, damit die Produktivität und Ressourceneffizienz gesteigert und die Verletzlichkeit der Produktionssysteme reduziert werden kann. Investiert werden muss insbesondere dort, wo das Produktionspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Dies ist besonders in Entwicklungsländern der Fall. Die Stossrichtung muss dabei eine nachhaltige Intensivierung sein. Wichtig hinsichtlich der Angebotsknappheit ist auch die Bekämpfung von Nachernteverlusten in den Entwicklungsländern und eine Reduktion der Lebensmittelabfälle in den Industrieländern auf Stufe Verteiler und Konsumenten. Einen Beitrag zu weniger volatilen internationalen Agrarmärkten kann neben einem verstärkten internationalen Handel auch die Verbesserung der Transparenz und des Informationsflusses auf den Terminmärkten und den physischen Agrarmärkten leisten. Wichtig ist insbesondere eine bessere Übersicht über Lagerbestände in den verschiedenen Ländern sowie ein verbesserter Zugang aller Marktakteure zu produktions- und marktrelevanten Informationen (Wetterprognosen, Preise, Transportmöglichkeiten etc.). Für den Produzenten schliesslich stellen Risikomanagementmassnahmen wie die Betriebs- und Einkommensdiversifizierung, Versicherungen oder die Vertragsproduktion wichtige Instrumente zur Einkommensstabilisierung dar.
Bedeutung für die Schweiz
Der Grenzschutz für die Schweizer Landwirtschaft dämpft die Auswirkungen der Preisschwankungen auf dem internationalen Markt bei den meisten Produkten ab. Die Preisausschläge auf den Weltmärkten waren allerdings auch in der Schweiz spürbar. So wurde den Produzenten je kg Milch im Jahr 2007 rund 70 Rp. bezahlt, 2008 waren es fast 78 Rp., 2009 65 Rp. und 2010 62 Rp. In der Schweiz wirken sich die Direktzahlungen und die Einnahmen aus ausserlandwirtschaftlicher Tätigkeit stabilisierend auf das Einkommen der Produzenten aus. Für die Schweizer Konsumenten ist die Preisvolatilität im Vergleich zu den OECD-Ländern und insbesondere zu Entwicklungsländern weniger spürbar: Erstens wirken sich die Schwankungen an den internationalen Märkten aufgrund des hohen Grenzschutzes und dem relativ tiefen Anteil des Rohstoffs am Preis der einzelnen Lebensmittel weniger auf die Ladenpreise aus. Zweitens ist der Anteil des Einkommens, welcher für Nahrungsmittel ausgegeben wird, mit rund 7 % im Vergleich zum OECD-Länder Durchschnitt von 22 % relativ klein. Und drittens hat das Erstarken des Schweizer Frankens gegenüber dem Dollar und Euro den Preisanstieg gedämpft.
n Die Grüne Wachstumsstrategie der OECD für die Ernährungs- und Landwirtschaft
Angesichts des steigenden Bedarfs an landwirtschaftlichen Rohstoffen und der begrenzten Ressourcenverfügbarkeit wurde Grünes Wachstum am OECD-Agrarministertreffen im Februar 2010 in Paris als eines der prioritären Ziele des zukünftigen Ernährungs- und Landwirtschaftssystems identifiziert. Die OECD hat nun eine Green Growth Strategy for Food and Agriculture publiziert. Das Ziel der Strategie ist es, für eine wachsende Weltbevölkerung nachhaltig und effizient genügend Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Strategie der OECD zeigt Wege auf, wie die landwirtschaftliche Produktivität gesteigert und gleichzeitig die knappen natürlichen Ressourcen erhalten und die Kohlenstoffintensität reduziert werden können. Die Strategie zielt insbesondere darauf ab, schädliche Umwelteinflüsse der Landwirtschaft zu minimieren und positive Umweltleistungen wie die Kohlenstoffsequestrierung oder den Erhalt der Biodiversität zu fördern.
199 3.1 Internationale Entwicklungen
Die Strategie basiert auf folgenden Schlüsselelementen:
Die Produktivität muss nachhaltig gesteigert werden. Dafür muss die Ressourceneffizienz (Ertrag pro eingesetzte Ressourceneinheit) entlang der ganzen Angebotskette erhöht werden. Die Ressourcen Wasser, Boden, Luft etc. sollen nachhaltig bewirtschaftet werden und somit erhalten bleiben. Abfälle aus der Ernährungs- und Landwirtschaft müssen reduziert, recycelt und besser verwertet werden. Als Massnahmen empfiehlt die OECD, der Forschung und Entwicklung, den Innovationen, der Bildung sowie der Beratung eine höhere Priorität zuzuordnen.
– Die Märkte müssen die richtigen Signale aussenden. Damit Ressourcen effizienter genutzt und landwirtschaftliche Produkte nachhaltiger konsumiert werden, müssen die Preise an den Märkten die Knappheit der natürlichen Ressourcen und die positiven und negativen Umwelteinflüsse der Ernährungs- und Landwirtschaft widerspiegeln. Bei negativen Externalitäten soll das Verursacherprinzip gegebenenfalls durch Gebühren und Regulierungen konsequenter durchgesetzt werden. Wirtschafts- und umweltschädigende Agrarstützungen sollen reduziert und die Konsumenten besser informiert werden. Mit Anreizen können landwirtschaftliche Umweltgüter und -leistungen gefördert werden. Als weitere Massnahme empfiehlt die OECD, die inländischen und internationalen Märkte besser zu integrieren.
Eigentumsrechte müssen geschaffen und geltend gemacht werden. Eigentumsrechte fördern die optimale Ressourcennutzung, insbesondere bei der Nutzung der Meere, des Bodens, der Wälder, der Luft (inkl. Treibhausgasemissionen) und des Wassers. Keine oder nicht geltend gemachte Eigentumsrechte führen zu Übernutzung und Verschwendung von natürlichen Ressourcen. Die Schaffung von Eigentumsrechten ist komplex und zunehmend eine globale als eine rein nationale Angelegenheit. Die OECD fordert die politischen Entscheidungsträger auf, diesem Aspekt zukünftig eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.
Eine grüne Strategie für die Ernährungs- und Landwirtschaft erfordert gezielte, gut koordinierte und kohärente Antworten auf ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen von Seiten der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Auf Stufe politischer Entscheidungsträger wird die grüne Wirtschaft eines der Kernthemen der UNO-Konferenz für eine nachhaltige Entwicklung sein, welche im Juni 2012 in Rio stattfinden wird. Die FAO ist im Vorfeld der Konferenz für die Vorbereitungsarbeiten im Bereich Ernährungs- und Landwirtschaft zuständig. Das BLW beteiligt sich aktiv an diesem Prozess und engagiert sich auf nationaler und internationaler Ebene tatkräftig für ein nachhaltiges und versorgungssicheres Ernährungsund Landwirtschaftssystem.
200 3.1 Internationale Entwicklungen
–
–
3.1.8 FAO
n Konferenz 2011 / Komitee für globale Ernährungssicherheit
Der eigentliche Höhepunkt der 37. Konferenz der FAO war die Wahl des Brasilianers José Graziano da Silva zum neuen Generaldirektor. Er wird am 1. Januar 2012 die Nachfolge von Jacques Diouf antreten. Die Konferenz wählte zudem Luc Guyau (Frankreich) erneut zum unabhängigen Vorsitzenden des FAO-Rats. Daneben verabschiedete sie den mittelfristigen Plan 2010–2013, der im Sinne einer verbesserten Prioritätenregelung revidiert wurde, sowie das Arbeitsprogramm und Budget 2012–2013. Das Budget für die nächste Zweijahresperiode wurde um 0,56 % auf 1,015 Milliarden Dollar erhöht. Darüber hinaus rechnet die FAO für die nächste Zweijahresperiode mit rund 1,4 Milliarden Dollar aus Freiwilligenbeiträgen der Mitgliedstaaten und Partner. Der Anteil der Schweiz am ordentlichen Budget der FAO wurde für den Zeitraum 2012–2013 auf 1,135 % gesenkt. Ausserdem befasste sich die Konferenz mit der Reform der Organisation und verabschiedete den Bericht über die Umsetzung des sofortigen Aktionsplans in der Zweijahresperiode 2010–2011. Dieser Bericht zeigt auf, dass zwar Fortschritte erzielt wurden, umfassende und komplexe Aktionen jedoch noch zu realisieren sind. Es geht insbesondere darum, die Reform in den Bereichen Kulturwandel, HR-Politik und Dezentralisierung fortzusetzen und auszubauen sowie eine Partnerschaftsstrategie – namentlich mit der Privatwirtschaft – umzusetzen.
Auf Initiative der Schweiz wurde am Rande der Konferenz ein Anlass organisiert, um die UNO-Nachhaltigkeitskonferenz 2012 («Rio+20») seitens der FAO vorzubereiten. Ziel war es, die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Bedeutung einer vollständigen Integration der Landwirtschaft in die grüne Wirtschaft, das Hauptanliegen von Rio+20, zu sensibilisieren. Die Schweiz unterstützt die Arbeiten der FAO unter dem Motto «Greening economy with agriculture». Dieser Anlass, dessen Vorsitz die Schweiz führte, war ein durchschlagender Erfolg.

201 3.1 Internationale Entwicklungen
Das Komitee für globale Ernährungssicherheit (CFS), dessen Reform am Welternährungsgipfel auf höchster politischer Ebene verabschiedet wurde, tagte im Oktober 2010. Das CFS öffnete sich einer erweiterten Gruppe von Stakeholdern, namentlich der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft. Es soll zur internationalen und regierungsübergreifenden Plattform für die Prüfung und Beobachtung von Politiken im Bereich der globalen Ernährungssicherheit werden. Die Vollversammlung von Oktober 2010 verlief äusserst positiv. Das CFS sprach sich insbesondere für die Weiterführung des offenen Prozesses für die Erarbeitung von Freiwilligen Richtlinien für eine verantwortungsvolle Gouvernanz beim Umgang mit Land und natürlichen Ressourcen aus. Die interessierten Parteien aus aller Welt wurden eingeladen, zu einem entsprechenden Entwurf Stellung zu nehmen. Er ist derzeit Gegenstand von Verhandlungen und dürfte der CFS-Vollversammlung im Oktober 2011 zur Billigung vorgelegt werden. Ausserdem hat das CFS die hochrangige Expertengruppe «Ernährungssicherheit» beauftragt, Studien zu den Themen – geordnet nach ihrer Wichtigkeit – Instabilität der Agrarpreise, Sozialschutz und Klimawandel auszuarbeiten. Das BLW hat die Arbeiten dieser Expertengruppe 2011 finanziell unterstützt. Der Bericht über die Preisvolatilität wird an der Vollversammlung im Oktober 2011 präsentiert.
Im BLW konzentrierten sich die Tätigkeiten 2010 auf die Umsetzung der Beschlüsse, die 2009 am Welternährungsgipfel getroffen wurden. In enger Zusammenarbeit mit der DEZA wurde eine entsprechende Informationsnotiz zuhanden des Bundesrats ausgearbeitet. Darin wurden vier Bereiche hervorgehoben, in denen die Schweiz ihr konkretes Handeln intensivieren könnte, um sich auf internationaler Ebene dank ihrer finanziellen und menschlichen Ressourcen mehr Visibilität und ein markanteres Profil zu verschaffen.
n UNO-Nachhaltigkeitskonferenz (Rio+20)
Die UNO-Generalversammlung verabschiedete am 24. Dezember 2009 eine Resolution (A/RES/64/236) und erklärte sich damit bereit, 2012 die UNO-Nachhaltigkeitskonferenz, auch «Rio+20» genannt (http:// www.uncsd2012.org/rio20/), durchzuführen. Die folgenden zwei Themen werden im Zentrum der Konferenz stehen, die vom 4. bis 6. Juni in Rio stattfinden wird: die Förderung der grünen Wirtschaft im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung und der Überwindung der Armut sowie die Erarbeitung eines institutionellen Rahmens für die nachhaltige Entwicklung. Die FAO befindet sich mitten in den Vorbereitungen für Rio+20. Sie möchte die Ziellücken der Agenda 21, die 1992 an der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung beschlossen wurde, angehen – insbesondere jene im Zusammenhang mit Kapitel 14 über die Landwirtschaft und die nachhaltige ländliche Entwicklung, aber auch mit den Kapiteln zur Bodennutzung, der Entwaldung, der Wüstenbildung, den Bergen, der Biodiversität, den Ozeanen und dem Süsswasser. Die FAO prüft namentlich, wie sich die grüne Wirtschaft auf die Land- und Ernährungswirtschaft auswirkt. Das BLW unterstützt die Vorbereitungsarbeiten der FAO für Rio+20.
n Laufende Projekte
Die Schweiz hat sich 2010 bereit erklärt, den Vorsitz der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe des Codex Alimentarius für Tierfuttermittel («Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Animal Feeding») zu stellen. Das BLW übernimmt die Federführung des Projekts, dessen Leitung der BLW-Vizedirektorin Eva Reinhard überantwortet wurde (http://tfaf.clicdesign.ch/index.php?id=2). Vom 20. bis 24. Februar 2012 wird sich die Arbeitsgruppe, unter dem Vorsitz der Schweiz, zu einer Tagung in Bern treffen. Ziel ist es, Richtlinien für die Beurteilung und das Management von Risiken einer Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel tierischen Ursprungs zu erarbeiten, die zu internationalen Standards werden könnten. Daneben soll den Regierungen eine Prioritätenliste zur Verfügung gestellt werden, welche die Risiken von Inhalts- und Zusatzstoffen aufzeigt.
202 3.1 Internationale Entwicklungen
3.1.9 Genetische Ressourcen / Agrobiodiversität
n Übereinkommen über die biologische Vielfalt
An der 10. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP-10 der CBD), die vom 18. bis 29. Oktober 2010 im japanischen Nagoya stattfand, wurden mehrere Entscheidungen mit Bezug zur Agrobiodiversität gefällt. Das politisch grösste Gewicht hatte die Verabschiedung, nach über zehn Verhandlungsjahren, des Nagoya-Protokolls über den Zugang zu genetischen Ressourcen und den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung dieser Ressourcen (Protocole ABS, Access to genetic Resources and Benefit Sharing; http://www.cbd.int/abs/). Ziel dieses Protokolls ist der erleichterte Zugang zu genetischen Ressourcen dank eines festen internationalen Rahmens, um sicherzustellen, dass die Nutzer genetischer Ressourcen die Bestimmungen der Materialübertragungsvereinbarungen bezüglich des gerechten Vorteilsausgleichs einhalten, die vom Lieferland festgelegt werden. Das Protokoll gilt für alle genetischen Ressourcen, wobei den Besonderheiten und dem hohen Stellenwert der genetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft Rechnung getragen werden. Das Protokoll anerkennt, auf der Grundlage des Prinzips der gegenseitigen Unterstützung, die bestehenden internationalen Instrumente wie den Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft und räumt genügend Flexibilität ein, um – falls nötig und angebracht – die Entwicklung neuer, spezifischer Instrumente zu ermöglichen, soweit diese mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und mit dem Nagoya-Protokoll vereinbar sind. Die Schweiz hat das Nagoya-Protokoll am 11. Juni 2011 unterzeichnet, und die Ratifizierungsarbeiten im Parlament haben begonnen.
Die COP-10 hat zudem den Strategischen Plan von Aichi zur Biodiversität (2011–2020; http://www.cbd.int/ sp/) verabschiedet. Dieser Strategische Plan umfasst 20 Ziele und sieht namentlich vor, bis 2020 Folgendes zu erreichen:
– Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen, die die Erhaltung der biologischen Vielfalt sicherstellt (Ziel 7);
Die Beseitigung von Anreizen, die sich negativ auf die biologische Vielfalt auswirken, und die Schaffung von positiven Anreizen (Ziel 3);
– Die Einführung von Massnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Produktion und des Konsums von Komponenten der biologischen Vielfalt (Ziel 4);
Die Reduktion der Umweltverschmutzung – unter anderem durch überschüssige Nährstoffe – auf ein Niveau, das für die Funktion von Ökosystemen und für die biologische Vielfalt unschädlich ist (Ziel 8);
– Die Erhaltung von mindestens 17 % der Bodenfläche durch wirkungsvoll gemanagte, ökologisch repräsentative und gut vernetzte Schutzgebietssysteme, die in die umgebende terrestrische Landschaft integriert sind (Ziel 11); und
Die Sicherung der genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen und Nutztieren (Ziel 13).
203 3.1 Internationale Entwicklungen
–
–
–
n Internationaler Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
Der Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (nachfolgend: Vertrag), der 2004 in Kraft trat, ist ein zentrales Instrument zur Sicherstellung der Vielfalt der pflanzengenetischen Ressourcen, auf die die Landwirte und Züchter angewiesen sind, um den globalen Herausforderungen in den Bereichen Ernährungssicherheit und Klimawandel begegnen zu können. Der Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen und der gerechte Vorteilsausgleich aus ihrer Nutzung werden im Rahmen eines multilateralen Systems geregelt, das mit diesem Vertrag errichtet wird. Die Transaktionen zwischen Lieferanten und Nutzern von pflanzengenetischen Ressourcen erfolgen über eine standardisierte Materialübertragungsvereinbarung (MTA). Jedes Jahr werden über 100 000 Proben auf der Grundlage der MTA ausgetauscht, grösstenteils ab den Zentren der Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung. In der Schweiz wurden 2010 von der nationalen Genbank 71 MTA ausgestellt.
Die 4. Tagung des Lenkungsorgans des Vertrags fand in einer sehr konstruktiven Atmosphäre vom 14. bis 18. März 2011 in Bali statt. Mit der Verabschiedung der letzten offenen institutionellen Punkte, namentlich der Modalitäten in den Bereichen Finanzierung und Mediation im Falle einer Nichteinhaltung der MTA, hat der Vertrag eine wichtige Hürde genommen. Er ist ausgereifter und kann sich nun auf seine Hauptziele konzentrieren: die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen. Bei der Konkretisierung der Finanzierungsstrategie des Vertrags wurden deutliche Fortschritte erzielt. So konnte eine zweite Reihe von Projekten zur Erhaltung von pflanzengenetischen Ressourcen in Entwicklungsländern im Hinblick auf eine Anpassung an den Klimawandel finanziert werden. Die Zusammenarbeit mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt wird intensiviert, namentlich im Rahmen des Nagoya-Protokolls.
Mit der Lancierung eines konkreten Arbeitsprogramms für die Massnahmenentwicklung zur Förderung der nachhaltigen Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen konnte die Schweiz, die sich seit der ersten Sitzung des Lenkungsorgans im Jahr 2006 für diese Thematik stark gemacht hat, einen Erfolg verbuchen. Es ist hingegen bedauerlich, dass keine konkreten Entscheidungen getroffen wurden, um Mechanismen zur aktiveren Förderung einer Beteiligung der Saatgutbranche bei der Umsetzung des multilateralen Systems des Vertrags zu entwickeln.
Die Ratifizierung durch die USA bleibt ein entscheidendes Element für die Zukunft des Vertrags. Der Prozess ist auf gutem Weg, wurde 2010 jedoch insbesondere aufgrund der Wahlen im Repräsentantenhaus verzögert.
n FAO-Kommission für genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
Im Oktober 2010 publizierte die FAO den zweiten Bericht zur weltweiten Lage der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGRFA; http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/ theme/seeds-pgr/sow/sow2/en/), der von der Kommission für genetische Ressourcen erarbeitet wurde. Dieser Bericht liefert einen abschliessenden Überblick über die weltweiten Entwicklungen im Bereich der Erhaltung und Nutzung von PGRFA seit der Veröffentlichung des ersten Berichts 1996. Er basiert auf Informationen von über 100 Ländern, darunter auch der Schweiz, sowie von internationalen Forschungsorganisationen und Studienprogrammen. Aus dem Bericht geht hervor, dass bei der Ex-situ-Erhaltung der Vielfalt von PGRFA in nationalen Genbanken Fortschritte erzielt wurden. Die lokale Vielfalt, die man in den Feldern vorfindet, ist jedoch noch weitgehend ungenügend dokumentiert und gemanagt. Das Management von PGRFA ist fester Bestandteil der Strategien und politischen Massnahmen zahlreicher Länder – eine Folge des Abschlusses und der Umsetzung von internationalen Abkommen wie dem Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen. Zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Institutionen, die im Bereich des PGRFA-Managements tätig sind, gilt es jedoch die Kommunikation zu verbessern, die Zusammenarbeit zu intensivieren und solidere Partnerschaften anzustreben.
204 3.1 Internationale Entwicklungen
Die Kommission für genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, die sich vom 18. bis 22. Juli 2011 in Rom zu ihrer 13. Tagung traf, startete mit dem Engagement und der Unterstützung mehrerer Länder im Rahmen des Globalen Aktionsplans für tiergenetische Ressourcen, der 2007 an der Konferenz in Interlaken verabschiedet worden war, die erste Reihe von Umsetzungsprojekten in Entwicklungsländern. Daneben hat die Kommission der Aktualisierung des Globalen Aktionsplans für pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft zugestimmt. Sie hat beschlossen, eine Arbeitsgruppe «Zugang und gerechter Vorteilsausgleich» einzusetzen. Diese Arbeitsgruppe soll Instrumente und Mechanismen entwickeln, um die Umsetzung des Nagoya-Protokolls im Bereich der genetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft zu unterstützen. Die Schweiz wurde ernannt, die Regionalgruppe «Europa» in dieser Arbeitsgruppe und jener für tiergenetische Ressourcen zu vertreten.
3.1.10 Internationaler Getreiderat und NahrungsmittelhilfeÜbereinkommen (IGC/FAC)
Das Internationale Getreide-Abkommen von 1995 besteht aus zwei rechtlich getrennten Übereinkommen: dem Getreidehandels-Übereinkommen von 1995 und dem Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen von 1999. Das Getreidehandels-Übereinkommen ist Grundlage für die Tätigkeiten des Internationalen Getreiderates. Das Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen wird vom Nahrungsmittelhilfe-Ausschuss beaufsichtigt. Für die Gesamtadministration ist das Sekretariat des Internationalen Getreiderates mit Sitz in London zuständig.
n Internationaler Getreiderat (International Grains Council, IGC)
Hauptziel des Internationalen Getreiderates ist die Analyse und Berichterstattung zur weltweiten Marktlage für Getreide, Mais, Reis und Ölsaaten. In täglichen, wöchentlichen und monatlichen Publikationen werden Information zu Preisentwicklungen, zu Produktions- und Handelsmengen sowie zu relevanten Tätigkeiten der Export- und Importländer (Änderungen von Export- und Importzöllen, Ausschreibungen, etc.) kommuniziert. Die Informationen des Internationalen Getreiderates leisten einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz des Marktgeschehens und tragen damit zur Verbesserung der weltweiten Ernährungssicherheit bei. Der Internationale Getreiderat greift jedoch nicht direkt ins Marktgeschehen oder in die Gestaltung der Getreidepolitiken der Mitgliedsländer ein.
Die Schweiz ist seit Bestehen (1949) Mitglied des Internationalen Weizen- oder Getreide-Abkommens. Vom Juli 2010 bis Juni 2011 hatte die Schweiz den Vorsitz im Internationalen Getreiderat.
n Neuverhandlung des Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens (Food Aid Convention, FAC)
Die Mitglieder des Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens – es sind dies Argentinien, Australien, EU, Japan, Kanada, Norwegen, die Schweiz und die USA – verpflichten sich insbesondere zu jährlich definierten Mengen an Lebensmittelhilfe, umgerechnet in Weizenäquivalente. Die Schweiz ist mit einem Anteil von 40 000 t Weizenäquivalenten beteiligt. Im Getreidejahr 2009/10 wurde Nahrungsmittelhilfe im Umfang von rund
7 Mio. t Weizenäquivalenten rapportiert, davon betrug der Beitrag der Schweiz 48 000 t Weizenäquivalente.
Das Übereinkommen gewährleistet einen rechtlichen Rahmen für verbindliche Mengen an Nahrungsmittelhilfe, für die Koordination und den Informationsaustausch. Die Mitglieder verpflichten sich, insbesondere die Armut und den Hunger der schwächsten Bevölkerungsgruppen zu bekämpfen, ohne dabei die landwirtschaftliche Entwicklung dieser Länder zu beeinträchtigen. Richtlinien geben vor, dass Nahrungsmittelhilfe möglichst wirkungsvoll, effizient und qualitätsorientiert erfolgen soll. Das Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen ist nur indirekt operativ wirksam, da die Mitglieder die Tätigkeiten in diesem Bereich über andere Kanäle abwickeln und die entsprechenden Operationen periodisch melden. Die Beschaffung der von der Schweiz finanzierten Nahrungsmittelhilfe beispielsweise erfolgt grösstenteils in enger Zusammenarbeit mit dem World Food Programme WFP, welchem auch die Verteilung der Güter übertragen wird.
205 3.1 Internationale Entwicklungen
Das Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen wurde seit 1999 nicht mehr verändert und reflektiert nicht mehr das aktuellste Verständnis von effektiver Nahrungsmittelhilfe. Kritikpunkte bilden insbesondere die zu enge Definition von Nahrungsmittelhilfe, das Konzept der Weizenäquivalente und die mangelnde Vernetzung des Übereinkommens mit anderen Komponenten der internationalen Ernährungssicherheitsarchitektur. Zur Vorbereitung eines neuen Abkommens wurden zwischen Juni 2009 und Dezember 2010 informelle Gespräche geführt. Im Dezember 2010 wurde die Neuverhandlung des Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens eröffnet. Die «Food Aid Convention» soll in eine «Food Assistance Convention» überführt werden.
206 3.1 Internationale Entwicklungen
3.2 Internationale Vergleiche
3.2.1 Produzenten- und Konsumentenpreise –Vergleich mit den Nachbarländern
In diesem Abschnitt wird ein Vergleich der Produzenten- und Konsumentenpreise zwischen der Schweiz und den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Österreich vorgenommen. Einerseits werden absolute Produzenten- und Konsumentenpreise für eine Auswahl von Produkten für das Berichtsjahr, anderseits die Entwicklung von 2000/02 bis 2010 auf Basis von Indizes dargestellt.

207 3.2 Internationale Vergleiche
n Produzentenpreise in der Schweiz höher
Nachfolgend werden für die drei Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Österreich sowie für die Schweiz Produzentenpreise für eine Auswahl von Produkten dargestellt. Die Schwierigkeit besteht darin, wirklich vergleichbare Produkte zu finden. Bei Früchten und Gemüse kommt erschwerend dazu, Preise auf derselben Stufe zu erfassen. Dort wo kein vergleichbares Produkt gefunden werden konnte, fehlt deshalb eine Angabe. Bei den Preisen in den drei Nachbarländern ist ersichtlich, dass sie bei Milch, Fleisch und Ackerbauprodukten relativ homogen sind, bei Früchten und Gemüsen hingegen teilweise beträchtliche Differenzen zwischen den drei Ländern bestehen. Die Schweizer Zölle bewirken, dass die Produzentenpreise in der Schweiz über dem Niveau in der EU liegen. Bei der Milch bewegen sich die Preise der Nachbarländer bei zwei Drittel der Schweizer Preise. Die Produzentenpreise für das Fleisch sind in der Schweiz fast doppelt so hoch, bei Getreide und Ölsaaten erreichen diejenigen der Nachbarländer rund 60 % des Niveaus der Schweiz. Auch die Preise für Früchte und Gemüse sind in der Schweiz höher. Je nach Land sind die Differenzen recht unterschiedlich. Zum Teil ist der Preis doppelt so hoch, zum Teil sind sie auch fast auf demselben Niveau.
Produzentenpreise in der Schweiz und den Nachbarländern 2010
Anmerkung: Es ist schwierig, für alle vier Länder absolut vergleichbare Produkte auszuwählen. Bei den berücksichtigten Produkten handelt es sich daher um Erzeugnisse, die sich am besten für einen solchen Preisvergleich eignen und für welche vergleichbare und zugängliche Daten vorliegen.
Milchgehalt: D (4 % Fett, 3,4 % Eiweiss), F (3,8 % Fett, 3,2 % Eiweiss), A (3,7 % Fett, 3,4 % Eiweiss), CH (4 % Fett, 3,3 % Eiweiss); Tafeläpfel Kl I: F (Golden und Gala); Tafelbirnen Kl. I: F (Conférence); Zwiebeln: CH (gelb), D, F, A (allgemein)
Quellen: FranceAgriMer, Agreste Frankreich; Agrarmarkt Austria (AMA), Bundesanstalt Statistik Austria, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft Österreich; Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) Deutschland; BLW Marktbeobachtung
208 3.2 Internationale Vergleiche
Produkte Ø 2010 D F A CH Milch Rp./kg 42.63 40.34 41.94 60.30 Fleisch Muni T3 Fr./kg SG 4.35 4.27 4.43 8.16 Kälber T3 Fr./kg SG 6.53 7.86 6.95 13.46 Schweine Fr./kg SG 1.91 1.80 1.94 3.79 Getreide und Ölsaaten Weizen Kl. 1 Fr./100 kg 29.10 n.v. 28.01 50.26 Gerste Fr./100 kg 22.62 19.81 19.89 34.30 Körnermais Fr./100 kg 26.40 25.51 24.45 36.91 Raps Fr./100 kg 55.07 n.v. 47.68 81.15 Hackfrüchte Lagerkartoffeln Fr./100 kg n. v. n. v. 24.14 48.11 Zuckerrüben Fr./100 kg n. v. n. v. 3.64 7.77 Früchte Tafeläpfel, Kl. I Fr./ kg 0.60 1.06 0.46 1.07 Tafelbirnen, Kl. I Fr./ kg 0.68 1.39 1.02 1.12 Gemüse Karotten Fr./kg 0.38 0.54 0.46 0.80 Kopfsalat Fr./Stück 0.55 0.72 0.39 0.68 Salatgurken Fr./Stück 0.55 0.73 0.43 0.87 Zwiebeln Fr./kg 0.38 0.43 0.43 0.79
Für die Entwicklung des Preisabstandes bei den Produzentenpreisen 2000/02 bis 2010 konnte nur ein Vergleich mit Österreich gemacht werden, da für die anderen Länder keine lückenlosen Datenreihen bestehen. Da die Produzentenpreise der Nachbarländer insgesamt ziemlich homogen sind, dürften bei einem Einbezug von Deutschland und Frankreich die Ergebnisse kaum anders aussehen. Aus der Graphik ist ersichtlich, dass der Preisabstand bis 2007 kontinuierlich geringer geworden ist. Betrug der Abstand 2000/02 noch 48 Prozent, waren es 2007 nur noch 33 Prozent. Hauptgründe für diese Entwicklung waren der Anstieg der Weltmarktpreise für wichtige Agrarprodukte und die gleichzeitige Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro. Zwischen 2007 und 2010 ist der Abstand wieder grösser geworden. 2010 betrug er 43 Prozent. Hauptgrund dafür ist der stärker werdende Schweizer Franken. Lag der Kurs Euro zu Schweizer Franken 2007 noch bei 1.64, sank er 2010 auf 1.38 oder um 16 %.
Entwicklung der Produzentenpreise in Österreich im Vergleich zur Schweiz
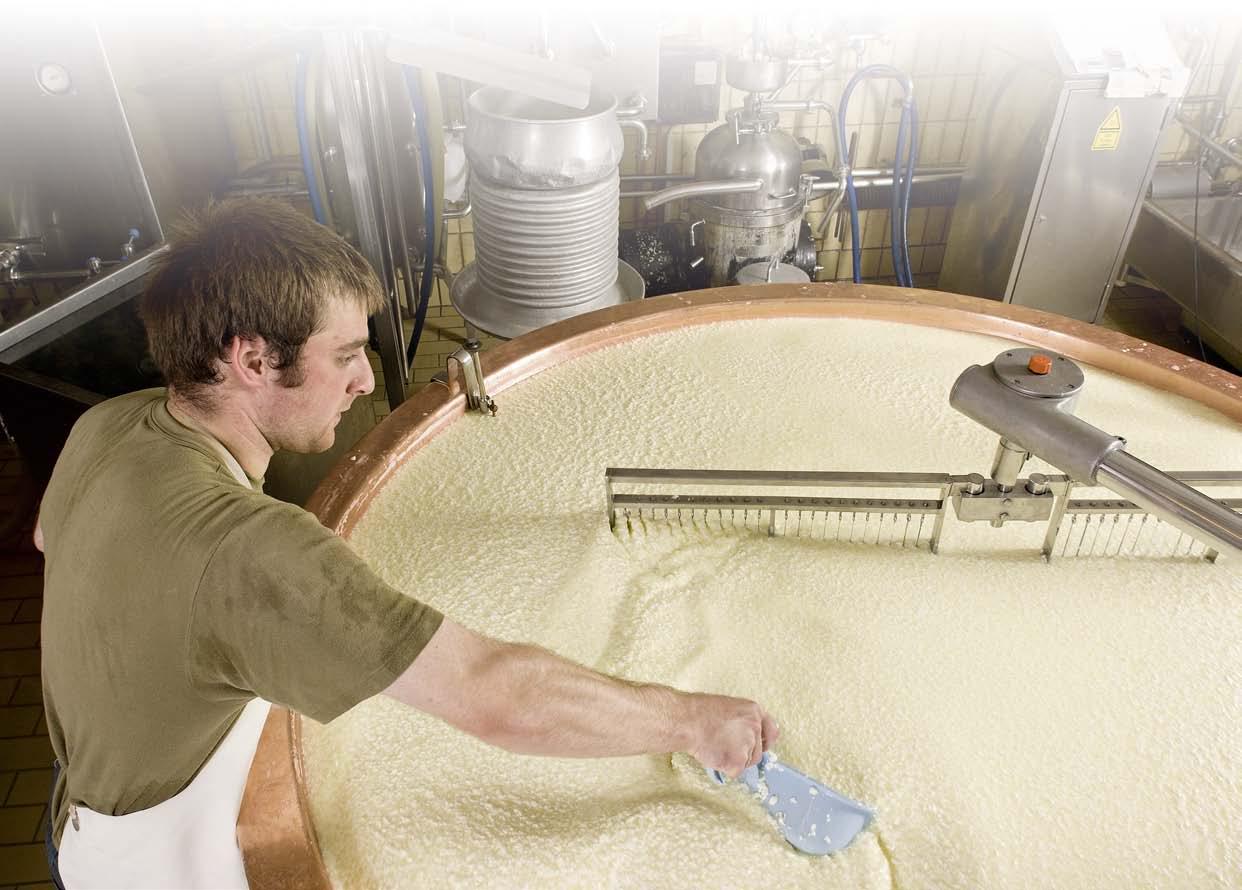
209 3.2 Internationale Vergleiche
Index (CH = 100)
0 20 10 30 50 40 70 60 80 100 90 2000/02 2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quellen: Statistik Austria, BLW
n Konsumentenpreise ebenfalls höher als in den Nachbarländern
Wie bei den Produzentenpreisen werden nachfolgend für die drei Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Österreich sowie für die Schweiz Konsumentenpreise für eine Auswahl von Produkten dargestellt. Wirklich vergleichbare Produkte zu finden gestaltet sich auf der Ebene des Konsums noch schwieriger als auf Stufe Produktion. Deshalb sind die Angaben auch bei den Konsumentenpreisen nicht lückenlos. Bei den Konsumentenpreisen zeigt sich eine grössere Heterogenität unter den EU-Ländern als bei den Produzentenpreisen. Deutlich am billigsten kann der Konsument in Deutschland einkaufen. In Österreich und Frankreich sind die meisten Produkte um einiges teurer. Dies gilt vor allem für Milchprodukte und Fleisch. Im Vergleich zur Schweiz sticht der grosse Abstand beim Fleisch mit Deutschland hervor. So bezahlen deutsche Konsumenten weniger als die Hälfte für das Fleisch. Zu Österreich ist der Abstand hingegen bedeutend geringer. Auch bei Früchten und Gemüsen sind die Preise in der Schweiz am höchsten. Die Differenz zu den Nachbarländern ist allerdings weniger gross als beim Fleisch.
Konsumentenpreise in der Schweiz und den Nachbarländern 2010
Anmerkung: Es ist schwierig, für alle vier Länder absolut vergleichbare Produkte auszuwählen. Bei den berücksichtigten Produkten handelt es sich daher um Erzeugnisse, die sich am besten für einen solchen Preisvergleich eignen und für welche vergleichbare und zugängliche Daten vorliegen.
Vollmilch Past: F (Lait UHT demi-écrémé); Joghurt nature: A (Naturjoghurt, Handelsmarke, Preis des günstigsten österreichischen Produktes, quartalsweise erhoben); Birnen: F (Conférence); Zwiebeln: CH (gelb), D, F, A (allgemein)
Quellen: FranceAgriMer, Agreste Frankreich; Agrarmarkt Austria (AMA), Bundesanstalt Statistik Austria, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft Österreich; Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) Deutschland; BLW Marktbeobachtung
210 3.2 Internationale Vergleiche
Produkte Ø 2010 D F A CH Milch und Milchprodukte Vollmilch Past Fr./l 0.85 0.99 1.29 1.41 Butter Fr./kg 5.35 8.77 8.05 14.78 Joghurt nature Fr./kg 1.37 1.84 1.61 2.97 Mozzarella Fr./kg 5.86 n.v n.v 12.07 Emmentaler Fr./kg 11.92 11.54 14.03 18.52 Fleisch und Eier Rindsentrecôte Fr./kg n.v 29.27 28.29 62.88 Rindssiedfleisch, Federstück Fr./kg 8.33 n.v. 15.82 20.06 Kalbsplätzli (Stotzen) Fr./kg n.v 30.86 37.41 68.97 Schweinsplätzli (Stotzen) Fr./kg 8.79 n.v 12.79 26.97 Schweinskoteletten Fr./kg 6.68 n.v 12.18 19.61 Poulet frisch Fr./kg 4.57 n.v 6.04 9.66 Eier Bodenhaltung 10 Stück Fr./Ei 0.19 n.v n.v 0.45 Hackfrüchte Kartoffeln Fr./kg n. v n.v 1.47 1.72 Früchte Apfel Golden Delicious Fr./kg 2.30 2.31 2.46 3.26 Birnen Fr./kg 2.71 2.93 3.40 4.04 Gemüse Karotten Fr./kg 1.02 1.40 1.53 2.28 Kopfsalat Fr./Stück 1.16 1.40 1.29 2.07 Salatgurken Fr./Stück 0.80 1.30 1.33 1.79 Zwiebeln Fr./kg 1.30 1.66 1.58 2.32
Die Entwicklung des Preisabstandes zeigt auf der Konsumseite dasselbe Bild wie auf der Produktionsseite. Zwischen 2002/02 und 2007 wurde der Abstand geringer, danach erhöhte er sich wieder. 2000/02 betrug die Differenz 32 %, 2007 nur noch 19 % und 2010 wieder 27 %. Hauptgründe für die Annäherung bis 2007 waren einerseits der schwächer werdende Franken und anderseits der gegenüber der Schweiz stärkere Anstieg der Nahrungsmittelpreise in den Nachbarländern. Die Vergrösserung des Abstandes zwischen 2007 und 2010 ist wie bei den Produzentenpreisen auf die Erstarkung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro zurückzuführen.
Entwicklung der Konsumentenpreise in den Nachbarländern im Vergleich zur Schweiz

211 3.2 Internationale Vergleiche
Index (CH = 100)
0 20 10 30 50 40 70 60 80 100 90 2000/02 2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: Eurostat
3.2.2 Schweizer Milchbetriebe im Vergleich mit Österreich und Deutschland
n Einleitung
Die EU-Kommission betreibt zusammen mit allen EU-Mitgliedstaaten ein Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB), das auf einer einheitlichen Methodik beruht. Durch die Umrechnung der Daten des schweizerischen Buchhaltungsnetzes gemäss der INLB-Methodik an der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART stehen vergleichbare Ergebnisse zur Verfügung. Der Vergleich erfolgt auf EuroBasis. 1 Euro entspricht im Durchschnitt der Jahre 2005–2008 Fr. 1.59.

n Methode
Die Datenerhebung und Auswertung im INLB weicht in mehreren Bereichen von der Methodik des schweizerischen Buchhaltungsnetzes ab (Meier, 1996). Um schweizerische Buchhaltungsergebnisse INLB-vergleichbar darzustellen, ist eine Anpassung der Schweizer Daten erforderlich. Entsprechend sind die hier dargestellten Ergebnisse von Schweizer Betrieben nicht mit den Schweizer Standardauswertungen der Referenzbetriebe vergleichbar. Nachfolgend werden die Ergebnisse von Milcherzeugungsbetrieben (gemäss EU-Typologie BWA 41) mit einer Fläche zwischen 30 und 50 ha dargestellt. Die Vergleiche werden aufgrund der beschränkten Datenverfügbarkeit auf der Ebene von Gruppenmittelwerten durchgeführt.
212 3.2 Internationale Vergleiche
n Ergebnisse
Betriebsstruktur
Bei Milcherzeugungsbetrieben zwischen 30 und 50 ha zeigt sich bei den schweizerischen Betrieben ein höherer Arbeitseinsatz von über zwei Arbeitskräften, gefolgt von Österreich mit 1,9 und Bayern mit 1,5. Angestellte kommen in den Betrieben der EU-Vergleichsregionen kaum vor, machen hingegen bei den schweizerischen Betrieben 0,6 Arbeitskräfte aus. Die österreichischen Betriebe halten bei gleicher landwirtschaftlicher Nutzfläche viel weniger Tiere. Demzufolge erreicht die produzierte Milchmenge je Betrieb in Österreich lediglich 65 % der Schweizer Betriebe bzw. 70 % der Milchmenge der Betriebe in Bayern.
Betriebsstrukturen spezialisierter Milcherzeugungsbetriebe mit 30–50 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, 2008
2
3
n Bruttoerzeugung und Beihilfen
Quellen: EU-Kommission, INLB, ART Zentrale Auswertung
Die schweizerischen Milcherzeugungsbetriebe erwirtschaften aus der landwirtschaftlichen Produktion die 1,7- (Bayern) bzw. 2,2-fache (Österreich) Bruttoerzeugung der EU-Vergleichsländer. Bei den österreichischen Betrieben wirkt sich der um rund ein Drittel niedrigere Kuhbestand aus. Im Vergleich zu Bayern ist der Milchpreis aber höher. Die Direktzahlungen (Beihilfen und Steuern) der schweizerischen Betriebe sind mit 53 000 Euro ungefähr doppelt so hoch wie diejenigen der österreichischen Betriebe mit 26 000 Euro.
Die Zeitreihe zeigt, dass sich in den Ländern die starken Schwankungen bei den Milchpreisen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlicher Intensität ausgewirkt haben. Während bei den schweizerischen Betrieben die Bruttoerzeugung der Milch von 2007 auf 2008 um 20 % zunahm, war in Österreich ein kontinuierlicher Anstieg von 2006 auf 2008 von 20 % pro Jahr zu verzeichnen. In Bayern war das Jahr 2007 herausragend, aber 2008 lag die Bruttoerzeugung der Milch wieder nahe dem Niveau von 2006.
213 3.2 Internationale Vergleiche
Land / Region Schweiz Österreich Bayern Wirtschaftliche Größe [EGE 1] 80 33 44 Insges. Arbeitskräfte [JAE 2] 2,1 1,9 1,5 Nicht entlohnte Arbeitskräfte [JAE 2] 1,5 1,8 1,5 Landwirtsch. genutzte Fläche [ha] 37,2 37,8 37,5 Gesamtviehbestand [VE 3] 53,1 37,0 54,7 Milchkühe [VE 3] 31,6 20,9 31,3 Milchleistung [kg/Kuh] 6 905 6 789 6 460 Milchproduktion [Tsd. kg] 218 142 202
Europäische Grösseneinheiten
1
Jahresarbeitseinheiten
Vieheinheiten
Bruttoerzeugung und Beihilfen spezialisierter Milcherzeugungsbetriebe mit 30–50 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, 2005–2008
Beihilfen und Steuern (SE600+SE405) Sonstige Bruttoerzeugung (SE256)
Insgesamt Pflanzliche Bruttoerzeugung (SE135)
n Aufwand und Einkommen
Tierische Bruttoerzeugung ohne Milch (SE206–SE216) Kuhmilch und Milch (SE216)
Quellen: EU-Kommission, INLB, ART Zentrale Auswertung
Auch beim Aufwand unterscheiden sich die schweizerischen Betriebe deutlich von ihren Nachbarn. Die Abbildung zeigt den Gesamtaufwand und das erzielte Familienbetriebseinkommen als Resultierende. Die Gesamthöhe der Säulen entspricht der Summe von Bruttoerzeugung plus Beihilfen und Steuern in der ersten Abbildung. Der Gesamtaufwand erreicht in den österreichischen Betrieben 43 % der schweizerischen Betriebe, in den bayerischen Betrieben liegt dieser Wert bei 58 %. Bei allen dargestellten Aufwandpositionen liegen die schweizerischen Betriebe deutlich über den EU-Vergleichsgruppen. Am stärksten fallen die Lohnkosten auf, die bei EU-Betrieben dieser Grösse kaum vorkommen. Auch die Kosten für Pacht- und Schuldzinsen sind in der Schweiz überdurchschnittlich. Der Anteil gepachteter Flächen liegt bei den schweizerischen Betrieben bei rund 60 %, in Bayern bei 50 % und in Österreich bei 28 %. Der Aufwand für Unterhalt von Gebäude und Reparaturen sowie andere Vorleistungen beträgt in den untersuchten schweizerischen Betrieben mindestens das Doppelte der deutschen und österreichischen Nachbarn.
Die Differenz von Bruttoerzeugung inkl. Beihilfen und Gesamtaufwand ergibt das Familienbetriebseinkommen. 2005 betrug es bei den schweizerischen Betrieben 53 000 Euro. Dank vergleichsweise geringen Kosten lag es bei den österreichischen Betrieben bei 34 000 Euro und in Bayern bei 30 000 Euro. Beim Quervergleich ist zu berücksichtigen, dass in der Schweiz aufgrund hoher Konsumentenpreise die Kaufkraft eines Euro um 20 bis 30 % geringer ist als in den für den Vergleich herangezogenen Ländern (Eurostat, 2010). Zu berücksichtigen ist auch, dass die österreichischen Betriebe rund 1,8 nicht entlohnte Arbeitskräfte ausweisen, während das Familienbetriebseinkommen in Deutschland und der Schweiz 1,5 nicht entlohnte Arbeitskräfte entschädigt. Die starken Bewegungen auf den Agrarmärkten führten dazu, dass das Familienbetriebseinkommen in Österreich im Jahr 2008 auf 50 000 Euro anstieg. In Bayern wurde der Höchststand im Jahr 2007 mit 45 000 Euro erreicht, gefolgt von einem sehr starken Einbruch im Jahr 2008 auf 29 000 Euro. In der Schweiz waren die Schwankungen weniger ausgeprägt. 2008 betrug das Familienbetriebseinkommen 59 000 Euro.
214 3.2 Internationale Vergleiche
in Euro / Betrieb
0 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 2005 2006 Schweiz Österreich Bayern 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Aufwand und Familienbetriebseinkommen spezialisierter Milcherzeugungsbetriebe mit 30–50 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, 2005–2008
in Euro / Betrieb
Pacht, Zinsen (SE375+SE380)
Gezahlte Löhne (SE370)
Abschreibungen (SE360)
Andere Vorleistungen (ohne SE 310, SE340)
n Schlussfolgerung
Unterhaltung von Gebäuden und Maschinen (SE340)
Futter für Raufutterfresser (SE310)
Familienbetriebseinkommen (SE420)
Quellen: EU-Kommission, INLB, ART Zentrale Auswertung
Die Analyse zeigt, dass die Schweizer Milchbetriebe in der Grössenklasse 30 bis 50 ha auf der einen Seite deutlich höhere Einnahmen haben, auf der anderen Seite aber auch deutlich höhere Kosten als jene in Österreich und Bayern. Für die höheren Einnahmen sind die höheren Produktepreise und mehr Direktzahlungen, zusätzlich aber auch ein Mehr an Leistungen (mehr Milch, mehr Fleisch) verantwortlich. Deutlich höher sind auch die Kosten. Ein Teil davon ist zurückzuführen auf höhere Preise für die Produktionsmittel, insbesondere für zugekaufte Futtermittel, und für Dienstleistungen (z.B. Unterhalt von Gebäuden, Maschinen, Tierarzttarife) sowie Investitionen in Gebäude, Einrichtungen und Maschinen. Auf der Basis dieser Analyse kann keine Aussage gemacht werden über die Produktivität des Einsatzes von Arbeit, Produktionsmitteln und Kapital. Die Betriebe sind flächenmässig zwar fast gleich gross, ihre Leistungen unterscheiden sich aber beträchtlich. Die Schweizer Betriebe erwirtschaften auch höhere Einkommen. Dies gilt insbesondere, wenn das Einkommen je Familienarbeitskraft betrachtet wird. Die Einkommensdifferenz bewegt sich in der Grössenordnung der Kaufkraftunterschiede, die zwischen der Schweiz auf der einen Seite und Österreich auf der anderen Seite bestehen.
215 3.2 Internationale Vergleiche
0 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 2005 2006 Schweiz Österreich Bayern 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Mitarbeit am Agrarbericht 2011
Projektleitung, Sekretariat
Werner Harder, Alessandro Rossi, Monique Bühlmann
Autoren
n Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Arnaud De Loriol, Simon Hasler, Théodore Muller, Vonimanitra Raharimanga, Frédéric Rothen, Beat Ryser, Beat Sahli, Hans-Ulrich Tagmann, Werner Spycher
Wirtschaftliche Lage
Vinzenz Jung, Werner Harder
Soziales und Gesellschaft
Esther Grossenbacher, Hans Wydler
Ökologie und Ethologie
Brigitte Decrausaz, Daniel Felder, Esther Grossenbacher, Christine Zundel
n Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Jean-Marc Chappuis, Martin Messer
Übergreifende Instrumente
Patrik Aebi, Priska Dittrich, Emanuel Golder, Kilian Greter, Samuel Heger, Jacques Henchoz, Karin Hulliger, Tim Kränzlein, Alessandra Silauri, Barbara Steiner
Milchwirtschaft
Simon Hasler, Théodore Muller
Viehwirtschaft
Simon Hasler, Hanspeter Lüthi, Catherine Marguerat, Théodore Muller, Colette Schmid, Yves Schleppi, Marcel Zingg
Pflanzenbau
Arnaud de Loriol, Hans-Ulrich Tagmann, Michaël Würzner
Direktzahlungen
Thomas Maier, Victor Kessler, Laurent Nyffenegger, Jonas Plattner, Hugo Roggo, Olivier Roux, Daniela Schmied, Patricia Steinmann, Beat Tschumi, Peter Zbinden
216 Mitarbeit am Agrarbericht 2011
Grundlagenverbesserung
Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
René Weber, Gustav Munz, Wilhelm Riedo, Sandra Schärer, Andreas Schild, Christian Flury, Thomas Hersche, Robert Wernli, Andreas Zischg
Landwirtschaftliches Wissen – forschen, beraten, bilden
Anton Stöckli, Urs Gantner, Etel Keller, David Raemy, Jakob Rösch
Produktionsmittel
Doris Bühler
Spezialthemen
Finanzinspektorat
Rolf Enggist
Vernetzung der Agrar-Datenbanken
Wiebke Egli-Schaft, Ines Heer
n Internationale Aspekte
Internationale Entwicklungen
Krisztina Bende, Kilian Greter, Tim Kränzlein, Martin Messer, Corinne Müller, Isabelle Pasche, Hubert Poffet, François Pythoud, Fabian Riesen, Deborah Stotz
Internationale Vergleiche
Alessandro Rossi, Werner Harder, Dierk Schmid
Übersetzungsdienste
Deutsch: Cornelia Heimgartner
Französisch: Elisabeth Tschanz, Odile Derossi, Florent Gonnet, Isabelle Gris, Anne Hegmann, Madeleine Kobel, Martina Novotny
Italienisch: Patrizia Singaram, Francesca De Giovanni, Simona Stückrad
Internet
Denise Kummer
Technische Unterstützung
Hanspeter Leu, Peter Müller
217 Mitarbeit am Agrarbericht 2011
Stichwortverzeichnis
103, 126, 127, 129, 133
16, 67, 163, 170, 172, 173
mit der EU 188
Geflügel 18, 23, 24, 26, 39, 89, 91 Gentechnisch veränderte Organismen 179
Geografische Ursprungsbezeichnung, GUB 101, 102, 185, 190
Gesamteinkommen 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49
Gesamtrechnung, landwirtschaftliche 12, 36, 37
Geschützte geografische Angabe, GGA 101, 102, 185, 190
17, 126, 127, 136, 169
F Familienarbeitskraft 42,
Finanzielle Stabilität
Finanzinspektorat
Flächenbeiträge
Freihandelsabkommen
Fremdkapitalquote 45,
Fremdkosten
G
43, 44
45
180
Forschung
46
42
H Hangbeiträge
139,
Hochstamm-Feldobstbäume 139,
I Importpreisindex
Index der Preise der landwirtschaftlichen
tionsmittel 15 Inlandbeihilfen 104, 110, 178 Innovative Kulturen 110,
Investitionskredite 40,
158, 160 K Kartoffeln 18, 28, 32, 38, 98, 99, 104, 123 Kennzeichnung 95, 101 Konsumentenpreise 9, 15, 22, 207, 210, 211 Kraftfutterverbrauch 65 L Landesindex der Konsumentenpreise 15 M Märkte, öffentliche 115, 117 Marktentlastung 94 Milchmarkt 17, 18, 23, 39, 94, 96, 109, 112 Milchverwertung 20, 109 Mineraldüngerverbrauch 65 N Nebenerwerbsbetriebe 11 Nettounternehmenseinkommen 36, 37, 40 218 Stichwortverzeichnis
Haupterwerbsbetriebe 11 Hecken, Feld- und Ufergehölze
141, 145, 146
143, 145
für Nahrungsmittel 15
Produk-
116
157,
A Absatzförderung 93, 94, 98, 100, 163 Ackerkulturen 28, 76, 122, 142 Ackerschonstreifen 139, 142, 144, 169 Agrarabkommen Schweiz-EU 189, 190 Agrarpolitisches Informationssystem 128 Anbaubeiträge 38, 40, 121 Arbeitsverdienst 42, 44, 48, 51 Ausfuhrbeiträge 107, 191 Ausgleich, ökologischer 139, 153, 156 Ausgleichsflächen, ökologische 64, 139, 144, 145, 156, 164 Aussenhandel 9, 12, 13, 20, 24, 105, 188 Auswertungsplattform Milchdaten, AMD 113 B Beratung 62, 67, 163, 166, 170, 176, 200 Berufsbildung 177, 178 Beschäftigte 10, 11 Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme, BTS 89, 127, 129, 150 Betriebshilfe 40, 157, 161 Bildung 16, 163, 170 Biodiversität 67, 120, 145, 155, 173, 192, 199, 202, 203 Biologischer Landbau 138, 149 Bodennutzung 153, 202 Branchenorganisationen 95, 96, 100 Bruttomarge 27, 35 Bruttowertschöpfung 12, 37, 39 Bundesausgaben 16 Buntbrachen 139, 141, 144 C Cashflow 46 Cashflow-Investitionsverhältnis 46 D Direktzahlungen, allgemeine 125, 127, 133 Direktzahlungen, ökologische 125, 126, 127, 138 E Eiermarkt 23, 115, 118 Eigenkapitalbildung 45, 46, 48, 49 Ein- und Ausfuhrregelungen 105 Einkommen, ausserlandwirtschaftliches 42, 48 Einkommen, landwirtschaftliches 42, 43, 44, 48 Extensive Produktion von Getreide und Raps 126, 127, 129, 148
219 Stichwortverzeichnis V Verarbeitungsbeiträge 92, 114 Verarbeitungsprodukte 17, 103, 107, 117, 188 Vergleichslohn 43 Versteigerungen 100, 101 Verwertungsmassnahmen 111, 117 Viehexport 112 Viehwirtschaft 18, 91, 92, 108, 109 Vorleistungen 34, 35, 36, 37 W Wiesen, extensiv genutzt 135 Wiesen, wenig intensiv genutzt 136, 140 Z Zollkontingent 32, 100 Zolltarifarische Massnahmen 100 O Obstverwertung 17, 122 Ökobeiträge 126, 127, 138, 152 Öko-Qualitätsverordnung 127, 145, 146, 155, 162, 180 P Pachten 37, 40 Pflanzenschutzmittelverkäufe 65 Pflanzliche Produktion 38 Privatverbrauch 46, 48, 49 Produktionswert 18, 38, 39, 40 Produzentenorganisationen 95, 96, 97 Produzentenpreisindex Landwirtschaft 15 Protokoll Nr. 2 191 Q Qualitätseinstufung, neutral 116 Qualitätspolitik 95 Qualitätsstrategie 95, 100, 104, 190 R Rassen, gefährdete 120 Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien, RAUS 150 Rotationsbrachen 139, 141, 144 S Schafwollverwertung 118 Schlachtvieh 17, 26, 27, 114, 116, 117 Schoggigesetz 17, 107, 108, 191 Schuldzinsen 40, 42, 214 Schwellenpreis-System 30 Selbsthilfemassnahmen 94 Selbstversorgungsgrad, brutto 14, 15 Selbstversorgungsgrad, netto 14, 15 Spezialkulturen 31, 42, 117, 145, 152, 174 Streueflächen 132, 135, 136, 140, 141, 142, 145 Strukturverbesserungen 153, 154, 161 T Tierbestand 130 Tierhaltungsprogramme 89 Tierische Produktion 37 Tierverkehr 112 Tierverkehr-Datenbank 109, 112, 130 Tierzucht 113, 153 U Umweltschonende Bewirtschaftung 68, 122
220
A1 Anhang Anhang n Tabellen A2 Strukturen A2 Märkte A3 Wirtschaftliche Ergebnisse A14 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung A14 Betriebsergebnisse A16 Ausgaben des Bundes A27 Ausgaben für Produktion und Absatz A27 Ausgaben Absatzförderung A27 Ausgaben Milchwirtschaft A28 Ausgaben Viehwirtschaft A28 Ausgaben Tierzucht A29 Ausgaben Pflanzenbau A30 Ausgaben für Direktzahlungen A31 Ausgaben für Grundlagenverbesserung A52 Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung A58 n Rechtserlasse, Begriffe und Methoden A59 n Abkürzungen A60 n Literatur A62
Tabellen
Strukturen
Tabelle 1
Entwicklung von Landwirtschaftsbetrieben, Landwirtschaftlicher Nutzfläche und
Tabelle 2
Entwicklung der Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft
A2 Anhang
Grossvieheinheiten Grössenklassen in ha Betriebe Landwirtschaftliche Nutzfläche Grossvieheinheiten landwirtschaftlicher Nutzfläche 2000 2009 2010 2000 2009 2010 2000 2009 2010 Anzahl Anzahl Anzahl ha ha ha Anzahl Anzahl Anzahl 0-1 3 609 2 911 2 999 1 336 959 895 61 016 60 210 64 784 1-3 4 762 3 739 3 660 8 861 6 919 6 756 14 753 11 914 11 598 3-5 5 393 3 477 3 375 21 348 13 947 13 514 27 714 18 787 18 096 5-10 13 149 9 669 9 280 99 056 73 025 70 209 127 361 93 356 89 289 10-15 13 812 10 561 10 263 171 817 131 833 128 251 230 628 176 603 172 489 15-20 11 172 9 303 9 042 193 856 161 778 157 345 247 517 217 470 209 628 20-25 7 244 6 794 6 761 161 311 151 546 150 911 191 057 193 721 195 613 25-30 4 430 4 759 4 671 121 005 130 219 127 924 130 901 155 683 154 457 30-40 4 168 4 889 4 951 142 266 167 215 169 252 142 628 185 676 189 651 40-50 1 591 2 048 2 099 70 501 90 905 93 217 61 914 92 355 94 476 50-70 921 1 370 1 422 52 672 79 009 82 127 42 707 76 811 80 835 70-100 209 407 423 17 021 32 871 34 239 13 290 29 670 30 605 >100 77 107 119 11 444 15 421 17 107 8 025 11 869 14 144 Total 70 537 60 034 59 065 1 072 492 1 055 649 1 051 747 1 299 512 1 324 124 1 325 666 Quelle: BFS
Kategorie Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte Total 2000 2009 2010 2000 2009 2010 2000 2009 2010 Betriebsleiter Männer 49 339 38 373 37 638 25 385 18 763 18 600 74 724 57 136 56 238 Frauen 524 1 022 1 009 1 822 1 876 1 818 2 346 2 898 2 827 Andere Familieneigene Männer 8 749 9 426 9 229 18 212 19 759 19 351 26 961 29 185 28 580 Frauen 14 281 8 765 8 411 47 665 40 876 40 153 61 946 49 641 48 564 Familieneigene total 72 893 57 586 56 287 93 084 81 274 79 922 165 977 138 860 136 209 Familienfremde Schweizer/innen Männer 10 836 7 826 7 917 5 125 3 959 3 820 15 961 11 785 11 737 Frauen 2 592 2 044 1 906 4 194 3 498 3 622 6 786 5 542 5 528 Ausländer/innen Männer 8 061 6 293 6 469 3 454 3 015 3 174 11 515 9 308 9 643 Frauen 1 613 1 731 1 760 1 941 2 562 2 585 3 554 4 293 4 345 Familienfremde total 23 102 17 894 18 052 14 714 13 034 13 201 37 816 30 928 31 253 Beschäftigte total 95 995 75 480 74 339 107 798 94 308 93 123 203 793 169 788 167 462 Quelle: BFS
nach
A3 Anhang Märkte Tabelle 3
Produkt 2000/02 2008 2009 2010 1 2000/02–2008/10 ha ha ha ha % Getreide 178 576 156 105 152 842 151 513 -14.0 Brotgetreide 96 527 84 328 86 692 86 341 -11.1 Weizen 91 045 79 255 80 798 79 853 -12.2 Dinkel 1 878 2 822 3 288 4 136 81.8 Emmer, Einkorn 46 210 84 82 172.8 Roggen 3 518 2 014 2 495 2 248 -36.0 Mischel von Brotgetreide 39 27 27 22 -35.6 Futtergetreide 82 049 71 776 66 150 65 171 -17.5 Weizen - 9 178 7 132 7 057 Gerste 42 916 32 958 30 891 28 949 -27.9 Hafer 4 342 1 861 1 917 1 789 -57.3 Mischel von Futtergetreide 311 218 189 170 -38.1 Körnermais 22 280 17 593 16 713 16 898 -23.4 Triticale 12 201 9 969 9 279 10 274 -19.3 Hirse - - 30 34 Hülsenfrüchte 3 514 4 604 4 035 3 816 18.1 Futtererbsen (Eiweisserbsen) 3 165 4 291 3 715 3 483 21.0 Ackerbohnen 294 245 259 274 -12.0 Lupinen 55 68 62 59 14.6 Hackfrüchte 34 229 32 600 32 411 29 640 -7.8 Kartoffeln (inkl. Saatgut) 13 799 11 058 11 215 10 874 -19.9 Zuckerrüben 17 886 20 469 20 191 17 842 9.0 Futterrüben (Runkeln, Halbzuckerrüben) 2 544 1 072 1 004 924 -60.7 Ölsaaten 18 535 24 440 25 020 25 393 34.6 Raps 13 126 19 203 20 259 20 731 52.9 Sonnenblumen 4 389 4 218 3 633 3 544 -13.5 Soja 989 997 1 108 1 087 7.6 Ölkürbisse 32 22 20 31 -23.1 Nachwachsende Rohstoffe 1 304 1 486 1 204 1 100 -3.1 Raps 1 137 1 455 1 175 1 075 8.6 Sonnenblumen 35 19 21 19 -43.5 Andere (Kenaf, Hanf, usw.) 132 12 8 7 -93.2 Freilandgemüse 8 489 9 676 9 548 9 460 12.6 Silo- und Grünmais 40 652 44 735 46 126 46 759 12.8 Grün- und Buntbrache 3 392 2 792 2 414 2 385 -25.4 Übrige offene Ackerfläche 1 770 1 793 1 801 1 902 3.5 Offenes Ackerland 290 462 278 230 275 401 271 968 -5.3 Kunstwiesen 117 671 127 259 129 460 131 401 9.9 Übrige Ackerfläche 2 427 1 935 1 176 1 153 -41.4 Ackerland Total 410 560 407 423 406 037 404 522 -1.1 Obstbaumkulturen 6 756 6 543 6 596 6 624 -2.5 Reben 15 048 14 841 14 820 14 942 -1.2 Chinaschilf 257 231 229 224 -11.3 Naturwiesen, Weiden 627 938 617 481 614 553 611 884 -2.1 Andere Nutzung sowie Streue- und Torfland 10 572 11 615 13 449 13 551 21.7 Landwirtschaftliche Nutzfläche 1 071 131 1 058 134 1 055 684 1 051 747 -1.5 1 provisorisch Quellen: Reben und Obstbaumkulturen: BLW; andere Produkte: SBV, BFS
Landwirtschaftliche Nutzfläche
Nutzungsarten
A4 Anhang
4 Nutztierhalter und Nutztierbestände 2000/02 2008 2009 2010 2000/02–2008/10 Stk. Stk. Stk. Stk. % Nutztierhalter Viehhalter 58 602 51 640 50 714 50 018 -13.3 Rindviehhalter 49 598 42 937 41 903 41 095 -15.4 Pferdehalter 10 564 9 906 9 683 9 621 -7.8 Schweinehalter 14 656 9 564 9 126 8 848 -37.4 Schafhalter 12 158 10 541 10 035 9 779 -16.8 Ziegenhalter 6 977 6 613 7 190 6 976 -0.7 Nutzhühnerhalter 19 943 14 660 13 784 13 500 -29.9 Bestände Rindvieh 1 597 684 1 604 287 1 597 484 1 591 233 0.0 davon Kühe 716 784 726 875 707 742 700 315 -0.7 Pferde 50 566 58 969 60 156 62 113 19.5 Schweine 1 534 217 1 540 129 1 557 204 1 588 998 1.8 Schafe 423 413 446 153 431 889 434 083 3.3 Ziegen 63 828 81 445 85 131 86 987 32.4 Nutzhühner 6 934 609 8 474 239 8 741 117 8 943 676 25.7 davon Lege- und Zuchthennen 2 124 632 2 254 875 2 318 296 2 438 051 10.0 Quelle: BFS, Daten für Rindvieh 2009 und 2010 aus der Tierverkehr-Datenbank
Tabelle
1 provisorisch
2 Durchschnitt der Jahre 2000/03
3 Veränderung 2000/03–2007/10
Quellen:
Milch und -produkte: TSM
Fleisch: Proviande
Eier: Aviforum
Getreide, Hackfrüchte, Ölsaaten: SBV
Obst: Schweizerischer Obstverband, Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein: BLW, Kantone
A5 Anhang Tabelle 5 Produktion Produkt Einheit 2000/02 2008 2009 2010 2000/02–2008/10 % Milch und -produkte Konsummilch t 505 764 488 397 491 546 493 181 -2.9 Rahm t 68 213 67 575 68 173 68 022 -0.4 Butter t 40 247 45 763 47 895 48 511 17.7 Milchpulver t 47 152 54 128 60 467 57 213 21.5 Käse t 166 668 179 338 178 276 181 329 7.8 Fleisch und Eier Rindfleisch t SG 110 111 105 143 109 360 111 216 -1.4 Kalbfleisch t SG 34 202 30 251 32 238 31 673 -8.2 Schweinefleisch t SG 231 645 231 013 237 884 249 470 3.4 Schaffleisch t SG 5 787 5 394 5 365 5 477 -6.5 Ziegenfleisch t SG 534 539 493 498 -4.5 Pferdefleisch t SG 1 164 729 802 748 -34.7 Geflügel t Verkaufsgewicht 29 435 40 816 41 726 44 050 43.4 Schaleneier Mio. St. 689 686 718 752 4.3 Getreide 1 112 267 1 001 700 1 005 800 923 600 1 -12.2 Brotweizen t 521 667 451 100 467 800 448 800 1 -12.6 Futterweizen t - 85 900 69 200 58 700 1Roggen t 20 833 12 100 15 900 13 700 1 -33.3 Gerste t 255 500 200 300 198 100 174 100 1 -25.3 Hafer t 22 533 9 500 10 500 8 900 1 -57.2 Körnermais t 206 333 170 700 174 000 143 500 1 -21.1 Triticale t 75 067 58 900 56 300 58 300 1 -23.0 Andere t 10 333 13 200 14 000 17 600 1 44.5 Hackfrüchte Kartoffeln t 539 933 473 000 522 000 421 000 1 -12.6 Zuckerrüben t 1 288 852 1 625 219 1 719 707 1 302 055 1 20.2 Ölsaaten 59 956 77 064 82 153 81 983 1 34.1 Raps t 43 684 62 100 67 000 67 900 1 50.3 Sonnenblumen t 12 972 11 700 11 800 10 600 1 -12.4 Andere t 3 300 3 264 3 353 3 483 1 2.0 Obst (Tafel) Äpfel t 99 540 2 94 367 119 910 100 300 6.4 3 Birnen t 15 523 2 9 898 22 330 13 200 3.4 3 Aprikosen t 1 485 2 4 280 6 730 5 705 257.8 3 Kirschen t 1 810 2 1 308 2 225 1 960 6.3 3 Zwetschgen t 2 418 2 2 307 3 446 2 716 26.0 3 Erdbeeren t 5 064 5 181 5 199 5 663 5.6 Gemüse (frisch) Karotten t 56 474 61 673 74 263 62 638 17.2 Zwiebeln t 26 126 29 033 37 895 32 716 27.1 Knollensellerie t 10 359 8 927 11 203 9 796 -3.7 Tomaten t 30 398 39 806 40 945 42 979 35.7 Kopfsalat t 16 514 13 381 13 475 13 268 -19.0 Blumenkohl t 6 474 7 166 6 793 7 180 8.8 Gurken t 8 823 10 224 11 057 10 968 21.8 Wein Rotwein hl 574 245 578 948 586 775 533 792 -1.3 Weisswein hl 613 076 495 520 526 767 497 146 -17.4
A6 Anhang
6
Milchprodukte Produkt 2000/02 2008 2009 2010 2000/02 –2008/10 t t t t % Total Käse 166 668 179 338 178 276 181 329 7.8 Frischkäse 35 832 42 620 43 644 44 920 22.0 Mozzarella 12 208 17 183 17 176 18 820 45.2 Übrige Frischkäse 23 624 25 437 26 468 26 100 10.1 Weichkäse 6 848 7 181 7 378 7 874 9.2 Tomme 1 229 2 283 2 043 2 030 72.3 Weissschimmelkäse, halb- bis vollfett 2 122 1 234 751 1 358 -47.5 Übrige Weichkäse 3 497 3 664 4 584 4 486 21.4 Halbhartkäse 47 176 55 650 56 561 57 664 20.0 Appenzeller 8 505 8 925 8 853 9 113 5.4 Tilsiter 6 135 4 177 3 873 3 812 -35.5 Raclettekäse 11 871 11 540 11 211 11 744 -3.1 Übrige Halbhartkäse 20 665 31 008 32 624 32 995 55.9 Hartkäse 76 215 72 809 69 572 69 765 -7.2 Emmentaler 42 171 28 831 25 723 27 059 -35.5 Gruyère 26 072 28 207 28 420 28 166 8.4 Sbrinz 2 940 2 129 1 863 1 857 -33.7 Übrige Hartkäse 5 032 13 642 13 566 12 683 164.2 Spezialprodukte 1 663 1 079 1 121 1 106 66.2 Total Frischmilchprodukte 704 033 763 649 760 427 754 884 7.9 Konsummilch 505 764 488 397 491 546 493 181 -2.9 Übrige 198 270 275 252 268 881 261 703 35.5 Total Butter 40 247 45 763 47 895 48 511 17.7 Total Rahm 68 213 67 575 68 173 68 022 -0.4 Total Milchpulver 47 152 54 128 60 467 57 213 21.5 1 reiner Schafkäse und reiner Ziegenkäse Quelle: TSM Tabelle 7 Milchverwertung nach Inhaltsstoffen (Milchäquivalent; MAQ) Produkt 2000/02 2008 2009 2010 2000/02 –2008/10 % Käse 1 375 908 1 443 644 1 429 872 1 453 442 4.8 Quark 19 366 16 855 16 808 15 999 -14.5 Konsummilch 459 605 438 267 425 410 422 867 -6.7 Konsumrahm 258 197 258 686 262 261 266 864 1.7 Jogurt 70 003 115 435 114 997 114 555 64.3 übrige Frischmilchprodukte (inkl. Speiseeis) 84 282 109 295 99 010 98 429 21.3 Dauermilchwaren 331 579 361 144 367 990 367 795 10.3 Butter 476 737 550 636 572 021 580 541 19.1 andere Verwertung 122 375 129 086 126 983 117 130 1.7 1 MAQ entspricht 1 kg Milch mit 7,3% Fett- und Proteinanteil Quelle: TSM
Tabelle
Produktion
Tabelle 8
Verwertung der Ernte im Pflanzenbau
A7 Anhang
Produkt 2000/02 2008 2009 2010 2000/02 –2008/10 t t t t % Kartoffeln - 473 400 521 000 421 000 1Speisekartoffeln 169 433 185 100 187 600 183 000 1 9.3 Veredlungskartoffeln 127 500 142 000 148 100 154 000 1 16.1 Saatgut 28 300 24 500 24 400 24 000 1 -14.1 Frischverfütterung 143 067 116 000 161 000 60 000 1 -21.5 Verarbeitung zu Futtermitteln 71 633 300 0 0 1 -99.9 Schweizer Mostäpfel und -birnen (Verarbeitung in gewerblichen Mostereien) 151 950 2 114 879 117 238 75 722 -22.5 3 Mostobst-Menge für Rohsaft 151 746 2 114 850 117 226 75 710 -22.5 3 Frisch ab Presse 9 376 2 7 941 8 146 7 756 -15.1 3 Obstwein zur Herstellung von Obstbrand 418 2 4 4 26 -97.9 3 Konzentratsaft 140 271 2 102 737 109 012 66 144 -23.5 3 Andere Säfte (inkl. Essig) 1 682 2 4 168 64 1 784 39.2 3 Obst eingemaischt 204 2 29 12 12 -65.9 3 Spirituosenerzeugung aus Schweizer Äpfel und Birnen 21 079 2 13 163 10 061 14 693 -39.5 3 aus Schweizer Kirschen und Zwetschgen 12 137 2 11 473 7 392 10 641 -17.1 3 Schweizer Frischgemüse für Nährmittelherstellung Tiefkühlgemüse 25 157 24 268 30 942 32 504 16.2 Konservengemüse (Bohnen, Erbsen, Pariserkarotten) 14 607 15 828 13 877 12 915 -2.7 Sauerkraut (Einschneidekabis) 6 410 5 570 3 716 5 561 -22.8 Sauerrüben (Rübe) 1 059 641 498 494 -48.6 1 provisorisch 2 Durchschnitt der Jahre 2000/03 3 Veränderung 2000/03–2007/10 Quellen: Kartoffeln: swisspatat Mostobst: BLW; Spirituosen: Eidgenössische Alkoholverwaltung Verarbeitungsgemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
1 Durchschnitt der Jahre 2000/03
2 Veränderung 2000/03–2007/10
3 Tarifnummer 0206
Quellen: Milch und -produkte, Fleisch, Schlachtnebenprodukte, Eier, Getreide, Hackfrüchte, Ölsaaten, Obst, Gemüse und Wein: OZD Zucker: réservesuisse
A8
Produkt 2000/02 2008 2009 2010 2000/02 –2008/10 t t t t % Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Milch und -produkte Milch 19 22 919 404 23 074 368 23 443 266 23 141 1 721.1 1.3 Jogurt 3 494 148 6 411 8 166 5 509 9 765 6 905 10 635 79.6 6 333.8 Rahm 918 246 3 022 1 905 5 354 1 401 2 794 1 986 305.4 616.1 Butter 447 4 960 19 296 4 201 55 4 145 220 523.3 -96.2 Milchpulver 11 688 1 076 8 450 2 731 28 733 3 192 23 443 1 234 72.9 121.8 Käse und Quark 52 295 31 087 56 143 41 081 57 014 44 101 58 379 46 892 9.3 41.6 Fleisch, Eier und Fische Rindfleisch 876 7 854 1 503 22 282 1 613 15 827 1 884 18 891 90.2 141.9 Kalbfleisch 0 1 115 0 795 0 331 0 746 - -44.0 Schweinefleisch 249 9 753 543 22 017 575 13 993 620 12 765 132.7 66.7 Schaffleisch 0 6 940 5 5 848 3 5 646 5 5 750 - -17.2 Ziegenfleisch 0 358 0 301 0 267 0 304 - -18.8 Pferdefleisch 0 4 117 0 4 958 0 4 745 0 4 872 - 18.0 Geflügel 331 42 770 62 55 421 120 56 428 236 53 933 -58.0 29.2 Schlachtnebenprodukte 3 1 552 6 934 15 793 21 723 20 809 18 360 21 467 15 025 1 147.2 164.9 Eier 0 24 839 3 34 370 27 33 562 12 34 336 - 37.2 Fische, Krebs- und Weichtiere 96 56 228 218 65 714 249 68 152 142 69 023 111.4 20.3 Getreide Weizen 74 284 629 1 170 403 022 173 377 001 197 336 015 591.8 30.7 Roggen 1 7 250 122 4 000 0 3 649 67 4 719 6 290.6 -43.1 Gerste 11 52 079 348 71 697 233 30 937 250 71 357 2 427.0 11.4 Hafer 5 540 50 469 9 60 397 1 43 781 23 56 391 -99.8 6.1 Körnermais 196 26 496 216 118 658 96 67 465 104 96 419 -29.3 255.5 Hackfrüchte Kartoffeln 3 313 30 709 852 33 243 1 498 27 941 499 23 573 -71.3 -8.0 Zucker 152 572 188 008 281 040 244 119 200 503 174 981 99 996 84 438 27.1 -10.7 Ölsaaten Ölsaaten 699 105 697 756 67 836 910 58 639 799 60 004 17.6 -41.2 Pflanzliche Öle und Fette 7 327 95 762 4 033 128 732 3 797 128 711 4 460 124 943 -44.1 33.1 Obst (frisch) Äpfel 1 342 1 8 595 1 1 504 9 169 730 9 477 689 7 503 -1.6 2 -8.2 2 Birnen 119 1 8 786 1 243 8 025 158 13 744 135 9 037 116.6 2 16.8 2 Aprikosen 26 1 9 155 1 75 6 666 166 6 766 121 7 030 291.4 2 -29.9 2 Kirschen 7 1 1 104 1 11 1 461 10 1 202 13 1 645 188.9 2 18.0 2 Zwetschgen und Pflaumen 8 1 5 254 1 32 6 677 30 7 085 73 7 926 425.0 2 25.4 2 Erdbeeren 22 11 240 36 11 716 0 13 043 58 13 503 40.9 13.5 Trauben 10 38 448 490 36 970 286 34 286 181 35 109 2 987.1 -7.8 Zitrusfrüchte 41 124 102 424 125 200 120 129 082 255 130 556 549.6 3.4 Bananen 1 73 363 4 82 125 1 80 772 8 79 889 336.7 10.3 Gemüse (frisch) Karotten 26 6 739 132 5 970 1 216 2 458 64 5 626 1 687.3 -30.5 Zwiebeln 51 6 432 2 7 095 1 3 822 581 3 277 284.2 -26.4 Knollensellerie 0 287 0 334 0 147 0 130 - -29.0 Tomaten 25 42 449 61 39 897 162 39 918 115 39 155 356.8 -6.6 Kopfsalat 3 2 537 3 2 860 6 2 945 4 3 460 30.0 21.7 Blumenkohl 1 9 067 53 9 708 48 9 260 27 9 067 4 166.7 3.1 Gurken 21 17 046 58 14 346 58 15 473 33 16 397 140.3 -9.6 Wein (Trinkwein) Rotwein (in hl) 6 585 1 417 802 13 369 1 307 144 13 247 1 360 033 14 231 1 368 625 106.8 -5.1 Weisswein (in hl) 5 997 214 349 5 391 296 573 5 422 299 130 5 998 314 033 -6.6 41.5
Anhang Tabelle 9 Aussenhandel
A9 Anhang Tabelle 10 Aussenhandel Käse Produkt 2000/02 2008 2009 2010 2000/02 –2008/10 t t t t % Einfuhr Frischkäse 1 8 644 13 568 15 282 17 416 78.4 Reibkäse 2 420 972 1 088 1 195 158.5 Schmelzkäse 3 2 413 2 118 2 906 3 260 14.4 Schimmelkäse 4 2 321 2 220 2 159 2 146 -6.3 Weichkäse 5 5 731 7 630 8 308 8 191 40.3 Halbhartkäse 6 4 400 7 174 7 086 7 199 62.6 Hartkäse 7 7 158 7 399 7 272 7 485 3.2 Total Käse und Quark 31 087 41 081 44 101 46 892 41.6 Ausfuhr Frischkäse 1 52 2 183 2 935 4 617 6 140.4 Reibkäse 2 99 113 165 147 43.1 Schmelzkäse 3 5 259 4 083 3 627 2 902 -32.7 Schimmelkäse 4 11 16 14 12 23.5 Weichkäse 5 109 816 1 432 1 743 1 120.5 Halbhartkäse 6 7 361 12 420 13 752 13 296 78.7 Hartkäse 7 39 404 36 512 35 089 35 662 -9.3 Total Käse und Quark 52 296 56 143 57 014 58 379 9.3 1 0406.1010, 0406.1020, 0406.1090 2 0406.2010, 0406.2090 3 0406.3010, 0406.3090 4 0406.4010, 0406.4021, 0406.4029, 0406.4081, 0406.4089 5 0406.9011, 0406.9019 6 0406.9021, 0406.9031, 0406.9051, 0406.9091 7 0406.9039, 0406.9059, 0406.9060, 0406.9099 Quelle: OZD
Tabelle 11
Pro-Kopf-Konsum
1 teilweise provisorisch
2 Durchschnitt der Jahre 2000/03
3 Veränderung 2000/03–2007/10
4 Zahlen werden Ende 2011 publiziert
5 Veränderung 2000/02–2007/09
Quellen: Milch und -produkte, Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV
Eier: Aviforum
Fleisch: Proviande Getreide, Obst, Gemüse und Wein: BLW
A10
Anhang
Produkt 2000/02 2008 2009 2010 1 2000/02 –2008/10 kg kg kg kg % Milch und -produkte Konsummilch, Trinkmilch 84.63 75.70 73.30 70.70 -13.5 Milchgetränke 3.53 10.10 9.10 8.20 158.5 Jogurt 16.57 18.40 18.50 18.20 10.9 Butter 5.93 5.70 5.40 5.40 -7.3 Rahm 9.27 8.40 8.20 8.30 -10.4 Käse und Schmelzkäse 19.63 21.20 21.40 21.50 8.8 Fleisch und Eier Rindfleisch 10.22 11.32 10.99 11.20 9.3 Kalbfleisch 3.86 3.12 3.23 3.15 -18.0 Schweinefleisch 25.39 25.14 24.62 25.33 -1.4 Schaffleisch 1.51 1.26 1.22 1.23 -18.1 Ziegenfleisch 0.11 0.09 0.08 0.09 -21.2 Pferdefleisch 0.64 0.68 0.66 0.66 4.2 Geflügel 9.28 10.90 10.79 11.00 17.4 Schaleneier (in St.) 188 186 187 189 -0.4 Getreide Brot- und Backwaren 51.13 49.90 49.10 49.30 -3.3 Hackfrüchte Kartoffeln und Kartoffelprodukte 43.43 46.35 45.63 4 2.1 5 Zucker (inkl. Zucker in Verarbeitungsprodukten) 40.48 42.19 40.46 4 3.1 5 Ölsaaten Pflanzliche Öle und Fette 14.98 18.59 18.78 4 21.7 5 Obst (Tafel) Äpfel 14.7 2 13.25 16.53 13.76 -0.8 3 Birnen 3.33 2 2.30 4.61 2.84 1.5 3 Aprikosen 1.46 2 1.41 1.71 1.62 2.9 3 Kirschen 0.4 2 0.36 0.44 0.46 3.8 3 Zwetschgen und Pflaumen 1.06 2 1.16 1.35 1.36 17.8 3 Erdbeeren 2.25 2.19 2.34 2.45 3.4 Zitrusfrüchte 17.15 16.20 16.57 16.74 -3.8 Bananen 10.14 10.66 10.38 10.26 2.9 Gemüse (frisch) Karotten 8.73 8.77 9.70 8.76 4.0 Zwiebeln 4.49 4.69 5.36 4.55 8.3 Knollensellerie 1.47 1.20 1.46 1.27 -10.9 Tomaten 10.07 10.34 10.37 10.53 3.4 Kopfsalat 2.63 2.11 2.11 2.15 -19.4 Blumenkohl 2.15 2.18 2.06 2.08 -2.0 Gurken 2.81 3.02 3.11 3.31 11.8 Wein Rotwein (in l) 28.28 25.29 24.92 24.50 -11.9 Weisswein (in l) 12.45 11.11 10.88 11.10 -11.4 Wein total (in l) 40.73 36.40 35.80 35.60 -11.8
1 Durchschnitt der Jahre 2000/03
2 Veränderung 2000/03–2007/10
3 Preise franko Schlachthof, ausgenommen Fleischschweine ab Hof; Preise ab 2006 für Tiere aus dem Programm Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch
4 Vergleichbare Preise 2000–2002 wurden nicht erhoben
5 Preis gilt nicht für Übermengen
6 Kein definitiver Richtpreis
Quellen:
Milch und Eier: BLW
Schlachtvieh: Proviande
Getreide, Hackfrüchte und Ölsaaten: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Obst: Schweizerischer Obstverband und Interprofession des fruits et légumes du Valais; es handelt sich um definitive Produzenten-Richtpreise
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau; Es handelt sich um Richtpreise auf Stufe franko Grossverteiler.
A11 Anhang Tabelle 12
Produkt Einheit 2000/02 2008 2009 2010 2000/02 –2008/10 % Milch CH gesamt Rp./kg 79.23 77.65 64.78 61.79 -14.1 Verkäste Milch Rp./kg 79.14 77.88 68.12 67.07 -10.3 Biomilch Rp./kg 94.18 86.12 77.50 74.72 -15.6 Schlachtviehh 3 und Eier 4 Kühe T3 Fr./ kg SG 5.18 7.08 6.63 6.36 29.2 Jungkühe T3 Fr./ kg SG 6.28 7.60 7.12 6.90 14.8 Muni T3 Fr./ kg SG 7.64 8.93 8.09 8.16 9.8 Ochsen T3 Fr./ kg SG 7.40 8.93 8.07 8.14 13.2 Rinder T3 Fr./ kg SG 7.39 8.90 8.07 8.11 13.1 Kälber T3 Fr./ kg SG 12.31 14.57 13.28 13.48 11.9 Fleischschweine Fr./ kg SG 4.57 4.97 4.31 3.80 -4.5 Lämmer bis 40 kg, T3 Fr./ kg SG 12.53 11.34 10.29 9.71 -16.6 Eier aus Bodenhaltung Rp./St. - 22.73 22.85 21.98Eier aus Freilandhaltung Rp./St. - 23.46 23.64 23.06Getreide Weizen Fr./100 kg 59.54 60.50 49.05 46.71 -12.5 Roggen Fr./100 kg 49.98 53.89 40.20 39.23 -11.1 Gerste Fr./100 kg 46.16 40.86 37.31 36.77 -17.0 Hafer Fr./100 kg 46.20 46.97 44.77 41.54Triticale Fr./100 kg 46.95 40.90 36.28 36.19 -19.5 Körnermais Fr./100 kg 45.38 41.73 36.96 36.01 -15.8 Hackfrüchte Kartoffeln Fr./100 kg 35.52 40.68 34.40 38.49 6.6 Zuckerrüben Fr./100 kg 12.21 10.56 8.39 8.50 -25.1 Ölsaaten Raps Fr./100 kg 69.94 103.04 81.09 80.41 26.1 Sonnenblumen Fr./100 kg 78.45 103.66 87.10 87.45 18.2 Obst Äpfel: Golden Delicious, Klasse I Fr./ kg 0.98 1 1.11 5 0.9 5 0.93 5 -2.3 2 Äpfel: Maigold, Klasse I Fr./ kg 0.77 1 1.16 5 0.9 5 0.6 6 15.9 2 Birnen: Conférence, Klasse I Fr./ kg 1.05 1 1.42 5 0.99 5 1.41 5 12.6 2 Aprikosen, alle Klassen Fr./ kg 2.69 1 2.92 2.55 2.73 -0.1 2 Kirschen, Klasse I Fr./ kg 3.4 1 3.80 3.70 3.70 6.6 2 Zwetschgen, Klasse I, 33 mm Fr./ kg 1.75 1 2.10 1.80 2.00 10.0 2 Erdbeeren Fr./ kg 5.03 5.80 6.40 6.20 21.9 Gemüse Karotten (Lager) Fr./ kg 1.21 1.63 1.26 1.44 19.3 Zwiebeln (Lager) Fr./ kg 1.14 1.60 1.09 1.30 16.7 Knollensellerie (Lager) Fr./ kg 1.86 2.72 1.87 2.58 28.3 Tomaten rund Fr./ kg 2.12 2.55 2.38 2.78 21.0 Kopfsalat Fr./ St. 0.94 1.14 1.14 1.24 24.8 Blumenkohl Fr./ kg 2.06 2.68 2.50 2.69 27.3 Salatgurken Fr./ St. 1.01 1.21 1.15 1.23 18.5
Produzentenpreise
Tabelle 13
Konsumentenpreise
1 Durchschnitt der Jahre 2000/03
2 Veränderung 2000/03–2007/10
3 Vergleichbare Preise 2000–2002 wurden nicht erhoben
4 ab 1.1.2009
Quellen: Milch, Eier, Fleisch (Warenkorb aus Labelfleisch und konventionell produziertem Fleisch), Obst und Gemüse: BLW
Kartoffeln und Kristallzucker: BFS, andere pflanzliche Produkte: BLW seit 2006
A12 Anhang
Produkt Einheit 2000/02 2008 2009 2010 2000/02 –2008/10 % Milch und -produkte Vollmilch, pasteurisiert,verpackt Fr./l 1.55 1.48 1.36 1.41 -8.8 Standardisierte Vollmilch UHT 35 g 4) Fr./l 1.36 1.31Milchdrink, pasteurisiert, verpackt Fr./l 1.55 1.49 1.38 1.40 -8.2 Magermilch UHT Fr./l 1.44 1.54 1.52 1.49 5.3 Emmentaler Fr./kg 20.37 20.06 20.88 20.28 0.2 Greyerzer Fr./kg 20.47 20.16 20.70 20.63 0.1 Tilsiter Fr./kg 17.66 17.52 17.78 17.49 -0.3 Camembert 60 % (FiT) 125 g 2.68 2.80 2.60 2.57 -1.0 Weichkäse Schimmelreifung 150 g 3.50 3.61 3.37 3.36 -1.5 Mozzarella 45 % (FiT) 150 g 2.35 1.91 1.81 1.81 -21.4 Vorzugsbutter 200 g 3.10 2.97 2.99 2.96 -4.0 Die Butter (Kochbutter) 250 g 3.01 2.98 3.14 3.11 2.2 Vollrahm, verpackt 1/2 l 4.89 3.68 3.58 3.46 -26.9 Kaffeerahm, verpackt 1/2 l 2.52 2.09 2.07 2.00 -18.4 Joghurt, aromatisiert oder mit Früchten 180 g 0.69 0.68 0.67 0.64 -4.3 Rindfleisch Entrecôte, geschnitten Fr./kg 49.80 62.18 62.90 62.88 25.8 Plätzli, Eckstück Fr./kg 38.77 46.76 46.82 46.18 20.2 Braten, Schulter Fr./kg 26.68 30.28 30.94 30.62 14.7 Hackfleisch Fr./kg 15.47 18.68 19.16 19.01 22.5 Kalbfleisch Koteletten, geschnitten Fr./kg 40.89 51.52 50.87 49.69 24.0 Braten, Schulter Fr./kg 34.44 39.08 38.54 37.59 11.5 Voressen Fr./kg 28.68 34.53 34.08 33.74 19.0 Schweinefleisch Koteletten, geschnitten Fr./kg 20.31 23.04 21.22 19.61 4.8 Plätzli, Eckstück Fr./kg 26.06 28.64 28.88 26.97 8.1 Braten, Schulter Fr./kg 19.09 20.66 21.08 19.05 6.2 Voressen, Schulter Fr./kg 18.02 19.59 20.29 18.26 7.5 Lammfleisch Inland frisch Gigot ohne Schlossbein Fr./kg 27.85 30.90 32.58 32.89 15.4 Koteletten, geschnitten Fr./kg 34.21 47.34 50.27 49.57 43.4 Fleischwaren Hinterschinken, Model geschnitten Fr./kg 28.62 33.02 33.39 30.82 13.2 Salami Inland I, geschnitten Fr./100 g 3.82 4.87 5.21 5.09 32.2 Poulets Inland, frisch Fr./kg 8.99 9.79 9.64 9.66 7.8 Eier 3 Eier aus Bodenhaltung Rp./St. - 48 49 48Eier aus Freilandhaltung Rp./St. - 63 64 63Pflanzenbau und pflanzliche Produkte Ruchbrot Fr./500 g - 2.05 2.05 -Halbweissbrot Fr./500 g - 1.78 1.79 -Weggli / Semmel Fr./kg - 11.66 12.21 -Gipfeli Fr./kg - 18.05 19.26 -Kartoffeln Fr./kg 1.99 2.38 2.51 2.69 26.8 Kristallzucker Fr./kg 1.43 1.93 1.65 1.38 15.3 Obst (Herkunft In- und Ausland) Äpfel: Golden Delicious, Klasse I Fr./kg 3.57 1 3.75 3.86 3.34 2.6 2 Birnen, Klasse I Fr./kg 3.53 1 4.00 4.06 3.88 11.1 2 Aprikosen, Klasse I Fr./kg 5.5 1 8.23 6.79 7.23 35.4 2 Kirschen, Klasse I Fr./kg 9.27 1 13.74 10.26 14.47 32.3 2 Zwetschgen, Klasse I Fr./kg 3.96 1 4.82 4.37 4.45 10.7 2 Erdbeeren Fr./kg 10.01 13.28 13.59 12.91 32.4 Gemüse (Frischkonsum; Herkunft In- und Ausland) Karotten (Lager) Fr./kg 1.99 2.35 2.08 2.28 12.2 Zwiebeln (Lager) Fr./kg 2.26 2.47 2.12 2.32 1.8 Knollensellerie (Lager) Fr./kg 3.64 4.59 4.17 4.87 24.7 Tomaten rund Fr./kg 3.49 3.68 3.59 4.17 9.4 Kopfsalat Fr./St. 1.72 2.02 1.81 2.07 14.3 Blumenkohl Fr./kg 3.92 4.39 4.32 4.34 11.0 Salatgurken Fr./St. 1.94 1.89 1.89 1.79 -4.3
Selbstversorgungsgrad
1 inkl. Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide, jedoch ohne Ölkuchen; ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 Brot und Futtergetreide einschliesslich Hartweizen
3 nach verwertbarer Energie
4 Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche
5 einschliesslich Fleisch von Pferden, Ziegen, Kaninchen sowie Wildbret, Fische, Krusten- und Weichtiere
6 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
7 nach verwertbarer Energie, alkoholische Getränke eingeschlossen, gemäss Nahrungsmittelbilanz
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen, Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
A13 Anhang
Tabelle 14
Produkt 2000/02 2007 2008 2009 2000/02–2007/09 % % % % % Mengenmässiger Anteil: Brotgetreide 71 70 79 76 5.2 Futtergetreide 1 84 74 63 63 -20.8 Getreide total 2 59 56 55 53 -7.9 Energiemässiger Anteil 3: Getreide total (inklusive Reis) 51 50 57 55 6.0 Speisekartoffeln 94 92 90 93 -2.4 Zucker 67 75 75 79 14.8 Pflanzliche Fette, Öle 20 19 17 19 -7.4 Obst 4 77 80 68 74 -4.4 Gemüse 52 46 46 51 -8.3 Konsummilch 97 97 97 96 -0.8 Butter 91 83 103 108 8.0 Käse 117 118 116 110 -2.0 Milch und Milchprodukte total 106 103 109 102 -1.0 Kalbfleisch 96 96 97 99 1.1 Rindfleisch 90 84 81 85 -7.2 Schweinefleisch 94 96 91 94 -0.5 Schaffleisch 39 41 41 42 7.5 Geflügel 42 47 48 49 13.7 Fleisch aller Arten 5 70 69 66 69 -2.5 Eier und Eikonserven 47 43 44 46 -6.3 Pflanzliche Nahrungsmittel 45 46 46 48 2.5 Tierische Nahrungsmittel brutto 93 91 93 95 -0.3 Tierische Nahrungsmittel netto 6 78 72 72 73 -7.1 Nahrungsmittel im ganzen brutto 62 61 61 63 0.1 Nahrungsmittel im ganzen netto 7 56 54 55 56 -2.5 Wertmässiger Anteil Nahrungsmittel im ganzen 8 63 65 68 70 7.4
Quelle: SBV
Wirtschaftliche Ergebnisse
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
1 Halbdefinitiv, Stand 12.9.2011
2 Provisorisch, Stand 12.9.2011
3 Schätzung, Stand 12.9.2011
Die Zahlen werden auf- oder abgerundet, wodurch die Summe der Komponenten gegenüber der Totale oder Salden abweichen kann.
A14 Anhang
Produkt 2000/02 2008 2009 1 2010 2 2000/02– 2011 3 2008/10–2008/10 2011 % % Erzeugung landwirtschaftlicher Güter 9 865 686 10 248 009 9 676 381 9 295 230 -1.3 9 227 416 -5.3 Pflanzliche Erzeugung 4 712 454 4 648 040 4 697 134 4 502 834 -2.0 4 440 191 -3.8 Getreide (einschl. Saatgut) 536 551 451 125 385 241 375 033 -24.7 396 577 -1.8 Weizen 296 542 292 723 241 173 247 541 -12.2 256 695 -1.5 Gerste 111 233 71 188 62 865 56 128 -43.0 61 245 -3.4 Körnermais 77 169 57 450 54 917 45 272 -31.9 52 700 0.3 Sonstiges Getreide 51 607 29 763 26 286 26 092 -46.9 25 936 -5.3 Handelsgewächse 261 299 318 295 274 746 243 079 6.7 270 752 -2.9 Ölsaaten und Ölfrüchte (einschl. Saatgut) 71 607 113 321 83 181 83 040 30.1 86 792 -6.9 Eiweisspflanzen (einschl. Saatgut) 9 913 13 689 9 866 9 460 11.0 9 493 -13.7 Rohtabak 20 386 18 554 14 751 18 404 -15.5 19 153 11.1 Zuckerrüben 154 982 167 145 160 159 126 866 -2.3 149 656 -1.1 Sonstige Handelsgewächse 4 411 5 585 6 789 5 310 33.6 5 657 -4.0 Futterpflanzen 1 366 815 1 249 724 1 270 322 1 235 354 -8.4 1 084 484 -13.4 Futtermais 167 324 187 468 161 224 168 083 2.9 178 560 3.7 Futterhackfrüchte 16 314 7 614 6 902 6 307 -57.5 6 039 -13.0 Sonstige Futterpflanzen 1 183 178 1 054 642 1 102 196 1 060 965 -9.3 899 885 -16.1 Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus 1 312 854 1 403 432 1 457 944 1 447 575 9.4 1 424 680 -0.8 Frischgemüse 481 965 587 766 650 444 651 300 30.7 625 509 -0.7 Pflanzen und Blumen 830 889 815 666 807 500 796 276 -2.9 799 171 -0.9 Kartoffeln (einschl. Pflanzkartoffeln) 195 487 183 858 195 027 175 528 -5.5 178 588 -3.4 Obst 577 213 536 024 592 255 523 815 -4.6 568 644 3.3 Frischobst 323 199 301 681 343 463 302 524 -2.3 333 739 5.7 Weintrauben 254 014 234 343 248 792 221 291 -7.6 234 906 0.0 Wein 438 140 460 141 472 770 452 147 5.4 461 760 0.0 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 24 095 45 443 48 829 50 302 100.0 54 706 13.5 Tierische Erzeugung 5 153 231 5 599 969 4 979 246 4 792 396 -0.6 4 787 224 -6.6 Rinder 1 048 511 1 314 703 1 255 439 1 224 132 20.6 1 260 632 -0.3 Schweine 1 070 133 1 158 445 1 015 621 945 503 -2.8 883 896 -15.0 Einhufer 6 787 5 932 6 602 3 136 -23.0 2 718 -48.0 Schafe und Ziegen 57 827 44 803 43 182 41 469 -25.4 42 976 -0.4 Geflügel 190 394 228 929 238 314 245 055 24.7 251 957 6.1 Sonstige Tiere 13 028 10 327 13 287 15 354 -0.3 16 161 24.4 Milch 2 576 239 2 644 560 2 201 803 2 110 061 -10.0 2 121 607 -8.5 Eier 182 442 184 660 198 569 201 671 6.9 200 558 2.9 Sonstige tierische Erzeugnisse 7 871 7 609 6 430 6 014 -15.1 6 719 0.5 Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen 560 790 647 887 650 046 655 193 16.1 659 364 1.3 Landwirtschaftliche Dienstleistungen 526 408 647 887 650 046 655 193 23.7 659 364 1.3 Verpachtung von Milchkontingenten 34 382 0 0 0 - 0Landwirtschaftliche Erzeugung 10 426 475 10 895 897 10 326 427 9 950 423 -0.3 9 886 780 -4.9 Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten (nicht trennbar) 322 782 333 382 353 002 340 472 6.0 363 901 6.3 Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 183 398 210 234 208 820 204 604 13.4 206 828 -0.5 Sonstige nicht trennbare Nebentätigkeiten (Waren und Dienstleistungen) 139 384 123 148 144 182 135 869 -3.6 157 072 16.9 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs 10 749 257 11 229 278 10 679 429 10 290 895 -0.1 10 250 680 -4.5
Tabelle 15 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs zu laufenden Herstellungspreisen, in 1 000 Fr.
Quelle: BFS
Tabelle 16
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung zu laufenden Preisen, in 1 000 Fr.
wodurch die Summe der Komponenten gegenüber der Totale oder Salden abweichen kann.
A15 Anhang
Produkt 2000/02 2008 2009 1 2010 2 2000/02– 2011 3 2008/10–2008/10 2011 % % Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs 10 749 257 11 229 278 10 679 429 10 290 895 -0.1 10 250 680 -4.5 Vorleistungen insgesamt 6 250 118 6 655 228 6 686 794 6 471 828 5.7 6 470 048 -2.0 Saat- und Pflanzgut 320 477 330 631 340 964 319 205 3.1 314 816 -4.7 Energie, Schmierstoffe 391 791 499 961 450 246 452 127 19.3 491 893 5.2 Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 147 276 209 906 247 381 200 172 48.8 210 990 -3.7 Pflanzenbehandlungs- und Schädlingbekämpfungsmittel 134 183 125 372 129 430 125 471 -5.5 122 224 -3.6 Tierarzt und Medikamente 161 451 214 264 209 481 212 709 31.4 210 716 -0.7 Futtermittel 2 860 966 2 778 704 2 766 971 2 633 034 -4.7 2 582 717 -5.3 Instandhaltung von Maschinen und Geräten 399 129 500 663 503 903 503 612 26.0 499 829 -0.6 Instandhaltung von baulichen Anlagen 144 513 195 171 194 876 194 222 34.8 190 931 -2.0 Landwirtschaftliche Dienstleistungen 560 790 647 887 650 046 655 193 16.1 659 364 1.3 Sonstige Waren und Dienstleistungen 967 338 1 048 623 1 087 648 1 079 372 10.8 1 090 223 1.7 Unterstellte Bankgebühren 162 204 104 045 105 848 96 711 -37.0 96 345 -5.7 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 4 499 140 4 574 051 3 992 634 3 819 067 -8.2 3 780 632 -8.4 Abschreibungen 2 055 966 2 283 203 2 286 626 2 232 111 10.3 2 129 308 -6.1 Ausrüstungsgüter 1 009 546 1 140 177 1 180 707 1 157 270 14.8 1 139 702 -1.7 Bauten 936 902 1 008 938 974 701 943 801 4.2 860 514 -11.8 Anpflanzungen 98 445 104 036 104 252 105 713 6.3 106 398 1.7 Sonstige 11 073 30 052 26 966 25 327 147.9 22 694 -17.3 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2 443 174 2 290 848 1 706 009 1 586 956 -23.8 1 651 325 -11.3 Sonstige Produktionsabgaben 113 699 138 796 148 634 149 929 28.2 170 770 17.1 Sonstige Subventionen (produktunabhängige) 2 407 335 2 655 424 2 836 529 2 876 449 15.9 2 915 349 4.5 Faktoreinkommen 4 736 810 4 807 475 4 393 904 4 313 476 -4.9 4 395 903 -2.4 Arbeitnehmerentgelt 1 138 891 1 276 157 1 238 506 1 250 781 10.2 1 257 371 0.2 Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen 3 597 919 3 531 319 3 155 398 3 062 695 -9.7 3 138 532 -3.4 Gezahlte Pachten 204 609 202 525 203 571 203 438 -0.7 203 390 0.1 Gezahlte Zinsen 246 449 269 844 238 914 230 421 0.0 231 686 -6.0 Empfangene Zinsen 32 701 17 459 12 927 11 383 -57.4 11 092 -20.3 Nettounternehmenseinkommen 4 3 179 562 3 076 409 2 725 839 2 640 219 -11.5 2 714 548 -3.5 1 Halbdefinitiv, Stand 12.9.2011
Provisorisch, Stand 12.9.2011
Schätzung, Stand 12.9.2011
wird in der Literatur
Eurostat-Methodik
bezeichnet Die Zahlen werden auf-
Quelle: BFS
2
3
4
und
als Nettounternehmensgewinn
oder abgerundet,
Betriebsergebnisse
Tabelle 17
Betriebsergebnisse: Alle Regionen
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A16 Anhang
Merkmal Einheit 2000/02 2007 2008 2009 2010 2007/09–2010 % Referenzbetriebe Anzahl 2 955 3 328 3 376 3 372 3 202 -4.7 Vertretene Betriebe Anzahl 52 596 49 203 49 397 48 375 47 166 -3.7 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 19.09 20.31 20.44 20.69 21.06 2.8 Offene Ackerfläche ha 5.20 5.28 5.38 5.38 5.46 2.1 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.68 1.63 1.64 1.66 1.66 1.0 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.29 1.24 1.23 1.22 1.22 -0.8 Kühe total Anzahl 13.8 14.3 14.8 15.1 15.2 3.2 Tierbestand total GVE 24.3 24.1 24.3 25.5 25.8 4.7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 727 756 821 324 825 000 859 543 873 205 4.5 davon: Umlaufvermögen total Fr. 139 412 142 097 145 538 153 383 152 401 3.7 davon: Tiervermögen total Fr. 44 554 54 356 55 150 57 050 56 942 2.6 davon: Anlagevermögen total Fr. 543 790 624 871 624 313 649 109 663 861 4.9 davon: Aktiven Betrieb Fr. 678 557 774 288 779 294 807 930 823 594 4.6 Fremdkapitalquote % 41 45 44 44 44 -0.8 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 13 797 12 345 12 675 9 912 7 506 -35.5 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. * 242 567 254 343 255 656 250 181 -0.3 davon: Direktzahlungen Fr. 42 700 52 220 51 522 57 924 59 874 11.1 Sachkosten Fr. * 152 903 159 483 164 209 164 060 3.3 Betriebseinkommen Fr. * 89 664 94 860 91 447 86 121 -6.4 Personalkosten Fr. 12 042 14 375 15 806 16 912 16 847 7.3 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 8 301 7 528 7 867 7 374 6 991 -7.9 Pacht- und Mietzinsen Fr. * 6 617 7 041 6 856 7 102 3.9 Fremdkosten Fr. * 181 424 190 197 195 351 194 999 3.2 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 56 203 61 143 64 147 60 305 55 182 -10.8 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 18 806 23 417 24 131 26 204 26 308 7.0 Gesamteinkommen Fr. 75 009 84 561 88 278 86 509 81 490 -5.7 Privatverbrauch Fr. 63 222 69 934 71 532 71 568 71 421 0.6 Eigenkapitalbildung Fr. 11 787 14 627 16 746 14 941 10 069 -34.8 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 45 376 45 333 48 400 51 448 50 148 3.6 Cashflow 3 Fr. 42 203 45 495 48 270 49 836 46 677 -2.5 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 93 100 100 97 93 -6.1 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 68 66 68 66 -2.0 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 45 42 42 42 38 -9.5 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 20 26 25 24 22 -12.0 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 19 17 17 17 20 17.6 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 16 15 16 17 19 18.8 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 49 369 54 978 57 711 55 135 51 984 -7.1 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 4 340 4 414 4 640 4 419 4 090 -8.9 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 12.2 11.6 12.2 11.3 10.5 -10.3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2.1 -1.7 -1.4 -2.0 -2.4 -20.0 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -5.7 -4.8 -4.4 -5.2 -5.9 -13.5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 32 906 39 488 41 732 41 184 39 149 -4.0 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 29 754 36 630 37 187 36 465 35 500 -3.4 (Median) 1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000: 3.95 %; 2001: 3.36 %; 2002: 3.22 %; 2007: 2.91 %; 2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
Tabelle 18
Betriebsergebnisse: Talregion*
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000: 3.95 %; 2001: 3.36 %; 2002: 3.22 %; 2007: 2.91 %; 2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion: Talzone
** Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A17 Anhang
Merkmal Einheit 2000/02 2007 2008 2009 2010 2007/09–2010 % Referenzbetriebe Anzahl 1 300 1 524 1 434 1 444 1 358 -7.5 Vertretene Betriebe Anzahl 24 116 22 546 22 306 22 100 21 543 -3.5 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20.01 21.22 21.63 21.66 22.17 3.1 Offene Ackerfläche ha 9.40 9.71 9.92 9.78 9.97 1.7 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.78 1.71 1.75 1.77 1.75 0.4 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.25 1.17 1.18 1.17 1.16 -1.1 Kühe total Anzahl 13.6 14.4 15.2 15.0 15.3 2.9 Tierbestand total GVE 24.4 24.7 25.5 26.1 26.7 5.0 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 833 276 933 570 956 736 990 381 989 105 3.0 davon: Umlaufvermögen total Fr. 173 511 172 927 182 549 192 554 187 802 2.8 davon: Tiervermögen total Fr. 45 056 53 320 55 354 56 159 56 401 2.7 davon: Anlagevermögen total Fr. 614 709 707 323 718 833 741 668 744 903 3.1 davon: Aktiven Betrieb Fr. 772 248 880 586 903 745 926 845 929 868 2.9 Fremdkapitalquote % 40 45 44 44 43 -3.0 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 15 945 13 946 14 759 11 440 8 610 -35.7 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. ** 297 284 319 029 315 981 304 343 -2.1 davon: Direktzahlungen Fr. 37 378 47 396 47 734 53 593 55 378 11.7 Sachkosten Fr. ** 185 324 197 444 200 233 197 255 1.5 Betriebseinkommen Fr. ** 111 959 121 585 115 749 107 087 -8.0 Personalkosten Fr. 17 826 21 125 23 858 25 596 24 797 5.4 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 9 678 8 951 9 516 8 716 7 993 -11.8 Pacht- und Mietzinsen Fr. ** 9 049 9 641 9 362 9 670 3.4 Fremdkosten Fr. ** 224 449 240 459 243 908 239 715 1.5 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 67 865 72 834 78 570 72 074 64 627 -13.2 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 17 197 22 961 24 877 26 565 25 016 0.9 Gesamteinkommen Fr. 85 061 95 795 103 447 98 639 89 643 -9.7 Privatverbrauch Fr. 70 916 76 473 79 674 80 081 78 841 0.1 Eigenkapitalbildung Fr. 14 145 19 322 23 773 18 558 10 802 -47.4 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 51 877 49 576 54 120 60 593 54 650 -0.2 Cashflow 3 Fr. 48 751 54 103 58 122 57 459 50 690 -10.4 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 94 109 107 95 93 -10.3 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 65 69 69 69 64 -7.2 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 46 44 46 43 37 -16.5 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 18 28 26 25 21 -20.3 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 20 15 15 17 22 40.4 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 16 13 14 15 20 42.9 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 58 142 65 378 69 453 65 491 61 347 -8.1 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 5 196 5 277 5 621 5 345 4 831 -10.8 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 13.5 12.7 13.5 12.5 11.5 -10.9 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -0.6 -0.2 0.2 -0.6 -1.2 -500.0 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -3.1 -2.2 -1.5 -2.7 -3.6 -68.8 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 41 391 50 139 53 885 51 700 48 458 -6.6 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 38 364 46 484 50 668 47 488 44 682 -7.3 (Median)
Tabelle 19
Betriebsergebnisse: Hügelregion*
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I
** Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A18
Anhang
Merkmal Einheit 2000/02 2007 2008 2009 2010 2007/09–2010 % Referenzbetriebe Anzahl 874 961 1 046 1 057 998 -2.3 Vertretene Betriebe Anzahl 14 292 13 241 13 618 13 365 12 972 -3.3 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 17.96 19.29 19.24 19.55 19.71 1.8 Offene Ackerfläche ha 3.01 2.94 3.09 3.12 3.12 2.3 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.58 1.53 1.53 1.56 1.58 2.6 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.26 1.23 1.20 1.21 1.21 -0.3 Kühe total Anzahl 15.7 16.3 16.3 16.9 16.7 1.2 Tierbestand total GVE 27.5 26.7 26.2 27.8 27.9 3.7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 682 949 775 604 770 399 790 071 831 520 6.8 davon: Umlaufvermögen total Fr. 118 324 126 644 128 264 132 495 135 292 4.8 davon: Tiervermögen total Fr. 49 221 60 224 60 137 62 486 62 000 1.7 davon: Anlagevermögen total Fr. 515 404 588 736 581 998 595 089 634 228 7.8 davon: Aktiven Betrieb Fr. 635 008 732 093 729 139 746 603 787 205 7.0 Fremdkapitalquote % 44 46 46 46 47 2.2 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 12 207 11 406 11 434 8 834 6 848 -35.1 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. ** 222 356 232 618 233 174 234 042 2.0 davon: Direktzahlungen Fr. 41 567 51 220 49 256 56 977 58 886 12.2 Sachkosten Fr. ** 143 722 148 562 153 069 156 779 5.6 Betriebseinkommen Fr. ** 78 633 84 057 80 105 77 263 -4.5 Personalkosten Fr. 9 095 10 332 11 521 11 974 12 629 12.0 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 8 213 7 211 7 514 6 945 7 137 -1.2 Pacht- und Mietzinsen Fr. ** 5 569 6 212 5 807 5 929 1.1 Fremdkosten Fr. ** 166 835 173 809 177 795 182 475 5.6 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 50 826 55 520 58 809 55 379 51 567 -8.8 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 20 580 23 804 24 221 27 049 27 748 10.9 Gesamteinkommen Fr. 71 406 79 324 83 030 82 428 79 314 -2.8 Privatverbrauch Fr. 60 504 67 489 68 643 68 325 68 296 0.2 Eigenkapitalbildung Fr. 10 901 11 835 14 387 14 102 11 019 -18.0 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 42 487 44 389 48 289 48 822 49 956 5.9 Cashflow 3 Fr. 40 021 42 097 45 479 47 387 47 279 5.1 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 95 94 97 95 -0.3 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 65 69 66 69 67 -1.5 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 43 40 40 42 38 -6.6 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 23 28 28 25 26 -3.7 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 16 17 16 14 17 8.5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 17 15 16 20 19 11.8 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 46 461 51 304 54 760 51 231 48 972 -6.6 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 4 105 4 076 4 369 4 098 3 920 -6.2 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 11.6 10.7 11.5 10.7 9.8 -10.6 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2.6 -2.3 -1.8 -2.5 -2.7 -22.7 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -7.1 -6.1 -5.3 -6.4 -6.8 -14.6 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 30 537 35 877 39 318 38 479 37 025 -2.3 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 28 530 33 208 36 325 34 794 33 728 -3.0 (Median) 1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen
3.22
2007: 2.91
2008: 2.93
2009: 2.22
2010: 1.65
(2000: 3.95 %; 2001: 3.36 %; 2002:
%;
%;
%;
%;
%)
Betriebsergebnisse: Bergregion*
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000: 3.95 %; 2001: 3.36 %; 2002: 3.22 %; 2007: 2.91 %; 2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion: Bergzonen II bis IV
** Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A19 Anhang
Tabelle 20
Merkmal Einheit 2000/02 2007 2008 2009 2010 2007/09–2010 % Referenzbetriebe Anzahl 781 843 896 871 846 -2.8 Vertretene Betriebe Anzahl 14 187 13 416 13 473 12 910 12 651 -4.6 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18.68 19.81 19.70 20.23 20.55 3.2 Offene Ackerfläche ha 0.26 0.16 0.17 0.17 0.16 -4.0 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.58 1.59 1.58 1.57 1.59 0.6 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.37 1.34 1.34 1.33 1.33 -0.5 Kühe total Anzahl 12.0 12.3 12.6 13.4 13.4 5.0 Tierbestand total GVE 21.0 20.4 20.2 22.1 22.1 5.7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 594 017 677 816 662 087 707 487 718 585 5.3 davon: Umlaufvermögen total Fr. 102 662 105 538 101 722 107 952 109 664 4.4 davon: Tiervermögen total Fr. 39 028 50 307 49 769 52 949 52 678 3.3 davon: Anlagevermögen total Fr. 452 328 521 970 510 595 546 586 556 243 5.7 davon: Aktiven Betrieb Fr. 563 737 637 296 623 947 667 854 679 935 5.7 Fremdkapitalquote % 40 42 42 43 43 1.6 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 11 749 10 580 10 478 8 413 6 302 -35.8 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. ** 170 563 169 208 175 661 174 501 1.6 davon: Direktzahlungen Fr. 52 913 61 314 60 083 66 317 68 544 9.5 Sachkosten Fr. ** 107 480 107 672 114 075 114 998 4.8 Betriebseinkommen Fr. ** 63 082 61 536 61 587 59 503 -4.1 Personalkosten Fr. 5 185 7 022 6 805 7 158 7 635 9.1 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 6 063 5 450 5 494 5 521 5 135 -6.4 Pacht- und Mietzinsen Fr. ** 3 564 3 574 3 650 3 929 9.3 Fremdkosten Fr. ** 123 517 123 545 130 403 131 697 4.7 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 41 789 47 046 45 663 45 258 42 804 -6.9 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 19 725 23 801 22 806 24 711 27 032 13.7 Gesamteinkommen Fr. 61 514 70 848 68 469 69 969 69 837 0.1 Privatverbrauch Fr. 52 925 61 356 60 971 60 352 61 990 1.8 Eigenkapitalbildung Fr. 8 589 9 492 7 498 9 617 7 847 -11.5 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 37 235 39 136 39 044 38 513 42 679 9.7 Cashflow 3 Fr. 33 246 34 381 34 781 39 320 39 225 8.5 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 89 88 89 102 92 -1.1 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 63 64 62 67 69 7.3 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 45 43 37 40 41 2.5 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 19 22 20 23 20 -7.7 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 20 18 24 20 21 1.6 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 16 17 19 17 18 1.9 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 35 483 39 655 39 026 39 210 37 508 -4.6 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 3 008 3 185 3 124 3 044 2 895 -7.1 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 10.0 9.9 9.9 9.2 8.8 -9.0 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -4.9 -4.5 -5.0 -4.8 -5.0 -4.9 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -10.0 -9.3 -10.3 -9.9 -10.3 -4.7 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 21 896 27 117 26 189 27 807 27 377 1.3 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 19 909 26 561 24 292 24 185 23 525 -5.9 (Median)
Tabelle 21a
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 2008/10
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A20 Anhang
Pflanzenbau Tierhaltung Merkmal Einheit Mittel alle Spezial- Verkehrs- Mutter- Anderes Betriebe Ackerbau kulturen milch kühe Rindvieh Referenzbetriebe Anzahl 3 317 138 117 1 292 201 180 Vertretene Betriebe Anzahl 48 313 3 276 3 656 15 328 3 189 3 679 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20.73 25.51 13.28 21.05 20.12 17.64 Offene Ackerfläche ha 5.40 21.10 6.35 1.13 0.93 0.41 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.65 1.21 2.39 1.64 1.34 1.43 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.22 0.92 1.26 1.32 1.10 1.23 Kühe total Anzahl 15.0 2.7 1.0 20.2 18.6 8.2 Tierbestand total GVE 25.2 6.9 2.1 27.8 20.7 16.5 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 852 583 805 582 1 018 971 805 840 756 956 594 380 davon: Umlaufvermögen total Fr. 150 441 170 423 276 611 127 657 109 726 96 822 davon: Tiervermögen total Fr. 56 381 14 185 5 533 64 851 59 134 44 630 davon: Anlagevermögen total Fr. 645 761 620 975 736 826 613 332 588 096 452 928 davon: Aktiven Betrieb Fr. 803 606 748 360 950 806 761 184 710 541 555 344 Fremdkapitalquote % 44 38 40 45 45 46 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 10 031 10 531 12 609 9 277 8 806 6 796 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. 253 393 243 116 327 851 215 628 167 341 148 695 davon: Direktzahlungen Fr. 56 440 56 752 29 365 59 950 65 954 58 710 Sachkosten Fr. 162 584 151 230 164 187 135 886 106 986 102 147 Betriebseinkommen Fr. 90 809 91 886 163 664 79 742 60 355 46 548 Personalkosten Fr. 16 522 10 391 58 292 10 685 8 181 5 015 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 7 411 6 854 8 906 6 768 6 785 5 015 Pacht- und Mietzinsen Fr. 6 999 9 349 9 647 6 123 4 139 3 462 Fremdkosten Fr. 193 516 177 824 241 033 159 463 126 091 115 639 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 59 878 65 292 86 818 56 166 41 250 33 056 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 25 548 31 064 24 026 21 931 36 981 27 933 Gesamteinkommen Fr. 85 426 96 356 110 844 78 097 78 231 60 989 Privatverbrauch Fr. 71 507 84 646 86 453 65 756 68 310 56 498 Eigenkapitalbildung Fr. 13 919 11 709 24 391 12 341 9 921 4 491 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 49 999 43 740 51 309 49 650 41 481 37 315 Cashflow 3 Fr. 48 261 39 420 57 273 46 264 40 547 29 008 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 97 105 112 93 100 79 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 67 63 65 69 70 65 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 41 46 42 41 44 33 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 24 17 23 25 25 19 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 18 24 18 16 15 25 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 17 13 16 18 17 23 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 54 943 75 981 68 494 48 522 44 998 32 597 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 4 383 3 616 12 321 3 791 3 001 2 642 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 11.3 12.3 17.2 10.5 8.5 8.4 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2.0 0.8 0.7 -3.1 -3.3 -7.1 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -5.2 -0.2 -0.5 -7.4 -7.9 -14.8 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 40 688 59 792 59 082 35 519 29 421 21 424 (Mittelwert)
Tabelle 21b
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 2008/10
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A21 Anhang
Tierhaltung Kombiniert Pferde/ VerkehrsMerkmal Einheit Mittel alle Schafe/ milch/ MutterBetriebe Ziegen Veredlung Ackerbau kühe Veredlung Andere Referenzbetriebe Anzahl 3 317 49 77 272 62 515 415 Vertretene Betriebe Anzahl 48 313 2 276 1 320 3 347 1 052 4 616 6 574 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20.73 12.99 11.71 28.83 24.93 21.64 22.89 Offene Ackerfläche ha 5.40 0.55 0.99 15.27 11.12 7.21 7.36 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.65 1.34 1.48 1.90 1.59 1.83 1.67 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.22 1.06 1.11 1.27 1.15 1.28 1.23 Kühe total Anzahl 15.0 1.3 8.8 24.0 19.7 18.2 17.7 Tierbestand total GVE 25.2 14.2 46.3 31.8 22.3 49.2 27.8 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 852 583 607 977 1 025 178 986 237 951 870 1 047 401 915 306 davon: Umlaufvermögen total Fr. 150 441 84 093 216 037 182 248 168 247 171 123 150 038 davon: Tiervermögen total Fr. 56 381 24 823 64 471 73 763 64 964 86 847 68 894 davon: Anlagevermögen total Fr. 645 761 499 061 744 670 730 227 718 659 789 432 696 374 davon: Aktiven Betrieb Fr. 803 606 585 622 921 210 937 126 904 500 1 002 651 862 546 Fremdkapitalquote % 44 47 46 42 44 46 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 10 031 6 744 11 367 11 984 11 381 12 251 10 671 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. 253 393 131 972 398 468 318 721 245 660 428 866 263 952 davon: Direktzahlungen Fr. 56 440 40 591 37 654 65 361 70 460 59 455 57 802 Sachkosten Fr. 162 584 86 066 300 818 202 270 161 011 303 868 170 316 Betriebseinkommen Fr. 90 809 45 906 97 650 116 452 84 650 124 998 93 636 Personalkosten Fr. 16 522 10 959 13 279 22 415 18 286 22 137 15 877 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 7 411 5 936 9 464 7 963 8 376 9 558 8 196 Pacht- und Mietzinsen Fr. 6 999 2 796 4 571 11 671 8 058 8 613 8 019 Fremdkosten Fr. 193 516 105 756 328 132 244 319 195 731 344 176 202 408 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 59 878 26 216 70 336 74 402 49 930 84 690 61 545 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 25 548 36 452 32 624 19 030 33 684 21 941 24 732 Gesamteinkommen Fr. 85 426 62 668 102 960 93 432 83 614 106 631 86 277 Privatverbrauch Fr. 71 507 57 588 74 522 79 811 76 180 80 559 73 080 Eigenkapitalbildung Fr. 13 919 5 079 28 439 13 621 7 434 26 072 13 197 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 49 999 32 328 49 876 60 524 59 117 61 891 55 309 Cashflow 3 Fr. 48 261 28 883 74 131 52 200 42 909 73 575 49 682 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 97 91 148 87 88 121 90 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 67 54 71 64 61 71 67 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 41 27 38 44 34 45 41 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 24 20 41 21 22 27 25 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 18 34 8 20 20 13 17 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 17 19 14 15 25 14 17 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 54 943 34 438 66 160 61 376 52 977 68 277 56 065 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 4 383 3 534 8 320 4 044 3 393 5 781 4 092 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 11.3 7.9 10.6 12.5 9.3 12.5 10.9 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2.0 -6.3 0.3 -1.0 -2.6 0.5 -1.8 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -5.2 -14.2 -1.3 -3.2 -6.3 -0.9 -5.1 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 40 688 18 532 53 142 49 000 33 630 56 442 41 461 (Mittelwert)
Tabelle 22
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Alle Regionen 2008/10
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE) Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A22 Anhang
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Referenzbetriebe Anzahl 3 317 691 858 894 874 Vertretene Betriebe Anzahl 48 313 12 083 12 079 12 080 12 072 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20.73 15.45 18.64 21.70 27.14 Offene Ackerfläche ha 5.40 2.78 3.31 5.25 10.27 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.65 1.46 1.65 1.69 1.81 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.22 1.16 1.34 1.28 1.12 Kühe total Anzahl 15.0 11.1 14.6 16.6 17.9 Tierbestand total GVE 25.2 18.5 22.5 26.7 33.0 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 852 583 722 717 736 877 892 536 1 058 375 davon: Umlaufvermögen total Fr. 150 441 114 642 129 779 161 741 195 635 davon: Tiervermögen total Fr. 56 381 44 316 52 244 59 951 69 023 davon: Anlagevermögen total Fr. 645 761 563 759 554 855 670 844 793 716 davon: Aktiven Betrieb Fr. 803 606 680 103 696 675 836 658 1 001 153 Fremdkapitalquote % 44 46 43 43 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 10 031 8 247 8 916 10 650 12 313 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. 253 393 157 861 203 779 265 168 386 871 davon: Direktzahlungen Fr. 56 440 45 052 53 013 58 584 69 123 Sachkosten Fr. 162 584 124 202 136 060 164 645 225 475 Betriebseinkommen Fr. 90 809 33 659 67 719 100 523 161 396 Personalkosten Fr. 16 522 11 053 11 100 15 329 28 614 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 7 411 6 969 6 244 7 223 9 207 Pacht- und Mietzinsen Fr. 6 999 4 286 5 279 7 135 11 300 Fremdkosten Fr. 193 516 146 511 158 683 194 332 274 597 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 59 878 11 351 45 096 70 836 112 274 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 25 548 39 854 23 034 19 969 19 326 Gesamteinkommen Fr. 85 426 51 205 68 130 90 805 131 600 Privatverbrauch Fr. 71 507 58 795 63 754 74 165 89 328 Eigenkapitalbildung Fr. 13 919 -7 590 4 376 16 640 42 271 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 49 999 44 018 41 596 46 062 68 338 Cashflow 3 Fr. 48 261 24 492 35 654 50 565 82 361 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 97 56 86 111 121 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 67 54 66 72 76 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 41 22 40 48 53 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 24 13 20 28 35 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 18 35 22 11 6 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 17 30 19 13 7 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 54 943 23 014 41 172 59 324 89 175 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 4 383 2 188 3 634 4 633 5 951 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 11.3 5.0 9.7 12.0 16.1 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2.0 -8.6 -5.4 -1.1 4.3 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -5.2 -18.0 -11.2 -3.5 6.2 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 40 688 2 642 27 087 47 086 89 088 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 36 384 (Median)
Tabelle 23
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Talregion* 2008/10
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion: Talzone
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A23 Anhang
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Referenzbetriebe Anzahl 1 412 318 360 374 359 Vertretene Betriebe Anzahl 21 983 5 506 5 499 5 507 5 470 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 21.82 17.58 19.44 22.67 27.63 Offene Ackerfläche ha 9.89 6.90 8.00 10.06 14.62 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.75 1.59 1.77 1.74 1.92 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.17 1.14 1.27 1.20 1.06 Kühe total Anzahl 15.2 13.4 15.1 16.7 15.6 Tierbestand total GVE 26.1 21.6 23.6 27.2 32.0 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 978 741 902 114 882 527 996 071 1 135 424 davon: Umlaufvermögen total Fr. 187 635 159 382 173 519 198 425 219 449 davon: Tiervermögen total Fr. 55 971 49 873 52 098 59 186 62 786 davon: Anlagevermögen total Fr. 735 134 692 860 656 909 738 460 853 189 davon: Aktiven Betrieb Fr. 920 153 850 467 824 412 933 043 1 073 867 Fremdkapitalquote % 44 45 42 42 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 11 603 10 533 10 625 12 105 13 162 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. 313 118 219 609 270 347 324 197 439 156 davon: Direktzahlungen Fr. 52 235 42 439 46 577 54 427 65 604 Sachkosten Fr. 198 311 165 656 177 192 199 578 251 190 Betriebseinkommen Fr. 114 807 53 953 93 156 124 618 187 966 Personalkosten Fr. 24 750 18 338 20 351 22 505 37 893 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 8 742 8 765 7 885 8 173 10 150 Pacht- und Mietzinsen Fr. 9 558 6 879 7 633 10 438 13 303 Fremdkosten Fr. 241 361 199 638 213 061 240 695 312 536 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 71 757 19 971 57 286 83 502 126 619 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 25 486 37 580 24 893 19 436 19 999 Gesamteinkommen Fr. 97 243 57 551 82 179 102 938 146 619 Privatverbrauch Fr. 79 532 66 919 73 630 81 971 95 697 Eigenkapitalbildung Fr. 17 711 -9 369 8 548 20 967 50 922 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 56 454 56 018 42 757 53 216 74 012 Cashflow 3 Fr. 55 424 27 410 43 630 58 342 92 586 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 98 49 105 112 125 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 67 53 67 72 77 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 42 21 43 51 52 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 24 14 19 26 36 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 18 35 21 10 6 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 16 30 16 12 6 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 65 430 34 032 52 542 71 554 97 913 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 5 266 3 091 4 797 5 493 6 817 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 12.5 6.3 11.3 13.4 17.5 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -0.5 -6.4 -3.3 0.5 5.6 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -2.6 -13.6 -7.5 -0.7 8.5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 51 348 8 249 36 578 59 357 106 740 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 47 613 (Median)
Tabelle 24
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Hügelregion* 2008/10
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A24 Anhang
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Referenzbetriebe Anzahl 1 034 201 258 283 292 Vertretene Betriebe Anzahl 13 318 3 368 3 293 3 334 3 323 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 19.50 14.47 17.18 20.36 26.02 Offene Ackerfläche ha 3.11 2.08 2.46 2.99 4.92 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.56 1.41 1.53 1.59 1.71 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.21 1.08 1.28 1.28 1.18 Kühe total Anzahl 16.7 11.7 15.4 18.4 21.3 Tierbestand total GVE 27.3 19.3 23.7 28.7 37.6 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 797 330 692 355 715 221 786 325 996 412 davon: Umlaufvermögen total Fr. 132 017 110 828 119 842 132 739 164 833 davon: Tiervermögen total Fr. 61 541 46 189 54 171 65 714 80 243 davon: Anlagevermögen total Fr. 603 772 535 337 541 209 587 872 751 336 davon: Aktiven Betrieb Fr. 754 316 652 391 677 523 746 471 941 923 Fremdkapitalquote % 46 49 46 43 46 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 9 039 7 307 8 258 9 354 11 259 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. 233 278 153 983 192 255 234 730 352 940 davon: Direktzahlungen Fr. 55 040 41 461 48 945 57 244 72 632 Sachkosten Fr. 152 803 122 732 129 897 147 817 211 089 Betriebseinkommen Fr. 80 475 31 251 62 357 86 913 141 850 Personalkosten Fr. 12 041 11 033 7 912 9 692 19 515 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 7 199 7 325 6 433 6 142 8 893 Pacht- und Mietzinsen Fr. 5 983 3 876 4 674 5 600 9 793 Fremdkosten Fr. 178 027 144 966 148 916 169 252 249 289 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 55 252 9 017 43 339 65 479 103 650 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 26 339 43 120 24 010 19 099 18 936 Gesamteinkommen Fr. 81 591 52 137 67 349 84 577 122 586 Privatverbrauch Fr. 68 421 58 290 61 119 69 835 84 526 Eigenkapitalbildung Fr. 13 169 -6 153 6 230 14 742 38 060 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 49 023 40 715 43 904 44 642 67 004 Cashflow 3 Fr. 46 715 27 037 37 034 45 902 77 089 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 67 90 104 116 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 67 59 66 70 75 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 40 24 39 44 52 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 26 16 23 30 37 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 15 26 19 13 3 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 18 33 19 13 8 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 51 654 22 204 40 696 54 844 82 946 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 4 129 2 169 3 629 4 267 5 453 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 10.7 4.8 9.2 11.7 15.1 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2.3 -8.5 -5.2 -1.8 3.6 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -6.2 -19.4 -11.6 -4.6 5.0 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 38 274 1 487 27 319 43 845 78 022 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 34 949 (Median)
Tabelle 25
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Bergregion* 2008/10
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2008: 2.93 %; 2009: 2.22 %; 2010: 1.65 %)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50 % und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50 % und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50 % und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50 % und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion: Bergzonen II bis IV
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A25 Anhang
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Referenzbetriebe Anzahl 871 165 222 239 244 Vertretene Betriebe Anzahl 13 011 3 261 3 247 3 255 3 247 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20.16 13.84 16.94 21.59 28.30 Offene Ackerfläche ha 0.17 0.04 0.10 0.16 0.37 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1.58 1.38 1.63 1.66 1.65 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1.33 1.21 1.46 1.41 1.26 Kühe total Anzahl 13.1 8.3 11.8 14.3 18.3 Tierbestand total GVE 21.4 15.2 18.3 22.5 29.8 Kapitalstruktur Aktiven total Fr. 696 053 553 976 616 420 723 593 890 785 davon: Umlaufvermögen total Fr. 106 446 69 491 98 272 115 564 142 597 davon: Tiervermögen total Fr. 51 799 36 160 45 477 54 694 70 925 davon: Anlagevermögen total Fr. 537 808 448 325 472 671 553 335 677 262 davon: Aktiven Betrieb Fr. 657 245 528 937 576 421 682 509 841 624 Fremdkapitalquote % 43 42 42 42 44 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr. 8 398 6 855 7 475 8 855 10 412 Erfolgsrechnung Rohleistung Fr. 173 123 106 883 144 965 184 533 256 372 davon: Direktzahlungen Fr. 64 982 47 214 57 465 69 952 85 360 Sachkosten Fr. 112 248 89 410 98 716 113 983 146 980 Betriebseinkommen Fr. 60 875 17 473 46 249 70 551 109 392 Personalkosten Fr. 7 199 4 877 5 438 7 143 11 350 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertrag Fr. 5 383 4 860 4 714 5 511 6 451 Pacht- und Mietzinsen Fr. 3 718 2 825 2 937 4 028 5 084 Fremdkosten Fr. 128 548 101 972 111 804 130 665 169 864 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 44 575 4 911 33 161 53 868 86 508 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 24 850 38 051 24 586 18 914 17 810 Gesamteinkommen Fr. 69 425 42 962 57 748 72 782 104 318 Privatverbrauch Fr. 61 104 51 780 55 646 62 706 74 325 Eigenkapitalbildung Fr. 8 321 -8 818 2 102 10 076 29 993 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr. 40 079 36 168 27 950 40 573 55 641 Cashflow 3 Fr. 37 775 18 260 28 944 39 645 64 332 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 94 51 105 98 117 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 66 48 70 71 76 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 39 20 38 47 53 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 % 21 8 17 24 36 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 22 44 25 14 4 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 18 28 21 16 7 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE 38 581 12 704 28 415 42 542 66 340 Betriebseinkommen je ha landw. Nutzfläche Fr./ha 3 021 1 265 2 731 3 269 3 867 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 9.3 3.3 8.0 10.4 13.0 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -4.9 -12.3 -9.0 -4.1 1.8 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -10.2 -22.9 -17.2 -8.6 1.9 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 27 125 -1 623 17 656 31 821 60 400 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE 24 001 (Median)
Tabelle 26
Betriebsergebnisse nach Regionen, Betriebstypen und Quartilen: 2000/02–2008/10
A26 Anhang
Einheit Alle Betriebe Talregion Hügelregion Bergregion Betriebsergebnisse nach Regionen 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 19.09 20.73 20.01 21.82 17.96 19.50 18.68 20.16 Familienarbeitskräfte FJAE 1.29 1.22 1.25 1.17 1.26 1.21 1.37 1.33 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 56 203 59 878 67 865 71 757 50 826 55 252 41 789 44 575 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 18 806 25 548 17 197 25 486 20 580 26 339 19 725 24 850 Gesamteinkommen Fr. 75 009 85 426 85 061 97 243 71 406 81 591 61 514 69 425 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr./FJAE 32 906 40 688 41 391 51 348 30 537 38 274 21 896 27 125 Einheit Ackerbau Spezialkulturen Verkehrsmilch Mutterkühe Betriebsergebnisse nach Betriebstypen 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24.23 25.51 12.57 13.28 18.65 21.05 17.27 20.12 Familienarbeitskräfte FJAE 1.10 0.92 1.36 1.26 1.34 1.32 1.10 1.10 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 69 492 65 292 73 163 86 818 50 192 56 166 39 811 41 250 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 22 200 31 064 14 907 24 026 18 215 21 931 31 247 36 981 Gesamteinkommen Fr. 91 693 96 356 88 070 110 844 68 406 78 097 71 058 78 231 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr./FJAE 49 026 59 792 40 617 59 082 28 231 35 519 24 120 29 421 Einheit Anderes Pferde/Schafe/ Veredlung Rindvieh Ziegen Betriebsergebnisse nach Betriebstypen 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15.90 17.64 13.64 12.99 11.30 11.71 Familienarbeitskräfte FJAE 1.27 1.23 1.20 1.06 1.15 1.11 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 33 665 33 056 21 767 26 216 64 009 70 336 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 21 325 27 933 29 559 36 452 17 090 32 624 Gesamteinkommen Fr. 54 990 60 989 51 326 62 668 81 099 102 960 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr./FJAE 18 432 21 424 10 267 18 532 42 428 53 142 Einheit Kombiniert Kombiniert Kombiniert Kombiniert Verkehrsmilch/ Mutterkühe Veredlung Andere Ackerbau Betriebsergebnisse nach Betriebstypen 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 24.94 28.83 21.79 24.93 19.39 21.64 20.29 22.89 Familienarbeitskräfte FJAE 1.33 1.27 1.16 1.15 1.29 1.28 1.27 1.23 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 70 405 74 402 57 703 49 930 69 752 84 690 56 658 61 545 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 14 369 19 030 26 966 33 684 15 977 21 941 19 538 24 732 Gesamteinkommen Fr. 84 774 93 432 84 669 83 614 85 730 106 631 76 197 86 277 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr./FJAE 40 656 49 000 37 282 33 630 41 244 56 442 33 830 41 461 Einheit 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil 4. Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Betriebsergebnisse nach Quartilen 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 2000/02 2008/10 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14.41 15.45 17.05 18.64 19.82 21.70 25.08 27.14 Familienarbeitskräfte FJAE 1.26 1.16 1.36 1.34 1.33 1.28 1.20 1.12 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 18 967 11 351 43 840 45 096 63 938 70 836 98 108 112 274 Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Fr. 28 621 39 854 18 171 23 034 15 535 19 969 12 888 19 326 Gesamteinkommen Fr. 47 588 51 205 62 011 68 130 79 473 90 805 110 996 131 600 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr./FJAE 4 883 2 642 23 160 27 087 37 512 47 086 68 236 89 088 Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Ausgaben des Bundes
Ausgaben für Produktion und Absatz
Ausgaben Absatzförderung
1 Definitiver Rechnungsabschluss fallweise noch offen
2 Für 2011 nicht definitiv, Korrekturen Käse Ausland möglich
3 Neu gemäss Artikel 10 Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung
4 Neu ab 2009
A27 Anhang
Tabelle 27
Sektoren / Produkt-Markt-Bereich Rechnung 2009 Rechnung 2010 1 Budget 2011 Fr. Fr. Fr. Milchproduktion 28 900 000 30 985 596 27 400 730 Käse Inland / Ausland 2 21 000 000 22 822 396 19 237 530 Milch und Butter 7 900 000 8 163 200 8 163 200 Tierproduktion 5 243 784 6 597 000 6 650 679 Fleisch 3 769 612 4 806 000 4 836 400 Eier 928 735 1 066 000 1 115 905 Fische 0 0 0 Lebende Tiere 445 437 625 000 598 374 Honig 100 000 100 000 100 000 Pflanzenbau 6 547 958 6 695 269 7 640 624 Gemüse 885 697 886 623 618 695 Pilze 166 266 250 000 250 000 Obst 2 274 142 2 327 500 2 502 200 Getreide 416 741 369 166 320 000 Kartoffeln 646 758 613 250 598 250 Ölsaaten 351 101 382 110 431 479 Zierpflanzen 474 697 420 000 420 000 Wein 1 332 557 1 446 620 2 500 000 Agrotourismus 3 284 000 284 000 280 000 Pilotprojekte Ausland 4 162 618 550 000 400 000 Gemeinsame Massnahmen 3 315 210 3 168 500 3 148 390 Übergreifende Massnahmen (Bio, IP) 3 365 884 4 164 590 4 229 590 Öffentlichkeitsarbeit 2 778 410 2 778 410 2 785 000 Kleinprojekte und Sponsoring 4 000 National 50 601 864 55 223 365 52 535 013 Regional 2 617 000 2 861 690 3 229 150 Total 53 218 864 58 085 055 55 764 163
Quelle: BLW
A28 Anhang Tabelle 29 Ausgaben Viehwirtschaft Bezeichnung Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Fr. Fr. Fr. Entschädigung an private Organisationen Schlachtvieh und Fleisch 6 182 500 6 182 500 6 182 500 Marktstützung Fleisch Einlagerungsbeiträge von Kalbfleisch 2 777 709 1 068 627 2 777 709 1 068 627 4 317 500 Marktstützung Eier Aufschlagsaktionen 688 273 500 000 Verbilligungsaktionen 1 021 960 1 500 000 1 710 233 2 000 000 2 000 000 Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh Tiere der Rindviehgattung 6 171 700 Tiere der Schafgattung 36 100 Tiere der Ziegengattung 96 800 Tiere der Pferdegattung 545 200 6 849 800 0 0 Schafwolle Verwertungsbeiträge Schafwolle 734 759 274 532 Beiträge für innovative Projekte Schafwolle 0 471 056 734 759 745 588 800 000 Beiträge für die Geräte und/oder Ausrüstungen von öffentlichen Märkten im Berggebiet 1 506 19 010 150 000 Finanzhilfe Qualitätssicherung Fleisch 0 220 000 0 Total 18 256 507 10 235 725 13 450 000 Massnahmen gegen die BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte 47 673 215 47 700 000 48 100 000 Einnahmen Tierverkehr -10 496 853 -10 500 000 -9 600 000 Betriebsausgaben Tierverkehr 9 229 701 9 200 000 11 087 000 Quellen: Staatsrechnung, BLW Tabelle 28 Ausgaben Milchwirtschaft Bezeichnung Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Fr. Fr. Fr. Marktstützung (Zulagen und Beihilfen) Zulage auf verkäster Milch 247 759 007 256 292 300 258 608 000 Zulage für Fütterung ohne Silage 31 888 900 32 707 700 33 392 000 Inlandbeihilfen für Butter 9 466 853 0 0 Inlandbeihilfen für Magermilch und Milchpulver 1 688 074 0 0 Ausfuhrbeihilfen für Käse 2 224 333 0 0 Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte 972 833 0 0 294 000 000 289 000 000 292 000 000 Marktstützung (Administration) Rekurskommissionen Milchkontingentierung 188 277 0 0 Administration Milchproduktion und -verwertung 4 023 824 2 943 528 3 500 000 4 212 101 2 943 528 3 500 000 Total 298 212 101 291 943 528 295 500 000 Entlastungsmassnahmen Inlandbeihilfen für Butter (zulasten Butterimportfonds) 9 000 000 0 0 Ausfuhrbeihilfen für Rahm (zulasten Butterimportfonds) 5 000 000 0 0 Butterlagerentlastungsmassnahmen (zulasten Butterimportfonds) 4 500 000 0 0 Total Markstützungen 316 712 101 291 943 528 295 500 000 Quellen: Staatsrechnung, BLW
Tabelle 30
Ausgaben Tierzucht
A29 Anhang
Tierart und Massnahmen Rechnung 2000 1 Rechnung 2005 1 Rechnung 2010 2 anerkannte Zucht- Rassen organisationen 2010 2010 Fr. Fr. Fr. Anzahl Anzahl Rinder 28 052 522 26 754 400 24 304 246 6 37 Herdebuchführung 5 036 242 4 929 712 5 597 390 Exterieurbeurteilungen 1 511 756 1 343 919 1 308 192 Milchleistungsprüfungen 17 219 327 16 659 701 17 127 744 Fleischleistungsprüfungen 143 176 171 516 270 920 Kantonseigene Massnahmen 4 142 021 3 649 552 0 Pferde 2 916 988 2 468 695 1 701 860 11 45 Identifizierte und registrierte Fohlen 1 792 373 1 646 580 1 393 800 Leistungsprüfungen 203 785 279 236 280 360 Hengstprüfungen in einer Station 21 187 55 300 10 500 Hengstprüfungen im Felde 0 0 17 200 Kantonseigene Massnahmen 899 643 487 579 0 Schweine 2 794 903 3 530 742 3 399 027 3 10 Herdebuchführung 1 154 581 1 221 066 1 272 285 Feldprüfungen 0 300 000 189 737 Stationsprüfungen 1 460 322 1 344 676 1 437 005 Infrastruktur 0 485 000 500 000 Kantonseigene Massnahmen 180 000 180 000 0 Schafe 2 329 587 2 325 848 2 016 025 6 16 Herdebuchführung 2 090 390 2 070 475 2 016 025 Kantonseigene Massnahmen 239 197 255 373 0 Ziegen und Milchschafe 1 609 029 1 807 852 1 796 358 4 14 Herdebuchführung 980 960 1 094 188 1 347 360 Milchleistungsprüfungen 408 069 483 664 406 278 Aufzuchtleistungsprüfungen (Ziegen) 0 0 42 720 Kantonseigene Massnahmen 220 000 230 000 0 Neuweltkameliden 0 0 33 588 1 4 Herdebuchführung 0 0 33 588 Honigbienen 0 0 62 245 1 3 Herdebuchführung 0 0 2 520 Rassenreinheit der Königinnen 0 0 1 575 Leistungsprüfungen im Prüfstand 0 0 22 050 Belegstation A 0 0 28 000 Belegstation B 0 0 8 100 Erhaltung gefährdeter Schweizer Rassen 204 683 1 728 488 1 127 592 Erhaltung der Freiberger-Pferderasse 0 1 006 840 931 200 1 1 Projekte 204 683 721 648 196 392 Forschungsprojekte tiergenetische Ressourcen 0 0 0 Total 37 907 712 38 616 025 34 440 941 1 Bundes- und Kantonsbeiträge 2 Neuer Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen: Bundesbeiträge Quellen: Staatsrechnung und Zuchtorganisationen
Tabelle 31
Ausgaben Pflanzenbau
A30 Anhang
Bezeichnung Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Fr. Fr. Fr. Ackerbaubeiträge 69 602 964 65 894 870 72 440 000 Flächenbeiträge für Ölsaaten 25 818 073 26 168 244 28 200 000 Flächenbeiträge für Körnerleguminosen 3 968 643 3 812 951 4 100 000 Flächenbeiträge für Faserpflanzen 219 936 225 505 230 000 Flächenbeiträge für Zuckerrüben 37 630 573 33 638 486 37 810 000 Flächenbeiträge für Saatgut (ab 2009) 1 965 739 2 049 684 2 100 000 Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 28 070 335 2 911 482 3 326 000 Zuckerrübenverarbeitung 0 0 0 Ölsaatenverarbeitung 2 153 500 0 0 Kartoffelverarbeitung 4 060 867 0 0 Saatgutproduktion 2 481 000 0 0 Obstverwertung 19 367 343 2 894 184 3 276 000 Pilot- und Demonstrationsanlagen 7 625 17 298 50 000 Förderung des Weinbaus 1 348 370 1 270 793 1 576 000 Weinlesekontrolle 837 821 842 823 856 000 Umstellungsbeiträge Weinbau 510 549 427 970 720 000 Total 99 021 669 70 077 145 77 342 000 Quellen: Staatsrechnung, BLW
Ausgaben für Direktzahlungen
Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich. Die Werte betreffend Direktzahlungen beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs. Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle: BLW
A31 Anhang Tabelle 32 Entwicklung der Direktzahlungen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Beitragsart 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. 1 000 Fr. Allgemeine Direktzahlungen 1 999 091 1 993 915 1 999 606 2 007 181 2 070 357 1 986 617 2 190 245 2 201 118 Flächenbeiträge 1 317 956 1 317 773 1 319 595 1 319 103 1 275 681 1 200 649 1 225 518 1 221 166 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 287 692 286 120 291 967 301 213 412 813 406 223 509 591 510 283 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 287 289 284 023 282 220 281 258 277 786 276 528 352 540 354 306 Allgemeine Hangbeiträge 95 630 95 308 94 768 94 227 92 671 91 721 91 015 104 044 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 10 524 10 691 11 056 11 380 11 407 11 496 11 581 11 318 Ökologische Direktzahlungen 476 724 494 695 506 895 518 211 523 533 539 064 566 108 597 955 Ökobeiträge 381 319 207 458 213 582 216 999 217 737 224 514 234 928 249 710 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 124 927 125 665 126 023 126 976 126 928 122 911 123 014 128 715 Beiträge nach der Öko-Qalitätsverordnung (ÖQV) 14 638 23 007 27 442 30 256 32 107 43 093 54 902 61 978 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 31 255 30 824 31 516 31 094 30 629 30 529 29 075 29 336 Beiträge für den biologischen Landbau 27 135 27 962 28 601 28 672 28 074 27 980 27 937 29 680 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 183 363 - - - - - -Ethobeiträge - 190 651 195 767 203 247 207 796 216 590 222 950 225 632 Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) - 46 517 47 089 49 749 51 602 56 025 59 890 61 729 Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) - 144 134 148 678 153 498 156 194 160 565 163 060 163 903 Sömmerungsbeiträge 91 381 91 066 91 610 91 696 92 110 91 711 98 008 101 275 Gewässerschutzbeiträge- und Ressourcenprogrammbeiträge 4 024 5 521 5 936 6 270 5 890 6 249 10 223 21 339 Kürzungen 17 138 18 120 20 378 25 820 18 851 20 667 14 668 9 839 Total Direktzahlungen 2 458 677 2 470 490 2 486 122 2 499 572 2 575 039 2 505 014 2 741 686 2 789 234 Anmerkung:
Tabelle 33a
Allgemeine Direktzahlungen 2010
Flächenbeiträge
Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere
1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A32 Anhang
Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe RGVE Total Beiträge Anzahl ha Fr. Anzahl Anzahl Fr. Kanton ZH 3 307 69 844 89 884 900 2 577 56 177 29 411 883 BE 11 353 186 425 223 175 424 10 675 186 762 99 021 766 LU 4 711 76 314 87 611 900 4 439 89 780 46 729 796 UR 596 6 629 6 889 822 592 7 308 4 379 680 SZ 1 556 23 830 24 922 963 1 536 27 647 15 369 322 OW 633 7 655 7 976 314 628 11 095 5 803 118 NW 464 6 006 6 255 000 463 7 953 4 151 942 GL 378 6 796 7 096 370 375 7 740 4 226 207 ZG 517 10 216 11 381 540 501 11 802 6 060 529 FR 2 860 74 426 90 921 482 2 576 79 505 39 525 874 SO 1 312 31 258 38 602 896 1 182 26 392 14 136 696 BL 885 21 335 25 402 854 771 17 699 9 441 838 SH 540 14 225 19 956 814 335 6 646 3 739 173 AR 690 11 764 12 219 828 685 13 923 7 266 068 AI 491 7 042 7 321 962 483 8 063 4 120 487 SG 3 937 70 303 75 952 258 3 803 89 439 46 067 974 GR 2 406 53 170 55 812 598 2 344 48 709 29 538 853 AG 2 859 58 293 76 856 321 2 330 47 740 25 602 204 TG 2 421 48 407 61 652 861 1 986 49 334 24 002 487 TI 814 13 031 14 332 072 651 10 357 6 030 371 VD 3 588 105 857 142 776 688 2 449 66 174 35 423 908 VS 3 153 35 340 40 795 527 1 990 26 630 15 584 923 NE 832 31 194 33 865 376 745 25 954 13 419 866 GE 279 10 450 14 474 918 100 2 025 1 244 318 JU 1 006 39 323 45 027 727 964 35 993 19 983 976 Schweiz 51 588 1 019 134 1 221 166 415 45 180 960 846 510 283 259 Zone 1 Tal 22 004 477 011 634 851 655 16 802 397 356 203 488 408 Hügel 7 321 140 508 165 006 191 6 858 149 392 77 391 515 BZ I 6 690 116 772 126 404 101 6 463 137 241 71 383 666 BZ II 8 196 153 229 158 924 354 7 742 156 322 85 558 207 BZ III 4 801 82 829 85 915 545 4 753 79 368 47 482 658 BZ IV 2 576 48 785 50 064 569 2 562 41 167 24 978 805
Quelle: BLW
Tabelle 33b
Allgemeine Direktzahlungen 2010
A33 Anhang
Tierhaltung unter Allgemeine Hangbeiträge Hangbeiträge Steil- und erschwerenden Bedingungen Terrassenlagen im Rebbau Total Total Total Betriebe RGVE Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Anzahl Anzahl Fr. Anzahl ha Fr. Anzahl ha Fr. Kanton ZH 765 17 768 5 434 781 740 4 884 2 291 008 190 183 346 650 BE 8 093 142 198 81 491 191 7 513 46 315 22 403 534 65 103 406 106 LU 3 119 59 864 24 684 900 3 048 20 120 9 593 567 20 22 38 705 UR 592 7 307 6 597 197 551 4 744 2 694 108 3 2 3 060 SZ 1 410 25 088 14 686 529 1 377 10 058 4 982 629 11 11 21 480 OW 606 10 529 6 334 673 584 4 479 2 440 238 2 2 5 010 NW 441 7 451 4 140 684 433 3 250 1 710 265 0 0 0 GL 346 6 897 4 893 110 342 3 058 1 525 605 1 2 7 650 ZG 347 7 333 3 491 550 345 2 923 1 403 148 3 1 1 815 FR 1 627 53 341 20 512 399 1 355 6 940 3 101 575 17 15 26 004 SO 584 14 458 5 849 591 550 4 674 2 013 262 0 0 0 BL 655 15 150 4 627 425 637 5 340 2 352 322 43 38 66 135 SH 119 2 655 488 802 145 948 396 289 117 94 155 590 AR 684 13 914 8 551 430 687 5 902 2 665 573 5 7 22 995 AI 483 8 063 5 627 968 478 2 925 1 332 846 0 0 0 SG 2 767 61 817 27 375 701 2 682 22 999 11 184 480 67 100 306 915 GR 2 312 48 073 47 209 396 2 259 29 394 15 137 856 27 20 43 935 AG 1 128 23 280 4 990 775 1 115 7 324 3 167 633 140 182 311 465 TG 173 4 548 1 280 428 148 1 159 594 488 72 97 148 710 TI 587 9 221 7 669 270 511 3 161 1 630 626 168 165 344 555 VD 1 185 37 442 15 758 460 896 5 444 2 440 261 448 731 2 482 150 VS 1 939 25 507 22 893 221 1 826 11 496 6 050 627 1 172 1 799 6 333 420 NE 695 24 659 15 415 967 544 3 335 1 394 820 58 76 155 705 GE 1 67 1 132 0 0 0 40 54 83 190 JU 727 26 563 14 299 634 548 3 552 1 537 247 3 4 6 585 Schweiz 31 385 653 194 354 306 214 29 314 214 422 104 044 007 2 672 3 707 11 317 830 Zone 1 Tal 3 054 90 626 8 726 612 2 160 6 221 2 861 703 1 693 2 458 7 410 110 Hügel 6 844 149 010 43 557 730 6 416 35 277 15 606 248 207 274 699 894 BZ I 6 449 136 993 65 581 188 6 176 43 878 20 451 474 177 223 652 043 BZ II 7 736 156 234 112 000 625 7 318 58 116 28 172 677 454 699 2 360 754 BZ III 4 745 79 267 76 223 558 4 699 44 196 22 768 316 100 40 148 555 BZ IV 2 557 41 065 48 216 501 2 545 26 734 14 183 589 41 12 46 474 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 34a
Ökobeiträge 2010
1 Hochstammobstbäume umgerechnet in Aren
2 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A34 Anhang
Ökologischer Ausgleich 1 Biologischer Landbau Extensive Produktion von Getreide und Raps Total Total Total Betriebe Fläche Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Anzahl ha Fr. Anzahl ha Fr. Anzahl ha Fr. Kanton ZH 3 300 9 514 13 621 467 312 6 612 2 413 152 1 423 6 319 2 520 238 BE 11 103 18 563 18 873 574 1 149 18 049 4 684 495 4 003 12 846 5 138 658 LU 4 712 8 866 10 259 080 277 4 555 1 276 165 1 046 2 802 1 120 696 UR 592 1 320 673 680 57 850 171 386 0 SZ 1 538 3 404 2 994 543 153 2 539 515 397 13 16 6 240 OW 633 1 076 882 400 169 2 220 446 243 0 NW 462 932 727 282 66 901 184 257 0 GL 369 844 522 934 77 1 448 290 401 1 2 604 ZG 519 1 707 1 909 462 70 1 330 303 548 53 126 50 396 FR 2 781 6 439 7 145 076 113 2 506 933 556 1 027 5 440 2 176 187 SO 1 310 4 277 5 441 479 115 3 120 863 876 634 3 427 1 365 348 BL 885 3 405 4 422 184 120 2 710 798 377 561 2 874 1 133 507 SH 529 1 771 2 682 513 19 508 256 305 325 2 569 1 009 914 AR 642 839 673 078 111 2 182 438 119 1 1 297 AI 434 530 386 111 21 301 60 324 0 SG 3 906 7 989 8 664 375 410 7 373 1 672 645 228 595 235 444 GR 2 385 15 392 6 697 544 1 311 30 514 6 346 087 209 646 258 324 AG 2 861 7 900 11 256 727 212 4 054 1 693 292 1 508 7 162 2 863 985 TG 2 397 5 218 7 452 638 231 4 238 1 794 165 766 3 149 1 258 703 TI 777 1 655 1 292 545 114 1 909 449 995 59 254 101 464 VD 3 394 9 575 12 432 808 131 3 029 1 242 525 1 718 16 149 6 454 527 VS 1 758 4 154 2 391 231 265 4 868 1 401 629 89 287 114 708 NE 608 1 754 1 581 372 41 1 242 330 314 285 2 258 903 364 GE 276 1 122 1 927 371 12 346 235 078 205 3 521 1 343 831 JU 965 3 287 3 803 694 85 3 039 879 108 449 3 211 1 279 990 Schweiz 49 136 121 535 128 715 165 5 641 110 445 29 680 439 14 603 73 654 29 336 425 Zone 2 Tal 21 214 51 628 75 444 401 1 169 23 109 10 570 450 9 046 53 349 21 227 427 Hügel 7 239 17 543 21 206 039 576 10 643 3 230 072 3 431 13 635 5 441 164 BZ I 6 447 11 397 10 417 251 697 11 645 2 668 908 1 588 5 345 2 137 854 BZ II 7 314 14 727 10 424 853 1 096 19 834 4 075 980 426 1 188 475 260 BZ III 4 462 13 108 6 105 073 1 201 24 230 4 952 236 85 112 44 696 BZ IV 2 460 13 133 5 117 548 902 20 984 4 182 793 27 25 10 024
Quelle: BLW
Tabelle 34b
Ethobeiträge 2010
Besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere
A35 Anhang
Betriebe GVE Total Beiträge Anzahl Anzahl Fr. Kanton ZH 2 032 51 901 12 402 306 BE 9 040 197 185 43 492 536 LU 3 873 115 488 28 359 990 UR 429 5 641 1 144 191 SZ 1 120 22 212 4 804 002 OW 475 9 622 2 209 092 NW 284 5 968 1 385 413 GL 305 6 487 1 358 302 ZG 398 11 765 2 699 258 FR 2 394 86 604 20 182 192 SO 1 043 26 922 6 186 421 BL 617 16 130 4 046 498 SH 265 8 548 2 048 084 AR 601 14 242 3 028 645 AI 413 10 382 2 382 770 SG 2 971 82 761 19 118 580 GR 2 224 46 990 10 554 073 AG 1 741 47 003 11 715 549 TG 1 713 56 490 13 409 422 TI 582 9 335 2 082 247 VD 2 113 65 108 15 192 572 VS 1 270 17 926 3 643 968 NE 651 23 930 5 387 480 GE 82 1 746 404 757 JU 899 36 021 8 393 225 Schweiz 37 535 976 405 225 631 573 Zone 1 Tal 14 119 439 055 105 350 563 Hügel 5 752 155 826 37 011 891 BZ I 5 305 132 687 30 087 383 BZ II 6 356 145 059 31 428 126 BZ III 3 869 68 481 14 346 079 BZ IV 2 134 35 297 7 407 531 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 35a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2010
A36 Anhang
Extensiv genutzte Wiesen Wenig intensiv genutzte Wiesen Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr. Anzahl ha Fr. Kanton ZH 3 075 5 657 8 009 406 533 412 123 591 BE 8 392 9 166 9 545 818 4 700 4 124 1 240 656 LU 4 246 4 685 5 047 022 1 200 895 268 512 UR 415 675 327 750 405 478 143 526 SZ 1 165 1 206 873 649 343 238 71 427 OW 576 689 438 772 145 76 22 815 NW 391 552 348 344 147 104 31 149 GL 342 618 364 075 116 103 31 011 ZG 423 515 588 968 160 111 33 429 FR 1 920 3 138 4 142 400 1 437 2 023 607 431 SO 1 194 2 705 3 420 875 325 427 128 087 BL 775 1 535 1 832 718 330 391 117 222 SH 507 1 257 1 757 019 68 83 24 888 AR 389 244 176 127 322 204 61 119 AI 293 188 132 625 118 81 24 402 SG 3 059 3 079 3 375 065 1 314 843 252 987 GR 2 087 8 025 3 898 130 2 021 6 831 2 048 685 AG 2 632 4 899 6 663 592 608 448 134 343 TG 1 961 2 292 3 377 535 655 431 129 243 TI 545 811 680 241 338 543 162 921 VD 2 947 6 023 8 155 692 885 1 585 475 500 VS 813 1 167 778 658 1 249 2 393 717 811 NE 465 993 1 065 768 249 583 175 002 GE 270 834 1 249 520 8 9 2 769 JU 723 1 659 2 013 199 420 749 224 568 Schweiz 39 605 62 612 68 262 965 18 096 24 166 7 253 094 Zone 1 Tal 18 990 30 902 45 257 707 4 582 3 961 1 188 673 Hügel 5 772 8 187 9 607 426 2 756 2 639 792 632 BZ I 4 578 4 601 3 416 385 2 692 2 329 699 708 BZ II 5 095 5 963 4 041 487 3 303 4 001 1 201 169 BZ III 3 252 6 707 3 110 556 2 771 4 836 1 451 311 BZ IV 1 918 6 252 2 829 404 1 992 6 399 1 919 601 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 35b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2010
A37 Anhang
Streueflächen Hecken, Feld- und Ufergehölze Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr. Anzahl ha Fr. Kanton ZH 1 133 1 435 1 956 754 1 059 215 534 641 BE 744 567 371 364 2 234 441 1 020 628 LU 554 391 345 241 1 285 255 611 690 UR 76 67 52 472 3 0 877 SZ 867 1 263 997 631 96 9 20 061 OW 155 88 83 133 75 5 11 025 NW 120 98 78 910 22 2 4 895 GL 79 68 45 501 6 1 1 498 ZG 322 548 438 159 306 53 120 497 FR 116 62 61 861 816 263 642 704 SO 4 2 2 146 365 101 243 124 BL 0 0 0 283 98 237 936 SH 9 7 10 650 270 75 186 750 AR 268 198 140 722 77 11 22 455 AI 220 210 146 902 59 10 21 462 SG 1 709 1 791 1 522 837 604 91 213 312 GR 230 122 58 047 479 76 157 206 AG 164 162 240 347 1 250 345 853 885 TG 173 99 140 699 417 81 202 116 TI 61 65 71 016 35 11 25 618 VD 139 118 94 980 1 062 398 974 143 VS 33 17 9 641 81 17 37 478 NE 8 5 3 507 104 44 100 566 GE 3 2 2 460 117 34 86 075 JU 50 28 25 381 410 200 462 282 Schweiz 7 237 7 413 6 900 360 11 515 2 834 6 792 924 Zone 1 Tal 1 944 2 079 3 024 600 6 260 1 578 3 937 937 Hügel 855 696 840 196 2 176 586 1 457 041 BZ I 1 090 853 676 029 1 323 318 675 126 BZ II 2 103 2 622 1 808 771 1 159 264 554 555 BZ III 898 820 394 919 462 74 143 550 BZ IV 347 343 155 845 135 13 24 715 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 35c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2010
A38 Anhang
Buntbrachen Rotationsbrachen Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr. Anzahl ha Fr. Kanton ZH 279 184 515 099 62 77 177 468 BE 228 204 571 882 34 34 77 384 LU 30 16 44 072 9 6 14 582 UR 0 0 0 0 0 0 SZ 0 0 0 0 0 0 OW 0 0 0 0 0 0 NW 0 0 0 0 0 0 GL 0 0 0 0 0 0 ZG 8 5 12 628 2 1 2 300 FR 193 182 509 705 15 22 49 795 SO 41 50 140 285 15 21 48 001 BL 97 91 253 736 34 49 112 930 SH 158 134 374 164 9 7 14 950 AR 0 0 0 0 0 0 AI 0 0 0 0 0 0 SG 25 18 49 616 0 0 0 GR 19 13 37 016 5 11 24 794 AG 367 163 457 380 77 86 197 800 TG 93 88 245 448 18 18 41 262 TI 4 4 12 544 5 11 25 093 VD 273 373 1 044 260 59 92 212 727 VS 3 4 10 388 1 4 8 602 NE 25 30 83 748 7 4 8 901 GE 64 137 383 236 28 55 127 121 JU 55 70 197 176 4 11 24 610 Schweiz 1 962 1 764 4 942 383 384 508 1 168 320 Zone 1 Tal 1 651 1 540 4 315 392 319 423 973 483 Hügel 299 219 612 609 64 83 191 617 BZ I 8 4 10 052 0 0 0 BZ II 4 2 4 330 1 1 3 220 BZ III 0 0 0 0 0 0 BZ IV 0 0 0 0 0 0 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 35d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2010
A39 Anhang
Ackerschonstreifen Saum auf Ackerfläche Hochstamm-Feldobstbäume Total Total Total Betriebe Fläche Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Betriebe Bäume Beiträge Anzahl ha Fr. Anzahl ha Fr. Anzahl Anzahl Fr. Kanton ZH 9 4 5 720 26 6 13 409 2 313 152 401 2 285 379 BE 13 4 5 144 36 8 17 965 7 653 401 585 6 022 732 LU 3 2 1 963 6 1 3 105 3 884 261 527 3 922 893 UR 0 0 213 9 937 149 055 SZ 0 0 954 68 785 1 031 775 OW 0 0 413 21 777 326 655 NW 0 0 331 17 599 263 985 GL 0 0 132 5 390 80 850 ZG 1 1 1 755 6 1 2 691 459 47 269 709 035 FR 8 2 2 839 28 9 19 616 1 693 73 915 1 108 725 SO 1 3 3 822 5 1 1 789 1 056 96 890 1 453 350 BL 0 17 8 18 952 832 123 246 1 848 690 SH 1 0 130 1 1 1 242 346 20 848 312 720 AR 0 0 321 18 177 272 655 AI 0 0 75 4 048 60 720 SG 4 2 2 795 3 1 1 748 2 673 216 401 3 246 015 GR 8 1 1 196 0 539 31 498 472 470 AG 3 0 234 91 17 39 836 2 345 177 954 2 669 310 TG 4 1 1 183 9 2 4 554 1 938 220 735 3 310 598 TI 0 1 0 1 012 247 20 940 314 100 VD 19 16 21 112 9 2 5 589 1 791 96 587 1 448 805 VS 2 2 3 094 1 0 690 747 54 994 824 869 NE 0 0 162 9 592 143 880 GE 1 0 65 3 0 690 104 5 029 75 435 JU 5 1 780 10 2 3 818 620 56 792 851 880 Schweiz 82 40 51 832 252 59 136 706 31 841 2 213 916 33 206 581 Zone 1 Tal 56 30 39 648 193 47 108 908 15 225 1 106 678 16 598 052 Hügel 16 7 9 298 49 10 22 091 6 263 511 542 7 673 130 BZ I 4 2 2 171 9 2 5 270 5 209 328 834 4 932 510 BZ II 0 0 0 1 0 437 3 676 187 395 2 810 884 BZ III 5 0 637 0 0 0 1 212 66 940 1 004 100 BZ IV 1 0 78 0 0 0 256 12 527 187 905 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 36
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2010
A40 Anhang
Biologische Qualität 1 Vernetzung 1 Beiträge Bund Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Total Beiträge Anzahl ha Anzahl ha Anzahl Fr. Kanton ZH 1 465 2 667 1 616 4 156 2 045 5 198 995 BE 4 839 5 797 8 497 16 296 8 794 14 478 848 LU 2 606 2 876 1 442 3 413 2 906 5 687 602 UR 309 627 283 762 401 691 299 SZ 1 222 2 683 1 061 3 026 1 290 3 793 597 OW 403 588 264 556 422 718 182 NW 306 580 272 586 343 748 747 GL 204 402 61 216 217 344 756 ZG 420 886 404 1 377 478 1 966 696 FR 474 620 647 1 799 903 1 753 729 SO 246 415 219 474 404 841 558 BL 610 1 481 562 1 694 629 1 894 347 SH 208 406 170 508 248 773 128 AR 274 283 170 232 287 430 596 AI 236 244 255 322 297 436 534 SG 2 172 3 058 1 754 3 713 2 604 5 400 892 GR 1 637 5 033 1 342 5 171 1 674 5 167 593 AG 988 2 510 704 2 763 994 3 937 039 TG 891 889 1 656 2 230 1 843 2 558 574 TI 234 565 56 323 251 464 696 VD 1 152 2 347 370 1 387 1 333 1 893 316 VS 458 865 157 840 520 732 116 NE 329 864 126 447 379 504 914 GE 49 66 0 0 49 43 174 JU 382 1 480 244 1 543 477 1 516 780 Schweiz 22 114 38 230 22 332 53 833 29 788 61 977 708 Zone Tal 7 255 9 516 8 244 16 414 11 164 21 434 361 Hügel 3 335 5 051 3 052 6 825 4 305 9 571 935 BZ I 2 942 3 871 3 193 5 933 4 151 7 414 513 BZ II 4 099 7 973 3 951 10 136 5 131 11 548 169 BZ III 2 817 6 627 2 624 8 603 3 234 7 047 133 BZ IV 1 666 5 193 1 268 5 921 1 803 4 961 597 1 Hochstamm umgerechnet in Aren Quelle: BLW
Tabelle 37
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2010
A41 Anhang
Brotgetreide Futtergetreide Raps Total Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Fr. Kanton ZH 1 165 4 680 731 1 427 85 212 2 520 238 BE 2 361 6 939 2 889 5 669 110 238 5 138 658 LU 675 1 492 610 1 134 86 175 1 120 696 UR 0 0 0 0 0 0 0 SZ 2 3 11 13 0 0 6 240 OW 0 0 0 0 0 0 0 NW 0 0 0 0 0 0 0 GL 0 0 1 2 0 0 604 ZG 24 49 31 61 4 16 50 396 FR 717 3 385 690 1 864 56 191 2 176 187 SO 472 1 993 472 1 337 42 97 1 365 348 BL 396 1 531 440 1 269 20 74 1 133 507 SH 315 2 127 118 323 44 119 1 009 914 AR 0 0 1 1 0 0 297 AI 0 0 0 0 0 0 0 SG 69 197 181 360 18 37 235 444 GR 121 362 142 248 14 36 258 324 AG 1 282 4 756 970 2 214 94 193 2 863 985 TG 657 2 395 356 661 40 93 1 258 703 TI 29 132 34 117 1 4 101 464 VD 1 277 9 856 1 174 4 324 508 1 969 6 454 527 VS 66 237 32 48 1 1 114 708 NE 148 862 262 1 277 34 119 903 364 GE 190 2 529 167 910 20 82 1 343 831 JU 283 1 690 345 1 413 27 107 1 279 990 Schweiz 10 249 45 215 9 657 24 674 1 204 3 765 29 336 425 Zone 1 Tal 7 355 36 565 5 150 13 785 945 2 999 21 227 427 Hügel 2 174 6 862 2 629 6 199 200 574 5 441 164 BZ I 582 1 535 1 408 3 636 53 174 2 137 854 BZ II 98 203 386 966 6 19 475 260 BZ III 26 37 68 75 0 0 44 696 BZ IV 14 13 16 12 0 0 10 024 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil
LN,
Betrieb
Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
der
die ein
in einer
Tabelle 38
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2010
1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A42 Anhang
Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme Regelmässiger Auslauf im Freien Betriebe GVE Total Beiträge Betriebe GVE Total Beiträge Anzahl Anzahl Fr. Anzahl Anzahl Fr. Kanton ZH 1 275 34 405 3 669 985 1 952 47 953 8 732 321 BE 3 887 83 672 10 012 426 8 912 184 123 33 480 110 LU 2 729 80 160 9 738 118 3 777 101 415 18 621 872 UR 111 1 399 132 721 428 5 614 1 011 470 SZ 435 8 447 925 896 1 109 21 393 3 878 106 OW 262 5 161 547 421 469 9 160 1 661 671 NW 160 3 485 413 755 274 5 404 971 658 GL 99 1 825 188 811 305 6 482 1 169 491 ZG 254 8 038 806 682 389 10 662 1 892 576 FR 1 475 49 071 5 846 850 2 336 79 758 14 335 342 SO 617 15 789 1 686 636 1 013 24 889 4 499 785 BL 422 11 046 1 190 978 612 15 174 2 855 520 SH 202 7 469 917 462 220 6 247 1 130 622 AR 196 4 048 472 367 603 14 029 2 556 278 AI 164 4 194 616 150 411 9 410 1 766 620 SG 1 463 40 275 4 774 904 2 948 77 892 14 343 676 GR 1 064 22 678 2 144 732 2 221 46 687 8 409 341 AG 1 256 34 363 4 236 635 1 670 39 639 7 478 914 TG 1 121 39 777 4 678 066 1 623 48 271 8 731 356 TI 199 3 610 345 214 598 9 106 1 737 033 VD 1 213 39 353 4 288 930 2 044 60 577 10 903 642 VS 299 4 424 464 052 1 267 17 453 3 179 916 NE 351 12 390 1 221 022 646 23 374 4 166 458 GE 35 920 104 904 80 1 617 299 853 JU 621 24 223 2 303 812 888 34 464 6 089 413 Schweiz 19 910 540 222 61 728 529 36 795 900 790 163 903 044 Zone 1 Tal 9 299 297 637 35 035 192 13 553 385 742 70 315 371 Hügel 3 494 93 080 10 943 604 5 617 142 534 26 068 287 BZ I 2 684 63 662 7 020 753 5 271 127 379 23 066 630 BZ II 2 565 54 496 5 767 651 6 336 141 739 25 660 475 BZ III 1 201 20 621 1 965 719 3 880 68 217 12 380 360 BZ IV 667 10 727 995 610 2 138 35 179 6 411 921
Quelle: BLW
Tabelle 39
Beteiligung am BTS-Programm 2010
A43 Anhang
Basis 1 BTS-Beteiligung Tierkategorie GVE Betriebe GVE Betriebe GVE Betriebe Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl % % Milchkühe 587 870 32 769 207 757 6 982 35.3 21.3 andere Kühe 86 541 15 160 67 688 5 619 78.2 37.1 weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung 155 733 38 642 63 542 12 137 40.8 31.4 weibliche Tiere, über 120−365 Tage alt 54 275 38 403 24 248 12 435 44.7 32.4 männliche Tiere, über 730 Tage alt 3 948 8 864 1 974 3 608 50.0 40.7 männliche Tiere, über 365−730 Tage alt 12 155 15 191 6 378 4 539 52.5 29.9 männliche Tiere, über 120−365 Tage alt 31 292 29 103 16 482 7 174 52.7 24.7 Total Rindergattung 931 813 40 580 388 069 16 371 41.6 40.3 weibliche und kastrierte männliche Tiere, über 30 Monate alt 32 445 9 908 4 049 1 219 12.5 12.3 Hengste, über 30 Monate alt 1 322 1 874 108 123 8.2 6.6 Total Pferdegattung 33 766 10 417 4 157 1 241 12.3 11.9 weibliche Tiere, über ein Jahr alt 9 301 5 664 3 279 889 35.3 15.7 männliche Tiere, über ein Jahr alt 676 2 760 168 533 24.9 19.3 Total Ziegengattung 9 977 6 436 3 447 980 34.6 15.2 Zuchteber, über halbjährig 736 2 183 164 482 22.3 22.1 nicht säugende Zuchtsauen, über halbjährig 22 616 2 616 15 117 1 289 66.8 49.3 säugende Zuchtsauen 17 354 2 822 11 035 1 405 63.6 49.8 abgesetzte Ferkel 17 540 2 736 11 082 1 281 63.2 46.8 Remonten, bis halbjährig, und Mastschweine 101 364 7 642 64 193 3 319 63.3 43.4 Total Schweinegattung 159 609 8 750 101 591 4 021 63.6 46.0 Kaninchen 846 2 829 216 94 25.5 3.3 Total Kaninchen 846 2 829 216 94 25.5 3.3 Zuchthennen und Zuchthähne (Bruteierproduktion für Lege- und Mastlinien) 929 1 561 306 60 32.9 3.8 Legehennen 21 286 11 364 18 568 1 622 87.2 14.3 Junghennen, Junghähne und Küken (ohne Mastpoulets) 3 246 513 2 506 142 77.2 27.7 Mastpoulets 22 906 1 059 20 269 807 88.5 76.2 Truten 1 133 201 1 079 57 95.2 28.4 Total Nutzgeflügel 49 500 12 636 42 728 2 534 86.3 20.1 Total alle Kategorien 1 185 511 45 091 540 208 19 749 45.6 43.8 1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe, die Direktzahlungen erhalten haben) Quelle: BLW
Tabelle 40
Beteiligung am RAUS-Programm 2010
A44 Anhang
Basis 1 RAUS-Beteiligung Tierkategorie GVE Betriebe GVE Betriebe GVE Betriebe Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl % % Milchkühe 587 870 32 769 468 370 22 687 79.7 69.2 andere Kühe 86 541 15 160 75 213 7 187 86.9 47.4 weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung 155 733 38 642 118 484 25 273 76.1 65.4 weibliche Tiere, über 120−365 Tage alt 54 275 38 403 38 048 23 561 70.1 61.4 weibliche Tiere, bis 120 Tage alt 10 771 37 816 3 882 13 184 36.0 34.9 männliche Tiere, über 730 Tage alt 3 948 8 864 2 561 4 806 64.9 54.2 männliche Tiere, über 365−730 Tage alt 12 155 15 191 6 307 6 662 51.9 43.9 männliche Tiere, über 120−365 Tage alt 31 292 29 103 15 967 10 482 51.0 36.0 männliche Tiere, bis 120 Tage alt 11 061 37 335 2 969 10 011 26.8 26.8 Total Rindergattung 953 645 40 587 731 803 31 381 76.7 77.3 weibliche und kastrierte männliche Tiere, über 30 Monate alt 32 445 9 908 26 907 7 453 82.9 75.2 Hengste, über 30 Monate alt 1 322 1 874 773 835 58.5 44.6 Tiere, bis 30 Monate alt 3 037 2 481 2 397 1 493 78.9 60.2 Total Pferdegattung 36 803 10 673 30 077 7 645 81.7 71.6 weibliche Tiere, über ein Jahr alt 9 301 5 664 7 169 3 153 77.1 55.7 männliche Tiere, über ein Jahr alt 676 2 760 375 1 405 55.4 50.9 Total Ziegengattung 9 977 6 436 7 544 3 374 75.6 52.4 weibliche Tiere, über ein Jahr alt 37 690 8 545 31 838 6 145 84.5 71.9 männliche Tiere, über ein Jahr alt 1 558 6 122 1 090 4 170 70.0 68.1 Weidelämmer 228 639 178 366 78.0 57.3 Total Schafgattung 39 476 8 608 33 106 6 167 83.9 71.6 Zuchteber, über halbjährig 736 2 183 396 1 163 53.8 53.3 nicht säugende Zuchtsauen, über halbjährig 22 616 2 616 15 079 1 354 66.7 51.8 säugende Zuchtsauen 17 354 2 822 1 046 267 6.0 9.5 abgesetzte Ferkel 17 540 2 736 783 204 4.5 7.5 Remonten, bis halbjährig, und Mastschweine 101 364 7 642 61 833 3 328 61.0 43.5 Total Schweinegattung 159 609 8 750 79 135 3 943 49.6 45.1 Kaninchen 846 2 829 14 147 1.6 5.2 Total Kaninchen 846 2 829 14 147 1.6 5.2 Zuchthennen und Zuchthähne (Bruteierproduktion für Lege- und Mastlinien) 563 572 240 25 42.7 4.4 Legehennen 21 286 11 364 15 021 2 678 70.6 23.6 Junghennen, Junghähne und Küken (ohne Mastpoulets) 3 246 513 658 99 20.3 19.3 Mastpoulets 22 906 1 059 2 216 187 9.7 17.7 Truten 1 133 201 1 072 79 94.6 39.3 Total Nutzgeflügel 49 133 12 636 19 207 2 942 39.1 23.3 Total alle Kategorien 1 249 489 46 597 900 885 36 610 72.1 78.6 1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe, die Direktzahlungen erhalten haben) Quelle: BLW
Tabelle 41a
Sömmerungsbeiträge 2010
Kantone Schafe Kühe gemolken, Milchschafe Übrige Raufutter Betriebe und (ohne Milchschafe) und Milchziegen 1 verzehrende Tiere Beiträge Total
A45 Anhang
Betriebe Beitrags- Betriebe Beitrags- Betriebe Beitrags- Betriebe Beiträge berechtigter berechtigte berechtigter Besatz GVE Besatz Anzahl Normalstösse Anzahl GVE Anzahl Normalstösse Anzahl Fr. ZH 0 0 0 0 7 330 7 108 917 BE 182 2 344 387 11 243 1 557 48 940 1 662 20 882 737 LU 36 298 2 28 231 6 149 236 2 113 089 UR 65 1 521 111 2 096 252 5 015 329 2 708 117 SZ 48 678 165 1 787 416 9 779 441 4 256 600 OW 21 190 47 549 237 8 453 254 3 013 541 NW 17 188 4 29 128 4 159 134 1 445 608 GL 13 460 2 26 110 6 686 118 2 359 715 ZG 0 0 1 3 9 208 9 69 534 FR 42 530 28 652 585 22 975 607 7 997 655 SO 1 3 1 7 62 2 458 62 816 076 BL 1 20 0 0 9 348 10 119 930 SH 0 0 0 0 1 100 1 32 878 AR 0 0 22 318 110 2 374 111 895 830 AI 8 90 76 1 129 141 1 863 147 1 093 236 SG 32 1 062 75 3 828 415 17 135 428 7 218 129 GR 176 7 910 225 11 207 839 36 314 957 18 119 305 AG 2 15 0 0 6 343 8 116 921 TG 0 0 0 0 6 329 6 108 548 TI 87 2 277 59 3 500 195 4 643 247 3 304 358 VD 32 748 8 175 622 32 808 639 11 056 445 VS 154 5 884 109 5 357 440 16 382 522 8 288 392 NE 1 117 1 46 145 4 348 147 1 490 606 GE 0 0 0 0 1 6 1 1 841 JU 2 103 0 0 104 10 983 104 3 656 697 Total 920 24 440 1 323 41 978 6 628 243 126 7 187 101 274 705 1 Gemolkene Tiere mit einer Sömmerungsdauer von 56 bis 100 Tagen Quelle: BLW
Tabelle 41b
Sömmerungsstatistik 2010: Betriebe und Normalstösse nach Kantonen
A46 Anhang
Kantone Milchkühe Mutter- und Anderes Pferde Schafe Ziegen Andere Ammenkühe Rindvieh und andere Kühe Betriebe Besatz Betriebe Besatz Betriebe Besatz Betriebe Besatz Betriebe Besatz Betriebe Besatz Betriebe Besatz Anzahl NST Anzahl NST Anzahl NST Anzahl NST Anzahl NST Anzahl NST Anzahl NST ZH 0 0 3 13 7 270 0 0 0 0 0 0 0 0 BE 1 074 26 029 360 3 117 1 519 26 191 226 920 192 2 903 446 815 8 54 LU 85 1 122 95 844 230 3 711 17 25 37 290 36 48 4 20 UR 206 3 618 57 583 180 2 241 11 10 68 1 639 64 295 0 0 SZ 306 3 559 85 845 402 6 732 43 127 57 687 109 260 2 1 OW 204 4 731 21 273 232 3 297 19 23 23 196 29 39 21 108 NW 80 1 687 32 321 124 1 911 15 18 17 256 19 62 21 106 GL 99 3 632 25 398 109 2 539 21 25 13 410 35 39 48 91 ZG 2 39 1 0 9 161 0 0 0 0 0 0 0 0 FR 251 6 887 167 1 460 569 13 470 71 231 49 688 94 243 3 1 SO 9 109 27 512 60 1 594 9 95 4 18 4 6 0 0 BL 0 0 4 72 9 259 0 0 1 18 1 1 0 0 SH 0 0 0 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 AR 80 1 308 8 58 106 1 113 7 12 0 0 38 41 16 48 AI 118 1 511 3 12 134 1 267 5 4 8 80 45 84 20 41 SG 263 7 100 138 1 665 401 9 980 33 88 37 1 632 120 232 2 3 GR 365 12 880 597 11 629 739 19 084 233 826 195 7 435 138 1 075 7 8 AG 0 0 3 57 6 267 1 1 2 15 0 0 0 0 TG 0 0 5 131 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 TI 96 3 573 76 679 128 1 081 49 160 90 2 135 105 1 940 33 45 VD 321 12 481 236 3 960 600 14 675 90 249 36 929 50 102 7 6 VS 247 10 551 223 3 687 363 6 067 59 180 162 5 711 73 631 1 0 NE 23 585 47 522 137 2 995 15 94 1 97 1 1 GE 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 JU 25 3 201 50 1 501 100 4 616 38 1 283 3 113 4 13 1 1 Total 3 854 104 602 2 263 32 343 6 171 123 816 963 4 376 995 25 252 1 411 5 928 194 532 Ein Normalstoss (NST) = 1 GVE * Sömmerungsdauer / 100 Quelle: BLW
Tabelle 42a
Direktzahlungen auf Betriebsebene 1: nach Zonen und Grössenklassen 2010 2
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung von ART
2 Ohne die Betriebstypen Spezialkulturen und Veredlung
3 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge
Tabelle 42b
Direktzahlungen auf Betriebsebene 1: nach Zonen und Grössenklassen 2010 2
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung von ART
2 Ohne die Betriebstypen Spezialkulturen und Veredlung
3 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge
A47 Anhang
Talzone HZ Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 469 441 231 229 157 74 Vertretene Betriebe Anzahl 7 268 4 961 3 322 2 908 1 490 940 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15.52 24.28 37.17 15.02 23.96 36.28 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr. 28 697 45 037 66 497 33 842 51 162 77 992 Flächenbeiträge Fr. 20 155 32 049 49 657 17 328 28 676 43 651 Raufutterverzehrerbeiträge Fr. 7 873 12 123 15 732 9 440 13 102 20 421 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr. 405 596 791 5 080 6 714 10 145 Hangbeiträge Fr. 265 269 316 1 995 2 671 3 776 Ökobeiträge und Ethobeiträge total Fr. 7 837 11 411 17 001 7 488 11 239 17 373 Ökologischer Ausgleich Fr. 2 483 3 333 5 519 2 239 3 380 5 014 Extensive Produktion Fr. 696 1 009 1 802 528 886 1 531 Biologischer Landbau Fr. 442 404 1 035 304 488 479 Ethobeiträge Fr. 4 217 6 665 8 646 4 417 6 485 10 350 Total Direktzahlungen nach DZV Fr. 36 534 56 448 83 498 41 330 62 401 95 365 Rohleistung Fr. 214 218 321 095 414 113 185 543 274 523 400 625 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung % 17.1 17.6 20.2 22.3 22.7 23.8 Andere Direktzahlungen 3 Fr. 4 317 5 980 10 675 3 358 5 258 6 742 Total Direktzahlungen Fr. 40 851 62 428 94 173 44 689 67 659 102 108 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung % 19.1 19.4 22.7 24.1 24.6 25.5
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon
ART
BZ I BZ II Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 214 131 64 170 168 71 Vertretene Betriebe Anzahl 2 635 1 272 668 2 402 1 759 896 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15.20 24.80 37.82 15.06 24.32 38.01 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr. 39 027 60 188 88 083 41 671 63 009 89 077 Flächenbeiträge Fr. 16 326 26 802 42 248 15 787 25 799 38 781 Raufutterverzehrerbeiträge Fr. 9 873 15 054 20 711 9 254 13 719 19 352 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr. 9 271 13 891 20 390 12 623 18 395 26 151 Hangbeiträge Fr. 3 558 4 440 4 734 4 007 5 096 4 793 Ökobeiträge und Ethobeiträge total Fr. 6 104 11 983 15 027 5 700 9 222 12 776 Ökologischer Ausgleich Fr. 1 505 3 094 2 931 1 408 2 007 1 924 Extensive Produktion Fr. 144 419 1 143 17 71 119 Biologischer Landbau Fr. 478 1 541 1 205 789 1 282 1 569 Ethobeiträge Fr. 3 977 6 929 9 748 3 486 5 862 9 165 Total Direktzahlungen nach DZV Fr. 45 131 72 171 103 110 47 370 72 232 101 853 Rohleistung Fr. 175 073 252 655 342 436 154 945 221 818 292 720 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung % 25.8 28.6 30.1 30.6 32.6 34.8 Andere Direktzahlungen 3 Fr. 3 511 5 609 8 478 5 581 7 161 7 473 Total Direktzahlungen Fr. 48 642 77 780 111 588 52 952 79 393 109 326 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung % 27.8 30.8 32.6 34.2 35.8 37.3
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabelle 42c
Direktzahlungen auf Betriebsebene 1: nach Zonen und Grössenklassen 2010 2
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung von ART
2 Ohne die Betriebstypen Spezialkulturen und Veredlung
3 Aufgrund der zu kleinen Stichprobe werden keine Ergebnisse dargestellt
4 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A48
Anhang
BZ III BZ IV Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 3 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 111 70 44 59 39 13 Vertretene Betriebe Anzahl 1 665 820 636 1 111 500 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14.84 24.79 37.16 14.97 24.58 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr. 45 742 71 003 93 719 49 496 74 272 Flächenbeiträge Fr. 15 286 25 882 37 975 15 862 25 504 Raufutterverzehrerbeiträge Fr. 9 613 14 563 17 370 9 807 14 515 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr. 15 308 23 202 29 349 17 596 25 672 Hangbeiträge Fr. 5 534 7 355 9 024 6 232 8 580 Ökobeiträge und Ethobeiträge total Fr. 4 894 8 292 11 798 5 026 7 897 Ökologischer Ausgleich Fr. 1 437 1 804 2 665 1 745 1 995 Extensive Produktion Fr. 2 19 19 0 0 Biologischer Landbau Fr. 694 1 822 2 903 1 032 1 879 Ethobeiträge Fr. 2 762 4 647 6 210 2 249 4 023 Total Direktzahlungen nach DZV Fr. 50 636 79 295 105 516 54 522 82 169 Rohleistung Fr. 131 596 202 593 239 651 119 832 189 716 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung % 38.5 39.1 44.0 45.5 43.3 Andere Direktzahlungen 4 Fr. 6 128 7 793 10 065 6 295 8 604 Total Direktzahlungen Fr. 56 764 87 088 115 581 60 817 90 773 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung % 43.1 43.0 48.2 50.8 47.8
Tabelle 43
Direktzahlungen auf Betriebsebene 1: nach Regionen 2010
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART
2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A49 Anhang
Merkmal Einheit Alle Tal- Hügel- BergBetriebe region region region Referenzbetriebe Anzahl 3 202 1 358 998 846 Vertretene Betriebe Anzahl 47 166 21 543 12 972 12 651 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 21.06 22.17 19.71 20.55 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr. 45 346 39 541 45 237 55 342 Flächenbeiträge Fr. 25 125 29 113 22 333 21 195 Raufutterverzehrerbeiträge Fr. 10 583 9 476 11 535 11 490 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr. 7 206 521 8 333 17 434 Hangbeiträge Fr. 2 433 431 3 037 5 222 Ökobeiträge und Ethobeiträge total Fr. 9 014 10 018 9 338 6 972 Ökologischer Ausgleich Fr. 2 591 3 200 2 486 1 660 Extensive Produktion Fr. 627 1 006 572 38 Biologischer Landbau Fr. 691 540 537 1 105 Ethobeiträge Fr. 5 105 5 272 5 742 4 169 Total Direktzahlungen nach DZV Fr. 54 360 49 559 54 575 62 314 Rohleistung Fr. 250 181 304 343 234 042 174 501 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung % 21.7 16.3 23.3 35.7 Direktzahlungen pro ha Fr./ha 2 581 2 236 2 769 3 032 Andere Direktzahlungen 2 Fr. 5 515 5 819 4 311 6 230 Total Direktzahlungen Fr. 59 874 55 378 58 886 68 544 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung % 23.9 18.2 25.2 39.3
Tabelle 44a
ÖLN-Kontrollen 2010
Quelle: AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2010
Beanstandungen
angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe in diesem Kanton
A50
Anhang
Anzahl % Anzahl Anzahl Anzahl ZH 3 330 54.14 1 803 0 0 76 6 3 18 0 0 0 189 292 BE 11 376 20.97 2 386 11 211 74 113 60 79 6 12 113 7 686 LU 4 718 33.91 1 600 0 46 357 75 11 14 4 2 16 12 537 UR 597 69.35 414 0 27 23 0 3 3 0 0 0 5 61 SZ 1 558 42.68 665 0 53 29 30 0 6 1 1 0 0 120 OW 635 63.31 402 0 37 2 3 3 2 0 0 0 0 47 NW 466 54.29 253 0 87 69 0 3 6 0 2 0 39 206 GL 378 26.72 101 0 8 2 2 1 8 0 0 0 0 21 ZG 521 44.34 231 0 9 5 3 1 0 0 0 1 0 19 FR 2 868 28.14 807 1 80 7 7 8 2 2 4 1 8 120 SO 1 320 100.38 1 325 4 51 8 0 1 7 1 0 0 0 72 BL 890 65.62 584 0 22 21 2 0 2 2 0 3 18 70 SH 541 51.57 279 0 6 4 0 0 3 2 3 7 7 32 AR 692 27.02 187 0 16 12 4 0 6 0 0 0 10 48 AI 497 36.22 180 0 19 12 2 0 0 0 0 0 0 33 SG 3 958 32.11 1 271 0 90 289 4 18 3 0 0 0 19 423 GR 2 413 95.98 2 316 0 68 59 1 80 24 0 0 7 0 239 AG 2 877 39.90 1 148 13 77 83 1 15 29 6 43 6 3 276 TG 2 443 51.53 1 259 0 46 126 38 27 49 7 7 29 29 358 TI 821 37.64 309 0 30 40 0 0 1 0 0 0 25 96 VD 3 600 34.92 1 257 21 95 29 29 2 33 2 13 15 1 240 VS 3 159 51.95 1 641 174 40 83 4 4 1 1 0 1 99 407 NE 835 36.77 307 10 0 5 0 2 3 1 1 0 31 53 GE 280 67.86 190 8 0 2 2 2 0 6 1 7 2 30 JU 1 008 32.94 332 0 0 29 7 7 7 2 1 3 0 56 CH 51 781 41.03 21 247 242 1 118 1 446 333 251 306 43 90 209 504 4 542 Falls Anzahl kontrollierter Betriebe > Anzahl direktzahlungsberechtigter Betriebe, gibt es mehr
Kanton DZ-berechtigte Betriebe Kontrollierte Betriebe in % aller beitragsberechtigten Betriebe Kontrollierte Betriebe Nicht rechtzeitige Anmeldung
Aufzeichnungen Ausgeglichene Düngerbilanz Angemessener
Grasstreifen Geregelte Fruchtfolge Geeigneter Bodenschutz Auswahl und gezielte Anwendung von
Andere Total Beanstandungen
Tiergerechte Haltung der Nutztiere
Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen Pufferstreifen /
Pflanzenbehandlungsmitteln
ÖLN-Kontrollen 2010
Falls Anzahl kontrollierter Betriebe > Anzahl direktzahlungsberechtigter Betriebe, gibt es mehr angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe in diesem Kanton
Quelle: AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2010
A51 Anhang
Tabelle 44b
% % Anzahl % % Fr. Fr. ZH 8.77 16.20 65 1.95 3.61 1 398.95 90 932 BE 6.03 28.75 686 6.03 28.75 578.39 396 774 LU 11.38 33.56 91 1.93 5.69 1 887.67 171 778 UR 10.22 14.73 48 8.04 11.59 725.69 34 833 SZ 7.70 18.05 68 4.36 10.23 1 613.76 109 736 OW 7.40 11.69 47 7.40 11.69 843.15 39 628 NW 44.21 81.42 36 7.73 14.23 663.42 23 883 GL 5.56 20.79 8 2.12 7.92 2 416.50 19 332 ZG 3.65 8.23 14 2.69 6.06 1 240.21 17 363 FR 4.18 14.87 105 3.66 13.01 1 557.94 163 584 SO 5.45 5.43 71 5.38 5.36 2 134.82 151 572 BL 7.87 11.99 19 2.13 3.25 527.05 10 014 SH 5.91 11.47 16 2.96 5.73 900.38 14 406 AR 6.94 25.67 26 3.76 13.90 2 540.88 66 063 AI 6.64 18.33 13 2.62 7.22 3 897.15 50 663 SG 10.69 33.28 422 10.66 33.20 518.54 218 822 GR 9.90 10.32 86 3.56 3.71 3 459.19 297 490 AG 9.59 24.04 143 4.97 12.46 1 436.28 205 388 TG 14.65 28.44 120 4.91 9.53 1 321.37 158 564 TI 11.69 31.07 6 0.73 1.94 689.83 4 139 VD 6.67 19.09 183 5.08 14.56 1 457.45 266 714 VS 12.88 24.80 50 1.58 3.05 1 152.62 57 631 NE 6.35 17.26 18 2.16 5.86 2 160.39 38 887 GE 10.71 15.79 11 3.93 5.79 1 564.00 17 204 JU 5.56 16.87 13 1.29 3.92 2 337.85 30 392 CH 8.77 21.38 2 365 4.57 11.13 1 122.96 2 655 792
Kanton Beanstandungen
direktzahlungsberechtigte Betriebe Beanstandungen
Betriebe Betriebe
direktzahlungsberechtigte Betriebe Betriebe
Kürzungen
kontrollierte Betriebe Kürzung in Fr. pro Betrieb mit Kürzungen Kürzungen Total
pro 100
pro 100 kontrollierte
mit Kürzungen Betriebe mit Kürzungen pro 100
mit
pro 100
Ausgaben für Grundlagenverbesserung
Tabelle 45
An die Kantone ausbezahlte Beiträge 2010
an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2010
A52 Anhang
Kanton Bodenverbesserungen Landwirtschaftliche Gebäude Total Beiträge Fr. Fr. Fr. ZH 1 520 197 247 800 1 767 997 BE 8 098 135 4 469 225 12 567 360 LU 5 304 937 886 500 6 191 437 UR 553 000 364 300 917 300 SZ 1 923 990 992 200 2 916 190 OW 236 589 707 928 944 517 NW 493 741 409 115 902 856 GL 285 904 264 710 550 614 ZG 235 000 235 000 FR 4 674 865 3 391 000 8 065 865 SO 2 029 173 765 370 2 794 543 BL 393 247 504 100 897 347 SH 430 822 93 100 523 922 AR 494 230 547 050 1 041 280 AI 278 370 237 000 515 370 SG 3 624 578 1 855 700 5 480 278 GR 15 861 174 3 818 200 19 679 374 AG 1 060 659 427 000 1 487 659 TG 259 508 124 500 384 008 TI 826 185 515 000 1 341 185 VD 5 143 703 868 700 6 012 403 VS 3 698 600 531 100 4 229 700 NE 699 392 1 013 782 1 713 174 GE 34 234 34 234 JU 3 097 732 610 680 3 708 412 Diverse 97 975 97 975 Total 61 120 940 23 879 060 85 000 000 Quelle: BLW
Tabelle 46 Beiträge
Massnahmen Beiträge Gesamtkosten Talregion Hügelregion Bergregion Total Total 1 000 Fr. Bodenverbesserungen Landumlegungen (inkl. Infrastrukturmassnahmen) 1 199 3 616 11 757 16 572 39 893 Wegebauten 1 587 4 560 13 366 19 513 74 763 Übrige Transportanlagen 732 732 3 917 Massnahmen zum Boden-Wasserhaushalt 1 377 621 3 224 5 222 18 400 Wasserversorgungen 44 2 096 10 388 12 528 51 934 Elektrizitätsversorgungen 23 6 572 601 2 373 Wiederherstellungen und Sicherungen 1 487 1 661 2 149 6 550 Grundlagenbeschaffungen 168 363 531 1 529 Periodische Wiederinstandstellung 1 124 258 1 958 3 340 19 072 Projekte zur regionalen Entwicklung 250 5 865 6 115 24 338 Total 5 771 11 644 49 886 67 301 242 769 Landwirtschaftliche Gebäude Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere 6 757 11 098 17 855 149 673 Alpgebäude 66 1 413 1 480 12 033 Gewerbliche Kleinbetriebe 293 348 642 5 869 Gem. Einrichtungen und Bauten für die Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung landw. Produkte 1 778 798 2 575 17 874 Total 8 894 13 657 22 551 185 449 Gesamttotal 5 771 20 538 63 543 89 852 428 218 1 inkl. Unwetterschäden Quelle: BLW
Tabelle 47
Von den Kantonen bewilligte Investitionskredite 2010
A53 Anhang
Kanton Bodenverbesserungen Landwirtschaftlicher Hochbau Total Gemeinschaftliche Massnahmen Gemeinschaftliche M. Einzelbetriebliche M. Baukredite Investitionskredite Investitionskredite Investitionskredite Anzahl 1 000 Fr. Anzahl 1 000 Fr. Anzahl 1 000 Fr. Anzahl 1 000 Fr. Anzahl 1 000 Fr. ZH 5 197 103 19 462 108 19 659 BE 1 130 7 2 297 15 1 657 354 47 281 377 51 365 LU 12 4 690 7 682 1 540 185 25 105 205 31 017 UR 1 240 14 1 515 15 1 755 SZ 11 3 300 1 45 3 438 55 7 766 70 11 549 OW 2 860 1 85 1 1 500 27 3 337 31 5 782 NW 1 899 1 83 1 50 15 2 264 18 3 296 GL 1 500 14 1 857 15 2 357 ZG 13 1 561 13 1 561 FR 6 1 003 23 6 053 101 17 625 130 24 681 SO 3 412 1 74 1 37 46 8 737 51 9 260 BL 3 208 45 6 043 48 6 251 SH 2 94 30 4 197 32 4 291 AR 31 3 696 31 3 696 AI 1 176 19 2 010 20 2 186 SG 1 100 8 2 700 177 23 948 186 26 748 GR 18 14 130 12 2 949 115 15 525 145 32 604 AG 5 4 380 104 13 964 109 18 344 TG 2 63 78 13 979 80 14 042 TI 3 1 800 1 40 4 338 13 1 650 21 3 827 VD 2 830 64 9 099 141 21 402 207 31 331 VS 4 1 226 2 2 100 29 4 017 35 7 343 NE 5 510 22 3 359 27 3 869 GE 4 171 4 569 8 740 JU 3 100 62 9 400 65 9 500 Total 53 26 961 33 6 641 164 33 183 1 797 260 267 2 047 327 053 Quelle: BLW
Tabelle 48
Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2010 (ohne Baukredite)
Kanton Starthilfe Kauf Wohn- Ökonomie- Diversi- Garten- Gewerbl. Erneuer- Gemein- Boden- Total Betrieb gebäude gebäude fizierung bau Klein- bare schaftliche verbesdurch betriebe Energie
1 Gemeinschaftliche Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energie aus Biomasse
2 Gemeinschaftlicher Kauf von Maschinen und Fahrzeugen, Starthilfe für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, Gemeinschaftliche Einrichtungen und Bauten für die Verarbeitung / Lagerung landw. Produkte
A54 Anhang
1 Mass- serungen Pächter nahmen 2 1 000 Fr. ZH 4 490 1 845 12 040 1 037 50 197 19 659 BE 12 569 14 576 19 436 700 200 1 457 2 297 51 235 LU 6 449 7 473 10 573 610 540 682 26 327 UR 530 360 414 74 137 1 515 SZ 2 150 1 700 3 515 401 438 45 8 249 OW 1 360 560 1 360 57 1 500 85 4 922 NW 590 792 807 75 50 83 2 397 GL 700 680 376 101 1 857 ZG 610 500 451 1 561 FR 3 630 2 821 10 516 658 6 053 1 003 24 681 SO 1 920 960 4 450 1 034 373 37 74 8 848 BL 1 350 1 869 2 668 156 208 6 251 SH 1 090 937 2 170 94 4 291 AR 1 060 1 760 876 3 696 AI 370 970 670 176 2 186 SG 8 410 640 5 269 9 409 220 2 700 100 26 748 GR 4 660 2 841 5 609 2 415 2 949 18 474 AG 2 670 600 3 027 6 957 710 140 4 240 18 344 TG 3 320 1 781 8 618 260 63 14 042 TI 230 452 449 519 338 40 2 027 VD 5 100 2 654 13 548 100 9 099 830 31 331 VS 1 700 900 1 204 213 2 100 1 226 7 343 NE 780 455 771 1 233 120 510 3 869 GE 460 109 171 740 JU 2 280 1 713 5 183 224 100 9 500 Total 68 478 1 695 57 320 122 531 9 684 50 510 1 840 31 343 6 641 300 091
Quelle:
BLW
Tabelle 49
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2010 (Bundes- und Kantonsanteile)
A55 Anhang
Kanton Anzahl Summe pro Fall Tilgungsdauer Fr. Fr. Jahre ZH 3 893 000 297 667 16.0 BE 25 4 761 800 190 472 13.7 LU 18 3 009 500 167 194 13.9 UR 1 320 000 320 000 16.0 SZ 2 351 000 175 500 14.0 OW NW 1 90 000 90 000 12.0 GL 1 160 000 160 000 19.0 ZG 1 348 500 348 500 10.0 FR 5 611 000 122 200 9.6 SO 11 1 963 000 178 455 13.4 BL 9 711 000 79 000 10.6 SH 2 209 500 104 750 11.0 AR 5 620 000 124 000 13.0 AI 3 522 000 174 000 9.3 SG 16 2 527 000 157 938 15.1 GR 6 740 000 123 333 15.3 AG 8 1 881 000 235 125 14.4 TG 6 590 000 98 333 9.3 TI VD 20 5 635 250 281 763 15.2 VS 7 1 435 000 205 000 15.0 NE 3 550 000 183 333 12.7 GE JU 19 2 908 000 153 053 12.9 Total 172 30 836 550 Durchschnitt 179 282 13.5 Quelle: BLW
Tabelle 50a
Übersicht über Beiträge
Übersicht über
1 vom Kanton bewilligt
2 Gemeinschaftlicher Kauf von Maschinen und Fahrzeugen, Starthilfe für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, Gemeinschaftliche Einrichtungen und Bauten für die Verarbeitung / Lagerung landw. Produkte
A56 Anhang
Massnahme Genehmigte Projekte in 1 000 Fr. 2008 2009 2010 Beiträge 93 408 86 204 89 852 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen 25 104 10 426 16 572 Wegebauten 19 423 23 930 19 513 Wasserversorgungen 7 321 10 110 12 528 Projekte zur regionalen Enwicklung 1 554 1 571 6 115 andere Tiefbaumassnahmen (inkl. Unwetter) 14 620 15 877 12 574 Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere 24 781 22 866 19 334 andere Hochbaumassnahmen 606 1 403 3 217 Quelle: BLW
Tabelle 50b
Investitionskredite
Massnahme bewilligte Kredite in 1 000 Fr. 2008 2009 2010 Investitionskredite 1 343 063 303 631 300 091 Starthilfe 76 054 76 613 68 478 Kauf Betrieb durch Pächter 3 706 3 019 1 695 Wohngebäude 53 908 56 989 57 320 Ökonomiegebäude 147 263 130 829 122 531 Diversifizierung 21 695 10 338 9 684 Produzierender Gartenbau 528 50 Gewerbliche Kleinbetriebe 479 1 221 510 Gem. Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energie aus Biomasse 2 923 1 678 1 840 Gemeinschaftliche Massnahmen 2 33 496 17 256 31 343 Bodenverbesserungen, ohne Baukredite 3 010 5 689 6 641 Betriebshilfedarlehen 1 23 270 18 806 30 837
und Betriebshilfedarlehen
Quelle:
BLW
Tabelle 51
Umschulungsbeihilfen 2010
A57 Anhang
Kanton zugesicherte Beiträge ausbezahlte Beiträge 1 Anzahl Fr. Anzahl Fr. ZH BE 1 48 910 LU UR SZ OW NW 1 123 600 GL ZG FR SO BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU 1 113 100 Total 2 236 700 1 48 910 1 von Zusicherungen der Vorjahre Quelle: BLW
Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung
Tabelle 52
Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung, in 1 000 Fr.
Mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM) im Jahr 2007 erfolgte ein Systemwechsel in der Rechnungslegung des Bundes. Aufgrund dieses Strukturbruchs sind Vorjahresvergleiche nicht mehr möglich.
A58 Anhang
Ausgabenbereich 2006 2007 2008 2009 2010 Aufgabengebiet Landwirtschaft und Ernährung 3 644 826 3 601 158 3 550 873 3 691 923 3 665 703 Innerhalb Zahlungsrahmen 3 359 451 3 318 647 3 265 861 3 383 444 3 369 167 Produktion und Absatz 605 644 547 874 536 221 471 318 428 052 Absatzförderung 31 796 54 022 54 275 55 535 55 840 Milchwirtschaft 442 742 365 981 349 720 298 499 291 944 Viehwirtschaft 18 791 18 483 18 218 17 798 10 191 Pflanzenbau 112 316 109 387 114 008 99 486 70 077 Direktzahlungen 2 553 000 2 596 058 2 545 668 2 742 228 2 769 273 Allgemeine Direktzahlungen 1 989 000 2 071 158 1 996 790 2 167 745 2 181 967 Ökologische Direktzahlungen 564 000 524 900 548 878 574 483 587 306 Grundlagenverbesserung 200 806 174 715 183 972 169 898 171 842 Strukturverbesserungen 107 474 92 366 88 521 82 792 85 000 Investitionskredite 68 500 53 875 50 980 47 000 47 000 Betriebshilfe 2 250 6 040 2 239 2 006 2 213 Pflanzen- und Tierzucht 22 372 22 434 42 232 38 100 37 629 Ausserhalb Zahlungsrahmen 285 375 282 512 285 012 308 479 296 537 Verwaltung 45 180 46 378 47 767 51 672 55 219 Beratung 18 000 17 998 11 326 11 150 12 177 Pflanzenschutz 1 618 12 865 11 088 2 094 1 631 Vollzug und Kontrolle (Agroscope) 46 615 44 484 44 897 47 466 47 671 Gestüt 7 472 7 386 7 391 7 497 7 527 Landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte (EZV) 90 000 79 200 75 000 93 000 76 711 Familienzulagen in der Landwirtschaft (BSV) 76 100 74 200 87 600 95 600 95 600 Übriges 390 Ausgaben ausserhalb der Landwirtschaft 126 724 131 018 133 405 138 510 138 307 Forschung und Entwicklung Landwirtschaft 72 636 69 452 70 386 74 636 72 893 Tiergesundheit 47 547 54 900 55 504 56 903 57 653 Übriges 6 541 6 666 7 515 6 971 7 761 Anmerkung:
Quelle: Staatsrechnung
Rechtserlasse, Begriffe und Methoden
Rechtserlasse
Rechtserlasse sind im Internet unter folgender Adresse einzusehen: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00498/index.html?lang=de
Begriffe und Methoden
Begriffe und Methoden sind im Internet unter folgender Adresse einzusehen: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00498/index.html?lang=de
A59 Anhang
Abkürzungen
Organisationen/Institutionen
ACW Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Agridea Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
ALP Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH
ART Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
BAG Bundesamt für Gesundheit, Bern
BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Bern
BFS Bundesamt für Statistik, Neuenburg
BLW Bundesamt für Landwirtschaft, Bern
BSV Bundesamt für Sozialversicherung, Bern
BAFU Bundesamt für Umwelt, Bern
BVET Bundesamt für Veterinärwesen, Bern
BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, Bern
ETH Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich
EU Europäische Union
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Bern
EZV Eidg. Zollverwaltung, Bern
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rom
FiBL Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, Frick
IAW Institut für Agrarwirtschaft, Zürich
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris
OZD Oberzolldirektion, Bern
SBV Schweizerischer Bauernverband, Brugg
seco Staatssekretariat für Wirtschaft, Bern
SMP Schweizerische Milchproduzenten, Bern
TSM Treuhandstelle Milch, Bern
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation), Genf
Masseinheiten dt Dezitonne = 100 kg
A60 Anhang
h
ha
hl Hektoliter Kcal Kilokalorien kg Kilogramm km Kilometer l Liter m Meter m2 Quadratmeter m3 Kubikmeter Mio.
Fr. Franken
Stunden
Hektare = 10 000 m2
Million Mrd. Milliarde
Rp. Rappen
St. Stück
t Tonne
% Prozent
Ø Durchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGIS Agrarpolitisches Informationssystem
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
AK Arbeitskraft
AKZA Ausserkontingentszollansatz
BDM Biodiversitäts-Monitoring Schweiz
BSE Bovine spongiforme Enzephalopathie («Rinderwahnsinn»)
BTS Besonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw. beziehungsweise
BZ I, II, … Bergzone
ca. zirka
CO2 Kohlendioxid
EO Erwerbsersatzordnung
FJAE Familien-Jahresarbeitseinheit
GAP Gemeinsame Agrarpolitik der EU
GGA Geschützte Geografische Angaben
GUB Geschützte Ursprungsbezeichnung
GVE Grossvieheinheit
GVO Gentechnisch veränderte Organismen
inkl. inklusive
IP Integrierte Produktion
IV Invalidenversicherung
JAE Jahresarbeitseinheit
KZA Kontingentszollansatz
LG Lebendgewicht
LN Landwirtschaftliche Nutzfläche
LwG Landwirtschaftsgesetz
Mwst Mehrwertsteuer
N Stickstoff
NWR Nachwachsende Rohstoffe
ÖAF Ökologische Ausgleichsfläche
ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis
P Phosphor
PSM Pflanzenschutzmittel
RAUS Regelmässiger Auslauf im Freien
RGVE Raufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAK Standardarbeitskraft
SG Schlachtgewicht
u.a. unter anderem
vgl. vergleiche
z.B. zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B. Tabellen)
A61 Anhang
Literatur
Ammann C., Spirig C., Leifeld J., Neftel A., 2009. Assessment of the Nitrogen and Carbon Budget of Two Managed Grassland Fields. Agriculture, Ecosystems and Environment, 133, 150–162.
Beratendes Organ für Fragen der Klimaänderung (OcCC), 2007. Klimaänderung und die Schweiz 2050 – Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), verschiedene Jahrgänge.
Agrarbericht 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010.
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2011. Klimastrategie Landwirtschaft. Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel für eine nachhaltige Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft.
Bundesamt für Statistik (BFS). http://www.bfs.admin.ch/
Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2011.
Gesamt-Umweltbelastung durch Konsum und Produktion der Schweiz: Input-Output Analyse verknüpft mit Ökobilanzierung.
Umwelt-Wissen Nr. 1111.
Calanca P., Holzkämper A., 2010. Agrarmeteorologische Bedingungen im Schweizer Mittelland von 1864 bis 2050. Agrarforschung 1 (9), 320–325.
Eurostat, 2010.
Vergleich der Preisniveaus in der EU27 im Jahr 2009. Luxemburg.
Fuhrer J., Jasper K., 2009.
Bewässerungsbedürftigkeit in der Schweiz. Schlussbericht. Agroscope Forschungsanstalt Reckenholz-Tänikon ART.
Fuhrer J., 2010.
Abschätzung des Bewässerungsbedarfs in der Schweizer Landwirtschaft. Abschlussbericht, Agroscope Forschungsanstalt Reckenholz-Tänikon ART.
Gadermaier F., Berner A., Fliessbach A., Friedel J. K., Mäder P., 2011.
Impact of reduced tillage on soil organic carbon and nutrient budgets under organic farming. Renewable Agriculture and Food Systems, doi:10.1017/S1742170510000554.
Gubler N., 2007.
Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen. ART-Bericht 676.
A62 Anhang
Hersener J.-L. (Hrsg), 2011. Zentrale Auswertung von Ökobilanzen landwirtschaftlicher Betriebe. Schlussbericht. Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, in Vorbereitung.
Ivemeyer S., Maeschli A., Walkenhorst M., Klocke P., Heil F., Oser S., Notz C., 2008. Auswirkungen einer zweijährigen Bestandesbetreuung von Milchviehbeständen hinsichtlich Eutergesundheit, Antibiotikaeinsatz und Nutzungsdauer. Schweiz. Arch. Tierheil. 150(19), 499–505.
Landis M., Schiess I., Wolfensberger U., 2007. Partikelfilter-Nachrüstungen bei Traktoren. Abstimmung des Filtersystems auf den Fahrzeugeinsatz nötig. ART-Bericht Nr. 677.
Leifeld J., Reiser R., Oberholzer H.-R., 2009.
Consequences of conventional vs. organic farming on soil carbon: Results from a 27-year field experiment. Agronomy Journal 101, 1204–1218.
Leifeld J., Müller M., Fuhrer J., 2011.
Peatland subsidence and carbon loss from drained temperate fens. Soil Use and Management, doi: 10.1111/j.1475-2743.2011.00327.x.
Meier B., 1996.
Vergleich landwirtschaftlicher Buchhaltungsdaten der Schweiz und der EU – Methodische Grundlagen. FAT-Schriftenreihe Nr. 41.
Richner B., Schmidlin A., 1995.
Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen. Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe. FAT-Bericht Nr. 476.
Widmer S. und Wydler H., 2011b.
Entwicklungspotenzial im Bereich Care Farming. Agrarforschung Schweiz 2 (Juni/August 11).
Wydler H. und Picard R., 2010. Care Farming: Soziale Leistungen in der Landwirtschaft. Agrarforschung Schweiz (1): 24–29.
A63 Anhang
A64 Anhang