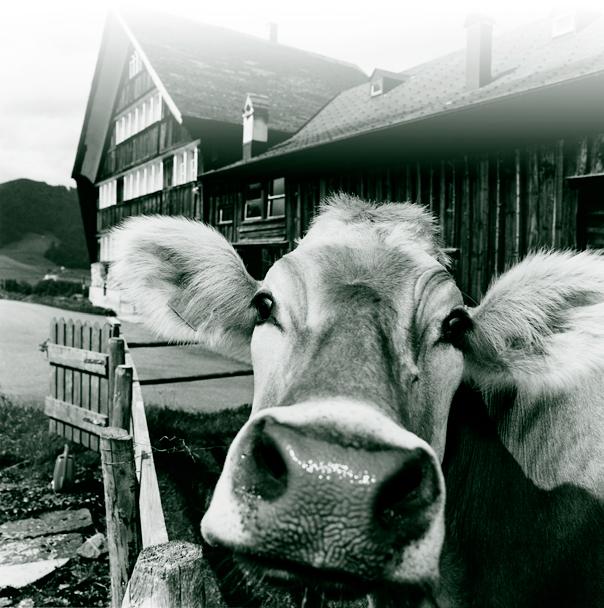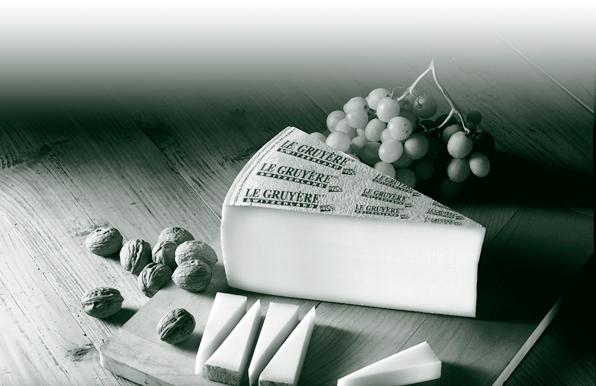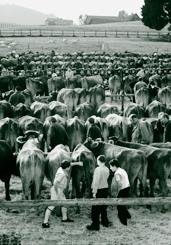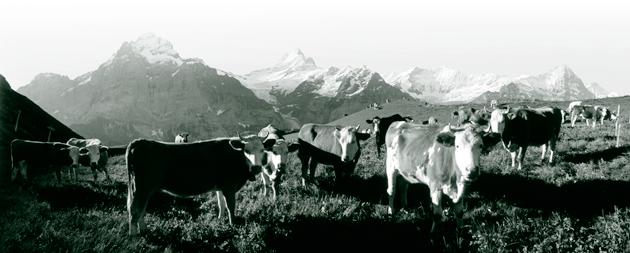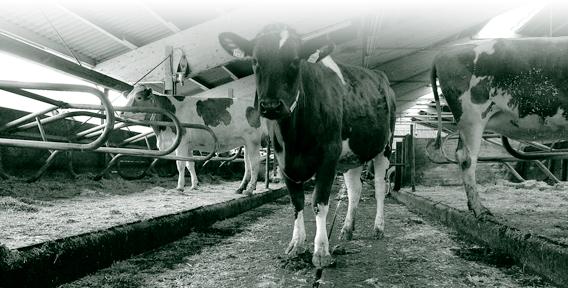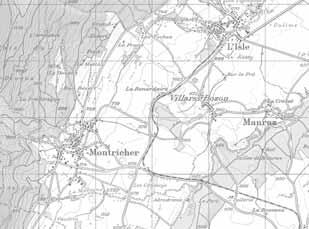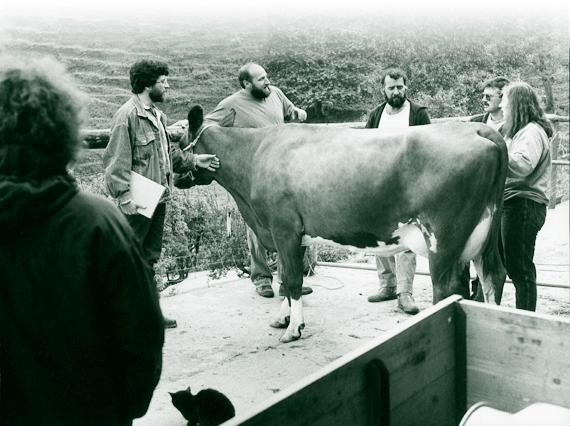AGRARBERICHT
Agrarbericht 2008 des Bundesamtes für Landwirtschaft
1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
Telefon:031 322 25 11
Telefax:031 322 26 34
Internet: www.blw.admin.ch
Copyright:BLW, Bern 2008
Gestaltung
Artwork, Grafik und Design, St.Gallen
Fotos
–AGRIDEA Lindau
–Agrofot Bildarchiv
–Agroscope Changins-Wädenswil ACW
– Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
–Bundesamt für Landwirtschaft BLW
–Christof Sonderegger, Fotograf
–Getty Images GmbH
–Herbert Mäder, Fotograf
–Interprofession du Gruyère
–Peter Mosimann, Fotograf
–Peter Studer, Fotograf
–PhotoDisc Inc.
–Schweizerischer Bauernverband SBV
–Schweizer Milchproduzenten SMP
–Switzerland Cheese Marketing AG
–Tobias Hauser, Fotograf
Bezugsquelle
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern
Bestellnummern:
Deutsch:730.680.08 d
Französisch:730.680.08 f
Italienisch:730.680.08 i www.bundespublikationen.admin.ch
2 IMPRESSUM 11.08 1800 206415
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1.Bedeutung und Lage 1.1Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1.1.1Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1.1.2Märkte 21 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 45 1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 51 1.2Soziales 59 1.2.1 Einkommen und Verbrauch 60 1.2.2 Junge Bewirtschaftende und ihre Sicht der Zukunft 62 1.3Ökologie und Ethologie 85 1.3.1 Ökologie 85 1.3.2 Ethologie 107 1.4Internationale Nahrungsmittelmärkte 110 ■ 2.Agrarpolitische 2.1Produktion und Absatz 125 Massnahmen 2.1.1Übergreifende Instrumente 126 2.1.2Milchwirtschaft 137 2.1.3 Viehwirtschaft 145 2.1.4 Pflanzenbau 155 2.2Direktzahlungen 167 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 168 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 178 2.2.3 Ökologische Direktzahlungen 187 2.3Grundlagenverbesserung 209 2.3.1Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen 210 2.3.2 Landwirtschaftliches Wissenssystem 223 2.3.3 Produktionsmittel 237 2.4Sektion Finanzinspektorat 243 2.5Vernetzung der Agrar-Datenbanken 246 ■ 3. Internationale 3.1Internationale Entwicklungen 251 Aspekte3.2 Internationale Vergleiche 273 ■ Anhang Tabellen A2 Rechtserlasse, Begriffe und Methoden A59 Abkürzungen A60 Literatur A62 INHALTSVERZEICHNIS 3
Das Berichtsjahr 2007 war für die Schweizer Landwirtschaft ein gutes Jahr. Obwohl die Schweizer Bauern nicht im gleichen Ausmass von den Preiserhöhungen verschiedener Produkte auf dem Weltmarkt profitieren konnten wie z.B. ihre Kollegen in der EU oder in den USA, erhöhten sich die einzelbetrieblichen Einkommen um rund 15% und erreichten das Niveau der ebenfalls guten Jahre 2000 und 2004. Für das laufende Jahr sind die Erlösaussichten ebenfalls sehr gut. Die Erlöse aus der landwirtschaftlichen Erzeugung dürften um 300 Mio. Fr. steigen. Gleichzeitig erhöhen aber Preissteigerungen insbesondere bei den Vorleistungen für Dünger und Treibstoffe die Kosten. Die Schätzungen gehen davon aus, dass das Sektoreinkommen gut 2,8 Mrd. Fr. betragen dürfte.
International war das Halbjahr zwischen Herbst 2007 und Frühling 2008 geprägt durch starke Preissteigerungen bei verschiedenen Ackerbauprodukten und bei der Milch. Die Rede war von Nahrungsmittelkrise und die Medien berichteten breit über Auswirkungen und mögliche Ursachen. Diese Situation brachte deutlich zum Ausdruck, wie wichtig die Landwirtschaft für die Gesellschaft ist. In diesem Zusammenhang war es eindrücklich, wie an der im Juni 2008 durchgeführten FAO-Konferenz zur Nahrungsmittelkrise die multifunktionale Landwirtschaft als Modell für die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschaft in den Mittelpunkt gestellt wurde. Die Konferenzteilnehmer hoben hervor, dass künftig wieder mehr in die Landwirtschaft investiert werden muss, so im Bereich der Produktionsgrundlagen, der Forschung und Beratung und der Logistik für die Weiterverarbeitung und den Transport von den Produzenten zu den Konsumzentren, dies insbesondere in den Entwicklungsländern. Als grundlegende Herausforderung steht die Frage im Mittelpunkt, wie bei begrenzten Flächenreserven je ha höhere Erträge erzielt werden können ohne oder mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt. Dies ist eine grosse Herausforderung, wie z.B. die Diskussionen zum Thema Stickstoffbelastung durch die Landwirtschaft in der Schweiz zeigen.
Die Situation auf den internationalen Märkten für Agrarrohstoffe hat sich inzwischen beruhigt. Die Ernte 2008 kündigt sich als weitere Rekordernte an und die Produktion dürfte die Nachfrage leicht übersteigen, was einen bescheidenen Aufbau der Lagerhaltung erlaubt. Die Preise für Weizen oder Reis sind gegenüber ihren kurzfristig erreichten Höchstständen in diesem Frühjahr bedeutend zurückgegangen. Das Niveau ist allerdings bei Weizen, bei Butter oder Milchpulver nach wie vor fast doppelt so hoch wie vor den Preissteigerungen. Die Lage bleibt nach wie vor labil. Schon eine schlechte Ernte nächstes Jahr kann die Preise wieder steigen lassen.

VORWORT 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ Vorwort
Für die Schweiz als Nettoimporteurin im Nahrungsmittelbereich sind diese Entwicklungen mittel- und längerfristig von Bedeutung. Unmittelbarer betroffen ist der Agrarsektor aber von den Verhandlungen im Rahmen der WTO-Doha-Runde und von einem Freihandelsabkommen mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich (FHAL). Trotz intensiven Bemühungen von allen Verhandlungsteilnehmern konnten die WTO-Verhandlungen dieses Jahr noch nicht abgeschlossen werden. Bestehen im WTO-Bereich Unsicherheiten über den weiteren Verlauf, sind die nächsten Schritte für ein FHAL bekannt. Der Bundesrat hat am 14. März 2008 für ein FHAL sowie für ein Gesundheitsabkommen ein gemeinsames Verhandlungsmandat verabschiedet. Ein FHAL soll die Märkte für sämtliche Produkte entlang der Wertschöpfungskette gegenseitig vollständig öffnen. Das Abkommen würde sowohl tarifäre Handelshemmnisse wie Zölle und Kontingente als auch nicht-tarifäre Hürden wie unterschiedliche Produktvorschriften und Zulassungsbestimmungen abbauen.
Der Bundesrat ist überzeugt, dass mittelfristig die Chancen einer Marktöffnung überwiegen. Er ist sich aber bewusst, dass diese kurzfristig für die Landwirtschaft und die ganze Lebensmittelkette eine Herausforderung darstellt. Er ist daher gewillt, den Agrarsektor beim Übergang zu unterstützen. So hat er diesen Herbst eine Vorlage in Vernehmlassung geschickt, welche die Finanzierung von Begleitmassnahmen zum Ziel hat. Das EVD hat im April zudem eine breit abgestützte Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Aufgabe hat, ein Konzept für konkrete Begleitmassnahmen auszuarbeiten. Die Arbeiten sind in vollem Gang und ein entsprechender Bericht soll dem EVD spätestens im Mai 2009 vorgelegt werden.
Ein durch die Agroscope Reckenholz-Tänikon ART zusammen mit dem BLW durchgeführtes Projekt über junge Bauern und Bäuerinnen und ihre Sicht der Zukunft zeigt, dass die jungen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Zukunft realistisch entgegensehen. Sie sind der Meinung, dass weitere Marktöffnungen anstehen und sie ihren Betrieb diesen Herausforderungen laufend anpassen müssen. Die Mehrheit der Befragen ist der Auffassung, dass es ihnen gelingen wird, in der Landwirtschaft verbleiben zu können, sei dies durch Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit, Diversifizierung auf dem Betrieb oder durch die Aufnahme eines Nebenerwerbs.
Die Produktion erreichte 2007 einen hohen Stand, die Einkommen waren so hoch wie in den guten Jahren 2000 und 2004, der effiziente Einsatz beim Stickstoff verbesserte sich wieder und die ökologischen Flächen mit guter Qualität sowie die Beteiligung bei den Programmen zur Förderung des Tierwohls nahmen weiter zu. Aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung war 2007 ein positives Jahr.
Manfred Bötsch
Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft

VORWORT 5
und Lage der

1 7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Bedeutung
Landwirtschaft
In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten, dass «der Bund dafür zu sorgen hat, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
c.dezentralen Besiedlung des Landes».
Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich, dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt, die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft. Die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen, die im öffentlichen Interesse liegen, welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.
Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert. Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.
Der Bundesrat verfolgt die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik. Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind. Absatz 2 hält fest, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind. Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten. Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts. Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.
8 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1
1.1 Ökonomie
Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen, damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann. Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung. Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe, über die Strukturentwicklungen, über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.
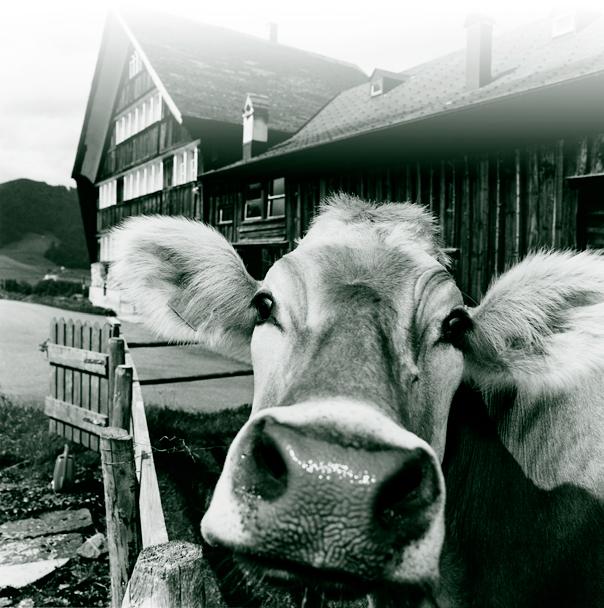
9 1.1 ÖKONOMIE ■■■■■■■■■■■■■■■■■
1
1.1.1
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Strukturentwicklungen

Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft wird der Fokus vorwiegend auf die Zahl der Betriebe und deren Grössenverhältnisse und auf die Zahl der Beschäftigten gelegt. Die folgenden Abschnitte orientieren über die Veränderungen dieser beiden Strukturmerkmale.
Im Jahrzehnt 1990–2000 war die Hälfte der Reduktion der Anzahl Betriebe auf den Rückgang der Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha zurückzuführen. Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha. Demgegenüber konnten die Betriebe der Grössenklassen über 20 ha zahlenmässig zunehmen. Die höchste absolute Zunahme der Anzahl Betriebe in diesem Jahrzehnt konnte mit +2'210 in der Grössenklasse 30–50 ha verzeichnet werden.
In den Jahren 2000 bis 2007 schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber den neunziger Jahren markant ab. Leicht zugenommen hat sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3 bis 10 ha und 10 bis 20 ha. Neu war in dieser Zeitspanne auch in der Grössenklasse 20 bis 25 ha eine schwache Abnahmerate auszumachen. Die Wachstumsschwelle stieg von 20 auf 25 ha. Das heisst, dass seit der Jahrtausendwende per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha ab- und über diesem Wert zugenommen hat. Die höchste absolute Abnahme in diesen sieben Jahren wurde mit über 4'000 Betrieben in der Grössenklasse 3–10 ha festgestellt.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Betriebe
10 1.1 ÖKONOMIE 1
Tabelle 1, Seite A2
Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen
Die Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Region zwischen 1990 und 2000 wies absolut eine stärkere Abnahme in der Talregion (rund 10'000) als in der Hügel- und Bergregion (5'500 bzw. 6'500) auf. Relativ betrachtet war aber die jährliche Abnahmerate in der Bergregion am höchsten. Seit dem Jahr 2000 waren die Abnahmeraten im Vergleich zu den neunziger Jahren in allen Regionen tiefer.
Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nach Regionen
Haupterwerbsbetriebe
Talregion30 13923 53620 947–2,4–1,7
Hügelregion17 45213 79312 620–2,3–1,3
Bergregion16 65111 91011 467–3,3–0,5
Total64 24249 23945 034–2,6–1,3
Nebenerwerbsbetriebe
Talregion11 4518 0766 490–3,4–3,1
Hügelregion7 0895 1644 341–3,1–2,4
Bergregion10 0338 0585 899–2,2–4,4
Total28 57321 29816 730–2,9–3,4
Quelle: BFS
MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in % 1990200020071990–20002000–2007 Grössenklasse 0–3 ha19 8198 3716 577–8,3–3,4 3–10 ha27 09218 54214 148–3,7–3,8 10–20 ha31 63024 98420 876–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2446 9610,8–0,6 25–30 ha3 3644 4304 7342,81,0 30–50 ha3 5495 7596 7515,02,3 >50 ha6841 2071 7175,85,2 Region Talregion41 59031 61227
Hügelregion24 54118 95716 961–2,5–1,6 Bergregion26 68419 96817 366–2,9–2,0 Total92 81570 53761 764–2,7–1,9 Quelle: BFS
437–2,7–2,0
1990200020071990–20002000–2007
MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in %
1.1 ÖKONOMIE 11 1 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Bei den Haupterwerbsbetrieben war die Abnahmerate zwischen 2000 und 2007 in allen Regionen bedeutend weniger hoch als in den neunziger Jahren. In der Bergregion war sie mit 0,5% pro Jahr am tiefsten. Bei den Nebenerwerbsbetrieben war die Entwicklung umgekehrt. Die Abnahmerate erhöhte sich von 2,9 auf 3,4%. Insgesamt sank zwischen 2000 und 2007 die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um rund 4'200 und jene der Nebenerwerbsbetriebe um über 4'500.
Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist mit einer Reduktion der Anzahl Beschäftigten verbunden.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
In den neunziger Jahren ging die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft um rund 50'000 Personen zurück. Der Rückgang betraf ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte. Demgegenüber stieg die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte in dieser Zeitspanne leicht an.
Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Beschäftigten um weitere 30’000 Personen gesunken. Im Unterschied zu den neunziger Jahren ging zwischen 2000 und 2007 auch die Anzahl familienfremde Arbeitskräfte zurück. Insgesamt war die Abnahmerate nach 2000 leicht höher als in den zehn Jahren zuvor. Mit 2,3% war sie 0,4 Prozentpunkte höher als diejenige bei den Betrieben. Zwischen 1990 und 2000 war noch das Gegenteil der Fall: die Betriebe nahmen um 2,7% pro Jahr ab, die Beschäftigten nur um 2,2%.
12 1.1 ÖKONOMIE 1
BeschäftigteVeränderung pro Jahr in % 1990200020071990–20002000–2007 Familieneigene217 477165 977142 657–2,7–2,1 davon: Betriebsleiter88 88974 72458 766–1,7–3,4 Betriebsleiterinnen3 9262 3462 998–5,03,6 Familienfremde36 08437 81630 3340,5–3,1 Total253 561203 793172 991–2,2–2,3
MerkmalAnzahl
Quelle:
BFS
■ Beschäftigte
Tabelle 2, Seite A3
■ Bruttowertschöpfung
Wirtschaftliche Kennziffern
Die Bruttowertschöpfung der Schweizer Wirtschaft im Berichtsjahr lag mit 482,1 Mrd. Fr. 5,2% höher als im Vorjahr. Der Anteil des Primärsektors war mit 1,2% gering. Davon entfielen gut zwei Drittel auf die Landwirtschaft.
Entwicklung der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen
Sektor20052006 1 2007 1 Anteil Veränderung 20072005/07 in Mio. Fr.in %in %
Primärsektor5 478 5 4415 6071,22,4 davon Landwirtschaft nach LGR4 083 3 8463 9170,8–4,1
Sekundärsektor118 324 126 758134 951 28,014,1
Tertiärsektor312 067 325 954341 511 70,89,4
Total435 870 458 153482 069 100,010,6
1 provisorisch Quelle: BFS
■ Aussenhandel
Für den Schweizer Aussenhandel war das Berichtsjahr ein herausragendes Jahr. Einund Ausfuhren erreichten mit 193,1 Mrd. Fr. resp. 206 Mrd. Fr. neue Höchstwerte. Dies entspricht einer Zunahme von 9% resp. 11,2% gegenüber 2006. Die gesamtwirtschaftliche Handelsbilanz erreichte 2007 einen Exportüberschuss von 13 Mrd. Fr. Demgegenüber wurde im Jahr 2000 noch ein Importüberschuss von 3 Mrd. Fr. verbucht.
Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zog ebenfalls an. Die Importe erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mrd. Fr. auf 11,3 Mrd. Fr., die Exporte ebenfalls um 1,2 Mrd. Fr. auf 6,5 Mrd. Fr. Die Handelsbilanz bei den Landwirtschaftsprodukten schloss 2007 mit einem Importüberschuss von 4,8 Mrd. Fr. Im Vergleich dazu lag der Importüberschuss im Jahr 2000 bei 5 Mrd. Fr. Die Handelsbilanz verbesserte sich demzufolge um 0,2 Mrd. Fr.
Im Berichtsjahr stammten 8,6 Mrd. Fr. oder 76,1% der Landwirtschaftsimporte aus der EU. 4,6 Mrd. Fr. oder 70,8% der Exporte wurden in den EU-Raum getätigt. Die Handelsbilanz mit der EU bei den Landwirtschaftsprodukten schloss 2007 mit einem Importüberschuss von 4 Mrd. Fr. Im Jahr 2000 lag der Importüberschuss bei 3,7 Mrd. Fr. Die Handelsbilanz verschlechterte sich um 0,3 Mrd. Fr.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 13 1.1 ÖKONOMIE 1
1 EU15-25-27: 2000-2003 EU15, 2004-2005 EU25, ab 2006 EU27
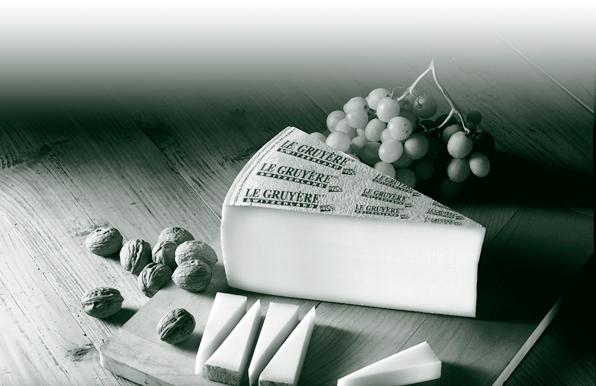
2 EU27: alle heutigen EU-Mitgliedsländer
OZD
Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt, gefolgt von Deutschland und Italien. Fast zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern. Das gleiche Bild zeigte sich bereits im Jahr 2000. Gut die Hälfte der wertmässigen Ausfuhren in die EU gingen 2007 in die drei Länder Deutschland, Frankreich und Italien. Im Jahr 2000 waren es rund 60%.
Die Handelsbilanz mit den umliegenden EU-Ländern wies 2007 Importüberschüsse aus. Gegenüber 2000 nahm der Importüberschuss mit Deutschland stark zu, leicht bis mittelstark nahm der Importüberschuss mit Italien und den Niederlanden zu. Leicht abgenommen hat der Importüberschuss mit Frankreich, Österreich und Spanien. Einen Exportüberschuss wies die Schweiz 2007 im Verkehr mit den übrigen EU-Ländern aus.
14 1.1 ÖKONOMIE 1 20002001200220032004200520062007
Einfuhren total139,4141,9130,2129,7138,8157,6177,1193,0 38,5 Landwirtschaftsprodukte8,58,68,58,98,99,410,111,332,9 davon aus EU15-25-27 1 6,06,26,36,76,97,17,88,643,3 davon aus EU27 2 6,26,46,67,06,97,17,88,638,7 Ausfuhren total136,0138,5136,5135,4147,4166,0185,2206,0 51,5 Landwirtschaftsprodukte3,53,63,53,64,04,45,36,585,7 davon in EU15-25-27 1 2,32,42,32,52,83,13,74,6100,0 davon in EU27 2 2,42,52,52,62,83,13,74,691,7
2000–07 Mrd. Fr.%
Quelle:
Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2000/2007
Einfuhren 2000 Import- bzw. Exportüberschuss 2000 Ausfuhren 2000
bzw. Exportüberschuss 2007 Ausfuhren 2007
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2000/2007
Einfuhren 2000 Import- bzw. Exportüberschuss 2000 Ausfuhren 2000
2007 Ausfuhren 2007
15 1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1
Quelle: OZD Deutschland Frankreich Italien Österreich
Niederlande übrige Länder
übrige Länder EU27
754 976 1 240 1 929 388 1 588 699 1 870 263 1 267 430 1 751 160 233 320 351 61 479 254 590 133 747 367 1 059 552 714 1 263 1 073 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 0 in Mio. Fr. 5001 000
Einfuhren
Import-
Spanien
EU15 (2000)
(2007)
2007
Quelle: OZD Tabak und Diverses Milchprodukte Nahrungsmittelzubereitungen Genussmittel Tierfutter, Abfälle Getreide und Zubereitungen Ölsaaten, Fette und
Pflanzen, Blumen Gemüse Früchte Getränke Tierische Produkte,
712 474 743 435 537 318 660 571 819 813 1 384 1 251 599 761 1 505 1 326 158 315 262 398 413 597 642 1 017 43 346 76 544 3 545 4 628 5 553 5 662 5 854 13 1 042 191 1 433 1 075 1 813 54 1 407 102 1 640 2 000 2 500 1 5001 5002 000 1 000500 5001 000
Öle Lebende
Fische
Einfuhren
Import-
Exportüberschuss
0 in Mio. Fr.
2007
bzw.
Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land. Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke, tierische Produkte (inkl. Fische), Genussmittel (Kaffee, Tee, Gewürze) sowie Nahrungsmittelzubereitungen eingeführt. Ein ähnliches Bild zeigte sich bereits im Jahr 2000. Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 64% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch, 30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.
Im Jahr 2007 wurden vor allem Genussmittel und Nahrungsmittelzubereitungen exportiert, gefolgt von Getränken, Tabak und Diverses sowie Milchprodukten. Unter den Genussmitteln waren es vorwiegend Kaffee (570 Mio. Fr.) sowie Schokolade und kakaohaltige Nahrungsmittel (774 Mio. Fr.). Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bildeten die Lebensmittelzubereitungen, Kaffee-Extrakte, Suppen und Saucen. Im Vergleich zum Jahr 2000 gab es bei den genannten Positionen markante Zunahmen.
Die Handelsbilanz nach Produktekategorien wies 2007 vor allem bei tierischen Produkten inkl. Fische (–1’538 Mio. Fr.) und Früchten (–1’029 Mio. Fr.) Importüberschüsse aus. Tiefer lag der Importüberschuss bei den Getränken (–738 Mio. Fr.). Gegenüber 2000 gab es vor allem bei den Getränken eine markante Reduktion des Importüberschusses um 504 Mio. Fr.
Exportüberschüsse wurden 2007 bei Tabak und Diverses, Milchprodukten, Genussmitteln sowie Nahrungsmittelzubereitungen erzielt. Gegenüber 2000 legten Tabak und Diverses, Genussmittel und Nahrungsmittelzubereitungen zu; bei den Milchprodukten sank der Exportüberschuss um 45 Mio. Fr. auf 89 Mio. Fr.
Die Schweizer Landwirtschaft hat gemäss Verfassung den Auftrag, mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten. Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.
16 1.1 ÖKONOMIE 1
■
Entwicklung des Selbstversorgungsgrades 199519961997199819992000200120022003200520042006 kalorienmässiger Anteil in % Tierische Nahrungsmittel Nahrungsmittel Total Pflanzliche Nahrungsmittel Quelle: SBV 0 100 80 60 40 20
Selbstversorgungsgrad
Das Schwergewicht der Schweizer Landwirtschaft liegt auf der tierischen Produktion, was auch den verhältnismässig hohen Selbstversorgungsgrad in diesem Bereich erklärt. Im Jahr 2006 lag der Inlandanteil bei tierischen Produkten mit 93% einen Prozentpunkt tiefer als 2005. Der Anteil bei pflanzlichen Produkten sank um 3 Prozentpunkte auf 40%. Insgesamt lag 2006 der Selbstversorgungsgrad mit 57% 3 Prozentpunkte tiefer als 2005. Im längerfristigen Vergleich zeigt sich insgesamt eine leicht sinkende Tendenz.
Wird die Inlandproduktion (gemessen in Kalorien) über das letzte halbe Jahrhundert hinweg betrachtet, so zeigt sich, dass diese nahezu verdoppelt werden konnte. Diese markante Produktionssteigerung erlaubte es, den Selbstversorgungsgrad etwa auf gleich hohem Niveau zu halten, obwohl in dieser Zeit die Bevölkerung um rund 50% zunahm. Seit 1990 konnte die gesamte Inlandproduktion um weitere 6% erhöht werden. Während in diesen 15 Jahren die pflanzliche Produktion einen 20%igen Anstieg erfuhr, sank die tierische Produktion um rund 5%.
Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ging von 1990 bis 2002 stark zurück. Nach einem leichten Anstieg im Trockenjahr 2003 und dem darauf folgenden Frühjahr 2004, zeigte der Index wieder sinkende Tendenz. Nach dem Tiefststand 2005 hat sich dieser in den letzten beiden Jahren etwas erholt (2006: 74,8 Indexpunkte; 2007:75 Indexpunkte). Dazu beigetragen haben die gute Verfassung des Grossviehmarktes und höhere Preise beim Gemüsebau.
1.1 ÖKONOMIE 17 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1
13,
Entwicklung der Inlandproduktion 19551960196519701975198019851990200019952005 Terajoules Nahrungsmittel Total Tierische Nahrungsmittel Pflanzliche Nahrungsmittel Quelle: SBV 0 25000 20000 15000 10000 5000
■ Entwicklung von Preisindices Tabelle
Seite A13
Index (1990/92 = 100)
Im Vergleich zum Produzentenpreisindex legte der Landesindex der Konsumentenpreise für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke bis 2004 kontinuierlich zu. Seither ist er praktisch stabil geblieben, dies obwohl der Importpreisindex für Nahrungsmittel sich in diesem Zeitraum um 5 Prozentpunkte erhöhte. Im Berichtsjahr lag der Index bei 111,3 Punkten, derjenige für importierte Nahrungsmittel bei 108,1 Punkten.
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel
Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel 1
Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke
Produzentenpreisindex
Landwirtschaft
Importpreisindex
für Nahrungsmittel 2
1 Basis Mai 1997 = 100. Der neue Index enthält zu 100% Produktionsmittel. Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen. Das Gewicht der Produktionsmittel betrug damals 75%.
2 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.
Quellen: BFS, SBV
Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel ging nach einem starken Anstieg zu Beginn der neunziger Jahre bis 1999 kontinuierlich leicht zurück. Bis 2003 stieg er dann leicht an, bis 2006 stärker. Der Indexstand ist damit leicht höher als zu Beginn der neunziger Jahre. Im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2006 um 1 Prozentpunkt auf 107,4 Punkte zu. Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut, Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden. Der Teilindex Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft ist im betrachteten Zeitraum gesunken, der Teilindex der übrigen Produktionsmittel angestiegen.
1.1 ÖKONOMIE 1 18
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 19901992 19931994199519961997199819992000200120032007 20042006 2005 2002
■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung
Bundesausgaben
Im Jahr 2007 wurde beim Bund das Neue Rechnungsmodell (NRM) eingeführt. Der Systemwechsel in der Rechnungslegung führte u.a. zu Veränderungen bei den Ausgaben nach Aufgabengebieten. Diese sind deshalb nicht mehr mit denjenigen früherer Jahre vergleichbar.
Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 53'965 Mio. Fr. Dies entspricht einer Zunahme von rund 1,6 Mrd. Fr. oder 3% gegenüber 2006. Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3'601 Mio. Fr. aufgewendet, rund 44 Mio. Fr. (–1,2%) weniger als 2006. Nach sozialer Wohlfahrt (16'945 Mio. Fr.), Finanzen und Steuern (9'753 Mio. Fr.), Verkehr (7'349 Mio. Fr.), Bildung und Forschung (4'978 Mio. Fr.) und Landesverteidigung (4'327 Mio. Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung an sechster Stelle.
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes war 2007 bei 6,7%. In den beiden Jahren zuvor lag er bei 7%.

Ernährung 2004200520062007 Mio. Fr. in % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 7503 6083 6453 601 1.1 ÖKONOMIE 1 19
Die Ausgaben für Produktion und Absatz sanken auch im Berichtsjahr. Gegenüber 2006 nahmen sie um 58 Mio. Fr. ab.
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Anmerkung: Mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM) im Jahr 2007 erfolgte ein Systemwechsel in der Rechnungslegung des Bundes. Aufgrund dieses Strukturbruchs sind Vorjahresvergleiche nicht mehr möglich.
Quelle: Staatsrechnung
Bei den Direktzahlungen wurden im Berichtsjahr rund 40 Mio. Fr. mehr ausgegeben als 2006. Diese Zunahme ist vor allem auf die grössere Beteiligung an den freiwilligen Ethoprogrammen sowie auf Zahlungsüberhänge aus dem Rechnungsjahr 2006 zurückzuführen.
Die Ausgaben im Bereich Grundlagenverbesserung gingen im Berichtsjahr nach einem Zwischenhoch 2006 (Mehrausgaben aufgrund der Unwetterschäden 2005) wieder auf das Niveau von 2005 zurück.
1.1 ÖKONOMIE 1 20
Ausgabenbereich2004200520062007 in Mio. Fr. Produktion und Absatz731677606548 Direktzahlungen2 4982 4642 5532 596 Grundlagenverbesserung202178201175 Weitere Ausgaben319289285282 Total Landwirtschaft und Ernährung3 7503 6083 6453 601
Tabelle 51, Seite A58
Das Jahr 2007 war zum Teil durch extreme Wetterverhältnisse geprägt. Ein milder und niederschlagsarmer Winterabschluss sowie ein trockener Monat April, gefolgt von einem äusserst regnerischen Frühling und Sommer haben bei der pflanzlichen Erzeugung (44% des Gesamtproduktionswertes) zu einer stark durchzogenen Bilanz geführt. Die Erträge fielen je nach Anbauart und Region sehr unterschiedlich aus. Demgegenüber profitierte die tierische Erzeugung (47% des Produktionswertes) von gesamthaft guten Absatzbedingungen. Der restliche Anteil der Produktion, der sich aus landwirtschaftlichen Dienstleistungen (spezialisierte Arbeiten in Ackerbau und Tierhaltung) und nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten zusammensetzt, ist insgesamt praktisch unverändert geblieben (9% des Produktionswertes). Der Produktionswert des gesamten Sektors betrug 10,6 Mrd. Fr.
Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2007

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%
Landw. Dienstleistungen 6%
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2%
Wein 4%
Obst 5%
Gemüse- und Gartenbau 13%
Futterpflanzen 13%
Kartoffeln, Zuckerrüben 3%
Getreide 4%
Milch 21%
Rindvieh 12%
Schweine 9%
Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%
Quelle: BFS
Die Nahrungsmittelproduktion (tierische und pflanzliche Produkte) vergrösserte sich um 7,0% gegenüber 2006. Dabei nahm die tierische Erzeugung um 2,1% (104 Mio. Fr.) und der Pflanzenbau um 12,8% (532 Mio. Fr.) zu. Die starke Zunahme beim Pflanzenbau erklärt sich durch bessere Erträge gegenüber 2006, vor allem bei den Futterpflanzen.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1.2 Märkte
1.1 ÖKONOMIE 21 1
Tabelle 14, Seite A14
Milch und Milchprodukte
■ Produktion: Milcheinlieferungen auf Höchstwert Milcheinlieferungen nach Monaten 2006 und 2007
Im Berichtsjahr hat die eingelieferte Milchmenge gegenüber dem Vorjahr um 1,7% zugenommen. Der Absatz von Milch und Milchprodukten stieg an und bei Käse, Butter, Milchpulver und Rahm wurde 2007 eine Zunahme der Produktion beobachtet. Eine weiterhin sinkende Tendenz zeigte sich bei den Produzentenpreisen für Milch.
Gegenüber dem Vorjahr stieg die Gesamtmilchproduktion um 60'700 t auf rund 4,02 Mio. t. Davon wurden 757'100 t für die Selbstversorgung verwendet oder auf dem Hof verfüttert. Die Milcheinlieferungen inkl. der Milch aus der Freizone rund um Genf und aus dem Fürstentum Liechtenstein betrugen im Berichtsjahr 3,26 Mio. t, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von rund 55'000 t entspricht. Im Milchjahr 2007 betrug der geschätzte mittlere Jahresbestand an Kühen 692'000 Tiere.

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember in 1 000 t Milcheinlieferungen 2006 Milcheinlieferungen 2007 Quelle: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320
22 1.1 ÖKONOMIE 1
Tabellen 3–12, Seiten A4–A12
■ Verwertung: weiterhin steigende Käseproduktion
Im Berichtsjahr wurde die eingelieferte und vermarktete Milch von 3,233 Mio. t (ohne diejenige aus der Freizone rund um Genf und aus dem Fürstentum Liechtenstein) wie folgt verwertet:
Zu Käse:1,427 Mio. t(+1,71%)
Zu Butter:0,452 Mio. t (–2,59%)
Zu Konsummilch: 0,447 Mio. t (–0,67%)
Zu Rahm:0,261 Mio. t (+3,98%)
Zu anderen Milchprodukten:0,646 Mio. t (+5,73%)
Die Gesamtmenge an hergestelltem Käse stieg 2007 gegenüber 2006 um 1,9% auf 176'279 t. Die grösste prozentuale Steigerung verzeichnete die Herstellung von Schafund Ziegenkäse mit 7,3% auf 995 t. Die Zunahme beim Halbhartkäse betrug 5,2% auf 52'158 t, beim Weichkäse 2% auf 6'909 t und beim Frischkäse 2% auf 41'382 t. Mit 4,7% auf 16'191 t ist im Bereich der Frischkäse die Herstellung von Mozzarella stark angestiegen. Nach wie vor nimmt der Hartkäse mit 42% den grössten Anteil der produzierten Käse ein. Im Berichtsjahr wurden davon 74'836 t hergestellt, was gegenüber 2006 ein Rückgang von 0,4% bedeutet.
Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch
Im Berichtsjahr war die Produktion von Frischmilchprodukten im Vergleich zu 2005 und 2006 in etwa stabil und lag bei rund 750'000 t. Sauermilch- und Sauermilchprodukte erreichten im Jahr 2007 ein Volumen von 7'494 t, was einer Zunahme von 33,9% gegenüber 2006 entspricht. Die Produktion von Milchgetränken nahm zwischen 2006 und 2007 um 0,8% auf 65'668 t zu, während sie beim Jogurt stabil blieb.
Erneut wurde im Berichtsjahr mehr Rahm produziert. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr belief sich auf 2'362 t (+3,6%). Butter und Butterfette verzeichneten mit einer Zunahme von 6,4% auf 43'474 t ebenso eine steigende Produktion wie das Milchpulver, wovon im Berichtsjahr 50'834 t hergestellt wurden (+5,1%).
1990/92 200520062007 in 1 000 t Milch andere Milchprodukte Rahm Butter Quellen: TSM, SBV Käse Konsummilch 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 23 1
■ Aussenhandel: positive Handelsbilanz
Die Aussenhandelsbilanz für das Jahr 2007 zeigt, dass die Schweiz mengenmässig mehr Käse, Milchpulver und Rahm exportierte als sie einführte. Beim Jogurt und bei der Butter überstiegen die Importe die ausgeführten Mengen.
Gegenüber dem Vorjahr nahm der Käseexport inkl. Quark um rund 7% auf 54’321 t zu. Der Käseimport stieg auf 37’329 t an, was einer Zunahme von 11% entspricht. Wie bereits im Vorjahr sind die Importe von Jogurt auffallend angestiegen: Im Berichtsjahr betrug deren Einfuhr 6'674 t (+71%). Beim Milchpulver gingen sowohl die Exporte (–44,3%) als auch die Importe (–21,6%) zurück.
Am 1. Juni 2007 trat nach einer fünfjährigen Übergangsfrist mit einem schrittweisen Abbau der tarifären Handelshemmnisse das Käseabkommen der Bilateralen Verhandlungen I zwischen der Schweiz und der EU in Kraft. Mit dieser vollständigen Liberalisierung des Käsehandels fielen sämtliche Zölle, Marktzutrittsbeschränkungen und Exportsubventionen weg. Zwischen der Schweiz und der EU können seit diesem Datum alle Käsesorten zollfrei und ohne mengenmässige Einschränkungen gehandelt werden.
Unmittelbar nach der Übergangsfrist von 2002 bis 2007 ist der Warenaustausch zwischen der Schweiz und der EU im Bereich des Käses deutlich gestiegen. Nach der vollständigen Liberalisierung des Käsehandels haben die Käseexporte im Zeitraum von Juni 2007 bis Mai 2008 gegenüber dem Jahr unmittelbar vor der fünfjährigen Übergangsfrist (Juni 2001 bis Mai 2002) um 5'244 t auf 56'703 t zugenommen. Die Käseimporte kletterten in diesem Zeitraum um 7'859 t auf 39'629 t. Die Mehrimporte wurden auf dem Schweizer Markt problemlos abgesetzt, weil auch der Konsum von 2001 bis 2007 um 2,3 kg auf 20,7 kg pro Kopf stieg.
Mit Exporten von rund 55 t zwischen Juni 2001 – Mai 2002 und rund 1'733 t von Juni 2007 – Mai 2008 verzeichnen die Frischkäse das grösste Wachstum im Zuge der Liberalisierung des Käsehandels zwischen der Schweiz und der EU. Beim Weichkäse hat sich der Export in die EU zudem nahezu verfünffacht. Gesunken ist hingegen der Export von Hartkäse, und zwar um rund 6'800 t. In den erwähnten Vergleichsperioden wiesen die Importe von Frisch- bzw. Halbhartkäse mit +47,9% bzw. +41,1% die mengenmässig grössten Steigerungen auf.
1.1 ÖKONOMIE 1 24
■
Verbrauch: Käsekonsum im Hoch Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums
Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums an Milch- und Milchprodukten ist leicht zunehmend. 2007 wurden 1,1% mehr Jogurt und 1,8% mehr Butter konsumiert. Der Konsum von Quark blieb hingegen stabil.
Der Pro-Kopf-Konsum von Käse nahm 2007 um 3,7% gegenüber dem Vorjahr zu. Beim Weich- und Hartkäseverbrauch konnte ein Anstieg von 5,6% bzw. 8,9% verzeichnet werden. Beim Frischkäse betrug die Zunahme 2%, beim Halbhartkäse 1,8%.
Ein Rückgang von 1,5% auf 77,7 kg konnte im Berichtsjahr gegenüber 2006 im ProKopf-Verbrauch von Konsummilch beobachtet werden. Der Absatz von Milchgetränken blieb 2007 mit 8,5 kg pro Kopf gegenüber dem Vorjahr unverändert.

1990/92 200520062007 kg pro Kopf Käse Jogurt Quelle: SBV Butter Quark 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 1.1 ÖKONOMIE 25 1
■ Produzentenpreise: tiefere Milchpreise

Der durchschnittliche Produzentenpreis für Milch betrug im Jahr 2007 70.04 Rp./kg, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 1,79 Rp. entspricht. Per Anfang 2007 kam der Produzentenpreis für Milch aufgrund der reduzierten Beihilfen zur Stützung des Milchpreises unter Druck. Der positiven Lage auf dem Milchmarkt folgte gegen Ende 2007 die Aussicht auf eine Erhöhung des Milchpreises ab 2008. Die Schweizer Milchproduzenten konnten aus der ab dem Frühjahr 2007 eintretenden Hausse auf den internationalen Milchmärkten nur verzögert einen Nutzen ziehen.
Milchpreise 2007 gesamtschweizerisch und nach Regionen 1
Die regionalen Unterschiede bei der Industriemilch und der verkästen Milch sind 2007 im Vergleich zu 2006 etwas kleiner geworden. Bei der Industriemilch betrugen die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bis zu 2.83 Rp./kg, bei der verkästen Milch bis zu 5.36 Rp. Bei den Produzentenpreisen für Biomilch verkleinerte sich die regionale Differenz im Vergleich zum Vorjahr von 4.93 Rp./kg auf 2.6 Rp. Im Berichtsjahr wurde mit durchschnittlich 78.31 Rp./kg (–1.93 Rp. oder –2,41%) auch für Biomilch ein tieferer Produzentenpreis ausbezahlt. Im Vergleich zur Industriemilch liess sich 2007 mit Biomilch durchschnittlich ein um 9.51 Rp/kg höherer Preis erzielen.
■ Konsumentenpreise: erneuter Rückgang
Die Konsumentenpreise für fast alle Milch- und Milchprodukte nahmen im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr erneut ab. Für 1 kg Emmentaler surchoix zahlte der Konsument durchschnittlich Fr. 19.04, was gegenüber 2006 einer Abnahme von 17 Rp. entspricht. 1 kg Gruyère surchoix kostete 2007 durchschnittlich Fr. 19.94. Sinkende Konsumentenpreise wiesen auch Konsumrahm und Jogurt auf, wobei die grösste Abnahme beim Vollrahm 35% (verpackt, ½ l) mit –34 Rp. auf 3.63 Fr. verzeichnet wurde.
Rp./kgCHRegion IRegion IIRegion IIIRegion IVRegion V Gesamt70.0470.4570.1769.5169.8370.10 Industriemilch68.8068.8869.2968.3368.3966.46 Verkäste Milch70.6673.3169.7269.5970.2974.95 Biomilch78.3180.4178.2878.1677.81 Nicht erhoben
1Region I: Westschweiz; Region II: Bern, Zentralschweiz; Region III: Nordwestschweiz; Region IV: Zürich/Ostschweiz; Region V: SüdschweizQuelle: BLW
1.1 ÖKONOMIE 1 26
Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte
■ Marktspanne: tendenziell
Die Gesamtbruttomarge für Milch und Milchprodukte erreichte im April 2007 ihren Jahreshöchstwert, sank dann bis Oktober kontinuierlich und verzeichnete in den Monaten November und Dezember 2007 wieder einen leichten Anstieg.
Entwicklung der Bruttomarge 2007
Milchprodukte
Die Bruttomarge für Jogurt erreichte im März ihren tiefsten Wert, was auf Aktionsverkäufe zweier Verteiler zurückzuführen ist. Im Juni beendete ein Grossverteiler seine Aktionsangebote für Vorzugsbutter des Vormonats, aufgrund dessen die Bruttomarge für Butter ihren Jahreshöchstwert erreichte. Der anschliessende Rückgang der Bruttomarge für Butter zwischen Juni und Oktober ist auf eine Verteuerung des Rohstoffs zurückzuführen.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
abnehmend
Index (Dez. 2005 = 100) 94 98 96 100 102 104 106 2003200420052007 2006 Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte
Index (2000 = 100) Milch-und
Käse Butter Jogurt Quelle: BLW 60 65 70 75 80 85 90 105 100 95 110 115 120 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1.1 ÖKONOMIE 27 1
Tiere und tierische Erzeugnisse

Der Fleischkonsum stieg 2007 insbesondere wegen der guten konjunkturellen Lage und der weiter abklingenden Tierseuchenproblematik (Vogelgrippe und BSE) um 1,2%. Die Schweizer Bevölkerung verzehrte 51,95 kg Fleisch pro Kopf – soviel wie seit 2002 nicht mehr. Zusätzlich konsumierte jede Person durchschnittlich 8,29 kg Fisch und Krustentiere. Die grösste Zunahme gegenüber dem Vorjahr verzeichnete Geflügelfleisch mit 16,3% und die grösste Abnahme wurde bei Schaffleisch mit 5,1% beobachtet.
Für Kälbermäster war das Berichtsjahr mit hohen Produzentenpreisen erneut erfreulich. Der Jahrespreis der Kälber von Fr. 14.47 je kg SG lag sogar um 0,9% über dem durchschnittlichen Preis der Jahre 1990 bis 1992. Die Produzentenpreise auf dem Rindfleischmarkt stiegen ebenso auf ein Niveau, das letztmals 2001 erreicht wurde. Für Muni und Kühe der Handelsklasse T3 wurden im Jahresdurchschnitt Fr. 8.73 je kg SG bzw. Fr. 6.77 je kg SG erzielt. Das geringe Inlandangebot, vor allem an Kuhfleisch für die Verarbeitung, wurde mit Importen von rund 16'000 t ergänzt. Der Geflügelmarkt erholte sich nach der Verunsicherung durch die Vogelgrippe wieder vollständig. Im Inland wurde deshalb rund 16% mehr Geflügelfleisch als 2006 produziert.
1.1 ÖKONOMIE 1 28
Tabellen 3–12, Seiten A4–A12
■ Produktion: der Schweinebestand sinkt
Der Rindviehbestand stieg 2007 leicht an (+0,3%), die Zahl der Betriebe mit Rindvieh (43'700) verringerte sich indes um weitere 800 Einheiten. Gestiegen ist hauptsächlich die Zahl der Mutterkühe, deren Bestand nun bei 94'000 Stück liegt. Jede siebte Kuh in der Schweiz ist eine Mutterkuh. Während den letzten drei Jahren wurden in etwa gleich viele Kühe zur Verkehrsmilchproduktion gehalten. Der Schweinebestand sank um 3,8% auf 1,573 Mio. Stück. Der Bestand an Zuchtsauen fiel um rund 10'000 Tiere auf 140'600 Tiere. Beide Entwicklungen sind die Folge der Preisbaisse auf dem Markt. Die Haltung von Ziegen und Pferden ist seit 1990 immer beliebter geworden und die Bestände sind stetig gewachsen. Im Vergleich zu 1990 werden 25% mehr Ziegen und sogar 48% mehr Pferde gehalten. Hingegen hat sich der Schafbestand in den letzten drei Jahren bei etwa 445'000 Stück stabilisiert. Infolge der Vogelgrippe reduzierten die Geflügelmäster ihre Bestände im Jahre 2006 um rund 10%. Im Berichtsjahr zog der Konsum von Geflügelfleisch aber unerwartet stark an, so dass wieder mehr als 5 Mio. Stück Mastpoulets gehalten wurden. Der Legehennenbestand sank auf rund 2 Mio. Tiere. Mehr als 50% der Schafe und mehr als 75% der Ziegen werden im Berggebiet gehalten und nutzen dort Raufutter. Demgegenüber stehen 85% der Schweine und des Geflügels in Ställen des Talgebiets. Am meisten Rindvieh, Geflügel, Ziegen und Pferde werden im Kanton Bern gehalten. Der Kanton Luzern weist den grössten Schweinebestand und der Kanton Wallis den grössten Schafbestand auf. Entwicklung
Quelle: BFS
der Tierbestände Tierart19902005200620071990–2005/07 in 1 000in 1 000in 1 000in 1 000% Rindvieh1 8581 5551 5671 571–15,81 –Kühe für die Verkehrsmilchproduktion726568565564–22,09 –Kühe ohne Verkehrsmilchproduktion, gemolken515353512,61 –Mutterkühe14788794516,67 Schweine1 7761 6091 6351 573–9,59 Schafe35544645144425,92 Ziegen6174767925,14 Pferde3855565848,25 Mastgeflügel2 8785 0604 4815 00268,44 Lege- und Zuchthennen2 7952 1892 1472 030–24,08
1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 29 1
Die Schweinefleischproduktion von 241'902 t SG war im Berichtsjahr beinahe so hoch wie 2006. Sie ist bezüglich Produktionsmenge am bedeutendsten – gefolgt von der Rindfleischproduktion mit 102'147 t. Mit Ausnahme von Geflügelfleisch sank die Erzeugung aller Fleischkategorien. Am deutlichsten war dies bei Pferdefleisch mit einer Abnahme von 12,4% und bei Schaffleisch mit 6,3% der Fall. Die Lust auf Schweizer Geflügel hatte hingegen eine Produktionssteigerung um 16,1% auf die im Vergleich mit früheren Jahren grösste Inlandproduktion (34'579 t Verkaufsgewicht) zur Folge, wodurch die zeitweise leer stehenden Geflügelmastställe wieder ausgelastet waren. Von 1990/92 bis zum Berichtsjahr waren zwei wesentliche Entwicklungen zu beobachten: Erstens wurde die Produktion von Geflügelfleisch um 67% ausgedehnt und zweitens sank die Schweine- und Rindfleischproduktion um 9% bzw. 22%. Mit 34% nahm in diesem Zeitraum die inländische Pferdefleischproduktion ab. Dieser Rückgang wurde durch grössere Importmengen gedeckt. Stabil blieb indes die Erzeugung von Ziegenfleisch.
Das konsumierte Rind- und Schweinefleisch wurde 2007 zu 84,1% bzw. zu 94,5% in der Schweiz produziert. Den höchsten Inlandanteil von 96% weist seit Jahren Kalbfleisch auf. Hingegen stammt lediglich jedes zwölfte Kilogramm Pferdefleisch, jedes fünfte Kilogramm Kaninchenfleisch sowie jedes zweite Kilogramm Geflügel-, Ziegen- und Schaffleisch aus einheimischer Produktion. Im Berichtsjahr betrug der Inlandanteil bei allen Fleischarten von Schlachttieren ohne Geflügel insgesamt 88,8% und bei Geflügel 46,5%.
Entwicklung
Die Eierproduktion ging 2007 gegenüber dem Vorjahr um 0,9% auf 654 Mio. Stück zurück. Im Vergleich zur Periode 1990/92 legte sie jedoch um 2,5% zu. Der Markt war eher knapp mit Schweizer Eiern versorgt, deshalb waren im Sommer sehr wenig Eier an Lager. Dies führte zu Mehrimporten von Schaleneiern. Der Inlandanteil am Verbrauch von Schaleneiern sank dadurch auf 70,4%. Dies ist der tiefste Wert seit 1996.

1.1 ÖKONOMIE 1 30
1990/92200520062007 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quellen: Proviande, SBV Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 60 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch
der tierischen Produktion
■ Tierwohl: Labelanteile in der schweizerischen Fleischproduktion
Labels sind das wesentliche Element für die Vermarktung von Mehrwerten in der Fleischproduktion. Die Labelprogramme beinhalten in erster Linie höhere Anforderungen an das Tierwohl (Auslauf, Flächenbedarf, etc.). Die Programme werden von unabhängigen Stellen kontrolliert und zertifiziert und als Grundanforderung wird häufig die Erfüllung der staatlichen Förderprogramme BTS und/oder RAUS vorausgesetzt. Die Verkaufsanteile von Labelfleisch aus Schweizer Produktion wurden 2007 bei den wichtigsten Detaillisten vom Schweizer Tierschutz in einer Umfrage ermittelt. Im Detailhandel wird schätzungsweise die Hälfte des Fleisches verkauft, währenddem die andere Hälfte in der Gastronomie und in Kantinen Absatz findet. Bei Migros liegt der Labelanteil für Rind-, Lamm- und Geflügelfleisch aus schweizerischer Produktion bei 75%. Bei Coop beträgt der Labelanteil für Geflügelfleisch 90%, für Schweinefleisch 50% und für Kalbfleisch 25%. Die Labelanteile bei Volg, Carrefour und Denner belaufen sich hingegen auf unter 25%. Aus früheren Untersuchungen geht hervor, dass der wertmässige Anteil der Labels im gesamten Fleischsortiment des Lebensmitteldetailhandels rund 1,5 Mrd. Fr. (40% des Umsatzes) beträgt.
■ Aussenhandel: Importe auf Rekordniveau
Die Ausfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen fiel 2007 gegenüber dem Vorjahr um 171 t auf 1'914 t. Über 90% der Exporte gehen in EU-Länder. Rindstrockenfleisch ist das wichtigste Exportprodukt, wobei von 1'351 t fast die gesamte Menge nach Frankreich und Deutschland verkauft wurde. Die Wurstwarenexporte kletterten um 32% auf 69 t und die Exporte von Fleischkonserven und -zubereitungen um 102% auf 186 t. Diese Produkte wurden grossmehrheitlich nach Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Italien ausgeführt. Weiteres Exportpotenzial bietet das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene zollfreie Kontingent der EU für 1'900 t Schweizer Wurstwaren. Der Handelswert der schweizerischen Fleischexporte betrug im Berichtsjahr rund 40 Mio. Fr. und ist im Vergleich zu 2006 um 5 Mio. Fr. gestiegen.
Schweizer Firmen importierten 2007 insgesamt eine Rekordmenge von 119'336 t Fleisch, Fleischerzeugnissen und Schlachtnebenprodukten mit einem Handelswert von 817 Mio. Fr. Aus EU-Ländern stammten 81'600 t (68,4%), aus Südamerika 24'896 t (20,9%), aus Ozeanien 6'935 t (5,8%) und aus Nordamerika 3'160 t (2,6%). Infolge des gesunkenen Inlandangebots stieg die Einfuhrmenge gegenüber dem Vorjahr um 9,5%. Die wichtigsten Lieferländer waren Deutschland mit 36'210 t (30,3%), Brasilien mit 23'123 t (19,4%), Frankreich mit 10'486 t (8,8%) und Italien mit 9'418 t (7,9%). Geflügel- und Rindfleisch mit Einfuhren von 50'076 t bzw. 15'966 t waren die dominierenden Fleischsorten. Fisch und Krustentiere wurden im Umfang von 63'500 t mit einem Handelswert von 687 Mio. Fr. importiert. Die wichtigsten Lieferanten waren Dänemark und Vietnam mit je rund 7'000 t.
1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 31 1
2007 stammten 44% des eingeführten Rind- und Kalbfleisches aus Brasilien, was einer Abnahme um 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es folgten Deutschland (26%), Österreich (6,2%) und die Niederlande (4,9%). Brasilien exportiert vor allem Spezialstücke des Rindsstotzens, Nierstücke und High-Quality-Beef. Der Marktanteilsverlust von Brasilien ist die Folge der wesentlich grösseren Einfuhrmenge von Kuhfleisch aus europäischen Ländern.
Zwei Drittel des eingeführten Schweinefleischs kommen aus Deutschland und rund ein Fünftel aus Österreich. Australien und Neuseeland sind mit einem Anteil von insgesamt 89% die grössten Lieferanten von Schaf- und Lammfleisch. Das Pferdefleisch stammt hauptsächlich aus Kanada (46%) und Mexiko (18%). Eingebrochen ist der Import aus den USA, dem bisher wichtigsten Herkunftsland von Pferdefleisch. Infolge politischer Diskussionen zu einem Pferdeschlachtverbot in den USA wurden diverse Pferdeschlachtbetriebe geschlossen. Brasilien ist mit einem Marktanteil von 34% Hauptlieferant von Geflügelfleisch. Aus Deutschland kommen 21% und aus Frankreich 13% des ausländischen Geflügelfleischs. Grosser Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor die italienischen Wurstwaren, wovon rund 2'700 t in die Schweiz verkauft werden. Ausserdem landen je etwa 1'300 t deutsche, französische und ungarische Fleischkonserven und -zubereitungen in Schweizer Haushalten und in der Gastronomie.
3'311 Esel und Pferde wurden 2007 in die Schweiz eingeführt, was einer Zunahme um rund 750 Tiere gegenüber 2006 entspricht. Diese Steigerung ist die Folge der neuen Verteilmethode «Windhund an der Grenze», welche für das Zollkontingent Tiere der Pferdegattung die Versteigerung abgelöst hat. Im Nachgang zu dieser administrativen Vereinfachung wurden einige vor dem 1. Januar 2007 provisorisch eingeführte Pferde definitiv verzollt. Viele Personen haben den Pferdeimport zeitlich verschoben, um von erleichterten Bestimmungen zu profitieren. Dieser Mehrimport im Berichtsjahr ist daher als einmaliger Effekt zu beurteilen. Jedes dritte Importpferd stammt aus Deutschland und jedes vierte aus Frankreich. Während desselben Zeitraums wurden aus der Schweiz 2'001 Tiere ausgeführt. Dank der guten Nachfrage konnten 1'717 Pferde und Esel nach Deutschland, Frankreich und Italien und weitere 284 Stück in andere Länder verkauft werden. Seit über zehn Jahren wurde diese Zahl nicht mehr erreicht. Vor allem dank Exportbeihilfen fanden 4'453 Rinder und Kühe einen ausländischen Käufer. Aus dem Ausland bezogen Schweizer Produzenten 970 Zuchttiere der Gattung Rinder. Exportiert wurden je rund 250 Tiere der Schaf- und Ziegengattung sowie rund 50 Tiere der Schweinegattung. Die Importe lagen bei rund 1'000 Tieren der Schweinegattung, 230 Tieren der Schafgattung und 30 Tieren der Ziegengattung.
Als Folge des knappen Angebots an Schweizer Eiern nahm die Einfuhr von Schaleneiern um 11,8% auf 32'329 t zu. Bei der Herkunft belegte Deutschland vor den Niederlanden und Frankreich den Spitzenplatz. Etwa die Hälfte der eingeführten Eier wird in der Schweiz aufgeschlagen und als Eiprodukte in der Lebensmittelindustrie und in der Gastronomie verwendet, die andere Hälfte wird im Detailhandel verkauft. Ausgeführt wurden lediglich 5 t. Zudem wurden 8'500 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine in die Schweiz gebracht. Zwei Drittel davon stammten aus den Niederlanden. Die Ausfuhren beliefen sich hingegen nur auf 38 t.
1.1 ÖKONOMIE 1 32
■ Verbrauch: Geflügelfleisch im Hoch
Im Rahmen der Uruguay-Runde der WTO hat sich die Schweiz verpflichtet, den Marktzutritt für eine bestimmte Fleischmenge zu tiefen Kontingentszöllen zu gewähren. Für Rind-, Kalb-, Schaf-, Pferde- und Ziegenfleisch beträgt die Zollkontingentsmenge seit 1996 zusammen 22'500 t. Die Schweiz hat ihre Verpflichtung jedes Jahr eingehalten. Für Schweine- und Geflügelfleisch nahm die Zollkontingentsmenge von 50'020 t im Jahre 1996 auf 54'500 t im Jahre 2000 zu; seither ist sie konstant. 2007 betrug die Ausnützung des Zollkontingents 99% (53'770 t). Seit 1996 beträgt das Zollkontingent für Tiere der Pferdegattung 3'322 Stück. Die Ausnützung liegt bei durchschnittlich 89% und im Berichtsjahr bei über 99%.

Der Fleischverbrauch lag mit 401'037 t um 2,2% über dem Vorjahreswert. Spitzenreiter ist Schweinefleisch mit 195'750 t, gefolgt von Rindfleisch (82'577 t) und Geflügelfleisch (74'292 t). Um 17,5% ist der Verbrauch von Geflügelfleisch gestiegen. Hingegen brach der Verbrauch von Lammfleisch um 4,2% und von Kalbfleisch um 2,4% ein. Ausserdem verzehrten die Schweizerinnen und Schweizer 63’969 t Fisch und Krustentiere. Davon stammten rund 97% aus dem Ausland.
Der Pro-Kopf-Konsum von verkaufsfertigem Fleisch nahm im Berichtsjahr um 1,2% auf 51,95 kg zu. Wie seit Jahren wird Schweinefleisch (25,36 kg) am meisten konsumiert, gefolgt von Rindfleisch (10,70 kg) und Geflügelfleisch (9,62 kg). Den grössten Sprung im Pro-Kopf-Konsum verzeichnete das Geflügelfleisch mit einem Anstieg von 16,3%. Alle anderen Fleischkategorien wiesen einen rückläufigen oder stabilen Pro-KopfKonsum auf. Grösste Verlierer sind Schaf- und Lammfleisch mit einem Rückgang von 5,1% und Kalbfleisch mit 3,3%. Stabil blieb der Konsum von Pferdefleisch mit 0,68 kg pro Kopf. Die Lust auf Eier führte zu einem seit langem wieder steigenden Konsum auf 188 Eier pro Kopf. Der Mehrkonsum ging auf das Konto einer höheren Importmenge.
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern
Quellen: Proviande und Aviforum
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 33
1990/92 200520062007 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch
Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier
Im Berichtsjahr erzielten die Produzenten von Schlachtvieh der Rindergattung sehr gute Preise. Zu dieser Entwicklung trugen einerseits die stabile Nachfrage und andrerseits das geringe Angebot bei. Für Muni und Rinder mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurden im Jahresmittel Fr. 8.73 bzw. Fr. 8.58 je kg SG franko Schlachthof bezahlt. Dies entspricht einem Anstieg von rund 30 Rp. gegenüber dem Vorjahr und 70 Rp. gegenüber 2005. Nach einer Preisbaisse bei den Schweinen in den Jahren 2005 und 2006 stieg der Produzentenpreis wieder auf Fr. 4.04 je kg SG ab Hof an. Dafür ist hauptsächlich die tiefere Inlandproduktion verantwortlich. Seit dem Tiefpunkt 2004 ist der Preis für Lämmer stetig gestiegen; als Ursache gilt das rückläufige Inlandangebot.
Die durchschnittlichen Produzentenpreise eines Monats verlaufen bei verschiedenen Fleischkategorien saisonal. Die Grillsaison belebt den Konsum von Schweinefleisch und führt zu den höchsten Preisen im Mai und Juni. Das geringe Angebot an Kälbern im Herbst und Winter führt zu den höchsten Produzentenpreisen in dieser Zeit. Mit steigendem Angebot ab März bis zum Sommer sinkt in der Folge der Preis wieder. Kein saisonaler Preisverlauf war im Berichtsjahr bei Rind- und Kuhfleisch zu beobachten. Weil das Inlandangebot grundsätzlich sehr gering war und durch Mehrimporte permanent ergänzt werden musste, wirkte sich das grössere Angebot im Herbst nicht negativ auf die Produzentenpreise aus.

1.1 ÖKONOMIE 1 34
■ Produzentenpreise: Preise für Schlachtvieh im Hoch
Fr. pro kg SG
Monatliche Schlachtvieh- und Schweinepreise 2007
Kälber, Handelsklasse T3 Lämmer Handelsklasse T3 Muni, Handelsklasse T3
Kühe, Handelsklasse T2/3 Fleischschweine, leicht
3.00 4.00 6.00 5.00 8.00 7.00 9.00 11.00 10.00 13.00 12.00 15.00 14.00 16.00 17.00 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Quelle: SBV
■ Konsumentenpreise steigen
Die steigenden Produzentenpreise für Schweine und Tiere der Rindergattung bewirkten insgesamt höhere Konsumentenpreise. Für Entrecôte bezahlten Konsumenten rund Fr. 59.– je kg und für Schweinekoteletten rund Fr. 20.– je kg. Die beobachteten Konsumentenpreise für Fleisch aller Tierkategorien lagen im Berichtsjahr höher als 1990/92, obwohl seither die Produzentenpreise teils wesentlich gesunken sind. Die grösste Steigerung bei den Konsumentenpreisen seit 1990/92 weist Kalbfleisch auf. Allerdings ist der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke an den gesamten Haushaltsausgaben seit Jahren rückläufig. Er betrug im letzten Erhebungsjahr 2005 lediglich noch 7,7%.
■ Bruttomarge auf Fleisch
Gegenüber dem Vorjahr ging der Jahresdurchschnitt der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung von frischem Rindfleisch um 3,3% zurück. Wenig gesunken sind hingegen die Margen für Kalb- und Schweinefleisch. Um 11,4% stieg die Marge für Lammfleisch. Über alle Fleischkategorien (Rind, Kalb, Schwein und Lamm) sowie Fleisch- und Wurstwaren zusammen gerechnet sank die Bruttomarge auf den tiefsten Jahresdurchschnitt seit mehreren Jahren. Die Bruttomarge lag rund 10% über der Basisperiode (Februar-April 1999). Dies ist ein Zeichen des verstärkten Wettbewerbs. Interessant ist der saisonale Verlauf der Bruttomarge Schweinefleisch: Diese weist seit einigen Jahren im Juli und August jeweils die tiefsten Werte auf. Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung ist die Ankurbelung des Verkaufs durch tiefere Preise in der Sommerferienzeit.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 35
Index (Februar–April 1999 = 100) Schwein Rind Kalb Lamm Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren Quelle: BLW 150 155 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Entwicklung der Bruttomargen Fleisch 2007
■ Wettersituation: Sommer im April
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte
Das Jahr 2007 war extrem warm. Die erste Hälfte des Berichtsjahres war von überdurchschnittlichen Temperaturen geprägt. In der Südschweiz betrug der Wärmeüberschuss rund 2°C, in höheren Lagen war ein etwas geringerer Wärmeüberschuss zu verzeichnen. Der April präsentierte sich sommerlich warm. Mai und Juni waren auch um 1,5–3°C wärmer als im langjährigen Mittel. Dementsprechend war die Vegetation ab April bis im Sommer stets 2–3 Wochen im Vorsprung. Im Juli und August normalisierten sich die Temperaturen, der Oktober war sogar leicht kühler als das langjährige Mittel (1961–1990). Im Mittelland gab es nur zwei kurze Wintereinbrüche mit Schnee (24.–26. Januar und 19.–24. März). Das Berichtsjahr war in der westlichen Schweiz niederschlagsreich. Im Osten fielen normale Mengen, während im Süden und im Engadin unterdurchschnittliche Regensummen fielen. Der April war extrem trocken, vielerorts fiel bis zu 25 Tage kein Regen. Westlich der Reuss brachte der Juli grosse Regenüberschüsse, während im Tessin teils weniger als die Hälfte der Normalsummen fielen. Der August war ebenfalls äusserst regenreich, dafür war der Oktober, nach einem normalen September, vielerorts trocken. Die überdurchschnittliche Jahresbesonnung war 2007 hauptsächlich dem extrem sonnigen April zu verdanken. Im Sommer waren die monatlichen Überschüsse respektive Defizite an Sonnenstunden gering, einzig der August verzeichnete in einigen Gebieten ein deutliches Sonnenscheindefizit.
Die intensiven Niederschläge vom 8./9. August werden im Berichtsjahr als extremes Wetterereignis festgehalten. In 48 Stunden erhielten Wädenswil und Zürich um die 140 mm Regen. Vielerorts (vor allem Bern und Basel) führten die extremen Regenmengen zu kritischen Hochwassersituationen.

1.1 ÖKONOMIE 1 36
■ Produktion: Flächenabnahme bei Ölkürbissen und Soja
Ackerkulturen
Die offene Ackerfläche wurde gegenüber dem Vorjahr um 4'795 ha (2%) reduziert. Die Brotgetreidefläche wurde mit 2% ein wenig vergrössert, während die Futtergetreidefläche im Vergleich zum Vorjahr um ganze 12% zurückging. Unter den Kulturen, welche im Berichtsjahr an Fläche gewonnen haben zählen Zuckerrüben (10%), Raps (8%), Silo- und Grünmais (2%) und Freilandgemüse (1%). Flächenabnahmen verzeichneten die Ölkürbisse (–14%), Soja (–11%), Sonnenblumen (–8%), Futterrüben (–5%), Kartoffeln (–2%) und Hülsenfrüchte (–1%).
Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2007 (provisorisch)
Total 279 671 ha
Silo- und Grünmais 15% 42 773 ha
Freilandgemüse 3% 9 254 ha
Raps 7% 18 649 ha
Zuckerrüben 7% 20 660 ha
übrige Kulturen 7% 19 018 ha
Getreide 56% 157 572 ha
Kartoffeln 4% 11 745 ha
Quelle: SBV
Mit Ausnahme von Gerste und Raps, welche die Erträge des Vorjahrs nicht ganz erreichten (–2%), übertrafen die Kulturen die niedrigen Erträge von 2006. Der Weizenertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5% und der Zuckerrübenertrag um 12% gesteigert werden. Auch der letztjährige ausserordentlich tiefe Kartoffelertrag von 324 dt/ha überschritt im Berichtsjahr zum ersten Mal seit 2000, durch eine Ertragssteigerung um 29%, die Grenze von 400 dt (417 dt/ha).
Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte
1990/92199920002001200220052007
Produkte (Erträge 2007 provisorisch)
Winterweizen (59,4 dt/ha)
Kartoffeln (417,0 dt/ha)
Raps (30,3 dt/ha)
Gerste (60,6 dt/ha)
Zuckerrüben (743,4 dt/ha)
Quelle: SBV
1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 37
2006 20032004
(1990/92 = 100)
Index
70 140 130 120 110 100 90 80
Tabellen 3–12, Seiten A4–A12
■ Verwertung: Auswuchs bei Getreide
Die Brotgetreideproduktion erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr, mit einer Steigerung der Produktionsfläche und einer leichten Abnahme der Erträge, nur um 1%. Die Futtergetreideproduktion konnte trotz einer starken Flächenreduktion konstant gehalten werden. Im Vorjahr ging die Körnermais-Produktion stark zurück. Trotz einer weiteren Flächenreduktion konnte im Berichtsjahr die Produktion dank sehr guten Erträgen wieder gesteigert werden (19%). Die Haferproduktion nahm wie in den letzten Jahren weiterhin kontinuierlich ab (–16%). Die Weizenproduktion ist insgesamt konstant geblieben. Eine detaillierte Betrachtung zeigt jedoch, dass die Anbaufläche von Weizen als Brotgetreide um 2% gesteigert wurde, während die Futterweizenfläche um 26% niedriger war als im Vorjahr.
Die Wetterbedingungen im Frühjahr des Berichtsjahres waren vielversprechend für eine gute Getreideernte. Das nasse Wetter im Juli erschwerte jedoch die Getreideernte und führte vielerorts zu einem hohen Protzensatz an Auswuchs. Nach einem sehr niedrigen Zuckergehalt der Zuckerrüben von 16,4% im letzten Jahr erreichten die Zuckerrüben im Berichtsjahr einen sehr hohen Zuckergehalt von 17,8%. Trotz zu nassen Wetterbedingungen bei der Saat und zu trockenen Bedingungen im April war die Zuckerrübenernte mit einem Durchschnittsertrag von 13,2 t Zucker pro Hektare auf einem normalen Niveau. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 282’754 t Zucker produziert. Die Kartoffelernte konnte trotz einer um 300 ha niedrigeren Kartoffelanbaufläche als im Vorjahr um 99'300 t gesteigert werden (Durchschnittsertrag von 417 dt/ha). Die guten Wetterbedingungen im Frühling führten zu einem Überangebot an Charlotte auf dem Inlandmarkt. Grosse Mengen konnten trotz Frischkonsumqualität nicht abgesetzt werden. Dies war der Hauptgrund warum im Berichtsjahr 116’000 t Kartoffeln frisch verfüttert wurden. Dank den Bemühungen der Kartoffelbranche die Verwertungsprioritäten einzuhalten, wurde nur eine kleine Menge von 5’600 t zu Flocken und Mehl verarbeitet. Starke Gewitter kurz vor der Rapsernte führten an einigen Orten zu grösseren Ernteeinbussen. Die Kulturen von Raps und Sonnenblumen litten unter den schlechten Witterungsverhältnissen, wodurch die Flächenerträge unterdurchschnittlich ausfielen. Bei den Sonnenblumen konnte wie im Vorjahr nicht die ganze Zielmenge zugeteilt werden. Die von den Ölwerken abgeschlossenen Kontrakte über rund 15'000 t mussten gekürzt werden.
38 1.1 ÖKONOMIE 1
Entwicklung der Getreideproduktion 1990/92 2005200620071 in 1 000 t Weizen Triticale Quelle: SBV 1 provisorisch Roggen Hafer Dinkel Körnermais Gerste 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 342 211 536 211 181 533 230 152 521 231 199
■ Aussenhandel: Anstieg der Rohstoffpreise (Bsp. Zucker)
Aufgrund verschiedener Faktoren begannen die Preise auf dem Agrarweltmarkt in der zweiten Jahreshälfte des Berichtjahres in einem unvorhersehbarem Masse anzusteigen. Nebst den neu aufgetretenen Börsenspekulationen mit Agrargütern hatten die steigende Nachfrage in Entwicklungs- und Schwellenländern, grosse wetterbedingte Ernteausfälle und die Nachfrage nach Rohstoffen zur Herstellung von biogenen Treibstoffen Einfluss auf die Preisentwicklungen. Zu den Ereignissen auf dem Weltmarkt kam speziell beim Zuckermarkt dazu, dass bereits in der ersten Jahreshälfte 2007 im Vergleich zu den Vorjahren viel grössere Mengen Zucker zum präferenziellen Zollansatz eingeführt wurden. Dadurch drohte der schweizerische Zuckerpreis wesentlich unter denjenigen der EU zu fallen. Durch die vermehrten Einfuhren von billigem Zucker aus Entwicklungsländern war das Abkommen (Protokoll Nr. 2) der Schweiz mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1972 gefährdet, wonach der Zuckerpreis der EU und derjenige der Schweiz annähernd gleich sein sollten («Doppel-NullLösung»). Um das Protokoll Nr. 2 nicht zu gefährden, wurde per 1. September 2007 (bis 31. Dezember 2007) der Präferenzzoll für Entwicklungsländer aufgehoben. LDCLänder (Least Developed Countries) und Länder mit bilateralen Abkommen wurden von dieser Änderung nicht betroffen. Per 1. Januar 2008 wurde die Einfuhr von Weisszucker aus Entwicklungsländern auf 10'000 t kontingentiert (zusätzliches Kontingent für Rohzucker von 7’000 t), damit kurzfristige Aufhebungen der Präferenzzölle künftig verhindert werden können.
Einfuhren von Zucker (27.8.2006–22.2.2008) (Charge ≥ 1 t, Preis ≤ 80.–/100 kg)
MFN inkl. GFB
APS inkl. GFB
LDC 25% inkl. GFB
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 39 1.1 ÖKONOMIE 1
Aug. 2006 Okt. 2006 Dez. 2006 Febr. 2007 April 2007 Juni 2007 Aug. 2007 Okt. 2007 Dez. 2007 Febr. 2008 EL APS Menge EL MFN Menge Nicht EL Menge Quellen: BLW, OZD 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 in 1000 t Fr. je 100 kg 0 60 45 30 15
■ Produzentenpreise: Anstieg der Rapspreise
Die hohen Kartoffelpreise aus dem Vorjahr gingen wieder leicht zurück. Im Vergleich zu den Jahren 2004 und 2005 befanden sich die Produzentenpreise von Kartoffeln im Berichtsjahr immer noch auf einem sehr hohen Preisniveau. Der durchschnittliche Produzentenpreis der Basisjahre 1990/92 war nur gerade 82 Rappen höher.
Der durchschnittliche Produzentenpreis von Raps verzeichnete im Berichtsjahr zum ersten Mal seit 2003 einen Anstieg. Diese Tendenz kann mit den steigenden Ölpreisen auf dem Weltmarkt in der zweiten Jahreshälfte erklärt werden.
Entwicklung der Produzentenerlöse für Ackerprodukte
■ Konsumentenpreise: Hoher Zuckerpreis konstant
Produzentenpreise 2006 Weizen Kl. I, 52.37 Fr./dt Zuckerrüben, 11.49 Fr./dt Raps, 75.55 Fr./dt
Gerste, 41.87 Fr./dt Kartoffeln, 38.07 Fr./dt
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Der letztjährige hohe Durchschnittspreis von Kristallzucker konnte sich im Berichtsjahr mit einem Rückgang von 2 Rp./kg kaum erholen. Die Nachfrage nach Zucker auf den Weltmärkten ist nach wie vor hoch, nicht zuletzt wegen der Ethanolproduktion zu Treibstoffzwecken. Der Kartoffelpreis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3% an. Weil die Konsumentenpreise von Weissmehl, Ruchbrot, Halbweissbrot, Weggli/Semmel, Gipfeli, Spaghetti und Sonnenblumenöl übers Jahr stark schwanken, werden sie nicht mehr in Form von jährlichen Durchschnittspreisen publiziert.
1.1 ÖKONOMIE 1 40
2005 2003
in %
1990/92199920002001200220042006
Abweichung
–70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60
■ Produktion: Dynamische Entwicklung der mittleren und grossen Gemüsegewächshaus-Betriebe
Spezialkulturen
Auf einer Fläche von 23’600 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’847 ha Reben, 6’602 ha Obstanlagen und 302 ha Strauchbeeren.
Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl. Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 14’400 ha. In den letzten Jahren waren die bedeutendsten Flächenzunahmen bei den Verarbeitungsgemüse Erbsen und Bohnen sowie bei den Grün- und Bleichspargeln zu verzeichnen.
Bei den Obstflächen waren die gleichen Entwicklungstendenzen wie in den Vorjahren zu beobachten. Die Apfelfläche betrug 4’235 ha und nahm weiter um einige Hektaren ab. Hingegen legten die Apfelsorten Gala, Braeburn, Topaz und Pinova weiter zu. In den letzten fünf Jahren steigerten sie ihren Anteil an der gesamten Apfelfläche um 9 Prozentpunkte auf 28%. Die Fläche der Birnenanlagen betrug 870 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr um einige Prozente ab. Steinobst war weiterhin im Trend. Die Fläche von Steinobst dehnte sich gegenüber dem Vorjahr um 39 ha auf 1’451 ha aus. Hingegen nahm die Beerenfläche erstmals seit mehreren Jahren um einige ha auf 709 ha ab.
Die gesamte Rebfläche der Schweiz betrug 14’847 ha und hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen (–38 ha). Davon waren 6’303 ha (–61 ha) mit weissen und 8’543 ha (+23 ha) mit roten Trauben bestockt. Der in den letzten Jahren zu beobachtende Rückgang des Anbaus weisser Rebsorten hat sich 2007 weiter verlangsamt. Mittelfristig ist mit einer Konsolidierung der Rebsortenverteilung auf dem derzeitigen Niveau von 43% weissen und 57% roten Sorten zu rechnen.
Die Gemüsegewächshäuser mit festem Fundament konzentrieren sich auf einige Regionen im Mittelland, des Rhonetales und des Tessins.
1.1 ÖKONOMIE 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 41
in ha 0,11– 0,50 0,51– 1,00 1,01– 2,00 2,01– 3,00 3,01– 5,00 5,01– 10,07
Gemüsekulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament 2007
Quelle: BLW, GG25 ©2008 swisstopo Werte pro Gemeinde
Die Fläche der Gemüsegewächshäuser mit festem Fundament nahm in den letzten acht Jahren von 100 auf 180 ha zu (+80%). Besonders stark legten die Betriebe mit mehr als 3 ha Gewächshausgemüse zu. Diese Betriebsgrössenklasse bestand im Jahre 2007 aus 11 Betrieben, welche zusammen 54 ha umfassten. Der Anteil der grossen Gewächshausbetriebe, gemessen an der gesamten Gewächshausfläche, betrug 31%. Zusätzlich bauten diese Gewächshausspezialisten 385 ha Freilandgemüse an. Der Anteil an der gesamten Freilandgemüsefläche bertrug lediglich 5%.
Es wurden 311'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 146’000 t Tafelobst geerntet. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich um Ertragssteigerungen von 2% bei Gemüse und 11% bei Obst.
Die Marktvolumina der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen 522’000 t bzw. 180’000 t. Das Gemüsevolumen war 2% und das Obstvolumen 1% grösser als im Durchschnitt der letzten vier Jahre. Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen betrug 60% und derjenige von Obst 81%. Bei Gemüse ist dieser Wert 1% und bei Obst 8% grösser als im Vierjahresmittel 2003/06.
Die Weinernte war im Berichtsjahr mit 1,040 Mio. hl erneut unterdurchschnittlich. Davon waren 512’292 hl Weisswein und 528’139 hl Rotwein. Das Erntevolumen lag um rund 2,9% höher als im Vorjahr.

1.1 ÖKONOMIE 1 42
199920002001200220032004200520062007 prov. Fläche (in ha) >3,01 1,01–3,00 0,11–1,00 Quelle: BLW 0 200 150 100 50
Gewächshausgemüse mit festem Fundament; Entwicklung der Flächen je Betriebsgrössenklassen
■ Verwertung: Dank optimalen Wetterbedingungen überdurchschnittliche Mostobsternte
Nach den Gesetzmässigkeiten der Alternanz wäre im Jahr 2007 mit einer unterdurchschnittlichen Mostobsternte zu rechnen gewesen. Dank idealen Bedingungen während der Blüte sowie optimalen Witterungsverhältnissen während der Fruchtentwicklung und trotz nicht bezifferbaren Ernteausfällen, verursacht durch Feuerbrand, wurde eine überdurchschnittliche Ernte eingebracht. Die in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 123’662 t und jene der Mostbirnen 39’162 t. Importiert wurden im Rahmen des Importkontingentes für Mostobst von jährlich 172 t 168 t Mostbirnen. Die Mitte August 2007 durch den SBV herausgegebene Vorernteschätzung unterschätzte die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln um 15% und bei den Mostbirnen um 68%. Der Deckungsgrad, gemessen an der Normalversorgung, betrug per Ende Jahr bei den Mostäpfeln 163%, bei den Mostbirnen 166%.
Der seit dem Jahr 2000 bei den ungegorenen Obstsaftgetränken verzeichnete Aufwärtstrend beim Getränkeausstoss setzte sich auch 2007 fort. Mit 540'000 hl lag er 2007 praktisch wieder auf dem Niveau der im Jahr 1980 begonnenen Erhebungen. Der Getränkeausstoss der gegorenen Obstsaftgetränke konnte seit vier Jahren auf gleichbleibendem, tiefem Niveau gehalten werden (123'000 hl).
■ Aussenhandel: Dank guter Obsternte besonders geringe Obsteinfuhren
Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst, welche in der Schweiz angebaut werden können, beliefen sich auf 212'000 t bzw. 38’000 t. Das waren 1% mehr Gemüse und 22% weniger Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Die Exporte waren mit 400 t Gemüse und 3'400 t Obst wie in den Vorjahren unbedeutend.
Die Einfuhren von Wein stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 108'325 hl und erreichten 1,875 Mio. hl. Davon wurden 1,635 Mio. hl innerhalb des Zollkontingents eingeführt. Die Weissweinimporte registrierten mit einem Gesamtvolumen von 341’058 hl erneut einen Anstieg (+33'017 hl bzw. +10,7%). Dabei stiegen sowohl der Anteil der Einfuhren an Flaschenweinen (+13,6%) als auch derjenige an Offenweinen (+8,9%). Beim Rotwein mit einer Gesamtmenge von 1,357 Mio. hl zeigten die Flaschenimporte einen markanten Anstieg (+11%), während die Offenweineinfuhren um 8'233 hl abnahmen (–1,2%). In diesen Zahlen sind alle Weineinfuhren einschliesslich Verarbeitungswein und Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz berücksichtigt.
■ Verbrauch: Weinkonsum nimmt wieder zu
Der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse betrug 69 kg, derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 24 kg. Die Werte entsprechen dem langjährigen Mittel.
Der Gesamtweinverbrauch betrug (inkl. Verarbeitungsweine und exportierte bzw. wiederausgeführte Weine) im Berichtsjahr 2,798 Mio. hl, was einer Zunahme um 3,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei stieg der Konsum von Schweizer Weinen auf 1,079 Mio. hl (+5,6%) und derjenige der ausländischen auf 1,719 Mio. hl (+2,3%). Insgesamt blieb der Marktanteil von Schweizer Wein mit rund 38% stabil.
1.1 ÖKONOMIE 1 43 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Preise: Erneuter Rekordumsatz bei Gemüse
Der Umsatz von Gemüse ist seit Jahren kontinuierlich am Wachsen und war mit 866 Mio. Fr. so gross wie noch nie zuvor. Er war 9% grösser als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt, franko Grossverteiler) betrug 2.79 Fr. pro kg gegenüber 2.76 Fr. pro kg im Jahr zuvor und 2.61 Fr. pro kg im Durchschnitt der vier Vorjahre.
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter
Gemüse Bruttomarge Gemüse Verkauf Linear (Gemüse Verkauf)
Die Bruttomarge Gemüse ist im Jahr 2007 praktisch stabil geblieben. Sie ist um 1 Rp. auf 1.60 Fr./kg angestiegen. Während sich der Einstandspreis um 1 Rp./kg erhöhte, stieg der Endverkaufspreis um 2 Rp./kg. Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2007 betrug 40% des Endverkaufspreises.
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen ausgewählter
Früchte Bruttomarge
Früchte Verkauf Linear (Früchte Verkauf)
Früchte Einstand Linear (Früchte Einstand) Linear (Früchte Bruttomarge)
Die Gesamtbruttomarge Früchte ist nach einem markanten Anstieg im Jahr 2006 wieder zurückgegangen (–24 Rp./kg). Während der Einstandspreis um 13 Rp./kg anstieg, sank der Endverkaufspreis um 11 Rp./kg an. Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2007 betrug 43% des Endverkaufspreises.
44 1.1 ÖKONOMIE 1
Gemüse 1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004 in Fr./kg Quelle: BLW 0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50
Linear (Gemüse Einstand) Linear (Gemüse Bruttomarge)
Gemüse Einstand
in Fr./kg Quelle: BLW 0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 1993199419951996199719981999200020012002200320052007 2006 2004
Früchte
■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
1.1.3Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme. Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR), welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl. Abschnitt 1.1.3). Die LGR wurde 2007 teilrevidiert. Alle hier ausgewiesenen Zahlen (Schätzung 2008 und sämtliche Resultate seit 1990/92) beruhen auf der neuen Methodik. Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (vgl. Abschnitt 1.1.4).

■
Im Jahr 2007 betrug das Nettounternehmenseinkommen 2,845 Mrd. Fr. Im Vergleich zu den Jahren 2004/06 war es 9 Mio. Fr. oder 0,3% tiefer. Dabei lagen die Werte für 2005 und insbesondere 2006 unter dem Dreijahresmittel, 2004 dagegen klar darüber. Die höhere Erzeugung (+215 Mio. Fr. oder 2,1%), die höheren sonstigen Subventionen (+84 Mio. Fr. oder 3,2%) sowie die höheren empfangenen Zinsen (+3 Mio. Fr. oder 27,3%) vermochten die Zunahme bei den Kosten nicht ganz zu kompensieren. Zugenommen haben vor allem die Kosten für die Vorleistungen (+164 Mio. Fr. oder 2,6%), die Abschreibungen (+89 Mio. Fr. oder 4,2%) und die gezahlten Zinsen (+41 Mio. Fr. oder 19,5%).
Gegenüber dem Jahr 2006 nahm das Nettounternehmenseinkommen 2007 um 215 Mio. Fr. zu (+8,2%). Das höhere Einkommen ist insbesondere auf die Zunahme der Erzeugung um 613 Mio. Fr. (+6,1%) zurückzuführen. Positiv ausgewirkt haben sich zudem die Zunahme der sonstigen Subventionen (+39 Mio. Fr. oder 1,5%) und die Abnahme des Arbeitnehmerentgelts (–18 Mio. Fr. oder 1,4%). Negativ ausgewirkt haben sich insbesondere die Zunahme der Vorleistungen (+364 Mio. Fr. oder 6,0%), der Abschreibungen (+63 Mio. Fr. oder 2,9%) und der gezahlten Zinsen (25 Mio. Fr. oder 11,1%).
■■■■■■■■■■■■■■■■■
45 1.1 ÖKONOMIE 1
Sektor-Einkommen 2007
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen, in Mio. Fr.

Stand 9.9.2008
Stand 9.9.2008
in der Literatur und in der Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet
Die Zahlen werden auf- oder abgerundet, wodurch die Summe der Komponenten gegenüber der Totale oder Salden abweichen kann.
1990/92200420052006 1 2007 2 2008 3 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs14 11010 89610 34710 02410 63710 913 –Vorleistungen6 8676 5046 2636 0836 4476 624 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen7 2434 3924 0833 9404 1904 289 –Abschreibungen2 0582 0982 1552 1662 2292 279 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen5 1852 2931 9291 7751 9612 010 –sonstige Produktionsabgaben43135141136140141 + sonstige Subventionen (produktunabhängige)8872 6072 5712 6572 6962 658 Faktoreinkommen6 0284 7654 3594 2964 5164 527 – Arbeitnehmerentgelt1 2341 2191 1931 2511 2331 237 Nettobetriebsüberschuss/Selbständigeneinkommen4 7943 5463 1653 0453 2833 290 – gezahlte Pachten193200201201201202 –gezahlte Zinsen456191212226251277 + empfangene Zinsen641111121419 Nettounternehmenseinkommen 4 4 2103 1672 7642 6302 8452 831 1Halbdefinitiv,
2Provisorisch,
3Schätzung,
4wird
Stand 9.9.2008
Quelle:
1.1 ÖKONOMIE 1 46
BFS
■ Schätzung des SektorEinkommens 2008
Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Sonstige Subventionen Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen) Nettounternehmenseinkommen
Die Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes 2008 liegt mit 10,913 Mrd. Fr. um 5,6% höher als das Dreijahresmittel 2005/07. Die pflanzliche Produktion zeigt dieses Jahr mittlere bis gute Erträge. Die Preise sind teilweise unverändert geblieben, teilweise aber höher als im Vorjahr. Bei der tierischen Erzeugung gehen die Schätzungen von einer beträchtlichen Erhöhung der Produktionswerte bei Milch sowie Schweine- und Geflügelfleisch aus.
Die pflanzliche Produktion (4,574 Mrd. Fr.; inbegriffen Gartenbau) wird 2008 gegenüberdem Mittel der drei Vorjahre um 3,1% höher geschätzt.
Die Getreideernte dürfte mengenmässig tiefer ausfallen als letztes Jahr, die Qualität jedoch besser sein. Damit wird dieses Jahr deutlich weniger Ware im Futtersektor zum Einsatz gelangen. Es wird angenommen, dass die Getreidepreise eher etwas tiefer ausfallen könnten als die im Vorjahr ausbezahlten. Der Wert der Getreideernte 2008 wird 1,2% unter dem Dreijahresmittel 2005/07 veranschlagt.
Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine gute Ernte erwarten. Die Änderung der Zuckermarktordnung hat zu tieferen Produzentenpreisen geführt. Gleichzeitig wurden für die Zuckerrüben Anbaubeiträge eingeführt, die ebenfalls im Produktionswert verbucht werden. Beim Raps sind die Erträge etwas tiefer als im Vorjahr, dafür wurde die Anbaufläche um 2000 ha ausgedehnt und die Produzentenpreise dürften höher sein als im Vorjahr. Der Produktionswert der Handelsgewächse insgesamt dürfte 2008 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2005/07 um 11,8% höher ausfallen.
1990/922004200520061 20072 20083 Angaben zu laufenden Preisen in Mio. Fr.
Quelle: BFS 1 Halbdefinitiv, Stand 9.9.2008 2 Provisorisch, Stand 9.9.2008 3 Schätzung, Stand 9.9.2008 0 12 000 14 000 16 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 47
Tabellen 14–15, Seiten A14–A15
Die Futterversorgung wird als ähnlich gut beurteilt wie im Vorjahr. Die vollen Lager üben jedoch Druck auf das Preisniveau des Hoffutters aus. Der Produktionswert der Futterpflanzen wird dieses Jahr 2,3% über dem Dreijahresmittel 2005/07 geschätzt.
Beim Gemüsebau werden die Erträge der Freilandkulturen höher eingeschätzt als diejenigen im Vorjahr. Auch beim Lagergemüse sind bessere Erträge als im Vorjahr zu erwarten. Der Produktionswert 2008 wird für den Gemüsebau 4,5% höher veranschlagt als im Mittel der drei Vorjahre.
Beim produzierenden Gartenbau wird eine Zunahme des Produktionswertes von 3,8% gegenüber dem Dreijahresmittel 2005/07 erwartet. Dies ist insbesondere auf den verbesserten Absatz der inländischen Baumschulerzeugnisse zurückzuführen.
Bei den Kartoffeln wird die Ernte 2008 tiefer als im Vorjahr eingeschätzt. Zum einen hat die Anbaufläche gegenüber 2007 weiter abgenommen, zum andern sind auch die Erträge etwas tiefer als im letzten Jahr ausgefallen. Dafür ist die Qualität gut und damit der Anteil an Speiskartoffeln hoch. Diese Marktsituation führte zu deutlich höheren Produzentenpreisen als im Vorjahr. Der Produktionswert 2008 wird 2,9% höher als das Dreijahresmittel 2005/07 geschätzt.
Beim Frischobst wird 2008 eine kleinere Ernte als im Vorjahr erwartet. Dafür dürften höhere Preise gelöst werden. Eher mittelmässig ausgefallen sind auch die Ernten bei den Beeren und beim Steinobst. Der Wert von Frischobst 2008 wird im Vergleich zum Dreijahresmittel 2005/07 voraussichtlich um 8,9% sinken. Die Position Obst beinhaltet neben dem Frischobst zum Teil auch die Weintrauben (für den Frischkonsum und die Verarbeitung zu Wein ausserhalb des Bereiches Landwirtschaft). Für das dritte nachfolgende Jahr wird gegenüber dem Vorjahr mengenmässig eine grössere Weintraubenernte prognostiziert. Gesamthaft wird für die Position Obst 2008 ein um 1,5% tieferer Wert als im Durchschnitt der 2005/07 erwartet.
Der Produktionswert des Weins beruht teilweise auf den Veränderungen der Vorräte der beiden Vorjahre. Mengenmässig wird die Ernte 2008 um 6% höher als diejenige von 2007 und mit leicht höheren Preisen geschätzt, so dass der Produktionswert des Weins 2008 um 7% über dem Dreijahresdurchschnitt 2005/07 veranschlagt wird.
Die tierische Produktion (5,407 Mrd. Fr.) wird 2008 im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre um 8,9% höher eingeschätzt. Sowohl die Nutz- und Schlachtviehproduktion wie auch die tierischen Erzeugnisse wie Milch und Eier tragen zu diesem guten Ergebnis bei. Der Rindviehmarkt profitiert auch dieses Jahr dank ausgeglichenen Märkten grossteils von guten Preisen. Wesentlich höhere Preise als im Vorjahr erhalten die Schweineproduzenten. Die deutliche Steigerung des Konsums beim Geflügelfleisch hat auch zu einer Mehrproduktion im Inland beigetragen. Die sinkende Schaffleischproduktion dürfte durch höhere Preise ausgeglichen werden. Der Produktionswert der Milch wird 2008 um rund 11% höher ausfallen als im letzten Jahr. Dies ist einerseits auf einen deutlich besseren Milchpreis, zum andern auf eine Steigerung der Produktion zurückzuführen.

1.1 ÖKONOMIE 1 48
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen (626 Mio. Fr.) wird 2008 im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre um 0,9 % höher geschätzt. In dieser Position sind auch die Erträge für die Verpachtung von Milchkontingenten enthalten, welche 2008 auf Null zurückgehen, weil für die Berechnung des Zinses jeweils die Ende Milchjahr verpachteten Kontingente herangezogen werden. Da die Milchkontingentierung 2009 aufgehoben wird, wird es zu diesem Zeitpunkt keine Verpachtungen mehr geben. Der Produktionswert der übrigen landwirtschaftlichen Dienstleistungen wie insbesondere Lohnarbeiten für Dritte (z.B. Saat und Ernte) hat in den letzten Jahren kontinuierlich etwas zugelegt.
Der Wert der nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten (305 Mio. Fr.) dürfte 2008 gegenüber dem Dreijahresmittel 2005/07 um 2,1% abnehmen. In dieser Position sind Tätigkeiten enthalten wie die Verarbeitung von Mostobst, Fleisch oder Milch auf dem Hof oder Dienstleistungen, wie Strassenrand- und Landschaftspflege, die Haltung von Pensionstieren (Pferde) sowie die Übernachtungen von Touristen (Schlafen im Stroh).
Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2008 auf 6,624 Mrd. Fr. veranschlagt, was 5,7% über dem Dreijahresdurchschnitt 2005/07 liegt. Dabei dürften die Ausgaben für Futtermittel ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr, wobei auf der einen Seite der Zukauf von Futtermitteln höhere Kosten verursacht, die innerbetrieblich erzeugten auf der anderen Seite weniger zu Buche schlagen. Gegenüber 2005/07 markant höher dürften 2008 die Ausgaben für Energie und Schmierstoffe (+14,9%) sowie für Dünger (+36,4%) sein. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die Landwirte dafür 2008 rund 130 Mio. Fr. mehr aufwenden müssen als 2007. Hingegen sind die Ausgaben für Pflanzenschutzmittel 2008 gegenüber 2005/07 gesunken. Es wird geschätzt, dass der Bedarf an tierärztlichen Leistungen und Medikamenten leicht zunimmt, parallel zur Entwicklung der Tierbestände. Die Zunahme der Löhne in den sekundären und tertiären Wirtschaftssektoren sowie die allgemeine Inflation der Konsumentenpreise dürften zur Folge haben, dass sich der Unterhalt der Maschinen und Gebäude sowie der sonstigen Vorleistungen verteuert.
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (4,289 Mrd. Fr.) wird 2008 um 5,4 % höher eingeschätzt als im Dreijahresmittel 2005/07.
Die Abschreibungen (2,279 Mrd. Fr.) werden 2008 im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre um 4,4% höher veranschlagt. Da die Abschreibungen zu Anschaffungspreisen (Wiederbeschaffungspreise) bewertet werden, spielt die Preisentwicklung der Investitionsgüter eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren sind die Preise für Bauten und Ausrüstungen (Fahrzeuge und Maschinen) deutlich gestiegen. Obwohl die Neuinvestitionen mengenmässig eine sinkende Tendenz aufweisen, wird diese Entwicklung durch die steigenden Preise mehr als kompensiert.
Die sonstigen Produktionsabgaben (141 Mio. Fr.) dürften 2008 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2005/07 um 1,3% zunehmen. Die sonstigen Produktionsabgaben setzen sich zusammen aus den übrigen Produktionsabgaben (Motorfahrzeugsteuer, Stempelgebühr und Grundsteuer) sowie der Unterkompensation der Mehrwertsteuer.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 49
Die sonstigen Subventionen (2,658 Mrd. Fr.) beinhalten alle Direktzahlungen, den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite, Betriebshilfe) und die übrigen von Kantonen und Gemeinden erbrachten laufenden Beiträge. Nicht enthalten sind die Gütersubventionen, welche bereits im Produktionswert zu Herstellungspreisen berücksichtigt wurden (z.B. Anbauprämien und Zulagen für silagefreie Fütterung bei der Milchproduktion). Die sonstigen Subventionen dürften 2008 gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 0,7% höher ausfallen.
Das Arbeitnehmerentgelt (= Angestelltenkosten) wird für 2008 auf 1,237 Mrd. Fr. geschätzt, was einer Zunahme um 0,9% gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2005/07 entspricht. Der Rückgang von Angestellten in der Landwirtschaft (–4.4%, in Jahresarbeitseinheiten ausgedrückt) dürfte durch den Anstieg der Lohnkosten (inkl. Sozialbeiträge der Arbeitgeber) mehr als wettgemacht werden.
Die gezahlten Pachten (202 Mio. Fr.) stagnieren seit Jahren und dürften auch 2008 gegenüber dem Dreijahresmittel 2005/07 praktisch auf derselben Höhe bleiben (+0,2%). Die gezahlten Schuldzinsen (277 Mio. Fr.) werden 2008 gegenüber dem Dreijahresmittel um 20,9% höher veranschlagt, was zum grossen Teil auf die Erhöhung der Hypothekarzinssätze zurückzuführen ist. Zur erhöhten Schuldenlast trägt – jedoch in begrenztem Ausmass – auch die geschätzte Zunahme der Passiven bei.
Als Nettounternehmenseinkommen verbleiben 2,831 Mrd. Fr. Das sind 3,1% mehr als das Dreijahresmittel 2005/07. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Schätzung um 14 Mio. Fr. tiefer (0,5%).
50 1.1 ÖKONOMIE 1
1.1.4Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren, wie z.B. jener zur finanziellen Stabilität, wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe. Im Tabellenanhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt. Auf den folgenden Seiten wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen.

■■■■■■■■■■■■■■■■
Begriffe und Methoden, Seite A59 1.1 ÖKONOMIE 1 51
■ Landwirtschaftliches Einkommen 2007 höher als 2004/06
Einkommen und betriebswirtschaftliche Kennziffern
Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel aller Regionen
1990/922007 20052006
Die Rohleistung nahm im Jahr 2007 gegenüber dem Mittel der Jahre 2004/06 um 6,1% zu. Die Zunahme gegenüber 2006 liegt in der selben Grössenordnung (+7,0%). Dies liegt einerseits an den höheren Produzentenpreisen einzelner tierischer und pflanzlicher Produkte (Rindvieh, Schweine, Gemüse) und andererseits an der Ausdehnung der Raps- und Zuckerrübenflächen und höheren Erntemengen im Ackerbau (vor allem Kartoffeln und Zuckerrüben) sowie im Futter- und Obstbau. Die Direktzahlungen pro Betrieb nahmen gegenüber den drei Vorjahren um 7,1% zu. Im Vergleich zu 2006 betrug die Zunahme 4,4%. Dies ist die Folge des flächenmässigen Betriebswachstums und der erstmaligen Ausrichtung von Direktzahlungen für Milchkühe (Beiträge für raufutterverzehrende Tiere).
Die Fremdkosten lagen im Jahr 2007 um 5,0% über dem Dreijahreswert 2004/06. Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um 4,3%. Zugenommen haben insbesondere die Futtermittelkosten aufgrund des höheren Rindviehbestands, die Kosten für den Tierzukauf, die Kosten für Arbeiten durch Dritte sowie die Gebäudekosten.
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohleistung und Fremdkosten. Es entschädigt einerseits die Arbeit der durchschnittlich 1,24 Familienarbeitskräfte und andererseits das durchschnittlich im Betrieb investierte Eigenkapital von 424'000 Fr. Im Jahr 2007 lag das landwirtschaftliche Einkommen 9,4% über dem Mittelwert der Jahre 2004/06 und 15,5% über dem Vorjahresniveau.
Tabellen 16–25, Seiten A16–A26
2004 Fr. pro Betrieb Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Landwirtschaftliches Einkommen Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheiten 23 417 61 143 1,24 21 557 60 472 1,25 22 172 54 274 1,24 22 939 52 915 1,24 1.1 ÖKONOMIE 1 52
Das landwirtschaftliche Einkommen war 2007 gegenüber 2004/06 in der Tal- und Hügelregion um 11,2% bzw. 9,2% höher, in der Bergregion betrug die Zunahme 4,6%. Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen nahm ebenfalls in allen Regionen zu, in der Talregion um 7,0%, in der Hügelregion um 4,3% und in der Bergregion um 4,0%. Das Gesamteinkommen stieg in der Talregion um 10,2%, in der Hügelregion um 7,7% und in der Bergregion um 4,4%.
Der Anteil der Direktzahlungen an der Rohleistung betrug im Jahr 2007 15,9% in der Talregion, 23,0% in der Hügelregion und 35,9% in der Bergregion. Damit stieg der Anteil in der Tal- und Hügelregion gegenüber 2004/06 leicht an, während er in der Bergregion etwas sank.
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Regionen Einkommen nach RegionEinheit1990/9220042005200620072004/06–2007 % Talregion Landwirtschaftliche Nutzflächeha16,6620,0720,6421,0221,223,1 FamilienarbeitskräfteFJAE1,361,211,191,191,17–2,2 Landwirtschaftliches EinkommenFr.73 79472 61562 69661 13272 83411,2 Ausserlandw. EinkommenFr.16 42920 53221 53122 33922 9617,0 GesamteinkommenFr.90 22393 14684 22783 47195 79510,2 Hügelregion Landwirtschaftliche Nutzflächeha15,3018,5218,9218,8819,292,8 FamilienarbeitskräfteFJAE1,401,231,231,221,230,3 Landwirtschaftliches EinkommenFr.59 83854 74249 62748 11455 5209,2 Ausserlandw. EinkommenFr.14 54422 16723 27723 00023 8044,3 GesamteinkommenFr.74 38276 90972 90471 11479 3247,7 Bergregion Landwirtschaftliche Nutzflächeha15,7618,6319,0919,6619,813,6 FamilienarbeitskräfteFJAE1,421,331,341,331,340,5 Landwirtschaftliches EinkommenFr.45 54146 10944 80743 98047 0464,6 Ausserlandw. EinkommenFr.17 85322 64522 15123 87923 8014,0 GesamteinkommenFr.63 39468 75466 95867 85870 8484,4 Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1.1 ÖKONOMIE 1 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 53
Tabellen 16–19, Seiten A16–A19
Die Einkommenssituation der 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) weist erhebliche Differenzen auf.
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2005/07
BetriebstypLandw. Familien- Landw.Ausserlandw.GesamtNutzflächearbeits-EinkommenEinkommeneinkommen kräfte
Im Durchschnitt der Jahre 2005/07 erzielten die Betriebstypen Spezialkulturen, Ackerbau und bestimmte kombinierte Betriebe (Verkehrsmilch/Ackerbau, Veredlung) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen. Diese erwirtschafteten zusammen mit dem Betriebstyp kombiniert Mutterkühe auch die höchsten Gesamteinkommen. Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen anderes Rindvieh und Pferde/Schafe/Ziegen. Dazwischen liegen die spezialisierten Verkehrsmilchbetriebe. Ihre Ergebnisse sind in allen Einkommenskategorien unterdurchschnittlich.
haFJAEFr.Fr.Fr. Mittel alle Betriebe20,041,2456 11122 84378 954 Ackerbau24,160,9662 40228 99191 393 Spezialkulturen12,961,2667 67521 49789 172 Verkehrsmilch20,131,3253 86019 02972 888 Mutterkühe19,651,1444 79733 47278 269 Anderes Rindvieh16,91,2336 72128 47265 193 Pferde/Schafe/Ziegen13,661,2430 61437 40868 022 Veredlung11,991,1853 43628 94182 377 Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau27,071,2771 05315 58286 635 Kombiniert Mutterkühe24,041,0854 36530 65985 023 Kombiniert Veredlung20,241,2668 25217 80386 055 Kombiniert Andere22,251,2258 59723 21681 812 Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1.1 ÖKONOMIE 1 54
Tabellen 20a–20b, Seiten A20–A21
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte. Gegenüber dem Dreijahresmittel 2004/06 verbesserte sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) 2007 um 6,7%. Im Vergleich zu 2006 stieg er um 12,8%. Damit hat der Arbeitsverdienst im Vergleich zu den drei Vorjahren und zum Vorjahr weniger stark zugenommen als das landwirtschaftliche Einkommen. Der Grund dafür liegt im gestiegenen Zinsanspruch für das Eigenkapital (höheres Zinsniveau der Bundesobligationen) und im höheren Eigenkapitaleinsatz.
Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen unterschiedlich hoch. Im Durchschnitt ist er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion. Auch die Quartile liegen weit auseinander. So erreichte 2005/07 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 19,7% und derjenige im vierten Quartil 205,6% des Mittelwertes aller Betriebe der Region. In der Hügelregion war die Streuungsbandbreite ähnlich (15,9% und 196,0%) und im Berggebiet noch grösser (8,5% und 209,4%).

Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 2005/07: nach Regionen und Quartilen Arbeitsverdienst 1 in Fr. pro FJAE 2
1Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen: 2005: 2,11%; 2006: 2,50%; 2007: 2,91%
2Familien-Jahresarbeitseinheiten: Basis 280 Arbeitstage
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
MedianMittelwerte Region1. Quartil2. Quartil3. Quartil4. Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Talregion42 530 8 941 33 859 52 276 93 373 Hügelregion32 170 5 365 25 257 39 576 66 186 Bergregion25 966 2 292 19 459 32 543 56 810
Tabellen 21–24, Seiten A22–A25
1.1 ÖKONOMIE 1 55
■ Arbeitsverdienst 2007
In der Tal- und Hügelregion übertraf 2005/07 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe im Durchschnitt den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung um über 23'000 Fr. resp. über 2'000 Fr. In der Bergregion verfehlte in diesem Zeitraum das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe das Niveau des entsprechenden Vergleichslohns um über 2'000 Fr. Im Vergleich zur Periode 2004/06 hat nur die Talregion ihre relative Situation leicht verbessert.
Vergleichslohn 2005/07, nach Regionen
RegionVergleichslohn 1
Fr. pro Jahr
Talregion69 907
Hügelregion63 792
Bergregion59 071
1Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten
Quellen: BFS, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Zu berücksichtigen gilt, dass die landwirtschaftlichen Haushalte ihren Lebensunterhalt nicht nur aus dem Arbeitsverdienst bestreiten. Ihr Gesamteinkommen, einschliesslich der ausserlandwirtschaftlichen Einkommen, liegt wesentlich höher als der Arbeitsverdienst.
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens. Kombiniert man diese Kennzahl mit der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen. Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält – finanziell nicht existenzfähig.
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt.
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit …
Fremdkapitalquote
Tief (<50%)Hoch (>50%)
EigenkapitalbildungPositiv... guter... beschränkter finanfinanzieller Situationzieller Selbständigkeit
Negativ... ungenügendem ... bedenklicher
Einkommenfinanzieller Situation
Quelle: De Rosa
1.1 ÖKONOMIE 1 56
■ Finanzielle Stabilität
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild. Zwischen 38 und 42% der Betriebe befinden sich in einer finanziell guten Situation und zwischen 35 und 37% sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung). Das Dreijahresmittel 2005/07 präsentiert sich damit in allen Regionen etwas schlechter als 2004/06.
Beurteilung der finanziellen Stabilität 2004/06 nach Regionen

1.1 ÖKONOMIE
Talregion Hügelregion Bergregion Anteil Betriebe in % bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle Situation Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 17 19 23 41 18 19 25 38 15 20 23 42 1 57
■ Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
Die Investitionen der ART-Referenzbetriebe haben im Jahr 2007 im Vergleich zu 2004/06 abgenommen (–6,3%). Gleichzeitig hat aber der Cashflow zugenommen (+5,0%). Daraus resultiert eine Zunahme beim Cashflow-Investitionsverhältnis um 11,5%. Die Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen minus Privatverbrauch) war wesentlich höher als in der Referenzperiode (+35,4%) und die Fremdkapitalquote etwas höher (+2,3%). Der Grund für die Zunahme liegt darin, dass das Fremdkapital mehr zugenommen hat als das Eigenkapital. Beim Fremdkapital nahmen insbesondere die Hypothekarkredite und das verschiedene mittel- und langfristige Fremdkapital zu.
Entwicklung von Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
1Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Merkmal1990/9220042005200620072004/06–2007 % EigenkapitalbildungFr.19 51315 5909 4937 32514 62735,4 Investitionen 1 Fr.46 91451 26147 33646 52445 333–6,3 Cashflow-Investitionsverhältnis 2 %9591889010011,5 Fremdkapitalquote%43444345452,3
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 1.1 ÖKONOMIE 1 58
Die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft setzt sich dieses Jahr aus den beiden folgenden Bereichen zusammen:
–Gesamteinkommen und Privatverbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte sowie –Studie zu gesellschaftlichen und sozialen Fragestellungen.
Im vorliegenden Agrarbericht werden daher die Einkommen und der Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART dargestellt. Die diesjährige Studie befasst sich mit der Thematik «Junge Bewirtschaftende und ihre Sicht der Zukunft». Die Studie ist Fragen wie «Wer sind die Jungbauern und Jungbäuerinnen?» «Was erwarten sie von der Zukunft?» nachgegangen.

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.2Soziales
1.2 SOZIALES 1 59
■ Gesamteinkommen und Privatverbrauch
1.2.1Einkommen und Verbrauch
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Bauernfamilien sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen. Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem als Mass für die Leistungsfähigkeit der Betriebe. Bei der sozialen Dimension steht die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte im Vordergrund. Daher wird das ausserlandwirtschaftliche Einkommen der Bauernfamilien ebenfalls mit in die Analyse einbezogen. Untersucht werden dabei sowohl das Gesamteinkommen als auch die Entwicklung des Privatverbrauchs.
Das Gesamteinkommen, das sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen zusammensetzt, lag im Durchschnitt der Jahre 2005/07 je nach Region zwischen 68’600 und 87’800 Fr. pro Haushalt: Die Haushalte der Bergregion erreichten etwa 78% des Gesamteinkommens der Haushalte der Talregion. Mit durchschnittlichen ausserlandwirtschaftlichen Einkommen von 22’300 bis 23’400 Fr. hatten die Bauernfamilien eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle: Diese machte bei den Haushalten der Talregion 25% des Gesamteinkommens aus, bei jenen der Hügelregion 31% und bei denjenigen der Bergregion 34%. Die Haushalte der Hügelregion wiesen mit 23’400 Fr. absolut die höchsten ausserlandwirtschaftlichen Einkommen aus.
Quelle: Zentrale Auswertung, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Die Eigenkapitalbildung – der nicht konsumierte Teil des Gesamteinkommens – macht in allen Regionen durchschnittlich rund 13% des Gesamteinkommens aus. Der Privatverbrauch liegt jeweils über der Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens. Er ist entsprechend der Höhe des Gesamteinkommens bei den Haushalten der Talregion absolut am höchsten und bei jenen der Bergregion am tiefsten.
Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Haushalt lag 2007 mit 84’600 Fr. über jenem der Jahre 2004/06 mit 78’100 Fr. Und auch der Privatverbrauch pro Haushalt im Jahr 2007 hat im Vergleich zu 2004/06 um 2’600 Fr. zugenommen und lag bei 70’000 Fr.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Talregion
in Fr. Privatverbrauch Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Landwirtschaftliches
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Betrieb nach Region 2005/07
Hügelregion Bergregion
Einkommen
0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 SOZIALES 1 60
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Verbrauchereinheit
nach Quartil 1 2005/07

1. Quartil2. Quartil3. Quartil4. QuartilAlle Betriebe
1 Quartile nach Arbeitsverdienst je Familien-Jahresarbeitseinheit
2 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr Quelle: Zentrale Auswertung, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Die Haushalte des ersten Quartils erreichten 43% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Haushalten des vierten Quartils. Beim Privatverbrauch war die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer: Er lag bei den Haushalten des ersten Quartils bei 69% des Verbrauchs der Haushalte des vierten Quartils.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte 2005/07 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken. Die Eigenkapitalbildung war negativ. Zehren diese Betriebe längerfristig von der Substanz, so müssen sie früher oder später aufgegeben werden. In den übrigen Quartilen war der Privatverbrauch geringer als das Gesamteinkommen: Er lag bei den Betrieben des zweiten Quartils bei 95% des Gesamteinkommens, bei den Betrieben des dritten Quartils bei 84% und bei den Betrieben des vierten Quartils bei 71%.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit war 2007 in allen Quartilen im Vergleich zu den drei Vorjahren 2004/06 höher. Auch der Privatverbrauch hat im Jahr 2007 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2004/06 in allen Quartilen zugenommen.
Ein kurzer Rückblick zeigt Folgendes: In den letzten zehn Jahren erreichten die Haushalte des ersten Quartils im Dreijahresmittel durchwegs rund 43% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Haushalten des vierten Quartils. Und das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte in den letzten zehn Jahren den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nie decken, es fehlten jeweils rund 10%.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Gesamteinkommen pro VE 2 (Fr.)15 36619 48424 49235 77923 692 Privatverbrauch pro VE (Fr.)17 71718 55820 52525 52220 550
1.2 SOZIALES 1 61
■ Charakterisierung der Jungbauern
1.2.2Junge Bewirtschaftende und ihre Sicht der Zukunft
Das BLW hat zusammen mit der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART ein Projekt durchgeführt, um die Sicht der Zukunft der jungen Bewirtschaftenden in Erfahrung zu bringen. Im Januar/Februar 2008 wurden aus diesem Grund 2’000 zufällig ausgewählte junge Bewirtschafter/innen (35 Jahre und jünger) von direktzahlungsberechtigten landwirtschaftlichen Betrieben schriftlich zu ihrer Einschätzung der heutigen und zukünftigen schweizerischen Landwirtschaft und zu ihrer Lebenssituation und Befindlichkeit befragt. Über die Hälfte der Angeschriebenen hat geantwortet. Für die schriftliche Umfrage war das Meinungsforschungsinstitut ISOPUBLIC hinzugezogen worden. Im Frühjahr 2008 wurden zusätzlich Gruppengespräche durchgeführt. Diese ermöglichten einen vertieften Einblick in die Sicht der jungen Bewirtschafter/innen.
Die Themenbereiche Stärken und Schwächen der Schweizer Landwirtschaft, ideale Landwirtschaft, zukünftige Landwirtschaft, Zukunftsfähigkeit sowie Befindlichkeit wurden sowohl bei der schriftlichen Befragung als auch bei den anschliessenden Gruppengesprächen untersucht. Nach einer Charakterisierung der befragten jungen Bewirtschafter/innen und ihrer Betriebe wird auf diese Themen näher eingegangen.
Nachfolgend werden die 1'023 jungen Bewirtschafter/innen, die an der schriftlichen Befragung teilgenommen haben, und ihre Betriebe beschrieben.
Antwortende Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen
Anteil an der Anteil an der AuswertungGrundgesamtheit (gewichtet)
Betriebsgrösseklein<1 SAK 1 2825
mittel1–2,5 SAK 1 5759 gross>2,5 SAK 1 1616
BetriebstypPflanzenbau1210 Tierhaltung5555 kombiniert3435
1SAK = Standardarbeitskraft
Quelle: Isopublic, BLW
1.2 SOZIALES 1 62 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
%%
weiblich135
italienisch
Geschlechtmännlich8795
Sprachedeutsch7179 französisch2419
52 RegionTal4042 Hügel2930 Berg3228
Lebenssituation

Drei Viertel der Befragten sind verheiratet oder leben in einer festen Partnerschaft, wobei fast die Hälfte der Partner/innen bäuerlicher Abstammung ist. Drei Viertel der Partner/innen arbeiten (auch) im landwirtschaftlichen Betrieb, ebenfalls drei Viertel der (Schwieger-)Eltern, wobei nicht befragt wurde wie oft bzw. wie lange. Bei lediglich 9% sind keine Mitglieder aus dem engsten Familienkreis auf dem Hof tätig. Gut 60% der Jungen gehen einem Nebenerwerb nach, in 44% der Fälle ist zudem die Partner/in (auch) ausserbetrieblich tätig. In je 30% der Fälle macht das ausserlandwirtschaftliche Einkommen (des Betriebsleitenden oder der/des Partners/in) über die Hälfte des Gesamteinkommens aus. In gut 50% der Haushalte leben Kinder, in 17% sind es 3 und mehr Kinder.
Ausbildung
61% der befragten Betriebsleiter/innen haben einen landwirtschaftlichen Berufsabschluss (Erst- und eventuell Zweitausbildung), 19% verfügen sowohl über einen landwirtschaftlichen als auch einen nichtlandwirtschaftlichen Berufsabschluss und 20% können keine landwirtschaftliche Ausbildung vorweisen. 3% haben keinen Berufsabschluss (weder landwirtschaftlich noch nichtlandwirtschaftlich). Von den Partner/innen haben 11% eine Erstausbildung im landwirtschaftlichen Bereich absolviert, 5% haben eine landwirtschaftliche resp. bäuerlich-hauswirtschaftliche Zweitausbildung.
Betriebsverhältnisse
Drei Fünftel der landwirtschaftlichen Betriebe der jungen Bewirtschafter/innen haben eine mittlere Grösse (das heisst 1–2,5 SAK) und etwas mehr als die Hälfte hat sich auf Tierhaltung spezialisiert. 8% der Betriebe werden von Personen mit einer nicht-bäuerlichen Herkunft geleitet. Sie bewirtschaften häufiger kleinere Betriebe in der Bergregion, wobei sie selten Tierhaltung und Pflanzenbau kombiniert betreiben. Ebenso sind von Frauen geführte Betriebe häufiger klein (58% der Frauen führen einen Kleinbetrieb, bei Männern sind es 23%) und die Betriebe liegen häufiger in der Bergregion (46% im Vergleich zu 27% bei den Männern). 10% der Befragten führen einen BioBetrieb. Diese Betriebe befinden sich seltener in der Romandie und sind seltener in der Talregion angesiedelt. Es handelt sich dabei zu drei Viertel um reine Tierhaltungsbetriebe und die Bewirtschafter/innen stammen markant häufiger aus einer nichtbäuerlichen Familie.
Betriebsübernahme
Ein Fünftel der Befragten hat den Hof vor mehr als acht Jahren übernommen, ein Viertel vor sechs bis acht Jahren und gut die Hälfte ist seit fünf oder weniger Jahren Betriebsleiter/in. Dabei bewirtschaften 17% den Hof als Pächter/in, 79% als Eigentümer/in und 3% als Generationengemeinschaft.
1.2 SOZIALES 1 63 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Veränderungen im Rahmen der Betriebsübernahme1 (n=810) Wurden im Hinblick auf ihre Betriebsübernahme oder seit der Übernahme Veränderungen auf dem Betrieb vorgenommen oder stehen zur Zeit solche bevor?
Bauliche Veränderungen am Ökonomiegebäude
Ausbau/Intensivierung eines Betriebszweigs
Bauliche Veränderungen am Wohnhaus
Verbesserung der Mechanisierung
Aufnahme eines neuen Betriebszweigs
Aufgabe eines Betriebszweigs
Spezialisierung auf einen oder wenige Betriebszweige Umstellung von Haupt- auf Nebenerwerb
Anderes
Neue Zusammenarbeit: Betriebs(zweig)gemeinschaft Umstellung auf Bio oder andere Label
Neue Zusammenarbeit: Maschinenring
Betriebsübernahmen sind ein Anlass für Veränderungen: Rund 80% der Befragten geben an, bei der Betriebsübernahme oder danach Änderungen am Betrieb vorgenommen zu haben. In gut der Hälfte der Fälle waren es bauliche Veränderungen (Wohnhaus und/oder Ökonomiegebäude). Zudem wurde in zwei Fünftel der Fälle ein Betriebszweig ausgebaut respektive intensiviert; gleich häufig wurde auch in eine verbesserte Mechanisierung investiert. Weiter wurde in drei von zehn Fällen ein neuer Betriebszweig eröffnet. Veränderungen bei der Betriebsübernahme sind häufiger in der Deutschschweiz und bei grösseren Betrieben. Die Veränderungen wurden einerseits vorgenommen, um sich den Markterfordernissen anzupassen. Als Gründe werden genannt: Arbeitsersparnis oder Arbeitserleichterung (53%), Betrieb auf absehbare Entwicklungen vorbereiten (46%), Einkommensverbesserung (38%). Anderseits werden die Veränderungen aber auch mit persönlichen Vorlieben begründet. 51% geben an, mit den Veränderungen hätten sie den Betrieb ihren persönlichen Neigungen und Fähigkeiten angepasst. In 21% der Fälle wird die Veränderung damit erklärt, dass die Anpassung notwendig war, um direktzahlungsberechtigt zu bleiben.
1.2 SOZIALES 1 64
Aufgabe der biologischen Produktionsweise Quelle: Isopublic 1 Mehrfachnennungen möglich 0 01020 51 42 40 40 31 24 16 13 10 9 8 6 1 30 in % 50 4060
■ Gruppengespräche
Zur Vertiefung und Konkretisierung der Resultate der schriftlichen Umfrage fanden 11 Gruppengespräche in unterschiedlichen geografischen und sprachlichen Regionen der Schweiz statt: Sechs Gespräche erfolgten mit zufällig ausgewählten jungen Bewirtschaftern, drei Gespräche wurden in Landwirtschaftsschulen mit Betriebsleiterschüler/innen durchgeführt sowie zwei mit Kursteilnehmerinnen von Bäuerinnenschulen.
Gruppengespräche
OrtRegionSpracheDatumTeilnehmende Morges VDTalf11.03.0810 m
Lyss BETald27.03.087 m
Landquart GRBergd02.04.0816 m, 1 w Gränichen AGTald08.04.087 m
Seuzach ZHTald10.04.086 m
Stans NWBergd15.04.087 m
Bellinzona TITali17.04.088 m
Le Peu-Péquignot JUBergf22.04.088 m
Zweisimmen BEBergd24.04.087 m
Langenthal BETald08.05.083 w
Riedholz SOTald13.05.0810 w m = männlich, w = weiblich
■ Stärken und Schwächen der heutigen Landwirtschaft
Als Stärken der heutigen Landwirtschaft werden von den jungen Bewirtschafter/innen in der schriftlichen Umfrage an erster Stelle Qualitäts- und Umweltaspekte genannt. Angeführt wird die Rangliste von den Bereichen Produktequalität und Tierwohl. Je rund 90% der Befragten empfinden diese beiden Bereiche als Trumpfkarten der Schweizer Landwirtschaft. Es folgen Aspekte zu Ökologie und Umwelt (Pflege der Kulturlandschaft, hohe Umweltstandards und GVO-freie Produktion – sie werden von 67 bis 81% der Befragten als Stärke bezeichnet). Positiv – also mehrheitlich als Stärke – wird auch die landwirtschaftliche Ausbildung einerseits, die Führung der Betriebe im bäuerlichen Familienverband anderseits bewertet. 70 resp. 63% der Befragten bezeichnen diese beiden Aspekte als Stärken.
Als Schwächen der heutigen Landwirtschaft gelten demgegenüber finanzielle Aspekte (Kosten der Produktionsmittel, Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland, die Höhe der Produzentenpreise und die Einkommenssituation) sowie administrative Aspekte (Aufwand für die Administration, gesetzliche Rahmenbedingungen). Diese beiden Seiten werden von mehr als der Hälfte der Befragten (von 55 bis 82%) als Schwäche wahrgenommen.
1.2 SOZIALES 1 65 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Stärken und Schwächen (n=1023)
Welches sind in den folgenden Bereichen die Stärken und die Schwächen der heutigen schweizerischen Landwirtschaft?
Hohe Produktqualität Tierwohl
Pflege Kulturlandschaft
Hohe Umweltstandards
GVO-frei
Landwirtschaftliche Ausbildung

Bäuerliche Familienbetriebe Gesetzliche Rahmenbedingungen
Einkommenssituation
Hohe Produzentenpreise
Konkurrenzfähigkeit
Gewisse Differenzen in der Beurteilung der Stärken und Schwächen ergeben sich durch die Art und Weise der Lebensführung der Befragten: Was auf dem eigenen Hof praktiziert wird, wird etwas häufiger auch als Stärke der Schweizer Landwirtschaft bezeichnet. So wird z.B. das Tierwohl von Befragten, die Tierhaltung betreiben, häufiger als Stärke genannt. Die Bedeutung der bäuerlichen Familienbetriebe wird zudem von Personen bäuerlicher Herkunft, von Personen mit mitarbeitender Partnerin/mitarbeitendem Partner und von Personen mit mitarbeitenden (Schwieger-)Eltern ebenfalls überproportional oft als Stärke wahrgenommen.
Weitere Differenzen lassen sich erklären durch die Ausrichtung, Lage und Grösse der Betriebe. So wird die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland zwar von allen Befragten mehrheitlich (63%) als Schwäche der Schweizer Landwirtschaft bezeichnet. Dieser Anteil ist bei Jungbauern und Jungbäuerinnen, die nur Tierhaltung betreiben, mit 56% und bei kleineren Betrieben mit 59% etwas geringer. Kleinere Betriebe werten zudem die Kosten für Produktionsmittel weniger stark negativ als der Durchschnitt. Bewirtschafter im Berggebiet bezeichnen die hohen Umweltstandards und die GVO-freie Landwirtschaft zwar ebenfalls als Stärke (68 resp. 62%), aber nicht in einem gleich hohen Ausmass wie der Durchschnitt der Befragten (76 resp. 67%). Weiter erachten Betriebsleiter/innen im Berggebiet administrative Vorgaben und gesetzliche Rahmenbedingungen weniger häufig als Schwäche. Beim Administrativen sind Frauen weniger negativ eingestellt, bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen sind es Personen, welche ihren Betrieb nach biologischen Vorgaben führen.
1.2 SOZIALES 1 66
gg. Ausland Aufwand Administration Kosten Produktionsmittel Quelle: Isopublic 0 02040 in % 80 60100 Schwäche Stärke weder/noch keine Angabe
«Schweizer Qualität ist halt ein bisschen besser.»
Vertieft wird das Thema «Stärken und Schwächen der Schweizer Landwirtschaft» in Gruppengesprächen. Was verstehen die jungen Bewirtschafter/innen konkret unter den von ihnen genannten Stärken und Schwächen? Qualität, nicht Quantität, ist eine Stärke der Schweizer Landwirtschaft. Das kommt klar zum Ausdruck. Doch diese Produktequalität ist vielschichtig und geht über das eigentliche Produkt hinaus. Wichtig scheint in diesem Zusammenhang das Gesamtbild eines landwirtschaftlichen Produkts in seinem Kontext, also Produktionsweise, Herkunft etc. Hohe gesetzliche Auflagen und Vorschriften in der Tierhaltung und in der Nahrungsmittelverarbeitung unterstützen diese Qualität, auch wenn diese von einigen jungen Bewirtschafter/innen manchmal als einschränkend empfunden werden. Für Konsument/innen wird die Qualität durch die entsprechenden Labels «messbar», denn nicht immer ist die Qualität auf den ersten Blick erkennbar. Eine gute Produktequalität ist für die jungen Bewirtschafter/innen heute selbstverständlich; dem muss die Schweizer Landwirtschaft weiterhin Sorge tragen. Auf den relativ kleinen Landwirtschaftsbetrieben in der Schweiz ist eine qualitativ hochstehende Produktion nach Ansicht der Gesprächsteilnehmer wohl leichter zu bewerkstelligen als auf Grossbetrieben, in denen die Übersicht schneller verloren gehen kann. Hier hat die bäuerliche gegenüber der industriellen Agrarproduktion klar einen Vorteil. «Tierfabriken» passen nicht in dieses Bild von «Produktequalität», weil das Tierwohl ebenfalls zum Qualitätsmanagement gehört. «...sagen wir mal 15 bis 20 Kühe oder aber ein Betrieb im Ausland mit 100 Kühen, dort ist das Management natürlich viel, viel heikler als hier mit 20 Kühen, da kenne ich jede meiner Kühe in- und auswendig und wenn sie das eine Ohr hängen lässt, dann sieht man das, das sehen natürlich die anderen nicht und dann haben sie viel schneller einfach mal schlechte Milch drin.»
Die jungen Bewirtschafter sehen als weitere Stärke, dass sie als Landwirte auch tagsüber als Väter präsent sein können, was für die meisten anderen berufstätigen Väter nicht möglich ist. Bei der «Pflege der Kulturlandschaft» steht für sie insbesondere eine schön gepflegte, saubere Kulturlandschaft («wie ein Gärtlein») im Vordergrund. In den Bergen ist Kulturpflege dann eben eine gemähte Alpwiese oder eine von Blacken gesäuberte Weide, damit die Touristen auch weiterhin eine schöne Berglandschaft geniessen können.
1.2 SOZIALES 1 67 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Idealbild der Landwirtschaft
«Jeder Bauer backt seine eigenen Brötchen.»
In den Gruppendiskussionen sind auch selbstkritische Punkte erörtert worden. Die Schwäche der Landwirtschaft kann u.a. an den Bauern selber liegen. Die Mentalität der Bewirtschafter/innen ist von grosser Bedeutung: Demotivierte Betriebleiter/innen und «verknorzte» Bauern schwächen die Landwirtschaft enorm. Die Ausbildung hat dabei relativ wenig damit zu tun. Früher hiess es «Der dümmste Bauer hat die grössten Kartoffeln.» Heute sind junge Bewirtschafter/innen von allen Seiten so stark gefordert, dass eigentlich nur noch die «Schlausten» Bauern werden sollten. Schlecht qualifizierte Bewirtschafter/innen vermögen den heutigen hohen Ansprüchen in der Landwirtschaft kaum mehr zu genügen. Die kleinräumige, kleinstrukturierte Schweizer Landwirtschaft wird nie so rentabel produzieren können wie jene ihrer grossen Nachbarländer Deutschland und Frankreich, das ist ihnen bewusst. Die heutigen Nahrungsmittelpreise werden als tief und damit als eine weitere, grosse Schwäche in der Landwirtschaft angesehen. Unser Schweizer Alpkäse oder andere Spezialitäten werden teilweise unter ihrem Wert verkauft, finden sie. Kunden sind immer mehr bereit für die Qualität der Produkte auch mehr zu bezahlen, auch im Ausland. Diese neue Generation von Bewirtschafter/innen ist sich aber bewusst, dass «mehr produzieren nicht auch mehr Einkommen» bedeutet.
Als Schwäche wird zudem die mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Solidarität erwähnt. Auch in der Landwirtschaft gibt es Neid, Missgunst und Konkurrenzdruck. Eine mangelnde oder fehlende Kommunikation zwischen Berg- und Talbauern, zwischen Milch-, Acker- und Gemüsebauern, zwischen Haupt- und Nebenerwerbslandwirten wird als weitere Schwäche erkannt. Zudem ist Bauen in der Landwirtschaft teuer und risikoreich: «Gebaut wird für zwei Generationen, aber Gesetze gelten nur zwanzig Jahre.»
Die von den befragten jungen Bewirtschafter/innen als wichtig postulierten Aspekte einer idealen Landwirtschaft entsprechen nur teilweise den Stärken der schweizerischen Landwirtschaft. Genannt werden bei der Vorstellung einer idealen Landwirtschaft auf den ersten fünf Positionen ein angemessenes Einkommen, ein gutes Image bei der Bevölkerung, die Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel, das Bewahren bäuerlicher Familienbetriebe und eine ausreichende Selbstversorgung. Jener Bereich, der im Idealbild der wichtigste Punkt ist (angemessenes Einkommen), wird in der Bewertung der heutigen Landwirtschaft jedoch als Schwäche (finanzielle Aspekte) wahrgenommen. Qualitätsaspekte rangieren sowohl im Stärken-/Schwächenprofil als auch im Idealbild weit vorne. Hingegen werden die als Stärke bewerteten Ökologieund Umweltaspekte im Idealbild in den hinteren Rängen geführt. Die Stärke der schweizerischen Landwirtschaft im Bereich der umweltverträglichen Produktion entspricht also nicht den Idealvorstellungen der jungen Bewirtschafter/innen.
1.2 SOZIALES 1 68
Idealbild1 (n=1023)
Was wäre Ihre Vorstellung von einer idealen schweizerischen Landwirtschaft?
Angemessenes Einkommen
Gutes Image bei Bevölkerung
Qualitativ hochwertige Nahrungsmittel
Bewahren bäuerlicher Familienbetriebe Ausreichende Selbstversorgung
Dezentrale Besiedlung
Besonders tierfreundlich
Traditionelle Landschafts-/Ortsbilder
Rationelle konkurrenzfähige Produktion
Vielseitige Produktion
Hohe Umweltstandards
Ursprüngliche Nutz-Pflanzen/Tierarten
Ökologische Ausgleichsflächen
Öffentliche Erholungsräume
Stark auf ausländischen Märkten Anderes
Das Idealbild differiert allerdings je nach Betriebsform. So rangieren bei den Bewirtschafter/innen, die nach biologischen Regeln wirtschaften, die Aspekte Umweltstandards, Erhalt ursprünglicher Sorten und Arten, besonders tierfreundliche Produktionsformen und Flächen zum Erhalt bzw. zur Förderung der Artenvielfalt höher als der Durchschnitt, während insbesondere der rationellen und konkurrenzfähigen Produktion ein weniger starkes Gewicht beigemessen wird. Dafür wird dem Aspekt der konkurrenzfähigen Produktion von Bewirtschafter/innen von grossen Betrieben eine vergleichsweise grössere Bedeutung zugemessen, ebenso der Produktion von qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln. Für weniger wichtig halten sie die Bereitstellung öffentlicher Erholungsräume. Im Berggebiet werden die Bewahrung bäuerlicher Familienbetriebe, die dezentrale Besiedelung, der Erhalt traditioneller Landschafts- und Ortsbilder sowie die Pflege ursprünglicher Sorten und Arten im Vergleich höher bewertet, während eine rationelle Produktion als weniger wichtig eingeschätzt wird.
1.2 SOZIALES 1 69 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Quelle: Isopublic 1 Mehrfachnennungen möglich 0 02040 in % 80 60100
«Eine produzierende Landwirtschaft!»
In den Gruppengesprächen wird auch der Frage der idealen Landwirtschaft nachgegangen. Für die jungen Bewirtschafter/innen ist eine produzierende Landwirtschaft sehr wichtig. Produzieren von Nahrungsmitteln macht Sinn. Der Auftrag der Bundesverfassung, einen Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft z.B. in Form von Buntbrachen zu leisten, ist für sie eher Pflicht denn Kür. Ein Gesprächsteilnehmer erklärt, weshalb Ökologie und Umweltschutz bei den Bauern teils Unmut auslöst: «Es ist teilweise sicher für die Bauern stossend, wenn sie schauen, was sie dann schlussendlich bekommen und was gewisse Projektverantwortliche kassieren, wenn es irgend um ein Naturschutzgebiet oder so etwas geht, dann kommt irgend ein Biologe Schmetterlinge und Pflanzenarten zählen und solche Sachen ... und dann wird geknausert, wenn es darum geht, dem Bauer überhaupt noch etwas zu geben, wenn der die Wiese jahrelang gepflegt hat, dass sie jetzt in diesem Zustand ist.»
Kulturpflege widerspricht z.T. ihrem Bild einer «produktiven Landwirtschaft», wie sie die jungen Bewirtschafter/innen gerne hätten. Ihr Selbstverständnis als Bauer wird vorwiegend über die Produktion von wertvollen Nahrungsmitteln definiert. Die Produktion von Bio-Treibstoffen entspricht nicht unbedingt ihrem Idealbild. Und im Hinblick auf die Ernährung der Weltbevölkerung ist für einige Gesprächsteilnehmer auch eine intensive Tierproduktion fraglich. Idealerweise sollte ein Landwirtschaftsbetrieb sich selber tragen und nicht auf ein ausserlandwirtschaftliches Einkommen der/des Partners/in angewiesen sein.
Eine Landwirtschaft ohne Subventionen à la Neuseeland ist und bleibt für viele ein Traum: Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen für die Landwirtschaft und die gesamte Wirtschaftsstruktur der beiden Länder. Der Verstand sagt ihnen, dass es in der Landwirtschaft nicht ohne Direktzahlungen geht: «Si on enlève les paiements directs sur certaines exploitations, on peut mettre la clé sur la porte.» Vom Bauch her fühlen sie sich in der Freiheit sehr beschnitten. Und vom Selbstverständnis als «produzierender» Unternehmer möchten sie lieber auf staatliche Unterstützung verzichten und über den Markt mit fairen Preisen abgegolten werden: «I prodotti non vengono valorizzati.» Wenn schon Direktzahlungen, dann mache es Sinn, wenn diese an Betriebe mit Zukunft fliessen und weniger an auslaufende Betriebe verteilt werden.
Sinn macht auch, wenn «Job, Verdienst und Lebensqualität in Einklang» stehen. Neben der Arbeit sollte auch Raum und Zeit für die Familie und Hobbies bleiben. Und die Produktion sollte standortgerecht sein: «Mehr die Natur einbeziehen und das produzieren, was dort eigentlich geeignet ist.» Nicht immer ist die Grösse eines Betriebs entscheidend in der Landwirtschaft, sind sie überzeugt. Auch kleinere Betriebe, die in ihren eigenen Markt eingebettet sind und sich spezialisieren konnten, machen Sinn.
1.2 SOZIALES 1 70
Landwirtschaft

In der schriftlichen Umfrage kam heraus, dass ein angemessenes Einkommen an erster Stelle beim Idealbild der jungen Bewirtschafter/innen steht. Was heisst das konkret für sie? Sie wünschen sich ein Einkommen, dass eine Familie davon Leben kann und «nicht jeden Fünfer kehren müssen.» Das Einkommen sollte für einen ganz normalen Lebensstandard reichen, so wie er in der Schweiz üblich ist, inkl. Ferien: «Vivre de notre métier normalement.» Das Verhältnis zwischen Arbeitseinsatz und Lohn muss stimmen, auch im Vergleich zu anderen Berufsgattungen. «Ich denke, es ist auch noch wichtig, dass ein anständiges Einkommen auch in einer vernünftigen Arbeitszeit resultieren kann, weil es gibt einen Haufen Bauern, die haben zwar ein anständiges Einkommen, aber die schaffen einfach schier Tag und Nacht.» Nicht einig sind sich die jungen Gesprächsteilnehmer darüber, ob sie ihr Einkommen nun mit jenem eines Angestellten oder eines Selbständigen vergleichen sollen. «Davon leben können und etwas auf die Seite tun.» Es reicht nicht, dass man von der Landwirtschaft überleben kann, sondern das Einkommen sollte so bemessen sein, dass auch Investitionen möglich sind. Zudem ist es auch wichtig, dass Schulden getilgt werden können. Und ein angemessenes Einkommen sollte reichen, ohne dass noch jemand auswärts arbeiten muss.
Die Abhängigkeit von den Steuerzahler/innen stimmt die jungen Bewirtschafter/innen nachdenklich. Die Steuergelder müssen innerhalb des Agrarbudgets gesprochen werden und das braucht wiederum das Verständnis der Bevölkerung, weshalb auch ein gutes Image der Landwirtschaft bei der Bevölkerung so wichtig ist. Ein gutes Image bei den Konsument/innen unterstützt den Absatz von Schweizer Produkten im In- und Ausland. Lebensmittel- oder Tierskandale schaden hingegen dem Image. Dies ist besonders wichtig, weil die Bauern eine Minderheit stellen. Ein gutes Image wird durch Ordnung auf den Betrieben gefördert. Und ein gutes Image trägt auch zum Berufsstolz bei: «Als Bauer möchte man auch ein gewisses Ansehen haben in der Öffentlichkeit.» Die Verantwortung für das Image trägt die Landwirtschaft selber, meint einer: «Das Image der Landwirtschaft, das liegt an uns Bauern und nicht an den anderen.» Andere finden, dass die Medien die Landwirtschaft häufig negativ darstellen.
Die befragten jungen Betriebsleiter/innen gehen davon aus, dass in der schweizerischen Landwirtschaft in zehn Jahren die Bedeutung von Umweltstandards und Qualitätsorientierung, inkl. einer tierfreundlichen Landwirtschaft, zunehmen wird. Wichtiger wird, gemäss Ansicht der Befragten, auch die Rationalisierung und die Präsenz auf ausländischen Märkten, ebenso wird dem Aspekt der Landschaftspflege (Pflege der Kulturlandschaft, ökologische Ausgleichsflächen) mehr Bedeutung zukommen. Aspekte, welche einer Rationalisierung oder Spezialisierung entgegenstehen, würden demgegenüber eher abnehmen. So gehen die Befragten davon aus, dass die vielseitige Produktion, die Pflege ursprünglicher Sorten und Arten und der Selbstversorgungsgrad eher zurückgehen. Eine geringere Bedeutung werden auch traditionelle Orts- und Landschaftsbilder sowie das Führen der Betriebe im bäuerlichen Familienverband haben. Negativ wird zudem die Entwicklung des bäuerlichen Einkommens bewertet: Mehr als die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass die Einkommen zurückgehen werden.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.2 SOZIALES 1 71
«Ich möchte von meinem Beruf leben können.»
■ Zukünftige Schweizer
In zehn Jahren1 (n=1023) Wie wird die schweizerische Landwirtschaft in zehn Jahren aussehen?
Umweltstandards
Rationelle konkurrenzfähige Produktion
Tierfreundliche Produktion
Präsenz auf ausländischen Märkten Öffentliche Erholungsräume
Qualitativ hochwertige Nahrungsmittel Ökologische Ausgleichsflächen Image bei Bevölkerung
Vielseitige Produktion
Ursprüngliche Sorten und Arten Selbstversorgung
Traditionelle Landschafts-/Ortsbilder Landwirtschaftliches Einkommen
Bei der Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Landwirtschaft zeichnen sich über die verschiedenen Betriebsformen und soziodemografischen Merkmale wenig Differenzen ab. Im Berggebiet wird der Rückgang der Selbstversorgung und der vielseitigen Produktion etwas weniger negativ beurteilt. Während die zukünftige Einkommenslage von Frauen negativer beurteilt wird als vom Durchschnitt (70 gegenüber 55%), schätzen junge Bewirtschafter/innen von grossen Betrieben diese Entwicklung vergleichsweise weniger negativ ein (45%). Bewirtschafter/innen auf grossen Betrieben gehen zudem von einer verstärkten Rationalisierung aus; im Vergleich zu kleineren Betrieben prognostizieren sie auch eine höhere Präsenz auf ausländischen Märkten.
«Es wird weiter zu kämpfen geben.»
In den Gruppengesprächen werden ihre Zukunftsvisionen diskutiert sowie weitere Vorstellungen und Erwartungen der jungen Bewirtschafter/innen erörtert. Starre Betriebskonzepte werden zukünftig durch flexiblere abgelöst: «Umstellen, wenn es sein muss, auch wenn es einem nicht entspricht.» Und: «Nicht der Masse nachrennen.» Tendenziell gehen die jungen Bewirtschafter/innen davon aus, dass es in Zukunft weniger, dafür grössere landwirtschaftliche Betriebe geben wird. «Weniger Bauern und grösser.» Die Frage ist, «ob man wachsen kann oder nicht.» In der Landwirtschaft werden Konzepte wie Spezialisierung («man macht nicht mehr alles») und Intensivierung («etwas intensiver fahren») einerseits und völlige Extensivierung anderseits prognostiziert. «Entweder Vollgas oder Low-Input.» Doch Tierwohl und rationelle Produktion, da besteht in ihren Augen ein Widerspruch. Es braucht zudem mehr und mehr innovative Ideen in der Landwirtschaft. Wenn Betriebe ständig grösser werden, dann gelangen die einzelnen Bewirtschafter/innen alleine schnell einmal an ihre Kapazitätsgrenzen bei der Bewirtschaftung. Eine häufigere Zusammenarbeit ist deshalb
1.2 SOZIALES 1 72
Dezentrale Besiedlung Bäuerliche Familienbetriebe Quelle: Isopublic 1 Mehrfachnennungen möglich 0 02040 in % 80 60100 nehmen zu nehmen ab bleiben gleich keine Angabe
vermehrt ins Auge zu fassen. Worauf sollen sie sich aber in unserer schnelllebigen Zeit einstellen?, fragen sie sich besorgt. «L’incertitude, on ne sait pas ce qui va arriver.»
Für die Zukunft entscheidend finden die jungen Bewirtschafter/innen jedoch die Vermarktung der Produkte. Dass die Tierschutzvorschriften zukünftig noch strenger werden könnten, ist für einige der Teilnehmer der Gruppendiskussionen angesichts des heute schon hohen Tierschutzniveaus nur schwer vorstellbar («...bald als Haustier halten, die Tiere, die wir auf dem Bauernhof haben,» oder: «Dann kannst du die Kühe in der Stube drin haben, langsam.»). Andere jedoch sehen gerade im Tierwohl für die Schweizer Landwirtschaft eine Chance, weil eine Massenproduktion in der Schweiz ohnehin keine Zukunft hat. Aufgrund des weiter steigenden Siedlungsdrucks – «im Mittelland wird die Bodenversiegelung sicher zunehmen und viele Betriebe werden verschwinden» – wird der Wunsch der Gesellschaft nach Naturschutzflächen bzw. Ökoflächen grösser und zukünftig wirtschaftlich wohl interessanter. Doch Flächen, die sich eigentlich bestens zur Produktion eignen, als ökologische Ausgleichsflächen zu nutzen, widerspricht klar dem Selbstverständnis der Bauern als Nahrungsmittelproduzent/innen.
Das allfällige EU-Agrarfreihandelsabkommen sowie die WTO rufen teilweise starke Existenzängste hervor und die Stimmung geht angesichts dieser Herausforderungen von optimistisch bis stark pessimistisch. Die Landwirtschaft in der Schweiz wird auch zukünftig von Wirtschaft und Politik geleitet. Einzelne fühlen sich als deren Spielball: «On est basculé d’un côté de l’autre.» Die Bewirtschafter/innen werden auch in Zukunft auf Direktzahlungen angewiesen sein, sind viele überzeugt. Wichtig scheint auch, dass der Landwirtschaft in Zukunft weiterhin günstige Investitionskredite zur Verfügung stehen. Es wird eine Standardisierung der Landwirtschaft, des Geschmacks und der Qualität vorhergesagt. «Tutto standard, gusto standard, qualità standard!» Unsicherheit herrscht darüber, ob eine nachhaltige Landwirtschaft überhaupt realistisch ist, wenn am anderen Ende der Welt Kühe geklont und gentechnisch veränderter Mais angebaut wird, oder ob die Schweiz für die anderen Länder weiterhin einen Vorbildcharakter haben soll. Verschiedene Zukunftsszenarien sind möglich. Leichter als bisher wird es in Zukunft in der Landwirtschaft nicht: «Die goldenen Jahre sind vorbei!»
1.2 SOZIALES 1 73 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Diskrepanz zwischen Prognose und Idealbild
Vergleicht man nun dieses Bild einer Landwirtschaft in zehn Jahren mit der von den jungen Bewirtschafter/innen skizzierten idealen schweizerischen Landwirtschaft, so zeigen sich markante Diskrepanzen. So wird im Idealbild dem angemessenen Einkommen am meisten Bedeutung gegeben, in der Zukunftsprognose wird demgegenüber von einer Verminderung der bäuerlichen Einkünfte ausgegangen. Zudem messen die Jungbauern und Jungbäuerinnen den Umweltaspekten nicht das Gewicht bei, das ihnen gemäss Prognose in der zukünftigen Landwirtschaft zukommen wird. Die Befragten sagen gemäss ihrer Einschätzung zwar voraus, dass eine rationelle Produktion und die Präsenz auf ausländischen Märkten an Bedeutung zulegen werden. Diese rationelle Produktion ist aber nicht unbedingt erwünscht, und ihre Folgen wie eine weniger vielseitige Produktion, eine geringere Selbstversorgung, die weniger dezentrale Besiedlung oder der Rückgang bäuerlicher Familienbetriebe widersprechen dem Bild der von den Jungbauern und Jungbäuerinnen entworfenen idealen Landwirtschaft.
Rang 1
PrognoseIdealbild
Umweltstandards155
Rationelle konkurrenzfähige Produktion147
Tierfreundliche Produktion139
Präsenz auf ausländischen Märkten121
Öffentliche Erholungsräume112
Qualitativ hochwertige Nahrungsmittel1013
Ökologische Ausgleichsflächen93
Image bei Bevölkerung814
Vielseitige Produktion76
Ursprüngliche Sorten und Arten64 Selbstversorgung511
Traditionelle Landschafts-/Ortsbilder48
Landwirtschaftliches Einkommen315
Dezentrale Besiedlung210
Bäuerliche Familienbetriebe112
1Angaben in Rangpunkten, absteigend nach Wichtigkeit. Je geringer die Anzahl Rangpunkte, desto geringer auch das Gewicht des entsprechenden Aspekts bei der prognostizierten resp. idealen Landwirtschaft.
In den Gruppendiskussionen geht es auch darum, mehr darüber zu erfahren, was die jungen Bewirtschafter/innen dazu motiviert hat, in einen Beruf einzusteigen, in dem Ideal und Realität so weit auseinanderliegen. Laut Aussagen der Gesprächsteilnehmer ist Landwirt/in einer der interessantesten Berufe, die es gibt, mit einer Vielseitigkeit und Freiheit, die man in anderen Berufen nicht kennt. Die Freude am Beruf ist wohl das stärkste Motiv, trotz Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, dran zu bleiben: «Es ist nur die Freude, die Motivation macht.» Dazu kommen weitere Argumente für die Landwirtschaft: «Selber Chef sein», «vielseitige Arbeit», «Zusammenarbeiten mit Tieren und der Natur» etc. Sie sind «Bauer mit Leib und Seele.» Ein guter Preis für ein Produkt
1.2 SOZIALES 1 74
Diskrepanz Prognose – Idealbild
«Landwirtschaft ist Lebensqualität.»
■ Zukünftige Rahmenbedingungen
ist sicher motivierend, aber auch die Entwicklung des Betriebs steigert die Motivation: «Den Betrieb vorwärts bringen.» Und wenn die eigenen Kinder auch noch Interesse an der Landwirtschaft zeigen, dann motiviert das zum Weitermachen. Die Landwirtschaft kann der Familie etwas bieten: Ein eigenes Haus, eine schöne Aussicht, Tiere. Das alles ist Lebensqualität. Zudem ist die Zusammenarbeit mit der Familie eine grosse Befriedigung und steigert das persönliche Wohlbefinden. Auch gelebte Traditionen geben Ansporn. In der Landwirtschaft wird von vielen Freizeit als etwas Anderes empfunden als in der übrigen Bevölkerung, weil Dinge, die quasi zum Beruf gehören, andere eben in ihrer Freizeit machen, z.B. zum Zäunen im Frühling mit der Familie in die Berge gehen. Die Natur und der Umgang mit Tieren hat einen grossen Stellenwert in der Landwirtschaft. Wenn jemand alles selber machen kann, was auf einem Betrieb anfällt, wie beispielsweise Maschinen warten, dann ist diese Eigenständigkeit und Unabhängigkeit ebenfalls sehr befriedigend.

Ein aus Bauernsicht eher negatives Bild skizzieren die befragten, jungen Bewirtschafter/innen zu den zukünftigen Rahmenbedingungen. Was die Landwirtschaft eher aufwändiger macht (Anforderungen, Vorschriften und Kosten), nimmt aus der Perspektive der jungen Betriebsleiter/innen zu, während Aspekte, welche ein bäuerliches Leben unterstützen und ermöglichen (Produzentenpreise, öffentliche Gelder, gesetzliche Rahmenbedingungen zum Schutz der Landwirtschaft) nach ihrer Einschätzung abnehmen.
Veränderte Rahmenbedingungen1 (n=1023) Wie werden sich die Rahmenbedingungen im Vergleich zu heute in den nächsten zehn Jahren verändern?
Anforderungen an Direktzahlungen Kosten
Umwelt-/Tierschutzvorschriften
Generelle Vorschriften
Vorgaben durch Raumplanung
Regionale Massnahmen
Produzentenpreise Schutz durch Bodenrecht Höhe des Agrarbudgets
Grenzschutzmassnahmen
1.2 SOZIALES 1 75 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Isopublic 1 Mehrfachnennungen möglich 0 02040 in % 80 60100
zu nehmen ab bleiben gleich keine Angabe
Quelle:
nehmen
In den Gruppengesprächen wird darauf hingewiesen, dass neben den wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen auch das persönliche und betriebliche Umfeld von grosser Bedeutung ist: «In einem guten Umfeld zu schaffen ist enorm wertvoll.» Damit ist vor allem die Zusammenarbeit angesprochen, mit der Partnerin, mit der Familie, in der Betriebs(zweig)gemeinschaft.
Direktzahlungen für die Landwirtschaft sind und bleiben nötig, sind sich die meisten Gesprächsteilnehmer einig, auch wenn diese vielleicht die Innovationskraft hemmen oder einzelne sich als «quasi Bundesangestellte» nicht wohl fühlen. Sie finden wichtig, dass die Kontrollen überall gleich ablaufen, da scheint es noch einen Nachholbedarf zu geben. Direktzahlungen sollen nur diejenigen erhalten, die ihre Arbeit auch korrekt machen und ihren Pflichten nachkommen. «Ob er es gut macht oder schlecht, ob er sich einsetzt für das Zeug oder nicht, er bekommt das,» ärgert sich der eine oder andere. Eine Differenzierung zwischen Tal- und Bergbetrieben ist in Ordnung, aber die Direktzahlungen für Nebenerwerbsbetriebe sind bei Haupt- und Vollerwerbsbewirtschafter/innen nicht unbestritten. Aus ökologischer Sicht sind tierbezogene Beiträge zwar problematischer als Flächenbeiträge, weil diese eher zur Intensivierung in der Tierhaltung führen, von den Bewirtschaftenden sind sie aber geschätzter: «Flächen kannst du nicht einfach so regenerieren, die kannst du nicht herzüchten und dann hast du nächstes Jahr zehn Hektaren mehr. Tiere kannst du schon...»
Interessengeleitete Umzonungen von Landwirtschafts- in Industrie- oder Bauland sind für die Jungbauern problematisch: «Landwirtschaftsland muss Landwirtschaftsland bleiben.» Hier haben jedoch die Gemeinden unterschiedliche Vorstellungen und Strategien. Aber auch Landwirte verkaufen Bauland, um Landwirtschaftsland zu kaufen und den Betrieb zu vergrössern. Der Druck auf den Boden ist gross, insbesondere in günstigen Lagen.
Die Landwirtschaft ist ein Gebiet, wo der freie Markt nicht funktioniert, sind die meisten der Meinung. Da brauche es gewisse Regeln, und zwar am besten weltweit. Die Schweiz ist als kleines, rohstoffarmes Land auf den Export von Gütern angewiesen, darum verstehen die Bewirtschafter/innen, dass die Exportbedingungen relevant sind. Kein Verständnis haben die meisten jungen Bewirtschafter/innen aber, wenn bei den WTO-Verhandlungen für relativ wenig Zugeständnisse die Landwirtschaft geopfert werden soll. Was Mühe bereitet, ist die Aussicht, dass die Preise sinken, aber der «hohe Schweizer Standard» beibehalten wird. Nach Meinung der jungen Bewirtschafter/innen geht das nicht auf. Skepsis gibt es auch gegenüber dem EU-Agrarfreihandel. Gewisse Spezialitäten werden eine Chance haben im Ausland, aber profitieren werden andere von einem derartigen Freihandelsabkommen, meinen die meisten.
1.2 SOZIALES 1
76
Übersicht EU-Agrarfreihandel
ChancenRisiken
–Nischenprodukte und Spezialitäten
–Direktvermarkter, die nicht von Grossverteiler abhängig sind
–Vertrauen der Konsument/innen in hohe Produktequalität (u.a. Bio)
–Milch und Milchprodukte
–Allgemeine Nahrungsmittelknappheit
–Marke Schweiz hat Potenzial
–Exportchancen im Hochpreissegment
–Grenzöffnung kommt sowieso, also lieber agieren statt reagieren
–Randregionen (Bergregion) im Vorteil gegenüber Mittelland
–Tiefere Produzentenpreise und somit tieferes Einkommen bei kaum sinkendem Kostenumfeld
–Sinkender Selbstversorgungsgrad bei höherer Exporttätigkeit
–Bauernopfer: Auf Kosten der Bauern die Grenzen öffnen, damit die übrige Wirtschaft davon profitiert
–Verteilkampf um öffentliche Gelder wegen den sehr unterschiedlichen Betriebsstrukturen
–Zu teure Produkte um konkurrenzfähig sein zu können
–Gleich lange Spiesse sind nicht sicher (z.B. Deklaration)
–Umweltverschmutzung wegen langen Transportwegen
–«Anschubfinanzierung» reicht nicht, um dann dem freien Markt ausgeliefert zu werden
–Folgen und Auswirkungen unklar
Die wichtigsten Kriterien zur Zukunftsfähigkeit eines Betriebs sind für die befragten jungen Bewirtschafter/innen eine solide finanzielle Basis und Freude am Beruf. Ebenfalls wichtig sind für sie Flexibilität und Innovationsfähigkeit der Bewirtschafter/innen, eine zumutbare Arbeitsbelastung und ein günstiges familiäres Umfeld. Im Durchschnitt weniger häufig genannt werden Aspekte, die eher einer betriebswirtschaftlichen Optimierung entsprechen: Ein grosser Betrieb, Spezialisierung, ein ausserbetriebliches Standbein (Nebenerwerb), Rationalisierung bzw. Mechanisierung und Diversifizierung. Ein Teil dieser Aspekte wird von den Befragten in der Talregion allerdings als vergleichsweise wichtiger erachtet, so die Grösse des Betriebs, die Spezialisierung und Rationalisierung bzw. Mechanisierung. Umgekehrt halten die Bewirtschafter/innen von Betrieben in der Bergregion das gute familiäre Umfeld für die Zukunftsfähigkeit für markant wichtiger als Befragte der Talregion.
Insbesondere die beiden Faktoren solide finanzielle Basis und zumutbare Arbeitsbelastung scheint für die jungen Bewirtschaftenden aber eine schwierig zu erfüllende Voraussetzung zu sein. Denn bei einer offen gestellten Frage nach der grössten Sorge nennen die Befragten an erster Stelle finanzielle Sorgen, an dritter Stelle (nach der Einengung durch Auflagen und Gesetze) die hohe Arbeitsbelastung.
1.2 SOZIALES 1 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 77
Aufgeführt sind in den Gruppengesprächen erwähnte Faktoren, die nicht die Sicht der Mehrheit wiedergeben müssen.
■ Zukunftsfähigkeit eines Betriebes
Kriterien zur Zukunftsfähigkeit1 (n=1023)
Welche Voraussetzungen muss ein Betrieb erfüllen, damit er zukunftsfähig ist?
Finanzielle Basis Freude am Beruf Flexibilität/Innovation Arbeitsbelastung
Zukunftszuversicht (n=1023)
Sind Sie bezüglich der Zukunft zuversichtlich?
nicht zuversichtlich zuversichtlich weder noch keine Angabe
1.2 SOZIALES 1 78
Weiterbildung Ausbildung Überprüfung/Anpassung Betriebsgrösse Spezialisierung Nebenerwerb Rationalisierung/Mechanisierung Diversifizierung
Isopublic 1 Mehrfachnennungen möglich 0 02040 in % 80 60100
Hügel
Familiäres Umfeld
Quelle:
Tal
Berg
Betriebliche Zukunft Landwirtschaftliche Zukunft Quelle: Isopublic 0 02040 in % 80 60100
Persönliche Zukunft
132858 417772 1 2135440
Bei der Frage nach der persönlichen Einschätzung der Zukunft sind 77% zuversichtlich und 17% unentschieden. Zur Zukunft des Betriebs gefragt sind noch 58% zuversichtlich, 28% unentschieden. In Bezug auf die Landwirtschaft generell ist die Zukunftszuversicht geringer: 44% sind zuversichtlich und 35% unentschieden. Weniger als die Hälfte der Befragten vertritt also in Bezug auf die Landwirtschaft der Schweiz eine zuversichtliche Meinung zur zukünftigen Entwicklung. Vermehrt pessimistisch zur Zukunftsfähigkeit ihres Betriebes äussern sich Frauen: 19% halten ihren Betrieb nicht für zukunftsfähig im Vergleich zum Durchschnitt von 8%, ebenfalls Personen ohne landwirtschaftliche Ausbildung (16%) sowie Bewirtschafter/innen von kleineren Betrieben (21%). Da Frauen und Personen ohne landwirtschaftliche Ausbildung häufiger kleinere Betriebe führen, darf angenommen werden, dass insbesondere die Grösse des Betriebs ein wichtiger Faktor zur Beurteilung der Zukunftsfähigkeit des Betriebs ist.
«In der Zusammenarbeit liegt Potenzial drin.»
In den Gruppengesprächen wird insbesondere diskutiert, was denn eine solide finanzielle Basis für die jungen Bewirtschafter/innen konkret ist. Laut Aussagen der Bewirtschafter/innen bedeutet eine solide finanzielle Basis, dass einerseits die Kosten im Verhältnis zum Erlös stehen müssen und anderseits der Betrieb nicht mit zu hohen Schulden belastet ist. Ihrer Ansicht nach ist die Verschuldungsrate entscheidend: «Wenn einer minimal verschuldet ist, dann hat er grössere Überlebenschancen!»
Zudem braucht es auch flüssige Mittel, damit nicht für jede Anschaffung gleich ein Kredit aufgenommen werden muss. Ein Problem besteht, wenn Bewirtschafter/innen das Budget für Extra-Anschaffungen überfordern: «Wir leisten uns natürlich z.T. ein bisschen Luxus.» Eine hohe Verschuldung ist bei hohem Einkommen nicht unbedingt ein Problem, doch das Risiko bleibt. Gerade Innovationen sind oft mit grossen Investitionen verbunden, die erst sorgfältig und realistisch geprüft werden sollten: «Mit dem Kopf investieren und nicht mit dem Herzen.» Und: «Es muss in einem einigermassen vernünftigen Rahmen sein.» Der Verschuldung der Bewirtschafter/innen sind durch das bäuerliche Bodenrecht, wegen der Belehnungsgrenze eines landwirtschaftlichen Gewerbes, Grenzen gesetzt. Es scheint, dass dieser Grenzwert nötig ist. Zudem prüfen auch Banken die Ideen der Bauern heute auf Herz und Nieren, bevor sie einen Kredit sprechen, erzählen die jungen Bewirtschafter. Abwarten und nichts machen ist anderseits aber auch keine zukunftsorientierte Lösung: «Also den gesunden Mittelweg finden!»
Die Freude ist für die jungen Bewirtschafter/innen ganz wichtig als Motivator und für die Zukunftsfähigkeit eines Betriebes: «Ich denke, man sollte eigentlich eine Landwirtschaft haben, die einem Freude macht, also woran man Freude hat, dann macht man auch die Arbeiten ringer, die anfallen.» Ein anderer meint: «… wenn man nicht wirklich Freude daran hat, und wenn man auch wirklich von etwas 100% überzeugt ist und dahinter steht, dann kann im Prinzip fast passieren, was will, der kommt vorwärts.» «… etwas, woran du nicht Freude hast, gehst du nicht voller Elan dahinter und wenn du nicht voll Elan dahinter bist, hat das Ganze keinen Sinn.»

1.2 SOZIALES 1 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
79
Die Zusammenarbeit, z.B. in einer Maschinengenossenschaft, ist heute noch keine Selbstverständlichkeit in der Landwirtschaft. Das Zusammenarbeiten wird von jungen Bewirtschafter/innen jedoch als eine wichtige, zukunftsfähige Strategie erkannt. Damit können Kosten geteilt und gemeinsam schlagkräftigere Maschinen angeschafft werden als es einer allein könnte. Doch viele Bauern denken anders: «Jeder will den Fünfer, das Weggli und die Bäckerstochter noch dazu.» Die jungen Bewirtschafter/ innen beschönigen nicht und berichten, dass es natürlich auch Schwierigkeiten zu überwinden gibt. Doch es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, unter denen man wählen kann: Es muss nicht immer gleich eine Betriebsgemeinschaft oder Betriebszweiggemeinschaft sein. Mit etwas Toleranz können viele Freiheiten gewonnen und erst noch ein besserer wirtschaftlicher Erfolg ermöglicht werden.

Ein gutes Management ist wichtig, das wiederum hängt von den Bewirtschafter/innen ab. Die optimale Betriebsgrösse gibt es dabei nicht. Der Betrieb muss richtig geführt werden, dann ist jeder Betrieb irgendwie überlebensfähig. «Oder sonst musst du die richtige Frau heiraten.» Die einfachste betriebliche Zukunftsstrategie läuft über die Betriebsvergrösserung, denn so kann die Struktur des Betriebs erhalten bleiben: «Einfach alles ein bisschen mehr auslasten.» Die anderen Wege brauchen ein wenig mehr Innovation und Flexibilität. Die Frage wird auch aufgeworfen, ob es in Zukunft nur Vollerwerbsbetriebe geben sollte, weil die Bewirtschafter/innen von Nebenerwerbsbetrieben den Strukturwandel resp. die Betriebsvergrösserung der anderen blockieren. «Gewinnen kann einer nur, wenn ein anderer etwas verliert.» Doch würden sie selber aufhören? Sie müssten aufgeben, was sie lieben und das, was ihnen Freude bereitet. «Es muss aber ein Geben und Nehmen sein.» Aus diesem Grund ist für sie die Zusammenarbeit zwischen einem Voll- und einem Nebenerwerbsbetrieb unter Umständen eine zukunftsfähige Lösung, weil beide etwas davon haben.
Zukunftsfähig sein, heisst auch «wandelbar» sein. Nicht immer nur das machen, was die grosse Masse macht, sondern dynamisch und innovativ sein. Das ist zukunftsfähig. Es ist wichtig, am Markt zu bleiben: «Zu fühlen, was es brauchen könnte.» Heute arbeitet üblicherweise kaum mehr jemand lebenslang im gleichen Beruf, sondern will nach einer gewissen Zeit noch etwas Neues lernen oder sich umschulen lassen. Doch ein Bauer bleibt meist ein Leben lang Bauer, wenn er Freude daran hat. Eine wichtige Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit ist ebenfalls eine gute Ausbildung, eine stete Weiterbildung sowie das Einholen von Informationen. Der Unterschied in der Einschätzung der Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildung in der Bergregion gegenüber der Talregion wird von den jungen Bewirtschafter/innen mit einem «Minderbedarf» erklärt. Die landwirtschaftlichen Arbeiten in der Bergregion, insbesondere der Umgang mit Tieren, sind weniger kompliziert als diejenigen auf den vielfältigen Talbetrieben. Und die Bergbauernkinder lernen den Umgang mit Tieren schon früh auf dem Hof: «Ja, weil man damit aufwächst.» Der Umgang mit Spritzmitteln z.B., wie er auf einem grossen intensiven Ackerbaubetrieb nötig ist, kann man als Kind nicht vom Beobachten lernen.
1.2 SOZIALES 1
80
■ Befindlichkeit
Gut drei Viertel der jungen Betriebsleiter/innen sind laut schriftlicher Umfrage zufrieden mit dem Leben und fühlen sich wohl auf dem Betrieb. Und vier von zehn der Befragten hoffen, es bleibe so wie es ist. Geschätzt am Leben als Bewirtschafter/in eines landwirtschaftlichen Betriebs wird besonders die Selbständigkeit, das naturverbundene Arbeiten, die Arbeit mit Tieren sowie die Arbeit im Familienverband. Diesen positiven Aussagen zur Befindlichkeit stehen Aussagen zum Zeitmangel gegenüber. Die Hälfte gibt an, für sich, die Familie und die Partnerschaft zu wenig Zeit zu haben. Mit 60% noch höher ist dieser Anteil in Bezug auf Zeit für Hobbies. Diese Einschätzung bestätigt sich auch bei der offen gestellten Frage nach der grössten Sorge: 11% der Befragten bezeichnen die hohe Arbeitsbelastung als ihre Hauptsorge. Dass sie zu wenig Zeit haben, wird von Bewirtschafter/innen aus der Westschweiz und von solchen mit grossen Betrieben noch verstärkt angegeben.
Befindlichkeit (n=1023)
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf Sie zu?
Fühle mich wohl auf Betrieb Bin mit Leben zufrieden Nehme am öffentlichen Leben teil Hoffe, es bleibt, wie es ist Genügend Zeit für mich Genügend Zeit für Familie
1.2 SOZIALES 1 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
81
Genügend
Genügend
Quelle: Isopublic 0 02040 in % 80 60100 nicht zutreffend zutreffend weder/noch keine Angabe 417781 417772 2030482 3129382 5028211 4833182 4828195 5923152
Zeit für Partner/in
Zeit für Hobbies
«Man hat auch als Bauer nur 24 Stunden und zwei Hände.»
Die Arbeitsbelastung wird in den Gruppendiskussionen thematisiert. Sie ist nach Meinung der jungen Bewirtschafter/innen in der Landwirtschaft hoch, z.T. zu hoch: «Immer mehr machen und mehr machen und irgendwann ist man einfach am Anschlag.» Hohe Arbeitsbelastungen entstehen nach Aussagen der Betroffenen z.B. durch Betriebsvergrösserungen und/oder durch die Aufnahme einer Nebenerwerbstätigkeit. In der Folge fehlt dann auch die Zeit für Familie und Erholung: «Wenn die Woche acht Tage hätte, wäre man acht Tage auf dem Betrieb am Schaffen.» Bekanntlich gibt es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb immer etwas zu tun, das liegt in der Natur der Sache. Deshalb ist es nötig, Prioritäten zu setzen: «Ich gestalte mir das auch selber.» Das Schöne am landwirtschaftlichen Beruf, meinen die jungen Bewirtschafter/innen, sei es ja gerade, dass sie die Arbeit nach dem eigenen Gusto organisieren können: «Ich, jeder, kann selber einteilen wie er will, wie viel er schaffen will und wie und was.»«Man macht es ja freiwillig, nicht.» Wichtig ist für die Jungen auch, dass der Kontakt zum Umfeld nicht verloren geht vor lauter Arbeit. In einer Bauphase kann die Arbeitsbelastung extrem hoch sein, doch dadurch kann nach erfolgtem Um- oder Neubau die Arbeitsqualität und somit auch die Lebensqualität gesteigert werden. Die körperliche Belastung ist dank der Mechanisierung nicht das Problem, sondern der finanzielle, «unternehmerische Druck»: «Man muss führen, man muss das Unternehmen rentabel behalten und immer irgendwie neue Ideen bringen.»
Wenn die zeitliche Belastung auf dem Betrieb zu gross wird, dann leidet auch die Weiterbildung: «Von der Arbeitsbelastung her, ich mag gar nicht mehr, ich habe so viel im Büro zu tun, ich tu mich gar nicht mehr weiterbilden.» Es fragt sich, ob eine so hohe Arbeitsbelastung auf Dauer durchgehalten werden kann, ohne dass die Bauern an Körper und Seele schaden nehmen: «Der eine könnte das 50 Jahre durchziehen, und wäre noch tipptopp fit und der andre muss nach zehn Jahren sagen, das kann es nicht sein, das stimmt nicht und schon gar nicht für die Familie. Dann muss man etwas ändern.» Die Arbeitsbelastung liesse sich auch mit vermehrter Zusammenarbeit reduzieren. Die Betriebsvergrösserungen können jedoch nicht immer mit besseren – und teuren – Maschinen kompensiert werden. Wünschenswert wäre für sie zudem eine Betriebsgrösse, die von der Arbeit her mit Familienarbeitskräften zu bewältigen wäre. Landwirtschaftliche Angestellte sind für die meisten Betriebe finanziell nicht tragbar.
In der Landwirtschaft darf man die Arbeitsstunden nicht zählen, was zählt sind die Stunden in der Natur, mit den Kindern, mit der Partnerin, betonen die Gesprächsteilnehmer. Auch in der Landwirtschaft sollten Ferien normal sein: «Jeder Bauer sollte auch mal fort können, ein bisschen Tapetenwechsel machen.» Wichtig für die Befindlichkeit ist auch in der Landwirtschaft die Kommunikation: «Moi, pour le bien-être, moi, ce que je fais beaucoup c’est parler avec mon épouse.» Noch schöner ist das Leben auf einem Bauernhof, wenn man Familie hat, meint ein junger Bewirtschafter: «On joue beaucoup, on rigole beaucoup sur la ferme.» Die jungen Bewirtschafter scheinen insbesondere ihre Rolle als Väter bewusst zu geniessen: «Moi, je profite le maximum de mes enfants.» Und wenn im Winter dann weniger Arbeit anfällt, dann bleibt auch Zeit für Sport oder andere Aktivitäten.

1.2 SOZIALES 1 82
Ein wichtiger Aspekt ist auch die landwirtschaftliche Sozialisation der Kinder: «C’est un truc important de montrer à nos enfants la nécessité de l’agriculture.» Und auch die Freude daran: «Die Hintendran, die hinter uns kommen, dass die nicht einen Vater haben, der 365 Tage den Grind am Boden unten hat und so auch irgendwann vielleicht denken, ja Bauer könnte ich auch noch lernen, das ist noch cool.» Insbesondere finanzielle Sorgen hingegen können das Wohlbefinden belasten.
Junge Bewirtschafter/innen sehen den Sinn ihres Berufes als Landwirt/innen in erster Linie in der Produktion hochwertiger Nahrungsmittel, wobei die Qualität der Produkte auch umweltrelevante und tierwohlbezogene Aspekte wie z.B. eine ökologische Produktionsweise oder die geografische Herkunft beinhalten. Die Bedeutung von Landschaftspflege und Biodiversität wird hingegen aus Sicht der Jungen von der Bevölkerung überbewertet. Eine produzierende bzw. produktive Landwirtschaft entspricht ihren Vorstellungen, das heisst gute Ackerböden sollten für die Nahrungsmittelproduktion und nicht für Blumenwiesen genutzt werden. Reine Landschaftspflege widerspricht in der Regel ihrem Verständnis als Nahrungsmittelproduzent/innen. Eine gewisse Bestätigung sehen sie darin, dass die Bedeutung der Landwirtschaft für die Ernährung der Bevölkerung allgemein aufgrund von weltweiten Nahrungsmittelund Energiekrisen wieder zugenommen hat. Die Befragten sind sich bewusst, dass ein allfälliger EU-Agrarfreihandel auf jeden Fall grosse Veränderungen mit sich bringen und zu einem verstärkten Strukturwandel in der Landwirtschaft führen würde. Die einen wollen diese Herausforderungen aktiv angehen, anderen aber machen sie Angst. Nach Einschätzung der jungen Bewirtschaftenden wird sich die Einkommenslage in der Landwirtschaft zukünftig aber so oder so kaum verbessern. Die jungen Bewirtschafter/innen sehen ihre Abhängigkeit von den Direktzahlungen als Einschränkung ihrer Autonomie, doch die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung wird eingesehen. Sie bleiben also weiterhin von der Politik abhängig und sind deshalb auf ein gutes Image bei der Bevölkerung angewiesen. Zwar klaffen eigene Vorstellungen und gesellschaftliche Anforderungen an die Landwirtschaft in gewissen Bereichen stark auseinander, doch die Freude am Beruf motiviert die jungen Bewirtschaftenden. Sie haben mit der Übernahme des elterlichen Betriebs eine bewusste Entscheidung für die Landwirtschaft getroffen. Dabei hängt die Zukunftsfähigkeit eines Betriebs nicht nur von einer soliden finanziellen Basis ab, sondern auch von einer zumutbaren Arbeitsbelastung für die Bewirtschaftenden und ihre Familien. In der Zusammenarbeit unter Bewirtschaftenden in der Landwirtschaft wird ein grosses Potenzial gesehen, doch das Selbstverständnis von Eigenständigkeit und Unabhängigkeit verzögert bzw. verhindert dies oft. Die Befindlichkeit der jungen Bewirtschaftenden ist mehrheitlich positiv. So sind bei allen Befürchtungen und Unsicherheiten weniger als 15% der Befragten nicht zuversichtlich für die Zukunft ihres Betriebes.
1.2 SOZIALES 1 83 ■ Fazit
84 1.2 SOZIALES 1
Im vorliegenden Agrarbericht werden zuerst Grunddaten zur Bodennutzung und zu Produktionsmitteln präsentiert. Anschliessend werden gemäss dem festgelegten Turnus Themen aus dem agrarökologischen Monitoring vertieft betrachtet:
–Phosphor und Boden (2002, 2006, 2010)
–Energie und Klima (2003, 2007, 2011)
–Stickstoff und Wasser, inkl. Pflanzenschutzmittel (2004, 2008, 2012)
–Biodiversität und Landschaft (2005, 2009, 2013)
Die Themen Stickstoff und Wasser werden nach 2004 zum zweiten Mal behandelt. Für ausführlichere Hintergrundinformationen, insbesondere zu Stickstoff, sei deshalb auf den Agrarbericht 2004 verwiesen.
Zum Thema Stickstoff wird zuerst ein Überblick über die N-Flüsse in Landwirtschaft und Umwelt gegeben. Anschliessend folgt ein internationaler Vergleich wichtiger Kennzahlen zu Stickstoff. Nach der Diskussion über die agrarökologischen Ziele mit Schwerpunkt auf den Ammoniakemissionen wird ein Blick auf verschiedene, im Zusammenhang mit den agrarökologischen Zielgrössen stehende, Teilaspekte geworfen: Entwicklung der Immissionen von Ammoniak und Ammonium, Nitratgehalte im Grundwasser, N-Bilanzüberschuss und N-Effizienz. Erstmals werden Daten aus dem Projekt «Zentrale Auswertung einzelbetrieblicher Ökobilanzen» präsentiert. Zum Schluss wird eine Vorausschau auf die Modellierung zukünftiger N-Emissionen gegeben.
Beim Thema Pflanzenschutzmittel werden die Regelungen zum Schutz von Mensch und Umwelt vorgestellt, ehe die Entwicklung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und ihrer Spuren im Grundwasser allgemein und am Beispiel von Atrazin dargestellt wird.

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3Ökologie
Ethologie ■■■■■■■■■■■■■■■■■
und
1.3.1Ökologie
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 85
Bodennutzung und Produktionsmittel
Entwicklung des Anteils der Fläche mit umweltschonender Bewirtschaftung in % der LN umweltschonende Bewirtschaftung 1 davon Bio Quelle: BLW 1 1993 bis 1998: IP+Bio; ab 1999: ÖLN 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 2007 2006 2005 2004 2003 Entwicklung der ökologischen Ausgleichsflächen1 19931994199519961997199819992000200120022003200520062007 2004 in 1 000 ha Berggebiet Talgebiet Quelle: BLW 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume, vor 1999 nur zu Beiträgen berechtigte ökologische Ausgleichsflächen 0 140 120 100 80 60 40 20 Entwicklung des Tierbestandes 19901996199719981999200020012002200520062007 2004 2003 in 1 000 GVE 1 übrige Schweine Rindvieh Quelle: BFS 1 GVE: Grossvieheinheit 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 86

Entwicklung des Mineraldüngerverbrauchs in 1 000 t Stickstoff (N)Phosphat (P2O5) Quelle: SBV 19901992 1993199519971999200119941996199820002002 0 80 70 60 50 30 40 20 10 20032007 200420052006 Entwicklung des Kraftfutterverbrauchs in 1 000 t CH andere Kuchen CH Ölsaaten CH Futtergetreide Veredelung von Importen Importfuttermittel Quelle: SBV 19901992 19941996199820002002 1993199519971999200120032007 (prov.) 200420052006 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 87

Entwicklung des Pflanzenschutzmittelverkaufs in t Wirkstoff Fungizide, Bakterizide, Saatbeizmittel Herbizide Insektizide, Akarizide Wachstumsregulatoren Rodentizide Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie (SGCI) 1 Neue Datenerhebung; Zahlen für 2007 noch nicht verfügbar 19901992 19941996199820002002 19931995199719992001200320071 200420052006 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 88
■ N: Antrieb der Biomasseproduktion und Risiko für die Umwelt
Stickstoff
Stickstoff unterliegt einem stetigen komplizierten natürlichen Kreislauf. Er wird durch biogeochemische Prozesse in verschiedene N-Verbindungen umgewandelt und im Bereich von Mikrometern bis einigen Kilometern und auf Zeitskalen von Sekunden bis mehreren Tagen in Luft, Wasser, Boden und Biomasse verfrachtet. Die Landwirtschaft ist mit einer Doppelrolle in den N-Kreislauf eingebunden – als Beeinflusserin und Beeinflusste. Für sie hat Stickstoff eine herausragende Bedeutung. Einerseits gilt er als Motor für die Biomasseproduktion: Da er als Nährstoff im Boden besonders knapp vorhanden ist, bestimmt die N-Zufuhr weitgehend die Höhe des Pflanzenertrages. Andererseits können sich erhöhte N-Emissionen aus Landwirtschaft, Industrie und Verkehr nebst weiteren schädlichen Folgen auch negativ auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken.
Ein Teil des in der Landwirtschaft eingesetzten Stickstoffs gelangt in die organische Substanz von pflanzlichen und tierischen Produkten oder des Bodens. Ein Teil geht aus Sicht der Landwirtschaft unproduktiv verloren. In Form von elementarem Stickstoff (N2) ist diese Emission für die Umwelt unproblematisch. Verlässt Stickstoff aber als Ammoniak (NH3), als Nitrat (NO3), oder als Lachgas (N2O) die Landwirtschaft, kann er Boden, Wasser, Luft und Pflanzengesellschaften, allen voran sensible Ökosysteme wie Wälder, Hochmoore und Magerwiesen belasten. Die Folgen sind Versauerung und Überdüngung von Böden, Eutrophierung von Oberflächengewässern, Grundwasserbelastung, Abbau der Ozonschicht und Verstärkung des Treibhauseffekts sowie eine Abnahme der Biodiversität in empfindlichen Ökosystemen. Des Weiteren trägt Ammoniak zur Bildung von sekundären Aerosolen in der Atmosphäre bei, welche als feine Partikel (PM10) die menschliche Gesundheit gefährden. Bei Verbrennungsprozessen wird Stickstoff zudem in Form von Stickoxiden (NOx) emittiert, welche zur N-Deposition und zur Bildung bodennahen Ozons beitragen. Ozon ist ein Reizgas, das neben der menschlichen Gesundheit auch diejenige von Pflanze und Tier beeinträchtigt und so die pflanzenbaulichen und tierischen Erträge vermindern kann.
■ Ammoniak, Nitrat und Lachgas stammen vor allem aus der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft ist nicht allein verantwortlich für alle umweltschädlichen N-Emissionen. Sie ist aber Hauptemittentin von Ammoniak (über 90% der Gesamtemissionen), Nitrat (gegen 75%) und Lachgas (gegen 80%). Bei den Emissionen von Stickoxiden stehen andere Quellen (insbesondere der Verkehr) im Vordergrund. Der Beitrag der Landwirtschaft macht hier weniger als 10% aus.
Der gesamte Ausstoss der genannten umweltschädlichen N-Verbindungen aus der Landwirtschaft hat zwischen 1994 und heute abgenommen. Der Anteil der Landwirtschaft an den Gesamtemissionen hat sich in diesem Zeitraum allerdings vergrössert, da die Emissionen der Stickoxide als Folge der verschärften lufthygienischen Vorschriften (Luftreinhalteverordnung) stärker vermindert wurden als diejenigen der vorwiegend aus der Landwirtschaft stammenden N-Verbindungen.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 89
■ Der N-Kreislauf ist komplex …
Die Grafik zum Stickstoffkreislauf gibt eine Übersicht über alle wichtigen N-Flüsse in der Landwirtschaft sowie über die ins System Landwirtschaft (Tierhaltung und Pflanzenanbau) eingetragenen und aus dem System austretenden N-Flüsse. Mengenmässig – die Angaben sind als ungefähre Mittelwerte der Schweizer Landwirtschaft über mehrere Jahre zu verstehen – beträgt die Summe aller Einträge 155 Kilotonnen N (importierte Futtermittel 30 kt N + Mineral- und Recyclingdünger 55 kt N + biologische Fixierung 40 kt N + Deposition aus der Luft 30 kt N). Dieser Wert liegt weit über der Summe aller Austräge in Form von landwirtschaftlichen Produkten von total 40 Kilotonnen N (tierische Nahrungsmittel 30 kt N + pflanzliche Nahrungsmittel 10 kt N). Damit erreicht die Landwirtschaft eine Effizienz von unter 30%.
Schematische Darstellung des N-Kreislaufs 1
Atmosphäre
Anthroposphäre
Tierhaltung
Tierische Futtermittel
Pflanzliche Futtermittel
Hofdünger
Ernteverluste
Pflanzenbau
Tierische Nahrungsmittel
Importierte Futtermittel
Andere Emissionen: Verkehr, Industrie,...
Pflanzliche Nahrungsmittel
Mineraldünger Recyclingdünger
Pedosphäre Hydrosphäre
LandwirtschaftNicht-Landwirtschaft
Quelle: BLW
Die Differenz zwischen Ein- und Austrägen fällt als Überschuss an verschiedenen Stellen des N-Umlaufs an (sogenannter N-Bilanzüberschuss). Kann dieser Überschuss nicht gespeichert werden, geht er verloren. Als grösster potenzieller N-Speicher kann der Boden auftreten. Da jedoch unter der heute vorherrschenden Art der Landbewirtschaftung davon ausgegangen wird, dass der Humusvorrat der Landwirtschaft in einem Zeitraum von wenigen Jahren keine grösseren Veränderungen erfährt, entspricht die N-Einlagerung im Mittel etwa der N-Auslagerung im Boden. Daraus folgt, dass der NÜberschuss mengenmässig näherungsweise der Summe der N-Verluste entspricht. Die bedeutendsten Mengen gehen in Form von Ammoniak (>35 kt N), Nitrat (>30 kt N), elementarem Stickstoff (>20 kt N) und Lachgas (>5 kt N)verloren.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 90
1 Die Landwirtschaft (Systemgrenze durch gestrichelte Linie markiert) steht im Zentrum der Betrachtung. Zusätzlich werden die wichtigsten Wechselwirkungen zwischen der Landwirtschaft und den verschiedenen Ökosphären dargestellt.
■ … viele Fragen sind noch unbeantwortet
Eine bessere N-Verwertung ist gefordert. Allerdings wird auch langfristig eine landwirtschaftliche Produktion ohne schädliche N-Austräge nicht möglich sein. Auf verschiedenen Ebenen – etwa bei der Tierernährung und im Boden – laufen biologische Vorgänge ab, die mit unvermeidbaren N-Verlusten verbunden sind. Die tierische Produktion führt dabei tendenziell zu höheren N-Verlusten als die pflanzliche Produktion. Während im Ackerbau die Nitratauswaschung ins Grundwasser im Vordergrund steht, sind es bei der tierischen Produktion die Ammoniakemissionen in die Luft.
Das System als Ganzes ist komplex. Da ein ständiger Austausch zwischen den verschiedenen N-Formen stattfindet, darf nie nur ein Teilproblem der N-Austräge einzeln betrachtet werden. Werden beispielsweise die Ammoniakemissionen bei der Hofdüngerausbringung vermindert und die zugeführte N-Mineraldüngermenge nicht entsprechend reduziert, gelangt mehr Stickstoff in den Boden. Dieser Stickstoff kann direkt von den Pflanzen aufgenommen werden, aber auch in den Nitrifikations-/ Denitrifikationsprozess gelangen und dabei zu Nitrat (NO3), Lachgas (N2O), Stickoxid (NO2) oder elementarem Stickstoff (N2) umgewandelt werden. Als Folge können etwa die Auswaschung von Nitrat und die Lachgasemissionen ansteigen.
Viele Prozesse können sehr unterschiedlich ablaufen und die Höhe der N-Emissionen wesentlich mitbestimmen. In der Landwirtschaft sind dabei z.B. die Fütterung der Tiere, das Stallsystem, die Reinigung der Oberflächen, die Art der Mist- und Gülleproduktion, die Nährstoffausscheidungsrate der Tiere, die Aufbereitung der Hofdünger wie Verdünnung, Vergärung, Kompostierung etc., die Ausbringtechnik der Dünger, die Kulturenwahl, die Bodenbearbeitung und die Art der futterbaulichen Nutzung, das Weidemanagement, der Humusauf- und -abbau im Boden usw. relevante Prozesse, bei denen einzelne Aspekte noch ungenügend geklärt sind. Messungen in Feld, Stall, Laufhof und Lager sind sehr aufwändig und führen je nach Ausgangslage und Rahmenbedingungen zu unterschiedlichen Resultaten. So sind die Unsicherheiten über die N-Verlustmengen in der Praxis insgesamt beträchtlich und das Ausmass der Wirkung von Massnahmen in der Landwirtschaft nur grob abschätzbar. Entsprechende Forschungsarbeiten sind im Gang oder müssen noch geleistet werden.
■ N-Einsatz und N-Emissionen: Im internationalen Vergleich im Mittelfeld
Die drei folgenden Grafiken zu ausgewählten Aspekten der Stickstoffproblematik in der Landwirtschaft (N-Bilanzüberschuss, Einsatz mineralischer N-Dünger und Nitratgehalt im Grundwasser) zeigen die Stellung der Schweiz im internationalen Vergleich. Für weitergehende Informationen sei auf den Bericht der OECD verwiesen (siehe Literaturangaben im Anhang).
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 91 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Entwicklung der N-Bilanz von 1990–92 bis 2002–04
Quelle: OECD bereinigt
Der N-Bilanzüberschuss (in t N) in der Landwirtschaft der OECD-Länder hat im Zeitraum 1990–92 bis 2002–04 um 17% abgenommen. Die Abnahme in der Schweiz liegt leicht darunter und beträgt etwa 14%. Länder, welche in der Vergleichsperiode eine Zunahme des Bilanzüberschusses aufweisen, haben im Mittel geringere Überschüsse in Kilogramm pro Hektare, während die Länder mit den grössten Abnahmen vorwiegend solche sind, die besonders hohe Überschüsse zeigen. In der Schweiz liegt der N-Überschuss pro Hektare unter dem OECD-Durchschnitt.
Entwicklung des N-Mineraldüngereinsatzes von 1990–92 bis 2002–04
–50–2550 025 in %
Quelle: OECD erweitert
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 92
Neuseeland Portugal USA Polen Schweiz Frankreich Norwegen OECD Deutschland EU15 Österreich Niederlande 46 47 37 48 57 54 77 74 113 83 48 229 Mittel 2002–04 [kgN/ha]
50
in %
–50–25
025
Neuseeland Kanada Spanien OECD Deutschland Frankreich EU15 Schweden Österreich Schweiz Niederlande Slowakei 26 27 37 23 106 79 66 57 31 36 152 34 Mittel 2002–04 [kg/ha]
■ Agrarökologische Etappenziele bezüglich Stickstoff teilweise erreicht
Der Einsatz mineralischer N-Dünger (in t Produktgewicht) hat während des Untersuchungszeitraumes in den OECD-Ländern um 3% zugenommen, insbesondere weil verschiedene grosse, vorwiegend nicht-europäische Länder mehr N-Dünger eingesetzt haben. Australien und Neuseeland haben den Einsatz in diesem Zeitraum sogar verdoppelt. Diesbezüglich steht die Schweiz im Ländervergleich der OECD deutlich besser da. Sie hat eine Abnahme um rund 20% aufzuweisen.
Anteil Grundwassermessstellen mit Nitratgehaltsüberschreitungen1
Dänemark
Niederlande
Italien
USA
Frankreich
Grossbritannien
Österreich
Deutschland
Ungarn
Tschechien
Schweiz
Norwegen
Quelle: OECD
Zum Vergleich der Nitratgehalte über dem Trinkwasserwert ist anzumerken, dass neben den Messprogrammen auch die Anforderungen für Nitratgehalte im Trinkwasser je nach Land unterschiedlich sind. Während in der EU ein Grenzwert für Nitrat von 50 mg/l gilt, beträgt der Wert in den USA 10 mg/l. In der Schweiz besteht ein Toleranzwert von 40 mg/l. Daneben gilt eine maximale Konzentration von 25 mg/l Nitrat in Fliessgewässern, die der Trinkwassernutzung dienen und in Grundwasser, das als Trinkwasser dient oder dafür vorgesehen ist. Trotz der eingeschränkten Aussagekraft zeigt sich, dass die Schweiz im internationalen Vergleich relativ wenige Überschreitungen des lebensmittelrechtlichen Trinkwasserwertes aufweist.
Im Jahr 2002 legte der Bundesrat in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik 2007 erstmals mittelfristige agrarökologische Etappenziele fest. Von sieben Zielen betrafen drei den Stickstoff:

–Reduktion der umweltrelevanten N-Verluste um 23% bis 2005 gegenüber dem Basisjahr 1994;
–Reduktion der Ammoniak-Emissionen um 9% bis 2005 (Basisjahr 1990);
–Nitratgehalt unter 40 mg/l in 90% der Trinkwasserfassungen, deren Zuströmbereich von der Landwirtschaft genutzt wird.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 93
1 Anteil der Messstellen in landwirtschaftlich dominiertem Einzugsgebiet mit Nitratgehalten über den nationalen Trinkwasserwerten, Daten 2002–04
in %
05253010152035
Agrarökologische Basiswerte, Ziele und Beurteilung der Zielerreichung
ZielgrösseEinheit/BasisSOLLISTBeurteilung Ziel ISTBeurteilung Indikatorder Ziel-AP 2011der Zielerreichungerreichung
Angaben gemäss Text in der BotschaftNeubeurteilung zur AP 2011 vom 17. März 2006Juni 2008 N-Bilanz
1Nach OSPAR-Methode.
2Bisherige Methoden zur Berechnung der umweltrelevanten N-Verluste und der Ammoniakemissionen müssen überarbeitet werden. Bis Ende 2008 sollen die neuen Ergebnisse vorliegen. Basis-, Soll- und Ist-Werte müssen neu bestimmt werden.
In der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik 2011 (AP 2011) wurde, gestützt auf den Stand der Zielerreichung 2002, der agrarökologische Handlungsbedarf beurteilt. Da die Methode zur Berechnung der umweltrelevanten N-Verluste angepasst werden musste, waren zu dieser Grösse für 2002 keine verlässlichen Zahlen verfügbar. So wurde zum ersten Ziel der N-Überschuss (N-Bilanz nach OSPAR) als Ersatzgrösse herangezogen und gegenüber dem Ausgangswert für 1994 von 123'000 t N ebenfalls eine Reduktion um 23% bis 2005 vorgegeben. Das Fazit gemäss der Botschaft zur AP 2011 lautete: zwei von drei Zielen bezüglich Stickstoff erreicht. Bei den AmmoniakEmissionen wurde das Ziel nach dem Stand des Wissens übertroffen, ebenso beim Nitrat. Hingegen betrug 2002 der N-Überschuss 115'000 t und war damit deutlich über dem Zielwert von 95'000 t. Das ursprüngliche Ziel bezüglich N-Bilanz wurde dementsprechend von 2005 auf 2015 verschoben, dasjenige von Ammoniak noch verschärft (Reduktion um 23% gegenüber 1990) und für 2009 festgelegt. Zu Nitrat wurde kein weiteres Ziel definiert: Die verwendete Zielgrösse machte eine Interpretation der Entwicklung der von der Landwirtschaft beeinflussten Nitratgehalte im Grundwasser schwierig (Trinkwasserfassungen mit hohen Nitratgehalten werden teilweise nicht mehr genutzt und fallen aus der betrachteten Kategorie).
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 94
Reduktion
Reduktion
Ammoniak-Emissionen Reduktion der Ammoniakemissionen Nitrat Nitratgehalt von
aus Trinkwasserfassungen, deren Zuströmbereich von der Landwirtschaft genutzt wird t umweltrelevante N-Verluste t N-Überschuss 1 t N in NH3Emissionen % der Fassungen unter 40 mg NO3/l 1994 96 000 123 000 1990 53 300 1990 keine Angabe 2005 74 000 (–23%) 95 000 (–23%) 2005 48 500 (–9%) 2005 90 2002 keine Angabe 2 115 000 (–6,5%) 2002 43 700 (–18%) 2002/3 97 nicht möglich 2 nicht erfüllt erfüllt erfüllt 20152 95 000 (–23%) 2009 41 000 (–23%) 220052 111 000 2005 keine Angabe 2 2005 93 für 2005 nicht möglich nicht erfüllt für 2005 nicht möglich erfüllt
der umweltrelevanten N-Verluste
der N-Überschüsse
Wasser
■ Neufestlegung des Ziels zu Ammoniak nötig
Eine aktuelle Einschätzung (Juni 2008) aufgrund der Zahlen von 2005 und neuer Erkenntnisse bestätigt die Beurteilung der Botschaft zur AP 2011 zu den Zielen bezüglich N-Bilanz (Ziel mit einem tatsächlichen N-Überschuss von 111‘000 t nicht erreicht) und bezüglich Nitrat (Ziel mit einem Anteil von 93% der Trinkwasserfassungen unter einem Nitratgehalt von 40 mg/l erreicht). Jedoch bestehen mittlerweile Zweifel an der angeblichen Reduktion der Ammoniakemissionen von gegen 20% für die Zeit zwischen 1990 und 2002:
–Vorhandene, je nach N-Komponente unterschiedlich lange Zeitreihen von schweizerischen Immissionsmessdaten können die modellierte Abnahme nicht bestätigen (siehe nachfolgende Grafiken);
–Die nach der Schweiz am meisten zur Gesamtstickstoffdeposition in der Schweiz beitragenden Länder Italien, Frankreich, ehemaliges West-Deutschland und Spanien verzeichnen insgesamt keine Reduktion der Ammoniakemissionen in demselben Zeitraum;
–Neue Haltungsformen von Nutztieren (Laufställe, Laufhöfe etc.) führen tendenziell zu einer Zunahme der Ammoniakemissionen;
–Die berechnete Reduktion der Ammoniakemissionen hätte eine stärkere Verminderung des N-Bilanzüberschusses in diesem Zeitraum erwarten lassen.
Es hat sich herausgestellt, dass das bisher für die Prognose der landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen verwendete Modell Dynamo verschiedene Teilprozesse nicht richtig abgebildet hat. Es ist deshalb 2006 einem Review unterzogen worden. Das überarbeitete neue Modell Agrammon wird gegen Ende 2008 vorliegen. Nach den Neuberechnungen wird sich weisen, wie sich die landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen verändert haben. Darauf basierend werden die Aussagen in den Botschaften zur AP 2007 und zur AP 2011 bezüglich Basiswert 1990 und Zielerreichung 2005 (bzw. 2002) revidiert und – mit der Einschätzung der Wirkung zukünftiger Massnahmen –neue Etappenziele für die Emissionsreduktionen abgeleitet.
Nachfolgend werden einzelne Aspekte vorgestellt, die einen Zusammenhang mit den agrarökologischen Zielgrössen haben.

1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 95
■ Die Immissionen von Ammoniak und Ammonium sind nicht zurückgegangen
Immissionsmessungen (Erfassungen der Einträge an einem bestimmten Standort) zu Ammoniak (NH3) stehen in der Schweiz seit 2000 an 16 Standorten durchgehend zur Verfügung. Die Resultate dieser Messungen weisen keine eindeutige Tendenz auf. Inzwischen ist das Messnetz deutlich ausgebaut worden, jedoch lassen auch die Daten der über 50 Messstellen in den letzten Jahren keinen Trend zur Abnahme erkennen.
Im Durchschnitt wird etwa die Hälfte der Ammoniakemissionen in einem Umkreis von wenigen Kilometern von der Quelle in Form von verschiedenen N-Verbindungen wieder deponiert. Der Rest wandelt sich in Ammonium (NH4) um, welches in der Atmosphäre über Hunderte von Kilometern verfrachtet werden kann, bevor es mit dem Niederschlag oder als Staub wieder auf die Erdoberfläche gelangt.
Auch bei der NH4-Menge mit den Niederschlägen ist im Jahresmittel der Frachten für die Stationen Dübendorf (Agglomeration) sowie Payerne, Rigi und Chaumont (ländlich) kein abnehmender Trend sichtbar: seit 1997 für Rigi und Chaumont, bzw. seit Beginn der Messungen 1990 an den Stationen Dübendorf und Payerne.

1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 96
20002001200220032004200520062007 in µg/m 3
Ammoniak-Konzentration in der Schweiz 2000–071
1 Jahresmittelwerte von 16 Stationen, über alle 8 Jahre beprobt 4,0 3,0 3,5 2,0 2,5 1,0 1,5 0,5 0
Quelle: Forschungsstelle für Umweltbeobachtung fub
An den NABEL-Stationen Payerne (seit 1994, mit Unterbruch) und Rigi (seit 2000) werden auch die Summen von NH3 (gasförmig) und NH4 (Aerosole) gemessen. Auch hier ist kein Trend zu erkennen. Interessant ist, dass diese Summe beispielsweise auch in Dänemark an zwei Stationen gemessen wird. Dort wird seit Beginn der Messreihe 1990 eine Abnahme der Belastung auf etwa den halben Wert bis 2005 festgestellt. In Dänemark sind nachweislich bereits viele Massnahmen zur Minderung der Ammoniakemissionen ergriffen worden. Die Belastung war 1990 etwa gleich hoch wie bei Payerne.
Zwischen 1997 und 2002 sind die Nitratgehalte in der Schweiz in hauptsächlich landwirtschaftlich beeinflussten Gebieten tendenziell gesunken, seither steigen sie wieder an. Der Anstieg ist besonders stark bei Messstellen mit der Hauptbodennutzung «Grasund Viehwirtschaft». Für den Anstieg sind verschiedene Ursachen möglich. Bekannt ist, dass ein Ausnahmejahr – bedingt durch das Ausmass der Grundwasserneubildung und die Aufenthaltsdauer des Wassers – mehrjährige Auswirkungen haben kann. So geht eine Erklärung davon aus, dass wegen der Trockenheit während des Hitzesommers 2003 die Pflanzen nur wenig Nährstoffe aufgenommen haben. In der Folge habe sich Nitrat im Boden angereichert und sei mit den Niederschlägen im Herbst und Winter 2003/04 ausgewaschen worden und so ins Grundwasser gelangt. Zusätzlich können auch Umstellungen in der landwirtschaftlichen Nutzung wie etwa die Veränderung der Bodenbedeckung während des Winters einen Einfluss gehabt haben. Interessant ist der Vergleich mit dem angrenzenden Ausland: In Baden-Württemberg ist die Nitratbelastung im Grundwasser 2004 und 2005 angestiegen, 2006 jedoch wieder auf den Wert der Jahre 2002/03 gesunken.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 97
■ Nitratgehalt im Grundwasser
wieder angestiegen
1990919293949596979899200001020304050607 in mg N/m 2 Jahr Rigi Dübendorf Payerne Chaumont
Ammonium-Fracht mit dem Regen in der Schweiz 1990–2007
0 700 600 500 400 300 200 100 800
Quelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
in
0 25 20 15 10 5 30
Nitratkonzentration im Grundwasser in der Schweiz 1997–20061
Hauptbodennutzung «Ackerbau» (n=35)
Hauptbodennutzung «Grasland & Viehwirtschaft» (n=42)
1 Median der Nitrat-Mittelwerte pro Jahr und Messstelle; Daten der NAQUA-Messstellen in landwirtschaftlich dominiertem Einzugsgebiet der Kantone AG, BE, GE, JU, NE, NW, SO, SZ, VD, ZH
2006 enthielten 16% der Messstellen des Nationalen Netzes zur Beobachtung der Grundwasserqualität (NAQUA) mit Hauptbodennutzung «Ackerbau» über 40 mg/l Nitrat, 45% zwischen 25 und 40 mg/l. Bei der Hauptbodennutzung «Gras- und Viehwirtschaft» lagen die Konzentrationen bei 6% der Messtellen über 40 mg/l Nitrat und bei 15% zwischen 25 und 40 mg/l. Messstellen mit steigenden Nitratkonzentrationen befinden sich hauptsächlich im Mittelland. Bei den Stationen in den Alpen mit vorwiegend naturnahen Nitratkonzentrationen sind nur geringe Veränderungen auszumachen.
Nitrat-Konzentration
2006
Änderungen der Nitrat-Konzentrationen 2003–2006 gestiegen gleich geblieben (±1 mg/l) gesunken
1 Werte für 2006 inkl. Veränderung gegenüber 2003. Dargestellt sind NAQUA-Messstellen mit landwirtschaftlicher Hauptbodennutzung.
<5% 5–20% 20–40% >40%
Quelle: BAFU
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 98
1997199819992000200120022003200420052006 mg/l
Quelle: BAFU
<25 mg/l 25 mg/l–40 mg/l >40 mg/l Ackeranteil
Räumliche Verteilung der Nitrat-Konzentration im Grundwasser 1
Die sicherste Grösse zur Abschätzung des Trends bei den N-Emissionen ist der NÜberschuss. Unter der Annahme, dass der N-Vorrat des Bodens im Durchschnitt aller Flächen von Jahr zu Jahr in etwa gleich bleibt, kann der N-Überschuss den N-Verlusten gleich gesetzt werden, die irgendwo im System entstehen (siehe Abschnitt zu NBilanzüberschuss). Bei der Berechnung der N-Überschüsse nach der OSPAR-Methode wird die gesamte Landwirtschaft der Schweiz als ein einziger Betrieb betrachtet. Als Input gilt, was von aussen in die Landwirtschaft gelangt. So werden importierte Futtermittel und Mineraldünger zum Input gezählt, nicht aber inländische Futtermittel und Hofdünger, da diese auf dem Betrieb anfallen. Als Output gilt, was aus der Landwirtschaft weggeführt wird: die pflanzlichen und tierischen Lebensmittel. Selbst produzierte Nahrungsmittel für die Fütterung der Tiere bleiben im System Landwirtschaft und werden deshalb nicht als Output betrachtet (siehe gestrichelter Rahmen in der Grafik zum N-Kreislauf).
Zu Beginn der neunziger Jahre nahm der Bilanzüberschuss praktisch parallel mit dem Einsatz von N-haltigen Mineraldüngern deutlich ab. Ab Ende des letzten Jahrzehnts stieg der Bilanzüberschuss bis 2003 wieder leicht an. Das ist vor allem auf die zunehmende Menge an Importfuttermitteln (u.a. eine Folge des Verbots von Tiermehl in der Fütterung) und an Mineraldünger (u.a. eine Folge des Verbots von Klärschlamm für die Düngung) zurückzuführen. Seit 2003 ist kein eindeutiger Trend mehr auszumachen.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 99
Entwicklung der N-Bilanz und der N-Inputs nach OSPAR 1990919293 94 95969798992000010203040506 in 1000 t N Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 120 100 80 60 40 20 140 N-Bilanz N-Fixierung und N-Deposition Mineraldünger Importierte Futtermittel und Saatgutimport Recyclingdünger, übrige Dünger ■ Entwicklung von N-Bilanzüberschuss und N-Effizienz
■ N-Input pro Hektare: Auswertung nach Betriebstypen
Bei der N-Effizienz nach OSPAR wird die Summe aller N-Inputs in das System Landwirtschaft der Summe der N-Frachten in den landwirtschaftlichen Produkten, welche die Landwirtschaft verlassen, gegenüber gestellt. Auffällig ist, dass nach dieser Betrachtung der Output weniger als einen Drittel des gesamten Inputs ausmacht. Seit Anfang der neunziger Jahre kann bei jährlichen Schwankungen eine deutliche Steigerung der N-Effizienz von etwa 25% auf gegen 30% festgestellt werden. Die landwirtschaftlicheProduktion gemessen am N-Output hat dabei zugenommen, während der gesamte N-Input in diesem Zeitraum zurückgegangen ist.
Das Ziel des Projekts «Zentrale Auswertung von Ökobilanzen landwirtschaftlicher Betriebe» (ZA-ÖB) ist es, ökologische Kenndaten von repräsentativen Betrieben der schweizerischen Landwirtschaft systematisch zu erfassen und auszuwerten (vergleichbar mit der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten). Das Projekt ermöglicht es, detaillierte Aussagen zu verschiedenen ökologischen Auswirkungen einzelner landwirtschaftlicher Betriebe sowie von Betriebstypen zu machen. Das gleichzeitige Vorhandensein von Buchhaltungsdaten bei rund 200 Betrieben wird darüber hinaus ökonomisch-ökologische Analysen zulassen. Im vorliegenden Abschnitt werden erste Zahlen zum N-Einsatz auf den Betrieben dargestellt.
Die teilnehmenden Landwirte haben Inputdaten wie den Tierbestand selbst elektronisch erhoben. Daraus sind Parameter wie der Hofdüngeranfall berechnet und in der Folge der ausgebrachte Stickstoff bestimmt worden. Der Einsatz an Mineraldüngern und übrigen Düngern (z.B. Kompost) ist ebenfalls erfasst worden.
Zu beachten ist die vorläufig noch sehr kleine Stichprobe, welche die Aussagekraft der Resultate stark einschränkt. Überhaupt sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Betriebstypen durch die kleinen Stichproben statistisch nicht signifikant (siehe Vertrauensintervalle).
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 100
in 1 000 t N N-Input N-Effizienz N-Output N-Überschuss Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 in % 30 25 20 15 10 5 0 9091929394959697989900010203040506
Entwicklung von N-Input, N-Output und N-Effizienz nach OSPAR
■ In Zukunft nur geringe Fortschritte bei der Reduktion der N-Emissionen?
Ausbringung Gesamtstickstoff nach Betriebstypen
Kombiniert Veredelung (n=9)
Kombiniert Verkehrsmilch/ Ackerbau (n=6)
Verkehrsmilch (n=15)
Ackerbau (n=9)
Durchschnitt total (n=56)1

Über alle 56 Betriebe gesehen stammt etwas mehr als die Hälfte des ausgebrachten Stickstoffes aus Hofdüngern, der restliche Anteil aus Mineraldüngern und übrigen Handelsdüngern. Bei den Betrieben mit Tierhaltung ist der Anteil der Hofdünger entsprechend grösser, währenddem die Betriebe des Typs «Ackerbau» (Bezeichnung gemäss FAT99-Typologie) weit mehr als die Hälfte des Stickstoffs in Form von Mineraldüngern ausbringen. Der Hofdünger, den diese Betriebe einsetzen, ist teilweise zugeführt. Die Betriebe des Typs «kombiniert Verkehrsmilch / Ackerbau» bringen tendenziell mehr Stickstoff pro Hektare aus als die übrigen Betriebe. Obwohl sie deutlich mehr Hofdünger produzieren, setzen Betriebe dieses Typs nicht viel weniger Mineraldünger ein als die Betriebe des Typs «Ackerbau». Insgesamt fällt auf, dass die Unterschiede beim gesamten N-Input pro Hektare zwischen den Betriebstypen gering sind. Die Bedeutung der verschiedenen N-Quellen ist aber von Betriebstyp zu Betriebstyp sehr unterschiedlich.
Von besonderem Interesse ist die voraussichtliche Entwicklung der zukünftigen NEmissionen. Im Auftrag des BLW wurde deshalb am Institut für Umweltentscheidungen der ETH Zürich eine Abschätzung der Auswirkungen des Massnahmenpakets der AP 2011 auf die N-Emissionen aus der Landwirtschaft bis 2013 vorgenommen. Die wichtigsten Kennzahlen, die dabei berechnet wurden, sind die N-Düngung, der N-Entzug, das N-Verlustpotenzial (der gesamte N-Überschuss) und die umweltrelevanten N-Verluste. Letztere umfassen die N-Emissionen in Form von Ammoniak, Nitrat und Lachgas. Für die Berechnung der N-Fraktion Ammoniak musste dabei mangels besserer Grundlagen noch auf das zurzeit sich in Überarbeitung befindende Modell Dynamo zurückgegriffen werden. In diesem Fall sind also die Berechnungen mit einem unbekannten Fehler behaftet, was eine zuverlässige Aussage bezüglich der absoluten Höhe der umweltrelevanten N-Verluste verunmöglicht. Aussagen über den zu erwartenden Trend der verschiedenen N-Emissionen können dennoch gemacht werden, da über die Jahre die gleiche Methode angewendet und damit der gleiche Fehler reproduziert wird.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 101 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1 Im Durchschnitt sind neben den dargestellten Betriebstypen noch weitere ausgewertete Betriebe enthalten.
Gülle Mineraldünger Mist übrige Dünger
in kg N/ha 0150100250 50 200
Modellierung der zukünftigen umweltrelevanten N-Verluste (provisorisch)
Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung der AP 2011 bis 2013 zu einem leicht abnehmenden Einsatz von Stickstoff in der Landwirtschaft führen wird. Da gemäss den Modellergebnissen die Produktion von pflanzlicher und tierischer Biomasse ebenfalls leicht zurückgeht, wird es nur zu einer minimalen Abnahme der N-Überschüsse und insbesondere der umweltrelevanten N-Verluste kommen. Bei den Berechnungen wird allerdings davon ausgegangen, dass die heutige Technologie beibehalten wird und dass keine spezifischen Massnahmen zur Reduktion der N-Emissionen ergriffen werden. In Wirklichkeit wird eine stärkere Abnahme der umweltrelevanten N-Emissionen erwartet, da mit dem Ressourcenprogramm (77a LwG) u.a. Anreize geschaffen worden sind, gezielte Massnahmen zum nachhaltigen und effizienten Einsatz von Stickstoff zu ergreifen, wie etwa der Einsatz des Schleppschlauchverteilers, die Abdeckung noch offenerGüllegruben oder die vermehrte Weidehaltung.
Das agrarökologische Ziel betreffend N-Bilanz wurde verfehlt. Der vielversprechendste Weg, den angestrebten Rückgang der N-Emissionen zu erreichen, führt über einen verminderten N-Input in das System Landwirtschaft bei möglichst gleich bleibender Produktion. Dies zeigt sich in einer verbesserten N-Effizienz. Dazu beitragen können der geringere Einsatz von N-haltigen Mineraldüngern in Kombination mit einer verlustärmeren Lagerung und Ausbringung von Hofdüngern. Mit Art. 77a LwG sind Anreize zum effizienteren N-Einsatz geschaffen worden.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 102
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 in 1000 t N N-Düngung N-Entzug Biomasse N-Verlustpotential umweltrelevante N-Verluste Quelle: IAW ETH 0 250 200 150 100 50 300
■ Fazit zu Stickstoff:
■ Umfassende Regelungen zum Schutz von Mensch und Umwelt
Pflanzenschutzmittel
Die Pflanzenschutzmittel dienen vor allem der Sicherung der Ernten. Als biologisch aktive Substanzen können sie jedoch auch die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährden. Das Risiko wird wesentlich von Faktoren wie Toxizität, Mobilität und Persistenz des Produktes, Anwendungsmethode, Witterung nach der Applikation oder Nähe zu Gewässern beeinflusst.
Auch bei sorgfältiger Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbleiben gewisse Anteile des Wirkstoffs nicht wie gewünscht auf der behandelten Kultur, sondern gelangen auf oder in den Boden oder durch Verdampfung in die Atmosphäre. Im Boden werden PSM-Rückstände bestenfalls festgehalten und abgebaut. Geringe Anteile der Rückstände von Wirkstoffen oder deren Umwandlungsprodukte können ins Grundwasser auslaufen oder mit dem Regenwasser oberflächlich in Bäche, Flüsse und Seen abtransportiert werden.
Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sind vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu schützen. Um diese gesetzliche Vorgabe im Bereich der Pflanzenschutzmittel zu erreichen, hat der Bund verschiedene Massnahmen eingeführt:
–Bevor Pflanzenschutzmittel in den Handel gebracht werden dürfen, müssen sie durch die Behörden zugelassen werden. Beim Zulassungsverfahren wird neben der Wirksamkeit auch die Sicherheit in Bezug auf Menschen, Kulturpflanzen und Umwelt überprüft und beurteilt. Für diese Sicherheitsprüfung sind Unterlagen zur Toxikologie, zur Ökotoxikologie, zum Umweltverhalten und zu den Rückständen vorzuweisen. Dabei sind die Anforderungen an das Registrierdossier wie auch an die Beurteilungsmethodik und -kriterien mit der EU harmonisiert. Bei der Zulassung wird festgelegt, wofür und wie das jeweilige Pflanzenschutzmittel angewendet werden darf. Aktuell ist bei der Schweizer Zulassungsbehörde ein Programm im Gange, bei dem unter Berücksichtigung des EU-Reviewprogrammes die Zulassungen von alten Wirkstoffen und Produkten überprüft werden. Ergibt diese Neubeurteilung eine ungenügende Sicherheit für Mensch und Umwelt oder eine mangelnde Wirksamkeit, führt dies zu Anwendungseinschränkungen oder dem Rückzug von Wirkstoffen und Produkten.
–Pflanzenschutzmittel dürfen in der Landwirtschaft nur von Personen verwendet werden, welche entweder über eine Fachbewilligung verfügen oder vor Ort von einer Inhaberin oder einem Inhaber einer Fachbewilligung angeleitet worden sind oder angeleitet werden.

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 103
■ Pflanzenschutzmittelmenge tiefer als agrarökologisches Etappenziel
–Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gelten die Grundsätze der allgemeinen Sorgfaltspflicht. In bestimmten Fällen ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verboten. So dürfen in Hecken und Feldgehölzen sowie in einem Streifen von 3 m entlang von diesen keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden – ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen wie Ambrosia, sofern andere Massnahmen wie Mähen nicht zum Erfolg führen. Ebenfalls verboten ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in einem Streifen von 3 m entlang von Oberflächengewässern. Weiter ist im Fassungsbereich von Grund- und Quellwasserschutzzonen (Zone S1) die Anwendung jeglicher Pflanzenschutzmittel verboten. Für die engere Schutzzone (S2) bezeichnet das BLW die Wirkstoffe, die auf Grund ihrer Mobilität und Abbaubarkeit nicht eingesetzt werden dürfen.
–Für den ökologischen Leistungsnachweis sind verschiedene zusätzliche Bedingungen im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu erfüllen, so zu den eingesetzten Geräten (regelmässige Tests, Spülwassertank), zum Zeitpunkt des Einsatzes (Monate mit Einsatzverboten, Schadschwellen) und zu den eingesetzten Produkten. Entlang von Gewässern dürfen Pflanzenschutzmittel in einem 6 m breiten Pufferstreifen nicht eingesetzt werden.
–Bei der Gerätereinigung darf das Spülwasser nicht ins Abwasser abgeleitet werden. Hersteller und Händler müssen Pflanzenschutzmittel vom Verbraucher zurücknehmen und sachgemäss entsorgen.
–PSM-Rückstände in Lebensmitteln und Trinkwasser werden über Höchstwerte geregelt. Ebenso gibt es Anforderungen bezüglich Maximalgehalten in Fliessgewässern und im Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist. Überschreitungen dieser Werte können zu Anpassungen in der gesamten Kette von Massnahmen führen –von Einschränkungen bei der Anwendung bis hin zum Entzug der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels.
Für eine verbesserte Überprüfung möglicher Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mensch und Umwelt sind u.a. genauere Angaben zu ihrem Einsatz nötig. Das BLW entwickelt dafür im Rahmen des Agrarumweltmonitorings einen Indikator.
Im Rahmen der Botschaft zur Agrarpolitik 2007 hat der Bundesrat bis zum Jahr 2005 eine Reduktion der eingesetzten PSM-Mengen um 30% gegenüber 1990–92 als Ziel gesetzt. Als Datenbasis für die Untersuchung diente die von der Schweizerischen Gesellschaft für Chemische Industrie (SGCI) jährlich publizierte Statistik über die von ihren Mitgliederfirmen in der Schweiz und in Liechtenstein verkauften Mengen an PSM. Seit 1989 sind die verkauften Pflanzenschutzmittelwirkstoffe generell rückläufig. Während der Rückgang anfänglich rasch war, hat er sich in den letzten Jahren deutlich verlangsamt. Von damals rund 2’500 t PSM ist die Menge auf 1’359 t im Jahr 2006 zurückgegangen, womit das agrarökologische Ziel erreicht wurde.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 104
■ Überschreitungen der zulässigen Konzentrationen im Grundwasser
Die Reduktion der eingesetzten PSM-Mengen dürfte auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen sein, so etwa auf den breiteren Einsatz nach dem Prinzip der Schadschwellen, den Ersatz älterer Wirkstoffe durch solche mit deutlich geringeren Aufwandmengen, einen Rückgang der intensiv bewirtschafteten Ackerflächen und Dauerkulturen und eine Zunahme an Ackerflächen, welche unter Programmen für die extensive Produktion bewirtschaftet werden (Extenso-Getreide und -Raps).
Für den Gehalt an organischen Pestiziden im Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist, gilt eine Anforderung von max. 0,1 µg/l je Einzelstoff. Vorbehalten bleiben andere Werte auf Grund von Einzelstoffbeurteilungen im Rahmen des Zulassungsverfahrens.
In Einzugsgebieten mit Hauptbodennutzung «Ackerbau» wurde 2006 bei rund 20% der Messstellen mindestens eine Substanz mit einer maximalen Konzentration von über 0,1 µg/l nachgewiesen. Bei der Hauptbodennutzung «übrige ganzjährige Landwirtschaft» waren es 8% und bei Sömmerungsweiden 0%. Zum Vergleich: 2002/03 wiesen Messstellen in den Einzugsgebieten «Siedlung und Verkehrswege» ebenfalls in knapp 20% der Fälle Überschreitungen des Anforderungswertes auf.
Räumliche Verteilung der PSM-Konzentration1
1
kein PSM nachgewiesen oder <0,01 µg/Liter
PSM nachgewiesen, mindestens eine Substanz 0,01–0,1 µg/Liter
PSM nachgewiesen, mindestens eine Substanz >0,1 µg/Liter
Ackeranteil <5% 5–20% 20–40% >40%
Quelle: BAFU
Die meisten Überschreitungen des Wertes von 0,1 µg/l sind auf Atrazin und sein Abbauprodukt Desethylatrazin zurückzuführen. Atrazin wird nur langsam abgebaut. Ein Teil der positiven Atrazinbefunde kann deshalb vermutlich auf Rückstände aus einer früheren Anwendung zurückgeführt werden. Die Atrazin-Anwendung entlang von Eisenbahnlinien wurde Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts verboten. In der Landwirtschaft wurden zunächst Anwendungseinschränkungen vorgenommen (kein Einsatz in Karstgebieten und der Grundwasserschutzzone S2, restriktiver Einsatz ausserhalb der Schutzzonen), was zu einer Reduktion der Überschreitungen des zulässigen Wertes im Grundwasser führte. Auch im Baldegger- und Zürichsee, wo seit 1988,
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 105
Werte für 2006. Dargestellt sind NAQUA-Messstellen mit landwirtschaftlicher Hauptbodennutzung.
■ Fazit zu Pflanzenschutzmitteln:
und im Greifensee, wo seit 1990 Daten zur Verfügung stehen, sind Konzentrationsabnahmen seit den neunziger Jahren zu verzeichnen. Anfang 2007 wurde die Zulassung für Atrazin und Simazin zurückgezogen. Beide PSM dürfen noch bis Ende 2008 verkauft und die Restbestände drei Jahre darüber hinaus verwendet werden. Im Grundwasser werden diese schwer abbaubaren Stoffe noch mehrere Jahre nachgewiesen werden können.
Das Beispiel Atrazin zeigt, dass Möglichkeiten bestehen, um auf neu erkannte Probleme zu reagieren. Die Methodik von Risikobeurteilung und -management von Pflanzenschutzmitteln wird ständig weiterentwickelt. Dabei hat die Zulassungsbehörde die Aufgabe, ihre Strategien und Kriterien den neuesten Erkenntnissen anzupassen. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass die Wirkstoffe, mit denen Atrazin im Pflanzenschutz ersetzt wird, bald in hohen Konzentrationen im Grundwasser zu finden sind. Eine gezielte Überwachung von Pflanzenschutzmitteln im Wasser bleibt dennoch wichtig.
Vergleich der fünf Triazine im Grundwasser 2003–061
Atrazin 2003
2006
Atrazin-desethyl 2003
Atrazin-desethyl 2004
Atrazin-desethyl 2005
Atrazin-desethyl 2006
Atrazin-desisopropyl 2003
Atrazin-desisopropyl 2004
Atrazin-desisopropyl 2005
Atrazin-desisopropyl 2006
Simazin 2003
Simazin 2004
Simazin 2005
Simazin 2006
Terbuthylazin 2003
Terbuthylazin 2004
Terbuthylazin 2005
Terbuthylazin 2006
Anteil Messstellen mit mind. 1 Nachweis ≤0,1 µg/l
Anteil Messstellen mit mind. 1 Nachweis >0,1 µg/l
Quelle: BAFU 1 Konsistentes Datenset von 198 NAQUA-Messstellen in landwirtschaftlich dominiertem Einzugsgebiet
Das rein quantitative agrarökologische Ziel betreffend der Reduktion des PSMEinsatzes wurde erreicht. Den Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt durch PSM wird mit einem umfangreichen Zulassungsverfahren und praxisgerechten Anwendungsvorschriften Rechnung getragen. Darüber hinaus ist ein Monitoring im Aufbau begriffen, welches erlauben soll allfällige negative Auswirkungen rasch festzustellen und entsprechende Massnahmen einzuleiten.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 106
Atrazin
in % 0403060 1020 50
Atrazin 2004 Atrazin 2005
Beteiligung bei den Tierhaltungsprogrammen RAUS und BTS
Im Rahmen der Direktzahlungen an die Landwirte und Landwirtinnen fördert der Bund mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. Das RAUS-Programm enthält hauptsächlich Bestimmungen zum Auslauf auf der Weide oder im Laufhof bzw. beim Geflügel im Aussenklimabereich. Das BTS-Programm beinhaltet vor allem qualitative Vorgaben für die einzelnen Bereiche der geforderten Mehrbereichsställe, in denen sich die Tiere frei bewegen können. Die Teilnahme an einem solchen Programm ist freiwillig. Die im Folgenden genannten Prozentzahlen beziehen sich auf die Grundgesamtheit aller Direktzahlungsbetriebe bzw. aller dort gehaltenen Nutztiere.
Seit der Einführung von RAUS (1993) und BTS (1996) stieg die Teilnahme an beiden Programmen stetig: Im Jahr 2007 nahmen 38’800 Betriebe am RAUS-Programm und 18’500 Betriebe am BTS-Programm teil.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3.2Ethologie
Tabellen 38–39, Seiten A42–A43
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 107
der Beteiligung bei RAUS und BTS
Der prozentuale Anteil der nach den RAUS-Bedingungen gehaltenen Nutztiere stieg zwischen 1996 und 2007 von 19 auf 72%. Beim BTS-Programm nahm der Anteil in der gleichen Zeitspanne von 9 auf 42% zu. Diese Werte sind Durchschnittszahlen der vier Nutztiergruppen (Rindvieh, übrige Raufutter Verzehrer, Schweine und Geflügel).
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS, nach Nutztiergruppe
Wenn man die Beteiligung am RAUS-Programm nach Nutztiergruppen differenziert, stellt man beim Rindvieh und bei den übrigen Raufutterverzehrern zwischen 1996 und 2007 eine starke Zunahme von 20 auf 74 bzw. 82% fest. Bei den Schweinen stieg die Beteiligung von 5 auf 62%.
Entwicklung
GVE-Anteil in % RAUSBTS Quelle: BLW 1996199719981999 0 60 70 80 50 40 30 20 10 2001 2000 2002 200320042005 2006 2007
GVE-Anteil in % Quelle: BLW Rindvieh übrige Raufutter Verzehrer SchweineGeflügel 199619971998199920012002 2000 0 70 80 90 50 60 40 30 20 10 20032004 2005 2007 2006 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 108
Die Entwicklung der Beteiligung beim Nutzgeflügel setzt sich aus den unterschiedlichen Entwicklungen bei den Legehennen und bei den Mastpoulets zusammen. Währenddem die Beteiligung bei den Legehennen bis 2007 stetig zunahm (2007: 67%), endete der Anstieg bei den Mastpoulets 1999 bei 42%. Seither ist ein kontinuierlicher Rückgang auf 7% im Jahr 2007 festzustellen. Diese Entwicklung wurde durch die Einführung der minimalen Mastdauer von 56 Tagen bei den Poulets ausgelöst. Durch die im Vergleich zur konventionellen Produktion wesentlich längere Mastdauer stiegen die Produktionskosten und folglich auch der Preis am Markt erheblich. Entsprechend ging die Nachfrage nach RAUS-Poulets zurück.

Differenziert man die Beteiligung am BTS-Programm nach Nutztiergruppen, stellt man beim Rindvieh und bei den übrigen Raufutterverzehrern zwischen 1996 und 2007 eine im Vergleich zum RAUS-Programm wesentlich geringere Zunahme von 10 auf 37 bzw. 31% fest. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass die Investition in den meisten Fällen sehr hoch ist (Laufstall), so dass diese in der Regel erst bei einer notwendigen Ersatzinvestition getätigt wird.
Bei den Schweinen wurde das BTS-Programm erst 1997 eingeführt. Die Beteiligung verlief ähnlich wie beim entsprechenden RAUS-Programm. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die bedeutenden Labels bei den Schweinen sowohl RAUS als auch BTS voraussetzen.
Die rasante Entwicklung der BTS-Beteiligung beim Geflügel (2007: 84%) ist zu einem grossen Teil auf den Markterfolg der Labels zurückzuführen, die sich für die besonders tierfreundliche Stallhaltung von Legehennen und Mastgeflügel engagieren.
GVE-Anteil in % Quelle: BLW Rindvieh übrige Raufutter Verzehrer SchweineGeflügel 1996199719981999200120022003200420052007 2006 2000 0 80 90 50 60 70 40 30 20 10 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 109 1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Entwicklung der Beteiligung bei BTS, nach Nutztiergruppe
■ Ausgangslage
1.4Internationale Nahrungsmittelmärkte
Knappe Agrarrohstoffe: Kurzfristiges Phänomen oder langfristige Herausforderung?

2007 stiegen die Preise wichtiger Agrarrohstoffe wie Weizen, Ölsaaten und Milch stark an, in der ersten Hälfte 2008 zusätzlich jene von Mais und Reis. In der Zwischenzeit sind die Preise mit Ausnahme von Fleisch und Zucker wieder gesunken, liegen aber nach wie vor über dem Niveau vor der Hausse (zur Preisentwicklung im Einzelnen vgl. Kapitel 3.2 Internationale Vergleiche). Die Gründe für die Preissteigerungen sind vielfältig und in ihrem Zusammenwirken komplex. So haben das Bevölkerungswachstum, die steigende Kaufkraft und die Verknappung der fossilen Energie die Nachfrage nach Agrarrohstoffen ansteigen lassen, gleichzeitig haben die bis anhin tiefen Agrarpreise zu wenig Anreiz für die Ausweitung des Angebots geschaffen. Dazu kamen verstärkende Elemente wie die Dürre in Australien oder die Exportrestriktionen verschiedener Länder.
■ Auswirkungen
Höhere Preise für Agrarrohstoffe verteuern die Lebensmittel für die Konsumentinnen und Konsumenten. In den entwickelten Ländern schlägt die Erhöhung nicht eins zu eins auf die Konsumentenpreise durch, da der Anteil der Rohstoffe am Endprodukt im Laden im Durchschnitt nur ungefähr 20% beträgt. In der EU haben die zum Teil markant höheren Rohstoffpreise im Zeitraum April 2007 bis September 2008 im Durchschnitt zu einer Zunahme der Konsumentenpreise um 8,1% geführt. In der Schweiz waren es im selben Zeitraum 4,2%. Diese Differenz hat mit den unterschiedlichen Schutzniveaus für die Landwirtschaft in der EU und in der Schweiz zu tun. In der EU sind die Preise für Agrarrohstoffe fast ebenso stark gestiegen wie diejenigen auf dem Weltmarkt. In der Schweiz ermöglichen Massnahmen an der Grenze eine Abkoppelung vom Weltmarkt und damit Preise für die Agrarrohstoffe, die wesentlich über dem Weltmarktpreisniveau liegen. Grundsätzlich hatte dies bisher zur Folge, dass sich die Erhöhung der Weltmarktpreise weniger auf die Schweizer Produzentenpreise auswirkte.
1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1 110 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Nachfrage nach Agrarrohstoffen nahm in den letzten Jahren beschleunigt zu
In den Entwicklungsländern sind die Auswirkungen der Preissteigerungen bedeutend gravierender als in den Industrieländern. Besonders betroffen sind jene Länder, die Nettoimporteure von Nahrungsmitteln sind. Da die armen Bevölkerungsschichten einen grossen Teil ihres Haushaltsbudgets für Nahrungsmittelausgaben einsetzen müssen, sind starke Preissteigerungen für sie ein existenzielles Problem.
Nahrungsmittelpreissteigerung1 und Anteil Ausgaben für Nahrungsmittel
In den letzten 50 Jahren hat sich die Erdbevölkerung mehr als verdoppelt. Zusätzlich hat die Kaufkraft allein seit 1995 um 50% zugenommen. Damit einher ging eine kontinuierliche Steigerung der Nachfrage nach Agrarrohstoffen. In den letzten Jahren hat sich das Nachfragewachstum beschleunigt, weil vor allem bevölkerungsreiche Staaten im südostasiatischen Raum wirtschaftlich stark zugelegt haben. Damit kann sich heute eine wachsende Zahl von Menschen besser ernähren und insbesondere mehr Fleisch und Milchprodukte konsumieren. Dies wiederum hat zur Folge, dass mehr Futtermittel benötigt werden, da für eine tierische Kalorie 2 bis 8 pflanzliche Kalorien eingesetzt werden müssen. Heute werden rund 36% des gesamten Getreides den Tieren verfüttert. Als zusätzlicher Faktor ist in den letzten Jahren die Nachfrage nach Biomasse zur Energiegewinnung hinzugekommen. Im Jahr 2007 wurden auf ca. 20 Mio. Hektaren Pflanzen angebaut, die zu Ethanol als Benzinersatz oder Biodiesel verarbeitet wurden. Damit stehen die entsprechenden pflanzlichen Produkte (Weizen, Zucker, Speiseöl oder Mais) für die direkte menschliche oder tierische Ernährung nicht mehr zur Verfügung. Da die Abfallprodukte (z.B. Rapskuchen oder die Schlempe aus der Maisdestillation) in der Tierfütterung eingesetzt werden, bleibt ein Teil der Kalorien aus dem Anbau von Pflanzen für die Produktion von Biotreibstoffen aber indirekt für die menschliche Ernährung erhalten.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1 111
ChinaSüdafrikaÄgyptenHaitiIndienUSASchweiz in % in % Nahrungsmittelpreissteigerung Anteil für Nahrungsmittel an Haushaltsausgaben Quellen: OECD, FAO 1 Prozentuale Veränderung von Februar 2007 bis Februar 2008 0 60 50 40 30 20 10 0 60 50 40 30 20 10
Die Entwicklung von Angebot und Nachfrage beim Getreide zwischen 1999/00 und 2007/08 zeigt, dass die Produktion nur gerade 2004/05 über der Nachfrage lag. Die Lagerbestände gingen in diesem Zeitraum stark zurück und betrugen im Frühjahr 2007 nur noch 16% des jährlichen Verbrauchs. Reserven in dieser Höhe werden international als untere Schwelle erachtet, um eine problemlose Versorgung sicherstellen zu können. Entsprechend nervös reagieren die Märkte, wenn in Hauptanbaugebieten Produktionsausfälle zu verzeichnen sind. Dies war in der Ernteperiode 2007/08 dürrebedingt in Australien für Weizen der Fall. Da Australien bei Weizen einen Weltmarktanteil von rund 15% hat, reagierte der Preis sehr stark. In kurzer Frist verdoppelte er sich. Wieder einmal zeigte sich, wie unelastisch Angebot und Nachfrage im Agrarbereich sind. Die Schätzungen für Getreide (ohne Reis) für 2008/09 gehen erstmals wieder von einem leichten Angebotsüberhang aus, so dass die Lagerbestände leicht zunehmen werden.
Entwicklung von Angebot und Nachfrage sowie Lagerbestände bei Getreide (ohne Reis)
Beim Reis führte das Produktionsdefizit der Jahre 2001 bis 2005 zu einem deutlichen Abbau der Lagerbestände. Seither machen diese unter 20% des jährlichen Verbrauchs aus. Für 2008/09 wird davon ausgegangen, dass das Angebot die Nachfrage zu decken vermag. Die Lagerbestände bleiben damit voraussichtlich auf tiefem Niveau stabil.
1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1
112
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 1 in Mio. t in Mio. t LagerbestandProduktionVerbrauch Quelle: USDA 1 2008/09: Schätzung 1 400 1 800 1 700 1 600 1 500 0 500 400 300 200 100 441 416 399 336 272 329 312 265 269 287
■ Angebot blieb hinter Nachfrage zurück
Entwicklung von Angebot und Nachfrage sowie Lagerbestände bei Reis
Unter anderem aufgrund der tiefen Lagerbestände waren die Märkte für Weizen, Mais und Reis insbesondere in den ersten Monaten des Jahres 2008 durch eine im langjährigen Vergleich äusserst hohe Preisvolatilität gekennzeichnet.
Auch die Zunahme der Milchpreise ist auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen. Seit 2004 wurde weniger produziert als nachgefragt. Bis ins Frühjahr 2007 konnten die Lager bei Milchpulver und Butter diese Unterversorgung ausgleichen. Danach schlug das Ungleichgewicht voll auf den Preis durch.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1 113
1999/00 1998/99 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 1 in Mio. t in Mio. t LagerbestandProduktionVerbrauch Quelle: USDA 1 2008/09: Schätzung 0 500 400 300 200 100 0 200 150 100 50 60 143 146 137 110 86 78 77 77 75 80 Erdbevölkerung 20052020 Jahr 2050 in Mio. Szenario hoch Szenario mittel Szenario tief Quelle: UN population division 6 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 ■ Nachfrage nach Agrarrohstoffen wird weiter wachsen
Gemäss Schätzungen der FAO soll die Nachfrage nach Agrarrohstoffen bis 2030 um 50% und bis 2050 um bis zu 100% zunehmen. Ein wesentlicher Faktor dieser Nachfragesteigerung ist weiterhin das Wachstum der Erdbevölkerung von heute rund
6,6 Mrd. Menschen auf ungefähr 9,1 Mrd. Menschen im Jahr 2050 – dies entspricht dem mittleren Bevölkerungswachstumsszenario der UN-Behörden. Diese gehen von drei möglichen Szenarien (hoch, mittel, tief) aus, welche sich insbesondere bezüglich Fruchtbarkeitsannahmen unterscheiden, d.h. Anzahl Kinder pro Frau (hoch = 2,35; mittel = 1,85; tief = 1,35). Pro Jahr müssen heute rund 75 Millionen Menschen zusätzlich ernährt werden. Dies entspricht fast der Bevölkerung von Deutschland. Hinzu kommt, dass damit gerechnet wird, dass sich die Kaufkraft in bevölkerungsreichen Schwellenländern ebenfalls weiter erhöht und damit die Nachfrage nach tierischen Produkten überproportional zunimmt.
Die Nachfrage nach Agrarrohstoffen für die Energieproduktion und für industrielle Zwecke dürfte ebenfalls weiter zulegen. Bei den Biotreibstoffen rechnen die OECD und FAO für das Jahr 2017, unter der Annahme, dass die gegenwärtige Förderpolitik fortbesteht, mit beinahe einer Verdreifachung der Produktionsmenge. Beim Erdöl zeichnet sich ab, dass der Höhepunkt der Förderung mehr oder weniger erreicht ist. Damit verknappt sich die Leitenergie der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Denn der Güterund Individualverkehr ist zu einem hohen Prozentsatz abhängig von Diesel und Benzin und ein schneller und vollständiger Ersatz der erdölabhängigen Transportinfrastruktur ist kurz- und mittelfristig nicht in Sicht. Treibstoffe aus agrarischen Rohstoffen sind eine relativ rasch verfügbare Alternative ohne dass die ganze Infrastruktur umgebaut werden muss, wie dies z.B. bei einer auf Wasserstoff basierten Mobilität der Fall sein würde. Wie sich die Nachfrage effektiv entwickeln wird, ist schwierig vorauszusagen. Auf der einen Seite regt sich politischer Widerstand gegen einen unüberlegten Ausbau der Treibstoffproduktion aus Agrarrohstoffen, auf der anderen Seite wirken die heutigen politischen Rahmenbedingungen der USA und der EU mit der aktiven Förderung der Produktion von Ethanol und Biodiesel auf einen Ausbau hinaus. Auch die Marktkräfte ziehen in diese Richtung. Erdöl dürfte weiterhin knapp und somit teuer sein. Die Agrotreibstoffe bieten in diesem Umfeld eine attraktive Alternative.
Mit den hohen Preisen für Agrarrohstoffe stellt sich die Frage, ob auf Grund dieses Anreizes nicht einfach mehr produziert werden kann. Dabei gilt es zu beachten, dass das organische Pflanzenmaterial die Basis aller Nahrungsmittel ist und deren Produktion Boden (landwirtschaftliche Nutzfläche), Wasser, Nährstoffe und Licht benötigt. Im Jahreszyklus wandeln die Pflanzen mittels der Photosynthese die Ausgangsstoffe zu organischem Material resp. den für menschliche Zwecke brauchbaren Rohstoffen (z.B. Getreidekörner) um. Ein wesentliches Merkmal der Agrarproduktion ist die Gebundenheit an die jahreszeitlichen Rhythmen. Ist die Ernte schlecht, kann nicht sofort, sondern erst mit der Aussaat der nächsten Ernte darauf reagiert werden.
1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1
114
■ Natürliche Ressourcen sind nur begrenzt verfügbar
Verteilung der Landfläche 2005
Infrastruktur (Siedlungen, Verkehr) 2% (360 Mio. ha)
Unproduktive Fläche (z.B. Wüsten, Gebirge) 28% (4 093 Mio. ha)
Rest (z.B. Feuchtgebiete) 10% (1 500 Mio. ha)

Landwirtschaftliche Nutzfläche 33% (4 933 Mio. ha)
Wald 27% (3 952 Mio. ha)
Quelle: FAOSTAT
Das Festland der Erdoberfläche breitet sich auf rund 14,8 Mrd. ha aus. Davon wächst auf 9 Mrd. Hektaren Biomasse, der Rest ist Infrastrukturfläche oder unproduktive Fläche wie Eis oder Gebirge. Von den 9 Mrd. Hektaren sind 4 Mrd. Wald und 5 Mrd. Hektaren gelten als landwirtschaftlich genutzt. Für den Anbau von Acker- und Spezialkulturen werden gegen 1,6 Mrd. ha verwendet, die restlichen 3,4 Mrd. ha werden in unterschiedlicher Intensität als Grasland genutzt oder es handelt sich um Naturschutzflächen oder momentan brach liegende Flächen. Neueste Schätzungen gehen davon aus, dass sich deren Umfang zwischen 50 und 100 Mio. ha bewegt, meistens handelt es sich aber um ertragsschwächere Flächen.
Die Möglichkeiten auf der Erde Ackerbau zu betreiben sind beschränkt. Gemäss einer IIASA/FAO-Studie aus dem Jahr 2001 eignen sich höchstens rund 3,3 Mrd. ha für den Ackerbau. Davon sind fast 800 Mio. ha bewaldet und 600 Mio. ha sind nur bedingt für den Ackerbau nutzbar. Für die Ausdehnung der Produktion von Agrarrohstoffen stehen also nur noch beschränkt Flächen zur Verfügung. Die Konkurrenz um Flächen kann heute an verschiedenen Fronten bereits beobachtet werden. So wurde in den USA 2007 die Maisfläche (+6 Mio. ha) zu Lasten der Sojafläche (–5 Mio. ha) erhöht, 2008 die Weizenfläche (+2 Mio. ha) und die Sojafläche (+ 4 Mio. ha) ausgedehnt, dafür die Maisfläche –3 Mio. ha) wieder reduziert. Diese Anbauentscheidungen wurden auf Grund der relativen Preisverhältnisse getroffen. 2006 war der Maispreis im Verhältnis zu Soja und Weizen sehr gut, 2007 war es umgekehrt. Offensichtlich wird damit, dass es in den USA mit Ausnahme von Wald und geschützten Gebieten nur sehr begrenzt Flächenreserven für die Produktion von Agrarrohstoffen gibt. Die hohen Preise haben auch sofort auf die Bodenrente durchgeschlagen. So verzeichneten in den besten Gebieten der USA und Europa die Pachtpreise und die Preise für landwirtschaftlichen Boden einen starken Anstieg. Und schliesslich bemühen sich Länder wie Japan, Südkorea, China oder Staaten aus dem Nahen und mittleren Osten darum, in Drittländern Landwirtschaftsland zu kaufen oder zu pachten.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1 115
Neben dem Land ist Wasser für die Produktion von Agrarrohstoffen unverzichtbar. So benötigt die Produktion von 1 kg Weizen rund 1000 l Wasser und jene von 1 kg Rindfleisch bis 15'000 l. Eine fleischreiche Ernährung braucht deutlich mehr Wasser als eine vegetarische. Heute gehen rund 70% des weltweit genutzten Wassers in die Produktion von Agrarrohstoffen. Besonders kritisch ist Wasser in Gebieten mit wenig Niederschlag. Nach Schätzungen der UNO dürften bis im Jahr 2025 rund 1,8 Mrd. Menschen in Gebieten mit akutem Wassermangel leben. Eine nachhaltige Produktion ist vor allem dort gefährdet, wo mit Grundwasser intensiv bewässert wird und zu diesem Zweck mehr Wasser entnommen wird als während des Jahres wieder nachfliesst. Dies gilt heute z.B. für den Norden Chinas, die Punjab-Region Indiens oder für Gebiete im Nahen und mittleren Osten. So hat Saudiarabien angekündigt, die Weizenproduktion bis 2016 aufzugeben, weil es die Grundwasservorkommen für andere Zwecke verwenden will.
In den letzten 50 Jahren sind die Erträge sowohl beim Pflanzenbau als auch in der Tierproduktion stark angestiegen. Beim Pflanzenbau haben sich die Ertragszunahmen aber mit der Zeit teils abgeflacht. In Regionen, in denen bereits seit langer Zeit mit intensiver Bewirtschaftung hohe Erträge erwirtschaftet werden, kann teilweise gar ein Rückgang beobachtet werden. Insgesamt hat die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion dazu geführt, dass die durchschnittliche Kalorienzahl pro Bewohner trotz steigender Weltbevölkerung angestiegen ist und prozentual weniger Menschen ungenügend ernährt sind als noch vor dreissig Jahren. Die Steigerung der Flächenerträge kann aber auch negative Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen haben. So sinkt in vielen Anbaugebieten die Bodenfruchtbarkeit als Folge einseitiger Fruchtfolgen, gleichzeitig werden Wasser und Luft durch den Einsatz moderner Produktionsmittel belastet. Das Millennium Ecosystem Assessment stellt fest, dass in den letzten drei Jahrzehnten bei fast allen natürlichen Ressourcen Rückschritte zu verzeichnen waren. Damit einher geht eine verminderte Fähigkeit der Ökosysteme, grundlegende Funktionen der Regulation von stofflichen Kreisläufen zu gewährleisten.
1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1
116 Entwicklung der Erträge in kg/ha 0 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1962/66 1967/71 1972/76 1977/81 1982/86 1987/91 1992/96 1997/01 2002/06 Mais Reis Weizen Quelle: FAO Sojabohnen Sorghum ■
Nachhaltige Steigerung der Flächenerträge notwendig
■ Klimawandel und knappe Lagerbestände sorgen für volatile Agrarmärkte
Millennium Ecosystem Assessment (MEA)
Das MEA wurde im Jahr 2000 vom damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan lanciert und hatte zum Ziel, die Auswirkungen der Ökosystemveränderungen auf die Wohlfahrt der Menschheit zu analysieren sowie die wissenschaftlichen Grundlagen für die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme zu schaffen. Der Schlussbericht wurde im Jahr 2005 publiziert. Das MEA kam u.a. zu folgenden Schlüssen: Die Struktur und die Funktionsweise der Ökosysteme der Welt haben sich durch menschlichen Einfluss in den letzten 50 Jahren stärker verändert als je zuvor in der Menschheitsgeschichte: So wurde beispielsweise zwischen 1950 und 1980 mehr Land in Ackerland umgewandelt als zwischen 1700 und 1850. Seit 1950 sind 20% der Korallenriffe und 35% der Mangrovenwälder verloren gegangen. Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid hat seit 1750 um 32% zugenommen und die Biodiversität sinkt: So sind beispielsweise heute 10–30% aller Tierarten vom Aussterben bedroht.
Die Veränderungen der Ökosysteme haben wesentlich zur Wohlfahrtssteigerung und zum Wirtschaftswachstum beigetragen, allerdings zum Preis, dass die Natur ihre Funktionen (Ökosystemdienstleistungen) immer weniger wahrnehmen kann. Heute sind ca. 60% der im MEA evaluierten Ökosystemdienstleistungen degradiert oder sie werden unnachhaltig genutzt. Dazu gehören die Meerfischbestände und das Frischwasser, die beide übernutzt werden. Abgenommen hat beispielsweise auch die Wasserqualität und die natürliche Fähigkeit der Natur, auf Pflanzenkrankheiten zu reagieren. Gewisse Dienstleistungen haben andererseits zugenommen (z. B. die Nahrungsmittelproduktion), allerdings ist dies auf Kosten anderer Funktionen geschehen.
Für die Zukunft besteht folglich die Herausforderung darin, hohe Erträge mit nachhaltigen Methoden zu erzielen. Zu diesem Zweck sind Investitionen in Forschung, Bildung und Beratung unabdingbare Voraussetzung, ebenso Investitionen in Infrastrukturen in den bisher vernachlässigten ländlichen Gebieten.
Der Prozess der Photosynthese setzt den Ertragszuwächsen der einzelnen Pflanzen Grenzen und die Flächenerträge hängen von den natürlichen Voraussetzungen wie Bodenfruchtbarkeit, Wasserverfügbarkeit, Temperatur, Höhenlage, Saisondauer, Sonneneinstrahlungu.a.m. ab. Innerhalb einer Produktionsperiode ist ausserdem das Wetter entscheidend für Erfolg und Misserfolg. Dies unterscheidet die landwirtschaftliche von der industriellen Produktion.
In den letzten Jahren hat die Klimavariabilität zugenommen und in Zukunft dürfte sich die Situation noch verschärfen. Für die Produktion von Agrarrohstoffen ist das eine schlechte Nachricht, denn sowohl zu trockene als auch zu nasse Verhältnisse können die Produktion erheblich beeinträchtigen. In einer Situation wie heute mit tiefen Lagerbeständen schlagen sich schlechte Nachrichten bereits vor der Ernte in Preissteigerungen nieder. Beispiel dafür sind dieses Jahr die Überschwemmungen in Iowa, der Kornkammer der USA. Die Preise für Weizen, Mais und Soja haben sofort angezogen. Die Höhe der Preisausschläge ist abhängig vom vermuteten Produktionsausfall.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1 117
Die Ausschläge können sich, je mehr Gewissheit über den effektiven Ausfall besteht, entweder verstärken oder wieder in sich zusammenfallen.
Grüne Gentechnologie
Seit 12 Jahren werden gentechnisch veränderte Nutzpflanzen angebaut. 2007 gediehen in 23 Ländern vor allem gentechnisch veränderte Soja- und Maissorten (vorwiegend für Futtermittelzwecke) sowie Baumwollsorten auf einer Fläche von 114 Mio. ha, was ca. 9% der weltweiten Ackerfläche entspricht. Bezüglich Nutzen und Gefahren von Gentechpflanzen (Produktivität, Einkommenswirkung, Insektizid-, Herbizid- und Energieeinsatz, Resistenzbildung, Saatgutpreise und -sortenvielfalt etc.) gehen die Einschätzungen nach wie vor weit auseinander. Hauptanbauländer sind die USA, gefolgt von Argentinien, Brasilien und Kanada.
Im Zusammenhang mit der Rohstoffknappheit interessiert vor allem die Frage, ob die Gentechnologie zu einer Steigerung der Erträge resp. zu einer besseren Stresstoleranz (Wasser, Hitze etc.) beitragen kann. Bisher sind die Haupteigenschaften der angebauten Gentechsorten vor allem Insektenresistenz und Herbizidtoleranz. Sie tragen vor allem dazu bei, Arbeit und Produktionsmittel einzusparen. Interessant waren sie damit vorwiegend für den grossflächigen Anbau in guten Agrarregionen.
Entscheidend für die Welternährung ist, ob auch die Entwicklungsländer und dort insbesondere die kleinen Selbstversorger in Zukunft mehr vom Fortschritt bei der Gentechnologie profitieren können. Bisher bauen im Süden Kleinbauern vor allem insektenresistente Baumwolle (Bt Baumwolle) und nur wenige gentechnisch veränderte Grundnahrungsmittel an. Zur Zeit gibt es Erfahrungen mit insektenresistentem Mais (zum menschlichen Verzehr) in Südafrika, zudem befinden sich verschiedene Sorten im Stadium der Entwicklung. Am meisten Hoffnung wird auf Gentechreissorten gesetzt, die krankheitsresistent sind oder eine Vitamin A Quelle darstellen («Golden Rice»).
Die Weltbank nennt in ihrem World Development Report 2008 die wichtigsten Gründe, weshalb in den Entwicklungsländern die Fortschritte im Bereich der gentechnisch veränderten Pflanzen kleiner sind als in den Industrieländern: An erster Stelle nennt sie als Grund, dass die Forschung und Entwicklung vor allem auf die kommerziellen Bedürfnisse in den Industrieländern und weniger auf jene der Kleinbauern im Süden ausgerichtet sei. Die Weltbank schlägt aufgrund ihrer Analyse vor, die öffentliche GVO-Forschung auf nationaler und internationaler Stufe zu stärken und vermehrt auf die Bedürfnisse der Kleinbauern des Südens auszurichten («pro poor» Fokus). Zudem verlangt sie, dass mehr Geld in die Institutionen zu investieren sei, die neue Produkte evaluieren und zulassen. Das International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) fordert in seinen Schlussfolgerungen vom April 2008, dass die Forschungsprioritäten im Bereich GVO und ganz allgemein vermehrt im Rahmen von partizipativen Prozessen auf lokaler Ebene definiert und damit auf die Bewältigung lokaler Herausforderungen ausgerichtet werden. Damit soll auch sichergestellt werden, dass in Zukunft die Gentechnologie vermehrt zur Bewältigung der Nahrungsmittelknappheit und des Klimawandels beitragen kann.
1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1
118
Im Agricultural Outlook der OECD-FAO für das Jahr 2017 wird auf der Basis von Modellrechnungen davon ausgegangen, dass die Lagerbestände für Getreide auf dem aktuell tiefen Niveau bleiben. Damit hat die Grundkonstellation wie vor der Preishausse 2007 Bestand. Sie wird quasi zum Normalfall. Da die Nachfrage relativ unelastisch ist, muss deshalb für die Zukunft davon ausgegangen werden, dass Preissprünge, wie sie in letzter Zeit zu beobachten waren, jederzeit wieder eintreten können.
Damit dürfte auch die Spekulation attraktiv bleiben und politische Eingriffe, wie z.B. die Exportrestriktionen bei Reis in diesem Frühjahr, dürften die Volatilitäten an den Agrarmärkten hoch halten. Insgesamt sind Spekulation und politische Eingriffe aber nicht Auslöser der Preishausse sondern verstärken Entwicklungen, die auf Grund der Besonderheiten der Agrarmärkte (unelastische Nachfrage, natürliche Begrenztheit des Angebots, Wettereinflüsse) entstehen.
Spekulation
Im Zusammenhang mit steigenden Rohstoffpreisen wird international die Frage diskutiert, ob und wenn ja in welchem Ausmass die Spekulation an den Warenterminbörsen für die Preissteigerungen verantwortlich ist. Das Meinungsspektrum dazu ist äusserst breit. Verschiedene Institutionen haben angekündigt, der Frage vertieft nachzugehen (z. B. die EU-Kommission).
Der übliche Handelsweg für Rohstoffe ist der Weg über den Spotmarkt. Die Geschäfte werden ohne zeitliche Verzögerung durchgeführt und der physische Warenaustausch zwischen Verkäufer und Käufer findet tatsächlich statt.
Am Warenterminmarkt werden Kontrakte (Futures oder Warenterminkontrakte) auf zukünftige Termine gekauft und verkauft. Die Kontrakte sind standardisiert (Menge, Qualität, Zeitpunkt und Ort der Erfüllung) und können deshalb an der Warenterminbörse gehandelt werden. Zwischen Käufer und Verkäufer kommt es zum Abschluss eines Handels, wenn beide die gleichen Preisvorstellungen haben. Der Handel findet aber nicht direkt zwischen Käufer und Verkäufer sondern via eine Clearingstelle statt. Diese sucht jeweils die Marktteilnehmer, bei denen die Preisvorstellungen zusammentreffen und führt anschliessend Angebot und Nachfrage zusammen. Der eigentliche Handelspartner von Käufer und Verkäufer ist damit die Clearingstelle. Sie tritt gegenüber dem Käufer als Verkäufer und gegenüber dem Verkäufer als Käufer auf. In den meisten Fällen werden die Transaktionen bei Fälligkeit nicht physisch durchgeführt sondern durch ein Gegengeschäft an der Börse ausgeglichen («glatt stellen»: Wenn man ursprünglich einen Kontrakt gekauft hat, verkauft man einen über die gleiche Menge und umgekehrt).
Man unterscheidet drei Kategorien von Akteuren:
– Hedgers sind Marktteilnehmer, die am Spotmarkt physisch mit der Ware handeln (Landwirte, Händler, Verarbeiter) und ihre Positionen am Spotmarkt mit Futuresgeschäften absichern wollen.
Spekulanten nutzen Warenterminmärkte zur Kapitalanlage. Ihr Ziel ist das Erzielen von Gewinnen, indem sie auf steigende oder auf sinkende Kurse setzen. Damit übernehmen sie am Markt die Funktion der Risikoträger. Sie ermöglichen

1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1 119
–
so die Absicherung der Hedger und sorgen für genügend liquide Märkte. Sie reagieren unmittelbar auf neue Informationen und tragen damit dazu bei, dass die Terminpreise als Preisprognose verwendet werden können (sog. «price discovery»-Funktion der Terminmärkte).
Arbitrageure versuchen aus zeitlichen und räumlichen Preisdifferenzen mit einer Kombination von Geschäften am Spot- und am Terminmarkt einen risikolosen Gewinn zu erzielen.
Seit ca. 2003 ist zu beobachten, dass sich die Zusammensetzung der Marktakteure an den Rohstoffterminmärkten verändert. Institutionelle Anleger (z.B. Pensionskassen) haben damit begonnen, verstärkt an Warenterminmärkten in Rohstoffe zu investieren. Die massive Aufstockung ihres Engagements in diesen Märkten hat zwei Gründe:
–Abnahme der Attraktivität der traditionellen Anlagekategorien (Gründe: Schwache Aktienkurse 2000–02 resp. ab 2007 und die anziehende Inflation seit 2007 machen Geldanlagen auf Aktien- und Obligationenmärkten weniger attraktiv)
–Gute Gewinnaussichten an Rohstoffmärkten aufgrund des erwarteten längerfristigen Nachfrageüberhangs am physischen Markt.
Aufgrund der Erwartung, dass die Rohstoffpreise weiter steigen, treten die institutionellen Anleger an den Warenterminmärkten vor allem als Käufer von Futures auf Rohstoffindizes auf. Bei Rohstoffindizes handelt es sich um Indizes, welche die Preisentwicklung eines Korbs von Rohstoffen am Spotmarkt abbilden. Aufgrund dieser Fokussierung auf indexbasierte Produkte werden diese institutionellen Anleger auch Indexspekulanten genannt. 2003 waren gesamthaft ca. 13 Mrd. US$ in Rohstoffpreisindizes investiert, im März 2008 waren es bereits ca. 260 Mrd. US$.
International kontrovers geführt wird die Debatte, inwiefern die Zunahme des Handelsvolumens und das einseitige Setzen auf hohe Preise durch die institutionellen Anleger eine preistreibende Wirkung auf den physischen Rohstoffmärkten hat.
Klar scheinen zurzeit folgende Punkte:
–Der Zusammenhang zwischen der Preisveränderung an den realen Märkten und dem Volumen der an den Terminmärkten gehandelten Kontrakte ist statistisch nicht gesichert. So sind die Preise auch bei solchen Agrarrohstoffen stark angestiegen, für die es keinen Terminhandel gibt (z.B. Hartweizen) oder die nicht Teil von wichtigen Indizes sind (z. B. Minneapolis wheat futures).
–Terminmärkte funktionieren nur dank dem Engagement von Spekulanten. Nur dank ihrer Bereitschaft ein finanzielles Risiko einzugehen, können die Hedger, d.h. die Akteure an den physischen Märkten, ihre Preise absichern.
–Das Auftreten der Indexspekulanten als Käufer am Terminmarkt führt am Spotmarkt nicht zu einer physischen Verknappung des Angebots. Ihr Auftreten am Terminmarkt führt auch nicht zu einem Ungleichgewicht (Nachfrageüberhang), muss doch bei jedem abgeschlossenen Kontrakt einem Angebot eine
1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1
–
120
Nachfrage gegenüber stehen. Konkret bedeutet dies für jeden abgeschlossenen Kontrakt, dass einem Indexspekulanten, der auf steigende Preise setzt, immer ein anderer Spekulant oder ein Hedger gegenübersteht, der auf sinkende Preise setzt. Eine Analyse zeigt, dass im Frühling 2008 vor allem Index-Spekulanten auf weiter steigende Rohstoffpreise setzten, während vor allem Marktteilnehmer, welche nahe am physischen Markt agieren (Landwirte, Energieproduzenten, Nahrungsmittelindustrie etc.), auf fallende Preise setzten.
–Physische Märkte und Terminmärkte sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig: Informationen zu Angebot und Nachfrage an den physischen Märkten sowie die entsprechenden Aussichten beeinflussen die Preisentwicklung an den Terminmärkten. Die resultierenden Preise dienen umgekehrt als Grundlage für die Preisverhandlungen und damit für die kurzfristige Preisfindung an den physischen Märkten. Sie beeinflussen auch die realen Investitionsentscheide und damit die längerfristigen Preise an den physischen Märkten.

–Solange die marktfremden Akteure Preissteigerungen erwarten und gewillt sind, Kontrakte zu höheren Preisen zu kaufen, werden diese Preissteigerungen eintreffen – vorausgesetzt dass es genügend Verkäufer gibt, die auf die gegenteilige Entwicklung resp. eine Preisstagnation setzen. Preissteigerungen, genährt von Informationen, dass die Rohstoffe immer knapper werden, sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Allerdings kann die Balance leicht kippen, ausgelöst entweder durch realwirtschaftliche Entwicklungen (Abnahme der Rohstoffnachfrage z.B. infolge konjunktureller Abkühlung, Zunahme des Angebots aufgrund guter Ernten) oder Entwicklungen an den Finanzmärkten (z.B. bessere Aussichten an den Aktien- und Obligationenmärkten, so dass Gelder wieder vermehrt dort investiert werden). In der Folge könnten die Preise wieder sinken.
–Das Ausmass der Volatilität der Preise an den Terminmärkten hängt unter anderem davon ab, wie viel Geld innerhalb einer bestimmten Zeitspanne in diese Märkte verschoben resp. wieder abgezogen werden kann. Zur Zeit gelten in den USA für die nicht-kommerziellen Anleger (Pensionskassen etc.), welche via Rohstoffindizes und einen bestimmten Kanal (Swaps Traders) in diese Märkte investieren, keine Limiten bezüglich der Anzahl Kontrakte, die sie kaufen können. Deshalb ist in den letzten Jahren innert kurzer Zeit so viel Geld in diese Märkte geflossen. Nun wird aber darüber diskutiert, ob solche Limiten eingeführt werden sollen.
–Fundamental bestimmend für die Richtung und das Ausmass der Preisentwicklung an beiden Märkten bleiben die aktuelle Angebots- und Nachfragesituation an den physischen Märkten sowie die längerfristigen Erwartungen bezüglich Entwicklung von Angebot und Nachfrage.
1. BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1 121
■ Fazit
Die seit 2007 beobachteten Preissteigerungen bei verschiedenen Pflanzenbauprodukten und bei der Milch haben ihre Ursache in einem strukturellen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Dies hat zu einem kontinuierlichen Rückgang der Lagerbestände auf ein kritisches Niveau geführt. Da die Nachfrage relativ unelastisch ist, können in einer derartigen Situation erntebedingte Ausfälle grosse Preissprünge verursachen. Verstärkt wurden diese durch spekulative Anlagen oder durch politische Entscheide.
Für die nächsten 10 Jahre dürfte diese Grundkonstellation erhalten bleiben. Preissprünge sind jederzeit möglich. Ähnlich wie beim Erdöl muss davon ausgegangen werden, dass die Zeit der kostengünstigen Bereitstellung von Agrarrohstoffen vorbei ist. Die besten und kostengünstig zu bewirtschaftenden Böden sind in Produktion, teilweise werden sie heute sogar zu intensiv genutzt. Zusätzlich verteuern die steigenden Energie- und Rohstoffpreise die Vorleistungen der Landwirtschaft laufend. Die Preise dürften also trendmässig weiter steigen. Wie stark dieser Trend sein wird, ist schwierig vorauszusagen. Die FAO geht davon aus, dass die Höchststände im Frühjahr 2008 erreicht wurden. Gemäss ihren Prognosen werden sich die Preise für die nächsten 10 Jahren auf etwas tieferem Niveau stabilisieren. Dieser Prognose liegt allerdings ein Ölpreis von rund 100 Dollar im Jahr 2017 zu Grunde und blendet zudem die durch Klimavariabilitäten verursachten Ernteschwankungen aus. Sie könnte damit eher zu optimistisch sein.
122
1.4 INTERNATIONALE NAHRUNGSMITTELMÄRKTE 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. Agrarpolitische Massnahmen 2 123
Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln. Die finanziellen Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz nehmen laufend ab. Im Jahr 2007 wurden dafür 548 Mio. Fr. eingesetzt, über 1 Mrd. Fr. weniger als vor der Agrarreform in den Jahren 1990/92.
– Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab. Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht, weil dafür kein Markt besteht. Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher, dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden.
– Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte, sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion. Im Einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung, im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz.
124 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2
■ Finanzielle Mittel 2007
2.1 Produktion und Absatz
Artikel 7 LwG beschreibt die Zielsetzungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die Landwirtschaft soll nachhaltig und kostengünstig produzieren und aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen können. Hierfür stehen die Massnahmen in den Bereichen Qualität, Absatzförderung und Kennzeichnung, Ein- und Ausfuhr, Milchwirtschaft, Viehwirtschaft, Pflanzenbau und Weinwirtschaft zur Verfügung.

Im Jahr 2007 sind zur Förderung von Produktion und Absatz im ordentlichen Rahmen 548 Mio. Fr. aufgewendet worden. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 58 Mio. Fr. bzw. 9,6% weniger Ausgaben. Der für die Absatzförderung aufzuwendende Betrag liegt indessen wie bisher bei 54 Mio. Fr. und wird sich auch in den kommenden Jahren nicht verändern.
Ausgaben für Produktion und Absatz
Rechnung 2007Budget 2008
■ Ausblick
Quellen: Staatsrechnung, BLW
Die Umlagerung der Mittel von der Marktstützung zu den Direktzahlungen hat eine schrittweise Senkung des Zahlungsrahmens für die Produktion und den Absatz zur Folge. Mit der Agrarpolitik 2011 hat das Parlament entschieden diesen Prozess fortzusetzen.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Absatzförderung549,9559,9 Milchwirtschaft36666,835063,2 Viehwirtschaft193,4213,8 Pflanzenbau (inkl. Weinbau)10919,912823,1 Gesamt548100554100
AusgabenpostenBetragAnteilBetragAnteil Mio. Fr.%Mio. Fr.%
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 125 2
Tabellen 26–30, Seiten A27–A29
2.1.1 Übergreifende Massnahmen
Produzenten- und Branchenorganisationen
Im Rahmen der Landwirtschaftsgesetzgebung (Art. 8 und 9 LwG) kann der Bundesrat die von Branchen- und Produzentenorganisationen gemeinschaftlich beschlossenen Massnahmen zur Qualitätsverbesserung, Absatzförderung und Anpassung des Angebots an die Nachfrage auch für Nichtmitglieder verbindlich erklären. Man spricht in diesem Fall von der «Ausdehnung» gemeinschaftlicher Massnahmen. Damit werden Unternehmen, die von den Selbsthilfemassnahmen profitieren, ohne Mitglied der Organisation zu sein, zur Beteiligung verpflichtet und so dem Problem der «Trittbrettfahrer» entgegen gewirkt.
Im Rahmen der AP 2011 hiess das Parlament folgende Änderungen des Artikels 9 LwG gut:
–Zum einen wurde klargestellt, dass die Allgemeinverbindlichkeit der Selbsthilfemassnahmen auf Gesuch der Organisation hin und nach einer erneuten Prüfung verlängert werden kann. Damit wird die Kontinuität der Massnahmen sichergestellt; –zum anderen beschränkte das Parlament die Ausdehnung von Selbsthilfemassnahmen zur Anpassung der Produktion und des Angebots an die Markterfordernisse auf ausserordentliche, nicht strukturell bedingte Situationen. Gesuchsstellende Organisationen müssen in ihren Unterlagen eine solche Situation nachweisen können. Selbsthilfemassnahmen, welche eine dauernde Marktintervention zur Preisoder Mengenstabilisierung zum Gegenstand haben, können vom Bundesrat nicht mehr unterstützt werden.
Die Änderung des LwG hatte folgende Anpassungen der Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen auf den 1. Januar 2008 zur Folge:
Bisher wurden die Ausdehnungen jeweils für zwei Jahre beschlossen. Da das Parlament die Ausdehnung einer Selbsthilfemassnahme nicht a priori befristen wollte, besteht die Möglichkeit, Ausdehnungen für eine Dauer von mehr als zwei Jahren zu gewähren. Bei Absatzförderungs- und Qualitätsverbesserungsmassnahmen ist neu eine Ausdehnungsdauer von maximal vier Jahren vorgesehen. Im Falle von Massnahmen zur Angebotsbewirtschaftung in ausserordentlichen Situationen wird weiterhin die zweijährige Gültigkeit angewendet.
Die längere Ausdehnungsdauer bringt sowohl den betroffenen Organisationen als auch den Amtsstellen des Bundes eine administrative Vereinfachung. Die Organisationen, denen der Bundesrat eine Ausdehnung ihrer Selbsthilfemassnahmen gewährt hat, müssen dem EVD weiterhin einen jährlichen Bericht über die Durchführung und die Wirkung der Massnahmen liefern. Der Bundesrat kann die Ausdehnung jederzeit widerrufen, wenn eine Veränderung der Situation dies erfordert oder wenn Missstände festgestellt werden.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 126 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen
■ Im Jahr 2007 beschlossene Ausdehnungen
Im Jahr 2005 dehnte der Bundesrat im Falle von drei Produzentenorganisationen und vier Branchenorganisationen die von ihnen vereinbarten Massnahmen auf die Nichtmitglieder aus. Diese Ausdehnungen waren bis zum 31. Dezember 2007 befristet. Sechs dieser Organisationen (Interprofession du Gruyère, Schweizer Milchproduzenten, Schweizerischer Bauernverband, GalloSuisse, Emmentaler Switzerland, Interprofession du Vacherin Fribourgeois) haben dem Bundesrat die Erneuerung ihrer Ausdehnung beantragt. Wie gesetzlich vorgeschrieben, wurden die entsprechenden Gesuche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht, um Nichtmitgliedern der Organisationen im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Der Bundesrat hat im November 2007 allen sechs Erneuerungen zugestimmt.
Die Schweizer Rindviehproduzenten (SRP) stellten beim BLW ein Begehren um Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen zur Ausrottung der Bovinen Virus-Diarrhoe (BVD) auf Nichtmitglieder der Organisation. Die Massnahme bezweckt die Verpflichtung zur Mitfinanzierung des Ausrottungsprogramms. Im Sommer 2007 hat der Bundesrat dem Begehren zugestimmt. Die Pflicht zur Mitfinanzierung ist auf drei Jahre, von 2008 bis 2010, befristet.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 127 2
■ Die Schweizer Landwirtschaft will sich auf dem Markt behaupten
Absatzförderung
Mit der Liberalisierung der internationalen Märkte muss sich die Schweizer Landwirtschaft in einem zunehmend freien Markt behaupten. Dazu braucht es maximale Effizienz in der Absatzförderung. Im Gegensatz zu Ländern wie Deutschland oder Österreich, welche eine zentrale Marketingstelle für die Agrarwirtschaft kennen, sind es in der Schweiz die einzelnen Branchen, welche die Absatzförderung betreiben. Der Auftritt der Schweizer Landwirtschaft in Werbung und Kommunikation ist denn auch in diverse Kampagnen zergliedert, es besteht bisher keine gemeinsame Basiskampagne für Schweizer Agrarprodukte. Der Bezug zur Schweizer Herkunft wird je nach Branchenkampagne in sehr unterschiedlicher Intensität und Form hergestellt.
Die Schweizer Landwirtschaft muss ihre Kräfte auch in Kommunikation und Werbung bündeln, um sich auf den immer härter umkämpften Märkten behaupten zu können. Die Voraussetzungen für erfolgreiche Schweizer Produkte sind ausgezeichnet, die Marke Schweiz geniesst ganz allgemein einen hervorragenden Ruf. Die Schweizer Landwirtschaft kann auf das Vertrauen der Konsumenten zählen. Ihre Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, Sicherheit und die Nähe zwischen Feld und Teller aus.
■ «Schweiz. Natürlich.» vereinheitlicht Kommunikation
Das EVD hat im August 2007 mit «Schweiz. Natürlich.» ein gemeinsames Erscheinungsbild für alle vom Bund kofinanzierten Absatzförderungsmassnahmen der Landwirtschaft festgelegt. «Schweiz. Natürlich.» vereinheitlicht die Kommunikation für Schweizer Agrarprodukte. Dies war das Ergebnis eines partizipativen Prozesses, in dem die betroffenen Branchen und Verbände sowie unabhängige Kommunikationsfachleute mitgewirkt haben.
Die «Marke Schweiz» hat einen enormen Wert, der sich auf die grosse Bekanntheit und das hervorragende Image des Landes gründet. Damit liegt ein Trumpf bereit, den die Landwirtschaft für die Marktbearbeitung in In- und Ausland einsetzen kann. Während im Heimmarkt die Qualität (Mehrleistung gegenüber Importprodukten auch in Bezug auf Ökologie, Tierwohl und Produktesicherheit) und die Nähe die wichtigsten Parameter dieser Swissness darstellen, gilt es im Ausland von den positiven Werten der Marke Schweiz ganz generell zu profitieren. «Schweiz. Natürlich.» bringt die Werte der Marke Schweiz bei Agrarprodukten kurz und bündig auf den Punkt.
«Schweiz. Natürlich.» profitiert von der Kommunikation von Schweiz Tourismus («Schweiz. Ganz natürlich»). Auch inhaltlich besteht eine enge Verwandtschaft zwischen der Schweiz als Ferienland und den Schweizer Agrarprodukten: Viele Touristen lernen in der Schweiz unsere Produkte kennen, und können dann zu Hause z.B. mit Schweizer Käse noch einmal «ein Stück Schweiz» geniessen. In diesem Sinne ist «Schweiz. Natürlich.» auch ein Beitrag an die vom Parlament gewünschte bessere Koordination des Marktauftrittes der bundesnahen Förderinstrumente.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 128
■ «Schweiz. Natürlich.»: Gemeinsames Gestaltungselement
Neu ist das gemeinsame Gestaltungselement. Damit kann die Schweizer Landwirtschaft in der Kommunikation gemeinsam auftreten, ohne auf die spezifischen Garantie-, Leistungs- oder Absendermerkmale der verschiedenen Branchen und Produkte zu verzichten. Die Konsumentinnen und Konsumenten können sich daran orientieren, dass es einen Platz gibt für Garantiezeichen (G) wie die Knospe und einen Platz für den Absender (I) der Botschaft. Die rote Fläche mit «Schweiz. Natürlich» bringt Ordnung in die Vielfalt der Branchenauftritte. Ob Käse-TV-Spot oder KartoffelPlakat: die rote Fläche wird künftig noch besser auf die Herkunft unserer Agrarprodukte aufmerksam machen.
«Schweiz. Natürlich.»: Gemeinsames Gestaltungselement
IGSchweiz. Natürlich.
Mit «Schweiz. Natürlich.» wurde kein neues Label geschaffen, sondern ein Gestaltungselement. Damit können bestehende Garantiemarken wie Suisse Garantie, Knospe (Bioprodukte), Käfer (IP-Produkte) oder die privaten Marken der schweizerischen Vereinigung zum Schutz der GUB und GGA (geschützte Ursprungsbezeichnung und geschützte geografische Angabe) und individuelle Absenderkennzeichen der Branchen kombiniert werden.
«Schweiz. Natürlich.» schafft einen einheitlichen Absender in der Werbung für Schweizer Agrarprodukte. Noch fehlt aber eine einheitliche Herkunftskennzeichnung, die sich auch auf der Produktetikette, am Verkaufspunkt, wieder findet. Hier sind die Branchenverbände und der Handel weiterhin gefordert.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 129 2
■ Aktueller Stand des Registers der Ursprungsbezeichnungen
Qualitätspolitik und Kennzeichnung
Das Register der Ursprungsbezeichnungen (auch GUB/GGA-Register genannt) wurde 2007 um zwei neue Bezeichnungen erweitert. Am 16. August traf das BLW einen Einspracheentscheid betreffend das Eintragungsgesuch für Poire à Botzi als GUB. Gegen den Entscheid des Amtes, das alle Einsprachen zurückwies, wurde keine Beschwerde eingereicht, so dass die Bezeichnung «Poire à Botzi» in das Register eingetragen werden konnte. Am 15. Oktober fällte das Bundesgericht (BG) ein Urteil betreffend das Eintragungsgesuch für die Bezeichnung «Raclette» als GUB. Die Beschwerde, die eine Gruppierung im Anschluss an den Entscheid der Rekurskommission des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (REKO/EVD) an das BG richtete, wurde zurückgewiesen. Die REKO/EVD betrachtete es als unzulässig, die Bezeichnung «Raclette» auf Walliser Käseproduzenten zu beschränken. In seinem Urteil hält das BG fest, dass der Begriff «Raclette» im Ursprung zwar ein Walliser Gericht bezeichne, seine Verwendung als Käsename jedoch zu neu sei, als dass man von einer traditionellen Bezeichnung sprechen könne. Die Bezeichnung «Raclette» könne folglich nicht als GUB eingetragen werden. Die REKO/EVD entschied in ihrem Urteil vom 27. Juni 2006, dass die Bezeichnung «Walliser Raclette» ins Register aufgenommen wird. Mit diesen beiden Bezeichnungen beläuft sich die Zahl der Einträge im GUB/GGA-Register nun auf 23 (17 GUB und 6 GGA).
Am 16. Juli 2007 legte das BLW das Pflichtenheft von St. Galler Bratwurst als GGA öffentlich auf, worauf innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten eine Einsprache einging. Das Einspracheverfahren betreffend die Eintragung von Damassine als GUB ist beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Betreffend die Änderungsanträge bei den Pflichtenheften von Saucisson neuchâtelois und Saucisse neuchâteloise sowie Saucisson vaudois, Saucisse aux choux vaudoise, Berner Alpkäse und Vacherin Montd’Or wurden Entscheide gefällt.
Beim BLW ist ein neues Gesuch für die Eintragung von Bündner Alpkäse als GUB eingegangen und die Societá Ticinese di Economia Alpestre unterbreitete einen Änderungsantrag betreffend das Pflichtenheft von Formaggio d’alpe ticinese. Zurzeit werden die Eintragungsgesuche von Tomme vaudoise, Büscion da cavra, Jambon de la borne, Boutefas und Sauerkäse/Bloderkäse als GUB sowie von Absinthe, Langeole, Appenzeller Mostbröckli, Appenzeller Pantli und Appenzeller Siedwurst als GGA geprüft. Für die Behandlung des Eintragungsgesuchs von Bois du Jura als GUB fehlt aufgrund des Nichteintretens des Parlaments auf die Teilrevision des Waldgesetzes noch immer die gesetzliche Grundlage.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 130
GUB/GGA-Register am 31. Dezember 2007
AnzahlAnzahltt
Käse
L’Etivaz GUB721366393OIC
Emmentaler GUB4 77421633 79830 897OIC
Gruyère GUB3 65425628 88328 600OIC
Sbrinz GUB107301 6081 572Procert
Tête de Moine GUB 29182 0642 222OIC
Formaggio d’alpe ticineseGUB 44180285OIC
Vacherin fribourgeois GUB ----OIC
Vacherin Mont-d’Or1579543531OIC
Berner Alpkäse/HobelkäseGUB22388-1 430OIC
Raclette du Valais GUB ----OIC

Fleischwaren
Bündnerfleisch GGA169831 011Procert
Saucisse d’Ajoie GGA106260OIC
Viande séchée du Valais GGA21361435OIC
Saucisson neuchâtelois/ Saucisse neuchâteloise
GGA1762128OIC
Saucisson vaudois GGA466501 040OIC Procert
Saucisse aux choux GGA 41612752OIC vaudoiseProcert
Spirituosen
Eau-de-vie de poire GUB26819 OIC du Valais
AbricotineGUB122OIC
Andere Erzeugnisse
Rheintaler Ribel GUB 613336Procert
Cardon épineux genevoisGUB416357Procert
Pain de seigle du Valais GUB3969738753OIC
Munder Safran GUB 190,000520,002OIC
Poire à Botzi GUB----OIC
Quelle: BLW
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 131 2
Bezeichnung Schutz Landwirtschafts- betriebe Unternehmen (Verarbeitung/ Veredelung) Zertifizierte Produktionsmenge 2006 Zertifizierte Produktionsmenge 2007 Zertifizierungs- stellen 93 000 Liter 100%-iger Alkohol 93 547 Liter 100%-iger Alkohol 592 Liter 100%-iger Alkohol
■ Einfuhr: Änderungen bei den Rechtsgrundlagen und beim Vollzug
Instrumente des Aussenhandels
In den Marktordnungen Käse, Eier und Eiprodukte sowie Tiere der Pferdegattung wurde die Bewilligungspflicht im Rahmen des 1. Verordnungspakets zur AP 2011 anfangs 2008 aufgehoben. Die Zollkontingente dieser Marktordnungen werden nach dem Kriterium der Reihenfolge der Zollanmeldung (Windhund an der Grenze) verteilt. Bei Käse ist der Handel mit der EU liberalisiert, so dass nur noch das WTO-Kontingent für Fontalkäse zu verteilen ist. Eine besondere Situation besteht bei der Marktordnung Brotgetreide. Auch dieses Kontingent wird nach dem Windhundverfahren an der Grenze verteilt. Auf die Bewilligungspflicht kann jedoch wegen der Pflichtlagerhaltung nicht verzichtet werden. Bewilligungsstelle ist die réservesuisse. Wie bei den anderen erwähnten Marktordnungen ergibt sich für das BLW fast kein administrativer Aufwand mehr, weshalb die bisherige Verwaltungsgebühr nicht mehr erhoben wird. Wer sich über den Stand der Ausnützung von Zollkontingenten informieren will, die nach dem Windhundverfahren an der Grenze verteilt werden, kann die Homepage der Eidg. Zollverwaltung www.ezv.admin.ch unter Zollinformation Firmen > Zollkontingente konsultieren.
Im Hinblick auf die Vereinfachung der rechtlichen Grundlagen wurden die weiterhin geltenden Bestimmungen der Verordnung über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung (SR 916.322.1) und die Verordnung über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr von Getreide, Futtermitteln, Stroh und Waren, bei deren Verarbeitung Futtermittel anfallen (SR 916.112.211), in die Agrareinfuhrverordnung (AEV; SR 916.01) integriert und die bisherigen Verordnungen aufgehoben. Sobald in anderen Produktverordnungen wegen auslaufenden Regelungen nur noch Bestimmungen über die Einfuhr enthalten sind, sollen diese ebenfalls in die AEV aufgenommen werden. Im 2. Verordnungspaket zur AP 2011 ist deshalb die Aufhebung der Verordnung über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten, Speiseölen und Speisefetten sowie von Kaseinen und Kaseinaten (VEMSK; SR 916.355.1) und der Kartoffelverordnung (SR 916.113.11) vorgesehen.
Im Bereich frisches Gemüse und frische Früchte wurde mit der Zuteilung 2008 erstmals ermöglicht, prozentuale Zollkontingentsanteile (sog. Vergleichszahlen) über die gesicherte Internetverbindung AEV14online zur Ausnützung abzutreten. Gleichzeitig wurden die bisherigen Mindestmengen- und Rundungsregeln bei der Verteilung der Zollkontingentsteilmengen abgeschafft. Dadurch verkleinert sich der Verwaltungsaufwand und die missbräuchliche Generierung von Einfuhrrechten wird verhindert.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 132
Für Gemüse und Früchte wird ein 2-Phasensystem angewendet. Während der freien Phase können diese Waren in unbeschränkter Menge im Kontingent eingeführt werden. In der bewirtschafteten Phase sind beschränkte Freigaben von Zollkontingentsteilmengen zur Deckung des Bedarfs möglich. Der Übergang der beiden Phasen wird gewährleistet, indem die Warenvorräte zu Beginn der Bewirtschaftungsperiode limitiert sind. Mit dem Inkrafttreten des neuen Zollgesetzes am 1. Mai 2007 hat die Eidg. Zollverwaltung vom BLW den Vollzug dieser Vorratsregelung übernommen. Wer anzugebende Vorräte lagert, ist nun verpflichtet, eine spezielle Zollanmeldung über Internet einzureichen. Gleichzeitig kann die Übermenge mit AEV14online einem bereits freigegebenen Zollkontingentsanteil angerechnet werden, oder es ist die Differenz zwischen KZA und AKZA nachzuzahlen. Nach einer relativ aufwendigen Umsetzung zu Beginn ist das neue Verfahren vereinfacht worden. Die Phasenwechsel 2008 werden zeigen, wie es sich bewährt.
In der Marktordnung für Schnittblumen werden die Ausserkontingentszollansätze (AKZA) innerhalb von zehn Jahren auf das Niveau des Kontingentszollansatzes (KZA) abgebaut. Der erste Abbauschritt erfolgte per 1. Januar 2008. Mit dem Zollabbau verlieren die mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen zunehmend an Bedeutung, bis sich die Einfuhrregelung ganz erübrigt. Die aktuellen Verteilmethoden, insbesondere die Zuteilung der Zollkontingentsanteile aufgrund von mit Schweizer Produzenten abgeschlossenen und gemeldeten Kaufverträgen (Inlandleistung), werden vorerst beibehalten.

In der Marktordnung Schlachttiere und Fleisch wurden die Teilzollkontingente für Halalfleisch aufgrund des gestiegenen Bedarfs erhöht.
Einen detaillierten Überblick über die zolltarifarischen Massnahmen 2007 bietet der entsprechende Bericht des Bundesrates vom 16. Januar 2008, insbesondere die Veröffentlichung der Zuteilung und Ausnützung der Zollkontingente, die auf der BLWWebseite unter dem Thema Ein- und Ausfuhr zu finden ist.
Im 2. Verordnungspaket zur AP 2011 sind weitere Änderungen der Einfuhrregelungen enthalten. So soll gemäss Botschaft zur AP 2011 der Grenzschutz für Brotgetreide durch eine Flexibilisierung der Zollansätze und für Futtermittel durch die Senkung der Schwellenpreise weiter reduziert werden. Die Verteilmethoden für die Teilzollkontingente Butter und Milchpulver werden geändert. Schliesslich ist vorgesehen, die Beträge für Sicherstellungen bei Versteigerungen im Bereich Fleisch anders zu berechnen.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 133 2
Im Rahmen des bilateralen Agrarabkommens vereinbarten die EU und die Schweiz 1999 den schrittweisen Übergang zu einem freien Käsemarkt. Die Schweiz gewährte der EU während der Übergangszeit fünf präferenzielle Zollkontingente, in deren Rahmen Käse zum Nullzoll importiert werden durfte. Die Mengen wurden jedes Jahr gemäss Antrag des Vertragspartners erhöht. Die Schweiz versteigerte diese Zollkontingente. In den letzten Jahren vor dem Übergang zum Freihandel waren die ausgeschriebenen Mengen teilweise so hoch, dass die Mengen selbst bei wiederholter Ausschreibung nicht mehr voll nachgefragt wurden. Die Steigerungspreise sanken tendenziell – teilweise sogar bis zum Minimalangebot von einem Rappen pro kg. Per Juni 2007 fielen die mengenmässigen Beschränkungen ganz weg. Die EU ihrerseits verteilte die der Schweiz gewährten Nullzollkontingente mit dem so genannten Windhund an der Bewilligungsstelle. EU-Importeure reichten dafür während einer kurzen Frist bei einem Mitgliedstaat ein Gesuch für eine bestimmte Importmenge ein. Die Gesuche mit den Mengen der Mitgliedstaaten wurden bei der zuständigen Kommission in Brüssel zentral gesammelt. Übertraf die total beantragte Menge die Kontingentsmenge, wurden die Gesuche der Mitgliedstaaten gekürzt, die ihrerseits dann die Anträge der Importeure entsprechend kürzten. Für die zugeteilte Menge mussten die Importeure eine Kaution hinterlegen, die sie wieder zurückerstattet bekamen, wenn sie die zugeteilte Menge zu mindestens 95% ausgenützt hatten. Da die EU aus verfahrenstechnischen Gründen nicht in der Lage war, das Kautionssystem rechtzeitig per Juni 2007 abzuschaffen, sondern nur die Kautionsbeträge massiv reduzierte und die Fristen liberalisierte, hat die Schweiz ihrerseits erst per Anfang 2008 die Bewilligungspflicht und die Gebührenerhebung beim Käseimport abgeschafft. Seitdem läuft der Handel ohne Hindernisse; für den Export wird nur noch ein Ursprungszeugnis und der Nachweis benötigt, dass die Produkte aus einem für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr zugelassenen Fabrikationsbetrieb stammen. Die verbleibenden veterinärrechtlichen Kontrollen der EU sollen 2008 ebenfalls abgeschafft werden.
Die Entwicklung des Gesamthandels von Käse und Quark (Zolltarif 0406) zeigt, dass sich die Handelsmengen zwischen der EU und der Schweiz vor allem 2007 beim Schritt zum vollständigen Freihandel erhöhten, während in der Übergangszeit keine klaren Tendenzen festzustellen waren. Der Import aus anderen Ländern als der EU ist vernachlässigbar, der Export in diese Länder blieb konstant.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 134
■ Übergang zum Freihandel bei Käse und Vergemeinschaftung des Zollkontingents für Wurstwaren
Im Rahmen des Gemischten Ausschusses (GA) zum Agrarabkommen von 1999 vereinbarten die EU und die Schweiz 2007 eine erste grössere Revision des Abkommens. Dabei wurden auch die gegenseitigen Zollkonzessionen geändert und aufdatiert. Infolge der EU-Beitritte von Rumänien und Bulgarien wurden bisherige Zollpräferenzen für die beiden Länder in zusätzliche bilaterale Zollkontingente umgewandelt. Gleichzeitig wurden die bisher von der Schweiz bilateral an Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn gewährten Zollkontingente für Wurstwaren «vergemeinschaftet», also in ein ab 2008 für die ganze EU geltendes und gleichzeitig auf 3’715 t netto erhöhtes Nullzollkontingent umgewandelt. Dieses Nullzollkontingent versteigerte das BLW im Dezember 2007, und zwar erst nachdem die EU-Kommission am 27. November 2007 die «Verordnung (EG) Nr. 1399/2007 zur übergangsweisen Eröffnung und Verwaltung eines autonomen Einfuhrzollkontingents für Würste und bestimmte Fleischerzeugnisse mit Ursprung in der Schweiz» erlassen hatte. Das von der EU gewährte Zollkontingent beträgt 1’900 t pro Jahr. Aufgeteilt wird es in vier Quartalstranchen à 25%, wobei nicht beantragte Mengen von der Kommission auf die nächste Tranche übertragen werden können. Verteilt werden die Kontingentsmengen mit Einfuhrlizenzen, ähnlich wie oben beschrieben bei den früheren Käsekontingenten. Anträge an die Bewilligungsstellen der Mitgliedsstaaten auf Erteilung einer Einfuhrlizenz können in den ersten sieben Tagen des Monats gestellt werden, der dem jeweiligen Quartal (Teilperiode) vorausgeht. Zusammen mit den Anträgen ist eine Sicherheit von 20 EUR/100 kg Erzeugnisgewicht zu leisten. Weitere Bestimmungen betreffen die Mindest- und Maximalmengen pro Gesuch, den Nachweis von Import oder Export von mindestens 25 t der entsprechenden Waren in der Vergleichsperiode sowie das Veterinärrecht. Die Ausschöpfung des Kontingents wird nicht auf Internet publiziert. Auf Anfrage bei der zuständigen Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der EUKommission betrug die bewilligte Menge am 2. April 2008 lediglich 15 t für die ersten beiden Quartale. Das BLW stellt auf seiner Webseite unter dem Thema Ausfuhr weitere Informationen dazu und Listen der zuständigen Behörden in der EU bereit.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 135
in t Quelle: EZV Import EU Import andere Länder Export EUExport andere Länder 2001200220032004 0 40000 50000 30000 20000 10000 200520062007
Entwicklung Käsehandel 2001–07
Erstmals haben sowohl die Ein- als auch die Ausfuhren von Verarbeitungsprodukten die Grenze von 1 Mio. t überschritten. Im Vorjahresvergleich legten dabei die Ausfuhren um mehr als 8%, die Einfuhren um rund 2% zu. Das Wachstum der exportierten Verarbeitungsprodukte um 8% widerspiegelt die Dynamik der Schweizer Exportwirtschaft in der Berichtsperiode. Obschon die Ausfuhren in die EU mit relativ bescheidenen 4% wuchsen (gegenüber einer Zunahme um gut 34% der Ausfuhren nach ausserhalb der EU), bleibt die EU mit 81% aller Exporte mit Abstand der wichtigste Markt der exportorientierten Schweizer Nahrungsmittelindustrie.
Für den Ausgleich der Rohstoffpreisdifferenzen standen nach Abzug von 1% (Kreditsperre aufgrund von Sparmassnahmen) 79,2 Mio. Fr. zur Verfügung. Die stark angestiegenen Rohstoffpreise auf den Weltmärkten verringerte die Differenz zum Schweizer Preisniveau. Diese Tendenz hatte einen positiven Einfluss auf die Mittelausschöpfung.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 136
■ Ein- und Ausfuhren von Verarbeitungsprodukten
1000 t AusfuhrenEinfuhren Quellen: EZV, BLW 2004 0 1000 1200 800 600 400 200 2005 2007 2006
Mio. Fr. Quellen: EZV, BLW 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 180 115 1991/922004 115 2003 79,2 2007 90 2006 90 2005
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten
Entwicklung der Ausfuhrbeiträge für Verarbeitungsprodukte
2.1.2Milchwirtschaft
Die Entwicklung in der Milchwirtschaft erfuhr im Jahr 2007 sowohl auf dem Welt- als auch auf dem EU-Markt eine unerwartete Dynamik. Nach einer rund zehn Jahre andauernden Senkung zeichnete sich bei den Preisen eine Kehrtwende ab, deren Einfluss auch auf dem Schweizer Milchmarkt spürbar wurde. Ausschlaggebend für diese Tendenz ist einerseits die Zunahme der Weltbevölkerung und eine gesteigerte Nachfrage nach Milchprodukten in Asien und Südamerika. Andererseits führt die Stagnation des weltweiten Wachstums der Milchproduktion, veränderte Flächennutzungen sowie Trockenheiten in wichtigen Milchproduktionsregionen zu einem begrenzten Angebot am Rohstoff Milch. Gesamthaft überstieg deshalb die Nachfrage nach Milch und Milchprodukten deren Angebot auf dem Weltmarkt.
Die Marktentwicklung der schweizerischen Milchwirtschaft im Jahr 2007 war erfreulich. Die Milcheinlieferungen sowie die Exporte von Milch, Käse, Butter und Rahm haben im Berichtsjahr zugenommen. Die inländische Butterproduktion vermochte wie bereits im Vorjahr den Konsum nicht zu decken, weshalb die Butterimporte angestiegen sind.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 137 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Massnahmen 2007/08 für den Schweizer Milchmarkt
1Wegfall des Grenzschutzes aufgrund der vollständigen Liberalisierung des Käsehandels zwischen der Schweiz und der EU ab 1. Juni 2007
2 nur für bestimmte Verwendungszwecke
3 nur bei Importverzicht
4 nur für Ausfuhren in andere Länder als jene der EU und nach Käsesorte differenziert
5 wurden für Magermilchpulver aufgrund von ausserordentlichen Steigerungen der Weltmarktpreise auf den 1. September 2007 ausgesetzt
6 ausgenommen Konsummilch
■
Finanzielle Mittel 2007
Im Jahr 2007 standen für die Preisstützungen im Milchbereich 366 Mio. Fr. zur Verfügung, was gegenüber dem Vorjahr einer Abnahme von 76,8 Mio. Fr. (–17,3%) entspricht. Mit den Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage sind die Stützungsmassnahmen wie in den vorhergehenden Jahren schwerpunktmässig weiterhin auf den Käse ausgerichtet.
Inlandbeihilfen 16,1%
Ausfuhrbeihilfen 3,5% Zulagen
79,1%
138 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
ProduktKäseButterMagermilchMilchpulverKonsummilch Rahm Frischmilchprodukte Massnahme Grenzschutz ■ 1 ■■■■ Zulagen ■ Inlandbeihilfen ■ 2 ■ 2 ■ 3 Ausfuhrbeihilfen ■ 4 ■ 5 ■ 6
Quelle: BLW
Von den rund 366 Mio. Fr., die der Bund im Jahr 2007 zugunsten der Milchwirtschaft ausgegeben hat, beanspruchte der Käse 295,5 Mio. Fr. (80,7%). 28,9 Mio. Fr. (7,9%) wurden für Butter und 37 Mio. Fr. (10,1%) für Pulver und andere Milchprodukte eingesetzt. Die Administrationskosten beliefen sich auf 4,6 Mio. Fr. (1,3% des Milchbudgets). Mittelverteilung 2007
Total 366 Mio. Fr.
Administration 1,3%
Quelle: BLW
Tabelle 27, Seite A28
■ Statistische Kennzahlen
Milchkontingentierung und Milchdaten
Im Milchjahr 2006/07 vermarkteten 29'172 Produzenten Milch. Dies entspricht einer Verringerung der Anzahl Milchproduzenten um 8'910 oder 23,4% gegenüber dem Jahr 2000/01. Die durchschnittlichen Einlieferungen je Milchproduzent stiegen im Milchjahr 2006/07 gegenüber dem Vorjahr um rund 5% auf 106'904 kg. Die durchschnittliche Einlieferung je Milchkuh beträgt im Berichtsjahr 5'457 kg, was gegenüber dem Milchjahr 1995/96 einer Zunahme von 20% entspricht.
Die nicht endgültige Übertragung (Miete) als auch die endgültige Übertragung (Kauf) von Kontingenten verloren im Berichtsjahr stark an Bedeutung. 1'034 Milchproduzenten haben im Milchjahr 2006/07 Kontingent gekauft (–86,1% gegenüber dem Vorjahr) und 2'096 Milchproduzenten (–54,7%) haben Kontingent gemietet. Die Menge an gemieteten Kontingenten verringerte sich dementsprechend gegenüber dem Vorjahr um 47,5% auf 41,5 Mio. kg. Beim Kontingentskauf fällt der Rückgang mit 85,8% auf 27,3 Mio. kg noch deutlicher aus. Die insgesamt übertragene Menge erreichte somit im Milchjahr 2006/07 rund 69 Mio. kg oder 9,8% des Grundkontingents.
■ Vorzeitiger Ausstieg aus der Milchkontingentierung
Die schweizerische Milchwirtschaft wird zunehmend von internationalen Einflüssen geprägt, welche die Milchproduzenten und -verwerter vor die Herausforderung stellen, sich zugunsten ihrer Wettbewerbsfähigkeit den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Vor diesem Hintergrund hat das Parlament mit der Revision des LwG im Rahmen der AP 2007 die dreijährige Übergangsfrist bis zur Aufhebung der Milchkontingentierung am 1. Mai 2009 beschlossen. Die Produktionsbedingungen wurden damit so angepasst, dass die Milchproduzenten und -verwerter die entstehenden Chancen auf den Märkten besser wahrnehmen können. Hierfür wurde die Verantwortung für die Mengensteuerung und den Absatz den direkt betroffenen Marktakteuren übertragen.Am 1. Mai 2008 waren insgesamt 23’862 Produzenten mit einer Basismenge von 2,6 Mio. t aus der staatlichen Milchkontingentierung ausgestiegen.
■ Mehrmengen
Organisationen, die mit Ihren Produzenten auf den 1. Mai 2006, 1. Mai 2007 oder 1. Mai 2008 vorzeitig aus der Milchkontingentierung ausgestiegen sind (Ausstiegsorganisationen), können gemäss Artikel 12 und 20 der Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung (VAMK) mit der Zustimmung des BLW während einem Milchjahr eine zusätzliche Milchmenge (Mehrmenge) vermarkten. Die Zustimmung wird vom BLW nur dann erteilt, wenn eine Verdrängung von Mitkonkurrenten auf dem Inlandmarkt ausgeschlossen werden kann. Bewilligt werden aus diesem Grund vorwiegend Exportprojekte. Mehrmengen für Inlandprojekte werden dann bewilligt, wenn die hergestellten Produkte eine aussergewöhnliche Qualität der Milch erfordern oder einen innovativen Charakter vorweisen können. In jedem Fall muss der Bedarf für die Vermarktung einer zusätzlichen Menge ausgewiesen werden können.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 139 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
Im Milchjahr 2007/08 haben 30 Ausstiegsorganisationen die Möglichkeit der Beantragung von Mehrmengen genutzt.
Übersicht Mehrmengengesuche 2007/08
AnzahlMenge (Mio. kg)
Eingereichte Gesuche 136196
Von Produzentenorganisationen (PO)79126,5 Von Produzenten-Milchverwerterorganisationen (PMO)5769,5
Bewilligte Gesuche135195,9
Exportprojekte95148,5
Inlandprojekte4047,4
Im Vergleich zu 2006/07 hat sich die bewilligte Menge an Milch für Mehrmengenprojekte im Milchjahr 2007/08 mehr als verdoppelt. Diese Tendenz ist auf die günstige Marktlage mit der steigenden Nachfrage nach Milchprodukten zurückzuführen. Die flexibel ausgestaltete Regelung für einen vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung erlaubt den neu gegründeten Organisationen eine rasche Realisierung ihrer geplanten Mehrmengenprojekte. Die Möglichkeit des vorzeitigen Ausstiegs erwies sich auch im zweiten Übergangsjahr als wertvolle Vorbereitung auf die generelle Aufhebung der Milchkontingentierung auf den 1. Mai 2009.
Damit das BLW den Verlauf der bewilligten Mehrmengenprojekte beobachten und kontrollieren kann, rapportieren die Organisationen bzw. deren Verwerter quartalsweise die Export- und Verkaufszahlen der aus der Mehrmenge hergestellten Produkte. Dadurch wird sichergestellt, dass die Milch der bewilligten Mehrmenge projektkonform verarbeitet und vermarktet wird und zudem den inländischen Markt nicht belastet. Nach dem dritten Quartal des laufenden Milchjahres überprüft das BLW gemeinsam mit den verantwortlichen Organisationen und den jeweiligen Verwertern stichprobenartig und vor Ort, ob das Mehrmengenprojekt gemäss den Angaben aus dem Gesuch durchgeführt wird.
Bei der Kontrolle der Mehrmengenprojekte des Milchjahres 2006/07 stellte sich heraus, dass in einem Fall die Bedingungen zur Verwertung der Mehrmenge zum Teil nicht eingehalten wurden. Das BLW hat in diesem Fall interveniert und die notwendigen Verwaltungsmassnahmen ergriffen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 140
Quelle: BLW
Zu den bestehenden 34 Ausstiegsorganisationen haben für das letzte Übergangsjahr vor dem endgültigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung vier neue Organisationen ein Ausstiegsgesuch eingereicht. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Organisationen mit einem zugehörigen Milchverwerter. Die erforderliche Mindestmenge von 20 Mio. kg zu vermarktender Milch wird von den erwähnten Organisationen teilweise nicht erfüllt. Da die beteiligten Milchproduzenten und -verwerter jedoch eine regional wichtige Bedeutung bezüglich Wertschöpfung aus der Milchproduktion haben, konnten die Gesuche gestützt auf die Ausnahmebestimmung von Artikel 5 der VAMK dennoch bewilligt werden.
Neue Ausstiegsorganisationen per 1. Mai 2008
Für das Milchjahr 2008/09 haben sich weitere 2'885 Milchproduzenten dazu entschieden, aus der Kontingentierung auszusteigen und einer neuen oder bestehenden Ausstiegsorganisation beizutreten. Die Anzahl der ausgestiegenen Milchproduzenten erhöht sich damit von 23'862 auf 26'830, was einer Zunahme von rund 11% entspricht. Die Milchmenge, welche von den neu 38 Ausstiegsorganisationen geliefert wird, steigt auf rund 2,83 Mio. t an. Dies entspricht ungefähr 91% der gesamtschweizerischen Produktionsmenge von 3,11 Mio. t (ohne Zusatzkontingente und Mehrmengen).

2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 141
ProduzentenBasismenge (prov.) (Stand 7.4.2008) Produzenten-MilchverwerterOrganisation (PMO)Anzahlkg PMO Reutigen201 672 674 PMO SPTC Cremo42820 546 635 PMO Seiler282 459 604 PMO Gais564 943 275
■ Projekt Auswertung Milchdaten (AMD)
Das Projekt Auswertung Milchdaten (AMD) (ehemals Teilprojekt Auswertung) wurde im Juli 2006 gestartet. Mit diesem Projekt soll für sämtliche Milchdaten eine einheitliche und übersichtliche Auswertungsplattform entstehen, welche die aktuellen und künftigen Auswertungsbedürfnisse des BLW abdeckt und im Rahmen eines umfassenden Agrardatennetzes weiter ausgebaut werden kann. Im Rahmen der Bedürfnisklärung wurden die Bedürfnisse an diese neue Plattform bei interessierten Anwendern innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung erhoben und daraus ein erster Lösungsvorschlag erarbeitet. Ende Mai 2007 konnte die Phase Bedürfnisklärung abgeschlossen werden. Anfang Juni 2007 begannen die konzeptionellen Arbeiten. Diese wurden im Sommer 2008 beendet.
Gleichzeitig wurde die zukünftige kostenpflichtige Nutzung und Weitergabe von Milchdaten für privatrechtliche Zwecke definiert. Auf dieser Basis wurde ein Angebot für die privatrechtliche Nutzung von Milchdaten und die entsprechenden Gebühren erarbeitet und den externen Interessierten unterbreitet. Das Angebot sieht drei verschiedene Möglichkeiten für den Bezug von Milchdaten vor:
1.Einzelbetriebliche Milchdaten
Es können einzelbetriebliche Daten über die Milchproduktion wie die monatliche Einlieferung oder einzelbetriebliche Daten über die Milchverarbeitung wie die monatlichen Verarbeitungsmengen pro Produkt und pro Verwerter bezogen werden. Dies natürlich nur unter der Einhaltung des Datenschutzes (Einverständnis der betroffenen Personen für gewünschten Verwendungszweck muss vorhanden sein).
2.Standardauswertungen
Im Rahmen eines Monats- oder Jahresabos wird der Zugriff auf den geschützten Bereich der Auswertungsplattform mit der Möglichkeit, ein definiertes Set von Standardauswertungen auszuführen, erteilt.
3.Individuelle Auswertungen
Es können individuelle Auswertungen zu Milchproduktion und -verwertung auf der Basis der vorhandenen Milchdaten erstellt werden.
Auf der neuen Auswertungsplattform sollen nur wenige, vordefinierte Abfragen zur Verfügung gestellt werden. Mit Hilfe eines Auswertungswerkzeuges (sog. BI-Tool) können individuelle Abfragen vom Anwender selber erstellt werden. Im Rahmen der Konzeptphase wurde ein geeignetes Auswertungswerkzeug evaluiert.
Im Laufe der Projektarbeiten wurden mehrere Bereiche an Milchdaten – so genannte Informationsobjekte –eruiert, mit denen die Gesamtheit der Milchdaten umfassend dargestellt werden kann. Ein wichtiges Informationsobjekt sind die Marktdaten. Im Rahmen der Bedürfnisklärung des Projektes AMD hat sich gezeigt, dass bezüglich Marktdaten im BLW Bedürfnisse vorhanden sind, die mit heute verfügbaren Informationen über den Milchmarkt nicht abgedeckt werden können. Aus diesem Grund wurde eine Arbeitsgruppe aus Fachexperten beauftragt, Vorschläge für die Erschliessung von Marktdaten im Bereich Milch zu erarbeiten.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
142
Marktstützung mit Zulagen und Beihilfen
Im Rahmen der Agrarpolitik 2002 wurde der Abbau aller Preisstützungen im Milchbereich festgeschrieben. Der Bundesrat hat diesbezüglich Artikel 188 LwG, der den Artikeln betreffend Zulagen und Beihilfen im Milchbereich eine Gültigkeit von zehn Jahren zuschreibt, am 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt. Auf den 1. Januar 2009 werden somit die Beihilfen zur Marktstützung wegfallen. Im Gegensatz dazu wurde mit den Gesetzesänderungen durch die Agrarpolitik 2011 die Ausrichtung der Zulage für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage über den 1. Januar 2009 hinaus verlängert.
Im Sinne einer schrittweisen Umsetzung wurden die Ansätze der Beihilfen zur Förderung des Inlandabsatzes sowie diejenigen der Ausfuhrbeihilfen auf den 1. Januar 2007 um rund die Hälfte gesenkt. Aufgrund der positiven Entwicklung des Milchmarktes im Laufe des Jahres 2007 erfuhren die bestehenden Beihilfenansätze zur Förderung des Inlandabsatzes auf den 1. Januar 2008 erneut eine Senkung von jeweils rund 50%. Die Ansätze der Beihilfen für Käseausfuhren in andere Länder als jene der EU bewegen sich unverändert zwischen 40 und 70 Rp. je kg.
Bei den Massnahmen zur Stützung des Milchpreises wurde per 1. September 2007 die Aussetzung der Ausfuhrbeihilfe auf Magermilchpulver beschlossen. Ausgangslage für diesen Entscheid war die ausserordentliche Steigerung der Weltmarktpreise im Verlauf des Jahres 2007, wodurch erstmals für das Magermilchpulver im Ausland mehr als im Inland gelöst werden konnte.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
143
■ Änderungen bei den Stützungsbeiträgen für den Milchmarkt
■ Bergmilch-Projekt der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL)
Forschungsprojekte
Das Hauptziel des Bergmilch-Projektes bestand darin, Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Milchproduktion, -verarbeitung und -vermarktung im Schweizer Berggebiet zu entwickeln.
Gemeinsam und mit der Unterstützung der Schweizer Milchproduzenten (SMP), einer privaten Stiftung, der Schweizer Berghilfe, der Migros sowie verschiedenen kantonalen landwirtschaftlichen Beratungsstellen, dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) und dem BLW arbeitete die SHL Massnahmen für eine möglichst effiziente Wertschöpfung der Milch aus dem Schweizer Berggebiet aus. Das Projekt dauerte von 2003 bis 2007 und konzentrierte sich primär auf die Regionen Engadin, Rheinwald/ Andeer, das Luzerner Hinterland, das Obere Emmental und das St. Gallische Neckertal.
Aus den Ergebnissen der einzelnen Teil- und Subprojekte ergaben sich 11 zusammenfassende Handlungsempfehlungen, deren Umsetzung in den Projektregionen bereits begonnen hat. Die SHL wird sich auch in Zukunft für den Wissenstransfer in weitere Bergregionen einsetzen.
Die Empfehlungen beziehen sich unter anderem auf die Ausgestaltung und Umsetzung von langfristigen Betriebs- und Produktionsstrategien,auf eine optimale Verkaufspositionierung der qualitativ hochwertigen Produkte aus dem Berggebiet sowie auf Massnahmen zur Kostensenkung und zur Anwendung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten. Nicht zuletzt wird betont, dass es für die einzelnen Milchproduzenten und -verarbeiter langfristig unverzichtbar ist, sich auch auf regionaler Ebene für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Milchbranche zu engagieren.
Sämtliche Berichte zum Bergmilch-Projekt der SHL sind auf der entsprechenden Homepage abrufbar: http://bergmilch.shl.bfh.ch
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 144
2.1.3 Viehwirtschaft
Bund und Kantone müssen nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und unter Einbezug der Erfahrungen aus der Vergangenheit das Ausbreiten von Tierseuchen verhindern. Im Berichtsjahr wurden deshalb verschiedene Massnahmen verordnet, um die Erlösverluste, welche die Schweizer Viehwirtschaft infolge von Tierseuchen erleidet, zu reduzieren.
Der Bundesrat hat am 12. September 2007 beschlossen, die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) bei Tieren der Rindergattung in der Schweiz auszurotten. Diese Krankheit verursacht unter anderem Magen-Darm-Störungen, vermindert die Fruchtbarkeit, führt zu mehr Fehl- und Missgeburten und beeinträchtigt die Milch- und Mastleistung. Die viral bedingte Krankheit verursacht wirtschaftliche Einbussen von rund 9 Mio. Fr. pro Jahr für die Schweizer Landwirtschaft. Mit einem mehrstufigen Massnahmenplan wurden im Frühling 2008 alle Jungtiere, die im Sommer auf die Alp gehen, vorgängig getestet, um persistent infizierte Tiere (PI-Tiere) zu finden und zu eliminieren. Zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2008 werden alle bis dahin nicht getesteten Tiere der Rindergattung auf BVD untersucht. PI-Tiere müssen umgehend geschlachtet werden. Die Kosten für das mehrjährige BVD-Ausrottungsprogramm belaufen sich auf insgesamt rund 60 Mio. Fr. Von diesen Kosten werden die Rindviehhalter rund einen Drittel und die Kantone zwei Drittel tragen.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 145 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Massnahmen 2007
Ende Oktober 2007 trat in der Schweiz der erste Fall von Blauzungenkrankheit auf. Es handelt sich dabei um eine nicht direkt ansteckende, durch Mücken übertragene virale Infektionskrankheit beim Wiederkäuer. Die Krankheit kann zu erhöhter Körpertemperatur, Entzündungen an den Klauen, Apathie, vermehrtem Speicheln und Ablösungen von Schleimhäuten führen. Aufgrund der Erfahrungen in anderen mitteleuropäischen Staaten muss damit gerechnet werden, dass in der Schweiz im Jahr 2008 die Zahl der Ansteckungen von Blauzungenkrankheit erheblich zunehmen wird. Die potenziellen Einbussen der Viehproduzenten werden im schlimmsten Fall auf über 50 Mio. Fr. geschätzt. Der Bundesrat hat deshalb am 27. Februar 2008 im Hinblick auf eine nationale Impfkampagne gegen die Blauzungenkrankheit die Finanzierung des nötigen Impfstoffes durch den Bund beschlossen.
Um weitere Vogelgrippefälle in der Schweiz zu verhindern, galten im Winter 2007/08 vorbeugende Schutzmassnahmen in Gebieten rund um grössere Gewässer. Insbesondere mussten Hühner und Truten in einem geschützten Raum gefüttert und getränkt und getrennt von Wasservögeln gehalten werden. Ein generelles Freilandhalteverbot, wie in den zwei Wintern davor, war derweil nicht mehr in Kraft.
Auf den 1. Januar 2008 trat die neue Tierzuchtverordnung in Kraft. Die wichtigsten Änderungen sind die Erhöhung der Bundesbeiträge im Umfang der bisherigen Kantonsbeiträge als Folge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), die Anerkennung von Zuchtorganisationen für maximal zehn Jahre und die Einführung einer sogenannten Förderschwelle von 30'000 Fr. je Zuchtorganisation. Mit dieser Änderung erhalten anerkannte Zuchtorganisationen, deren züchterische Dienstleistungen weniger als 30'000 Fr. Fördermittel auslösen, ab 2009 keine finanzielle Unterstützung mehr. Davon ausgenommen sind Zuchtorganisationen von Schweizer Rassen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 146
Tier/ProduktRinderKälberSchweinePferdeSchafeZiegenGeflügelEier Massnahme Grenzschutz ■■■■■■■■ Marktabräumung ab öffentlichen Märkten ■■■ Einlagerungsaktionen ■■■ Verbilligungsaktionen ■■■ Aufschlagaktionen und Vermarktungsmassnahmen ■ Verwertungsbeiträge Schafwolle ■ Ausfuhrbeihilfen Zuchtund Nutzvieh ■■■■ Höchstbestände ■■■■ Tierverkehr-Datenbank ■■■■■ Infrastrukturbeiträge für öffentliche Märkte im Berggebiet ■■■ Tierzuchtförderung ■■■■■■
Quelle: BLW
Das wesentlichste Stützungselement für den inländischen Fleischmarkt ist der Grenzschutz mit Zöllen und Kontingenten. Sowohl für die Stützung des Fleisch- und Eiermarktes als auch zur Förderung des Zucht- und Nutzviehexports richtet das BLW zudem Beihilfen aus. Zur temporären Absatzsicherung müssen ausserdem Schlachtviehhändler überschüssige Tiere auf öffentlichen Märkten übernehmen. Aufgrund der guten Marktlage wurden für Fleisch und Eier weniger Beihilfen als geplant eingesetzt. Auf öffentlichen Märkten waren die Übernahmen von Tieren zudem sehr gering. Im Rahmen der periodischen Weiterentwicklung des bilateralen Abkommens erhielt die Schweiz von der EU auf den 1. Januar 2008 ein zollfreies Kontingent für 1'900 t Wurstwaren. Im Gegenzug hat die Schweiz vier bestehende Länderkontingente (Italien, Deutschland, Frankreich und Ungarn) von Wurstwaren zusammengefasst und um 800 t auf 3'715 t netto erhöht. Ferner können neu Wurstwaren aus allen EU-Ländern in diesem grösseren Importkontingent zollfrei eingeführt werden.
Für Massnahmen in der Viehwirtschaft, ohne die Ausgaben für die Tierverkehrskontrolle und für die Entsorgungsbeiträge von tierischen Nebenprodukten, waren im Berichtsjahr 42,6 Mio. Fr. budgetiert. Davon wurden 37,5 Mio. Fr. ausgegeben. Der Hauptgrund für die Minderausgaben war die gute Marktlage auf dem Rindfleisch- und Eiermarkt. Einzig Kalbfleisch musste temporär eingelagert werden und auf dem Eiermarkt war das saisonale Überangebot nach Ostern geringer als in den Vorjahren. Im Rahmen der Tierverkehrskontrolle wurden 8,9 Mio. Fr. zum Betrieb der Tierverkehr-Datenbank (TVD) ausgegeben, welche durch die Gebühreneinnahmen von 9,5 Mio. Fr. vollständig gedeckt wurden. Für die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte richtete das BLW 46 Mio. Fr. aus. Etwa ein Drittel dieses Betrages floss zu Rindviehhaltern und zwei Drittel an Schlachtbetriebe von Tieren der Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Ziegengattung.
Mittelverteilung 2007
Total 37,5 Mio. Fr.
Inlandbeihilfen Schlachtvieh und Fleisch und Infrastrukturbeiträge im Berggebiet 10%
Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh 15%
Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 5%
Leistungsvereinbarungen Proviande 18%
Verwertungsbeiträge Schafwolle 2%
Tierzucht 50%
Quelle: Staatsrechnung
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 147 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
■ Finanzielle Mittel 2007
Tabelle 28, Seite A28
■ Schlachtvieh und Fleisch: Leistungsvereinbarung
Gestützt auf Artikel 51 LwG hat das BLW seit dem 1. Januar 2000 verschiedene Aufgaben auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt der Genossenschaft Proviande übertragen. Auf den 1. Januar 2008 trat eine neue, vierjährige Leistungsvereinbarung mit Proviande in Kraft, nachdem die Aufgaben vorgängig öffentlich ausgeschrieben worden waren.
1.Neutrale Qualitätseinstufung
Die Qualität der geschlachteten Tiere muss in allen grossen Schlachtbetrieben von Proviande neutral eingestuft werden. Der Klassifizierungsdienst von Proviande hat bis zum Ende des Berichtsjahres in 34 Betrieben die Schlachtkörperqualität eingestuft. In 5 Betrieben wurden Tiere der Rindviehgattung und teils Tiere der Pferde-, Schaf- und Ziegengattung und in 3 Betrieben wurden ausschliesslich Tiere der Schweinegattung geschlachtet. 26 Betriebe schlachteten alle Tiergattungen. Insgesamt stuften Mitarbeiter von Proviande 89% aller geschlachteten Tiere der Schweinegattung, 88% aller Kälber, 87% aller Kühe, Muni, Rinder und Ochsen sowie 64% aller Tiere der Schafgattung ein. Im Bereich CH-TAX sanken die Beanstandungen im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf
6'060 Schlachtkörper der Rindvieh- und Schafgattung. Etwa bei einem Drittel dieser beanstandeten Schlachtkörper wurde die Qualitätseinstufung bei der Nachklassierung geändert. 72% der Beanstandungen wurden durch Lieferanten geltend gemacht und 28% durch Abnehmer.
Verteilung der Schlachtkörper auf die Fleischigkeitsklassen 2007
Quelle: Proviande C
Die Fleischigkeit und die Fettabdeckung von Tieren der Rindvieh-, Schaf-, Ziegen- und Pferdegattung werden optisch bestimmt. Es gelten fünf Fleischigkeitsklassen: C = sehr vollfleischig, H = vollfleischig, T = mittelfleischig, A = leerfleischig, X = sehr leerfleischig.Die Fettabdeckung wird ebenfalls in fünf Klassen unterteilt. Von den Kühen waren57% mittelfleischig bis sehr vollfleischig, was rund 1% mehr ist als im Vorjahr.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 148
in %
C H T A X KüheMuniKälber Fleischigkeitsklasse LämmerGitzi 0 70 50 60 40 30 20 10
= sehr vollfleischig H = vollfleischig T = mittelfleischig A = leerfleischig X = sehr leerfleischig
In der Kategorie Muni wurden beinahe 97% aller Tiere mittel-, voll- oder sehr vollfleischig eingestuft. Zwei Drittel der geschlachteten Kälber und die Hälfte der geschlachteten Lämmer wurden mittelfleischig beurteilt. Die Beobachtung über mehrere Jahre zeigt zwei Trends: die Zunahme der Fleischigkeit bei Kühen, Muni und Gitzi sowie eine stabile Fleischigkeit bei Kälbern und Lämmern. Der erste Trend ist die Folge eines stark steigenden Anteils von fleischigen Mutterkühen sowie einer verbesserten Munimast. Der zweite Trend deutet auf seit Jahren unveränderte Fütterungsmethoden und Mastleistungen hin.
2.Überwachung von öffentlichen Märkten und Organisation von Marktentlastungsmassnahmen
Öffentliche Schlachtvieh- und Schafmärkte wurden in 21 Kantonen durchgeführt. Lediglich die Kantone Basel-Stadt, Genf, Schaffhausen, Zürich und Zug organisierten keine Märkte.
Bäuerliche Organisationen und/oder kantonale Stellen organisierten für Tiere der Rindvieh- und Schafgattung während des ganzen Jahres öffentliche Märkte. Gegenüber 2006 stieg die Zahl der versteigerten Tiere der Schafgattung (3,3%) und der Kälber (12,2%) auf den öffentlichen Märkten. Hingegen wurden 4,9% weniger Grossvieh versteigert. Dieser Rückgang wird hauptsächlich durch die rückläufigen Schlachtungen von Kühen erklärt.
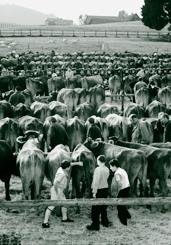
Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten 2007
MerkmalEinheitKälberGrossviehTiere der Schafgattung
Überwachte öffentliche MärkteAnzahl269779334
Aufgeführte, an den Versteigerungen
verkaufte TiereAnzahl35 53559 60476 688
Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen%141730
Zugeteilte Tiere
(Marktabräumung)Anzahl14147551
Quelle: Proviande Vor Beginn des Kalenderjahres erstellt Proviande in Übereinkunft mit den Kantonen und den bäuerlichen Organisationen ein Jahresmarktprogramm mit den bezeichneten öffentlichen Märkten. Dieses Programm nennt insbesondere die Marktplätze und -tage sowie die Tierkategorien, die aufgeführt werden können. Es muss durch das BLW gutgeheissen werden.
Im Rahmen temporärer Einlagerungen von 890 t Kalbfleisch zahlte das BLW 3,7 Mio. Fr. an Schlachtbetriebe aus. Einlagerungen oder Verbilligungen von Rindfleisch waren indessen aufgrund der guten Marktlage nicht nötig.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 149 2
■ Einfuhrbestimmungen Fleisch
Das BLW legt die Einfuhrmenge einer Fleischkategorie nach Beurteilung der Marktlage und nach Anhörung des Verwaltungsrates von Proviande für eine bestimmte Einfuhrperiode fest. Die Einfuhrperiode für Rindfleisch und Schweinefleisch in Hälften beträgt vier Wochen; die Periode für Fleisch von Tieren der Schaf-, Ziegen- und Pferdegattung sowie für Geflügel und Schlachtnebenprodukte beträgt ein Quartal. Bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen können die Einfuhrperioden auch verkürzt oder verlängert werden. Die Importkontingente für Wurstwaren, Fleischspezialitäten und Fleisch von rituell geschlachteten Tieren sind durch den Bundesrat in der Verordnung über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen festgelegt. Diese Kontingentsmengen sind mindestens für ein Jahr verankert. Im Jahre 2007 hat das BLW erstmals 100% der Importkontingente von Fleisch versteigert und damit die schrittweise Einführung der Versteigerung abgeschlossen. Als Ausnahme werden weiterhin 10% der Importkontingente von Fleisch von Tieren der Rindviehgattung (ohne Rindsbinden) und Fleisch von Tieren der Schafgattung nach einer Inlandleistung verteilt. Als Inlandleistung gilt die Zahl der ersteigerten Tiere auf überwachten öffentlichen Märkten.
■ Versteigerung der Importkontingente Fleisch
Die Zahl der bietenden Firmen bei allen Fleischkategorien nahm von insgesamt 170 (2005) auf 197 (2007) zu. Da ein Teilnehmer die Gebote vieler kleiner Firmen in einer «Bieter-Plattform» zusammenfasst und anschliessend als eine Firma Gebote einreicht, ist die effektive Teilnehmerzahl jedoch grösser. Der Anteil neuer Firmen, welche erstmals mit der Versteigerung Importkontingente von Fleisch erhielten, stieg von 28% (2005) auf 43% (2007). 57% der im Jahre 2007 teilnehmenden Firmen sind Importeure, die vor 2005 im Inlandleistungssystem Zollkontingentsanteile erhalten haben. Die Mehrheit dieser Firmen hat mit der Versteigerung die Geschäftstätigkeit auf zusätzliche Fleischsorten ausgeweitet. Die Teilnehmerzahl bei den 14 Fleischkategorien war sehr unterschiedlich. Sie hat für das gesamte Jahr eine Spanne von 22 Bietern für Gitzifleisch bis zu 103 Bietern für Nierstücke und High-Quality-Beef (Rindfleisch hoher Qualität).
Der Wettbewerb auf dem Markt für Importfleisch hat deutlich zugenommen. Die Bruttomargen Verarbeitung-Verteilung von Rind- und Schweinefleisch sinken deshalb seit 2005 kontinuierlich. Die Produzentenpreise sind mit Ausnahme von Schweinefleisch, wo das Inlandangebot seit 2005 markant gestiegen ist, nicht unter Druck geraten.
Die Preise des eingeführten Fleisches sind 2006 und 2007 gegenüber 2005 mehrheitlich nochmals gestiegen. Es bestehen daher keine Anzeichen, dass vermehrt billiges Fleisch eingeführt wurde.
Alle versteigerten Fleischimportkontingente für die Kontingentsperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 führten zu Einnahmen von 178,2 Mio. Fr. für die Bundeskasse. Geflügelfleisch, Nierstücke und High-Quality-Beef sowie Fleisch von Tieren der Schafgattung steuerten den Anteil von 79% bei. In seiner Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik vom 29. Mai 2002 schätzte der Bundesrat die zusätzlichen Einnahmen zu Gunsten der Bundeskasse für das Jahr 2007 auf 150 Mio. Fr. Die Wurstwaren und die Fleischspezialitäten, die seit 1999 zu 100% versteigert werden, wurden bei dieser Schätzung nicht berücksichtigt. Diese Produkte sorgten für Einnahmen im Berichtsjahr von 17,8 Mio. Fr.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 150
Ergebnisse der Versteigerungen 2007
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 151 2
Einheitkg bruttoAnzahlFr./kg brutto Geflügelfleisch43 200 000571,83 Schweinefleisch in Hälften5 725 000310,57 Fleisch von Tieren der Schafgattung5 490 000573,61 Fleisch von Tieren der Pferdegattung5 175 000210,75 Schlachtkörper von Verarbeitungskühen 4 365 000240,79 Nierstücke / High-Quality-Beef3 757 5007710,92 Kalbfleisch922 500373,96 Verarbeitungsfleisch von Kühen787 500272,38 Zungen495 00070,03 Fleisch von Tieren der Ziegengattung370 000221,01 Rindsbinden350 0002610,57 Ochsenmaul224 80060,03 Kalbslebern117 000110,12 Pistolas von Kühen45 000171,20 Rindfleisch (Koscher)267 00040,21 Rindfleisch (Halal)300 00030,31 Schaffleisch (Koscher)16 60030,22 Schaffleisch (Halal)150 00030,32 Luftgetrockneter Schinken aus der EU1 100 000817,69 Luftgetrocknetes Trockenfleisch aus der EU 220 000579,04 Dosen- und Kochschinken71 500257,09 Rindfleischkonserven770 000130,58 Wurstwaren aus Italien2 856 000732,07 Wurstwaren aus Frankreich125 000141,31 Wurstwaren aus Deutschland103 000182,40 Wurstwaren aus Ungarn64 000100,39 Quelle: BLW
ProduktVersteigerte DurchschnittlicheDurchschnittlicher MengeZahl der TeilnehmerZuschlagspreis je Ausschreibung
■ Strukturwandel in der Schlachtvieh- und Fleischbranche
Gemäss der Eidgenössischen Betriebszählung des BFS arbeiteten im Jahre 2005 insgesamt 21'461 Personen in 2'075 Betrieben, deren Haupttätigkeit das Schlachten, die Fleischverarbeitung, der Fleischgrosshandel oder der Fleischdetailhandel war. Im Vergleich zu 1995 nahm die Zahl der Beschäftigten um 9% und die Zahl der Betriebe um 26% ab. Innerhalb dieser Branche war der Rückgang der Metzgereien, deren Haupttätigkeit der Fleischdetailhandel ist, überdurchschnittlich. Im Jahre 1995 gab es 2'227 Metzgereien und 2005 lediglich noch 1'627 Metzgereien (–29%). Die Zahl der Beschäftigten sank im selben Zeitraum um einen Fünftel auf 8'441 Personen. Im Jahre 2005 war das Schlachten von Tieren für 104 Betriebe die Haupttätigkeit. Zehn Jahre früher war dies noch für 112 Betriebe der Fall. Gestiegen ist dabei die Zahl der Beschäftigten von 22 auf 48 pro Betrieb. Dies zeigt die erfolgte Verlagerung der Schlachtungen von Metzgereien zu spezialisierten Schlachtbetrieben, die immer grösser wurden. Von 1995 bis 2005 blieb die Zahl der Fleischverarbeitungsbetriebe stabil, hingegen wurden 22% weniger Personen in diesen Betrieben beschäftigt. Es ist der gegensätzliche Trend zur Schlachtbranche zu beobachten. Im Jahre 2005 arbeiteten nur noch 35 Personen pro Fleischverarbeitungsbetrieb (1995: 45 Personen). Diese Branche hat gezeigt, dass auch weiterhin kleinere Betriebe im Schweizer Markt existieren können, indem sie sich z.B. auf Spezialitäten fokussieren. Eine schrumpfende Branche ist der Grosshandel mit lebenden Tieren. Von 1995 bis 2005 ging die Betriebszahl von 314 auf 233 zurück, wobei gleichzeitig die Anzahl der im Grosshandel Beschäftigten um 6% zurückging.
■ Eier: Stützung der inländischen Produktion und Verwertungsmassnahmen
Besonders nach Ostern und während der Sommermonate ist die Nachfrage nach inländischen Eiern gering. Um die Auswirkungen dieser saisonalen Marktschwankungen zu mildern, stellte das BLW im Berichtsjahr nach Anhörung der interessierten Kreise einen Betrag von 2,815 Mio. Fr. für Verwertungsmassnahmen zur Verfügung. Die Eiprodukthersteller schlugen 7,4 Mio. inländische Konsumeier zur Marktentlastung auf. Sie erhielten pro nachweislich aufgeschlagenes Ei einen Beitrag von 9 Rp. Die Eierverkäufer verbilligten 10,3 Mio. Eier zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten und erhielten dafür 5 Rp. pro Ei. Insgesamt nahmen 14 Firmen an den Aufschlagsaktionen und 10 Firmen an den Verbilligungsaktionen teil. Das BLW überprüfte die Einhaltung der Bestimmungen mit Domizilkontrollen und Kontrollen von Nachweisdokumenten.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
152
■ Ein- und Ausfuhr von Zucht- und Nutztieren
Seit dem 1. Januar 2007 werden die Zollkontingentsanteile von Tieren der Pferdegattung nach der Reihenfolge der Annahme der Zollanmeldung (Windhundverfahren) zugeteilt. Der Wechsel von der Versteigerung zu diesem Verfahren führte zu einer administrativen Erleichterung der Pferdeeinfuhr. Das Zollkontingent von 3'322 Pferden wurde in der Folge beinahe vollständig ausgeschöpft. Ein weiterer Schritt wurde mit der Aufhebung der Bewilligungspflicht (Generaleinfuhrbewilligung) für die Pferdeeinfuhr auf den 1. Januar 2008 realisiert. Das Zollkontingent Tiere der Rindergattung von 1'200 Stück wurde in zwei Tranchen versteigert. Die durchschnittlichen Zuschlagspreise betrugen 537 Fr. respektive 359 Fr. pro Tier. Die Zollkontingentsanteile für Schweine, Schafe, Ziegen sowie für Samen von Stieren werden in der Reihenfolge des Eingangs der Gesuche beim BLW zugeteilt (Windhundverfahren). Als Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen dürfen ausschliesslich Tiere zur Zucht innerhalb des Zollkontingents eingeführt werden.
■ Tierverkehrskontrolle
Die Tierverkehr-Datenbank (TVD) wird im Auftrag des Bundes durch die Firma Identitas AG betrieben. Mehrere Projekte und Verbesserungen wurden im Berichtsjahr verwirklicht. Seit dem Release vom 12. Mai 2007 sind die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit der Tiergeschichte bei den Rindern strikter: Die zwei betroffenen Tierhaltungen müssen das gleiche Datum für eine Tierbewegung (Abgang sowie Zugang) angeben. Vorher wurde eine Abweichung von bis zu drei Tagen zwischen Abgang und Zugang eines Tieres akzeptiert. Gleichzeitig wurde ein SMS-Service eingerichtet, der die Tierhalter auf eventuelle Unvollständigkeiten in der Rückverfolgbarkeit ihrer Tiere aufmerksam macht und ihnen das Nachholen von Abgangsmeldungen vorschlägt. Mit dem Release vom 17. November 2007 wurde ein weiteres wichtiges Ziel realisiert: Das Betriebsregister vom Agrarinformationssystem AGIS wird für die TVD verwendet. Für die kantonalen Veterinär- und die Landwirtschaftsdienste hat dies einen beträchtlichen Aufwand bedeutet. Dank diesem Schritt konnten ab Frühling 2008 auch die Tierbewegungen zu und von Sömmerungsbetrieben erfasst werden. Die Verwendung von TVD-Daten für die Berechnung von rindviehbezogenen Direktzahlungen und die Einführung einer Tierverkehr-Datenbank Schweine sind weitere laufende Projekte.
Tierzucht
Der Bundesrat hat am 14. November 2007 eine neue Tierzuchtverordnung verabschiedet und auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt. Zwei Hauptgründe machten eine Totalrevision der Verordnung über die Tierzucht vom 7. Dezember 1998 nötig:
Die Eidgenössische Finanzkontrolle untersuchte im Jahre 2006 die Zuchtförderung und kam zum Schluss, dass die finanziellen Mittel in hohem Masse zweckdienlich und zielgerichtet eingesetzt wurden. Sie stellte aber auch ein Verbesserungspotenzial in den Bereichen der Anerkennung von Zuchtorganisationen und bei den ausgewählten Förderkriterien, die falsche Anreize setzen könnten, fest. Im Weiteren bemängelte sie die Kleinstsubventionen an sehr kleine Zuchtorganisationen, welche weder eine eigenständige noch eine effiziente Zuchttätigkeit sicherstellen können.
Mit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen NFA auf den 1. Januar 2008 hat der Bund die alleinige Zuchtförderung übernommen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2
153
■
Tabelle 29, Seite A29
Die wesentlichsten Änderungen im Bereich der Tierzucht sind die folgenden: Mit dem neuen Finanzausgleich werden die Bundesbeiträge zur Förderung der Tierzucht im Umfang der bisherigen Kantonsbeteiligungen erhöht. Die Kantone werden die auf das Bundesrecht abgestützten Massnahmen nicht mehr mitfinanzieren müssen. Für die einzelnen Tierkategorien (Rindvieh, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Milchschafe und Neuweltkameliden) wird je ein Höchstbetrag für tierzüchterische Massnahmen pro Jahr festgelegt. Die Förderbereiche sowie die Kriterien für die Anerkennung von Zuchtorganisationen werden präziser bestimmt. Die bisher unbefristete Anerkennung einer Zuchtorganisation wird in Anlehnung an das deutsche Tierzuchtrecht auf zehn Jahre befristet. Nach bisherigem Recht anerkannte Zuchtorganisationen behalten ihre Anerkennung bis Ende 2009. Sie müssen vor Ablauf dieses Termins beim BLW ein neues Gesuch stellen, damit die Erfüllung der Voraussetzungen zur Anerkennung als Zuchtorganisation überprüft werden kann. Jede anerkannte Zuchtorganisation erhielt bislang grundsätzlich Zuchtbeiträge von Bund und Kantonen. Dies führte teilweise zu Kleinstsubventionen, welche neu mit einer sogenannten Förderschwelle vermieden werden sollen. Ab 2009 sollen ausschliesslich Zuchtorganisationen finanziell gefördert werden, welche insgesamt Zuchtbeiträge von mindestens 30'000 Fr. pro Jahr erhalten. Dies setzt einen Mindestbestand an Zuchttieren voraus. Von der Förderschwelle ausgenommen sind Zuchtorganisationen von Schweizer Rassen. In der neuen Tierzuchtverordnung sind zudem zwei neue Tierkategorien eingefügt worden. Die Neuweltkameliden erhalten erstmals im Jahre 2008 Beiträge für Herdebuchtiere im Umfang von maximal 50'000 Fr. pro Jahr. Die Honigbienen wurden als Tierkategorie aufgenommen, damit Beiträge für die Erhaltung der dunklen Biene als Schweizer Rasse ausgerichtet werden können. Als Folge der Motion Gadient (04.3733) wurden in einer vom BLW eingesetzten Arbeitsgruppe verschiedene Optionen zur Förderung der Bienenhaltung geprüft. Ein diesbezüglicher Bericht wurde im Sommer 2008 ausgearbeitet und publiziert. Aufgrund der Ergebnisse könnte gegebenenfalls die Förderung der Bienenzucht in der Tierzuchtverordnung neu aufgenommen werden.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
154
Massnahmen 2007
Im Bereich Pflanzenbau wurde im Berichtsjahr keine grundlegende Änderung am Massnahmenkatalog zur Stützung der Inlandproduktion vorgenommen. Der Grenzschutz gilt weiterhin als zentrales Instrument, obwohl er im Futtermittelbereich in Folge steigender Weltmarktpreise und Anwendung des Schwellenpreissystems stark reduziert wurde. Der Beitrag für die Verarbeitung von Zuckerrüben wurde wie angekündigt gekürzt.
1Je nach Verwendungszweck bzw. Zolltarifposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung.
2Betrifft nur Teile der Erntemenge (Frischverfütterung und Trocknung von Kartoffeln, Marktreserven Kernobstsaftkonzentrate)

3Kartoffeln: nur für Kartoffelprodukte zu Speisezwecken / Saatgut: nur für Saatkartoffeln / Obst: nur für verarbeitete Konservenkirschen und diverse Kernobstprodukte
4Betrifft nur bestimmte Kulturen
Quelle: BLW
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1.4Pflanzenbau
Massnahme Grenzschutz 1 ■■■■■■■■ Verarbeitungsbeiträge ■■ 2 ■■ 2 ■ 2 Anbaubeiträge ■■■ Ausfuhrbeiträge 3 ■■■ Beiträge
Pflanzung
■■
für Umstellung und
innovativer Kulturen 4
Kultur Getreide Körnerleguminosen Ölsaaten Kartoffeln Zuckerrüben Saatgut Gemüse, Schnittblumen, Weinbau Obst 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 155 2
■ Finanzielle Mittel
Die für den Pflanzenbau ausgerichteten Marktstützungen nahmen gegenüber dem Vorjahr von 112 auf 109 Mio. Fr. ab. Der Stützungsbedarf für die Ausfuhr von Obstprodukten fiel geringer aus. Obwohl die Exportbeiträge für Kartoffeln im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant blieben, bewirkte die Veränderung im Obstbereich gesamthaft eine Halbierung der Exportbeiträge. Der finanzielle Aufwand für Verarbeitungsund Verwertungsbeiträge sowie Anbaubeiträge hat sich nur wenig verändert.

Mittelverteilung 2007
Total 109 Mio. Fr. Exportbeiträge 4% Diverses 2%
Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 50%
Anbaubeiträge 44%
Quelle: Staatsrechnung
Insgesamt stiegen die für die Ackerkulturen aufgewendeten Mittel im Vorjahresvergleich um 2,6 Mio. Fr. Der erneut gekürzte Beitrag für die Verarbeitung der Zuckerrüben teilte sich wie bis anhin auf die zwei letzten Ernten (2006, 2007) auf. Für die Verarbeitung der Ernte 2006 wurden noch 7,7 Mio. Fr. aufgewendet, während für die Ernte 2007 bereits 14,8 Mio. Fr. ausbezahlt wurden. Der Anstieg des finanziellen Aufwands für Kartoffeln lässt sich durch eine vorgezogene Zahlung (im Dezember 2007 anstatt Januar 2008) des Beitrags für das erste Semester 2008 erklären. Diese Mehrausgabe im Jahr 2007 wird durch den Wegfall der ersten Auszahlung 2008 kompensiert. Die Ausgabenerhöhung bei den Ölsaaten ist auf eine Flächenausdehnung zurückzuführen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 156
Tabelle 30, Seite A29
Mittelverteilung nach Kulturen
Zuckerrüben 1
Kartoffeln
Körnerleguminosen
Ölsaaten (inkl. NWR)
Nachwachsende Rohstoffe (ohne Ölsaaten)
Saatgutproduktion Obst
Mio. Fr.
0253050 5 10 1520354045 Weinbau
2005 2006 2007
Ausgaben für die Obstverwertung 2007
Total 6,0 Mio. Fr.
Quelle: Staatsrechnung
Verwertung von Äpfel und Birnen im Inland 24%
Marktanpassungsmassnahmen bei Obst und Gemüse (Umstellung Obst) 7%
Export Kirschen 3%
Export andere Kernobstprodukte 5%
Export von Birnensaftkonzentrat 53%
Export von Apfelsaftkonzentrat 6% Anderes 2%
Quelle: BLW
Die Ausgaben für die Obstverwertung betrugen insgesamt 6 Mio. Fr. Da die beiden Vorjahresernten klein waren, gelangten nur kleine Mengen an Apfel- und Birnensaftkonzentrat in den Export. Dadurch konnte das Exportbudget um 9,4 Mio. Fr. unterschritten werden.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 157 2
1 2006: 11,3 Mio. Fr. für Ernte 2005 und 18,3 Mio. Fr. für Ernte 2006; 2007: 7,7 Mio. Fr. für Ernte 2006 und 14,8 Mio. Fr. für Ernte 2007
Ackerkulturen
Am 1. Juli 2007 traten die vom Bundesrat beschlossenen durchschnittlich um Fr. 3.–/ 100 kg reduzierten Schwellenpreise für Futtermittel in Kraft. Der Schwellenpreis von Gerste wurde neu auf Fr. 40.–/100 kg und derjenige von Soja auf Fr. 47.–/100 kg festgesetzt. Ausserdem wurde per 1. Juli 2007 die Grenzbelastung von Brotgetreide innerhalb des Zollkontingents von Fr. 30.–auf Fr. 27.–/100 kg gesenkt (Kontingentszollansatz KZA von Fr. 26.30 auf Fr. 23.30/100 kg; Garantiefondsbeitrag unverändert bei Fr. 3.70/100 kg).
Zwischen 2003 und 2006 bewegte sich die verwendbare Produktion von Brotweizen in der Schweiz um 400'000 t pro Jahr. Der Produzentenpreis stieg zwischen 2002 und 2003 noch um ca. Fr. 5.–/100 kg an. Danach sank er bis 2006 um Fr. 10.– auf ca. Fr. 53.–/100 kg. Infolge der geringen Inlandernte und der angestiegenen Weltmarktpreise stieg auch der Produzentenpreis im Jahr 2007 an.
Im Bereich Getreide zur menschlichen Ernährung wurde bislang das Zollkontingentssystem mit fixen Zollansätzen angewandt. Fixe Zollansätze übertragen die Veränderungen der Weltmarktpreise eins zu eins auf die verzollten Importpreise. Im Futtermittelbereich werden die Preisbewegungen am Weltmarkt durch das Schwellenpreissystem geglättet, bis die Importpreise die Schwellenpreise bzw. Importrichtwerte erreichen und die Zollansätze dadurch auf Null sinken.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 158
■ Einfuhrsystem für Brotund Futtergetreide Brotweizen Produktion und Preise 200220032004200620052007 1000 t Fr./dt Quellen: BLW, ART, swiss granum 0 700 600 500 400 300 200 100 0 70 60 50 40 30 20 10 Deklassierte Mengen (dt/ha) Verwendbare Produktion (CH) Produzentenpreis
■ Weltmarktpreise für Getreide schnellten 2007 in die Höhe
Fr./100 kg
Fixzoll und Schwellenpreissystem im Vergleich
Importpreis bei Fixzoll (Brotweizen)
Importpreis bei Schwellenpreissystem (Futterweizen)
Importrichtwert
Preis franko Grenze
Quelle: BLW
Mitte 2007 begannen die Getreidepreise an den internationalen Märkten in einem kaum voraussehbaren Mass anzusteigen. Im Bereich Futtermittel konnte die Preisentwicklung anfangs mit dem Schwellenpreissystem aufgefangen werden. Seit Herbst 2007 konnten jedoch für verschiedene Getreidearten zu Futterzwecken keine Grenzbelastungen mehr erhoben werden. Die Preise für Importe wie auch für inländische Ware stiegen dadurch über die Schwellenpreise hinaus. Die fixen Zollansätze im Bereich Brotgetreide verteuerten die importierten Rohstoffe über das angestrebte Agrarschutzniveau hinaus.
Börsennotierungen von Mahlweizen (MATIF, Paris) (1.1.2007 bis 20.6.2008)
Kontrakt Mai 08
Kontrakt August 08 (neue Ernte)
Kontrakt November 08
Januar 09
Reuters
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 159
42 Zeit Fixzoll Flexibler Zoll
Euro je Tonne Quelle:
Kontrakt
300 250 200 150 100 50 0 2.1.2007 23.1.2007 13.2.2007 6.3.2007 27.3.2007 19.4.2007 11.5.2007 1.6.2007 22.6.2007 13.7.2007 3.8.2007 24.8.2007 14.9.2007 5.10.2007 26.10.2007 16.11.2007 7.12.2007 2.1.2008 23.1.2008 13.2.2008 5.3.2008 28.3.2008 18.4.2008 12.5.2008 2.6.2008
Der Importpreis von konventionellem Brotweizen franko Schweizer Grenze stieg von rund Fr. 31.–/100 kg im Jahre 2006 auf Fr. 47.–/100 kg im Januar 2008. Die Grenzbelastung von Fr. 27.–/100 kg führte im Monatsmittel zu Importpreisen von bis zu Fr. 74.–/100 kg. Für inländisches Getreide (Qualität Top) legte die Branche im Jahr 2006 den Produzentenrichtpreis auf Fr. 57.–/100 kg fest. Per 1. Juli 2007 senkte der Bundesrat den Kontingentszollansatz zusammen mit den Schwellenpreisen um Fr. 3.–/ 100 kg, wodurch ungeachtet der Weltmarktpreisentwicklung ein Richtpreis 2007 von Fr. 54.–/100 kg resultiert wäre. Die Branche konnte sich nicht einigen, weshalb für das Jahr 2007 keine Richtpreise für Brotgetreide festgelegt wurden.
Um die Preise der importierten Rohstoffe nicht über das anvisierte Schutzniveau zu verteuern, wurde mit den interessierten Kreisen eine Flexibilisierung des Brotgetreidezolls diskutiert. Der Bundesrat setzte mit einer Änderung der Agrareinfuhrverordnung den Referenzpreis für Brotgetreide auf Fr. 60.–/100 kg fest. Jeweils vor dem 1. April und dem 1. Oktober (erstmals 1. Oktober 2008) werden die Marktpreise von Brotgetreide erhoben, um den Zollansatz auf den Zielpreis auszurichten. Der Marktpreis wird anhand von Börsen- und Preisinformationen repräsentativer Handelspartner erhoben. Liegt der ermittelte Marktpreis ausserhalb der Bandbreite (Richtpreis Fr. ±5.–) soll eine Anpassung der Grenzbelastung vorgenommen werden. Die Grenzbelastung wird um 60% der Differenz zwischen dem Richtpreis und dem Marktpreis angepasst.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 160
in 1000 t Fr./100 kg 2006 Menge 2007 Menge 2008 Menge Quelle: BLW 1 biologische und konventionelle Ware 2006 Preis 2007 Preis 2008 Preis 0 2498 8282 83 77 75 81 90 82 74 66 58 50 20 16 12 8 4 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember ■
Importmenge und -preis von Brotweizen zwischen 2006 und 2008 1
Flexibilisierung Brotgetreidezoll
Anpassungen
ReferenzpreisFr. 60.–/100 kg
(ab 1.7.2009 Fr. 56.–/100 kg)
Anpassungszeitpunkte1. April, 1. Oktober
BandbreiteFr. ±5.–/100 kg

Korrekturausmass falls sich zum Korrektur um 60% bezogen auf die Erhebungszeitpunkt der Marktpreis Differenz zum Referenzpreis
ausserhalb der Bandbreite befindet
Maximale GrenzbelastungFr. 27.–/100 kg
(ab 1.7.2009 Fr. 23.–/100 kg)
Der Referenzpreis von Fr. 60.– bzw. Fr. 56.–/100 kg ab 1. Juli 2009 dient zum halbjährlichen Anpassungszeitpunkt der Grenzbelastung als Messlatte. Eine Korrektur der Grenzbelastung um 60% ermöglicht eine Entwicklung der Inlandpreise in Richtung Trends an den Weltmärkten. Die beiden Elemente zusammen ermöglichen den inländischen Getreideproduzenten, an einer Preishausse teilzuhaben. Allerdings verzögert eine Bandbreite von Fr.±5.–/100 kg eine Erhöhung der Zollansätze bei sinkenden Weltmarktpreisen, wodurch ein gewisses Preisrisiko für die Produzenten entsteht.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 161 2
■ AP 2011: Verordnungsänderungen im Überblick
Am 14. November 2007 hat der Bundesrat die Änderung des LwG (SR 910.1) beschlossen. Aufgrund der Änderungen waren zahlreiche Anpassungen in den Verordnungen vorzunehmen. Im Ackerbaubereich gibt es folgende bedeutende Änderungen:
1.Ackerbaubeitragsverordnung (ABBV; SR 910.17)
Anbaubeiträge: Der Anbaubeitrag für Hanf wurde per 1. Januar 2008 aufgehoben. Dieser Beitrag wurde gestrichen, weil der Hanf-Markt unübersichtlich, die Wertschöpfung im legalen Bereich niedrig und die bisherige Anbaufläche gering ist. Der Kontrollaufwand der Behörden (Bund, Kantone) war zudem erheblich. Für Zuckerrüben zur Zuckerherstellung wurde per 1. Januar 2008 ein Anbaubeitrag von Fr. 850.– pro ha eingeführt, welcher per 1. Januar 2009 auf Fr. 1900.– pro ha erhöht wird. Die Anbaubeiträge sollen die Rübenpreissenkungen, welche durch die EU-Zuckermarktreform verursacht werden und die Aufhebung des abgegoltenen Verarbeitungsauftrages an die Zuckerfabriken teilweise kompensieren. Der Anbaubeitrag für Ölsaaten, Körnerleguminosen, Faserpflanzen und Saatgut wurde per 1. Januar 2009 auf Fr. 1000.– je ha vereinheitlicht.
Verarbeitungsbeiträge Ölsaaten: Ab der Ernte 2009 werden keine Beiträge mehr für die Verarbeitung von Ölsaaten (ausgenommen in anerkannten Pilot- und Demonstrationsanlagen) ausbezahlt.
Pilot- und Demonstrationsanlagen: Ab 1. Juli 2009 wird die Anerkennungsdauer von Pilot- und Demonstrationsanlagen auf drei Jahre beschränkt. In begründeten Fällen ist eine Verlängerung um zwei Jahre möglich, jedoch nur mit einer gleichzeitigen Kürzung des Beitragssatzes. Pro Pilot- und Demonstrationsanlage wird maximal ein Beitrag von Fr. 400'000.–pro Jahr ausbezahlt. Zudem wurde festgelegt, dass der maximale Ansatz für die Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen in Pilot- und Demonstrationsanlagen Fr. 100.– pro hl produziertem reinem Ethanol, Rohöl oder Biodiesel oder 17 Rp. pro Kilowattstunde produzierter Energie beträgt.
2.Kartoffelverordnung (SR 916.113.11)
Die Kartoffelverordnung wird per 1. Juli 2009 aufgehoben. Die Verwertungsbeiträge für Kartoffeln und Saatkartoffeln, welche nicht vermarktet werden können, werden gestrichen. Zeitgleich wird die Ausrichtung von Ausfuhrbeiträgen für Kartoffelprodukte eingestellt. Die Einfuhr von Kartoffeln wird künftig in der Agrareinfuhrverordnung geregelt.
3.Zuckerverordnung (SR 916.114.11)
Per 1. Oktober 2007 wurde die Abgeltung für die Verarbeitung von Zuckerrüben zur Zuckerproduktion gekürzt. Mit der vollständigen Streichung der Verarbeitungsbeiträge für Zuckerrüben wird die Zuckerverordnung per 1. Oktober 2009 aufgehoben.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
162
4.Saatgutverordnung (SR 916.151)
Die Finanzhilfe für Mais-, Futterpflanzen- und Soja-Saatgutproduktion wird per 1. Januar 2009 aufgehoben. Der neu eingeführte Anbaubeitrag für Saatgut von Mais und Futterpflanzen sowie für Pflanzkartoffeln soll die Erhaltung der inländischen Saatgutproduktion unterstützen.

5.Agrareinfuhrverordnung (SR 916.01)
Brotgetreide: Mit einer Flexibilisierung der Grenzbelastung für Brotgetreide wird den hohen Importpreisen entgegengewirkt (siehe: «Flexibilisierung der Grenzbelastung für Brotgetreide»).
Der Garantiefondsbeitrag von Brotgetreide, welcher erhoben wird um die Pflichtlagerkosten zu decken, soll per 1. Juli 2009 von Fr. 3.70 auf Fr. 12.– je 100 kg angehoben werden. Dies hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Importeur, da gleichzeitig der Zollansatz um denselben Betrag reduziert werden soll.
Verarbeitetes Getreide zur menschlichen Ernährung: Der Zollansatz für verarbeitetes Getreide zur menschlichen Ernährung wird ab 1. Juli 2009 mittels Ausbeuteziffern aus dem Grenzschutz für die Rohstoffe hergeleitet. Ergänzend wird ein Zuschlag von Fr. 20.– je 100 kg erhoben.
Futtermittel: Um die Konkurrenzfähigkeit der tierischen Produktion zu verbessern, werden die Schwellenpreise für Futtermittel per 1. Juli 2009 um durchschnittlich Fr. 4.–/100 kg gesenkt. Der Schwellenpreis von Gerste wird neu bei Fr. 36.–/100 kg festgesetzt. Bei Sojaschrot soll in Zukunft die überwiegend importierte, proteinreichere Qualität als Referenz dienen. Aufgrund des höheren Nährwerts wird der Schwellenpreis für Sojaschrot nur um Fr. 2.– auf Fr. 45.–/100 kg reduziert.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
163
■ Stabile Märkte dank der Marktreserve
Spezialkulturen
Mostereien mit einem Ausstoss von Kernobstsaftgetränken halten eine betriebseigene Reserve. Diese Reserve entspricht der Normalversorgung (NV, Jahresbedarf plus 10% Manipulationsmasse) eines Betriebes. Darüber hinaus können sie eine betriebsbezogene, durch den Bund mitfinanzierte Marktreserve (MRes) schaffen. Die Höhe des prozentualen Anteils der MRes, bezogen auf die NV der Betriebe, wird alljährlich neu festgesetzt und kann maximal 50% der NV betragen. Durch die Haltung von MRes sollen die naturbedingten Ernteschwankungen der Mostobstproduktion ausgeglichen werden. Die Ernteschwankungen sind gross, weil die Mehrheit der Mostobstproduktion aus dem Hochstamm-Feldobstbau stammt. Bei diesen Bäumen ist die Alternanz besonders ausgeprägt (reichliche Blüte alle zwei Jahre). Die MRes als Sicherheitsnetz im Falle einer knapp oder gering ausfallenden Ernte dient zur Überbrückung von kleinen Ernten und gewährleistet ein konstantes Angebot mit Apfelsaftprodukten mit dem fruchtigen, typisch schweizerischen Aroma (Swissness). Ferner signalisiert die Mitfinanzierung einer angemessenen Lagerhaltung von MRes das Interesse an einen stabilen Markt, an der Erhaltung der Hochstamm-Feldobstbäume, an der Gewinnung qualitativ hochwertiger Produkte sowie an ökologischen Aspekten (z.B. kürzere Transportwege).
Aus der nachstehenden Grafik ist die Gesetzmässigkeit der Alternanz klar ersichtlich, wobei vier Ernten den Zehnjahresdurchschnitt (121’841 t) überschritten, zwei davon markant. Solche extreme Apfelernten scheinen jedoch der Vergangenheit anzugehören. Der Durchschnitt der letzten sechs Ernten weist, bezogen auf den Durchschnitt der NV, eine Übermenge von 18% aus. Ebenfalls vier der letzten zehn Ernten fielen geringer aus als die NV der Mostereien beträgt.
Der durch die Haltung von MRes erzielte Ausgleichseffekt hat sich bewährt. In der Regel wird in Jahren mit reichlicher bis grosser Ernte die durch das BLW anerkannte Menge an MRes höher angesetzt als bei kleinen Ernten. Dies, weil nach der Gesetzmässigkeit der Alternanz im Folgejahr eine kleine Ernte zu erwarten ist. In den Jahren 1999, 2001 und 2003, als die Ernte die NV nicht zu decken vermochte, wurde jeweils die aus dem Vorjahr stammende MRes oder ein Teil davon übertragen. Im Jahr 2005 wurde die MRes neu geschaffen. Zur Deckung der NV wurde die im Vorjahr ausgeschiedene Übermenge, welche für den Export bestimmt war, herangezogen.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
164
Die Möglichkeit zur Schaffung von Birnensaftkonzentrat (BSK) als MRes wurde im Rahmen der Agrarpolitik 2002 geschaffen. Dies, weil in den neunziger Jahren, entgegen der bisherigen Norm, zwei aufeinander folgende Birnenernten (1996 und 1997) auftraten, welche den Bedarf nicht oder nur knapp decken konnten. Mit der Ernte 1999 wäre es rechtlich möglich gewesen erstmals eine BSK-MRes herzustellen. Wegen dem grossen Überhang an BSK aus der Mostobsternte 1998 wurde jedoch darauf verzichtet. Den Gesetzmässigkeiten der Alternanz folgend wurde trotz der nur knapp die Normalversorgung deckenden Ernte 2002 auf die Schaffung einer MRes verzichtet.
Typisch schweizerischer Apfelsaft muss mindestens einen Anteil von 90% reinem Apfelsaft enthalten. Der fehlende Fruchtsaftanteil kann bis maximal 10% aus reinem Birnensaft bestehen. Reiner Birnensaft als Getränk wird nur in geringem Mass konsumiert. Der Bedarf an Birnensaft für den Getränkeabsatz beläuft sich auf rund 11%.
Der Markt für Mostobstprodukte ist durch Agrarschutzmassnahmen geschützt. Dies hat den Vorteil, dass die hochstehende Qualität der einheimischen Produkte heute Norm ist. Bei einer allfälligen Marktöffnung kann die typisch schweizerische Qualität des Apfelsaftes als Vorteil (Swissness) genutzt werden.
Die Lagerhaltung von Apfelsaftkonzentrat-MRes ist zur Sicherstellung des Fruchtsaftgetränkemarktes schweizerischer Provenienz bedeutend. Bei fehlendem inländischen Rohstoffangebot müsste das Manko durch Importe von Mostäpfeln oder Kernobstsaftprodukten sichergestellt werden. Dies wäre für die heute noch selbstverständlich typisch schweizerische Qualität des Apfelsaftes schädlich. Zudem setzt der Wille zur Haltung von MRes ein Zeichen zur Erhaltung des Hochstamm-Feldobstbaus.
Die Mitfinanzierung des Bundes an die Haltung von MRes beläuft sich auf rund 60 Rp. pro Hochstamm-Feldobstbaum, was einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis entspricht.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
165
in t Quelle:
Apfelernte
Normalversorgung NV Ernte Marktreserve MRes 1998199920002001 0 200000 250000 150000 100000 50000 2004 2003 2002200520062007
Vergleich verarbeitete Apfelernte, Normalversorgung und Marktreserve
BLW
verarbeitet
■ Ausblick
Im Rahmen der Agrarpolitik 2011 wird die Verstärkung der regionalen Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft vorangetrieben. Mostereien mit Getränkeausstoss können weiterhin eine betriebsbezogene, durch den Bund mitfinanzierte Marktreserve (MRes) schaffen. Dadurch werden naturbedingte Ernteschwankungen teilweise ausgeglichen. Diese Massnahmen tragen zur Erhaltung der Hochstamm-Feldobstbäume bei. Auf Anordnung des Parlamentes werden im Jahr 2009 letztmals Exporte von Kernobstsaftprodukten mit Finanzhilfen durch den Bund unterstützt.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 166
2.2 Direktzahlungen
Die Direktzahlungen sind eines der zentralen Elemente der Agrarpolitik. Sie gelten die von der Gesellschaft geforderten Leistungen ab. Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen.
Ausgaben für die Direktzahlungen 2000–2007

Ausgabenbereich20002001200220032004200520062007
Allgemeine
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich. Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Mio. Fr.
Direktzahlungen18041929199519991994200020072070 Ökologische Direktzahlungen361413452477495507518524 Kürzungen2317211718202619 Total21422325242624592470248625002575
BLW 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 167
Quelle:
Tabelle 31, Seiten A30
■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
2.2.1Bedeutung der Direktzahlungen
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten. Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere. Diese Beiträge haben das Ziel, die Nutzung und Pflege der landwirtschaftlichen Nutzfläche sicherzustellen. In der Hügelund Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen. Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt. Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).
■ Abgeltung besonderer ökologischer Leistungen
Ökologische Direktzahlungen sind der Oberbegriff für die Öko-, Etho-, Gewässerschutz- und Sömmerungsbeiträge. Mit diesen Beiträgen werden die Landwirte wirtschaftlich motiviert, Anforderungen zu erfüllen, welche die allgemeinen gesetzlichen Vorgaben und den Ökologischen Leistungsnachweis übersteigen.
Die Ökobeiträge umfassen die Beiträge für den ökologischen Ausgleich, für die ÖkoQualität, für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) sowie für den biologischen Landbau. Mit den Ethobeiträgen fördert der Bund die Tierhaltung in besonders tierfreundlichen Stallhaltungssystemen (BTS) sowie den regelmässigen Auslauf der Nutztiere im Freien (RAUS). Die Gewässerschutzbeiträge bewirken die Reduktion von Nitrat- und Phosphorbelastungen in Gewässern und die Sömmerungsbeiträge werden für die nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung der Sömmerungsflächen ausgerichtet.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 168
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2007
Die Direktzahlungen betrugen im Jahr 2007 2,575 Mrd. Fr. pro Betrieb wurden durchschnittlich 47'071 Fr. ausbezahlt. Den Berg- und Hügelregionen kamen 61% der gesamten Direktzahlungssumme zugute.
Direktzahlungen 2007
Anmerkung:
Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich. Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs. Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle: BLW
Beitragsart TotalTalregionHügelregionBergregion 1 000 Fr. Allgemeine Direktzahlungen 2 070 357788 662536 891733 398 Flächenbeiträge 1 275 681638 873312 072324 737 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 412 813142 708114 733155 371 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 277 786 4 69477 420195 672 Allgemeine Hangbeiträge 92 671 2 38632 66757 617 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 11 407 Ökologische Direktzahlungen 523 533210 817116 32998 387 Ökobeiträge 217 738114 43854 33448 966 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 126 92873 68731 72321 518 Beiträge nach der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV)32 10710 118 8 79013 199 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 30 62921 898 8 138 593 Beiträge für den biologischen Landbau 28 074 8 735 5 68313 656 Ethobeiträge 207 79696 37961 99549 422 Beiträge für Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) 51 60229 56915 048 6 985 Beiträge für Regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) 156 19466 81046 94742 437 Sömmerungsbeiträge 92 110 Gewässerschutzbeiträge 5 890 Kürzungen 18 851 Total Direktzahlungen 2 575 039999 479653 220831 785 Direktzahlung pro Betrieb 47 07142 97444 02950 074
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 169 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
Quelle:
Die Abgeltung der erschwerenden Bewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion führt dazu, dass die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis ansteigt. Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zahlreiche Anforderungen zu erfüllen. Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen, wie Rechtsform, zivilrechtlicher Wohnsitz usw., anderseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend wie beispielsweise ein minimaler Arbeitsbedarf, das Alter der Bewirtschafter, das Einkommen und Vermögen. Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen, die unter den Begriff «Ökologischer Leistungsnachweis» fallen. Die Anforderungen des ÖLN umfassen: eine ausgeglichene Düngerbilanz, ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen, eine geregelte Fruchtfolge, ein geeigneter Bodenschutz, eine gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. Mängel bei den massgebenden Vorschriften haben Kürzungen oder eine Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge.
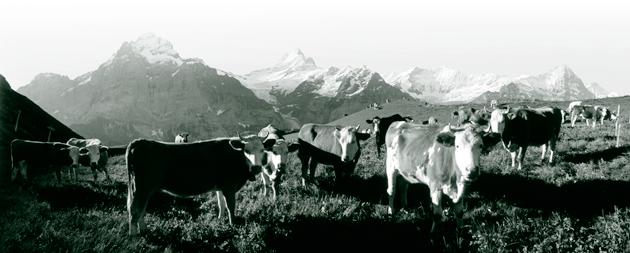
MerkmalEinheitTotalTal-Hügel-Bergregionregionregion BetriebeAnzahl3 3281 524961843 LN im Øha20,3121,2219,2919,81 Allgemeine DirektzahlungenFr.40 53734 78040 19150 554 Öko- und EthobeiträgeFr.8 1869 1648 3626 370 Total DirektzahlungenFr.48 72443 94448 55356 924 RohleistungFr.242 567297 284222 356170 563 Anteil Direktzahlungen an der Rohleistung%20,114,821,833,4
Anteil der Direktzahlungen an der Rohleistung von Referenzbetrieben nach Regionen 2007
Agroscope
ART
Reckenholz-Tänikon
■ Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 170
Tabellen 41a–42, Seiten A46–A49
■ Agrarpolitisches Informationssystem
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem). Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen, welche die Kantone zusammentragen und übermitteln und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart (Massnahme) gespiesen. Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge. Eine weitere Funktion des Systems besteht in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen. Dank der Informationsfülle und der leistungsfähigen EDV-Hilfsmittel können zahlreiche agrarpolitische Fragen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden.
Von den 59'985 über der Erhebungslimite des Bundes liegenden und im Jahre 2007 in AGIS erfassten Betrieben beziehen deren 54’705 Direktzahlungen.
■ Auswirkungen der Begrenzungen und Abstufungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus. Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro Standard-Arbeitskraft (SAK), bei den Abstufungen um die Degressionen nach Fläche und Tieren.
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2007
BegrenzungBetroffene Kürzung Anteil am Beitrag Anteil am Total Betriebeder betroffenenDZ Betriebe
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen von knapp 12 Mio. Fr. zur Folge, wovon rund 11,2 Mio. Fr. auf Kürzungen infolge Überschreitung der Einkommens- und Vermögensgrenzen zurück zu führen sind. Sowohl die Anzahl der betroffenen Betriebe wie auch die Kürzungssumme haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
AnzahlFr.%% pro StandardArbeitskraft390780 3745,660,03 auf Grund des Einkommens1 1406 166 88110,930,24 auf Grund des Vermögens2855 001 13953,220,19 Total11 948 3940,46
Quelle: BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 171
Wirkung der Abstufungen der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl 2007
Fläche oder Reduktion Anteil am Anteil am BetriebeTierbestandBeitrag derTotal der pro
Quelle: BLW
Insgesamt sind 9’579 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen. Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenen Massnahmen. Die Reduktionen betragen total rund 41,2 Mio. Fr. Gemessen an allen Direktzahlungen, die abgestuft sind, beträgt der Anteil sämtlicher Reduktionen rund 1,6%. Die Beitragsdegressionen wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus, wo die Abstufungen bei über 7’800 Betrieben (rund 14,3%) aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen. Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 333 von der Kürzung dieser Beiträge betroffen, da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken. Von der Beitragsreduktion betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen. So werden z.B. die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei 3’762 Betrieben (ohne Doppelzählungen) um 10,8% (BTS) bzw. um 8,7% (RAUS) reduziert. 819 Bio-Betriebe erhalten um 7,6% herabgesetzte Direktzahlungen.
Anzahlha oder GVEFr.%% Flächenbeiträge7 81242,533 427 1767,71,30 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere33359,11 167 1067,00,05 Allgemeine Hangbeiträge9434,444 3163,20,01 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen135,042713,60,01 Beiträge für den ökologischen Ausgleich2938,689 0419,20,01 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion)5936,343 5635,00,01 Beiträge für den biologischen Landbau81940,3656 2757,60,03 Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme2 36569,12 268 57610,80,09 Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien3 41265,63 452 5028,70,13 Total9 579 1 41 152 8267,91,60
Doppelzählungen
MassnahmeBetroffene
BetriebBetriebeDirektzahlungsart
1ohne
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 172
■
Vollzug und Kontrolle
Die Kontrolle des ÖLN wird gemäss Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert. Diese ziehen akkreditierte Organisationen, die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten, zum Vollzug bei. Sie müssen die Kontrolltätigkeit stichprobenweise überprüfen. Direktzahlungsberechtigte Bio-Betriebe müssen neben den Auflagen des Biolandbaus die Vorgaben des ÖLN erfüllen und die Nutztiere nach den RAUS-Anforderungen halten. Sie werden von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle jährlich überprüft. Die Kantone überwachen diese Kontrollen. Artikel 66 Absatz 4 der Direktzahlungsverordnung präzisiert, nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben.
Zu kontrollieren sind: –alle Betriebe, welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen; –alle Betriebe, bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden; und –mindestens 30% der übrigen Betriebe, die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind.
Bei einer mangelhaften Erfüllung des ÖLN werden die Beiträge nach einheitlichen Kriterien gekürzt. Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren hat eine entsprechende Richtlinie erlassen.
■ Durchgeführte Kontrollen und Beitragskürzungen
2007
Im Jahr 2007 waren insgesamt 54’705 Landwirtschaftsbetriebe beitragsberechtigt. Davon wurden 30’913 (56,5%) durch die Kantone bzw. durch die von ihnen beauftragten Kontrollstellen auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert. Wegen Mängeln beim ÖLN wurden bei 1’806 Betrieben (3,3% der Betriebe) die Beiträge gekürzt.
Gemäss Bio-Verordnung müssen alle Bio-Betriebe jedes Jahr kontrolliert werden. Wegen Mängeln erhielten 3,5% der Biobetriebe gekürzte Beiträge.
Beim BTS-Programm wurden durchschnittlich 58,5% und beim RAUS-Programm 49,6% der beitragsberechtigten Betriebe kontrolliert. Die Kontrollen werden meist zuammen mit den ÖLN-Kontrollen vorgenommen. Der effektive Prozentsatz ist deshalb höher. Beim BTS-Programm erhielten 2,6%, beim RAUS-Programm 2,0% der beteiligten Betriebe gekürzte Beiträge.
Gesamthaft wurden bei 5’463 Betrieben Mängel festgestellt, was Beitragskürzungen von rund 6,8 Mio. Fr. zur Folge hatte.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 173
Mangelhafte Aufzeichnungen, nicht tiergerechte Haltung der Nutztiere, andere Gründe (fehlende Bodenproben, abgelaufener Spritzentest), nicht ausgeglichene Düngerbilanz, ungenügende Pufferund Grasstreifen, Auswahl und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, nicht rechtzeitige Anmeldung, nicht angemessener Anteil ÖAF. Schnittzeitpunkt oder Pflegemassnahmen nicht eingehalten, falsche Angabe der Anzahl Bäume, Verunkrautung, falsche Flächenangaben, unzulässige Düngung, nicht rechtzeitige Anmeldung, und Pflanzenschutz.
nicht rechtzeitige Anmeldung, Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung, unzulässige Pflanzenschutzmittel
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Verstoss Fütterungsvorschriften, Hobbybetriebe nicht nach Bio-Vorschriften, Tierhaltung, Gewässerschutz, Aufzeichnungen u.a.), im Bio-Landbau nicht zugelassene Dünger und Pflanzenschutzmittel, nicht rechtzeitige Anmeldung, falsche Angaben.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Einstreu unzweckmässig), nicht rechtzeitige Anmeldung, kein Mehrflächen-Haltungssystem, Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften, mangelhafter Liegebereich, falsche Angaben, mangelhafte Stallbeleuchtung.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Mindestmastdauer nicht erreicht, Liegebereich mit Spalten/Löcher, Tierschutz, zu kleine Weidefläche, verspäteter Einzug u.a.), zu wenig Auslauftage, nicht rechtzeitige Anmeldung, mangelhafte Aufzeichnungen, nicht alle Tiere einer Kategorie nach den Vorschriften gehalten, falsche Angaben, ungenügender Laufhof.
Unter- oder Überschreitung des Normalbesatzes, unsachgemässe Weideführung, Nutzung nicht beweidbarer Flächen, Verstösse gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften nicht rechtzeitige Anmeldung, Ausbringen nicht erlaubter Dünger, andere Elemente (Überlieferung Milchkontingent) falsche Angaben zum Tierbestand, fehlende Dokumente, nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Erschweren von Kontrollen, falsche Angaben betreffend Sömmerungsdauer, fehlende Daten, unerlaubter Herbizideinsatz, Wiederholungsfälle.
Quelle: Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Beitragskürzungen
Zusammenstellung der Beitragskürzungen 2007 KategorieBeitrags- Kontrollierte BetriebeKürzungenHauptgründe berechtigteBetriebemit BetriebeKürzungen AnzahlAnzahlAnzahlFr. ÖLN54 70530 9131 8062 159 538 ÖAF 51 823-612523 149 Extenso 15 8265 5194221 311 Bio 6 0826 296218190 244 BTS 18 64910 901498441 402 RAUS 37 97818 796742588 615 Sömmerung7 2997836641 076 871
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 174
Tabellen 43a–43b, Seiten A50–A51
Zusammenstellung der Beitragskürzungen 2007

KategorieBeitrags-
falsche Flächenangaben, falsche Tierbestandesangaben, andere Elemente (falsche Angaben ÖLN, weniger als 50% betriebseigene Arbeitskräfte, nicht rechtzeitige An-/Abmeldung eines Programmes, Kontrollen erschwert), falsche Angaben zum Betrieb oder Bewirtschafter, falsche Angaben zur Sömmerung. keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
BetriebeKürzungen AnzahlAnzahlAnzahlFr. Grunddaten--6391 146 679 Gewässerschutz--210647 186 Natur- und--1520 334 Heimatschutz Umweltschutz--1715 040 Total--5 4636 830 369
Kontrollierte BetriebeKürzungenHauptgründe berechtigteBetriebemit
Quelle: Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Beitragskürzungen
Tabellen 43a–43b, Seiten A50–A51
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 175
■ Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz
Die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen können in Spezialfällen, gestützt auf Anhang 6.4 der Direktzahlungsverordnung, Sonderbewilligungen ausstellen. Im Jahr 2007 gab es für 4’986 ha LN 2’253 Sonderbewilligungen. Am häufigsten bewilligt wurde analog zu den Vorjahren die Behandlung von Blacken (Ampfer) und Hahnenfuss in Naturwiesen.
Erteilte Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz 2007
Bekämpfungsmittel BewilligungenFläche Anzahl% allerha% der total BetriebeBetriebebetroffenen Fläche
Applikationen mit Pflanzenschutzmittel während des Winterbehandlungsverbots462,0105,12,1 Einsatz von Insektiziden und nematiziden Granulaten39017,31 185,123,8
Getreide: Bekämpfung der Getreidehähnchen 1 713,2426,18,5
Raps: Bekämpfung der Erdflöhe251,160,11,2 Kartoffeln: Bekämpfung der Kartoffelkäfer 1 40,24.60,1
Leguminosen, Sonnenblumen, Tabak: Bekämpfung der Blattläuse11,4 Übrige Schädlingsbekämpfung im Ackerbau25411,3592,311,9
1Mit anderen als der in den Weisungen der Konferenz der Kantonalen Pflanzenschutzdienste aufgelisteten Produkte. Zur Bekämpfung der Getreidehähnchen haben die Kantone AG und ZH je eine regionale Sonderbewilligung erteilt, die in der Tabelle nicht berücksichtigt sind.
2 Erteilte Sonderbewilligungen für Pflanzenschutzmassnahmen, die in den anerkannten spezifischen Richtlinien ausgeschlossen sind.
Quelle: BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 176
Flächenbehandlung1 39561,92 460,949,4 Gemüsebau 2 60,350,1 Obstbau 2 582,6138,52,8 Weinbau 2 30,170,1 Total2 2531004 986,1100
Dauergrünland:
Neuerungen 2008/2009
Mit Beschluss vom 14. November 2007 und vom 25. Juni 2008 hat der Bundesrat mit der Umsetzung der AP 2011 einige Änderungen vorgenommen.
Inkraftsetzung der Verordnung über die Koordination der Inspektionen auf Landwirtschaftsbetrieben als rechtlichen Basis für die Koordination der öffentlich-rechtlichen Inspektionen auf Landwirtschaftsbetrieben im Bereich der Primärproduktion. Diese hat folgende Kernelemente:
–Eine, ausnahmsweise zwei öffentlich-rechtliche Inspektionen pro Jahr bei Betrieben ohne Mängel; –Harmonisierung der Inspektionsfrequenzen verschiedener Rechtserlasse; –gegenseitige Anerkennung der Inspektionsresultate; –Administration Inspektionsdaten mit einem umfassenden, standardisierten und gemeinsamen Informationssystem; –Koordination der Inspektionen durch Kanton.
Ökologischer Leistungsnachweis: –Entlastung wenig intensiv geführter Betriebe von Suisse-Bilanz und Bodenanalysen; –strengere Vorgaben für den Einsatz von Phosphor im Zuströmbereich von phosphorbelasteten Seen; –Verbesserung des Schutzes der Gewässer vor Eintrag von Pflanzenschutzmitteln durch Verbreiterung des Grünflächenstreifens von 3 auf 6 Meter; –obligatorische Spülwassertanks auf Pflanzenschutzgeräten.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 177
■ Flächendeckende Bewirtschaftung als Ziel
2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen
Flächenbeiträge
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Schutz und Pflege der Kulturlandschaft, Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab. Die Flächenbeiträge werden seit dem Jahr 2001 mit einem Zusatzbeitrag für das offene Ackerland und die Dauerkulturen ergänzt.
Ansätze 2007Fr./ha 1
– bis 30 ha 1 150
– 30 bis 60 ha862.5
– 60 bis 90 ha575

– über 90 ha 0
1Der Zusatzbeitrag für offenes Ackerland und Dauerkulturen beträgt Fr. 450 pro ha und Jahr; auch er unterliegt der Flächenabstufung
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25%. Insgesamt handelt es sich um rund 5’000 ha, welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden. Schweizer Betriebe, die heute Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone zukaufen oder pachten, erhalten keine Direktzahlungen.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 178
Tabellen 32a–32b, Seiten A31–A32
Flächenbeiträge 2007 (inkl. Zusatzbeitrag)
Der Zusatzbeitrag wurde für insgesamt 270’414 ha offenes Ackerland und 18’545 ha Dauerkulturen ausgerichtet.
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen 2007
Von der Beitragsdegression betroffen sind 10,4% der LN. Im Durchschnitt wird pro ha ein Flächenbeitrag von Fr. 1'242 ausbezahlt (inkl. Zusatzbeitrag). Die Betriebe mit einer Fläche bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 8,5% der gesamten LN. Eine Betriebsgrösse von mehr als 60 ha weisen lediglich 1,6% aller Betriebe aus; sie bewirtschaften 6,2% der gesamten LN.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 179
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion Flächeha479 374259 916287 7031 026 993 BetriebeAnzahl23 13814 79416 60354 535 Fläche pro Betriebha20.717.617.318.8 Beitrag pro BetriebFr.27 61121 09419 55923 392 Total Beiträge1 000 Fr.638 873312 072324 7371 275 681 Total Beiträge 20061 000 Fr. 653 275325 471340 3571 319 103 Quelle: BLW
Quelle: BLW Grössenklassen in ha Betriebe LN < 30 60 < LN < 90 30 < LN < 60 LN > 90 30 302020100 Verteilung in % 20 1030 über 90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 bis 5 2,02,10,7 21,8 27,5 16,2 13,3 7,1 13,7 1,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 21,3 17,6 20,0 17,7 1,4 6,5 Betriebe in %LN in % 8,1 0,1 1,32,02,10,7 0,30,40,3 0,3
■ Flächennutzung mit Grünland
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere
Die Massnahme hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig die Flächen im Grasland Schweiz durch die Nutzung zu pflegen.
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere, die während der Winterfütterung (Referenzperiode: 1. Januar bis Stichtag des Beitragsjahres) auf einem Betrieb gehalten werden. Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe, Ziegen, Bisons, Hirsche, Lamas und Alpakas. Die Beiträge werden in Abhängigkeit der vorhandenen Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt. Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE) und sind je ha begrenzt. Die Begrenzung ist abgestuft nach Zonen.

Begrenzung der FörderungRGVE/ha –in der Ackerbauzone, der erweiterten Übergangszone und der Übergangszone2,0 –in der Hügelzone 1,6 –in der Bergzone I1,4 –in der Bergzone II 1,1 –in der Bergzone III0,9 –in der Bergzone IV0,8
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 180
Die RGVE sind in drei Beitragsgruppen aufgeteilt. Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung, Bisons, Milchziegen und Milchschafe werden Fr. 900 und für die übrigen Ziegen und Schafe, sowie Hirsche, Lamas und Alpakas Fr. 400 je RGVE ausgezahlt. Bei den Verkehrsmilchproduzenten wurden weiterhin pro 4'400 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE in Abzug gebracht. Für diese vom Milchabzug betroffenen RGVE wurden im Beitragsjahr 2007 neu Fr. 200 je RGVE ausgerichtet. Mit der Änderung erhöhte sich die Gesamtsumme dieser Beitragsart um rund 110 Mio. Fr. auf insgesamt 413 Mio. Fr.
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2007 MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2007
ohne vermarkteter vermarktete MilchMilch
Quelle: BLW
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar rund 3’500 Fr. weniger RGVEBeiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch. Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z.B. Zulage für verkäste Milch).
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 181
Beiträgen berechtigende RGVEAnzahl370 165280 467273 883924 515 BetriebeAnzahl17 47013 99815 96947 437 Zu Beiträgen berechtigende RGVE pro BetriebAnzahl21.220.017.219.5 Beiträge pro BetriebFr.8 1698 1969 7308 702 Total Beiträge1 000 Fr.142 708114 733155 371412 813 Total Beiträge 20061 000 Fr.89 52077 905133 788301 213 Quelle: BLW
Zu
MerkmalEinheitBetriebe
Betriebe
BetriebeAnzahl27 80819 629 Tiere pro BetriebeRGVE26.714.2 Abzug aufgrund Beitragbegrenzung der GrünflächeRGVE2.61.4 MilchabzugRGVE20.50.0 Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE24.112.9 Beiträge
BetriebFr.7 22910 789
mit
pro
■ Abgeltung der Produktionserschwernisse
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen. Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung), werden bei dieser Massnahme auch soziale, strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt. Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere. Die Beiträge werden für höchstens 20 RGVE je Betrieb ausgerichtet.

Ansätze pro RGVE 2007Fr./GVE – in der Hügelzone 260 – in der Bergzone I440 – in der Bergzone II 690 – in der Bergzone III930 – in der Bergzone IV1 190
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 182
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden
Produktionsbedingungen 2007
MerkmalEinheitTal- Hügel-Berg-Total regionregionregion
Zu Beiträgen berechtigende
RGVEAnzahl53 490223 647236 786513 923
BetriebeAnzahl2 98013 99715 97132 948
RGVE pro BetriebAnzahl17.916.014.815.6
Beiträge pro BetriebFr.1 5755 53112 2528 431
Total Beiträge1 000 Fr.4 69477 420195 672277 786
Total Beiträge 20061 000 Fr.4 63978 648197 972281 258
Quelle: BLW
Der Trend der abnehmenden Beitragszahlungen bei den Beiträgen für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen hat sich auch im Beitragsjahr 2007 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr hat die ausbezahlte Beitragssumme infolge des laufenden Strukturwandels und der Limitierung auf 20 RGVE je Betrieb um rund 3,5 Mio. Fr. abgenommen. Dementsprechend haben auch die zu Beiträgen berechtigenden RGVE um 4'706 und die Anzahl beitragsberechtigter Betriebe um 443 Einheiten abgenommen.
Verteilung der Raufutter verzehrenden Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen nach Grössenklassen 2007
(in 100) Tiere (in 1 000) mit Beitrag
Quelle: BLW
Im Beitragsjahr 2007 standen rund 69% der RGVE in beitragsberechtigten Betrieben, die von der Limite betroffen sind. Bei diesen Betrieben betrug der Anteil der RGVE ohne Beitrag 36%.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 183
über 90 45–90 30–45 20–30 15–20 10–15 5–10 bis 5
Grössenklassen in RGVE Betriebe
Tiere (in
100 10050500 0 Anzahl 50100150200250 67 53 39 52 8 23 99 56 16435 82 9166 44 4260 18 49 1
1 000) ohne Beitrag
■ Allgemeine Hangbeiträge: Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Hangbeiträge
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion abgegolten. Sie werden nur für Wies-, Streuund Ackerland ausgerichtet. Wiesen müssen jährlich mindestens einmal, Streueflächen alle ein bis drei Jahre geschnitten werden. Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt.
Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert leicht von Jahr zu Jahr. Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab, die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 184
Ansätze 2007Fr./ha – Neigung 18 bis 35% 370 – Neigung über 35% 510 Beiträge für Hangflächen 2007 MerkmalEinheitTal- Hügel-Berg-Total regionregionregion Zu Beiträgen berechtigende Flächen: –Neigung 18–35%ha4 56064 07472 907141 541 –über 35% Neigungha1 37017 57160 14379 084 Totalha5 93181 644133 051220 626 BetriebeAnzahl2 08913 24915 45030 788 Beitrag pro BetriebFr.1 1422 4663 7293 010 Total Beiträge1 000 Fr.2 38632 66757 61792 671 Total Beiträge 20061 000 Fr.2 38933 27058 56894 227 Quelle: BLW
unter 18% Neigung 61% 18–35% Neigung 25% 35% und mehr Neigung 14%
Betriebe mit Hangbeiträgen 2007 Quelle: BLW
Total 567 703 ha
■ Hangbeiträge für Rebflächen: Zur Erhaltung der Rebflächen in Steilund Terrassenlagen
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei, Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten. Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden, wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden. Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden nur für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet. Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig.

Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2007
Der Anteil der beitragsberechtigten Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 25%.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 185
Ansätze 2007Fr./ha – für Flächen mit 30 bis 50% Neigung 1 500 – für Flächen mit über 50% Neigung 3 000 – für Flächen in Terrassenlagen 5 000
Einheit Zu Beiträgen berechtigende Flächen total:ha3 747 Steillagen 30 bis 50% Neigungha1 892 Steillagen über 50% Neigung ha353 Terrassenanlagenha1 503 Anzahl BetriebeAnzahl2 857 Fläche pro Betrieb (in ha)ha1.3 Beitrag pro Betrieb (in Fr.)Fr.3 993 Total Beiträge (in 1 000 Fr.)1 000 Fr.11 407 Total Beiträge 20061 000 Fr. 11 380 Quelle: BLW
Neuerungen 2008/2009
Mit den Beschlüssen vom 14. November 2007 und vom 25. Juni 2008 hat der Bundesrat im Rahmen der Umsetzung zur AP 2011 einige Änderungen vorgenommen.
Auf den 1. Januar 2008 wurde der allgemeine Flächenbeitrag um Fr. 70 auf Fr. 1080 pro ha gesenkt. Ausserdem wurde der Beitrag für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere für die Kategorie Rindvieh, Tiere der Pferdegattung, Bisons, Milchziegen und Milchschafe von Fr. 900 auf Fr. 860 pro RGVE reduziert.
Ein Kernelement der Agrarpolitik 2011 ist die Umlagerung von Mitteln aus der Preisstützung und den Exportsubventionen hin zu produktunabhängigen Direktzahlungen. Die folgenden Änderungen treten auf den 1. Januar 2009 in Kraft.
Beitragsabstufung
Erhöhung der Grenzwerte bei der Abstufung der Beiträge nach Fläche und Tierzahl.
Einkommens- und Vermögensgrenze
Moderate Erhöhung der Abzüge für Verheiratete und der maximalen Beiträge pro Standardarbeitskraft.
Flächenbeiträge
Reduktion Allgemeiner Flächenbeitrag auf Fr. 1'040 pro ha. Erhöhung Zusatzbeitrag für offene Ackerflächen und Dauerkulturen auf Fr. 620 pro ha.
Berechnung Rindviehbestand anhand der TVD-Daten
Durchschnittsbestand aus der TVD anstelle des Stichtagsbestandes zur Festsetzung des beitragsberechtigten Rindviehbestandes.
RGVE-Beiträge
Anrechnung von Mais- und Futterrübenflächen an die Förderlimite. Weiterführung der RGVE-Beiträge in drei Kategorien:
– Tiere der Rinder- und Pferdegattung, Milchziegen und Milchschafe: neu Fr. 690 pro RGVE –übrige Ziegen und Schafe, Lamas, Alpakas:neu Fr. 520 pro RGVE –Milchabzugs-GVE: neu Fr. 450 pro RGVE
Die Berücksichtigung der Milchmarktstützung mittels Abzug für vermarktete Milch wird beibehalten.
TEP-Beiträge
Aufhebung der Limitierung der TEP-Beiträge auf 20 GVE pro Betrieb; Abstufung wie bei übrigen Beitragsarten. Umstellung auf Förderlimite wie bei RGVE-Beiträgen; Beitragsansätze werden über alle Zonen um Fr. 40 pro GVE erhöht; Übergangsregelung für kleine Betriebe bis 2011.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 186
2.2.3Ökologische Direktzahlungen

Ökobeiträge
Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab, deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen. Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten, bei denen sie freiwillig mitmachen können. Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig; die Beiträge können kumuliert werden.
■■■■■■■■■■■■■■■■
BLW Total 217,7 Mio. Fr. Ökoausgleich 58% Biologischer Landbau 13% Extenso 14% ÖQV 15% 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 187
Tabellen 33a–33b, Seiten A33–A34 Verteilung der Ökobeiträge auf die verschiedenen Programme 2007 Quelle:
Ökologischer Ausgleich
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert werden. Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei. Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN angerechnet werden, während andere Elemente beim ÖLN nur anrechenbar sind.
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Beim ÖLN anrechenbare Elemente Beim ÖLN anrechenbare Elemente mit Beiträgen ohne Beiträge extensiv genutzte Wiesenextensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte WiesenWaldweiden Streueflächeneinheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen Hecken, Feld- und UfergehölzeWassergräben, Tümpel, Teiche BuntbrachenRuderalflächen, Steinhaufen und -wälle RotationsbrachenTrockenmauern Ackerschonstreifenunbefestigte natürliche Wege Hochstamm-FeldobstbäumeRebflächen mit hoher Artenvielfalt
weitere, von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN
Die Flächen dürfen nicht gedüngt und während sechs Jahren in Abhängigkeit zur Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt werden. Das späte Mähen soll gewährleisten, dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird. So bleibt auch zahlreichen wirbellosen Tieren, bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion.
Die Beiträge für extensiv genutzte Wiesen, Streueflächen, Hecken, Feld- und Ufergehölze sind einheitlich geregelt und richten sich nach der Zone, in der sich die Fläche befindet. Der Anteil an extensiven Wiesen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Ansätze 2007Fr./ha – Ackerbau- und Übergangszonen 1 500 – Hügelzone1 200 – Bergzonen I und II 700 – Bergzonen III und IV450
Extensiv genutzte Wiesen 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 188
Tabellen 34a–34d, Seiten A35–A38
■
■ Streueflächen
Beiträge für extensiv genutzte Wiesen 2007
■ Hecken, Feld- und Ufergehölze
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten, welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden.
Beiträge für Streueflächen 2007
Als Hecken, Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-, Hoch- oder Baumhecken, Windschutzstreifen, Baumgruppen, bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze. Die Flächen müssen während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet und sachgerecht gepflegt werden.
Beiträge für Hecken, Feld- und Ufergehölze 2007 MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl19 0179 94710 17339 137 Flächeha27 72711 26517 06656 058 Fläche pro Betriebha1,461,131,681,43 Beitrag pro BetriebFr.2 1351 1578821 561 Total Beiträge1 000 Fr.40 59711 5118 96961 077 Total Beiträge 20061 000 Fr.39 59511 3498 85359 797 Quelle: BLW
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl1 9081 9223 2227 052 Flächeha1 9091 5273 6777 112 Fläche pro Betriebha1,000,791,141,01 Beitrag pro BetriebFr.1 466771719935 Total Beiträge1 000 Fr.2 7971 4822 3166 594 Total Beiträge 20061 000 Fr.2 7601 4922 2966 548 Quelle: BLW
regionregionregion BetriebeAnzahl5 8223 0811 41210 315 Flächeha1 4218023152 538 Fläche pro Betriebha0,240,260,220,25 Beitrag pro BetriebFr.361270146304 Total Beiträge1 000 Fr.2 1008322063 138 Total Beiträge 20061 000 Fr.2 0808212053 106 Quelle: BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 189
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden. Für die Nutzung gelten die gleichen Vorschriften wie bei den extensiv genutzten Wiesen.
Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen 2007
Als Buntbrachen gelten mehrjährige, mit einheimischen Wildkräutern angesäte, ungedüngte Streifen von mindestens 3 m Breite. Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter. In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung. Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung. Für Buntbrachen werden Fr. 3’000 pro ha ausgerichtet. Die Beiträge gelten für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone.
Ansätze 2007Fr./ha – Ackerbau- bis Hügelzone 650 – Bergzonen I und II 450 – Bergzonen III und IV300
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl6 4506 8769 17922 505 Flächeha5 6866 24117 39829 325 Fläche pro Betriebha0,880,911,901,30 Beitrag pro BetriebFr.565502643577 Total Beiträge1 000 Fr.3 6443 4515 89912 994 Total Beiträge 20061 000 Fr.3 9113 6106 12013 641 Quelle: BLW
Beiträge für Buntbrachen 2007 MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1 BetriebeAnzahl1 91037752 292 Flächeha1 82231632 141 Fläche pro Betriebha0,950,840,500,93 Beitrag pro BetriebFr.2 8622 5191 5122 802 Total Beiträge1 000 Fr.5 46694986 423 Total Beiträge 20061 000 Fr.5 8771 00956 891
Quelle: BLW
Wenig intensiv genutzte Wiesen ■ Buntbrachen 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 190
1Hier
handelt es sich um Betriebe, die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften
■
■ Rotationsbrachen
Als Rotationsbrachen gelten ungedüngte ein- bis zweijährige, mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen, die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen. In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel, Hasen und Insekten Lebensraum. In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich. Für die Rotationsbrachen werden in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone Fr. 2’500 pro ha ausgerichtet.
Beiträge für Rotationsbrachen 2007
1Hier handelt es sich um Betriebe mit Standort in der Hügel- oder Bergregion, die jedoch Teile ihrer Flächen in der Talregion bewirtschaften
Quelle: BLW
■ Ackerschonstreifen
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben. Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite, extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen wie Getreide, Raps, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Soja, nicht jedoch Mais. In allen Zonen wird ein einheitlicher Beitrag von Fr. 1’500 pro ha bezahlt.
Beiträge für Ackerschonstreifen 2007
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1
BetriebeAnzahl6024084
Flächeha308038
Fläche pro Betriebha0,520,420,090,48 Beitrag pro BetriebFr.7994570718
Total Beiträge1 000 Fr.4811059
Total Beiträge 20061 000 Fr.4811059
1Hier handelt es sich um Betriebe, die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften
Quelle: BLW
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1 BetriebeAnzahl502972601 Flächeha7141292845 Fläche pro Betriebha1,421,331,051,41 Beitrag pro BetriebFr.3 5583 3232 6253 517 Total Beiträge1 000 Fr.1 78632252 114 Total Beiträge 20061 000 Fr.1 67532031 998
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 191
■ HochstammFeldobstbäume
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume, die nicht in einer Obstanlage stehen, sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven. Pro angemeldeter Baum werden Fr. 15 ausgerichtet.
Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume 2007
■ Übersicht über die ökologischen Ausgleichsflächen 2007
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 2007
Rotationsbrachen 0,9%
2,2%
Wenig intensiv genutzte Wiesen 29,9% Feld- und Ufergehölze 2,6%
0,0%
Extensiv genutzte Wiesen 57,2%
7,3%
Quelle: BLW 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume
Verteilung der ökologischen Ausgleichflächen nach Regionen 2007
6861,136 2412,3517 3985,97
Streueflächen1 9090,381 5270,573 6771,26
Hecken, Feld- und Ufergehölze1 4210.288020,303150,11
Buntbrachen1 8220,363160,1230,00
Rotationsbrachen7140,141290,0520,00 Ackerschonstreifen300,0180,0000,00
Total39 3097,8320 2887,6338 46013,21
Quelle: BLW
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl16 12812 1425 39533 665 Bäumeha1 150 217877 656274 2972 302 170 Bäume pro Betriebha71,3272,2850,8468,38 Beitrag pro BetriebFr.1 0701 0847631 026 Total Beiträge1 000 Fr.17 25013 1644 11434 529 Total Beiträge 20061 000 Fr.17 45513 3674 11334 935 Quelle: BLW
TalregionHügelregionBergregion ha%ha%ha% Elementeder LNder LNder LN Extensiv genutzte Wiesen27
genutzte
7275,5211 2654,2417 0665,86 Wenig intensiv
Wiesen5
Streueflächen
Ackerschonstreifen
Buntbrachen
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 192
Total 98 058 ha
Öko-Qualitätsverordnung
Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern, unterstützt der Bund auf der LN ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen mit Finanzhilfen. Die Anforderungen, welche die Flächen für die Beitragsberechtigung gemäss der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) erfüllen müssen, werden durch die Kantone festgelegt. Der Bund überprüft die kantonalen Vorgaben auf Grund von Mindestanforderungen. Entsprechen die kantonalen Anforderungen den Mindestanforderungen des Bundes, und ist die regionale Mitfinanzierung gewährleistet, so leistet der Bund Finanzhilfen an die von den Kantonen ausgerichteten Beiträge an die Landwirte. Die Finanzhilfen des Bundes betragen 80% der anrechenbaren Beiträge. Die restlichen 20% müssen durch Dritte (Kanton, Gemeinde, Private, Trägerschaften) übernommen werden. Beiträge für die biologische Qualität und die Vernetzung sind kumulierbar. Die Verordnung beruht auf Freiwilligkeit, finanziellen Anreizen und der Berücksichtigung regionaler Unterschiede bezüglich der Biodiversität.
Anrechenbare Ansätze
Ansätze 2007Fr.
– für die biologische Qualität500.–/ha
– für die biologische Qualität der Hochstamm-Feldobstbäume20.–/Baum
– für die Vernetzung500.–/ha
Eine ökologische Ausgleichsfläche trägt vor allem dann zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei, wenn sie bestimmte Zeigerarten und Strukturmerkmale ausweist und/oder an einem ökologisch sinnvollen Standort liegt. Während sich der Bewirtschafter einer ökologischen Ausgleichsfläche für die biologische Qualität direkt anmelden kann, braucht es für die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen ein Konzept, das mindestens eine landschaftlich und ökologisch begründbare Einheit abdeckt.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 193
Beiträge1 gemäss Öko-Qualitätsverordnung 2007
1 Kürzungen, Rückforderung und Nachzahlung nicht berücksichtigt
2 Hochstamm umgerechnet (1 Stück = 1 Are)
Beiträge1 für biologische Qualität und Vernetzung 2007
Extensiv genutze Wiesen, wenig intensiv genutze Wiesen, Streueflächen
1 Kürzungen, Rückforderung und Nachzahlung nicht berücksichtigt
2 Als Verbund der beiden Programme Quelle: BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 194
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl10 0487 9399 62327 610 Fläche 2 ha15 75912 67723 55251 989 Fläche 2 pro Betriebha1,571,602,451,88 Beitrag pro BetriebFr.1 0071 1071 3721 163 Total Beiträge1 000 Fr.10 1188 79013 19932 107 Total Beiträge 20061 000 Fr.9 6428 52912 08630 256
Quelle: BLW
MerkmalEinheitNur NurBiologische biologische VernetzungQualität und QualitätVernetzung 2
BetriebeAnzahl 9 77613 4748 029 Flächeha11 74512 71712 538 Beiträge1 000 Fr.4 5395 0729 770 Hecken, Feld- und Ufergehölze BetriebeAnzahl 5082 8831 144 Flächeha114518289 Beiträge1 000 Fr.44236233 Hochstamm-Feldobstbäume BetriebeAnzahl 3 6659 0703 947 BäumeStück222 541304 938206 331 Beiträge1 000 Fr.3 4971 2094 090 Andere Elemente BetriebeAnzahl -7 137Flächeha-6 729Beiträge1 000 Fr.-3 423-
Tabelle 35, Seite A39
Ökologische Ausgleichsflächen mit Qualität (inklusive Hochstammbäume)
Quelle: BLW GG25 ©Swisstopo
Ökologische Ausgleichsflächen mit Vernetzung (inklusive Hochstammbäume)
Quelle: BLW GG25 ©Swisstopo

2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 195
0 1–5 6–10 11–20 >20 Sömmerung in % der LN
Werte pro Gemeinde
0 1–5 6–10 11–20 >20 Sömmerung in % der LN
Werte pro Gemeinde
Extensive Produktion von Getreide und Raps
Diese Massnahme hat zum Ziel, den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren, Fungizide, chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide zu fördern. Der Beitrag betrug Fr. 400 pro ha. Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps

2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 196
2007 MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl9 7415 47461115 826 Flächeha55 04520 3841 48476 913 Fläche pro Betriebha5,653,722,434,86 Beitrag pro BetriebFr.2 2481 4879711 935 Total Beiträge1 000 Fr.21 8988 13859330 629 Total Beiträge 20061 000 Fr.21 8068 59969031 094 Quelle: BLW Aufteilung der Extensofläche 2007 Brotgetreide 54% Raps 7% Futtergetreide 39% Quelle: BLW Total 76 913 ha
Tabelle 36, Seite A40
Biologischer Landbau
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform. Um Beiträge zu erhalten, müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der Bio-Verordnung erfüllen. Ausnahmen von der Gesamtbetrieblichkeit bestehen für den Weinbau und für Obstanlagen.
Beim biologischen Landbau wird auf chemisch-synthetisch hergestellte Hilfsstoffe, wie Handelsdünger oder Pestizide, gänzlich verzichtet. Dies spart Energie und schont Wasser, Luft und Boden. Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig, die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen. Insgesamt erreicht der Biolandbau eine höhere Effizienz in der Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit des Produktionssystems.
Der Verzicht auf Herbizide fördert die Entwicklung zahlreicher Beikrautarten. Wo eine vielfältige Flora vorhanden ist, finden auch mehr Kleinlebewesen Nahrung. Dies wiederum verbessert die Ernährung der räuberisch lebenden Gliedertiere, wie der Laufkäfer, und damit die Voraussetzungen für eine natürliche Bekämpfung von Schädlingen. Zahlreicher vorkommende Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen machen das Ökosystem robuster gegen Störungen und Stress.
Durch die organische Düngung, die schonende Bodenbearbeitung und den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel fördert der Biobaulandbau eine grosse Menge und Vielfalt an Bodenorganismen. Die Bodenfruchtbarkeit wird durch die biologische Aktivität gefördert. Es wird Humus angereichert, die Bodenstruktur verbessert und die Bodenerosion vermindert.
Um eine optimale Abstimmung von Pflanzen, Boden, Tier und Mensch im Betrieb zu erreichen, wird im Biolandbau die Schliessung der Nährstoffkreisläufe auf dem Betrieb angestrebt. Erreicht wird dies durch die Bindung der Tierhaltung an die betriebseigene Futtergrundlage. Der Anbau von Leguminosen verbessert das Stickstoffangebot im Boden. Hofdünger und organisches Material aus Gründüngungen und Ernterückständen stellen über die Ernährung der Bodenlebewesen eine ausgewogene Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen sicher.
In der Nutztierhaltung müssen die RAUS-Anforderungen erfüllt sein. Sie bilden die Minimalanforderungen für die Tierhaltung im Biolandbau. Als weitere Massnahme ist der vorbeugende Einsatz von Medizinalfutter verboten. Die Verwendung von grösstenteils betriebseigenem Futter soll eine angemessene Leistung und eine gute Gesundheit der Tiere sicherstellen. Natürliche Heilmethoden kommen im Bedarfsfall vorrangig zur Anwendung.
Im Jahr 2007 umfasste der biologische Landbau 10,9 % der gesamten LN.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 197
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 198 Ansätze 2007Fr./ha – Spezialkulturen1 200 – Offene Ackerfläche ohne Spezialkulturen800 – Grün- und Streueflächen200 Beiträge für den biologischen Landbau 2007 MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl1 1771 3743 5316 082 Flächeha21 89723 30468 330113 531 Fläche pro Betriebha18,6016,9619,3518,67 Beitrag pro BetriebFr.7 4214 1363 8674 616 Total Beiträge1 000 Fr.8 7355 68313 65628 074 Total Beiträge 20061 000 Fr.8 8805 79913 99328 672 Quelle: BLW
Talregion 19% Bergregion 60% Quelle: BLW Total 113 531 ha Hügelregion 21%
Tabelle 33a, Seite A33
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche nach Region 2007
Ethoprogramme
Unter dem Begriff Ethoprogramme werden die Programme «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) und «Regelmässiger Auslauf im Freien» (RAUS) zusammengefasst (vgl. auch Abschnitt 1.3.2).
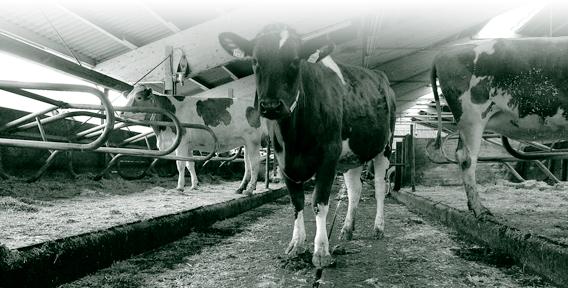
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen, welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen.
BTS-Beitragsansätze 2007Fr./GVE – Tiere der Rindergattung ohne Kälber, Ziegen, Kaninchen 90
– Zuchthennen und -hähne, Legehennen, Junghennen und -hähne, Küken280
– Mastpoulets und Truten180
BTS-Beiträge 2007
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 199
– Schweine155
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl8 9055 7953 94918 649 GVEAnzahl264 135134 21368 636466 984 GVE pro BetriebAnzahl29,6623,1617,3825,04 Beitrag pro BetriebFr.3 3212 5971 7692 767 Total Beiträge1 000 Fr.29 56915 0486 98551 602 Total Beiträge 20061 000 Fr.28 35014 7186 68149 749 Quelle: BLW
■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
Tabelle 37, Seite A41
■ Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren, auf einer Weide oder in einem Laufhof bzw. in einem Aussenklimabereich, der den Anforderungen der RAUS-Verordnung entspricht.

RAUS-Beitragsansätze 2007Fr./GVE –Tiere der Rinder- und Pferdegattung, Bisons, Schafe, Ziegen, Dam- und Rothirsche sowie Kaninchen180 – Schweine155 – Geflügel 280 RAUS-Beiträge 2007 MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl13 96111 20112 73637 898 GVEAnzahl386 804267 199237 348891 352 GVE pro BetriebAnzahl27,7123,8518,6423,52 Beitrag pro BetriebFr.4 7854 1913 3324 121 Total Beiträge1 000 Fr.66 81046 94742 437156 194 Total Beiträge 20061 000 Fr.65 11246 33342 053153 498 Quelle: BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 200
Tabelle 39, Seite A43
Sömmerungsbeiträge
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege der ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden. Das Sömmerungsgebiet wird mit rund 300'000 GVE genutzt und gepflegt. Der Viehbesatz wird nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Nutzung festgelegt. Man spricht dabei vom sogenannten Normalbesatz. Ausgehend vom Normalbesatz werden die Beiträge nach Normalstoss (NST) ausgerichtet. Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen.
Ansätze 2007Fr.
–Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe pro GVE (56–100 Tage Sömmerung)300
–Für Schafe ohne Milchschafe pro NST
– bei ständiger Behirtung300
– bei Umtriebsweide220
– bei übrigen Weiden120
–Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 300
Sömmerungsbeiträge 2007
1Bei dieser Zahl handelt es sich um das Total der beitragsberechtigten Sömmerungsbetriebe (ohne Doppelzählungen)
Quelle: BLW
Seit dem Beitragsjahr 2003 werden differenzierte Sömmerungsbeiträge für Schafe (ohne Milchschafe) nach Weidesystem ausgerichtet. Mit den höheren Beiträgen für die ständige Behirtung und Umtriebsweide werden einerseits die höheren Kosten abgegolten, andererseits wird, in Analogie zu den Ökobeiträgen, der Anreiz für eine nachhaltige Schafalpung erhöht. Eine ständige Behirtung bedeutet, dass die Herdenführung durch einen Hirten mit Hunden erfolgt und die Herde täglich auf einen vom Hirten ausgewählten Weideplatz geführt wird. Bei einer Umtriebsweide hat die Beweidung während der ganzen Sömmerung abwechslungsweise in verschiedenen Koppeln zu erfolgen, die eingezäunt oder natürlich klar abgegrenzt sind.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 201
bzw. NST 1 000 Fr.Anzahl Anzahl Kühe, Milchziegen und Milchschafe15 9692 05353 316 Schafe ohne Milchschafe5 10993524 824 Übrige Raufutter verzehrende Tiere71 0466 693237 046 Total92 1247 299 1 Total 200691 6967 336 1
MerkmalBeiträgeBetriebeGVE
■ Nachhaltige Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete
Tabellen 40a–40b, Seiten A44–A45
Schafsömmerung nach Weidesystem 2007
Entwicklung der Sömmerung 2000–2007:
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 202
WeidesystemBetriebeTiere mit Beiträge Beiträgen AnzahlNST1 000 Fr. Ständige Behirtung948 3852 516 Umtriebsweiden2085 4901 203 Übrige Weiden61310 0381 200 Kombination von Weidesystemen20910190 Total93524 8245 109 Total 200695524 5354 967 Quelle: BLW
gesömmerte Tiere in Normalstössen
Tierkategorien Jahr20002001200220032004200520062007 TierkategorieEinheiten MilchküheBetriebe4 9614 7124 6004 4904 3534 3014 2594 662 Stösse118 793118 021116 900116 679111 123112 858110 070118 919 Mutter- und AmmenküheBetriebe1 2801 1601 2271 3541 4341 5121 5921 643 Stösse13 85414 48615 71517 94918 90421 22722 66224 962 Andere RindviehBetriebe6 6846 4536 5036 4256 3586 3196 3326 294 Stösse134 457129 217127 946126 910121 169120 421118 060122 562 Tiere der PferdegattungBetriebe1 1321 0861 0751 0841 0631 0791 0561 024 Stösse4 6524 3154 3644 3404 3474 5154 5584 550 SchafeBetriebe1 1731 1451 1041 1501 1111 0761 053993 Stösse29 67826 17224 71026 63325 81326 85626 08625 803 ZiegenBetriebe1 7001 6231 6671 6691 6571 6481 6151 557 Stösse5 1655 2145 4345 6625 6645 9775 8575 926 Andere gesömmerte TiereBetriebe22289277241240236225223 Stösse60899764735541496497518 Ein Stoss = 1 GVE * Dauer / 100 Quelle:
Betriebe,
nach
BLW
Beiträge für den Gewässerschutz
Seit 1999 ermöglicht Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes dem Bund, Massnahmen der Landwirtschaft zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in ober- und unterirdische Gewässer abzugelten. Die Arbeitsgruppe Nitrat des Bundes betreut die Umsetzung auf nationaler Ebene. Geleitet wird die Arbeitsgruppe vom BLW. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind neben dem BLW Vertreter und Vertreterinnen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU), der Konferenz der Vorsteher der Landwirtschaftsämter der Schweiz (KOLAS) und der Beratungszentrale AGRIDEA. Das Schwergewicht des Programms liegt bei der Reduktion der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen, in denen der ÖLN, der Biolandbau, Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso, ökologischer Ausgleich) nicht genügen.

Im Jahre 2007 waren insgesamt 25 Projekte in der Umsetzung: 20 Nitratprojekte, 3 Phosphorprojekte und 2 Projekte im Bereich Pflanzenschutzmittel (PSM). Die drei Phosphorprojekte der Mittellandseen und 8 Nitratprojekte sind in der 2. Projektphase. Rund 10 neue Projekte sind in Vorbereitung.
Gemäss der Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet, für ober- und unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen. Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen für die Betriebe mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und 50% für Bewirtschaftungsmassnahmen.
Im Jahr 2007 wurden rund 5,9 Mio. Fr. ausbezahlt.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 203
■ Abschwemmungen und Auswaschung von Stoffen verhindern
Überblick über die Projekte 2007
Der geringe Rückgang der gewährten Beiträge im Vergleich zu 2006 ist auf Beiträge für bauliche Strukturmassnahmen zurückzuführen, welche im Jahr 2007 in kleinerem Umfang ausfielen.
KantonRegion, Geplante StoffProjekt-Projektierte Beiträge GemeindeProjektdauergebietGesamtkosten2007 JahrhaFr. Fr. AGBaldingen2004–2009Nitrat69281 40025 728 AGBirrfeld2002–2007Nitrat8131 909 500177 914 AGWohlenschwil2001–2009Nitrat62547 69652 172 AGKlingnau2007–2012Nitrat101486 60010 506 AGHallwilersee2001–2010 1 Phosphor1200851 398124 902 FRAvry-sur-Matran2000–2011 1 Nitrat37405 73927 133 FRCourgevaux2003–2008Nitrat27164 83820 880 FRDomdidier2004–2009Nitrat30195 58822 677 FRFétigny2004–2009Nitrat631 526 110107 716 FRLurtigen2005–2010Nitrat2861 218 964100 500 FRTorny (Middes) 2000–2012 1 Nitrat45369 85321 817 FRSalvenach2005 2 Nitrat13.5202 334LUBaldeggersee2000–2010 1 Phosphor5 60018 800 7821 856 306 LUSempachersee2005–2010 1 Phosphor4 90517 577 4551 432 713 LUHallwilersee2001–2010 1 Phosphor3 7867 312 967954 917 SHKlettgau2001–2012 1 Nitrat3574 049 470186 437 SOGäu I2000–2008 1 Nitrat6582 220 050218 445 SOGäu II2003–2008Nitrat8501 217 040186 000 VDBavois2005–2010Nitrat5178 98522 333 VDBofflens2005–2010Nitrat112580 10074 421 VDBoiron/Morges2005–2010PSM2 2501 313 10045 847 VDMorand/Montricher2000–2013 1 Nitrat4031 082 996128 622 VDThierrens1999–2011 1 Nitrat17333 57026 738 VDSugnens2007–2012Nitrat16129 90017 298 ZHBaltenswil2000–2008 1 Nitrat und PSM130712 00041 926 Total 63 668 4355 889 747 Total 2006 6 269 542 1 Verlängerungen verfügt 2 Projekt
Rahmen
Güterregulierung
im
einer
mit einmaligem Beitrag im Jahre 2005
Quelle: BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 204
Neuerungen 2008/2009
Mit den Beschlüssen vom 14. November 2007 und vom 25. Juni 2008 hat der Bundesrat im Rahmen der Umsetzung zur AP 2011 einige Änderungen vorgenommen.
Ökologischer Ausgleich
–Einführung des neuen Elements Saum auf Ackerfläche von der Tal bis in die Bergzone II;
–Senkung der Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen von der Talzone bis in die Bergzone II.
Öko-Qualität
–Neue Beiträge für die biologische Qualität von extensiv genutzten Weiden, Waldweiden und Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt;
–Erhöhung der Beiträge im Bereich biologische Qualität und Vernetzung für verschiedene Elemtente bis in in die Bergzonen III und IV; –Konkretisierung der Anforderungen an die Vernetzung.
Ethoprogramme
–Die bis dahin geltende BTS- und die RAUS-Verordnung werden in der Ethoprogrammverordnung zusammengefasst;
–Anpassung der Tierkategorien der Rindergattung infolge Neuregelung der massgebenden Tierzahlen (TVD);
–Neues BTS-Programm für über 30 Monate alte Tiere der Pferdegattung;
–Kategorie «Zuchtschweine» in vier Kategorien unterteilt.
Sömmerungsbeiträge
–Ab 2009 stehen neu 10 Mio. Fr. mehr für die Unterstützung der Sömmerung zur Verfügung;
–Der Beitrag pro Normalstoss wird um Fr. 20 erhöht (ausser für Schafe bei übriger Weide);
–Zufuhr von Futter wird begrenzt;
–Für die Zufuhr von alpfremden Düngern ist künftig die Bewilligung der zuständigen kantonalen Fachstelle notwendig.
Gewässerschutz
–Die Bestimmungen des neuen Finanzausgleichs gelten auch für Gewässerschutzprojekte;
–Neu werden zwischen dem Bund und den Kantonen Vereinbarungen erstellt, welche die Zielvorgaben, die Umsetzung der Massnahmen sowie die Auszahlungsmodalitäten regeln.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 205
Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen (Ressourcenprogramm)
Gemäss Artikel 77 LwG fördert der Bund ab dem Jahr 2008 die Verbesserung der Nutzung von natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft mit Beiträgen. Die Zielbereiche sind die für die landwirtschaftliche Produktion benötigten Ressourcen wie Stickstoff, Phosphor und Energie, die Optimierung des Pflanzenschutzes sowie der verstärkte Schutz und die nachhaltigere Nutzung des Bodens, der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft und der Landschaft.
–Die Massnahmen müssen über die Anforderungen der Gesetze, des Ökologischen Leistungsnachweises oder anderweitiger Förderprogramme des Bundes wie der Öko-Qualitätsverordnung hinausgehen;
–Die auf 6 Jahre befristeten Beiträge sollen neuen Techniken und Organisationsformen sowie strukturellen Anpassungen zum Durchbruch verhelfen, die Verbesserungen in diesen Bereichen bringen;
–Unterstützt werden Massnahmen, zu deren Einführung eine finanzielle Unterstützung notwendig ist und die in absehbarer Zeit ohne Bundesunterstützung weitergeführt werden;
–Die Teilnahme an den Massnahmen ist freiwillig.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 206
■ Ausgangslage und Auftrag
Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems (WDZ)
In der seit 1992 laufenden Reform der Agrarpolitik ist die Bedeutung der Direktzahlungen laufend gewachsen; schrittweise wurde der Grenzschutz und die interne Marktstützung abgebaut und die Mittel zur direkten Abgeltung der multifunktionalen Leistungen aufgestockt.
Die Beratungen zur Agrarpolitik 2011, deren Kern eine weitere Umlagerung von Geldern aus der Marktstützung zu den Direktzahlungen darstellt, hat im Parlament Diskussionen über Höhe und Ausgestaltung der Direktzahlungen ausgelöst. Das Parlament hat schliesslich der vom Bundesrat vorgeschlagenen Richtung zugestimmt, verlangte jedoch in einer Motion, dass der Bundesrat bis 2009 einen Bericht vorlegt, welcher eine Beurteilung ermöglicht, ob und wie das Direktzahlungssystems nach 2011 weiterzuentwickeln sei (Motion WAK-S, 06.3635). Dabei sind verschiedene Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Den Kern der Motion bildet aber die Forderung nach einem möglichst zielgenauen Einsatz der Mittel im Hinblick auf die gewünschte Wirkung.
■ Multifunktionale Leistungen und klar definierte Ziele
Als Grundlage zur Erarbeitung des Berichts dient Artikel 104 der Bundesverfassung aus dem Jahre 1996. Dieser stellt eine solide Ausgangslage dar und bildet den gemeinsamen Nenner der Erwartungen an die Landwirtschaft ab, wie auch eine Befragung der Universität St. Gallen im Jahr 2007 klar bestätigt hat.
Der Verfassungsartikel besagt in Absatz 1, dass der Bund dafür sorgt, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur (a) sicheren Versorgung der Bevölkerung, (b) zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft und (c) zur dezentralen Besiedlung des Landes. Implizit kommt als weiteres Ziel das Tierwohl hinzu, denn in Absatz 3 heisst es, dass der Bund mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen Produktionsformen fördert, die besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlich sind. Als weiteres agrarpolitisches Ziel spielt auch die Einkommenssicherung politisch eine Rolle. Der Verfassungsartikel hält dazu fest, dass der Bund das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen ergänzt zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen.
Um staatliche Massnahmen auf diese Ziele auszurichten, müssen Letztere konkretisiert werden. Für die Erarbeitung des Berichtes zur Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems müssen diese Ziele beschrieben und wo möglich mittels Indikatoren quantifiziert werden.
Die landwirtschaftliche Produktion hat externe Effekte, sogenannte Externalitäten, zur Folge. Diese können positiver oder negativer Art sein. Der Beitrag der Landwirtschaft zur Versorgungssicherheit, zur Landschaftspflege, zur Erhaltung der Biodiversität und des fruchtbaren Kulturbodens sowie zur dezentralen Besiedlung sind positive Externalitäten. Auf der anderen Seite verursacht die landwirtschaftliche Produktion auch negative Externalitäten im Bereich der natürlichen Lebensgrundlagen (Boden-, Wasserund Luftqualität). Beispiele sind der Eintrag von Schadstoffen mit Gülle in den Boden, Ammoniakemissionen durch Tierhaltung in die Luft oder der Eintrag von Pflanzenschutzmittel in Oberflächengewässer.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 207
■ Effektive und effiziente Instrumente
Ein weiterer Aspekt, welcher einerseits für die Definition der Leistungen und Ziele andererseits aber auch für die Ausgestaltung der Instrumente zu berücksichtigen ist, betrifft die Regionalisierung. Wenngleich die Agrarpolitik grundsätzlich Bundespolitik ist, kann es zur Steigerung der Effizienz Sinn machen, bei regional unterschiedlichen Voraussetzungen auch regionalisierte Ziele und Instrumente zu definieren bzw. gewisse Kompetenzen an die Regionen zu delegieren. Dies kann beispielsweise die Landschaft betreffen, welche je nach Region unterschiedlich ausgeprägt ist, aber auch die negativen Externalitäten, wie die Gewässerbelastung, die z.B. aufgrund der in einer Region ausgeprägten Produktionsrichtung deutlich höher sein kann, als in anderen Landesgegenden.
Ausgehend von der Leistungsbeschreibung, der Definition von Zielen sowie der Festlegung von Indikatoren sollen die Instrumente eines weiterentwickelten Direktzahlungssystems den folgenden Grundprinzipien entsprechend festgelegt werden:
–Die Direktzahlungen werden bezüglich Zielerreichung wirksam und effizient eingesetzt;
–Positive Externalitäten der landwirtschaftlichen Produktion werden mit finanziellen Anreizen gefördert; die Vermeidung von negativen Externalitäten ist keine Leistung, die permanent mit finanziellen Mitteln unterstützt werden kann;
–Die Agrarpolitik ist grundsätzlich eine Bundespolitik. Leistungen, für die eine regional unterschiedliche Zielbeschreibung definiert wird, werden mit regional differenzierten (regionalisierten) Massnahmen gefördert;
–Für unterschiedliche Preis- und Kostenszenarien sollen die Ziele im Grundsatz mit dem gleichen Direktzahlungssystem erreicht werden können, wobei je nach Preisniveau die einzelnen Instrumente mit mehr oder weniger Mitteln ausgestattet werden;
–Die Höhe der Direktzahlungen wird so bemessen, dass die definierten Leistungen durch die Landwirtschaft langfristig erbracht werden können;
–Die Direktzahlungen werden mit anderen Politikbereichen abgestimmt.
■ Weiteres Vorgehen
Die Arbeiten zur Konzeption eines weiterentwickelten Direktzahlungssystems basierend auf den definierten Zielen und Grundprinzipien sind momentan im Gang. In diesen Prozess werden sowohl die interessierten Organisationen (Begleitgruppe) und die Wissenschaft (Beirat) mit einbezogen. So ist eine breite Abstützung des Projektes sichergestellt. Der Bericht wird vom Bundesrat voraussichtlich im ersten Halbjahr 2009 verabschiedet.
Je nachdem wie der Bericht von den vorberatenden Kommissionen aufgenommen wird und in Abstimmung mit den aussenhandelspolitischen Entwicklungen (WTO, Freihandel mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich), wird der Bundesrat später einen konkreten Entwurf zur Änderung des LwG in Form einer Vernehmlassungsunterlage und in der Folge einer Botschaft unterbreiten.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 208
2.3Grundlagenverbesserung
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion sowie die Erfüllung der multifunktionalen Aufgaben. Finanzhilfen für Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen
1inklusive Sanierung der Unwetterschäden 2005 2inklusive ausserordentlicher Beitrag Beratungswesen als Folge des Inkrafttretens des Neuen Finanzausgleichs (NFA) 3inklusive Nachtragskredite zur Feuerbrandbekämpfung
4Übernahme der kantonalen Beiträge als Folge des Inkrafttretens des NFA
5Budget
Quelle: BLW
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt:
–Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Produktionskosten; –Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im ländlichen Raum;
–Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen; –Effiziente und umweltgerechte Produktion; –Ertragreiche, möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte; –Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt; –Genetische Vielfalt.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
Massnahme200620072008 5 Mio. Fr. Beiträge Strukturverbesserungen107 1 92 1 90 1 Investitionskredite695451 Betriebshilfe268 Umschulungsbeihilfen0,20,52 Beratungswesen und Forschungsbeiträge232427 2 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge213 3 9 3 Pflanzen- und Tierzucht222338 4 Total225,2212,5225,0
209 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Gleich lange Spiesse für gewerbliche Kleinbetriebe im Berggebiet
2.3.1Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert, insbesondere im Berggebiet und in den Randregionen. Die Interessen der Öffentlichkeit werden umgesetzt mit der Verwirklichung ökologischer, tierschützerischer und raumplanerischer Ziele wie der naturnahe Rückbau von Kleingewässern, die Vernetzung von Biotopen oder der Bau von besonders tierfreundlichen Stallhaltungssystemen.
Investitionshilfen unterstützen die landwirtschaftlichen Infrastrukturen und ermöglichen somit die Anpassung der Betriebe an die sich ändernden Rahmenbedingungen. Durch die Senkung der Produktionskosten und die Förderung der Ökologisierung wird die Wettbewerbsfähigkeit einer nachhaltig produzierenden Landwirtschaft verbessert. Auch in anderen Ländern, insbesondere in der EU, sind landwirtschaftliche Investitionshilfen wichtige Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raums.
Investitionshilfen werden als Hilfe zur Selbsthilfe für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt. Es stehen zwei Instrumente zur Verfügung: –Beiträge (à fonds perdu) mit Beteiligung der Kantone, vorwiegend für gemeinschaftliche Massnahmen; –Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen, vorwiegend für einzelbetriebliche Massnahmen.
Das Parlament hat im Rahmen der AP 2011 beschlossen, an Bauten und Einrichtungen gewerblicher Kleinbetriebe im Berggebiet Investitionshilfen zu gewähren, sofern diese landwirtschaftliche Produkte verarbeiten und vermarkten und dadurch deren Wertschöpfung erhöhen. Die Betriebe dürfen vor der Investition höchstens 1000 Stellenprozente beschäftigen und müssen eigenständige Unternehmen sein. Ihre Tätigkeit umfasst mindestens die erste Verarbeitungsstufe landwirtschaftlicher Rohstoffe. Mit der Ausweitung der Förderung werden beispielsweise private Käser im Berggebiet den bäuerlichen Käsereigenossenschaften gleichgestellt.

210 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Finanzielle Mittel für Beiträge
Für Bodenverbesserungen, landwirtschaftliche Hochbauten und die Bewältigung der Unwetterschäden 2005 wurden im Jahr 2007 Beiträge im Umfang von 92,4 Mio. Fr. ausbezahlt. Ausserdem genehmigte das BLW neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 85,6 Mio. Fr. Damit wurde ein Investitionsvolumen von 405 Mio. Fr. ausgelöst. Die Summe der Bundesbeiträge an die genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen», da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird.

Genehmigte Beiträge des Bundes 2007
Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
Wegebauten
Wasserversorgungen
Unwetterschäden und andere Tiefbaumassnahmen
Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere andere Hochbaumassnahmen
211 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Tabellen 44–45, Seite A52
Talregion Hügelregion Bergregion 051020152530 Quelle: BLW 62% 11% 27%
Mio. Fr.
Ausbezahlte Beiträge des Bundes an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten 1998–2007
Im Jahre 2007 bewilligten die Kantone für 1’861 Fälle Investitionskredite im Betrag von 275,5 Mio. Fr. Von diesem Kreditvolumen entfallen 81,8% auf einzelbetriebliche und 18,2% auf gemeinschaftliche Massnahmen. Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite, so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren, gewährt werden.
Investitionskredite 2007
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden hauptsächlich als Starthilfe sowie für den Neu- oder Umbau von landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomiegebäuden eingesetzt. Sie werden in durchschnittlich 13,6 Jahren zurückbezahlt. Auf die Massnahme «Diversifizierung» entfallen 55 Fälle mit 5 Mio. Fr.
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen, der gemeinschaftliche Kauf von Maschinen und Fahrzeugen und bauliche Massnahmen (Bauten und Einrichtungen für die Milchwirtschaft sowie für die Verarbeitung, Lagerung und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte) unterstützt.
Im Jahre 2007 wurden den Kantonen neue Bundesmittel von 53,875 Mio. Fr. zur Verfügung gestellt. Diese werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt. Das Umlaufvermögen des seit 1963 geäufneten Fonds de roulement beträgt 2,2 Mrd. Fr.
212 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
FälleBetragAnteil AnzahlMio. Fr.% Einzelbetriebliche Massnahmen1 655224,081,8 Gemeinschaftliche Massnahmen, ohne Baukredite15028,39,8 Baukredite5623,28,4 Total1 861275,5100
Quelle: BLW
■ Finanzielle Mittel für Investitionskredite
1990/92199819992000200120022003200420062007 2005 Mio. Fr. Quelle: BLW 0 20 40 60 80 100 120 140 1197575871029010294,5107,592,4 85
Tabellen 46–47, Seiten A53–A54
Investitionskredite 2007 nach Massnahmenkategorien, ohne Baukredite
0 20406080100120
Kauf Betrieb durch Pächter
1
Wohngebäude Ökonomiegebäude

213 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Starthilfe
Gemeinschaftliche Massnahme 1 Diversifizierung
Mio.
Fr. Talregion Hügelregion Bergregion
Bodenverbesserungen Quelle: BLW
25% 47% 28%
Gemeinschaftlicher Inventarkauf, Starthilfe für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, Verarbeitung und Lagerung landwirtschaftlicher Produkte
■ Betriebshilfe
Soziale Begleitmassnahmen
Die Betriebshilfe wird in Form von zinslosen Darlehen gewährt und dient dazu, eine vorübergehende, unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben. In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen indirekten Entschuldung.
Im Jahr 2007 wurden in 131 Fällen insgesamt 18,4 Mio. Fr. Betriebshilfedarlehen gewährt. Das durchschnittliche Darlehen betrug 140’082 Fr. und wird in 13,8 Jahren zurückbezahlt.
Betriebshilfedarlehen 2007
BestimmungFälleBetrag
AnzahlMio. Fr. Umfinanzierung bestehender Schulden8914,2 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung424,2
Total13118,4
Quelle: BLW
Im Jahr 2007 wurden den Kantonen 5,637 Mio. Fr. neu zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden, die je nach Finanzkraft 20 bis 80% des Bundesanteils betrug. Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt. Das Umlaufvermögen des seit 1963 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufneten Fonds de roulement beträgt zusammen mit den Kantonsanteilen rund 216 Mio. Fr.
■ Umschulungsbeihilfen
Die Umschulungsbeihilfe erleichtert für selbständig in der Landwirtschaft tätige Personen den Wechsel in einen nichtlandwirtschaftlichen Beruf. Sie beinhaltet Beiträge an Umschulungskosten und Lebenskostenbeiträge für Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter, die das 52. Altersjahr noch nicht beendet haben. Die Gewährung einer Umschulungsbeihilfe setzt die Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs voraus. Im Jahre 2007 wurde für einen Fall 75’000 Fr. zugesichert. Insgesamt wurden auf Basis der zugesicherten Umschulungsbeihilfen der Vorjahre an acht in der Umschulung stehende Personen 402’800 Fr. ausbezahlt. Die Umschulungsdauer beträgt, je nach Ausbildung, ein bis drei Jahre. Das Ausbildungsspektrum der Umschulung ist breit und reicht von sozialen Berufen, wie Physiotherapeut, Katechet oder Krankenschwester bis hin zu handwerklichen und kaufmännischen Berufen (Zimmermann, Schlosser, Koch oder Agrokaufmann).
214 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Umfrage bringt genauere Schätzwerte
Bewässerungen in der Schweiz: Stand und Ausblick
Bis heute gibt es keine systematischen und flächendeckenden Datenerhebungen über die bewässerten Flächen und den Wasserbedarf für Bewässerungen in der Schweiz. Deshalb hat die Abteilung Strukturverbesserungen des BLW im Jahr 2006 eine Umfrage zum Stand der Bewässerungseinrichtungen bei den mit Strukturverbesserungen betrauten Amtsstellen der Kantone durchgeführt. Grundlage bildete ein Fragebogen, den die kantonalen Amtsstellen für Strukturverbesserungen zusammen mit den im Bereich Gewässer und Wasserwirtschaft zuständigen Fachstellen ausfüllten. Alle Kantone haben sich beteiligt. Die Qualität der gelieferten Daten unterscheidet sich stark zwischen den Kantonen. Die detaillierten Schätzungen sind jedoch deutlich zuverlässiger als die bisherigen Daten des BLW.
■ Verschiedene Kulturen, diverse Bewässerungstechniken
Nach Angaben der Kantone werden in der Schweiz insgesamt 38’000 ha regelmässig und 12’000 ha gelegentlich bewässert. Verschiedene, auch bedeutende Kantone konnten keine gesicherten Angaben machen. Dort schätzt das BLW, dass mindestens weitere 5’000 ha regelmässig bewässert werden. Das BLW geht davon aus, dass –43'000 ha regelmässig und weitere 12'000 ha in Trockenjahren bewässert werden; –der gesamte Wasserbedarf für ein Trockenjahr 144 Mio. m3 beträgt.
Verteilung der Flächennutzung auf die regelmässig bewässerte Fläche
Total bewässerte Fläche: 43 000 ha
Zusätzlich geschätzt BLW 12%
Andere 16%
Reben 12%
Obst 5%
Wiesland 42%
Kartoffeln 3%
Gemüse 10%
Quelle: BLW
Nach Kulturart aufgeteilt werden 18’000 ha Wiesland, 5’200 ha Reben, 4’400 ha Gemüse, 2’300 ha Obst, 1’200 ha Kartoffeln sowie 6’800 ha andere Kulturen regelmässig bewässert. Gelegentlich bewässert werden 5’100 ha Wiesland, 2’400 ha Gemüse, 800 ha Kartoffeln, 150 ha Obst, 70 ha Reben und 3’600 ha andere Kulturen. Bei der Bewässerung werden unterschiedliche Techniken angewendet. Am verbreitetsten sind Regner, die aus ortsfesten Leitungsnetzen gespiesen werden. Anlagen mit Tropfen- und Mikrobewässerung sind mit einer Fläche von 1’650 ha noch wenig verbreitet. Die subventionierten Anlagen umfassen 17’200 ha, was knapp der Hälfte der von den Kantonen geschätzten regelmässig bewässerten Flächen entspricht.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 215 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Flächenanteile pro Anlagetyp an der gesamten bewässerten Fläche
Total bewässerte Fläche: 55 000 ha
unbestimmt 35%
Mikroirrigation, Tropfenbewässerung 3%
traditionelle Flächenbewässerung 9%
ortsfeste Leitungsnetze mit Regnern 44%
Beregnungsautomaten 8%
Furchenbewässerung 1%
Quelle: BLW
Flächenanteile pro Wasserbezugsart an der gesamten bewässerten Fläche
Total bewässerte Fläche: 55 000 ha
Zusätzlich geschätzt BLW 25%
aus Trinkwasserversorgung 3%
aus Grundwasser 16%
aus Suonen 37%
aus Kanälen und Bächen 8%
aus Flüssen 4%
aus Seen 7%
Quelle: BLW
Zwei Drittel der für die Bewässerung benötigten Wassermenge wird über traditionelle Bewässerungskanäle wie Suonen oder Bisses in das Bewässerungsgebiet geführt. Diese Bezugsart ist vor allem im Wallis vorherrschend. Die Wasserverluste und der Arbeitsaufwand dieser Technik sind vergleichsweise hoch. Die ökologischen, landschaftlichen und kulturhistorischen Aspekte wiegen jedoch diese Nachteile auf. Je rund 5% der Wassermengen werden aus Kanälen und Bächen, aus Flüssen oder aus dem Grundwasser entnommen. Mit nur je 1% hält sich die Entnahmemenge aus Seen sowie aus dem Trinkwassernetz in Grenzen.

216 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Bescheidener Wasserbedarf der Landwirtschaft in der Schweiz
Ein Trend für eine Zunahme der Bewässerung in den letzten Jahren kann aus der Umfrage nicht abgeleitet werden. Die höheren Werte beruhen im Wesentlichen auf genaueren Schätzungen der Kantone.
Die schweizerische Landwirtschaft ist kein Wasserverschwender: Sie braucht für die Bewässerung 12% des Gesamtwasserbedarfs der Schweiz. In Europa sind es 33%, weltweit sogar 70%. Aufgrund der anstehenden Gesuche rechnet das BLW, dass der Wasserbedarf für die landwirtschaftliche Bewässerung in den nächsten Jahren von 144 auf 170 Mio. m3 pro Jahr ansteigt.
Gemessen am durchschnittlichen Gesamtjahresabfluss der Schweiz von 53'000 Mio. m3 beträgt der Bedarf für die Bewässerung lediglich 0,3%. Für die Gesamtbilanz ist dieser Anteil unbedeutend. Der Bewässerungsbedarf wird aber mit dem Klimawandel auch in der Schweiz zunehmen. Zeitlich und regional kann es zu Konkurrenzsituationen mit andern Nutzungen kommen, wie der Bericht «Klimaänderung und die Schweiz 2050» des OcCC (Organe consultatif sur les changements climatiques) aufzeigt. Die scheinbar unbedenkliche Gesamtbilanz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf betrieblicher wie auf regionaler Ebene ökonomische und ökologische Aspekte der Bewässerung zu berücksichtigen sind, die künftig vermehrt eine Rolle spielen werden.
■ Handeln, bevor es zu spät ist
Die Umfrage hat aufgedeckt, dass das Wissen um den Stand der landwirtschaftlichen Bewässerungen sehr heterogen und unbefriedigend ist. Die festgestellten Lücken haben zur Zeit kaum negative Auswirkungen. Die Bewältigung des Hitzesommers 2003 hat jedoch gezeigt, dass im Hinblick auf den Klimawandel eine bessere Kenntnis über die in der Schweiz praktizierte Bewässerungswirtschaft notwendig ist. Dies ist von Vorteil, wenn in künftigen Konkurrenzsituationen die Nutzungsinteressen gegeneinander abgewogen werden, um ökonomisch und ökologisch optimierte Bewässerungssysteme zu entwickeln, oder wenn neue rechtliche Bestimmungen zur Wassernutzung vorbereitet werden.
Das BLW wird auch künftig Gesuche zur Unterstützung von Bewässerungsanlagen zurückhaltend und nach strengen Kriterien beurteilen. Neben der klimatologisch begründeten Bewässerungsbedürftigkeit müssen die Bewässerungswürdigkeit (agronomische und pedologische Aspekte) sowie die Machbarkeit (ökologische und technische Aspekte) ausgewiesen sein.
Erschwerend für einen zuverlässigen Überblick ist, dass keine Koordination zwischen den kantonalen Landwirtschaftsfachstellen und den für Wasserentnahmen zuständigen Ämtern institutionalisiert ist. Hier besteht Handlungsbedarf, ebenso bei der Vereinheitlichung der Aufsicht über den Wasserbezug, der Erfassung der entnommenen Wassermengen sowie der Abstimmung der Tarifstrukturen. Aufgrund der Erfahrungen der Kantone, welche sich bereits heute mit Bewässerungsprojekten beschäftigen, sollten in der Ausbildung von Ingenieuren und Landwirten wieder vermehrt Bewässerungsaspekte einfliessen.
217 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Wasser als Lebensgrundlage
Landwirtschaftliche Hochbauten zur Verbesserung der Wasserqualität
Wasser ist der Hauptbestandteil jeder lebenden Zelle. Es bildet die Grundlage allen Lebens. Nichts kann Wasser ersetzen. Doch die Reinheit von Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Die Auswaschung von Schadstoffen kann ober- und unterirdische Gewässer für Jahre, ja sogar Jahrzehnte verschmutzen. Seit 1999 unterstützt der Bund Projekte im Rahmen von Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes (GSchG). Diese Projekte dienen der Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen, um die Anforderungen an die Wasserqualität der ober- und unterirdischen Gewässer zu erfüllen. Zu diesen Stoffen gehören insbesondere Nitrat, Phosphat und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln.
■ Vom Bund unterstützte Massnahmen der Landwirtschaft
Die Projektinitiative geht von den landwirtschaftlichen Akteuren aus. Diesen steht das BLW mit Ratschlägen und Instrumenten für die Antragserstellung zur Seite. Das Bundesamt für Umwelt wird zu jedem Antrag angehört. Letzteres beurteilt, ob die geplanten Massnahmen einen sachgemässen Gewässerschutz gewährleisten. Der Bund unterstützt Massnahmen der Landwirtschaft, die für diese aus wirtschaftlicher Sicht nicht tragbar sind. Die Höhe der Abgeltungen richtet sich nach den Eigenschaften und der Menge der Stoffe, deren Abschwemmung und Auswaschung verhindert wird. Bei Massnahmen, die Änderungen der Betriebsstruktur erfordern, kann die Höhe der Abgeltungen bis zu 80% der anrechenbaren Kosten betragen. Die verbleibenden 20% müssen durch Eigenmittel des Bewirtschafters bzw. Drittmittel der Privatwirtschaft oder der öffentlichen Hand gedeckt werden.
Geografische Verteilung der im Rahmen von Art. 62a GSchG unterstützten Projekte
Nitratprojekte
Nitratprojekte mit Strukturmassnahmen
Phosphorprojekte
Pflanzenschutzmittel
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
218
Quelle: BLW
■ Das Beispiel der Bekämpfung der Nitratauswaschung
Gesamtschweizerisch befassen sich gegenwärtig zwanzig Projekte mit der Problematik der Nitratbelastung unterirdischer Gewässer. Daneben bestehen drei Phosphatprojekte und zwei Pflanzenschutzmittelprojekte. Im Rahmen der Nitratbekämpfung befinden sich zurzeit sieben Projekte in Planung.
Die Art der Bewirtschaftung ist ein entscheidender Faktor bei der Bekämpfung der Nitratauswaschung. Eine bessere Bodenbedeckung vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass Nitrat über das Sickerwasser in die unterirdischen Gewässer gelangt. Massnahmen wie die Verringerung der offenen Ackerfläche zugunsten von Grünland, die Aufgabe bestimmter Kulturen in sensiblen Zonen (z.B. Kartoffeln, Tabak, Mais und Gemüse), die Einschränkung der Bodenbearbeitung (z.B. Direktsaat statt Pflügen) oder die Umstellung auf biologische Landwirtschaft können einen deutlichen Beitrag zur Problemlösung leisten.
Betriebe, die sich an solchen Projekten beteiligen, müssen ihre Produktionszweige manchmal radikal umstellen, um die Qualitätsziele für ober- und unterirdische Gewässer zu erreichen. Die effizienteste Massnahme zur Nitratbekämpfung ist die Verringerung der Ackerfläche zugunsten von Dauerwiesen. Normalerweise sollten die Ziele hinsichtlich der Wasserqualität erreicht werden, wenn in für Auswaschung sensiblen Zonen der Anteil an Dauerwiesen ein bis zwei Drittel der Gesamtfläche ausmacht.
■ Die Stadt Morges legt Wert auf Trinkwasserqualität
Ein Beispiel für ein Projekt zur Verringerung der Nitratbelastung unterirdischer Gewässer wird im Kanton Waadt umgesetzt. Die Fassung «Puits du Morand» befindet sich auf dem Boden der Gemeinde Montricher und ist im Besitz der Stadt Morges mit ihren über 14'000 Einwohnern. Die beiden Gemeinden liegen über 14 km Luftlinie voneinander entfernt. Seit Beginn der sechziger Jahre stieg der Nitratgehalt des «Puits du Morand» immer weiter an und übertraf 1993 schliesslich den Toleranzwert. Die Stadt Morges leitete verschiedene Massnahmen ein. In einem ersten Schritt wurden rund um die Fassung zirka 15 ha Grünland angelegt. Zur Stärkung der Massnahmen wurde im Jahr 2000 ein Nitratprojekt lanciert. So wurde das Grünland deutlich ausgeweitet (+60 ha), primär in den sensibelsten Zonen des Zuströmbereichs, aus dem rund 90% des gefassten Wassers stammen. Dadurch konnten die durchschnittliche Nitratkonzentration nahe oder gar unter dem Qualitätsziel von 25 Milligramm pro Liter gehalten und die Spitzenwerte gesenkt werden.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
219
Zuströmbereich (Zu)
Schutzzone S1

Schutzzone S2

Schutzzone S3
Puits du Morand
Betrieb

Betriebsfläche
■ Ein Betrieb richtet seine Produktionszweige neu aus
Mehr als 15 Landwirte der Gemeinde Montricher sind von dem Nitratprojekt je nach Parzellenlage der Betriebe in unterschiedlicher Weise betroffen. In der ersten Projektphase (2001–2007) entschied das Landwirtschaftsamt des Kantons Waadt, als Massnahmen zur Bekämpfung der Nitratauswaschung Dauerwiesen anzulegen und grüne Fruchtfolgen (über einen Zeitraum von sechs Jahren mindestens vier bis fünf Jahre Wiese) einzuführen. In der zweiten Projektphase (2007–2013) war das Pflügen von Dauerwiesen und Kunstwiesen innerhalb der grünen Fruchtfolge nicht mehr zulässig. Ein Landwirt, dessen Betriebsfläche sich im Zuströmbereich des «Puits du Morand» und grösstenteils innerhalb der sensiblen Zone befand, entschied sich, auf den Ackerbau zu verzichten und seinen Betreib stattdessen in erster Linie auf die Haltung von Raufutter verzehrenden Tieren umzustellen. Doch eine Ausweitung des Grünlandes bedeutet für den Betrieb auch einen Erhöhung der Raufutterproduktion. Und diese Raufuttermasse muss verwertet werden. Landwirtschaftliche Betriebe, die mit diesem Problem konfrontiert sind, entscheiden sich meist für eine Investition in den Aus- bzw. Umbau der bestehenden Ökonomiegebäude, um den Viehbestand der neuen Raufuttergrundlage anzupassen. Solche Investitionen können von einer Unterstützung gemäss Art. 62a profitieren.

Um Hilfen für die Strukturverbesserungen zu erhalten, verpflichtete sich der Landwirt, die massgebenden Flächen des Grünlandprojekts (16,6 ha) während der kommenden 18 Jahre zu bewirtschaften. Eine Anmerkung im Grundbuch zu den umgewandelten Parzellen stellt die Grünlandbewirtschaftung der betroffenen Flächen sicher.

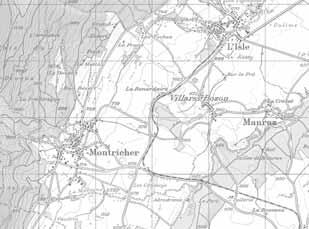
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
220
Gewässereinzugsgebiet des «Puits du Morand»
Quelle: BLW
Das Projekt wurde aus wirtschaftlichen Gründen und zur Hervorhebung der Baukultur lanciert. Der bestehende Anbindstall sollte für die Haltung von Milch- und Ammenkühen der Eringerrasse, deren Fleisch unter einem regionalen Schutzlabel verkauft wird, teilweise umgebaut werden. Der Stall ist auf eine wirtschaftliche Lösung für die Tierhaltung im Laufstall mit Stroheinstreu ausgerichtet. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen die Haltung von 40 Raufutter verzehrenden Grossvieheinheiten (RGVE). Die Bauarbeiten wurden 2006 erfolgreich abgeschlossen.
Die Baukosten beliefen sich auf 676'000 Fr. Die Beteiligung des Bundes im Rahmen von Art. 62a GSchG basiert auf einem Ansatz von 1,95 RGVE pro ha multipliziert mit den Pauschalbetrag von 9'375 Fr. pro RGVE als anrechenbare Kosten (bei einem komplettem Ökonomiegebäude). Aufgrund der teilweisen Wiederverwendung der bestehenden Baugrundlage wurde der Pauschalbetrag um 10% gekürzt. Der Bund übernahm 80% dieses Betrags, was einer Beteiligung à fonds perdu von 218'000 Fr. entspricht. Da sich der Betrieb in hügeligem Gelände befindet, unterstützte das kantonale Meliorationsamt – in diesem Fall das Amt für Raumentwicklung – das Projekt mit einer Beteiligung in Höhe von 75'300 Fr. gemäss den Bestimmungen der Strukturverbesserungsverordnung (SVV). Auch die Stadt Morges leistet einen Projektbeitrag über 27'300 Fr. Die verbleibenden Kosten wurden teilweise mit einem Investitionskredit gemäss SVV über ein zinsloses, rückzahlbares Darlehen von 198'000 Fr. finanziert. Demgegenüber hätte sich eine Unterstützung des Bundes im Rahmen einer Beitragsleistung gemäss SVV auf rund 87'000 Fr. belaufen.

2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
221
■ Ein Bau für die Haltung von Mutter- und Ammenkühen der Eringerrasse
Dieses Bauvorhaben als Teil eines Grossprojekts zur Verbesserung der Trinkwasserqualität einer Stadt garantiert das Wohlbefinden der Tiere und bringt den Reiz der Region besser zur Geltung.
Das Nitratprojekt wird auf einem Gebiet von 403 ha Landwirtschaftsfläche weitergeführt. Ziel ist es, die Nitrat-Spitzenwerte im Wasser des «Puits du Morand» weiter zu reduzieren – und dies bis 2013.
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 222
2.3.2 Landwirtschaftliches Wissenssystem
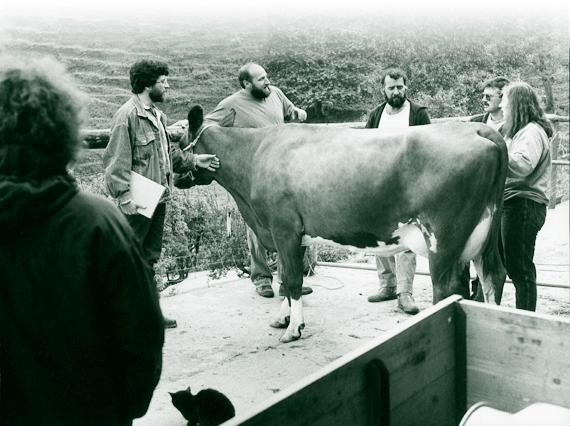
Im Landwirtschaftlichen Wissenssystem vereinigen sich alle Kenntnisse und Erfahrungen zu einem Wissen über die landwirtschaftliche Produktion, ihrer Interaktion mit der biologischen und ökonomischen Umwelt und der weiteren Verwendung der Produkte bis hin zu Aspekten der menschlichen Ernährung.
Die Hauptakteure im Wissenssystem sind die landwirtschaftlichen Produzenten (Landwirte und Landwirtinnen) und Veredelungsbetriebe. Ihr Handeln ist getragen von Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind somit im hohen Masse auf eine fundierte Ausbildung und Beratung angewiesen. Geräte/Maschinen, Methoden und Verfahren auf dem neusten Stand der Technik fördern zudem ihre Leistungsfähigkeit. Bildung, Beratung sowie Technik und Methoden werden durch öffentliche und private Forschung laufend weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklungen zusammen mit den Erfahrungen in der Praxisanwendung bilden die Basis dafür, dass die landwirtschaftliche Produktion auf neue Herausforderungen angemessen reagieren und sich positiv entwickeln kann.
Somit übernehmen neben den Erfahrungen der Praxis Forschung, Bildung und Beratung eine Schlüsselrolle ein. Diese vier Systemeinheiten müssen jedoch in hohen Masse miteinander agieren und kommunizieren.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 223
■ Leistungsauftrag
Agroscope 2008 bis 2011
Forschung
Agroscope, mit den drei landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Agroscope Liebefeld-Posieux ALP sowie Agroscope ReckenholzTänikon ART wird seit acht Jahren mit Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG) geführt. Der Bundesrat hat für eine weitere Vierjahresperiode (2008–2011) einen neuen Leistungsauftrag erteilt.
Über den Zeitraum der nächsten Leistungsauftragsperiode gelten für Agroscope die folgenden übergeordneten Ziele:
Agroscope
–trägt zu einem ökonomisch leistungsfähigen Agrar- und Ernährungssektor bei; –bearbeitet ökologische und ethologische Fragestellungen im Agrarsektor; –trägt zu einer sozialverträglichen Entwicklung des ländlichen Raums, insbesondere des Agrarsektors, bei; –stellt Wissen für zukünftige Herausforderungen bereit, insbesondere wägt Chancen und Risiken neuer Technologien wie GVO ab; –forscht problem- und systemorientiert, denn effektive Problemlösungen erfordern oft transdisziplinäre und innovative Systemansätze; –kommuniziert die Forschungsergebnisse kundengerecht.
■ Noch drei Produktgruppen
Der Leistungsauftrag für Agroscope beinhaltet neu drei Produktgruppen gegenüber bisher vier. Dieser Wechsel steht in engem Zusammenhang mit den auf den 1. Januar 2006 erfolgten Zusammenschlüssen von je zwei Forschungsanstalten zu einer Einheit. Seit 2008 sind zudem ALP und das Nationalgestüt zusammengeschlossen.
– Produktgruppe 1: Pflanzenbau und pflanzliche Produkte.
ACW bildet die Produktgruppe 1; sie bearbeitet die Bereiche Feldkulturen, Weidesysteme und Spezialkulturen. Sie liefert wissenschaftlich-technische Grundlagen, um die Versorgung mit qualitativ hochwertigen und sicheren Nahrungs- und Futtermitteln sicher zu stellen und um die Wettbewerbsfähigkeit durch Entwicklung von Massnahmen zur Produktionskostenoptimierung zu verbessern. Dazu gehören auch Tätigkeiten, mit denen die Umweltverträglichkeit, Qualität, Sicherheit und Marktfähigkeit der Produkte gesteigert werden können.
– Produktgruppe 2: Tierische Produktion und Lebensmittel tierischer Herkunft. ALP bildet die Produktgruppe 2; sie umfasst sämtliche Tätigkeiten, die eine nachhaltige, wettbewerbsfähige Produktion von Milch, Fleisch und Honig sowie deren Verarbeitung zu gesunden, sicheren und qualitativ hochwertigen Produkten zum Ziel haben. Dazu erarbeitet ALP durch eine stark vernetzte Forschung und Beratung entlang der Lebensmittelkette, das heisst vom Futtermittel über die Produktion und Verarbeitung bis zum Lebensmittel, wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Grundlagen für Entscheidungen und Vollzugsmassnahmen.
224 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
– Produktgruppe 3: Agrarökologie und Biolandbau, Agrarökonomie und Agrartechnik.

ART bildet die Produktgruppe 3; sie umfasst die Ökologisierung der Produktion im Bereich Acker- und Futterbau, die Erhaltung und Förderung der Biodiversität sowie die Verminderung von Schadstoffflüssen zwischen dem Agrarraum und der übrigen Umwelt. Zudem umfasst sie die Tätigkeiten, welche die Erarbeitung agrarökonomischer und agrartechnischer Grundlagen für die landwirtschaftliche Praxis und die Agrarpolitik zum Ziel haben.
In den dazugehörenden Wirkungsmodellen werden Impact (Reaktionen der Zielgruppen auf Leistungen) und Outcome (Wirkung des Outputs) zusammenfassend wie folgt beschrieben:
Impact:
–Praxis sowie vor- und nachgelagerte Bereiche wenden neue Erkenntnisse an;
–Beratung und Bildung nutzen die Kompetenzen von Agroscope und vermitteln aktuelles Wissen;
–Politik, Behörden, Verbände und Nichtregierungsorganisationen (NGO) setzen bei Entscheiden das Wissen von Agroscope ein;
–Medien nehmen Arbeiten von Agroscope auf;
–Expertengutachten, Kontrollen, Zertifikate usw. werden nachgefragt.
Outcome:
–Postitive Wahrnehmung der ökologischen und landschaftsgestaltenden Leistungen der Landwirtschaft durch die Bevölkerung;
–Die Bevölkerung hat Vertrauen in schweizerische Produkte und ernährt sich bedarfsgerecht, gesund und nachhaltig;
–Lebensmittel aus der Schweiz können den Marktanteil halten;
–Schweizer Landwirtschaft kann langfristig bestehen und trägt zur dezentralen Besiedlung und zu einem attraktiven ländlichen Raum bei.
Agroscope führt zu zentralen Fragestellungen aus der Landwirtschaft ausgewählte Forschungsprogramme durch. Dabei handelt es sich um koordinierte Forschungsaktivitäten der drei Agroscope Forschungsanstalten und eventuell weiteren Forschungsinstitutionen.
Charakteristische Merkmale der Forschungsprogramme sind die beschränkte Laufzeit mit klar definierten Zielsetzungen, die interdisziplinäre Ausrichtung sowie die Zusammenarbeit mit Stakeholdern, welche die Forschungsresultate direkt nutzen. Der Wissens- und Know-how-Austausch ist ein wesentlicher Bestandteil der Agroscope Forschungsprogramme.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 225 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Agroscope Forschungsprogramme
Drei Programme erstrecken sich über die Leistungsauftragsperiode 2008–2011:
ProfiCrops –Neue Wege für einen zukunftsfähigen Pflanzenbau in der Schweiz. ProfiCrops setzt sich zum Ziel, im weitgehend liberalisierten Markt dem schweizerischen Pflanzenbau eine Zukunft zu sichern und das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in die einheimische Produktion zu stärken.
NutriScope –Gesunde, sichere und qualitativ hochwertige Lebensmittel schweizerischer Herkunft. Nutri-Scope setzt sich zum Ziel, die über Qualität, Sicherheit und Gesundheit entscheidenden Parameter entlang der Lebensmittelkette vom Anbau bis zum verzehrsfertigen Produkt zu optimieren. NutriScope will einen wesentlichen Beitrag zu gesunden Nahrungsmitteln und damit zu einer gesunden Bevölkerung leisten.
AgriMontana –Beiträge der Landwirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung des Berggebiets. Bei AgriMontana werden die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Nutzungssysteme (best practices) in montanen Räumen untersucht. Im Sinne der Politikberatung leistet das Programm einen Beitrag zu einer koordinierten Regional- und Sektoralpolitik (best policies).

Im Frühjahr wurde auf dem Versuchsgelände von ART gentechnisch veränderter Weizen ausgesät. Es handelt sich dabei um die umfangreichsten Freilandsversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen, die je in der Schweiz durchgeführt wurden. Am Reckenholz werden auf einer Fläche von rund einer halben Hektare 6 gentechnisch veränderte Weizen geprüft und mit andern Sorten verglichen. Auf dem Versuchsgelände der ACW in Pully konnte wegen Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht der Versuch 2008 nicht durchgeführt werden.
Der Bundesrat hat das Nationale Forschungsprogramm 59 (NFP 59) gestartet, das Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen untersuchen soll. Die Freilandversuche mit gentechnisch verändertem Weizen sind in das NFP 59 eingebettet. Zur Teilnahme am NFP 59 haben sich die Universität Zürich (Leitung), die ETH Zürich, ART, ACW sowie die Universitäten Basel, Bern, Neuenburg und Lausanne –insgesamt 11 Forschungsgruppen – zum Konsortium Weizen zusammengeschlossen.
226 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Aktive Rolle in der Biosicherheitsforschung
Die Freilandversuche des Konsortiums untersuchen die Auswirkungen von gentechnisch verändertem Weizen auf die Umwelt, sogenannte Biosicherheitsforschung. Im Labor und im Gewächshaus zeigten diese Pflanzen eine erhöhte Resistenz gegen die Pilzkrankheit Mehltau. Im Freilandversuch erforschen zwei Projekte die Resistenz der Pflanzen, sechs Projekte befassen sich mit ökologischen Risiken. Es geht in den einzelnen Projekten des Konsortiums unter anderem darum zu klären:
– Wie die Wirkung der Mehltauresistenz im Freiland ist, und wie stark und wie spezifisch sich der Weizen gegen Mehltau schützen kann (Universität und ETH Zürich);
– Ob gentechnisch veränderte Weizenpflanzen einen Einfluss auf das Bodenleben zum Beispiel Pilze, Bakterien oder Insekten haben (Universität Bern);
– Ob und in welchem Umfang der gentechnisch veränderte Weizen auf Wildpflanzen auskreuzen kann (Universität Neuenburg);
–Ob und wie verschiedene Insekten reagieren, die als Nicht-Zielorganismen (Blattläuse, Getreidehähnchen, Parasitoiden von Blattläusen) mit dem gentechnisch veränderten Weizen in Berührung kommen können (ART);
–Ob der gentechnisch veränderte Weizen gegenüber gentechnisch nicht verändertem Weizen eine erhöhte Konkurrenzkraft besitzt (Universität Zürich);
–Ob der gentechnisch veränderte Weizen auf benachbarte Felder auskreuzen kann oder nicht (ART).
Zudem wird untersucht, ob die gentechnisch veränderten Weizenpflanzen auch die gewünschten Eigenschaften besitzen, für die sie gezüchtet wurden. Weiter interessiert, welche Wirkung die gentechnische Veränderung auf die Eigenschaften der Pflanzen wie Ertrag oder Backqualität hat. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit den Eigenschaften der Ausgangssorten und anderen Neuzüchtungen verglichen.
ACW und ART sind durch das vorhandene spezifische Wissen zur Biosicherheit in der Landwirtschaft prädestiniert, sich beim Konsortium Weizen aktiv zu beteiligen. Dabei müssen sie die hohen Sicherheitsauflagen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) befolgen. Agroscope verfügt über ein umfassendes Wissen bei der Anlage und Betreuung landwirtschaftlicher Feldversuche. Beide Standorte befinden sich in einem urbanen Umfeld und nahe bei involvierten Universitäten.
Leider wurde der Versuch durch maskierte Aktivisten beträchtlich zerstört. Betroffen von der Zerstörung sind vor allem die Untersuchungen zur biologischen Sicherheit dieser Pflanzen.
Die Forschung wird keine direkte Antwort auf die Frage liefern, ob der kommerzielle Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Schweiz erfolgen soll oder nicht. Aber sie wird mit wissenschaftlichen Grundlagen zu einer sachlicheren Diskussion im politischen Entscheidungsprozess beitragen.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 227 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Ziele der Freilandversuche
■ Obstbauforschung

Der Feuerbrand hat sich im Jahr 2007 stark ausgebreitet (vgl. Kapitel 2.3.3). In der Motion von Nationalrat Walter Müller vom 21. Juni 2007 wird der Bundesrat aufgefordert die Grundlagenforschung für den Obstbau –besonders im Bereich Feuerbrand –deutlich auszubauen, damit der professionelle Obstbau langfristig gesichert werden kann.
Angesichts der Dringlichkeit der Fragestellung und der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Obstbaues beschloss das Parlament während einer befristeten Dauer von vier Jahren (2008–2011) mehr Mittel für die entsprechenden Forschungskredite im Umfange von 0,5 Mio. Fr. pro Jahr vorzusehen und diese gezielt in Projekte der Obstbauforschung einzusetzen. Die Ressourcen werden haushaltsneutral durch Umschichtungen innerhalb der bewilligten Kredite zur Verfügung gestellt.
Das Kompetenzzentrum Feuerbrandforschung von ACW kann Forschungsprojekte schneller und umfassender umsetzen; insbesondere:
–Resistenzmonitoring und Abklärung ökotoxikologischer Aspekte im Falle der Zulassung von Streptomycin;
–Entwicklung alternativer Bekämpfungsstrategien für den Bio- und IP-Obstbau (Antagonistenforschung, Anbaustrategien Nieder- und Hochstammanlagen, Verstärkung der Obstbaubakteriologie);
–Validierung und Implementierung neuer Diagnostikmethoden;
–Züchtung feuerbrandresistenter Apfel- und Birnensorten, dies in Zusammenarbeit mit ETH und privaten Unternehmen.
Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) untersucht bio-spezifische Aspekte der Feuerbrandbekämpfung, wie z.B. die Wirkungsoptimierung der Anwendung bio-tauglicher Bekämpfungsmittel.
Das BLW hat eine Begleitgruppe Obstbauforschung Feuerbrand (BegObst) eingesetzt. Die Produzenten wie auch Umweltkreise erwarten, dass praxisorientiert geforscht wird. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, bzw. diese dort wo notwendig zu relativieren, sind ein koordiniertes Vorgehen, eine Diskussionskultur, ein aktiver Wissensaustausch und Kommunikation notwendig.
228 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Feuerbrand
Schweizerisches Nationalgestüt
Das Schweizer Nationalgestüt in Avenches unterstützt landesweit eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und tiergerechte landwirtschaftliche Pferdehaltung und -zucht, die auch den übrigen Zielsetzungen der Agrarpolitik entspricht. In diesem Rahmen nimmt neben der Haltung von Freibergerhengsten und praxisorientierter Forschung insbesondere der Wissensaustausch eine zentrale Rolle ein. Neben einer Beratungsstelle und einem Dokumentationszentrum sowie dem vor vier Jahren eingeführten und jeweils ein Jahr dauernden Pferdehalter-Kurs Equigarde® wurde neu im September 2007 in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Hochschule Zollikofen und der Pferdeklinik der Universität Bern zusätzlich das Studium «Pferdewissenschaften» lanciert.
Zur Situation des Pferdes und der Pferdehalter liegt vielerorts die irrtümliche Vorstellung vor, dass es sich hierbei um eine «reiche Gesellschaft handelt, die am Wochenende mit teuren Fahrzeugen zu den Springprüfungen fährt». Einst Nutztier für die Landwirtschaft und das Militär, hat das Pferd heute als Freizeitpartner auch die weniger wohlhabenden Kreise und die Frauenwelt erobert. Im Laufe der letzten 20 Jahre stieg der Equiden-Bestand in der Schweiz um nicht weniger als 53,1%, auf 85'000 Tiere. Davon werden 85% in Landwirtschaftsbetrieben gehalten und schätzungsweise 10% der LN wird für Equiden verwendet. Die Haltung und Zucht von Pferden ist somit Teil der regionalen und ländlichen Entwicklungspolitik und trägt zur Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Gebiete bei.
Seit der schrittweisen Aufhebung der Pferdetruppen und dem gleichzeitigen Abbau der landwirtschaftlichen Ausbildung im Pferdebereich werden die Kenntnisse über die Haltung und die Pflege von Pferden nicht mehr so effizient weitergegeben. Nur 24% der Halter verfügen über eine entsprechende Ausbildung; ein Drittel hat spezifische Kenntnisse in der Pferdehaltung. Pferdespezifische Ausbildungen werden derzeit nur für die Berufe Bereiter und Reitlehrer, Rennjockey, Tierarzt und Hufschmied angeboten. Bis zur Einführung des Ausbildungsgangs Equigarde® durch das Nationalgestüt gab es kein spezifisches und vollständiges Weiterbildungsangebot über die Zucht und Pflege von Pferden. Die Pferdebranche ist sich darin einig, dass die Pferdehaltung nachhaltig verbessert werden kann, indem die Ausbildung verstärkt wird.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 229 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Rolle des Pferdes und Ausbildung der Pferdeleute in der Schweiz –aktuelle Zahlen
Die Partner Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL) in Zollikofen, Nationalgestüt und Pferdeklinik der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern haben auf die entstandene Nachfrage reagiert und ein entsprechendes Angebot entwickelt: ein Bachelor-Studium in Agronomie mit Vertiefung (Major) in Pferdewissenschaften.
Organisiert wird der Studiengang durch die SHL, der Unterricht findet aber an allen drei Institutionen statt. Die Studierenden profitieren somit von den Kompetenzen und Infrastrukturen dieser drei Institutionen.
Die Resonanz auf das Studium «Pferdewissenschaften» hat die Erwartungen übertroffen. So haben nach kurzer Vorankündigung im September 2007 17 Studentinnen und Studenten das Studium aufgenommen. Bei einer Gesamtdauer von 6 Semestern gelten die ersten beiden Semester als Grundstudium und sind für alle SHL-Studierende mehr oder weniger identisch. Ab dem dritten Semester beginnt das Fachstudium der Agronomie mit den Vertiefungen in den Pferdewissenschaften. Über ein Dutzend teils obligatorische, teils frei wählbare Module werden angeboten. Sie decken alle Themenfelder ab: Geschichte der Pferdehaltung, Physiologie und Anatomie, Rassenkunde, Ernährung, medizinische Aspekte, Reproduktion, Ethologie, Sport und Training usw. Weitere Module vermitteln für Führungsaufgaben relevante Grundkenntnisse in Management, Recht, Marketing, Kommunikation usw. Dabei wird der für die Pferdehaltung notwendigen Praxis Raum eingeräumt. Unter anderem absolvieren alle Studiengänger vorgängig ein einjähriges landwirtschaftliches Praktikum mit Bezug zu Pferden.
Erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen stehen verschiedenste Tätigkeitsfelder offen: in Führungs-, Beratungs- und Kommunikationsfunktionen in der Pferdebranche oder als Spezialistinnen und Spezialisten in der Forschung.

230 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Einführung des Studiums der Pferdewissenschaften
■ Kein weiterer Abbau bei der kantonalen Beratung
Beratung
Die Beratung unterstützt all jene Personen in der beruforientierten Weiterbildung, die in der Landwirtschaft, der bäuerlichen Hauswirtschaft, landwirtschaftlichen Organisationen oder im Rahmen der Entwicklung des ländlichen Raums sowie in der Sicherung und Förderung der Qualität landwirtschaftlicher Produkte tätig sind. Dies sieht Artikel 136 des LwG vor, der auf Anfang 2008 überarbeitet wurde. Gleichzeitig setzt er die Vorgaben der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) um. Demnach sind für die kantonale Beratung die Kantone alleine zuständig, während der Bund weiterhin die Beratungszentralen von AGRIDEA und einige Spezialberatungsdienste von landwirtschaftlichen Organisationen unterstützt. Die letzten Überweisungen des Bundes an die kantonalen Beratungsdienste erfolgten im Verlauf des Jahres 2008.
Ausgaben des Bundes für die Beratung 2007
Landwirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone8,6 Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone0,6 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen0,8 AGRIDEA (Beratungszentralen Lausanne und Lindau)8,0
Total18,0
Quelle: Staatsrechnung
Ende 2007 leistete der Bund Finanzhilfen an 473 Personen (ohne nebenamtliche Beratungskräfte), die in den kantonalen landwirtschaftlichen Beratungsdiensten tätig sind. Dies entspricht 224 Vollzeitstellen. Hinzu kommen rund 18 Stellen in der bäuerlich-hauswirtschaftlichen Beratung. Die AGRIDEA beschäftigt in ihren Beratungszentralen 140 Mitarbeitende, was 108 Vollzeitstellen entspricht.
Seit 2005 wurden somit in der kantonalen Beratung keine weiteren Stellen mehr abgebaut. Gegenüber der Situation im Jahr 1998 zeigt sich aber ein Abbau von etwa 8% der Stellen.
Entwicklung der kantonalen Beratung
Landwirtschaftliche Beratungsdienste243237222224
Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienstek. A.241918
Total261241242
Quelle: BLW
231 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
EmpfängerBetrag Mio. Fr.
Empfänger1998200320052007 subventionierte Vollzeitstellen
■ 50 Jahre Beratung in der Schweiz

Die Beratung in der Landwirtschaft ist ausgerichtet auf den Landwirt, die Bäuerin, die Familie, das Umfeld in dem sie leben, den Betrieb mit seinen Investitionen, die Region, die gemeinsamen Einrichtungen und Aktivitäten für die Alpwirtschaft sowie die Vermarktung. Seit 1958 ist die Beratung eine im Instrumentarium der Agrarpolitik vorgesehene, im Landwirtschaftsgesetz abgestützte Massnahme zur Begleitung der Anpassungsprozesse der Branche. Sie ergänzt die landwirtschaftliche Grundbildung und die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und Hochschulen.
Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg und Militärdienstpflicht, Kampf gegen die Hungergefahr mit dem «Plan Wahlen», Konkurrenzdruck der sich erholenden Weltwirtschaft, Preisstützungen und Grenzschutz von rasch vergessenden Konsumenten unter Beschuss: Die Zustände, die zahlreiche Bauernfamilien gegen Mitte des 20. Jahrhunderts in der Existenz bedrohten, veranlassten initiative Persönlichkeiten in der Deutsch- und Westschweiz, sich für die landwirtschaftliche Beratung einzusetzen. Auch Bund und Kantone wurden aktiv: Geschaffen wurden das Bundesgesetz über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstands (1951), die Verordnung über das landwirtschaftliche Bildungs- und Versuchswesen (1955), der Viehwirtschaftskataster (50er Jahre) und die Tierzuchtverordnung (1958). Landwirte mussten in Beratungsgruppen teilnehmen, um Betriebs- und Rindvieh-Ausmerzbeiträge beanspruchen zu können. Die finanziellen Anreize der neuen Erlasse machten Beratungsaktivitäten attraktiv, sowohl für die Bauernfamilien als auch für die Organisationen und die Kantone. Rasch erfolgte der Aufbau kantonaler Beratungsdienste. Auch die Schaffung einer zentralen Bundesstelle war im Gespräch. Von der schliesslich gewählten Vereinslösung für die zentralen Leistungen erwartete man mehr Praxisnähe als von der ebenfalls diskutierten Angliederung an eine Forschungsanstalt oder an die ETH. 1958 wurde die Schweizerische Vereinigung zur Förderung der Betriebsberatung in der Landwirtschaft SVBL (heutige AGRIDEA) gegründet.
Verschiedene Ereignisse und Entwicklungen haben die Arbeit der Beratungsdienste in den vergangenen 50 Jahren geprägt. In Bezug auf die Ziele haben sich die Akzente verschoben. Seit jeher tragen Weiterbildung und Beratung dazu bei, dass die Bauernfamilien die technische und wirtschaftliche Führung der Betriebe und die eigene soziale Stellung verbessern können. Sie fördern ihre Anpassungsfähigkeit und die Produktions- und Vermarktungsmöglichkeiten. Seit einiger Zeit werden auch Ökologie und Tierwohl gefördert und darauf hingewiesen, dass die regionale Wirtschaftsentwicklung für den Agrar- und Ernährungssektor wichtig ist.
Beratungskräfte bringen ihr Fachwissen ein und berücksichtigen die individuelle Situation, die Talente und Fähigkeiten der Betriebsleiterfamilie, aber auch die Gegebenheiten der Region und des Umfeldes. Mit der Reform der Agrarpolitik wird der Markt mit Produktdifferenzierung durch Qualitätsbezeichnungen noch wichtiger. Die Beratungskräfte werden Beraterinnen und Berater für den ländlichen Raum und sind mit sozialen Fragen konfrontiert. Nebenerwerb, Agrotourismus, Gästeverpflegung und Hofverarbeitung mit Direktvermarktung gehen über rein landwirtschaftliche Themen hinaus, sind aber untrennbar mit den Betrieben und Familien verknüpft. Im landwirtschaftlichen Wissenssystem ist die Beratung Drehscheibe zwischen den Akteuren der Grundlagen- und angewandten Forschung, der Aus- und Weiterbildung sowie den Bauernfamilien.
232 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Von der Reform zur Umsetzung der neuen Berufslehre im Berufsfeld «Landwirtschaft und deren Berufe»
Die Schweizer Bauernfamilien haben schnellen Zugriff auf die relevanten Informationen: Die Beratungsdienste tragen gemeinsam mit Partnern aus Forschung, Grundbildung, Hochschulen und Organisationen dazu bei. Obwohl die Beratungskräfte nicht Anwälte agrarpolitischer Vorschriften sind, gehört es zu den Dienstleistungen der Offizialberatung, deren Inhalte – und die damit verbundenen Anforderungen und Chancen – zu vermitteln. Von der Öffentlichkeit unterstützte Weiterbildung und Beratung tragen neben den weiteren Akteuren des Wissenssystems wesentlich zur Multifunktionalität und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft bei. Wie, in welcher Form, mit welchen Aufgaben und welchem Kostendeckungsgrad wird laufend diskutiert.
Berufsbildung
Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt geben die Rahmenbedingungen an die Berufsbildung vor. Sowohl die Grundbildung (dreijährig auf Stufe Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ, und zweijährig auf Stufe Eidgenössisches Berufsattest EBA) wie auch die höhere Berufsbildung haben die Arbeitsmarktfähigkeit zum Ziel. Mit der aktuell laufenden Bildungsreform werden die Berufe der Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Spezial- und Verarbeitungsberufe, die vormals in der landwirtschaftlichen Gesetzgebung geregelt waren, in das neue Berufsbildungsgesetz integriert. Die Reform erfolgt im Berufsfeld «Landwirtschaft und deren Berufe». Die involvierten Berufe wurden bisher in 14 Reglementen (teilweise in kantonalen und sprachregionalen Erlassen) gesteuert. In Zukunft soll je eine Verordnung über die berufliche Grundbildung auf Stufe EFZ, bzw. EBA die gesamtschweizerisch einheitliche Berufsbildung sicherstellen. Neun Berufsorganisationen engagieren sich in der Bildung der im Berufsfeld vereinten sechs Berufe plus im Schwerpunkt Biolandbau. Sie haben sich zur Organisation der Arbeitswelt (OdA) AgriAliForm, zusammengeschlossen. Diese nimmt die Aufgaben im Rahmen der im Berufsbildungsgesetz geforderten Verbundpartnerschaft wahr und ist damit Ansprechpartner für Bund (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT) und Kantone (Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz SBBK).
Die Reform der landwirtschaftlichen Grundbildung hat nach drei Jahren Reformarbeit anfangs 2008 ein wichtiges Etappenziel erreicht. Die Verordnung über die berufliche Grundbildung Berufsfeld «Landwirtschaft und deren Berufe» tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Für Lernende, die mit ihrer Berufslehre im Jahre 2008 starten, bzw. schon früher begonnen haben, gelten noch die Bestimmungen nach den Vorgaben des alten Reglements.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 233 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Die bereits eingeleiteten Umsetzungsarbeiten werden nun mit Nachdruck weitergeführt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die folgenden Bereiche:
–Lehrmittel unter der Vorgabe des neuen pädagogischen Konzepts (prozess- und handlungsorientiert);
–Lerndokumentation als Nachfolgeprodukt des Betriebshefts;
–Überbetriebliche Kurse, die als neuer Lernort eingeführt werden müssen;
–Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Lehrvertrag zur Anwendung kommen (Beiblatt zum Lehrvertrag, arbeitsrechtliche Bestimmungen, Richtlohntabelle);
–Marketing und Kommunikationsmittel für die neue Berufslehre.
Die Reform der landwirtschaftlichen Grundbildung wird für Lernende, Lehrbetriebe und die Schulen zu Veränderungen führen. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Elemente der Grundbildung bisherneu ab Lehrbeginn 2009 Ausbildungsmodell
zwei Lehrjahre mit Berufsschule und zwei Semester Vollzeitschule (Landwirtschaftsschule)
drei Lehrjahre mit praktischer Bildung und lehrbegleitender Berufsfachschule
Betriebliche Bildung
Überbetriebliche Kurse (ÜK)
Anforderungen an Berufsbildner (= Lehrmeister)
Ausbildung in Biolandbau Zweitausbildung
nach zwei Jahren abgeschlossen
keine
Dipl. Meisterlandwirt
betriebliche Bildung über drei Lehrjahre
neu 8 Tage für die ganze Lehrzeit
mindestens Landwirt mit Fachausweis (Berufsprüfung = erste Stufe der beruflichen Weiterbildung)
Schulverteilung
Spezialrichtung Bio mit einem Lehrjahr auf Bio-Lehrbetrieb
Schwerpunkt Biolandbau für alle Berufe des Berufsfelds (exkl. Weintechnologen) mit mind. 50% der praktischen Bildung auf Biobetrieb
Schulorganisation
Schule
ein Lehrjahr und Sonderkurs von 8 Monaten oder drei Jahre berufsbegleitend
1. Lehrjahr 240 Lektionen
2. Lehrjahr 240 Lektionen
Landwirtschaftsschule 1120 bis 1320 Lektionen
1. und 2. Lehrjahr in gemischten Klassen
Berufsschule und Landwirtschaftsschule getrennt und mit separaten Lehrmitteln
2. und 3. Lehrjahr oder berufsbegleitend mit mehr Auflagen zur praktischen Bildung
1. Lehrjahr 360 Lektionen
2. Lehrjahr 360 Lektionen
3. Lehrjahr 880 Lektionen* (total 1600 Lektionen)
1. bis 3. Lehrjahr in Jahrgangsklassen
Berufsfachschule mit systematischem Aufbau über die drei Lehrjahre
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
234
* die Gemüsegärtner haben im 3. Lehrjahr 780, die Geflügelfachleute und die Weintechnologen je 820 Lektionen.
Es war stets das Bestreben, die bäuerliche Ausbildung ins neue Berufsbildungsgesetz zu integrieren, ohne die positiven Elemente und Errungenschaften der bisherigen Berufslehre zu verlieren. Wir dürfen heute feststellen, dass mit der Bildungsreform wichtige Ziele erreicht wurden:
–Ein Berufsprofil (Berufsbild) mit Kompetenzen in Betriebswirtschaft (Grundlagen);
–Eine Bildungsverordnung und einen Bildungsplan für 6 Berufe und den Schwerpunkt Biolandbau;
–Die dreijährige duale Grundbildung (gleichzeitige Ausbildung auf Lehrbetrieb und in Berufsfachschule);
–Höhere Anforderung an die Berufsbildner (Lehrmeister) als in anderen Berufen üblich;
–Ein progressives Ausbildungsmodell mit 1600 Lektionen (mehr Unterrichtslektionen im 3. Lehrjahr als in den ersten beiden Lehrjahren);
–Der interkantonale Lehrbetriebswechsel (auch über Sprachgrenze);
–Ein Bildungsplan, der prozess- und handlungsorientiert aufgebaut ist;
–Die Einführung der überbetrieblichen Kurse (ÜK) im Umfang von 8 Tagen über die ganze Lehrzeit;
–Ein vereinfachtes, transparentes Qualifikationsverfahren.
Neben der Reform der dreijährigen Grundbildung auf Stufe EFZ ist diejenige für das Berufsattest (EBA, zweijährige Grundbildung) im Gang. Auch diese neue Berufslehre soll auf Lehrbeginn 2009 eingeführt werden. Die Differenzierung in zwei Ausbildungsniveaus ist im Berufsbildungsgesetz vorgesehen. Damit kann ein breiterer Kreis von Jugendlichen angesprochen und in die Berufswelt geführt werden. Das Berufsattest entspricht einem Bedürfnis des Arbeitsmarktes. Insgesamt leistet er zudem einen Beitrag zur Steigerung der Bildungsqualität innerhalb des Berufsfelds.
CIEA
Seit 50 Jahren unterstützt das BLW das CIEA (Centre international d’études agricoles, Internationales Studienzentrum für landwirtschaftliches Bildungswesen) in seiner Suche nach effizienten, innovativen und nachhaltigen Bildungs- und Beratungsprozessen.

Im Rahmen der CIEA-Seminare konnten –mehr als 2500 Fachleute an Bildung und Beratung weitergebildet, –in über 70 Ländern Lernimpulse vermittelt und –Erfahrungen aus der landwirtschaftlichen Praxis vieler Länder ausgetauscht werden.
Nach 50 Jahren steht das CIEA vor wichtigen Weichenstellungen. Der Bedarf an Ausund Weiterbildung für Lehr- und Beratungspersonen der Landwirtschaft ist nach wie vor gross. Wie weit sich die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und das BLW auch nach 2008 daran beteiligen, werden künftige Gespräche zeigen.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
235
Vor 50 Jahren, im August 1958, fand in Zürich eine Weiterbildungsveranstaltung zu Fragen der landwirtschaftlichen Berufsbildung statt. Angeregt durch F.T. Wahlen (damals Direktor innerhalb der FAO in Rom) trafen sich unter Federführung des BLW mehr als 50 Bildungsfachleute aus der ganzen Welt, um zu überlegen, wie Bäuerinnen und Bauern noch besser ausgebildet werden könnten. Neben der Seminararbeit wurde ein vielseitiges Rahmenprogramm rund um Aktivitäten und Spezialitäten der Landwirtschaft absolviert.
Vom 11. bis 23. August 2008 konnte in der Schweiz erneut ein CIEA-Seminar durchgeführt werden. Schwerpunktmässig unterstützt und finanziert durch die DEZA und durch das BLW, inhaltlich koordiniert durch die Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL) lautete das Seminarthema: «Was macht Lernen erfolgreich?» Im Verlauf des Seminars konnten vielfältige Aspekte bearbeitet werden, so beispielsweise die Frage: «Was motiviert Bauern und Bäuerinnen zu lernen?» Grosse Bedeutung wurde der Präsentation von Beratungs- und Bildungsprojekten beigemessen, so zum Beispiel der landwirtschaftlichen Schule Los Andes in Chile, dem Beratungsprojekt LEAP in Laos oder der Teleakademie für Schwarzwaldbauern in Deutschland. Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit persönlichen Lernverträgen, in denen die Teilnehmenden formulierten, was sie verändern möchten, wenn sie nach dem Seminar in ihre Länder und Institutionen zurückkehren.
Mit den CIEA-Seminaren wollten die Organisatoren die folgenden Lernziele erreichen:
Die Teilnehmenden –vertiefen und gewinnen Erkenntnissen zur Frage, wie Lehr-Lernprozesse erfolgreich und effektiv gestaltet werden können, –diskutieren mit Fachleuten aktuelle Themen der Berufspädagogik und Didaktik, –lernen konkrete Fallbeispiele kennen und analysieren diese, –erarbeiten gemeinsam Ideen wie Bildung und Beratung im ländlichen Raum verbessert werden können, –leiten aus den Seminarbeiträgen persönliche Erkenntnisse ab und formulieren Ideen, was sie in ihrer beruflichen Tätigkeit konkret verändern können, –tauschen ihre Einsichten in methodisch vielfältiger Art und Weise mit allen Seminarteilnehmenden aus.
CIEA-Seminare in der Schweiz, aber auch im Ausland, wurden so während 50 Jahren zu aktuellen, spannenden und vielseitigen Anlässen für Fachleute der Bildung und Beratung im ländlichen Raum.
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 236
■ 50 Jahre Seminare
■ Feuerbrand: Jüngste Entwicklungen
2.3.3 Produktionsmittel
Pflanzenschutz
Der Feuerbrand ist die für Kernobstgehölze und einige verwandte Zierpflanzen gefährlichste Krankheit. Sie wird vom Bakterium Erwinia amylovora verursacht, dessen erste Spuren in die Vereinigten Staaten Ende des 18. Jahrhunderts zurückgehen, wo die Krankheit bereits im 19. Jahrhundert schwere Schäden in Kernobstanlagen verursachte. Für Mensch und Tier ist das Bakterium jedoch ungefährlich.
Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde Feuerbrand erstmals in England festgestellt, wo der Erreger sehr wahrscheinlich mit infiziertem Pflanzenmaterial eingeschleppt wurde. Der erste Herd auf dem Festland wurde einige Jahre später in Dänemark entdeckt. Von dort aus hat sich die Krankheit ziemlich rasch weiter verbreitet, so dass heute fast der gesamte europäische Kontinent vom Feuerbrand betroffen ist.
In der Schweiz trat Feuerbrand erstmals 1989 auf Zierpflanzen (Cotoneaster) auf, praktisch gleichzeitig in Stein am Rhein (SH), Eschenz (TG) und Stammheim (ZH). In der Deutschschweiz hat sich das Bakterium mittlerweile stark ausgebreitet und seit 2007 ist es in allen Kantonen mindestens einmal nachgewiesen worden, auch wenn die aus Sicht des Kernobstbaus wichtigen Kantone VD und insbesondere VS noch wenig betroffen sind. Informationen über die aktuelle Befallssituation und deren Entwicklung seit 1989 sind der Website www.feuerbrand.ch zu entnehmen.
Das Ausmass des Befalls im Jahr 2007 auf Kernobstbäumen war ausserordentlich hoch. In den Kantonen TG, SG, AR, AI, ZH, SZ, GL, LU, NW und OW waren die meisten Gemeinden betroffen. Die Kantone BE und GR, die zum Feuerbrandschutzgebiet gehörten, mussten aufgrund der Befallssituation per 1. Oktober 2007 von diesem ausgeschlossen werden. Auch in den Kantonen SH, AG, BL, JU, NE und FR wurden noch nie so viele Befallsherde festgestellt. 2007 waren rund 75’000 Hochstammobstbäume (ca. 50’000 Apfelbäume und ca. 25’000 Birnbäume) als befallen gemeldet. Es wurden ca. 25’000 bis 30’000 Hochstammobstbäume gefällt. In Erwerbsobstanlagen hat die vernichtete Fläche rund 110 ha betragen. Ursache des massiven Befalls war die warme Witterung des Monates April, in welchem die Kernobstbäume bereits blühten. Obwohl es zu dieser Zeit nur sehr wenig Niederschlag gab, förderten die noch relativ kühlen Nächte die Bildung von Tau, welcher die zur Massenvermehrung der Feuerbrand erregenden Bakterien zusätzlich unterstützte.

2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 237 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Die zahlreichen Feuerbrandherde forderten in sehr vielen Kantonen einen anspruchsvollen Einsatz in der Feststellung von Befallsherden und deren Bekämpfung, sowohl seitens der für den Vollzug zuständigen behördlichen Stellen (kantonale Pflanzenschutzdienste, Zentralstellen für Pflanzenschutz, Feuerbrandkontrolleure der Gemeinden) wie seitens der Wirtspflanzenbesitzer (vor allem Obstbauern und Baumschulisten). In vielen Gemeinden musste aufgrund der Befallsintensität von der Tilgungsstrategie abgesehen werden, weil die Ausrottung des Erregers nicht mehr aussichtsreich war. Nicht nur die hohe Arbeitslast, aber auch die Aufgabe, sich für eine sachgerechte Sanierung zu entscheiden –restlose Vernichtung der befallenen Pflanze(n) oder phytosanitärer Rückschnitt –waren während Monaten eine ständige Herausforderung. Besonders schwierig war dies in Gebieten mit vielen Hochstammbeständen. Das Fällen kranker Bäume veränderte das Landschaftsbild. Die Feuerbrandbekämpfung stiess hier an Grenzen der Akzeptanz nicht nur bei den Baumbesitzern, sondern bei allen, denen die Hochstämme wichtig sind. Eine sehr komplexe Situation ergab sich an Orten, wo Hochstammbestände und Niederstammanlagen verflochten sind. Hier zeichneten sich Interessenskonflikte zwischen intensivem und extensivem Obstbau ab: man bevorzugte entweder rigorose Sanierungsmassnahmen zur Erhaltung akzeptabler phytosanitärer Rahmenbedingungen für die Früchteproduktion oder wehrte sich gegen drastische Eingriffe in das Naturerbe, nicht zuletzt aus Zweifel über den Nutzen der Sanierung.
Die vom Bund definierte Bekämpfungsstrategie wurde in den Medien und von einigen Parlamentariern mittels Vorstössen kritisiert. Die Anhörung von Umweltorganisationen und der Vereinigung Hochstamm Schweiz anfangs 2008 am BLW führte allerdings zu einem verbesserten gegenseitigen Verständnis. Auch wenn hier noch nicht von einer Konsensfindung gesprochen werden kann, erwies sich die vom Bund anfangs Sommer 2006 erlassene Richtlinie Nr. 3 zur Bekämpfung des Feuerbrandes als konsistent und genügend differenziert, um der standortspezifischen Struktur der Wirtspflanzenbestände und Befallssituation sinnvoll Rechnung zu tragen. Die differenzierte Bekämpfungsstrategie des Bundes wurde durch die Entscheide des Bundesvewaltungsgerichts in drei Streitfällen im Zusammenhang mit der Feuerbrandbekämpfung im Jahre 2007 im Kanton St. Gallen in Frage gestellt.
238 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Gemeinden mit Feuerbrand 2007 (Stand 31.12.2007)
Quelle: ACW
■ Revision Sortenschutzgesetz
Nach Anhörung der betroffenen Bundesämter hat das BLW über die Gesuche zur Zulassung des Antibiotikums Streptomycin zur Bekämpfung des Feuerbrands entschieden. Es wurden strenge Vorschriften erlassen, damit die mit dem Einsatz verbundenen Risiken minimiert werden können. Im Frühjahr 2008 wurden in 144 Gemeinden in den Kantonen TG, SG, ZH, BE, LU, ZG, SO, SH, GR und AG 453 kg Streptomycin verwendet.
Der Vormarsch des Erregers Richtung Westen geht unaufhaltsam voran. Die Bekämpfungsstrategie des Bundes sieht hierzu vor, dass die zu treffenden Massnahmen die Ausbreitung der Krankheit verlangsamen und dort, wo sie bereits Fuss gefasst hat, deren Auswirkungen bei schützenswerten Objekte verringern. In den 2007 schwer betroffenen Gebieten hat sich zweifellos Inokulum von Erwinia amylovora angereichert. Die Witterungsverhältnisse während der Blütenzeit des Kernobstes in den kommenden Jahren werden weiterhin das Ausmass des Befalls stark mitbestimmen.
Sortenschutz
Der Sortenschutz ist ein dem Patent vergleichbares Ausschliesslichkeitsrecht und schützt das geistige Eigentum an Pflanzenzüchtungen. Der Züchter erhält die Möglichkeit, seine Investitionen zu amortisieren. Der Sortenschutz leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Züchtung neuer Pflanzensorten, die wirtschaftlichen und ökologischen Erfordernissen gerecht werden.
International setzt das Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Ü) entsprechende Mindestanforderungen. Die Schweiz hat dieses Abkommen in der Fassung von 1978 ratifiziert. Das UPOV-Ü wurde 1991 umfassend revidiert, um den neuen Entwicklungen der Pflanzenzüchtung Rechnung zu tragen. Damit die Schweiz das revidierte UPOV-Ü ratifizieren kann, musste das geltende Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) zuerst entsprechend geändert werden.
Das Parlament hat am 5. Oktober 2007 die Revision des Sortenschutzgesetzes verabschiedet, und die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen. Mit dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes im Herbst 2008 können alle Züchter, unabhängig davon, ob ihr Staat Gegenrecht gewährt, für alle Sorten den Schutz für ihre neuen Züchtungen in der Schweiz beantragen.
2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 239 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Die materiellen Schutzvoraussetzungen (Unterscheidbarkeit, Neuheit, Homogenität und Stabilität) bleiben unverändert. Hingegen wird der Schutzumfang in zweierlei Hinsicht erweitert: Erstens beschränkt er sich nicht mehr ausschliesslich auf das Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte, sondern der Schutzinhaber kann sein Recht auch beim Erntegut noch gelten machen, sofern er beim Vermehrungsmaterial keine angemessene Gelegenheit dazu hatte. Kommen beispielsweise Äpfel einer in der Schweiz geschützten Sorte auf den schweizerischen Markt, die aus einem Land stammen, in dem die Sorte nicht geschützt ist, so kann der Sortenschutzinhaber sein Recht bei diesen Äpfeln noch geltend machen. Zweitens wird der Schutz auf im Wesentlichen abgeleitete Sorten ausgedehnt. Dabei handelt es sich um Sorten, die sich zwar von der geschützten Sorte unterscheiden, aber alle ihre charakteristischen Merkmale aufweisen. Wird zum Beispiel in einem Pflanzenbestand einer geschützten Sorte mit roten Blütenblättern eine Mutante mit blauen Blütenblättern entdeckt und zu einer homogenen und stabilen Sorte entwickelt, so hat der Züchter der blaublättrigen Sorte die Zustimmung des Sorteninhabers der rotblättrigen Sorte einzuholen, wenn er seine Sorte in Verkehr bringen will.
Neu ist auch die explizite Regelung des Landwirteprivilegs. Danach darf der Landwirt ohne Erlaubnis des Sortenschutzinhabers einen Teil seiner Ernte auf seinem Betrieb als Saatgut zur Erzeugung neuer Pflanzen nutzen. Da das Landwirteprivileg eine bedeutende Einschränkung des Sortenschutzrechtes ist, wird es auf Pflanzenarten von grundlegender Bedeutung für die Ernährung (Kartoffeln, Getreide, Futter- und Ölpflanzen) beschränkt. In der neuen Sortenschutzverordnung, die gleichzeitig mit dem Gesetz in Kraft tritt, sind die betroffenen Arten aufgeführt. Für Obst und Beeren gibt es kein Landwirteprivileg. Einerseits sind bei Obst und Beeren Erntegut und Vermehrungsmaterial nicht identisch (was gemäss UPOV-Ü eine Voraussetzung für das Landwirteprivileg ist), andererseits würde der Züchter für seine Investitionen kaum entschädigt, wenn der Landwirt einige wenige Pflanzen kauft und diese lizenzfrei vermehren und eine ganze Plantage anlegen dürfte.
Als neues Instrument wird die Zwangslizenz für abhängige Patente eingeführt. Damit kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Sorteninhaber gerichtlich gezwungen werden, eine Lizenz zu erteilen, falls diese notwendig ist, um ein Patent zu verwerten. Im Gegenzug kann der Sortenschutzinhaber verlangen, dass ihm der Patentinhaber eine Lizenz zur Nutzung seiner Erfindung erteilt. Eine spiegelbildliche Regelung zu Gunsten eines von einem Patent abhängigen Sortenschutzrechtes enthält das Patentgesetz.
Im Weitern ist die Schutzdauer um 5 Jahre verlängert worden und beträgt nun 30 Jahre für Bäume und Reben und 25 Jahre für die übrigen Pflanzen. Zudem sind verfahrensrechtliche Bestimmungen sowie Bestimmungen betreffend den zivilrechtlichen Schutz mit jenen anderer Bereiche des Immaterialgüterrechts harmonisiert und die Artikel über den strafrechtlichen Schutz den neuen Gegebenheiten angepasst worden.
Nach dem Inkrafttreten dieser Neuerungen kann das UPOV-Ü von 1991 ratifiziert werden. Zudem entspricht das schweizerische auch dem europäischen Sortenschutzrecht.
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 240
■ Änderungen des Düngerrechts im Bereich Hof- und Recyclingdünger
Dünger
Das Düngerrecht regelt grundsätzlich das Inverkehrbringen, die Einfuhr und die Verwendung von Düngern. Die Änderungen des Düngerrechts (Dünger-Verordnung und Düngerbuch-Verordnung) auf den 1. Januar 2008 sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass besonders im Bereich der Vergärung in den letzten Jahren grosse technische Fortschritte in der Herstellung sowie auch der Verwendung der Gärreste gemacht wurden, die eine Anpassung des Rechts erforderlich machten.
Dünger dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie zugelassen sind und den entsprechenden Anforderungen genügen. Davon ausgenommen sind Hofdünger, die von einem Betrieb mit Nutztierhaltung direkt an den Endverbraucher abgegeben werden. Die Grenzwerte, die bisher nur für Recyclingdünger galten, müssen neu auch beim Inverkehrbringen von Hofdüngern erfüllt werden. Einzig wenn der überwiegende Teil (das heisst mehr als 50%, bezogen auf die Trockensubstanz) der Masse aus Schweineexkrementen besteht, kann der höhere Grenzwert für die beiden Schwermetalle Kupfer und Zink von 150 statt 100 g/t respektive von 600 statt 400 g/t beansprucht werden.
Die Verwendung von Hofdünger wird von Gewässerschutzgesetz und -verordnung abgedeckt. Darin werden Vorschriften zur Düngerbilanz, Ausbringmenge, Düngerabgabe etc. geregelt. Neu schliesst die Hofdüngerdefinition der Dünger-Verordnung auch Hofdünger ein, welche mit maximal 20% landwirtschaftsfremdem Material vergärt wurden. So können landwirtschaftliche Co-Vergärer, welche weniger als 20% landwirtschaftsfremdes Co-Substrat mitvergären, ihr Produkt ohne Zulassung an Endverbraucher abgeben. Als Einschränkung dürfen nur landwirtschaftsfremde Co-Substrate Hofdüngern zugefügt werden, wenn die Grenzwerte für Schadstoffe in den CoSubstraten nicht überschritten werden.
An Stelle von Gärgut und Presswasser wird neu von festem und flüssigem Gärgut gesprochen. Dies definiert sich durch als fachgerecht unter Luftabschluss vergärtes pflanzliches, tierisches oder (neu) mikrobielles Material. Die Produkte aus Vergärungsund Kompostieranlagen gelten beim BLW als angemeldet, wenn dem Bundesamt eine Kopie der kantonalen Betriebsbewilligung zugestellt wird. Die Produzenten von Kompost und Gärgut brauchen jedoch weiterhin eine Bewilligung vom BLW, wenn Material wie Fleisch, Fett, Knochen, Blut, Horn, Klauen sowie Feststoffabscheidungen und Schlämme eines Schlachthofs verwendet werden.
Inhaber von Kompostier- und Vergärungsanlagen müssen ein Verzeichnis über die Abnehmer führen, die jährlich mehr als 5 t Kompost oder Gärgut bezogen auf die Trockensubstanz beziehen. Dieses Verzeichnis muss mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden. Anstelle eines Verzeichnisses kann die Abgabe auch über HODUFLU (eine neue, internetbasierte Anwendung zur Überwachung von Hofdüngerflüssen von einer Region zur anderen) erfasst werden.

2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 241
Gentechnisch veränderte Organismen in Futtermitteln
Die Einfuhr von Futtermitteln, die gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthalten oder aus solchen hergestellt wurden, hat sich auf tiefem Niveau stabilisiert. Im Jahre 2007 betrug der Anteil GVO-haltiger Futtermittel nur noch 0,01%. Der tiefe Prozentsatz wird gestützt durch die hohe Anzahl vom Zoll erhobener Proben, in welchen keine GVO-haltige Anteile nachgewiesen werden konnten. Bei Heimtierfuttermitteln ist eine Verbesserung der Deklarationsangaben möglich.
Bei der Einfuhr dem Zoll gegenüber gemeldete GVO-haltige Futtermittelimporte
JahrImportierte Futtermittel-gemeldete GVO-gemeldete GVOmenge totalhaltige Futtermittelhaltige Futtermittel
Untersuchungen von Nutztierfuttermitteln auf GVO-haltige Bestandteile durch ALP
Jahrdurch den Zoll erhobenefalschedurch ALP erhobenefalsche Proben beim ImportAngabenProben des MarktesAngaben
Untersuchungen von Heimtierfuttermitteln auf GVO-haltige Bestandteile durch ALP
Jahrkontrollierte Heimtier-Futtermittelfalsche Angaben
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 242
in tin tin % 2003412 1636880,2 2004383 5952 1010,55 2005356 1494020,11 2006373 228600,02 2007486 743550,01 Quellen: BLW, OZD
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl 20038102670 20046122285 20053002503 20067903000 20079302603 Quelle: ALP
AnzahlAnzahl 20051264 200611410 2007979 Quelle: ALP
■ Rechenschaftsablage im Berichtsjahr
2.4 Sektion Finanzinspektorat
Das Inspektionsprogramm des Finanzinspektorates wird aufgrund von sektionsinternen Risikoanalysen, Erfahrungswerten und einer Mehrjahresplanung erarbeitet. Um Lücken, Doppelspurigkeiten und Überlappungen im Prüfprogramm zu vermeiden, wird dieses mit dem Programm der Eidgenössischen Finanzkontrolle abgestimmt und von ihr genehmigt.
Finanzinspektorat
Im Berichtsjahr wurden folgende Revisionstätigkeiten unternommen:
–BLW-interne Revisionen in drei Fachsektionen und einer Stabsstelle; –Periodische Belegkontrollen im Amt inkl. Forschungsanstalten und Nationalgestüt; –eine Finanzrevision bei Agroscope ALP Liebefeld-Posieux; –sechs Abschlussrevisionen bei Subventionsempfängern; –Nachfolgeprozess von abgeschlossenen Revisionen.
Sämtliche Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit den Standards für die berufliche Praxis des Institute of Internal Auditors (IIA) sowie des Schweizerischen Verbandes für Interne Revision (SVIR) vorgenommen und einer internen Qualitätssicherung unterzogen. Weiter hat die Eidgenössische Finanzkontrolle gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag und im Rahmen einer Gesamtüberprüfung aller Finanzinspektorate der Bundesverwaltung auch die Qualität und Wirksamkeit des Finanzinspektorates BLW überprüft. Die Revision und Beurteilung erfolgte basierend auf den internationalen Standard des IIA. Die Prüfung ergab ein positives Bild. Generell wurde ein hohes, professionelles Niveau in der Arbeitsausführung attestiert.
Die System- und Wirkungsprüfungen in drei Fachsektionen und einer Stabsstelle des BLW bildeten einen Schwerpunkt der Prüfungstätigkeiten. Diese Revisionen beinhalten eine unabhängige und systematische Beurteilung der betrieblichen Organisation und der Tätigkeiten der Organisationseinheit. Sie umfassen die Aufbau- und Ablauforganisation einer Sektion. Ein wichtiges Element ist auch die Überprüfung des Internen Kontrollsystems (IKS). Das Augenmerk richtet sich nicht nur auf eine Soll-Ist-Abweichung, sondern auch auf deren Ursachen. Die Resultate der Prüfungen fallen überwiegend positiv aus. Die im Einsatz stehenden Führungs- und Steuerungsinstrumente sind mehrheitlich angemessen. Soweit die Sektionen die Zielsetzungen beeinflussen können, sind diese auch erreicht worden.
2.4 SEKTION FINANZINSPEKTORAT 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 243 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Im Zuge der Umstellung der Buchhaltung des Bundes auf das neue Rechnungsmodell NRM hat das FISP die Migration und die Eröffnungsbilanzen BLW, Agroscope und Nationalgestüt einer vertieften Prüfung unterzogen. Die Migration der Bilanzdaten erfolgte gemäss den Weisungen der Eidgenössischen Finanzverwaltung und der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Die Finanzrevision wurde in einem reduzierten Umfang durchgeführt, da die EFK eine Zwischenrevision vorgenommen hat. Die Prüfungen erfolgten risikobasiert. Aufgrund der stichprobenweisen Prüfung ausgewählter Rubriken konnten die Ordnungs- und Rechtmässigkeit der getätigten Ausgaben bestätigt werden. Die Rechnungsführung im Amt ist ordnungsgemäss. Die Grundsätze der Rechnungs- und Haushaltführung werden eingehalten. Auch die Finanzrevision bei Agroscope ALP führte zu positiven Resultaten.
Bei allen Abschlussrevisionen konnte ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben werden. Die jeweilige Ausgestaltung des Internen Kontrollsystems wird als genügend beurteilt, teilweise jedoch noch mit Verbesserungspotenzial. Bei zwei Partnerorganisationen entspricht die gesetzlich resp. vertraglich verlangte Ausgestaltung einer Betriebsbuchhaltung mit Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung noch nicht den Anforderungen, um eine klare Trennung der öffentlich-rechtlichen zu den privatrechtlichen Tätigkeiten der Organisationen vornehmen zu können. Die Bilanz und Buchführung einer Partnerorganisation weist Mängel auf und sollten weiterentwickelt und verbessert werden. Bei einer Projektorganisation fehlt das finanzielle Gesamtbild über alle Aktivitäten. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie zweckmässig die Vergabe von Projekten an Einzelpersonen ist, nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine nachhaltige Weiterführung solcher Arbeiten.
Im Rahmen des Folgeprozesses wurde der Umsetzungsstand der offenen Empfehlungen aus fünf Revisionen bei den betroffenen Sektionen überprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass 89% der Empfehlungen umgesetzt worden sind. Die noch nicht umgesetzten Empfehlungen werden im laufenden Jahr nochmals auf ihren Umsetzungsstand hin überprüft.
2.4 SEKTION FINANZINSPEKTORAT 2 244
Folgeprozess
■
■ Kontrolltätigkeit im Berichtsjahr
Inspektionsstelle Feldkontrolle
Die Inspektionsstelle Feldkontrolle führt für die Fachstellen des BLW Kontrollen in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Gesetzgebung von Produktion und Absatz durch. Im Jahr 2007 wurden 447 Kontrollen durchgeführt. Die Prüfungen fanden in den folgenden Bereichen statt:
–Milch- und Milchprodukte mit 344 Kontrollen;
–Obst, Gemüse und Schnittblumen mit 34 Kontrollen;
–Fleisch und Eier mit 24 Kontrollen;
–Acker- und Futterbau mit 15 Kontrollen;
–Reben bezüglich Umstellungsmassnahmen mit 19 Kontrollen;
–Marktanpassungsmassnahmen mit 11 Kontrollen.
Die Mengenkontrollen in der Milchwirtschaft im Zusammenhang mit Zulagen und/oder Beihilfen (Milchpreisstützung) und/oder Abgaben (Milchkontingentierung) erfolgten nach der internationalen Norm EN 45004 (ISO/IEC 17020, akkreditierte Inspektionsstelle Typ B). Für die übrigen Kontrollbereiche wurden die gleichen Qualitätsnormen angewandt.
Die Grundlage für die Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe im Bereich Milch- und Milchprodukte bildet eine periodisch aktualisierte Risikoanalyse und ein mit der zuständigen Fachsektion vereinbarter Jahresgesamtauftrag. Im Berichtsjahr haben 1'145 beihilfeberechtigte Betriebe Zulagen und Inlandbeihilfen im Gesamtbetrag von 361,4 Mio. Fr. erhalten. Von diesen Betrieben wurden 344 Betriebe (30%) kontrolliert. Bei 116 Betrieben mussten Mängel beanstandet werden. Mit finanziellen Konsequenzen in Form von Rückzahlungen und Nachzahlungen waren 24 Betriebe betroffen.
Im Bereich der Domizilkontrollen von frischen Früchten und Gemüsen wurden die Kontrollen im ersten Halbjahr 2007 durchgeführt. Aufgrund der geänderten Gesetzesbestimmungen in der Agrareinfuhrverordnung wurden diese Kontrollen per 1. Mai 2007 in den Verantwortungsbereich der Eidgenössischen Zollverwaltung übergeben.
In den übrigen Bereichen gaben die Kontrollen zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
■ Widerhandlungen
Abklärungen, Untersuchungen und Befragungen im Zusammenhang mit Widerhandlungen gegen die Landwirtschaftsgesetzgebung werden in Zusammenarbeit mit eidgenössischen und kantonalen Untersuchungsbehörden, mit privaten Organisationen und anderen Rechtshilfestellen vorgenommen. Im Berichtsjahr wurden fünf neue Fälle im Milchkontingentierungsbereich eröffnet. Davon sind vier abgeschlossen und einer in Bearbeitung. Es ist festzuhalten, dass es zunehmend aufwändiger wird, die Milchflüsse aufzuzeigen und mögliche Verstösse gegen die Verordnung rechtsgenügend nachweisen zu können, da mittlerweile rund 80% der Produzenten aus der staatlichen Mengenregulierung ausgestiegen sind.
2.4 SEKTION FINANZINSPEKTORAT 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 245
■ Vermeiden von Doppelspurigkeiten
2.5Vernetzung der Agrar-Datenbanken
Gestützt auf Artikel 185 LwG und auf die vom Ausschuss des Programms ASA (AgrarSektorAdministration) 2011 genehmigten Dokumente baut der Bund zusammen mit den Kantonen und der Privatwirtschaft ein nationales Agrarinformationssystem auf. Dieses wird den Vollzug national geltender Rechtserlasse im Bereich der Landwirtschaft unterstützen und unter Einhaltung des Datenschutzes auch für private Bedürfnisse wie Label-Kontrollen verwendet werden können. Das vorgesehene Informationssystem verbindet dabei bestehende kantonale Systeme der Agrarsektoradministration mit Bundessystemen wie das Agrarpolitische Informationssystem (AGIS), die Tierverkehrsdatenbank (TVD) oder der Datenbank Milch.
Bisher werden die Direktzahlungen mit sechs verschiedenen kantonalen Systemen administriert. Für die Koordination der Kontrollen sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privat-rechtlichen Bereich unternehmen die zuständigen Organe erhebliche Anstrengungen. Allgemein werden die Agrarsektordaten über Schnittstellen in verschiedene Bundessysteme transferiert und dort weiter verarbeitet. Speziell die Landwirtinnen und Landwirte als betroffene Akteure müssen teilweise dieselben Informationen wiederholt abgeben.
Nationale und internationale Vorgaben erfordern Systemanpassungen. Zudem werden von verschiedenen Seiten Vereinfachungen im Bereich der Prozess- und Informationstechnologie gefordert. Durch das Programm «ASA 2011» wird die Zusammenarbeit der Kantone und des Bundes organisatorisch und IT-mässig unterstützt. Dabei steht die Reduktion des administrativen und finanziellen Aufwandes im Vordergrund. Das Programm soll zu Vereinfachungen in der Systemlandschaft führen und die Bedürfnisse der Primärproduktion abdecken.
In die Programmorganisation sind zahlreiche Akteure eingebunden: Neben den Kantonen und diversen Bundesämtern wurden private Organisationen (z.B. SBV) in die Arbeiten einbezogen. Damit soll gewährleistet werden, dass auch Anliegen der Landwirtschaftsbetriebe frühzeitig eingebracht werden können.
■ Bewährtes mit Innovativem verbinden
Mitte 2007 wurde die Voranalyse mit einem Variantenentscheid abgeschlossen. Die vorgesehene Lösung soll Anwendungsmodule (sog. Services) für neue, auf Bundesstufe zu regelnde Bereiche, zentral bereitstellen. Zudem werden bestehende, im Bund und in den Kantonen eingesetzte Anwendungen über eine zentrale Datendrehscheibe (Message-/Service-Bus) integriert (siehe Abbildung). Die gewählte Variante ist eine flexible Lösung, welche es ermöglicht, das System den zukünftigen Bedürfnissen stufengerecht und mit geringem Aufwand anzupassen.
Ausserdem wird gemeinsam ein zentrales Internetportal geschaffen, sodass die Landwirtschaftsbetriebe, die Kantone, der Bund und weitere Interessierte über eine gemeinsame Eintrittspforte zu allen relevanten Informationen und Anwendungen im Agrarbereich gelangen können.
2.5 VERNETZUNG DER AGRAR-DATENBANKEN 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
246
Neu aufgebaut wird ferner eine nationale Kontrolldatenbank, auf welcher die Kontrollergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes für die Zutrittsberechtigten zur Verfügung gestellt werden. Damit können Kontrollen auf den Betrieben besser koordiniert und auch der nationale Kontrollplan sowie der Notfallplan können einfacher realisiert werden.
Mit dem Inkrafttreten der Geoinformationsverordnung (GeoIV) per 1. Juli 2008 erhielt das BLW den Auftrag, Datenmodelle für die in seiner Zuständigkeit stehenden Geodaten zu erarbeiten. Die Bedeutung und der potenzielle Nutzen von Geodaten im Bereich der Agrarsektoradministration wurden in der Voranalyse von «ASA 2011» erkannt und hervorgehoben.
Mit dem Projekt «Auswertungsplattform» wird die Aufbereitung der Agrardaten automatisiert und vereinfacht. Damit werden rasch Entscheidgrundlagen für politische und marktwirtschaftliche Bedürfnisse abrufbar sein.
Entscheid Lösungsvariante (Ende Voranalyse): Datendrehscheibe als «Message-/Service-Bus»
BLW
Kontrollorganisationen
Dritte (Labels, Marken)
Landwirt
Sachbearbeiter
Landwirtschaftsamt
Kantonale Verwaltung
Dritte
· Nationales Betriebsregister mit einheitlichem Identifikator
· Zentrale Administration des Kontrollwesens
· Zentrale Berechnung der Direktzahlungsbeiträge
· Zentrales Internetportal für den Landwirt
Zentrales System Adapter Adapter
DBMilch.ch Adapter
Tierverkehrsdatenbank (TVD) Adapter
Datendrehscheibe: Message-/Service-Bus
Kantonale Systeme Agricola, Agridea, Lawis, Gerlan
Kantonale Module
· Beitragsverwaltung und Zahlungswesen
· Natur- und Gewässerschutz
· Strukturverbesserung
· Veterinärwesen (Tierseuchenkasse)
· Wald, Rebbau und weitere kt. Aspekte
· Kantonale Webseiten
Weitere kantonale Systeme
Obst.ch Adapter
Quelle: BLW
2.5 VERNETZUNG DER AGRAR-DATENBANKEN 2 2. AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 247
Weitere Systeme BVET BFS BAG Adapter
248 2
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3. Internationale Aspekte

3 249
Die Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen betreffen die Landwirtschaft in zunehmendem Masse. Auf globaler Ebene ist die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk der WTO eingeflochten. Angesichts der geographischen Konzentration des Agrarhandels sind die vertraglichen Beziehungen zur EU und die zunehmende Integration in Europa für die Schweizer Landwirtschaft von grösster Bedeutung.
Um ihre Exportmöglichkeiten zu erhalten und verbessern, ist die Schweiz auf einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten angewiesen. Die Schweiz setzt sich zudem auf internationaler Ebene stark dafür ein, dass die multifunktionalen Eigenschaften der Landwirtschaft in den internationalen Abkommen stärker berücksichtigt werden.
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung und behandelt die internationalen Themen im dritten Kapitel.
–Abschnitt 3.1 enthält Informationen über den aktuellen Stand im Europa-Dossier, bei den WTO-Verhandlungen, bei den Freihandelsabkommen, bei der OECD und bei der FAO.
–In Abschnitt 3.2 geht es um internationale Vergleiche. Im vorliegenden Bericht wird die Thematik der internationalen Rohstoffpreise weiter verfolgt. Anschliessend wird ein Produzentenpreisvergleich zwischen der Schweiz und Deutschland sowie die Darstellung der Entwicklung der Konsumentenpreise in der Schweiz im Vergleich zur EU gemacht.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3 250
3.1 Internationale Entwicklungen
Die internationalen Entwicklungen spielen sich in einem turbulenten ökonomischen Umfeld ab. Nicht nur die durch eine Preishausse bei vielen landwirtschaftlichen Rohstoffen entstandenen Unruhen in einigen Entwicklungsländern, sondern auch Bewegungen bei bilateralen und multilateralen Handelsabkommen bestimmen das Geschehen auf den Märkten und das Produktionsumfeld der Schweizer Landwirtschaft. Daneben schreitet die strategische Ausrichtung der Schweiz hin zu bilateralen Abkommen voran.

–Unterbruch in der WTO Doha-Runde: An einer Ministerkonferenz im Juli 2008 konnte kein Durchbruch in der seit 2001 andauernden multilateralen Handelsrunde erreicht werden. Damit ist der Zeitpunkt des Abschlusses der Verhandlungen weiter offen.
–Freihandelsabkommen mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich: Der Bundesrat hat ein Mandat für die Aufnahme von Verhandlungen erteilt. Damit gehen die explorativen Gespräche in formelle Verhandlungen über. Das Ziel ist ein Abkommen, das die gesamte Lebensmittelkette, das heisst die Landwirtschaft wie auch die vor- und nachgelagerten Sektoren umfasst.
–Verstärkte Aktivitäten in bilateralen Freihandelsabkommen: im Jahre 2008 konnten bedeutende Fortschritte in zahlreichen Freihandelsabkommen erzielt werden. Für eine Reihe weiterer Länder sind explorative Gespräche im Gange.
–FAO-Ministerkonferenz: Als Reaktion auf die Turbulenzen auf den Weltmärkten hat die FAO eine Ministerkonferenz in Rom durchgeführt, an der Wege aus der Krise und Instrumente für Entwicklungsländer diskutiert wurden.
–Konferenz der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung: Die Schweiz hat im Jahre 2008 die Diskussionen in New York begleitet und forciert eine Konkretisierung der Resultate im Jahre 2009.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 251 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Freihandelsabkommen mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich (FHAL)
Bereits im Frühjahr 2006 beschloss der Bundesrat, die Vor- und Nachteile eines Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich mit der EU (FHAL) zu prüfen. Seither wurden die verschiedenen Vorabklärungen in schrittweisen Etappen vertieft. Die explorativen Gespräche mit der EU-Kommission sowie die Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen konnten Anfang 2008 abgeschlossen werden. Aufgrund dieser Ergebnisse hat der Bundesrat am 14. März 2008 – unter Vorbehalt der Konsultation der parlamentarischen Kommissionen und der Kantone – entschieden, mit der EU Verhandlungen über eine umfassende, gegenseitige Marköffnung im Agrar- und Lebensmittelbereich und eine verbesserte Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich aufzunehmen. Zudem wurde entschieden, dass die betroffenen Kreise beim Übergang in die neue Marktsituation mit Begleitmassnahmen unterstützt werden sollen. Wie unten dargestellt sind die Verhandlungen mit der EU, die Konkretisierung der Begleitmassnahmen sowie deren Finanzierung drei parallel ablaufende Prozesse.
Freihandel mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich (FHAL) und Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich
Finanzierung Begleitmassnahmen
Begleitmassnahmen
Gegenseitige Marktöffnung
Gesamte Lebensmittelkette
Beseitigung tarifäre Handelshemmnisse
Beseitigung nichttarifäre Handelshemmnisse
Verhandlungsgegenstand mit EU
Lebensmittelsicherheit
Produktsicherheit
Öffentliche Gesundheit
LebensmittelSicherheitsagentur EFSA
Schnellwarnsystem
Lebens- und Futtermittel RASFF
Schnellwarnsystem
Konsumgüter RAPEX
Übertragbare Krankheiten ECDC, EWRS
Gesundheitsprogramme HP 2008–2013
Quelle: BLW
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 252
Entscheid Bundesrat 14. März
Breiter Ansatz FHAL
■ Explorative Gespräche mit der EU
In den explorativen Gesprächen bestätigte die EU-Kommission mehrmals ihr grundsätzliches Interesse an einer gegenseitigen Marktöffnung im Agrar- und Lebensmittelbereich und einer verstärkten Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich. Der breite Ansatz des FHAL wird begrüsst. Bezüglich des Abbaus der Zölle gilt es insbesondere die Übergangsfristen auszuhandeln. Die Exploration zeigte weiter, dass für den Abbau der nichttarifären Handelshemmnisse eine weitgehende Übernahme des acquis communautaire (EU-Gemeinschaftsrecht) nötig wäre. Für schweizerische Sensibilitäten (z.B. Produktionslandangabe, Deklaration von Käfigeiern, genetisch veränderte Organismen und Allergene) sind pragmatische Ansätze zu finden. Ausnahmeregelungen in diesen Bereichen scheinen aber möglich. Zudem soll der freie Warenverkehr und die Rechtsangleichung durch eine Einbindung der Schweiz in die gemeinschaftlichen Prozesse und Gremien zur Risikoanalyse und Entscheidungsfindung in gesundheits-, umwelt- und verbraucherschutzbezogenen Fragen begleitet werden.
■ Verhandlungsmandat
Der breite Ansatz des FHAL umfasst die Beseitigung der tarifären (Zölle, Kontingente) und nichttarifären (Produktvorschriften, Vermarktungsnormen, Zulassungen) Handelshemmnisse sowie den Einbezug der gesamten ernährungswirtschaftlichen Produktionskette. Damit wird neben der Landwirtschaft auch die vorgelagerte Stufe (Produktionsmittel und Investitionsgüter) sowie die nachgelagerte Stufe (Verarbeitung und Handel) einem verstärktem Wettbewerb ausgesetzt. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht Kostensenkungen in der Produktion und wichtige Exportchancen für Schweizer Produkte.
Das Mandat für die Verhandlungen mit der EU sieht neben der gegenseitigen Marktöffnung im Agrar- und Lebensmittelbereich auch eine verbesserte Zusammenarbeit in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, allgemeine Produktsicherheit und öffentliche Gesundheit vor. Diese vier Bereiche werden unter einem Mandat verhandelt, da insbesondere der Bereich der Lebensmittelsicherheit und die Marktöffnung eine enge inhaltliche Verknüpfung erfordern. Die Angleichung des Lebensmittelrechts ist zentral für den Abbau der nichttarifären Handelshemmnisse und damit den verbesserten gegenseitigen Marktzugang. Gleichzeitig ist die Rechtsangleichung aber auch eine Voraussetzung für die Teilnahme der Schweiz an den entsprechenden Agenturen (EFSA und RASFF) der EU.
Nachdem der Bundesrat am 14. März 2008 das Verhandlungsmandat beschlossen hat, wurde dieses den zuständigen parlamentarischen Kommissionen (Wirtschafts- und Abgabekommissionen und Aussenpolitische Kommissionen von National- und Ständerat) sowie den Kantonen zur Konsultation vorgelegt. Alle parlamentarischen Kommissionen haben sich für die Aufnahme von Verhandlungen mit der EU im Agrar- und Lebensmittelbereich sowie im Gesundheitsbereich ausgesprochen. Die Mehrheit ist der Auffassung, dass eine Marktöffnung mehr Chancen als Risiken mit sich bringt und für die Schweizer Volkswirtschaft vorteilhaft ist. Dieses Projekt stelle aber für die Landwirtschaft eine grosse Herausforderung dar, die geeignete Begleitmassnahmen erfordert und nur mit einer konsequenten Qualitätsstrategie zu meistern sei. In diesem Zusammenhang wurde hervorgehoben, dass in den Verhandlungen wichtigen Schweizer Errungenschaften beim Umwelt- und Tierschutz oder bei der Konsumenteninformation Rechnung getragen werden muss. Weiter gelte es, eine Abnahme des Selbstversorgungsgrads zu verhindern. Die Konferenz der Kantonsregierungen hat sich in ihrer Stellungnahme gegen eine Aufnahme von Verhandlungen zum gegenwärtigen Zeit-
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 253
■ Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, den Agrarsektor und die Bundesfinanzen
punkt ausgesprochen. Ihre Haltung ist nicht mit Differenzen zur Stossrichtung des Mandates begründet. Aufgrund allgemeiner europapolitischer Erwägungen erscheint es den Kantonsregierungen momentan nicht angezeigt, Verhandlungen in neuen europapolitischen Dossiers aufzunehmen. Sie behält sich jedoch die Möglichkeit vor, die Situation zu gegebenem Zeitpunkt nochmals neu zu beurteilen.
Parallel zur Exploration mit der EU wurde eine Analyse der gesamtwirtschaftlichen und sektoriellen Auswirkungen eines FHAL durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung mit einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell zeigen, dass ein dauerhafter Anstieg des Schweizer BIP um jährlich 0,5% zu erwarten ist. Dies entspricht jährlich etwa 2 Mrd. Fr. Dieser positive volkswirtschaftliche Effekt lässt sich mit der verstärkten Kaufkraft dank tieferen Konsumentenpreisen, der Re-allokation von Ressourcen (Arbeit und Kapital) und dem grösseren Exportpotenzial für Schweizer Produkte erklären.
Trotz dieser gesamtwirtschaftlich positiven Auswirkungen würde die Schweizer Landwirtschaft vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Da das Sektoreinkommen der Landwirtschaft bei einem Szenario FHAL rascher zurückgeht als bei einem Szenario ohne Marktöffnung, ist nach Modellschätzungen mit einem –über eine mehrjährige Anpassungsperiode kumulierten –Einkommensausfall von mehreren Milliarden Franken zu rechnen. Wie gross die Einkommenslücke tatsächlich ausfallen wird, hängt insbesondere von der Ausnützung des Export- und Kostensenkungspotenzials, der allgemeinen Preis- und Kostenentwicklung, dem Verhandlungsergebnis mit der EU sowie der Ausgestaltung und dem Umfang der Begleitmassnahmen ab.
Weiter hätte ein FHAL auch Folgen für den Bundeshaushalt. Dieser wird wegen der tieferen Zolleinnahmen und der zusätzlichen, temporären Ausgaben für die Begleitmassnahmen kurzfristig belastet. Langfristig wird jedoch der allgemeine Wachstumseffekt höhere Steuereinnahmen generieren. Daher wird für die Bundesfinanzen während der Umsetzungsphase des Abkommens eine Mehrbelastung resultieren, während danach dauerhaft jährliche Mehreinnahmen zu erwarten sind. Die Kantone und Gemeinden haben keine zusätzlichen Kosten zu tragen, würden aber schon von Beginn weg von Mehreinnahmen durch den Wachstumseffekt profitieren.
■ Begleitmassnahmen
Die erwähnten kurz- und mittelfristigen Einkommensausfälle für die betroffenen Kreise im Agrar- und Lebensmittelbereich erfordern Begleitmassnahmen, welche die Betriebe bei der Anpassung an die neue Marktsituation unterstützen sollen. Mit den Begleitmassnahmen sollen Rahmenbedingungen für die ganze Ernährungswirtschaft geschaffen werden, damit diese ihre Stärken in einem offenen Markt von Beginn weg ausspielen kann. Die Begleitmassnahmen müssen daher folgenden Ansprüchen genügen:
–Sie müssen primär die Landwirtschaftsbetriebe beim Übergang in die neue Marktsituation in der Neuausrichtung unterstützen und beitragen, neue Marktpotenziale rasch und optimal zu nutzen.
–Sie haben die Stärken (Qualität, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, umwelt- und tiergerechte Produktionsmethoden etc.) der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft zu fördern.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 254
–Sie sollen auch jene Landwirtschaftsbetriebe unterstützen, die sich ausserhalb des Sektors neu orientieren müssen.
–Sie sind so zu gestalten, dass der durch die neuen Rahmenbedingungen ausgelöste Strukturwandel nicht behindert wird. Ziel ist, dass Strukturen entstehen, die optimale wirtschaftliche Voraussetzungen für die im Markt verbleibenden Betriebe schaffen.
Die Begleitmassnahmen werden zeitlich befristet sein. Ergänzend dazu sind Anpassungen der permanenten Instrumente der Agrarpolitik und anderer Politikbereiche zu prüfen. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus verwaltungsexternen Experten und Vertretern der betroffenen Kreise soll bis im Mai 2009 Vorschläge für die Konkretisierung der Begleitmassnahmen ausarbeiten.
Die Arbeitsgruppe «Begleitmassnahmen» besteht aus Vertretern der folgenden Organisationen:
–Schweizerischer Bauernverband (SBV)
–Schweizer Milchproduzenten (SMP)
–Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen (Bio-Suisse)
–Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen (IP-Suisse)
–Schweizerischer Getreideproduzentenverband (SGPV) für den Ackerbau
–Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten (VSGP) für die Spezialkulturen
–Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband (Suisseporcs) für die Fleischproduzenten
–Verband der Schweizer Unternehmen (economiesuisse)
–Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrien (FIAL)
–Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI)
–Schweizerischer Fleisch-Fachverband (SFF)
–Verband des Schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels (Swisscofel)
–Gewerbliche Milchverarbeiter (Fromarte)
–IG Detailhandel Schweiz (IG DHS)
–IG Agrarstandort Schweiz (IGAS)
–Konsumentenforum (kf)
–2 Vertreter der Konferenz kantonaler Landwirtschaftsdirektoren
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 255
■ Finanzierung der Begleitmassnahmen

Die oben angesprochenen Begleitmassnahmen erfordern Bundesmittel in Milliardenhöhe. Damit die Unterstützung für die betroffenen Bereiche garantiert werden kann, ist die frühzeitige Schaffung einer Bilanzreserve zur späteren Finanzierung der Begleitmassnahmen notwendig. Der Umfang der benötigten Mittel für die Begleitmassnahmen kann vom Rückgang des Sektoreinkommens in der Landwirtschaft hergeleitet werden, welcher nicht durch Produktivitätssteigerungen und einen sozialverträglichen Strukturwandel aufgefangen werden kann. Die Höhe dieses Betrages ist sowohl von der Entwicklung der Preise und Kosten wie auch vom Verhandlungsergebnis mit der EU abhängig und muss daher zum Zeitpunkt des Inkrafttretens neu berechnet werden.
Die Finanzierung der geplanten Begleitmassnahmen müsste voraussichtlich über einen mehrjährigen Zeitraum verteilt werden, um den Anforderungen der Schuldenbremse gerecht zu werden. Diese ist das zentrale Instrument für das Erreichen der finanzpolitischen Ziele. Der Bundesrat hat am 10. September 2008 eine Vernehmlassungsvorlage zur Schaffung einer Bilanzreserve zur Finanzierung von Begleitmassnahmen zu Gunsten der Landwirtschaft verabschiedet. Gemäss dieser Vorlage würden mit einer Spezialfinanzierung nach Artikel 53 des Finanzhaushaltsgesetzes frühzeitig Mittel für die spätere Finanzierung reserviert. Dabei sollen die Einnahmen aus den Einfuhrzöllen auf Agrarerzeugnisse und Lebensmittel bereits vor dem Inkrafttreten des Abkommens für Begleitmassnahmen reserviert werden. Da die Agrarzolleinnahmen bei einem FHAL oder im Rahmen einer multilateralen Marktöffnung deutlich zurückgehen werden, muss der Bundeshaushalt diesen Einkommensausfall in einer langfristigen Perspektive ohnehin antizipieren.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 256
■ Freihandelsabkommen im Rahmen der EFTA
Freihandelsabkommen mit Ländern ausserhalb der EU
Die weltweite Tendenz zum Abschluss regionaler und überregionaler Freihandelsabkommen nimmt weiter zu. Dies vor allem vor dem Hintergrund des nach wie vor unsicheren Ausgangs der laufenden Doha-Verhandlungsrunde im Rahmen der WTO.
Die Schweiz verfolgt mit dem Abschluss von Freihandelsabkommen das Ziel, ihren Unternehmen einen gegenüber wichtigen ausländischen Konkurrenten möglichst gleichwertigen Zugang zu ausgewählten ausländischen Märkten zu verschaffen. Freihandelsabkommen leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität der Schweiz.
Die Schweiz ist seit 1960 Mitglied der Europäischen Freihandelszone (European Free Trade Association EFTA), welcher heute noch Island, Norwegen und das Fürstentum Liechtenstein angehören. Neben der EFTA-Konvention bestehen zurzeit über 18 EFTAFreihandelsabkommen. Island, Norwegen und das Fürstentum Liechtenstein sind zudem Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), welchem die Schweiz 1992 nicht beigetreten ist.
Ziel der EFTA-Staaten im Mittelmeerraum ist die Teilnahme an der geplanten grossen Freihandelszone Europa-Mittelmeer, die im Rahmen des Barcelona-Prozesses der EU bis 2010 verwirklicht werden soll. Aus diesem Grund begannen Verhandlungen mit Algerien gegen Ende 2007. Die EFTA-Staaten streben die Beseitigung der seit September 2005 bestehenden Benachteiligungen gegenüber der EU auf dem algerischen Markt an.
Des Weiteren fanden Expertentreffen mit Serbien und Albanien statt. Beide Länder bestätigen ihr Interesse an der Aufnahme von Freihandelsverhandlungen. Auch Montenegro, das mit der EU ein Stabilitäts- und Assoziationsabkommen unterzeichnet hat, hat mit der EFTA entsprechende Kontakte aufgenommen. Sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine kommen Freihandelsverhandlungen frühestens nach deren WTOBeitritt in Frage.
Eine gemeinsame Studiengruppe EFTA-Indien zur Prüfung der Machbarkeit eines umfassenden Freihandelsabkommens empfiehlt in ihrem Bericht die Aufnahme entsprechender Verhandlungen. Auf Ersuchen der mongolischen Regierung wurde eine Zusammenarbeitserklärung zwischen den EFTA Staaten und der Mongolei unterzeichnet. Mit weiteren Staaten wie Malaysia und Pakistan wurden ebenfalls entsprechende Kontakte gepflegt. Die mit Thailand im Oktober 2005 aufgenommenen Verhandlungen wurden nach innenpolitischen Unsicherheiten im Frühling 2006 zunächst suspendiert und werden zurzeit auf technischer Ebene weitergeführt. Die Verhandlungen mit Kolumbien sind abgeschlossen und diejenigen mit Peru stehen kurz vor dem Abschluss.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 257
Freihandelsabkommen
Die EFTA-Abkommen der neueren Generation umfassen zusätzlich zum Warenverkehr Regeln über die Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs, zum Schutz des geistigen Eigentums und der Investitionen sowie Bestimmungen zum öffentlichen Beschaffungswesen. Charakteristisch für EFTA-Abkommen ist, dass die verarbeiteten Landwirtschaftsprodukte plurilateral, die Bestimmungen über die Basisagrarprodukte hingegen bilateral, das heisst zwischen den einzelnen Vertragsstaaten separat verhandelt werden. Dieser Ansatz erlaubt es einerseits, massgeschneiderte Konzessionen auszuhandeln und gewährleistet andererseits die autonome Weiterentwicklung der Agrarpolitiken der einzelnen EFTA-Mitgliedsländer.
Die Schweiz verfolgt den dynamischen Ausbau ihres Netzes von Freihandelsabkommen primär im bewährten EFTA-Rahmen. Erweist sich jedoch in konkreten Fällen dieser Rahmen als wenig Erfolg versprechend oder ungeeignet, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu wahren, steht der Schweiz auch die Möglichkeit eines rein bilateralen Vorgehens zur Verfügung. So zeigte beispielsweise Japan aufgrund der unterschiedlichen Handelsstrukturen zwischen Japan und den einzelnen EFTA-Staaten kein Interesse an einem Vorgehen im EFTA-Rahmen. Ebenso hat China dem sukzessiven Abschluss separater bilateralen Freihandelsabkommen mit den einzelnen EFTA-Staaten den Vorzug vor einem Vorgehen im EFTA-Rahmen gegeben. Im Sommer 2008 stand das Abkommen mit Japan kurz vor dem Abschluss, dasjenige mit China erst in der Phase von Machbarkeitsstudien.

3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 258
■ Bilaterale
Freihandelsabkommen ausserhalb der EU mit Beispielen über die im Bereich der Landwirtschaft gewährten Konzessionen (Stand Juni 2008)
LandInkrafttretenBeispiele spezifischer Konzessionen Beispiele spezifischer Konzessionen der Schweiz an die Partnerländer der Partnerländer an die Schweiz
Ägyptenunterzeichnet am 27.1.2007
Reziprokes Käsekontingent, Milchpulver, Honig für industrielle Verarbeitung, Schnittblumen, Kartoffeln (Kontingent), Tafeltrauben (Kontingent), Olivenöl (Kontingent), Pfirsiche und Nektarinen (Kontingent)
Chile1.2.2004
Faröer Inseln1.3.1995
GCC abgeschlossen (GulfCooperation Council)
Israel1.1.1993
Jordanien1.1.2002
Kanadaunterzeichnet am 26.01.2008
Kolumbienabgeschlossen
Kroatien1.1.2002
Libanon24.06.2004
Tafeltrauben, Haselnüsse, Olivenöl EFTA-Konzessionen
Keine zusätzlichen, über die bestehenden WTO Kontingente oder das Allgemeine Präferenzensystem (GSP) hinausgehende Konzessionen
Keine zusätzlichen Konzessionen Geflügelfleisch, Tafeltrauben, Olivenöl, Fruchtsäfte (ohne Zuckerzusatz)
Hartweizen, Pferdefleisch, Stierensamen, Zollfreikontingent für Hunde- und Katzenfutter
Tropische Früchte, Kaffee, Früchte und Gemüsezubereitungen, Zigaretten
Rabatte für Käse, Honig, Kiwi, Malzmehl, Olivenöl, Suppen, Saucen
Fleisch von Schafen und Ziegen, Schlachtnebenprodukte, Geflügelfleisch, Frischkäse, Lebende Zierpflanzen, Schnittblumen, Weihnachtsbäume, Tafeltrauben (Kontingent), Olivenöl, Wurstwaren, Fleischkonserven
Milchpulver, Käsekontingent, Pektine und Pektinate Zuchtvieh, Trockenfleisch, Stierensamen Zollfreier Marktzutritt für alle Landwirtschaftsprodukte mit Ausnahme einiger weniger Tariflinien
Zollfreier Marktzutritt für Kaffee; Käse, Milch- und Rahmprodukte, Schnittblumen, Kartoffeln, Margarine; Zollermässigung Konfitüre, Frucht- und Gemüsesäfte, Suppen, Saucen Verarbeitete Landwirtschaftsprodukte Zuchtvieh, Milchpulver, Hart- und Halbhartkäse, Röstkaffee, Futterzubereitungen
Hart- und Halbhartkäse, Rindfleisch, Stierensamen, Futterzubereitungen
Käse, Fleischerzeugnisse, Schokolade, Biscuits, Yoghurts, Teigwaren, Wein Zuchtvieh, Milchpulver- und Käsekontingente, Lebensmittelzubereitungen und Ethylalkohol
Zuchtvieh, Milchpulver, Käse, Stierensamen, Röstkaffee, Fruchtkonserven, Kaffee- und TeeEssenzen und -extrakte, Futterzubereitungen
Marokko1.1.1998
Mazedonien1.1.2001
Mexiko1.7.2001
Schnittblumen, Tomaten, diverse Gemüse, Olivenöl, zubereitetes Gemüse, Gemüsekonserven, Nüsse, Fruchtsäfte Gemüsekonserven (Mischungen), Fruchtsäfte
Pathogenfreie Eier, Honig zur industriellen Verarbeitung, Bananen, Tafeltrauben, Roh- und Röstkaffee, Pflanzensäfte, Pektine, Fruchtsäfte, Bier, Liköre, Branntwein
Käse, Fruchtkonserven, Kaffee- und TeeEssenzen und -extrakte, Futterzubereitungen
Zuchtvieh, Käsekontingente, Kaffee- und Tee-Essenzen und -extrakte
Zuchtvieh, Stierensamen, Pektine und Pektinate, Kaffee- und Tee-Essenzen und -extrakte, Suppen, Saucen, Lebensmittelzubereitungen, Ethylalkhole, Liköre und Branntweine, Futtermittelzubereitungen
Palästinensische 1.7.1999
Behörde
Honig, Tafeltrauben, Zitrusfrüchte, Kartoffeln, Oliven, Olivenöl
Milchpulver, Käse, Röstkaffee, Konfitüren, Fruchtkonserven
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 259
Freihandelsabkommen ausserhalb der EU mit Beispielen über die im Bereich der Landwirtschaft gewährten Konzessionen (Stand Juni 2008)
LandInkrafttretenBeispiele spezifischer Konzessionen Beispiele spezifischer Konzessionen der Schweiz an die Partnerländer der Partnerländer an die Schweiz
SACU unterzeichnet
Südafrikanische am 1.7.2006
Zollunion
Singapur1.1.2003
Südkorea1.9.2006
Gesamtes APS plus frisches, gekühltes und gefrorenes Fleisch (Kontingent), Trockenfleisch (Biltong), Halbhart- und Hartkäsekontingent, Honig für industrielle Verarbeitung, Haselnüsse, Tafeltrauben, Kaseine, Eieralbumine Spezielle Orchideen
Gemüsekonserven (Kimchi), Reiswein («Cheong ju», «Yak ju», «Tak ju», «Makkoli»)
Zuchtvieh, Trockenfleisch, Hart- und Halbhartkäsekontingente, Fruchtpulver, Gemüsekonserven, Kaffee- und TeeEssenzen und -extrakte, Futtermittelzubereitungen; Zigarren, Zigaretten, zubereiteter Tabak
Zollfreier Marktzutritt für alle Landwirtschaftsprodukte
Zuchtvieh, Trockenfleisch, Käsekontingente, Stierensamen, Trinkweine, Futterzubereitungen, Zigaretten
Tunesien1.6.2005
Fleisch von Wild, Straussen, Kamelen, Kartoffeln, Olivenöl (Kontingent)
Milchpulver, Schmelzkäse, Konfitüren, Fruchtkonserven, Kaffee- und TeeEssenzen und -extrakte, Futterzubereitungen
Türkei1.4.1992
Geflügellebern, Schnittblumen, Fruchtsäfte, Raki, Olivenöl
Verarbeitete Landwirtschaftsprodukte

3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 260
■ Verhandlungen zum gegenseitigen Schutz der GUB und GGA zwischen der EU und der Schweiz
Agrarabkommen Schweiz–EU
Der Gemischte Ausschuss (GA) zum Agrarabkommen von 1999 zwischen der Schweiz und der EU hat am 29. November 2007 in Bern und unter Vorsitz der Schweiz zum siebten mal getagt. Erstmals beteiligte sich die liechtensteinische Delegation als Teil der Schweizer Delegation am Gemischten Agrarausschuss. Infolge des Zusatzabkommens, das die Ausweitung des Agrarabkommens auf das Fürstentum Liechtenstein regelt, kann Liechtenstein seine Anliegen über die Schweizer Delegation im Gemischten Agrarausschuss einbringen. Das Zusatzabkommen wurde am 27. September 2007 von allen drei Parteien in Brüssel unterzeichnet und ist am gleichen Tag in Kraft getreten.
Die Schweiz begrüsste die Abschaffung der EU-Importlizenzen für Käse per 1. Januar 2008, die somit zur Beseitigung der letzten administrativen Hürden im Rahmen des bilateralen Käsefreihandels führte. Seit diesem Datum müssen die Käsehändler für den Export lediglich das Ursprungszeugnis vorweisen. Der Käsefreihandel Schweiz-EU gilt seit dem 1. Juni 2007.
Durch den EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens kamen die Schweiz und die EU überein, frühere Zollpräferenzen, die im Rahmen von EFTA-Abkommen abgeschlossen wurden, im Ausmass der bisherigen Handelsströme aufrechtzuerhalten und in Zollkontingente für die EU-27 umzuwandeln. Im Gegenzug erhielt die Schweiz Nullzollkontingente für Mangold, Karden und Erdbeeren. Seitens der EU wurden diese Konzessionen bereits per 1. September 2007 umgesetzt. Schweizerischerseits wurden die Konzessionen rückwirkend für das Jahr 2007 angewandt.
Die Schweiz und die EU einigten sich schliesslich darauf, zu Gunsten der EU bilaterale Wurstkontingente mit Italien, Frankreich, Deutschland und Ungarn zu vergemeinschaften, die Zollbelastungen auf Null zu reduzieren und um 800 t zu erhöhen. Die Schweiz erhielt ihrerseits von der EU ein neues Nullzollkontingent für die gleichen Wurstwaren. Beide Parteien vereinbarten, die Konzessionen ab dem 1. Januar 2008 gegenseitig autonom anzuwenden.
Im Paket der Bilateralen I äusserten die EU und die Schweiz ihre Absicht, Bestimmungen zum gegenseitigen Schutz der geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützten geografischen Angaben (GGA) bei Agrarprodukten einzubringen, wie dies bereits beim Wein und den Spirituosen der Fall ist. Auf dieser Grundlage hat der Bundesrat im Juni 2005 einen Verhandlungsauftrag erteilt. Ziel war die gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Bezeichnungen über einen Listenaustausch der geschützten Bezeichnungen. Aufgrund des von den USA und Australien im Rahmen der WTO einberufenen Panels über die geografischen Angaben war die EU gezwungen, ihr Reglement im Jahre 2006 zu ändern. Seither lehnt sie einen solchen Listenaustausch ab. Entsprechend der Meistbegünstigungsklausel (MFN) könnte ein solches Abkommen ihrer Meinung nach dazu führen, dass geografische Angaben von Drittländern, die nicht den gemeinschaftlichen Standards entsprechen, gleichermassen geschützt würden. Die Kommission hat der Schweiz daher einen neuen Ansatz für ein Abkommen unterbreitet: Jede Partei unterbreitet der anderen Partei eine Liste der zu schützenden Bezeichnungen. Letztere werden geprüft und einem Einsprache- und Eintragungsverfahren unterzogen. Ein solches Abkommen könnte das Einsprache-
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 261
verfahren somit nicht ausschliessen, sondern es höchstens vereinfachen (vereinfachtes Eintragungsverfahren).
Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU zum gegenseitigen Schutz der GUB und GGA setzten im Oktober 2007 ein und schritten zügig voran. Die letzte Zusammenkunft fand im Juni 2008 in Brüssel statt. Die grösste Herausforderung besteht darin, sowohl Lösungen in Sachen Bezeichnungen auszuhandeln, die für beide Parteien interessant sind, als auch dem Wunsch der EU nach einem Einsprache- und Rekursverfahren für alle Bezeichnungen Rechnung zu tragen. Eine Annäherung der Positionen in einem entsprechenden Textentwurf wird zurzeit aufgrund der unterschiedlichen Verfahren zwischen der Schweiz und der EU verzögert. Beide Parteien arbeiten jedoch konstruktiv an der Bewältigung dieser Schwierigkeit. Ziel der Schweiz ist es nach wie vor, ein solches Abkommen abzuschliessen, das einen Mehrwert gegenüber der direkten und individuellen Eintragung der Bezeichnungen darstellt und die Rechtssicherheit seiner Marktteilnehmer optimal gewährleistet.
Protokoll 2
Das Protokoll Nr. 2 des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und der EU erlaubt der Schweiz, im Handel mit der EU Preisnachteile bei Agrargrundstoffen auszugleichen, indem sie bei der Ausfuhr von Verarbeitungsprodukten Ausfuhrbeiträge gewährt und bei der Einfuhr Zölle erhebt. Diese Preisausgleichsmassnahmen dürfen im Handel mit der EU die Preisdifferenzen der Agrargrundstoffe zwischen der Schweiz und der EU nicht überschreiten. Das Protokoll Nr. 2 enthält die für die Preisausgleichsmassnahmen massgebenden Referenzpreise und Preisdifferenzen und beauftragt den Gemischten Ausschuss, diese Referenzpreise mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.
In jüngster Vergangenheit sind allgemein die internationalen Rohwarenpreise stark angestiegen. Zudem prägt eine hohe Preisvolatilität die weltweiten Rohstoffmärkte. Die Gründe für diese Entwicklung sind sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zu suchen. Sich verändernde Konsumgewohnheiten breiter Bevölkerungsschichten in aufstrebenden Schwellenländern (insbesondere China und Indien) und der nach wie vor ungebremste Boom nach Bioethanol steigerten die Nachfrage. Geringer ausfallende Ernten und temporär verhängte Exportrestriktionen grosser Agrarexportländer verknappten das Angebot. Dass gerade in dieser Zeit grosse Finanzinstitute die Rohstoffmärkte für ihr Engagement entdeckten, trug zumindest zur hohen Volatilität der Märkte bei.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 262
■ «Neuste Entwicklungen»
In der Referenzperiode (September und Oktober 2007) für die ab 1. Februar 2008 gültigen Referenzpreise lagen die Schweizer Milchpulverpreise zwischenzeitlich tiefer als in der EU. Bereits gegen Ende 2007 stiegen die Schweizer Preise jedoch wieder über das EU-Niveau. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der angepassten Referenzpreise entsprachen diese für gewisse Agrargrundstoffe daher bereits nicht mehr der Realität.
Dies führte zu einem erheblichen Rohstoffpreishandicap der Schweizer Exporteure bei voll- und magermilchhaltigen Verarbeitungsprodukten. Auch bei Butter hatte sich seit dem 1. Februar 2008 eine Unterkompensation eingestellt, da die internationalen Preise bereits wieder gesunken und der inländische Preis gestiegen war. Bei Weizenmehl bestand auf Grund der Berechnung des EU-Preises mit einem Faktor (Verhältnis Schweizer Mehl- zu Weichweizenpreise) eine zu kleine Differenz, so dass die Schweizer Exporteure ebenfalls unterkompensiert waren.
Die Bundesverwaltung erhielt folglich zahlreiche Gesuche um aktiven Veredelungsverkehr. Darauf stellte die Branche Selbsthilfemassnahmen zur Kompensation des bestehenden Rohstoffhandicaps zur Verfügung und der Veredelungsverkehr wurde nicht bewilligt.
Die EU war ab dem 1. Februar 2008 aufgrund der geltenden Referenzpreise ermächtigt, auf Produkten der schweizerischen Nahrungsmittelindustrie, die Milchpulver enthalten, Zölle zu erheben, bzw. Exportsubventionen bei Ausfuhren in die Schweiz zu gewähren. Dies schmälerte die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Schweizer Nahrungsmittelindustrie weiter.
Mitte 2008 konnten auf Expertenebene neue Referenzpreise ausgehandelt werden, die im Sommer 2008 in Kraft traten. Die Preise für Milchpulver und andere Agrargrundstoffe konnten den aktuellen Verhältnissen auf den beiden Referenzmärkten angepasst werden. Konkret bedeutet dies, dass die Schweiz mit Inkrafttreten der revidierten Preise wieder Zölle auf milchpulverhaltigen Lebensmitteln aus der EU erheben darf, bzw. Schweizer Exporteure von solchen Produkten wieder Ausfuhrrückerstattungen erhalten. Die diesjährige Übung zeigt, dass volatile Märkte die Grenzen des Preisausgleichssystems nach Protokoll Nr. 2 aufzeigen.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 263
■ Gesundheitscheck der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
Die Europäische Kommission hat am 20. Mai 2008 vorgeschlagen, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zeitgemässer, einfacher und schlanker zu gestalten und verbleibende Einschränkungen aufzuheben, damit die Landwirtinnen und Landwirte besser auf die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln reagieren können. Dieser sogenannte GAP-Gesundheitscheck schlägt insbesondere folgende Massnahmen vor:
1.Aufhebung der Milchquotenregelung, Abschaffung der Flächenstilllegung und der Prämie für Energiepflanzen: Die Milchquotenregelung läuft im April 2015 aus. Um eine «sanfte» Landung zu ermöglichen, schlägt die Kommission vor, die Quoten über fünf Jahre von 2009/10 bis 2013/14 um jeweils 1% aufzustocken. Zudem schlägt sie vor, Landwirtinnen und Landwirte in der pflanzlichen Erzeugung von der Pflicht zu befreien, 10% ihrer Flächen stillzulegen.
2.Entkoppelung der Stützungszahlungen: Abschaffung der noch verbleibenden gekoppelten Zahlungen und Einbezug in die Betriebsprämienregelung (BPR). Ausnahmen bilden die Mutterkuhprämie und die Prämie für Schaf- und Ziegenfleisch, wo die derzeitige gekoppelte Stützung beibehalten werden kann.
3.Auslaufen des «historischen Modells»: In einigen Mitgliedstaaten erhielten die Landwirte Zahlungen auf der Grundlage der Beträge, die sie während eines Referenzzeitraums je Hektar erhielten. In anderen Staaten werden diese Beträge auf einer regionalen Grundlage, pro Hektar, bestimmt. Da es mit der Zeit immer schwieriger wird, das historische Modell zu rechtfertigen, schlägt die Kommission vor, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, ein pauschaleres System einzuführen.
4.Erhöhung der Modulation: Derzeit werden die Zahlungen für Landwirtinnen und Landwirte, die direkte Beihilfen in Höhe von über 5'000 Euro jährlich erhalten, um 5% gekürzt, und der betroffene Betrag wird dem Haushalt für die Entwicklung des ländlichen Raums zugewiesen. Die Kommission schlägt vor, diese Modulation bis 2012 auf 13% anzuheben. Grössere Betriebe müssten höhere Abschläge hinnehmen (zusätzliche 3% für Betriebe, die mehr als 100'000 Euro pro Jahr erhalten, zusätzliche 6% für Betriebe mit über 200'000 Euro pro Jahr und zusätzliche 9% für Betriebe mit mehr als 300'000 Euro pro Jahr). Diese Mittel könnten dann von den Mitgliedstaaten für die Aufstockung von Programmen in den Bereichen Klimawandel, erneuerbare Energien, Wasserbewirtschaftung und Erhaltung der biologischen Vielfalt verwendet werden.
5.Interventionsmechanismen: Abschaffung der Interventionsregelung für Schweinefleisch und Festsetzung der Intervention für Futtergetreide auf Null. Für Brotweizen, Butter und Magermilchpulver wird ein Ausschreibungsverfahren eingeführt.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 264
■ Verlauf der Verhandlungen in der Doha-Runde seit September 2007
6.Cross Compliance: Die Zahlungen an die Landwirte sind an die Einhaltung von Qualitätsstandards in den Bereichen Umweltschutz, Tierschutz und Lebensmittelqualität gebunden. Landwirte, die sich nicht an diese Anforderungen halten, müssen damit rechnen, dass ihre Zahlungen gekürzt werden. Diese sogenannte Cross Compliance soll vereinfacht werden. Es wird neue Anforderungen geben, die darauf abzielen, den Umweltnutzen der Flächenstilllegung zu erhalten und die Wasserbewirtschaftung zu verbessern.
7.Zahlungsuntergrenzen: Die Mitgliedstaaten sollen entweder einen Mindestbetrag von 250 Euro oder eine beihilfefähige Mindestfläche von mindestens 1 Hektar je Betrieb oder beides anwenden.
An der dritten Debatte der EU-Agrarminister zum Gesundheitscheck der GAP am 15. Juli 2008 in Brüssel äusserten mehrere Mitgliedstaaten Vorbehalte zu den Vorschlägen zur Erhöhung des Modulationsansatzes der direkten Beihilfen, zur Erosion der Interventionsmechanismen und zum zwingenden Charakter der Normen für die Gute Landwirtschafts- und Umweltpraxis. Die Ministerdebatte dürfte sich diesen Herbst 2008 intensivieren.
Mehr Informationen zum Gesundheitscheck der GAP finden Sie unter: http://ec. europa.eu/agriculture/healthcheck/index_fr.htm.
WTO
Die WTO-Verhandlungen im Rahmen der sogenannten Doha-Runde haben seit September 2007 eine starke Dynamik erlebt, die im Juli 2008 bei einer Ministerkonferenz in Genf in einen Unterbruch mündete. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes ist die Perspektive über den weiteren Fortgang der Verhandlungen unsicher, da mehrere innenpolitische Faktoren von Bedeutung sind (u.a. Präsidentschaftswahlen in den USA am 4. November 2008).
Im Vorfeld der Ministerrunde wurde hauptsächlich in den beiden Verhandlungsfeldern Agar- und Industriegüter einige Vorarbeit geleistet, die in mehreren Versionen der sogenannten Modalitäten (Eckpunktepapiere für ein Gesamtabkommen) Ausdruck gefunden haben. So wurden im Agrardossier durch den Verhandlungsführer, dem neuseeländischen Botschafter Falconer, drei Versionen dieser Modalitäten aufgesetzt (Februar sowie Mai und Juli 2008). Darin konnten jeweils die offenen Punkte markant reduziert und auch methodische Aspekte wie die Errechnung der Kontingentsausdehnung, die bei der Deklaration sensibler Produkte als Ausgleich hätte genehmigt werden müssen, eindeutig formuliert werden. Ebenso konnte in weiteren Feldern wie der Behandlung tropischer Produkte oder der Verwaltung der Zollkontingente deutliche Konvergenz der Positionen erreicht werden. Dabei wurde das Ambitionsniveau im Agrarbereich insgesamt, vor allem aber beim Marktzugang, gesteigert, so auch durch die Einführung einer Mindestzollreduktion um 54% über alle Zolllinien oder die Abschaffung bzw. Reduktion der Sonderschutzklausel für entwickelte Länder auf nur mehr 1,5% aller Linien.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 265
Im Verlauf der Verhandlungen auf Ministerniveau, die zunächst in einem Format mit rund 30 Ministern, später dann hauptsächlich in einer kleinen 7-er Gruppe der wirtschaftlich bedeutendsten Länder (Australien, Brasilien, China, EU, Indien, Japan und USA) geführt wurde, schien zunächst eine Einigung bei Eckpunkten im Landwirtschafts- und Industriegüterbereich möglich. Zudem zeigte sich in weiteren Verhandlungsfeldern der Doha-Runde, wie dem Dienstleistungsbereich, Bewegung. Im weiteren Verlauf kristallisierte sich allerdings eine Blockade innerhalb der 7-er Gruppe um den Sonderschutzmechanismus für Entwicklungsländer heraus, die eine Fortführung der Verhandlungen verunmöglichte. In ersten Stellungnahmen, die dem Abbruch folgten, wurde die Situation allgemein bedauert und eine Fortführung der Runde unter Nutzung des bisher Erreichten angeregt.
Die schweizerische Handelspolitik untersteht im Jahr 2008 einer Überprüfung durch das WTO-Sekretariat. In diesem, alle vier Jahre stattfindenden Verfahren, erstellt das WTO-Sekretariat einen Bericht zu allen Aspekten der Handelspolitik und gibt eine Wertung zur Entwicklung ab. Im Landwirtschaftskapitel stehen verschiedene Aspekte des Marktzuganges und der internen Stützung, vor allem die durch die AP 2011 initiierten Änderungen, im Fokus. Die Schweiz konnte zum Bericht Stellung beziehen und hat – wie im Rahmen des Trade Policy Review üblich –zusätzlich selber einen Bericht zu den Veränderungen in der Handelspolitik verfasst und an die Mitgliedsstaaten verteilt. Das WTO-Sekretariat hat bei einem Besuch der Bundesverwaltung im August 2008 einzelne Punkte vertieft diskutiert. Nach einer Veröffentlichung der beiden Berichte im Dezember 2008 werden alle WTO-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit haben, Fragen zum Bericht zu formulieren. Zu diesen wird die Schweiz in einem Anhörungsverfahren Stellung beziehen.

3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 266
■ Bericht zur Schweizer Handelspolitik (Trade Policy Review)
FAO
Im Jahre 2005 veranlasste der FAO-Rat die erste unabhängige externe Evaluierung (IEE) der Organisation mit dem Ziel, die FAO zu stärken und zu verbessern. Die besagte Evaluierung durch ein international anerkanntes Expertenteam umfasste sämtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Arbeit, der institutionellen Struktur und den Entscheidungsprozessen der FAO sowie ihrer Rolle im internationalen System.
Im Herbst 2007 unterbreitete das Prüfungsteam seinen Bericht unter dem Titel «FAO: Le défi du renouveau» (FAO: Die Herausforderung der Erneuerung). Gemäss IEE liefert die FAO eine Palette von nützlichen Produkten und Dienstleistungen und schreibt: «Wenn die FAO morgen verschwinden würde, müsste sie neu erfunden werden – wenn auch in einer anderen Form». Die Welt braucht die FAO, aber diese muss sich radikal und schnellstens ändern. Die IEE schlug eine Reform kombiniert mit Wachstum «reform with growth» vor und formulierte zu diesem Zweck 110 Empfehlungen zur Umsetzung. Sie empfahl die Ausarbeitung und Annahme eines unverzüglichen Aktionsplans basierend auf ihren Empfehlungen.
Die IEE schlug vor, folgende vier grossen Bereiche der FAO zu erneuern:
–Neuer Strategierahmen, indem die FAO ihre Prioritäten aufgrund ihrer komparativen Vorteile festlegt;
–Investition in die Lenkung, insbesondere durch Stärkung der Rolle und Unabhängigkeit des Rats;
–Änderung der institutionellen Kultur («risikoscheue Kultur») der Organisation und Reform der Verwaltungs- und Führungssysteme der FAO;
–Restrukturierung der Dienste am Sitz in Rom und auf dem Feld zur Wirksamkeitsund Effizienzsicherung.
Gefordert, sich über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der IEE zu äussern, beschloss die 34. Sitzung der FAO-Konferenz im November 2007:
–Den Reformprozess durch Ausarbeitung eines unverzüglichen Aktionsplans und eines strategischen Plans zur Erneuerung der Organisation einzuleiten;
–Im November 2008 eine ausserordentliche Konferenz einzuberufen, um über die Anträge für einen unverzüglichen Aktionsplan und die finanzielle Folgen zu bestimmen;
–Ein zeitlich begrenztes Konferenzkomitee zu wählen, das die Anträge zu einem unverzüglichen Aktionsplan auszuarbeiten hat.
Dieses Komitee hat seine Arbeit im Dezember 2007 aufgenommen und drei Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Die Schweiz war Mitglied der Arbeitsgruppe I, die sich der «Vision und den vorrangigen Programmen der FAO» widmete. Das Komitee hat seinen Schlussbericht Ende Oktober 2008 abgeliefert. Dieser Bericht, der auch den sofortigen Aktionsplan für die Reform der FAO beinhaltet, wird der FAO-Konferenz im November 2008 im Rahmen einer Sondersession zur Genehmigung unterbreitet.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 267
■
FAO-Reform
■ FAO-Ministerkonferenz
über Ernährungssicherheit, Klimawandel und Biotreibstoffe
Von Anfang an begrüsste die Schweiz die Idee der Durchführung einer unabhängigen externen Evaluierung und war denn auch eines der ersten Länder, das eine finanzielle Unterstützung daran leistete. Die Schweiz war aktiv an den Arbeiten dieser Evaluierung beteiligt und nahm den Evaluierungsbericht, dessen Inhalt eine hervorragende Grundlage zur notwendigen Reform der Organisation liefert, positiv auf. Die Schweiz wünscht die Zusammenarbeit mit einer starken, effizienten und dynamischen FAO, die in der Lage ist, die Bedürfnisse ihrer Mitglieder abzudecken. Ihr Ziel ist es, die FAO zu stärken, damit diese die grossen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts annehmen kann, insbesondere jene der Lebensmittelsicherheit und der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen. Die Schweiz ist der Meinung, dass die FAO ihre Rolle als federführende Organisation in Sachen Ernährung, Landwirtschaft und natürlichen Ressourcen wirksam wahrnehmen muss. Dazu muss sie ein echtes Forum werden für Austausch, Diskussionen und Verhandlungen zur Festlegung der Politiken und ihrer Umsetzung. Dabei soll sich die FAO auf die drei Ziele der Organisation stützen, nämlich:
–Abschaffung von Hunger und Unterernährung;
–Beitrag der Landwirtschaft an die wirtschaftliche und soziale Entwicklung;
–Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen für die Ernährung und die Landwirtschaft sowie die Lebensmittelsicherheit und die Qualität der Nahrungsmittel.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.fao.org/iee-follow-up-committee/ home-iee/fr/?no_cache=1
Die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel sind seit 2006 stark angestiegen. Die FAO befürchtet, dass die Zahl der Hungernden aufgrund der Entwicklung an den Lebensmittelmärkten um 100 Mio. auf fast 1 Mrd. ansteigen könnte. Vor diesem Hintergrund organisierte die FAO vom 3. bis 5. Juni 2008 eine Ministerkonferenz in Rom, bei welcher Fragen der Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung angesichts der stark angestiegenen Nahrungsmittelpreise, der Auswirkungen der Klimaveränderung und der zunehmenden Bioenergieproduktion im Zentrum standen.
Die gut 40 Staatspräsidentinnen und -präsidenten waren sich einig, dass die Soforthilfe rasch erhöht werden muss. Verschiedene Länder, die Weltbank sowie die afrikanische und islamische Entwicklungsbank machten Zusagen in Milliardenhöhe. Die langfristige Lösung sah eine Mehrheit der anwesenden Regierungsvertreterinnen und -vertreter in einer Produktionssteigerung mit einer lokalen und nachhaltigen Landwirtschaft. Vor allem Agrarexportländer plädierten für eine Produktionssteigerung durch eine Intensivierung der Landwirtschaft und für eine rasche Liberalisierung der Agrarmärkte. Die Biotreibstoffproduktion wurde mehrheitlich als eine der massgeblichen Ursachen der hohen Nahrungsmittelpreise erwähnt, wobei hauptsächlich Brasilien und EU-Präsidentschaftsvertreter Slowenien die nachteiligen Auswirkungen der Biotreibstoffe auf die Nahrungsmittelkrise negierten bzw. als minimal betrachteten. Unter den Delegierten der über 180 anwesenden Länder bestand hingegen weitgehend Konsens, dass der Klimawandel die Bedingungen der Nahrungsmittelproduktion negativ beeinflussen wird. Die Landwirtschaft muss die Treibhausgasemissionen minimieren und sich den Auswirkungen des Klimawandels bestmöglich anpassen.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 268
Die Schweizer Delegation unter der Leitung von Manfred Bötsch hob in ihrem Statement die Wichtigkeit einer effizienten, kohärenten und gut koordinierten Organisation der internationalen Aktivitäten gegen den Hunger hervor. Die Schweiz bekräftigte, dass eine multifunktionale Landwirtschaft mit einer lokalen und nachhaltigen Produktion basierend auf Familienbetrieben, die progressive Öffnung der Agrarmärkte mit fairen Bedingungen für Entwicklungsländer sowie die Förderung der Forschung und Innovationen die strategischen Pfeiler einer zukünftigen Nahrungsmittelsicherheit bilden müssen. Weiter unterstrich die Schweiz, dass Biotreibstoffe nur dann eine Zukunft haben, wenn die ökologischen und sozialen Auswirkungen ebenso wie ihr Effekt auf die Nahrungsmittelsicherheit in die Beurteilung der Nachhaltigkeit einbezogen werden. Vor diesem Hintergrund machte die Schweizer Delegation auf die Notwendigkeit aufmerksam, internationale Rahmenbedingungen und international anerkannte Nachhaltigkeitskriterien zu definieren.
Die Konferenz endete nach drei Tagen zäher Diskussion mit der Verabschiedung einer Schlusserklärung. Als kurzfristige Massnahme empfiehlt die Deklaration mehr Soforthilfe. Dabei soll auf das Angebot der lokalen und regionalen Märkte zurückgegriffen werden. Um die Nahrungsmittelproduktion bzw. die Produktivität langfristig zu steigern, müssen die Ressourcen nachhaltig und besser genutzt werden. Der Zugang der Hungernden zu Nahrung und der Zutritt der Kleinbauern in Entwicklungsländern zu den Märkten muss verbessert werden. Gleichzeitig müssen die Agrarmärkte weiter liberalisiert werden. Die Schlusserklärung verlangt zudem vertiefte Analysen, um die Nachhaltigkeit der Biotreibstoffe zu prüfen. Damit die Ernährungssicherheit im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels zukünftig gewährleistet werden kann, verlangt die Deklaration weitere Investitionen in die Forschung und Entwicklung sowie eine internationale Kooperation. Die kürzlich gegründete Task Force unter der Leitung von UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon wird die Empfehlungen der Deklaration aufnehmen und konkrete Aktionen formulieren.
Weitere Informationen sind unter http://www.fao.org/foodclimate/hlc-home/fr/ erhältlich.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 269
OECD
Die aussergewöhnliche Situation an den Weltagrarmärkten hat im Berichtsjahr auch die Arbeiten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) massgeblich geprägt:
–Der jährlich erscheinende OECD-FAO-Agricultural Outlook, welcher die Nachfrage-, Angebots- und Preisentwicklung der nächsten zehn Jahre für die wichtigsten Agrargüter prognostiziert, beschäftigte sich eingehend mit der angespannten Lage an den Weltmärkten. Gemäss Bericht sollen die historisch hohen Preise mehr oder weniger ihren Höhepunkt erreicht haben. Mittel- und langfristig dürften die Preise auf ein tieferes Niveau zurückkommen, das aber deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen wird. Die Modelle der OECD und der FAO sagen zudem eine höhere Preisvolatilität an den Agrarmärkten voraus, verursacht durch klimawandelbedingte Ernteschwankungen, Spekulation mit Agrargütern und den weltweit tiefen Nahrungsmittelreserven. Der Bericht, welcher erstmals einen Abschnitt zu Biotreibstoffen enthält, sieht ein deutliches Wachstum der Treibstoffe aus erneuerbaren Ressourcen voraus. Die weltweite Bioethanolproduktion soll sich bis 2017 auf rund 125 Mrd. Liter pro Jahr verdoppeln. Die Biodieselproduktion soll sogar noch stärker wachsen und in zehn Jahren 24 Mrd. Liter pro Jahr betragen.
–Die Entwicklung an den Agrarmärkten ist auch am jährlich publizierten OECDAgricultural Policies: Monitoring and Evaluation Report, in dem die Agrarpolitiken der OECD-Länder evaluiert werden, nicht spurlos vorbei gegangen. Die hohen Preise haben massgeblich dazu beigetragen, dass der PSE (Producer Support Estimate), der den jährlichen monetären Transfer vom Steuerzahler und Konsumenten zum landwirtschaftlichen Produzenten schätzt, auf ein Rekordtief gesunken ist. Der prozentuale Anteil der Stützung am Produktionswert sank seit 1986 von 37% auf heute 23%. Für die Schweiz fiel der Stützungsindikator gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozentpunkte auf 50%. Verglichen mit dem Höchstwert aus dem Jahr 1988 bedeutet dies ein Rückgang von 28%. Waren die Inlandpreise in der Schweiz Ende der achtziger Jahre noch rund fünf mal höher als die Weltmarktpreise, so betragen sie heute nicht mal mehr das Doppelte. Die OECD lobt die Schweiz in der Evaluation für den im Rahmen der AP 2011 umgesetzten Abbau der Marktregulierung und den Grenzschutzabbau für Futtergetreide. Im Gegenzug kritisieren die Experten den hohen Anteil an Grenzschutz, der immer noch rund die Hälfte der Stützung der Landwirtschaft ausmacht.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 270
Kommission der Vereinten Nationen für Nachhaltige Entwicklung (CSD)
Seit 1992 nimmt die CSD bei den Vereinten Nationen bezüglich der Überwachung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung eine bedeutende Stellung ein. Die 16. Sitzung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung fand vom 5. bis 16. Mai 2008 am Sitz der Vereinten Nationen in New York statt und bezweckte eine Prüfung der realisierten Fortschritte in den Bereichen Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Böden, Dürre, Verwüstung, Afrika, Wasser und Entwässerung. Aufgrund der Versorgungsschwierigkeiten mit Nahrungsmitteln, denen zahlreiche Nettoimportländer seit Anfang 2008 begegnen, waren die Themen der Agenda äusserst aktuell. Das BLW führte für die Schweiz den Vorsitz der interdepartementalen Vorbereitungs- und Vertretungsarbeiten dieser 16. Kommissionssitzung.
Die Regierungen stellten eine deutliche Abnahme der natürlichen Ressourcen fest und kamen zum Schluss, dass es künftig einschneidender Änderungen bedarf, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln und Energie gerecht zu werden. Dieser Sachverhalt wird durch den Klimawandel noch verstärkt.
Die Landwirtschaft wurde zwar als wichtiger Sektor anerkannt, bei der Entwicklung der ländlichen Zonen und beim Kampf gegen Armut jedoch zu stark vernachlässigt. Die Notwendigkeit einer massiven Reinvestition, insbesondere zur Förderung der lokalen, diversifizierten Agrarproduktion über eine vermehrte Unterstützung der Familienbetriebe und vor allem der Frauen, wurde erkannt. Die Probleme der Verwüstung, Bodenerosion und des Verlusts von Anbauflächen wurden ebenfalls als Gefahren wahrgenommen, denen künftig besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Als grösste Hindernisse für eine nachhaltige Entwicklung gelten: fehlende, zuverlässige Daten für eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, politische Instabilität, mangelnder politischer Willen und Gouvernance, fehlende Koordination zwischen den Sektoren, schwache Stellung der landwirtschaftlichen Organisationen und Schwächen bei der Umsetzung. Die Schweiz hat sich für eine multifunktionelle Landwirtschaft eingesetzt, die Produktivität und Effizienz sicherstellt, die natürlichen Ressourcen schont (Wasser, Boden und Biodiversität) und zur ländlichen Entwicklung beiträgt. Die Anerkennung der ökologischen Dienstleistungen der Landwirtinnen und Landwirte wurde als innovatives Instrument vorgestellt, das eine integrierte Bewirtschaftung der Ressourcen ermöglicht. Ein besonderes Augenmerk galt der Bodenbewirtschaftung und dem weltweiten Verlust von Ackerboden. Betreffend Biotreibstoff hat die Schweiz betont, dass internationale Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, welche die als positiv bewiesene Wirkung ihrer Nutzung sicherstellen und dafür sorgen, dass die sozialen und ökologischen Mindeststandards bei der Produktion eingehalten werden. Die Schweiz hat zudem ein «side event» über die «Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung im Berggebiet» organisiert, wo das FAOProjekt «Sustainable Agriculture in Mountain Regions» (SARD-M) und die Arbeiten der Adelboden-Gruppe vorgestellt wurden.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 271
Im Jahr 2009 wird die Schweiz wieder an der 17. Sitzung der Kommission teilnehmen, um konkrete Empfehlungen in diesen Sektoren auszuhandeln.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 272
3.2Internationale Vergleiche
Im vergangenen Jahr wurde über den starken Anstieg der Weltmarktpreise bei wichtigen Pflanzenbauprodukten und bei der Milch berichtet. In diesem Jahr wird die Entwicklung der internationalen Preise weiter verfolgt. Das Kapitel wird mit einem Produzentenpreisvergleich zwischen der Schweiz und Deutschland und einer Darstellung der Entwicklung der Konsumentenpreise in der Schweiz im Vergleich zur EU abgerundet.
Das Jahr 2007 war weltweit gekennzeichnet durch einen starken Anstieg der Preise wichtiger Grundnahrungsmittel auf den Weltmärkten. Die Preishausse begann bereits Ende 2006 bei den Milchprodukten. Deren Preise lagen 2007 (Jahresdurchschnitt) bei Butter um 67%, bei Magermilchpulver um 93%, bei Vollmilchpulver um 91% und bei Cheddar-Käse um 51% über jenen von 2006 (Jahresdurchschnitt). Beim Weizen begann die kräftige Hausse etwas später, nämlich Mitte 2007. Der Preisanstieg beim Mais begann Ende 2007 und war etwas weniger ausgeprägt.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 273
Internationale Preise bleiben hoch Preisentwicklung bei verschiedenen Produktegruppen Index, 1998/2000 = 100 50 150 100 200 250 300 350 200001020304050607Jan 08 Feb 08 Mrz 08 Apr 08 Mai 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Getreide Milch Fleisch Quelle: FAO Zucker Öl und Fette
■
■ Entwicklung im 2008
Die Preise für Milchprodukte hatten bereits Ende 2007 ihren Höhepunkt erreicht, bei jenen für Getreide war es im Frühling 2008 und bei jenen für Öle und Fette im Frühsommer 2008 soweit. Seither sind alle Preise zurückgegangen, ausser bei Milch bleiben sie allerdings auf dem hohen Niveau von Ende 2007. Die Milchpreise sind stärker zurückgegangen, sie liegen im Sommer 2008 aber immer noch über dem Durchschnitt von 2006.
Anders als bei den Pflanzenbauprodukten ist bei den Preisen für Fleisch kein Rückgang in Sicht. Die Tendenz bei den Zuckerpreisen zeigt nach einer Abschwächung im Frühling 2008 wieder nach oben.
Preise 2008: CH Milch August; D Milch August, Speisekartoffeln August Gemüse Schweiz: franko Grossverteiler Richtpreise; Gemüse Deutschland: Grossmärkte
Quellen: Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, SBV, BFS, SZG, SOV, swisspatat, ZMP
ProdukteØ 2006Ø 20072008 (Sept.) DCHDCHDCH MilchRp./kg43.0271.8254.9670.0454.4584.39 Fleisch Muni T3Fr./kg SG4.798.224.748.735.269.18 Kälber T3Fr./kg SG8.0814.078.4014.527.6714.90 SchweineFr./kg SG2.373.762.244.042.824.98 Poulet Kl. 1Fr./kg LG1.042.541.282.411.392.63 Getreide und Ölsaaten Weizen Kl. 1Fr./100 kg18.2151.9535.1652.1026.8257.96 GersteFr./100 kg16.2639.5530.7436.6222.1637.11 KörnermaisFr./100 kg19.3941.0232.3641.0224.6139.55 RapsFr./100 kg35.7876.9948.6083.6656.5497.66 Hackfrüchte SpeisekartoffelnFr./100 kg31.6651.4521.3545.6031.9249.30 ZuckerrübenFr./100 kg6.9111.496.7311.866.3311.10 Gemüse KarottenFr./kg0.751.440.781.480.841.53 Tomaten rundFr./kg2.142.592.112.482.352.45 KopfsalatFr./kg2.183.942.173.772.253.51 BlumenkohlFr./kg1.322.811.422.601.332.65
Entwicklung der Rohstoffpreise
3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 274
Die gestiegenen Weltmarktpreise wirken sich nur teilweise auf die Schweizer Produzentenpreise aus, da die Schweizer Landwirtschaft durch Zölle geschützt ist. Die Entwicklung an den internationalen Märkten hat aber zur Folge, dass sich der Preisabstand zum umliegenden Ausland verringert hat. Schweizer Rohstoffe haben also an Wettbewerbskraft gewonnen.
Waren die Produzentenpreise bei wichtigen Ackerbauprodukten wie Weizen, Gerste oder Mais in der Schweiz 2006 noch zwei bis drei Mal so hoch wie in Deutschland, so verringerte sich diese Differenz im Jahr 2007 auf einen Faktor 1 bis 1,5. Aktuell sind die Schweizer Preise wieder 1,5–2 Mal höher als in Deutschland.
Während 2006 der Milchpreis noch 67% über jenem von Deutschland lag, betrug der Abstand 2007 nur noch 27%. Im August 2008 nahm die Differenz wieder zu (Abstand: 55%). Beim Fleisch blieb die Differenz zwischen 2006 und 2008 ziemlich konstant.
Auf der Konsumentenpreisfront hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt, zumindest was die Schweiz betrifft. Dies kommt in der folgenden Graphik zum Ausdruck, welche zeigt, wie sich die Preise für die Schweiz und die umliegenden EU-Länder im Vergleich zum EU-Durchschnitt seit dem Jahr 2000 entwickelt haben.
Entwicklung der Konsumentenpreise für Nahrungsmittel in ausgewählten Ländern im Vergleich zum EU-Durchschnitt
Die Schweiz hat sich in den letzten fünf Jahren dem EU-Durchschnitt angenähert. Die Preise in Deutschland liegen seit dem Jahr 2000 im EU-Mittel, während sie sich in Frankreich erst seit 2005 dort befinden. In Italien und Österreich liegen die Konsumentenpreise etwas über dem EU-Durchschnitt.
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 275
■ Konsumentenpreise
Index (EU15 = 100) 80 110 100 90 120 130 150 140 160 20002001200220032004200520062007 Deutschland Frankreich Italien Quelle: Eurostat Österreich Schweiz
Entwicklung der Konsumentenpreise für Nahrungsmittel in der Schweiz im Vergleich zum EU-Durchschnitt
Getreide Fleisch insgesamt
Milch, Käse und Eier Fette und Öle
Quelle: Eurostat
Die Konsumentenpreise in der Schweiz haben sich bei allen Nahrungsmittelgruppen dem EU-Durchschnitt angenähert. Die kleinste Differenz weist die Schweiz heute bei Milch, Käse und Eiern, die grösste beim Fleisch aus.
3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 276
Index (EU15 = 100) 100 140 120 160 180 200 220 20002001200220032004200520062007
3. INTERNATIONALE ASPEKTE 3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 277
Mitarbeit am Agrarbericht 2008
■ Projektleitung, Werner Harder
Sekretariat
■ Autoren
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Jean-Marc Chappuis, Simon Hasler, Nicole Locher, Frédéric Rothen, Beat Ryser, Beat Sahli, Nadine Studer
Wirtschaftliche Lage
Vinzenz Jung
Soziales
Esther Grossenbacher, Ruth Rossier
Ökologie und Ethologie
Brigitte Decrausaz, Ruth Badertscher, Reto Burkard, Anton Candinas, Daniel Felder, Christiane Vögeli-Albisser, Esther Grossenbacher
Internationale Nahrungsmittelmärkte
Werner Harder, Vinzenz Jung
■ Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Jean-Marc Chappuis
Übergreifende Instrumente
Thomas Ackermann, Emanuel Golder, Samuel Heger, Jacques Henchoz, Stefan Schönenberger
Milchwirtschaft
Nadine Studer
Viehwirtschaft
Simon Hasler
Pflanzenbau
Beat Ryser, Nicole Locher, Beat Sahli
278
Direktzahlungen
Thomas Maier, Lukas Barth, Jonas Plattner, Hugo Roggo, Olivier Roux, Beat Tschumi, Conrad Widmer, Peter Zbinden
Grundlagenverbesserung
Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
René Weber, Samuel Brunner, Johnny Fleury, Willi Riedo, Andreas Schild
Landwirtschaftliches Wissenssystem
Anton Stöckli, Dominik Burger, Urs Gantner, Jean-Pierre Perdrizat, Pierre-André Poncet, Jakob Rösch, Roland Stähli, Denise Tschamper, Esther Weiss, Christoph Zimmermann
Produktionsmittel
Alfred Klay, Eva Tscharland, Markus Hardegger
Sektion Finanzinspektorat
Rolf Enggist
Vernetzung der Agrar-Datenbanken
Dieter Wälti
■ Internationale Aspekte
Internationale Entwicklungen
Krisztina Bende, Thomas Ackermann, Claudia Challandes Binggeli, Jean Girardin, Tim Kränzlein, Isabelle Pasche, Hubert Poffet, François Pythoud, Fabian Riesen, Stefan Rösch
Internationale Vergleiche
Vinzenz Jung, Alessandro Rossi
■ Übersetzungsdienste Deutsch: Cornelia Heimgartner
Französisch: Elisabeth Tschanz, Delphine Binder, Odile Derossi, Giovanna Mele, Laura Sanchez
Italienisch: Patrizia Singaram, Francesca De Giovanni, Simona Stückrad
■ Internet Denise Kummer
■ Technische Unterstützung Hanspeter Leu, Peter Müller
279
280
ANHANG A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ Anhang Tabellen Strukturen A2 Tabellen Märkte A4 Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse A14 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung A14 Ergebnisse Einzelbetriebe A16 Tabellen Ausgaben des Bundes A27 Ausgaben für Produktion und Absatz A27 Ausgaben Absatzförderung A27 Ausgaben Milchwirtschaft A28 Ausgaben Viehwirtschaft A28 Ausgaben Pflanzenbau A29 Ausgaben für Direktzahlungen A30 Ausgaben für Grundlagenverbesserung A52 Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung A58 Rechtserlasse, Begriffe und Methoden A59 Abkürzungen A60 Literatur A62
A2 ANHANG Tabelle 1 Entwicklung von Landwirtschaftsbetrieben, Landwirtschaftlicher Nutzfläche und Grossvieheinheiten Grössenklassen in ha BetriebeLandwirtschaftliche NutzflächeGrossvieheinheiten landwirtschaftlicher Nutzfläche 199020002007199020002007199020002007 AnzahlAnzahlAnzahlhahahaAnzahlAnzahlAnzahl 0-16 6293 6092 7402 8951 336947 82 55061 01656 808 1-313 1904 7623 83723 8288 8617 039 34 46614 75312 234 3-58 2595 3933 69932 24321 34814 790 42 47327 71420 031 5-1018 83313 14910 449141 40399 05678 746 209 784127 36199 273 10-1518 92013 81211 177233 888171 817139 369 341 563230 628183 900 15-2012 71011 1729 699218 771193 856168 498 290 523247 517219 577 20-256 6777 2446 961147 772161 311155 173 173 896191 057193 181 25-303 3644 4304 73491 271121 005129 413 97 680130 901147 539 30-402 6744 1684 80290 726142 266163 738 87 709142 628175 999 40-508751 5911 94938 67270 50186 485 32 21461 91482 456 50-705079211 26228 84952 67272 919 23 17242 70766 791 70-10012720935310 37117 02128 644 7 41413 29024 629 >10050771027 80211 44414 518 6 3158 02510 866 Total92 81570 53761 7641 068 4901 072 4921 060 2781 429 7591 299 5121 293 284 Quelle: BFS
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Strukturen
ANHANG A3
KategorieVollzeitbeschäftigteTeilzeitbeschäftigteTotal 199020002007199020002007199020002007 BetriebsleiterMänner62 72049 33940 41826 16925 38518 34888 88974 72458 766 Frauen1 4565241 0052 4701 8221 9933 9262 3462 998 Andere FamilieneigeneMänner21 7968 7499 70722 72918 21220 12044 52526 96129 827 Frauen14 36714 2819 14165 77047 66541 92580 13761 94651 066 FamilieneigeneTotal100 33972 89360 271117 13893 08482 386217 477165 977142 657 Familienfremde Schweizer/innenMänner12 45310 8367 7832 9495 1253 92715 40215 96111 710 Frauen3 2002 5922 0083 3044 1943 6476 5046 7865 655 Ausländer/innenMänner10 9108 0616 2621 7583 4542 88512 66811 5159 147 Frauen6631 6131 5568471 9412 2661 5103 5543 822 FamilienfremdeTotal27 22623 10217 6098 85814 71412 72536 08437 81630 334 BeschäftigteTotal127 56595 99577 880125 996107 79895 111253 561203 793172 991 Quelle: BFS
Tabelle 2 Entwicklung der Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Märkte
A4 ANHANG
Tabelle 3 Landwirtschaftliche Nutzfläche nach Nutzungsarten Produkt1990/92200520062007 1 1990/92–2005/07 hahahaha% Getreide207 292167 689165 659157 572-21.1 Brotgetreide102 84088 03980 08581 925-19.0 Weizen96 17383 74475 83577 550-17.8 Dinkel2 1602 4282 5292 37213.1 Emmer, Einkorn 2 165160205 Roggen4 4321 6771 5391 780-62.4 Mischel von Brotgetreide75252218-71.1 Futtergetreide104 45379 65085 57475 647-23.1 Weizen-6 33415 00310 803Gerste59 69537 68937 05134 874-38.8 Hafer10 4342 9502 4162 226-75.7 Mischel von Futtergetreide238254231194-4.9 Körnermais 25 73920 61219 61617 464-25.3 Triticale8 34711 81111 25710 08632.4 Hülsenfrüchte2 2585 1785 6525 609142.6 Futtererbsen (Eiweisserbsen)2 1124 8075 2545 243141.5 Ackerbohnen 14627229327892.0 Lupinen-9910588Hackfrüchte36 38532 19831 98433 613-10.4 Kartoffeln (inkl. Saatgut)18 33312 51011 97311 745-34.1 Zuckerrüben14 30818 24818 73920 66034.3 Futterrüben (Runkeln, Halbzuckerrüben)3 7441 4401 2721 208-65.1 Ölsaaten18 20323 14323 83024 52830.9 Raps16 73016 54917 40218 6494.8 Sonnenblumen -5 0425 2684 851Soja1 4741 5181 125998-17.6 Ölkürbisse-343530Nachwachsende Rohstoffe-1 3061 4611 645Raps -1 1021 2861 551Sonnenblumen-414123Andere (Kenaf, Hanf, usw.)-16313471Freilandgemüse8 2508 9149 1759 25410.5 Silo- und Grünmais38 20442 93841 86942 77311.3 Grün- und Buntbrache3193 2923 1003 033885.9 Übrige offene Ackerfläche8301 6551 7361 644102.1 Offenes Ackerland311 741286 313284 466279 671-9.1 Kunstwiesen94 436119 101120 500126 20829.1 Übrige Ackerfläche3 9772 3252 5172 192-41.0 Ackerland Total410 154407 739407 483408 071-0.6 Obstbaumkulturen6 9146 6726 6366 602-4.0 Reben14 91914 90314 88514 847-0.3 Chinaschilf32312312287 566.7 Naturwiesen, Weiden638 900625 432625 132619 420-2.4 Andere Nutzung sowie Streue- und Torfland7 39410 14111 06411 33846.7 Landwirtschaftliche Nutzfläche1 078 6001 065 1181 065 2001 060 278-1.4 1 provisorisch 2 separate Erfassung ab 2002 Quellen: Reben und Obstbaumkulturen: BLW; andere Produkte: SBV, BFS
1 provisorisch 2 Durchschnitt der Jahre 1990/93
3 Veränderung 1990/93–2004/07
Quellen:
Milch und -produkte: SBV (1990–98), ab 1999 TSM
Fleisch: Proviande
Eier: Aviforum
Getreide, Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV
Obst: Schweizerischer Obstverband, Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein: BLW, Kantone
ANHANG A5 Tabelle 4 Produktion Produkt Einheit1990/92200520062007 1 1990/92–2005/07 % Milch und -produkte Konsummilch t549 810488 412493 246489 227-10.8 Rahmt68 13364 41664 74367 105-4.0 Buttert38 76640 27340 84543 4747.1 Milchpulvert35 84450 80448 37350 83439.5 Käset134 400167 708172 914176 27928.2 Fleisch und Eier Rindfleischt SG130 710100 024104 217102 147-21.9 Kalbfleischt SG36 65632 28931 58830 831-13.9 Schweinefleischt SG266 360236 165243 321241 902-9.7 Schaffleischt SG5 0656 1915 7885 42414.5 Ziegenfleischt SG541568525514-0.9 Pferdefleischt SG1 212941911798-27.1 Geflügelt Verkaufsgewicht20 73333 36129 78134 57957.1 SchaleneierMio. St.6386576606542.9 Getreide Weichweizent546 733521 400533 200535 600 1 -3.0 Roggent22 9789 4008 60010 100 1 -59.2 Gerstet341 774231 200230 000210 900 1 -34.4 Hafert52 80715 30012 00010 100 1 -76.4 Körnermaist211 047198 900152 400180 900 1 -15.9 Triticalet43 94068 40064 60057 600 1 44.6 Anderet11 46911 90011 80011 600 1 2.6 Hackfrüchte Kartoffelnt750 000485 000392 000490 000 1 -39.2 Zuckerrübent925 8671 409 4001 242 7281 572 925 1 52.1 Ölsaaten Rapst46 11456 20053 30056 500 1 20.0 Sonnenblument-15 00013 60012 900 1Anderet3 6584 3724 4323 309 1 10.4 Obst (Tafel) Äpfel t91 503 2 102 900102 881109 20013.6 3 Birnen t-16 25114 23818 790Aprikosen t3 407 2 3 3554 5554 54025.3 3 Kirschen t1 818 2 1 5881 6892 2023.2 3 Zwetschgen t2 837 2 1 9982 3823 714-2.3 3 Erdbeeren t4 2635 6955 4015 77631.9 Gemüse (frisch) Karottent49 16255 92459 47261 26419.8 Zwiebelnt23 50532 84426 76629 59826.5 Knollenselleriet8 50610 7858 20310 10414.0 Tomatent21 83032 03531 79836 32352.9 Kopfsalatt18 82115 66713 21214 207-23.7 Blumenkohlt8 3316 4615 4556 038-28.2 Gurkent8 6089 6699 9469 81614.0 Wein Rotweinhl550 276522 415539 742528 139-3.7 Weissweinhl764 525478 988471 380512 292-36.2
rund um Genf und aus dem Fürstentum Liechtenstein
A6 ANHANG
5 Produktion Milchprodukte Produkt1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% Total Käse 134 400167 708172 914176 27928.2 Frischkäse4 38739 78140 55141 382824.8 Mozzarella-14 81515 47016 191Übrige Frischkäse-24 96625 08125 190Weichkäse4 8126 5656 7736 90940.3 Tommes1 2492 0341 9882 06162.3 Weissschimmelkäse, halb- bis vollfett1 5731 4551 4881 416-7.6 Übrige Weichkäse1 9903 0753 2973 43264.2 Halbhartkäse40 55649 43349 56052 15824.2 Appenzeller8 7259 1888 6628 8402.0 Tilsiter7 7364 1434 1234 124-46.6 Raclettekäse9 89813 20412 92913 71134.2 Übrige Halbhartkäse14 19722 89823 84625 48369.6 Hartkäse84 62971 05075 10574 836-13.0 Emmentaler56 58832 18033 89430 772-43.0 Gruyère22 46427 52928 37128 21124.8 Sbrinz4 6591 5631 6642 003-62.6 Übrige Hartkäse9189 77811 17613 8501 163.8 Spezialprodukte 1 158799279956 124.4 Total Frischmilchprodukte 680 822740 535748 474746 8309.5 Konsummilch549 810488 412493 246489 227-10.8 Übrige131 012252 123255 228257 60394.6 Total Butter 38 76640 27340 84543 4747.1 Vorzugsbutter27 2004 1924 3555 421-82.9 Übrige11 56636 08136 49038 053218.8 Total Rahm 68 13364 41664 74367 105-4.0 Total Milchpulver 35 84450 80448 37350 83439.5 1 reiner Schafkäse und reiner Ziegenkäse Quellen: SBV (1990–98), ab 1999 TSM Tabelle 6 Verwertung der vermarkteten Milch Produkt1990/922005200620071990/92–2005/07 1 000 t Milch1 000 t Milch1 000 t Milch1 000 t Milch% Konsummilch549448450447-18.3 Verarbeitete Milch2 4902 7552 7282 78510.7 zu Käse1 5311 3721 4031 427-8.5 zu Butter35648146445230.8 zu Rahm430251251261-40.9 andere Milchprodukte173652611646267.8 Total 1 3 0393 2033 1793 2335.5 1 exklusive Milch aus der Freizone
Quellen: SBV (1990–98), ab 1999 TSM
Tabelle
ANHANG A7
Tabelle 7
Produkt1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% Kartoffeln Speisekartoffeln285 300166 200160 200163 500 1 -42.8 Veredlungskartoffeln114 700133 200114 741135 000 1 8.9 Saatgut35 93324 70029 11024 000 1 -24.6 Frischverfütterung225 967134 00072 600156 000 1 -47.4 Verarbeitung zu Futtermitteln146 90021 50014 1005 600 1 -79.3 Schweizer Mostäpfel und -birnen (Verarbeitung in gewerblichen Mostereien)183 006 2 95 768132 917162 992-25.1 3 Mostobst-Menge für Rohsaft182 424 2 95 651132 850162 767-24.9 3 Frisch ab Presse10 477 2 9 1669 6797 993-13.2 3 Obstwein zur Herstellung von Obstbrand3 297 2 1622331-92.5 3 Konzentratsaft165 263 2 81 195115 597151 423-25.3 3 Andere Säfte (inkl. Essig)3 387 2 5 1287 3413 35023.4 3 Obst eingemaischt582 2 11767225-72.7 3 Spirituosenerzeugung aus Schweizer Äpfel und Birnen40 255 2 21 66811 10413 104-60.8 3 aus Schweizer Kirschen und Zwetschgen23 474 2 12 7268 06510 728-52.2 3 Schweizer Frischgemüse für Nährmittelherstellung Tiefkühlgemüse26 06124 10430 04925 4551.8 Konservengemüse (Bohnen, Erbsen, Pariserkarotten)19 77614 35414 93718 421-19.6 Sauerkraut (Einschneidekabis)8 4755 6825 7805 970-31.4 Sauerrüben (Rübe)1 495997951773-39.3 1 provisorisch 2 Durchschnitt der Jahre 1990/93 3 Veränderung 1990/93–2004/07 Quellen: Kartoffeln: swisspatat Mostobst: BLW; Spirituosen: Eidgenössische Alkoholverwaltung Verarbeitungsgemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Verwertung der Ernte im Pflanzenbau
A8 ANHANG
Aussenhandel Produkt1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% AusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhr Milch und -produkte Milch1923 00732623 05533523 9292 45423 1935 280.01.7 Jogurt1 195177 3001 8776 9183 9036 5006 674477.824 319.6 Rahm 909254 2753 2104 0113 0434 3862 800364.711 827.5 Butter04 15422 04154 507126 9092 011.18.0 Milchpulver8 1583 26616 97054512 6913847 07230150.1-87.4 Käse und Quark62 48327 32851 70931 91350 48733 89254 32137 329-16.525.8 Fleisch, Eier und Fische Rindfleisch2807 8731 22312 6101 34614 4501 39115 966371.482.2 Kalbfleisch0916097201 20851 161-21.6 Schweinefleisch2881 95624312 88929911 96733812 6971.9540.0 Schaffleisch56 48906 07306 07705 923-100.0-7.2 Ziegenfleisch0403025403310349--22.8 Pferdefleisch04 60004 27804 74804 871-0.7 Geflügel1039 94273842 13044043 50618050 2804 426.713.4 Eier 031 4017028 3442928 912532 329--4.9 Fische, Krebs- und Weichtiere62031 13215737 01116840 47118041 616-72.827.5 Getreide Weizen6232 13478202 62970257 241197332 7751 708.413.8 Roggen03 05702 7793008 754484 776-77.9 Gerste43644 50417214 06812455 0158982 751-70.513.7 Hafer13160 885047 408054 97650055 63027.3-13.5 Körnermais19460 51253376 09617156 30473162 27133.362.3 Hackfrüchte Kartoffeln9 6958 72252520 2101 74357 3251 87747 512-85.7377.9 Zucker40 882124 065302 485313 561284 086277 158222 932306 135560.0141.0 Ölsaaten Ölsaaten489134 57060379 1271 11685 12377980 92370.2-39.3 Pflanzliche Öle und Fette18 68057 7652 953110 9572 865123 1653 155119 875-84.0104.3 Obst (frisch) Äpfel 683 1 12 169 1 61110 62975910 0082 3585 41142.4 2 -2.6 2 Birnen 491 1 11 803 1 3289 605788 48249710 247-42.5 2 -26.3 2 Aprikosen 226 1 10 578 1 19 1281358 363495 212-78.4 2 -31.4 2 Kirschen 256 1 1 062 1 251 561221 86044900-90.6 2 27.5 2 Zwetschgen und Pflaumen 12 1 3 290 1 16 313295 603334 66535.4 2 59.6 2 Erdbeeren 15011 0237412 3846811 2994410 380-58.83.0 Trauben 2333 691636 71014032 67615833 225334.31.5 Zitrusfrüchte161135 7805123 676351126 087303131 92336.4-6.3 Bananen8577 896574 2203174 068878 237-82.7-3.1 Gemüse (frisch) Karotten711 710705 87745 411258 398-53.5283.7 Zwiebeln8623 44463 40118 692506 127-97.876.4 Knollensellerie020609782040923-97.7 Tomaten40235 7004140 3524841 1943138 964-90.012.5 Kopfsalat373 95402 394132 65422 694-86.4-34.7 Blumenkohl119 98518 58079 420139 003-38.2-9.9 Gurken6517 4791916 113116 222814 080-85.6-11.5 Wein (Trinkwein) Rotwein (in hl)3 4991 494 29411 7711 348 27415 1251 287 36212 7481 346 110277.7-11.2 Weisswein (in hl)7 59076 83511 651228 17511 129239 4595 844292 33825.7229.7 1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 2 Veränderung 1990/93–2004/07 Quellen: Milch und -produkte, Fleisch, Eier, Getreide, Hackfrüchte, Ölsaaten, Obst, Gemüse und Wein: OZD Zucker: réservesuisse
Tabelle 8
ANHANG A9
9 Aussenhandel Käse Produkt1990/922005200620071990/92–2005/07 tttt% Einfuhr Frischkäse 1 4 1759 2299 89611 629145.6 Reibkäse 2 233833804880260.7 Schmelzkäse 3 2 2212 1752 4082 3884.6 Schimmelkäse 4 2 2762 0802 0782 205-6.8 Weichkäse 5 6 6285 7835 7006 796-8.1 Halbhartkäse 6 11 795 4 8925 5086 275 Hartkäse 7 6 9216 9067 156 6.4 Total Käse und Quark27 32831 91333 30037 32925.1 Ausfuhr Frischkäse 1 22984581 09530 750.0 Reibkäse 2 104881351044.8 Schmelzkäse 3 8 2454 6154 2534 339-46.6 Schimmelkäse 4 01320160 Weichkäse 5 306073743911 419.2 Halbhartkäse 6 54 102 8 9599 35510 636 Hartkäse 7 37 12836 35037 739 -13.6 Total Käse und Quark62 48351 70950 94554 320-16.3 1 0406.1010, 0406.1020, 406.1090 2 0406.2010, 0406.2090 3 0406.3010, 0406.3090 4 0406.4010, 0406.4021, 0406.4029, 0406.4081, 0406.4089 5 0406.9011, 0406.9019 6 0406.9021, 0406.9031, 0406.9051, 0406.9091 7 0406.9039, 0406.9059, 0406.9060, 0406.9099 Quelle: OZD
Tabelle
Pro-Kopf-Konsum
A10 ANHANG
10
Tabelle
Produkt1990/92200520062007 1 1990/92–2005/07 kgkgkgkg% Milch und -produkte Konsummilch 104.3779.1078.9077.70-24.7 Rahm6.438.208.208.4028.5 Butter6.205.605.605.70-9.1 Käse (ohne Quark)16.9019.7018.7019.4014.0 Frischkäse3.466.406.406.5085.9 Weichkäse1.831.701.801.90-1.8 Halbhartkäse5.655.605.605.70-0.3 Hartkäse5.966.006.106.504.0 Fleisch und Eier Rindfleisch 13.7110.3910.9110.70-22.2 Kalbfleisch 4.253.433.353.24-21.4 Schweinefleisch 29.7325.2025.6625.36-14.5 Schaffleisch 1.421.401.361.29-4.9 Ziegenfleisch 0.120.090.100.10-19.4 Pferdefleisch 0.750.630.680.68-11.6 Geflügel 8.059.698.279.6214.2 Schaleneier (in St.)199185185189-6.4 Getreide Brot- und Backwaren50.7051.0051.6047.90-1.1 Hackfrüchte Kartoffeln und Kartoffelprodukte44.1743.6447.1047.003.9 Zucker (inkl. Zucker in Verarbeitungsprodukten) 42.3758.6056.9057.0035.7 Ölsaaten Pflanzliche Öle und Fette12.8016.1016.8017.0029.9 Obst (Tafel) Äpfel 15.26 2 15.1314.9314.790.4 3 Birnen -3.423.023.76Aprikosen 2.04 2 1.671.701.28-24.9 3 Kirschen 0.39 2 0.420.470.409.6 3 Zwetschgen und Pflaumen 0.91 2 1.111.061.1017.3 3 Erdbeeren 2.242.412.222.120.4 Zitrusfrüchte20.0916.5816.7517.34-15.9 Bananen11.539.959.8610.30-12.9 Gemüse (frisch) Karotten7.538.278.649.1715.4 Zwiebeln3.864.864.724.7023.3 Knollensellerie1.291.461.121.454.1 Tomaten8.469.709.719.9115.5 Kopfsalat3.372.432.132.25-32.6 Blumenkohl2.712.021.981.98-26.4 Gurken2.972.802.882.94-3.3 Wein Rotwein (in l)31.9725.5924.8325.76-20.6 Weisswein (in l)14.4710.2110.8111.26-25.6 Wein total (in l)46.4435.8035.6437.02-22.2 1 teilweise provisorisch 2 Durchschnitt der Jahre 1990/93 3 Veränderung 1990/93–2004/07 Quellen: Milch und -produkte, Eier, Hackfrüchte, Getreide und Ölsaaten: SBV Fleisch: Proviande Obst, Gemüse und Wein: BLW
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–2004/07
3 Preise franko Schlachthof, ausgenommen Fleischschweine ab Hof, QM: Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch
4 Preis gilt nicht für Übermengen
Quellen:
Milch: BLW
Schlachtvieh: Proviande
Getreide, Hackfrüchte und Ölsaaten: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Obst: Schweizerischer Obstverband und Interprofession des fruits et légumes du Valais; handelt sich um definitive Produzenten-Richtpreise
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau; Preise entsprechen Stufe franko Grossverteiler.
ANHANG A11
11 Produzentenpreise ProduktEinheit1990/922005200620071990/92–2005/07 % Milch CH gesamtRp./kg104.9772.4171.8270.04-32.0 Verkäste Milch (erst ab 1999) Rp./kg-72.2171.6570.66Biomilch (erst ab 1999)Rp./kg-81.8180.2478.31Schlachtvieh 3 Kühe T3Fr./ kg SG7.826.166.356.77-17.8 Jungkühe T3Fr./ kg SG8.136.947.087.24-12.8 Muni T3Fr./ kg SG9.287.978.448.73-9.7 Ochsen T3Fr./ kg SG9.837.958.418.71-15.0 Rinder T3Fr./ kg SG8.667.948.238.58-4.7 Kälber T3Fr./ kg SG14.3913.2014.4314.47-2.5 Fleischschweine, ab 2003 QMFr./ kg SG5.834.023.854.04-31.9 Lämmer bis 40 kg, T3Fr./ kg SG15.4010.3010.3410.45-32.7 Getreide WeizenFr./100 kg99.3452.4252.3753.57-46.9 RoggenFr./100 kg102.3644.7844.6645.02-56.2 GersteFr./100 kg70.2442.2441.8741.20-40.5 HaferFr./100 kg71.4046.9747.7345.22-34.7 TriticaleFr./100 kg70.6942.6641.8341.24-40.7 KörnermaisFr./100 kg73.5442.2342.8742.60-42.1 Hackfrüchte KartoffelnFr./100 kg38.5534.3038.0737.73-4.8 ZuckerrübenFr./100 kg14.8411.7711.4911.67-21.5 Ölsaaten RapsFr./100 kg203.6776.8375.5580.73-61.8 SonnenblumenFr./100 kg-82.0082.9284.46Obst Äpfel: Golden Delicious IFr./ kg1.12 1 1.01 4 0.97 4 0.90 4 -12.1 2 Äpfel: Maigold IFr./ kg1.35 1 0.90 4 0.90 4 0.91 4 -27.4 2 Birnen: ConférenceFr./ kg1.33 1 1.09 4 1.23 4 0.92 4 -20.7 2 AprikosenFr./ kg2.09 1 2.372.532.5514.1 2 KirschenFr./ kg3.20 1 3.703.603.3010.2 2 Zwetschgen: FellenbergFr./ kg1.40 1 2.052.051.8033.0 2 ErdbeerenFr./ kg4.775.005.205.6010.4 Gemüse Karotten (Lager)Fr./ kg1.091.381.451.5433.6 Zwiebeln (Lager)Fr./ kg0.890.971.601.6658.4 Knollensellerie (Lager)Fr./ kg1.622.322.432.7153.5 Tomaten rundFr./ kg2.422.342.592.482.1 KopfsalatFr./ kg2.373.633.943.7759.5 BlumenkohlFr./ kg1.852.302.812.6038.9 SalatgurkenFr./ kg1.662.152.362.2736.1
Tabelle
Tabelle 12
Konsumentenpreise
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–2004/07
3 Daten werden vom BFS nicht mehr erhoben
Milch, Fleisch (Warenkorb aus Labelfleisch und konventionell produziertem Fleisch): BLW
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte: BFS
A12 ANHANG
ProduktEinheit1990/922005200620071990/92–2005/07 % Milch und -produkte Vollmilch, pasteurisiert,verpacktFr./l1.851.541.521.52-17.5 Milchdrink, pasteurisiert, verpacktFr./l1.851.501.491.49-19.2 Magermilch UHTFr./l-1.421.431.48EmmentalerFr./ kg20.1519.6319.2119.04-4.3 GreyerzerFr./ kg20.4020.1919.9719.94-1.8 TilsiterFr./ kg-17.5916.8016.66Camembert 60% (FiT)125 g-2.902.882.76Weichkäse Schimmelreifung150 g-3.683.643.52Mozzarella 45% (FiT)150 g-2.132.121.90Vorzugsbutter200 g3.462.952.852.77-17.5 Die Butter (Kochbutter)250 g3.442.842.762.66-20.0 Vollrahm, verpackt 1⁄2 l-4.223.973.63Kaffeerahm, verpackt 1⁄2 l-2.342.272.01Joghurt, aromatisiert oder mit Früchten180 g0.890.660.650.64-26.6 Rindfleisch Entrecôte, geschnittenFr./ kg48.3655.7057.0558.7018.2 Plätzli, EckstückFr./ kg37.5942.8643.7544.5516.3 Braten, SchulterFr./ kg26.3427.8928.1627.846.2 HackfleischFr./ kg15.0016.9517.2117.4014.6 Kalbfleisch Koteletten, geschnittenFr./ kg35.3244.1747.5348.3832.2 Braten, SchulterFr./ kg32.5636.3537.8437.0313.9 VoressenFr./ kg21.6731.8633.5832.7551.0 Schweinefleisch Koteletten, geschnittenFr./ kg19.8819.9219.6420.360.5 Plätzli, EckstückFr./ kg24.4825.7925.9725.765.6 Braten, SchulterFr./kg18.4319.5918.5318.111.7 Voressen, SchulterFr./ kg16.6918.9718.4117.8010.2 Lammfleisch Inland frisch Gigot ohne SchlossbeinFr./ kg26.3428.7528.9129.5810.4 Koteletten, geschnittenFr./ kg30.3238.4641.6243.3535.7 Fleischwaren Hinterschinken, Model geschnittenFr./ kg25.5629.6729.7629.0615.4 Salami Inland I, geschnittenFr./100 g3.094.464.514.5445.8 Poulets Inland, frischFr./ kg8.419.129.569.5812.0 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte Weissmehl 3 Fr./ kg-1.391.38-Ruchbrot 3 Fr./500 g-1.371.26-Halbweissbrot 3 Fr./500 g-1.411.30-Weggli / Semmel 3 Fr./ kg-10.4910.66-Gipfeli 3 Fr./ kg-16.2116.36-Spaghetti 3 Fr./500 g-1.101.06-KartoffelnFr./ kg1.432.262.312.3761.8 KristallzuckerFr./ kg1.651.651.831.816.9 Sonnenblumenöl 3 Fr./l5.054.81---4.8 Obst (Herkunft In- und Ausland) Äpfel: Golden DeliciousFr./ kg3.15 1 3.824.023.7123.7 2 BirnenFr./ kg3.25 1 3.563.903.7315.0 2 AprikosenFr./ kg3.93 1 6.156.807.5269.5 2 KirschenFr./ kg7.35 1 9.889.5810.5836.2 2 ZwetschgenFr./ kg3.42 1 4.464.333.8821.1 2 ErdbeerenFr./ kg8.6910.8311.9212.6134.9 Gemüse (Frischkonsum; Herkunft In- und Ausland) Karotten (Lager)Fr./ kg1.912.022.202.2212.4 Zwiebeln (Lager)Fr./ kg1.861.952.662.6429.9 Knollensellerie (Lager)Fr./ kg3.143.854.574.7439.7 Tomaten rundFr./ kg3.733.593.513.68-3.7 KopfsalatFr./ kg4.461.862.011.99-56.2 BlumenkohlFr./ kg3.584.214.674.3623.3 SalatgurkenFr./ kg2.804.101.801.74-9.0
Quellen:
Tabelle 13
Selbstversorgungsgrad
1 inkl. Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide, jedoch ohne Ölkuchen; ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 einschliesslich Hartweizen, Speisehafer, Speisegerste und Mais
3 Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche
4 Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5 einschliesslich Fleisch von Pferden, Ziegen, Kaninchen sowie Wildbret, Fische, Krusten- und Weichtiere
6 verdauliche Energie in Joules, alkoholische Getränke eingeschlossen
7 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen, Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
Quelle: SBV
ANHANG A13
Produkt1990/922004200520061990/92–2004/06 % Mengenmässiger Anteil:%%%% Brotgetreide 118928781-26.6 Futtergetreide 1 6175727119.1 Getreide total 2 64636359-3.6 Speisekartoffeln101959176-13.5 Zucker465050422.9 Pflanzliche Fette, Öle22222219-4.5 Obst 3 72735971-6.0 Gemüse55555147-7.3 Konsummilch 979998981.4 Butter 899793873.7 Käse 137114117118-15.1 Milch und Milchprodukte total110108108105-2.7 Kalbfleisch 4 979897960.0 Rindfleisch 4 93888684-7.5 Schweinefleisch 4 99939695-4.4 Schaffleisch 4 3945444413.7 Geflügel 4 3748494729.7 Fleisch aller Arten 4 5 76697070-8.3 Eier und Eikonserven444644463.0 Energiemässiger Anteil 6: Pflanzliche Nahrungsmittel 43454340-0.8 Tierische Nahrungsmittel brutto 97949493-3.4 Nahrungsmittel im ganzen brutto62606057-4.8 Nahrungsmittel im ganzen netto 7 58555453-6.9 Wertmässiger Anteil Nahrungsmittel im ganzen 8 72646364-11.6
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse
A14 ANHANG
Tabelle 14 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs zu laufenden Herstellungspreisen, in 1000 Fr. Produkt1990/9220052006 1 2007 2 1990/92–2008 3 2005/07–2005/07 2008 %% Erzeugung landwirtschaftlicher Güter13 325 5909 414 4879 080 3709 715 798-29.49 981 5596.1 Pflanzliche Erzeugung6 049 8314 465 6894 156 0984 687 824-26.74 574 1973.1 Getreide (einschl. Saatgut)1 116 180448 267442 399456 257-59.8443 536-1.2 Weizen543 264259 251267 914287 633-50.0282 2333.9 Gerste306 59184 82885 27277 385-73.169 590-15.6 Körnermais153 80368 89356 76261 457-59.459 777-4.2 Sonstiges Getreide112 52235 29532 45229 781-71.131 935-1.8 Handelsgewächse261 444284 733255 499299 5947.1312 85011.8 Ölsaaten und Ölfrüchte (einschl. Saatgut)96 23087 99788 35794 919-6.0104 84816.0 Eiweisspflanzen (einschl. Saatgut)10 28214 34114 61114 40540.613 976-3.3 Rohtabak16 94522 83017 30712 7794.113 230-25.0 Zuckerrüben136 590154 747130 238172 61311.7175 73315.2 Sonstige Handelsgewächse1 3984 8174 9854 879250.25 0623.4 Futterpflanzen1 953 8331 347 965976 4571 383 288-36.71 264 1562.3 Futtermais200 132171 391149 943196 145-13.8172 8910.2 Futterhackfrüchte31 7619 1888 7478 312-72.57 956-9.1 Sonstige Futterpflanzen1 721 9391 167 386817 7671 178 831-38.81 083 3102.7 Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus1 246 2961 269 7321 332 0261 367 4496.21 376 9104.1 Frischgemüse387 355530 192521 150565 66939.1563 4154.5 Pflanzen und Blumen858 941739 540810 876801 781-8.7813 4953.8 Kartoffeln (einschl. Pflanzkartoffeln)276 669177 114173 826171 508-37.1179 2532.9 Obst704 397496 360507 576540 768-26.9507 301-1.5 Frischobst324 160282 824297 262321 923-7.2273 884-8.9 Weintrauben380 237213 536210 314218 844-43.7233 4179.0 Wein467 759413 234431 593434 871-8.8456 4847.0 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse23 25328 28336 72234 08842.133 7082.0 Tierische Erzeugung7 275 7604 948 7984 924 2725 027 974-31.75 407 3628.9 Rinder1 833 1621 177 4321 237 5011 293 693-32.61 240 2240.3 Schweine1 533 212975 330948 445992 388-36.61 137 69217.0 Einhufer15 0025 0664 8973 292-70.53 120-29.4 Schafe und Ziegen62 47151 02945 69144 783-24.548 0441.9 Geflügel177 154205 507182 098203 90611.3225 86814.6 Sonstige Tiere32 12910 79311 15912 426-64.312 1936.4 Milch3 396 1492 336 1952 307 7152 292 083-31.92 553 68810.5 Eier211 437179 538178 114174 396-16.1179 2581.1 Sonstige tierische Erzeugnisse15 0447 9088 65211 006-38.97 275-20.8 Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen425 198638 100609 861613 65245.9625 9950.9 Landwirtschaftliche Dienstleistungen425 198607 767606 978612 20543.2625 9952.8 Verpachtung von Milchkontingenten030 3332 8831 447-0-100.0 Landwirtschaftliche Erzeugung13 750 78910 052 5869 690 23110 329 450-27.110 607 5545.8 Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten (nicht trennbar)359 034294 148333 655307 861-13.1305 204-2.1 Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse276 878193 502207 693207 564-26.7202 017-0.4 Sonstige nicht trennbare Nebentätigkeiten (Waren und Dienstleistungen)82 156100 646125 962100 29732.6103 187-5.3 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs14 109 82310 346 73410 023 88510 637 311-26.710 912 7585.6 1Halbdefinitiv, Stand 9.9.2008 2Provisorisch, Stand 9.9.2008 3Schätzung, Stand 9.9.2008 Die Zahlen werden auf- oder abgerundet, wodurch die Summe der Komponenten gegenüber der Totale oder Salden abweichen kann.Quelle: BFS
ANHANG A15 Tabelle 15 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung zu laufenden Preisen, in 1 000 Fr. Produkt1990/9220052006 1 2007 2 1990/92–2008 3 2005/07–2005/07 2008 %% Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs 14 109 82310 346 73410 023 88510 637 311-26.710 912 7585.6 Vorleistungen insgesamt6 866 7756 263 3426 083 4086 447 468-8.86 623 6835.7 Saat- und Pflanzgut346 578303 775301 344316 251-11.4322 0384.9 Energie, Schmierstoffe334 759432 847458 539452 60933.8514 53914.9 Dünge- und Bodenverbesserungsmittel250 334183 940179 257179 284-27.8246 63836.4 Pflanzenbehandlungs- und Schädlingbekämpfungsmittel138 587126 012126 488126 734-8.8122 017-3.5 Tierarzt und Medikamente156 121180 894192 928199 54722.4204 1256.8 Futtermittel3 766 0312 674 9502 456 1622 795 095-29.82 774 3655.0 Instandhaltung von Maschinen und Geräten353 840462 322457 560466 75130.6472 6242.3 Instandhaltung von baulichen Anlagen119 521188 790189 155199 52961.1201 0324.4 Landwirtschaftliche Dienstleistungen425 198638 100609 861613 65245.9625 9950.9 Sonstige Waren und Dienstleistungen848 486955 4461 004 881998 10516.21 022 2303.7 Unterstellte Bankgebühren127 321116 265107 23499 911-15.3118 0809.5 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen7 243 0474 083 3923 940 4784 189 843-43.84 289 0755.4 Abschreibungen2 058 2542 154 6152 165 5242 228 9546.12 279 4134.4 Ausrüstungsgüter1 023 5491 076 8321 076 6741 104 0166.11 139 3214.9 Bauten947 711954 453970 6831 003 6993.01 005 6733.0 Anpflanzungen83 44297 61696 78497 92216.8103 6446.4 Sonstige3 55225 71421 38323 317560.730 77431.1 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen5 184 7931 928 7771 774 9541 960 889-63.62 009 6626.4 Sonstige Produktionsabgaben43 355140 742135 529140 216220.2140 6741.3 Sonstige Subventionen (produktunabhängige)886 8542 570 7702 656 8062 695 827197.82 658 4980.7 Faktoreinkommen6 028 2924 358 8054 296 2324 516 500-27.24 527 4863.1 Arbeitnehmerentgelt1 233 8401 193 4221 250 9961 233 407-0.61 237 2380.9 Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen4 794 4523 165 3833 045 2363 283 093-34.03 290 2494.0 Gezahlte Pachten192 569200 829201 416201 3304.5201 5110.2 Gezahlte Zinsen455 911211 723225 636250 778-49.7277 36720.9 Empfangene Zinsen64 03110 98012 04914 150-80.619 18254.8 Nettounternehmenseinkommen 4 4 210 0032 763 8102 630 2332 845 135-34.82 830 5533.1 1Halbdefinitiv, Stand 9.9.2008 2Provisorisch, Stand 9.9.2008 3Schätzung, Stand 9.9.2008 4 wird in der Literatur und Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet Die Zahlen werden auf- oder abgerundet, wodurch die Summe der Komponenten gegenüber der Totale oder Salden abweichen kann.Quelle: BFS
Betriebsergebnisse: Alle Regionen
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden. Für die Jahre 1990/92 fehlen die Informationen, vgl. Erläuterungen im Textteil.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A16 ANHANG
Tabelle 16
MerkmalEinheit1990/9220042005200620072004/06–2007 % ReferenzbetriebeAnzahl4 302 3 077 3 135 3 271 3 328 5.3 Vertretene BetriebeAnzahl62 921 50 976 50 916 50 099 49 203 -2.9 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha16.06 19.25 19.75 20.07 20.31 3.1 Offene Ackerflächeha4.90 4.84 5.16 5.24 5.28 3.9 Arbeitskräfte BetriebJAE1.88 1.63 1.63 1.63 1.63 0.0 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.39 1.25 1.24 1.24 1.24 -0.3 Kühe totalAnzahl12.9 13.5 13.8 13.9 14.3 4.1 Tierbestand totalGVE23.2 23.1 23.4 23.7 24.1 3.0 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.606 321 771 195 777 034 797 522 821 324 5.0 davon: Umlaufvermögen totalFr.116 932 135 366 134 727 135 289 142 097 5.2 davon: Tiervermögen totalFr.60 662 48 205 50 444 50 975 54 356 9.0 davon: Anlagevermögen totalFr.428 727 587 624 591 862 611 257 624 871 4.7 davon: Aktiven BetriebFr.558 933 726 323 733 817 753 830 774 288 4.9 Fremdkapitalquote%43 44 43 45 45 2.3 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.19 808 11 028 8 694 10 283 12 345 23.4 Erfolgsrechnung RohleistungFr.*231 763 227 283 226 795 242 567 6.1 davon: DirektzahlungenFr.13 594 47 485 48 745 50 033 52 220 7.1 SachkostenFr.*144 409 145 550 146 039 152 903 5.2 BetriebseinkommenFr.93 027 87 354 81 733 80 756 89 664 7.7 PersonalkostenFr.13 775 13 081 13 548 13 925 14 375 6.3 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.11 361 7 095 6 941 7 232 7 528 6.2 Pacht- und MietzinsenFr.5 069 6 706 6 970 6 684 6 617 -2.5 FremdkostenFr.*171 291 173 009 173 880 181 424 5.0 Landwirtschaftliches EinkommenFr.62 822 60 472 54 274 52 915 61 143 9.4 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.16 264 21 557 22 172 22 939 23 417 5.4 GesamteinkommenFr.79 086 82 030 76 446 75 854 84 561 8.3 PrivatverbrauchFr.59 573 66 440 66 954 68 529 69 934 3.9 EigenkapitalbildungFr.19 513 15 590 9 493 7 325 14 627 35.4 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.46 914 51 261 47 336 46 524 45 333 -6.3 Cashflow 3 Fr.44 456 46 392 41 588 41 961 45 495 5.0 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %95 91 88 90 100 11.5 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %66 66 64 67 68 3.6 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %52 46 41 38 42 0.8 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %26 25 21 22 26 14.7 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %10 14 20 21 17 -7.3 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 14 17 19 15 -10.0 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE49 473 53 720 50 282 49 459 54 978 7.5 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha5 796 4 538 4 138 4 025 4 414 4.3 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%16.7 12.0 11.1 10.7 11.6 3.0 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %0.8 -1.6 -2.5 -2.7 -1.7 -25.0 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-2.2 -4.7 -6.2 -6.6 -4.8 -17.7 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE31 025 39 676 36 687 34 492 39 488 6.9 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE29 465 36 704 33 833 32 461 36 630 6.7 (Median)
(1990:
6.42%; 2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen
6.40%; 1991: 6.23%; 1992:
Betriebsergebnisse: Talregion*
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion: Ackerbauzone plus Übergangszonen
**Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden. Für die Jahre 1990/92 fehlen die Informationen, vgl. Erläuterungen im Textteil.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A17
Tabelle 17
MerkmalEinheit1990/9220042005200620072004/06–2007 % ReferenzbetriebeAnzahl2 356 1 435 1 426 1 491 1 524 5.1 Vertretene BetriebeAnzahl29 677 23 059 23 244 22 818 22 546 -2.1 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha16.66 20.07 20.64 21.02 21.22 3.1 Offene Ackerflächeha8.34 8.88 9.38 9.62 9.71 4.5 Arbeitskräfte BetriebJAE2.05 1.70 1.68 1.71 1.71 0.8 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.36 1.21 1.19 1.19 1.17 -2.2 Kühe totalAnzahl12.8 13.7 13.8 13.9 14.4 4.3 Tierbestand totalGVE22.9 24.0 24.0 24.0 24.7 2.9 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.706 406 866 584 873 507 902 017 933 570 6.0 davon: Umlaufvermögen totalFr.149 871 161 665 165 542 165 408 172 927 5.3 davon: Tiervermögen totalFr.61 461 48 325 49 315 49 685 53 320 8.6 davon: Anlagevermögen totalFr.495 074 656 594 658 649 686 925 707 323 6.0 davon: Aktiven BetriebFr.642 757 814 884 819 652 850 932 880 586 6.3 Fremdkapitalquote%41 44 42 45 45 3.1 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.23 633 12 331 9 830 11 638 13 946 23.8 Erfolgsrechnung RohleistungFr.**285 352 276 157 272 530 297 284 6.9 davon: DirektzahlungenFr.7 248 41 563 42 994 44 741 47 396 10.0 SachkostenFr.**176 795 176 761 173 929 185 324 5.4 BetriebseinkommenFr.115 056 108 557 99 396 98 600 111 959 9.6 PersonalkostenFr.20 784 18 517 19 255 19 872 21 125 9.9 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.13 463 8 450 8 006 8 457 8 951 7.8 Pacht- und MietzinsenFr.7 015 8 975 9 440 9 139 9 049 -1.5 FremdkostenFr.**212 737 213 461 211 397 224 449 5.6 Landwirtschaftliches EinkommenFr.73 794 72 615 62 696 61 132 72 834 11.2 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.16 429 20 532 21 531 22 339 22 961 7.0 GesamteinkommenFr.90 223 93 146 84 227 83 471 95 795 10.2 PrivatverbrauchFr.67 985 73 335 73 704 75 679 76 473 3.0 EigenkapitalbildungFr.22 238 19 811 10 523 7 792 19 322 52.0 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.56 951 56 403 50 898 54 327 49 576 -8.0 Cashflow 3 Fr.52 079 54 643 46 840 45 705 54 103 10.3 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %92 97 92 84 109 19.8 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %64 66 62 63 69 8.4 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %52 46 41 38 44 5.6 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %24 27 20 21 28 23.5 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %12 13 21 21 15 -18.2 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 15 18 20 13 -26.4 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE56 050 63 865 59 256 57 637 65 378 8.5 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha6 908 5 410 4 816 4 691 5 277 6.1 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%17.9 13.3 12.1 11.6 12.7 3.0 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %2.1 -0.2 -1.4 -1.6 -0.2 -81.3 Eigenkapitalsrentabilität 11 %0.0 -2.2 -4.2 -4.7 -2.2 -40.5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE36 924 49 916 44 425 41 655 50 139 10.6 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE36 186 48 155 41 665 39 440 46 484 7.9 (Median)
Zinssatz
Bundesobligationen (1990:
2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
1Verzinsung zum mittleren
der
6.40%; 1991: 6.23%; 1992: 6.42%; 2004: 2.73%;
Tabelle 18
Betriebsergebnisse: Hügelregion*
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:
1991: 6.23%; 1992: 6.42%; 2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I
** Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden. Für die Jahre 1990/92 fehlen die Informationen, vgl. Erläuterungen im Textteil.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A18 ANHANG
MerkmalEinheit1990/9220042005200620072004/06–2007 % ReferenzbetriebeAnzahl1 125 846 901 957 961 6.6 Vertretene BetriebeAnzahl17 397 14 013 13 739 13 610 13 241 -4.0 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha15.30 18.52 18.92 18.88 19.29 2.8 Offene Ackerflächeha3.08 2.77 3.05 2.98 2.94 0.2 Arbeitskräfte BetriebJAE1.81 1.54 1.55 1.53 1.53 -0.6 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.40 1.23 1.23 1.22 1.23 0.3 Kühe totalAnzahl14.4 15.1 15.5 15.6 16.3 5.8 Tierbestand totalGVE26.0 25.3 26.1 26.2 26.7 3.2 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.553 876 739 401 739 607 749 459 775 604 4.4 davon: Umlaufvermögen totalFr.95 672 118 553 115 250 113 742 126 644 9.3 davon: Tiervermögen totalFr.66 366 53 082 56 503 56 355 60 224 8.9 davon: Anlagevermögen totalFr.391 838 567 766 567 855 579 362 588 736 3.0 davon: Aktiven BetriebFr.516 933 698 926 705 879 713 054 732 093 3.7 Fremdkapitalquote%46 46 46 47 46 -0.7 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.17 271 10 213 7 983 9 359 11 406 24.2 Erfolgsrechnung RohleistungFr.**213 244 209 813 209 031 222 356 5.5 davon: DirektzahlungenFr.15 415 46 540 47 887 47 897 51 220 8.0 SachkostenFr.**135 541 136 468 137 667 143 722 5.2 BetriebseinkommenFr.84 599 77 702 73 345 71 363 78 633 6.1 PersonalkostenFr.9 943 10 005 10 531 10 336 10 332 0.4 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.10 915 6 913 6 964 7 136 7 211 3.0 Pacht- und MietzinsenFr.3 903 6 042 6 224 5 777 5 569 -7.4 FremdkostenFr.**158 501 160 186 160 917 166 835 4.4 Landwirtschaftliches EinkommenFr.59 838 54 742 49 627 48 114 55 520 9.2 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.14 544 22 167 23 277 23 000 23 804 4.3 GesamteinkommenFr.74 382 76 909 72 904 71 114 79 324 7.7 PrivatverbrauchFr.55 272 63 851 63 761 65 303 67 489 5.0 EigenkapitalbildungFr.19 110 13 058 9 143 5 811 11 835 26.7 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.41 428 53 676 47 152 41 892 44 389 -6.7 Cashflow 3 Fr.41 445 42 906 40 168 40 410 42 097 2.3 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %100 80 85 96 95 9.2 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %68 66 67 68 69 3.0 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %50 45 40 35 40 0.0 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %30 27 23 23 28 15.1 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %8 13 18 21 17 -1.9 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 15 19 21 15 -18.2 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE46 654 50 332 47 252 46 591 51 304 6.8 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha5 533 4 195 3 876 3 779 4 076 3.2 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%16.4 11.1 10.4 10.0 10.7 1.9 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %0.4 -2.3 -3.0 -3.2 -2.3 -18.8 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-3.3 -6.1 -7.4 -8.0 -6.1 -14.9 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE30 335 36 197 33 778 31 657 35 877 5.9 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE29 520 34 360 31 865 31 436 33 208 2.0 (Median)
6.40%;
Betriebsergebnisse: Bergregion*
6.40%; 1991: 6.23%; 1992: 6.42%; 2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion: Bergzonen II bis IV
** Diese Werte können nur für die Jahre ab 2003 berechnet werden. Für die Jahre 1990/92 fehlen die Informationen, vgl. Erläuterungen im Textteil.
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A19
Tabelle 19
MerkmalEinheit1990/9220042005200620072004/06–2007 % ReferenzbetriebeAnzahl821 796 808 823 843 4.2 Vertretene BetriebeAnzahl15 847 13 904 13 933 13 671 13 416 -3.0 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha15.76 18.63 19.09 19.66 19.81 3.6 Offene Ackerflächeha0.44 0.23 0.20 0.19 0.16 -22.6 Arbeitskräfte BetriebJAE1.63 1.59 1.61 1.60 1.59 -0.6 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.42 1.33 1.34 1.33 1.34 0.5 Kühe totalAnzahl11.4 11.8 11.9 12.2 12.3 2.8 Tierbestand totalGVE20.5 19.3 19.8 20.6 20.4 2.5 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.476 486 645 041 652 996 670 958 677 816 3.3 davon: Umlaufvermögen totalFr.78 573 108 694 102 525 106 471 105 538 -0.3 davon: Tiervermögen totalFr.52 902 43 089 46 354 47 772 50 307 10.0 davon: Anlagevermögen totalFr.345 011 493 257 504 118 516 715 521 970 3.4 davon: Aktiven BetriebFr.448 089 607 061 618 171 632 350 637 296 2.9 Fremdkapitalquote%45 41 42 43 42 0.0 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.15 432 9 690 7 501 8 943 10 580 21.5 Erfolgsrechnung RohleistungFr.**161 553 162 977 168 145 170 563 3.9 davon: DirektzahlungenFr.23 476 58 257 59 185 60 993 61 314 3.1 SachkostenFr.**99 635 102 439 107 820 107 480 4.0 BetriebseinkommenFr.61 026 61 918 60 539 60 325 63 082 3.5 PersonalkostenFr.4 860 7 168 7 002 7 571 7 022 -3.1 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.7 918 5 029 5 143 5 284 5 450 5.8 Pacht- und MietzinsenFr.2 707 3 612 3 587 3 490 3 564 0.0 FremdkostenFr.**115 444 118 170 124 165 123 517 3.6 Landwirtschaftliches EinkommenFr.45 541 46 109 44 807 43 980 47 046 4.6 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.17 853 22 645 22 151 23 879 23 801 4.0 GesamteinkommenFr.63 394 68 754 66 958 67 858 70 848 4.4 PrivatverbrauchFr.48 548 57 614 58 840 59 807 61 356 4.4 EigenkapitalbildungFr.14 846 11 140 8 118 8 052 9 492 4.3 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.34 138 40 299 41 575 38 112 39 136 -2.1 Cashflow 3 Fr.33 482 36 224 34 227 37 257 34 381 -4.2 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %98 90 82 98 88 -2.2 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %70 68 66 72 64 -6.8 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %54 48 42 42 43 -2.3 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %26 22 23 23 22 -2.9 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %8 18 22 19 18 -8.5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 12 14 16 17 21.4 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE37 418 39 021 37 571 37 621 39 655 4.2 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha3 874 3 323 3 171 3 069 3 185 -0.1 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%13.6 10.2 9.8 9.5 9.9 0.7 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.3 -4.1 -4.5 -4.6 -4.5 2.3 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-7.4 -8.5 -9.3 -9.5 -9.3 2.2 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE21 201 27 465 27 861 26 395 27 117 -0.5 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE20 707 25 374 26 855 24 483 26 561 3.9 (Median) 1Verzinsung
Zinssatz
Bundesobligationen (1990:
zum mittleren
der
Tabelle 20a
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 2005/07
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A20 ANHANG
PflanzenbauTierhaltung MerkmalEinheitMittel alleSpezial-Verkehrs-Mutter-Anderes BetriebeAckerbaukulturenmilchküheRindvieh ReferenzbetriebeAnzahl3 245 122 91 1 239 154 184 Vertretene BetriebeAnzahl50 073 3 450 3 467 16 084 2 781 3 883 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha20.04 24.16 12.96 20.13 19.65 16.90 Offene Ackerflächeha5.23 19.79 6.31 1.03 0.87 0.29 Arbeitskräfte BetriebJAE1.63 1.28 2.14 1.63 1.35 1.41 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.24 0.96 1.26 1.32 1.14 1.23 Kühe totalAnzahl14.0 3.4 1.4 18.1 16.9 8.0 Tierbestand totalGVE23.7 6.7 2.4 25.3 19.5 15.8 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.798 626 754 880 928 133 741 238 738 205 606 237 davon: Umlaufvermögen totalFr.137 371 168 234 221 072 117 082 119 964 104 370 davon: Tiervermögen totalFr.51 925 14 799 5 752 57 833 55 232 44 369 davon: Anlagevermögen totalFr.609 330 571 847 701 310 566 323 563 009 457 498 davon: Aktiven BetriebFr.753 978 697 081 868 853 701 566 687 939 564 783 Fremdkapitalquote%44 40 42 44 45 42 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.10 441 10 438 12 512 9 687 9 423 8 170 Erfolgsrechnung RohleistungFr.232 215 223 555 272 366 197 476 164 271 150 761 davon: DirektzahlungenFr.50 333 49 134 26 998 51 251 64 583 59 619 SachkostenFr.148 164 134 513 147 303 121 470 102 601 101 678 BetriebseinkommenFr.84 051 89 042 125 063 76 006 61 670 49 083 PersonalkostenFr.13 949 10 993 42 132 9 673 6 666 4 938 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.7 234 6 872 8 623 6 341 6 614 4 580 Pacht- und MietzinsenFr.6 757 8 774 6 632 6 132 3 593 2 843 FremdkostenFr.176 104 161 153 204 691 143 617 119 474 114 040 Landwirtschaftliches EinkommenFr.56 111 62 402 67 675 53 860 44 797 36 721 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.22 843 28 991 21 497 19 029 33 472 28 472 GesamteinkommenFr.78 954 91 393 89 172 72 888 78 269 65 193 PrivatverbrauchFr.68 472 83 859 79 369 62 677 65 724 58 075 EigenkapitalbildungFr.10 481 7 534 9 803 10 211 12 544 7 119 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.46 398 38 094 37 593 45 923 31 606 39 319 Cashflow 3 Fr.43 015 34 528 42 425 41 122 39 750 30 365 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %93 94 116 90 131 77 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %66 60 58 67 76 63 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %41 43 36 43 45 43 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %23 14 25 23 29 19 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %19 23 20 17 15 22 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %17 21 19 17 11 17 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE51 573 69 539 58 383 46 662 45 721 34 856 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha4 192 3 682 9 657 3 776 3 139 2 906 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%11.1 12.8 14.4 10.8 9.0 8.7 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.3 0.3 -1.2 -3.2 -2.9 -5.8 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-5.9 -1.2 -3.9 -7.5 -7.0 -11.5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE36 889 53 999 43 770 33 502 31 004 23 230 (Mittelwert)
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen*2005/07
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A21
Tabelle 20b
TierhaltungKombiniert Pferde/VerkehrsMerkmalEinheitMittel alleSchafe/milch/MutterBetriebeZiegenVeredlungAckerbauküheVeredlungAndere ReferenzbetriebeAnzahl3 245 33 81 325 53 564 398 Vertretene BetriebeAnzahl50 073 2 002 1 502 3 921 918 5 173 6 891 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha20.04 13.66 11.99 27.07 24.04 20.24 22.25 Offene Ackerflächeha5.23 0.34 0.99 14.25 11.28 6.50 7.21 Arbeitskräfte BetriebJAE1.63 1.48 1.44 1.82 1.44 1.75 1.70 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.24 1.24 1.18 1.27 1.08 1.26 1.22 Kühe totalAnzahl14.0 1.6 10.6 21.2 17.6 16.6 16.1 Tierbestand totalGVE23.7 14.9 45.3 28.5 20.7 43.6 26.0 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.798 626 544 878 942 578 892 653 922 039 976 818 861 773 davon: Umlaufvermögen totalFr.137 371 82 098 169 453 166 796 171 544 143 478 135 753 davon: Tiervermögen totalFr.51 925 25 430 63 262 65 557 58 361 74 597 62 647 davon: Anlagevermögen totalFr.609 330 437 350 709 863 660 300 692 134 758 743 663 373 davon: Aktiven BetriebFr.753 978 515 244 865 446 853 363 875 213 940 070 813 989 Fremdkapitalquote%44 54 47 42 45 46 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.10 441 5 815 11 540 12 283 11 767 12 599 11 138 Erfolgsrechnung RohleistungFr.232 215 129 693 332 306 284 175 233 282 363 196 251 191 davon: DirektzahlungenFr.50 333 44 618 34 172 52 605 68 479 49 426 51 777 SachkostenFr.148 164 83 206 256 354 174 614 146 824 259 906 159 280 BetriebseinkommenFr.84 051 46 487 75 952 109 562 86 458 103 290 91 911 PersonalkostenFr.13 949 7 457 9 307 18 599 14 952 18 116 16 219 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.7 234 6 675 10 193 7 691 8 328 9 393 8 044 Pacht- und MietzinsenFr.6 757 1 742 3 016 12 219 8 814 7 529 9 052 FremdkostenFr.176 104 99 079 278 870 213 122 178 917 294 943 192 594 Landwirtschaftliches EinkommenFr.56 111 30 614 53 436 71 053 54 365 68 252 58 597 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.22 843 37 408 28 941 15 582 30 659 17 803 23 216 GesamteinkommenFr.78 954 68 022 82 377 86 635 85 023 86 055 81 812 PrivatverbrauchFr.68 472 60 623 69 532 73 811 74 043 73 360 70 395 EigenkapitalbildungFr.10 481 7 399 12 845 12 824 10 981 12 695 11 417 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.46 398 33 717 48 414 57 506 47 356 61 072 52 039 Cashflow 3 Fr.43 015 29 053 60 470 48 727 46 582 56 554 46 956 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %93 98 125 85 110 93 92 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %66 71 77 63 65 68 66 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %41 30 37 43 38 38 39 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %23 25 24 21 29 26 25 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %19 25 20 21 12 19 19 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %17 20 19 15 22 17 16 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE51 573 31 292 52 999 60 239 60 222 58 846 54 215 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha4 192 3 406 6 350 4 046 3 593 5 098 4 130 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%11.1 9.0 8.8 12.8 9.9 11.0 11.3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.3 -7.5 -1.7 -1.1 -1.3 -0.7 -1.9 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-5.9 -19.6 -5.4 -3.5 -4.2 -3.2 -5.3 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE36 889 19 972 35 659 46 416 39 399 44 261 38 789 (Mittelwert)
Tabelle 21
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Alle Regionen 2005/07
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A22 ANHANG
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1. Quartil2. Quartil3. Quartil4. Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl3 245 690 820 869 865 Vertretene BetriebeAnzahl50 073 12 525 12 527 12 508 12 513 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha20.04 15.21 17.55 21.21 26.22 Offene Ackerflächeha5.23 2.86 3.27 4.92 9.87 Arbeitskräfte BetriebJAE1.63 1.55 1.62 1.66 1.69 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.24 1.25 1.33 1.28 1.10 Kühe totalAnzahl14.0 10.5 13.2 15.8 16.4 Tierbestand totalGVE23.7 18.8 21.2 25.5 29.4 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.798 626 727 050 708 033 816 024 943 590 davon: Umlaufvermögen totalFr.137 371 112 243 119 896 146 678 170 711 davon: Tiervermögen totalFr.51 925 42 930 47 131 56 093 61 563 davon: Anlagevermögen totalFr.609 330 571 876 541 006 613 253 711 315 davon: Aktiven BetriebFr.753 978 686 062 671 086 765 887 893 056 Fremdkapitalquote%44 44 43 42 47 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.10 441 9 680 9 494 10 827 11 763 Erfolgsrechnung RohleistungFr.232 215 165 241 194 212 241 700 327 824 davon: DirektzahlungenFr.50 333 41 699 46 790 52 196 60 660 SachkostenFr.148 164 126 888 128 026 148 839 188 949 BetriebseinkommenFr.84 051 38 353 66 186 92 861 138 875 PersonalkostenFr.13 949 11 017 10 201 12 995 21 590 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.7 234 6 838 6 331 6 886 8 882 Pacht- und MietzinsenFr.6 757 4 036 5 018 7 286 10 694 FremdkostenFr.176 104 148 778 149 576 176 006 230 116 Landwirtschaftliches EinkommenFr.56 111 16 463 44 636 65 694 97 708 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.22 843 34 892 20 808 17 800 17 858 GesamteinkommenFr.78 954 51 355 65 444 83 494 115 566 PrivatverbrauchFr.68 472 59 222 62 320 69 948 82 414 EigenkapitalbildungFr.10 481 -7 867 3 123 13 546 33 152 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.46 398 42 412 36 262 45 408 61 523 Cashflow 3 Fr.43 015 24 021 31 840 46 999 69 231 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %93 57 88 104 113 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %66 56 66 71 73 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %41 24 38 50 50 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %23 12 20 25 36 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %19 37 22 12 6 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %17 27 20 13 8 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE51 573 24 751 40 901 55 902 82 162 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha4 192 2 522 3 771 4 376 5 296 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%11.1 5.6 9.9 12.1 15.5 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.3 -8.2 -5.1 -1.5 3.7 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-5.9 -16.4 -10.8 -4.2 5.1 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE36 889 5 437 26 500 42 813 78 296 (Mittelwert) Arbeitsverdienst
12 Fr./FJAE34 308 (Median)
je Familienarbeitskraft
Tabelle 22
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Talregion* 2005/07
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Talregion: Ackerbauzone plus ÜbergangszonenQuelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A23
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1. Quartil2. Quartil3. Quartil4. Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl1 480 324 378 401 377 Vertretene BetriebeAnzahl22 869 5 739 5 715 5 704 5 712 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha20.96 15.99 18.31 22.00 27.56 Offene Ackerflächeha9.57 6.48 7.25 9.79 14.78 Arbeitskräfte BetriebJAE1.70 1.64 1.70 1.69 1.77 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.18 1.20 1.28 1.21 1.05 Kühe totalAnzahl14.0 11.1 13.9 15.5 15.5 Tierbestand totalGVE24.2 19.8 22.5 25.8 29.0 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.903 031 884 781 819 638 887 915 1 019 801 davon: Umlaufvermögen totalFr.167 959 142 324 156 870 176 193 196 600 davon: Tiervermögen totalFr.50 773 43 436 47 600 53 859 58 242 davon: Anlagevermögen totalFr.684 299 699 021 615 169 657 863 764 959 davon: Aktiven BetriebFr.850 390 833 658 772 642 825 165 970 105 Fremdkapitalquote%44 44 42 41 48 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.11 804 11 644 11 062 11 950 12 562 Erfolgsrechnung RohleistungFr.281 990 216 198 247 802 285 914 378 355 davon: DirektzahlungenFr.45 044 34 677 39 807 46 518 59 231 SachkostenFr.178 671 162 192 161 923 174 824 215 807 BetriebseinkommenFr.103 318 54 006 85 879 111 090 162 549 PersonalkostenFr.20 084 17 263 16 344 18 130 28 604 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.8 471 8 678 7 412 7 660 10 134 Pacht- und MietzinsenFr.9 209 5 745 7 803 10 226 13 083 FremdkostenFr.216 436 193 877 193 482 210 840 267 627 Landwirtschaftliches EinkommenFr.65 554 22 320 54 320 75 074 110 728 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.22 277 32 507 19 272 19 598 17 687 GesamteinkommenFr.87 831 54 828 73 592 94 672 128 415 PrivatverbrauchFr.75 285 66 230 69 858 75 867 89 235 EigenkapitalbildungFr.12 546 -11 403 3 734 18 805 39 181 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.51 600 47 287 43 442 46 506 69 172 Cashflow 3 Fr.48 883 25 363 37 565 56 391 76 345 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %95 55 87 122 112 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %65 51 64 73 71 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %41 20 41 54 50 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %23 13 19 24 36 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %19 36 24 11 6 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %17 31 17 12 9 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE60 757 33 035 50 475 65 633 91 739 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha4 928 3 383 4 690 5 047 5 898 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%12.1 6.5 11.1 13.5 16.7 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-1.0 -6.3 -3.6 -0.2 4.9 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-3.7 -13.2 -8.0 -2.0 7.4 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE45 406 8 941 33 859 52 276 93 373 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE42
(Median)
530
Tabelle 23
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Hügelregion* 2005/07
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A24 ANHANG
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1. Quartil2. Quartil3. Quartil4. Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl940 196 230 252 262 Vertretene BetriebeAnzahl13 530 3 388 3 384 3 387 3 371 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha19.03 15.31 16.53 19.70 24.62 Offene Ackerflächeha2.99 2.32 2.45 2.86 4.33 Arbeitskräfte BetriebJAE1.54 1.50 1.53 1.53 1.60 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.23 1.18 1.31 1.27 1.15 Kühe totalAnzahl15.8 12.2 14.9 17.3 18.9 Tierbestand totalGVE26.3 21.1 24.2 26.9 33.1 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.754 890 705 299 676 431 751 629 886 729 davon: Umlaufvermögen totalFr.118 545 107 551 107 017 117 818 141 867 davon: Tiervermögen totalFr.57 694 48 455 52 511 59 497 70 375 davon: Anlagevermögen totalFr.578 651 549 293 516 903 574 314 674 487 davon: Aktiven BetriebFr.717 009 668 952 641 669 721 357 836 543 Fremdkapitalquote%46 47 44 46 47 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.9 583 8 839 8 929 9 681 10 886 Erfolgsrechnung RohleistungFr.213 733 168 330 183 837 214 740 288 355 davon: DirektzahlungenFr.49 001 40 352 44 134 49 853 61 728 SachkostenFr.139 286 130 013 124 223 133 984 169 041 BetriebseinkommenFr.74 447 38 317 59 614 80 756 119 314 PersonalkostenFr.10 400 11 850 7 002 8 024 14 745 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.7 104 6 938 6 315 6 901 8 266 Pacht- und MietzinsenFr.5 857 4 362 4 295 5 828 8 958 FremdkostenFr.162 646 153 163 141 835 154 737 201 009 Landwirtschaftliches EinkommenFr.51 087 15 167 42 002 60 003 87 346 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.23 360 36 157 22 289 17 022 17 946 GesamteinkommenFr.74 448 51 324 64 291 77 025 105 291 PrivatverbrauchFr.65 518 57 514 61 537 65 493 77 584 EigenkapitalbildungFr.8 930 -6 190 2 754 11 532 27 707 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.44 478 48 153 30 787 43 116 55 894 Cashflow 3 Fr.40 892 26 206 32 167 42 658 62 626 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %92 55 105 99 112 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %68 57 68 71 76 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %38 22 36 47 48 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %25 14 19 28 39 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %19 34 23 12 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %18 30 22 12 8 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE48 382 25 590 38 968 52 802 74 656 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha3 911 2 504 3 613 4 097 4 846 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%10.4 5.7 9.3 11.2 14.3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.8 -7.9 -5.5 -2.0 2.6 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-7.2 -17.2 -11.8 -5.4 3.1 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE33 771 5 365 25 257 39 576 66 186 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE32
(Median)
170
Tabelle 24
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Bergregion* 2005/07
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2005: 2.11%; 2006: 2.50%; 2007: 2.91%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Bergregion: Bergzonen II bis IV
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A25
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1. Quartil2. Quartil3. Quartil4. Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl825 171 209 222 222 Vertretene BetriebeAnzahl13 673 3 429 3 416 3 420 3 409 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha19.52 13.95 16.58 20.62 26.96 Offene Ackerflächeha0.18 0.07 0.11 0.14 0.41 Arbeitskräfte BetriebJAE1.60 1.50 1.64 1.63 1.65 davon: FamilienarbeitskräfteFJAE1.34 1.31 1.45 1.36 1.23 Kühe totalAnzahl12.1 8.7 10.6 13.0 16.2 Tierbestand totalGVE20.3 15.7 17.5 21.1 26.9 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.667 257 584 900 584 068 674 026 826 703 davon: Umlaufvermögen totalFr.104 845 78 076 99 088 108 855 133 537 davon: Tiervermögen totalFr.48 144 36 672 41 790 50 492 63 704 davon: Anlagevermögen totalFr.514 268 470 152 443 190 514 679 629 462 davon: Aktiven BetriebFr.629 273 558 780 551 267 630 887 776 755 Fremdkapitalquote%42 41 40 41 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.9 008 8 363 8 147 9 077 10 450 Erfolgsrechnung RohleistungFr.167 228 117 465 140 417 177 782 233 574 davon: DirektzahlungenFr.60 497 46 234 55 431 64 029 76 381 SachkostenFr.105 913 93 044 91 621 107 450 131 648 BetriebseinkommenFr.61 315 24 421 48 796 70 332 101 926 PersonalkostenFr.7 198 5 209 5 220 7 863 10 514 Schuldzinsen, übriger Finanzaufwand/-ertragFr.5 292 5 477 4 373 5 027 6 296 Pacht- und MietzinsenFr.3 547 2 356 2 907 4 028 4 903 FremdkostenFr.121 951 106 086 104 121 124 368 153 361 Landwirtschaftliches EinkommenFr.45 278 11 379 36 295 53 414 80 213 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.23 277 37 171 20 997 18 860 16 017 GesamteinkommenFr.68 555 48 550 57 293 72 274 96 231 PrivatverbrauchFr.60 001 54 732 53 548 60 037 71 732 EigenkapitalbildungFr.8 554 -6 182 3 745 12 237 24 499 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.39 608 30 472 30 964 42 452 54 622 Cashflow 3 Fr.35 289 20 540 27 403 37 934 55 375 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %89 68 92 90 102 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %67 58 70 69 72 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %42 25 43 53 48 Betriebe mit beschränkter finanz. Selbständigkeit 7 %23 11 18 23 38 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %20 43 21 11 4 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %15 22 17 13 9 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE38 282 16 286 29 843 43 214 61 908 Betriebseinkommen je ha landw. NutzflächeFr./ha3 142 1 752 2 943 3 414 3 784 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%9.7 4.4 8.9 11.2 13.1 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-4.5 -10.9 -8.1 -3.5 1.8 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-9.4 -20.3 -15.1 -7.5 1.8 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE27 124 2 292 19 459 32 543 56 810 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE25 966 (Median)
Tabelle 25
Betriebsergebnisse nach Regionen, Betriebstypen und Quartilen: 1990/92–2005/07
A26 ANHANG
EinheitAlle BetriebeTalregionHügelregionBergregion Einkommen nach Regionen1990/922005/071990/922005/071990/922005/071990/922005/07 Landwirtschaftliche Nutzflächeha16.06 20.04 16.66 20.96 15.30 19.03 15.76 19.52 FamilienarbeitskräfteFJAE1.39 1.24 1.36 1.18 1.40 1.23 1.42 1.34 Landwirtschaftliches EinkommenFr.62 822 56 111 73 794 65 554 59 838 51 087 45 541 45 278 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.16 264 22 843 16 429 22 277 14 544 23 360 17 853 23 277 GesamteinkommenFr.79 086 78 954 90 223 87 831 74 382 74 448 63 394 68 555 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE31 025 36 889 36 924 45 406 30 335 33 771 21 201 27 124 EinheitAckerbauSpezialkulturenVerkehrsmilchMutterkühe Einkommen nach Betriebstypen1990/922005/071990/922005/071990/922005/071990/922005/07 Landwirtschaftliche Nutzflächeha21.23 24.16 8.92 12.96 15.30 20.13 15.32 19.65 FamilienarbeitskräfteFJAE1.08 0.96 1.29 1.26 1.42 1.32 1.20 1.14 Landwirtschaftliches EinkommenFr.60 284 62 402 67 184 67 675 53 923 53 860 36 627 44 797 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.26 928 28 991 21 555 21 497 16 044 19 029 33 558 33 472 GesamteinkommenFr.87 212 91 393 88 739 89 172 69 967 72 888 70 185 78 269 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE34 375 53 999 30 334 43 770 26 471 33 502 17 348 31 004 EinheitAnderes Pferde/Schafe/Veredlung RindviehZiegen Einkommen nach Betriebstypen1990/922005/071990/922005/071990/922005/07 Landwirtschaftliche Nutzflächeha14.20 16.90 Nur sieben13.66 9.34 11.99 FamilienarbeitskräfteFJAE1.37 1.23 Betriebe1.24 1.35 1.18 Landwirtschaftliches EinkommenFr.38 407 36 721 vorhanden30 614 86 288 53 436 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.20 570 28 472 37 408 14 614 28 941 GesamteinkommenFr.58 977 65 193 68 022 100 902 82 377 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE16 793 23 230 19 972 48 182 35 659 EinheitKombiniert Kombiniert Kombiniert Kombiniert Verkehrsmilch/MutterküheVeredlungAndere Ackerbau Einkommen nach Betriebstypen1990/922005/071990/922005/071990/922005/071990/922005/07 Landwirtschaftliche Nutzflächeha20.37 27.07 17.93 24.04 15.59 20.24 17.24 22.25 FamilienarbeitskräfteFJAE1.45 1.27 1.24 1.08 1.40 1.26 1.43 1.22 Landwirtschaftliches EinkommenFr.75 368 71 053 51 161 54 365 84 363 68 252 66 705 58 597 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.11 802 15 582 20 475 30 659 12 032 17 803 15 000 23 216 GesamteinkommenFr.87 170 86 635 71 636 85 023 96 395 86 055 81 705 81 812 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE36 420 46 416 27 456 39 399 42 927 44 261 32 732 38 789 Einheit1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil4. Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Einkommen nach Quartilen (Arbeitsverdienst)1990/922005/071990/922005/071990/922005/071990/922005/07 Landwirtschaftliche Nutzflächeha14.68 15.21 15.30 17.55 15.78 21.21 18.47 26.22 FamilienarbeitskräfteFJAE1.36 1.25 1.49 1.33 1.42 1.28 1.27 1.10 Landwirtschaftliches EinkommenFr.26 883 16 463 52 294 44 636 69 198 65 694 102 975 97 708 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.27 789 34 892 14 629 20 808 12 064 17 800 10 557 17 858 GesamteinkommenFr.54 672 51 355 66 923 65 444 81 262 83 494 113 532 115 566 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE4 367 5 437 23 592 26 500 36 016 42 813 62 665 78 296 Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tabellen Ausgaben des Bundes
ANHANG A27
Tabelle 26 Ausgaben Absatzförderung Sektoren / Produkt-Markt-BereichRechnung 2006Rechnung 2007 1 Budget 2008 Fr.Fr.Fr. Milchproduktion29 450 19629 628 84028 875 919 Käse Inland / Ausland 20 350 54722 528 04021 000 000 Milch und Butter 9 099 6497 100 8007 875 919 Tierproduktion4 848 9865 037 4375 551 275 Fleisch3 814 7623 850 0003 890 500 Eier 593 407629 289970 000 Fische 0015 000 Lebende Tiere440 817460 750575 775 Honig 097 398100 000 Pflanzenbau9 748 6817 869 7967 133 895 Gemüse und Pilze1 811 5571 995 800847 450 Pilze 2 384 523 Obst2 119 3122 225 0002 326 000 Getreide423 862452 000545 562 Kartoffeln593 407630 000578 750 Ölsaaten362 500330 578361 650 Zierpflanzen423 862425 000479 960 Wein 3 772 6811 621 4181 360 000 Saatgut241 500190 0000 Agrotourismus 3 250 000 Gemeinsame Massnahmen3 113 3833 286 5583 273 455 Übergreifende Massnahmen (Bio, IP)2 951 9212 953 2003 741 570 Öffentlichkeitsarbeit 5 2 734 2502 701 1412 736 783 Kleinprojekte und Sponsoring500 000922 424200 000 National53 347 41752 399 39651 512 897 Regional 2 300 0002 283 7052 500 000 Total55 647 41754 683 10154 012 897 1 Definitiver Rechnungsabschluss fallweise noch offen 2 Ab 2007 eigener PMB 3 Neu gemäss LAfV Art. 10 Quelle: BLW
für Produktion und Absatz
Ausgaben
Ausgaben Viehwirtschaft
A28 ANHANG
28
Tabelle
BezeichnungRechnung 2006Rechnung 2007Budget 2008 Fr.Fr.Fr. Entschädigung an private Organisationen Schlachtvieh und Fleisch6 701 4716 631 0206 000 000 Marktstützung Fleisch Einlagerungsbeiträge von Kalbfleisch2 373 8403 673 597 Verbilligungsbeiträge Rindsstotzen62 127Verbilligungsbeiträge Bankfleisch für die Verarbeitung587 3213 023 2883 673 5975 500 000 Marktstützung Eier Aufschlagsaktionen1 713 263669 262 Verbilligungsaktionen660 225515 821 Investitionsbeiträge für Stallbauten750 858573 672 3 124 3461 758 7553 000 000 Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh5 138 6005 615 9505 000 000 Verwertungsbeiträge Schafwolle803 088799 855800 000 Beiträge für die Geräte und/oder Ausrüstungen von öffentlichen Märkten im Berggebiet 4 025500 000 Total 18 790 79318 483 20220 800 000 Massnahmen gegen die BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte38 664 91046 010 28647 500 000 Einnahmen Tierverkehr-2 003 702-9 462 117-9 000 000 Betriebsausgaben Tierverkehr8 882 2108 890 1138 700 000 Quellen: Staatsrechnung, BLW Tabelle 27 Ausgaben Milchwirtschaft BezeichnungRechnung 2006Rechnung 2007Budget 2008 1 Fr.Fr.Fr. Marktstützung (Zulagen und Beihilfen) Zulage auf verkäster Milch296 979 460255 072 330236 700 000 Zulage für Fütterung ohne Silage44 591 50534 466 69034 600 000 Inlandbeihilfen für Butter24 861 80928 886 02422 500 000 Inlandbeihilfen für Magermilch und Milchpulver39 034 61330 072 26831 000 000 Inlandbeihilfen für Käse00Ausfuhrbeihilfen für Käse10 731 7005 943 8276 510 000 Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte20 935 1136 908 86213 690 000 437 134 200361 350 000345 000 000 Marktstützung (Administration) Rekurskommissionen Milchkontingentierung67 24253 30250 000 Administration Milchverwertung und -kontingentierung5 540 1744 577 9704 950 000 5 607 4164 631 2725 000 000 Total 442 741 616365 981 272350 000 000 1Kreditsperre berücksichtigt Quellen: Staatsrechnung, BLW
Tabelle 29 Ausgaben Tierzucht 2007
ANHANG A29 Tabelle 30 Ausgaben Pflanzenbau BezeichnungRechnung 2005Rechnung 2006Rechnung 2007Budget 2008 Fr.Fr.Fr.Fr. Ackerbaubeiträge44 413 15946 297 44147 749 48548 495 200 Flächenbeiträge für Ölsaaten36 245 11737 435 27339 431 59739 025 200 Flächenbeiträge für Körnerleguminosen7 704 3928 393 9547 884 5739 000 000 Flächenbeiträge für Faserpflanzen463 650468 214433 315470 000 Flächenbeiträge für Zuckerrüben00019 600 000 Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge77 958 73062 748 18959 503 02355 792 600 Zuckerrübenverarbeitung 1 45 982 00029 641 00022 476 00015 000 000 Ölsaatenverarbeitung2 577 5004 054 2004 158 0004 307 000 Kartoffelverarbeitung16 260 74615 558 50023 648 80016 013 600 Saatgutproduktion3 421 7203 126 1043 227 9403 470 000 Obstverwertung9 716 76310 368 3855 992 28317 002 000 Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe 2 0000 Förderung des Weinbaus3 120 8002 871 3901 744 3623 356 000 Weinlesekontrolle 3 1 086 010882 4781 010 671856 000 Umstellungsbeiträge Weinbau2 034 7901 988 912733 6912 500 000 Total125 492 688111 917 020108 996 870107 643 800 1 In der Rechnung 2006 wurden 11,3 Mio. Fr. für die Ernte 2005 und 18,3 Mio. für die Ernte 2006 ausbezahlt. In der Rechnung 2007 wurden 7,8 Mio. Fr. für die Ernte 2006 und 14,8 Mio. für die Ernte 2007 ausbezahlt. 2 ohne Ölsaaten 3 ehemals Förderung des Rebbaus Quellen: Staatsrechnung, BLW
Tierart und MassnahmenBetragHerdebuchtiereZuchtorganisationen Fr.Anzahl Rinder13 681 300541 65810 Herdebuchführung2 693 000 Milch- und Fleischleistungsprüfungen10 311 000 Exterieurbeurteilungen677 300 Pferde1 031 0004 248 1 25 Schweine1 629 00014 9542 Schafe1 098 00083 4076 Ziegen und Milchschafe890 00031 9215 Herdebuchführung635 000 Milchleistungsprüfungen255 000 Erhaltung CH-Rassen724 0006 Total19 053 300 1 identifizierte Fohlen Quellen: Staatsrechnung/Zuchtorganisationen
Ausgaben für Direktzahlungen
Tabelle 31
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich. Die Werte betreffend Direktzahlungen beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs. Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle: BLW
A30 ANHANG
20002001200220032004200520062007 Beitragsart 1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr. Allgemeine Direktzahlungen1 803 6581 929 0941 994 8381 999 0911 993 9151 999 6062 007 1812 070 357 Flächenbeiträge1 186 7701 303 8811 316 1831 317 9561 317 7731 319 5951 319 1031 275 681 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere258 505268 272283 221287 692286 120291 967301 213412 813 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen251 593250 255289 572287 289284 023282 220281 258277 786 Allgemeine Hangbeiträge96 71496 64395 81195 63095 30894 76894 22792 671 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen10 07610 04310 05110 52410 69111 05611 38011 407 Ökologische Direktzahlungen361 309412 664452 448476 724494 695506 895518 211523 533 Ökobeiträge278 981329 886359 387381 319398 109409 348420 245425 533 Beiträge für den ökologischen Ausgleich108 130118 417122 347124 927125 665126 023126 976126 928 Beiträge nach der Öko-Qalitätsverordnung (ÖQV)--8 93414 63823 00727 44230 25632 107 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion)33 39832 52631 93831 25530 82431 51631 09430 629 Beiträge für extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland (Übergangsbestimmung bis Ende 2000)17 150--Beiträge für den biologischen Landbau12 18523 48825 48427 13527 96228 60128 67228 074 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere108 118155 455170 684183 363190 651195 767203 247207 796 Sömmerungsbeiträge81 23880 52489 56191 38191 06691 61091 69692 110 Gewässerschutzbeiträge1 0902 2543 5004 0245 5215 9366 2705 890 Kürzungen22 54216 76321 14317 13818 12020 37825 82018 851 Total Direktzahlungen2 142 4252 324 9952 426 1432 458 6772 470 4902 485 7582 499 5722 575 039
Entwicklung der Direktzahlungen
Allgemeine Direktzahlungen 2007
ANHANG A31
Tabelle 32a
FlächenbeiträgeBeiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeRGVE Total Beiträge Anzahl haFr.Anzahl Anzahl Fr. Kanton ZH3 47470 59392 404 0192 67953 49222 167 596 BE12 023187 055234 994 07711 250178 88679 910 324 LU4 89777 00893 889 5534 59487 26535 503 457 UR6326 7107 707 7096247 5694 897 447 SZ1 60323 96627 525 1651 58427 80214 433 141 OW6677 6968 857 88866111 1034 756 161 NW4816 0686 974 6064807 9353 319 230 GL3986 8597 885 4443927 8433 960 169 ZG54210 45312 417 71252011 4714 396 034 FR3 05574 99994 494 4402 74875 42827 050 077 SO1 36131 47539 835 7051 22024 86511 023 483 BL91721 25626 199 82579316 8617 546 765 SH55814 30119 472 8393345 8843 089 789 AR72211 87813 573 10971814 1196 028 860 AI5277 0108 045 7845188 0373 205 880 SG4 15771 31683 377 2594 00088 13936 227 229 GR2 54952 83260 176 7022 48247 30131 472 305 AG2 97658 28677 683 9362 40444 65319 724 410 TG2 55249 00063 669 7702 06846 64014 380 847 TI87613 16415 374 46669710 5926 177 128 VD3 826106 528141 113 7822 59361 73528 242 195 VS3 51335 92943 687 2902 18526 34115 903 415 NE88332 94536 761 56479324 62910 298 154 GE30010 47913 935 6441011 8931 279 815 JU1 04639 18945 623 17899934 02917 818 701 Schweiz54 5351 026 9931 275 681 46647 437924 515412 812 612 Zone 1 Tal23 138479 374638 873 11917 470370 165142 707 944 Hügel7 751142 048174 739 8297 197145 67158 455 368 BZ I7 043117 867137 331 7716 801134 79656 277 974 BZ II8 697155 450174 885 4788 142154 29077 205 309 BZ III5 18284 60296 085 7945 12779 85651 845 845 BZ IV2 72447 65153 765 4752 70039 73726 320 172 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
A32 ANHANG
Tabelle 32b
Tierhaltung unter Allgemeine HangbeiträgeHangbeiträge Steil- und erschwerenden BedingungenTerrassenlagen im Rebbau TotalTotalTotal BetriebeRGVEBeiträgeBetriebeFlächeBeiträgeBetriebeFlächeBeiträge AnzahlAnzahlFr.AnzahlhaFr.AnzahlhaFr. Kanton ZH77412 7393 849 5347394 9732 047 330199194363 600 BE8 537127 12370 167 1937 93446 75019 602 74073104362 395 LU3 22551 04120 823 9133 16321 0868 768 549151831 760 UR6257 8316 814 7145834 7682 264 803323 060 SZ1 44222 08512 708 9301 40810 0784 304 159131222 635 OW63710 0445 764 7726124 5092 072 585111 500 NW4577 0393 695 4804393 8391 714 7230 GL3555 6544 168 8203503 0831 384 946127 650 ZG3566 0432 818 2133542 8131 178 35021915 FR1 73533 24812 156 6311 4387 0922 798 798181522 781 SO5959 7753 652 5215624 7761 829 3180 BL68010 7622 976 9246605 3722 096 085433866 855 SH1201 854303 315150960360 65812297161 545 AR71811 8346 848 3187195 9362 361 5544514 960 AI5188 2465 472 5015132 8941 158 2780 SG2 89547 97421 634 5672 81724 53710 221 18468106328 395 GR2 44738 45837 180 7982 39930 70713 445 185251840 575 AG1 14917 8263 417 7871 1387 4002 845 593145184316 410 TG1732 999923 9251491 172513 71877100151 950 TI6377 8046 352 8425443 1731 398 792180175367 505 VD1 24321 4979 094 0939465 6072 223 8054697522 555 595 VS2 14023 00320 711 1242 02412 0215 385 4011 3041 7856 337 589 NE74114 4798 659 7245773 4871 309 0295282158 600 GE153 167121 265405584 630 JU74814 5607 585 9585693 5921 383 742346 150 Schweiz32 948513 923277 785 76430 788220 62692 670 5902 8573 74711 407 055 Zone 1 Tal2 98053 4904 694 0542 0895 9312 386 4671 7712 4767 460 369 Hügel7 196115 74829 652 0316 77436 41814 256 284219283687 863 BZ I6 801107 89947 767 7266 47545 22618 410 354185228673 609 BZ II8 144127 95187 204 6387 69459 75925 098 3795367032 380 800 BZ III5 12771 94266 483 6865 06445 99020 253 03910145160 760 BZ IV2 70036 89241 983 6292 69227 30212 266 067451243 654 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Allgemeine Direktzahlungen 2007
ANHANG A33 Tabelle 33a
2007 Ökologischer Ausgleich 1 Biologischer Landbau BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr. AnzahlhaFr. Kanton ZH3 4629 19313 019 3443416 9842 187 009 BE11 73618 40218 401 4381 28619 2564 698 261 LU4 8938 7479 901 3912984 8521 247 101 UR6291 257651 25863912182 940 SZ1 5793 3452 969 2361532 493500 545 OW6651 053875 8011892 366474 922 NW479948747 98070976198 245 GL389922587 182881 595317 915 ZG5431 6241 767 702771 382302 826 FR2 9716 5627 480 1621142 385832 935 SO1 3604 2285 301 1721143 147799 055 BL9173 4294 544 1121282 834777 276 SH5481 7722 712 74418496207 480 AR673840690 3781242 291456 791 AI464550396 0873044989 254 SG4 1268 1848 893 2524598 1161 759 614 GR2 52015 0376 328 2261 42431 0466 301 901 AG2 9687 71110 668 0392124 0851 476 162 TG2 5195 2537 532 0882284 1891 519 324 TI8151 6381 253 2381051 704399 433 VD3 6009 55712 406 7511362 9801 011 778 VS2 0104 6902 729 8082854 7221 282 869 NE6581 8201 658 351441 284312 256 GE2951 1411 948 783118155 724 JU1 0043 1763 461 744852 908681 988 Schweiz51 823121 080126 926 2636 082113 53128 073 604 Zone 2 Tal22 21550 81173 684 2671 17721 8978 735 024 Hügel7 66217 68321 473 16560710 9702 980 161 BZ I6 76811 38210 250 84876712 3342 702 670 BZ II7 73914 84710 604 3051 24121 9554 439 878 BZ III4 83513 4166 018 4141 35226 3165 272 488 BZ IV2 60412 9414 895 26593820 0593 943 383 1 Hochstammobstbäume umgerechnet in Aren 2Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Ökobeiträge
Ökobeiträge 2007
1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A34 ANHANG
Tabelle 33b
Extensive Produktion von Besonders tierfreundliche Haltung Getreide und Rapslandwirtschaftlicher Nutztiere BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeGVETotal Beiträge AnzahlhaFr.AnzahlAnzahlFr. Kanton ZH1 4826 3152 518 3762 11277 04211 518 112 BE4 51713 9915 596 3999 388253 78740 412 334 LU1 1313 1381 255 0603 964179 76426 657 524 UR0004387 0771 154 760 SZ18228 9121 10927 7774 454 143 OW00047813 2532 064 063 NW0002808 1371 262 750 GL352 0803108 1251 335 958 ZG4311445 62440416 9292 469 772 FR1 1705 8282 330 3092 508118 05818 107 938 SO7033 6301 444 9071 05937 4485 636 998 BL5923 0651 206 05060924 3523 633 807 SH3232 404945 20826813 0811 834 582 AR1129761816 8912 810 286 AI00043213 3172 274 487 SG231561221 0503 034112 80217 750 661 GR152502200 9922 29161 8869 609 373 AG1 5456 9982 796 8221 84374 05611 081 785 TG7852 8751 147 4331 77180 88411 864 516 TI66297118 79264513 4532 099 154 VD1 92517 5827 011 4672 20692 31213 666 965 VS88255101 0731 32120 3703 363 658 NE3172 454979 69868731 6224 764 749 GE2203 3351 287 928822 777401 497 JU5143 5411 410 31591853 1387 565 965 Schweiz15 82676 91330 628 79238 7751 358 336207 795 837 Zone 1 Tal9 74155 04521 897 80214 630650 93996 379 012 Hügel3 68614 3685 731 4135 921224 90134 372 541 BZ I1 7886 0162 406 3005 454176 51227 622 141 BZ II5261 386554 0626 532181 25629 076 009 BZ III688433 4714 07383 71813 653 894 BZ IV17145 7442 16541 0116 692 240
Quelle: BLW
Tabelle 34a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2007
ANHANG A35
Extensiv genutzte WiesenWenig intensiv genutzte Wiesen BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr. AnzahlhaFr. Kanton ZH3 1125 0497 153 332809696440 980 BE7 9887 9118 117 2846 0185 0722 397 616 LU4 1784 2204 566 5851 5981 212600 474 UR407573275 862432511161 481 SZ1 1101 097797 824430313134 740 OW585647406 6051768939 021 NW387532340 20217213658 720 GL350663401 26114913652 079 ZG368391467 59821514677 208 FR1 9302 7763 649 8891 7312 4091 415 109 SO1 1772 3993 051 645467630357 373 BL7691 3561 613 111398484295 882 SH5201 1601 624 52710911876 628 AR380222160 667357224101 499 AI316198139 0481338739 261 SG2 9992 8593 133 2211 6401 113593 626 GR2 1036 9513 384 6182 1647 6312 337 567 AG2 5794 3765 941 960895732471 011 TG1 9732 0693 042 720809548353 850 TI536752637 018376623218 311 VD3 0215 4867 442 3261 0981 915987 850 VS8661 236821 9031 4582 793930 603 NE476907974 626319717333 686 GE2868411 261 2239106 515 JU7211 3891 672 044543980512 448 Schweiz39 13756 05861 077 09722 50529 32512 993 539 Zone 1 Tal19 01727 72740 596 8256 4505 6863 643 732 Hügel5 6587 2678 557 6783 5353 3782 121 448 BZ I4 2893 9982 953 2883 3412 8631 329 545 BZ II4 9245 3453 611 3763 9224 6792 049 795 BZ III3 2886 2912 908 0703 1085 6351 718 503 BZ IV1 9615 4302 449 8612 1497 0842 130 516 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 34b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2007
StreueflächenHecken, Feld- und Ufergehölze
1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A36 ANHANG
BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr. Anzahlha Fr. Kanton ZH1 1481 3671 864 661977191275 851 BE755553357 0222 123443484 937 LU555392342 801791155201 847 UR686349 27431601 SZ8681 225973 6386044 349 OW1488380 2563632 595 NW11910080 5032121 885 GL616242 8431211 284 ZG301535418 2652866563 336 FR945150 448791241321 900 SO312 03132494116 657 BL027293111 745 SH979 7502577096 159 AR263195138 48172107 071 AI228213148 88362128 715 SG1 7561 7991 538 0665417584 769 GR1156330 6173075640 314 AG12094139 4041 166323423 844 TG18099141 37745796142 177 TI454953 6292878 766 VD13512194 5101 011358485 335 VS3485 8211633527 477 NE432 2821033735 297 GE457 3051143654 510 JU392422 519338130137 038 Schweiz7 0527 1126 594 38210 3152 5383 138 458 Zone 1 Tal1 9081 9092 796 5525 8221 4212 100 406 Hügel851689827 0581 965523629 607 BZ I1 071838655 0911 116279201 980 BZ II2 1052 6091 808 473958242171 576 BZ III824769371 8043616028 732 BZ IV293299135 40593136 158
Quelle: BLW
Tabelle 34c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2007
der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
ANHANG A37
BuntbrachenRotationsbrachen BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr. Anzahlha Fr. Kanton ZH314219657 71098120299 250 BE263238715 9745354135 312 LU301647 430121332 925 UR000000 SZ000000 OW000000 NW000000 GL000000 ZG7516 140125 500 FR240239718 5784056139 039 SO4167201 124161845 025 BL138127380 4304689221 275 SH172169506 280182562 950 AR000000 AI000000 SG322471 206223 750 GR141546 1103820 025 AG397186556 740123135337 775 TG109105313 530253587 275 TI6823 85041230 475 VD3414921 477 41092143358 600 VS191030 39010700 NE2635103 590132767 075 GE66107321 5404185211 875 JU7779235 181132254 800 Schweiz2 2922 1416 423 2136018452 113 626 Zone 1 Tal1 9101 8225 466 1755027141 786 005 Hügel368313938 16896129321 821 BZ I9411 31010550 BZ II537 560225 250 BZ III000000 BZ IV000000
Quelle: BLW
1Zuteilung
Tabelle 34d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2007
AckerschonstreifenHochstamm-Feldobstbäume
der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A38 ANHANG
BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeBäumeTotal Beiträge AnzahlhaFr. AnzahlAnzahl Fr. Kanton ZH933 7802 411154 9812 323 781 BE1157 4628 052412 5026 185 831 LU312 1454 106273 8134 107 184 UR00023310 936164 040 SZ00099570 5791 058 685 OW00043723 155347 325 NW00033817 778266 670 GL0001395 98189 715 ZG00048447 977719 655 FR823 5701 81178 7751 181 629 SO646 5251 105101 3871 520 792 BL000867128 1381 921 669 SH2190037222 370335 550 AR00033118 844282 660 AI000714 01260 180 SG235 0702 923230 9173 463 543 GR4057055931 227468 405 AG1423 3902 465186 2612 793 915 TG211 1402 075230 0483 450 019 TI00023518 744281 190 VD171420 9251 935102 6531 539 795 VS111 86080360 737911 055 NE0001679 453141 795 GE10751125 71685 740 JU00063955 186827 714 Schweiz803857 41233 6652 302 17034 528 537 Zone 1 Tal583044 94716 1281 150 21717 249 626 Hügel1679 9156 661537 8598 067 471 BZ I312 1305 481339 7975 096 955 BZ II304203 893196 6852 950 275 BZ III0001 25566 059990 885 BZ IV00024711 553173 325 1Zuteilung
Quelle: BLW
Tabelle 35
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2007 Nur
ANHANG A39
biologische Qualität 1 Nur Vernetzung 1 Biologische Qualität Beiträge Bund und Vernetzung 1 BetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeTotal Beiträge AnzahlhaAnzahlhaAnzahlhaAnzahl Fr. Kanton ZH6466931 6722 5417941 2642 1492 368 989 BE1 5267367 3008 5423 6933 1418 0467 315 282 LU1 7471 4629311 3977189642 6383 064 216 UR147204225315171341380541 604 SZ6445705587397351 5231 2642 004 912 OW24925410783165267394398 107 NW20319411495182366342367 716 GL18637040622535229201 764 ZG37773750513546411481 520 FR2462645151 045134142757765 689 SO329643474800372377 272 BL74822666135411 0386321 321 088 SH142113989688194213257 240 AR1891006641135163275209 824 AI8338197126191207320236 620 SG1 4481 5551 1811 5618881 2022 5142 716 833 GR 1 2902 1606741 2056631 5491 4673 045 412 AG2692685657885851 9468592 283 793 TG5083291 6671 6194623691 8841 659 860 TI2043254311928133238283 728 VD1 0201 387143489001 097819 622 VS41673713064400484623 318 NE2473189729900303235 842 GE384700003817 049 JU2664999049800304509 868 Schweiz12 49414 08516 77623 01310 23314 89127 61032 107 165 Zone Tal4 0873 8376 6398 5832 7363 33910 04810 118 028 Hügel1 7251 6362 3752 9001 6462 6454 1205 269 217 BZ I1 5891 6442 3232 4761 3121 3763 8193 521 160 BZ II2 1462 5372 6693 6292 1192 9644 7055 184 737 BZ III1 6922 3071 8663 1871 6372 8063 1434 681 401 BZ IV1 2552 1249042 2377831 7601 7753 332 623 1 Hochstamm umgerechnet in Aren Quelle: BLW
Tabelle 36
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2007
der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A40 ANHANG
BrotgetreideFuttergetreideRapsTotal BetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaAnzahlhaAnzahlhaFr. Kanton ZH1 1674 2928741 7501272732 518 376 BE2 5286 7483 5246 9221653225 596 399 LU6421 3208031 5411362761 255 060 UR0000000 SZ44141908 912 OW0000000 NW0000000 GL003502 080 ZG1637275482345 624 FR7473 1458602 3321013522 330 309 SO5031 9585581 562491101 444 907 BL4101 4484791 502361151 206 050 SH3131 92913436052115945 208 AR00110297 AI0000000 SG721621853641334221 050 GR92290113198615200 992 AG1 2764 1741 0812 5001633242 796 822 TG6492 033425726671161 147 433 TI382003480316118 792 VD1 2899 1191 4285 4928172 9717 011 467 VS55191475816101 073 NE1406882901 51266254979 698 GE2052 33319095214511 287 928 JU2801 5464291 885321101 410 315 Schweiz10 42641 61811 49929 8141 8565 48130 628 792 Zone 1 Tal7 51233 7976 25316 8031 4694 44521 897 802 Hügel2 2036 2283 0327 3283138115 731 413 BZ I5951 4051 6594 402672092 406 300 BZ II941614831 209715554 062 BZ III172357610033 471 BZ IV531511005 744 1Zuteilung
Quelle: BLW
Tabelle 37
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2007
ANHANG A41
Besonders tierfreundliche StallhaltungssystemeRegelmässiger Auslauf im Freien BetriebeGVETotal BeiträgeBetriebeGVETotal Beiträge AnzahlAnzahlFr.AnzahlAnzahlFr. Kanton ZH1 17929 5853 091 0582 02847 4568 427 054 BE3 67271 7718 398 5089 246182 01632 013 826 LU2 68573 5468 778 8513 879106 21817 878 673 UR1101 364129 5934385 7141 025 167 SZ3836 989747 5461 09820 7883 706 597 OW2404 339469 4134688 9141 594 650 NW1442 985356 1012745 152906 649 GL931 601164 3793106 5241 171 579 ZG2326 671677 43039610 2581 792 342 FR1 41040 9904 542 9522 44277 06813 564 986 SO55613 0141 368 8051 03024 4344 268 193 BL3809 6271 016 66759314 7252 617 140 SH1996 801776 7822226 2811 057 800 AR1713 285382 04861813 6062 428 238 AI1503 648549 9704289 6691 724 517 SG1 35735 2014 043 5692 98377 60113 707 092 GR91217 4741 645 8192 28944 4127 963 554 AG1 18531 6853 638 6831 73042 3707 443 102 TG1 05533 8593 737 1041 67447 0258 127 412 TI1813 367304 20064110 0861 794 954 VD1 16034 0003 410 6492 12958 31210 256 316 VS2363 530355 0381 31216 8403 008 620 NE33310 114981 39268321 5073 783 357 GE351 009102 116801 768299 381 JU59120 5301 933 63790732 6085 632 328 Schweiz18 649466 98451 602 31037 898891 352156 193 527 Zone 1 Tal8 905264 13529 569 48713 961386 80466 809 525 Hügel3 31381 4419 280 8715 792143 45925 091 670 BZ I2 48252 7725 766 7055 409123 74021 855 436 BZ II2 32744 2374 678 5466 505137 01824 397 463 BZ III1 07916 5871 587 8424 06867 13112 066 052 BZ IV5437 812718 8592 16333 1995 973 381 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Beteiligung am BTS-Programm 2007
A42 ANHANG
Tabelle 38
Basis 1 BTS-Beteiligung TierkategorieGVEBetriebeGVEBetriebeGVEBetriebe AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl% % Zucht und Nutzung: Milchkühe600 83133 608176 5766 34929.418.9 Rinder, über 1jährig135 23133 29846 4399 10134.327.3 Stiere, über 1jährig5 7798 5282 1032 89236.433.9 weibliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate32 89826 73411 0466 85333.625.6 männliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate1 9913 82626947413.512.4 Mutter- und Ammenkühe: Mutter- und Ammenkühe ohne Kälbern84 6997 12970 4544 78583.267.1 Mast: Rinder, Stiere, Ochsen, über 4 Monate40 1956 88324 1412 90460.142.2 Total Rindvieh901 62342 507331 02815 13236.735.6 Ziegen9 6126 0742 97680631.013.3 Kaninchen6773 13225915138.34.8 Total übrige Raufutter Verzehrer10 2898 4713 23692031.410.9 Zuchtschweine, über 6 Monate, und Ferkel59 3744 14137 2991 76062.842.5 Remonten, bis 6 Monate, und Mastschweine100 2998 39364 5273 51264.341.8 Total Schweine159 6729 969101 8264 30363.843.2 Zuchthennen und -hähne8711 7422997934.34.5 Legehennen18 60511 95515 3001 57482.213.2 Junghennen, -hähne und Küken2 7084782 01912474.625.9 Mastpoulets20 40899617 90376187.776.4 Truten2 2352302 1718897.138.3 Total Geflügel44 82713 49837 6922 46584.118.3 Total alle Tierkategorien1 116 41145 824473 78218 54142.440.5 1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe, die Direktzahlungen erhalten haben) Quelle: BLW
Tabelle 39
Beteiligung am RAUS-Programm 2007
ANHANG A43
Basis 1 RAUS-Beteiligung TierkategorieGVEBetriebeGVEBetriebeGVEBetriebe AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl% % Zucht und Nutzung: Milchkühe600 83133 608467 76423 97277.971.3 Rinder, über 1jährig135 23133 29899 82522 72473.868.2 Stiere, über 1jährig5 7798 5283 2364 92256.057.7 weibliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate32 89826 73421 37216 88565.063.2 männliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate1 9913 8266201 27431.133.3 Aufzuchtkälber, unter 4 Monate25 51924 3146 8616 38626.926.3 Mutter- und Ammenkühe: Mutter- und Ammenkühe mit Kälbern84 6997 12979 2136 07893.585.3 Mast: Rinder, Stiere, Ochsen, über 4 Monate40 1956 88319 6573 47148.950.4 Kälber, unter 4 Monate3 7605 8898491 19022.620.2 Mastkälber9 83115 0471 1021 54611.210.3 Total Rindvieh940 73342 507700 49931 99974.575.3 Tiere der Pferdegattung35 62411 10030 0288 32684.375.0 Schafe39 7629 32332 9236 65182.871.3 Ziegen9 6126 0746 9353 04172.250.1 Dam- und Rothirsche85522175317788.180.1 Bisons188121831197.291.7 Kaninchen6773 132181662.65.3 Total übrige Raufutter Verzehrer86 71822 31870 84014 82881.766.4 Zuchtschweine, über 6 Monate, und Ferkel59 3744 14137 0741 85762.444.8 Remonten, bis 6 Monate, und Mastschweine100 2998 39361 3313 52061.141.9 Total Schweine159 6729 96998 4054 42561.644.4 Zuchthennen und -hähne8711 74214414416.58.3 Legehennen18 60511 95512 4322 73466.822.9 Junghennen, -hähne und Küken2 7084784618317.017.4 Mastpoulets20 4089961 4011486.914.9 Truten2 2352302 16610796.946.5 Total Geflügel44 82713 49816 6043 00437.022.3 Total alle Tierkategorien1 231 95049 124886 34837 77771.976.9 1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe, die Direktzahlungen erhalten haben) Quelle: BLW
Tabelle 40a
Sömmerungsbeiträge 2007
KantoneSchafe Kühe gemolken, Milchschafe Übrige Raufutter Betriebe und (ohne Milchschafe)und Milchziegen 1 verzehrende TiereBeiträge
A44 ANHANG
Total BetriebeBeitrags-BetriebeBeitrags-BetriebeBeitrags-BetriebeBeiträge berechtigterberechtigte berechtigter BesatzGVEBesatz AnzahlNormalstösseAnzahlGVEAnzahlNormalstösseAnzahlFr. ZH00007330799 015 BE1812 29650613 2061 56348 5701 66518 934 121 LU37340573162395 9292441 923 262 UR671 5172133 9522383 0563302 410 046 SZ456422712 7374249 7624493 894 013 OW23213567602458 2232652 735 019 NW19184151401274 1711331 327 576 GL1243961481126 6221192 121 394 ZG00139209963 642 FR49616461 02458922 9826187 321 690 SO1217592 55559 768 866 BL00001041510 124 629 SH00001100129 889 AR17293081112 377112806 606 AI8901041 4641391 869145999 736 SG391 1401304 34742716 7114396 555 201 GR1878 17638314 09587833 6571 01316 217 522 AG2140073899 119 650 TG131186213669 854 TI832 219784 0432004 7642533 052 555 VD236891531464032 74665410 087 737 VS1535 9071376 33643015 3815217 522 097 NE11174971484 4021531 382 946 GE11100014234 145 JU2103008311 607833 508 495 Total93524 8242 05353 3166 693237 0467 29992 109 706 1Gemolkene Tiere mit einer Sömmerungsdauer von 56 bis 100 Tagen Quelle: BLW
Tabelle 40b
Sömmerungsstatistik 2007: Betriebe und Normalstösse nach Kantonen
ANHANG A45
KantoneMilchküheMutter-/Anderes PferdeSchafeZiegenAndere AmmenküheRindvieh BetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatz AnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNST ZH1400730600000000 BE1 18427 5332512 4531 52926 0732399611912 867482820955 LU1201 334627212383 7671951443513754316 UR2214 123323781772 1621512691 7226424100 SZ3253 835797984176 862451465367010527200 OW2184 904162572423 32619262522547602799 NW921 837252671221 989111618267216618104 GL1034 010273551112 507253513419436452118 ZG34100916510000000 FR3497 638961 04558113 756792575485911722411 SO1211926507591 63413744213200 BL1347910303118002300 SH000019300000000 AR851 4033341081 1507201939441750 AI1221 6231371 35785890471011117 SG3237 8821021 5124149 8674371452 16814625225 GR58716 1734868 94277517 7882307672007 6481501 18853 AG003517312002140000 TG117499611411140000 TI1144 136545991311 13459202862 1521101 8647852 VD37713 6322163 93764014 62610126341717014000 VS33513 878831 2453535 762541431675 8456851800 NE52956384681402 8022112131192500 GE000000132951000 JU373 838361 214804 705321 36038831000 Total4 662118 9191 64324 9626 294122 5621 0244 55099325 8031 5575 926223518 Ein Normalstoss (NST) = 1 GVE * Sömmerungsdauer / 100 Quelle: BLW
Tabelle 41a
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2007
A46 ANHANG
TalzoneHZ MerkmalEinheit10–2020–30 30–50 10–2020–30 30–50 ha LNha LNha LNha LNha LNha LN ReferenzbetriebeAnzahl59349123821813459 Vertretene BetriebeAnzahl8 0365 3153 2062 7021 404773 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 15.4524.3136.5914.6323.9436.93 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr.26 26340 35758 13729 80946 96568 280 FlächenbeiträgeFr.20 37732 80648 07618 06130 09445 592 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.5 1436 8869 2275 8159 42314 128 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.4714064714 2284 7384 643 HangbeiträgeFr.2712583631 7052 7103 917 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.7 33510 79915 4277 04911 63615 275 Ökologischer AusgleichFr.2 3343 3315 4852 2183 5334 444 Extensive ProduktionFr.6441 0661 8506049811 363 Biologischer LandbauFr.3934341 088416835348 EthobeiträgeFr.3 9645 9687 0033 8126 2879 120 Total Direktzahlungen nach DZVFr.33 59851 15673 56436 85858 60183 555 RohleistungFr.223 428327 543401 831187 329283 066377 491 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung%15.015.618.319.720.722.1 Andere Direktzahlungen 2 Fr.2 4293 3466 3162 1703 5465 456 Total Direktzahlungen Fr.36 02654 50279 88039 02862 14889 011 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung%16.116.619.920.822.023.6 1Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART 2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabelle 41b
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2007
ANHANG A47
BZ IBZ II MerkmalEinheit10–2020–30 30–50 10–2020–30 30–50 ha LNha LNha LNha LNha LNha LN ReferenzbetriebeAnzahl2321336420514577 Vertretene BetriebeAnzahl3 1001 3588172 7361 764975 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 14.9524.4737.1314.9524.6137.01 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen totalFr.35 97152 16971 68741 16457 70973 275 FlächenbeiträgeFr.17 46028 87742 94217 24228 13940 336 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.7 52310 70014 8078 27211 82215 314 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.7 9758 6769 46112 04613 37713 779 HangbeiträgeFr.3 0143 9164 4773 6044 3713 847 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.5 95810 24412 9815 6638 49110 539 Ökologischer AusgleichFr.1 4122 1682 3401 2411 6711 587 Extensive ProduktionFr.1484781 2662229153 Biologischer LandbauFr.6431 1964878991 2721 672 EthobeiträgeFr.3 7556 4038 8883 5015 5197 126 Total Direktzahlungen nach DZVFr.41 92962 41384 66846 82766 20083 814 RohleistungFr.168 332259 377331 598160 002211 095271 572 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung%24.924.125.529.331.430.9 Andere Direktzahlungen 2 Fr.1 7192 9345 2054 0483 9424 650 Total Direktzahlungen Fr.43 64765 34789 87350 87670 14288 464 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung%25.925.227.131.833.232.6 1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART 2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabelle 41c
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2007
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART
2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge
3 Aufgrund der zu kleinen Stichprobe werden keine Ergebnisse dargestellt
A48 ANHANG
BZ IIIBZ IV MerkmalEinheit10–2020–30 30–50 10–2020–30 30–50 3 ha LNha LNha LNha LNha LNha LN ReferenzbetriebeAnzahl10663407629 Vertretene BetriebeAnzahl1 5538775731 316446 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 14.5724.1237.4414.6824.51 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen totalFr.46 89566 19781 83150 62270 335 FlächenbeiträgeFr.16 58927 25239 80417 18228 594 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.11 06514 80716 08811 00013 864 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.14 59718 09019 13617 15321 864 HangbeiträgeFr.4 6436 0476 8025 2876 013 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.4 4746 81610 9734 55110 474 Ökologischer AusgleichFr.1 1701 3772 3561 2122 872 Extensive ProduktionFr.063400 Biologischer LandbauFr.7731 4602 8089483 469 EthobeiträgeFr.2 5313 9735 7752 3914 133 Total Direktzahlungen nach DZVFr.51 36973 01392 80455 17380 809 RohleistungFr.133 345196 121233 450127 372185 815 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung%38.537.239.843.343.5 Andere Direktzahlungen 2 Fr.5 0135 2138 6954 8108 760 Total Direktzahlungen Fr.56 38378 226101 49959 98389 569 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung%42.339.943.547.148.2
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabelle 42
Direktzahlungen auf Betriebsebene1 : nach Regionen 2007
ANHANG A49
MerkmalEinheitAlleTal-Hügel-BergBetrieberegionregionregion ReferenzbetriebeAnzahl3 3281 524961843 Vertretene BetriebeAnzahl49 20322 54613 24113 416 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 20.3121.2219.2919.81 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen totalFr.40 53734 78040 19150 554 FlächenbeiträgeFr.25 08628 06723 01122 125 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.7 8465 9098 36610 588 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.5 5393986 11613 609 HangbeiträgeFr.2 0664072 6994 231 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.8 1869 1648 3626 370 Ökologischer AusgleichFr.2 3683 0732 1901 359 Extensive ProduktionFr.60797655539 Biologischer LandbauFr.6904895701 148 EthobeiträgeFr.4 5214 6265 0473 825 Total Direktzahlungen nach DZVFr.48 72443 94448 55356 924 RohleistungFr.242 567297 284222 356170 563 Anteil Direktzahlungen nach DZV an der Rohleistung%20.114.821.833.4 Direktzahlungen pro haFr./ha2 3992 0712 5172 874 Andere Direktzahlungen 2 Fr.3 4973 4522 6674 390 Total DirektzahlungenFr.52 22047 39651 22061 314 Anteil Direktzahlungen total an der Rohleistung%21.515.923.035.9 1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART 2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, andere Beiträge Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2007
A50 ANHANG
Beanstandungen Anzahl%AnzahlAnzahlAnzahl ZH3 49756.391 97204771663211172091300 BE12 04459.557 1724148171394313131270 LU4 90145.052 20805913685218532119348 UR63339.49250025 41000001343 SZ1 60343.1769204122 234000274 OW67263.6942803125 3140002892 NW48361.282960599233200134131 GL39847.9919104 010000005 ZG54455.883040715 001000831 FR3 06238.281 17211164753830442316480 SO1 370101.821 3951271211414266184 BL92299.8992101251321963015129 SH55955.6431100 50187021336 AR72436.60265032132147000876 AI53145.39241033162110000071 SG4 17643.681 824054138311102117227 GR2 55526.6968201039515916000154382 AG2 990101.643 0397561251114184134270 TG2 56755.751 4310321042619231234512276 TI88258.1651305577161000497250 VD3 83770.112 69011513111616314110148 VS3 52055.371 949275186101110995380 NE88637.133295061224017037 GE30156.8117100 53003011123 JU1 04844.5646700311425000052 CH54 70556.5130 913311 0791 25130214528963601876294 215 Falls Anzahl kontrollierter Betriebe
Anzahl
Kanton Quelle:
Kanton DZ-berechtigte Betriebe (Zahlen Agrarbericht 2006) Kontrollierte Betriebe in % aller beitragsberechtigten Betriebe Kontrollierte Betriebe Nicht rechtzeitige Anmeldung Tiergerechte Haltung der Nutztiere Aufzeichnungen Ausgeglichene Düngerbilanz Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen Pufferstreifen/Grasstreifen Geregelte Fruchtfolge Geeigneter Bodenschutz Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln Andere Total Beanstandungen
Tabelle 43a ÖLN-Kontrollen 2007
>
direktzahlungsberechtigter Betriebe, gibt es mehr angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe in diesem
ÖLN-Kontrollen 2007
Falls Anzahl kontrollierter Betriebe > Anzahl direktzahlungsberechtigter Betriebe, gibt es mehr angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe in diesem Kanton
Quelle: AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2007
ANHANG A51
Tabelle 43b
%%Anzahl%%Fr.Fr. ZH8.5815.21942.694.771 453.66136 644 BE2.243.762852.373.97733.45209 033 LU7.1015.761372.806.201 997.99273 725 UR6.7917.20325.0612.80422.7313 527 SZ4.6210.69553.437.951 971.00108 405 OW13.6921.50345.067.94331.2616 027 NW27.1244.26163.315.411 113.5617 817 GL1.262.6251.262.62398.001 990 ZG5.7010.2050.921.64690.003 450 FR15.6840.961765.7515.021 493.15262 794 SO6.136.02614.454.371 189.4472 556 BL13.9914.01333.583.582 637.6787 043 SH6.4411.58254.478.04482.2012 055 AR10.5028.68466.3517.36528.7024 320 AI13.3729.46336.2113.69842.1527 791 SG5.4412.452235.3412.23500.13111 529 GR14.9556.01953.7213.93861.5481 846 AG9.038.881294.314.241 752.87226 120 TG10.7519.29682.654.751 512.12102 824 TI28.3448.738910.0917.352 008.03178 715 VD3.865.501002.613.721 118.45111 845 VS1.0019.50340.971.74967.5632 897 NE4.1811.25161.814.86940.0915 042 GE7.6413.45103.325.852 053.1920 532 JU4.9611.1350.481.072 202.4011 012 CH7.7013.641 8063.305.841 195.762 159 538
Kanton Beanstandungen pro 100 direktzahlungsberechtigte Betriebe Beanstandungen pro 100 kontrollierte Betriebe Betriebe mit Kürzungen Betriebe mit Kürzungen pro 100 direktzahlungsberechtigte Betriebe Betriebe mit Kürzungen pro 100 kontrollierte Betriebe Kürzung in Fr. pro Betrieb mit Kürzungen Kürzungen Total
Ausgaben für Grundlagenverbesserung
Tabelle 44
An die Kantone ausbezahlte Beiträge 2007
45
Beiträge an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2007
A52 ANHANG
Kanton BodenverbesserungenLandwirtschaftliche Gebäude Total Beiträge Fr. Fr. Fr. ZH 1 149 660 299 800 1 449 460 BE 10 566 715 4 882 000 15 448 715 LU 4 858 698 1 003 500 5 862 198 UR 870 503 155 000 1 025 503 SZ 2 215 304 1 015 600 3 230 904 OW 1 127 200 731 600 1 858 800 NW 2 050 812 308 562 2 359 374 GL 253 366 191 600 444 966 ZG 223 773 212 500 436 273 FR 5 866 507 2 983 200 8 849 707 SO 1 600 146 583 400 2 183 546 BL 225 686 508 800 734 486 SH 315 080 205 200 520 280 AR 170 014 700 200 870 214 AI 301 047 754 200 1 055 247 SG 4 299 624 1 777 236 6 076 860 GR 14 819 020 3 843 000 18 662 020 AG 1 621 897 457 500 2 079 397 TG 388 600 371 100 759 700 TI 473 624 441 850 915 474 VD 5 478 323 1 237 200 6 715 523 VS 3 665 594 953 700 4 619 294 NE 567 582 1 117 900 1 685 482 GE 82 000 82 000 JU 2 928 330 1 455 400 4 383 730 Diverse 56 400 56 400 Total 66 175 505 26 190 048 92 365 553 Quelle: BLW
Tabelle
Massnahmen Beiträge Gesamtkosten TalregionHügelregionBergregion Total Total 1000 Fr. Bodenverbesserungen Landumlegungen (inkl. Infrastrukturmassnahmen) 6 057 2 289 8 052 16 398 44 237 Wegebauten 2 050 4 958 12 118 19 126 63 872 Übrige Transportanlagen 353 353 1 250 Massnahmen zum Boden-Wasserhaushalt 1 156 553 2 186 3 895 12 456 Wasserversorgungen 2 949 7 407 10 355 61 603 Elektrizitätsversorgungen 26 607 633 2 225 Wiederherstellungen und Sicherungen 1 32 1 806 5 437 7 276 19 537 Grundlagenbeschaffungen 40 208 247 798 Periodische Wiederinstandstellung 481 36 1 204 1 721 7 898 Total 9 816 12 616 37 572 60 005 213 875 Landwirtschaftliche Gebäude Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere 10 401 12 531 22 931 174 257 Alpgebäude 967 967 8 442 Gemeinschaftsgebäude für Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung 200 1 495 1 695 8 588 Total 10 601 14 993 25 593 191 287 Gesamttotal 9 816 23 217 52 565 85 598 405 162
Unwetterschäden Quelle: BLW
1inkl.
Tabelle 46
Von den Kantonen bewilligte Investitionskredite 2007
ANHANG A53
KantonBodenverbesserungenLandwirtschaftlicher HochbauTotal Gemeinschaftliche MassnahmenGemeinschaftliche M.Einzelbetriebliche M. BaukrediteInvestitionskrediteInvestitionskrediteInvestitionskredite Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr. ZH6 624 104 16 371 110 16 995 BE14 6 048 3 340 10 1 208 337 43 805 364 51 401 LU6 2 740 7 585 6 7 711 165 21 956 184 32 992 UR1 90 1 70 17 1 606 19 1 766 SZ12 2 525 56 6 722 68 9 247 OW2 250 2 105 1 83 20 2 427 25 2 865 NW5 326 1 29 20 1 743 26 2 098 GL 6 657 6 657 ZG 19 2 309 19 2 309 FR13 1 417 8 564 118 19 180 139 21 161 SO2 1 045 1 86 44 5 771 47 6 902 BL2 168 22 3 261 24 3 429 SH 15 2 866 15 2 866 AR 39 3 871 39 3 871 AI1 66 1 24 27 2 907 29 2 997 SG2 650 3 355 2 299 143 19 002 150 20 306 GR14 8 145 1 50 79 10 921 94 19 116 AG2 60 86 12 895 88 12 955 TG3 470 84 11 788 87 12 258 TI1 365 3 726 3 1 037 15 1 647 22 3 775 VD1 300 1 33 38 2 249 131 16 247 171 18 829 VS1 1 087 4 861 4 7 144 25 2 630 34 11 722 NE7 476 28 5 239 35 5 715 GE5 220 1 48 6 268 JU3 690 3 204 54 8 083 60 8 977 Total56 23 245 47 5 661 103 22 620 1 655 223 951 1 861 275 476 Quelle: BLW
Tabelle 47
Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2007 (ohne Baukredite)
KantonStarthilfeKauf desDiversi-Wohn-Ökonomie-Gemein-VerarbeitungBoden-Total Betriebesfizierunggebäudegebäudeschaftlicheund LagerungverbesdurchMass-landw. serungen
A54 ANHANG
Pächternahmen 1 Produkte 1000 Fr. ZH4 175 100 654 2 086 9 356 143 481 16 995 BE12 770 1 275 527 11 094 18 139 77 1 131 340 45 353 LU7 967 379 5 248 8 363 7 711 585 30 252 UR645 772 189 70 1 676 SZ2 220 200 2 090 2 212 6 722 OW870 200 690 667 83 105 2 615 NW450 171 180 942 29 326 2 098 GL420 120 117 657 ZG870 352 1 087 2 309 FR3 825 520 460 3 290 11 085 244 320 1 417 21 161 SO3 420 609 1 742 86 5 857 BL510 52 421 2 278 168 3 429 SH870 93 120 1 783 2 866 AR840 100 140 1 507 1 284 3 871 AI1 200 238 1 469 24 66 2 997 SG6 030 150 132 3 167 9 523 299 355 19 656 GR2 198 589 2 918 5 216 50 10 971 AG3 240 160 328 1 290 7 877 60 12 955 TG3 210 288 472 1 284 6 534 170 300 12 258 TI150 690 807 1 037 726 3 410 VD5 550 204 1 862 8 631 1 931 318 33 18 529 VS540 247 955 888 92 7 052 861 10 635 NE1 230 190 34 795 2 990 117 359 5 715 GE48 166 54 268 JU2 246 313 260 925 4 339 204 690 8 977 Total65 446 3 296 4 990 42 701 107 518 3 372 19 248 5 661 252 232
Quelle:
1Inventarkauf, Starthilfe für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen
BLW
Tabelle 48
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2007 (Bundes- und Kantonsanteile)
ANHANG A55
KantonAnzahlSummepro FallTilgungsdauer 1000 Fr.1000 Fr. Jahre ZH5 710 142 17 BE17 2 729 161 14 LU16 3 043 190 17 UR1 120 120 15 SZ1 130 130 14 OW NW GL ZG1 240 240 12 FR6 620 103 9 SO3 351 117 15 BL12 1 400 117 15 SH3 240 80 10 AR1 35 35 10 AI SG5 609 122 14 GR7 980 140 18 AG2 230 115 14 TG2 195 98 8 TI5 513 103 16 VD14 3 160 226 14 VS7 770 110 13 NE4 250 63 10 GE1 250 250 15 JU18 1 776 99 10 Total131 18 351 Durchschnitt 140 14 Quelle: BLW
A56 ANHANG Tabelle 49a Übersicht über Beiträge Massnahme Genehmigte Projekte in 1000 Fr. 200520062007 Beiträge 86 631 111 435 85 598 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen16 648 16 954 16 398 Wegebauten 17 251 13 466 19 126 Wasserversorgungen 9 775 9 218 10 355 andere Tiefbaumassnahmen (inkl. Unwetter)16 512 44 798 14 126 Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere25 137 26 519 23 898 andere Hochbaumassnahmen1 308 481 1 695 Quelle: BLW Tabelle 49b Übersicht über Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen Massnahme bewilligte Kredite in 1000 Fr. 200520062007 Investitionskredite 1 293 956 252 244 252 232 Starthilfe 76 039 78 726 65 446 Kauf Betrieb durch Pächter6 703 4 877 3 296 Diversifizierung 4 357 2 562 4 990 Wohngebäude 55 255 46 258 42 701 Ökonomiegebäude 125 573 102 095 107 518 Gemeinschaftliche Massnahmen / Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte21 433 15 017 22 620 Bodenverbesserungen, ohne Baukredite4 596 2 709 5 661 Betriebshilfedarlehen 1 16 592 18 403 18 351 1vom Kanton bewilligt Quelle: BLW
Umschulungsbeihilfen 2007
ANHANG A57
Tabelle 50
Kantonzugesicherte Beiträgeausbezahlte Beiträge 1 AnzahlFr.AnzahlFr. ZH BE 3 107 700 LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO 1 47 800 BL SH AR AI SG1 75 000 GR 1 76 500 AG TG 1 76 500 TI VD 1 48 650 VS 1 45 650 NE GE JU Total1 75 000 8 402 800 1von Zusicherungen des Vorjahres Quelle: BLW
Mit der Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM) im Jahr 2007 erfolgte ein Systemwechsel in der Rechnungslegung des Bundes. Aufgrund dieses Strukturbruchs sind Vorjahresvergleiche nicht mehr möglich.
A58 ANHANG
Ausgabenbereich2004200520062007 Aufgabengebiet Landwirtschaft und Ernährung3 750 1003 608 3963 644 8263 601 158 Innerhalb Zahlungsrahmen3 431 7953 318 5013 359 4513 318 647 Produktion und Absatz731 419676 975605 644547 874 Absatzförderung63 67456 67631 79654 022 Milchwirtschaft503 513474 232442 742365 981 Viehwirtschaft22 49920 57418 79118 483 Pflanzenbau141 734125 493112 316109 387 Direktzahlungen2 498 3482 464 0002 553 0002 596 058 Allgemeine Direktzahlungen2 023 0001 989 0001 989 0002 071 158 Ökologische Direktzahlungen475 348475 000564 000524 900 Grundlagenverbesserung202 028177 526200 806174 715 Strukturverbesserungen94 50885 026107 47492 366 Investitionskredite76 46368 00068 50053 875 Betriebshilfe8 8141 5882 2506 040 Pflanzen- und Tierzucht22 24322 82122 37222 434 Ausserhalb Zahlungsrahmen318 305289 895285 375282 511 Verwaltung47 97845 56945 18045 898 Beratung18 36218 31118 00017 998 Pflanzenschutz1 6022 9381 61812 865 Vollzug und Kontrolle (Agroscope)48 59548 02546 61544 484 Gestüt 7 7567 6697 4727 386 Landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte (EZV)114 90090 00090 00079 200 Familienzulagen in der Landwirtschaft (BSV)77 80076 80076 10074 200 Übriges 1 312583390480 Ausgaben ausserhalb der Landwirtschaft117 729126 692126 947131 704 Forschung und Entwicklung Landwirtschaft76 49274 80572 63669 452 Tiergesundheit34 40345 42847 54754 900 Übriges 6 8346 4596 7647 352 Anmerkung:
Staatsrechnung
Tabelle 51 Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung, in 1000 Fr.
Quelle:
Rechtserlasse
Rechtserlasse, Begriffe und Methoden
Rechtserlasse sind im Internet unter folgender Adresse einzusehen: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00498/index.html?lang=de
Begriffe und Methoden
Begriffe und Methoden sind im Internet unter folgender Adresse einzusehen: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00498/index.html?lang=de
ANHANG A59 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Organisationen/Institutionen
ACWForschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW
AgrideaEntwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
ALPForschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
ARTForschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
BAGBundesamt für Gesundheit, Bern
BBTBundesamt für Berufsbildung und Technologie, Bern
BFSBundesamt für Statistik, Neuenburg
BLWBundesamt für Landwirtschaft, Bern
BSVBundesamt für Sozialversicherung, Bern
BAFUBundesamt für Umwelt, Bern
BVETBundesamt für Veterinärwesen, Bern
BWLBundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, Bern
ETHEidgenössische Technische Hochschule, Zürich
EUEuropäische Union
EVDEidg. Volkswirtschaftsdepartement, Bern
EZVEidg. Zollverwaltung, Bern
FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations, Rom
FiBLForschungsinstitut für Biologischen Landbau, Frick
IAWInstitut für Agrarwirtschaft, Zürich
OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development, Paris
OZDOberzolldirektion, Bern
SBVSchweizerischer Bauernverband, Brugg
secoStaatssekretariat für Wirtschaft, Bern
SMPSchweizerische Milchproduzenten, Bern
TSMTreuhandstelle Milch, Bern
WTOWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation), Genf
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, Bonn
Masseinheiten
dtDezitonne = 100 kg
Fr.Franken
hStunden
haHektare = 10 000 m2
hlHektoliter
KcalKilokalorien
kgKilogramm
kmKilometer
lLiter mMeter
m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
Mio.Million
Mrd.Milliarde
A60 ANHANG ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Abkürzungen
Rp.Rappen
St.Stück
tTonne
%Prozent
ØDurchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGISAgrarpolitisches Informationssystem
AHVAlters- und Hinterlassenenversicherung
AKArbeitskraft
AKZAAusserkontingentszollansatz
BSEBovine spongiforme Enzephalopathie («Rinderwahnsinn»)
BTSBesonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw.beziehungsweise
BZ I, II, …Bergzone
ca.zirka
CO2 Kohlendioxid
EOErwerbsersatzordnung
FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheit
GAPGemeinsame Agrarpolitik der EU
GGAGeschützte Geografische Angaben
GUBGeschützte Ursprungsbezeichnung
GVEGrossvieheinheit
GVOGentechnisch veränderte Organismen
inkl.inklusive
IPIntegrierte Produktion
IVInvalidenversicherung
JAEJahresarbeitseinheit
KZAKontingentszollansatz
LGLebendgewicht
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche
LwGLandwirtschaftsgesetz
MwstMehrwertsteuer
NStickstoff
NWRNachwachsende Rohstoffe
ÖAFÖkologische Ausgleichsfläche
ÖLNÖkologischer Leistungsnachweis
PPhosphor
PSMPflanzenschutzmittel
RAUSRegelmässiger Auslauf im Freien
RGVERaufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAKStandardarbeitskraft
SGSchlachtgewicht
u.a.unter anderem
vgl.vergleiche
z.B.zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B. Tabellen)
ANHANG A61
4hm AG, 2007.
Was erwartet die schweizerische Bevölkerung von der Landwirtschaft? Ergebnisse einer Online-Befragung in der deutschen französischen Schweiz.
Forschungsstelle für Business Metric, Universität St. Gallen.
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), verschiedene Jahrgänge.
Agrarbericht 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007.
Bundesamt für Statistik (BFS).
Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2004.
Kenngrössen zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Schweiz (1990–2002)
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2005. Stickstoffhaltige Luftschadstoffe in der Schweiz.
Statusbericht der Eidg. Kommission für Lufthygiene. Schriftenreihe Umwelt Nr. 384.
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), 2008. Messresultate des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL).
NABEL, Luftbelastung 2007.
Forschungsstelle für Umweltbeobachtung (fub), 2008.
Ammoniak-Immissionsmessungen in der Schweiz 2000 bis 2007. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, der OSTLUFT und der Kantone Luzern, Freiburg und Zug.
ISOPUBLIC, Januar/Februar 2008. Junge Bauern und Bäuerinnen und ihre Sicht der Zukunft. Schwerzenbach.
Menzi H. et al., 1997.
Ammoniak-Emissionen in der Schweiz: Ausmass und technische Beurteilung des Reduktionspotentials. Schriftenreihe der FAL 26.
OECD, 2008.
La performance environnementale de l’agriculture dans les pays de l’OCDE depuis 1990.
Peter S. et al., 2006.
Entwicklung der landwirtschaftlichen Emissionen umweltrelevanter Stickstoffverbindungen. IAW, Schriftenreihe 2006/1. Schlussbericht.
Rossier D., 2000.
Vereinfachte Beurteilung der potenziellen Umweltwirkungen der schweizerischen Landwirtschaft. Studie im Rahmen des Projekts: «Zentrale Auswertung und Ökobilanzierung».
Schweizerischer Bauernverband (SBV), verschiedene Jahrgänge.
Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg.
A62 ANHANG ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Literatur
Schweizerischer Bauernverband (SBV), 2007. http://www.bauernverband.ch/de/markt_preise_statistik/tiere/se_2005_0311.pdf
Spirig C., Neftel A., 2006. Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft und Feinstaub. Agrarforschung, 13 (9), 392–397, 2006.
ANHANG A63
A64 ANHANG