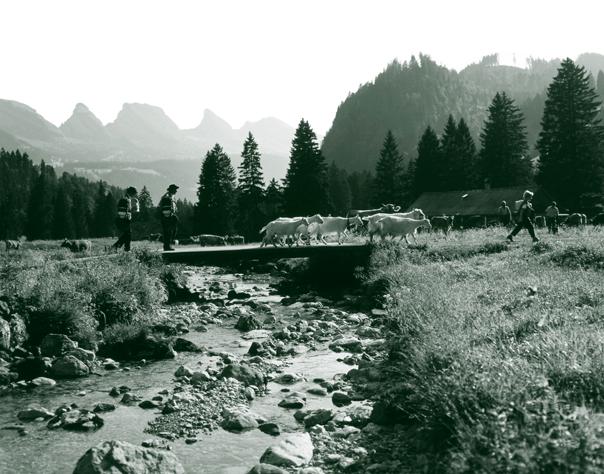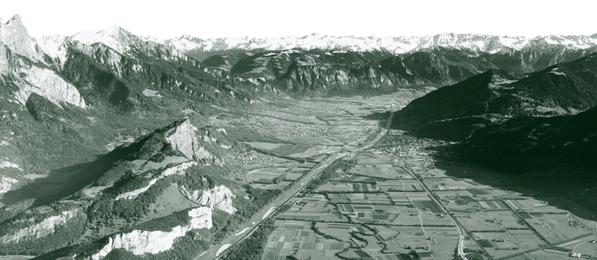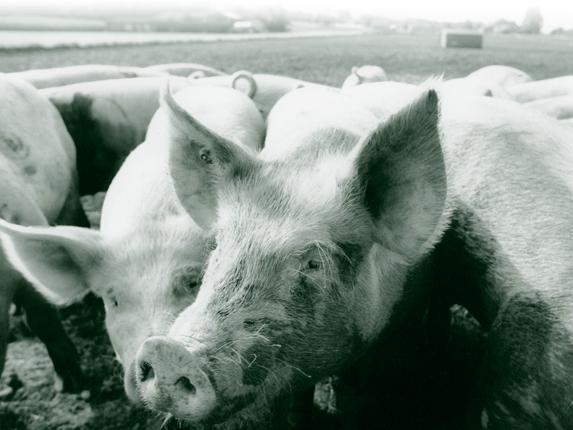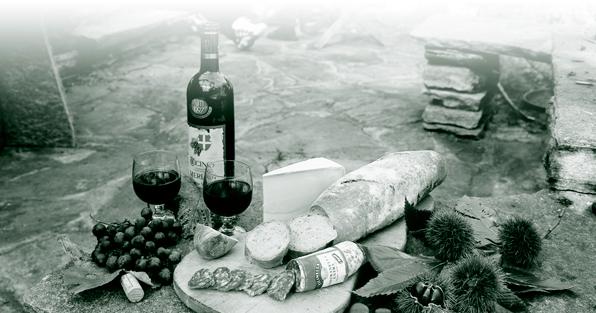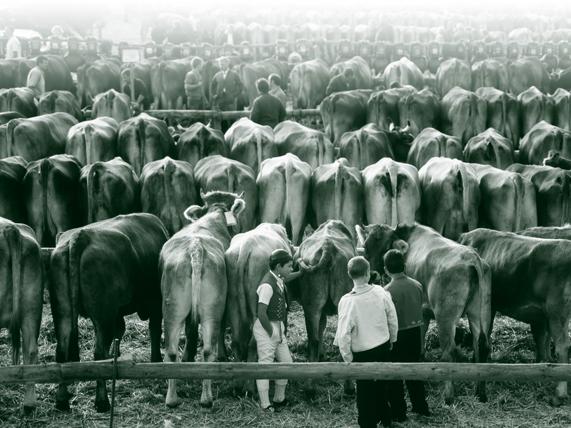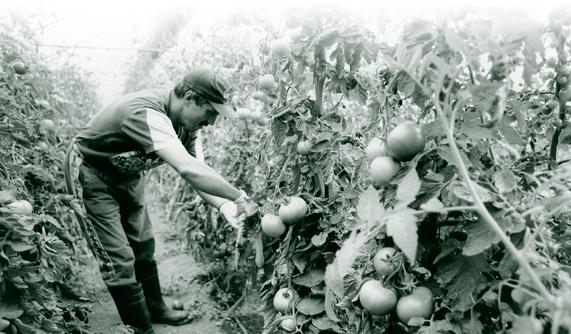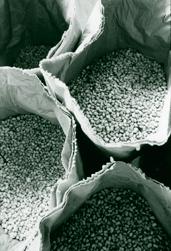AGRARBERICHT
Agrarbericht 2006 des Bundesamtes für Landwirtschaft
1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
Telefon:031 322 25 11
Telefax:031 322 26 34
Internet:www.blw.admin.ch
Copyright:BLW,Bern 2006
Gestaltung
Artwork,Grafik und Design,St.Gallen
Druck RDV AG,Berneck
Fotos
–Agrofot Bildarchiv
– Agroscope Changins-Wädenswil ACW
– Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
–BananaStock Ltd.
–BLW Bundesamt für Landwirtschaft
–Christof Sonderegger,Fotograf
–Getty Images GmbH
–Herbert Mäder,Fotograf
–Peter Mosimann,Fotograf
–Peter Studer,Fotograf
–PhotoDisc Inc.
–Switzerland Cheese Marketing AG
–Tobias Hauser,Fotograf
Bezugsquelle
BBL,Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern
Bestellnummern:
Deutsch:730.680.06 d
Französisch:730.680.06 f
Italienisch:730.680.06 i www.bundespublikationen.admin.ch
2 IMPRESSUM 11.06 1800 161996/1
■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1.Bedeutung und Lage 1.1Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1.1.1Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1.1.2Märkte 19 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 43 1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 49 1.2Soziales 57 1.2.1 Einkommen und Verbrauch 58 1.2.2 Leistungen der Sozialversicherungen 60 1.2.3 Bäuerinnen und Bauern im Pensionsalter 68 1.3Ökologie und Ethologie 89 1.3.1 Ökologie 89 1.3.2 Ethologie 113 ■ 2.Agrarpolitische 2.1Produktion und Absatz 119 Massnahmen 2.1.1Übergreifende Instrumente 120 2.1.2Milchwirtschaft 129 2.1.3 Viehwirtschaft 135 2.1.4 Pflanzenbau 143 2.2Direktzahlungen 151 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 152 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 161 2.2.3 Ökologische Direktzahlungen 169 2.3Grundlagenverbesserung 185 2.3.1Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen 186 2.3.2 Forschung,Gestüt,Beratung,Berufsbildung,CIEA 197 2.3.3 Produktionsmittel 204 2.3.4 Tierzucht 209 2.4Sektion Finanzinspektorat 211 ■ 3.Internationale 3.1Internationale Entwicklungen 217 Aspekte3.2 Internationale Vergleiche 227 ■ Anhang Tabellen A2 Rechtserlasse,Begriffe und Methoden A64 Abkürzungen A65 Literatur A67 INHALTSVERZEICHNIS 3
Das Berichtsjahr 2005 war im mehrjährigen Vergleich ein durchschnittliches Landwirtschaftsjahr.Gegenüber 2004,einem sehr guten Jahr,gingen sowohl der Wert der Tierals auch derjenige der Pflanzenproduktion zurück.Das Sektoreinkommen betrug etwas über 2,7 Mrd.Fr.und war damit ähnlich hoch wie im Jahr 2003.Die Schätzungen für das laufende Jahr gehen von einem leichten Rückgang gegenüber 2005 aus.

Im Brennpunkt des Interesses stehen für die Landwirtschaft zurzeit die parlamentarischen Beratungen über die Agrarpolitik 2011.Im Vorfeld hat diese viele Diskussionen ausgelöst.Unbestritten ist,dass die Bäuerinnen und Bauern täglich wertvolle Arbeit verrichten und ihre Leistungen zugunsten der Schweizer Bevölkerung,wie die hochwertige Produktion von Nahrungsmitteln,der Beitrag zur Versorgung oder die Kulturlandschaftspflege,in unserem Land mit seinem hohen Lebensstandard ihren Preis haben.Die Meinungen,wie die Abgeltung am besten zu gestalten ist,gehen hingegen auseinander.Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Agrarpolitik 2011 die Umlagerung von finanziellen Mitteln für die Marktstützung zu den Direktzahlungen sowie den Abbau von Zöllen auf Futtermitteln und Getreide vorgeschlagen.Damit soll einerseits eine weitere Verbesserung der preislichen Wettbewerbsposition der Schweizer Agrarrohstoffe erreicht werden,anderseits muss sich auch die Verarbeitungsindustrie vermehrt nach dem Markt ausrichten.
Ist dieser Reformschritt richtig und kann die Landwirtschaft die entsprechenden Auswirkungen verkraften? Der Bundesrat hat sich mit diesen Fragen intensiv auseinandergesetzt.Die in den Agrarberichten präsentierten Resultate im ökonomischen,sozialen und ökologischen Bereich dienen als Grundlage für die Entscheidfindung.Für eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft ist die Produktion sehr wichtig.Der Erlös aus dem Produkteverkauf hat für die Einkommensbildung der Landwirtschaftsbetriebe nach wie vor den höchsten Stellenwert.Dies gilt vor allem für die Betriebe im Talgebiet. Abnehmer finden die Schweizer Produkte,wenn sie konkurrenzfähig sind.Es gilt deshalb,die politischen Massnahmen so auszugestalten,dass weitere Verbesserungen möglich werden.Dies führt dann nicht zu Einkommenseinbussen,wenn die Landwirtschaft es schafft,die tieferen Preise mit Produktivitätsverbesserungen aufzufangen.Wie die Zahlen in den Agrarberichten zeigen,gelingt ihr dies.So sind die Einkommen seit dem Inkrafttreten des neuen Landwirtschaftsgesetzes 1999 trotz tieferen Produzentenpreisen stabil geblieben.Für die Jahre 2003 bis 2005 kann ausserdem festgestellt werden,dass der durchschnittliche Arbeitsverdienst der Betriebe im obersten Quartil in allen Regionen den entsprechenden Vergleichslohn der übrigen Bevölkerung erreicht oder übertroffen hat.Ein weiterer Hinweis für die stabile Situation ist die seit 2000 gegenüber den neunziger Jahren etwas tiefere Rate beim Strukturwandel.Diese Entwicklungen lassen den Schluss zu,dass das Reformtempo bisher angepasst war.Die Agrarpolitik 2011 sieht keine Beschleunigung vor,sondern eine kontinuierliche Weiterentwicklung,die den Betroffenen den notwendigen Spielraum für ihre Entscheidungen lässt.
VORWORT 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Vorwort
Unbestritten sind die Verbesserungen im ökologischen Bereich.Der vorliegende Agrarbericht zeigt auf,dass die Landwirtinnen und Landwirte weniger Handelsdünger und weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen,deutlich mehr ökologische Ausgleichsflächen pflegen und mehr Tiere gemäss den Anforderungen der beiden Tierhaltungsprogramme RAUS und BTS halten als zu Beginn der neunziger Jahre.Die Schweizer Landwirtschaft hat insgesamt im ökologischen Bereich einen guten Stand erreicht.Auf regionaler Ebene gibt es ein Potenzial für weitere Verbesserungen.Deshalb werden in der Agrarpolitik 2011 Starthilfen für ressourcenschonende Techniken und Produktionssysteme vorgeschlagen.Verbesserungen werden aber auch beim Vollzug angestrebt.Die Koordination der Kontrollen und die Vereinfachung der Abläufe sollen unter Wahrung der Glaubwürdigkeit dazu beitragen,dass für die Landwirtschaft der administrative Aufwand massvoll ist.
Der Ständerat wird die Agrarpolitik 2011 in der Wintersession 2006 behandeln. Anschliessend geht die Vorlage in den Nationalrat.Voraussichtlich werden die mit der Agrarpolitik 2011 vorgesehenen Anpassungen sowie die Höhe der finanziellen Mittel für den Rahmenkredit 2008 bis 2011 im Sommer 2007 bekannt sein.Ziel ist es,dass auch die notwendigen Ausführungsbestimmungen bis Ende 2007 bekannt sind,damit die Bäuerinnen und Bauern anschliessend bis 2011 klare Vorgaben für ihre Entscheidungen haben.
Manfred Bötsch
Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft
VORWORT 5
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

1 7
In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
c.dezentralen Besiedlung des Landes».
Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.
Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.
Der Bundesrat verfolgt die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.
8 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1
Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

9 1.1 ÖKONOMIE ■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1 Ökonomie
1
1.1.1
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Strukturentwicklungen
Bei der Entwicklung der landwirtschaftlichen Strukturen handelt es sich um einen Prozess der Anpassung an veränderte wirtschaftliche Bedingungen.Sichtbar werden diese Veränderungen in einer Verminderung der Anzahl Betriebe bei gleichzeitiger Vergrösserung der durchschnittlichen Betriebsfläche sowie im Rückgang der landwirtschaftlichen Bevölkerung und der fortschreitenden Mechanisierung.Die folgenden Abschnitte orientieren über die Strukturen in der Landwirtschaft anhand der Entwicklung der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten.
Seit mehreren Jahrzehnten nimmt die Zahl der Betriebe stetig ab.In den fünfziger und sechziger Jahren lag die durchschnittliche Abnahme pro Jahr bei rund 2%.Etwas schwächer war sie in den zwei darauffolgenden Jahrzehnten.Mit der Neuorientierung der Agrarpolitik in den neunziger Jahren setzte wieder ein höherer Strukturwandel ein. Seit der Jahrtausendwende ist die jährliche Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren wieder zurück gegangen.
Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen
■■■■■■■■■■■■■■■■
MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in % 19902000200320051990–20002000–2005 Grössenklasse 0–3 ha19 8198 3717 1186 622–8,3–4,6 3–10 ha27 09218 54216 22015 133–3,7–4,0 10–20 ha31 63024 98423 07721 994–2,3–2,5 20–25 ha6 6777 2447 1557 1570,8–0,2 25–30 ha3 3644 4304 6134 6492,81,0 30–50 ha3 5495 7596 2166 4945,02,4 >50 ha6841 2071 4671 5785,85,5 Region Talregion41 59031 61229 10228 180–2,7–2,3 Hügelregion24 54118 95717 97217 398–2,5–1,7 Bergregion26 68419 96818 79218 049–2,9–2,0 Total92 81570 53765 86663 627–2,7–2,0 Quelle:BFS ■ Betriebe
10 1.1 ÖKONOMIE 1
Tabelle 1,Seite A2
Im Jahrzehnt 1990–2000 war die Hälfte der Betriebe,die abnahmen,Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha.Demgegenüber konnten die Betriebe der Grössenklassen über 20 ha zahlenmässig zunehmen.
In der Fünfjahresperiode 2000–2005 schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber den neunziger Jahren ab.Leicht zugenommen hat sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3 bis 10 ha und 10 bis 20 ha.In der Grössenklasse 20 bis 25 ha war in dieser Zeitspanne eine schwache Abnahmerate auszumachen.Die Wachstumsschwelle stieg von 20 auf 25 ha.Das heisst,dass seit der Jahrtausendwende per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha abund über diesem Wert zugenommen hat.
Die Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Region zwischen 1990 und 2000 wies absolut eine stärkere Abnahme in der Talregion (rund 10'000) als in der Hügel- und Bergregion (5'500 bzw.6'500) auf.Relativ betrachtet war aber die jährliche Abnahmerate in der Bergregion am höchsten.In den ersten fünf Jahren des neuen Jahrtausends konnten im Vergleich zu den neunziger Jahren vor allem in der Hügel- und Bergregion deutlich tiefere Abnahmeraten festgestellt werden.

Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nach Regionen
29818 74017 716–2,9–3,6
Quelle:BFS
Bei den Haupterwerbsbetrieben gab es zwischen 2000 und 2005 in allen Regionen einen Rückgang der Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren.In der Bergregion war sie mit 0,6% pro Jahr am tiefsten.Bei den Nebenerwerbsbetrieben wurde in der Bergregion eine fast doppelt so hohe Abnahmerate festgestellt als im Jahrzehnt zuvor. In der Tal- und Hügelregion blieb sie auf relativ hohem Niveau ziemlich stabil.Insgesamt ging zwischen 2000 und 2005 die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um gut 3'300 und jene der Nebenerwerbsbetriebe um rund 3'600 zurück.
MerkmalAnzahl BetriebeVeränderung pro Jahr in % 19902000200320051990–20002000–2005 Haupterwerbsbetriebe Talregion30 13923 53622 00721 454–2,4–1,8 Hügelregion17 45213 79313 21712 894–2,3–1,3 Bergregion16 65111 91011 90211 563–3,3–0,6 Total64 24249 23947 12645 911–2,6–1,4 Nebenerwerbsbetriebe Talregion11 4518 0767 0956 726–3,4–3,6 Hügelregion7 0895 1644 7554 504–3,1–2,7 Bergregion10 0338 0586 8906 486–2,2–4,2 Total28 57321
1.1 ÖKONOMIE 11 1 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Beschäftigte
Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist mit einer Reduktion der Anzahl Beschäftigte verbunden.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
MerkmalAnzahl
Quelle:BFS
In den neunziger Jahren ging die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft um rund 50'000 Personen zurück.Der Rückgang betraf ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Demgegenüber stieg die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte in dieser Zeitspanne leicht an.
Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Beschäftigten um weitere 15'700 Personen gesunken.Im Unterschied zu den neunziger Jahren gingen zwischen 2000 und 2005 auch die familienfremden Arbeitskräfte zurück.Fast die Hälfte der Reduktion betraf diese Kategorie.

BeschäftigteVeränderung
Jahr
19902000200320051990–20002000–2005
477165 977157 683157 360–2,7–1,1
pro
in %
Familieneigene217
88974 72469 48167 888–1,7–1,9 Betriebsleiterinnen3 9262 3462 5171 989–5,0–3,2
08437 81635 49630 6640,5–4,1 Total253 561203 793193 179188 024–2,2–1,6
davon: Betriebsleiter88
Familienfremde36
12 1.1 ÖKONOMIE 1
Tabelle 2,Seite A3
Wirtschaftliche Kennziffern
Die Schweizer Wirtschaft erreichte 2004 mit 447'976 Mio.Fr.eine um 2,1% höhere Bruttowertschöpfung als im Vorjahr.Der Anteil des Primärsektors war mit 1,3% gering. Davon entfielen drei Viertel auf die Landwirtschaft.
Entwicklung der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen
Entwicklung des
In den Jahren 2000 bis 2005 stiegen die Gesamteinfuhren um 18,2 Mrd.Fr.oder 13,1%,die Gesamtausfuhren um 30 Mrd.Fr.oder 22,1%.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zog zwischen 2000 und 2005 ebenfalls an.Die Importe erhöhten sich in dieser Zeitspanne um 0,9 Mrd.Fr.auf 9,4 Mrd.Fr.,die Exporte ebenfalls um 0,9 Mrd.Fr.auf 4,4 Mrd.Fr.
Im Berichtsjahr stammten 7,1 Mrd.Fr.oder 75,7% der Landwirtschaftsimporte aus der EU (EU25).3,1 Mrd.Fr.oder 69,6% der Exporte wurden in den EU-Raum getätigt (EU25).Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Einfuhren von der EU (EU25) um 208 Mio.Fr.und die Ausfuhren in diese Länder um 302 Mio.Fr.zu.
Sektor199920002001200220032004 1 Veränderung 1999/2004 in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in Mio.Fr.in % Primärsektor5 9656 4365 7725 6935 4245 866–1,7 davon Landwirtschaft nach LGR4 6454 9874 4244 3704 0244 398–5,3 Sekundärsektor109 973111 978116 423116 687115 784117 8737,2 Tertiärsektor285 005300 106303 493313 354317 489324 23713,8 Total400 943418 520425 688435 734438 698447 97611,7 1 provisorisch Quelle:BFS
Aussenhandels 200020012002200320042005Veränderung 2000/05 in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in Mrd.Fr.in % Einfuhren total139,4141,9130,2129,7138,8157,613,1 Landwirtschaftsprodukte8,58,68,58,98,99,410,6 davon aus der EU 1 6,06,26,36,76,97,118,1 Ausfuhren total136,0138,5136,5135,4147,4166,022,1 Landwirtschaftsprodukte3,53,63,53,64,04,425,7 davon in die EU 1 2,32,42,32,52,83,133,4 1 EU15 bis 2003,ab 2004 EU25 Quelle:OZD ■ Bruttowertschöpfung ■ Aussenhandel 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 13 1.1 ÖKONOMIE 1
Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt gefolgt von Italien und Deutschland.Fast zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern.Das gleiche Bild zeigte sich auch in den Jahren zuvor.Die meisten Ausfuhren wurden nach Deutschland getätigt.Eine stark negative Bilanz weist die Schweiz mit Italien,Frankreich,der Niederlande und Spanien aus.Ausgeglichen erscheint sie hingegen auf relativ tiefem
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2005
Tabak und Diverses (13, 14, 24)
Milchprodukte (4)
Nahrungsmittel (20, 21)
Genussmittel (9, 17, 18)
Tierfutter, Abfälle (23)
Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)
Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)
Lebende Pflanzen, Blumen (6)
Gemüse (7)
Früchte (8)
Getränke (22)
Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)
Quelle: OZD
14 1.1 ÖKONOMIE 1
mit Österreich.
Niveau
Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2005
Deutschland Frankreich Italien Österreich Spanien Niederlande übrige Länder 1 018 1 318 575 1 662 298 1 493 251 282 115 526 251 849 573 959 2 0001 5001 500 1 0005000 in Mio. Fr. 5001 000 Einfuhren Importüberschuss Ausfuhren
Quelle: OZD
609 397 584 442 1 140 999 917 996 219 327 505 712 68 432 3 562 5 587 11 1 011 288 1 500 77 1 395 in Mio. Fr.
Zolltarif-Nr. Einfuhren Import- bzw. Exportüberschuss Ausfuhren 2 0001 5001 500 1 00050005001 000
( ):
■ Selbstversorgungsgrad
Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land.Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke,tierische Produkte (inkl.Fische) sowie Früchte und Nahrungsmittelzubereitungen eingeführt.Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser.Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.
Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.
Exportüberschüsse wurden im Berichtsjahr bei Tabak und Diverses (+213 Mio.Fr.), Milchprodukten (+142 Mio.Fr.) sowie Nahrungsmitteln (+141 Mio.Fr.) erzielt.Gegenüber dem Vorjahr sank der Exportüberschuss bei Tabak und Diverses um 63 Mio.Fr. und bei Milchprodukten um 20 Mio.Fr.,hingegen stieg er bei Nahrungsmitteln um 46 Mio.Fr.
Die Schweizer Landwirtschaft hat gemäss Verfassung den Auftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.
Das Schwergewicht der Schweizer Landwirtschaft liegt seit jeher auf der tierischen Produktion,was auch den verhältnismässig hohen Selbstversorgungsgrad in diesem Bereich erklärt.Im Jahr 2004 lag der Inlandanteil bei tierischen Produkten mit 94% einen Prozentpunkt tiefer als 2003.Der Anteil bei pflanzlichen Produkten stieg nach dem sehr trockenen 2003 (39%) wieder deutlich (45%).Insgesamt lag 2004 der Selbstversorgungsgrad mit 60% um 4 Prozentpunkte höher als 2003.
15 1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1
Entwicklung des Selbstversorgungsgrades 199319941995199619971998199920002001200320022004 kalorienmässiger Anteil in % Tierische Nahrungsmittel Nahrungsmittel Total Pflanzliche Nahrungsmittel Quelle: SBV 0 100 80 60 40 20
Tabelle 13,Seite A13
■ Entwicklung von Preisindices
Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ging von 1990 bis 2002 stark zurück.Nach einem leichten Anstieg 2003 und 2004,zeigte der Index wieder sinkende Tendenz.Im Berichtsjahr lag dieser mit 74,0 Prozentpunkten so tief wie noch nie in den vergangenen 15 Jahren.Gegenüber dem Vorjahr (76,8) war er fast 3 Prozentpunkte tiefer.Insgesamt waren die meisten Positionen gegenüber 2004 rückläufig, besonders stark betroffen waren die Preise für Schlachtschweine und für Gemüse.Nur die Kälberpreise wiesen im Vorjahresvergleich eine starke Zunahme aus.
Im Vergleich zum Produzentenpreisindex legte der Landesindex der Konsumentenpreise für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke bis 2004 kontinuierlich zu. Eine stärkere Zunahme ist besonders ab 1999 feststellbar.Im Berichtsjahr ging der Index um 0,8 Prozentpunkte auf 110,4 Prozentpunkte leicht zurück.
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel
Produzentenpreisindex
Index (1990/92 = 100)
1 Basis Mai 1997 = 100. Der neue Index enthält zu 100% Produktionsmittel. Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen. Das Gewicht der Produktionsmittel betrug damals 75%.
Landwirtschaft
Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke
Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel 1
Importpreisindex für Nahrungsmittel 2
2 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.
Quellen: BFS, SBV
Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel zeigt seit 1999 eine leicht steigende Tendenz.Ein etwas kräftigerer Anstieg ist in den beiden letzten Jahren sichtbar.Im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2004 um 1,5 Prozentpunkte auf 105,3 Punkte zu.Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut,Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden.Der Teilindex Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft ist im betrachteten Zeitraum gesunken, der Teilindex der übrigen Produktionsmittel angestiegen.
Der Importpreisindex für Nahrungsmittel wurde im Mai 2003 revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 2003 = 100).Zusätzliche Untergruppen wurden in den Warenkorb aufgenommen,so dass der Index nun einen grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte abdeckt.Im Berichtsjahr lag der Index bei 103,3 Punkten und somit 0,9 Prozentpunkte höher als 2004.
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–1992 19931994199519961997199819992000200120032005 2004 2002 16 1.1 ÖKONOMIE 1
■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung
Bundesausgaben
Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 51'403 Mio.Fr.Dies entspricht einer Zunahme von 1,1 Mrd.Fr.oder 2,2% gegenüber 2004.Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3'771 Mio.Fr.aufgewendet.Nach sozialer Wohlfahrt (14'143 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (10'216 Mio.Fr.),Verkehr (7'806 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'576 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.Im Vorjahresvergleich zeigt sich,dass während für soziale Wohlfahrt (+330),Finanzen und Steuern (+799) und Verkehr (+371) die Ausgaben insgesamt um rund 1,3 Mrd.Fr.zunahmen,diese für Landesverteidigung (–65 Mio.Fr.) und Landwirtschaft und Ernährung (–131 Mio.Fr.) um rund 200 Mio.Fr. abnahmen.
Entwicklung
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes erreichte 2005 mit 7,3% einen Tiefstwert.
Die Ausgaben für Produktion und Absatz sind weiter im Sinken begriffen.Nachdem in der Periode 1998–2003 die Verpflichtung von Art.187 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG – Senkung der Mittel für die Marktstützung um ein Drittel – eingehalten wurde,konnten 2004 und 2005 die Ausgaben in diesem Bereich jährlich um weitere 60 Mio.Fr.oder rund 8% reduziert werden.
Ernährung 19951996199719981999200020012002200320042005 Mio. Fr. in % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0,0 1,0 10,0 8,0 9,0 6,0 7,0 4,0 5,0 2,0 3,0 3 547 3 953 3 922 3 925 4 197 3 727 3 962 4 067 3 908 3 902 3 771
der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und
1.1 ÖKONOMIE 17 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1
Tabelle 51,Seite A58
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung,diejenigen zwischen 2003 und 2005 sind jedoch wieder vergleichbar.
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Bei den Direktzahlungen wurden im Berichtsjahr gut 30 Mio.Fr.weniger ausgegeben als 2004.Diese Abnahme ist vor allem auf die Einsparungen zurückzuführen,die im Rahmen des Entlastungsprogrammes 03 (EP 03) getätigt wurden.
Die Ausgaben im Bereich Grundlagenverbesserung gingen im Berichtsjahr um 24 Mio.Fr. zurück.Wie bei den Direktzahlungen hängt auch in diesem Bereich der Ausgabenrückgang mit den Einsparungen im Rahmen des EP 03 zusammen.
1.1 ÖKONOMIE 1 18
Ausgabenbereich1990/92200320042005 in Mio.Fr. Produktion und Absatz1 685798731677 Direktzahlungen7722 4352 4982 464 Grundlagenverbesserung186215202178 Weitere Ausgaben405460471452 Total Landwirtschaft und Ernährung3 0483 9083 9023 771
Die Umstände waren 2005 weniger günstig als im Vorjahr.Die Witterungsbedingungen ermöglichten den Landwirten – ausgenommen in den durch Extremereignisse betroffenen Regionen – durchschnittliche Erträge einzufahren.Die Milchproduktion blieb trotz sinkender Produzentenpreise gegenüber 2004 mehr oder weniger stabil. Während auf dem Rindfleischmarkt ein guter Preis zu erzielen war,bescherten relativ tiefe Produzentenpreise der Schweinebranche ein schwierigeres Jahr als 2004.Der Schweinefleischkonsum hingegen stieg auf Kosten des Geflügelfleisches.Angesichts des wiederum relativ hohen Preisniveaus fielen die Erträge im Gemüsebau etwa gleich aus wie im Vorjahr.Der Produktionswert des gesamten Sektors beträgt 10,3 Mrd.Fr.
Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2005

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%
Landw. Dienstleistungen 6%
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2%
Milch 22%
Obst 5%
Gemüse- und Gartenbau 13%
Futterpflanzen 12%
Wein 4% Kartoffeln, Zuckerrüben 3% Getreide 5%
Rindvieh 11%
Schweine 9%
Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%
Quelle: BFS
Die Nahrungsmittelproduktion (tierische und pflanzliche Produkte) verminderte sich um 6,6% gegenüber 2004,das im Vergleich zu 2005 ein relativ gutes Jahr war. Der Pflanzenbau ging um 8,4% (–414 Mio.Fr.) zurück,die Viehwirtschaft um 4,8% (–247 Mio.Fr.).Letztere ist weniger von den Wetterbedingungen abhängig,was den geringeren Rückgang erklärt.
■■■■■■■■■■■■■■■■
1.1.2 Märkte
1.1 ÖKONOMIE 19 1
Tabelle 14,Seite A14
■ Produktion:steigende Gesamtproduktion –leicht sinkende Milcheinlieferungen
Milch und Milchprodukte

Im Jahr 2005 wurde etwas weniger Milch eingeliefert als im Vorjahr.Die Absatzlage beim wichtigsten Produkt der Milchwirtschaft,dem Käse,hat sich sowohl im Inland als auch beim Export erfreulich entwickelt.Auch die Verkäufe von Frischmilchprodukten, Joghurt und Konsumrahm haben zugenommen.Entsprechend tiefer lauten denn auch die Produktionszahlen für Milchpulver und Butter,deren marktkonforme Verwertung oft schwierig ist.Weiterhin sinkende Tendenz weisen die Produzentenpreise für Milch auf.
Die Gesamtmilchproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 20‘000 t auf 3,96 Mio.t. 19% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert. Mit 3,203 Mio.t waren hingegen im 2005 die Milcheinlieferungen geringfügig (–8'765 t) tiefer als im Vorjahr.Diese Milchmenge stammte von 567'997 Kühen.Die durchschnittliche Milchleistung pro Kuh nahm im Berichtsjahr leicht auf 5'690 kg (+10 kg) zu.
nach Monaten 2004 und 2005
Nach wie vor sind die saisonalen Schwankungen bei den Milcheinlieferungen gross und für die Milchverwertung immer wieder eine Herausforderung.Im Spitzenmonat Mai des Berichtsjahres lagen sie rund 59'500 t oder über 24% höher als beispielsweise im August.
Milcheinlieferungen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember in 1 000 t Milcheinlieferungen 2005 Milcheinlieferungen 2004 Quelle: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 320 20 1.1 ÖKONOMIE 1
Tabellen 3–12,Seiten A4–A12
Im Jahr 2005 wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,203 Mio.t) wie folgt verwertet (in t Milch):
zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1 099 889 t(–2,6%)
zu Käse:1 371 514 t (+2,2%)
zu Rahm/Butter:731 819 t (–1,2%)
Die hergestellte Menge Käse nahm gegenüber dem Vorjahr um 3,3% auf 167'708 t zu. Der Frischkäse stieg um 8,0% auf 39’781 t,der Halbhartkäse um 3,2% auf 49’433 t, der Hartkäse um 0,5% auf 71'050 t.Das Produktionsvolumen von Weichkäse sank leicht auf 6'565 t (–2,4%),jenes der Schaf- und Ziegenkäse erhöhte sich auf 879 t (+8%).
Auch die Produktion von Frischmilchprodukten ist insgesamt nach wie vor zunehmend: Joghurt allein erreichte im Berichtsjahr ein Volumen von fast 140’471 t (+4,6%). Zurückgegangen um 1,7% auf 488’412 t ist hingegen die Konsummilchproduktion.
Im Berichtsjahr konnte bei der Rahmproduktion erstmals seit ein paar Jahren wieder eine leicht positive Tendenz festgestellt werden.Die Magermilch- und Vollmilchpulverproduktion sank geringfügig;die Butterproduktion reduzierte sich um relativ deutliche 3,7% oder fast 1'500 t.
1990/92 200320042005 in 1 000 t Milch andere Milchprodukte Rahm Butter Quellen: TSM, SBV Käse Konsummilch 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 21 1
■ Verwertung:mehr Käse
■ Aussenhandel:positive Gesamtbilanz
Im Milchsektor ist die Aussenhandelsbilanz nach wie vor positiv.Die Schweiz exportiert bei Käse,Milchpulver,Joghurt und Rahm mengenmässig mehr als sie einführt.
Die Käseausfuhr (inkl.Fertigfondue von 5'312 t) stieg im Berichtsjahr um 2,0% auf 57’020 t,der Käseimport nahm leicht auf rund 31'912 t zu.Auffallend ist im 2005 die Abnahme der Joghurtexporte um 57,1% auf 7’300 t.Der Export von Rahm stieg hingegen um 210% auf 4'275 t.Die unterschiedliche Entwicklung kann teilweise auf eine entsprechend angepasste Nutzung des Zollfreikontingents «Joghurt und Rahm» der EU zurückgeführt werden.Der Export von Milchpulver wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 1'353 t oder 8,7% auf 16'970 t.Der Import nahm um 41,1% ab.
Auch im vierten Jahr nach Inkrafttreten des Käseabkommens mit der EU wurden nicht bei allen Nullzollkontingenten die zur Verfügung stehenden Importmengen zugeteilt. Von den verfügbaren 19’500 t wurden nur 16’059 t ersteigert.Im Gegensatz zu den zwei vorangehenden Jahren konnte aber diesmal das Kontingent 119 (Mozzarella) vollumfänglich zugeteilt werden.
Die Versteigerung der ersten Halbjahresmengen der Einfuhrrechte für das Jahr 2006/07 bestätigte die Entwicklung der letzten vier Jahre:die Kontingentsmengen für Mozzarella,andere Frisch- und Weichkäse sowie für Halbhart- und Hartkäse konnten vollumfänglich zugeteilt werden.Hingegen wurden nur 2'090 t der ausgeschriebenen 2'500 t der Kontingentsmenge Nr.121 und 163 t von 250 t der Kontingentsmenge für Provolone ersteigert.
Käse-Importkontingente der Schweiz Produkt1.Jahr2.Jahr 3.Jahr4.Jahr (Juni 02 – Mai 03)(Juni 03 – Mai 04)(Juni 04 – Mai 05)(Juni 05 – Mai 06) Kontin-ZugeteilteKontin-ZugeteilteKontin-ZugeteilteKontin-Zugeteilte gentMengegentMenge gentMengegentMenge in tin tin tin tin tin tin tin t 119Mozzarella5005007005009507001 0501 050 120Frisch- und Weichkäse1 0001 0003 3001 0004 8504 8506 3506 037 121Asiago,Bitto,Brà,Fontal, Montasio …5 0002 7195 0005 0005 0003 4275 0003 073 122Provolone500211500500500304500273 123Hart- und Halbhartkäse5 0004 5695 0005 0005 7005 3676 6005 626 Quelle:BLW
1.1 ÖKONOMIE 1 22
Kontingents-Nr.
Gemäss Abkommen standen im vierten Jahr 6'750 t für einen zusätzlichen zollfreien Käseexport in die EU zur Verfügung (Erhöhung des Nullzollkontingentes um 1'250 t gegenüber dem dritten Kontingentsjahr).Im Vergleich zu diesem dritten Jahr wurde die Marktzutrittsmöglichkeit besser genutzt.Im Juli 2005 (Beginn Kontingentsjahr) vergab die EU für den Zeitraum Juli 2005 bis Dezember 2005 Einfuhrlizenzen in der Höhe von 1'564 t.Gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet dies eine Erhöhung um 613 t oder 64,4%.Verfügbar wären für diesen ersten Halbjahreszeitraum 3'375 t gewesen.Für die zweite Jahreshälfte 2005/06 standen demnach,einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,5'186 t zur Verfügung.
Das Zollfreikontingent der EU von 2'000 t für schweizerischen Joghurt- und Rahmexport wurde wiederum voll beansprucht.
1
1.1
Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums einzelner Milchprodukte zeigt,dass mit Ausnahme des steigenden Joghurtkonsums weiterhin stabile Tendenzen dominieren.
14,0 16,0 18,0 20,0
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0
0,0
Verbrauch:Joghurt im Trend Butter Quark
■ kg pro Kopf Käse Joghurt Quelle: SBV
ÖKONOMIE 23
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Der Weich-,Halbhart- und Hartkäsekonsum pro Kopf war im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.Der Frischkäseverbrauch kompensierte diesen Rückgang mit einem Anstieg um 4,9% auf 6,4 kg.Der Joghurtabsatz betrug 17,8 kg pro Kopf,bemerkenswerte 2,2 kg oder 14,1% mehr. Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums 1990/92 200320042005
■ Produzentenpreise: sinkende Tendenz
Im Vergleich zum Vorjahr lag der durchschnittliche schweizerische Produzentenpreis für Milch ab Hof bzw.Sammelstelle um 2.2 Rp.tiefer bei 72.41 Rp.
Milchpreise 2005 gesamtschweizerisch und nach Regionen 1
1Region I:Westschweiz;Region II:Bern,Zentralschweiz;Region III:Nordwestschweiz; Region IV:Zürich/Ostschweiz;Region V:SüdschweizQuelle:BLW
Die regionalen Differenzen bei der Industriemilch und der verkästen Milch nahmen im Berichtsjahr zu.Sie betrugen bei der verkästen Milch bis zu 8.66 Rp.und bei der Industriemilch bis zu 2.22 Rp.Hingegen verkleinerte sich im Vergleich zum Vorjahr die regionale Differenz bei der Biomilch auf bis zu 4.24 Rp.Der Preis für Biomilch sank um 4,3% und erreichte 81.81 Rp.pro kg Milch.Für Biomilch wird je nach Region zwischen 8.36 und 14.03 Rp.pro kg Milch mehr als für Industrie- oder verkäste Milch bezahlt.
■ Konsumentenpreise: verstärkter Druck
Einige wenige Beispiele dokumentieren den allgemeinen Preisdruck bei Milchprodukten an der Verkaufsfront:1 kg Emmentaler kostete im Jahr 2005 durchschnittlich Fr.19.63.Die Abnahme beträgt gegenüber dem Vorjahr 30 Rp.Für 1 kg Gruyère zahlte der Konsument Fr.20.19 oder 35 Rp.weniger.Der Konsumentenpreis für 150 g Mozzarella 45% nahm im Vergleich zum Vorjahr um 7 Rp.ab auf Fr.2.13.Wie beim Käse sanken auch bei der Vorzugsbutter 200 g oder beim Vollrahm 1⁄2 l die Preise innert Jahresfrist von Fr.3.14 auf Fr.2.95 bzw.von Fr.4.50 auf Fr.4.22.
Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte
Die Konsumentenpreisindices sämtlicher Milchprodukte weisen im 2005 – im Gegensatz zum Vorjahr – sinkende Tendenzen auf.Der Index für Butter ist am stärksten gesunken:minus 2,91 Punkte oder 3%.
Rp./kgCHRegion IRegion IIRegion IIIRegion IVRegion V Gesamt72.4172.6972.0971.5774.0274.15 Industriemilch71.0471.4271.1070.3671.6972.58 verkäste Milch72.2175.1770.7071.8271.8179.36 Biomilch81.8184.4181.6484.3980.17 nicht erhoben
1990/92 200320042005 Index (Mai 1993 = 100) Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte 75 85 80 90 95 100 105 1.1 ÖKONOMIE 1 24
■ Marktspanne:tendenziell abnehmend

Nachdem die Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukte ihren höchsten Wert des Berichtsjahres im Juni erreicht hatte,verzeichnete sie bis Dezember eine stetige Abnahme.Dafür typisch ist der Verlauf der Bruttomarge beim Käse.Generell erklärt sich diese auch bei der Butter deutlich festzustellende Entwicklung durch verschiedene Verkaufsaktionen im zweiten Halbjahr 2005.
Entwicklung der Bruttomarge 2005
Index (Januar 1997 = 100) Käse Milch-und Milchprodukte Joghurt Butter Quelle: BLW 40 50 60 70 80 100 90 110 120 130 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 1.1 ÖKONOMIE 25 1
Tiere und tierische Erzeugnisse
Das Auftreten der Vogelgrippe in Europa führte gegen Ende des Berichtsjahres zu einem Einbruch des Geflügelfleischkonsums.Die Verkäufe von Geflügelfleisch gingen ab Oktober 2005 um rund 20% zurück.Eine Erholung trat bis in den Frühling 2006 nicht ein.Als Folge davon sank der Pro-Kopf-Konsum von Geflügelfleisch gegenüber dem Vorjahr um 2,8%.Die Produzentenpreise für Poulets und Truten blieben relativ stabil,hingegen drosselten die Schlachtbetriebe die Produktionsmenge.Sie liessen bei den Mästern weniger Mastküken einstallen oder sie veranlassten längere Perioden,in denen keine Küken eingestallt wurden.Beides führte zu Erlösausfällen bei den Mästern.Keinen nennenswerten Einfluss hatte die Vogelgrippe auf den Eiermarkt. Jeder Schweizer und jede Schweizerin ass im Berichtsjahr 185 Eier.Einerseits stieg die Inlandproduktion um 0,8% (5 Mio.Stück),andererseits wurden auch 1'300 t mehr eingeführt.
Der Schweinefleischmarkt durchlief ein historisches Tief und die Produzenten erhielten im Durchschnitt des Jahres lediglich Fr.4.02 je kg SG.Der Hauptgrund ist die Ausdehnung der Produktion um 4%.Die Konsumenten profitierten von rund 10% tieferen Preisen beim Einkauf und konsumierten daher auch über 2% mehr Schweinefleisch als 2004.Die Kälbermäster erlebten ein gutes Jahr mit einem Jahrespreis von Fr.13.20 je kg SG.Es war der höchste seit mehr als 10 Jahren.Da die Tränkekälber für die Kälberund Grossviehmast sehr rar waren,mussten entsprechend hohe Ankaufspreise bezahlt werden.Auf dem Rindfleischmarkt erreichten die Produzentenpreise zwar ein tieferes Niveau als im Vorjahr,doch stieg der Konsum weiter an.Weil im Inland vor allem Verarbeitungsfleisch fehlte,wurden Kuhfleischeinfuhren von mehr als 2'400 t bewilligt.

1.1 ÖKONOMIE 1 26
Tabellen 3–12,Seiten A4–A12
■ Produktion:Steigender Schweinebestand
Der Rindviehbestand stieg erstmals seit 2001 wieder an,und zwar um 0,7%.Der Bestand der Verkehrsmilchkühe ist seit Jahren rückläufig,derjenige für die Mutter- und Ammenkühe steigend.Das Rindvieh wird insgesamt auf 45'430 Betrieben gehalten, was rund 750 Betriebe weniger sind als 2004.Der Schweinebestand wurde um 4,7% ausgedehnt und erreichte 1,609 Mio.St.Letztmals wurden 1994 so viele Schweine gehalten.Der Zuchtsauenbestand stieg um 5'600 St.auf 148'800 St.Die Schaf-, Ziegen- und Pferdehaltung ist sehr beliebt,weshalb wesentlich mehr Tiere als 1990 gehalten werden.Die Mehrheit der Schafe und Ziegen wird im Berggebiet gehalten.
Entwicklung der Tierbestände
Der Mastgeflügelbestand kletterte weiter und liegt nun bei über 5 Mio.St.Im Vergleich zu 1990 steht 76% mehr Mastgeflügel in Schweizer Ställen.Das Mastgeflügel wird auf rund 1'000 Betrieben gehalten.
Die Produktion von Schweinefleisch ist mit 236'165 t SG am bedeutendsten.An zweiter Stelle folgt Rindfleisch mit 100'024 t SG und an dritter Stelle Geflügelfleisch mit 33'361 t Verkaufsgewicht.Gegenüber 2004 wurde 16,4% mehr Ziegenfleisch und 4,0% mehr Schweinefleisch im Inland erzeugt.Gesunken ist dagegen die Produktion von Pferdefleisch (–10,4%),Schaf- und Lammfleisch (–6,1%),Kalbfleisch (–4,1%) und Geflügelfleisch (–2,9%).Seit Anfang der neunziger Jahre wurde jedes Jahr mehr Geflügelfleisch in der Schweiz erzeugt.Dieser Trend wurde nun erstmals im Berichtsjahr wegen den Auswirkungen der Vogelgrippe gebrochen.Seit 1990/92 sinkt der Rindvieh- und Schweinebestand auf den Schweizer Bauernhöfen und entsprechend ist die Produktion um 23,5% und 11,4% tiefer.Damit hat sich die Erzeugung beider Fleischarten dem langfristig rückläufigen Konsum angepasst.Genau umgekehrt ist es beim Geflügelfleisch,wo die substanzielle Konsumzunahme seit 1990/92 zu einer Steigerung der Inlandproduktion um 60,9% führte.Keine gleichgerichtete Entwicklung ist bei Schaf- und Lammfleisch zu beobachten:Der Konsum ist seit 15 Jahren stabil, wohingegen die Inlandproduktion um 22,2% stieg.
Tierart19902003200420051990–2003/05 in 1 000in 1 000in 1 000in 1 000% Rindvieh 1 8581 5701 5441 555–16,24 – Kühe für die Verkehrsmilchproduktion726587570568–20,80 – Kühe ohne Verkehrsmilchproduktion, gemolken515151531,31 – Mutter- und Ammenkühe14657078407,14 Schweine 1 7761 5291 5371 609–12,26 Schafe 35544544044624,98 Ziegen 6167717415,85 Pferde 3853545542,11 Mastgeflügel 2 8784 5184 9715 06068,51 Lege- und Zuchthennen 2 7952 1172 0882 189–23,75 Quelle:BFS
1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 27 1
Entwicklung der tierischen Produktion
■ Aussenhandel:Brasilien ist der wichtigste Rind- und Geflügelfleischlieferant
Vom konsumierten Rind- und Schweinefleisch stammen 85,9% bzw.94,3% aus der Schweiz.Hingegen kommt lediglich jedes zehnte Kilogramm Pferdefleisch,jedes fünfte Kilogramm Kaninchenfleisch sowie etwa jedes zweite Kilogramm Geflügel-,Ziegenund Schaffleisch aus inländischer Produktion.Der Inlandanteil aller Fleischkategorien zusammen lag im Berichtsjahr bei 80,5%.
Die Eierproduktion stieg um 0,8% und belief sich auf 657 Mio.St.Im Vergleich zur Periode 1990/92 nahm die Produktion um 3% zu.
Die Ausfuhren von Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnissen beliefen sich auf 2'160 t. Rinds-Trockenfleisch ist das wichtigste Produkt mit einem Marktanteil von 1'218 t;es wird fast ausschliesslich nach Frankreich und Deutschland verkauft.Der Handelswert der schweizerischen Fleischexporte betrug rund 30 Mio.Fr.
Schweizer Firmen führten insgesamt über 103'000 t Fleisch,Fleischerzeugnisse und Schlachtnebenprodukte ein,die einen Handelswert von über 690 Mio.Fr.aufweisen. Die wichtigsten Handelspartner sind Deutschland (31'000 t),Brasilien (20'000 t) und Frankreich (10'000 t).Der Handelswert dieser Waren erreichte zusammen rund 275 Mio.Fr.Mengenmässig sind Geflügel- und Rindfleisch dominierend,wovon 42'100 t bzw.12'600 t importiert wurden.Wegen des kleinen Inlandangebotes wurde so viel Rindfleisch eingeführt,wie seit vielen Jahren nicht mehr.
Aus Brasilien stammen 79% des eingeführten Rind- und Kalbfleisches,was einer Anteilszunahme um 5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht.Südafrika (5%),Niederlande (4%) und Frankreich (4%) sind die nächstgrössten,aber viel kleineren Lieferanten.Brasilien exportiert vor allem Spezialstücke des Rindsstotzens, Nierstücke und High-Quality-Beef.Die grössten Exporteure von Schaf- und Lammfleisch sind Australien und Neuseeland mit einem Anteil von zusammen 82%.Das Pferdefleisch stammt hauptsächlich aus den USA (46%) und Kanada (34%).Brasilien hat erstmals die Spitze als grösster Lieferant von Geflügelfleisch mit einem Importanteil von 26% erreicht.Es ist zurzeit auch der weltweit grösste Exporteur.Aus Deutschland kommen rund 19% sowie aus Frankreich und Ungarn je 17% des ausländischen Geflügelfleisches.Nach wie vor beliebt sind italienische Wurstwaren,wovon etwa
1990/92200320042005 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quellen: Proviande, SBV Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 70 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch
1.1 ÖKONOMIE 1 28
■ Verbrauch: Schweinefleisch wird am meisten gegessen
2'600 t in die Schweiz verkauft werden.Ausserdem landen etwa 1'600 t französische Fleischzubereitungen und Konserven in Schweizer Haushalten und in der Gastronomie.

Schweizer und Schweizerinnen führten insgesamt 3'229 Esel und Pferde ein.Jedes dritte Pferd stammt aus deutscher,jedes vierte aus französischer Herkunft.Immerhin wurden aus der Schweiz auch 1’064 Equiden ausgeführt.
Der Aussenhandel mit Eiern ist sehr einseitig.Den Eiereinfuhren von über 28'300 t stehen Ausfuhren von lediglich 70 t gegenüber.Die Einfuhren stiegen um 1’300 t gegenüber dem Vorjahr.Etwa die Hälfte der Importeier wird im Detailhandel verkauft und etwa die Hälfte aufgeschlagen und in der Nahrungsmittelindustrie als Eiprodukt verwendet.Deutsche,niederländische und französische Eier von zusammen 22'800 t weisen den grössten Anteil auf.Zudem wurden auch 10'500 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine in die Schweiz gebracht.Mehr als die Hälfte davon stammen aus den Niederlanden.Die Ausfuhren beliefen sich hingegen nur auf 10 t.
Im Rahmen der WTO Uruguay-Runde hat sich die Schweiz verpflichtet,den Marktzutritt für eine bestimmte Fleischmenge zu tiefen Kontingentszöllen zu gewähren.Für Rind-, Schaf-,Pferde- und Ziegenfleisch beträgt die Zollkontingentsmenge seit 1996 zusammen 22'500 t.Die Schweiz hat diese Verpflichtung jedes Jahr eingehalten und im Jahresmittel der letzten zehn Jahre über 28'000 t Einfuhren zugelassen.Für Schweine- und Geflügelfleisch nahm die Zollkontingentsmenge von 50'020 t im Jahre 1996 auf 54'500 t im Jahre 2000 zu;seither ist sie konstant bei 54'500 t.Auch diese Verpflichtung wurde im Durchschnitt der Jahre 1996 bis 2005 mit 54'570 t pro Jahr übertroffen.Allerdings gab es sechs Jahre,in denen die Zollkontingentsmenge nicht erreicht wurde.Diese wurden jedoch von vier Jahren mit Mehrimporten überkompensiert.Seit 1996 beträgt das Zollkontingent Tiere der Pferdegattung 3'322 St.Seither liegt die Ausnützung bei durchschnittlich 89%.
Der Fleischverbrauch lag mit 393'296 t um 0,6% über dem Vorjahreswert.Etwa die Hälfte davon war Schweinefleisch.Den kleinsten Anteil weist Ziegenfleisch mit 708 t auf.Wieder steigender Beliebtheit erfreuen sich sowohl Rindfleisch wie auch Schweinefleisch mit einer Zunahme des Verbrauchs von je 2,1%.Der Geflügelfleischverbrauch sank dagegen um 2,3%.Dies ist hauptsächlich auf die Vogelgrippe zurück zu führen, welche einen Konsumrückgang auslöste.Die grössten Einbussen mussten jedoch das Wild- und Kaninchenfleisch (–6,6%) und das Schaf- und Lammfleisch (–4,2%) verbuchen.Ausserdem verzehrten die Konsumentinnen und Konsumenten 58'057 t Fische und Krustentiere,was eine Abnahme von 1% bedeutet.
Der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch blieb im Berichtsjahr stabil auf 51,75 kg.Wie bereits im Vorjahr ist der Konsum von Schweinefleisch am grössten (25,2 kg),gefolgt von Rindfleisch (10,39 kg).Von beiden Fleischsorten stieg der Pro-Kopf-Konsum um je 1,6%.Unverändert blieb der Konsum von Pferdefleisch bei 0,63 kg.Die grössten Abnahmen in Kilogramm pro Kopf verzeichneten Geflügelfleisch (–0,28 kg) und Kalbfleisch (–0,11 kg).Ebenfalls weniger beliebt sind Fische und Krustentiere.Der Konsum sank um 1,5% auf 7,64 kg.Nach einem seit 1990/92 tendenziell sinkenden Eierkonsum,stieg er im 2005 wieder an.Pro Person wurden 185 Eier gegessen (2004: 182 Eier).
1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 29 1
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern
■ Produzentenpreise: Preise für Schlachtkälber im Hoch
Der Konsum von Wurstwaren und Charcuterie ist in Privathaushalten sehr bedeutend. Zusammen beträgt deren Anteil rund 45% am gesamten Konsum.Mengenmässig auch bedeutend sind sowohl Schweine- als auch Geflügelfleisch (je 18%).In der Gastronomie werden im Vergleich dazu Charcuterie mit einem Anteil von 19% und Rindfleisch mit 17% am meisten serviert.
Für Muni,Ochsen und Rinder mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurden im Jahresmittel rund Fr.8.– je kg SG franko Schlachthof bezahlt.Die Preise sind seit 2003 stabil geblieben.Gesunken sind dagegen die Kuhpreise,die in allen Handelsklassen etwa einen halben Franken je kg SG tiefer lagen als im Vorjahr.Für eine Kuh der Handelsklasse T3 erhielten die Bauern Fr.6.16 je kg SG.Gegen Ende des Berichtsjahres wurden für Schlachtkälber mehr als Fr.15.– je kg SG bezahlt.Der mittlere Jahrespreis von Fr.13.20 je kg SG ist der höchste seit 1994.Die Hauptursache ist das kleine Angebot auf Grund des geringen Kuhbestandes bei gleichzeitig stabilem Konsum. Wegen der steigenden Schweinefleischproduktion (4%) brach der Jahrespreis für Fleischschweine ein,und zwar auf ein historisches Tief von Fr.4.02 je kg SG.Der Preis für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) stieg moderat um 1% infolge der rückläufigen Inlandproduktion (–6,1%).
1990/92 200320042005 Index (1990/92 = 100) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch Quellen: Proviande, SBV Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier (in St.)
1.1 ÖKONOMIE 1 30
Monatliche Schlachtvieh- und Schweinepreise 2005
■ Konsumentenpreise: Schweinefleisch wurde billiger
Saisonale Preisschwankungen traten bei Schweinen und Kälbern auf.Der Kälberpreis stieg infolge des rückläufigen Angebotes in der zweiten Jahreshälfte von Fr.11.85 auf Fr.15.10 je kg SG.Für Schweine wurde wie gewohnt von Mai bis Juli mit bis zu Fr.4.76 je kg SG der höchste Preis bezahlt.Die Grillsaison bewirkt jeweils eine Zunahme der Nachfrage.Vom Sommer an fielen die Schweinepreise stetig und lagen im November nur noch bei Fr.3.73 je kg SG.Saisonale Angebotsspitzen treten bei den Lämmern im Frühling und Herbst auf.Die Produzenten erzielten deshalb im April und Oktober jeweils weniger als Fr.10.– je kg SG.
Fleischstücke vom Schwein wurden im Berichtsjahr bis zu 10% günstiger an Konsumentinnen und Konsumenten verkauft als im Jahre 2004.Der tiefere Produzentenpreis für Schweine hat sich somit bis zur Ladentheke ausgewirkt.Stabile Konsumentenpreise in den letzten drei Jahren wiesen die verschiedenen Stücke vom Rind und vom Lamm auf.Die beobachteten Konsumentenpreise für Fleisch aller Tierkategorien lagen in den letzten drei Jahren höher als 1990/92.Gründe dafür dürften der höhere Anteil von Labelfleisch und zusätzliche Kosten in der Wertschöpfungskette sein (LSVA,Entsorgung von tierischen Nebenprodukten,Mehraufwand für die Deklaration und Rückverfolgbarkeit der Nahrungsmittel etc.).Die grösste Preiszunahme seit 1990/92 weist mit 43% das Voressen vom Kalb auf.Lediglich um 3,5% kletterte der Preis für geschnittene Koteletten vom Schwein.Die Produzentenpreise brachen dagegen seit 1990/92 um 13% für Muni,um 12% für Kälber,um 25% für Schweine und sogar um 31% für Lämmer ein.Die Schere zwischen Produzentenund Konsumentenpreisen hat sich deutlich geöffnet.
Fr. pro kg SG Kälber, Handelsklasse T3 Lämmer Handelsklasse T3 Muni, Handelsklasse T3
Handelsklasse
Fleischschweine, leicht
SBV 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Kühe,
T2/3
Quelle:
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 31
■ Bruttomarge Fleisch
Die stetige Steigerung der nominalen Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung für Rindfleisch,Schweinefleisch und für den Warenkorb aller Frischfleischsorten,inkl. Fleisch- und Wurstwaren,wurde im Berichtsjahr unterbrochen.Die Marge für Rindfleisch sank um 5 Prozentpunkte,für Schweinefleisch um 2,4 Prozentpunkte und für alle Frischfleischsorten um 1,6 Prozentpunkte.Bei Lammfleisch blieb die Marge im Berichtsjahr stabil gegenüber dem Vorjahr.Der steigende Trend der Marge von Lammfleisch von 1999 bis 2003 wurde bereits 2004 gebrochen.Insgesamt ist der Rückgang der Bruttomargen auf einen verstärkten Wettbewerb in der Fleischbranche zurückzuführen.Zum einen ist die Ankündigung des Markteintritts von grossen LebensmittelDiscountern verantwortlich.Zum anderen hat auch bereits die Versteigerung eines Teils der Zollkontingente Fleisch mehr Wettbewerb ermöglicht.Die augenfälligste Margenzunahme von 35,5% seit 1999 ist beim Schweinefleisch festzustellen.Am geringsten ist sie mit 15,1% beim Kalbfleisch.Die Marge des Warenkorbes aller Frischfleischsorten,inklusive der Fleisch- und Wurstwaren,kletterte seit der Basisperiode (FebruarApril 1999,Index = 100) stetig auf 118,8 Punkte.
Entwicklung der Bruttomargen Fleisch 2005
1.1 ÖKONOMIE 1 32
Index (Februar–April 1999
100) Schwein Rind Kalb Lamm Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren Quelle: BLW 150 135 140 145 130 125 120 115 110 105 100 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
=
■ Wettersituation: sonnig und warm
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte
Die Temperaturen lagen im Berichtsjahr beidseits der Alpen über dem langjährigen Mittel von 1961 bis 1990.Der Juni wies vor den Monaten Mai,Oktober,April und September den grössten Wärmeüberschuss aus.Kälter als gewöhnlich war es im Februar und Dezember.Vor allem entlang des Mittellandes und der Zentralalpen fielen unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen.Aussergewöhnlich starke Niederschläge im August am Alpennordhang führten regional zu normalen Jahressummen.Landesweit zu trocken war der November und vielerorts auch der März.Auf der Alpensüdseite resultierte aus den in jedem Monat hinter dem langjährigen Mittel zurückbleibenden Regenmengen ein extremes Niederschlagsdefizit.Mit Ausnahme des Puschlavs und des Unterengadins lag die Sonnenscheindauer über dem langjährigen Mittel.Sonniger als gewöhnlich waren die Monate Juni,Mai,März und Januar.
Zu extremen Ereignissen zählen die Kälteperiode von Mitte Februar bis Mitte März mit einem mittleren Temperaturdefizit von 5°C gegenüber dem langjährigen Mittel,der Wintereinbruch in der Westschweiz vom 17.April mit 20 cm Schnee in Aarberg und 30 cm in Lausanne,der Hagelsturm vom 18.Juli im Lavaux mit grossflächigen Verwüstungen in den Rebkulturen und die starken Regenfälle vom 21./22.August am Alpennordhang.Seit 1901 lässt sich kein Starkregen mit vergleichbarem Schadensausmass finden.Betroffen waren vor allem das Berner Oberland und die Innerschweiz, gebietsweise aber auch das Voralpengebiet,besonders vom Emmental bis zur Zugerund Walenseeregion sowie das Prättigau.In den Einzugsgebieten der betroffenen Regionen wurden die seit 1901 grössten Regensummen für 1,2 und 5 Tage registriert.

1.1 ÖKONOMIE 1 33
■ Produktion: Flächenausdehnung bei Raps und Getreide
Ackerkulturen
Insgesamt nahm die offene Ackerfläche gegenüber dem Vorjahr um 6’412 ha zu (2%). Stärker als die Brotgetreidefläche (1%) stieg die Futtergetreidefläche (7%) an,womit der Flächenrückgang vom Vorjahr wettgemacht wurde.Flächengewinne verbuchten zudem Hülsenfrüchte (6%),Raps (5%) sowie Silo- und Grünmais (2%).Flächenabnahmen verzeichneten Soja (–39%),Futterrüben (–13%),Kartoffeln (–6%) und Zuckerrüben (–1%).
Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2005 (provisorisch)
Total 287 715 ha
Silo- und Grünmais 15% 43 111 ha
Freilandgemüse 3% 8 840 ha
Raps 6% 17 715 ha
Zuckerrüben 6% 18 352 ha
übrige Kulturen 7% 18 686 ha
Getreide 59% 168 449 ha
Kartoffeln 4% 12 562 ha
Quelle: SBV
Gegenüber dem sehr guten Vorjahr fielen die Erträge im Berichtsjahr geringer aus.Am meisten betrug der Rückgang bei Gerste (–11%),am wenigsten bei Zuckerrüben (–1%).
Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte
Index (1990/92 = 100)
1990/92199920002001200220042005 2003
Produkte (Erträge 2005 provisorisch)
Winterweizen (57,5 dt/ha)
Kartoffeln (387,0 dt/ha)
Raps (32,3 dt/ha)
Gerste (61,4 dt/ha)
Zuckerrüben (762,8 dt/ha)
Quelle: SBV
1.1 ÖKONOMIE 1 34
70 140 130 120 110 100 90 80
Tabellen 3–12,Seiten A4–A12
■ Verwertung: Frischverfütterung nicht marktfähiger Kartoffeln legte zu
Trotz der Ausdehnung der Getreidefläche blieb im Berichtsjahr sowohl die Produktion von Brot- als auch Futtergetreide um 3% hinter dem Vorjahresergebnis zurück.Einzig bei Körnermais resultierte aus einer Flächenausdehnung und leicht höheren Erträgen eine Produktionsausdehnung.Erstmals seit 2001 wurden wieder 200'000 t Körnermais gedroschen.
Trotz geringerer Brotgetreideernte hatte der Schweizerische Getreideproduzentenverband wegen eines Angebotsüberhangs rund 41'000 t in den Futtermittelsektor umzulenken.Günstige Wachstumsbedingungen bis Ende November führten bei den Zuckerrüben zu einem erfreulichen mittleren Zuckergehalt von 17,5% bzw.einem sehr guten Zuckerertrag von 13,3 t je ha.Bei einer Ausbeute von gegen 90% erreichte die Zuckerproduktion 221'434 t.Im Mittel der Jahre 2002 bis 2004 liessen sich rund 35% der Kartoffelernte nicht im Speisesegment absetzen.Wurden im Jahre 2003 davon 65% frisch verfüttert,steigerte sich dieser Anteil im Jahre 2004 auf 73% und im Berichtsjahr auf 88%.Die kostengünstigere Verfütterung unverarbeiteter Knollen gewann deutlich an Bedeutung.Auf eine sehr gute Rapsernte im Jahre 2004 folgte im Berichtsjahr mit 57'000 t eine gute Ernte.Erstmals seit der Einführung des Ernteausgleichs im Jahre 2001 deckte im Berichtsjahr die Rapsernte den Bedarf zur Speiseölproduktion,ohne dass zur technischen Verwendung bestimmter Raps an die Speiseölwerke abgegeben werden musste.
1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 35
1990/92 200320042005 1 in 1 000 t Weizen Triticale Quelle: SBV 1 provisorisch Roggen Hafer Dinkel Körnermais Gerste 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 516 232 201 528 257 181 428 218 91 342 211
Entwicklung der Getreideproduktion
■ Aussenhandel: Öl und Ölfrüchte zu technischen Zwecken
Pflanzenöle werden zur menschlichen Ernährung,in der Tierfütterung oder ausserhalb des Ernährungsbereichs zu technischen Zwecken (z.B.als Schmiermittel in sensiblen Bereichen der Nahrungsmittelindustrie oder zur Herstellung von Treibstoffen wie Rapsmethylester) verwendet.Im Berichtsjahr wurden insgesamt rund 31'000 t Öle zu technischen Zwecken und 7'100 t Ölfrüchte zur Ölgewinnung zu technischen Zwecken eingeführt.Von total 42'710 t importiertem Sonnenblumenöl dienten 46% technischen Verwendungen.Bei den importierten Ölfrüchten zur Ölgewinnung zu technischen Zwecken führt Raps vor Soja die Rangfolge an.
Importe von Pflanzenölen und Ölfrüchten zu technischen Zwecken 2005
in 1 000 t
Sonnenblumen,
■ Produzentenpreise: Getreide tiefer
Die per 1.Juli 2005 in Kraft getretene Senkung der Grenzbelastung von Brotgetreide und Futtermitteln veranlasste die Branche zur Reduktion der entsprechenden Richtpreise.Nachdem der Richtpreis von Weizen Kl.I im Trockenjahr 2003 deutlich übertroffen und im Jahr 2004 erreicht wurde,blieb der erzielte Produzentenpreis im Berichtsjahr unter dem Richtpreis.
Die Kürzung der Bundesbeiträge für die Verarbeitung von Zuckerrüben und Ölsaaten sowie für die Verwertung von Kartoffeln wirkte sich nur geringfügig auf die Produzentenpreise von Zuckerrüben,Raps und Kartoffeln aus.Trotz des gesamthaft nach wie vor hohen Anteils Kartoffeln,die in die Tierfütterung gelangen,stiegen die mittleren Produzentenpreise von Kartoffeln gegenüber dem Vorjahr leicht an.
36 1.1 ÖKONOMIE 1
Saflor
Rizinus Rüben, Raps, Senf Lein Palm Soja Jojoba Erdnuss Tung Oliven Kokos andere Pflanzen Quelle: OZD Öl Früchte 0 48121620
■ Konsumentenpreise: teilweise rückläufig
Entwicklung der Produzentenerlöse für Ackerprodukte
Produzentenpreise 2005
Weizen Kl. I, 52.42 Fr./dt Zuckerrüben, 11.77 Fr./dt Raps, 76.83 Fr./dt
Gerste, 42.24 Fr./dt Kartoffeln, 34.30 Fr./dt
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Die Konsumentenpreise von Weissmehl und Halbweissbrot blieben stabil.Die Preise von Ruchbrot (1%),Kartoffeln (1%),Weggli (2%) und Zucker (4%) stiegen an. Hingegen sanken die Preise von Sonnenblumenöl (–2%) und Spaghetti (–8%).

37 1.1 ÖKONOMIE 1
1990/92199920002001200220042005 2003 Abweichung in %
–70 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60
■ Produktion:Mehr Gemüse und Obst, aber weniger Wein
Spezialkulturen
Auf einer Fläche von 23’745 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’903 ha Reben,6’672 ha Obstanlagen und 297 ha Strauchbeeren.
Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13’800 ha.Sie vergrösserte sich gegenüber dem Vorjahr um 350 ha.Die bedeutendste Flächenzunahmen waren bei Konservenspinat mit 150 ha sowie bei Konservenbohnen und Chicoré Witloof mit je 50 ha zu verzeichnen.Spinat konnte sich nach dem Einbruch im Vorjahr wiederum erholen. Karotten und Zwiebeln sind durch jährlich bedeutende Flächenschwankungen geprägt, welche Angebotszyklen verursachen.Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Fläche um 130 ha,während ein Jahr zuvor die Fläche um 110 ha zunahm.
Bei den Obstflächen waren die gleichen Entwicklungstendenzen wie in den Vorjahren zu beobachten.Die Apfelfläche betrug 4’315 ha und nahm weiter um einige Hektaren ab – allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.Hingegen legten die Apfelsorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova weiterhin zu.In den letzten sieben Jahren verdoppelte sich deren Fläche auf 1’000 ha.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 946 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr leicht ab.Steinobst und Beeren waren weiterhin im Trend.Die Fläche von Steinobst dehnte sich um 15 ha auf 1’366 ha und diejenigen der Beeren um 24 ha auf 720 ha aus.
Die Rebfläche betrug 14’903 ha.Das sind 34 ha weniger als ein Jahr zuvor.Davon waren 6’454 ha (–133 ha) mit weissen und 8’449 ha (+99 ha) mit roten Trauben bestockt.Der Rückgang der mit weissen Trauben bestockten Flächen dürfte aufgrund der verhaltenen Weissweinnachfrage und der gewährten Umstellungsbeiträge für die Rodung der Rebsorten Chasselas und Müller-Thurgau in den kommenden Jahren wenn auch in geringem Umfang weiter gehen.
Blattsalate: Angebotsentwicklung zwischen 1996/98 und 2003/05
Kopfsalat
Batavia Chinakohl Endivien
Blattsalate, andere Lollo rot
Zuckerhut Eisberg echter Eichenlaubsalat
Nüsslisalat Cicorino rot
Quelle: SZG
1.1 ÖKONOMIE 1 38
in t
1996/98 2003/05 0 5 000 10 000 15 00020 000
■ Verwertung:Kleine Mostobsternte
Es wurden 316'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 133’000 t Tafelobst geerntet. Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich bei Gemüse um eine Ertragssteigerung von 6% und bei Obst von 5%.
Die Blattgemüse machten mit 273 Mio.Fr.ein Drittel des Gemüseumsatzes aus. Mengenmässig waren sie weniger bedeutend.Sie umfassten ein Viertel der Gemüsemenge,nämlich 80'000 t.In den letzten sieben Jahren nahm das Angebot an Blattgemüse um 6’400 t oder 9% zu.Die Salatpalette unterlag während diesem Zeitraum teilweise sehr grossen Schwankungen.Das Angebot von Eichenlaubsalat verdreifachte sich und dasjenige von echtem Eisbergsalat verdoppelte sich.Der wichtigste Blattsalat ist immer noch Kopfsalat,obwohl er die stärkste Angebotsreduktion (26%) zu verzeichnen hat.
Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,betrugen 516’000 t bzw.183’000 t.Das Gemüsevolumen war 1% und das Obstvolumen 5% grösser als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre.Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen betrug 61% und derjenige von Obst 73%.Bei Gemüse ist dieser Wert 3% höher und bei Obst gleich gross wie im Vierjahresmittel 2001/04.
Im Berichtsjahr wurden 100,1 Mio.Liter Wein gekeltert.Das sind 15,8 Mio.Liter weniger als im Vorjahr.Davon waren 47,9 Mio.Liter Weisswein und 52,2 Mio.Liter Rotwein.Die durchschnittlichen Erträge betrugen 0,7 Liter pro m2 bei den weissen und 0,6 Liter pro m2 bei den roten Gewächsen.
Die eingebrachte und in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 73’431 t und jene der Mostbirnen 22’165 t.Gemessen an der durch den SBV im August 2005 herausgegebenen Vorernteschätzung verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Minus von 9% und bei den Mostbirnen ein solches von 8%.Auf Grund der als klein veranschlagten Ernte konnte auf den Einzug von Rückbehalten zur Verwertung von Übermengen durch die Branchenorganisation verzichtet werden.Dank der Lager (Marktreserve und Übermengen) aus der Vorjahresernte konnte der inländische Bedarf an Apfelsaftprodukten vollumfänglich gedeckt werden.
Der seit 1998 bei den ungegorenen Obstsaftgetränken zu verzeichnende Aufwärtstrend beim Getränkeausstoss konnte nach einem Einbruch im Vorjahr erfreulicherweise erneut weiter ausgebaut werden.

1.1 ÖKONOMIE 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1 39
■ Aussenhandel: Weinexport nahm zu
Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst,die in der Schweiz angebaut werden können,beliefen sich auf 200'000 t bzw.51’000 t.Das waren 6% weniger Gemüse und 5% mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.Von den Importrückgängen waren vor allem Karotten (–1’500 t) und Zwiebeln (–4’200 t) und von den Importzunahmen waren Zwetschgen,Birnen und Erdbeeren mit je rund 1000 t betroffen.Die Exporte waren mit 200 t Gemüse und 1'100 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren,insgesamt aber unbedeutend.

Die Einfuhren an Trinkwein betrugen 157,6 Mio.Liter Wein.Davon waren 134,8 Mio. Liter Rotwein und 22,8 Mio.Liter Weisswein.Dazu wurden noch 12,9 Mio.Liter Schaumwein,8 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,5 Mio.Liter so genannte Süssweine oder Spezialitäten eingeführt.Gegenüber dem Vorjahr war eine weitere Reduktion von 1,2 Mio.Liter bei den Rotwein- und eine Zunahme von 0,5 Mio.Liter bei den Weissweinimporten festzustellen.Die Schaumweinimporte nahmen ebenfalls leicht zu.Die Exporte von Schweizer Flaschenwein nahmen gegenüber dem Vorjahr erneut zu und erreichten 1,8 Mio.Liter (+29%).
■ Verbrauch:Weinkonsum nimmt weiter ab
Der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse betrug 69 kg,derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 25 kg.Gegenüber dem Vierjahresmittel 2001/04 wurden gleich viel Gemüse und 1 kg mehr Obst gegessen.
Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug 264,9 Mio. Liter.Der Gesamtverbrauch ging somit weiterhin zurück (–6,4 Mio.Liter).Dabei nahm der Konsum an ausländischen Weinen sowohl bei den Rotweinen als auch bei den Weissweinen leicht zu.Gemäss der Lagerbestandsmeldung des Handels bei der Eidgenössischen Weinhandelskommission (ohne Vorräte der Selbsteinkellerer) ging beim Schweizer Wein hingegen der Konsum um insgesamt 10 Mio.Liter,das heisst beim Weissen um 5,5 Mio.Liter und beim Roten um 4,5 Mio.Liter zurück.Der Marktanteil von Schweizer Wein war somit rückläufig und betrug nur noch 37,4% (2,3% weniger als im Vorjahr).Wenn man allerdings die Lager der Selbsteinkellerer berücksichtigt,wäre der Konsum an Schweizer Weinen stabil.Trotz dieses erfreulichen Resultats sind diese Zahlen aufgrund der kurzen Zeitreihen noch mit Vorsicht zu interpretieren.Der gesamte Weinkonsum (inkl.die Verarbeitungsweine) bezifferte sich auf rund 273 Mio.Liter,wovon 70% auf Rotweine entfiel.
1.1 ÖKONOMIE 1 40
■ Preise:Bei Gemüse weiterhin Rekordumsatz auf Stufe franko Grossverteiler
Der Umsatz von Gemüse stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an und erreichte wie im letzten Jahr 806 Mio.Fr.Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre stieg er um 9%.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.55 Fr. pro kg gegenüber 2.52 Fr.pro kg im Jahr zuvor und 2.48 Fr.pro kg im Durchschnitt der vier Vorjahre.
Blattsalate: Preis-, Mengen- und Erlösentwicklung zwischen 1996/98 und 2003/05
Kopfsalat in % Batavia Chinakohl Endivien Blattsalate, andere Lollo rot Zuckerhut
echter
Preisentwicklung Mengenentwicklung Erlösentwicklung
Die Preise der Blattsalate nahmen seit 1996/98 zu.Ihre Entwicklung war jedoch sehr unterschiedlich.Während die Preiszunahmen von Nüsslisalat und Cicorino rot unter 20% blieben,nahmen die Preise von Kopfsalat,Batavia,Chinakohl und Endivien um mehr als 50% zu.In Übereinstimmung mit den Preiszunahmen konnten bei allen Blattgemüse die Erlöse gesteigert werden.Allerdings hat die grösste Preissteigerung nicht automatisch die grösste Erlössteigerung zur Folge.Zuckerhut,Eisbergsalat echt und Eichenlaubsalat wiesen die grössten Erlössteigerungen auf.Diese beruhten vorwiegend auf den enormen Mengensteigerungen.Hingegen basierten die beachtlichen Erlössteigerungen von Kopfsalat,Chinakohl,Endivien und Lollo rot auf den höheren Preisen.Denn diese Blattsalate wiesen geringere Angebotsmengen auf als noch vor wenigen Jahren.Es kann angenommen werden,dass die Preiszunahmen nur teilweise mit einem höheren Gewinnen verbunden waren.Tendenziell waren mehr Dienstleistungen in den Gemüseprodukten enthalten,so dass dem höheren Erlös höhere Kosten gegenüber standen.
1.1 ÖKONOMIE 1 41 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Eichenlaubsalat Nüsslisalat Cicorino rot Quelle: SZG –50 –50050 100 150 200 250 300
Eisberg
■
Die Gesamtbruttomarge Gemüse ist im Jahr 2005 seit 2002 erstmals wieder leicht gestiegen;dies bei einem stabilen Einstandspreis.Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2005 betrug 41% des Endverkaufspreises.
Bei den Einzelprodukten,aus welchen sich die Gesamtbruttomarge zusammensetzt, wurde bei Tomaten und Blumenkohl eine steigende,bei Zwiebeln,Karotten und Chicorée eine sinkende und bei Kartoffeln eine stabile Bruttomarge beobachtet.
Die Gesamtbruttomarge Früchte ging im Jahr 2005 um 24 Rp.zurück,während der Einstandspreis um 7 Rp.sank.Der durchschnittliche Einstandspreis des Jahres 2005 betrug 43% des Endverkaufspreises.
Bei den Einzelprodukten der Gesamtbruttomarge wurde mit Ausnahme der Orangen bei allen beobachteten Produkten (Äpfel,Birnen,Aprikosen,Kirschen,Nektarinen,Erdbeeren) ein Rückgang festgestellt.
42 1.1 ÖKONOMIE 1
199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 in Fr./kg
0 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Verkaufspreise Einstandspreise Bruttomarge
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Gemüsen
Quelle:
BLW Berücksichtigtes Gemüse: Tomaten, Blumenkohl, Karotten, Chicorée, Gurken, Zwiebeln und Kartoffeln
199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 in Fr./kg Quelle: BLW 0 5.00 4.50 3.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.50 1.00 0.50 Verkaufspreise Einstandspreise Bruttomarge
Obst:
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Früchten
Berücksichtigtes
Äpfel, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Nektarinen, Erdbeeren und Orangen
Bruttomarge bei Obst wieder zurückgegangen
■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
1.1.3Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART (vgl.Abschnitt 1.1.4).

■ Sektor-Einkommen 2005
Im Jahr 2005 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 2,746 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 2002/04 war es 312 Mio.Fr. oder rund 10% tiefer.Verantwortlich dafür waren einerseits die tiefere Erzeugung (–195 Mio.Fr.oder 1,9%) und die geringeren sonstigen Subventionen (–25 Mio.Fr. oder 0,9%),andererseits die höheren Kosten (Vorleistungen:+45 Mio.Fr.oder 0,7%; Abschreibungen:+48 Mio.Fr.oder 2,5%;Arbeitnehmerentgelt:+51 Mio.Fr.oder +4,3%).Mildernd wirkte sich die Abnahme bei den gezahlten Zinsen (–36 Mio.Fr.oder 10,6%) aus.
Gegenüber dem Jahr 2004 nahm das Nettounternehmenseinkommen um 535 Mio.Fr. ab (–16,3%).Das tiefere Einkommen des Sektors im Jahr 2005 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Abnahme bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs um 664 Mio.Fr.(–6,1%) zurückzuführen.Bedeutend tiefer als im Jahr 2004 waren sowohl die Erträge im Pflanzenbau als auch in der Tierproduktion. Eine Abnahme um 36 Mio.Fr.(–1,3%) verzeichneten auch die sonstigen Subventionen. Auf der Kostenseite nahmen die Vorleistungen um 203 Mio.Fr.(–3,2%) ab.Stabil geblieben sind das Arbeitnehmerentgelt sowie die gezahlten Pachten und Zinsen. Leicht zugenommen haben die Abschreibungen.
43 1.1 ÖKONOMIE 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 ÖKONOMIE 1 44 Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr. 1990/92 2002200320042005 1 2006 2 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs13 87010 38110 11410 95110 28710 009 – Vorleistungen6 6276 0106 0916 4226 2205 996 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen7 2424 3704 0244 5284 0674 013 – Abschreibungen2 0151 9251 9191 9391 9752 004 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen5 2282 4462 1052 5902 0922 010 – sonstige Produktionsabgaben44328335308309311 + sonstige Subventionen (produktunabhängige)8782 7092 6942 7172 6822 687 Faktoreinkommen6 0624 8264 4634 9994 4654 386 – Arbeitnehmerentgelt1 2341 1251 1511 2191 2151 211 Nettobetriebsüberschuss/Selbständigeneinkommen4 8283 7023 3123 7813 2503 175 – gezahlte Pachten193203200200201201 – gezahlte Zinsen553393326299303306 Nettounternehmenseinkommen4 0833 1062 7863 2812 7462 669 1Provisorisch,Stand 13.9.2006 2Schätzung,Stand 13.9.2006 Geringe Abweichungen gegenüber Originaldatenbank des BFS sind wegen Rundung möglich Quelle:BFS
■ Schätzung des SektorEinkommens 2006
Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Sonstige Subventionen Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen) Nettounternehmenseinkommen
Die Schätzung des Produktionswertes der Landwirtschaft liegt 2006 mit 10,009 Mrd.Fr.um 4,2% tiefer als das Dreijahresmittel 2003/05.Der lange Winter und die Sommerhitze beeinträchtigten die pflanzliche Produktion.Die im Vergleich zum Vorjahr tieferen Erträge wurden aber teilweise durch höhere Preise kompensiert.Gegenüber 2005 konnten im tierischen Bereich dank den ausgeglichenen Märkten bei Milch und Rindvieh ähnliche oder höhere Preise erzielt werden.Weniger vorteilhaft waren die Marktverhältnisse in der Schweine- und Geflügelbranche.Beim Geflügel setzte die Vogelgrippe dem Absatz stark zu.Insgesamt wird geschätzt,dass sowohl die pflanzliche als auch die tierische Erzeugung tiefer ausfallen werden als im Dreijahresmittel 2003/05.
Der Wert der pflanzlichen Produktion (4,205 Mrd.Fr.,inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 7,2% tiefer geschätzt.Dieses Ergebnis ist vor allem auf die ungünstigen Wetterverhältnisse zurückzuführen.
Die Getreideernte wird qualitativ gut und mengenmässig leicht besser als die letztjährige Ernte beurteilt.Nur Körnermais dürfte deutlich weniger anfallen als im Jahre 2005. Die frühzeitige Verwendung als Futter wegen der Trockenheit und die tiefen Erträge sind die Gründe dafür.Der Anbau von Futterweizen wurde auf Kosten der backfähigen Weizensorten weiter ausgedehnt.Gegenüber dem Dreijahresmittel 2003/05 wird der Wert der Getreideernte 2006 insgesamt um 5,8 % tiefer veranschlagt.
Die ersten Rübenuntersuchungen deuteten sowohl beim Ertrag als auch beim Zuckergehalt auf tiefere Werte als in den letzten Jahren hin.Die Grundpreise wurden unverändert gelassen.Für Ölsaaten werden trotz guter Nachfrage und weltweit geringerer Ernte nur leicht höhere Preise als im Vorjahr erwartet.Mit Ausnahme von Soja wurde erneut eine grössere Fläche mit Ölsaaten angebaut.Die tieferen Erträge konnten dadurch jedoch nicht aufgefangen werden.Insgesamt wird der Produktionswert der Handelsgewächse im Mehrjahresvergleich 2003/05 um 7,8% tiefer geschätzt.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 45
1990/9220022003200420051 20062 Angaben zu laufenden Preisen in Mio. Fr.
Quelle: BFS 1 Provisorisch, Stand 13.9.2006 2 Schätzung, Stand 13.9.2006 0 12 000 14 000 16 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Tabellen 14–15,Seiten A14–A15
Die Futterpflanzen haben unter der Trockenheit gelitten.Betroffen davon waren der erste und zweite Emd-Schnitt,je nach Region jedoch unterschiedlich.Der Produktionswert der Futterpflanzen wird dieses Jahr 23% unter dem Dreijahresmittel 2003/05 veranschlagt.
Der Gemüsebau hat ebenfalls unter der Trockenheit,der Hitze und einem verspäteten Erntebeginn aufgrund des langen Winters gelitten.Gegenüber dem Vorjahr werden weniger Menge dafür aber höhere Kilopreise erwartet,da die ungünstigen Wetterbedingungen die meisten europäischen Länder trafen.Insgesamt wird unterstellt,dass die höheren Preise die kleinere Ernte kompensieren werden und der Produktionswert ähnlich wie im Jahre 2005 ausfallen wird.
Beim produzierenden Gartenbau ist keine einheitliche Entwicklung zu erwarten.Bei allgemein stabilen Preisen wird bei den Baumschulpflanzen mit einer steigenden Produktion gerechnet.Beim Blumen- und Zierpflanzenanbau hingegen mit einem Rückgang.Insgesamt wird geschätzt,dass der Produktionswert um 3,4% tiefer ausfallen wird als das Dreijahresmittel 2003/05.
Die Anbaufläche der Kartoffeln nahm erneut ab und liegt nun bei 12'094 ha.Die ungünstigen Wetterbedingungen dürften sich auf den Ertrag niederschlagen (24% tiefer als das Dreijahresmittel 2003/05).Qualitätsprobleme könnten den Erlös zusätzlich beeinträchtigen.Der Produktionswert wird 10,4% tiefer als das Dreijahresmittel 2003/05 geschätzt.
Beim Obst kann dieses Jahr von mittleren bis guten Ernten ausgegangen werden.Beim Frischobst dürften die Mengen an Tafelbirnen und -äpfeln mit dem Vorjahr vergleichbar sein.Die Menge an Mostobst wird deutlich höher als im Jahre 2005 geschätzt.Auch bei Beeren und Steinobst dürften die Erträge erfreulich ausfallen,so dass der Wert von Frischobst im Vergleich zum Dreijahresmittel 2003/05 voraussichtlich um 2,1% steigen wird.In der Position Obst sind neben dem Frischobst auch die Weintrauben für den Frischkonsum und die Verarbeitung in Wein ausserhalb des Bereiches Landwirtschaft enthalten.Für 2006 wird mengenmässig eine gute Weintraubenernte erwartet.Der entsprechende Produktionswert dürfte um 9,8% höher ausfallen als das Dreijahresmittel 2003/05.Insgesamt wird angenommen,dass der Produktionswert beim Obst 5,3% über dem Dreijahresmittel 2003/05 zu liegen kommt.
Der Produktionswert des Weins beruht teilweise auf den Veränderungen der Vorräte der beiden Vorjahre.Nach einer kleinen Ernte 2005 wird für das Jahr 2006 mit höheren Erträgen gerechnet.Dazu kommt,dass das Preisniveau höher ist als im Dreijahresdurchschnitt 2003/05 und der Anteil der Kelterei von eigenen Weintrauben weiter zugenommen hat.Der Produktionswert Wein wird deshalb 11,7% höher eingeschätzt als das Dreijahresmittel 2003/05.
1.1 ÖKONOMIE 1 46
Der Wert der tierischen Produktion (4,879 Mrd.Fr.) wird im Vergleich zum Dreijahresmittel 2003/05 um 2,5% tiefer geschätzt.Der Rindviehmarkt konnte dank einem ausgeglichenen Angebot von guten Preisen profitieren.Die Schlachtkälber blieben nach wie vor knapp,so dass die guten Vorjahrespreise meist noch übertroffen wurden. Für 2006 wird beim Rindvieh mit einem um 6,3% höheren Produktionswert gegenüber dem Dreijahresmittel 2003/05 gerechnet.Bei den Schweinen dürfte im Vergleich zum Vorjahr mehr geschlachtet werden.Dies geht einher mit tieferen Produzentenpreisen. Die Schätzungen gehen von einem Rückgang des Produktionswertes um 6,9% gegenüber den drei Vergleichsjahren 2003/05 aus.Eine schwierige Zeit macht die inländische Geflügelproduktion durch.Der Produktionswert dürfte 11,7% tiefer sein als im Dreijahresmittel 2003/05.Bei den Eiern ist sowohl bei den Preisen als auch bei der Produktion eine stabile Situation zu verzeichnen.Der Produktionswert dürfte gegenüber 2003/05 nur leicht zurückgehen.Der Produktionswert der Milch dürfte 3,6% tiefer sein als in den Jahren 2003/05.Dies ist auf tiefere Produzentenpreise zurückzuführen.

Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen (638 Mio.Fr.) dürfte im Vergleich zu 2003/05 um 1,4% tiefer ausfallen.Da rund zwei Drittel der Milchproduzenten per 1.Mai 2006 aus der Milchkontingentierung ausgestiegen sind,wird mit einer starken Abnahme der verpachteten Milchkontingente gerechnet.Hingegen wird geschätzt,dass der Wert der landwirtschaftlichen Dienstleistungen (Lohnarbeiten,z.B. Saat und Ernte) weiter zunimmt.
Der Wert der nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten dürfte gegenüber dem Dreijahresmittel um 6,6% auf 287 Mio.Fr.ansteigen.Eine positive Entwicklung wird bei allen Tätigkeiten erwartet,so bei der Verarbeitung von Mostobst,von Fleisch und von Milch,bei den Dienstleistungen ausserhalb der landwirtschaftlichen Branche wie Strassenrand- und Landschaftspflege,bei der Haltung von Pensionstieren (Pferde) und bei den Übernachtungen von Touristen (z.B.Schlafen im Stroh).
Die Aufwendungen für Vorleistungen werden für 2006 auf 5,996 Mrd.Fr.veranschlagt,was 4,0% tiefer ist als der Dreijahresdurchschnitt 2003/05.Die Futtermittelaufwendungen dürften insgesamt deutlich tiefer als in den Vorjahren zu liegen kommen.Grund dafür ist die gegenüber den Vorjahren deutlich tiefere Einschätzung der innerbetrieblich erzeugten und verbrauchten Futtermittel (Gegenbuchung aus dem Produktionskonto).Die Ausgaben für die aus der Futtermittelindustrie zugekauften Futtermittel dürften anderseits leicht höher ausfallen,obwohl die Mischfutterpreise weiter gesunken sind.Es wird jedoch als Folge der tiefen Raufutterproduktion und der höheren Schweinebestände mit einem höheren Einsatz von Kraftfuttermitteln gerechnet.Zusätzlich dürften auch die Raufutterimporte zulegen.Weiter zunehmen dürften die Energiekosten.Dies ist einerseits preisbedingt,anderseits hat der lange Winter und die Bewässerung im Sommer als Folge der Trockenheit zusätzlichen Energiebedarf verursacht.Die Preissteigerungen beim Erdöl haben auch die Düngerpreise und in beschränktem Ausmass die Pflanzenschutzmittelpreise beeinflusst.Die Lohnerhöhungen in den sekundären und tertiären Wirtschaftssektoren haben u.a.den Unterhalt von Maschinen und Gebäuden verteuert.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.1 ÖKONOMIE 1 47
Bei der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (4,013 Mrd.Fr.) wird mit einer Abnahme um 4,6% gegenüber dem Dreijahresmittel 2003/05 gerechnet.Die tieferen Aufwendungen für Vorleistungen können den niedrigen Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches nicht kompensieren.
Die Abschreibungen (2,004 Mrd.Fr.) werden 2006 gegenüber dem Dreijahresmittel 2003/05 um 3,0% höher geschätzt.Zugenommen haben vor allem die Abschreibungen bei den Bauten.Dies ist vor allem auf die markant gestiegenen Baupreise zurückzuführen.Die Abschreibungen für Ausrüstungen (Fahrzeuge und Maschinen) steigen dagegen nur leicht.Volumenmässig wurde in diesem Bereich weniger investiert,dafür zu höheren Preisen.
Die sonstigen Produktionsabgaben dürften gegenüber den Jahren 2003/05 um 1,9% abnehmen.Die übrigen Produktionsabgaben (Motorfahrzeugsteuer,Grundsteuern und Stempelgebühr) dürften stagnieren während bei der Unterkompensation der Mehrwertsteuer (abhängig von Vorleistungs- und Investitionsausgaben) ein Rückgang geschätzt wird.
Die sonstigen Subventionen beinhalten alle Direktzahlungen,den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite,Betriebshilfe) und die übrigen kantonalen und von Gemeinden erbrachten Beiträge.Nicht Bestandteil sind die Gütersubventionen,welche bereits im Produktionswert berücksichtigt wurden (z.B. Anbauprämien und Zulagen für silagefreie Fütterung bei der Milch).Zusätzlich enthalten sie auch die Überkompensation der Mehrwertsteuer,welche für 2006 auf 119 Mio.Fr.geschätzt wird.Mit voraussichtlich 2,687 Mrd.Fr.(2,568 Mrd.Fr.ohne die Überkompensation der Mehrwertsteuer) dürften die sonstigen Subventionen gegenüber dem Dreijahresmittel 2003/05 um 0,4% tiefer zu liegen kommen.
Das Arbeitnehmerentgelt (= Angestelltenkosten) wird auf 1,211 Mrd.Fr.geschätzt, was einer Zunahme um 1,4% gegenüber den drei Jahren 2003/05 entspricht.Der Rückgang von Angestellten in der Landwirtschaft dürfte durch den Anstieg der Lohnkosten (inkl.Sozialbeiträge der Arbeitgeber) mehr als wettgemacht werden.
Die gezahlten Pachten dürften gegenüber dem Dreijahresmittel mit 0,2% nur sehr leicht zunehmen.Sie betragen seit Jahren um die 200 Mio.Fr.Die gezahlten Schuldzinsen (306 Mio.Fr.) dürften gegenüber dem Dreijahresmittel 2003/05 um 1,3% sinken, was zum grossen Teil auf die Senkung der Hypothekarzinssätze zurückzuführen ist.
Als Nettounternehmenseinkommen verbleiben 2,669 Mrd.Fr.Dies ist 9,2% weniger als im Durchschnitt der Jahre 2003/05.Gegenüber 2005 würde das Nettounternehmenseinkommen 2006 aber nur um 2,8% zurückgehen.
48 1.1 ÖKONOMIE 1
1.1.4Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren wie z.B.zur finanziellen Stabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe.Im Tabellenanhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt.Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen.

■■■■■■■■■■■■■■■■
Begriffe und Methoden,Seite A64 49 1.1 ÖKONOMIE 1
■ Landwirtschaftliches Einkommen 2005 tiefer als 2002/04
Einkommen und betriebswirtschaftliche Kennziffern
Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel aller Regionen
Der Rohertrag aus landwirtschaftlicher Produktion nahm im Jahr 2005 gegenüber dem Mittel der Jahre 2002/04 um 3% zu.Im Vorjahresvergleich lag er hingegen 2% tiefer. Die Direktzahlungen pro Betrieb nahmen gegenüber den drei Vorjahren im Durchschnitt der Betriebe um 4% zu.Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Zunahme rund 3%. Dies ist die Folge der weiterhin steigenden Beteiligung bei den Öko- und Ethoprogrammen wie BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung),RAUS (Regelmässiger Auslauf im Freien) und regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen.
Die Fremdkosten lagen im Jahr 2005 um 5,4% über dem Dreijahreswert 2002/04. Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um 1,2%.Zugenommen haben insbesondere die Kosten für das Personal,die Gebäude und den Treibstoff in Folge der stark gestiegenen Treibstoffpreise.Die Kosten für zugekauftes oder zugemietetes Milchkontingent nehmen immer noch zu.Grössere Einsparungen realisierten die Betriebe lediglich bei den Futtermitteln.Dies liegt einerseits daran,dass dank zwei guten Raufutterjahren 2004/05 weniger Futter zugekauft wurde und andererseits die Futtermittelpreise zurückgingen.
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten.Es entschädigt einerseits die Arbeit der durchschnittlich 1,24 Familienarbeitskräfte und andererseits das im Betrieb durchschnittlich investierte Eigenkapital von rund 410'000 Fr.Im Jahr 2005 lag es 2,5% unter dem Mittelwert der Jahre 2002/04 und 10,2% unter dem Vorjahreswert.
Tabellen 16–25,Seiten A16–A26
Fr. pro Betrieb Ausserlandwirtschaftliches Einkommen Landwirtschaftliches Einkommen Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheiten 21 557 60 472 1,25 22 172 54 274 1,24 18 577 51 500 1,28 21 210 55 029 1,24 50 1.1 ÖKONOMIE 1
1990/9220042005 20022003
Das landwirtschaftliche Einkommen war 2005 gegenüber 2002/04 in der Tal- und Hügelregion um 6% bzw.2% tiefer,in der Bergregion jedoch um 5% höher.Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen nahm in allen Regionen zu,in der Talregion um 12%,in der Hügelregion um 11% und in der Bergregion um 2%.Das Gesamteinkommen stieg in der Bergregion (+4%) und in der Hügelregion (+1%),sank aber in der Talregion (–2%).
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Regionen
Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2005 17% in der Talregion,25% in der Hügelregion und 38% in der Bergregion.Damit stieg der Anteil in der Tal- und Hügelregion gegenüber 2002/04 leicht,während er in der Bergregion etwas abnahm.
Einkommen nach RegionEinheit1990/9220022003200420052002/04–2005 % Talregion Landwirtschaftliche Nutzflächeha16,6620,6819,7920,0720,642,3 FamilienarbeitskräfteFJAE1,361,251,191,211,19–2,2 Landwirtschaftliches EinkommenFr.73 79463 40264 12972 61562 696–6,0 Ausserlandw.EinkommenFr.16 42916 74320 64220 53221 53111,5 GesamteinkommenFr.90 22380 14584 77193 14684 227–2,1 Hügelregion Landwirtschaftliche Nutzflächeha15,3018,0918,4818,5218,923,0 FamilienarbeitskräfteFJAE1,401,241,261,231,23–1,1 Landwirtschaftliches EinkommenFr.59 83846 25751 44254 74249 627–2,3 Ausserlandw.EinkommenFr.14 54419 36921 67122 16723 27710,5 GesamteinkommenFr.74 38265 62673 11476 90972 9041,4 Bergregion Landwirtschaftliche Nutzflächeha15,7618,5518,6018,6319,092,7 FamilienarbeitskräfteFJAE1,421,351,311,331,340,8 Landwirtschaftliches EinkommenFr.45 54137 51243 92146 10944 8075,4 Ausserlandw.EinkommenFr.17 85320 74821 66222 64522 1512,1 GesamteinkommenFr.63 39458 26065 58368 75466 9584,3 Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
51 1.1 ÖKONOMIE 1 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Tabellen 16–19,Seiten A16–A19
Die Einkommenssituation der 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) weist erhebliche Differenzen auf.
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2003/05
BetriebstypLandw.Familien- Landw.Ausserlandw.GesamtNutzflächearbeits-EinkommenEinkommeneinkommen kräfte
Im Durchschnitt der Jahre 2003/05 erzielten die Betriebstypen Spezialkulturen, Ackerbau,Veredlung und bestimmte kombinierte Betriebe (Veredlung,Verkehrsmilch/ Ackerbau) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen.Diese erwirtschafteten zusammen mit dem Betriebstyp kombiniert Mutterkühe auch die höchsten Gesamteinkommen.Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen anderes Rindvieh und Pferde/Schafe/Ziegen.Dazwischen liegen die spezialisierten Verkehrsmilchbetriebe.Ihre Ergebnisse sind in allen Einkommenskategorien unterdurchschnittlich.
haFJAEFr.Fr.Fr. Mittel alle Betriebe19,371,2456 59221 64678 238 Ackerbau22,220,9963 35728 36391 720 Spezialkulturen13,181,2567 52622 75390 279 Verkehrsmilch19,451,3253 33618 41471 750 Mutterkühe18,981,1145 75232 04877 800 Anderes Rindvieh16,531,2536 81825 90662 724 Pferde/Schafe/Ziegen12,441,1724 31439 06463 378 Veredlung11,521,2361 95323 10485 057 Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau26,021,2770 51014 67185 182 Kombiniert Mutterkühe22,631,0752 68832 87785 565 Kombiniert Veredlung19,621,2572 51817 01789 535 Kombiniert Andere21,181,2458 05521 81779 872 Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
52 1.1 ÖKONOMIE 1
Tabellen 20a–20b,Seiten A20–A21
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte.Gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 verbesserte sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) im Jahr 2005 um 4%.Im Vergleich zum Jahr 2004 ging er aber um 8% zurück.Damit sank der Arbeitsverdienst etwas weniger stark als das landwirtschaftliche Einkommen.Dies liegt einerseits am Zinsanspruch,der trotz höherem Eigenkapital zurückging (tieferes Zinsniveau der Bundesobligationen).Andererseits wurden auch etwas weniger Familienarbeitskräfte eingesetzt.
Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich.Im Durchschnitt liegt er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion.Auch die Quartile liegen weit auseinander.So erreichte 2003/05 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 26% und derjenige im vierten Quartil 197% des Mittelwertes aller Betriebe der Region.In der Hügelregion war die Streuungsbandbreite ähnlich (21% und 195%) und im Berggebiet noch extremer (11% und 207%).
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 2003/05: nach Regionen und Quartilen

Arbeitsverdienst
FJAE 2 MedianMittelwerte Region1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Talregion44 141 12 069 35 501 52 959 90 745 Hügelregion32 345 7 324 25 699 39 649 67 144 Bergregion25 682 3 128 19 742 32 098 56 455 1Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen:2003:2,63%,2004:2,73%,2005 2,11% 2Familien-Jahresarbeitseinheiten:Basis 280 Arbeitstage Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1 in Fr.pro
Tabellen 21–24,Seiten A22–A25 53
■ 1.1
Arbeitsverdienst 2005 ÖKONOMIE
1
In der Tal- und Hügelregion übertraf 2003/05 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe im Durchschnitt den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung um über 22'000 Fr.resp.4'000 Fr.In der Bergregion erreichte in diesem Zeitraum das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe knapp das Niveau des entsprechenden Vergleichslohns.Im Vergleich zur Periode 2002/04 hat vor allem die Hügelregion ihre relative Situation verbessert.
Vergleichslohn 2003/05,nach Regionen
RegionVergleichslohn 1
Fr.pro Jahr
Talregion68 266
Hügelregion62 836
Bergregion57 521
Quellen:BFS,Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Zu berücksichtigen gilt,dass die landwirtschaftlichen Haushalte ihren Lebensunterhalt nicht nur aus dem Arbeitsverdienst bestreiten.Ihr Gesamteinkommen,einschliesslich der ausserlandwirtschaftlichen Einkommen,liegt wesentlich höher als der Arbeitsverdienst.
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens.Kombiniert man diese Kennzahl mit der Grösse der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen.Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält –finanziell nicht existenzfähig.
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt.
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit …
Fremdkapitalquote
Tief (<50%)Hoch (>50%)
EigenkapitalbildungPositiv...guter...beschränkter finanfinanzieller Situationzieller Selbständigkeit
Negativ...ungenügendem ...bedenklicher
Einkommenfinanzieller Situation
Quelle:De Rosa
1Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten
54 1.1 ÖKONOMIE 1
■ Finanzielle Stabilität
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild.44% der Betriebe befinden sich in einer finanziell guten Situation und 32% sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung).Das Dreijahresmittel 2003/05 präsentiert sich damit in allen Regionen etwas besser als 2002/04.
Beurteilung der finanziellen Stabilität 2003/05 nach Regionen

Talregion Hügelregion Bergregion Anteil Betriebe in % bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle Situation Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 16 17 23 44 16 15 26 43 13 19 21 46 1.1 ÖKONOMIE 1 55
■ Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
Die Investitionen der ART-Referenzbetriebe haben im Jahr 2005 im Vergleich zu 2002/04 leicht abgenommen (–0,4%).Gleichzeitig sank auch der Cashflow (–6%). Daraus resultiert eine Abnahme beim Cashflow-Investitionsverhältnis um 6%.Die Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen minus Privatverbrauch) war deutlich tiefer als in der Referenzperiode (–20%) und die Fremdkapitalquote praktisch gleich hoch.
Entwicklung von Eigenkapitalbildung,Investitionen und Fremdkapitalquote
1 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2 Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Merkmal1990/9220022003200420052002/04–2005 % EigenkapitalbildungFr.19 5136 84013 34315 5909 493–20,4 Investitionen 1 Fr.46 91443 69547 58051 26147 336–0,4 Cashflow-Investitionsverhältnis 2 %9594959188–5,7 Fremdkapitalquote%43414344430,8
Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1.1 ÖKONOMIE 1 56
Die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft setzt sich aus folgenden drei Bereichen zusammen:

–Gesamteinkommen und Privatverbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte, –Bestandesaufnahme bei zentralen sozialen Themen sowie –Studien zu sozialen Fragestellungen.
Im vorliegenden Agrarbericht werden die Einkommen und der Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART dargestellt.Im Rahmen der Bestandesaufnahme bei zentralen sozialen Themen werden die Leistungen der Sozialversicherungen aufgezeigt.Die diesjährige Studie befasst sich mit Fragestellungen rund um die Thematik «Bäuerinnen und Bauern im Pensionsalter».
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.2 Soziales
1.2 SOZIALES 1 57
1.2.1Einkommen und Verbrauch
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Bauernfamilien sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen.Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem als Mass für die Leistungsfähigkeit der Betriebe. Bei der sozialen Dimension steht die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte im Vordergrund.Daher wird das ausserlandwirtschaftliche Einkommen der Bauernfamilien ebenfalls mit in die Analyse einbezogen.Untersucht werden dabei sowohl das Gesamteinkommen als auch die Entwicklung des Privatverbrauchs.
Das Gesamteinkommen,das sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen zusammensetzt,lag im Durchschnitt der Jahre 2003/05 je nach Region zwischen 67’100 und 87’400 Fr.pro Haushalt:Die Haushalte der Bergregion erreichten etwa 77% des Gesamteinkommens der Haushalte der Talregion.Mit durchschnittlichen ausserlandwirtschaftlichen Einkommen von 20’900 bis 22’400 Fr. hatten die Bauernfamilien eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle:Diese machte bei den Haushalten der Talregion 24% des Gesamteinkommens aus,bei jenen der Hügelregion 30% und bei denjenigen der Bergregion 33%.Die Haushalte der Hügelregion wiesen mit 22’400 Fr.absolut die höchsten ausserlandwirtschaftlichen Einkommen aus.
Einkommen
Einkommen Quelle: Zentrale Auswertung, Agroscope Reckenholz-Tänikon
Die Eigenkapitalbildung – der nicht konsumierte Teil des Gesamteinkommens – macht in allen Regionen durchschnittlich rund 16% des Gesamteinkommens aus.Der Privatverbrauch liegt jeweils über der Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens.Er ist entsprechend der Höhe des Gesamteinkommens bei den Haushalten der Talregion absolut am höchsten und bei jenen der Bergregion am tiefsten.
Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Haushalt lag 2005 mit rund 76’500 Fr. etwas über jenem der Jahre 2002/04 mit 76’100 Fr.Ebenso hat der Privatverbrauch pro Haushalt im Jahr 2005 im Vergleich zu 2002/04 um etwa 2’800 Fr.zugenommen und lag bei knapp 67’000 Fr.
1.2 SOZIALES 1 58 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Gesamteinkommen und Privatverbrauch
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Betrieb 2003/05
in Fr. Privatverbrauch Ausserlandwirtschaftliches
ART 0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Talregion Hügelregion Bergregion
Landwirtschaftliches
1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.QuartilAlle
1 Quartile nach Arbeitsverdienst je Familien-Jahresarbeitseinheit
2 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr Quelle:Zentrale Auswertung,Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Die Haushalte des ersten Quartils erreichten 43% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Haushalten des vierten Quartils.Beim Privatverbrauch war die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer:Er lag bei den Haushalten des ersten Quartils bei 68% des Verbrauchs der Haushalte des vierten Quartils.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte 2003/05 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken.Die Eigenkapitalbildung war negativ.Zehren diese Betriebe längerfristig von der Substanz,so müssen sie früher oder später aufgegeben werden.In den übrigen Quartilen war der Privatverbrauch geringer als das Gesamteinkommen:Er lag bei den Betrieben des zweiten Quartils bei 91% des Gesamteinkommens,bei den Betrieben des dritten Quartils bei 82% und bei den Betrieben des vierten Quartils bei 69%
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit war 2005 in allen Quartilen im Vergleich zu den drei Vorjahren 2002/04 höher.Auch der Privatverbrauch hat im Jahr 2005 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2002/04 in allen Quartilen zugenommen.

1.2 SOZIALES 1 59
und Privatverbrauch
Verbrauchereinheit nach Quartil 1 2003/05
Gesamteinkommen
pro
Betriebe Gesamteinkommen pro VE 2 (Fr.)14 48218 49323 16134 00322 441 Privatverbrauch pro VE (Fr.)16 02716 80418 91423 53418 778
■ Die Alters- und Hinterlassenenversicherung
AHV
1.2.2Leistungen der Sozialversicherungen
Der Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit als Landwirt oder Bäuerin und dem Anspruch auf Leistungen der Sozialversicherungen ist eines der zentralen sozialen Themen,zu welchen periodisch Bericht erstattet wird – erstmals im Agrarbericht 2000. Die staatlichen Sozialwerke und Personenversicherungen einerseits sowie Sachversicherungen und private Institutionen anderseits sind sowohl für die bäuerliche als auch für die nicht-bäuerliche Bevölkerung Teil des formalen Sicherheitsnetzes.Ein Vergleich der Versicherungsleistungen,die an die beiden Bevölkerungsgruppen ausgerichtet werden,zeigt die grosse Bedeutung wie auch die Unterschiede bei deren Inanspruchnahme.
Die staatlichen Sozialwerke
Die 1948 eingeführte AHV-Rente ist abhängig vom beitragspflichtigen Einkommen in der aktiven Zeit sowie von allfälligen Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.
Aus der AHV-Einkommensstatistik für das Jahr 2001 ergibt sich,dass unter den insgesamt 4’716’709 Beitragszahlern 28’182 selbständige Landwirte figurieren,davon 1’898 Frauen,die keine weitere beitragspflichtige Erwerbstätigkeit hatten.31’935 selbständige Landwirte – davon 1’482 Frauen – gingen zusätzlich einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach.
AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen 2001,in Fr.
Selbständige Landwirtinnen und Landwirte40 592
Landwirtinnen und Landwirte,die gleichzeitig als Arbeitnehmer beschäftigt sind,beziehen im Alter im Mittel Renten,die nur leicht unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen,während bei ausschliesslich selbständigen Landwirtinnen und Landwirten unterdurchschnittliche Rentenbezüge vorliegen.
Der selbständige Rentenanspruch der Bäuerin (Vor-Splitting) ist meistens sehr gering. Sofern die Bäuerin nicht ein ausserbetriebliches Einkommen erwirbt,hat sie kein AHVrechtliches Einkommen;das ganze AHV-Einkommen wird dem Mann gutgeschrieben. Mit der Einführung von Erziehungs- und Betreuungsgutschriften hat sich die Situation der Bäuerin jedoch verbessert.Es ist möglich geworden,der mitarbeitenden Ehefrau ein Erwerbseinkommen auszuzahlen,bzw.wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, die Bäuerin als Selbständigerwerbende mit eigenem Einkommen zu deklarieren –genaue Zahlen sind hierzu nicht bekannt.
1.2 SOZIALES 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Andere Selbständigerwerbende67 638 Landwirtinnen und Landwirte mit Nebenerwerb57 360 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer58 852
Quelle:BSV
60
■ Die Invalidenversicherung IV
Die degressive Beitragsskala hat,infolge der tiefen AHV-Einkommen,welche in der Landwirtschaft erwirtschaftet werden,eine besondere Bedeutung.Das durchschnittliche AHV-Einkommen der selbständigen Bauern betrug 2001 rund 40’600 Fr.Vereinfacht gerechnet resultiert daraus ein AHV/IV/EO Beitragssatz von 7,917% anstelle eines Beitragssatzes von 9,5% ohne degressive Skala und damit eine jährliche Prämienreduktion von durchschnittlich 641 Fr.pro Betrieb.
Hauptanliegen der IV ist die Wiedereingliederung und damit die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit.
2001 wurden von den 28’182 Landwirtinnen und Landwirten,welche ausschliesslich in der Landwirtschaft tätig waren,1’852 Personen zu Bezüger einer IV-Rente.Diese Anzahl entspricht 6,6%.Im Vergleich hierzu lag 2001 die Wahrscheinlichkeit,eine IVRente zu beziehen,gesamtschweizerisch bei 4,6%.Der hohe prozentuale Anteil der IVRentner aus dem Bereich Landwirtschaft weist u.a.auf die Schwere und Gefährlichkeit der Arbeit der in diesem Sektor tätigen Personen hin.
■ Die Ergänzungsleistungen
Die Ergänzungsleistungen werden an Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger der AHV oder IV ausgerichtet,wenn diese Renten den Existenzbedarf nicht decken.Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen für Personen,denen ein Landwirtschaftsbetrieb gehört hat oder noch gehört,ist in der Regel entscheidend,wie hoch das Nettovermögen ist und wie die vermögensrechtliche Übergabe (Wohnrecht,Verzicht etc.) erfolgte.Besondere Kennzahlen zur Ausrichtung von Ergänzungsleistungen in der Landwirtschaft liegen nicht vor,verschiedene Studien (u.a.Wicki und Pfister 2000) zeigen jedoch,dass Bauern und Bäuerinnen ganz allgemein auf Sozialämtern untervertreten sind.
■ Die Familienzulagen
Die Familienzulagen in der Landwirtschaft haben eine familienpolitische Zielsetzung: Bauernfamilien mit Kindern,die nur über ein bescheidenes Einkommen verfügen, sollen unterstützt werden.Die Ausrichtung von Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer/innen sowie an Berg- und Kleinbauern wird durch bundesrechtliche Vorschriften geregelt.Dabei liegt die Einkommensgrenze bei 30'000 Fr.zuzüglich 5'000 Fr.je zulageberechtigtes Kind.Für die Gewährung von Familienzulagen an Arbeitnehmer ausserhalb der Landwirtschaft sind dagegen die gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Kantone massgebend.Nach dem Bundesgesetz werden Familienzulagen in Form von Kinder- und Haushaltungszulagen gewährt.
1.2 SOZIALES 1
61
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Haushalt- und Kinderzulagen (Stand 1.1.2006)
Haushaltszulage an landwirtschaftliche Arbeitnehmer je Monat100 Fr.
Kinderzulage pro Kind Talgebiet175 Fr.für die ersten zwei Kinder je Monat180 Fr.ab dem dritten Kind
Berggebiet195 Fr.für die ersten beiden Kinder 200 Fr.ab dem dritten Kind
Gliederung der Familienzulagen:Jahresrechnung 2005
ErtragMio.Fr.AufwandMio.Fr.
Beiträge Arbeitgeber12,6Geldleistungen121,7
Beiträge öffentliche Hand112,2Verwaltungskosten3,1
davon Bund 2⁄3 74,8 + Entlastungsbeitrag1,4
– Total Kosten Bund76,2
– davon 1⁄3 Kantone36,0
Total Ertrag124,8Total Aufwand124,8
Quelle:BSV
Die im Rahmen der AP 2011 vorgesehenen Anpassungen zugunsten der bäuerlichen Familienbetriebe umfassen die Aufhebung der Einkommensgrenze für die selbständigen Landwirte und die Erhöhung der Ansätze für Kinderzulagen:Es wird eine Heraufsetzung der Ansätze um 15 Fr.pro Monat vorgeschlagen;diese würden somit 190 Fr. im Talgebiet und 210 Fr.pro Kind und Monat im Berggebiet betragen.Auf den bisher um 5 Fr.höheren Ansatz ab dem dritten Kind soll verzichtet werden.
Am 24.März 2006 haben die Eidgenössischen Räte ein neues Bundesgesetz über die Familienzulagen verabschiedet.Dieses sieht einen Anspruch aller Arbeitnehmenden auf Kinderzulagen von mindestens 200 Fr.und auf Ausbildungszulagen von mindestens 250 Fr.pro Kind und Monat vor.Die Beschäftigten in der Landwirtschaft würden somit ab Inkrafttreten Kinder- und Ausbildungszulagen nach diesen neuen Ansätzen erhalten,wobei wie bis anhin im Berggebiet um 20 Fr.höhere Ansätze ausgerichtet würden.Das Referendum gegen dieses neue Gesetz wurde ergriffen und ist im Sommer zu Stande gekommen,darüber abgestimmt wird Ende November.
1.2 SOZIALES 1
62
■ Sozialhilfeleistungen
Wegen der engen Verflechtung von Betrieb und Privathaushalt besteht eine hohe Flexibilität bezüglich Einsatz von Arbeit und Finanzen.Bäuerinnen und Bauern sind u.a.deshalb auf Sozialdiensten untervertreten:Der Gürtel wird in finanziell schwierigen Zeiten enger geschnallt und sie leben «von der Substanz».Auch die Angst vor einer Stigmatisierung als Sozialhilfebezüger ist nach wie vor gross.
Die ersten Ergebnisse der gesamtschweizerischen Sozialhilfestatistik liegen zwar vor, eine repräsentative Auswertung nach Berufskategorie ist jedoch noch nicht möglich.
■ Weitere Versicherungen

Mit dem Erwerbsersatz soll der Verdienstausfall für Zeiten,in welchen die Versicherten in der Armee oder im Zivildienst sind,entschädigt werden:Es soll verhindert werden,dass Bauernbetriebe aufgrund der Dienstpflicht ihrer Mitarbeiter in Schwierigkeiten geraten.Deshalb werden Betriebszulagen an mitarbeitende Familienmitglieder ausgerichtet.Mit dieser Sonderregelung wird die Landwirtschaft – im Vergleich mit anderen Branchen,in denen Familienunternehmen tätig sind – privilegiert behandelt. Mit der Revision des Erwerbsersatzgesetzes trat per 1.Juli 2005 die Mutterschaftsversicherung in Kraft.Anspruchsberechtigten,das heisst vor der Geburt erwerbstätigen Müttern,wird während 14 Wochen eine Erwerbsersatzentschädigung gewährt. Diese Grundsatzentschädigung beträgt 80% des Einkommens,welches vor dem Erwerbsausfall erzielt wurde.Zahlen über die Inanspruchnahme von Frauen in der Landwirtschaft liegen noch nicht vor.
Das Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung will AHV-pflichtige Arbeitnehmende eine angemessene Erwerbsausfallentschädigung garantieren,wenn sie durch Arbeitslosigkeit,Kurzarbeit,schlechtes Wetter oder bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers betroffen sind.Da Selbständigerwerbende generell nicht versichert sind,können auch selbständige Landwirte keine Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung ableiten.Von der Versicherung ausgenommen sind ebenfalls die mitarbeitenden Familienmitglieder,die den selbständigen Landwirten gleichgestellt sind.Relevant ist diese Versicherung daher nur bei einer Tätigkeit im Nebenerwerb.Überdies können landwirtschaftliche Betriebe – im Gegensatz zu anderen wetterabhängigen Gewerbebetrieben – nicht von der Schlechtwetterentschädigung profitieren.
Die Militärversicherung will im Militär-,Zivil- oder Zivilschutzdienst stehende Personen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Gesundheitsschäden,die sich im Dienst ereignen,schützen.Die Militärversicherung kennt für Selbständigerwerbende –und damit auch für die selbständigen Landwirte – besondere Entschädigungen.
1.2 SOZIALES 1
63
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Die Personenversicherungen
Die Krankenversicherung umfasst die obligatorische Krankenpflegeversicherung (bei Krankheit;Unfall,soweit dafür keine Unfallversicherung aufkommt und Mutterschaft) sowie eine freiwillige Taggeldversicherung.Die meisten Landwirte sind für die Grundversicherung und eine Zusatzversicherung für ergänzende Leistungen im ambulanten Bereich,und für die allgemeine Spitalabteilung versichert.
Der Schadenverlauf bei einer Krankenkasse,deren Mitgliederbestand vorwiegend aus der Landwirtschaft stammt – Zusatzversicherungen und Taggeldlösungen sind hier Bauernfamilien vorbehalten – zeigt,dass die Inanspruchnahme der bäuerlichen Bevölkerung von Leistungen der Krankenversicherung unterdurchschnittlich ist.Dies wirkt sich auf die Prämien aus.Landwirte dürften zudem tendenziell eher in den kostengünstigeren Regionen prämienpflichtig sein.Die Prämienverbilligungssysteme vieler Kantone benachteiligen die Selbständigerwerbenden durch die Festsetzung der Vermögenslimiten:Gerade die Bauern mit kleinen Einkommen sind darauf angewiesen,ihr Vermögen in den Betrieb zu investieren,wo es als steuerbares Vermögen in Erscheinung tritt.Viele Landwirte erhalten aus diesem Grunde trotz tiefem Einkommen keine Prämienverbilligung.
Die Unfallversicherung ist eine Versicherung für alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen von Berufsund Nichtberufsunfällen sowie Berufskrankheiten.Die selbständigerwerbenden Landwirte und ihre mitarbeitenden Familienangehörigen unterstehen nicht obligatorisch den Vorschriften des Gesetzes über die Unfallversicherung.

1.2 SOZIALES 1
64
■ Die Kranken- und Unfallversicherung
Jene Landwirte und Bäuerinnen ohne Nebenerwerb,das heisst welche nicht obligatorisch durch einen Arbeitgeber versichert sind,sind bei der Krankenkasse auch gegen Unfall versichert.Das Unfallrisiko in der Landwirtschaft ist zwar höher als in anderen Sektoren der Wirtschaft,hingegen sind die Nichtberufsunfälle weit weniger häufig und damit diese Kosten tiefer.Bei einer bäuerlichen Krankenkasse liegt der Anteil für Unfallkosten an allen Leistungen bei unter 10%.
Für Arbeitnehmer soll im Alter durch die berufliche Vorsorge,die Säule 2a,zusammen mit den AHV-Leistungen ein Ersatzeinkommen garantiert werden,das die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung ermöglicht.Selbständigerwerbende und ihre mitarbeitenden Familienmitglieder unterstehen nicht der obligatorischen beruflichen Vorsorge.Im Rahmen der weitergehenden beruflichen Vorsorge (Säule 2b) haben die Bauern und Bäuerinnen die Möglichkeit,der Vorsorgestiftung der schweizerischen Landwirtschaft (VSTL) beizutreten:2004 schlossen dabei rund 19'000 Bäuerinnen und Bauern solche Risiko- oder Sparversicherungen ab.
Von allen Personen,welche im Jahr 2001 in der Landwirtschaft tätig waren,gingen 53% einer nebenberuflichen Tätigkeit nach.Meist war dies eine Tätigkeit als Arbeitnehmer.Bei den Männern mit gemischter Tätigkeit betrug das durchschnittliche jährliche Einkommen 58'342 Fr.,bei den Frauen 36'312 Fr.Diese Angaben über das AHV-pflichtige Einkommen lassen sich zwar nach selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit aufschlüsseln,ein rein rechnerischer Durchschnitt lässt jedoch keinen Rückschluss darauf zu,wie viele Landwirtinnen und Landwirte mit zusätzlicher unselbständiger Tätigkeit effektiv dem Gesetzesobligatorium unterstehen – gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge lag die Grenze des Einkommens aus einer unselbständigen Erwerbstätigkeit im Jahre 2001 bei 24'720 Fr.Es ist zu vermuten,dass der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Personen,welche im Alter,bei Invalidität oder Todesfall aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge keinen oder nur einen sehr geringen Versicherungsschutz hat,trotz relativ häufiger unselbstständiger Arbeitstätigkeit sehr hoch sein dürfte.
Die private Vorsorge unterteilt sich in die gebundene (Säule 3a) und die freie Vorsorge (Säule 3b),in Form von Risikoversicherungen,Sparversicherungen resp.gemischten Versicherungen.Die Säule 3a wird durch den Bund mittels Massnahmen in der Steuerpolitik und der Wohneigentumsförderung unterstützt.Sie geniesst diverse steuerliche Vorteile.Die Säule 3b umfasst alle Ersparnisse,Obligationen,Wohneigentum usw.Über das angesparte Kapital kann jederzeit frei verfügt werden.Im Unterschied zur gebundenen Vorsorge geniesst die freie Vorsorge grundsätzlich keine Steuerprivilegien.Allerdings sind kapitalbildende Lebensversicherungen unter gewissen Voraussetzungen ebenfalls steuerprivilegiert.
1.2 SOZIALES 1
65
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Die berufliche und private Vorsorge
■ Hagelversicherung
Sachversicherungen und private Institutionen
Die Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft in Zürich ist die einzige Gesellschaft,welche Kulturen gegen Hagel versichert.Sie deckt neben dem Hagel noch eine ganze Reihe weiterer Elementarschäden.
In den Hauptanbaugebieten unseres Landes besitzen rund 90% der Bauern eine Hagelversicherung.Die Prämien der Hagelversicherung richten sich nach der Hagelempfindlichkeit der versicherten Kulturen,der örtlichen Hagelgefahr und der individuellen Beanspruchung durch den Versicherten (Bonus/Malus-System).
Angaben zur Hagelversicherung 2005
KulturenVersicherteVersicherungs-Versicherungskosten 2 Fläche 1 summepro ha bei mässigem mittlerem RisikoRisiko
Zuckerrüben658 00080168
Wein (ohne Kt.VS)7040
1geschätzte Grössen an den gesamten Kulturflächen
2Durchschnittswerte
3Wiesen und Weiden im Voralpengebiet
■ Weitere Versicherungen
Quelle:Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft
Die Haftpflichtversicherung deckt den einem Dritten zugefügten Schaden bei Personen- und bei Sachschädigungen.Landwirte schliessen in der Regel eine kombinierte Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung ab.Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist obligatorisch für alle Motorfahrzeuge,die in den öffentlichen Verkehr gebracht werden:Dies gilt für landwirtschaftliche Motorfahrzeuge,wie Traktoren, Mähdrescher etc.
Den Gebäuden und der Fahrhabe drohen viele Gefahren:Die wichtigsten sind die Feuer- und Elementarschäden.Die Feuerversicherung deckt z.B.die Schäden infolge von Brand,Rauch und Explosion.Auch allfällige Folgeschäden (durch Löschwasser, Russ etc.) sind mitversichert.In den meisten Kantonen ist die Gebäudeversicherung obligatorisch.Für das Mobiliar besteht hingegen häufig kein Versicherungszwang.Die Landwirtschaft trägt insbesondere bei den Gebäuden ein erhöhtes Risiko,was zu leicht höheren Prämien als bei andern Gebäuden führt.
1.2 SOZIALES 1
%Fr./haFr./haFr./ha Getreide854 5004186 Kartoffeln7015 000135285 Mais603 40061109
0001 3602 080 Obst4521 0001 4702 352 Gras (Wiesen und
Weiden) 3 35Pauschalvers.2860
66
■ Private Institutionen
Die Viehversicherungen sind hauptsächlich auf privater Ebene und auf Gemeindeebene organisiert.Viele Landwirte haben ihre Kühe gegen Unfall sowie Krankheit und Pferde auch gegen Tod versichert.Die Entschädigungen für Tierverluste infolge Seuchenfällen werden nach den Bestimmungen der Bundesgesetzgebung geleistet. Zur Bemessung der Entschädigungen wird in der Regel eine amtliche Schätzung der Tiere oder der Bestände vorgenommen.
Diverse Institutionen und Organisationen unterstützen die bäuerlichen Familien auf privater Basis.Es gibt dabei drei Arten von Leistungen:Geld-,Arbeits- und Materialleistungen.Die Hilfswerke haben sich im allgemeinen auf eine Art der Leistung spezialisiert.An dieser Stelle werden nur einige Hauptakteure erwähnt.Es gibt weitere zahlreiche Fonds und Stiftungen,die auch auf diesem Gebiet aktiv sind.
Finanzielle Hilfe privater Institutionen
Schweizer Berghilfe,Einzelbetriebe und Gemeinschaftsprojekte274512402522127167441757120992
COOP-Patenschaft260523582363179621072369
Patenschaft für Berggemeinden, an Gemeinschaftsprojekte
Landwirtschaft187333982845207814861157
Schweizerische Vereinigung für betriebliche Verbesserungen in der Berglandwirtschaft SVVB875761917641648500 Stiftung zur Selbst- und Sozialhilfe in der Landwirtschaft, insbes.Berggebiet324279231747980
■ Landdienst
Das Hauptziel des Landdienstes ist die Förderung des Verständnisses zwischen Stadt und Land:Die Jugendlichen lernen die Lebens- und Arbeitswelt der Bauern kennen und erhalten für ihre Mithilfe,neben freier Kost und Logis,ein Sackgeld.Die Bauernfamilien werden durch die Mithilfe der Landdienstler entlastet und lernen die Lebensauffassung dieser jungen Leute kennen.
Zahlen zum Landdienst
200020012002200320042005
Arbeitstage690076934652798563705643753816
Teilnehmer330231952814296028782857
Einsatzdauer in Tagen (Ø)212219192019
1.2 SOZIALES 1
in 1 000 Fr.
200020012002200320042005
67
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Auswertung der Gesundheitsbefragung
1.2.3Bäuerinnen und Bauern im Pensionsalter
Ein Ziel der vorliegenden Sozialberichterstattung ist die Darstellung der gesundheitlichen,sozialen sowie finanziellen Situation von Bäuerinnen und Bauern im Pensionsalter.Einerseits wurden hierzu die Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung speziell ausgewertet.Anderseits wurden Experteninterviews geführt und 13 pensionierte oder kurz vor der Pension stehende Bäuerinnen und Bauern porträtiert.Nachfolgend nun zuerst die Auswertungen der Gesundheitsbefragung.
Für die statistischen Auswertungen lieferte die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) die Datengrundlage.Die SGB,eine Erhebung des BFS,wird seit 1992 alle fünf Jahre durchgeführt.Erhoben werden u.a.Daten zum Gesundheitszustand,zu den Lebensgewohnheiten und zu gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen.Im Jahre 2002, anlässlich der letzten Erhebung,wurden rund 19'700 zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählte Personen zu diesen Themen telefonisch und schriftlich befragt.Grundgesamtheit der SGB ist die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren,die in privaten Haushalten lebt.
Im Rahmen der Gesundheitsbefragung 2002 wurden 62 Landwirte und 42 Bäuerinnen im Alter von 55 bis 64 Jahren,60 Landwirte und 42 Bäuerinnen im Alter von 65 bis 74 Jahren sowie 43 Landwirte und 51 Bäuerinnen,welche 75 Jahre alt und älter waren, befragt.Insgesamt waren es also 165 Landwirte und 135 Bäuerinnen.Bei der Untersuchung wurden nicht nur die Bäuerinnen und Bauern im Pensionsalter berücksichtigt, sondern bereits auch jene ab dem 55.Altersjahr.Dies,um aufzeigen zu können,ob und wie sich der Wechsel vom Erwerbsleben zum Ruhestand auf die Gesundheit auswirkt. Um die Vergleichbarkeit der Gruppen von Landwirten und Bäuerinnen mit der übrigen Bevölkerung zu gewährleisten,wurde jedem dieser Landwirte und jeder Bäuerin je zwei Personen mit gleichem Alter,gleichem Geschlecht und in der gleichen Region wohnend,aus der restlichen,nicht bäuerlichen,Stichprobe zufällig zugeordnet. Dadurch ergab sich eine Vergleichsgruppe von 330 Männern und 270 Frauen.Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse stammen aus den Analysen dieser beiden Gruppen.
Die Berichterstattung musste auf einige ausgewählte Aspekte der körperlichen,psychischen und psycho-sozialen Gesundheit beschränkt werden,die in diesem Zusammenhang relevant erscheinen.
■ Körperliche Gesundheit
Der körperliche Gesundheitszustand lässt sich gut daran abschätzen,wie Menschen ihre Gesundheit selber beurteilen.Verschiedene Studien haben gezeigt,dass Personen mittleren und höheren Alters,die ihre Gesundheit als schlecht einschätzen,ein erhöhtes Sterberisiko haben und dass ihre Fähigkeit,mit Beschwerden z.B.als Folge des Alterns umzugehen,geringer ist als bei Personen,die ihre Gesundheit als gut einschätzen.
Dieser selbstwahrgenommene Gesundheitszustand wurde mit der Frage «wie geht es Ihnen zurzeit gesundheitlich?» erhoben.
1.2 SOZIALES 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
68
Selbstwahrgenommener Gesundheitszustand
55- bis 64-Jährige Landwirte
Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
65- bis 74-Jährige Landwirte
Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
75-Jährige und Ältere Landwirte

Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
sehr schlecht schlecht mittelmässig
Die 55- bis 64-jährigen Landwirte schätzen ihren Gesundheitszustand deutlich schlechter ein als die Männer der Vergleichsgruppe,nach der Pensionierung kommt es zu einer Angleichung bei den Männern.Während der selbsteingeschätzte Gesundheitszustand der 55- bis 64-jährigen Bäuerinnen besser ist als jener der Vergleichgruppe,ist er bei den 75-jährigen und älteren Bäuerinnen im Vergleich schlechter.
Körperliche Beschwerden und Schmerzen haben verschiedene Ursachen.So können als Folge langjähriger hoher körperlicher Belastungen z.B.Gelenk- und Gliederschmerzen auftreten.
1.2 SOZIALES 1
69
Quelle: BFS
Vg = Vergleichsgruppe
in % 02040 10 30
■ Psychische Gesundheit
Gelenk- und Gliederschmerzen (in den 4 Wochen vor der Befragung)
55- bis 64-Jährige Landwirte Vg Männer Bäuerinnen Vg Frauen
65- bis 74-Jährige Landwirte Vg Männer Bäuerinnen Vg Frauen
75-Jährige und Ältere Landwirte Vg Männer Bäuerinnen Vg Frauen
Bei den befragten 55- bis 74-jährigen Landwirten treten Gelenk- und Gliederschmerzen weit häufiger auf als bei den Männern der Vergleichsgruppe:Es sind dies vor allem Abnützungserscheinungen auf Grund der harten körperlichen Arbeit.Die 55- bis 74-jährigen Bäuerinnen leiden ebenfalls stärker unter diesem Problem als die Vertreterinnen der Vergleichsgruppen,aber weniger ausgeprägt als die Männer.Im hohen Alter sind die Männer beider Gruppen in etwa demselben Mass von Gelenk- und Gliederschmerzen betroffen,den bäuerlichen Frauen geht es in dieser Hinsicht und in diesem Alter im Vergleich mit den anderen Frauen tendenziell etwas besser.
Psychische Gesundheit wird umschrieben als persönliches Wohlbefinden,Ausgeglichenheit,Selbstbewusstsein,Lebenszufriedenheit,Beziehungsfähigkeit,Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen und einer Arbeit nachgehen zu können sowie zu gesellschaftlicher Partizipation in der Lage zu sein.Psychische Krankheit dagegen ist charakterisiert durch klinisch erkennbare psychische Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten.
Die psychische Ausgeglichenheit,die für diesen Bericht ausgewählt wurde,stellt eine bedeutende Komponente der psychischen Gesundheit dar.Sie ist eine wichtige Voraussetzung für eine angemessene Bewältigung der täglichen Aufgaben.Psychische Anspannung bewirkt das Gegenteil und kann durch den dadurch hervorgerufenen Stress zu negativen Folgen für die Gesundheit führen.Gemessen wird die psychische Ausgeglichenheit an Hand von Fragen zur Häufigkeit von Niedergeschlagenheit,Ausgeglichenheit,Nervosität sowie dem Gefühl voller Optimismus und Energie zu sein.
1.2 SOZIALES 1
70 Quelle: BFS Vg = Vergleichsgruppe stark ein bisschen
in % 0403070 20 10 60 50
■ Psycho-soziale Gesundheit
Psychische Ausgeglichenheit (in der Woche vor der Befragung)
55- bis 64-Jährige Landwirte
65- bis 74-Jährige Landwirte
Bei den 55- bis 64-jährigen Landwirten ist der Anteil jener mit einer niedrigen psychischen Ausgeglichenheit mit 19% höher als bei der Vergleichsgruppe (12%),bei den beiden anderen Altersgruppen der Männer liegt dieser Anteil für Landwirte und Vergleichsgruppe um 10%.Bei den Bäuerinnen ist der Anteil mit niedriger psychischer Ausgeglichenheit in allen drei Altersgruppen höher als jener der Vergleichsgruppe,bei den 65- bis 74-jährigen Bäuerinnen liegt er gar bei 25%.
Soziale Beziehungen und die im sozialen Netz verfügbare Unterstützung sind eine wichtige Voraussetzung für das psychische Wohlbefinden.Sie stellen eine wichtige Ressource bei der Bewältigung von (gesundheitlichen) Problemen dar und beeinflussen dadurch selbst auch die Lebenserwartung.So erhöht beispielsweise das Fehlen tragfähiger sozialer Beziehungen die Anfälligkeit für gesundheitliche Störungen.Für diesen Aspekt der Gesundheit wird hier exemplarisch die Häufigkeit von Einsamkeitsgefühlen und – bei Personen mit Kindern – die Häufigkeit von Kontakten zu ihren Kindern dargestellt.
1.2 SOZIALES 1
71
Quelle: BFS
Vg
= Vergleichsgruppe niedrig mittel
Vg
Vg
Männer Bäuerinnen
Frauen
Vg
Vg
Vg
Bäuerinnen Vg
in % 03060 20 10 50 40
Männer Bäuerinnen
Frauen 75-Jährige und Ältere Landwirte
Männer
Frauen
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
Einsamkeitsgefühle
55- bis 64-Jährige Landwirte
Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
65- bis 74-Jährige Landwirte
Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
75-Jährige und Ältere Landwirte

Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
Im Unterschied zu den Männern der Vergleichsgruppe leiden die befragten Landwirte mit zunehmendem Alter vermehrt unter Einsamkeit.Bei den befragten Frauen ist die Einsamkeit ganz generell ein häufiger auftretendes Problem als bei den Männern.Bei den Bäuerinnen fühlen sich je nach Alter zwischen 29% und 43% manchmal oder häufig einsam,bei der Vergleichsgruppe liegen die Werte etwas tiefer (25 bis 35%). Insbesondere bei den 65- bis 74-jährigen Bäuerinnen ist die Einsamkeit ein häufig auftretendes Problem.Vermutlich steht dieses Phänomen der grösseren Einsamkeit u.a.im Zusammenhang mit der nachlassenden Mobilität im Alter.
1.2 SOZIALES 1
72
Quelle: BFS
Vg = Vergleichsgruppe
sehr häufig ziemlich häufig manchmal
in % 0302050 10 40
Kontakt mit den Kindern
55- bis 64-Jährige Landwirte
Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
65- bis 74-Jährige Landwirte
Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
75-Jährige und Ältere Landwirte
Vg Männer Bäuerinnen
Vg Frauen
Bei jenen Landwirten und Bäuerinnen mit Kindern ist der Kontakt zu diesen in allen Altersklassen häufiger als bei den Männern und Frauen der Vergleichsgruppen.Dies hängt sicherlich mit den örtlichen Gegebenheiten auf Landwirtschaftsbetrieben zusammen – häufig sind zwei und mehr Generationen auf dem gleichen Betrieb wohnhaft.Der scheinbare Widerspruch,dass Bäuerinnen und Landwirte trotz mehr Besuchen von den eigenen Kindern gegenüber der Vergleichsgruppe häufiger von Einsamkeitsgefühlen geplagt werden,ist wahrscheinlich auf die in der ersten Analyse eingeschlossenen Personen ohne eigene Kinder zurückzuführen.
Die befragten älteren Landwirte und Bäuerinnen schätzen ihren körperlichen Gesundheitszustand allgemein als schlechter ein als ihre Vergleichsgruppen.Die Folgen ihrer langjährigen,harten körperlichen Arbeit zeigen sich nicht nur bei dieser Selbsteinschätzung sondern auch in häufiger vorkommenden,schmerzhaften Abnützungserscheinungen.Was die psychische Gesundheit anbetrifft,so ist insbesondere bei den älteren Bäuerinnen vermehrt eine niedrige psychische Ausgeglichenheit anzutreffen, ebenfalls fühlen sie sich oft einsam.Mit zunehmendem Alter leiden auch die befragten Landwirte vermehrt unter Einsamkeit – möglicherweise hängt dies u.a.mit der abnehmenden Mobilität im Alter zusammen.Bei älteren Landwirten und Bäuerinnen mit Kindern ist dieser Kontakt wegen den örtlichen Gegebenheiten auf Landwirtschaftsbetrieben weit häufiger als bei den Vergleichsgruppen.Insgesamt geht es der bäuerlichen Bevölkerung gesundheitlich eher schlechter als der übrigen Bevölkerung.
1.2 SOZIALES 1
73 Quelle: BFS Vg = Vergleichsgruppe täglich mind. 1 mal wöchentlich mind. 1 mal
in % 06040100 20 80
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Fazit aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung
Experteninterviews
Gespräche mit Experten zum Thema «Bäuerinnen und Bauern im Pensionsalter» haben gezeigt,dass die AHV die klar bedeutendste Grundversicherung für die bäuerliche Bevölkerung im Alter ist.Da die Beitragszahlungen direkt rentenbildend sind,sollte das Einkommen während der aktiven Zeit nicht nur im Hinblick auf allfällige Steuerersparnisse,sondern auch auf die späteren AHV-Renten hin optimiert werden.Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigungen werden gemäss Einschätzung der befragten Experten wegen der Vermögensberücksichtigung nur selten in Anspruch genommen.Die allgemein tiefere Anspruchsmentalität der bäuerlichen Bevölkerung im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung wurde bestätigt.
Wohneigentum resp.das Wohnrecht ist eine weitere wichtige Vorsorgemöglichkeit.Das Wohnrecht hat nach wie vor eine grosse wirtschaftliche Bedeutung, ermöglicht dieses Recht doch ein kostenloses oder zumindest äusserst günstiges Wohnen.Gerade das Wohnrecht ist auch sozial gesehen wichtig,da damit die Verankerung in der bekannten Umgebung gewährleistet ist.Beim Wohnrechtsvertrag ist auf klare Regelungen zu achten.
Allgemein wird eine frühzeitige Altersvorsorgeplanung empfohlen mit folgender Prioritätensetzung:1.Investitionen in zukunftsorientierten Betrieb,2.Investitionen in den Wohnraum,3.Tod/Invalidität absichern,4.Sparen.
Im Frühjahr 2006 wurden in Zusammenarbeit mit der ART in der ganzen Schweiz 13 Gespräche mit pensionierten oder kurz vor der Pension stehenden Bäuerinnen und Bauern geführt.Pro Region wurden jeweils mehrere mögliche Gesprächspartner und -partnerinnen entweder aus der Datenbank der Betriebszählung des BFS zufällig oder anhand von Angaben der landwirtschaftlichen Beratungsdienste gewählt.All diesen Personen wurde ein Informationsschreiben zugesandt,da nicht bekannt war,wer überhaupt bereit sein würde,über die persönliche Situation Auskunft zu geben.Bei den anschliessenden telefonischen Anfragen wurde die Gesprächsbereitschaft abgeklärt und bei einer Zusage ein Gesprächstermin vereinbart.Die aufgrund dieser Gespräche entstandenen Porträts geben einen wertvollen Einblick in das Leben und die aktuelle Situation der älteren bäuerlichen Bevölkerung in der Schweiz.
1.2 SOZIALES 1
74
■ Porträts
Armand J.übernimmt den 11-Hektaren-Betrieb seines Vaters mit 46 Jahren,zu spät und zu teuer wie er meint.Damals waren Armand und Martha bereits verheiratet und hatten vier Kinder,eine Tochter und drei Söhne.Diese Situation sollte sich in der nächsten Generation nicht wiederholen.Die J.übergeben deshalb ihren inzwischen auf 45 Hektaren angewachsenen Betrieb an ihren jüngsten Sohn im 61.Altersjahr von Herrn J.,und zwar zum halben Ertragswert,um dem Sohn und seiner Familie einen guten Start zu ermöglichen.

Sparen konnten die J.kaum,denn die Einkünfte aus dem Betrieb wurden jeweils gleich wieder in Land investiert.Heute lebt das pensionierte Ehepaar von der AHV.Zwei Felder – ca.zwei Hektaren Land – haben sie jedoch behalten.Die sollen einmal den anderen Kindern zu Gute kommen,als Anerkennung für die in ihrer Jugend geleistete Arbeit auf dem Betrieb.Die J.geniessen das Wohnrecht im alten Wohnhaus des Betriebs.Sie leben zusammen mit einem Enkel,den sie bei sich aufgenommen haben, und der das nahe Gymnasium besucht.Der Hofnachfolger und seine Familie wohnen etwa 50 m von ihnen entfernt in einem Haus,das Armands Vater einst für sich gekauft hatte.
Armand arbeitet noch täglich im Betrieb.Heute macht er aber nur noch,was ihm gefällt,nämlich Pferde einfahren oder Fohlen für den Sohn auf dem Pferdemarkt einkaufen.Pferde sind seine grosse Leidenschaft und darin ist er unbestritten Fachmann. Auf Büroarbeiten und Buchhaltung kann er gut verzichten.Einen Lohn bezieht er für diese Arbeit nicht.Seine zahlreichen Ämter – er war u.a.25 Jahre Gemeindepräsident von D.– hat Armand alle bis auf ein kleineres aufgegeben.Früher war er deswegen oft vom Betrieb weg.Nach einem arbeitsreichen Tag geht Armand heute gerne sehr früh ins Bett.Martha hat sich ganz aus der Betriebsarbeit zurückgezogen,aber den Haushalt besorgt sie nach wie vor selber,trotz einiger gesundheitlicher Probleme.Die Eltern sind mit der Entwicklung des Betriebs zufrieden.Der Sohn und die Schwiegertochter setzen ihr Lebenswerk in ihrem Sinne fort.Dank Zupacht konnte der Betrieb nochmals wachsen und umfasst heute rund 100 Hektaren mit Pferden und Milchkühen.
Armand und Martha J.möchten,sofern es die Gesundheit erlaubt,solange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben.Den Kindern wollen sie auf keinen Fall zur Last fallen,dann lieber in ein Alters- und Pflegeheim gehen.
Die J.sind mit ihrem Leben zufrieden,doch wäre es schön,etwas mehr Geld zur Verfügung zu haben.Nach dem harten Arbeitsleben hätten sie sich eigentlich einen etwas besseren Lebensabend gewünscht,aber sie hadern nicht:«Nun,es ist wie es ist».
1.2 SOZIALES 1 75
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Der Betrieb zuerst
Eigentlich sollte alles ganz anders kommen,und der ältere Bruder von Fritz M.würde vielleicht noch heute auf dem Anwesen in F.wohnen.Doch durch einen tödlichen Motorradunfall des Bruders änderte sich die Lage.Die gewünschte Berufsausbildung zum Banker wurde für Fritz M.unmöglich,denn es war selbstverständlich,dass er auf dem väterlichen Betrieb arbeitete und wohnte.In seiner Freizeit widmete er sich dem Reitsport,aus Freude und als Ausgleich zur täglichen Arbeit auf dem Hof.1955 heiratete er Elisabeth,die im Haus und auf dem Betrieb mithalf.Das junge Ehepaar wohnte im gleichen Haushalt wie die Eltern,auch nach der Geburt der drei Töchter.1969 wurde der elterliche Betrieb übernommen.Die Ausrichtung des Betriebs auf Milchvieh, Obst und Ackerbau wurde beibehalten.
Da sich die Töchter zwar teilweise für die Bewahrung des elterlichen Wohnhauses,aber nicht für praktische Landwirtschaft interessierten,stand in den neunziger Jahren die Frage nach dem «wie» der Betriebsaufgabe im Raum.Doch diese Frage konnte schnell beantwortet werden,nachdem ein jüngerer Kollege aus der Nachbarschaft fragte,ob er nicht Betriebsgebäude und -flächen in Pacht übernehmen könne.Schnell wurde man sich handelseinig,und der Betrieb konnte auf diese Weise als ganzes weitergeführt werden.
Die Verpachtung des Betriebs war zumindest für Elisabeth M.nicht mit dem Eintritt in den Ruhestand gleichzusetzen.Bis nach ihrem 70.Lebensjahr war sie als Tagesmutter tätig.In dieser Lebensphase noch Kinder zu betreuen,mit ihnen Hürössli zu spielen und zu singen,hat sie als besondere Chance betrachtet.Und bis heute gilt es einen grossen Garten zu bewirtschaften.Auch Fritz M.ist noch äusserst aktiv.In der Umgebung schneidet er zahlreichen Nachbarn die Obstbäume.Und seine Hochstämme bewirtschaftet Fritz M.noch heute selbst,spritzt und erntet.
Doch in erster Linie war die Aufgabe des Betriebs für Herrn und Frau M.ein Schritt in die Freiheit.Der ersten gemeinsamen Reise nach Kanada nach der Betriebsaufgabe folgte eine zweite nach Spanien.Auch das Reiten wurde für eine Zeit wieder aufgenommen,und als neue Freizeitbeschäftigung ist das Jassen hinzugekommen.Auch die Sonntagsausflüge zu Kindern und Enkeln sind gegenüber früher entspannter geworden:«Man ist schon auch gegangen,aber es ist nicht dasselbe,wenn man um fünf Uhr wieder zuhause sein sollte,und dann in den Stau kam...»

1.2 SOZIALES 1 76
■ Fest im Sattel
■ Neues zulassen
Pietro,Bauernsohn aus Norditalien,und Luigina V.,Tochter eines Kleinbauern aus der Region,haben den Traum vom eigenen Landwirtschaftsbetrieb verwirklicht:Sie betrieben bis vor zwei Jahren Viehzucht und Rebbau.1980 bauten sie einen Stall, pachteten parzellenweise Land dazu,bis der Betrieb eine Grösse von 15 Hektaren erreichte.Haus,Stall und der kleine Rebberg gingen dann vor zwei Jahren in den Besitz der jüngeren der beiden Töchter über.Die Hofnachfolgerin stellte das Betriebskonzept der Eltern völlig auf den Kopf und setzt neu auf Agro-Tourismus:Die Tiere wurden verkauft,Stall und Heubühne zu attraktiven Gästezimmern umgebaut – sie können bis zu 30 Personen beherbergen.Die V.’s haben das Wohnrecht im Bauernhaus behalten, sodass die V.’s und ihre ledige Tochter einen gemeinsamen Haushalt führen.

Eigentlich hätte Luigina V.gerne ganz mit der Landwirtschaft aufgehört und auch die Rebberge verkauft,um den Lebensabend nach den arbeitsreichen Jahren noch etwas geniessen zu können.Pietro dagegen ist das Aufhören nicht leicht gefallen.Der passionierte Viehzüchter – Pokale,Treichlen und Auszeichnungen bezeugen seine Erfolge –ging früher auf jede Viehschau,heute muss er aus gesundheitlichen Gründen darauf verzichten.Wenigstens kann er die Tochter im Rebbau fachlich noch etwas unterstützen.Dem Bauern aus Berufung fällt das Loslassen nicht leicht.Doch das Alter zwingt ihn dazu.
Die V.’s haben ihre Tochter bei der Umsetzung ihres Plans finanziell unterstützt und einen Kredit für die nötigen Investitionen aufgenommen.Diese Investitionen belasten das Haushaltbudget der V.’s nun allerdings enorm.Zum Glück haben sie während der Betriebsjahre ein wenig Geld auf die Seite legen können.Das Einkommen aus der AHV würde nicht reichen.
Die V’s haben keine grossen Ansprüche.Luigina V.ist zufrieden,wenn sie sich einmal die Woche mit einer Freundin zum Einkaufen treffen kann.Sonntags geht sie auch gerne wandern.Sie ist Mitglied in einem Chor und turnt jede Woche in der Seniorengruppe.Pietro V.hingegen geniesst es,wenn er draussen noch etwas zum Werken hat und im Sommer zwei Wochen bei seiner Familie in Norditalien verbringen kann.
1.2 SOZIALES 1 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 77
So Einiges hat Thomas S.anders gemacht als seine Eltern.Während sie früh heirateten und neun Kinder bekamen,blieb er Junggeselle.Während sein Vater bis zum 92. Lebensjahr auf dem Betrieb wohnte,entschloss sich Thomas S.bereits mit 62 Jahren zum Umzug – er gesteht lächelnd,dass er es auf einmal in der Abgeschiedenheit der Berge mit der Angst zu tun bekam.Und während für den Vater eine Selbstverständlichkeit war,dass der Betrieb in der Familie übergeben wird,verkaufte Thomas S.den ganzen Betrieb an einen Kollegen aus der Region,der nun zwei Betriebe parallel bewirtschaftet.

Zwar kam dieser letzte Entschluss auch dadurch zustande,dass Thomas S.selbst keine Kinder hat,und auch Nichten und Neffen kein ernsthaftes Interesse am 6,5-HektarenBetrieb im Berggebiet zeigten,«ich hätte ihn am liebsten einem Verwandten gegeben, dann hätte ich ihn für nichts oder für halb nichts gegeben.» Es hat ihn schon geschmerzt,den Betrieb in familienfremde Hände geben zu müssen.Doch mittlerweile sieht Thomas S.auch die Vorzüge einer Betriebsaufgabe.Mit der Landwirtschaft, erinnert er sich,waren doch immer auch Kummer und Ängste verbunden,die nun der Vergangenheit angehören.
Aufgrund der abgelegenen Lage des Betriebs lieferte Thomas S.seine Milch nie an die Molkerei ab,sondern verkäste sie selbst.Zusätzlich wurden Kälber und Geissen aufgezogen.Seine Erfahrung auf diesen Gebieten ist noch immer sehr gefragt.Als Thomas S. seine Dienste einmal in der Zeitung anbot,meldeten sich 40 Interessenten:Er arbeitete dann drei Winter lang im L.bis es ihm doch zuviel wurde.Und jeden Sommer hilft er seit seinem Umzug auf der Alp seines Bruders mit,der ihm dafür Kost und Logis gewährt.
Den wirklichen «Ruhestand» geniesst Thomas S.daher meist nur in der kälteren Jahreszeit.Dann bereitet er Brennholz für sich und eine seiner Schwestern,geht durch den Wald – er war während rund sechs Jahren Wildhüter – oder beschäftigt sich mit dem Schnitzen.Einen besonderen Anlass gab es im letzten Jahr,als alle Geschwister gemeinsam einen Wanderurlaub unternahmen,mit Ausnahme eines nach Kanada ausgewanderten Bruders.
Ausgewandert ist Thomas S.auch,allerdings nur in das einige Kilometer bergabwärts liegende Dorf S.Dort konnte er von der Gemeinde eine Wohnung mieten.Die AHV und ein gewisses Polster reichen aus,die Ausgaben für Miete und den täglichen Bedarf zu bestreiten.Und zwei Schwestern helfen,den Haushalt in Ordnung zu halten.So ist er nun im Alter besonders dankbar für den seit jeher starken Familienverbund.
1.2 SOZIALES 1 78
■ Der Zweite von Neun
Erst mit 83 Jahren,ein Jahr vor seinem Tod,übergab der Vater von Hans W.seinem Sohn den Hof.Damals,als es noch keine Direktzahlungen gab,aber «die Milch noch etwas galt»,wie sich Hans W.erinnert.Zu diesem Zeitpunkt hatten er und seine Frau Margret bereits zwei Söhne,zwei weitere Kinder folgten nach der Betriebsübernahme. Weil der Bergbetrieb mit zehn Hektaren nicht so gross war,trug ein am Skilift verdientes Zusatzeinkommen dazu bei,dass es der Familie gut ging,«vielleicht zu gut», sagt Margret W.heute.

Da Hans und Margret W.viel in die Gebäude auf ihrem Betrieb investiert hatten, freuten sie sich,dass ihr jüngster Sohn Interesse an der Übernahme hatte.Aufgrund des Direktzahlungssystems war dabei klar,dass die Übergabe mit dem 65.Geburtstag von Hans W.erfolgt.Doch beim Vorgang der Betriebsübergabe lief nicht alles ideal und es wollte daher keine rechte Begeisterung aufkommen.Die Aufforderung des Notars, ein wenig fröhlicher dürfte man schon sein,verfehlte ihre Wirkung.
Aus heutiger Sicht von Hans und Margret W.war es ein Fehler,dass im Vertrag kein Wohnrecht für sie vorgesehen war.Aufgrund von Spannungen mit der Schwiegertochter folgte der Betriebsübergabe bald die Aufforderung,sich eine andere Wohnung zu suchen.Vielleicht war es kein Zufall,dass der Umzug mit einem Wirbelsäulenbruch von Margret M.zusammenfiel? Erschwerend war es in jedem Fall,denn es bedurfte viel Arbeit,bis das neue Heim wohnlich hergerichtet war.Hinzu kam,dass die Landstrasse begradigt wurde,nun direkt am Haus vorbeiführt und für einige Lärmbelästigung sorgt.
Inzwischen hat man sich aber mit den neuen Lebensverhältnissen arrangiert.Mit der AHV können die laufenden Ausgaben knapp gedeckt werden.Ihr neues Zuhause ist gross genug,damit Kinder und die Enkel zu Besuch kommen können – zum Beispiel, um mit Hans W.zusammen Ski zu fahren.Ein regelmässiger Anlass ist der sonntägliche Gottesdienst.Und gemeinsame Fahrten in die Stadt zum Einkauf hellen den Alltag auf. Doch steht Hans W.noch oft am Fenster des ersten Stocks und betrachtet die Kühe auf der Weide,die er früher gemolken hat.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.2 SOZIALES 1 79
■ Am anderen Ort
Albertina und Guido F.wohnen in einem Dorf in den Bergen.Ihre zwei Töchter haben studiert,Lehramt und Architektur,und sich für ein Leben ausserhalb der Landwirtschaft entschieden.Die drei Enkel sind jedoch gerne auf dem Bauernhof ihrer Grosseltern, sind aber mit acht,zehn und vier Jahren noch zu jung für eine berufliche Entscheidung. Guido F.war ein geschätzter und passionierter Braunvieh-Züchter,Albertina F.arbeitete auf dem Betrieb stets an seiner Seite.Wenn ihr Mann als Viehhändler unterwegs war, übernahm sie alle anstehenden Aufgaben.In den siebziger Jahren planen die F.’s einen neuen Stall.Sie verzichten schliesslich mangels Nachfolge darauf.Heute sind sie froh darüber.

Als Guido 65 wird,überschreibt er den Betrieb an seine jüngere Frau Albertina.Dabei passen sie den 12-Hektaren-Betrieb nach und nach ihren Kräften an:So wird erst der Viehbestand reduziert,dann das Land teilweise und schliesslich ganz verpachtet.Verkaufen wollen die F.’s den Betrieb vorerst nicht.Einerseits wegen den Enkeln,anderseits weil der Landpreis wenig attraktiv ist.
Die F.’s wohnen in einem Zweifamilienhaus,das Guidos Vater einst gekauft hat.Im einen Hausteil wohnen Albertina und Guido F.,im anderen eine Schwester von Guido. Wer wird sie pflegen,wenn sie nicht mehr für sich selber sorgen können? Öfter stellen sich Herr und Frau F.die Frage nach der Selbständigkeit im Alter.Der Gedanke an den Eintritt in ein Altersheim macht Herrn F.grosse Mühe – mehr als seiner Frau.
Finanziell machen sich die F.’s derzeit keine speziellen Sorgen:Ihr Einkommen aus AHV und Pachtzinsen reichen gut.Die Kosten für den Unterhalt des Hauses sind recht klein. Zudem konnten die F.’s etwas Geld auf die Seite legen,da sie auf grössere Investitionen im Betrieb verzichtet haben.
Nach wie vor liebt Guido F.interessante Diskussionen – dafür hatte er früher als Präsident der Burgergemeinde und langjähriger Gemeinderat oft Gelegenheit.Häufig gehen Albertina und Guido ihre Töchter und Enkel besuchen.Die F.’s nehmen sich auch gerne die Zeit,längere Spaziergänge in der Natur zu unternehmen – sie ist es nun nicht mehr,die das Tagesgeschehen diktiert.
1.2 SOZIALES 1 80
■ Schritt für Schritt in den Ruhestand
Peter B.entspricht nicht dem,was man sich unter dem typischen pensionierten Bauern vorstellt.Weder verbringt er den Lebensabend auf seinem ehemaligen Betrieb,noch legt er weiterhin dort Hand an.Trotz seiner 70 Lebensjahre arbeitet Peter B.nach wie vor als Schätzer.Geändert hat sich nur der Arbeitgeber:Während er früher beim Kanton angestellt war und sich dort zu seinem Schweinezuchtbetrieb ein zweites Standbein sichern konnte,arbeitet Peter B.jetzt freiberuflich.Er ist froh,sich seine Arbeitszeit nun selbst einteilen zu können.Dennoch füllt seine Tätigkeit heute mehr als eine halbe Arbeitsstelle aus.Hinzu kommt noch seine Tätigkeit als Verwaltungsratspräsident für eine Schweineproduzentenorganisation.
Angesichts seines vollen Terminkalenders ist es naheliegend,dass der Sohn von Peter B., der den Betrieb übernommen hat,ihn immer seltener anruft und um Unterstützung beim Heuen und Füttern bittet.Peter B.ist froh,dass sein Sohn mit Frau und vier Kindern den Betrieb auf 25 Hektaren,90 Mutterschweine und 60 Munis ausgebaut hat und nun selbständig bewirtschaftet.Seine Tochter dagegen hat eher die ökonomischen Interessen vom Vater geerbt und arbeitet heute bei einer Bank.

Ein einschneidendes Ereignis in Peter B.’s Biographie war der frühe Tod seiner Frau. Kurz nach einer gemeinsamen Reise nach China,einem langjährigen Wunschtraum seiner Frau,erkrankte sie schwer und schied nur sieben Monate später aus dem Leben. Die Motivation,den Familienbetrieb weiter zu führen,litt darunter spürbar,und vier Jahre später entschied sich Peter B.zur Übergabe.
Peter B.bereut heute keine seiner Entscheidungen.Doch durch die Übergabe seines Betriebes zum Ertragswert und ohne Wohnrecht ist seine finanzielle Situation weniger rosig,als er sich das vielleicht wünschen würde.Lachend berichtet er,dass die AHV und die kleine Pension für seine Anstellung beim Kanton für die ersten 12 Tage des Monats reichen – am 13.müsse er wieder arbeiten gehen.So ist ihm zu wünschen,dass er noch viele Schätz-Aufträge erhält.
1.2 SOZIALES 1 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 81
■ Das Alter schätzen lernen
Die Situation von Daniel und Martha J.ist nicht einfach.Die Übergabe erweist sich als äusserst schwierig für den auf Muttersauen spezialisierten 10-Hektaren-Betrieb.Als Daniel J.mit 64 Jahren beschliesst,den Betrieb an seinen Neffen zu verpachten,unternimmt er diesen Schritt in der Absicht,diesem Jungen,der bereits als 15 Jähriger auf dem Betrieb mitgeholfen hat,eine Chance zu geben.

Die einzige Tochter hat trotz anfänglichem Interesse auf eine Hofübernahme verzichtet, da sie unterdessen in einen Milchwirtschafts- und Tabakbetrieb eingeheiratet hat.Der Neffe verfügt weder über die nötige landwirtschaftliche Ausbildung,um Investitionskredite für die Sanierung des Schweinestalls aufzunehmen noch über finanzielle Mittel, um den Betrieb gar käuflich zu erwerben.So springen die J.’s ein und nehmen selber das erforderliche Geld auf.Für sie ist dies eine enorme Belastung,da sie nun bis ins hohe Alter Schulden tilgen müssen und dabei an die Grenzen ihrer finanziellen und psychischen Belastbarkeit geraten.Auch gesundheitlich ist die Situation kritisch:Frau J. leidet seit langem an Diabetes und Rheuma,Herr J.kämpft seit seiner Jugend mit einem Nierenleiden.
1959 beschloss Daniel J.,ein vom Betrieb getrenntes Zweifamilienhaus zu bauen.Er wollte ein eigenes Familienleben pflegen können.1974 zerstörte ein Feuer das Ökonomiegebäude,der 1959 erbaute Schweinestall blieb verschont.Für den Neffen und seine Familie bietet der Hausteil jedoch nicht ausreichend Platz – sie wohnen daher auswärts.Die Drei-Zimmer-Wohnung wird von den J.’s vermietet.Frau J.hat in diesem Haus mit Unterstützung ihres Mannes erst ihre Schwiegereltern und dann ihre eigenen Eltern gepflegt.Für sich selber sehen die J.’s eine andere Lösung:Sie werden zu gegebener Zeit ins Pflegeheim ziehen.
Ein Lichtblick sind für Daniel und Martha J.die alljährlichen Besuche ihrer langjährigen bäuerlichen Freunde in Frankreich.Daniel hat seinen französischen Freund in seiner Jugend kennen gelernt – er war landwirtschaftlicher Praktikant im Dorf.Der Kontakt brach nie ab und ist heute trotz allem leichter:Im Gegensatz zu früher können die J.’s ohne Probleme ein paar Tage vom Betrieb weggehen.
1.2 SOZIALES 1 82
■ Nachfolge mit Hindernissen
■
Gegenseitige Pflege im Alter
Das Ehepaar Anton und Alice Z.hat den Betrieb von Antons Eltern in den siebziger Jahren übernommen.Neben 14 Milchkühen und ein paar Mastkälbern hielten die Z.s zu Beginn auf ihrem Zehn-Hektaren-Betrieb auch 12 Muttersauen,die Alice Z.besorgte.Mit der Hofübernahme war neben dem Wohnrecht für die Eltern von Anton Z. aber auch ein Anrecht auf Pflege in gesunden und kranken Tagen verbunden.Die Pflege hat die diplomierte Bäuerin Alice Z.und die ganze Familie Z.stark belastet.Es waren harte Zeiten.Viel Geld musste nach der Hofübergabe in die Sanierung der Wirtschafts- und Wohngebäude gesteckt werden.Die Z.’s haben betrieblich einiges erreicht,dafür lebten sie ausschliesslich für den Betrieb und hatten keine Zeit für Ferien.Ferien? «Heute will ich das nicht mehr»,meint Alice Z.

Das Leben von Anton Z.findet weiterhin draussen auf dem Betrieb statt.Damit er etwas unter die Leute kommt,singt er seit 45 Jahren im Kirchenchor,seit ein paar Jahren auch im Seniorenchörli.Alice Z.macht Aquafit,ihrer Gesundheit zuliebe. Kontakte pflegen sie zu ihren drei Töchtern und dem Enkelkind,die regelmässig auf Besuch kommen.Schwierig gestaltet sich der Kontakt zur Aussenwelt für Alice Z.–nicht zuletzt wegen der aufwändigen Pflege der Eltern ging dieser mehr und mehr verloren.Diese ungewollte Isolation bereitet ihnen etwas Sorge.
Ein Jahr vor seinem 65.Altersjahr übergibt Anton Z.den Betrieb an seinen einzigen Sohn,damit dieser in den Genuss der Starthilfe für Junglandwirte kommt – weitere Investitionen stehen an.Der Hofnachfolger ist ledig und wohnt noch bei den Eltern. Alice Z.besorgt den Drei-Personen-Haushalt.Die Betriebsarbeit hat sie aufgegeben, nicht jedoch ihren Hausgarten.Der junge Hofnachfolger arbeitet zeitweise auswärts. Darum ist er auf die Mitarbeit des Vaters angewiesen.Anton Z.verzichtet auf einen Lohn,obwohl ihm sein Sohn dies angeboten hat.Er möchte den Sohn bzw.den Betrieb nicht zusätzlich belasten.
Das Ehepaar Z.kommt finanziell dank Wohnrecht mit AHV und Kostgeld des Sohnes zurecht.Von dem Verkauf des Betriebs an den Sohn bleibt nur das Geld für Vieh und Fahrhabe.Schulden und Ertragswert des Betriebs heben sich in etwa auf.Den Bau eines Stöckli können Anton und Alice Z.erst ins Auge fassen,als Alice Z.eine Erbschaft macht.Andernfalls hätten sie sich auswärts eine Wohnung gesucht,um dem Sohn nicht zur Last zu fallen und seine Zukunft nicht zu behindern.
Die Pflege der Eltern bzw.Schwiegereltern zehrten an den Kräften:«Wir haben einige Jahre Gesundheit eingebüsst»,meint Alice Z.Über das eigene Älterwerden denken sie nicht gerne nach:«Ist ja noch früh genug,wenn es dann kommt».Als erstes zählen sie jedoch auf sich selber und beabsichtigen sich gegenseitig zu pflegen solange es geht.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.2 SOZIALES 1 83
Als Balzer A.mit über 45 Jahren den elterlichen Bergbetrieb übernahm,da war das Land bereits verpachtet,und sein Vater lebte schon im Altersheim.Ausschlaggebend für diese späte Entscheidung war die junge Ehe mit Päuly A.Sie,geschieden von einem Grossbauern in der Region,zog die Landluft seiner Wohnung in der Stadt deutlich vor. So wurde der elterliche Hof bezogen,gemeinsam mit 14 Schafen,einem Hochzeitsgeschenk.Von Anbeginn an war die tiergerechte Haltung ein wichtiges Anliegen des Paares.
Obgleich Balzer und Päuly A.stets beide auswärts arbeiteten,wurden aus den 14 Schafen mit der Zeit 130.Und aus drei Hektar Eigenland wurde immerhin ein NeunHektar-Betrieb.Es war ohnehin nie leicht,die Arbeit als Bauarbeiter und als Köchin im Altersheim mit dem Füttern,Ablammen und Heuen zu verbinden – dazu kamen vermehrt Probleme mit Klauenkrankheiten.Im Jahr 2002 wurde die Fortführung des Betriebs jedoch ganz unmöglich.Balzer A.,der nie unter Rückenschmerzen litt,bekam einen plötzlichen Bandscheibenvorfall.Er musste fortan sämtliche Arbeiten auf dem Hof seiner Frau überlassen,ihm wurde eine IV-Rente zugesprochen.

Der Tag im Frühjahr 2003,als alle Schafe verkauft wurden,war für keinen der beiden leicht.Sie ging aus dem Haus,und er sagte sich,es sei ja nicht viel anders als ein Alpaufzug – um dann für ein Vierteljahr ins Spital und zur Kur zu gehen.Danach herrschte ein Gefühl der Leere,vor allem als die Schafe im Herbst nicht wiederkehrten. Ladewagen und Motormäher wechselten den Besitzer,auch das Land wurde an einen Nachbarn verpachtet.Der Plan,eine Pferdepension zu gründen,musste trotz der dafür günstigen Gebäudesituation aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben werden.
Heute haben sich Balzer und Päuly A.mit der unerwarteten Betriebsaufgabe arrangiert. Sie arbeitet bis zu ihrer Pensionierung im nächsten Jahr weiter im Altersheim und engagiert sich im Laientheater.Er betreut ein paar Ferienhäuser und trifft sich mit seinen Kollegen im nahe gelegenen I.auf einen Kaffee.Statt der Schafe werden zuhause nun noch vier Katzen betreut.Für Familie A.gilt für den Umgang mit den Katzen, was früher für die Schafe galt:Es reicht nicht,Tiere zu halten,man sollte auch eine Beziehung zu ihnen aufbauen.
1.2 SOZIALES 1 84
■ Später Anfang, frühes Ende
Vor einem Jahr haben Ernest und Marinette Sch.ihrem Sohn den Hof überschrieben,da sie das AHV-Alter erreicht haben.Für sie hat sich grundsätzlich nicht viel geändert.Von Ruhestand ist wenig zu spüren.Weiterhin arbeiten Ernest und Marinette Sch.auf dem Betrieb,da ihr Sohn nebenbei als Fleischinspektor tätig ist und noch keine Partnerin gefunden hat,die ihn auf dem Hof unterstützen könnte.Allein kann der Hofnachfolger die 32 Hektaren Land und die 25 Kühe nicht bewältigen.
Aus gesundheitlichen Gründen müssen die Sch.’s jedoch etwas kürzer treten.Ernest macht die operierte Hüfte,Marinette die Folgen eines Unfalls zu schaffen.Sie wurde von einem Tier auf der Weide angegriffen und musste sich deswegen mehreren Operationen unterziehen.Für die schweren körperlichen Arbeiten auf dem Betrieb wird im Sommer deshalb eine Hilfskraft eingestellt.
Marinette und Ernest Sch.wohnen zusammen mit ihrem Sohn im gleichen Haus,sie unten,er oben,im Sommer zusammen mit dem Angestellten.Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen.Marinette kümmert sich in der Regel darum.Wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ausfällt,dann übernimmt Ernest das Zepter in der Küche,er hat sich darin einige Fähigkeiten angeeignet.In der Freizeit liest Marinette am liebsten Bücher.Ernest spielt seit vielen Jahren in der Blasmusik.Am liebsten sind die Sch.’s, insbesondere Marinette,zu Hause.Dort fühlen sie sich wohl.
Ernest und Marinette sind es gewohnt,mit wenig Geld auszukommen.Die AHV-Rente reicht ihnen zum Leben,insbesondere da sie keine Miete zu zahlen haben.Geld ist bei der Hofübergabe keines geflossen.Ersparnisse oder gar eine dritte Säule haben die Sch.’s nicht.Kürzlich konnte Marinette als einzige Tochter das Elternhaus erben.Dieses wird sie nun verkaufen.
Ernest und Marinette Sch.möchten möglichst bis an ihr Lebensende auf dem Hof bleiben,genauso wie damals die Eltern von Ernest.Falls sie einmal nicht mehr auf dem Betrieb mitarbeiten können,dann wird der Sohn wohl die Kühe aufgeben.Sie hoffen jedoch,dass dies noch lange nicht der Fall sein wird und alles beim Alten bleibt.

1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.2 SOZIALES 1 85
■ Alles beim Alten
29 Jahre lang haben Martha und Otto H.einen Bauernhof bewirtschaftet.Auf den sieben Hektaren Land wurde Milchwirtschaft und Obstbau betrieben.Martha H.wurde auf dem Betrieb gebraucht,auch die Kinder mussten alle zupacken.Die Familie wohnte mit ihren sechs Kindern,drei Mädchen und drei Buben,an einer schönen,ruhigen Lage etwas ausserhalb des Dorfes,ideal für die kinderreiche Familie.Die junge Bauernfamilie wohnte zu Beginn mit Ottos Eltern im gleichen Haushalt bis das vierte Kind unterwegs war.Dann zogen die Eltern ins Dorf und machten der jungen Familie Platz.Eine Zweitwohnung lag damals nicht drin,weshalb auch das Wohnrecht kein Thema war.
Weil keines der Kinder in die Landwirtschaft einsteigen wollte,beschlossen die H.’s den Hof noch vor Erreichen des AHV-Alters zu verkaufen.Martha hatte damit fast noch mehr Mühe als Otto,der ohnehin lieber in einer Bank gearbeitet hätte ...– doch die Versteigerung der Kühe stimmte beide Beteiligte traurig.Den H.’s war es wichtig,dass eine Familie den Betrieb kaufen konnte.Sie haben den Betrieb daher nicht an den Meistbietenden verkauft,sondern gaben einer ehemaligen Pächterfamilie eine Chance.
Nach dem Verkauf des Hofs übernahmen Martha und Otto gemeinsam eine Stelle als Schulhauswart.Diese schöne Zeit dauerte leider nicht wie geplant bis zum AHV-Alter. Der frühe Tod von Otto veränderte wiederum die Lage von Martha.Sie gab schliesslich den Schuldienst auf,nachdem sie noch zwei Jahre mit einem der Söhne weiter gearbeitet hatte.Heute wohnt die verwitwete Martha H.in einer Mietwohnung im Nachbardorf.Regelmässig besucht Martha das Grab ihres Mannes am früheren Wohnort und spaziert dort an ihrem ehemaligen Betrieb vorbei.Näheren Kontakt zu den neuen Hofbesitzern pflegt sie jedoch nicht.
Als ehemalige Bäuerin kauft Martha H.sehr bewusst ein und bevorzugt Schweizer Produkte.Sie nimmt auch Stellung für die Bauern,wenn diese in die Kritik geraten. Martha ist mit ihren über 80 Jahren noch sehr aktiv:«Ich sage,mir hat die Woche immer noch zu wenig Tage».Sie besorgt den Haushalt,macht Fussreflexzonenmassagen und übernimmt die Krankenkommunion für die Kirche.Im Sommer geht sie gerne mit den Naturfreunden wandern.Dies geniesst sie heute doppelt,weil sie früher zu Hause im Restaurant der Eltern und dann auf dem Bauernhof ständig angebunden war.Einzig eine bevorstehende Augenoperation bereitet ihr etwas Sorge,aber sonst ist Martha mit ihrem jetzigen Leben zufrieden und dankbar.

1.2 SOZIALES 1 86
■ Anderen eine Chance geben
Fritz und Ursula A.haben drei erwachsene Söhne.Der Älteste und der Jüngste haben den elterlichen Betrieb als Gebrüdergemeinschaft übernommen,nachdem Fritz A.nach einer Hüftoperation mit Komplikationen zwei Jahre arbeitsunfähig war.Die vorzeitige Hofübergabe war für alle Beteiligten die beste Lösung.
Das alte Bauernhaus wird jetzt von der jungen Generation bewohnt.Fritz und Ursula A. wohnen in einem Haus nebenan,das nicht zum Betrieb gehört.In diesem Haus wohnten sie erst zur Miete,dann konnten sie es käuflich erwerben.Trotz der Fremdfinanzierung ist der Schuldzins durch die Miete der zweiten Wohnung abgedeckt.So leben sie in gesicherten finanziellen Verhältnissen.

Auf dem Betrieb läuft es gut.Inzwischen ist die Gemeinschaft noch auf einen weiteren Betrieb ausgedehnt worden,von einem dritten Betrieb pachten sie das ganze Land. Fritz A.betätigt sich nach wie vor im Stall.Als «Morgenmensch» macht es ihm nichts aus,früh aufzustehen.Im Gegenteil,für ihn ist die Stallarbeit eine willkommene Abwechslung.
Fritz und Ursula A.gehen gerne in die Berge.Jetzt haben sie etwas mehr Zeit dafür. Früher hat Ursula viel gestrickt,und Fritz spielte Handorgel.Doch heute wollen die Finger nicht mehr so richtig.Ursula A.hat inzwischen den Computer entdeckt,auch wenn sie manchmal von gleichaltrigen Nachbarn deswegen belächelt wird.Fritz A.ist hingegen eher der Bastlertyp und beschäftigt sich mit Holzarbeiten.Wichtig finden beide,dass sie Autofahren können,insbesondere da sie etwas abseits wohnen,und dadurch eine gewisse Unabhängigkeit haben.
Die junge und ältere Generation kommt gut miteinander aus,dafür sorgt auch die räumliche Distanz,davon ist Ursula A.überzeugt.Die Umstellung von einem Gross- zu einem Zwei-Personen-Haushalt bereitete ihr am Anfang etwas Mühe.Nach dem Umzug ins neue Haus vermisste Ursula A.den regen Betrieb und die vielen sozialen Kontakte.Lachend erzählt sie:«Drüben war ich dauernd beansprucht gewesen vom Telefon,an der Türe ...und hier:Funkstille.» Als positiv empfinden beide,dass sie die Verantwortung für den Betrieb nicht mehr tragen.Die A.’s haben akzeptiert,dass ein Lebensabschnitt definitiv zu Ende ist.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.2 SOZIALES 1 87
■ Ein neuer Lebensabschnitt
■ Fazit aus den Porträts
Immer wieder wurde in den Gesprächen betont,wie sehr die mit der Pensionierung gewonnene Ungebundenheit vom Betrieb geschätzt wird:Die Pensionierten haben nun mehr Freizeit,und auch die Möglichkeit in die Ferien zu gehen.Dies geht in die gleiche Richtung wie die Ergebnisse der quantitativen Erhebung über die Lebensqualität (vgl.Agrarbericht 2005),bei welcher die grössten Defizite bei Landwirten und Bäuerinnen im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung bei der zur Verfügung stehenden Zeit und Freizeit lagen.Meist war mit der Übernahme des Betriebs nebst einem Wohnrecht seinerzeit auch ein Pflegerecht der Eltern resp.Schwiegereltern verbunden,da es zu jener Zeit u.a.noch keine obligatorische Krankenversicherung gab.Dieses Pflegerecht war für einige eine grosse körperliche und auch psychische Belastung.Das Losund Überlassen des Betriebes fällt je nach Persönlichkeit und Situation mehr oder weniger leicht.Bestand die Aussicht auf eine Übergabe der Betriebe,so wurde viel investiert und z.T.auch beträchtliche Entwicklungen erreicht.Insgesamt zeigte sich im Rückblick trotz mancher Härten ein erfreuliches Bild von der dritten Lebensphase der Bäuerinnen und Bauern.
88
1.2 SOZIALES 1
Die Agrarpolitik konzentriert sich auf die nachhaltige Entwicklung;ein Pfeiler davon ist die Ökologie.Zur Wirkungsanalyse werden sechs Themenbereiche in einem Vierjahresrhythmus beobachtet.2006 beginnt ein neuer Zyklus mit den Themen Phosphor und Boden,die bereits 2002 behandelt wurden.
Im ersten Teil des Kapitels wird wie jedes Jahr auf die Entwicklung der Nutzung des Kulturlandes und der Produktionsmittel eingegangen.Der zweite Teil steht im Zeichen des Phosphors,der auf internationaler,nationaler und regionaler Ebene sowie nach Kulturart untersucht wird.Der dritte Teil ist dem Boden gewidmet und befasst sich nach einer weltweiten Bestandesaufnahme mit der Entwicklung der Bodennutzung in der Schweiz und der Qualität der Landwirtschaftsböden (Erosionsgefahr,Schwermetalle, organische Schadstoffe).
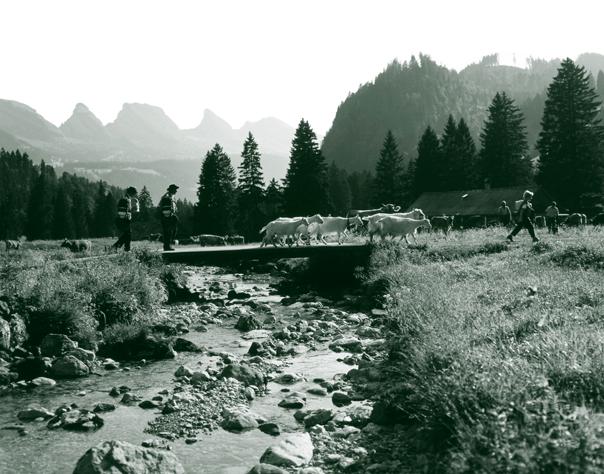
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3Ökologie und Ethologie ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3.1Ökologie
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 89
Bodennutzung und Produktionsmittel
Entwicklung des Anteils der Fläche mit umweltschonender Bewirtschaftung in % der LN umweltschonende Bewirtschaftung 1 davon Bio Quelle: BLW 1 1993 bis 1998: IP+Bio; ab 1999: ÖLN 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 2005 2004 2003 Entwicklung der ökologischen Ausgleichsflächen 1 199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 in 1 000 ha Berggebiet Talgebiet Quelle: BLW 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume, vor 1999 nur zu Beiträgen berechtigte ökologische Ausgleichsflächen 0 140 120 100 80 60 40 20 Entwicklung des Tierbestandes 199019961997199819992000200120022005 (prov.) 2004 2003 in 1 000 GVE 1 übrige Schweine Rindvieh Quelle: BFS 1 GVE: Grossvieheinheit 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 90

Entwicklung des Mineraldüngerverbrauchs in 1 000 t Stickstoff (N)Phosphat (P2O5) Quelle: SBV 1990/9219941996199820002002 19931995199719992001 0 80 70 60 50 30 40 20 10 20032005 2004 Entwicklung des Kraftfutterverbrauchs 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032005 (prov.) 2004 in 1 000 t CH andere Kuchen CH Ölsaaten CH Futtergetreide Veredelung von Importen Importfuttermittel Quelle: SBV 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 91

1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 92 Entwicklung des Pflanzenschutzmittelverkaufs 199019911992199319941995199619971998199920002001200220032005 2004 in t Wirkstoff Fungizide, Bakterizide, Saatbeizmittel Herbizide Insektizide, Akarizide Wachstumsregulatoren Rodentizide Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500
■ P-Düngung für produktive Landwirtschaft unentbehrlich
Phosphor
Folgende zwei Grundregeln bestimmen den richtigen Düngereinsatz:
1.Das Gesetz des Minimums.Es besagt,dass der im Minimum vorhandene Wachstumsfaktor (die verschiedenen Pflanzennährstoffe,Wasser,Licht,Temperatur) den Ertrag und die Qualität bestimmt.
2.Das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs.Es besagt,dass bei steigendem Nährstoffangebot der Ertragszuwachs pro zusätzliche Nährstoffeinheit immer kleiner wird und gegen Null strebt.Ein zu hohes Nährstoffangebot kann zu Ertragsund/oder Qualitätseinbussen führen.
Phosphor (P) gehört wie Stickstoff,Kalium,Calcium,Magnesium und verschiedene Spurenelemente zu den unentbehrlichen Pflanzennährstoffen.Er wird dem Boden entzogen,von den Pflanzen aufgenommen und in die landwirtschaftlichen Produkte eingebaut.Im Grasland Schweiz mit relativ hohem Tierbestand kehrt ein grosser Teil dieser Nährstoffe in Form von Hofdüngern auf den Boden zurück.Nährstoffe in landwirtschaftlichen Produkten für die menschliche Ernährung (oder für die Energieproduktion) verlassen aber den landwirtschaftlichen Betrieb und müssen durch zugeführte Dünger ersetzt werden,sonst nehmen Ertrag und Qualität je nach Nährstoff mehr oder weniger rasch ab.
■ Richtige Düngung ist anspruchsvoll
Die gute landwirtschaftliche Praxis berücksichtigt bei der Düngung die folgenden Aspekte:
–Nährstoffbedarf der Pflanzen –Nährstoffvorrat des Bodens –Anfall betriebseigener Hofdünger
–Lagerungs- und Ausbringtechnik der Hofdünger –Nährstoffgehalt und weitere Eigenschaften von Hof-,Recycling- und Mineraldüngern –Verhalten der Düngemittel und Nährstoffe im Boden –zeitlichen Nährstoffbedarf der einzelnen Kulturen –Wirtschaftlichkeit
Werden diese Aspekte berücksichtigt,sind gleichzeitig agronomische und ökologische Anliegen erfüllt.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 93
■ In der Landwirtschaft fehlt nur sehr wenig Phosphor
Anfangs des letzten Jahrhunderts war die P-Versorgung der meisten Böden in der Schweiz mangelhaft.Danach wurden die Böden während rund 80 Jahren mit billig erhältlichen P-Mineraldüngern aufgedüngt.Heute sind die meisten landwirtschaftlichen Böden mit Phosphor ausreichend versorgt,teilweise auch überversorgt.Aus agronomischer Sicht ist dies eine wertvolle Reserve,da Phosphor im Boden bis zur Sättigung gut festgehalten wird.Danach kann er allerdings ausgewaschen werden. Phosphor wird zu einem Problemstoff,wenn er in zu grossen Mengen in stehende Gewässer gelangt.Er ist zudem ein sehr begrenzter Rohstoff,der je nach Quelle bei heutigen Verbrauchsraten nur noch für 80–120 Jahre in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird.Es ist eine Verschwendung knapper Ressourcen,Phosphor zu düngen,wenn er nicht benötigt wird.Zudem nimmt die Qualität der P-Rohstoffvorkommen laufend ab,weil zuerst die schwermetallärmsten Vorkommen abgebaut werden und zunehmend auf Vorkommen mit höherem Schwermetallgehalt ausgewichen werden muss.Angesichts der knappen Ressourcen sollte die Rückgewinnung von Phosphor aus Abfällen,die wir heute weitgehend entsorgen (Klärschlamm,Fleischund Knochenabfälle) wieder ein Thema werden.In der Schweiz ist die P-Versorgung der Böden heute gut und die Eigenversorgung über Hofdünger ist hoch.Werden noch die P-Einträge über Kompost und andere Recyclingdünger (ohne Klärschlamm) eingerechnet,muss nur noch wenig P-Mineraldünger zur Deckung des landwirtschaftlichen P-Bedarfs eingesetzt werden (weniger als 1000 t P pro Jahr).Dies entspricht weniger als 5% des P-Bedarfs.Eine grosse Herausforderung besteht darin,die Hofdünger optimal zu verteilen.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 94
P-Mineraldüngerbedarf in der Landwirtschaft 2004
in t P
P-BedarfP-Zufuhr
Mineraldüngerbedarf Deposition, Kompost, andere Hofdünger Futterproduktion Nahrungsmittel 0 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
In den Industriestaaten wird Phosphor seit Jahrzehnten vor allem als Umweltproblem diskutiert,das Gewässer belastet.Unterdessen werden in der Schweiz 97% aller Abwässer aus Haushaltungen,Industrie und Gewerbe in Kläranlagen geleitet und zum grössten Teil mit chemischer P-Fällung und teilweise sogar in einer vierten Reinigungsstufe (zusätzliche P-Ausscheidung durch Flockungsfiltration) behandelt.1986 wurden P-haltige Waschmittel verboten.Auch die Landwirtschaft hat wirksame Massnahmen ergriffen.Insbesondere ist die Verwendung von P-Mineraldüngern seit 1990/92 um beinahe drei Viertel zurückgegangen,in der Schweinemast ist P-reduziertes Kraftfutter weit verbreitet und die Lagerkapazität für Hofdünger hat zugenommen.Vor allem die Abwasserreinigung,aber auch die Anstrengungen der Landwirtschaft haben zu einer starken Verminderung der P-Einträge in die Oberflächengewässer geführt.Die Schweiz hat die Verpflichtung gemäss OSPAR-Abkommen (Oslo-Paris-Abkommen zum Schutz der Nordsee),die P-Einträge in den Rhein bis 2000 gegenüber 1985 um 50% zu senken,deutlich übertroffen.
Der Vergleich verschiedener Länder zeigt,dass alle Länder von 1985 bis 2000 massive Reduktionen bei den P-Einträgen in die Oberflächengewässer im Umfang von mindestens 50% erreicht haben.Eine Ausnahme bildet Schweden.Hier waren die P-Einträge schon 1985 auf einem sehr tiefen Niveau.Grosse Reduktionen traten bei der Quellengruppe Industrie,Gewerbe,Haushalte auf.Sie sind Massnahmen bei der Abwasserbehandlung und in der Industrie zu verdanken.
Bei den diffusen P-Einträgen sind die Reduktionen deutlich geringer.Dazu zählen alle übrigen Einträge,v.a.solche durch Abschwemmung,Erosion,Auswaschung und Drainage.Ein Teil dieser Einträge findet auch ohne Landwirtschaft statt.Es handelt sich um die natürliche Hintergrundlast.Sie bleibt im Laufe der Zeit konstant.1985 betrug der Anteil der diffusen Belastung an den P-Einträgen meist weniger als 20%.2000 war er – relativ – in vielen Ländern deutlich höher.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 95 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ P-Einträge in die Gewässer haben stark abgenommen
198520001985200019852000198520001985200019852000 1985 BelgienDänemarkDeutschlandNiederlandeNorwegenSchwedenSchweiz 2000 17 800 7 429 5 875 1 605 73 365 25 018 30 615 8 875 1 853 693 995 1 140 3 064 665 P-Einträge in % nach Quelle
P-Einträge ins Meer direkt oder via Zuflüsse, Ländervergleich
Quelle: OSPAR Commission 2003 t/P 0 100 80 60 40 20
Industrie, Gewerbe, Haushalt Diffuse Belastung (Landwirtschaft und natürliche Hintergrundlast)
In der Schweiz haben die diffusen P-Einträge im Einzugsgebiet des Rheins unterhalb der Seen im Beobachtungszeitraum um 154 t oder 28% abgenommen.Bezogen auf die diffusen P-Einträge,die auf die Landwirtschaft zurückzuführen sind (total diffuse Einträge minus natürliche Hintergrundlast von 137 Tonnen) beträgt die Reduktion 38%.Der Anteil der diffusen Belastung an den gesamten P-Einträgen in die Oberflächengewässer betrug im Jahr 2000 27%.Der grösste Teil der gesamten P-Einträge in der Schweiz stammt immer noch aus nicht landwirtschaftlichen Quellen,auch wenn die Landwirtschaft bei verschiedenen kleinen und mittleren Seen des Mittellandes die Hauptverursacherin ist.
Allgemein ist in der Beobachtungsperiode ein markanter Rückgang der P-Konzentrationen in den Schweizer Seen festzustellen.Dieser Rückgang findet seit etwa Mitte der siebziger Jahre statt.Am stärksten sind die Reduktionen im Sempacher-,Hallwilerund Baldeggersee,in denen die P-Konzentration besonders hoch war.Dieser Rückgang ist primär den Fortschritten in der Abwassersanierung zu verdanken.Der Thuner- und der Vierwaldstättersee sind Seen mit sehr tiefen P-Konzentrationen.Diese sind in der Beobachtungsperiode in etwa gleich geblieben.

1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 96
Entwicklung der P-Konzentrationen in Schweizer Seen 1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005 mg P/m 3 Wasser Quelle: BAFU 0 140 120 100 80 60 40 20 Greifensee Thunersee Sempachersee Baldeggersee Hallwilersee Zürichsee Lago di Lugano sud Vierwaldstättersee Qualitätsziel
■ Die P-Gehalte in Seen haben markant
abgenommen
■ Landwirtschaft als Hauptverursacherin erhöhter P-Konzentrationen in einzelnen Seen
Um Problemgebiete bezüglich P-Gehalt in Seen identifizieren zu können,hat das BAFU die Gewässereinzugsgebiete von Seen mit erhöhten P-Gehalten ausgeschieden.Es wurden nur Seen mit über 3 km2 Fläche und Einzugsgebiete unterhalb 1’200 m ü.M. berücksichtigt.Massnahmen sollen überall dort ergriffen werden,wo der P-Gehalt im durchmischten Freiwasser von Seen über 20 µg/l liegt.
Gewässereinzugsgebiete mit erhöhtem P-Gehalt im Seewasser 1, 2004
P-Gehalt im Seewasser über 20 µg / L (P-Eintrag zu über 50% aus der Landwirtschaft) Phosphorbilanz (Eigenversorgung) >100% Sömmerungsgebiet
In der gezeigten Karte sind nur Seen aufgeführt,deren P-Gehalt im Seewasser im Mittel der letzten fünf Jahre über 20 µg/l liegt und deren Frachtanteil am gesamten P-Eintrag zu über 50% aus der Landwirtschaft stammt.Es handelt sich um den Hallwiler-,Baldegger-,Sempacher- und Zugersee sowie den Murten- und den Greyerzersee.Darüber hinaus gibt es verschiedene andere Seen,deren P-Gehalt im Seewasser über 20 µg/l liegt (z.B.Luganer-,Greifen-,Genfer- und Zürichsee).In diesen Seen sind aber andere Verursacher hauptverantwortlich für die P-Einträge.
Eine mögliche Ursache für erhöhte P-Einträge in Oberflächengewässer aus der Landwirtschaft ist eine P-Eigenversorgung von über 100%.In der Karte sind grössere Regionen aufgeführt,in denen der Tierbesatz so hoch ist,dass gesamthaft mehr Hofdünger anfällt als von den Kulturen benötigt wird (Mineraldüngerzufuhr und Hofdüngerabgaben werden nicht berücksichtigt).Daneben gibt es andere Ursachen,wie z.B.die Bewirtschaftungsweise,den Umgang mit den anfallenden Hofdüngern,die Erosion von mit Phosphor angereicherten Böden oder die P-Auswaschung aus solchen Böden.Zur Lösung solcher Probleme wurden im Hallwiler-,Baldegger- und Sempachersee bereits vor mehreren Jahren Sanierungsprojekte nach Art.62a Gewässerschutzgesetz gestartet.Gemäss diesem Gesetz kann der Bund unter bestimmten Voraussetzungen und im Rahmen der bewilligten Kredite Abgeltungen an Massnahmen der Landwirtschaft zur Verminderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen leisten.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 97
Gewässereinzugsgebiet = bilanz98 Quelle: BLW, AGIS Kartendaten GG25 ©Swisstopo/BAFU
1 nur Seen, in denen der Phosphor zu über 50% aus der Landwirtschaft stammt, P-Gehalt bezieht sich auf Mittelwerte 2000–2004
■ P-Dünger werden immer effizienter verwendet
Entwicklung von P-Überschuss und P-Effizienz
Die P-Überschüsse lassen sich aus der Differenz zwischen der Zufuhr in und der Wegfuhr von Phosphor aus der Landwirtschaft berechnen.Die hier verwendete OSPAR-Methode berücksichtigt den innerlandwirtschaftlichen Kreislauf nicht.Dazu gehören selbst produziertes Futter und Hofdünger.Die gesamte Landwirtschaft wird wie ein einziger Betrieb betrachtet.Die Zufuhr umfasst importierte Futtermittel, Mineral- und Recyclingdünger,das importierte Saatgut und die Deposition aus der Luft. Die Wegfuhr setzt sich zusammen aus den pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln und anderen Produkten,welche die Landwirtschaft verlassen.Der Überschuss hat vor allem in der ersten Hälfte der neunziger Jahre sehr stark und seitdem nur noch langsam abgenommen.Seit dem Jahr 2000 schwankt der P-Überschuss zwischen 5’500 und 7’000 t.
Die P-Effizienz (kg P-Output pro kg P-Input) hat in der Beobachtungsperiode entsprechend stark zugenommen und liegt heute bei gut 60%.Im Idealfall würde sie fast 100% betragen.Davon ist die Landwirtschaft immer noch deutlich entfernt.Auffällig ist die deutliche Zunahme der P-Effizienz Mitte der neunziger Jahre.Sie ist vor allem eine Folge davon,dass infolge BSE und des teilweisen Fütterungsverbots viel weniger Tiermehl verfüttert wurde und somit mehr Phosphor die Landwirtschaft verliess (in der Zwischenzeit wurde die Verfütterung von Tiermehl für alle Tierkategorien verboten).
Eine weitere Ursache der verbesserten P-Effizienz ist die zunehmende Verwendung von Futter mit reduziertem Gehalt an Stickstoff und Phosphor in der Mast.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 98
/ Input
Output
199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004 P-Überschuss Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 25 000 20 000 10 000 5 000 15 000 in t P Output / Input 0 0,70 0,50 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10
■ Verwendung von Mineraldüngern hat stark abgenommen
Zusammensetzung des P-Inputs
Die grössten P-Einträge stammen von den Mineraldüngern und den importierten Futtermitteln.Während der P-Eintrag über die importierten Futtermittel in der Beobachtungsperiode leicht zunahm,ist bei den Mineraldüngern eine Abnahme um über 60% zu verzeichnen.Auffällig ist auch der starke Rückgang beim Klärschlamm seit dem Jahr 2000,der auf das angekündigte Verbot des Einsatzes in der Landwirtschaft zurückzuführen ist.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 99
199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004 in t P Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Import Futtermittel Klärschlamm Mineraldünger andere Inputs
■ Landwirtschaftlich nutzbares Land ist knapp …
Boden
Boden ist die äusserste,in der Regel 50 cm bis 2 m dicke,belebte Verwitterungsschicht der Erdrinde.Wir können ihn als sehr dünne und verletzliche «Haut» der Erde ansehen. Der Boden erfüllt eine Vielzahl äusserst wichtiger Funktionen,welche das Leben auf der Erde erst ermöglichen (vgl.Agrarbericht 2002,S.113 ff.).
Eine für das Überleben der Menschheit zentrale Funktion ist die Produktion von Nahrungsmitteln.Diese Funktion hängt unter anderen von zwei Bedingungen ab: erstens müssen genügend landwirtschaftliche Nutzflächen zur Verfügung stehen und zweitens muss die Qualität dieser Flächen erhalten oder gar verbessert werden.
Von der gesamten Erdoberfläche von rund 51’000 Mio.ha sind knapp 30% (14'800 Mio.ha) Festland.Mehr als ein Drittel davon ist mit Eis bedeckt,reine Wüste oder unfruchtbares Hochgebirge (5'600 Mio.ha).Ein knappes Drittel (4'172 Mio.ha) ist Wald.Ein weiteres Drittel wird heute vorwiegend landwirtschaftlich genutzt (3'485 Mio.ha davon sind Weide und Steppe,1’534 Mio.ha Ackerland und Dauerkulturen).
Gliederung der Erdoberfläche
Weide, Steppe 7%
intensiv landwirtschaftlich genutzt 3% Wald 8%
Wüste, Hochgebirge, eisbedeckt 11%
Wasserfläche 71%
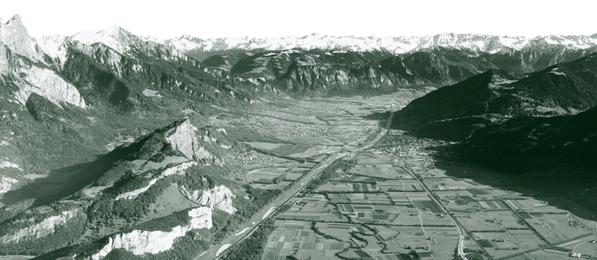
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 100
Quelle: FAO, UNEP
■ … und die Expansionsmöglichkeiten sind bescheiden …
Gemäss FAO lässt sich das anbaufähige Land nur noch wenig steigern.In Süd- und Ostasien sowie in Europa wird das meiste landwirtschaftlich nutzbare Land schon heute genutzt.In West-Asien,grossen Teilen von Australien und Nordafrika begrenzt Wassermangel die landwirtschaftlich nutzbare Fläche.In Afrika südlich der Sahara und in Südamerika gibt es die grössten landwirtschaftlich nutzbaren Landreserven.Dies geht allerdings vor allem auf Kosten der Wälder,was zu andern schwerwiegenden Auswirkungen führen kann (Biodiversitätsverluste,abnehmende Holzproduktion, Klimawandel etc.).Gemäss den Schätzungen der FAO sind nur 11% der Landfläche (1’630 Mio.ha) für intensive landwirtschaftliche Nutzung geeignet.
Von 1900 bis 1980 konnte das Ackerland stetig ausgedehnt werden,vor allem auf Kosten des Waldes.Seit diesem Zeitpunkt blieben die Ackerflächen aber etwa gleich gross.Dies gibt einen Hinweis darauf,dass für die Gewinnung von zusätzlichem Landwirtschaftsland Grenzen gesetzt sind.Die Erdbevölkerung hingegen stieg von 1,6 Mrd. im Jahr 1900 auf 6,4 Mrd.im Jahr 2000 und wird weiter wachsen.Aus dieser unterschiedlichen Entwicklung ergibt sich eine deutliche Abnahme der Ackerfläche pro Erdenbewohner von 0,5 ha im Jahr 1900 auf 0,23 ha im Jahr 2000.Bis 2100 wird eine Bevölkerungszahl von rund 10 Mrd.Menschen prognostiziert.Aus diesem Grund nimmt das Ackerland pro Erdbewohner weiterhin laufend ab.
Dazu kommt,dass die begrenzten Flächen an qualitativ gutem Boden durch mannigfache Einwirkungen geschädigt werden.Rund 15% der Landfläche (22 Mio.km2) werden bereits heute als degradiert betrachtet.Weltweit gesehen an vorderster Stelle steht die Bodendegradierung durch Wassererosion,gefolgt von Schadstoffbelastung, Winderosion,Verdichtung und Versalzung.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 101
Erdbevölkerung (Mrd. Einwohner) Ackerland (Mrd. Hektaren)
190019201940196019802000 Ackerland (Hektaren / Einwohner) Quelle: FAO 0 7 6 5 3 4 2 1 Mrd. ha / Mrd. Einwohner ha / Einwohner 0 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1
Ackerland pro Einwohner weltweit
■ In der
Von der Gesamtfläche der Schweiz von gut 41'000 km2 gelten etwas mehr als 10% als ackerfähige Böden.Dazu zählt Boden,der gemäss Arealstatistik zum günstigen Wiesund Ackerland,zum übrigen Wies- und Ackerland oder zu den Heimweiden gehört, unter 900 m ü.M liegt und eine Hangneigung von weniger als 20% aufweist.Dieser agronomisch wertvolle Boden ist besonders knapp.Er steht unter hohem Druck.Die Siedlungs- und Verkehrsfläche,die heute bereits rund 7% der Gesamtfläche der Schweiz beansprucht,dehnt sich immer weiter aus,zu einem guten Teil auf Kosten der ackerfähigen Böden.Weitere Gründe für deren Abnahme können auch die Rodungsersatzpflicht gemäss Waldgesetz und der Raumbedarf für Fliessgewässer sein.
Die Fläche der ackerfähigen Böden,die Grundlage unserer Ernährung,hat zwischen 1979/85 und 1992/97 um 10'352 ha abgenommen.Neuere Angaben dazu gibt es nicht.In dieser Zeit hat die Einwohnerzahl in der Schweiz zugenommen.Hierzu liegen auch Angaben für das Jahr 2005 vor.Die Fläche ackerfähiger Böden pro Einwohner für 2005 wurde aufgrund der Flächenangabe von 1992/97 und der aktuellen Einwohnerzahl berechnet.Sie beträgt heute in der Schweiz 6,5 Aren pro Einwohner gegenüber 23 Aren pro Einwohner global betrachtet.Die effektive Fläche dürfte noch etwas tiefer sein,da die Bautätigkeit unvermindert anhält.

1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 102
Schweiz sind ackerfähige Böden besonders knapp
Einwohner (Mio.) ackerfähige Böden (Mio. x 10 Aren)
ackerfähige Böden (Aren / Einwohner) Quelle: BFS 0 8 7 6 3 4 5 2 1 Mio. Einwohner / Mio. x 10 Aren Aren / Einwohner 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ackerfähige Böden pro Einwohner in der Schweiz
1979/851992/972005
■ Fruchtfolgeflächen als Schutz agronomisch guten Bodens
Der Schutz der besten Ackerböden ist seit Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes vom Juni 1979 ein zentrales Element der schweizerischen Raumordnungspolitik.Mit dem Ziel,das Kulturland besser zu schützen,hat der Bundesrat mit Beschluss vom 9.April 1992 den Sachplan Fruchtfolgeflächen verabschiedet.Der Sachplan legt den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen (FFF:total 438'560 ha) und die kantonalen Flächenanteile fest.Er verpflichtet die Kantone,die nötigen Massnahmen zur Sicherstellung des kantonalen Mindestumfanges an Fruchtfolgeflächen zu treffen.Die FFF umfassen das ackerfähige Kulturland (inkl.ackerfähige Naturwiesen) und somit lediglich einen Teil der LN.Im Rahmen der Überprüfung des Sachplans 2003 wurde festgestellt,dass der Mindestumfang an FFF gesamtschweizerisch noch vorhanden ist.Die Reserven haben jedoch deutlich abgenommen.In einzelnen Kantonen ist der Mindestumfang nicht mehr vorhanden.Zur Verbesserung des Vollzugs des Sachplans FFF wurde eine Vollzugshilfe erarbeitet.Bei Einzonungen und anderen Vorhaben,welche FFF beanspruchen,ist immer eine Interessenabwägung vorzunehmen und der Sachplan FFF als nationales Anliegen zu gewichten.
Die FFF liegen vor allem im Mittelland,wo auch der Siedlungsdruck besonders gross ist.Im Alpenraum ist der Anteil FFF an der LN bescheiden.
■ Bodennutzung ist stetem Wandel unterworfen
Die Landschaft in der Schweiz erfährt durch den steten Wandel der Bodennutzung eine langsame aber deutliche Veränderung.Gemäss Arealstatistik haben Landwirtschaftsflächen im Dauersiedlungsgebiet zwischen 1979/85 und 1992/97 um 30'300 ha abgenommen (–3,0%).Dafür ist praktisch ausschliesslich die Ausdehnung der Siedlungsflächen verantwortlich.Die Alpwirtschaftsflächen sind um 17'900 Hektaren zurückgegangen (–3,2%).Hier sind rund 80% der Abnahme auf die Ausdehnung bestockter Flächen (Wald,Gebüsch) zurückzuführen.Die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche hat um 48'200 Hektaren abgenommen (–3,1%).
Aber auch bei der Nutzung der LN finden markante Veränderungen statt.Im Beobachtungszeitraum hat z.B.die mit Feldobstbäumen bestockte Fläche um über 25% abgenommen.Auch diese Flächen fielen zu einem grossen Teil dem Siedlungsbau zum Opfer.Umgekehrt haben wertschöpfungsintensive Spezialkulturen wie Garten- und Weinbau deutlich zugenommen.
Die Zersiedlung sowie der Druck auf das beste Kulturland halten unvermindert an. Wie die Arealstatistik zeigt,werden pro Kopf der Bevölkerung inzwischen rund 400 m2 Boden für Siedlungszwecke beansprucht.Innert 12 Jahren (von 1979/85 bis 1992/97) hat die Landwirtschaft 482 km2 Kulturland verloren.Das entspricht der Fläche des Kantons Obwalden.Täglich verliert die Landwirtschaft weitere 11 Hektaren Kulturland. Da die Waldfläche per Gesetz geschützt ist und die unfruchtbaren Flächen sowie die Gewässerfläche sich kaum ändern,gehen die Flächenverluste fast ausschliesslich auf Kosten der LN.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 103
■ Qualität der Böden muss erhalten werden
Die Erhaltung einer guten Bodenqualität ist nicht selbstverständlich.Durch die landwirtschaftliche Tätigkeit wie durch andere Einflüsse können erhebliche Beeinträchtigungen der Bodenqualität stattfinden (Bodenkonzept des BLW,Agrarbericht 2002, S.113 ff.).Durch eine angepasste Bewirtschaftung sind aber auch grosse Regenerationsmöglichkeiten gegeben.Insbesondere der Bodenabtrag durch Erosion,die Verdichtung des Unterbodens und der Eintrag schwer abbaubarer organischer Schadstoffe und von Schwermetallen führen jedoch zu praktisch irreversiblen Schäden im Boden. Solche Beeinträchtigungen der Bodenqualität müssen unbedingt verhindert werden. Sonst könnten die Böden auch ihre Funktion als Trinkwasseraufbereiter,als Regulatoren des Gebietswasserhaushalts und der Klimaentwicklung (Fixierung von Kohlenstoff) nur noch begrenzt erfüllen.
Um die Entwicklung der Bodenqualität im Laufe der Zeit beurteilen zu können,hat das BLW beschlossen,geeignete Bodenindikatoren zu erarbeiten und ein Monitoring durchzuführen.Folgende Bodenindikatoren sind vorgesehen:Erosionsrisiko,Gehalt an Schwermetallen und persistenten organischen Schadstoffen in Böden sowie die mikrobielle Biomasse in Böden.Bisher ist erst der Indikator «Schwermetallgehalt in Böden» erarbeitet und wird systematisch erhoben (NABO).Für die übrigen Bodenindikatoren ist noch Grundlagenarbeit notwendig.Vorläufig werden Entwicklungen mit mehr oder weniger gut abgestützten Kennzahlen verfolgt.
■ Erosion ist in der Schweiz vergleichsweise gering
Im internationalen Vergleich treten starke Erosionsereignisse auf dem Landwirtschaftsland in der Schweiz nur sehr selten auf,obwohl das Erosionspotenzial aufgrund von Niederschlägen und Hangneigung ziemlich hoch ist.Das ist darauf zurückzuführen, dass die Nutzung häufig gut angepasst ist (Wald,Grünland,Fruchtfolgen mit Kunstwiesen,kleine Parzellengrösse usw.).Erosion gibt es jedoch auch in der Schweiz.Da die durchschnittliche jährliche Bodenneubildungsrate mit etwa einer Tonne pro Hektare und Jahr äusserst gering ist,besteht auch in der Schweiz die Gefahr,dass die Gründigkeit der Böden an verschiedenen Orten im Laufe der Zeit abnimmt.
Erosion auf Ackerflächen in der Schweiz
BeschreibungBodenabtrag t/ha/Jahr
Richtwert 1 (Böden bis 70 cm Gründigkeit)2
Richtwert 1 (Böden über 70 cm Gründigkeit)4
Mittlere Bodenneubildungsrate1
Häufige Erosionsereignisse1–2
Lokale Erosionsereignisse in einzelnen Jahren6–10
Seltene lokale Extremereignissebis 55
1Richtwerte gemäss Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBO),bei deren Überschreitung ermitteln die Kantone die Ursachen der Belastung und treffen Massnahmen
Quelle:Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 104
■ Gefahr der Bodenerosion ist regional sehr unterschiedlich
Die standortbedingte Gefahr für Bodenerosion ergibt sich aus der natürlichen Erosionsanfälligkeit der Böden,der Hangneigung und der regionalen Erosionskraft der Niederschläge.Sie kann durch die Landwirtschaft kaum beeinflusst werden,sollte aber bei der Bewirtschaftung beachtet werden.An der Agroscope Reckenholz-Tänikon ART wird zurzeit in Zusammenarbeit mit der Universität Bern (CDE) eine digitale Erosionsgefährdungskarte der Schweiz im Hektarraster erstellt.
In einem ersten Schritt wurde die natürliche Erosionsanfälligkeit der Böden abgeschätzt.Sie wird vor allem durch die Körnung,den Skelettgehalt,den Humusgehalt und die Durchlässigkeit bestimmt.Stark gefährdete,schluffreiche Lössböden kommen in der Schweiz nur selten und nur im nördlichen Teil vor.Sie machen weniger als 1% der gesamten Bodenfläche aus.In zentralen Lagen des Mittellandes sowie in verschiedenen Flusstälern finden sich gefährdete Böden aus feinsandiger Molasse oder feinsandigen Alluvionen.Sie umfassen rund 3% der Böden der Schweiz.Die Böden des westlichen Mittellandes gelten als mittel erosionsgefährdet und erstrecken sich über rund 25% der Bodenfläche.Der grösste Teil der Böden des östlichen Mittellandes und des Juras,rund 31% der Böden,sind nur leicht erosionsgefährdet.Die natürliche Erosionsanfälligkeit der Böden der Alpen (also ohne Berücksichtigung der Hangneigung und der regionalen Erosionskraft der Niederschläge) ist nur gering.
■ Bewirtschaftung des Bodens beeinflusst das Erosionsrisiko stark
Die Landwirtschaft kann durch angepasste Bewirtschaftungsmassnahmen das Erosionsrisiko stark vermindern.So beeinflusst z.B.die Feldergrösse (insbesondere die Hanglänge) das Erosionsrisiko.Geeignete Strukturverbesserungsmassnahmen,z.B.die Schaffung von Vernetzungselementen und Wegen hangparallel und eine optimale Wasserableitung,können dieses ebenfalls verringern.Die wichtigsten Massnahmen sind aber einerseits gute Bodenbedeckung (weitgehend bestimmt durch die Kulturenwahl) und andererseits konservierende Bodenbearbeitungsverfahren.Bewachsener Boden ist weitgehend geschützt vor Verschlämmung,Verdichtung und Erosion,ist biologisch aktiv und speichert Wasser.Um Ackerbau zu betreiben,muss der Boden aber bearbeitet werden.Starke Bearbeitung vereinfacht die Unkrautregulierung und Saatbettbereitung.Geringe Bearbeitung bedeutet eine Annäherung an den Idealzustand des bewachsenen Bodens.Der Einfluss der Bewirtschaftung (Bodenbedeckung und Bodenbearbeitung) auf das Erosionsrisiko wird mit dem C-Faktor beurteilt.Er gibt die relative Veränderung des Bodenabtrages bei einer bestimmten Bewirtschaftung gegenüber dem Abtrag bei langjähriger Schwarzbrache an.Relief und Boden bleiben unberücksichtigt.Je grösser der Wert ist,desto grösser ist das Erosionsrisiko.
Im Seeland,im Rhonetal am Genfersee,im Züricher Unterland sowie in der Orbe- und Broye-Ebene ist der Anbau von Gemüse und Hackfrüchten verbreitet.Diese Bewirtschaftung ist mit einem relativ hohen Erosionsrisiko verbunden.Bezüglich Erosion unproblematisch ist die Bewirtschaftung in den Voralpen und im Jura aufgrund des hohen Kunstwiesenanteils.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 105 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
■ Die Kulturenwahl hat das Erosionsrisiko vermindert
Der auf Gemeindeebene berechnete,flächengewichtete Mittelwert der C-Faktoren für das Ackerland (ohne Berücksichtigung der Bodenbearbeitung) zeigt zwischen 1985 und 1990 einen Anstieg von rund 11% und danach wieder eine kontinuierliche Abnahme bis 2003 auf denselben Wert wie 1985.Die Ursache liegt darin,dass bis 1990 die offene Ackerfläche zu- und die Kunstwiesenfläche abgenommen und dass anschliessend die offene Ackerfläche wieder ab- und die Kunstwiesenfläche zugenommen haben.
Entwicklung der C-Faktoren aufgrund der Kulturenwahl
■ Regional entwickeln sich Ackerbau und C-Faktoren
Entwicklung von C-Faktoren in verschiedenen Regionen
In den Kantonen BE,SH,VD hat der Ackerbau zugenommen bzw.die Kunstwiesenfläche abgenommen und die C-Faktoren entsprechend zugenommen.In den Kantonen SO,FR,ZH,TG,AG sind diese Grössen in etwa gleich geblieben.In den restlichen Kantonen hat die Kunstwiese deutlich zu- bzw.die offene Ackerfläche abgenommen, daher der Rückgang der C-Faktoren.In dieser Gruppe sind auch absolut betrachtet die C-Faktorenheute am niedrigsten.Innerschweizerkantone mit sehr wenig Ackerflächen wurden ausgeklammert.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 106
unterschiedlich
Index: 1985 = 100%
1985199019961998200020032004 94 112 108 110 106 104 102 100 98 96
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1985199019961998200220032004
60 120 110 100 90 80 70 Index: 1985 = 100% BE,
Quelle: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
SH, VD SO, FR, ZH, TG, AG ZG, SG, GR, TI, JU, NE, VS, BL, LU, GE
Auch bei der zweiten Möglichkeit der Bauern,das Erosionsrisiko zu vermindern,findet eine positive Entwicklung statt.Gesamtschweizerisch wird ein Trend zu bodenschonenden Bearbeitungsverfahren festgestellt.Dies wurde ermöglicht durch technische Fortschritte wie die Entwicklung geeigneter Geräte für die konservierende Bodenbearbeitung und von Gerätekombinationen,welche zu weniger Überfahrten führen sowie durch ökonomische Vorteile,die sich u.a.aus der Zeitersparnis und verminderten Energiekostenergeben.In der ersten Hälfte der neunziger Jahre wurde für die Bestellung der Ackerkulturen noch mehrheitlich gepflügt.Seither haben konservierende Bodenbearbeitungsverfahren (Direktsaat,Mulchsaat,Streifenfrässaat) stark zugenommen.Sie erhöhen die Bodenbedeckung und gelten als besonders wirksame Erosionsschutzmassnahmen.Verschiedene Kantone fördern konservierende Bodenbearbeitungsverfahrendurch spezielle Programme.
Die Direktsaat als weitest reichende Form pflugloser Bestellung hat in der Schweiz von 60 ha im Jahr 1992 auf fast 12'000 ha im Jahr 2004 zugenommen.Dies sind aber erst knapp 3% der gesamten Ackerfläche der Schweiz.
Schwermetalleinträge in die Böden finden v.a.durch Lufteinträge (Abgase,Abrieb) und die landwirtschaftliche Praxis statt.Erstere verteilen sich auf alle Böden der Schweiz, während letztere nur auf den landwirtschaftlich genutzten Boden gelangen.Um abschätzen zu können,wie diese Einträge sich im Lauf der Zeit entwickelt haben, wurde aufgrund von (lückenhaften) Gehaltsangaben und Mengen der eingesetzten Stoffe eine Frachtberechnung (Gehalt mal Menge) vorgenommen.Teilweise konnte auch auf publizierte Daten zurückgegriffen werden.Es kann festgestellt werden,dass die Metalleinträge aller Eintragsquellen von 1989 bis 2004 deutlich abgenommen haben.Dies wird am Beispiel Cadmium und Kupfer gezeigt.
1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT 1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 107
■ Bodenschonende Bearbeitungsverfahren nehmen zu
in ha Quelle: no-till.ch 1992199319941995199619971998199920002001 0 14000 12000 6000 4000 10000 8000 2000 20042005 2003 2002
Entwicklung der Direktsaatflächen in der Schweiz
■ Der Schwermetalleintrag nimmt ab
des Cadmiumeintrags in den Boden 0
Entwicklung des Kupfereintrags in den Boden 120 100 80 60 40 20 Klärschlamm Kompost Hofdünger
Mineraldünger Pflanzenbehandlungsmittel
Entwicklung in t Cu Quelle: BLW
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 108
1989199419992004 in kg Cd Quelle: BLW 0 2000 1800 1600 1200 1400 800 1000 600 200 400 Klärschlamm Kompost Hofdünger Mineraldünger Luft
Der mengenmässig wichtigste Cadmium-Eintrag über die gesamte Beobachtungsperiode von 1989 bis 2004 findet über die Luft statt.Es hat aber ein Rückgang um zwei Drittel stattgefunden.An zweiter Stelle stehen die Mineraldünger.Auch hier kann eine Abnahme der Einträge auf weniger als ein Drittel festgestellt werden.Die übrigen Eintragsquellen sind weit weniger wichtig.Beim Klärschlamm ist der Eintrag auf weniger als ein Sechstel des Ausgangswerts gesunken,hauptsächlich aufgrund des starken Rückgangs der Verwertung,während er sich aus dem entgegengesetzten Grund beim Kompost etwa verdoppelt hat.Beim Hofdünger ist keine wesentliche Veränderung feststellbar. 1989199419992004
Beim Kupfer sind die Hofdünger die wichtigste Eintragsquelle.Ein Teil des Kupfers zirkuliert betriebsintern zwischen Boden,Pflanze und Tierausscheidung und führt zu keiner Cu-Anreicherung im Boden.Schätzungsweise gegen 50% der Kupferfracht in den Hofdüngern stammen aus Zusätzen zu Futtermitteln.Bei den Kupfereinträgen über Hofdünger ist nur eine geringe Abnahme feststellbar.Die zweitwichtigste Quelle sind die Pestizide.Diese Einträge haben vor allem seit 1999 deutlich abgenommen.Die Einträge über die Luft liegen nur für 1996 vor.Sie betragen etwa 40 t und liegen damit an dritter Stelle.An nächster Stelle folgt der Klärschlamm.Aus den schon genannten Gründen hat diese Quelle im Lauf der Jahre stark an Bedeutung verloren,wie umgekehrt die Bedeutung von Kompost zugenommen hat.Beim Kupfer gibt es keine nennenswerten Einträge via die Mineraldünger.
Generell ist der Eintrag der untersuchten Schwermetalle zurückgegangen.Dazu beigetragen haben u.a.Massnahmen zur Luftreinhaltung wie etwa das Verbot von bleihaltigem Benzin,das Düngungsverbot mit Klärschlamm (2006) und der verminderte Einsatz von P-Mineraldüngern.Dieser Rückgang der Schwermetalleinträge bedeutet aber keine Verbesserung der Bodenqualität.So lange der Eintrag an Schwermetallen in den Boden höher ist als der Austrag (durch Pflanzenentzug,Auswaschung und Erosion),nimmt die Belastung des Bodens mit Schadstoffen immer noch zu,wenn auch in verlangsamtem Rhythmus.

1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 109
■ Auf vielen Betrieben reichern sich Schwermetalle immer noch an
Die Anreicherung von Schwermetallen in landwirtschaftlich genutzten Böden ist in der Regel ein schleichender Prozess und deshalb schwierig zu erfassen.Um frühzeitig Hinweise auf Schadstoffanreicherung in Böden zu erhalten,werden im NABOReferenznetz neben den wiederholten Gehaltsmessungen im Boden seit 1996 für 48 Landwirtschafts-Parzellen auch jährlich Schwermetallbilanzen für Cd,Zn,Pb und Cu berechnet.Beispielhaft wird die Zinkbilanz der Jahre 1996 bis 2003 gezeigt.
Entwicklung der Zinkbilanz auf 48 Landwirtschaftsparzellen 1
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1
110
1
Nettoflux = Bilanz Ernte Deposition Pestizide Hofdünger Mineraldünger Klärschlamm –800 –800–400–4000400 in g / ha und Jahr 12001600 8002000 Spezialkulturen <0,2 DGVE/ha Ackerbau <0,2 DGVE/ha Milchvieh/ Gemischt 0,5–1,1 DGVE/ha Gemischt/ Veredlung 1,4–1,9 DGVE/ha Veredlung 2,2–2,8 DGVE/ha AusträgeEinträge
Quelle: NABO 2005
NABO-Parzellen der Jahre 1996 bis 2003 nach Betriebstypen sortiert
■ Aktuelle Schwermetalleinträge auf lange Sicht problematisch
Der Zn-Eintrag übersteigt auf praktisch allen Betrieben den Austrag.Auffällig sind die grossen Unterschiede von Betrieb zu Betrieb.Die Veredelungsbetriebe weisen im Mittel die höchsten Zink-Bilanzüberschüsse aus,gefolgt vom Betriebstyp Gemischt/Veredelung,während die Ackerbaubetriebe und die Betriebe mit Spezialkulturen nur geringe Überschüsse oder gar negative Nettoflüsse ausweisen.Der Zn- (wie auch der Cu-) Eintrag hängt im Wesentlichen vom Tierbesatz der Betriebe ab.Cu und Zn sind bedeutende Makroelemente in Futtermittelzusatzstoffen für die Tierhaltung.
Um die ökologische Bedeutung von Schwermetallbilanzen auf den landwirtschaftlichen Betrieben zu beurteilen,können die Einträge den für dieses Schwermetall geltenden Richtwerten gegenüber gestellt werden.
Für die Mehrheit der 48 Parzellen wurden ziemlich ausgeglichene Ein- und Austräge festgestellt.Die Schwermetallkonzentrationen im Boden nehmen in einem Jahrzehnt um weniger als 1% des jeweiligen Richtwertes zu.Zunahmen der Bodenkonzentrationen von mehr als 1% in einem Jahrzehnt wurden hingegen für Cadmium in sieben, für Kupfer in zehn und für Zink in 20 der 48 NABO-Parzellen prognostiziert.Auf einigen Parzellen waren stark erhöhte Einträge von Zink über Hofdünger und von Kupfer über Pflanzenschutzmittel oder Hofdünger zu verzeichnen.Die geschätzten Schwermetallzunahmen können bis zu 5% für Kupfer und Zink bei intensiver Tierhaltung und sogar 21% für Kupfer im Rebbau des jeweiligen Richtwertes in einem Jahrzehnt betragen.
■ Auch organische Schadstoffe werden in den Boden eingetragen
Während nur eine begrenzte Anzahl von 63 Schwermetallen existiert,gibt es rund 100'000 verschiedene organische Verbindungen,von denen eine unbekannte Anzahl die Fruchtbarkeit des Bodens beeinträchtigen können.Im Gegensatz zu den Schwermetallen werden die organischen Schadstoffe aber abgebaut.Von besonderer ökologischer Bedeutung sind deshalb alle organischen Schadstoffe,die nur langsam (innert Jahren bis Jahrzehnten) abgebaut werden.Diese können sich im Boden und potenziell auch in den Stoffkreisläufen anreichern.
Eine besonders problematische Gruppe organischer Schadstoffe sind die Dioxine und Furane (PCDD/F).Es handelt sich um langlebige,chlorierte organische Schadstoffe,von denen viele eine hohe Giftigkeit haben und die im Boden angereichert werden.Sie entstehen als Nebenprodukte einer Vielzahl von thermischen Prozessen,insbesondere der Abfallverbrennung.Von 1950 bis 1980 haben die luftseitigen Emissionen von Dioxin in der Schweiz (dies sind mit Abstand die wichtigsten Emissionen) von <50 auf >450 g I-TEQ (Internationale Toxizitätsäquivalente,erlaubt den Vergleich verschiedener PCDD/F) zugenommen.Seitdem sind die Emissionen sehr stark zurückgegangen, auf heute deutlich weniger als 100 g I-TEQ.Die wichtigste verbleibende Emissionsquelle sind die unkontrollierte Abfallverbrennung im Haushalt und auf Baustellen.Die Landwirtschaft trägt praktisch nichts zu diesen Emissionen bei,sie ist aber Betroffene.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
111
■ Dioxin- und Furangehalte im landwirtschaftlich genutzten Boden sind meist unproblematisch
Seit 1998 existieren in der Schweiz gesetzlich verbindliche Schwellenwerte für Dioxine und Furane in Böden.Bei der Überschreitung des Richtwerts von 5 ng I-TEQ/kg gilt die Bodenfruchtbarkeit langfristig als nicht mehr gewährleistet und es besteht ein Überwachungsauftrag.Beim Überschreiten von 20 ng I-TEQ/kg muss geprüft werden,ob die Bodenfruchtbarkeit konkret gefährdet ist und gegebenenfalls müssen Massnahmen wie Nutzungseinschränkungen vorgenommen werden.Bei der Überschreitung von 1'000 ng I-TEQ/kg besteht für sämtliche Bodennutzungen akute Sanierungspflicht.
Es liegt eine Anzahl Ergebnisse von PCDD/F-Analysen von Böden aus Kantonen vor. Diese untersuchen vorwiegend Belastungsstandorte und sind somit nicht repräsentativ für die Gehalte unter normalen Bedingungen.Sie zeigen aber,dass sich auf Landwirtschaftsland im Mittel im Vergleich mit den Richtwerten unproblematische Gehalte finden.In Einzelfällen liessen sich allerdings kritische Werte feststellen.Die Ursachen müssen durch die zuständigen Kantone abgeklärt werden.Sollten Massnahmen (z.B. Nutzungseinschränkungen) nötig sein,müssten auch diese durch die Kantone veranlasst werden.
Dioxin- und Furangehalte in Oberböden
1ng I-TEQ bedeutet Nanogramm internationale Toxizitätsäquivalente (Einheit,um die Gefährlichkeit von einzelnen Dioxin- und Furan-Gemischen besser beurteilen zu können)
Quelle:NABO 2001
An Waldstandorten werden hingegen öfter erhöhte PCDD/F-Gehalte gefunden,weil PCDD/F durch die Waldbäume aus der Luft ausgekämmt werden.Im NABO-Referenznetz mit der Aufgabe,die «normale» Belastung der Schweizer Böden zu dokumentieren,wurden im Jahr 2002 an 23 der insgesamt 105 Beobachtungs-Standorte Proben bis in eine Tiefe von 10 cm für Dioxin- und Furananalysen gezogen.Die Analysenergebnisse zeigen,dass der Richtwert an keinem der 11 Landwirtschafts-Standorte überschritten ist.An 4 der 11 Waldstandorte wurden hingegen Überschreitungen festgestellt.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 112
NutzungMin.MedianMax. ng I-TEQ/kg 1 Anzahl Werte Ackerbau0,71,134,241 Dauerwiesen0,51,9179,556
1.3.2Ethologie
Beteiligung bei den Tierhaltungsprogrammen RAUS und BTS
Im Rahmen der Direktzahlungen an die Landwirte und Landwirtinnen fördert der Bund mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere.Das RAUS-Programm enthält hauptsächlich Bestimmungen zum Auslauf auf der Weide oder im Laufhof bzw. beim Geflügel im Aussenklimabereich.Das BTS-Programm beinhaltet vor allem qualitative Vorgaben für die einzelnen Bereiche der geforderten Mehrbereichsställe,in denen sich die Tiere frei bewegen können.Die Teilnahme an einem solchen Programm ist freiwillig.Die im Folgenden genannten Prozentzahlen beziehen sich auf die Grundgesamtheit aller Direktzahlungsbetriebe bzw.aller dort gehaltenen Nutztiere.
Seit der Einführung von RAUS (1993) und BTS (1996) stieg die Teilnahme an beiden Programmen stetig:Im Jahr 2005 nahmen 37'700 Betriebe am RAUS-Programm und 17'800 Betriebe am BTS-Programm teil.
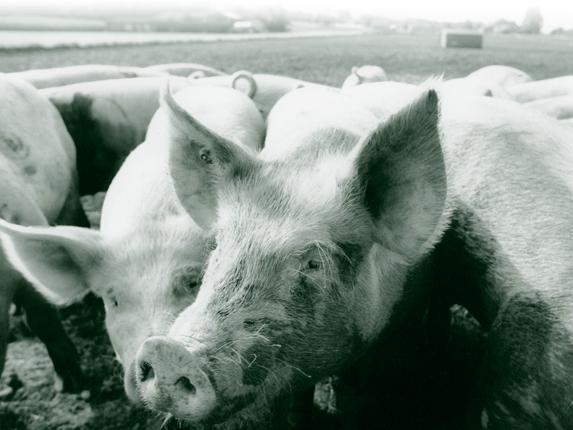
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 113 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tabellen 37–38,Seiten A42–A43
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS und BTS
Der prozentuale Anteil der nach den RAUS-Bedingungen gehaltenen Nutztiere stieg zwischen 1996 und 2005 von 19 auf 69%.Beim BTS-Programm nahm der Anteil in der gleichen Zeitspanne von 9 auf 38% zu.Diese Werte sind Durchschnittszahlen der vier Nutztiergruppen (Rindvieh,übrige Raufutter Verzehrer,Schweine und Geflügel).
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS, nach Nutztiergruppe
Wenn man die Beteiligung am RAUS-Programm nach Nutztiergruppen differenziert, stellt man beim Rindvieh und bei den übrigen Raufutterverzehrern zwischen 1996 und 2005 eine starke Zunahme von rund 20% auf rund 70 bzw.80% fest.Bei den Schweinen stieg die Beteiligung von unter 5% auf fast 60%.Die kleinere Beteiligung bei den Schweinen gegenüber dem Rindvieh lässt sich erklären durch die höheren Investitionen,die für eine Teilnahme notwendig sind.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 114
GVE-Anteil in % RAUSBTS Quelle: BLW 1996199719981999 0 60 70 80 50 40 30 20 10 2000 2001 200220032004 2005
GVE-Anteil in % Quelle: BLW Rindvieh übrige Raufutter Verzehrer Schweine Geflügel 199619971998199920012002 2000 0 70 80 90 50 60 40 30 20 10 20032004 2005
Die Entwicklung der Beteiligung beim Nutzgeflügel setzt sich hauptsächlich aus den zwei sehr unterschiedlichen Entwicklungen bei den Legehennen und bei den Mastpoulets zusammen.Währenddem die Beteiligung bei den Legehennen bis 2005 stetig zunahm (2005:63%),endete der Anstieg bei den Mastpoulets 1999 bei 42%.Seither ist ein kontinuierlicher Rückgang auf 9% im Jahr 2005 festzustellen.Diese Entwicklung wurde durch die Einführung der minimalen Mastdauer von 56 Tagen bei den Poulets ausgelöst.Durch die im Vergleich zur konventionellen Produktion wesentlich längere Mastdauer stiegen die Produktionskosten und folglich auch der Preis am Markt erheblich.Entsprechend ging die Nachfrage nach RAUS-Poulets zurück.

Differenziert man die Beteiligung am BTS-Programm nach Nutztiergruppen,stellt man beim Rindvieh und bei den übrigen Raufutterverzehrern zwischen 1996 und 2005 eine im Vergleich zum RAUS-Programm wesentlich geringere Zunahme von rund 10 auf rund 30% fest.Dies ist vor allem dadurch bedingt,dass die Investition in den meisten Fällen sehr hoch ist (Laufstall),so dass diese in der Regel erst bei einer notwendigen Ersatzinvestition getätigt wird.
Bei den Schweinen wurde das BTS-Programm erst 1997 eingeführt.Die Beteiligung verlief ähnlich wie beim entsprechenden RAUS-Programm.Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen,dass die bedeutenden Labels bei den Schweinen sowohl RAUS als auch BTS voraussetzen.
Die rasante Entwicklung der BTS-Beteiligung beim Geflügel ist zu einem grossen Teil auf den Markterfolg der Labels zurückzuführen,die sich für die besonders tierfreundliche Stallhaltung von Legehennen und Mastgeflügel engagieren.
1.3 ÖKOLOGIE UND ETHOLOGIE 1 115 1.BEDEUTUNG UND LAGE DER LANDWIRTSCHAFT
GVE-Anteil in % Quelle: BLW Rindvieh
Raufutter Verzehrer Schweine Geflügel 1996199719981999200120022003 20042005 2000 0 80 90 50 60 70 40 30 20 10
Entwicklung der Beteiligung bei BTS, nach Nutztiergruppe
übrige
1 116

■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.Agrarpolitische Massnahmen 2 117
Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln.Die finanziellen Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz nehmen laufend ab.Im Jahr 2005 wurden dafür 677 Mio.Fr.eingesetzt,über 1 Mrd.Fr.weniger als vor der Agrarreform in den Jahren 1990/92.
– Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab.Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht,weil dafür kein Markt besteht.Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher,dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden.
– Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte,sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion.Im Einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung,im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz.
118 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2
■ Finanzielle Mittel 2005
und Absatz
Artikel 7 LwG beschreibt die Zielsetzungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse.Die Landwirtschaft soll nachhaltig und kostengünstig produzieren und aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen können.Dazu stehen die Massnahmen in den Bereichen Qualität,Absatzförderung und Kennzeichnung,Ein- und Ausfuhr,Milchwirtschaft,Viehwirtschaft,Pflanzenbau und Weinwirtschaft zur Verfügung.

Im Jahr 2005 sind zur Förderung von Produktion und Absatz im ordentlichen Rahmen rund 677 Mio.Fr.aufgewendet worden.Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Aufwandminderung um rund 54 Mio.Fr.oder 7,4%.
Ausgaben für Produktion und Absatz
■ Ausblick
2007 ist infolge der Kreditsperre von 1% mit weiteren Budgetkürzungen zu rechnen.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 Produktion
Rechnung 2005Budget 2006 AusgabenbereichBetragAnteilBetragAnteil Mio.Fr.%Mio.Fr.% Absatzförderung578,4558,6 Milchwirtschaft4747044369,2 Viehwirtschaft213,1243,8 Pflanzenbau (inkl.Weinbau)12518,511818,4 Gesamttotal677100640100
Quellen:Staatsrechnung,BLW
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 119 2
Tabellen 26–29,Seiten A27–A30
2.1.1 Übergreifende Instrumente
Produzenten- und Branchenorganisationen
Im Rahmen der Landwirtschaftsgesetzgebung (Artikel 8 und 9) kann der Bundesrat die von Branchen- und Produzentenorganisationen gemeinschaftlich beschlossenen Massnahmen zur Qualitätsverbesserung,Absatzförderung und Anpassung des Angebots an die Nachfrage auch für Nichtmitglieder verbindlich erklären.Hierbei wird von «Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen» gesprochen.Die Unterstützung des Bundesrates ist für Massnahmen gerechtfertigt,die einem ganzen Sektor oder einer ganzen Branche zugute kommen und deren Nutzen nicht den Mitgliedern der Organisation vorbehalten werden kann (Problem der «Trittbrettfahrer»).Ohne Eingreifen des Bundesrates würden Unternehmen,die sich nicht an den Massnahmen beteiligen,aber dennoch davon profitieren,schnell jegliche gemeinschaftliche Initiative unterbinden. Mit seinem subsidiären Einschreiten fördert der Bundesrat die Bündelung der Kräfte. Die Branchenorganisationen können unter bestimmten Bedingungen auch Richtpreise veröffentlichen (Art.8a LwG).Dank dieser Instrumente wird die Position der Produzenten bei der Definition von Produkten und in Handelsgesprächen gestärkt.
Der Bundesrat fällte die ersten Ausdehnungsentscheide im Jahre 2001.Die seither gemachten Erfahrungen sind insgesamt positiv.Der Zusammenhalt der vom Bundesrat unterstützten Branchen hat sich dank des wirksamen Vorgehens gegen Trittbrettfahrer erhöht.Die Organisationen müssen allerdings mit möglichen Beschwerden seitens von Unternehmen rechnen,die sich nicht an die gemeinschaftlichen Massnahmen halten wollen.Die Durchführung der Massnahmen kann sich im Falle dieser Unternehmen denn auch verzögern.Im März 2006 nahm das Bundesgericht erstmals Stellung zur Anwendung dieses Instruments durch den Bundesrat.Das Gericht unterstützte vorbehaltlos die Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen sowie den bundesrätlichen Ausdehnungsbeschluss über einen Beitrag zur Finanzierung der Absatzförderung von Emmentaler.Diese Rechtssprechung dürfte die Umsetzung der Entscheide des Bundesrates vorantreiben.
Am 23.November 2005 hat der Bundesrat beschlossen,die von drei Produzentenorganisationen (Schweizerischer Bauernverband,Schweizer Milchproduzenten, GalloSuisse) und vier Branchenorganisationen (Interprofession du Gruyère,Interprofession du Vacherin fribourgeois,Emmentaler Switzerland,Sbrinz GmbH) vereinbarten Massnahmen auf alle betroffenen Nichtmitglieder dieser Organisation für zwei Jahre auszudehnen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 120 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Bündelung der Kräfte im Agrarsektor fördern
■ Erstmalige Rechtssprechung des Bundesgerichts
■ Anpassungsvorschläge des Bundesrates im Rahmen der AP 2011
In seiner Botschaft zur AP 2011 schlägt der Bundesrat dem Parlament vor,die Kontinuität der Unterstützung der Absatzförderungs- und Qualitätsverbesserungsmassnahmen sicherzustellen.Der Bundesrat hat denn auch entsprechende Beschlüsse der Branchen- und Produzentenorganisationen mehrere Male für allgemein verbindlich erklärt.Wie die Praxis gezeigt hat,verlangen diese Massnahmen Kontinuität.Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Deutschland und Österreich legt der Bund nicht selbst den Beitrag fest,den die Produzenten an die Absatzförderung leisten müssen.In der Schweiz entscheiden die Produzenten und Betriebe des Ernährungssektors über die Höhe der Beiträge,die sie für diesen Zweck einsetzen wollen.Der Bund greift in der Folge subsidiär ein,um dem Problem der Trittbrettfahrer zu begegnen.Bereits zweimal hat der Bundesrat seine Unterstützung von Absatzförderungs- und Qualitätsverbesserungsmassnahmen aus Gründen der Konstanz erneuert.Eine Änderung von Artikel 9 drängt sich auf,damit die Massnahmen nach einer periodischen Überprüfung weitergeführt werden können.Zu diesem Zweck muss wie bisher ein neues Begehren an den Bundesrat gerichtet werden.Die Unterstützung von Massnahmen zur Anpassung des Angebots an die Marktbedürfnisse hat hingegen ihren Ausnahmecharakter zu behalten und sich auf ausserordentliche,nicht strukturell bedingte Situationen zu beschränken.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 121 2
Absatzförderung
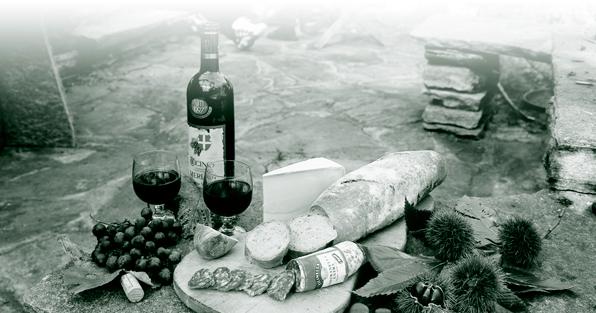
Die Ende der neunziger Jahre noch stark zersplitterten regionalen Marketinginitiativen haben sich in den meisten Landesregionen zu überregionalen Netzwerkstrukturen zusammen gefunden.Mehrere Absatzförderungsprojekte haben sich während der vom Bund unterstützten Aufbauphase zu Unternehmen,mit teilweise grosser wirtschaftlicher Bedeutung in der Standortregion,entwickelt.Einzelne Projekte erreichten die erforderliche Wirtschaftlichkeit allerdings nicht und wurden eingestellt.
Die Absatzförderung für regionale Produkte wird heute fast vollständig über die überregionalen Netzwerke betrieben und vom Bund auch auf diesem Weg unterstützt. Neue regionale Initiativen finden in diesen Netzwerken Anschlussmöglichkeiten und können so vom vorhandenen Fachwissen profitieren.
Produkte mit garantierter regionaler Herkunft sind im Trend:Eine überwiegende Mehrheit der Konsumenten würde ein Herkunftszeichen für Schweizer Landwirtschaftsprodukte begrüssen.Das zeigte eine repräsentative Umfrage im Auftrag des BLW.Bei der Frage:«Würden Sie darauf achten,wenn auch ihre Region als Herkunft angegeben wäre» antworteten 81% der Befragten positiv.Das zeigt,dass eine hohe Sensibilität für örtlich erzeugte Nahrungsmittel vorhanden ist.Die Herkunft aus der Region wirkt sich damit positiv auf den Kaufentscheid aus,auch wenn bekanntlich gewisse Divergenzen zwischen den Bekenntnissen der Konsumentinnen und Konsumenten und ihren konkreten,stark preisabhängigen Kaufentscheiden bestehen.
Die Projektverantwortlichen und weitere Interessierte haben unter der Moderation des BLW gemeinsam privatrechtliche,nationale Mindestanforderungen an Regionalmarken ausgearbeitet.Damit gelten nun für einen grossen Teil der im Handel und Gastgewerbe erhältlichen regionalen Produkte gleiche Anforderungen besonders in Bezug auf Herkunftsgarantie,Rohstoffanteile aus der Region und Qualitätssicherung und Kontrolle.Das ist auch eine wichtige Voraussetzung,um das Vertrauen der Käuferschaft in dieses Marktsegment zu stärken.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 122
■ Vermarktung von Regionalprodukten
Tabelle 26,Seite A27
■ Geflügelkennzeichnung
Qualitätspolitik und Kennzeichnung
Wer künftig Poulet- oder Trutenfleisch kauft weiss genau,wie das Geflügel gehalten wurde.Der Bundesrat hat die neue Geflügelkennzeichnungsverordnung (GKZV) auf den 1.Januar 2006 in Kraft gesetzt.Mit der Verordnung werden die Kennzeichnungen von Poulet- und Trutenfleisch aus tierfreundlichen Haltungssystemen klar definiert sowie vor Missbrauch und unlauterem Wettbewerb geschützt.Konsumentinnen und Konsumenten können sich jetzt darauf verlassen,dass ihre Erwartungen an eine tiergerechte Haltung,die sie beim Kauf von derart gekennzeichneten Produkten haben,auch tatsächlich erfüllt werden.Die neue GKZV regelt die Verwendung dieser Kennzeichnungen.Die bekannten Haltungsbestimmungen über den regelmässigen Auslauf (RAUS) und die besonders tierfreundlichen Stallhaltungssysteme (BTS) erfahren dabei keine grösseren Änderungen.Für die Produzenten ist somit kein signifikanter Mehraufwand verbunden.Entsprechend ergaben sich keine nennenswerten Umsetzungsschwierigkeiten nach Inkrafttreten dieser Verordnung.Die EU hat die neuen Bestimmungen formell als äquivalent mit dem europäischen Recht anerkannt.Damit hat die Schweiz auch eine Verpflichtung aus den bilateralen Verträgen eingelöst.
2005 wurden drei Eintragungsgesuche für folgende geschützte Ursprungsbezeichnungen veröffentlicht:Vacherin fribourgeois,Damassine und Poire à Botzi.Gegen die Gesuche gingen bei der öffentlichen Auflage der Pflichtenhefte Einsprachen ein.Nur der Vacherin fribourgeois fand 2005 Eingang in das GUB/GGA-Register,nachdem die Einsprachen betreffend das geografische Gebiet und insbesondere den Einschluss der Berner Enklaven Clavaleyres und Münchenwiler bereinigt wurden.Ein neues Eintragungsgesuch für Sauerkäse/Bloderkäse als GUB wurde dem BLW im Berichtsjahr eingereicht.Die Prüfung sechs weiterer Dossiers ist im Gange (2 GUB und 4 GGA). Ausserdem wurden für bereits eingetragene Erzeugnisse Änderungen ihrer Pflichtenhefte beantragt.Es handelt sich hierbei um die GUB Vacherin Mont-d’Or und Berner Alpkäse sowie die GGA Saucisson vaudois,Saucisse aux choux vaudoise,Saucisse neuchâteloise und Saucisson neuchâtelois.
Beim Dossier Emmentaler hat die REKO die Beschwerdelegitimation ausländischer Betriebe nicht anerkannt,da diese keine wirtschaftliche Tätigkeit auf schweizerischem Gebiet ausüben.Das Dossier Raclette ist beim Bundesgericht hängig.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 123 2
■ Aktueller Stand des GUB/GGA-Registers
GUB/GGA-Register am 31.Dezember 2005
AnzahlAnzahltt
Käse
L’EtivazGUB671354378OIC GruyèreGUB3 10726728 00028 148OIC
SbrinzGUB224351 7501 314Procert
Tête de MoineGUB25891 6691 791OIC
Formaggio d’alpe ticineseGUB2727135135OIC Vacherin Mont-d'OrGUB24211590555OIC Berner AlpkäseGUB549151 0121 020OIC
Fleischwaren
BündnerfleischGGA15950994Procert
Saucisse d’AjoieGGA105657OIC Walliser TrockenfleischGGA27337396OIC
Saucisse neuchâteloise / Saucisson neuchâtelois GGA18123123OIC
Saucisson vaudoisGGA50620650OIC Saucisse aux choux vaudoiseGGA44480450OIC
Spirituosen
Eau-de-vie de poire du ValaisGUB3974 OIC Abricotine
GUB1423OIC
Andere Erzeugnisse
Rheintaler RibelGUB412930Procert
Cardon épineux genevoisGUB517074Procert Walliser RoggenbrotGUB4565350480OIC Munder SafranGUB150,0030,00091OIC
Quelle:BLW
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 124
Landwirtschafts- betriebe Unternehmen (Verarbeitung/ Veredelung) Zertifizierte Produktionsmenge 2004 Zertifizierte Produktionsmenge 2005 Zertifizierungs- stelle 95 792 Liter 100%-iger Alkohol 98 824 Liter 100%-iger Alkohol 28 756 Liter 100%-iger Alkohol 32 981 Liter 100%-iger Alkohol
Bezeichnung Schutz
Der Bundesrat hat der Schweizer Delegation ein Verhandlungsmandat hinsichtlich der gegenseitigen Anerkennung der Register mit der Europäischen Kommission erteilt.Die europäische Delegation wartet ihrerseits auf ein Mandat des Ministerrates.Zum heutigen Zeitpunkt steht die Gleichwertigkeit der schweizerischen und gemeinschaftlichen Gesetzgebung auf technischer Ebene zwar fest,aber infolge der Ergebnisse des WTO-Panels zwischen der EU und USA/Australien hat die Kommission in einigen Punkten ihre Haltung zum Schutz in der EU geändert.Entsprechend musste die europäische Verordnung angepasst werden,damit sie mit den WTO-Verpflichtungen vereinbar ist.Aus diesem Grund hat sich die Aufnahme der Verhandlungen mit der Schweiz seitens der Europäischen Gemeinschaft verzögert.
In den WTO-Verhandlungen will sich die Schweiz weiterhin für die Ausdehnung des zusätzlichen Schutzes für Weine und Spirituosen (Art.23 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum,TRIPS-Abkommen) auf sämtliche Produkte einsetzen.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 125 2
■ Internationale Entwicklung im GUB/GGA-Bereich
■ Einfuhrregelungen, Zollabfertigungen und Verwaltung von Zollkontingentsanteilen werden einfacher
Instrumente des Aussenhandels
Die zolltarifarischen Massnahmen zur Unterstützung einer produktiven Landwirtschaft sind weiter vereinfacht und in bestimmten Bereichen gelockert worden.Beispielsweise wird das Zollkontingent Obstgehölze ab 2006 entsprechend der Reihenfolge der Verzollung verteilt.Bei diesem so genannten «Windhund an der Grenze» gilt die Zollanmeldung gleichzeitig als Antrag für einen Kontingentsanteil.Weitere Beispiele für eine Lockerung des Grenzschutzes sind die Senkung der Schwellenpreise für Futtermittel und des Kontingentszollansatzes für Brotgetreide.
Einen detaillierten Überblick über die zolltarifarischen Massnahmen bietet der entsprechende Bericht des Bundesrates vom 15.Februar 2006,insbesondere die Veröffentlichung der Zuteilung und Ausnützung der Zollkontingente 2005.Die Dokumente dazu werden nur noch über Internet veröffentlicht,zu finden sind sie auf der BLW-Homepage unter dem Thema Ein- und Ausfuhr.
■ EDV-Hilfsmittel werden erneuert und erweitert
Dank neuen elektronischen Hilfsmitteln können die Importeure ihre Administration vereinfachen und die Verwaltung wird entlastet.Zu erwähnen sind das erneuerte System zur elektronischen Verzollung e-dec,zusammen mit der angeschlossenen Kontrolle der verfügbaren Zollkontingentsanteile e-quota und die Internetanwendung AEV14online.
Bei der elektronischen Verzollung mit dem System e-dec wird vor der Annahme der Einfuhrzollanmeldung unter anderem geprüft,ob bei kontingentierten landwirtschaftlichen Erzeugnissen genügend Kontingentsanteil vorhanden ist.Die Kontrolle läuft über die neue Informatiklösung e-quota der Eidgenössischen Zollverwaltung.Kontingentsüberschreitungen sowie Einfuhren ohne entsprechenden Kontingentsanteil sind dadurch seit anfangs 2006 praktisch ausgeschlossen.Das BLW seinerseits kann auf die bisherige nachgelagerte Kontingentskontrolle verzichten.Ebenso entfallen die Nachforderungen von geschuldeten Einfuhrabgaben im Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung,sobald die Fälle des Jahres 2005 abgeschlossen sind.Die wegfallenden Aufgaben führen zu Einsparungen an personellen Ressourcen und werden eine sukzessive Senkung der Verwaltungsgebühr,die bei der Zollanmeldung anfällt,ermöglichen.
Die EDV-Anwendung AEV14online ermöglicht die Buchung von Vereinbarungen zur Ausnützung der Zollkontingentsanteile über das Internet.Sie wird den Zollkontingentsinhabern seit dem 1.Januar 2006 vom BLW zur Verfügung gestellt.Mit AEV14online wird nicht nur das Übertragen der Ausnützungsrechte vereinfacht,sondern der Zollkontingentsinhaber erhält auch in eingeschränkter Form und ohne Gewähr Auskunft über den zugeteilten und den noch verfügbaren Zollkontingentsanteil.Das Projekt konnte rechtzeitig umgesetzt werden und erfreut sich grosser Benutzerakzeptanz:im März 2006 wurden z.B.alle Vereinbarungen im Bereich Frischgemüse über Internet getätigt,wobei dieser Bereich bereits 80% von insgesamt 1’900 Vereinbarungen abdeckt.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 126
■ Ausblick
Die Grenzschutzmassnahmen werden weiterhin den aktuellen Bedürfnissen angepasst.Vorschläge zu Änderungen bei den Zuteilkriterien von Zollkontingenten sind in der AP 2011 enthalten.Die Tendenz geht zu einfacheren,marktgerechteren Verfahren wie «Windhund an der Grenze» und Versteigerungen.Geprägt wird diese Entwicklung durch bereits gefasste oder noch zu fassende Beschlüsse zur Verbesserung des Marktzutrittes im Rahmen der WTO und durch bilaterale Freihandelsabkommen sowie durch die ab 2007 zu erwartende weitgehende Zollbefreiung für Importwaren aus den ärmsten Entwicklungsländern (PMA).Die Zollpräferenzen zugunsten der PMA können mit Hilfe einer besonderen Schutzklausel eingeschränkt werden.
■ Ein- und Ausfuhren von Verarbeitungsprodukten
Am 1.Februar 2005 trat das revidierte Protokoll Nr.2 zum Freihandelsabkommen Schweiz – EG von 1972 in Kraft.Es umfasst einen ausgedehnteren Deckungsbereich an Produkten sowie einen angepassten Preisausgleichsmechanismus.
Mit dem Inkrafttreten des revidierten Protokolls Nr.2 verpflichtete sich die EU, sämtliche Zölle bei der Einfuhr von schweizerischen Verarbeitungsprodukten in die EU abzubauen und die Schweiz verpflichtete sich ihrerseits,die Zölle auf Einfuhren aus der EU stark zu reduzieren oder teilweise ganz abzuschaffen.
Der grösste Teil des erweiterten Deckungsbereichs betrifft Produkte,für welche im Verkehr mit der EU Freihandel besteht (Kapitel 5:Häute,Haare,Borsten usw.,Kapitel 9: Tee,Kaffee,Gewürze,Kapitel 20:Konfitüren,Kapitel 21:Kaffee- und Tee-Extrakte, Suppen,Saucen,Senf,Hefen,Kapitel 22:Bier,Branntweine und Fruchtbrände usw.), das heisst es werden weder Zölle bei der Einfuhr noch Beiträge bei der Ausfuhr angewendet.
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 127 2
1000 t EinfuhrenAusfuhren revidiertes Protokoll Nr. 2 erweiterter Deckungsbereich Quellen: EZV, BLW 2003 0 1000 1200 800 600 400 200 2004 2005
Der neue Preisausgleichsmechanismus wirkte sich so aus,dass die für die Ausfuhren benötigten Beiträge gleichzeitig auf das vom Parlament inkl.Nachtragskredit bewilligte Niveau von 90 Mio.Fr.reduziert werden konnten.
Gleichzeitig wurde auch die so genannte Doppel-Null-Lösung für Zucker in Verarbeitungsprodukten eingeführt.Damit ist Zucker in landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten als Rohstoff ebenfalls zum Freihandelsprodukt geworden.Voraussetzung für das gute Funktionieren dieser Doppel-Null-Lösung ist allerdings,dass die Zuckerpreise in der EU und in der Schweiz ungefähr gleich hoch sind.Die im Berichtsjahr in der EU vorbereitete und im Februar 2006 vom EU-Ministerrat beschlossene neue Marktordnung für Zucker führte allerdings dazu,dass sich die Preise in der EU und in der Schweiz unterschiedlich entwickeln.Eine Arbeitsgruppe unter Mitwirkung der beteiligten Wirtschaftsakteure hat ein Vorgehen entwickelt,welches erlaubt,den Zollansatz für Zucker bei der Einfuhr in die Schweiz so festzulegen,dass der Schweizer und der EU-Marktpreis für Zucker wieder in etwa gleich hoch sind.Damit werden der Schweizer Verarbeitungsindustrie sowohl auf dem EU- als auch auf dem Inlandmarkt wieder «gleich lange Spiesse» gewährt.
Der erfolgreiche Abschluss von Nachverhandlungen mit der EU ermöglicht es der Schweiz,für nicht alkoholische Getränke auf Milchbasis wieder Preisausgleichsmassnahmen anzuwenden,nachdem diese irrtümlicherweise in die «Freihandelsliste» gerutscht waren.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 128
Ausfuhrbeiträge Mio. Fr. Quellen: EZV, BLW 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 180 115 115 1991/922003 115 20022004 90 2005
Massnahmen 2005/06
2.1.2Milchwirtschaft
Die Absatzlage beim Käse hat sich im Jahre 2005 erfreulich entwickelt.Sowohl im Inland als auch im Ausland konnte je etwas über 2% mehr Käse abgesetzt werden. Wiederum positiv war die Entwicklung der Verkäufe bei Frischmilchprodukten, Konsumrahm und Joghurt.Deshalb ging auch die Butterproduktion leicht zurück.Der Produktionswert von Milch und Milchprodukten verbesserte sich insgesamt bei leicht tieferen Milcheinlieferungen im Vergleich zum Vorjahr.
1nur für bestimmte Verwendungszwecke
2nur bei Importverzicht
3nur für Ausfuhren in andere Länder als EU und nach Käsesorte differenziert
4nicht für Konsummilch
Gegenüber 2004 sank der durchschnittliche Produzentenpreis für Milch um 2.2 Rp.je kg auf rund 72.4 Rp.je kg.Der Preis für Biomilch fiel um 3.6 Rp.je kg und damit stärker auf 81.8 Rp.je kg.Die Stützungsmassnahmen sind mit den Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage schwerpunktmässig weiterhin auf den Käse ausgerichtet.

■■■■■■■■■■■■■■■■
Rahm Frischmilchprodukte Massnahme Grenzschutz ■■■■■ Zulagen ■ Inlandbeihilfen ■ 1 ■ 1 ■ 2 Ausfuhrbeihilfen ■ 3 ■■ 4
ProduktKäseButterMagermilchMilchpulverKonsummilch
Quelle:BLW
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 129 2
■ Finanzielle Mittel 2005 Mittelverteilung 2005
Im Jahr 2005 waren die Ausgaben des Bundes zugunsten der Milchwirtschaft entsprechend der Budgetvorgabe leicht tiefer;es standen 29,3 Mio.Fr.oder 5,8% weniger zur Verfügung.
Total 474,2 Mio. Fr.
Für die Preisstützung wurden im Milchbereich insgesamt 474,2 Mio.Fr.ausgegeben. Davon beanspruchte der Käse 341,1 Mio.Fr.(72%).61,5 Mio.Fr.(13%) wurden für Butter und 65,6 Mio.Fr.(13,8%) für Pulver und andere Milchprodukte eingesetzt.Die Administration kostete 5,9 Mio.Fr.oder 1,2% des Milchbudgets.

130 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2
Inlandbeihilfen 21%
Ausfuhrbeihilfen 8% Zulagen 70% Administration 1%
Quelle: BLW
Tabelle 27,Seite A28
Milchkontingentierung
Im Milchjahr 2004/05 vermarkteten 31'673 Produzenten Milch.Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Anzahl Produzenten um 1'399 oder 4,2%.Dies entspricht dem Mittel der jährlichen Abnahme seit dem 1.Mai 1999.Das durchschnittliche Kontingent erhöhte sich im Milchjahr 2004/05 um 4,7% auf 95'958 kg.Im Talgebiet ist das mittlere Kontingent um 5'908 kg auf 115'214 kg gestiegen,während es sich im Berggebiet um 3,9% auf 71'241 kg erhöhte.Seit dem Milchjahr 1999/2000 vergrösserte sich das Kontingent im Talgebiet um knapp 27'000 kg oder 30% und im Berggebiet um 12'800 kg oder 22%.
Der Handel mit Milchkontingenten wurde auch im Berichtsjahr rege betrieben.Im Hinblick auf den vorzeitigen Ausstieg verlor aber die nicht endgültige Übertragung (Miete) zu Gunsten der endgültigen Übertragung (Kauf) an Bedeutung.6'315 Produzenten haben im Milchjahr 2004/05 rund 163 Mio.kg Kontingente gekauft und 8'831 Produzenten haben rund 146 Mio.kg gemietet.Die nach Artikel 3 der Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion übertragene Menge erreichte 308 Mio.kg oder 10% des Grundkontingents.Während die Menge gemieteter Kontingente gegenüber dem Vorjahr um 23,0 Mio.kg abnahm (–14%),erhöhte sich die Menge gekaufter Kontingente um 33,7 Mio.kg (+26%) auf 163 Mio.kg.
Die Menge nicht endgültig übertragener Kontingente betrug im Milchjahr 2004/05 rund 421 Mio.kg.Die seit Einführung des Kontingentshandels im Milchjahr 1999 aufsummierte Menge endgültig erworbener Kontingente erreichte ihrerseits rund 591 Mio.kg.Somit wurden im Milchjahr 2004/05 gesamthaft 1,01 Mio.t oder ein Drittel des Grundkontingents durch flächenungebundene Kontingentsübertragungen von anderen Produzenten genutzt.
Die abgabepflichtigen Überlieferungen erreichten im Milchjahr 2004/05 die Rekordmenge von 23,4 Mio.kg.Allein die Sömmerungsbetriebe lieferten,als Folge der Senkung der Abgabe auf 10 Rp.je kg überlieferte Milch,17,2 Mio.kg zu viel Milch. Die Summe der Abgaben betrug knapp 5,5 Mio.Fr.
Organisationen,deren Produzenten sich für einen vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung per 1.Mai 2006 entschieden,mussten das entsprechende Gesuch vor Ende Oktober 2005 beim BLW einreichen.Von Anfang Jahr bis zu diesem Termin waren die interessierten Produzenten und Organisationen denn auch intensiv mit den Vorbereitungen dazu beschäftigt.Das BLW hatte in dieser Phase stets seine Bereitschaft signalisiert,bei der Erarbeitung der erforderlichen Statuten und Mengenreglemente beratend zur Verfügung zu stehen und bei der Klärung von Vorgehensfragen behilflich zu sein.Von diesem Angebot haben in der Folge praktisch alle Organisationen Gebrauch gemacht.Es ist bestimmt nicht zuletzt auch auf diesen Umstand zurück zu führen,dass die 27 eingereichten Gesuche in der Regel gut dokumentiert und in guter Qualität eingingen.Das BLW konnte Ende 2005 und Anfang 2006 schliesslich alle 27 Gesuche gutheissen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 131 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
■ 27 Gesuche für vorzeitigen Ausstieg eingereicht
Die 27 Ausstiegsorganisationen setzen sich aus 9 Produzentenorganisationen (PO) und 18 Produzenten-Milchverwerter-Organisationen (PMO) zusammen.Mit diesen steigen insgesamt 21'929 Produzenten mit einer Menge von rund 2,34 Mio.t Kontingent aus, was einem Produzentenanteil von 63% und einem Mengenanteil von 75% entspricht.
(prov.) (Stand 26.9.2006)
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 132
OrganisationProduzentenBasismenge
AnzahlMio.kg Produzentenorganisationen OP FTPL25216,6 PO ZMP4 143407,4 PO LOBAG3 099259,9 PO Nordostmilch AG2 128225,4 OP Prolait3 103428,4 PO MIBA2 063256,4 PO Biomilchpool GmbH69855,7 OP FLV-WMV97747,3 PO Ostschweiz 75783,1 Total PO17 2201 780,2 Produzenten-Milchverwerter-Organisationen OPU Le Maréchal122,1 PMO Thur Milch Ring AG15825,9 PMO Bodensee Milch16423,1 PMO Schwyzer Milch 32521,5 PMO BEMO80884,0 OPU GAE32442,8 PMO MIMO1 029131,6 PMO Swiss Premium Milk16218,7 PMO Gourmino Plus16123,1 PMO Mittelthurgau11417,5 OPU Chasseral20122,7 PMO Bachthalkäserei Girenbad GmbH91,0 PMO Ostschweiz24122,3 PMO Biedermann/Züger22431,4 PMO Strähl6411,8 PMO ZeNoOs65171,1 PMO Bergkäsereien Untervaz-Savognin322,7 PMO NapfMilch AG302,1 Total PMO4 709555,7 Total PO und PMO21 9292 335,9
■ Projekt Admin Milch 2006
Gesamthaft erreichten 8 Organisationen die erforderlichen Mindestmengen nicht. Ihre Gesuche konnten gestützt auf die Ausnahmebestimmungen dennoch bewilligt werden,entweder nach Artikel 4 Absatz 3 (Wallis und Tessin) oder nach Artikel 5 Absatz 2 VAMK.In der vorangehenden Tabelle fällt zudem auf,dass flächendeckend wenige grosse PO und dazwischen eine Reihe eher kleinerer PMO entstanden sind, welche sich vorwiegend um das Produkt Käse gruppieren.Schwergewichtig befinden sie sich in der Ostschweiz.
Der Ausstieg aus der Milchkontingentierung hat in der Milchbranche Bewegung ausgelöst:Traditionelle Strukturen wurden aufgebrochen und PO und PMO haben sich neu gebildet.Diese Entwicklung hat Konsequenzen für den gesamten Milchdatenfluss. Während der Übergangsphase von 2006 bis 2009 müssen im Bereich der Produktionslenkung zwei Administrationssysteme – das heute bestehende System der Milchkontingentierung und das neue System für die vorzeitig ausgestiegenen Produzenten –betrieben werden.Auch für die Zeit nach 2009 ist im Artikel 43 LwG ein Monitoring der Produktion auf Stufe des Einzelproduzenten verankert.
Weil mit der Liberalisierung des Milchmarktes auch die Erhebung und Verwaltung der Milchproduktionsdaten vereinfacht werden soll,besteht bei der Administration der Milchproduktionsdaten grosser Koordinationsbedarf,gleichzeitig sollen auch die Kosten für die Administration landwirtschaftlicher Massnahmen gesenkt werden.Zu diesem Zweck wurde das Projekt «Admin Milch 2006» gestartet.Ziel des Projektes ist, die Verwaltung der Milchproduktionsdaten unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen neu zu organisieren.Die Milchproduktionsdaten werden im Rahmen eines bereits bestehenden Outsourcings bei der TSM Treuhand GmbH verwaltet.Damit eine gesamt-sektorielle Sicht auch nach dem Ausstieg aus der Milchkontingentierung möglich ist,werden die Milchproduktionsdaten ab 1.Mai 2006 für beide Administrationssysteme einheitlich und zentral erfasst und bewirtschaftet.Gleichzeitig wird das Controlling der Milchproduktionsmengen sowie die benötigten Auswertungen und Publikationen gewährleistet.Es werden Stammdaten aus dem Agrarinformationssystem (AGIS) des BLW verwendet und die Milchdaten werden dort direkt angebunden.Mit der Grundausrichtung auf die Zentralisierung und Vernetzung mit AGIS und der Partnerschaft mit dem privaten Sektor ist ein Zeichen zu Gunsten einer gemeinsamen Datenplattform für die Belange der Milchwirtschaft und einer kohärenten Entwicklung in Richtung eines integrierten Agrardatennetzes gesetzt worden.
■ Änderungen der Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion
Hintergrund der am 1.März 2006 beschlossenen Änderung der Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion (MKV,SR 916.350.1) war die Möglichkeit zum vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung.Zum Einen hatten die Änderungen wesentliche Vereinfachungen beim Meldewesen und bei der Datenverwaltung im Bereich der Milchproduktionsdaten zur Folge.Sie sind auf das Projekt Admin Milch 2006 zur Milchdatenverwaltung abgestimmt.
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 133
■ Änderungen der Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung
Anderseits wurde die Abgabe bei Kontingentsüberlieferung für jene Produzentinnen und Produzenten reduziert,für die infolge Ausstiegs aus der Milchkontingentierung eine Schlussabrechnung erstellt werden muss.Damit wurde einem Anliegen der Schweizer Milchproduzenten weitgehend Rechnung getragen.Steigt ein Produzent nämlich aus der Milchkontingentierung aus,so entfällt ihm die Möglichkeit,5'000 kg der Überlieferungen auf das nächste Milchjahr zu übertragen.Durch die Reduktion der Abgabe für diese Menge von 30 auf 10 Rappen je kg wird er finanziell entlastet.
Die Änderungen der Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung (VAMK;SR 916.350.4) hängen grösstenteils ebenfalls mit dem Projekt Admin Milch 2006 zusammen.Ausserdem wurde die Möglichkeit geschaffen,dass interessierte Produzenten nachgemeldet werden können,auch wenn die Organisationen,bei denen sie Mitglied werden wollen,das Ausstiegsgesuch bereits gestellt haben oder dieses vom BLW schon gutgeheissen worden ist.In Anlehnung an die Kontingentierungsregelungen ist die Frist für die Produzenten je auf Ende Februar angesetzt.
Marktstützung mit Zulagen und Beihilfen
Im Berichtsjahr hat das Instrumentarium zur Marktstützung keine grundsätzliche Änderung erfahren.Als Folge des eingangs erwähnten Stützungsabbaus von 29,3 Mio.Fr. musste die Inlandbeihilfe für Butter angepasst werden.Auf den 1.Juli 2005 wurde der Ansatz für Grosspackungen 1 kg (Platten) um 29 Rp.je kg auf 1.80 Fr.gesenkt und derjenige für Grosspackungen 1 kg (Model) um 23 Rp.je kg auf 1.60 Fr.erhöht.
Die künftige Milchpolitik setzt die bisherigen marktorientierten Reformschritte konsequent fort und berücksichtigt dabei insbesondere den beschlossenen Ausstieg aus der Milchkontingentierung.Kernpunkt des entsprechenden Konzeptes im Rahmen der Agrarpolitik 2011 ist die Umlagerung in zwei Schritten von Mitteln der Marktstützung zu den Direktzahlungen.Milchkühe erhalten damit ebenfalls Beiträge für raufutterverzehrende Nutztiere.
Die Zulagen und Beihilfen werden zu diesem Zweck in einem ersten Schritt um jeweils insgesamt 66 Mio.Fr.in den Jahren 2007 und 2008 gesenkt.Mit dieser Reduktion wird ein Beitrag von 200 Fr.je Milchkuh ab 1.Januar 2007 mitfinanziert.In einem zweiten Schritt sollen ab 2009 die Stützungen im Milchbereich um weitere 205 Mio.Fr. abgebaut werden,damit die Finanzierung eines einheitlichen Beitrags von 600 Fr.für alle raufutterverzehrenden Nutztiere möglich wird.
Damit für die Umsetzung dieser Veränderungen im Milchsektor genügend Vorlaufzeit besteht,hat der Bundesrat bereits Ende 2005 die ab 1.Januar 2007 geltenden Ansätze für Zulagen und Beihilfen festgelegt.So wurde der Ansatz für die Zulage für verkäste Milch um 3 Rp.auf 15 Rp.je kg verkäster Milch reduziert und jener für die silagefreie Fütterung auf 3 Rp.gesenkt.Weitere Ausgabenreduktionen werden durch die Senkung der Beihilfesätze erreicht.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 134
2.1.3 Viehwirtschaft
Nachdem die ersten Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln und in Nutzgeflügelbeständen in Europa auftraten,trafen die schweizerischen Behörden verschiedene Massnahmen,um die Einschleppung der Vogelgrippe in die Schweiz zu verhindern.Die Ein- und Durchfuhr von Geflügelprodukten aus zahlreichen Ländern ausserhalb der EU wurde unter anderem verboten.Am 21.Oktober 2005 beschloss der Bundesrat ein bis zum 15.Dezember 2005 befristetes Freilandhalteverbot für Geflügel.Die Haltung in einem Aussenklimabereich,der allseitig gegen Wildvögel Schutz bietet,war indessen erlaubt.Während des Verbots waren ausserdem Geflügelmärkte und Geflügelausstellungen untersagt.Der Bundesrat sicherte den Nutzgeflügelhaltern zu,dass die Direktzahlungen infolge des Freilandhalteverbots nicht gekürzt werden.Die Deklaration von «Bio» oder «Freiland» durfte weiterhin verwendet werden,wenn beispielsweise mit einem Informationsblatt am Verkaufspunkt auf die temporären Einschränkungen hingewiesen wurde.Das Freilandhalteverbot trat am 20.Februar 2006 erneut in Kraft.Kurz nachher wurde das Vogelgrippevirus erstmals bei einem Wildvogel am Genfersee festgestellt.Auf Anfang Mai hob der Bundesrat die Massnahmen auf, nachdem die Wildvögelzüge praktisch abgeschlossen waren.

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 135 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Finanzielle Mittel 2005
Zölle und Zollkontingente sind die wichtigsten Instrumente zum Schutz der inländischen Fleischproduktion.Sowohl zur Stützung des Fleisch- und Eiermarktes als auch zur Förderung des Exportes von Zucht- und Nutztieren werden zudem Beihilfen ausgerichtet.Die finanzielle Unterstützung der praxisnahen Versuche bei Geflügel wurde auf Ende 2004 eingestellt.Infolge der guten Nachfrage auf dem Fleischmarkt und dem gesunkenen Inlandangebot waren keine Einlagerungsaktionen von Rind- und Schweinefleisch nötig;ebenfalls konnte auf eine Marktabräumung in Schlachtbetrieben bei Tieren der Rinder-,Schweine- und Pferdegattung verzichtet werden.
Von den 28,3 Mio.Fr.für Massnahmen in der Viehwirtschaft budgetierten Bundesmitteln wurden lediglich 20,6 Mio.Fr.ausgegeben.Der Hauptgrund für die Minderausgaben in der Viehwirtschaft war die gute Marktlage auf dem Fleisch- und Eiermarkt. Einerseits waren weniger Marktinterventionen nötig,andererseits wurden die verfügbaren Ausfuhrbeihilfen für den Zucht- und Nutztierexport nicht vollständig ausgenützt. Im Rahmen der Tierverkehrskontrolle wurden 8,9 Mio.Fr.für die Leistungsvereinbarung zum Betrieb der Tierverkehr-Datenbank ausgegeben und 9,8 Mio.Fr.an Gebühren (Ohrmarken,Schlacht- und Bearbeitungsgebühren) eingenommen.Vor allem auf Grund kleinerer Investitionen wurden bei der Leistungsvereinbarung rund 0,9 Mio.Fr. weniger ausgegeben als budgetiert.Die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte von Tieren der Rinder-,Schweine-,Schaf- und Ziegengattung kostete 44,3 Mio.Fr.Die Ausgaben für die Tierverkehrskontrolle und die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte wurden aus Budgetrubriken,die nicht der Viehwirtschaft zugeordnet sind,finanziert.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 136 Massnahmen 2005 Tier/ProduktRinderKälberSchweinePferdeSchafeZiegenGeflügelEier Massnahme Grenzschutz ■■■■■■■■ Marktabräumung ab öffentlichen Märkten ■■■ Marktabräumung in Schlachtbetrieben ■■■■■ Einlagerungsaktionen ■■■ Verbilligungsaktionen ■■■ Investitionsbeiträge für Stallbauten ■ Aufschlagsaktionen und Vermarktungsmassnahmen ■ Verwertungsbeiträge Schafwolle ■ Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh ■■■■ Höchstbestände ■■■■ Tierverkehr-Datenbank ■■■■■
Quelle:BLW
Tabelle 28,Seite A29
Mittelverteilung 2005
Total 20,6 Mio.
Fr.
Verwertungsbeiträge
Schafwolle 4%
Einlagerungs- und Verbilligungsbeiträge für Rind- und Kalbfleisch 19%
Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 15%
Ausfuhrbeihilfen
Zucht- und Nutzvieh 28%
Leistungsvereinbarungen
Proviande 34%
Quelle: Staatsrechnung
Gestützt auf Artikel 51 des LwG hat das BLW seit dem 1.Januar 2000 verschiedene Aufgaben auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt der Proviande übertragen.Die Aufträge und die finanzielle Vergütung wurden mit drei Leistungsvereinbarungen geregelt. Die Leistungsvereinbarung über die Erfassung und Kontrolle der Gesuche um Zollkontingentsanteile war bis Ende 2005 befristet.Die zwei anderen sind bis Ende 2007 befristet.Im Jahre 2007 wird das BLW die Aufgaben wieder öffentlich ausschreiben.
1.Neutrale Qualitätseinstufung
Die Qualität der geschlachteten Tiere muss in allen grossen Schlachtbetrieben von neutraler Seite (Proviande) eingestuft werden.Der Klassifizierungsdienst der Proviande stufte am Ende des Berichtsjahres in 36 Betrieben die Qualität ein.Damit wurden 90% aller geschlachteten Tiere der Schweinegattung,85% aller Tiere der Rindergattung sowie 60% aller Tiere der Schafgattung erfasst.Bei der Einführung im Jahre 2000 arbeitete die Proviande in 45 Schlachtbetrieben.Zudem bestimmte sie die Qualität aller Lebendtiere der Rinder- und Schafgattung auf öffentlichen Märkten.Für die Ausund Weiterbildung sowie die Organisation von Kursen leistete die Proviande ebenfalls viele Arbeitsstunden.
Das Qualitätsmerkmal von Schweineschlachtkörpern ist der Magerfleischanteil.Er wird mit technischen Geräten bestimmt.Der Mittelwert des Magerfleischanteils aus einer Stichprobe von 1,5 Mio.Schlachtungen (56% aller Schlachtungen) betrug 55,7%. Damit ist er im Vergleich mit dem Jahr 2004 um einen fünftel Prozentpunkt gestiegen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 137 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
■ Schlachtvieh und Fleisch: Leistungsvereinbarungen
Verteilung der Schlachtkörper auf die Fleischigkeitsklassen 2005
Die Fleischigkeit und die Fettabdeckung von Tieren der Rinder-,Schaf-,Ziegen- und Pferdegattung wird vom Klassifizierungsdienst optisch bestimmt.Es gibt fünf Fleischigkeitsklassen:C = sehr vollfleischig,H = vollfleischig,T = mittelfleischig,A = leerfleischig und X = sehr leerfleischig.Die Fettabdeckung wird ebenfalls in fünf Klassen unterteilt.Von den Kühen waren 23% leerfleischig und 20% sehr leerfleischig. Gegenüber dem Jahr 2004 sank der Anteil der leerfleischigen Tiere um einen und der Anteil der sehr leerfleischigen Tiere um zwei Prozentpunkte.Dieser Rückgang dürfte eine Folge der Zunahme des Mutter- und Ammenkuhbestandes sein.Tendenziell steigend ist die Fleischigkeit bei den Muni,die fast durchwegs mittel- bis sehr vollfleischig sind.Auch die Lämmer weisen tendenziell eine bessere Fleischigkeit auf.Etwa die Hälfte ist mittelfleischig und mehr als ein Drittel ist vollfleischig.Die Verteilung der Kälber und Gitzi in die verschiedenen Fleischigkeitsklassen ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.
2.Überwachung von öffentlichen Märkten sowie Organisation von Marktentlastungsmassnahmen
Bäuerliche Organisationen und/oder kantonale Stellen organisierten für Tiere der Rinder- und Schafgattung während des ganzen Jahres öffentliche Märkte.Die Zahl der aufgeführten Tiere der Schafgattung sank gegenüber 2004 um 13%,diejenige vom Grossvieh um 6% und von Kälbern um 49%.Diese Rückgänge sind hauptsächlich auf das gesunkene Angebot bei allen Tierkategorien zurückzuführen.Ausserdem ist der zunehmende Anteil von Labeltieren,die nicht über einen öffentlichen Markt vermarktet werden,ein weiterer Grund.Auf den Schafmärkten wurden 2’011 Tiere (2,7% der aufgeführten Tiere) nicht auf freiwilliger Basis gekauft.Diese Tiere teilte die Proviande den übernahmepflichtigen Schlacht- und Handelsfirmen zu.Sie bezahlten für diese Tiere von der Proviande festgestellte marktübliche Preise.Die Proviande teilte im Rahmen der Marktabräumung in Schlachtbetrieben 7'652 Gitzi an übernahmepflichtige Firmen zu.Gegenüber dem Vorjahr sind es rund 700 Tiere mehr.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 138
%
in
Quelle: Proviande
C = sehr vollfleischig H = vollfleischig T = mittelfleischig A = leerfleischig X = sehr leerfleischig KüheMuniKälber Fleischigkeitsklasse LämmerGitzi 0
C H T A X 70 50 60 40 30 20 10
Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten 2005
MerkmalEinheitKälberGrossviehTiere der Schafgattung
Überwachte öffentliche MärkteAnzahl466891314
Aufgeführte TiereSt.24 53160 69773 214
Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen%91728
Zugeteilte Tiere (Marktabräumung)St.63232 011
Quelle:Proviande
Die öffentlichen Märkte werden in 20 Kantonen organisiert und von der Proviande überwacht.Der Kanton Bern weist mit 25 Marktplätzen für Grossvieh,18 für Tiere der Schafgattung und 5 für Kälber am meisten Marktplätze auf.Pro Schafmarkt werden durchschnittlich 233 Tiere,pro Grossviehmarkt 68 Tiere und pro Kälbermarkt 53 Tiere vermarktet.
Das BLW zahlte für das Einfrieren von Kalbfleisch 2,7 Mio.Fr.und für das Verbilligen von Rindfleisch 1,2 Mio.Fr.aus.76 Schlacht- und Handelsbetriebe lagerten im Frühjahr 743 t Kalbfleisch ein,welches bis Ende des Berichtsjahres wieder dem Markt zugeführt wurde.Im Weiteren wurden 574 t Fleisch von Rindsvordervierteln für die Verarbeitung und rund 2'800 Rindsstotzen zur Trockenfleischproduktion verbilligt.
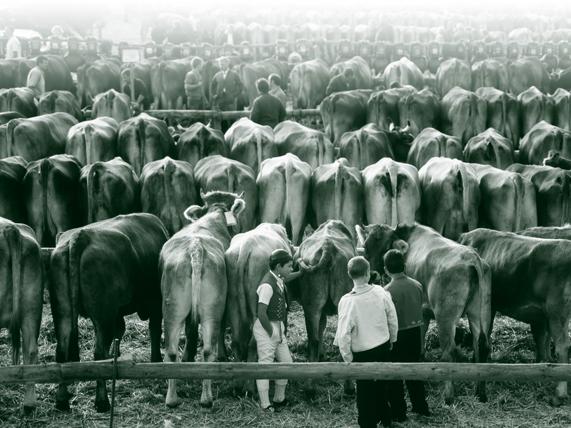
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 139 2
3.Erfassung und Kontrolle der Gesuche um Zollkontingentsanteile
Im Sommer 2005 wurden die Inlandleistungsdaten per Gesuch gemeldet,die für die Verteilung von 34% der Menge einer Fleischkategorie in der Kontingentsperiode 2006 massgebend sind.Seit dem Jahr 2000,in dem 1'003 Gesuche gestellt wurden,sinkt die Zahl der Gesuche stetig auf rund 730.Ab 2007 werden lediglich noch 10% der Zollkontingentsanteile von Fleisch von Tieren der Rindergattung (ohne Rindsbinden) und von Fleisch von Tieren der Schafgattung auf Grund einer Inlandleistung zugeteilt. Basierend auf den eingereichten Inlandleistungsdaten teilte das BLW für das Jahr 2006 insgesamt 721 juristischen und natürlichen Personen (2005:761) Zollkontingentsanteile mittels Verfügung zu:568 Personen erhielten Anteile für Fleisch von Tieren der Rindergattung (ohne Rindsbinden),345 für Schweinefleisch in Hälften,170 für Fleisch von Tieren der Schafgattung,141 für Rindsbinden,36 für Fleisch von Tieren der Pferdegattung und 22 für Fleisch von Tieren der Ziegengattung.Den grössten Rückgang mit minus 12% Zollkontingentanteilsinhabern weist die Kategorie Fleisch von Tieren der Schweinegattung auf.Entgegen dem allgemeinen Trend stieg die Zahl der Zollkontingentanteilsinhaber beim Pferdefleisch von 33 (2005) auf 36.Die Zollkontingentsanteile für Geflügelfleisch wurden im Jahr 2006 zu 34% nach einer Inlandleistung zugeteilt.Anteile an dieser Fleischkategorie erhielten insgesamt 30 Personen.
Das BLW legt die Einfuhrmengen für eine Einfuhrperiode nach Anhörung des Verwaltungsrates der Proviande und nach Beurteilung der Marktlage fest.Als Einfuhrperiode gilt für Fleisch von Tieren der Rindergattung und für Schweinefleisch in Hälften ein Zeitraum von vier Wochen und für Fleisch von Tieren der Schaf-,Ziegen- und Pferdegattung,Geflügelfleisch und Schlachtnebenprodukte das Jahresquartal.Mit der Erfüllung gewisser Voraussetzungen können die Einfuhrperioden jedoch auch verkürzt oder verlängert werden.Das BLW schrieb in der Kontingentsperiode 2005 33% aller Fleischeinfuhrmengen zur Versteigerung aus.
Die Bietenden können ihre Steigerungsgebote faxen,per Post senden oder durch einen gesicherten Internetzugang auf der Web-Applikation «eVersteigerung» des BLW einreichen.Mehr als 80% aller Gebote werden elektronisch übermittelt.Im Verlaufe des Jahres haben total 170 Firmen an der Versteigerung von Fleisch von Tieren der Rinder-, Schaf-,Schweine-,Pferde- und Ziegengattung sowie von Geflügelfleisch und Schlachtnebenprodukten teilgenommen.Da ein Teilnehmer die Gebote vieler kleinerer Firmen in einer so genannten Bieterplattform bündelt und anschliessend einreicht,ist die effektive Teilnehmerzahl jedoch grösser.47 Firmen (28%) waren bislang nicht Zollkontingentanteilsinhaber auf Grund einer Inlandleistung.Es sind hauptsächlich Firmen, welche Kantinen und die Gastronomie beliefern,und die nun neu direkt am Importmarkt partizipieren konnten.Ersteigert haben sie hauptsächlich Geflügelfleisch und Nierstücke/High-Quality-Beef.57 Firmen (33%),die schon Anteilsinhaber bei gewissen Fleischkategorien im Inlandleistungssystem waren,steigerten neu bei anderen Fleischkategorien mit.Diese Firmen dehnten ihr Importgeschäft auf neue Fleischsorten aus. Hauptsächlich ersteigerten sie zugeschnittene Rindsbinden,Schaf- und Geflügelfleisch. 66 Firmen (39%) haben ausschliesslich bei den Fleischkategorien gesteigert,wo sie bis dato auch Anteilsinhaber auf Grund einer Inlandleistung waren.Die Dynamik und der Wettbewerb im Markt für Importfleisch hat bereits mit der Versteigerung eines Drittels der Einfuhrmenge stark zugenommen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 140
■ Versteigerung Fleisch
Ergebnisse der Versteigerungen 2005
ProduktVersteigerte MengeDurchschnittlicheDurchschnittlicher Zahl der
Von den ab 2005 erstmals versteigerten Fleischkategorien resultierten Einnahmen zu Gunsten der Bundeskasse von insgesamt 42,7 Mio.Fr.Die Nierstücke/High-QualityBeef trugen dazu mit einem Anteil von 45% bei.Der Bundesrat schätzte in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2007) vom 29.Mai 2002 (BBl Nr.29 2002.Seite 4812) die zusätzlichen Einnahmen zu Gunsten der Bundeskasse für das Jahr 2005 auf 50 Mio.Fr.Auf Grund der fehlenden Erfahrungswerte für die Zuschlagspreise und der bei einigen Fleischkategorien variablen,marktlagenabhängigen Einfuhrmengen wurde nun effektiv etwas weniger Geld in die Bundeskasse eingenommen als ursprünglich angenommen wurde.Wurstwaren und Fleischspezialitäten werden bereits seit 1999 zu 100% versteigert.Die Einnahmen in die Bundeskasse betrugen für diese Produkte 15,1 Mio.Fr.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 141 2
Einheitkg bruttoAnzahlFr./kg brutto Geflügelfleisch13 200 000600,59 Fleisch von Tieren der Schafgattung2 079 000433,51 Schweinefleisch in Hälften1 996 000270,57 Fleisch von Tieren der Pferdegattung1 518 000161,07 Nierstücke / High-Quality-Beef1 460 2505613,16 Verarbeitungsfleisch von Kühen808 500331,73 Rindfleisch (Halal)300 00050,67 Rindsbinden297 000339,80 Kalbfleisch264 000293,33 Rindfleisch (Koscher)241 000270,05 Zungen195 50080,05 Schaffleisch (Halal)100 00061,27 Fleisch von Tieren der Ziegengattung82 500200,90 Ochsenmaul61 50050,15 Kalbslebern24 40090,20 Schaffleisch (Koscher)17 35020,19 Kalbsmilken3 30030,02 Quelle:BLW
TeilnehmerZuschlagspreis
■ Eier:Unterstützung der inländischen Produktion und Verwertungsmassnahmen
Das BLW richtete Investitionsbeiträge für den Um- und Neubau von besonders tierfreundlichen Geflügelställen aus.Die Beiträge sind ausschliesslich zu Gunsten von Ställen für Geflügel zur Eierproduktion bestimmt und müssen weder zurückgezahlt noch verzinst werden.12 Betriebe mit Legehennen,3 Betriebe mit Junghennen und 1 Betrieb mit Lege- und Junghennen erhielten insgesamt 460'446 Fr.Die 16 Betriebe halten durchschnittlich 5'750 Tiere und 3 davon produzieren nach biologischen Richtlinien.
Vor allem nach Ostern und in den Sommermonaten ist die Nachfrage nach inländischen Eiern gegenüber der Zeit vor Weihnachen und vor Ostern schwach.Um die Auswirkungen dieser saisonalen Nachfrageschwankungen zu mildern,stellte das BLW nach Anhörung der interessierten Kreise maximal 3 Mio.Fr.für Verwertungsmassnahmen zur Verfügung.Die Eiprodukthersteller schlugen 20,3 Mio.überschüssige Inlandeier auf,wobei sie pro nachweislich aufgeschlagenes Ei einen Beitrag von 9 Rp. erhielten.Zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten verbilligten die Anbieter 13,9 Mio.Eier.Dafür erhielten sie 5 Rp.je Ei.Insgesamt nahmen 14 Firmen an den Aufschlagsaktionen und 13 Firmen an der Verbilligungsaktion teil.Das BLW überprüfte die Einhaltung der Bestimmungen der Aufschlags- und Verbilligungsaktionen mit Domizilkontrollen und Kontrollen von Nachweisdokumenten.
■ Nutz- und Sportpferde: Versteigerung des Zollkontingentes
Im Jahr 2005 hat das BLW das Zollkontingent Tiere der Pferdegattung (ohne Zuchttiere,Esel,Maulesel und Maultiere) in zwei Hälften von je 1'461 St.ausgeschrieben und versteigert.Pro Versteigerung reichten rund 200 Personen Gebote ein.Im Mittel lag der Zuschlagspreis bei 357 Fr.pro Nutz- und Sportpferd,was einen Versteigerungserlös zu Gunsten der Bundeskasse von über 1 Mio.Fr.ergab.
■ Tierverkehrskontrolle und Entsorgung der tierischen Nebenprodukte
Seit dem Jahr 1999 wird die Tierverkehr-Datenbank von der Identitas AG (vormals Tierverkehrsdatenbank AG) geführt.Die Hauptaufgaben sind,die Ohrmarken zu verteilen,die Meldungen des Tiervekehrs zu erfassen und zu verarbeiten,Gebühren in Rechnung zu stellen und Entsorgungsbeiträge an Tierhalter und Schlachtbetriebe auszuzahlen.Der Bundesrat beschloss im April 2005,dass der Betrieb der TierverkehrDatenbank weiterhin an eine Privatfirma in Auftrag gegeben werden soll.Basierend auf diesem Beschluss hat das BLW mit der Identitas AG eine neue Leistungsvereinbarung für die Periode vom 1.Januar 2006 bis zum 31.Dezember 2010 abgeschlossen.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 142
Massnahmen 2005
2.1.4Pflanzenbau
Am Massnahmenkatalog zur Sicherstellung der Inlandproduktion gab es im Berichtsjahr keine grundlegenden Änderungen.Im Bereich Futtermittel und Brotgetreide erfolgte eine Reduktion des Grenzschutzes.
Bei Obst,Gemüse und Schnittblumen ist der Grenzschutz die wichtigste Massnahme. Bei Obst ist zudem die finanzielle Beteiligung an der Übermengenverwertung von Mostobst,die Marktentlastung für Steinobst und die Pflanzung innovativer Kulturen von Bedeutung.Im Weinbereich ist die Umstellung von Rebflächen zu erwähnen.
1Je nach Verwendungszweck bzw.Zolltarifposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung
2Betrifft nur Teile der Erntemenge (Frischverfütterung und Trocknung von Kartoffeln,Marktreserven Kernobstsaftkonzentrate)

3Kartoffeln:nur für Kartoffelprodukte zu Speisezwecken / Saatgut:nur für Saatkartoffeln / Obst:nur für verarbeitete Konservenkirschen und diverse Kernobstprodukte
4Betrifft nur bestimmte Kulturen Quelle:BLW
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 143 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Massnahme Grenzschutz 1 ■■■■■■■■ Verarbeitungsbeiträge ■■ 2 ■■ 2 ■ 2 Anbaubeiträge ■■■ Ausfuhrbeiträge 3 ■■■ Beiträge für Umstellung und Pflanzung innovativer Kulturen 4 ■■
Kultur Getreide Körnerleguminosen Ölsaaten Kartoffeln Zuckerrüben Saatgut Gemüse,Schnittblumen, Weinbau Obst
■ Finanzielle Mittel
Die für den Pflanzenbau ausgerichteten Marktstützungen nahmen gegenüber dem Vorjahr von 142 auf 125 Mio.Fr.ab.Durch eine Flächenausdehnung stiegen die in Form von Anbaubeiträgen ausgerichteten Mittel um 0,9 Mio.Fr.an,währenddem die ausbezahlten Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge aufgrund der Sparmassnahmen sanken.
Mittelverteilung 2005
Total 125 Mio. Fr.
Exportbeiträge 7%
Diverses 3%
Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 55%
Anbaubeiträge 35%
Quelle: Staatsrechnung
Insgesamt sanken die für die Ackerkulturen aufgewendeten Mittel im Vorjahresvergleich um 6,7 Mio.Fr.Wie bereits im Vorjahr teilte sich der Beitrag für die Verarbeitung der Zuckerrüben auf die Ernten 2004 und 2005 auf.Für die Verarbeitung der Ernte 2004 wurden nach einer neuerlichen Beitragskürzung noch 35,6 Mio.Fr.aufgewendet.Geringere Ausgaben für Kartoffeln sind auf eine Kürzung des Beitrages zur Verwertung nicht marktfähiger Kartoffeln zurückzuführen.Der Ausgabenrückgang bei den Ölsaaten beruht auf einer Kürzung des Beitrages für die Verarbeitung von Ölsaaten.Die mit dem Vollzug der Leistungsvereinbarung beauftragte Branchenorganisation swiss granum musste in der Folge die nach Ölsaat und Verwendungszweck abgestuften Beitragsansätze anpassen,was sich direkt auf die Produzentenerlöse auswirkte.
Die Ausgaben für die Obstverwertung reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Mio.Fr.Der Hauptgrund dafür ist die geringe Mostäpfelernte,welche den Jahresbedarf nicht zu decken vermochte.Das Apfelsaftkonzentrat,welches im Vorjahr aus Übermengen ausgeschieden worden war,konnte zum Teil für die Deckung des inländischen Bedarfes verwendet werden.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 144
Tabelle 29,Seite A30
Mittelverteilung nach Kulturen
Zuckerrüben 1
Kartoffeln
Körnerleguminosen Ölsaaten (inkl. NWR)
Nachwachsende Rohstoffe (ohne Ölsaaten)
Saatgutproduktion Obst
Mio. Fr. 0253050 5 10 1520354045 Weinbau 2
Ausgaben für Obstverwertung 2005
Total 9,7 Mio. Fr.
Export andere Kernobstprodukte 2,7%
Export Kirschen 1,5%
Verwertung von Äpfel und Birnen im Inland 4,0%
Marktanpassungsmassnahmen bei Obst und Gemüse 8,9%
Export von Apfelsaftkonzentrat 38,1%
Export von Birnensaftkonzentrat 43,3%
Anderes 1,5% davon Marktentlastung Kirschen und Zwetschgen 0,3%
Quelle: BLW
Im Berichtsjahr betrug die Unterstützung für die Obstverwertung 9,7 Mio.Fr.Dies entspricht lediglich 53% der durchschnittlichen Ausgaben der vier Vorjahre.Im Vergleich zum Vorjahr wurden für den Export von Apfelsaftkonzentrat 7,0 Mio.Fr.und für den Export von Birnensaftkonzentrat 1,1 Mio.Fr.weniger aufgewendet.

2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 145 2
1 2004: 38,2 Mio. Fr. für Ernte 2003 und 7,1 Mio. Fr. für Ernte 2004; 2005: 28,5 Mio. Fr. für Ernte 2004 und 17,5 Mio. Fr. für Ernte 2005 2 ab 2004 ohne Absatzförderung, 2003 Verwertung von Traubensaft 2003
Quelle:
Staatsrechnung
2004 2005
Ackerkulturen
Am 1.Juli 2005 traten die vom Bundesrat im vorausgegangenen November beschlossenen Senkungen der Schwellenpreise von Futtermitteln und des Kontingentszollansatzes von Brotgetreide in Kraft.Die Grenzbelastung von Energiefuttermitteln (Futtergetreide) sowie Brotgetreide sank um Fr.3.– je 100 kg und von Eiweissfuttermitteln (Eiweisserbsen,Nebenprodukte aus der Ölsaatenverarbeitung) um Fr.1.– je 100 kg.
Biomasse bindet bei deren Bildung dieselbe Menge CO2,die bei vollständiger Verbrennung wieder freigesetzt wird.Sie gilt daher als CO2-neutral.Zwar ist die Entstehung fossiler Energieträger auch auf organisches Material zurückzuführen,doch hat die urzeitliche Bildung natürlicher,hochkonzentrierter Kohlenstoffsenken zu einer Reduktion des CO2 in der Atmosphäre geführt.Die relativ konstante Zusammensetzung der Luft hat das globale Klima der vergangenen Jahrtausende geprägt.Mit dem seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts rasant angestiegenen Verbrauchs von Erdöl und Erdgas nimmt auch die CO2-Konzentration in der Luft zu.Zur Reduzierung der CO2-Emissionen kann eine Substituierung von fossilen durch erneuerbare Energien beitragen.Zwar wird Elektrizität zu über 50% aus Wasserkraft gewonnen,doch tragen die erneuerbaren Energien insgesamt lediglich zu rund 16% zur total konsumierten Energie bei. Die Wasserkraft ist mit einem Anteil von rund 70% denn auch der wichtigste erneuerbare Energieträger.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 146
■ Massnahmen an der Grenze ■ Energetisches Potenzial von Biomasse Energie-Endverbrauch seit 1910 nach Energieträgern 1910192019301940195019601970198019902000 PJ (10 15 Joule) übrige erneuerbare Energien Fernwärme Elektrizität 1 Gas Erdöltreibstoffe Erdölbrennstoffe Müll und Industrieabfälle Kohle und Koks Holz und Holzkohle Quelle: BFE 1 rund 50% der Elektrizität wird aus Wasserkraft gewonnen 0 500 400 300 200 100 600 700 800 900
■
Die Studie «Potentiale zur energetischen Nutzung von Biomasse in der Schweiz» des Bundesamtes für Energie (2004) zeigt das theoretische und das ökologische Nettoproduktionspotenzial verschiedener Biomassesortimente bis im Jahre 2040 auf.Das ökologische Nettoproduktionspotenzial ist definiert als Biomasse,welche aus landund forstwirtschaftlicher Produktion inkl.Nebenprodukten nachhaltig und energetisch mit einem plausiblen Aufwand-/Ertragsverhältnis gewonnen werden kann.Es müssen klar positive Energie- und Umweltbilanzen vorliegen.Die Rangfolge des bis 2040 realisierbaren Potenzials führt Wald- und Feldholz vor biogenen Haushalts- und Industrieabfällen sowie Ernterückständen und Hofdünger an.Unter Ausschöpfung des ökologischen Nettoproduktionspotenzials würde die aus Biomasse gewonnene Energie anhand eines konservativen Szenarios auf gegen 100 Petajoule oder bezogen auf den Endenergieverbrauch im Jahre 2004 von rund 4% auf 11% ansteigen.
Biomassepotenzial 2040
PJ (10 15 Joule) 060120 204080100
Wald- und Feldholz
Ackerkulturen, Energiepflanzen
Wiesland
Ernterückstände, Hofdünger
Strukturreiche Biomasse
Altholz, Restholz biogene Haushalts- und Industrieabfälle
theoretisches Potenzial ökologisches Nettoproduktionspotenzial Nutzung 2003
Quelle: BFE
Geeignet zur energetischen Verwertung ist primär preiswerte,kontinuierlich anfallende oder lagerfähige Biomasse von hoher Energiedichte.Im Vordergrund stehen neben Holz organische Abfälle und bezogen auf ackerbauliche Erzeugnisse Ernteprodukte mit hohen Stärke- oder Ölgehalten wie Getreide oder Ölsaaten.Grundsätzlich sind auch Kartoffeln,Zuckerrüben oder Gras energiereiche Ernteprodukte,doch wirkt sich deren hoher Wassergehalt in grossen Transportmassen,hohen Lagervolumina und in beschränkter Lagerfähigkeit aus.Biomasse kann zur thermischen Nutzung direkt verbrannt oder durch die Konversionspfade Pressung,Veresterung,Alkoholgärung oder Methangärung zu Treibstoff verarbeitet werden.Für Energieholz in Form von Stückgut, Schnitzeln oder Pellets steht die Substituierung von Heizöl im Vordergrund.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 147
Energetische Verwertung von Biomasse
■ Treibstoffgewinnung aus Biomasse
Das gängige Sortiment von erneuerbaren Treibstoffen umfasst Ethanol,Fettsäuremethylester (Biodiesel),Biogas und pflanzliche Rohöle.Qualitativ hochwertiges Rohöl kann in umgerüsteten Dieselmotoren direkt als Treibstoff eingesetzt werden.Rohe Pflanzenöle,pflanzliche Gebrauchtöle oder tierische Fette lassen sich zu Fettsäuremethylester (z.B.Rapsmethylester) weiterverarbeiten.Fettsäuremethylester dient als Dieselersatz,doch muss bei höheren Beimischungsanteilen zu Diesel oder bei Verwendung in Reinform zur Aufrechterhaltung der Garantieleistungen die Freigabe des jeweiligen Fahrzeugherstellers vorliegen.Aus cellulose-,stärke- oder zuckerreicher Biomasse kann mittels Alkoholgärung Ethanol oder mittels Methangärung in Biogasanlagen Biogas gewonnen werden.Ethanol kann Benzin oder Diesel beigemischt werden,wobei bei grösseren Mischungsanteilen eine adäquate Motorentechnologie erforderlich ist.Biogas wird in dezentralen,kleinen Biogasanlagen vorwiegend verstromt.Eine Alternative für grössere Anlagen ist die Aufbereitung des Biogases und dessen Einspeisung ins Erdgasnetz.
Basierend auf spezifischen Erträgen von Ackerkulturen lassen sich anhand mittlerer Ausbeuteziffern die Treibstofferträge je Flächeneinheit errechnen.Losgelöst von einer wirtschaftlichen Beurteilung weisen Zuckerrüben den grössten Ethanolertrag aus.Zu berücksichtigen ist,dass der Heizwert von Ethanol lediglich knapp zwei Drittel von Benzin erreicht.Zur Erbringung der mit einem Liter Benzin erzielbaren Leistung ist daher ein deutlich grösseres Volumen Ethanol nötig.Die landwirtschaftliche Nutzfläche des gesamten Talgebietes beträgt rund 600'000 ha.Würde diese Fläche vollumfänglich mit Zuckerrüben bepflanzt,liesse sich mit der resultierenden Bruttoethanolmenge dennoch weniger als die Hälfte des im Jahre 2004 verbrauchten Benzins und Diesels abdecken.Unter Berücksichtigung des kalorienmässigen Selbstversorgungsgrades von lediglich 60%,der höheren Wertschöpfung im Nahrungs- und Futtermittelbereich sowie den im nachhaltigen Ackerbau erforderlichen Fruchtwechseln und Anbaupausen verbleibt nur ein geringes Potenzial zur Erzeugung nachwachsender Rohstoffe zwecks Treibstoffgewinnung.Im Vordergrund steht die energetische Verwertung von organischen Haushaltsabfällen sowie Abfällen aus der Nahrungs- und Futtermittelindustrie. Die gängigen Technologien zur Herstellung von Ethanol oder Fettsäuremethylester aus nachwachsenden Rohstoffen ergeben nur leicht positive Energiebilanzen.Um mit Ackerkulturen einen substanziellen Beitrag an den Treibstoffverbrauch leisten zu können,sind neue Technologien und Verfahren notwendig.
Ethanol CHErnteertragEthanol-Raps-BenzinMittel 2003/05ertragmethylesteräquivalente

2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 148
t/hal/hal/hal/ha Zuckerrüben74,98 0005 200 Weizen5,82 2001 400 Triticale5,92 3001 500 Roggen6,02 4001 600 Körnermais9,33 5002 300 Kartoffeln37,33 0002 000 Raps3,21 2001 200 Quellen:SBV,BMVEL,BLW
■ Rahmenbedingungen für die Treibstoffgewinnung
Das Eidgenössische Finanzdepartement erhebt auf Treibstoffen eine Mineralölsteuer und einen Mineralölsteuerzuschlag.Insgesamt beträgt die Verbrauchssteuer heute rund Fr.0.73 je Liter Benzin.Erneuerbare Treibstoffe aus Biomasse sind steuerfrei, sofern sie basierend auf der Mineralölsteuerverordnung in von der Eidgenössischen Zollverwaltung anerkannten Pilot- und Demonstrationsanlagen hergestellt werden. Das BLW richtet für die Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen in anerkannten Pilot- und Demonstrationsanlagen Beiträge gemäss Ackerbaubeitragsverordnung aus. Diese sind als Anschubfinanzierung und nicht als permanente Stützung von gewerblichen oder industriellen Verarbeitungsanlagen konzipiert.Für die Verarbeitung von 3'900 t Inlandraps zu Treibstoff (Rapsmethylester),Treibstoffadditiven oder Schmiermitteln erhielten im Berichtsjahr zwei anerkannte Pilot- und Demonstrationsanlagen insgesamt 1,2 Mio.Fr.(im Mittel Fr.31.80 je 100 kg Raps).Mit dieser Stützung lösen die Produzenten von Raps zu technischen Zwecken annähernd denselben Preis wie für Raps zur Speiseölgewinnung.Ohne diese Stützung hätten die Verarbeiter aus Wirtschaftlichkeitsgründen den Rohstoff zusätzlich zu der importierten Rapsmenge von 4'000 t zu technischen Zwecken nahezu zollfrei auf dem internationalen Markt beschaffen müssen.
■ Ausblick
Der Bundesrat hat im Juni 2006 beschlossen,die Schwellenpreise von Eiweissfuttermitteln per 1.Juli 2006 um Fr.2.– je 100 kg zu reduzieren.Im Bereich Mischfutter wurde gleichzeitig ein Systemwechsel vorgenommen.Es werden keine Importrichtwerte mehr festgesetzt,sondern die Grenzbelastung wird mittels Standardrezeptur basierend auf der Grenzbelastung der verschiedenen Komponenten errechnet.Der den Mischfutterherstellern bislang gewährte Industrieschutz soll schrittweise abgebaut werden,was mithilft,die Futterkosten der Tierhalter zu senken und damit deren Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Im Energiebereich können die laufenden Revisionen des Mineralölsteuer-,CO2- und des Raumplanungsgesetzes sowie die Ausgestaltung des Energiegesetzes zu neuen Rahmenbedingungen führen.In Anbetracht des zu erwartenden Grenzschutzes im Nahrungs- und Futtermittelbereich nach Abschluss weiterer multilateraler und/oder bilateraler Abkommen dürfte die Wertschöpfung und damit die Effizienz der eingesetzten Bundesmittel im Bereich Ernährung nach wie vor höher ausfallen als im Energiesektor.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 149 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
Spezialkulturen
Apfel- und Birnensaftkonzentrate,welche im Inland nicht abgesetzt werden können, werden in den nachfolgenden Jahren exportiert.Die starken Exportschwankungen sind nachteilig für die Exportpreise.Zusätzliche Erschwernisse bilden neben den hohen Produktions- und Transportkosten,die im EU-Raum für Schweizer Kernobstsaftkonzentrate geltenden Importzölle von 18 und 21% des Exportwertes.
Mostapfelernte, Bedarf und Export von Apfelsaftkonzentrat in den Jahren 1998 bis 2005
Die Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen der Mostapfelernte,dem Bedarf an inländischen Mostäpfeln und dem Export von Apfelsaftkonzentrat auf.Während der Bedarf an inländischen Mostäpfeln von Jahr zu Jahr konstant ist,sind die Erntemengen grossen jährlichen Schwankungen ausgesetzt.Die Mostäpfel werden zu einem grossen Teil zu Apfelsaftkonzentrat verarbeitet.Dasjenige Konzentrat,das in den nachfolgenden Jahren im Inland nicht verwertet werden kann,gelangt in den Export.Tendenziell wird immer weniger Apfelsaftkonzentrat exportiert.
Die Situation ist bei den Mostbirnen noch ausgeprägter.Denn im Vergleich zum Bedarf sind die Erntemengen und somit die Exporte von Birnensaftkonzentrat höher.
Zwischen 1991 und 2001 nahm die Anzahl Hochstamm-Feldobstbäume um 20% ab. Gründe für diese Entwicklung sind namentlich fehlende Wirtschaftlichkeit dieser Produktion,Bauaktivitäten um die Dörfer und Rationalisierung in der Landwirtschaft. Es ist anzunehmen,dass die Reduktion im gleichen Ausmass fortschreitet.Die Erntemengen von Mostäpfeln und Mostbirnen nehmen entsprechend ab.Während für Mostäpfel in etwa ein Marktgleichgewicht im Jahre 2009 erwartet werden kann,ist bei Mostbirnen noch mit Überschüssen zu rechnen.Im Rahmen der AP 2011 sollen die Exporte von Kernobstsaftkonzentraten im Jahr 2009 zum letzen Mal mit Finanzhilfen unterstützt werden.Die Verstärkung der regionalen Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft wird zur Erhaltung der Hochstamm-Feldobstbäume beitragen.Der Markt an Obstprodukten, insbesondere der Konsum von Kernobstsäften,wird die Kernobstproduktion gestalten.
2.1 PRODUKTION UND ABSATZ 2 150
■ Export von Apfel- und Birnensaftkonzentrat ■ Ausblick
in t 1
Quelle: BLW
Mostapfelernte Bedarf an Mostäpfeln Export
199819992000200120032004 2002 0 25000 30000 35000 15000 20000 10000 5000 2005
1 in Form von Apfelsaftkonzentrat, 71% Gewicht, trüb
Apfelsaftkonzentrat
Die Direktzahlungen sind eines der zentralen Elemente der Agrarpolitik.Sie gelten die von der Gesellschaft geforderten Leistungen ab.Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen.

Ausgaben für die Direktzahlungen
Anmerkung:Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr;die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 Direktzahlungen
Mio.Fr.Mio.Fr.Mio.Fr.Mio.Fr.Mio.FrMio.Fr Allgemeine Direktzahlungen1 8041 9291 9951 9991 9942 000 Ökologische Direktzahlungen361413452477495507 Kürzungen231721171820 Total2 1422 3252 4262 4592 4702 486
Ausgabenbereich200020012002200320042005
Quelle:BLW 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 151
■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
2.2.1Bedeutung der Direktzahlungen
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten.Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere.Diese Beiträge haben das Ziel,die Nutzung und Pflege der landwirtschaftlichen Nutzfläche sicherzustellen.In der Hügelund Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen.Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt.Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).

■ Abgeltung besonderer ökologischer Leistungen
Die ökologischen Direktzahlungen geben einen Anreiz für besondere ökologische Leistungen.Zu ihnen gehören die Beiträge für den ökologischen Ausgleich,die ÖkoQualitäts-,die Gewässerschutz- und die Sömmerungsbeiträge sowie die ethologischen Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung der Nutztiere.Mit diesen Beiträgen werden Leistungen der Landwirtschaft,welche über die gesetzlichen Anforderungen und den ÖLN hinausgehen,mit wirtschaftlichen Anreizen gefördert.Ziele sind unter anderem,die Erhaltung bzw.die Erhöhung der Artenvielfalt in Landwirtschaftsgebieten,eine besonders tierfreundliche Nutztierhaltung,eine Verminderung des Düngerund Pflanzenschutzmitteleinsatzes,die Reduktion von Nitrat- und Phosphorbelastungen in Gewässern und die nachhaltige Nutzung des Sömmerungsgebietes.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 152
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2005
Die Direktzahlungen machten 2005 knapp 72% der Ausgaben des BLW aus.Von den Direktzahlungen kamen 63% der Berg- und Hügelregion zugute.
Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle:BLW
Direktzahlungen 2005 BeitragsartTotalTalregionHügelregionBergregion 1 000 Fr. Allgemeine Direktzahlungen1 999 606744 144514 634729 772 Flächenbeiträge1 319 595652 743326 778340 074 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere291 96784 58875 287132 093 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen282 2204 49679 109198 615 Allgemeine Hangbeiträge94 7682 31733 46058 991 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen11 056 Ökologische Direktzahlungen506 895202 253113 81093 285 Ökobeiträge409 348202 253113 81093 285 Beiträge für den ökologischen Ausgleich126 02372 97431 99721 053 Beiträge nach der Öko-Qalitätsverordnung (ÖQV)27 4428 8028 13310 507 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion)31 51622 0498 711756 Beiträge für den biologischen Landbau28 6018 7285 86914 004 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere195 76789 70059 10046 967 Sömmerungsbeiträge91 610 Gewässerschutzbeiträge5 936 Kürzungen20 378 Total Direktzahlungen2 485 758946 396628 444823 058 Direktzahlungen pro Betrieb Fr.44 12839 62541 08647 992
Anmerkung:
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 153 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN
■ Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
Quelle:Agroscope

Die Abgeltung der erschwerenden Bewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion führt dazu,dass die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis ansteigt.Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zahlreiche Anforderungen zu erfüllen.Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen wie Rechtsform,zivilrechtlicher Wohnsitz usw.,anderseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend,wie beispielsweise ein minimaler Arbeitsbedarf,das Alter der Bewirtschafter,das Einkommen und Vermögen. Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen,die unter den Begriff «Ökologischer Leistungsnachweis» (ÖLN) fallen.Die Anforderungen des ÖLN umfassen:eine ausgeglichene Düngerbilanz,ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen,eine geregelte Fruchtfolge,ein geeigneter Bodenschutz,eine gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. Mängel bei den massgebenden Vorschriften haben Kürzungen oder eine Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge.
Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von Referenzbetrieben nach Regionen 2005 MerkmalEinheitAlleTal-Hügel-BergBetrieberegionregionregion ReferenzbetriebeAnzahl3 1351 426901808 Landwirtschaftliche Nutzfläche øha 19,7520,6418,9219,09 Allgemeine Direktzahlungen totalFr.37 65731 21737 31748 738 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.7 9008 7968 1496 159 Total Direktzahlungen nach DZVFr.45 55740 01345 46754 896 RohertragFr.210 986254 733194 361154 400 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag%21,615,723,435,6
Reckenholz-Tänikon
ART
Tabellen 40a–41,Seiten A46–A49
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 154
■ Agrarpolitisches Informationssystem
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem).Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen,welche die Kantone zusammentragen und übermitteln und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart (Massnahme) gespiesen.Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge.Eine weitere Funktion des Systems besteht in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen.Dank der Informationsfülle und der leistungsfähigen EDV-Hilfsmittel können auch zahlreiche agrarpolitische Fragen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden.
Von den 61'981 über der Erhebungslimite des Bundes liegenden und im Jahre 2005 in AGIS erfassten Betrieben beziehen deren 56’330 Direktzahlungen.
■ Auswirkungen der Begrenzungen und Abstufungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus.Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro SAK,bei den Abstufungen um die Degressionen nach Fläche und Tieren.
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2005
BegrenzungBetroffene Kürzung Anteil am Beitrag Anteil am Total Betriebeder betroffenenDZ Betriebe
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge,insbesondere für jene 217 Betriebe,deren Vermögen zu hoch ist.Von den Einkommensgrenzen waren im Jahr 2005 rund 970 Betriebe betroffen.Die Kürzung der Direktzahlungen betrug bei diesen Betrieben im Durchschnitt 10,45%.Insgesamt wurden aufgrund der Begrenzungen 10,3 Mio.Fr.an Direktzahlungen gekürzt;dies entspricht 0,41% des Gesamtbetrages.
AnzahlFr.%% pro StandardArbeitskraft409910 7076,140,04 auf Grund des Einkommens9684 782 94910,450,19 auf Grund des Vermögens2174 592 46367,240,18 Total10 286 1190,41
Quelle:BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 155
Wirkung der Abstufungen der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl 2005 MassnahmeBetroffene Fläche oder Reduktion Anteil am Anteil am BetriebeTierbestandBeitrag derTotal der pro BetriebBetriebeDirektzahlungsart
die extensive Produktion
Getreide
Insgesamt sind 8'908 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen.Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenen Massnahmen.Die Reduktionen betragen total 37,5 Mio.Fr.Gemessen an allen Direktzahlungen,die abgestuft sind,beträgt der Anteil sämtlicher Reduktionen 1,51%.Die Beitragsdegressionen wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus,wo die Abstufungen bei knapp 7’400 Betrieben (rund 13,2% aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen.Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 262 von dieser Reduktion betroffen,da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite und der Milchabzug bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken.Von der Beitragsreduktion betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen.So werden z.B.die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei 3’143 Betrieben (ohne Doppelzählungen) um 10,4% (BTS) bzw.um 8,3% (RAUS) reduziert.777 Bio-Betriebe erhalten um 7,3% herabgesetzte Direktzahlungen.
Anzahlha oder GVEFr.%% Flächenbeiträge7 40842,131 612 0867,61,27 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere26258,4745 9935,80,03 Allgemeine Hangbeiträge9934,345 0793,10,00 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen133,02 5462,30,00 Beiträge für den ökologischen Ausgleich1442,287 27012,00,00 Beiträge für
von
und Raps (Extenso-Produktion)4737,634 7865,00,00 Beiträge für den biologischen Landbau77740,0585 6917,30,02 Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme1 86868,01 732 57710,40,07 Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien2 83664,32 663 0398,30,11 Total8 908 1 37 509 0677,61,51 1ohne Doppelzählungen
Quelle:BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 156
■ Vollzug und Kontrolle
Die Kontrolle des ÖLN wird gemäss Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert.Diese ziehen akkreditierte Organisationen,die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten,zum Vollzug bei.Sie müssen die Kontrolltätigkeit stichprobenweise überprüfen.Direktzahlungsberechtigte Bio-Betriebe müssen neben den Auflagen des Biolandbaus die Vorgaben des ÖLN erfüllen und alle Nutztiere nach den RAUS-Anforderungen halten.Artikel 66 Absatz 4 der Direktzahlungsverordnung präzisiert,nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben.
Zu kontrollieren sind: –alle Betriebe,welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen; –alle Betriebe,bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden;und –mindestens 30% der übrigen Betriebe,die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind.
Bei einer mangelhaften Erfüllung des ÖLN werden die Beiträge nach einheitlichen Kriterien gekürzt.Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren hat eine entsprechende Richtlinie erlassen.
■ Durchgeführte Kontrollen und Beitragskürzungen
2005
Im Jahr 2005 waren insgesamt 56’330 Landwirtschaftsbetriebe beitragsberechtigt. Davon wurden 29'431 (52,4%) durch die Kantone bzw.durch die von ihnen beauftragten Kontrollstellen auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert.Allerdings variiert der Anteil der kontrollierten Betriebe sehr stark zwischen den Kantonen (21 bis 100%). Wegen Mängeln beim ÖLN wurden bei 2’143 Betrieben (3,8% der kontrollierten Betriebe) die Beiträge gekürzt.
Gemäss Bio-Verordnung müssen alle Bio-Betriebe jedes Jahr kontrolliert werden. Wegen Mängeln erhielten 3,6% der Biobetriebe gekürzte Beiträge.
Beim BTS-Programm wurden durchschnittlich 30,5% (11,2 bis 100%) und beim RAUSProgramm 53,4% (14,9 bis 100%) der beitragsberechtigten Betriebe kontrolliert.Beim BTS-Programm erhielten 1,4%,beim RAUS-Programm 2,4% der beteiligten Betriebe gekürzte Beiträge.
Gesamthaft wurden bei 6’683 Betrieben Mängel festgestellt,was Beitragskürzungen von rund 9 Mio.Fr.zur Folge hatte.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 157
mangelhafte Aufzeichnungen,nicht tiergerechte Haltung der Nutztiere,andere Gründe (fehlende Bodenproben,abgelaufener Spritzentest),nicht ausgeglichene Düngerbilanz,ungenügende Pufferund Grasstreifen,Auswahl und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,nicht rechtzeitige Anmeldung, nicht angemessener Anteil ÖAF.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (anderweitige Nutzung,Schnittzeitpunkt und Pflegemassnahmen nicht eingehalten),zu frühe oder unzulässige Nutzung,falsche Angabe der Anzahl Bäume,Verunkrautung,falsche Flächenangaben, unzulässige Düngung und Pflanzenschutz,nicht rechtzeitige Anmeldung.
nicht rechtzeitige Anmeldung,Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung,unzulässige Pflanzenschutzmittel.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Verstoss Fütterungsvorschriften,Hobbybetriebe nicht nach Bio-Vorschriften,Tierhaltung,Gewässerschutz, Aufzeichnungen u.a.),im Bio-Landbau nicht zugelassene Dünger und Pflanzenschutzmittel, nicht rechtzeitige Anmeldung,falsche Angaben.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Einstreu unzweckmässig),nicht rechtzeitige Anmeldung,kein Mehrflächen-Haltungssystem,Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften,mangelhafter Liegebereich,falsche Angaben,mangelhafte Stallbeleuchtung.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Mindestmastdauer nicht erreicht,Liegebereich mit Spalten/Löcher,Tierschutz,zu kleine Weidefläche, verspäteter Einzug u.a.),zu wenig Auslauftage, nicht rechtzeitige Anmeldung,mangelhafte Aufzeichnungen,nicht alle Tiere einer Kategorie nach den Vorschriften gehalten,falsche Angaben, ungenügender Laufhof.
Unter- oder Überschreitung des Normalbesatzes, unsachgemässe Weideführung,Nutzung nicht beweidbarer Flächen,Verstösse gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften,nicht rechtzeitige Anmeldung,Ausbringen nicht erlaubter Dünger, andere Elemente (Überlieferung Milchkontingent) falsche Angaben zum Tierbestand,fehlende Dokumente,nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden,Erschweren von Kontrollen,falsche Angaben betreffend Sömmerungsdauer,fehlende Daten, unerlaubter Herbizideinsatz,Wiederholungsfälle.
Quelle:Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Beitragskürzungen
Zusammenstellung der Beitragskürzungen 2005 KategorieBeitrags- Kontrollierte BetriebeKürzungenHauptgründe berechtigteBetriebemit BetriebeKürzungen AnzahlAnzahlAnzahlFr. ÖLN56 33029 4312 1432 895 337 ÖAF 53 403-1 324671 781 Extenso 16 9287 19356153 572 Bio 6 3505 944230357 198 BTS 38 64311 783520420 534 RAUS 37 70720 127915845 579 Sömmerung7 3871 5954911 235 282
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 158
Tabellen 42a–42b,Seiten A50–A51
Zusammenstellung der Beitragskürzungen 2005
KategorieBeitrags- Kontrollierte BetriebeKürzungenHauptgründe berechtigteBetriebemit BetriebeKürzungen
falsche Flächenangaben,falsche Tierbestandesangaben,andere Elemente (falsche Angaben ÖLN, weniger als 50% betriebseigene Arbeitskräfte,nicht rechtzeitige An-/Abmeldung eines Programmes, Kontrollen erschwert),falsche Angaben zum Betrieb oder Bewirtschafter,falsche Angaben zur Sömmerung. keine Angaben möglich

keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
AnzahlAnzahlAnzahlFr. Grunddaten--6451 699 717 Gewässerschutz--311844 798 Natur- und--2111 876 Heimatschutz Umweltschutz--2724 600 Total--6 683 9 160 274
Quelle:Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Beitragskürzungen
Tabellen 42a–42b,Seiten A50–A51
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 159
■ Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz
Die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen können in Spezialfällen,gestützt auf Anhang 6.4 der Direktzahlungsverordnung,Sonderbewilligungen ausstellen.Im Jahr 2005 gab es für 4’887 ha LN 2‘269 Sonderbewilligungen.Bei der letzten DZV-Revision wurden die ÖLN-Auflagen bezüglich Pflanzenschutzmittel angepasst.Die wichtigsten Änderungen betreffen den Hebizideinsatz im Getreidebau und die Bekämpfung der Getreidehähnchen nach dem Schadenschwellensprinzip.Diese Lockerung führte zu einer Abnahme bei den erteilten Sonderbewilligungen.Am häufigsten bewilligt wurde analog zu den Vorjahren die Behandlung von Blacken (Ampfer) und Hahnenfuss in Naturwiesen.
Erteilte Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz 2005
Bekämpfungsmittel BewilligungenFläche
mit Pflanzenschutzmittel während des Winterbehandlungsverbots1406,24629,5 Einsatz von Insektiziden und nematiziden Granulaten25511,260712,4
1mit anderen als die in den Weisungen der Konferenz der Kantonalen Pflanzenschutzdienste aufgelisteten Produkten
2 Erteilte Sonderbewilligungen für Pflanzenschutzmassnahmen,die in den anerkannten spezifischen Richtlinien ausgeschlossen sind
3 Die Mehrheit der Sonderbewilligungen im Obstbau betrifft ein im Verlauf des Anbaujahres bewilligtes Mittel
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 160
Fläche Applikationen
Getreide:Bekämpfung
351,5881,8 Raps:Bekämpfung
Erdflöhe50,270,1
der Kartoffelkäfer 1 662,91072,2 Leguminosen,Sonnenblumen, Tabak:Bekämpfung der Blattläuse90,4230,5 Übrige Schädlingsbekämpfung im Ackerbau1787,971514,6 Dauergrünland: Flächenbehandlung1 44863,82 49151 Gemüsebau 2 100,510,02 Obstbau 2,3 1185,23857,9 Weinbau 2 50,220,04 Total2 2691004 887100
Anzahl% allerha% der total BetriebeBetriebebetroffenen
der Getreidehähnchen 1
der
Kartoffeln:Bekämpfung
Quelle:BLW
2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen
Flächenbeiträge
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft,Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab.Die Flächenbeiträge werden seit dem Jahr 2001 mit einem Zusatzbeitrag für das offene Ackerland und die Dauerkulturen ergänzt.
Ansätze 2005Fr./ha 1
– bis 30 ha 1 200
– 30 bis 60 ha900
– 60 bis 90 ha600

– über 90 ha 0
1Der Zusatzbeitrag für offenes Ackerland und Dauerkulturen beträgt 400 Fr.pro ha und Jahr;auch er unterliegt der Flächenabstufung
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25%.Insgesamt handelt es sich um rund 5’000 ha,welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden.Schweizer Betriebe,die heute Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone zukaufen oder pachten,erhalten keine Direktzahlungen.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 161 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Flächendeckende Bewirtschaftung als Ziel
Tabellen 31a–31b,Seiten A31–A32
Flächenbeiträge 2005 (inkl.Zusatzbeitrag)
Der Zusatzbeitrag wurde für insgesamt 275’893 ha offenes Ackerland und 18’334 ha Dauerkulturen ausgerichtet.
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen 2005
Von der Beitragsdegression betroffen sind 9,3% der LN.Im Durchschnitt wird pro ha ein Flächenbeitrag von 1'282 Fr.ausbezahlt (inkl.Zusatzbeitrag).Die Betriebe mit einer Fläche bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 9,3% der gesamten LN.Eine Betriebsgrösse von mehr als 60 ha weisen lediglich 1,3% aller Betriebe aus;sie bewirtschaften 5,3% der gesamten LN.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 162
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion Flächeha479 162262 166288 0581 029 386 BetriebeAnzahl23 76815 25717 13756 162 Fläche pro Betriebha20,217,216,818,3 Beitrag pro BetriebFr.27 46321 41819 84423 496 Total Beiträge1 000 Fr.652 743326 778340 0741 319 595 Total Beiträge 20041 000 Fr.650 815326 632340 3271 317 773 Quelle:BLW
Quelle: BLW Grössenklassen in ha Betriebe LN mit vollen Beiträgen LN von der Beitragsdegression betroffen 30 20 10 0201030 über 90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 bis 5 1,72,4 20,4 27,5 17,5 14,2 7,7 12,3 1,1 0,2 0,3 0,9 20,5 18,2 20,6 18,4 1,6 6,0 Betriebe in %LN in % 8,8 0,3 0,2 1,1 1,72,4 0,9
■ Flächennutzung mit Grünland
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere
Die Massnahme hat zum Ziel,die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig die Flächen im Grasland Schweiz durch die Nutzung zu pflegen.
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere,die während der Winterfütterung (Referenzperiode:1.Januar bis Stichtag des Beitragsjahres) auf einem Betrieb gehalten werden.Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe,Ziegen,Bisons, Hirsche,Lamas und Alpakas.Die Beiträge werden in Abhängigkeit der vorhandenen Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt.Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE) und sind je ha begrenzt.Die Begrenzung ist abgestuft nach Zonen.

2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 163
Begrenzung der FörderungRGVE/ha –in der Ackerbauzone,der erweiterten Übergangszone und der Übergangszone2,0 –in der Hügelzone 1,6 –in der Bergzone I1,4 –in der Bergzone II 1,1 –in der Bergzone III0,9 –in der Bergzone IV0,8
Die RGVE sind in zwei Beitragsgruppen aufgeteilt.Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung,Bisons,Milchziegen und Milchschafe werden 900 Fr.,für die übrigen Ziegen und Schafe,sowie Hirsche,Lamas und Alpakas 400 Fr.je RGVE ausgezahlt.
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2005
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion Zu Beiträgen
Bei den Verkehrsmilchproduzenten wurde im Jahr 2005 pro 4‘400 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE vom beitragsberechtigten Bestand in Abzug gebracht.
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2005
MerkmalEinheitBetriebe mit Betriebe ohne vermarkteter vermarktete MilchMilch
BetriebeAnzahl16 97418 789
Tiere pro BetriebeRGVE24,113,3 Abzug aufgrund Beitragbegrenzung der GrünflächeRGVE1,21,2 MilchabzugRGVE16,10,0
zu Beiträgen berechtigt RGVE6,812,2
pro BetriebFr.5 97110 145
Quelle:BLW
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar rund 4’175 Fr.weniger RGVEBeiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch.Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z.B.Zulage für verkäste Milch).
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 164
berechtigende
BetriebeAnzahl10
Beiträge pro BetriebFr.8 3927 2078 6708 164 Total Beiträge1 000 Fr.84 58875 287132 093291 967 Total Beiträge 20041 000 Fr.79 84873 487132 785286 120
RGVEAnzahl98 73888 121157 347344 206
08010 44715 23635 763 Zu Beiträgen berechtigende RGVE pro BetriebAnzahl9,88,410,39,6
Quelle:BLW
Tiere
Beiträge
■ Abgeltung der Produktionserschwernisse
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen.Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere,bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung),werden bei dieser Massnahme auch soziale,strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt.Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere.Die Beiträge werden für höchstens 20 RGVE je Betrieb ausgerichtet.

2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 165
Ansätze pro RGVE 2005Fr./GVE – in der Hügelzone 260 – in der Bergzone I440 – in der Bergzone II 690 – in der Bergzone III930 – in der Bergzone IV1 190
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 2005
Gegenüber dem Vorjahr haben die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen infolge des laufenden Strukturwandels um rund 1,8 Mio.Fr. abgenommen.Dementsprechend verzeichnen die zu Beiträgen berechtigenden RGVE eine Abnahme um 2’959 Einheiten.Weiter zurückgegangen ist die Betriebszahl,und zwar um 475 Einheiten.
Verteilung der Raufutter verzehrenden Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen nach Grössenklassen 2005
Betriebe in 100
RGVE in 1 000
Im Beitragsjahr 2005 standen rund 66% der RGVE in beitragsberechtigten Betrieben, die von der Limite betroffen sind.Bei diesen Betrieben betrug der Anteil der RGVE ohne Beitrag 33%.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 166
MerkmalEinheitTal- Hügel-Berg-Total region 1 regionregion Zu Beiträgen berechtigende RGVEAnzahl50 504228 463240 408519 375 BetriebeAnzahl2 84214 41116 49033 743 RGVE pro BetriebAnzahl17,815,914,615,4 Beiträge pro BetriebFr.1 5825 49012 0458 364 Total Beiträge1 000 Fr.4 49679 109198 615282 220 Total Beiträge 20041 000 Fr.4 42579 473200 125284 023 1
Quelle:BLW
Betriebe,die
einen Teil der Fläche in der Berg- und Hügelregion bewirtschaften
bis 5
Tiere
5–10 10–15 15–20 20–30 30–45 45–90 über 90 Quelle:
Grössenklassen in RGVE Betriebe (in 100) Tiere (in 1 000) mit Beitrag Tiere (in 1 000) ohne Beitrag 100 50 0 050100150200250 9 41 71 1080 16535 8762 3650 57 55 24 62 82 42 15 7 3
in
BLW
■ Allgemeine Hangbeiträge:Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Hangbeiträge
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion abgegolten.Sie werden nur für Wies-,Streuund Ackerland ausgerichtet.Wiesen müssen jährlich mindestens einmal,Streueflächen alle ein bis drei Jahre geschnitten werden.Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt.
für Hangflächen 2005
Total 562 122 ha
Betriebe mit Hangbeiträgen 2005 Quelle: BLW
Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert leicht von Jahr zu Jahr.Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab,die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben.
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 167
Ansätze 2005Fr./ha – Neigung 18 bis 35% 370 – Neigung über 35% 510
MerkmalEinheitTal- Hügel-Berg-Total region 1 regionregion Zu Beiträgen berechtigende Flächen: – Neigung 18–35%ha4 42565 26874 322144 016 – über 35% Neigungha1 33218 26361 81381 408 Totalha5 75783 532136 135225 424 BetriebeAnzahl2 04713 65715 92231 626 Beitrag pro BetriebFr.1 1322 4503 7052 997 Total Beiträge1 000 Fr.2 31733 46058 99194 768 Total Beiträge 20041 000 Fr.2 27633 73059 30295 308 1Betriebe
Quelle:BLW
Beiträge
mit Flächen in der Berg- und Hügelregion
unter
Neigung 60% 18–35% Neigung 26% 35% und mehr Neigung 14%
18%
■ Hangbeiträge für Rebflächen:Zur Erhaltung der Rebflächen in Steilund Terrassenlagen
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei,Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten.Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden,wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden.Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden nur für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet.Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig.
Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2005
Der Anteil der beitragsberechtigten Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 30% und der Anteil Betriebe gemessen an der Gesamtzahl aller Rebbaubetriebe 52%.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 168
Ansätze 2005Fr./ha – für Flächen mit 30 bis 50% Neigung 1 500 – für Flächen mit über 50% Neigung 3 000 – für Flächen in Terrassenlagen 5 000
Einheit Zu Beiträgen berechtigende Flächen total:ha3 629 Steillagen 30 bis 50% Neigungha1 834 Steillagen über 50% Neigung ha335 Terrassenanlagenha1 460 BetriebeAnzahl2 908 Fläche pro Betriebha1,25 Beitrag pro BetriebFr.3 802 Total Beiträge1 000 Fr.11 056 Total Beiträge 20041 000 Fr.10 691 Quelle:BLW
2.2.3Ökologische Direktzahlungen

Ökobeiträge
Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab,deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen.Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten,bei denen sie freiwillig mitmachen können.Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig;die Beiträge können kumuliert werden.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 169 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Quelle: BLW Total 409,3
Ökoausgleich 31% Extenso 8% RAUS 35% BTS 12% Biologischer Landbau 7% ÖQV 7%
Tabellen 32a–32b,Seiten A33–A34 Verteilung der Ökobeiträge auf die verschiedenen Programme 2005
Mio. Fr.
Ökologischer Ausgleich
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert werden.Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei.Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN angerechnet werden,während andere Elemente beim ÖLN nur anrechenbar sind.
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Beim ÖLN anrechenbare Elemente Beim ÖLN anrechenbare Elemente mit Beiträgen ohne Beiträge extensiv genutzte Wiesenextensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte WiesenWaldweiden Streueflächeneinheimische standortgerechte
Einzelbäume und Alleen Hecken,Feld- und UfergehölzeWassergräben,Tümpel,Teiche BuntbrachenRuderalflächen,Steinhaufen und -wälle RotationsbrachenTrockenmauern Ackerschonstreifenunbefestigte natürliche Wege Hochstamm-FeldobstbäumeRebflächen mit hoher Artenvielfalt
weitere,von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN
Die Flächen dürfen nicht gedüngt und während sechs Jahren in Abhängigkeit zur Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt werden.Das späte Mähen soll gewährleisten,dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird.So bleibt auch zahlreichen wirbellosen Tieren,bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion.
Die Beiträge für extensiv genutzte Wiesen,Streueflächen,Hecken,Feld- und Ufergehölze sind einheitlich geregelt und richten sich nach der Zone,in der sich die Fläche befindet.Der Anteil an extensiven Wiesen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 170
Ansätze 2005Fr./ha – Ackerbau- und Übergangszonen 1 500 – Hügelzone1 200 – Bergzonen I und II 700 – Bergzonen III und IV450
■ Extensiv genutzte Wiesen
Tabellen 33a–33d,Seiten A35–A38
■ Streueflächen
Beiträge für extensiv genutzte Wiesen 2005
■ Hecken,Feld- und Ufergehölze
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten,welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden.
Beiträge für Streueflächen 2005
Als Hecken,Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-,Hoch- oder Baumhecken,Windschutzstreifen,Baumgruppen,bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze. Die Flächen müssen während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet und sachgerecht gepflegt werden.
Beiträge für Hecken,Feld- und Ufergehölze 2005
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 171
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl19 0349 84510 11638 995 Flächeha26 20810 72915 28252 219 Fläche pro Betriebha1,381,091,511,34 Beitrag pro BetriebFr.2 0161 1118021 473 Total Beiträge1 000 Fr.38 38110 9388 11657 434 Total Beiträge 20041 000 Fr.36 93110 4817 85755 269 Quelle:BLW
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl1 8691 9673 1707 006 Flächeha1 8741 5273 5646 964 Fläche pro Betriebha1,000,781,120,99 Beitrag pro BetriebFr.1 470755707924 Total Beiträge1 000 Fr.2 7471 4852 2426 474 Total Beiträge 20041 000 Fr.2 7541 4402 2546 448 Quelle:BLW
BetriebeAnzahl5 7012 9711 2119 883 Flächeha1 3827733022 457 Fläche pro Betriebha0,240,260,250,25 Beitrag pro BetriebFr.358269165308 Total Beiträge1 000 Fr.2 0437982003 041 Total Beiträge 20041 000 Fr.2 0167721942 981 Quelle:BLW
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden.
Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen 2005
Als Buntbrachen gelten mehrjährige,mit einheimischen Wildkräutern angesäte,ungedüngte Streifen von mindestens 3 m Breite.Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter.In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung.Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung.Für Buntbrachen werden pro ha 3’000 Fr.ausgerichtet.Die Beiträge gelten für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone.
Beiträge für Buntbrachen 2005
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 172
Ansätze 2005Fr./ha – Ackerbau- bis Hügelzone 650 – Bergzonen I und II 450 – Bergzonen III und IV300
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl7 4277 6549 77124 852 Flächeha6 5576 90618 77332 236 Fläche pro Betriebha0,880,901,921,30 Beitrag pro BetriebFr.566498651579 Total Beiträge1 000 Fr.4 2043 8086 36514 378 Total Beiträge 20041 000 Fr.4 5224 0256 56015 107 Quelle:BLW
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1 BetriebeAnzahl2 08941042 503 Flächeha1 98033832 321 Fläche pro Betriebha0,950,820,800,93 Beitrag pro BetriebFr.2 8432 4702 4082 781 Total Beiträge1 000 Fr.5 9391 013106 961 Total Beiträge 20041 000 Fr.6 2441 03757 286 1Hier handelt es sich um Betriebe,die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften Quelle:BLW ■ Wenig intensiv genutzte Wiesen ■ Buntbrachen
■ Rotationsbrachen
Als Rotationsbrachen gelten ungedüngte ein- bis zweijährige,mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen,die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen.In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel,Hasen und Insekten Lebensraum.In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich. Für die Rotationsbrachen werden in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone pro ha 2’500 Fr.ausgerichtet.
Beiträge für Rotationsbrachen 2005
■ Ackerschonstreifen
Quelle:BLW
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben.Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen wie Getreide,Raps,Sonnenblumen,Eiweisserbsen,Ackerbohnen und Soja,nicht jedoch Mais.Pro ha wurden 1’500 Fr.bezahlt.
Beiträge für Ackerschonstreifen 2005
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1
BetriebeAnzahl7821099
Flächeha456051
Fläche pro Betriebha0,570,310,000,52
Beitrag pro BetriebFr.8604590775
Total Beiträge1 000 Fr.6710077
Total Beiträge 20041 000 Fr.458053
1Hier
Quelle:BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 173
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1 BetriebeAnzahl5711091681 Flächeha7501421893 Fläche pro Betriebha1,311,301,001,31 Beitrag pro BetriebFr.3 2833 2602 5003 279 Total Beiträge1 000 Fr.1 87535532 233 Total Beiträge 20041 000 Fr.2 26140772 673
1Hier handelt es sich um Betriebe mit Standort in der Hügel- oder Bergregion,die jedoch Teile ihrer Flächen in der Talregion bewirtschaften
handelt es sich um Betriebe,die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften
■ HochstammFeldobstbäume
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume,die nicht in einer Obstanlage stehen,sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven. Im Jahr 2005 wurden pro angemeldeten Baum 15 Fr.ausgerichtet.
Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume 2005
■ Übersicht über die ökologischen Ausgleichsflächen 2005
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 2005
Rotationsbrachen 0,9%
Extensiv genutzte Wiesen 53,8%
7,2%
Wenig intensiv genutzte Wiesen 33,2% Feld- und Ufergehölze 2,5% Quelle:
Verteilung der ökologischen Ausgleichflächen nach Regionen 2005 TalregionHügelregionBergregion
Wenig intensiv genutzte Wiesen6 5571,316 9062,5718 7736,42
Feld- und Ufergehölze1 3820,287730,293020,10 Ackerschonstreifen450,0160,0000,00
Extensiv genutzte
Wiesen26 2085,2310 7293,9915 2825,22
Streueflächen1 8740,371 5270,573 5641,22
Total38 7967,7420 4217,6037 92412,96
Quelle:BLW
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 174
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl16 76012 5385 48134 779 Bäumeha1 181 444905 980274 5182 361 942 Bäume pro Betriebha70,4972,2650,0967,91 Beitrag pro BetriebFr.1 0571 0847511 019 Total Beiträge1 000 Fr.17 71813 5904 11835 426 Total Beiträge 20041 000 Fr.18 04013 6864 12235 848 Quelle:BLW
ha%ha%ha% Elementeder LNder LNder LN
Buntbrachen1 9800,403380,1330,00 Rotationsbrachen7500,151420,0510,00
Streueflächen
Hochstamm-Feldobstbäume
Ackerschonstreifen
Buntbrachen
BLW 1 ohne
Total 97 142 ha
0,1%
2,4%
Öko-Qualitätsverordnung
Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern,unterstützt der Bund auf der LN ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen mit Finanzhilfen.Die Anforderungen, welche die Flächen für die Beitragsberechtigung gemäss der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) erfüllen müssen,werden durch die Kantone festgelegt.Der Bund überprüft die kantonalen Vorgaben auf Grund von Mindestanforderungen.Die Finanzhilfen des Bundes bewegen sich je nach Finanzkraft der Kantone zwischen 70 und 90% der anrechenbaren Beiträge.Die restlichen 10–30% müssen durch Dritte (Kanton,Gemeinde, Private,Trägerschaften) übernommen werden.Beiträge für die biologische Qualität und die Vernetzung sind kumulierbar.Die Verordnung beruht auf Freiwilligkeit,finanziellen Anreizen und der Berücksichtigung regionaler Unterschiede bezüglich der Biodiversität.
Anrechenbare Ansätze
Ansätze 2005Fr.
– für die biologische Qualität500.–/ha
– für die biologische Qualität der Hochstamm-Feldobstbäume20.–/Baum – für die Vernetzung500.–/ha
Eine ökologische Ausgleichsfläche trägt vor allem dann zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei,wenn sie bestimmte Zeigerarten und Strukturmerkmale ausweist und/oder an einem ökologisch sinnvollen Standort liegt.Während sich der Bewirtschafter einer ökologischen Ausgleichsfläche für die biologische Qualität direkt anmelden kann,braucht es für die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen ein Konzept,das mindestens eine landschaftlich und ökologisch begründbare Einheit abdeckt.
Beiträge1 gemäss Öko-Qualitätsverordnung 2005
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total
Quelle:BLW
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 175
regionregionregion BetriebeAnzahl9 0347 4439 03525 512 Fläche 2 ha12 99411 64325 96850 605 Fläche 2 pro Betriebha1,441,562,871,98 Beitrag pro BetriebFr.9741 0931 1631 076 Total Beiträge1 000 Fr.8 8028 13310 50727 442 Total Beiträge 20041 000 Fr.7 3096 7968 90223 007
1 Kürzungen,Rückforderung und Nachzahlung nicht berücksichtigt 2 Hochstamm umgerechnet (1 Stück = 1 Are)
Beiträge1 für biologische Qualität und Vernetzung 2005
genutze Wiesen,Streueflächen
1 Kürzungen,Rückforderung und Nachzahlung nicht berücksichtigt
2 Als Verbund der beiden Programme
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 176
BetriebeAnzahl 10 21110 2216 000 Flächeha16 04910 36811 740 Beiträge1 000 Fr.5 1873 8757 251 Hecken,Feld- und
BetriebeAnzahl 5362 044895 Flächeha117419218 Beiträge1 000 Fr.46178179 Hochstamm-Feldobstbäume BetriebeAnzahl 3 9287 3643 099 BäumeStück233 283256 776171 746 Beiträge1 000 Fr.3 8101 0813 469
Elemente BetriebeAnzahl -5 100Flächeha-4 922Beiträge1
Fr.-2 366-
MerkmalEinheitNur NurBiologische biologische VernetzungQualität und QualitätVernetzung 2 Extensiv genutze Wiesen,wenig intensiv
Ufergehölze
Andere
000
Quelle:BLW
Tabelle 34,Seite A39
Extensive Produktion von Getreide und Raps
Diese Massnahme hat zum Ziel,den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren,Fungizide,chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide zu fördern.Der Beitrag pro ha betrug im Jahre 2005 400

Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2005
Aufteilung der Extensofläche 2005
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 177
Fr.
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl10 2095 96875116 928 Flächeha55 39821 8151 88979 102 Fläche pro Betriebha5,433,662,524,67 Beitrag pro BetriebFr.2 1601 4601 0061 862 Total Beiträge1 000 Fr.22 0498 71175631 516 Total Beiträge 20041 000 Fr.21 5348 54774330 824 Quelle:BLW
Brotgetreide 54% Raps 6% Futtergetreide 40% Quelle: BLW Total 79 102 ha
Tabelle 35,Seite A40
Biologischer Landbau
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform.Um Beiträge zu erhalten,müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der Bio-Verordnung erfüllen.
Beim biologischen Landbau wird auf chemisch-synthetisch hergestellte Hilfsstoffe,wie Handelsdünger oder Pestizide,gänzlich verzichtet.Dies spart Energie und schont Wasser,Luft und Boden.Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig,die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen.Biobauern benötigen zwar mehr Energie für Infrastruktur und Maschinen,gesamthaft erreicht der Biolandbau aber eine höhere Effizienz in der Nutzung der vorhandenen Ressourcen.Dies ist ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit des Produktionssystems.
Der Verzicht auf Herbizide fördert die Entwicklung zahlreicher Beikrautarten.Wo eine vielfältige Flora vorhanden ist,finden auch mehr Kleinlebewesen Nahrung.Dies wiederum verbessert die Ernährung der räuberisch lebenden Gliedertiere,wie der Laufkäfer,und damit die Voraussetzungen für eine natürliche Bekämpfung von Schädlingen.Zahlreicher vorkommende Pflanzen,Tiere und Mikroorganismen machen das Ökosystem robuster gegen Störungen und Stress.
Durch die organische Düngung,die schonende Bodenbearbeitung und den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel fördert der Biolandbau eine grosse Menge und Vielfalt an Bodenorganismen.Die Bodenfruchtbarkeit wird durch die biologische Aktivität gefördert.Es wird Humus angereichert,die Bodenstruktur verbessert und die Bodenerosion vermindert.
Um eine optimale Abstimmung von Pflanzen,Boden,Tier und Mensch im Betrieb zu erreichen,wird im Biolandbau die Schliessung der Nährstoffkreisläufe auf dem Betrieb angestrebt.Erreicht wird dies durch die Bindung der Tierhaltung an die betriebseigene Futtergrundlage.Der Anbau von Leguminosen verbessert das Stickstoffangebot im Boden.Hofdünger und organisches Material aus Gründüngungen und Ernterückständen stellen über die Ernährung der Bodenlebewesen eine ausgewogene Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen sicher.
In der Nutztierhaltung müssen die RAUS-Anforderungen erfüllt sein.Sie bilden die Minimalanforderungen für die Tierhaltung im Biolandbau.Als weitere Massnahmen sind elektrisierende Steuerungseinrichtungen (Viehtrainer) und der Einsatz von Medizinalfutter verboten.Die Verwendung von grösstenteils betriebseigenem Futter soll eine angemessene Leistung und eine gute Gesundheit der Tiere sicherstellen.Natürliche Heilmethoden kommen im Bedarfsfall vorrangig zur Anwendung.
Im Jahr 2005 umfasste der biologische Landbau 10,8% der gesamten LN.
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 178
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche nach Region 2005
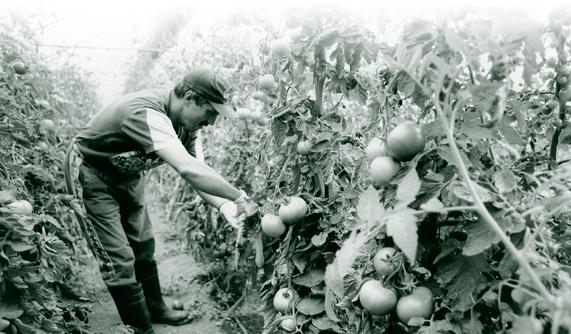
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 179 Ansätze 2005Fr./ha – Spezialkulturen1 200 – Offene Ackerfläche ohne Spezialkulturen800 – Grün- und Streueflächen200
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl1 1981 4383 7146 350 Flächeha21 66823 88169 838115 387 Fläche pro Betriebha18,0916,6118,8018,17 Beitrag pro BetriebFr.7 2854 0823 7704 504 Total Beiträge1 000 Fr.8 7285 86914 00428 601 Total Beiträge 20041 000 Fr.8 5275 68313 75227 962 Quelle:BLW
Beiträge für den biologischen Landbau 2005
Tabelle 32a,Seite A33
Talregion 19% Bergregion 60% Quelle: BLW Total 115 387 ha Hügelregion 21%
■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
Besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere
Unter diesem Titel werden die beiden im Folgenden beschriebenen Programme BTS und RAUS zusammengefasst (vgl.auch Abschnitt 1.3.2).
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen,welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen.
Ansätze 2005Fr./GVE
– Tiere der Rindergattung ohne Kälber,Ziegen,Kaninchen 90
– Schweine155
– Legehennen,Junghennen und -hähne,Zuchthennen und -hähne,Küken280
– Mastpoulets und Truten180
Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 2005
■ Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren,auf einer Weide oder in einem Laufhof bzw.in einem Aussenklimabereich,der den Bedürfnissen der Tiere entspricht.
Ansätze 2005Fr./GVE
– Tiere der Rinder- und Pferdegattung,Bisons,Schafe,Ziegen, Dam- und Rothirsche sowie Kaninchen180
– Schweine155
– Geflügel 280
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl8 6005 5793 66117 840 GVEAnzahl235 679121 44159 530416 650 GVE pro BetriebAnzahl27,4021,7716,2623,35 Beitrag pro BetriebFr.3 1302 5071 6902 640 Total Beiträge1 000 Fr.26 91913 9846 18647 089 Total Beiträge 20041 000 Fr.26 71013 6366 17146 517 Quelle:BLW
Tabelle 36,Seite A41
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 180
Beiträge für den regelmässigen Auslauf im Freien 2005
Sömmerungsbeiträge
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege der ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden. Das Sömmerungsgebiet wird mit rund 300'000 GVE genutzt und gepflegt.Der Viehbesatz wird nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Nutzung festgelegt.Man spricht dabei vom so genannten Normalbesatz.Ausgehend vom Normalbesatz werden die Beiträge nach Normalstoss (NST) ausgerichtet.Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen.
Ansätze 2005Fr.
–Für gemolkene Kühe,Milchziegen und Milchschafe pro GVE (56–100 Tage Sömmerung)300
–Für Schafe ohne Milchschafe pro NST – bei ständiger Behirtung300 – bei Umtriebsweide220 – bei übrigen Weiden120
–Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 300
Sömmerungsbeiträge 2005 MerkmalBeiträgeBetriebeGVE
1Bei dieser Zahl handelt es sich um das Total der beitragsberechtigten Sömmerungsbetriebe (ohne Doppelzählungen)
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion BetriebeAnzahl13 90911 16112 63737 707 GVEAnzahl361 012255 943227 993844 948 GVE pro BetriebAnzahl25,9622,9318,0422,41 Beitrag pro BetriebFr.4 5144 0423 2273 943 Total Beiträge1 000 Fr.62 78145 11640 781148 678 Total Beiträge 20041 000 Fr.60 83743 62536 672144 134 Quelle:BLW
000 Fr.Anzahl Anzahl Kühe gemolken,Milchziegen und Milchschafe16 2102 15554 155 Schafe ohne Milchschafe4 84797524 644 Übrige Raufutter verzehrende Tiere70 5536 755235 356 Total91 6107 387 1 Total
0667 449 1
bzw.NST 1
200491
Quelle:BLW
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 181 ■ Nachhaltige Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete
Tabelle 36,Seite A41
Tabellen 39a–39b,Seiten A44–A45
Seit dem Beitragsjahr 2003 werden differenzierte Sömmerungsbeiträge für Schafe (ohne Milchschafe) nach Weidesystem ausgerichtet.Mit den höheren Beiträgen für die ständige Behirtung und Umtriebsweide werden einerseits die höheren Kosten abgegolten,andererseits wird,in Analogie zu den Ökobeiträgen,der Anreiz für eine nachhaltige Schafalpung erhöht.Eine ständige Behirtung bedeutet,dass die Herdenführung durch einen Hirten mit Hunden erfolgt und die Herde täglich auf einen vom Hirten ausgewählten Weideplatz geführt wird.Bei einer Umtriebsweide hat die Beweidung während der ganzen Sömmerung abwechslungsweise in verschiedenen Koppeln zu erfolgen,die eingezäunt oder natürlich klar abgegrenzt sind.
Schafsömmerung nach Weidesystem 2005
Entwicklung der Sömmerung 2000–2005: Betriebe,gesömmerte Tiere in Normalstössen nach Tierkategorien
NST = 1 GVE * Sömmerungsdauer / 100
2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 182
WeidesystemBetriebeTiere mit Beiträge Beiträgen AnzahlNSTFr. Ständige Behirtung796 9372 081 011 Umtriebsweiden1965 6161 233 313 Übrige Weiden68111 1081 328 901 Kombination von Weidesystemen19983203 412 Total97524 6444 846 637 Total 20041 00524 5404 703 163 Quelle:BLW
Jahr200020012002200320042005 TierkategorieEinheiten MilchküheBetriebe4 9614 7124 6004 4904 3534 301 NST118 793118 021116 900116 679111 123112 858 Mutter- und Betriebe1 2801 1601 2271 3541 4341 512 AmmenküheNST13 85414 48615 71517 94918 90421 227 Anderes RindviehBetriebe6 6846 4536 5036 4256 3586 319 NST134 457129 217127 946126 910121 169120 421 Tiere der Betriebe1 1321 0861 0751 0841 0631 079 PferdegattungNST4 6524 3154 3644 3404 3474 515 SchafeBetriebe1 1731 1451 1041 1501 1111 076 NST29 67826 17224 71026 63325 81326 856 ZiegenBetriebe1 7001 6231 6671 6691 6571 648 NST5 1655 2145 4345 6625 6645 977 AndereBetriebe22289277241240236 gesömmerteTiereNST60 899764735541496
Quelle:BLW
■ Abschwemmungen und Auswaschung von Stoffen verhindern
Beiträge für den Gewässerschutz
Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes ermöglicht dem Bund,Massnahmen der Landwirte zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in ober- und unterirdische Gewässer abzugelten.Das Schwergewicht wird auf die Verminderung der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen gelegt,in denen der ÖLN,der Biolandbau,Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso,ökologischer Ausgleich) nicht genügen.In der Zwischenzeit sind verschiedene Projekte in eine zweite sechsjährige Periode überführt worden.Im neuen Projekt Boiron bei Morges soll die Auswaschung von Pflanzenbehandlungsmitteln in das Gewässer verhindert werden.
Gemäss der Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet,für ober- und unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen.Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen für die Betriebe mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und 50% für Bewirtschaftungsmassnahmen.Im Jahr 2005 wurden rund 6,1 Mio.Fr.ausbezahlt.

2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 183
Überblick über die Projekte 2005
KantonRegion,Voraussichtliche StoffProjekt-Projektierte Beiträge GemeindeProjektdauergebietGesamtkosten2005 JahrhaFr.Fr. AGBaldingen2004–2009Nitrat69281 40024 399 AGBirrfeld2002–2007Nitrat8131 909 500139 946 AGWohlenschwil2001–2009Nitrat62547 69651 967 BEWalliswil2000–2005Nitrat54513 80046 720 FRAvry-sur-Matran2000–2011 1 Nitrat37405 73927 463 FRCourgevaux2003–2008Nitrat27164 83820 880 FRDomdidier2004–2009Nitrat30195 58825 564 FRFétigny2004–2009Nitrat631 526 110444 291 FRLurtigen2005–2010Nitrat2861 218 964136 227 FRMiddes2000–2012 1 Nitrat45369 85323 543 FRSalvenach2005 2 Nitrat13,52 023 345 Auszahlung ab 2006 LUBaldeggersee2000–2010 1 Phosphor5 60018 800 7821 600 000 LUSempachersee2005–2010 1 Phosphor4 90517 577 4551 400 000 LU/AGHallwilersee2001–2006 1 Phosphor3 7864 283 7321 447 981 SHKlettgau2001–2006Nitrat3571 866 870198 944 SOGäu I2000–2008 1 Nitrat6582 220 050177 627 SOGäu II2003–2008Nitrat8501 217 040132 668 VDBavois2005–2010Nitrat5178 9855 647 VDBofflens2005–2010Nitrat112580 10061 942 VDBoiron / Morges2005–2010Pflanzenschutzmittel2 2501 313 10010 217 VDMorand2000–2007Nitrat3911 572 848125 974 VDThierrens1999–2011 1 Nitrat17333 57017 614 ZHBaltenswil2000–2008 1 Nitrat und 130712 00032 776 Pflanzenschutzmittel Total 58 134 3256 152 390 Total 2004 5 520 501 1 Verlängerungen verfügt 2 Projekt im Rahmen einer Güterzusammenlegung Quelle:BLW 2.2 DIREKTZAHLUNGEN 2 184
2.3Grundlagenverbesserung
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion sowie die Erfüllung der multifunktionalen Aufgaben.
Finanzhilfen für die Grundlagenverbesserung
Massnahme200420052006
Beiträge Strukturverbesserungen958589

Investitionskredite766869
Betriebshilfe9211
Umschulungsbeihilfen-0,13 Beratungswesen und Forschungsbeiträge242423 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge333 Pflanzen- und Tierzucht222323
Total229205,1221
Quelle:BLW
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt: –Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Produktionskosten; –Förderung des ländlichen Raums; –Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen; –Effiziente und umweltgerechte Produktion; –Ertragreiche,möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte; –Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt; –Genetische Vielfalt.
185 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Mio.Fr.
■ Pilotprojekte zur regionalen Entwicklung: erste Erfahrungen
2.3.1Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert.Dies betrifft insbesondere das Berggebiet und die Randregionen.
Investitionshilfen werden als Hilfe zur Selbsthilfe für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.Es stehen zwei Instrumente zur Verfügung:
–Beiträge (à-fonds-perdu) mit Beteiligung der Kantone,vorwiegend für gemeinschaftliche Massnahmen;
–Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen,vorwiegend für einzelbetriebliche Massnahmen.
Investitionshilfen unterstützen die landwirtschaftlichen Infrastrukturen und ermöglichen somit die Anpassung der Betriebe an die sich ändernden Rahmenbedingungen. Durch die Senkung der Produktionskosten und die Förderung der Ökologisierung wird die Wettbewerbsfähigkeit einer nachhaltig produzierenden Landwirtschaft verbessert. Auch in anderen Ländern,insbesondere in der EU,zählen die Investitionshilfen zu den wichtigsten Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raums.
Projekte zur regionalen Entwicklung und zur Förderung von einheimischen und regionalen Produkten,an denen die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt ist,können gemäss LwG seit 2004 mit Beiträgen gefördert werden.Im Hinblick auf die Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen wurden 2004 zwei Forschungsarbeiten abgeschlossen sowie zwei Pilotprojekte in den Kantonen Tessin (Brontallo) und Wallis (St.Martin) gestartet.Aus den gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen können für die Umsetzung folgende Schlüsse gezogen werden:
–Die Erhöhung der Wertschöpfung in der Landwirtschaft steht im Vordergrund.Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und den übrigen Sektoren zentral.Die öffentlichen Anliegen sollen wie bei Gesamtmeliorationen einbezogen werden.Eine Abstimmung der Projektziele mit den Konzepten der Regionalentwicklung ist unabdingbar.
–Projekte sind dann erfolgreich,wenn die Initiative in der Region ergriffen wird.Das bei den Strukturverbesserungen bewährte Prinzip des «Bottom up»-Ansatzes soll auch für Projekte zur regionalen Entwicklung gelten.Die Finanzierung erfolgt mit öffentlichen Beiträgen von Bund und Kanton.Die Restkosten sind von einer lokalen Trägerschaft zu übernehmen,die damit in die Verantwortung eingebunden wird.
186 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–Die Massnahmen sind projektspezifisch auszuwählen und sollen einen möglichst hohen Zielerreichungsgrad gewährleisten.Die klassischen Strukturverbesserungsmassnahmen im ländlichen Hoch- und Tiefbau stehen bei der Realisierung derartiger Projekte im Vordergrund.Eine hohe Bedeutung kommt einem gut durchdachten Marketingkonzept zu.
–Die «vorwiegende Beteiligung der Landwirtschaft» an den Projekten zur regionalen Entwicklung kann mit folgenden Bedingungen erfüllt werden: –mindestens die Hälfte des Angebots (Produkte,Dienstleistungen) muss eine landwirtschaftliche Herkunft aus der Region aufweisen,oder –mindestens die Hälfte der für das Angebot erforderlichen Arbeitsleistungen müssen durch bäuerliche Bewirtschafterinnen,Bewirtschafter oder deren Familien erbracht werden,oder –die Mitglieder der Trägerorganisation müssen mehrheitlich bäuerliche Bewirtschafterinnen oder Bewirtschafter sein und diese müssen die Stimmenmehrheit besitzen.
–Das angestrebte Angebot (Produkte,Dienstleistungen) soll auf die effektiven Marktchancen ausgerichtet und regional abgestimmt werden.Der Nachweis des Wertschöpfungspotenzials ist mittels geeigneter Planung (Businessplan) sowie in einem Controlling mit messbaren Indikatoren für die privaten und öffentlichen Anliegen aufzuzeigen.Die nötigen Marktanalysen und Vorabklärungen sollen im Rahmen einer fachlichen Begleitung (Coaching) erarbeitet werden.Die Finanzierbarkeit und die Tragbarkeit des Projektes sind nachzuweisen.
–Die Zielsetzungen,die Massnahmen und die Modalitäten sollen zwischen den verschiedenen Partnern diskutiert und ausgehandelt werden.Eine Programmvereinbarung (öffentlich-rechtlicher Vertrag) zwischen Bund und Kanton soll die rechtliche Basis für die Umsetzung derartiger Projekte bilden.Die Projektträgerschaft (Leistungserbringer) ist in die Verhandlungen einzubeziehen.
–Der Beitrag des Bundes soll mit einer Pauschalen an das Gesamtprojekt erfolgen.So besteht ein grösserer Anreiz für Sparbemühungen und kreative Alternativlösungen. Die Pauschale kann mit den bereits heute geltenden Grundsätzen für Strukturverbesserungen berechnet werden und setzt eine finanzielle Leistung des Kantons voraus.
Diese Schlussfolgerungen werden die Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen massgeblich beeinflussen und sollen in die Strukturverbesserungsverordnung (SVV) eingefügt werden.Damit gelten die allgemeinen Bestimmungen für Strukturverbesserungen auch für diesen neuen Projekttyp.Die revidierte Verordnung wird voraussichtlich auf den 1.Januar 2007 in Kraft treten.

187 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2
■ Finanzielle Mittel für Beiträge
Für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten wurden im Jahr 2005 Beiträge im Umfang von 85 Mio.Fr.ausbezahlt.Das BLW genehmigte neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 86,6 Mio.Fr.Damit wurde ein Investitionsvolumen von 373 Mio.Fr.ausgelöst.Die Summe der Bundesbeiträge an die genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen»,da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird.
Genehmigte Beiträge des Bundes 2005
Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
Wegebauten
Wasserversorgungen

Unwetterschäden und andere Tiefbaumassnahmen
Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere andere Hochbaumassnahmen
Der Bund setzte im Jahr 2005 10% weniger finanzielle Mittel in Form von Beiträgen ein als im Vorjahr und 17% weniger als 2003.Diese Abnahme ist mit der Aufstockung der Mittel im Jahr 2003 zur Bewältigung der Unwetterschäden 2002 begründet. Zudem bewirkten die ausserordentlichen Unwetterschäden 2005,dass die Arbeiten an den ordentlichen Projekten unverzüglich gestoppt und alle verfügbaren Ressourcen zur Bewältigung der Unwetterschäden eingesetzt werden mussten.
188 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Tabellen 43–44,Seite A52
Mio. Fr. Talregion Hügelregion Bergregion 051015202530 Quelle: BLW 16,6 17,3 9,8 16,5 25,1 1,3 62,4% 12,6% 24,9%
Ausbezahlte Beiträge des Bundes an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten 1996–2005
■ Unwetter August 2005

Zwischen dem 21.und 23.August 2005 ereigneten sich schwere Unwetter,welche auch die Landwirtschaft in den Kantonen BE,LU,UR,SZ,OW,NW,GL,ZG,SG und GR hart getroffen haben.Von der Ausdehnung her übertraf das Unwetter die bisher bekannten.Mit privaten und öffentlichen Schäden von 2,5 Mrd.Fr.ist es das schwerste bisher registrierte Einzelereignis.
Die Behebung der Unwetterschäden 2005 verursacht im Bereich Landwirtschaft Kosten von 72 Mio.Fr.,davon 50 Mio.Fr.für Güterwege und Brücken,4 Mio.Fr.für Wasserversorgungsanlagen,welche der Landwirtschaft dienen und 18 Mio.Fr.für die Wiederherstellung von Kulturland.Daran sollen gemäss Bundesratsbeschluss vom 21.Dezember 2005 Bundesbeiträge von insgesamt 40 Mio.Fr.gesprochen werden, wovon 2 Mio.Fr.bereits im Jahr 2005 ausbezahlt wurden.Im Jahr 2006 werden 21 Mio.Fr.ausgerichtet,die im Nachtragskreditverfahren beantragt werden.Die restlichen Beiträge von 17 Mio.Fr.sollen im Voranschlag 2007 aufgebracht werden.
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 189 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
1990/92199619971998199920002001200220032005 2004 Mio. Fr. Quelle: BLW 0 20 40 60 80 100 120 140 11985827575871029010285 94,5
Im Jahre 2005 bewilligten die Kantone für 2’185 Fälle Investitionskredite im Betrag von 320,3 Mio.Fr.Von diesem Kreditvolumen entfallen 83,7% auf einzelbetriebliche und 16,3% auf gemeinschaftliche Massnahmen.Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite,so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren,gewährt werden.
Investitionskredite 2005
Einzelbetriebliche Massnahmen1 990267,983,7 Gemeinschaftliche Massnahmen,ohne Baukredite13926,08,1
Baukredite5626,48,2
Total2 185320,3100
Quelle:BLW
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden hauptsächlich als Starthilfe sowie für den Neu- oder Umbau von landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomiegebäuden eingesetzt.Sie werden in durchschnittlich 13,8 Jahren zurückbezahlt.Auf die Massnahme «Diversifizierung» entfallen 39 Fälle mit 4,4 Mio.Fr.
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen,der gemeinschaftliche Kauf von Maschinen und Fahrzeugen und bauliche Massnahmen (Bauten und Einrichtungen für die Milchwirtschaft sowie für die Verarbeitung, Lagerung und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte) unterstützt.
Im Jahre 2005 wurden den Kantonen neue Bundesmittel von 68 Mio.Fr.zur Verfügung gestellt.Diese werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt.Der seit 1963 geäufnete Fonds de roulement beträgt 2,082 Mrd.Fr.
190 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
AnzahlMio.Fr.%
FälleBetragAnteil
■ Finanzielle Mittel für Investitionskredite
Tabellen 45–46,Seiten A53–A54
Investitionskredite 2005 nach Massnahmenkategorie, ohne Baukredite

191 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Starthilfe Kauf Betrieb durch Pächter Gemeinschaftliche Massnahmen 1 Diversifizierung Wohngebäude Ökonomiegebäude Mio. Fr. Talregion Hügelregion Bergregion 76 0 20 40 60 80 100 120 140 6,7 Bodenverbesserungen 4,6 21,4 4,4 55,3 125,6
Quelle:
BLW
25,0% 48,5% 26,5%
1 Gemeinschaftlicher Inventarkauf, Starthilfe für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte
■ Betriebshilfe
Soziale Begleitmassnahmen
Die Betriebshilfe wird in Form von zinslosen Darlehen gewährt und dient dazu,eine vorübergehende,unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben.In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen indirekten Entschuldung.
Im Jahr 2005 wurden in 120 Fällen insgesamt 16,6 Mio.Fr.Betriebshilfedarlehen gewährt.Das durchschnittliche Darlehen betrug Fr.138’264 und wird in 13,9 Jahren zurückbezahlt.
Betriebshilfedarlehen 2005
BestimmungFälleBetrag
AnzahlMio.Fr.
Umfinanzierung bestehender Schulden8412,6 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung364,0
Total12016,6
Quelle:BLW
Im Jahr 2005 wurden den Kantonen 1,588 Mio.Fr.neu zur Verfügung gestellt.Diese sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden,die je nach Finanzkraft 20 bis 80% des Bundesanteils beträgt.Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt.Der seit 1963 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufnete Fonds de roulement beträgt zusammen mit den Kantonsanteilen rund 206 Mio.Fr.
■
Umschulungsbeihilfen
Die Umschulungsbeihilfe erleichtert für selbständig in der Landwirtschaft tätige Personen den Wechsel in einen nichtlandwirtschaftlichen Beruf.Sie beinhaltet Beiträge an Umschulungskosten und Lebenskostenbeiträge für Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter,die das 52.Altersjahr noch nicht beendet haben.Die Gewährung einer Umschulungsbeihilfe setzt die Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs voraus.Im Jahre 2005 wurden für drei Fälle total 415'700 Fr.zugesichert.Die Umschulungsdauer beträgt,je nach Ausbildung,ein bis drei Jahre.Zwei Betriebe werden längerfristig verpachtet,der dritte wird verkauft.Im Berichtsjahr erfolgten die ersten Auszahlungen der zugesicherten Umschulungsbeihilfen des Vorjahres.An vier Gesuchsteller wurden total 91'400 Fr.ausbezahlt.
192 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Landwirtschaftsbetriebe
müssen gleiche Auflagen einhalten
Gewerbeneutralität bei Diversifizierungen auf dem Landwirtschaftsbetrieb
Landwirtschaftliche Betriebe diversifizieren immer häufiger und suchen Wertschöpfung und Marktanteile in nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten.Sie können damit Gewerbebetriebe ausserhalb der Landwirtschaft konkurrenzieren.Mit der Einführung der Unterstützungsmöglichkeit der Diversifizierung im Jahr 2004 im Rahmen der Agrarpolitik 2007 wurden Regelungen zur Einhaltung der Gewerbeneutralität aufgenommen.Nach Artikel 87 Absatz 2 LwG sind die unterstützten Strukturverbesserungsmassnahmen gegenüber direkt betroffenen Gewerbebetrieben im unmittelbaren Einzugsgebiet wettbewerbsneutral zu gestalten.In Artikel 13 SVV wird bestimmt,dass die Kantone vor dem Entscheid über eine Investitionshilfe direkt betroffene Gewerbebetriebe sowie deren lokale oder kantonale Organisationen anhören müssen.Erbringen bestehende Gewerbebetriebe im Einzugsgebiet eine gleichwertige Dienstleistung oder erfüllen sie die vorgesehene Aufgabe gleichwertig,können keine Investitionshilfen des Bundes gewährt werden.
Trotzdem werden immer wieder Vorwürfe laut über eine ungleiche Behandlung landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Anbieter von Produkten und Dienstleistungen.Insbesondere wird beanstandet,dass für landwirtschaftliche Anbieter weniger Vorschriften bestünden und dass diese weniger strikt angewandt würden.
Das BLW liess deshalb im Herbst 2005 unter Beizug des Schweizerischen Gewerbeverbandes eine Studie zur Gewerbeneutralität erarbeiten (Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft,2005,Konkurrenz mit ungleich langen Spiessen?).In dieser Arbeit wurde untersucht,ob der Wettbewerb zwischen einem nichtlandwirtschaftlichen oder paralandwirtschaftlichen Nebenbetrieb eines Landwirtschaftsbetriebs (nachfolgend: Nebenbetrieb) und einem Gewerbebetrieb mit gleich langen Spiessen betrieben wird.
Die Studie der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft kommt zum Schluss, dass auf Stufe Gesetz,Verordnung und Richtlinien kaum Unterschiede vorhanden sind, die den Nebenbetrieb gegenüber dem Gewerbe begünstigen.Unterschiede bestehen im Umfang der Aktivitäten oder bei der Erwerbsform (selbständig/unselbständig). Nichtlandwirte profitieren ebenfalls von den betreffenden Erleichterungen in der Gesetzgebung.Der Umfang der Aktivitäten der Nebenbetriebe ist beschränkt,da nur das Einkommen des landwirtschaftlichen Hauptbetriebes ergänzt und verbessert wird, weshalb die Auswirkungen auf konkurrenzierende Gewerbebetriebe limitiert bleiben. In keinem der untersuchten Fallbeispiele konnte festgestellt werden,dass den Nebenbetrieben aus Vorschriften Wettbewerbsvorteile zufielen.In Fällen,welche Investitionshilfen erhielten,wurde die geforderte Wettbewerbsneutralität korrekt vollzogen.
193 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
In beschränktem Rahmen können die nachfolgenden Regelungen zu unterschiedlichen Rahmenbedingungen für den Nebenbetrieb gegenüber einem Gewerbebetrieb führen:
–Für die Landwirtschaft existiert kein Branchen-Gesamtarbeitsvertrag.Der Einsatz familienfremder Arbeitskräfte ist jedoch sehr begrenzt und wird durch die Raumplanungsgesetzgebung eingeschränkt (Art.24b RPG und Art.40 RPV).
–Unterschiedliche Systeme bei den Familienzulagen,die sich je nach Branche,Kanton und wirtschaftliche Umstände begünstigend oder benachteiligend auswirken können.
Nicht untersucht wurden Fragen der Raumplanung,da diese Gegenstand der vorgezogenen Teilrevision des Raumplanungsrechts zum Bereich «Bauen ausserhalb Bauzonen» sind.Umnutzungen und begrenzte Erweiterungen bestehender Bauten sollen die Diversifizierung erleichtern.
Nur schwer zu ermitteln war der Vollzug der Gesetzgebung,weil dieser hauptsächlich bei den Kantonen liegt.Werden jedoch bei der Umsetzung Mängel festgestellt,besteht für die Betroffenen die Möglichkeit,unlauteren Wettbewerb feststellen zu lassen und richterlich dagegen vorzugehen.

2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
194
■ SAK eignet sich als Eintretenskriterium für Investitionshilfen
Wirkungsanalyse der Investitionshilfen bei landwirtschaftlichen Hochbauten
Mit der Einführung der Agrarpolitik 2002 im Jahre 1999 fand bei Investitionshilfen für einzelbetriebliche Massnahmen im landwirtschaftlichen Hochbau ein Wechsel von der Rest- zur Pauschalfinanzierung statt.Dies bedeutet,dass unabhängig der effektiven Kosten pauschale Beiträge oder Investitionskredite je Einheit gesprochen werden.Mit diesem System wird ein Anreiz geschaffen,kostengünstige Projekte zu realisieren (siehe Artikel im Agrarbericht 2004,Kostenreduktion im landwirtschaftlichen Hochbau).Erhebungen und Vergleiche im Jahr 2005 lassen den Schluss zu,dass die Bauinvestitionen pro Tiereinheit in den letzten zehn Jahren trotz höheren Anforderungen an die landwirtschaftlichen Ökonomiegebäude (Tierschutz,Gewässerschutz,Innenmechanisierung etc.) beachtlich gesunken sind.
Diese Feststellung ist ein Hinweis,dass der Systemwechsel zur Senkung der Produktionskosten und damit zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der Landwirtschaft beiträgt.Mit einer wissenschaftlichen Analyse hat das BLW unter Einbezug der Eidgenössischen Finanzkontrolle die Wirkung der Investitionshilfen vertieft untersuchen lassen.Die Arbeit wurde durch die Agroscope Reckenholz-Tänikon ART durchgeführt.Die Fragestellungen wurden in Teilprojekten bearbeitet.
Im ersten Teil des Projekts wurde der Einfluss der Standardarbeitskraft (SAK) auf die Wirtschaftlichkeit und ihre Eignung als Eintretenskriterium für einzelbetriebliche Investitionshilfemassnahmen analysiert.Zu diesem Zwecke wurden Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der ART und Angaben der Aargauischen Landwirtschaftlichen Kreditkasse verwendet.Die Ergebnisse der durchgeführten Regressionsanalysen zeigen,dass die SAK einen positiven Einfluss auf das Arbeitseinkommen haben.Dieses Resultat lässt den Schluss zu,dass die SAK einen praktikablen Indikator für die Wirtschaftlichkeit von landwirtschaftlichen Betrieben darstellen.
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist eine gewisse Vorsicht geboten,weil die zur Verfügung stehende Datenmenge für die Regressionsanalysen zu gering und der Zeitraum der Untersuchung zu kurz waren.So konnten die Einflüsse von weiteren Betriebszweigen oder die Umstellung der Produktion nach der Investition zu wenig berücksichtigt werden.
■ Investitionshilfen wirken kostensenkend
Im zweiten Teil des Projekts wurde die Wirtschaftlichkeit der Investitionshilfen untersucht.Die Daten für die Analyse stammen aus der Zentralen Auswertung der Buchhaltungsergebnisse der ART,aus der MAPIS-Datenbank des BLW und aus einer schriftlichen Umfrage bei 196 ausgewählten Referenzbetrieben,welche in den Jahren 1999 bis 2002 grössere Investitionen gemacht haben.
Die Erarbeitung einer Wirkungsanalyse der Investitionshilfen mit einem Vorher-Nachher-Vergleich gestaltet sich aufwändig,weil viele Faktoren wie Produktionskosten, Abschreibungen,Erlösniveau,gesamtbetriebliche Veränderungen etc.zu berücksichtigen sind.
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
195
Die nachfolgenden Erkenntnisse aus der Studie der ART betreffen in erster Linie die vertieft untersuchten Betriebsgruppen «Milchvieh gross» (mindestens 30 Kuhplätze) und «Milchvieh mittel» (13 bis 26 Kuhplätze).
–Gemessen an den Indikatoren «Produktionskosten pro kg Milch» und «Mittelfluss Landwirtschaft» wird das Ziel der Senkung der Produktionskosten nur teilweise erreicht,was auf die kurze Untersuchungsperiode zurückzuführen ist.
–Gemessen an den Indikatoren «Lebensqualität» und «Cashflow» wird das Ziel der Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse mehrheitlich erreicht.
–Gemessen an den Indikatoren «Ökologischer Leistungsnachweis» und «Beiträge für besonders tiergerechte Stallhaltung» werden die ökologischen und tierschützerischen Ziele in hohem Masse erreicht.
–Gemessen am Indikator «Finanzielle Stabilität» wird das Ziel der längerfristigen Existenzsicherung zu 85% erfüllt.Grössere Milchviehbetriebe schliessen in diesem Punkt wesentlich besser ab als mittlere Betriebe.
–Die Effektivität der Investitionshilfen ist aufgrund dieser Ergebnisse weitgehend gegeben.
Anhaltspunkte liefert die Studie auch bezüglich Effizienz des Mitteleinsatzes.Untersucht wird dabei,wie viel Franken an Mittelfluss ausgelöst wird mit einem eingesetzten Franken an Investitionshilfen.Erste Ergebnisse zeigen,dass die Werte von Betrieb zu Betrieb stark differieren.Diese Analysen müssen noch vertieft und verfeinert werden, bevor Schlüsse daraus gezogen werden können.
196 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Agroscope optimiert Führung und Abläufe
2.3.2 Forschung,Gestüt,Beratung,Berufsbildung,CIEA
Landwirtschaftliche Forschung
Das Budget 2005 von Agroscope belief sich netto auf rund 109 Mio.Fr.Als Folge des Entlastungsprogramms und der Aufgabenverzichtsplanung des Bundes wird das Budget von Agroscope bis 2008 auf 102 Mio.Fr.sinken.Agroscope wird Stellen abbauen müssen.Auf Entlassungen soll wenn möglich verzichtet werden.Wegen den Sparmassnahmen baut Agroscope bisher erbrachte Leistungen ab.
Unter dem Dach von Agroscope wird heute an sechs Standorten geforscht.Agroscope Liebefeld-Posieux ALP betreut die tierische Produktion vom Futtermittel bis zum Lebensmittel.In Wädenswil und Changins werden Fragen der pflanzlichen Produktion (Ackerbau und Spezialkulturen) behandelt.Reckenholz und Tänikon bearbeiten Fragen der Ökologie,Ökonomie und Landtechnik.Michael Gysi hat am 1.Januar 2006 die Leitung von Agroscope Liebefeld-Posieux ALP übernommen.Die Leitung der neuen Agroscope Changins-Wädenswil ACW wurde per 1.Februar 2006 Jean-Philippe Mayor übertragen.Die dritte Einheit,Agroscope Reckenholz-Tänikon ART wird vom bisherigen Reckenholz-Direktor Paul Steffen geleitet.
BLW-Direktor Manfred Bötsch und die drei Direktoren Steffen,Gysi und Mayor bilden zusammen die neue Geschäftsleitung von Agroscope.Die Geschäftsleitung,die vom Forschungsstab im BLW unterstützt wird,führt Agroscope und trägt die Verantwortung für die strategische Ausrichtung und Zieldefinition sowie deren Erreichung.Jeweils ein Agroscope-Direktor ist verantwortlich für einen der drei strategischen Bereiche Planung und Ressourcen,Forschung und Entwicklung sowie Kommunikation und Wissensaustausch.

197 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Die Vollzugs- und Kontrollaufgaben binden einen wesentlichen Teil der Ressourcen von Agroscope,nach Erhebungen bis 40%.Diese Aufgaben sind durch Gesetz oder Verordnung an Agroscope delegiert.Zu den wichtigsten und zeitlich aufwändigsten gehören die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln,die Bewilligung und Kontrolle von Futtermitteln,das milchwirtschaftliche Referenzlabor,der Bodenschutz und die Ermittlung der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft.Der grösste Teil dieser Massnahmen dient dem Schutz von Mensch,Tier und Umwelt vor unannehmbaren Nebenwirkungen der landwirtschaftlichen Produktion und leistet einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung landwirtschaftlicher Produkte.Ein anderer Teil der Massnahmen unterstützt das staatliche Handeln,indem er der Politik und der Verwaltung Informationen und Entscheidungsgrundlagen liefert.
Aus Forschung und Vollzugsmassnahmen unter einem Dach lassen sich Synergien gewinnen.So liefert der Vollzug oft Informationen,Anstösse und Ideen für neue Forschungsprojekte;Probleme,die aus dem Vollzug ersichtlich werden,können sogleich weiter bearbeitet werden;das spezifische,auf die Schweiz bezogene Wissen der Mitarbeitenden und teure Infrastrukturen werden gemeinsam benutzt;Vollzugsaufgaben zeigen Tendenzen und Entwicklungen und sind ein wichtiges Instrument der Früherkennung.In diesem Sinn bereichert der Vollzug die Forschung von Agroscope.
Seit der Abstimmung vom November 2005 gilt in der Schweiz ein fünfjähriges Moratorium für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen.Im Abstimmungskampf wiesen beide Seiten darauf hin,dass während dieser Zeit die Forschung zu Chancen und Risiken der Gentechnologie mit grosser Priorität weiterzutreiben sei.
Agroscope hat bereits in früheren Jahren mögliche Auswirkungen von gentechnisch veränderten Pflanzen auf Bienen und andere Nützlinge studiert,führte ein Umweltmonitoring durch und untersuchte die Möglichkeiten einer Koexistenz von gentechnisch veränderten und gentechnisch nicht veränderten Pflanzen in der Schweiz.
Verschiedene parlamentarische Vorstösse verlangen eine Intensivierung der Ressortforschung in diesem Bereich.Unter anderem sollen auch praktische Feldversuche durchgeführt werden.Nur dadurch sei es möglich,eine umfassende Biosicherheitsforschung auszuführen und die gewonnenen Erkenntnisse in die Umsetzung der Koexistenzverordnung einfliessen zu lassen.Agroscope will sich auch im Nationalen Forschungsprogramm «Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen» (NFP 59) stark engagieren.
198 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Gentech-Forschung trotz Moratorium
■ Vollzug befruchtet die Forschung
Im Leistungsauftrag von Agroscope für die Periode 2004–2007 sind Kundennähe und Kundenzufriedenheit wichtige Aspekte.Da die Forschungsanstalten zwei Arten von Kunden bedienen,wurden von Mitte 2005 bis Ende Mai 2006 zwei schriftliche Umfragen durchgeführt:Eine bei den direkten Kunden (Presse,Branchen- und Fachorganisationen,Bundesämter,Bundesamt für Landwirtschaft,kantonale Institutionen und Beratungszentralen) und eine bei den Landwirtinnen und Landwirten,welche zu den indirekten Kunden der Forschungsanstalten zählen.
Die direkten Kunden von Agroscope sind mit den Forschungsanstalten sehr zufrieden. Über 80% der Antwortenden wählten eine der beiden Höchstnoten.Dabei ist die Zufriedenheit vor allem bezüglich Mitarbeitende und Referentinnen und Referenten hoch.Besonders positiv bewerteten die Kunden die Freundlichkeit,das Fachwissen und die Sprachkompetenz.Verbesserungspotenzial weisen hingegen die Erreichbarkeit und die Flexibilität auf.
Für fast 70% der befragten Landwirtinnen und Landwirte ist es wichtig,dass die Forschungsanstalten auch in Zukunft zu Gunsten der Landwirtschaft forschen können. Dieser Zufriedenheitsfaktor wurde in allen Sprachgebieten und von allen Betriebstypen am höchsten bewertet.Etwas kritischer bewertet wurde der praktische Nutzen der Information für den eigenen Betrieb.Die Umfrage brachte auch sprachregionale und Betriebstyp spezifische Unterschiede zum Vorschein:Die Antwortenden aus der Romandie sind fast durchwegs zufriedener mit den Leistungen der Forschungsanstalten und der Wissensvermittler (direkte Kunden) als die Bäuerinnen und Bauern der deutschen Schweiz.Bezüglich Betriebstypen zeigen vor allem Antwortende aus dem Bereich Spezialkulturen (Obst- und Weinbau) einen höheren Zufriedenheitsgrad und eine häufigere Nutzung der Informationsquellen als Landwirtinnen und Landwirte von Betrieben mit Tierproduktion.
Die Informationskanäle «Zeitungen,Zeitschriften» und «Publikationen der Fachorganisationen» werden von den befragten Bäuerinnen und Bauern am meisten benutzt. Für Agroscope sind diese Kanäle deshalb sehr gut geeignet,ihre Informationen auch an die indirekte Kundschaft zu bringen.
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 199 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Zufriedene Kunden bei Agroscope
■
Nationalgestüt
Die Pferdehaltung auf Landwirtschaftsbetrieben ist weiter im Aufschwung,und dies obwohl das Pferd nicht mehr als Zugkraft eingesetzt wird.Der Kenntnisstand der Pferdehalter insbesondere in Sachen Wettbewerbsfähigkeit und Wohlergehen der Tiere hält mit dieser Entwicklung allerdings nicht immer Schritt.Die komplexen sozio-ökonomischen Fragen erfordern gemeinsame Anstrengungen mehrerer Disziplinen.Der Bedarf nach angewandter Forschung und Wissensaustausch nimmt zu.Vor diesem Hintergrund hat das Nationalgestüt die Schaffung zweier Kompetenznetzwerke gefördert:Das erste Netzwerk befasst sich mit einer Bestandesaufnahme der Schweizer Pferdewelt und das zweite vereint Forscher,die ihr Wissen teilen und auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnittene praktische Resultate austauschen wollen.
Die Gruppe setzt sich aus Vertretern der öffentlichen Hand (Bundesamt für Landwirtschaft,Nationalgestüt,Eidgenössisches Departement für Verteidigung,Bevölkerungsschutz und Sport) und von Organisationen zusammen,die sich mit dem wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Stellenwert des Pferdes befassen.
Die ersten Arbeiten zeigen,dass die Schweiz über 80’000 Tiere der Pferdegattung zählt,womit sich der Bestand in den vergangenen zehn Jahren um 40% vergrössert hat.85% der Tiere werden auf Landwirtschaftsbetrieben gehalten,während dies vor weniger als 20 Jahren nur bei 50% der Fall war.Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die notwendige Diversifizierung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten zurückzuführen. Sie ermöglicht zudem eine bessere Nutzung sowohl der Infrastrukturen (Haltung von Pensionspferden) als auch der Grünlandflächen (Verzehr von Raufutter).Die Anzahl Betriebe mit Pferdehaltung hat ebenfalls um 7% zugenommen und verzeichnet damit einen zur übrigen Nutztierhaltung gegenläufigen Trend.
Das Pferd geniesst insbesondere bei der weiblichen Jugend eine grosse Popularität.Es ist zum Familienbegleiter bei Freizeitbeschäftigungen in der Natur geworden.Entgegen der landläufigen Meinung nehmen bloss 10% der Pferde und Pferdeliebhaber an Wettkämpfen teil.
■ Forschungsnetzwerk und Publikumsveranstaltungen
Ein erster Austausch unter den Teilnehmern hat gezeigt,dass die Kommunikation verbessert,die Koordination der Forschungsarbeiten strukturiert und die Synergien sowie die wissenschaftlichen Kompetenzen optimiert werden müssen.Das vorrangige Anliegen der Pferdehalter und Benutzer ist vor allem das Wohlergehen des Tieres,das gesund sein und sich einwandfrei verhalten soll.
Die erste Publikumsveranstaltung stand im Zeichen der Prävention verschiedener Krankheiten,der Nutzung der Molekulargenetik zur Bestimmung der Freibergerrasse und von Erbkrankheiten sowie des Einflusses von Mensch und Haltungsbedingungen auf das Pferdewohl.
200 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Arbeitsgruppe Pferdebranche
■ Budgetkürzung auf Kantone überwälzt
Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung

Die direkte Beratung der Bauernfamilien geschieht zum grössten Teil durch die kantonalen Beratungsdienste,zu einem kleineren Teil durch Beratungsdienste von Organisationen,die in Spezialbereichen tätig sind,für die eine gesamtschweizerische Lösung naheliegend ist.Die beiden Beratungszentralen von AGRIDEA in Lausanne und Lindau unterstützen die Beratungsdienste,indem sie beispielsweise die Beratungskräfte weiterbilden,Beratungsmethoden entwickeln,Datengrundlagen aufarbeiten,Arbeitshilfsmittel auf Papier oder elektronisch publizieren und den Informations-,Wissensund Erfahrungsaustausch fördern.
Ausgaben des Bundes für die Beratung 2005
EmpfängerBetrag
Mio.Fr. Landwirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone8,4 Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone0,6 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen0,9 AGRIDEA (Beratungszentralen Lausanne und Lindau)8,4
Total18,3
Quelle:Staatsrechnung
Bereits zum zweiten Mal kürzte das Parlament die Budgetrubrik Beratung,nachdem bereits im Entlastungsprogramm 03 dieser Posten tiefer budgetiert wurde.Bisher konnte die Reduktion durch tiefere Beiträge an die Beratungszentralen und an die Organisationen aufgefangen werden.Ab 2006 mussten aber auch die Finanzhilfen an die kantonalen Beratungsdienste gekürzt werden.Mittelfristig werden die Finanzhilfen an die Kantone ohnehin entfallen,denn der Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen wird ab 2008 neu gestaltet.
■ AGRIDEA – Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
Seit 2006 treten die beiden Beratungszentralen (früher LBL und SRVA) und ihre Trägerorganisation,die frühere Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft,unter dem Namen AGRIDEA auf.Die Mitglieder (Kantone und landwirtschaftliche Organisationen) hatten den Statutenänderungen im Sommer 2005 zugestimmt. AGRIDEA will damit kenntlich machen,dass sie für innovative Ideen für die Landwirtschaft steht.Ebenso soll der Name zum Ausdruck bringen,dass die Beratung das Blickfeld auf den gesamten geografischen und wirtschaftlichen Raum,in dem die Landwirtschaft tätig ist,geöffnet hat.
■ Aufgaben für das Beratungsforum Schweiz
Trotz abnehmender Anzahl Betriebe sehen sich die Beratungsdienste zunehmend komplexeren Fragestellungen gegenüber.Sie gründeten im Sommer 2005 das Beratungsforum Schweiz.Zu den Zielen dieses Forums gehört unter anderem,die Beratung und Weiterbildung von Unternehmen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum zu fördern sowie die Aktivitäten seiner Mitglieder zu koordinieren.So ist nicht mehr jeder Kanton auf sich alleine gestellt,wenn es darum geht,innovative Lösungen für neue Fragestellungen zu erarbeiten.
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 201 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Berufliche Grundbildung
Landwirtschaftliche Berufsbildung
Das neue Berufsbildungsgesetz (BBG),das ab 1.Januar 2003 in Kraft getreten ist,trägt dem markanten Wandel in der Berufs- und Arbeitswelt Rechnung und ist bestrebt, neue,differenzierte Wege der beruflichen Bildung sowie eine grösstmögliche Durchlässigkeit im Berufs-Bildungssystem zu erreichen.Anstelle der bisherigen Aufwandsubventionierung tritt ab 2008 ein System von leistungsorientierten Pauschalen, welches auch aus finanzieller Sicht eine stärkere Zusammenarbeit von Bund,Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (OdA) fordert.Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstützt die landwirtschaftliche Berufsbildung mit jährlich ca. 10 Mio.Fr.
Die Reform der beruflichen Grundbildung mit Fähigkeitsausweis im Landwirtschaftsund Pferdebereich ist im Gange.Die Berufsverbände der verschiedenen Branchen haben sich zu OdAs zusammengeschlossen:
–AgriAliForm für Landwirt/in,Landwirte mit Spezialrichtung Biolandbau,Gemüsegärtner/in,Obstbauer/Obstbäuerin,Geflügelzüchter/in,Winzer/in und Weintechnologe/Weintechnologin.
–OdA «Pferdeberufe» für Bereiter/in,Pferdepfleger/in und Rennreiter/in.
Die entsprechenden Verordnungen und Ausbildungspläne,welche die Lernziele beschreiben,sind in Erarbeitung.Erstellt werden die verschiedenen Dokumente von Arbeitsgruppen,die sich aus Berufsfachleuten und Lehrkräften zusammensetzen.Die Reformkommissionen sind für die Steuerung aller Arbeiten zuständig.Ihnen gehören Vertreter der Organisationen der Arbeitswelt,der kantonalen Berufsbildungsämter und des Bundes an.Die Vernehmlassung bei allen Partnern der Berufsbildung ist auf Frühjahr 2007 und die Inkraftsetzung auf Januar 2008 geplant.
Die Einführung einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (zweijährige Ausbildung) ist im Pferdebereich für 2008 und im Landwirtschaftsbereich für 2009 vorgesehen.
■ Eidgenössische Berufsprüfung und Höhere Fachprüfung Landwirt
Für die Durchführung einer eidgenössischen Berufs- oder Höheren Fachprüfung bilden die entsprechenden OdA eine Trägerschaft.Die Prüfungsordnungen regeln die Zulassungsbedingungen,Lerninhalte,Qualifikationsverfahren,Ausweise und Titel.Sie unterliegen der Genehmigung durch das BBT.
Die oben erwähnte Organisation der Arbeitswelt AgriAliForm ist ab sofort auch für die Organisation und Überwachung der höheren Fachprüfungen verantwortlich.
Die Prüfungsordnungen der eidgenössischen Berufsprüfung und Höheren Fachprüfung Landwirt/Landwirtin wurden überarbeitet.Die ersten Fachausweise nach der neuen Prüfungsordnung sollen ab Juni 2007 ausgestellt werden.Die erste Abschlussprüfung und die Überprüfung der Modulabschlüsse der Höheren Fachprüfungen nach neuer Prüfungsordnung sollen im Jahre 2008 stattfinden.
202 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Weiterbildungsaktivitäten auf den Transfer ausrichten
Centre international d’études agricoles (CIEA)
Seit fast 50 Jahren leistet das CIEA (Internationales Studienzentrum für Bildung und Beratung in der Landwirtschaft) im Auftrag des BLW und der DEZA Beiträge zur Weiterbildung von Beratungs- und Lehrpersonen im ländlichen Raum.Wie in den vergangenen Jahren wurde auch 2006 im Rahmen eines Seminars gezielt versucht,die Transferleistung der Teilnehmenden,das heisst die Übertragung des am Kurs Gelernten in die berufliche Realität,zu verstärken.Das CIEA ist bestrebt,dass die in einem Seminar erarbeiteten und diskutierten Ideen und Resultate längerfristig wirksam werden.Das Weiterbildungsangebot soll bei den Teilnehmenden nach der Rückkehr in den beruflichen Alltag konkrete Handlungen auslösen.Dies bedingt,dass CIEASeminare nachhaltiges Lernen ermöglichen und auf den Transfer ausgerichtet sind.
Unter diesen beiden Zielsetzungen stand das CIEA-Seminar 2006,das vom 13.bis 26. August am Institut Agricole in Grangeneuve stattfand.
■ CIEA-Seminare im Dienst der Landwirtschaft
Die Ergebnisse des Seminars 2006 wie auch der vorgehenden Seminare sind ermutigend.Am Schluss lagen auch dieses Mal Ideen zu Veränderungen in den verschiedenen Ländern der Teilnehmenden sowie Vereinbarungen für Kleinprojekte vor (z.B.Austausch von Experten oder Material,Studentenaustausch,Organisation gemeinsamer Weiterbildung,Durchführen von Evaluationen).Die Schlussevaluation zeigte zudem einen hohen Grad von Zufriedenheit über den Verlauf und die Ergebnisse des Seminars. Die Organisatorinnen und Organisatoren sind überzeugt,dass Lernen und Veränderungen dann funktionieren,wenn im Rahmen von Weiterbildungsangeboten etwas Konkretes geschieht.Lernen bedeutet nicht nur Kognition,sondern immer auch Emotion.«Transfer,das sind nicht primär die Zahlen und Fakten auf einem Blatt Papier, sondern Transfer ist das Gefühl der Zufriedenheit und des Erfolges»,so formuliert es der Pädagoge A.Müller.Und er ergänzt:«Wenn Dinge mit mir zu tun haben,für mich wichtig sind,dann entwickelt sich eine Dynamik in Lern- und Veränderungsprozessen». Es scheint,dass es den Organisatorinnen und Organisatoren des CIEA-Seminars gelungen ist,mit kleinen Schritten und vielfältigen Elementen solche Emotionen zu wecken und so gute Voraussetzungen für den erfolgreichen Transfer zu schaffen.
Weitere Informationen finden sich unter www.ciea.ch.
203 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Die Bedeutung des Marktes
2.3.3 Produktionsmittel
Kostensenkung
Der wirtschaftliche Erfolg eines Landwirtschaftsbetriebes wird neben weiteren Faktoren auch von einer möglichst kostengünstigen Beschaffung resp.Bereitstellung der Vorleistungen bestimmt.Im Folgenden wird der Fokus auf die landwirtschaftlichen Produktionsmittel Dünger,Pflanzenschutzmittel und Saatgut gelegt.Der Gesamtwert dieser Vorleistungen betrug gemäss Landwirtschaftlicher Gesamtrechnung im Durchschnitt der Jahre 2002/04 419 Mio.Fr.Die Preise für diese Vorleistungen werden von verschiedenen Akteuren beeinflusst.
Zentrale Voraussetzung für den kostengünstigen Einkauf von Produktionsmitteln ist ein funktionierender Markt.Ziel jedes Marktteilnehmers ist die Maximierung seiner Marge. Produktpreise werden demnach,gemäss Theorie,auf einem Niveau angesetzt,das möglichst hoch,aber noch genug attraktiv ist,damit die verkaufte Menge ebenfalls möglichst hoch ist.Der Preisvergleich durch den Landwirt bei verschiedenen Zulieferern ist ein wichtiger Faktor für einen funktionierenden Markt.Die Veröffentlichung von Preisvergleichsstatistiken durch die Beratung bzw.die Medien können ihn dabei unterstützen.Ebenfalls kann eine Reduktion der Anzahl Akteure vom Produzenten von Produktionsmitteln bis zum Endverbraucher bei gleichbleibenden Margen des einzelnen Akteurs zu tieferen Preisen führen.Bedingung für solche Direkteinkäufe sind oftmals grössere Bezugsmengen und andere Gebindegrössen bzw.-typen.So ist Dünger in BigBags gemäss der 2005 durchgeführten Studie der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL) über Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland und Frankreich bis zu 2.50 Fr./dt günstiger als herkömmlich gesackte Ware.Sammeleinkäufe oder die Bildung von Einkaufsgenossenschaften setzen jedoch einen koordinativen Aufwand der beteiligten Landwirte und eine vorausschauende Planung voraus.Dem Handel entfallen im GegenzugMehrkosten bei der Logistik für kleinere Mengen.
Neben der Festlegung des Gleichgewichtspreises durch Angebot und Nachfrage gibt es weitere Elemente,welche bei der Festlegung der Preise eine Rolle spielen können.Ein wichtiger Faktor bei Düngern ist beispielsweise die Lieferung franko Betrieb.Durch die Frühbestellung von Produktionsmitteln können ebenfalls Rabatte erzielt werden.Die im Rahmen der Studie der SHL festgestellten Preisunterschiede zwischen der Schweiz und dem Ausland (vgl.Graphik) gründen zu einem Teil ausserdem in der kostenlosen Beratung durch die verschiedenen Anbieter.Die Kosten für diese Dienstleistung werden von den Firmen meistens auf die Produktpreise überwälzt.
204 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Produktionsmittelpreise in Deutschland und Frankreich in % der Schweizer Preise
DüngerPflanzenschutzmittel SaatgutTierarzneimittel
Noch wenig praktiziert wird der Einkauf von Produktionsmitteln direkt im Ausland,so genannte Parallelimporte.Diese sind allerdings nur für patentrechtlich nicht geschützte Produkte resp.Produkte mit abgelaufenem Patentschutz möglich.Für den Import von Produktionsmitteln bestehen gewisse staatlich festgelegte Anforderungen,auf welche im nächsten Abschnitt eingegangen wird.
Der Bereich der landwirtschaftlichen Produktionsmittel wird von verschiedenen Rechtserlassen mit jeweils unterschiedlichem Zweck beeinflusst.Nachfolgend werden die wichtigsten Regelungen erläutert.
Damit ein landwirtschaftliches Produktionsmittel in Verkehr gebracht werden darf, muss es sich gemäss LwG für die vorgesehene Verwendung eignen,bei vorschriftgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch,Tier und Umwelt sowie auf damit behandelte Ausgangsprodukte haben,und es muss zugelassen sein.Die Schweiz anerkennt ausländische Zulassungen,wenn die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen gleichwertig sind.Einen Zollschutz gibt es bei den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln nur im Bereich der Futtermittel und einzelnen in der Schweiz vermehrten Arten von Saatgut.Für stickstoffhaltige Dünger muss beim Import eine Pflichtlagerabgabe entrichtet werden.Die Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln,Dünger und einigen Arten von Saatgut bedingt den Besitz einer Generaleinfuhrbewilligung (GEB) durch den Importeur.Die GEB stellt die Rückverfolgbarkeit des Produktionsmittels sicher.
Das Patent- und Sortenschutzrecht schützt geistiges Eigentum und ermöglicht es so dem Schutzinhaber,für Produkte,zu deren Entwicklung hohe Investitionen getätigt wurden,während einer definierten Dauer Lizenzgebühren zu verlangen.Das momentan aufgrund eines Bundesgerichtsentscheides angewendete Prinzip der nationalen Erschöpfung verunmöglicht die parallele Einfuhr von immaterialgüterrechtlich geschützten Produkten.Die Zulassung von Parallelimporten würde den Einkauf von geschützten Produkten im preislich meist vorteilhafteren umliegenden Ausland ermöglichen.
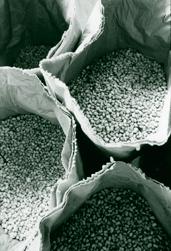
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 205 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Preis EU in % Preis CH Mittelwert Mittelwert 1.Quartil Mittelwert 4.Quartil Quelle: SHL Zollikofen 0 120 100 80 60 40 20 66 81 43 76 107 49 50 53 76 101 78 96
■ Staatliche Einflüsse auf Produktionsmittel
■ Einsatz der Produktionsmittel
Beim effizienten Einsatz von Produktionsmitteln und damit im hauptsächlichen Einflussbereich des Landwirtes liegt selbstverständlich ein weiterer Kostensenkungsfaktor.Als Beispiel kann die extensive Produktion sowie der zeitlich und mengenmässig optimale,auf die Bedürfnisse von Pflanzen resp.Tieren abgestimmte Einsatz von Produktionsmitteln zu einem Minderverbrauch und damit zu einer Kostenreduktion führen.Im Einsatz von Generika,das heisst Produktionsmitteln mit abgelaufenem Patentschutz,welche,wenn sie auf der im nächsten Kapitel beschriebenen Liste aufgeführt sind,zudem bewilligungsfrei importiert werden können,besteht ein weiteres Kostensenkungspotenzial.Ebenfalls kann der Einsatz von betriebseigenen Produktionsmitteln wie z.B.Futtermitteln oder Hofdünger die Fremdkosten vermindern.
Parallelimporte von Pflanzenschutzmitteln
Eine Grosszahl der in der Schweiz zugelassenen Mittel ist auch in unseren Nachbarländern bewilligt.Damit diese Produkte importiert werden können,ohne das vollständige Zulassungsverfahren zu durchlaufen,hat das Parlament unter Artikel 160 Absatz 6 des LwG eine neue Bestimmung eingeführt.Diese ermächtigt die zuständige Behörde,eine Liste der in der Schweiz und im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittel zu erstellen,die frei eingeführt werden können.Nach der Verordnung vom 18.Mai 2005 über Pflanzenschutzmittel ist das BLW mit der Erarbeitung dieser Liste beauftragt.
■ Verfahren zur Aufnahme in die Liste einführbarer Pflanzenschutzmittel
Das BLW bestimmt zunächst die in den Nachbarländern vermarkteten Produkte,die einem in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel entsprechen.Hierfür stützt es sich hauptsächlich auf die in diesen Ländern veröffentlichten amtlichen Listen.Anhand des darin angegebenen Wirkstoffgehalts und Formulierungstyps entscheidet das Bundesamt,ob das Mittel mit einem in der Schweiz zugelassenen Produkt gleichwertig ist.
Nachdem das BLW die Liste der ausländischen Pflanzenschutzmittel erstellt hat, überweist sie diese zunächst an das Bundesamt für Gesundheit und an das Bundesamt für Umwelt und anschliessend an die Schweizer Bewilligungsinhaber des Referenzprodukts zur Stellungnahme.Letztere Vernehmlassung hat hauptsächlich zum Zweck, den Bewilligungsinhabern die Möglichkeit zu geben,Einsprache gegen die Aufnahme ausländischer Produkte in die Liste zu erheben,wenn das Referenzprodukt durch ein Patent geschützt ist.
Dabei kommt der Grundsatz der nationalen Erschöpfung des Patentrechts zur Anwendung.Dieser bedingt,dass ein Pflanzenschutzmittel nur mit Einwilligung des Patentinhabers erstmals in die Schweiz eingeführt bzw.verkauft werden kann.Der Patentinhaber kann demzufolge Einsprache gegen den Direktimport eines ausländischen Mittels erheben,das einem in der Schweiz patentierten Produkt entspricht.
206 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
■ Verwendungsvorschriften
In der EU gilt der Grundsatz der regionalen Erschöpfung des Patentrechts:Gibt ein Patentinhaber eines EU-Landes sein Einverständnis für die Vermarktung eines Produkts,kann er dessen «Ausfuhr» bzw.Verkauf in einem anderen Mitgliedstaat nicht verhindern.Allerdings hat er die Möglichkeit,eine Lizenz auf den Verkauf des Mittels in einem anderen Mitgliedland zu erheben,insofern die Produkte dort ebenfalls patentrechtlich geschützt sind.
Nach Abschluss der Vernehmlassung nimmt das BLW jene Produkte,welche die Anforderungen erfüllen,in die Liste der frei einführbaren Pflanzenschutzmittel auf. Die entsprechende Verfügung wird im Bundesblatt veröffentlicht und kann binnen 30 Tagen angefochten werden.Nach Ablauf dieser Frist werden die Pflanzenschutzmittel in der Liste veröffentlicht,die auf der BLW-Homepage (Themen,Pflanzenschutz, Pflanzenschutzmittel) abrufbar ist.
Die Anwendungsbedingungen für die Pflanzenschutzmittel sind in der Schweiz und im Ausland nicht zwangsläufig identisch.Landwirte,die Pflanzenschutzmittel benutzen, sind gesetzlich dazu verpflichtet,sich an die Verwendungsanweisungen zu halten. Beispielsweise müssen Produkte,die in der Schweiz nicht in der Nähe von Quellfassungen ausgebracht werden dürfen,auf der Etikette einen speziellen Vermerk aufweisen.Dieser fehlt allerdings auf dem im Ausland verkauften Produkt.Die gesetzlichen Vorschriften werden auf der Homepage des BLW veröffentlicht,damit sich die Schweizer Anwender darüber informieren können.
■ Einfuhrverfahren
Wer Pflanzenschutzmittel importieren will,muss über eine Generaleinfuhrbewilligung (GEB) verfügen.Die entsprechenden Gesuchsformulare sind auf der BLW-Homepage abrufbar.Bei der Verzollung hat der Importeur die GEB-Nummer anzugeben.
Es können nur die im BLW-Verzeichnis aufgeführten Produkte frei importiert werden.
2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 207 2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2
Gentechnisch veränderte Organismen in Futtermitteln
Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bewilligt sind.Bisher wurden bestimmte GVO für die Verwendung in Lebensund Futtermitteln bewilligt.Beim Import sind Produkte,die GVO sind oder enthalten, dem Zoll gegenüber meldepflichtig.Auf Grund dieser Meldepflicht ist die Menge der importierten GVO-haltigen Futtermittel bekannt.Die Übersicht zeigt,dass die importierte Menge an GVO-haltigen Futtermitteln gegenüber der Menge der gesamten importierten Futtermittel sehr klein ist.In absoluten Zahlen werden pro Jahr ca.400 bis 2000 t GVO-haltige Futtermittel eingeführt.
Gemeldete GVO-haltige Futtermittelimporte
Futtermittel,die GVO sind oder enthalten,müssen entsprechend gekennzeichnet werden,damit die Wahlfreiheit gewährleistet ist.Der Schwellenwert für die Kennzeichnung liegt bei einem GVO-Anteil von 0,9%.Anteile,die darüber liegen,müssen deklariert werden.Die korrekte Anwendung der Kennzeichnungspflicht wird im Rahmen der gesamtschweizerischen Futtermittelkontrolle von der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP kontrolliert.Proben werden vom Zoll beim Import von Rohwaren sowie im Markt von ALP erhoben und an der ALP auf GVO-Anteile und die entsprechende Kennzeichnung überprüft.In den letzten Jahren mussten nur zwei vom Zoll erhobene Posten beanstandet werden.Auch die GVO-Kennzeichnung der Produkte bei den Herstellern ist insgesamt gut.Nur wenige Produkte weisen eine fehlerhafte Kennzeichnung bezüglich GVO auf.
Jahrdurch den Zoll falsche durch ALP falsche erhobene ProbenAngabenerhobene ProbenAngaben
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 208
in tin tin % 2001272 9913 7811,40 2002318 0682 5630,80 2003412 1636880,20 2004383 5952 1010,55 2005356 1494020,11
JahrImportierte Futter-gemeldete GVO-gemeldete GVOmittelmenge totalhaltige Futtermittelhaltige Futtermittel
Untersuchungen von Futtermitteln auf GVO
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl 20013002372 20025402033 20038102670 20046122285 20053002503
2.3.4Tierzucht
Im europäischen Vergleich gilt das Schweizer Tierzuchtrecht als sehr liberal und fortschrittlich.Verschiedenen Ländern dient es heute als Vorbild für die gegenwärtige Neuausrichtung ihrer staatlichen Regelungen zur Förderung der Zucht von landwirtschaftlichen Nutztieren.In diesem Umfeld hat sich die inländische Tierzucht in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt ohne dabei ihre Eigenständigkeit aufzugeben. Der freie Zugang zu ausländischer Genetik hat vorab bei den Rindern,Schafen und Pferden zu einem markanten Anstieg der Rassenvielfalt geführt.Trotz starker Konkurrenz aus dem Ausland sind die Schweizer Rassen nach wie vor gefragt und verteidigen erfolgreich ihren angestammten Platz im inländischen Zuchtgeschehen.
Die Bemühungen der Zuchtorganisationen um eine konkurrenzfähige und eigenständige Tierzucht wurden von Bund und Kantonen im Berichtsjahr mit einem Beitrag von 19,4 Mio.Fr.unterstützt.

2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 209 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tabelle 50,Seite A57
■ Internationale technische Konferenz für tiergenetische Ressourcen
Seit rund zehn Jahren befasst sich die FAO-Kommission für genetische Ressourcen mit der Erarbeitung einer weltweiten Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von tiergenetischen Ressourcen in der Landwirtschaft.Die ihr angeschlossenen Länder, darunter auch die Schweiz,sind stark in diesen Prozess eingebunden.Auf der Grundlage von über 170 Situationsberichten,die der FAO während der letzten zwei Jahre von den einzelnen Ländern zugestellt worden sind,erarbeitet sie gegenwärtig einen Weltzustandsbericht über die Biodiversität der landwirtschaftlichen Nutztierrassen sowie einen Bericht über dringende Massnahmen zur Sicherung und besseren Nutzung der weltweiten Rassenvielfalt.Die genannten Berichte sollen an der ersten internationalen technischen Konferenz für tiergenetische Ressourcen verabschiedet werden. Die Schweiz hat sich als Gastland zur Verfügung gestellt und wird diese Konferenz zusammen mit der FAO im September 2007 in Interlaken durchführen.Im Rahmen der Veranstaltung werden unsere einheimischen Rassen eine einmalige Chance erhalten, sich in ihrer ganzen Vielfalt einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und ihre Vorzüge,z.B.über ausserordentliche Produkte oder als Kulturgut aufzuzeigen.
■ Liberalisierung der künstlichen Besamung beim Rindvieh
Eine Regelung für die künstliche Besamung besteht in der Schweiz nur beim Rindvieh. Für die Gewinnung,Lagerung oder den Vertrieb von Stierensamen braucht es eine Bewilligung des BLW.Diese wurde bisher ausschliesslich inländischen Besamungsorganisationen erteilt,die im Inland gezüchtete Stiere halten,von diesen Samen gewinnen und vertreiben und damit einen Beitrag zur Erhaltung einer eigenständigen inländischen Rindviehzucht leisten.Samenhändlern ohne KB-Station war der Vertrieb von Samen nicht gestattet.Aufgrund einer Beschwerde hat das Bundesgericht im März 2005 entschieden,dass es sich beim vom Bund erlassenen Verbot,Stierensamen direkt zu vertreiben,um eine durch die geltende Tierzuchtverordnung nicht abgestützte Massnahme handelt.Dieser Entscheid hat zur Folge,dass die bisherige Regelung der künstlichen Besamung in Richtung einer weiteren Liberalisierung überprüft wird.
■ Innovative Projekte zur Verwertung der inländischen Schafwolle
Seit anfangs 2004 können innovative Projekte der Schafhalter und Wollverarbeiter zur Verwertung der inländischen Wolle im Inland mit Beiträgen gefördert werden.Von den eingereichten Projekten erfüllten bisher vier die Anforderung für die Zusage einer Finanzhilfe.Mit einer Anschubfinanzierung wurden der Aufbau eines Produktionsbetriebes für Schafwoll- und Naturprodukte im Prättigau und die Errichtung eines Zentrums für verschiedenste Aktivitäten und Schulungen rund um die Schafwolle im Jura unterstützt.Durch die Mitfinanzierung einer Kardmaschine und einer Waschanlage erhält eine Organisation in der Ostschweiz die Möglichkeit,einheimische Schurwolle in verschiedenen Arbeitsgängen von der Schur bis zur Fertigung von Bettinhalten für die Entwicklungshilfe zu verarbeiten.Die Waschanlage ist ein Unikat in der Schweiz und soll daher von sämtlichen vom Bund anerkannten Wollverwertungsorganisationen genutzt werden können.
2.3 GRUNDLAGENVERBESSERUNG 2 210
2.4 Sektion Finanzinspektorat
Das Inspektionsprogramm des Finanzinspektorates wird mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle abgestimmt und vereinbart.Die Feldkontrollen werden in Absprache mit den Fachbereichen oder nach Risikoüberlegungen durchgeführt.
Finanzinspektorat
Im Berichtsjahr wurden folgende Revisionstätigkeiten vorgenommen: –BLW-externe Revisionen bei neun Leistungsempfängern resp.Subventionsempfängern und deren ausführende Beauftragte; –BLW-interne Revision in zwei Fachsektionen; –Periodische Belegkontrollen im Amt inkl.Forschungsanstalten und Gestüt; –sieben Abschlussrevisionen bei vier Subventionsempfängern; –Nachfolgeprozess von abgeschlossenen Revisionen.
Sämtliche Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit den Standards für die berufliche Praxis des Institute of Internal Auditors (IIA) sowie des Schweizerischen Verbandes für Interne Revision (SVIR) vorgenommen und einer Qualitätssicherung unterzogen.
Die System- und Wirkungsprüfung des Direktzahlungssystems in neun Kantonen bildete einen Schwerpunkt der Tätigkeiten.Die Internen Kontrollsysteme (IKS) der Kantone sind allgemein zweckmässig organisiert.Es bestehen aber noch Weiterentwicklungspotenziale.Die Oberkontrolle der Kantone über die Kontrolldienste sollte verstärkt werden.Demgegenüber ist der Kontrollumfang bei den Betrieben als zu hoch zu beurteilen,durch eine bessere Risikoselektion könnte deren Anzahl reduziert werden.Übereinstimmend wird die Wirkung der allgemeinen Direktzahlungen als entscheidend für die Einkommenssituation der bäuerlichen Bevölkerung beurteilt.
BLW-interne Revisionen (so genannte Dienststellenrevisionen) beinhalten eine unabhängige und systematische Beurteilung der betrieblichen Organisation und der Tätigkeiten der Organisationseinheit.Sie umfassen insbesondere die Aufbau- und Ablauforganisation einer Sektion.Ein wichtiges Element ist auch die Überprüfung der internen Kontrolle (IKS).Das Augenmerk richtet sich nicht nur auf eine Soll-IstAbweichung,sondern auch auf deren Ursachen.Die Resultate der Prüfungen fallen überwiegend positiv aus.Die öffentlichen Mittel werden rechtmässig und zielgerichtet eingesetzt.Die dabei im Einsatz stehenden Führungs- und Steuerungsinstrumente sind mehrheitlich angemessen und transparent.
2.4 SEKTION FINANZINSPEKTORAT 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 211 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Rechenschaftsablage im Berichtsjahr
■ Folgeprozess
Die Finanzrevision im BLW umfasste mehrere Teilprüfungen in periodischen Abständen. Aufgrund der stichprobenweisen Prüfung ausgewählter Rubriken und deren Konti konnten die Ordnungs- und Rechtmässigkeit der getätigten Ausgaben bestätigt werden.
Die Abschlussrevisionen führten mehrheitlich zu zufriedenstellenden Resultaten.Bei drei Abrechnungen wurden die Ordnungsmässigkeit und Rechtmässigkeit mit Einschränkungen akzeptiert.Gründe dafür waren unzureichende Nachprüfbarkeit,unvollständige Aufzeichnungen,unangepasste Verbuchungspraxis und unzweckmässige Buchführung.Trotzdem haben die Organisationen die vereinbarten Leistungen erbracht und die Bundesgelder,abgesehen von einigen Ausnahmen,zweckmässig und wirtschaftlich verwendet.
Im Rahmen des Folgeprozesses wurde der Umsetzungsstand der offenen Empfehlungen aus 14 Revisionen der Jahre 2002 bis 2004 bei den betroffenen Sektionen überprüft.Dabei konnte festgestellt werden,dass die meisten Sektionen die anlässlich der Schlussbesprechungen vereinbarten Empfehlungen in der praktischen Arbeit umsetzen.Die noch nicht umgesetzten Empfehlungen werden im laufenden Jahr nochmals auf ihren Umsetzungsstand hin überprüft.Bei Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten des Finanzinspektorates wird festgehalten,dass die Linieninstanzen selber für ihre Entscheidungen verantwortlich sind.

2.4 SEKTION FINANZINSPEKTORAT 2 212
■ Kontrolltätigkeit im Berichtsjahr
Feldkontrolle
Die Inspektoren des Bereichs Feldkontrolle führen Kontrollen,Abklärungen,Ermittlungen und Untersuchungen in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Gesetzgebung von Produktion und Absatz bzw.für die Fachstellen des BLW durch.Im Jahr 2005 wurden 484 Kontrollen durchgeführt.Die Prüfungen fanden in den folgenden Bereichen statt:
–Milch- und Milchprodukte mit 363 Kontrollen; –Gemüse,Obst,Schnittblumen und Obstkonzentrat mit 58 Kontrollen; –Fleisch und Eier mit 36 Kontrollen; –Acker- und Futterbaubereich mit 20 Kontrollen und eine Preisberechnung und Mengenkontrolle; –Reben bezüglich Umstellungsmassnahmen mit 6 Kontrollen.
Die Mengenkontrollen in der Milchwirtschaft im Zusammenhang mit Zulagen und/oder Beihilfen (Milchpreisstützung) und/oder Abgaben (Milchkontingentierung) erfolgten nach der internationalen Norm EN 45004 (ISO/IEC 17020,akkreditierte Inspektionsstelle Typ B).Für die übrigen Kontrollbereiche wurden die gleichen Qualitätsnormen angewandt.
Im Bereich der Kontrollen von Milch- und Milchprodukten wurde rund ein Drittel aller Betriebe kontrolliert.132 Betriebe mussten beanstandet werden,davon waren 2% mit finanziellen Konsequenzen in Form von Rückzahlungen und Nachzahlungen betroffen.
Im Bereich der Domizilkontrollen von frischen Früchten und Gemüsen mussten bei 20% aller Kontrollen Verfehlungen beanstandet werden,die in der Folge Verwaltungsmassnahmen nach sich zogen.
In den übrigen Bereichen gaben die Kontrollen und Beanstandungen zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
■ Widerhandlungen
Abklärungen,Untersuchungen und Befragungen im Zusammenhang mit Widerhandlungen gegen die Landwirtschaftsgesetzgebung werden in Zusammenarbeit mit eidgenössischen und kantonalen Untersuchungsbehörden,mit privaten Organisationen und anderen Rechtshilfestellen vorgenommen.Im Berichtsjahr wurde ein Widerhandlungsfall eröffnet und zur Bearbeitung weitergeleitet.Gesamthaft wurden vier Fälle definitiv erledigt.
2.4 SEKTION FINANZINSPEKTORAT 2 2.AGRARPOLITISCHE MASSNAHMEN 213
2 214

3 215 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 3.Internationale Aspekte
Die Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen betreffen die Landwirtschaft in zunehmendem Masse.Auf globaler Ebene ist die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk der WTO eingeflochten.Angesichts der geographischen Konzentration des Agrarhandels sind die vertraglichen Beziehungen zur EU und die zunehmende Integration in Europa für die Schweizer Landwirtschaft von grösster Bedeutung.
Um ihre Exportmöglichkeiten zu erhalten und verbessern,ist die Schweiz auf einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten angewiesen.Die Schweiz setzt sich zudem auf internationaler Ebene stark dafür ein,dass die multifunktionalen Eigenschaften der Landwirtschaft in den internationalen Abkommen stärker berücksichtigt werden.
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung und behandelt die internationalen Themen im dritten Kapitel.
–Abschnitt 3.1 enthält Informationen über den aktuellen Stand im Europa-Dossier, bei den WTO-Verhandlungen und bei den Freihandelsabkommen.
–In Abschnitt 3.2 geht es um internationale Vergleiche.Im vorliegenden Bericht werden die im Jahr 2000 begonnenen internationalen Preisvergleiche fortgeführt.
3.INTERNATIONALE ASPEKTE 3 216
3.1 Internationale Entwicklungen
Das Berichtsjahr endete mit der unbefristeten Suspendierung aller Verhandlungen im Rahmen der WTO-Doha-Runde,am 27.Juli 2006.Es ist noch zu früh,die Auswirkungen auf das Welthandelssystem und die Agrarreform in der Schweiz einzuschätzen.Ein längeres Ausbleiben von richtungsweisenden Entscheiden könnte jedoch die weitere Gestaltung der Schweizer Aussenwirtschaftspolitik tangieren.
Die Beziehungen mit der EU entwickelten sich hingegen erfreulich.Sowohl der Handel mit Agrargütern als auch die vertragliche Weiterentwicklung des Agrarabkommens machten Fortschritte.Im Juni 2006 beauftragte der Bundesrat die zuständigen Verwaltungsstellen,zu Form und Inhalt eines allfälligen Agrarfreihandelsabkommens Explorations-Konsultationen mit der EU-Kommission durchzuführen.Ein Entscheid über die Aufnahme von formellen Verhandlungen könnte im Jahr 2007 getroffen werden.
Neue Freihandelsabkommen mit Konzessionen im Agrarbereich traten in Kraft mit Südkorea und wurden unterzeichnet mit der Zollunion im südlichen Afrika.Der Bundesrat beschloss auch die Einführung des zoll- und kontingentsfreien Zugangs für alle Güter aus den am wenigsten entwickelten Ländern.

3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 217 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Agrarfreihandel Schweiz – EU?
Im Januar 2006 beauftragte der Bundesrat das EVD und das EDA,die Machbarkeit eines Agrarfreihandelsabkommens mit der EU zu prüfen.Erste Ergebnisse zeigten,dass ein solches Abkommen volkswirtschaftlich vorteilhaft und agrarpolitisch vertretbar sein kann,wenn es sowohl die gesamte Produktionskette im Landwirtschafts- und Ernährungsbereich als auch tarifäre und alle nicht-tarifären Handelshemmnisse abdeckt.Die Annäherung an das EU-Preisniveau würde jedoch in der Landwirtschaft wie in den vorund nachgelagerten Bereichen eine grosse Herausforderung darstellen.Je nach Ausgestaltung der Übergangsphase wären befristete Begleitmassnahmen unabdingbar. Auf dieser Basis entschied der Bundesrat am 10.März 2006 das Projekt weiter zu vertiefen,die interessierten Kreise in der Schweiz zu konsultieren und informelle Kontakte mit der EU-Kommission zu knüpfen.
Diesbezüglich fanden bis Ende Mai 2006 Sondierungsgespräche mit der EU-Kommission statt.Abzuklärende Themen waren neben dem Grundinteresse der EU insbesondere die Harmonisierung der Vorschriften im nicht-tarifären Bereich und bei den Zulassungen von Produktions- und Lebensmitteln,die regionale Erschöpfung der Patent- bzw.Sortenschutzrechte von Pflanzenschutzmitteln,Tiermedikamenten und Saatgut,die Anerkennung der Gleichwertigkeit im nicht-harmonisierten Bereich (Cassis de Dijon-Prinzip) und institutionelle Aspekte.Die Sondierungen in der Schweiz und Brüssel ergaben ein grundsätzliches Interesse an einer Fortführung des Projektes und weiteren Abklärungen.
Ende Juni 2006 entschied der Bundesrat,exploratorische Gespräche mit der EUKommission über die inhaltlichen und formalen Eckwerte eines allfälligen Freihandelsabkommens aufzunehmen.Gleichzeitig soll die Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Auswirkungen vertieft,angemessene Begleitmassnahmen umrissen und die Einbettung eines Freihandelsabkommens in die bestehenden Politiken untersucht werden.
Ob Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen im Agrar- und Lebensmittelbereich aufgenommen werden,entscheidet der Bundesrat voraussichtlich im Jahr 2007 auf der Grundlage der Erkenntnisse unter anderem aus diesen Explorationsgesprächen.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 218
■ Entwicklungen
Agrarabkommen Schweiz – EU
Das Abkommen vom 21.Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrarabkommen) strebt eine Verbesserung des gegenseitigen Marktzutritts für Agrarprodukte durch Abbau von Zöllen,Exportsubventionen sowie technischen Handelshemmnissen an.Es anerkennt die technischen Vorschriften in einzelnen Bereichen wie Pflanzenschutz,biologische Landwirtschaft und Tierseuchenbekämpfung als gleichwertig.
Schwerpunkt des tarifären Teils ist die vollständige gegenseitige Liberalisierung des Käsehandels.Ab 1.Juni 2007 können zwischen der Schweiz und der EU alle Käsesorten frei,das heisst ohne jegliche mengenmässigen Beschränkungen,Exportbeihilfen oder Zölle,gehandelt werden.
Im nicht-tarifären Bereich bildet die Äquivalenz der Lebensmittel tierischer Herkunft einen neuen Schwerpunkt.Mit diesem Ziel wurden die schweizerische Gesetzgebung an das EU-Hygienerecht angepasst und Äquivalenzverhandlungen mit der EU geführt. Die Bundesämter für Gesundheit (BAG),Landwirtschaft (BLW) und Veterinärwesen (BVET) haben die Vorarbeiten in einem gemeinsamen Projekt realisiert.Eine erste Etappe wurde bereits auf den 1.Januar 2006 erreicht,indem die bereits bestehende Äquivalenz für Milch und Milchprodukte erhalten bleibt.In Zukunft (voraussichtlich ab Ende 2006) werden etliche Handelshemmnisse für alle anderen tierischen Lebensmittel weg fallen,womit ein vereinfachter Marktzutritt möglich sein wird.
■ Der Gemischte Agrarausschuss
Der Gemischte Ausschuss zum Agrarabkommen zwischen der Schweiz und der EU tagte am 25.November 2005 zum fünften Mal.Das Treffen fand unter Schweizer Vorsitz in Brüssel statt.
Dem Begehren des Fürstentums Liechtenstein,das bilaterale Agrarabkommen auf das Fürstentum auszuweiten,stimmte der Gemischte Ausschuss zu.Der Briefwechsel,der die Ausweitung regelt,soll zwischen der Schweiz,der EU und dem Fürstentum Liechtenstein im November 2006 finalisiert und anschliessend dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet werden.
Der Gemischte Ausschuss verabschiedete 2005 zwei Entscheide zur administrativen Vereinfachung des Handels mit Wein sowie mit Pflanzen und zwei weitere Entscheide zu Zollkonzessionen im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung sowie zur Aufdatierung des Anhangs über biologisch angebaute Produkte.Die Anhänge im Bereich des Weines und der Spirituosen sollen ebenfalls angepasst werden.Bei den Spirituosen wird die EU ihre Produkteliste anpassen,sobald sie dazu die Rechtsgrundlage hat.
Im Biobereich wurde hinsichtlich der Aktualisierung der Anhänge zum Agrarabkommen die problemlose Anpassung der schweizerischen und europäischen Rechtsnormen erläutert.Die Möglichkeit,dass die Schweiz am «Comité permanent pour l’agriculture biologique» teilnimmt,um den Informationsaustausch zu gewährleisten,muss noch abgeklärt werden.Bei der Geflügelkennzeichnung hat die Schweiz ihre Rechtsnormen angepasst,die am 1.Januar 2006 in Kraft traten und die Äquivalenz der Kennzeichnungen Schweiz-EU gewährleistet.
3.INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 219
■ AOC-Verhandlungen
Die Parteien erörterten auch das baden-württembergische Anliegen bezüglich allfälliger Doppelzahlungen für in der Schweiz ansässige Landwirte,die in Deutschland Land bewirtschaften.Der Bundesrat beschloss,EU-Zahlungen von den Schweizer Direktzahlungen abzuziehen,unter der Voraussetzung,dass die Schweiz die Informationen erhält,welche Schweizer Bauern EU-Zahlungen erhalten.
Die vom Gemischten Agrarausschuss eingesetzte Ad-hoc-Arbeitsgruppe AOC hat die Gleichwertigkeit der Gesetzgebungen anerkannt und die problematischen Fälle bezeichnet (von der einen Partei geschützte und von der anderen benützte Bezeichnungen).Mit Beschluss vom 10.Juni 2005 genehmigte der Bundesrat die Aufnahme von Verhandlungen im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung der GUB (geschützte Ursprungsbezeichnungen) und der GGA (geschützte geografische Angaben). Vom WTO-Panel der USA und Australiens ein wenig erschüttert,hat die EU noch kein Verhandlungsmandat formuliert.Sie teilt aber das Interesse der Schweiz,ein solches Abkommen abzuschliessen und den Willen,die problematischen Fälle zu lösen.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
In verschiedenen Bereichen fand 2006 eine Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU statt:
Am 24.November 2005 beschlossen die Agrarminister der EU,die Marktordnung «Zucker» zu reformieren.Der Garantiepreis für Weisszucker wird binnen vier Jahren um 36% gesenkt.Dabei erhalten die Landwirte für durchschnittlich 64,2% der Preissenkung einen Ausgleich in Form einer produktionsentkoppelten Zahlung,die an die Einhaltung bestimmter Standards für Umweltschutz und Bodenbewirtschaftung gebunden ist und in die einheitliche Betriebsprämie einbezogen wird.Länder,die mehr als die Hälfte ihrer Produktionsquote aufgeben,dürfen auf fünf Jahre befristet zusätzlich eine produktionsgekoppelte Zahlung in Höhe von 30% der Einkommenseinbussen leisten.Mit einer grosszügigen Regelung für eine freiwillige Umstrukturierung sollen wettbewerbsschwächere Erzeuger Anreize erhalten,aus dem Zuckersektor auszuscheiden.Die Intervention zum Aufkauf von Produktionsüberschüssen wird über einen Zeitraum von vier Jahren hin schrittweise abgeschafft.Den Entwicklungsländern wird weiterhin ein präferenzieller Zugang zum EU-Markt gewährt.Für AKP-Länder (Afrika, Karibik,Pazifik),die eine Hilfe benötigen,steht im Jahr 2006 ein Unterstützungsprogramm im Umfang von 40 Mio.Euro zur Verfügung.Einzelheiten über die Auswirkungen dieser Reform auf die schweizerische Zuckermarktpolitik siehe Kapitel 2.1 Produktion und Absatz.
Anfangs 2006 legte die EU-Kommission eine Strategie für Biokraftstoffe vor.Die drei Hauptziele sind die Förderung von Biokraftstoffen sowohl in der EU als auch in Entwicklungsländern;die Verbesserung ihrer Kostenwettbewerbsfähigkeit und die verstärkte Forschung auf dem Gebiet der Kraftstoffe «der zweiten Generation» sowie die Unterstützung von Entwicklungsländern,in denen die Biokraftstofferzeugung ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern könnte.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 220
Das bilaterale Weinabkommen EU-USA wurde nach über zwanzigjährigen Verhandlungen am 10.März 2006 in London unterzeichnet.Kernpunkte des Abkommens sind: 1.Einige europäische Weinnamen wie Porto, Sherry und Champagne gelten derzeit in den USA als generische Gattungsbezeichnungen.Durch das Abkommen wird ihre Verwendung in den USA eingeschränkt.2.Derzeit in den USA bestehende Weinbereitungsverfahren,die nicht unter EU-Ausnahmen fallen,werden anerkannt.3.EUWeine sind auch von den 2004 in den USA erlassenen Zertifizierungsvorschriften befreit.
Der Ausbruch der Vogelgrippe führte in einigen EU-Mitgliedstaaten zu einem erheblichen Rückgang des Verbrauchs und des Preises von Geflügel und Eiern.Deshalb nahmen der EU-Rat und das Parlament Ende April 2006 den Kommissionsvorschlag an,ausnahmsweise 50% der Kosten der Marktstützungsmassnahmen als Folge des schwerwiegenden Verbrauchs- und Preisrückgangs bei Geflügel und Eier zu übernehmen.
Anfang April 2006 besprachen 700 europäische Politiker,EU-Beamte und führende Sachverständige aus Wissenschaft und Handel sowie Vertreter von NGO an einem Experten-Treffen in Wien künftige Strategien für die Koexistenz gentechnisch veränderter,konventioneller und biologischer Nutzpflanzen.Eine der Kernaussagen der Konferenz war,dass es in Anbetracht der begrenzten Erfahrungen mit dem Anbau genetisch veränderter Kulturen in der EU und der noch nicht abgeschlossenen Einführung entsprechender Massnahmen in den Mitgliedstaaten zurzeit nicht gerechtfertigt ist, EU-weite Rechtsvorschriften über die Koexistenz auszuarbeiten.

3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 221
■ Ministerkonferenz in Hongkong (13.–18.Dezember 2005)
WTO
Der Sommer 2006 war durch den Unterbruch der Verhandlungen der im Jahre 2001 begonnenen Doha-Runde geprägt.Nach langen Monaten ständiger Diskussionen in Genf,auch am Rande des G8-Gipfels in St.Petersburg (15.–17.Juli),fanden sich die WTO-Mitglieder schliesslich mit einer Vertagung der Schlussverhandlungen ab.Es wurde noch kein Datum für die Wiederaufnahme festgesetzt.Insbesondere sind die Vereinigten Staaten mit den Teil-Wahlen von Mitte November beschäftigt und daher nicht imstande,Konzessionen einzugehen,vor allem im Landwirtschaftsbereich,und es werden weitere politische Vorgaben hinzukommen.Unter diesen Umständen dürften die Verhandlungen nicht so bald wieder aufgenommen werden;es ist die Rede von Monaten,ja von Jahren.
Während das zweite Semester 2005 im Wesentlichen der Vorbereitung der als entscheidend geltenden Ministerkonferenz im Januar 2006 gewidmet war,mussten die Minister anlässlich einer Sitzung am Rande des World Economic Forum (WEF) in Davos feststellen,wie wenig effektive Fortschritte in den Hauptdossiers erzielt worden waren. Die Diskussionen wurden danach mit mehr oder weniger Elan wieder aufgenommen, hatten die Minister doch ihre Verhandlungsteilnehmer mit der definitiven Ausarbeitung der Modalitäten bis Ende April beauftragt.Die Konferenz von Hongkong erlaubte es den 149 Mitgliedern immerhin,den Grundsatz der Abschaffung der Exportsubventionen bis 2013 sowie einige Parameter zur Abbauformel für die Inlandstützung festzulegen.
Exportsubventionen: Die Schweiz unterstützte die EU,die um die Zusicherung kämpfte, dass alle Arten von Exportstützungen gleich behandelt würden.Die Minister versuchten,die abzuschaffenden Praktiken zu bezeichnen:in den Exportkrediten enthaltene Subventionselemente,Nahrungsmittelhilfe aus Überschüssen und staatliche Exportunternehmen.Für die Nahrungsmittelhilfe,von der angenommen wird,dass sie keine handelsverzerrenden Auswirkungen hat,wurde eine so genannte «sichere Kategorie» (safe box) geschaffen.Die Empfänger von Nahrungsmittelhilfe (wie auch die grossen Spender) wehrten sich dagegen,dass jegliche Naturalhilfen verboten werden, vor allem in Notfällen.Während in der Schweiz die Exportsubventionen im Jahr 2003 noch 206 Mio.Fr.betrugen,gingen diese 2005 auf 145 Mio.Fr.zurück.
Inlandstützung: In diesem Bereich haben die Mitglieder die Formeln strukturiert,mit denen das aggregierte Stützungsmass und der Gesamtbetrag der internen Subventionen verringert werden können.Es geht um zwei Formeln mit je drei Bändern, denen die Mitglieder zugeordnet wurden:die EU dem obersten,die USA und Japan dem mittleren und die restlichen Mitglieder dem unteren Band.Die Abbauansätze steigen von Band zu Band an.Die Mitglieder bekräftigten ihren Willen,das Stützungsniveau «effektiv» zu senken.Dies bedeutet,dass beim Abbau vom reellen Stützungsniveau und nicht bloss vom Verpflichtungsniveau der Uruguay-Runde auszugehen sein dürfte.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 222
■ Treffen in Genf (Januar–Juni 2006)
Marktzutritt: Über den Marktzutritt konnte,was die entwickelten Länder anbelangt, auf Ministerebene nicht verhandelt werden,aber es fanden technische Gespräche statt.Der von den Ministern genehmigte Text bestätigt die Idee einer Abbauformel mit vier Bändern und «sensiblen Produkten» (mit geringeren Zollreduktionen,wobei aber die Importmengen in Form von Zollkontingenten zu erhöhen sind) sowie strategischen «Spezialprodukten» für die Entwicklungsländer.
Nach Hongkong wurden zahlreiche technische Treffen zu allen drei Bereichen und einigen verwandten Themen abgehalten.Die Diskussionen ermöglichten es dem Vorsitzenden der Agrarverhandlungen Arbeitsdokumente zu verfassen,in denen die Positionen der Mitgliedstaaten beschrieben werden.Die Mitglieder versuchten,die Arbeiten bis Ende April,dem von den Ministern für die meisten Themen festgesetzten Termin,bestmöglich voranzubringen,aber ohne Erfolg.Die Frist wurde daher bis Juni verlängert.
Marktzutritt: Die Diskussionen betrafen vor allem die Behandlung der sensiblen Produkte.Parallel dazu wurden die Forderungen der Entwicklungsländer erfolgreich eingebracht.So wurden u.a.die Fragen bezüglich Auswahl der Spezialprodukte,Inhalt des Sonderschutzmechanismus sowie Bezeichnung und Behandlung tropischer Produkte aufbereitet.Praktisch unverändert blieben hingegen die Fragen des «Capping» der Zollansätze (absolute Höchstgrenze) und der Anzahl und Behandlung sensibler Produkte.Kurz vor dem Ministertreffen im Juni wurde ersichtlich,dass auf der Ebene der Verhandlungsteilnehmer niemand Zahlen zu nennen vermochte und diese Aufgabe daher den Ministern oblag.
■ Ministerkonferenz im engeren Rahmen in Genf (29.Juni–1.Juli 2006)
Was als entscheidende Etappe der Doha-Runde geplant war,wurde zu einer freundlichen Zusammenkunft von Ministern,denen es an Flexibilität mangelte.Die in der Vorwahlphase vom Kongress völlig blockierten USA konnten,vor allem beim Agrardossier, in keiner Weise von ihrer Position abweichen.Desgleichen gaben die EU und die G20 der grossen Exportländer in keinem Punkt nach.Das Ministertreffen wurde früher als vorgesehen und ohne jegliches Resultat beendet.Der Generaldirektor erklärte den Notstand und kam der Bitte der Mitgliedländer nach,die Rolle eines Katalysators zu spielen und zu versuchen,in bilateralen Treffen Kompromisse zu erzielen.Dies gelang ihm jedoch nicht und führte deshalb zum Unterbruch der WTO-Runde.
3.INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 223
Am wenigsten entwickelte Länder
Am 15.Juni 2006 genehmigte der Nationalrat einstimmig das Bundesgesetz zur Änderung des Bundesbeschlusses vom 9.Oktober 1981 über die Gewährung von Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer (Zollpräferenzenbeschluss) (SR 632.91, http://www.admin.ch/ch/d/ff/2006/2963.pdf).Er beschloss damit,die Befristung der Geltungsdauer des Beschlusses auf den 28.Februar 2007 aufzuheben.
Im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems (APS),eröffnete der Bundesrat am 18.Juli 2006 bei den Zollexperten eine Vernehmlassung zur Revision der Verordnung vom 29.Januar 1997 über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer (Zollpräferenzenverordnung;SR 632.911).Die Revision umfasst die folgenden Punkte:
–Abschaffung aller Zölle zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder (LDC) auf den 1.März 2007;

–Ausdehnung der den LDC gewährten Präferenzzölle auf die stark verschuldeten armen Länder (HIPC) – Côte d’Ivoire,Kongo und Kirgistan – unter dem Vorbehalt, dass sie gemäss GATT-Abkommen (Ermächtigungsklausel) zulässig sind;
–Annullierung von Präferenzzöllen für fortgeschrittene Entwicklungsländer oder einzelne Produkte aus diesen Ländern (teilweise Abstufung).
Im Dezember 2005,an der 6.Ministerkonferenz der WTO in Hongkong,verpflichteten sich die Mitglieder,ab 2008 oder spätestens zu Beginn der Umsetzungsperiode eines allfälligen Doha-Abkommens den LDC einen zoll- und kontingentsfreien Marktzutritt für mindestens 97% der Tariflinien zu gewähren.
Die Schweiz hat in den Jahren 2002 und 2004 bereits zwei Etappen des Zollabbaus zugunsten der LDC realisiert.Die restlichen Zölle der Tarifkapitel 1 bis 24 belaufen sich noch auf 0–45% des ordentlichen Ansatzes.Bisher ist der Anteil der Einfuhren aus LDC gering.Er beträgt lediglich 0,12% unserer Importe.Die dritte Etappe vom (voraussichtlich) März 2007 wurde oben erwähnt.Zwei Produkte werden vom Zollabbau bis zu diesem Datum ausgeschlossen sein:Zucker (vollständige Liberalisierung,koordiniert mit dem Zeitplan der EU,für Juli 2009 vorgesehen) und Bruchreis (ebenfalls koordiniert mit der EU im September 2009).
Freihandelsabkommen mit Ländern ausserhalb der EU
Der schleppende Verlauf der WTO-Verhandlungen hat schon im Berichtsjahr 2005 dazu geführt,dass viele Länder parallel die Verhandlungen über bilaterale Freihandelsabkommen intensiviert haben.Die Schweiz ist im weltweiten Vergleich eine relativ kleine Wirtschaft und deshalb noch mehr darauf angewiesen,für ihre Exportwirtschaft (Waren und Dienstleistungen) auch auf aussereuropäischen Märkten besseren Zutritt und Sicherheit zu erlangen oder mindestens sich nicht durch andere Konkurrenten verdrängen zu lassen.Zurzeit bestehen 14 Freihandelsabkommen neben den bilateralen Abkommen mit der EU.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 224
Am 15.Dezember 2005 wurde ein umfassendes Freihandelsabkommen mit Südkorea unterzeichnet.Dieses Abkommen ist auf den 1.September 2006 in Kraft getreten.Das Freihandelsabkommen umfasst den Handel mit Industrieprodukten (einschliesslich verarbeitete Landwirtschaftsprodukte sowie Fisch und andere Meeresprodukte),den Handel mit Dienstleistungen,das Geistige Eigentum,das öffentliche Beschaffungswesen und den Wettbewerb.Die Schweiz,Liechtenstein und Island haben mit Korea zusätzlich zum Freihandelsabkommen ein Investitionsabkommen abgeschlossen. Dieses umfasst den Marktzutritt für neue Investitionen und den Schutz getätigter Investitionen.Es wird das bestehende bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und Korea von 1971 ablösen.Der Handel mit unverarbeiteten Landwirtschaftsprodukten wird in Landwirtschaftsabkommen geregelt,welche die einzelnen EFTA-Staaten und Korea bilateral abgeschlossen haben,um den Besonderheiten der Landwirtschaftsmärkte und -politiken der verschiedenen EFTA-Staaten Rechnung zu tragen.Die mit Korea abgeschlossenen Abkommen verbessern auf breiter Basis den Marktzutritt bzw.die Rechtssicherheit für die schweizerischen Exporte (Waren und Dienstleistungen) und gewährleisten die Zulassung und die Nutzung von Investitionen sowie den Schutz für Rechte an Geistigem Eigentum.Sie erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft auf dem koreanischen Markt nicht nur,weil damit Diskriminierungen abgewendet werden,die sich aus bestehenden und künftigen Präferenzabkommen Koreas mit anderen Partnerstaaten ergeben.Ein Wettbewerbsvorteil ergibt sich auch daraus,dass die EFTA-Staaten auf dem koreanischen Markt präferenziellen Zugang erhalten,ohne dass dies zurzeit für ihre Hauptkonkurrenten aus der EU,den USA und Japan der Fall ist.Korea hat bisher Freihandelsabkommen mit Chile und Singapur abgeschlossen und steht mit den ASEAN-Staaten,Japan und Kanada in Verhandlungen.
Mit der südafrikanischen Zollunion SACU (Botsuana,Lesotho,Namibia,Südafrika und Swasiland) konnten die Verhandlungen im August 2005 erfolgreich beendet werden. Es handelt sich um ein reines Warenhandelsabkommen,welches sowohl die Industrie (inkl.verarbeitete Landwirtschaftsprodukte,Fisch und andere Meeresprodukte) als auch unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse umfasst.Mangelnde gesetzliche Grundlagen in verschiedenen SACU-Staaten verunmöglichten ein umfassendes Freihandelsabkommen.Besonders herausfordernd war,dass die EFTA-Staaten zum ersten Mal mit einer Zollunion bestehend aus fünf Mitgliedländern mit sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Niveaus (Lesotho zählt zu den ärmsten Entwicklungsländern) und unterschiedlichen Rechtsformen (Republiken und Königreiche) verhandelten.Dadurch waren auch die Prozesse zur Unterzeichnung und Ratifizierung ziemlich zeitraubend. Mit einem Inkrafttreten des Abkommens wird im Laufe des Jahres 2007 gerechnet.
Mit folgenden Partnerländern sind Verhandlungen im Gang oder geplant:Kanada, Ägypten,Thailand,Algerien,Golf-Kooperationsrat (Kuwait,Katar,Oman,Saudi-Arabien, Bahrain,Vereinigte arabische Emirate),Japan,Indonesien,Mercosur,Malaysia,Syrien, Ukraine,Russland (nach WTO-Beitritt),Serbien und Montenegro.
3.INTERNATIONALE ASPEKTE 3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 225
■ Revision des PSE-Indikators
OECD
Der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) berechnete PSE-Indikator (Producer Support Estimate) schätzt den jährlichen monetären Transfer vom Steuerzahler und Konsumenten zum landwirtschaftlichen Produzenten. Der PSE der Schweiz setzt sich zusammen aus Marktpreisstützung,Absatzförderung, Direktzahlungen und Beiträgen zur Grundlagenverbesserung sowie den Grenzschutz. Der länderspezifische PSE zeigt den prozentualen Anteil des Produktionswertes auf,der die Landwirtschaft eines bestimmten Landes indirekt oder direkt von den Konsumenten und Steuerzahlern (und nicht über den Markt) erhält.Mit einem PSE von 68% für das Jahr 2005 führt die Schweiz die Rangliste der OECD-Länder an.Der güterspezifische PSE schätzt den Anteil des Steuerzahler- und Konsumententransfers am Produktionswert eines bestimmten Gutes und Landes.Bei der Milch beispielsweise betrug dieser Wert 1986 in der Schweiz rund 87% und ist bis heute auf knapp 68% gefallen.Der PSE-Index,der jährlich im Monitoring- und Evaluationsbericht der OECD veröffentlicht wird,gilt weltweit als einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren im Agrarsektor und erhält dementsprechend hohe Medienpräsenz.Als Mass der Agrarstützung interessiert der PSE nicht nur die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerungsschicht und Politiker,er wird auch als Argumentationsinstrument in der Diskussion über eine Welthandelsliberalisierung verwendet.
Seit mehreren Jahren arbeitet die OECD an einer Revision der PSE-Klassifizierung, welche die verschiedenen Stützungsmassnahmen der Länder in Kategorien einteilt.Ziel dieser Revision ist es,die von den Mitgliedländern durchgeführten Agrarreformen bzw. die Tendenz weg von der gekoppelten Marktpreisstützung hin zu entkoppelten Massnahmen transparenter und differenzierter darstellen zu können.Hierbei wird zwar die PSE-Klassifizierung revidiert,die Berechnungsmethodik und somit der Endwert des länderspezifischen PSE werden sich aber unwesentlich verändern.Beim güterspezifischen PSE steht die Frage im Zentrum,welche der Stützungsmassnahmen in Zukunft auf die Produkte aufgeteilt werden sollen bzw.dürfen.Je entkoppelter die Stützungsmassnahme,desto willkürlicher wird die Aufteilung der Geldsumme auf die verschiedenen Güter und desto grösser die Gefahr der Fehlinterpretation des Indikators.Bei dieser Frage scheiden sich die Meinungen der OECD-Experten.Während einige OECDMitgliedländer entsprechend der gegenwärtigen Methodik alle Stützungsmassnahmen mittels eines Schlüssels auf die Güter aufteilen wollen,erachtet eine zweite Gruppe es wissenschaftlich nur dann für vertretbar,wenn lediglich die direkt zuteilbaren Stützungen (z.B.Zoll oder Zuckerrübenbeiträge) in den produktspezifischen PSE einfliessen.Je nach Ausgang der Diskussion wird sich der produktspezifische PSE in starkem Ausmass verändern.Ob und wann der revidierte PSE im Monitoring- und Evaluationsbericht eingeführt wird,ist zurzeit noch unklar.
3.1 INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN 3 226
3.2Internationale Vergleiche
Im vorliegenden Kapitel wird ein internationaler Vergleich der Produzenten- und Konsumentenpreise vorgenommen.Die Stückkosten der Produktionsfaktoren sind, ausser im Falle von Gerste und Mais,in diesen Vergleich nicht eingeschlossen.

Wozu ein internationaler Preisvergleich?
Ein internationaler Preisvergleich erlaubt eine Standortbestimmung.Er lässt die Unterschiede bei den Produktionskosten der miteinander verglichenen Länder erkennen und beleuchtet die Gründe für den Einkaufstourismus über die Landesgrenzen.Er dient der Festlegung der an der Grenze zu treffenden Massnahmen (möglicher Zollabbau im Rahmen von Freihandelsabkommen).Schliesslich führt er den Steuerzahlern auch vor Augen,dass die Schweizer Landwirtschaft enorme Anstrengungen unternimmt,um im Preiswettbewerb bestehen zu können.
Die Preise sind zwar ein wichtiges Element der Wettbewerbsfähigkeit,doch andere Faktoren sind für den Erfolg eines Produkts in einem bestimmten Marktsegment ebenfalls entscheidend:Qualität,Sicherheit und Image des Produkts,Werbung,Verteilernetz,Absatzkraft und Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Erzeugnis.
■■■■■■■■■■■■■■■■
3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 227
Methode und Definition

Der internationale Preisvergleich erfolgt auf Grund identischer,ähnlicher oder wichtiger Märkte.Damit sind jedoch gewisse Schwierigkeiten verbunden wie die Auswahl der Produkte,die Verfügbarkeit der Daten,die Relevanz der Messgrössen,die unterschiedlichen Produktions- und Verkaufsformen oder die währungsspezifischen Einflüsse.Bei den in diesem Kapitel verwendeten Preisen handelt es sich um:
–nationale Durchschnittswerte:Minimale bzw.maximale Werte können je nach Region oder Verwertung des Erzeugnisses (Produzentenpreis) nicht ersichtlich sein.
–Grössenordnungen:Aus Gründen der Repräsentativität unterscheiden sich die Erzeugnisse (Qualitäts-,Labelprodukte),Vermarktungsvoraussetzungen (Menge,Vermarktungsgrad),Absatzkanäle und Berechnungsmethoden des Durchschnittswertes von Land zu Land.
–Bruttopreise:
–Es handelt sich um die auf dem Markt beobachteten Preise (im Rahmen der Agrarpolitik jedes einzelnen Landes).Die Produzentenpreise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.Diese ist jedoch in den Konsumentenpreisen eingeschlossen,da es sich um eine vom Konsumenten zu leistende Abgabe handelt.
–Sofern nichts anderes vermerkt ist,sind die Preise nicht nach der unterschiedlichen Kaufkraft der beobachteten Länder bereinigt.Siehe hierzu die Publikationen von OECD (www.oecd.org/std/ppp),Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) und UBS,(http://www.ubs.com/1/g/career_candidates/experienced_professionals. html?newsId=103136)
Es stehen also nicht die absoluten Werte,sondern die Entwicklungen im Verlaufe der Zeit im Vordergrund.
3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 228
Die aus dem Verkauf eines «Standardwarenkorbes» erzielten Einnahmen der Produzenten dienen als Vergleichsgrundlage.Der Standardwarenkorb setzt sich aus der durchschnittlichen Produktion (1998–2000) der Schweiz von 15 der 17 landwirtschaftlichen Erzeugnisse zusammen,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleichs sind.Da die Preisstatistik für Zuckerrüben und Raps der USA nicht verfügbar war,sind diese beiden Produkte nicht im «Standardwarenkorb» enthalten.Seine genaue Zusammensetzung ist am Ende der Tabelle 53b im Anhang aufgeführt.Der Warenkorb entspricht 3,2 Mio.t Milch,2,7 Mio.Schweinen,35,5 Mio.Poulets usw.Die schweizerische Struktur wird folglich auf die verglichenen Länder übertragen.
Die Preise der EU (EU-4/6) beziehen sich auf die vier Nachbarstaaten.Das fünfte und das sechste Land sind die Niederlande und Belgien.Sie werden für jene Produkte berücksichtigt,bei denen sie hohe Produktionsvolumen ausweisen.Der Durchschnittspreis für die EU-4/6 berechnet sich aus dem Produktionsvolumen 1995/2001 der betreffenden Länder.Die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes und das Gewicht der Länder der EU-4/6 sind als fix über die Zeit angenommen,denn es sollen nur die Preisschwankungen dargestellt werden.
Wie ist der Stand der schweizerischen Agrarpreise im Vergleich zur EU und den USA?
–Würden die Landwirte der EU-4/6 oder der USA den schweizerischen Standardwarenkorb 2003/05 «ab Hof» in ihren Ländern verkaufen,erzielten sie rund die Hälfte (54% bzw.47%) der Einnahmen ihrer Schweizer Kollegen.
–Wird allerdings ein Vergleich in Kaufkraftparitäten vorgenommen,zeigt sich für die Landwirte der EU-4/6 bzw.der USA ein besseres Bild:Nach den OECD-Studien würde nämlich derselbe repräsentative Korb mit Gütern und Dienstleistungen 2003/05 in der Schweiz 100 Fr.kosten gegenüber 80 Fr.in der EU-4/6 bzw.74 Fr.in den USA.Würden die Landwirte der EU-4/6 bzw.der USA den schweizerischen Standardwarenkorb in ihrem eigenen Land verkaufen,verfügten sie über 68% resp. 64% der Kaufkraft ihrer Schweizer Kollegen.
–Es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Ländern:Der Erlös des «Standardwarenkorbes» entspricht in Italien 65%,in Deutschland 54%,in Frankreich 54% und in Österreich 51% des Schweizer Preises 2003/05.
–Unterschiedliche Entwicklungen lassen sich auch bei den einzelnen Produkten feststellen:Der Preis der Ackerbauprodukte wie Weizen (30% des schweizerischen Preises),Gerste (35%),Raps (42%) und Kartoffeln (49%) bewegt sich 2003/05 in der EU-4/6 auf einem ausgesprochen tiefen Niveau.Eine Ausnahme bilden die in der EU kontingentierten Zuckerrüben (52%).Im Gegensatz zu diesen Erzeugnissen erreicht die Milch,die zurzeit noch kontingentiert ist,in der EU-5 einen ziemlich hohen Preis (63%).
–Im Vergleich «Land-Produkt» zeigen sich folglich noch viel grössere Abweichungen. Während 2003/05 in Frankreich Birnen zu 96% des schweizerischen Preises verkauft wurden,erhielten belgische Bauern für Karotten lediglich 10% des Entgelts der Schweizer Landwirte.
Tabellen 52–53b,Seiten A59–A61 3.INTERNATIONALE ASPEKTE 3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 229
■ Produzentenpreise
Entwicklung der Produzentenpreise in der EU und der Schweiz
(10 kg)
(10 kg)
(100 kg)
(20 kg)
(5 kg)
(10 kg)
(10 kg)
(10 kg)
(10 kg)
(5 kg)
(Mrd./Jahr)
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV Eurostat, ZMP, Agreste
Produzentenpreise in der EU-4/6 im Vergleich zur CH
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV Eurostat, ZMP, Agreste
Zuschlag CH 1990/92 EU 1990/92 Zuschlag CH 2003/05 EU 2003/05 0 16 14 12 10 8 6 4 2
Milch
Grossrinder
Kälber
Schweine
Poulets
Eier
Weizen
Gerste
Körnermais
Zuckerrüben
Kartoffeln
Birnen
Karotten
Zwiebeln
Tomaten
Warenkorb
Fr. 1990/92
0 100 90 80 70 60 40 50 30 20 10
(10 kg)
(kg SG)
(kg SG)
(kg SG)
(2 kg LG)
(20 Stck)
(10 kg)
Raps
Äpfel
2003/05
Milch Grossrinder Kälber Schweine Poulets Eier Weizen Gerste Körnermais Zuckerrüben Kartoffeln Raps Äpfel Birnen Karotten Zwiebeln Tomaten Warenkorb Index (CH = 100) 3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 230
Nähern sich die schweizerischen Agrarpreise denjenigen in der EU und den USA an?
–In der Zeitspanne zwischen 1990/92 und 2003/05 gingen die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) für den Standardwarenkorb nicht nur in der Schweiz (–25%), sondern auch im EU-Raum (–20%) zurück.Die niedrigeren Preise im EU-Raum lassen sich nicht nur durch die Agrarreformen,sondern auch durch die Schwächung des Euro erklären,der gegenüber dem Schweizer Franken 14% eingebüsst hat.
–Der relative Abstand zwischen der Schweiz und der EU hat im beobachteten Zeitraum daher nur leicht abgenommen.1990/92 betrug der Preis des Standardwarenkorbes in der EU 51% gegenüber aktuell 54% (2003/05).
–In absoluten Werten haben sich die Schweizerpreise den EU-Preisen hingegen erheblich angeglichen.Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den benachbarten EU-Ländern,die 1990/92 noch 49% (3’553 Mio.Fr.) der schweizerischen Preise betrug,sank 2003/05 auf 46% (2’484 Mio.Fr.).Die absolute Preisdifferenz zwischen der Schweiz und der EU hat sich zwischen den beiden Perioden um einen Drittel (–30%) verkleinert.
der Produzentenpreise des Warenkorbs
–Es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Ländern:Zwischen den genannten Zeitspannen reduzierte sich die absolute Preisdifferenz beim Standardwarenkorb am meisten zu Frankreich (–34%),Italien (–32%) und Deutschland (–29%),während das Preisgefälle zu Österreich (–8%) etwas weniger deutlich abnahm.
–Unterschiedliche Entwicklungen zeigen sich auch bei den einzelnen Produkten: Zwischen 1990/92 und 2003/05 reduzierte sich der absolute Abstand zwischen der EU und der Schweiz am meisten bei Raps (–71%),Eiern (–35%),Milch (–43%) und Weizen (–43%),während sich die Preisschere bei den Grossrindern (0%) unverändert hielt und bei den Zwiebeln (+70%) sogar weiter öffnete.
1990/9219971998199920002001200220032005 2004 CH EU-4/6 USA 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 100 Entwicklung
Index (CH 1990/92 = 100)
3.INTERNATIONALE ASPEKTE 3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 231
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste, U.S. Department of agriculture
■ Konsumentenpreise
–In den USA nahm die Entwicklung seit 1990/92 einen anderen Verlauf.Die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) zeigten bis 2001 eine steigende Tendenz (+28%) und verzeichneten seither bis 2003 einen Rückgang.2004 war erneut eine Erholung feststellbar.In den Jahren 2003/05 bewegten sich die Preise des Standardwarenkorbes in den USA praktisch auf dem Stand der Referenzperiode 1990/92 (+0%).Der Dollarkurs verschlechterte sich während des beobachteten Zeitraums gegenüber dem Schweizer Franken (–9%).Im Vergleich zur Referenzperiode 1990/92 verringerte sich das Preisgefälle zu den USA sowohl in relativen (Preise USA entsprachen 47% der Schweizer Preise 2003/05 gegenüber 35% im Zeitraum 1990/92) als auch in absoluten Werten (–39%).
Das Preisgefälle bei den Lebensmitteln zwischen der Schweiz und den beobachteten Ländern wurde aus dem Konsumentenpreis eines Standardwarenkorbes im Ladenverkauf inkl.MwSt.berechnet.Dieser Standardwarenkorb entspricht grob dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz pro Jahr (s.Tabelle 10) der 21 Lebensmittel,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleiches sind.«Grob»,da beispielsweise der Rinderbraten für das gesamte Rindfleischsortiment steht.Der Warenkorbentspricht 380 kg bzw.91% der 417 kg Nahrungsmittel (ohne Wein),die jährlich pro Kopf in der Schweiz konsumiert werden.Seine genaue Zusammensetzung ist am Ende der Tabelle 55 im Anhang aufgeführt.
Entwicklung der Konsumentenpreise des Warenkorbs
Quellen: BLW, BFS, ZMP (D), nationale Statistikämter F, B, A, USA, Statistikamt der Stadt Turin (I)
CH Oberer Durchschnitt EU EU-4/5 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 110 100 Unterer Durchschnitt EU USA
Tabellen 54–55,Seiten A62–A63
Index (CH 1990/92 = 100)
1990/9219971998199920002001200220032005 2004 3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 232
Zur Gruppe «EU-4» gehören wie bei den Produzentenpreisen die Nachbarländer Deutschland,Frankreich,Italien und Österreich.Für Italien dienten die Preise der Stadt Turin als Bezugsbasis.Beim Gemüse und bei fehlenden Zahlen aus den Nachbarländern wurde Belgien zusätzlich einbezogen.Zudem wurde aus den minimalen und maximalen nationalen Preisen ein oberer und unterer Durchschnittswert der EU-4/5 ermittelt.
Das Gewicht der einzelnen Länder der EU-4/6 (Ausgaben der Privathaushalte im Jahr 1998) und die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes wurden als fix angenommen,damit ausschliesslich die Preisschwankungen über die Jahre ersichtlich sind.
2003/05 machten die Konsumentenpreise eines Standardwarenkorbs in der EU-4/6 62% der in der Schweiz für denselben Warenkorb bezahlten Preise aus gegenüber den 54%,welche die Produzenten für den Standardwarenkorb erzielen.Die relativ höheren Konsumentenpreise im EU-Raum lassen sich einerseits durch die unterschiedliche Zusammensetzung des Warenkorbes auf Produzenten- und Konsumentenebene sowie andererseits durch das Ausmass der Nahrungsmitteleinfuhren und den höheren Mehrwertsteuersatz in der EU erklären (rund 7% gegenüber 2,4% in der Schweiz mit Schwankungen je nach Land und Produkt).

In der Schweiz blieben die Konsumentenpreise für den Standardwarenkorb zwischen 1990/92 und 2003/05 nahezu unverändert (+2%),während die EU eine Abnahme um 8% verzeichnete.Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den benachbarten EU-Ländern,die 1990/92 noch 31% (697 Fr.) der schweizerischen Preise betrug,stieg 2003/05 auf 38% (872 Fr.) an.Der absolute Preisabstand zwischen der Schweiz und der EU vergrösserte sich gar um einen Viertel (+25% bzw.+175 Fr.) zwischen diesen beiden Zeitspannen.
Im Gegensatz zu den Produzentenpreisen vertieft sich folglich der Graben zwischen den Konsumentenpreisen in der Schweiz und der EU.Diese Entwicklung lässt sich zumindest teilweise durch den deutlich gestiegenen Anteil der Label-Produkte (Bio, M-7,Coop,Natura Plan) insbesondere beim Fleisch erklären.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bleiben aber beträchtlich:Während in der EU der Zucker und in Italien (Turin) die Konsummilch mehr kosten als in der Schweiz,sind die Schweinekoteletts in der EU nur halb so teuer.Das in der EU-4 angebotene Schweinefleisch stammt denn auch mehrheitlich aus konventionellen Züchtungen.Das in den schweizerischen Geschäften im Jahr 2001 angebotene Schweinefleisch setzte sich hingegen zu 60% aus Marken- oder Labelerzeugnissen zusammen.
Im Zeitraum 1990/92 bis 2003/05 stiegen die Konsumentenpreise (in Schweizer Franken) in den USA um 10% an,während sie in der Schweiz stabil blieben (+2%).Die Preisschere zur Schweiz hat sich somit verringert und beträgt 2003/05 noch 48% der Schweizer Preise gegenüber 51% in den Jahren 1990/92.
3.INTERNATIONALE ASPEKTE 3.2 INTERNATIONALE VERGLEICHE 3 233
Mitarbeit am Agrarbericht 2006
■ Projektleitung, Werner Harder
Sekretariat
■ Autoren
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Jacques Gerber,Simon Hasler,Katja Hinterberger,Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Wirtschaftliche Lage
Alessandro Rossi
Soziales
Esther Grossenbacher,Stefan Mann,Ruth Rossier
Ökologie und Ethologie
Brigitte Decrausaz,Anton Candinas,Esther Grossenbacher,Hans-Jörg Lehmann
■ Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Jacques Gerber
Übergreifende Instrumente
Friedrich Brand,Jean-Marc Chappuis,Emanuel Golder,Samuel Heger, Jacques Henchoz
Milchwirtschaft
Katja Hinterberger
Viehwirtschaft
Simon Hasler
Pflanzenbau
Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Direktzahlungen
Thomas Maier,Daniel Meyer,Hugo Roggo,Olivier Roux,Beat Tschumi, Martin Weber,Michael Weber
3 234
■ Übersetzungsdienste
Grundlagenverbesserung
Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
René Weber,Samuel Brunner,Willi Riedo
Forschung,Gestüt,Beratung,Berufsbildung,CIEA
Anton Stöckli,Urs Gantner,Geneviève Gassmann,Pierre-André Poncet,Roland Stähli
Produktionsmittel
Lukas Barth,Olivier Félix,Markus Hardegger
Tierzucht
Karin Wohlfender
Sektion Finanzinspektorat
Rolf Enggist
■ Internationale Aspekte
Internationale Entwicklungen
Krisztina Bende,Friedrich Brand,Jean Girardin,Gisèle Jungo,Fabian Riesen
Internationale Vergleiche
Jean Girardin
Deutsch:Yvonne Arnold
Französisch:Christiane Bokor,Pierre-Yves Barrelet,Yvan Bourquard, Giovanna Mele,Elisabeth Tschanz,Marie-Thérèse Von Graffenried, Magdalena Zajac
Italienisch:Patrizia Singaram,Floriana Dondina,Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Technische Unterstützung Hanspeter Leu,Peter Müller
235
236
ANHANG A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Anhang Tabellen Strukturen A2 Tabellen Märkte A4 Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse A14 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung A14 Ergebnisse Einzelbetriebe A16 Tabellen Ausgaben des Bundes A27 Ausgaben für Produktion und Absatz A27 Ausgaben Absatzförderung A27 Ausgaben Milchwirtschaft A28 Ausgaben Viehwirtschaft A28 Ausgaben Pflanzenbau A29 Ausgaben für Direktzahlungen A30 Ausgaben für Grundlagenverbesserung A52 Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung A58 Tabellen Internationale Aspekte A59 Rechtserlasse,Begriffe und Methoden A64 Abkürzungen A65 Literatur A67
A2 ANHANG
1 Entwicklung von Landwirtschaftsbetrieben,Landwirtschaftlicher Nutzfläche und Grossvieheinheiten Grössenklassen in ha BetriebeLandwirtschaftliche NutzflächeGrossvieheinheiten landwirtschaftlicher Nutzfläche 199020002005199020002005199020002005 AnzahlAnzahlAnzahlhahahaAnzahlAnzahlAnzahl 0-16 6293 6092 8062 8951 33694382 55061 01661 507 1-313 1904 7623 81623 8288 8617 05034 46614 75313 001 3-58 2595 3934 02532 24321 34816 08542 47327 71420 980 5-1018 83313 14911 108141 40399 05683 756209 784127 361105 828 10-1518 92013 81211 806233 888171 817147 143341 563230 628194 006 15-2012 71011 17210 188218 771193 856176 906290 523247 517227 510 20-256 6777 2447 157147 772161 311159 578173 896191 057194 761 25-303 3644 4304 64991 271121 005126 97197 680130 901141 074 30-402 6744 1684 68090 726142 266159 71387 709142 628165 937 40-508751 5911 81438 67270 50180 53432 21461 91475 289 50-705079211 16928 84952 67267 47423 17242 70758 340 70-10012720931810 37117 02125 7507 41413 29021 673 > 1005077917 80211 44413 2166 3158 0259 418 Total92 81570 53763 6271 068 4901 072 4921 065 1181 429 7591 299 5121 289 324 Quelle:BFS
Tabelle
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Strukturen
ANHANG A3
KategorieVollzeitbeschäftigteTeilzeitbeschäftigteTotal 199020002005199020002005199020002005 BetriebsleiterMänner62 72049 33944 06726 16925 38523 82188 88974 72467 888 Frauen1 4565244552 4701 8221 5343 9262 3461 989 Andere FamilieneigeneMänner21 7968 74913 32322 72918 21217 62144 52526 96130 944 Frauen14 36714 2819 79065 77047 66546 74980 13761 94656 539 FamilieneigeneTotal100 33972 89367 635117 13893 08489 725217 477165 977157 360 Familienfremde Schweizer/innenMänner12 45310 8367 9862 9495 1253 86715 40215 96111 853 Frauen3 2002 5921 8823 3044 1943 3366 5046 7865 218 Ausländer/innenMänner10 9108 0617 0081 7583 4543 03412 66811 51510 042 Frauen6631 6131 4858471 9412 0661 5103 5543 551 FamilienfremdeTotal27 22623 10218 3618 85814 71412 30336 08437 81630 664 BeschäftigteTotal127 56595 99585 996125 996107 798102 028253 561203 793188 024 Quelle:BFS
Tabelle 2 Entwicklung der Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Märkte
A4 ANHANG
Tabelle 3 Landwirtschaftliche Nutzfläche nach Nutzungsarten Produkt1990/92200320042005 1 1990/92–2003/05 hahahaha% Getreide207 292166 558161 753168 449-20.1 Brotgetreide102 84086 41987 28188 440-15.0 Weizen96 17382 42883 16684 141-13.4 Dinkel2 1601 7662 2492 432-0.5 Emmer,Einkorn 2 181163165Roggen4 4321 9901 6801 677-59.8 Mischel von Brotgetreide75542325-54.7 Futtergetreide104 45380 13974 47280 009-25.1 Weizen-2 0002 5696 340Gerste59 69539 36837 40137 821-36.0 Hafer10 4344 4163 0282 960-66.8 Mischel von Futtergetreide23834425825419.9 Körnermais 25 73921 09818 81620 779-21.4 Triticale8 34712 91312 40011 85548.4 Hülsenfrüchte2 2585 4014 9255 202129.2 Futtererbsen (Eiweisserbsen)2 1124 9894 6004 825127.5 Ackerbohnen 14631124927890.9 Lupinen-1017699Hackfrüchte36 38533 02233 60932 355-9.3 Kartoffeln (inkl.Saatgut)18 33313 57813 33512 562-28.2 Zuckerrüben14 30817 53918 62218 35227.0 Futterrüben (Runkeln,Halbzuckerrüben)3 7441 9051 6521 441-55.5 Ölsaaten18 20322 88023 22723 20326.9 Raps16 73014 87515 75116 598-5.9 Sonnenblumen -5 4784 9815 086Soja1 4742 5272 4951 51948.0 Nachwachsende Rohstoffe-1 2401 2391 287Raps -1 1231 0881 117Andere (Kenaf,Hanf,usw.)-117151170Freilandgemüse8 2508 3998 8138 8405.3 Silo- und Grünmais38 20440 38042 43343 1119.9 Grün- und Buntbrache3193 8243 5923 5001 041.8 Übrige offene Ackerfläche830168 329163 465170 21720 053.0 Offenes Ackerland311 741283 475281 303287 715-8.8 Kunstwiesen94 436122 618124 474119 49029.4 Übrige Ackerfläche3 9772 9893 0692 969-24.3 Ackerland Total410 154409 082408 846410 174-0.2 Obstbaumkulturen6 9146 5976 7336 672-3.6 Reben14 91914 92914 93714 9030.0 Chinaschilf32392382387 844.4 Naturwiesen,Weiden638 900626 446624 337624 705-2.2 Andere Nutzung sowie Streue- und Torfland7 3949 7629 4838 42624.8 Landwirtschaftliche Nutzfläche1 078 6001 067 0551 064 5741 065 118-1.2
1 provisorisch 2 separate Erfassung ab 2002 Quellen:Wein und Obstbaumkulturen:BLW;andere Produkte:SBV,BFS
1 provisorisch
2 Durchschnitt der Jahre 1990/93
3 Veränderung 1990/93–2002/05
Quellen:
Milch und -produkte:SBV (1990–98),ab 1999 TSM
Fleisch:Proviande
Eier:Aviforum
Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:SBV
Obst:Schweizerischer Obstverband,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein:BLW,Kantone
ANHANG A5 Tabelle 4 Produktion Produkt Einheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % Milch und -produkte Konsummilch t549 810494 635497 021488 412-10.3 Rahmt68 13363 99763 92764 416-5.9 Buttert38 76640 85740 66440 2734.7 Milchpulvert35 84455 53651 04850 80446.4 Käset134 400160 165162 397167 70821.6 Fleisch und Eier Rindfleischt SG130 710102 789100 308100 024-22.7 Kalbfleischt SG36 65634 12733 67932 289-9.0 Schweinefleischt SG266 360229 658227 085236 165-13.3 Schaffleischt SG5 0656 1786 5966 19124.8 Ziegenfleischt SG541475488568-5.7 Pferdefleischt SG1 2121 0311 050941-16.9 Geflügelt Verkaufsgewicht20 73332 35834 34133 36160.9 SchaleneierMio.St.6386806526573.9 Getreide Weichweizent546 733428 300528 300516 400 1 -10.2 Roggent22 97810 50011 3009 400 1 -54.7 Gerstet341 774218 000257 400232 000 1 -31.0 Hafert52 80721 50015 70015 400 1 -66.8 Körnermaist211 04790 700180 900200 600 1 -25.4 Triticalet43 94067 90082 90069 300 1 67.0 Anderet11 46910 30012 50011 400 1 -0.6 Hackfrüchte Kartoffelnt750 000458 000526 700505 000 1 -33.8 Zuckerrübent925 8671 257 3001 455 8001 409 400 1 48.4 Ölsaaten Rapst46 11445 30059 10057 000 1 16.7 Sonnenblument-17 33013 60015 200 1Anderet3 6586 0307 3204 540 1 63.0 Obst (Tafel) Äpfel t91 503 2 93 864100 755102 90010.1 3 Birnen t-16 52917 20716 251Aprikosen t3 407 2 8454 6253 355-21.7 3 Kirschen t1 818 2 1 7042 0261 5881.3 3 Zwetschgen t2 837 2 3 2282 9951 998-8.0 3 Erdbeeren t4 2635 1095 7755 69529.6 Gemüse (frisch) Karottent49 16254 08057 84455 92413.8 Zwiebelnt23 50527 93932 35732 84432.1 Knollenselleriet8 5069 5988 85210 78514.6 Tomatent21 83030 05034 93132 03548.1 Kopfsalatt18 82115 46815 59015 667-17.2 Blumenkohlt8 3315 5917 4416 461-22.0 Gurkent8 6089 1459 3039 6698.9 Wein Rotweinhl550 276486 455606 909522 415-2.1 Weissweinhl764 525483 639552 261478 988-34.0
A6 ANHANG Tabelle 5 Produktion Milchprodukte Produkt1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% Total Käse 134 400160 165162 397167 70821.6 Frischkäse4 38737 10136 82239 781763.9 Mozzarella-13 32113 33714 815Übrige Frischkäse-23 78023 48524 966Weichkäse4 8126 7796 7276 56539 Tommes1 2491 8892 1812 03462.9 Weissschimmelkäse,halb- bis vollfett1 5731 6411 3971 455-4.8 Übrige Weichkäse1 9903 2493 1493 07558.7 Halbhartkäse40 55646 65047 87849 43318.3 Appenzeller8 7258 0618 3009 188-2.4 Tilsiter7 7365 2014 4534 143-40.6 Raclettekäse9 89813 25613 11713 20433.3 Übrige Halbhartkäse14 19720 13222 00822 89852.7 Hartkäse84 62968 92770 16071 050-17.2 Emmentaler56 58834 63233 50432 180-40.9 Gruyère22 46425 70826 72027 52918.6 Sbrinz4 6592 1471 7161 563-61.2 Übrige Hartkäse9186 4408 2209 778787.4 Spezialprodukte 1 157088108795 226.7 Total Frischmilchprodukte 680 822712 834726 901740 5356.8 Konsummilch549 810494 635497 021488 412-10.3 Übrige131 012218 199229 880252 12378.2 Total Butter 38 76640 85740 66440 2734.7 Vorzugsbutter27 2007 2134 2194 192-80.9 Übrige11 56633 64436 44536 081206 Total Rahm 68 13363 99763 92764 416-5.9 Total Milchpulver 35 84455 53651 04850 80446.4 1 reiner Schafkäse und reiner Ziegenkäse Quellen:SBV (1990–98),ab 1999 TSM Tabelle 6 Verwertung der vermarkteten Milch Produkt1990/922003200420051990/92–2003/05 1 000 t Milch1 000 t Milch1 000 t Milch1 000 t Milch% Konsummilch549454456448-17.5 Verarbeitete Milch2 4902 6992 7322 7559.6 zu Käse1 5311 2951 3231 372-13.1 zu Butter35649649448137.7 zu Rahm430247247251-42.2 andere Milchprodukte173661668652281.7 Total3 0393 1523 1873 2034.7 Quellen:SBV (1990–98),ab 1999 TSM
ANHANG A7
Produkt1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% Kartoffeln Speisekartoffeln285 300162 800162 800166 200 1 -42.5 Veredlungskartoffeln114 700116 100126 700133 200 1 9.3 Saatgut35 93326 70027 50029 600 1 -22.3 Frischverfütterung225 96796 400150 100129 100 1 -44.6 Verarbeitung zu Futtermitteln146 90050 90055 70021 500 1 -70.9 Schweizer Mostäpfel und -birnen (Verarbeitung in gewerblichen Mostereien)183 006 2 122 032156 82395 768-30.8 3 Mostobst-Menge für Rohsaft182 424 2 121 845156 59795 651-30.7 3 Frisch ab Presse10 477 2 11 0399 5289 166-5.4 3 Obstwein zur Herstellung von Obstbrand3 297 2 722598162-88.2 3 Konzentratsaft165 263 2 109 044145 56881 195-31.4 3 Andere Säfte (inkl.Essig)3 387 2 1 0409035 128-20.1 3 Obst eingemaischt582 2 187226117-72.3 3 Spirituosenerzeugung aus Schweizer Äpfel und Birnen40 255 2 19 77217 18621 668-53.0 3 aus Schweizer Kirschen und Zwetschgen23 474 2 12 83413 32912 726-47.0 3 Schweizer Frischgemüse für Nährmittelherstellung Tiefkühlgemüse26 06126 47420 05924 104-9.7 Konservengemüse (Bohnen,Erbsen,Pariserkarotten)19 77612 58514 53214 354-30.1 Sauerkraut (Einschneidekabis)8 0915 3156 1235 564-30.0 Sauerrüben (Rübe)1 5351 003924898-38.7 1 provisorisch 2 Durchschnitt der Jahre 1990/93 3 Veränderung 1990/93–2002/05 Quellen: Kartoffeln:swisspatat Mostobst:BLW;Spirituosen:Eidgenössische Alkoholverwaltung Verarbeitungsgemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Tabelle 7 Verwertung der Ernte im Pflanzenbau
A8 ANHANG
Aussenhandel Produkt1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% AusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhrAusfuhrEinfuhr Milch und -produkte Milch1923 00711822 3035722 64032623 055778.9-1.5 Joghurt1 1951710 64271817 0336937 3001 877875.46 347.1 Rahm 909251 0628821 3791 0124 2753 210146.36 705.4 Butter04 1546531 751598622 0410.0-61.7 Milchpulver8 1583 26619 05440915 61738116 970545111.0-86.4 Käse62 48327 32849 59731 86650 87531 46151 70931 913-18.816.2 Fleisch,Eier und Fische Rindfleisch2807 8731 0437 4741 15910 1031 22312 610307.727.8 Kalbfleisch0916039503770972--36.5 Schweinefleisch2881 9569011 56753413 49021610 036-2.8498.0 Schaffleisch56 48906 46506 23206 073-100.0-3.6 Ziegenfleisch0403038903390254--18.8 Pferdefleisch04 60003 94504 21104 278--9.9 Geflügel1039 94266345 97147042 53372442 0646 090.09.0 Eier 031 4011524 850127 0647028 344--14.8 Fische,Krebs- und Weichtiere62031 13212934 64717336 82015737 011-75.316.1 Getreide Weizen6232 13453313 812107279 90178202 6291 145.914.4 Roggen03 05702 06606 57802 779-24.6 Gerste43644 5041738 01011226 22517214 068-77.0-41.4 Hafer13160 885646 858144 007047 408-98.3-24.3 Körnermais19460 512343121 80235379 30553376 096111.052.7 Hackfrüchte Kartoffeln9 6958 7221 01833 3901 11938 35752520 210-90.8251.4 Zucker40 882124 065218 282245 503271 611288 462302 485313 561546.1127.7 Ölsaaten Ölsaaten489134 57064272 03749983 15560379 12718.8-42.0 Pflanzliche Öle und Fette18 68057 7652 090108 6862 275105 1862 953110 957-86.987.4 Obst (frisch) Äpfel 683 1 12 169 1 1 8707 72616321 34661110 62929.9 2 2.1 2 Birnen 491 1 11 803 1 759 1352266 4803289 605-63.2 2 -27.3 2 Aprikosen 226 1 10 578 1 218 179106 34119 128-94.6 2 -21.8 2 Kirschen 256 1 1 062 1 486851 094251 561-96.6 2 12.4 2 Zwetschgen und Pflaumen 12 1 3 290 1 225 48424 42116 313-29.2 2 63.0 2 Erdbeeren 15011 023710 9444511 8967412 384-72.16.5 Trauben 2333 691935 6011334 205636 710-60.05.4 Zitrusfrüchte161135 78034125 58238125 4365123 676-84.1-8.0 Bananen8577 896372 1782873 538574 220-85.8-5.9 Gemüse (frisch) Karotten711 71007 197258 313705 877-55.4316.8 Zwiebeln8623 44405 778299 98163 401-98.685.5 Knollensellerie020602450823097-88.2 Tomaten40235 700740 922939 5214140 352-95.312.8 Kopfsalat373 95412 44312 48002 394-98.2-38.3 Blumenkohl119 98508 66909 23118 580-97.1-11.6 Gurken6517 479516 660115 712316 113-95.4-7.5 Wein (Trinkwein) Rotwein (in hl)3 4991 494 2947 0161 409 8799 9131 360 28611 7711 348 274173.4-8.1 Weisswein (in hl)7 59076 8356 474196 7938 540223 08911 651228 17517.1181.1 1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 2 Veränderung 1990/93–2002/05 Quellen: Milch und -produkte,Fleisch,Eier,Getreide,Hackfrüchte,Ölsaaten,Obst,Gemüse und Wein:OZD Zucker:réservesuisse
Tabelle 8
1 0406.1010,0406.1020,406.1090
2 0406.2010,0406.2090
3 0406.3010,0406.3090
4 0406.4010,0406.4021,0406.4029,0406.4081,0406.4089
5 0406.9011,0406.9019
6 0406.9021,0406.9031,0406.9051,0406.9091
7 0406.9039,0406.9059,0406.9060,0406.9099
ANHANG A9
Käse Produkt1990/922003200420051990/92–2003/05 tttt% Einfuhr Frischkäse 1 4 1759 1879 4159 229122.2 Reibkäse 2 233634748833216.9 Schmelzkäse 3 2 2212 2492 1922 175-0.7 Schimmelkäse 4 2 2762 1672 1512 080-6.3 Weichkäse 5 6 6285 7965 6535 783-13.3 Halbhartkäse 6 11 795 4 7724 9174 892 Hartkäse 7 7 0616 3856 921 -1.2 Total Käse und Quark27 32831 86631 46131 91316.2 Ausfuhr Frischkäse 1 252862987 166.7 Reibkäse 2 104719688-18.3 Schmelzkäse 3 8 2454 4314 8954 615-43.6 Schimmelkäse 4 083130 Weichkäse 5 301755406071 368.9 Halbhartkäse 6 54 102 7 1247 7338 959 Hartkäse 7 37 73637 52237 128 -16.1 Total Käse und Quark62 48349 59750 87551 709-18.8
Tabelle 9 Aussenhandel
Quelle:OZD
A10 ANHANG
10
Produkt1990/92200320042005 1 1990/92–2003/05 kgkgkgkg% Milch und -produkte Konsummilch 104.3781.4080.9079.10-22.9 Rahm6.438.408.308.2029.1 Butter6.205.605.605.60-9.7 Käse16.9019.9019.8019.7017.2 Frischkäse3.466.106.106.4079.2 Weichkäse1.831.901.801.701.6 Halbhartkäse5.655.705.705.600.3 Hartkäse5.966.206.206.002.9 Fleisch und Eier Rindfleisch 13.7110.1510.2310.39-25.2 Kalbfleisch 4.253.673.543.43-16.5 Schweinefleisch 29.7325.1524.8025.20-15.7 Schaffleisch 1.421.471.471.401.9 Ziegenfleisch 0.120.100.100.09-19.4 Pferdefleisch 0.750.600.630.63-17.3 Geflügel 8.0510.099.979.6923.2 Schaleneier (in St.)199183182185-7.9 Getreide Brot- und Backwaren50.7050.3050.7051.00-0.1 Hackfrüchte Kartoffeln und Kartoffelprodukte44.1742.7240.2641.00-6.4 Zucker (inkl.Zucker in Verarbeitungsprodukten) 42.3754.7856.8560.8035.7 Ölsaaten Pflanzliche Öle und Fette12.8016.1315.8516.6026.5 Obst (Tafel) Äpfel 15.26 2 13.5316.4315.13-0.4 3 Birnen -3.473.163.42Aprikosen 2.04 2 1.221.481.67-27.5 3 Kirschen 0.39 2 0.350.420.425.1 3 Zwetschgen und Pflaumen 0.91 2 1.181.001.1118.5 3 Erdbeeren 2.242.182.382.413.7 Zitrusfrüchte20.0917.0316.9016.58-16.2 Bananen11.5310.089.919.95-13.4 Gemüse (frisch) Karotten7.538.318.918.2712.8 Zwiebeln3.864.575.704.8630.7 Knollensellerie1.291.341.301.465.9 Tomaten8.469.6310.039.7015.7 Kopfsalat3.372.452.452.43-27.5 Blumenkohl2.711.932.252.02-23.7 Gurken2.972.772.802.80-6.1 Wein Rotwein (in l)31.9727.1226.3325.59-17.6 Weisswein (in l)14.4711.6611.7810.21-22.5 Wein total (in l)46.4438.7838.1135.80-19.1 1 teilweise provisorisch 2 Durchschnitt der Jahre 1990/93 3 Veränderung 1990/93–2002/05 Quellen: Milch und -produkte,Eier,Hackfrüchte,Getreide und Ölsaaten:SBV Fleisch:Proviande Obst,Gemüse und Wein:BLW
Tabelle
Pro-Kopf-Konsum
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–2002/05
3 Preise franko Schlachthof,ausgenommen Fleischschweine ab Hof,QM:Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch
4 Preis gilt nicht für Übermengen
Quellen:
Milch:BLW
Schlachtvieh,Geflügel,Eier:SBV
Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:FAT
Obst:Schweizerischer Obstverband,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
ANHANG A11
Produzentenpreise ProduktEinheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % Milch CH gesamtRp./kg104.9775.5474.6372.41-29.3 Verkäste Milch (erst ab 1999) Rp./kg-75.1673.8472.21Biomilch (erst ab 1999)Rp./kg-89.2185.4581.81Schlachtvieh 3 Kühe T3Fr./ kg SG7.825.786.626.16-20.9 Jungkühe T3Fr./ kg SG8.136.487.126.94-15.8 Muni T3Fr./ kg SG9.288.198.177.97-12.6 Ochsen T3Fr./ kg SG9.838.188.147.95-17.7 Rinder T3Fr./ kg SG8.667.898.077.94-8.0 Kälber T3Fr./ kg SG14.3912.1512.6113.20-12.1 Fleischschweine,ab 2003 QMFr./ kg SG5.834.474.544.02-25.5 Lämmer bis 40 kg,T3Fr./ kg SG15.4011.5310.2110.30-30.6 Geflügel und Eier Poulets Kl.I,ab HofFr./ kg LG3.722.722.672.60-28.4 Eier aus Bodenhaltung an GrossverbraucherFr./100 St.41.0236.0036.0638.08-10.5 Eier aus Freilandhaltung an GrossverbraucherFr./100 St.46.2142.6742.2442.08-8.4 Getreide Weizen Kl.IFr./100 kg99.3461.1357.8452.42-60.1 RoggenFr./100 kg102.3646.7643.9944.78-70.4 GersteFr./100 kg70.2445.8244.2642.24-57.3 HaferFr./100 kg71.4047.8444.6746.97-56.8 TriticaleFr./100 kg70.6945.4944.9042.66-57.4 KörnermaisFr./100 kg73.5446.3143.3142.23-59.4 Hackfrüchte KartoffelnFr./100 kg38.5536.2133.3834.30-39.8 ZuckerrübenFr./100 kg14.8411.8711.8511.77-46.7 Ölsaaten RapsFr./100 kg203.6781.6976.6076.83-74.1 SonnenblumenFr./100 kg-85.7383.7482.00Obst Äpfel:Golden Delicious IFr./ kg1.12 1 1.211.06 4 1.01 4 -8.5 2 Äpfel:Maigold IFr./ kg1.35 1 1.401.21 4 0.90 4 -17.4 2 Birnen:ConférenceFr./ kg1.33 1 1.240.98 4 1.09 4 -20.5 2 AprikosenFr./ kg2.09 1 2.802.092.3712.0 2 KirschenFr./ kg3.20 1 3.403.503.709.4 2 Zwetschgen:FellenbergFr./ kg1.40 1 1.701.552.0529.5 2 ErdbeerenFr./ kg4.775.405.605.0011.8 Gemüse Karotten (Lager)Fr./ kg1.091.371.261.3822.6 Zwiebeln (Lager)Fr./ kg0.891.061.190.9720.6 Knollensellerie (Lager)Fr./ kg1.622.222.442.3243.6 Tomaten rundFr./ kg2.422.412.372.34-1.9 KopfsalatFr./ kg2.373.663.433.6350.8 BlumenkohlFr./ kg1.852.672.132.3027.9 SalatgurkenFr./ kg1.662.202.192.1531.3
Tabelle 11
Tabelle 12
Konsumentenpreise
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–2002/05
Quellen:
Milch,Fleisch (Warenkorb aus Labelfleisch und konventionell produziertem Fleisch):BLW
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte:BLW,BFS
A12 ANHANG
ProduktEinheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % Milch und -produkte Vollmilch,pasteurisiert,verpacktFr./l1.851.531.541.54-16.9 Milchdrink,pasteurisiert,verpacktFr./l1.851.531.521.50-18.2 Magermilch UHTFr./l-1.461.401.42EmmentalerFr./ kg20.1520.8919.9319.63GreyerzerFr./ kg20.4021.0220.5420.190.9 TilsiterFr./ kg-17.8617.3417.59Camembert 45% (FiT)125 g-2.862.862.90Weichkäse Schimmelreifung150 g-3.673.673.68Mozzarella 45% (FiT)150 g-2.342.202.13Vorzugsbutter200 g3.463.193.142.95-10.6 Die Butter (Kochbutter)250 g3.442.992.962.84-14.8 Vollrahm,verpackt 1⁄2 l-4.804.504.22Kaffeerahm,verpackt 1⁄2 l-2.482.412.34Joghurt,aromatisiert oder mit Früchten180 g0.890.700.680.66-23.6 Rindfleisch Entrecôte,geschnittenFr./ kg48.3653.3955.7455.7013.6 Plätzli,EckstückFr./ kg37.5941.7343.4242.8613.5 Braten,SchulterFr./ kg26.3427.1628.5627.895.8 HackfleischFr./ kg15.0016.6517.0216.9512.5 Kalbfleisch Koteletten,geschnittenFr./ kg35.3241.3042.5844.1720.8 Braten,SchulterFr./ kg32.5635.1436.3636.3510.4 VoressenFr./ kg21.6729.7631.4631.8643.2 Schweinefleisch Koteletten,geschnittenFr./ kg19.8821.3220.4919.923.5 Plätzli,EckstückFr./ kg24.4827.7028.0025.7911.0 Braten,SchulterFr./ kg18.4319.9020.3419.598.2 Voressen,SchulterFr./ kg16.6919.2219.6018.9715.4 Lammfleisch Inland frisch Gigot ohne SchlossbeinFr./ kg26.3429.4828.7228.7510.0 Koteletten,geschnittenFr./ kg30.3237.2837.0538.4624.0 Fleischwaren Hinterschinken,Model geschnittenFr./ kg25.5629.9931.1429.6718.3 Salami Inland I,geschnittenFr./100 g3.094.004.364.4638.3 Poulets Inland,frischFr./ kg8.418.909.019.127.1 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte WeissmehlFr./ kg2.051.711.781.78-14.3 RuchbrotFr./500 g2.081.811.791.80-13.4 HalbweissbrotFr./500 g2.091.801.821.82-13.2 WeggliFr./ St.0.620.740.750.7620.6 GipfeliFr./ St.0.710.880.890.8924.9 SpaghettiFr./500 g1.661.711.701.56-0.1 KartoffelnFr./ kg1.432.162.232.2655.1 KristallzuckerFr./ kg1.651.591.591.65-2.5 SonnenblumenölFr./l5.054.304.894.81-7.6 Obst (Herkunft In- und Ausland) Äpfel:Golden DeliciousFr./ kg3.15 1 3.674.043.8221.7 2 BirnenFr./ kg3.25 1 3.693.763.5612.4 2 AprikosenFr./ kg3.93 1 6.296.176.1553.2 2 KirschenFr./ kg7.35 1 8.9710.019.8827.9 2 ZwetschgenFr./ kg3.42 1 4.363.894.4621.9 2 ErdbeerenFr./ kg8.6910.9610.5710.8324.1 Gemüse (Frischkonsum;Herkunft In- und Ausland) Karotten (Lager)Fr./ kg1.912.262.162.0212.3 Zwiebeln (Lager)Fr./ kg1.862.392.281.9518.7 Knollensellerie (Lager)Fr./ kg3.143.944.213.8527.4 Tomaten rundFr./ kg3.733.673.293.59-5.7 KopfsalatFr./ kg4.461.961.751.86-58.3 BlumenkohlFr./ kg3.584.413.634.2114.1 SalatgurkenFr./ kg2.804.453.904.1048.2
Tabelle 13
Selbstversorgungsgrad
1 inkl.Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide,jedoch ohne Ölkuchen;ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 einschliesslich Hartweizen,Speisehafer,Speisegerste und Mais
3 Äpfel,Birnen,Kirschen,Zwetschgen und Pflaumen,Aprikosen und Pfirsiche
4 Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5 einschliesslich Fleisch von Pferden,Ziegen,Kaninchen sowie Wildbret,Fische,Krusten- und Weichtiere
6 verdauliche Energie in Joules,alkoholische Getränke eingeschlossen
7 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen,Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
Quelle:SBV
ANHANG A13
Produkt1990/922002200320041990/92–2002/04 % Mengenmässiger Anteil:%%%% Brotgetreide 118827892-28.8 Futtergetreide 1 616749754.4 Getreide total 2 64594662-13.0 Speisekartoffeln101948795-8.9 Zucker4661445012.3 Pflanzliche Fette,Öle22201922-7.6 Obst 3 72766473-1.4 Gemüse55545155-3.0 Konsummilch 979798991.0 Butter 899897979.4 Käse 137114113114-17.0 Milch und Milchprodukte total110108109108-1.5 Kalbfleisch 4 979798980.7 Rindfleisch 4 93899188-3.9 Schweinefleisch 4 99959393-5.4 Schaffleisch 4 394142459.4 Geflügel 4 3743434618.9 Fleisch aller Arten 4 5 76707069-8.3 Eier und Eikonserven444747466.1 Energiemässiger Anteil 6: Pflanzliche Nahrungsmittel 43443945-0.8 Tierische Nahrungsmittel brutto 97959594-2.4 Nahrungsmittel im ganzen brutto62615660-4.8 Nahrungsmittel im ganzen netto 7 58555155-7.5 Wertmässiger Anteil Nahrungsmittel im ganzen 8 72636262-13.4
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse
A14 ANHANG
Tabelle 14 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs zu laufenden Herstellungspreisen,in 1000 Fr. Produkt1990/92200320042005 1 1990/92–2006 2 2003/05–2003/05 2006 %% Erzeugung landwirtschaftlicher Güter13 089 0239 211 18310 025 4299 365 166-27.29 083 722-4.7 Pflanzliche Erzeugung5 915 3094 203 1264 898 6804 485 017-23.44 204 651-7.2 Getreide (einschl.Saatgut)1 116 180412 827522 190470 255-58.0441 377-5.8 Weizen543 264246 403281 024259 742-51.7257 365-1.9 Gerste306 59189 537128 279106 615-64.7103 277-4.5 Körnermais153 80335 15569 89568 899-62.349 264-15.0 Sonstiges Getreide112 52241 73242 99234 999-64.531 471-21.1 Handelsgewächse261 445277 046304 230287 00210.7266 853-7.8 Ölsaaten und Ölfrüchte (einschl.Saatgut)96 23088 54696 68290 085-4.687 940-4.2 Eiweisspflanzen (einschl.Saatgut)10 28215 85514 93314 39946.514 828-1.6 Rohtabak16 94523 89919 91622 83031.120 184-9.1 Zuckerrüben136 590144 352168 437154 73414.1139 149-10.7 Sonstige Handelsgewächse1 3984 3944 2624 954224.64 7524.7 Futterpflanzen1 833 6231 072 5421 523 3401 307 789-29.01 001 450-23.0 Futtermais210 597117 426156 519126 891-36.6108 571-18.7 Futterhackfrüchte31 76111 96411 3859 188-65.97 369-32.1 Sonstige Futterpflanzen1 591 264943 1521 355 4361 171 710-27.3885 510-23.4 Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus1 237 6051 331 7271 328 7441 289 9686.41 277 171-3.0 Frischgemüse387 355548 192520 112510 12035.8513 622-2.4 Pflanzen und Blumen850 250783 535808 632779 848-7.0763 549-3.4 Kartoffeln (einschl.Pflanzkartoffeln)276 669181 001170 617171 075-37.0156 145-10.4 Obst701 314524 795606 600518 211-21.6578 9805.3 Frischobst323 630311 041351 263297 116-1.2326 4812.1 Weintrauben377 683213 754255 337221 095-39.1252 4999.8 Wein465 258386 078420 537410 524-12.8453 19911.7 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse23 21417 11022 42230 1930.129 47626.8 Tierische Erzeugung7 173 7145 008 0575 126 7494 880 149-30.24 879 071-2.5 Rinder1 743 6691 048 5871 155 9561 120 569-36.41 177 9386.3 Schweine1 517 1881 062 8521 078 964971 744-31.6966 370-6.9 Einhufer15 0026 5247 0083 819-61.42 944-49.1 Schafe und Ziegen62 47155 00354 84150 112-14.748 275-9.5 Geflügel180 626200 539209 669196 10811.9178 445-11.7 Sonstige Tiere32 12917 46918 78314 081-47.814 364-14.4 Milch3 396 1492 420 6902 414 1662 336 195-29.62 304 040-3.6 Eier211 437186 866177 526179 538-14.2178 750-1.4 Sonstige tierische Erzeugnisse15 0459 5279 8367 983-39.47 945-12.8 Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen425 198636 129655 379649 961--638 121-1.4 Landwirtschaftliche Dienstleistungen425 198596 166618 020622 36144.0628 0582.6 Verpachtung von Milchkontingenten039 96337 35927 600--10 063-71.2 Landwirtschaftliche Erzeugung13 514 2219 847 31210 680 80810 015 127-24.79 721 843-4.5 Nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten (nicht trennbar)355 464267 004269 897271 431-24.2287 1146.6 Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse276 878171 745193 203190 382-33.1197 2886.6 Sonstige nicht trennbare Nebentätigkeiten (Güter und Dienstleistungen)78 58695 25976 69481 0497.389 8266.5 Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs13 869 68610 114 31610 950 70510 286 558-24.710 008 957-4.2 1Provisorisch,Stand 13.9.2006 2Schätzung,Stand 13.9.2006 Geringe Abweichungen gegenüber Originaldatenbank des BFS sind wegen Rundung möglichQuelle:BFS
ANHANG A15 Tabelle 15 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung zu laufenden Preisen,in 1 000 Fr. Produkt1990/92200320042005 1 1990/92–2006 2 2003/05–2003/05 2006 %% Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs 13 869 68610 114 31610 950 70510 286 558-24.710 008 957-4.2 Vorleistungen insgesamt6 627 4036 090 6966 422 4156 219 501-5.85 995 577-4.0 Saat- und Pflanzgut346 577319 567299 040317 306-10.0317 8721.9 Energie,Schmierstoffe334 723385 041397 289424 02520.1445 61210.8 Dünge- und Bodenverbesserungsmittel250 334169 438182 899181 630-28.9188 0175.6 Pfanzenbehandlungs- und Schädlingbekämpfungsmittel138 587127 863125 684126 012-8.7126 445-0.1 Tierarzt und Medikamente156 121170 519170 046179 54611.0180 4684.1 Futtermittel3 654 3542 656 5542 939 9372 701 189-24.32 441 929-11.7 Instandhaltung von Maschinen und Geräten353 833436 734461 835470 93429.0470 2823.0 Instandhaltung von baulichen Anlagen119 443186 126196 391192 54560.5197 1022.8 Landwirtschaftliche Dienstleistungen425 198636 129655 379649 96152.2638 121-1.4 Sonstige Waren und Dienstleistungen848 2321 002 725993 915976 35316.8989 729-0.1 Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen7 242 2834 023 6204 528 2904 067 057-41.94 013 380-4.6 Abschreibungen2 014 6341 919 0861 938 7001 975 048-3.52 003 5743.0 Ausrüstungsgüter1 013 2171 033 0311 057 2751 075 6134.21 079 1262.3 Bauten915 779769 936764 117777 118-15.9801 0224.0 Anpflanzungen82 09598 32696 87599 07819.599 0561.0 Sonstige3 54317 79320 43323 239478.324 37018.9 Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen5 227 6492 104 5342 589 5902 092 009-56.72 009 806-11.2 Sonstige Produktionsabgaben43 606335 258307 857308 520627.5311 040-1.9 Sonstige Subventionen (produktunabhängige)878 2112 693 7032 717 3002 681 672207.22 687 370-0.4 Faktoreinkommen6 062 2544 462 9794 999 0334 465 161-23.44 386 136-5.5 Arbeitnehmerentgelt1 233 8401 150 5491 218 5241 215 193-3.21 211 1351.4 Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen4 828 4143 312 4303 780 5093 249 968-28.63 175 001-7.9 Gezahlte Pachten192 569200 441200 071200 6604.1200 7400.2 Gezahlte Zinsen552 714326 225299 453303 422-44.0305 524-1.3 Empfangene Zinsen 0000--0-Nettounternehmenseinkommen 3 4 083 1312 785 7643 280 9852 745 886-28.12 668 737-9.2 1 Provisorisch,Stand 13.9.2006 2 Schätzung,Stand 13.9.2006 Geringe Abweichungen gegenüber Originaldatenbank des BFS sind wegen Rundung möglichQuelle:BFS
Tabelle 16
Betriebsergebnisse:Alle Regionen
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Agroscope
A16 ANHANG
MerkmalEinheit1990/9220022003200420052002/04–2005 % ReferenzbetriebeAnzahl4 302 2 379 2 663 3 077 3 135 15.8 Vertretene BetriebeAnzahl62 921 51 421 50 516 50 976 50 916 -0.1 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha16.06 19.38 19.10 19.25 19.75 2.6 Offene Ackerflächeha4.90 5.25 4.76 4.84 5.16 4.2 Arbeitskräfte BetriebJAE1.88 1.65 1.62 1.63 1.63 -0.2 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.39 1.28 1.24 1.25 1.24 -1.3 Kühe totalAnzahl12.9 13.9 13.6 13.5 13.8 1.0 Tierbestand totalGVE23.2 24.6 22.9 23.1 23.4 -0.6 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.606 321 734 566 749 781 771 195 777 034 3.3 davon:Umlaufvermögen totalFr.116 932 133 572 133 220 135 366 134 727 0.5 davon:Tiervermögen totalFr.60 662 43 507 46 012 48 205 50 444 9.9 davon:Anlagevermögen totalFr.428 727 557 487 570 549 587 624 591 862 3.5 davon:Aktiven BetriebFr.558 933 692 767 702 760 726 323 733 817 3.8 Fremdkapitalquote%43 41 43 44 43 0.8 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.19 808 12 880 10 383 11 028 8 694 -23.9 Erfolgsrechnung RohertragFr.184 762 194 365 203 189 215 341 210 986 3.3 davon:DirektzahlungenFr.13 594 45 630 47 046 47 485 48 745 4.3 SachkostenFr.91 735 117 279 123 272 128 875 130 139 5.7 BetriebseinkommenFr.93 027 77 086 79 917 86 466 80 847 -0.4 PersonalkostenFr.13 775 11 661 11 978 13 081 13 548 10.7 SchuldzinsenFr.11 361 8 411 7 309 7 095 6 941 -8.7 PachtzinsenFr.5 069 5 514 5 601 5 818 6 084 7.8 FremdkostenFr.121 941 142 865 148 160 154 868 156 712 5.4 Landwirtschaftliches EinkommenFr.62 822 51 500 55 029 60 472 54 274 -2.5 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.16 264 18 577 21 210 21 557 22 172 8.4 GesamteinkommenFr.79 086 70 077 76 238 82 030 76 446 0.4 PrivatverbrauchFr.59 573 63 237 62 896 66 440 66 954 4.3 EigenkapitalbildungFr.19 513 6 840 13 343 15 590 9 493 -20.4 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.46 914 43 695 47 580 51 261 47 336 -0.4 Cashflow 3 Fr.44 456 41 177 45 285 46 392 41 580 -6.1 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %95 94 95 91 88 -5.7 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %66 66 69 66 64 -4.5 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %52 41 45 46 41 -6.8 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %26 18 23 25 21 -4.5 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %10 22 17 14 20 13.2 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 20 15 14 17 4.1 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE49 473 46 648 49 356 53 174 49 737 0.0 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha5 796 3 977 4 185 4 491 4 093 -3.0 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%16.7 11.1 11.4 11.9 11.0 -4.1 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %0.8 -2.9 -2.3 -1.6 -2.5 10.3 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-2.2 -7.0 -5.9 -4.7 -6.2 5.7 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE31 025 30 262 35 886 39 676 36 687 4.0 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE29 465 27 420 33 356 36 704 33 833 4.1 (Median)
(1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
Reckenholz-Tänikon ART
Tabelle 17
Betriebsergebnisse:Talregion*
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion:Ackerbauzone plus ÜbergangszonenQuelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A17
MerkmalEinheit1990/9220022003200420052002/04–2005 % ReferenzbetriebeAnzahl2 356 1 006 1 219 1 435 1 426 16.9 Vertretene BetriebeAnzahl29 677 23 072 22 533 23 059 23 244 1.6 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha16.66 20.68 19.79 20.07 20.64 2.3 Offene Ackerflächeha8.34 9.82 8.77 8.88 9.38 2.4 Arbeitskräfte BetriebJAE2.05 1.78 1.68 1.70 1.68 -2.3 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.36 1.25 1.19 1.21 1.19 -2.2 Kühe totalAnzahl12.8 13.8 13.7 13.7 13.8 0.5 Tierbestand totalGVE22.9 25.1 23.7 24.0 24.0 -1.1 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.706 406 852 833 849 670 866 584 873 507 2.0 davon:Umlaufvermögen totalFr.149 871 168 801 160 321 161 665 165 542 1.2 davon:Tiervermögen totalFr.61 461 44 560 46 513 48 325 49 315 6.1 davon:Anlagevermögen totalFr.495 074 639 472 642 837 656 594 658 649 1.9 davon:Aktiven BetriebFr.642 757 797 415 793 919 814 884 819 652 2.2 Fremdkapitalquote%41 41 43 44 42 -1.6 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.23 633 14 923 11 760 12 331 9 830 -24.4 Erfolgsrechnung RohertragFr.225 249 242 450 247 188 263 974 254 733 1.4 davon:DirektzahlungenFr.7 248 40 791 40 265 41 563 42 994 5.2 SachkostenFr.110 193 143 609 150 032 156 663 156 528 4.3 BetriebseinkommenFr.115 056 98 841 97 157 107 311 98 205 -2.9 PersonalkostenFr.20 784 17 799 16 905 18 517 19 255 8.5 SchuldzinsenFr.13 463 10 147 8 717 8 450 8 006 -12.1 PachtzinsenFr.7 015 7 493 7 405 7 729 8 248 9.4 FremdkostenFr.151 456 179 048 183 059 191 359 192 037 4.1 Landwirtschaftliches EinkommenFr.73 794 63 402 64 129 72 615 62 696 -6.0 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.16 429 16 743 20 642 20 532 21 531 11.5 GesamteinkommenFr.90 223 80 145 84 771 93 146 84 227 -2.1 PrivatverbrauchFr.67 985 71 999 70 092 73 335 73 704 2.6 EigenkapitalbildungFr.22 238 8 146 14 679 19 811 10 523 -26.0 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.56 951 50 533 51 053 56 403 50 898 -3.4 Cashflow 3 Fr.52 079 47 438 51 149 54 643 46 933 -8.1 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %92 94 100 97 92 -5.2 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %64 65 68 66 62 -6.5 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %52 41 43 46 41 -5.4 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %24 15 23 27 20 -7.7 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %12 23 18 13 21 16.7 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 21 16 15 18 3.8 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE56 050 55 395 57 708 63 131 58 546 -0.3 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha6 908 4 779 4 909 5 348 4 758 -5.1 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%17.9 12.4 12.2 13.2 12.0 -4.8 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %2.1 -1.3 -1.0 -0.2 -1.4 68.0 Eigenkapitalsrentabilität 11 %0.0 -4.4 -3.7 -2.2 -4.2 22.3 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE36 924 38 758 43 948 49 916 44 425 0.5 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE36 186 35 855 42 602 48 155 41 665 -1.3 (Median) 1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der
Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
Tabelle 18
Betriebsergebnisse:Hügelregion*
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I
Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A18 ANHANG
MerkmalEinheit1990/9220022003200420052002/04–2005 % ReferenzbetriebeAnzahl1 125 698 745 846 901 18.1 Vertretene BetriebeAnzahl17 397 13 946 14 062 14 013 13 739 -1.9 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha15.30 18.09 18.48 18.52 18.92 3.0 Offene Ackerflächeha3.08 2.85 2.82 2.77 3.05 8.4 Arbeitskräfte BetriebJAE1.81 1.54 1.58 1.54 1.55 -0.2 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.40 1.24 1.26 1.23 1.23 -1.1 Kühe totalAnzahl14.4 16.0 15.0 15.1 15.5 0.9 Tierbestand totalGVE26.0 27.9 24.8 25.3 26.1 0.4 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.553 876 685 062 716 978 739 401 739 607 3.6 davon:Umlaufvermögen totalFr.95 672 110 023 117 869 118 553 115 250 -0.2 davon:Tiervermögen totalFr.66 366 48 151 49 785 53 082 56 503 12.2 davon:Anlagevermögen totalFr.391 838 526 888 549 325 567 766 567 855 3.6 davon:Aktiven BetriebFr.516 933 650 611 674 799 698 926 705 879 4.6 Fremdkapitalquote%46 44 45 46 46 2.2 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.17 271 11 650 9 549 10 213 7 983 -23.8 Erfolgsrechnung RohertragFr.170 201 179 713 186 427 196 665 194 361 3.6 davon:DirektzahlungenFr.15 415 43 917 46 494 46 540 47 887 4.9 SachkostenFr.85 602 111 844 113 382 119 831 121 922 6.0 BetriebseinkommenFr.84 599 67 870 73 045 76 834 72 439 -0.2 PersonalkostenFr.9 943 8 446 9 488 10 005 10 531 13.1 SchuldzinsenFr.10 915 8 045 7 120 6 913 6 964 -5.4 PachtzinsenFr.3 903 5 121 4 996 5 174 5 318 4.3 FremdkostenFr.110 363 133 456 134 985 141 923 144 734 5.8 Landwirtschaftliches EinkommenFr.59 838 46 257 51 442 54 742 49 627 -2.3 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.14 544 19 369 21 671 22 167 23 277 10.5 GesamteinkommenFr.74 382 65 626 73 114 76 909 72 904 1.4 PrivatverbrauchFr.55 272 60 218 59 442 63 851 63 761 4.2 EigenkapitalbildungFr.19 110 5 408 13 672 13 058 9 143 -14.7 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.41 428 40 781 54 334 53 676 47 152 -4.9 Cashflow 3 Fr.41 445 39 152 43 742 42 906 40 053 -4.5 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %100 96 81 80 85 -0.8 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %68 68 69 66 67 -1.0 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %50 39 44 45 40 -6.3 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %30 20 26 27 23 -5.5 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %8 22 15 13 18 8.0 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 20 15 15 19 14.0 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE46 654 44 049 46 211 49 769 46 669 0.0 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha5 533 3 753 3 954 4 149 3 828 -3.1 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%16.4 10.4 10.8 11.0 10.3 -4.0 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %0.4 -3.5 -3.0 -2.3 -3.0 2.3 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-3.3 -8.5 -7.5 -6.1 -7.4 0.5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE30 335 27 817 33 209 36 197 33 778 4.2 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE29 520 25 797 30 811 34 360 31 865 5.1 (Median)
Tabelle 19
Betriebsergebnisse:Bergregion*
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion:Bergzonen II bis IV
Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A19
MerkmalEinheit1990/9220022003200420052002/04–2005 % ReferenzbetriebeAnzahl821 675 699 796 808 11.7 Vertretene BetriebeAnzahl15 847 14 403 13 921 13 904 13 933 -1.0 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha15.76 18.55 18.60 18.63 19.09 2.7 Offene Ackerflächeha0.44 0.25 0.24 0.23 0.20 -16.7 Arbeitskräfte BetriebJAE1.63 1.55 1.55 1.59 1.61 3.0 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.42 1.35 1.31 1.33 1.34 0.8 Kühe totalAnzahl11.4 11.8 11.9 11.8 11.9 0.6 Tierbestand totalGVE20.5 20.6 19.6 19.3 19.8 -0.2 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.476 486 593 049 621 232 645 041 652 996 5.4 davon:Umlaufvermögen totalFr.78 573 99 941 104 862 108 694 102 525 -1.9 davon:Tiervermögen totalFr.52 902 37 323 41 392 43 089 46 354 14.2 davon:Anlagevermögen totalFr.345 011 455 785 474 979 493 257 504 118 6.2 davon:Aktiven BetriebFr.448 089 565 949 583 451 607 061 618 171 5.6 Fremdkapitalquote%45 40 41 41 42 3.3 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.15 432 10 798 8 997 9 690 7 501 -23.7 Erfolgsrechnung RohertragFr.124 931 131 524 148 901 153 507 154 400 6.7 davon:DirektzahlungenFr.23 476 55 041 58 581 58 257 59 185 3.3 SachkostenFr.63 905 80 364 89 948 91 904 94 218 7.8 BetriebseinkommenFr.61 026 51 161 58 952 61 603 60 181 5.1 PersonalkostenFr.4 860 4 940 6 518 7 168 7 002 12.8 SchuldzinsenFr.7 918 5 984 5 221 5 029 5 143 -5.0 PachtzinsenFr.2 707 2 725 3 292 3 297 3 229 4.0 FremdkostenFr.79 390 94 013 104 979 107 398 109 593 7.3 Landwirtschaftliches EinkommenFr.45 541 37 512 43 921 46 109 44 807 5.4 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.17 853 20 748 21 662 22 645 22 151 2.1 GesamteinkommenFr.63 394 58 260 65 583 68 754 66 958 4.3 PrivatverbrauchFr.48 548 52 126 54 736 57 614 58 840 7.3 EigenkapitalbildungFr.14 846 6 133 10 847 11 140 8 118 -13.4 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.34 138 35 562 35 138 40 299 41 575 12.4 Cashflow 3 Fr.33 482 33 108 37 352 36 224 34 155 -4.0 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %98 93 106 90 82 -14.9 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %70 66 71 68 66 -3.4 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %54 42 49 48 42 -9.4 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %26 19 20 22 23 13.1 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %8 21 17 18 22 17.9 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %12 18 14 12 14 -4.5 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE37 418 33 018 37 936 38 822 37 350 2.1 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha3 874 2 758 3 170 3 306 3 152 2.4 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%13.6 9.0 10.1 10.1 9.7 -0.3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.3 -5.7 -4.4 -4.1 -4.5 -4.9 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-7.4 -11.4 -9.0 -8.5 -9.3 -3.5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE21 201 19 816 26 631 27 465 27 861 13.1 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE20 707 18 355 24 817 25 374 26 855 17.5 (Median)
Tabelle 20a
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 2003/05
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A20 ANHANG
PflanzenbauTierhaltung MerkmalEinheitMittel alleSpezial-Verkehrs-Mutter-Anderes BetriebeAckerbaukulturenmilchküheRindvieh ReferenzbetriebeAnzahl2 958 97 74 1 160 121 176 Vertretene BetriebeAnzahl50 803 3 243 3 136 17 149 2 390 3 835 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha19.37 22.22 13.18 19.45 18.98 16.53 Offene Ackerflächeha4.92 18.25 6.36 0.98 1.00 0.29 Arbeitskräfte BetriebJAE1.62 1.27 2.04 1.62 1.31 1.46 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.24 0.99 1.25 1.32 1.11 1.25 Kühe totalAnzahl13.6 3.3 2.1 17.1 16.1 7.7 Tierbestand totalGVE23.1 6.6 3.3 24.0 18.2 15.5 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.766 003 729 262 800 237 713 653 708 399 593 684 davon:Umlaufvermögen totalFr.134 438 161 599 193 068 116 352 115 009 99 727 davon:Tiervermögen totalFr.48 220 13 596 8 170 51 686 48 849 40 506 davon:Anlagevermögen totalFr.583 345 554 067 598 998 545 614 544 541 453 452 davon:Aktiven BetriebFr.720 966 667 567 739 141 674 520 666 246 550 454 Fremdkapitalquote%43 39 43 43 46 42 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.10 035 9 944 10 265 9 399 8 731 7 906 Erfolgsrechnung RohertragFr.209 839 209 644 263 602 181 353 150 403 130 460 davon:DirektzahlungenFr.47 759 44 120 26 956 49 034 63 096 59 165 SachkostenFr.127 429 121 968 145 392 107 347 88 851 80 588 BetriebseinkommenFr.82 410 87 677 118 210 74 006 61 552 49 873 PersonalkostenFr.12 869 9 327 36 199 9 235 5 736 5 730 SchuldzinsenFr.7 115 6 481 8 207 6 268 6 663 4 508 PachtzinsenFr.5 834 8 511 6 278 5 168 3 401 2 816 FremdkostenFr.153 247 146 287 196 076 128 017 104 651 93 642 Landwirtschaftliches EinkommenFr.56 592 63 357 67 526 53 336 45 752 36 818 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.21 646 28 363 22 753 18 414 32 048 25 906 GesamteinkommenFr.78 238 91 720 90 279 71 750 77 800 62 724 PrivatverbrauchFr.65 430 79 482 74 090 60 134 63 890 54 822 EigenkapitalbildungFr.12 808 12 238 16 189 11 616 13 910 7 902 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.48 726 48 784 52 111 48 431 37 534 40 625 Cashflow 3 Fr.44 419 43 501 50 643 40 050 40 303 31 428 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %91 90 98 83 109 78 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %67 65 62 67 68 66 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %44 44 44 46 43 44 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %23 19 26 22 30 21 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %17 19 13 17 13 20 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %15 18 17 14 14 16 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE50 755 69 262 57 903 45 552 46 838 34 205 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha4 256 3 952 8 981 3 806 3 244 3 016 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%11.4 13.1 16.0 11.0 9.3 9.1 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.1 0.4 -1.2 -3.2 -2.3 -5.8 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-5.6 -1.0 -4.1 -7.4 -6.3 -11.5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE37 416 54 046 45 617 33 348 33 279 23 149 (Mittelwert)
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen*2003/05
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A21
Tabelle 20b
TierhaltungKombiniert Pferde/VerkehrsMerkmalEinheitMittel alleSchafe/milch/MutterBetriebeZiegenVeredlungAckerbauküheVeredlungAndere ReferenzbetriebeAnzahl2 958 28 69 296 39 544 355 Vertretene BetriebeAnzahl50 803 1 932 1 486 4 387 761 5 547 6 937 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha19.37 12.44 11.52 26.02 22.63 19.62 21.18 Offene Ackerflächeha4.92 0.40 1.12 13.60 10.28 5.91 6.91 Arbeitskräfte BetriebJAE1.62 1.39 1.52 1.84 1.46 1.74 1.67 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.24 1.17 1.23 1.27 1.07 1.25 1.24 Kühe totalAnzahl13.6 1.6 10.3 20.0 17.1 16.0 15.2 Tierbestand totalGVE23.1 12.7 47.4 27.3 19.9 40.4 25.2 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.766 003 497 175 971 367 870 086 914 644 934 633 824 515 davon:Umlaufvermögen totalFr.134 438 79 782 150 961 172 846 167 873 141 527 143 091 davon:Tiervermögen totalFr.48 220 23 041 68 663 57 355 52 821 69 278 57 963 davon:Anlagevermögen totalFr.583 345 394 352 751 743 639 885 693 950 723 829 623 461 davon:Aktiven BetriebFr.720 966 469 510 906 848 819 360 863 081 896 401 776 722 Fremdkapitalquote%43 54 50 39 45 45 43 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.10 035 5 147 11 502 12 301 11 717 12 182 10 851 Erfolgsrechnung RohertragFr.209 839 103 022 299 836 263 276 218 526 302 451 222 202 davon:DirektzahlungenFr.47 759 40 329 34 009 48 593 65 983 46 192 47 951 SachkostenFr.127 429 66 291 211 083 157 551 133 783 197 004 134 606 BetriebseinkommenFr.82 410 36 732 88 753 105 725 84 743 105 447 87 596 PersonalkostenFr.12 869 4 604 11 182 18 259 15 315 17 213 14 706 SchuldzinsenFr.7 115 6 038 12 411 7 227 9 164 9 141 7 877 PachtzinsenFr.5 834 1 777 3 207 9 728 7 576 6 575 6 958 FremdkostenFr.153 247 78 709 237 883 192 765 165 839 229 933 164 147 Landwirtschaftliches EinkommenFr.56 592 24 314 61 953 70 510 52 688 72 518 58 055 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.21 646 39 064 23 104 14 671 32 877 17 017 21 817 GesamteinkommenFr.78 238 63 378 85 057 85 182 85 565 89 535 79 872 PrivatverbrauchFr.65 430 57 435 68 463 71 386 75 700 70 288 67 111 EigenkapitalbildungFr.12 808 5 943 16 594 13 795 9 865 19 247 12 760 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.48 726 28 484 61 826 52 971 54 188 61 996 45 876 Cashflow 3 Fr.44 419 25 611 58 029 49 586 46 380 61 839 46 853 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %91 103 98 94 93 101 104 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %67 70 66 64 61 68 68 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %44 35 44 45 40 45 42 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %23 30 23 20 22 26 25 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %17 17 12 23 11 15 17 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %15 18 20 12 27 14 16 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE50 755 26 276 58 558 57 621 57 958 60 659 52 287 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha4 256 2 965 7 708 4 064 3 750 5 377 4 135 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%11.4 7.8 9.7 12.9 9.8 11.8 11.3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.1 -8.5 -0.7 -1.0 -1.1 0.0 -2.0 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-5.6 -22.1 -4.0 -3.1 -4.0 -1.9 -5.3 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE37 416 16 287 41 184 45 924 38 370 48 153 38 021 (Mittelwert)
Tabelle 21
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Alle Regionen 2003/05
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A22 ANHANG
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl2 958 621 747 798 792 Vertretene BetriebeAnzahl50 803 12 708 12 702 12 699 12 694 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha19.37 14.56 17.25 20.63 25.03 Offene Ackerflächeha4.92 2.53 3.34 4.82 8.99 Arbeitskräfte BetriebJAE1.62 1.53 1.62 1.64 1.70 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.24 1.26 1.33 1.28 1.11 Kühe totalAnzahl13.6 10.1 13.2 15.1 16.2 Tierbestand totalGVE23.1 17.6 20.9 25.2 28.7 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.766 003 678 310 693 568 782 357 909 921 davon:Umlaufvermögen totalFr.134 438 105 796 121 901 140 325 169 765 davon:Tiervermögen totalFr.48 220 38 345 44 588 52 430 57 532 davon:Anlagevermögen totalFr.583 345 534 169 527 078 589 602 682 624 davon:Aktiven BetriebFr.720 966 636 465 655 832 734 279 857 426 Fremdkapitalquote%43 45 42 41 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.10 035 8 607 9 366 10 577 11 593 Erfolgsrechnung RohertragFr.209 839 140 902 176 144 220 258 302 149 davon:DirektzahlungenFr.47 759 39 930 44 953 50 084 56 076 SachkostenFr.127 429 103 721 110 808 129 877 165 348 BetriebseinkommenFr.82 410 37 182 65 336 90 381 136 801 PersonalkostenFr.12 869 9 242 9 301 11 574 21 366 SchuldzinsenFr.7 115 6 784 6 267 6 657 8 753 PachtzinsenFr.5 834 3 381 4 169 6 358 9 433 FremdkostenFr.153 247 123 129 130 545 154 465 204 900 Landwirtschaftliches EinkommenFr.56 592 17 774 45 599 65 793 97 249 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.21 646 32 325 19 733 17 193 17 325 GesamteinkommenFr.78 238 50 099 65 332 82 986 114 573 PrivatverbrauchFr.65 430 55 408 59 327 67 745 79 254 EigenkapitalbildungFr.12 808 -5 309 6 006 15 242 35 319 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.48 726 45 788 37 819 45 612 65 698 Cashflow 3 Fr.44 419 24 890 34 206 47 070 71 539 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %91 54 90 104 109 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %67 57 67 71 72 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %44 27 44 52 53 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %23 14 19 25 35 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %17 32 19 12 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %15 26 17 11 7 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE50 755 24 269 40 310 55 174 80 302 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha4 256 2 556 3 786 4 382 5 472 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%11.4 5.8 10.0 12.3 16.0 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.1 -8.4 -4.9 -1.3 3.9 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-5.6 -17.4 -10.1 -3.8 5.2 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE37 416 7 297 27 191 43 109 77 341 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE34 631 (Median)
Tabelle 22
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Talregion* 2003/05
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Talregion:Ackerbauzone plus ÜbergangszonenQuelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A23
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl1 360 302 357 338 362 Vertretene BetriebeAnzahl22 945 5 766 5 751 5 701 5 728 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha20.17 16.13 18.63 19.41 26.52 Offene Ackerflächeha9.01 6.68 7.45 8.40 13.53 Arbeitskräfte BetriebJAE1.69 1.62 1.69 1.65 1.79 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.20 1.24 1.29 1.19 1.07 Kühe totalAnzahl13.7 11.4 14.0 13.4 16.0 Tierbestand totalGVE23.9 19.4 22.5 24.2 29.5 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.863 254 839 496 804 154 824 983 984 524 davon:Umlaufvermögen totalFr.162 509 142 387 152 171 164 536 191 200 davon:Tiervermögen totalFr.48 051 40 389 47 270 47 396 57 212 davon:Anlagevermögen totalFr.652 694 656 720 604 713 613 051 736 111 davon:Aktiven BetriebFr.809 485 785 675 757 463 766 718 928 062 Fremdkapitalquote%43 45 40 42 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.11 307 10 702 11 087 10 940 12 501 Erfolgsrechnung RohertragFr.255 298 192 374 223 488 252 734 353 200 davon:DirektzahlungenFr.41 607 33 312 38 160 40 449 54 581 SachkostenFr.154 408 137 977 139 042 146 643 194 145 BetriebseinkommenFr.100 891 54 398 84 446 106 091 159 055 PersonalkostenFr.18 226 14 976 13 823 17 017 27 143 SchuldzinsenFr.8 391 8 773 7 063 7 483 10 239 PachtzinsenFr.7 794 4 978 6 795 7 704 11 728 FremdkostenFr.188 818 166 703 166 723 178 847 243 255 Landwirtschaftliches EinkommenFr.66 480 25 671 56 765 73 887 109 944 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.20 902 29 884 18 503 18 703 16 457 GesamteinkommenFr.87 382 55 555 75 268 92 590 126 401 PrivatverbrauchFr.72 377 63 739 67 371 74 492 83 974 EigenkapitalbildungFr.15 005 -8 184 7 898 18 098 42 427 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.52 785 46 156 44 387 46 784 73 876 Cashflow 3 Fr.50 908 28 460 40 740 52 209 82 441 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %96 63 92 113 112 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %65 53 67 68 73 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %44 23 47 51 53 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %23 14 18 24 36 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %17 31 20 11 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %16 31 15 13 6 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE59 795 33 473 49 952 64 333 89 124 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha5 005 3 377 4 534 5 482 6 006 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%12.5 6.9 11.1 13.8 17.1 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-0.8 -6.4 -3.2 0.0 5.1 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-3.3 -13.6 -7.0 -1.6 7.3 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE46 097 12 069 35 501 52 959 90 745 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE44 141 (Median)
Tabelle 23
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Hügelregion* 2003/05
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I
Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A24 ANHANG
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl831 168 206 226 231 Vertretene BetriebeAnzahl13 938 3 496 3 496 3 475 3 471 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha18.64 14.40 16.17 19.63 24.41 Offene Ackerflächeha2.88 1.80 2.41 3.21 4.12 Arbeitskräfte BetriebJAE1.56 1.50 1.55 1.56 1.63 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.24 1.20 1.32 1.29 1.15 Kühe totalAnzahl15.2 11.2 14.2 16.9 18.6 Tierbestand totalGVE25.4 19.7 22.6 27.0 32.3 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.731 995 667 162 675 494 728 688 857 427 davon:Umlaufvermögen totalFr.117 224 98 594 112 744 116 564 141 133 davon:Tiervermögen totalFr.53 123 42 815 47 156 56 534 66 106 davon:Anlagevermögen totalFr.561 648 525 752 515 594 555 591 650 189 davon:Aktiven BetriebFr.693 201 626 077 640 161 694 804 812 565 Fremdkapitalquote%46 49 44 44 46 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.9 248 7 830 8 848 9 595 10 730 Erfolgsrechnung RohertragFr.192 485 140 801 166 119 200 697 262 895 davon:DirektzahlungenFr.46 974 38 308 41 063 48 824 59 803 SachkostenFr.118 378 104 080 105 834 120 165 143 642 BetriebseinkommenFr.74 106 36 720 60 285 80 532 119 252 PersonalkostenFr.10 008 9 488 7 068 8 209 15 296 SchuldzinsenFr.6 999 6 983 6 566 6 517 7 935 PachtzinsenFr.5 162 3 598 3 803 5 178 8 092 FremdkostenFr.140 547 124 149 123 271 140 069 174 965 Landwirtschaftliches EinkommenFr.51 937 16 652 42 848 60 628 87 929 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.22 372 32 642 21 027 17 811 17 945 GesamteinkommenFr.74 309 49 294 63 875 78 439 105 874 PrivatverbrauchFr.62 351 52 696 58 693 64 206 73 907 EigenkapitalbildungFr.11 958 -3 403 5 181 14 233 31 967 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.51 721 56 316 41 348 40 758 68 492 Cashflow 3 Fr.42 234 25 464 34 257 43 700 65 677 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %82 45 86 109 97 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %67 55 68 70 75 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %43 28 42 49 54 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %26 16 19 30 37 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %15 27 19 11 4 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %16 29 20 10 5 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE47 550 24 551 38 940 51 502 73 271 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha3 977 2 556 3 727 4 103 4 888 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%10.7 5.9 9.4 11.6 14.7 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-2.8 -8.4 -5.3 -2.0 2.9 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-7.0 -18.8 -11.4 -5.2 3.6 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE34 395 7 324 25 699 39 649 67 144 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE32 345 (Median)
Tabelle 24
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Bergregion* 2003/05
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2003:2.63%;2004:2.73%;2005:2.11%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Bergregion:Bergzonen II bis IV Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ANHANG A25
sortiert nach Arbeitsverdienst MerkmalEinheitMittel1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) ReferenzbetriebeAnzahl768 161 198 203 206 Vertretene BetriebeAnzahl13 919 3 488 3 482 3 478 3 472 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzflächeha18.78 13.27 16.10 19.37 26.39 Offene Ackerflächeha0.22 0.09 0.15 0.23 0.43 Arbeitskräfte BetriebJAE1.58 1.47 1.62 1.64 1.60 davon:FamilienarbeitskräfteFJAE1.33 1.29 1.43 1.35 1.23 Kühe totalAnzahl11.8 8.5 10.7 12.7 15.6 Tierbestand totalGVE19.6 15.1 17.1 20.8 25.2 Kapitalstruktur Aktiven totalFr.639 756 546 637 579 201 653 571 780 169 davon:Umlaufvermögen totalFr.105 360 74 513 101 155 115 515 130 418 davon:Tiervermögen totalFr.43 611 33 521 38 683 46 288 56 011 davon:Anlagevermögen totalFr.490 785 438 603 439 363 491 768 593 740 davon:Aktiven BetriebFr.602 894 521 050 546 001 609 497 735 553 Fremdkapitalquote%41 41 40 40 43 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr.8 729 7 545 8 025 8 952 10 404 Erfolgsrechnung RohertragFr.152 269 103 599 130 044 163 444 212 265 davon:DirektzahlungenFr.58 674 44 561 53 599 62 058 74 554 SachkostenFr.92 023 80 064 81 475 94 531 112 108 BetriebseinkommenFr.60 246 23 536 48 569 68 913 100 157 PersonalkostenFr.6 896 4 726 5 310 7 855 9 706 SchuldzinsenFr.5 131 5 131 4 493 4 992 5 909 PachtzinsenFr.3 273 2 090 2 514 3 640 4 856 FremdkostenFr.107 323 92 011 93 792 111 018 132 578 Landwirtschaftliches EinkommenFr.44 946 11 588 36 252 52 426 79 687 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.22 153 35 710 19 929 18 132 14 789 GesamteinkommenFr.67 098 47 299 56 180 70 558 94 475 PrivatverbrauchFr.57 063 51 647 51 224 56 819 68 605 EigenkapitalbildungFr.10 035 -4 348 4 957 13 738 25 871 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr.39 004 34 515 33 210 37 806 50 532 Cashflow 3 Fr.35 910 21 686 28 238 39 609 54 190 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 %93 63 87 105 110 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 %68 61 67 71 74 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 %46 28 45 58 55 Betriebe mit beschränkter finanz.Selbständigkeit 7 %21 14 19 20 33 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 %19 40 20 11 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 %13 19 16 11 7 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr./JAE38 036 15 965 29 953 42 027 62 647 Betriebseinkommen je ha landw.NutzflächeFr./ha3 209 1 773 3 020 3 559 3 794 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb%10.0 4.5 8.9 11.3 13.6 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 %-4.3 -11.0 -7.6 -3.4 2.0 Eigenkapitalsrentabilität 11 %-8.9 -20.7 -14.2 -7.1 2.2 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE27 319 3 128 19 742 32 098 56 455 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr./FJAE25 682 (Median)
Betriebsergebnisse nach Regionen,Betriebstypen und Quartilen:1990/92–2003/05
A26 ANHANG
Tabelle 25
EinheitAlle BetriebeTalregionHügelregionBergregion Einkommen nach Regionen1990/922003/051990/922003/051990/922003/051990/922003/05 Landwirtschaftliche Nutzflächeha16.06 19.37 16.66 20.17 15.30 18.64 15.76 18.78 FamilienarbeitskräfteFJAE1.39 1.24 1.36 1.20 1.40 1.24 1.42 1.33 Landwirtschaftliches EinkommenFr.62 822 56 592 73 794 66 480 59 838 51 937 45 541 44 946 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.16 264 21 646 16 429 20 902 14 544 22 372 17 853 22 153 GesamteinkommenFr.79 086 78 238 90 223 87 382 74 382 74 309 63 394 67 098 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE31 025 37 416 36 924 46 097 30 335 34 395 21 201 27 319 EinheitAckerbauSpezialkulturenVerkehrsmilchMutterkühe Einkommen nach Betriebstypen1990/922003/051990/922003/051990/922003/051990/922003/05 Landwirtschaftliche Nutzflächeha21.23 22.22 8.92 13.18 15.30 19.45 15.32 18.98 FamilienarbeitskräfteFJAE1.08 0.99 1.29 1.25 1.42 1.32 1.20 1.11 Landwirtschaftliches EinkommenFr.60 284 63 357 67 184 67 526 53 923 53 336 36 627 45 752 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.26 928 28 363 21 555 22 753 16 044 18 414 33 558 32 048 GesamteinkommenFr.87 212 91 720 88 739 90 279 69 967 71 750 70 185 77 800 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE34 375 54 046 30 334 45 617 26 471 33 348 17 348 33 279 EinheitAnderes Pferde/Schafe/Veredlung RindviehZiegen Einkommen nach Betriebstypen1990/922003/051990/922003/051990/922003/05 Landwirtschaftliche Nutzflächeha14.20 16.53 Nur sieben12.44 9.34 11.52 FamilienarbeitskräfteFJAE1.37 1.25 Betriebe1.17 1.35 1.23 Landwirtschaftliches EinkommenFr.38 407 36 818 vorhanden24 314 86 288 61 953 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.20 570 25 906 39 064 14 614 23 104 GesamteinkommenFr.58 977 62 724 63 378 100 902 85 057 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE16 793 23 149 16 287 48 182 41 184 EinheitKombiniert Kombiniert Kombiniert Kombiniert Verkehrsmilch/MutterküheVeredlungAndere Ackerbau Einkommen nach Betriebstypen1990/922003/051990/922003/051990/922003/051990/922003/05 Landwirtschaftliche Nutzflächeha20.37 26.02 17.93 22.63 15.59 19.62 17.24 21.18 FamilienarbeitskräfteFJAE1.45 1.27 1.24 1.07 1.40 1.25 1.43 1.24 Landwirtschaftliches EinkommenFr.75 368 70 510 51 161 52 688 84 363 72 518 66 705 58 055 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.11 802 14 671 20 475 32 877 12 032 17 017 15 000 21 817 GesamteinkommenFr.87 170 85 182 71 636 85 565 96 395 89 535 81 705 79 872 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE36 420 45 924 27 456 38 370 42 927 48 153 32 732 38 021 Einheit1.Quartil 2.Quartil 3.Quartil4.Quartil (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Einkommen nach Quartilen (Arbeitsverdienst)1990/922003/051990/922003/051990/922003/051990/922003/05 Landwirtschaftliche Nutzflächeha14.68 14.56 15.30 17.25 15.78 20.63 18.47 25.03 FamilienarbeitskräfteFJAE1.36 1.26 1.49 1.33 1.42 1.28 1.27 1.11 Landwirtschaftliches EinkommenFr.26 883 17 774 52 294 45 599 69 198 65 793 102 975 97 249 Ausserlandwirtschaftliches EinkommenFr.27 789 32 325 14 629 19 733 12 064 17 193 10 557 17 325 GesamteinkommenFr.54 672 50 099 66 923 65 332 81 262 82 986 113 532 114 573 Arbeitsverdienst je FamilienarbeitskraftFr./FJAE4 367 7 297 23 592 27 191 36 016 43 109 62 665 77 341 Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tabellen Ausgaben des Bundes
Ausgaben für Produktion und Absatz
ANHANG A27
Tabelle 26 Absatzförderung Sektoren / Produkt-Markt-BereichRechnung 2004Rechnung 2005 1 Budget 2006 Fr.Fr.Fr. Milchproduktion37 027 84326 918 95029 450 196 Käse Ausland 2 18 195 88720 572 00020 350 547 Käse Inland3 241 956 Milch und Butter 3 15 590 0006 346 9509 099 649 Tierproduktion4 906 1245 262 2504 848 986 Fleisch3 540 8033 915 0003 814 762 Eier 690 000703 000593 407 Fische10 00012 5000 Lebende Tiere665 321631 750440 817 Honig 000 Pflanzenbau11 340 56510 845 9289 748 681 Gemüse und Pilze1 643 5701 512 9051 811 557 Obst2 504 9462 425 1492 119 312 Getreide267 229438 270423 862 Kartoffeln717 959700 625593 407 Ölsaaten303 033362 500362 500 Zierpflanzen700 000665 000423 862 Wein5 000 0004 555 2363 772 681 Saatgut203 828186 243241 500 Gemeinsame Massnahmen2 557 7752 968 1793 113 383 Übergreifende Massnahmen (Bio,IP)3 037 2583 012 1642 951 921 Öffentlichkeitsarbeit 5 3 088 4502 834 2502 734 250 Schlussabrechnungen und längerfristige Verpflichtungen Kleinprojekte und Sponsoring 61 000500 000 National61 958 01551 902 72153 347 417 Regional 1 182 0591 296 5332 300 000 Total63 140 07453 199 25455 647 417 1 Nach provisorischer Abrechnung 2 Ab 2005 Käse Inland und Ausland 3 Rechnungsanteil gemäss Verfügung 2004/05 Quelle:BLW
A28 ANHANG
28
Viehwirtschaft BezeichnungRechnung 2004Rechnung 2005Budget 2006 Fr.Fr.Fr. Entschädigung an private Organisationen Schlachtvieh und Fleisch7 444 5357 144 7266 811 300 Marktstützung Fleisch Einlagerungsbeiträge von Kalbfleisch3 418 5832 737 944 Verbilligungsbeiträge Rindsstotzen687 151241 234 Verbilligungsbeiträge Bankfleisch für die Verarbeitung760 063975 690 4 865 7973 954 8676 500 000 Marktstützung Eier Aufschlagsaktionen1 335 8471 822 960 Verbilligungsaktionen546 951693 767 Praxisnahe Versuche beim Geflügel582 61654 704 Investitionsbeiträge für Stallbauten471 299444 606 2 936 7133 016 0373 500 000 Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh6 624 4505 658 2006 836 300 Verwertungsbeiträge Schafwolle627 327800 061800 000 Total 22 498 82220 573 89124 447 600 Massnahmen gegen die BSE:Entsorgung Fleischabfälle Entsorgungsbeiträge Tiere der Rindergattung 23 608 79731 676 291 Entsorgungsbeiträge Tiere der Schweine-,Schaf- und Ziegengattung8 951 32212 600 597 Gebühren Ohrmarken Rinder-3 960 847-4 232 752 Gebühren Schlachtbetriebe-3 155 496-3 027 865 Bearbeitungsgebühren-631 939-514 332 24 811 83736 501 93939 000 000 Leistungsvereinbarung Identitas AG9 591 4758 925 7069 834 000 Einnahmen Tierverkehr-1 758 332-2 037 745-1 500 000 Quellen:Staatsrechnung,BLW Tabelle 27 Ausgaben Milchwirtschaft BezeichnungRechnung 2004Rechnung 2005Budget 2006 1 Fr.Fr.Fr. Marktstützung (Zulagen und Beihilfen) Zulage auf verkäster Milch290 426 314287 330 430275 134 200 Zulage für Fütterung ohne Silage41 350 07943 058 40840 000 000 Inlandbeihilfen für Butter71 662 05761 560 30750 000 000 Inlandbeihilfen für Magermilch und Milchpulver49 300 03240 104 85340 000 000 Inlandbeihilfen für Käse000 Ausfuhrbeihilfen für Käse18 222 92410 706 02510 000 000 Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte26 184 32525 571 47722 000 000 497 145 731468 331 500437 134 200 Marktstützung (Administration) Rekurskommissionen Milchkontingentierung48 12859 49691 800 Administration Milchverwertung und -kontingentierung6 319 1485 841 3335 808 200 6 367 2765 900 8295 900 000 Total 503 513 007474 232 329443 034 200 1Kreditsperre berücksichtigt Quellen:Staatsrechnung,BLW
Tabelle
Ausgaben
Tabelle 29
Ausgaben Pflanzenbau
1 Im Budget 2004 neu in der Rubrik «übrige Sachausgaben» (3190.000)
2 ehemals Förderung des Rebbaus
3 Weinabsatzförderung im Ausland / In der Rechnung 2003 sind die Umstellungsbeiträge für Weinenthalten / Ab dem Jahre 2004 ist die Absatzförderung in der Rubrik 3601.200 enthalten
4 ohne Ölsaaten
5 In der Rechnung 2004 wurden 38,2 Mio.Fr.für die Ernte 2003 und 7,1 Mio.Fr.für die Ernte 2004 ausgerichtet, in der Rechnung 2005 wurden 28,5 Mio.Fr.für die Ernte 2004 und 17,5 Mio.Fr.für die Ernte 2005 ausbezahlt
ANHANG A29
BezeichnungRechnung 2003Rechnung 2004Rechnung 2005Budget 2006 Fr.Fr.Fr.Fr. Ackerbaubeiträge43 573 92543 503 72744 413 15942 179 800 Flächenbeiträge für Ölsaaten35 178 96735 857 27936 245 11734 115 300 Flächenbeiträge für Körnerleguminosen7 905 3927 190 0817 704 3927 641 000 Flächenbeiträge für Faserpflanzen489 567456 367463 650423 500 Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge94 055 91994 298 15477 958 73070 762 060 Zuckerrübenverarbeitung 5 45 000 00045 338 10745 982 00028 818 600 Ölsaatenverarbeitung8 500 0008 436 2502 577 5004 054 200 Kartoffelverarbeitung18 851 41218 329 41716 260 74616 398 500 Saatgutproduktion3 889 3443 730 7423 421 7203 371 000 Obstverwertung17 815 16418 463 6379 716 76318 099 760 Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe 4 00020 000 Förderung des Weinbaus16 411 7903 931 7693 120 8005 084 000 Sachausgaben 1 82 934--Weinlesekontrolle 2 1 066 298935 7241 086 0101 084 000 Verwertungsmassnahmen 3 9 951 554--Alkoholfreie Verwertung von Trauben5 311 004--Umstellungsbeiträge Weinbau-2 996 0452 034 7904 000 000 Total154 041 634141 733 649125 492 688118 025 860
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Ausgaben für Direktzahlungen
Tabelle 30
Entwicklung der Direktzahlungen
Anmerkung:Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte betreffend Direktzahlungen beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
A30 ANHANG
200020012002200320042005 Beitragsart 1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr.1 000 Fr. Allgemeine Direktzahlungen1 803 6581 929 0941 994 8381 999 0911 993 9151 999 606 Flächenbeiträge1 186 7701 303 8811 316 1831 317 9561 317 7731 319 595 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere258 505268 272283 221287 692286 120291 967 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen251 593250 255289 572287 289284 023282 220 Allgemeine Hangbeiträge96 71496 64395 81195 63095 30894 768 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen10 07610 04310 05110 52410 69111 056 Ökologische Direktzahlungen361 309412 664452 448476 724494 695506 895 Ökobeiträge278 981329 886359 387381 319398 109409 348 Beiträge für den ökologischen Ausgleich108 130118 417122 347124 927125 665126 023 Beiträge nach der Öko-Qalitätsverordnung (ÖQV)--8 93414 63823 00727 442 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion)33 39832 52631 93831 25530 82431 516 Beiträge für extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland (Übergangsbestimmung bis Ende 2000)17 150--Beiträge für den biologischen Landbau12 18523 48825 48427 13527 96228 601 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere108 118155 455170 684183 363190 651195 767 Sömmerungsbeiträge81 23880 52489 56191 38191 06691 610 Gewässerschutzbeiträge1 0902 2543 5004 0245 5215 936 Kürzungen22 54216 76321 14317 13818 12020 378 Total Direktzahlungen2 142 4252 324 9952 426 1432 458 6772 470 4902 485 758
Quelle:BLW
Allgemeine Direktzahlungen 2005
ANHANG A31
Tabelle 31a
FlächenbeiträgeBeiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeRGVE Total Beiträge Anzahl haFr.Anzahl Anzahl Fr. Kanton ZH3 57970 59194 581 0941 79316 97914 467 548 BE12 385187 983243 693 0318 31464 21756 026 173 LU5 02777 40597 681 0262 88325 29022 202 263 UR6486 6758 011 0766035 3454 476 272 SZ1 65224 00928 778 2361 42514 24111 997 050 OW6977 9359 533 8735893 7593 268 135 NW4896 0777 291 4173882 5492 155 560 GL4057 1768 601 1393883 7053 195 446 ZG55310 53112 990 9723713 1352 674 651 FR3 15075 16997 710 3621 88918 01715 786 732 SO1 40031 56841 134 4068668 7747 504 021 BL93621 22326 988 3686135 9545 128 935 SH57114 20719 617 8322282 5902 244 499 AR74811 93714 252 4706094 9604 168 519 AI5467 2718 707 4123612 5172 177 193 SG4 26771 63687 077 5393 11829 36624 911 971 GR2 65052 20062 519 6362 51835 39328 979 931 AG3 05058 33879 555 9801 49515 11412 891 194 TG2 61249 13665 415 8238397 1805 905 080 TI88512 97715 722 7316726 9875 274 965 VD3 926106 301144 120 2721 89022 37319 429 043 VS3 68236 20545 564 4002 23319 54914 148 710 NE91733 18338 691 0276708 4037 391 622 GE30510 45614 090 004981 3721 150 036 JU1 08239 19847 264 90191016 43614 411 921 Schweiz56 1621 029 3861 319 595 02735 763344 206291 967 470 Zone 1 Tal23 768479 162652 743 07610 08098 73884 588 040 Hügel7 970143 254182 373 1884 92343 33736 901 398 BZ I7 287118 913144 405 0905 52444 78438 385 228 BZ II8 928156 321183 622 6107 26270 74361 099 587 BZ III5 39384 931100 931 6905 22856 89547 150 469 BZ IV2 81646 80555 519 3732 74629 71023 842 748 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
Tabelle 31b
Allgemeine Direktzahlungen 2005
A32 ANHANG
Tierhaltung unter Allgemeine HangbeiträgeHangbeiträge Steil- und erschwerenden BedingungenTerrassenlagen im Rebbau TotalTotalTotal BetriebeRGVEBeiträgeBetriebeFlächeBeiträgeBetriebeFlächeBeiträge AnzahlAnzahlFr.AnzahlhaFr.AnzahlhaFr. Kanton ZH79212 9323 959 1517675 0542 080 746192173326 730 BE8 781128 97471 249 6488 15647 04619 728 36973103356 870 LU3 26951 04321 136 6263 23922 1709 260 384161733 990 UR6427 8786 819 3495994 7412 249 930111 245 SZ1 48522 46712 901 1991 44610 1404 332 692131222 635 OW66810 1995 842 6956434 7172 170 938112 500 NW4597 0603 722 5334423 8651 727 6270 GL3635 7234 248 9873623 3551 516 771127 650 ZG3596 0332 816 8233572 8161 179 38521915 FR1 78433 78112 421 6871 4917 1422 819 014181321 405 SO6039 8983 719 2305744 8511 856 0580 BL69010 8383 008 0536805 3922 103 314413664 035 SH1191 800300 984144839314 75112297161 680 AR74312 0336 967 3017415 9582 372 6794926 815 AI5388 5135 657 3565223 3851 410 6170 SG2 95448 50022 056 2632 88325 32210 548 25171101303 140 GR2 54539 07437 643 3232 48631 80413 876 997251840 335 AG1 09516 9553 413 5701 1477 4492 864 720144175301 695 TG1733 043935 5771491 164508 93277100152 745 TI6487 9026 422 7635473 1561 389 655185167342 495 VD1 26621 8139 318 9689615 6592 245 3614577262 517 710 VS2 22623 20120 985 5122 11712 2245 481 0191 3691 7306 110 109 NE76814 9018 929 6115893 5621 337 9645493175 780 GE153 167121 265405382 800 JU77214 8107 739 3075833 6121 390 248212 400 Schweiz33 743519 375282 219 68331 626225 42494 767 6872 9083 62911 055 679 Zone 1 Tal2 84250 5044 495 5642 0475 7572 316 9521 7882 4077 280 057 Hügel7 399118 25730 330 2976 96537 14614 549 627220282708 334 BZ I7 012110 20648 779 0346 69246 38618 910 309195216610 004 BZ II8 365130 39188 923 0947 87861 10825 729 1185566682 258 710 BZ III5 33473 14767 665 7985 26047 21920 750 59510345154 950 BZ IV2 79136 87142 025 8962 78427 80812 511 086461243 624 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
ANHANG A33 Tabelle 32a
2005 Ökologischer Ausgleich 1 Biologischer Landbau BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr.AnzahlhaFr. Kanton ZH3 5659 15512 969 0253547 0092 204 603 BE12 10918 64518 327 9601 39720 8465 076 615 LU5 0148 6199 725 5383144 9461 271 204 UR6451 210625 37062859171 847 SZ1 6283 2862 912 0421632 637530 105 OW6961 092903 0412012 552512 528 NW487937739 373721 000202 360 GL3981 041638 355931 709339 443 ZG5541 6351 766 033831 466320 969 FR3 0686 6127 446 3941112 223761 076 SO1 3984 2545 338 3351223 111811 099 BL9363 4344 522 9851312 890783 129 SH5571 7102 592 76819500214 098 AR696860702 4961362 385475 979 AI478554398 0203348396 136 SG4 2318 2468 910 2915169 0251 958 913 GR2 63014 1515 822 5711 44630 1906 176 743 AG3 0387 64510 483 0282154 0171 440 372 TG2 5855 2547 495 1042294 0661 498 340 TI8211 6421 255 3471051 663398 643 VD3 7079 68412 576 0531292 8801 008 897 VS2 1214 9622 901 3912804 5081 255 272 NE6991 8161 638 320451 293324 479 GE3031 1481 927 61365937 740 JU1 0393 1703 405 835883 072730 133 Schweiz53 403120 761126 023 2856 350115 38728 600 723 Zone 2 Tal22 83150 61172 973 7171 19821 6688 727 752 Hügel7 87817 85621 598 77862711 0863 044 569 BZ I7 01611 62510 397 86581112 7942 824 768 BZ II7 95814 94710 575 4841 33423 6954 785 372 BZ III5 02613 3805 902 7141 41126 4615 328 602 BZ IV2 69412 3424 574 72896919 6823 889 660 1 Hochstammobstbäume umgerechnet in Aren 2Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
Ökobeiträge
Ökobeiträge 2005
A34 ANHANG
Tabelle 32b
Extensive Produktion von Besonders tierfreundliche Haltung Getreide und Rapslandwirtschaftlicher Nutztiere BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeGVETotal Beiträge AnzahlhaFr.AnzahlAnzahlFr. Kanton ZH1 5476 4832 582 7852 13371 51410 845 387 BE4 97315 5866 233 8089 369237 45338 287 483 LU1 2703 5411 416 3803 938167 98225 164 116 UR04336 7081 099 431 SZ17239 2521 10026 0044 216 963 OW231 14847812 1661 920 605 NW02747 5331 183 322 GL127883087 6221 262 839 ZG7417168 34038715 4102 311 633 FR1 2346 0712 427 9902 542109 14517 098 763 SO7494 0011 593 3511 10134 8615 353 834 BL6133 1151 227 97259322 4713 420 050 SH3302 497981 61826011 7291 673 816 AR1126462416 3852 754 597 AI043812 7152 208 501 SG301704277 3242 987104 97216 700 361 GR173579231 4602 34858 2739 160 185 AG1 6207 0742 827 6921 83568 01410 274 756 TG8132 9891 193 2911 76474 30411 131 958 TI61285113 87663813 1552 068 833 VD1 93716 1556 449 6212 16885 02912 771 319 VS81277109 1781 22417 1392 850 376 NE3612 6861 071 88869129 4264 534 081 GE2233 3041 278 361762 601380 290 JU5473 5561 419 47493448 9887 093 300 Schweiz16 92879 10231 515 86138 6431 261 598195 766 799 Zone 1 Tal10 20955 39822 048 84114 584596 69189 700 243 Hügel3 96015 0866 020 5725 935213 07732 941 439 BZ I2 0086 7292 690 8875 447164 30726 158 606 BZ II6621 776710 2286 455170 52027 704 794 BZ III779939 4094 06378 61512 935 575 BZ IV12155 9242 15938 3886 326 142 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
Tabelle 33a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2005
ANHANG A35
Extensiv genutzte WiesenWenig intensiv genutzte Wiesen BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr.AnzahlhaFr. Kanton ZH3 1494 8346 846 809905795504 167 BE7 8187 4267 528 8866 7665 6792 710 178 LU4 1693 9714 314 2891 7981 344673 297 UR398508245 173450534168 809 SZ1 058977718 643526410173 916 OW605657412 20919010545 680 NW389508321 06318514663 182 GL362724431 77916219973 897 ZG359373438 66522816688 834 FR1 9312 6243 443 1301 8792 5711 506 219 SO1 2002 3072 916 600526683388 835 BL7701 3131 564 565421504308 559 SH5241 0831 518 08112913789 086 AR387219157 985389243110 502 AI299211148 0181509843 921 SG2 9572 7102 937 3321 8001 240668 717 GR2 0575 4022 669 2552 2728 3412 559 661 AG2 5684 0845 543 5441 063876564 335 TG1 9711 9842 917 428894603389 557 TI520718596 261397657231 332 VD3 0775 2567 108 4151 2242 1161 106 468 VS9191 306866 9181 5382 960991 279 NE487864937 539355753349 472 GE2948571 285 13310159 915 JU7271 3041 566 7525951 061557 761 Schweiz38 99552 21957 434 47124 85232 23614 377 579 Zone 1 Tal19 03426 20838 380 7637 4276 5574 203 831 Hügel5 6476 8898 109 3053 9223 7182 334 047 BZ I4 1983 8402 828 6843 7323 1881 474 265 BZ II4 8525 1313 466 4064 2315 0422 206 099 BZ III3 3145 6782 622 5143 3056 2531 908 257 BZ IV1 9504 4722 026 8002 2357 4782 251 080 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
Tabelle 33b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2005 StreueflächenHecken,Feld- und Ufergehölze
A36 ANHANG
BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr.AnzahlhaFr. Kanton ZH1 1721 3641 861 045980188270 725 BE750560353 0632 099443475 435 LU529369321 717606121158 675 UR595947 18221421 SZ8751 178939 5862321 952 OW1528781 2682521 724 NW1199979 6301921 718 GL605436 8781421 227 ZG302534418 3702836766 399 FR914950 317788240321 080 SO2041632593116 138 BL027187104 149 SH1068 7902496995 496 AR269196138 91671107 288 AI219190133 30864128 393 SG1 7711 7991 536 4635137180 797 GR783316 2581302621 437 AG12091135 0851 138320417 534 TG17398141 002478101150 031 TI404248 5932768 026 VD13411687 1161 035357481 505 VS3797 4581743628 252 NE442 5481113837 261 GE468 4601153552 620 JU362220 260343128133 020 Schweiz7 0066 9646 473 7279 8832 4573 041 301 Zone 1 Tal1 8691 8742 747 4015 7011 3822 042 923 Hügel856685824 5671 912503603 281 BZ I1 111842659 9791 059271195 038 BZ II2 0992 5581 766 745904243171 640 BZ III798736352 4812484923 838 BZ IV273270122 55559104 583 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
Tabelle 33c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2005
ANHANG A37
BuntbrachenRotationsbrachen BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaFr.AnzahlhaFr. Kanton ZH362273818 340100115286 850 BE303259777 0687169172 167 LU341749 95071229 675 UR000000 SZ000000 OW000000 NW000000 GL000000 ZG6925 680000 FR226242727 7294268169 332 SO6586256 901253279 746 BL147128382 5004461152 190 SH175152457 080243176 700 AR000000 AI000000 SG353191 676324 250 GR131443 29051229 775 AG407175525 060136148370 475 TG125109327 120273381 700 TI91441 85042358 100 VD3935831 749 030113160398 950 VS251750 4908513 600 NE3738114 420102050 275 GE6692276 6304681203 025 JU7583246 322162255 875 Schweiz2 5032 3216 961 1366818932 232 685 Zone 1 Tal2 0891 9805 938 6485717501 874 802 Hügel399330990 681107141351 135 BZ I11722 177224 248 BZ II439 630112 500 BZ III000000 BZ IV000000 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
Tabelle 33d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2005
AckerschonstreifenHochstamm-Feldobstbäume
1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A38 ANHANG
BetriebeFlächeTotal BeiträgeBetriebeBäumeTotal Beiträge AnzahlhaFr.AnzahlAnzahlFr. Kanton ZH823 4202 503158 5432 377 669 BE2046 1698 309420 4626 304 994 LU211 5604 189278 4254 176 375 UR00023410 919163 785 SZ0001 01971 8631 077 945 OW00045824 144362 160 NW00034418 252273 780 GL0001386 30594 575 ZG00049448 539728 085 FR735 0371 89481 5701 223 550 SO1234 0351 149105 0491 575 664 BL000886134 0702 011 022 SH2190038423 109346 635 AR00033819 187287 805 AI000794 29264 380 SG533 8853 015239 1533 587 171 GR00058032 193482 895 AG1557 3202 569194 6452 919 675 TG611 9652 148232 4683 486 301 TI1187023318 019270 315 VD141624 2402 020108 0221 620 330 VS11014 49083761 927928 905 NE0001819 787146 805 GE511 6051156 01590 225 JU111 20066354 984824 644 Schweiz995176 69634 7792 361 94235 425 690 Zone 1 Tal784567 05916 7601 181 44417 718 289 Hügel2068 3176 889558 5038 377 446 BZ I111 3205 649347 4775 212 155 BZ II0003 955196 8312 952 465 BZ III0001 28066 375995 625 BZ IV00024611 312169 710
Quelle:BLW
Tabelle 34
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2005
Nur biologische Qualität 1 Nur Vernetzung 1 Biologische Qualität Beiträge Bund und Vernetzung 1
ANHANG A39
BetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeTotal Beiträge AnzahlhaAnzahlhaAnzahlhaAnzahlFr. Kanton ZH7588481 3071 9456209321 8972 162 BE1 2206766 2587 0543 2502 9477 1877 252 LU1 9051 6695088183395442 3852 570 UR25639446944186300298 SZ8921 1573183404017911 2011 463 OW28838130328192349273 NW2102019783175364345363 GL19037739722538232212 ZG38874127311924408455 FR236257453855105123691647 SO336621464300378355 BL79752415835369676361 252 SH126114766175150192205 AR1981066647125145284196 AI238233101223897 SG1 6512 0468191 1145836412 3892 209 GR 1 2634 9464042 0813803 6121 4091 879 AG2542284816264941 7587502 025 TG5093161 6851 5714413471 9051 581 TI200319367724114232250 VD1 0601 32357200001 076681 VS3986968845100455522 NE2593098920800309225 GE18220000188 JU244445104500246264 Schweiz13 17618 49913 18218 4317 71513 67525 51227 442 Zone Tal4 1913 8425 3936 4372 1642 7149 0348 802 Hügel1 8461 7441 9752 4121 4132 3713 8944 927 BZ I1 7051 8021 8862 0671 0661 2473 5493 205 BZ II2 5623 6621 8582 5241 3521 8834 3914 144 BZ III1 6833 9791 3932 6191 1672 7312 9613 659 BZ IV1 1893 4696772 3715532 7291 6832 704 1 Hochstamm umgerechnet in Aren Quelle:BLW
Tabelle 35
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2005
1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A40 ANHANG
BrotgetreideFuttergetreideRapsTotal BetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeFlächeTotal Beiträge AnzahlhaAnzahlhaAnzahlhaFr. Kanton ZH1 2024 3479561 8191603172 582 785 BE2 9197 4733 9927 7182223956 233 808 LU7291 4999461 8101172321 416 380 UR0000000 SZ221621009 252 OW1112001 148 NW0000000 GL001200788 ZG2551509882368 340 FR7673 2019522 556963142 427 990 SO5442 0936121 743801651 593 351 BL4331 5295201 473381131 227 972 SH3172 0041434044489981 618 AR110000264 AI0000000 SG942142414561835277 324 GR10332113524839231 460 AG1 3504 2981 1692 5191442572 827 692 TG6732 094459752761421 193 291 TI391913178316113 876 VD1 2498 6011 4445 3327002 2226 449 621 VS49186458516109 178 NE1577863431 728501731 071 888 GE2072 2291941 00716681 278 361 JU2961 6254401 793361381 419 474 Schweiz11 15742 74412 69031 6441 8124 71431 515 861 Zone 1 Tal7 86334 2546 78717 3021 4513 84222 048 841 Hügel2 4176 6283 3277 7822936766 020 572 BZ I7421 6441 8854 902631832 690 887 BZ II1121946111 569513710 228 BZ III181968800039 409 BZ IV551210005 924
Quelle:BLW
Tabelle 36
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2005
ANHANG A41
Besonders tierfreundliche StallhaltungssystemeRegelmässiger Auslauf im Freien BetriebeGVETotal BeiträgeBetriebeGVETotal Beiträge AnzahlAnzahlFr.AnzahlAnzahlFr. Kanton ZH1 15026 2952 802 1132 04045 2198 043 274 BE3 52764 1877 697 1359 221173 26630 590 348 LU2 59667 8368 241 2203 842100 14516 922 896 UR1081 257121 0394325 451978 392 SZ3626 167675 9691 08919 8373 540 994 OW2273 814422 8344678 3521 497 771 NW1472 646324 1302674 887859 192 GL841 388143 6503086 2331 119 189 ZG2065 735607 8683789 6751 703 765 FR1 34335 8334 090 6512 46073 31213 008 112 SO55311 4231 241 4531 07023 4384 112 381 BL3548 502927 01457513 9692 493 036 SH1896 125720 9442185 604952 872 AR1622 951355 06362313 4342 399 534 AI1523 309525 0384339 4061 683 463 SG1 28531 5543 703 2432 93573 41812 997 118 GR83415 2251 439 0062 34643 0487 721 179 AG1 14028 2463 271 6181 71939 7677 003 138 TG1 01230 1153 402 2741 67944 1897 729 684 TI1673 146286 08863610 0081 782 745 VD1 14730 4863 136 5702 07754 5439 634 749 VS1902 531239 7561 21514 6082 610 620 NE2978 591854 48968520 8353 679 592 GE34967100 050761 634280 240 JU57418 3191 759 71291630 6695 333 588 Schweiz17 840416 65047 088 92737 707844 948148 677 872 Zone 1 Tal8 600235 67926 919 06113 909361 01262 781 182 Hügel3 24875 2578 782 1165 767137 81924 159 323 BZ I2 33146 1845 202 0765 394118 12320 956 530 BZ II2 19238 5424 190 8676 425131 97723 513 927 BZ III98014 3181 375 9484 05864 29711 559 627 BZ IV4896 669618 8592 15431 7195 707 283 1Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle:BLW
Tabelle 37
Beteiligung am BTS-Programm 2005
A42 ANHANG
Basis 1 BTS-Beteiligung TierkategorieGVEBetriebeGVEBetriebeGVEBetriebe AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl%% Zucht und Nutzung: Milchkühe604 43335 870152 8115 93025.316.5 Rinder,über 1jährig136 49634 62241 4228 26530.323.9 Stiere,über 1jährig5 4638 2261 7022 38131.228.9 weibliches Jungvieh,4 bis 12 Monate31 96027 6589 5246 43129.823.3 männliches Jungvieh,4 bis 12 Monate2 0994 04126442412.610.5 Mutter- und Ammenkühe: Mutter- und Ammenkühe ohne Kälber70 9996 37258 3074 18482.165.7 Mast: Rinder,Stiere,Ochsen,über 4 Monate38 5217 21022 8372 74459.338.1 Total Rindvieh889 97143 989286 86714 13532.232.1 Ziegen8 9436 0252 51274928.112.4 Kaninchen5663 65419415834.34.3 Total übrige Raufutter Verzehrer9 5098 8692 70686328.59.7 Zuchtschweine,über 6 Monate,und Ferkel60 5944 78933 6451 79155.537.4 Remonten,bis 6 Monate,und Mastschweine100 8429 35664 9633 81064.440.7 Total Schweine161 43611 28398 6084 60661.140.8 Zuchthennen und -hähne9881 9402378024.04.1 Legehennen17 66213 66714 0211 74379.412.8 Junghennen,-hähne und Küken2 6615251 87512970.524.6 Mastpoulets21 3571 11318 25980485.572.2 Truten2 2332932 15110496.335.5 Total Geflügel44 90215 34836 5442 66881.417.4 Total alle Tierkategorien1 105 81747 447424 72617 81338.437.5 1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe,die Direktzahlungen erhalten haben) Quelle:BLW
Tabelle 38
Beteiligung am RAUS-Programm 2005
ANHANG A43
Basis 1 RAUS-Beteiligung TierkategorieGVEBetriebeGVEBetriebeGVEBetriebe AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl%% Zucht und Nutzung: Milchkühe604 43335 870454 42124 67675.268.8 Rinder,über 1jährig136 49634 62296 48522 51970.765.0 Stiere,über 1jährig5 4638 2262 7754 34650.852.8 weibliches Jungvieh,4 bis 12 Monate31 96027 65819 73416 68961.760.3 männliches Jungvieh,4 bis 12 Monate2 0994 0415721 21427.330.0 Aufzuchtkälber,unter 4 Monate25 41625 0646 8236 42926.825.7 Mutter- und Ammenkühe: Mutter- und Ammenkühe mit Kälbern70 9996 37266 4015 38593.584.5 Mast: Rinder,Stiere,Ochsen,über 4 Monate38 5217 21018 1353 21947.144.6 Kälber,unter 4 Monate4 0306 1409801 25324.320.4 Mastkälber10 32216 6171 1281 67010.910.0 Total Rindvieh929 73843 989667 45431 94771.872.6 Tiere der Pferdegattung34 04111 44828 0578 28082.472.3 Schafe39 1609 63931 7356 70781.069.6 Ziegen8 9436 0256 2983 03170.450.3 Dam- und Rothirsche71021161016486.077.7 Bisons175151711197.573.3 Kaninchen5663 654172133.05.8 Total übrige Raufutter Verzehrer83 59423 07766 88814 80080.064.1 Zuchtschweine,über 6 Monate,und Ferkel60 5944 78932 7281 86754.039.0 Remonten,bis 6 Monate,und Mastschweine100 8429 35660 9923 76360.540.2 Total Schweine161 43611 28393 7204 65958.141.3 Zuchthennen und -hähne9881 94013320613.410.6 Legehennen17 66213 66711 1673 30163.224.2 Junghennen,-hähne und Küken2 6615254469816.818.7 Mastpoulets21 3571 1131 9691909.217.1 Truten2 2332932 14012595.842.7 Total Geflügel44 90215 34815 8543 62135.323.6 Total alle Tierkategorien1 219 67050 678843 91637 68669.274.4 1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe,die Direktzahlungen erhalten haben) Quelle:BLW
Tabelle 39a
Sömmerungsbeiträge 2005
KantoneSchafe Kühe gemolken,Milchschafe Übrige Raufutter Betriebe und (ohne Milchschafe)und Milchziegen 1 verzehrende TiereBeiträge
A44 ANHANG
Total BetriebeBeitrags-BetriebeBeitrags-BetriebeBeitrags-BetriebeBeiträge berechtigterberechtigte berechtigter BesatzGVEBesatz AnzahlNormalstösseAnzahlGVEAnzahlNormalstösseAnzahlFr. ZH000094719 141 183 BE1842 28351813 1771 58648 6341 69018 906 521 LU43375602972436 0642481 961 404 UR651 5082203 9252423 1303362 421 571 SZ506532702 7354259 7374543 872 978 OW23213567672448 2622632 746 508 NW19185151321274 1551331 319 400 GL1443551301126 6071202 110 149 ZG0013102411073 278 FR516471201 82360221 9506357 257 432 SO2417612 50261 753 051 BL00001041510 124 629 SH00001100129 889 AR11283061142 378115805 388 AI8901041 4641381 8531441 008 514 SG401 1351364 43243816 6494506 566 384 GR1918 21239214 35487633 1011 02516 032 998 AG2140073859 118 621 TG0000262218 582 TI872 125874 3532084 5872663 061 573 VD214841735963732 1796489 870 792 VS1705 9571215 79343015 9505197 511 104 NE1924971504 3431541 352 815 GE11100016234 719 JU2123008211 598833 507 787 Total97524 6442 15554 1556 755235 3567 38791 607 270 1Gemolkene Tiere mit einer Sömmerungsdauer von 56 bis 100 Tagen Quelle:BLW
Tabelle 39b
Sömmerungsstatistik 2005:Betriebe und Normalstösse nach Kantonen
ANHANG A45
KantoneMilchküheMutter-/Anderes PferdeSchafeZiegenAndere AmmenküheRindvieh BetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatzBetriebeBesatz AnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNSTAnzahlNST ZH001768368212001200 BE1 14626 5832392 1351 53325 7772439292043 048521844732 LU981 273595462473 819196648373445226 UR2243 894373551862 093147691 5057226200 SZ2753 139716114156 521471335766510424800 OW2054 538162322393 13322362823648522486 NW871 796171901221 861141818241236021115 GL1013 877202231112 295293614394377458121 ZG234131019110000000 FR3127 2038993358613 412882366187413722522 SO812226436621 70616525133100 BL0046910288126001200 SH0000199000040441649 AR771 3103301101 146111113481081521 AI1171 598001361 31486992151258410 SG2867 490751 1464239 5084767442 1471461 10142 GR44914 1614667 87578717 9032407482077 8690000 AG003547295002130000 TG000026100001241 9577850 TI1144 026444731361 12262199912 2506313821 VD37413 2251953 25961114 223101283309547853510 VS33313 801811 1403505 634551481825 9694210 NE55866343971472 86024102110000 GE00000016111231011 JU383 922311 046804 791341 3944970000 Total4 301112 8581 51221 2276 319120 4211 0794 5151 07626 8561 6485 977236496 Ein Normalstoss (NST) = 1 GVE * Sömmerungsdauer / 100 Quelle:BLW
Tabelle 40a
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2005
A46 ANHANG
TalzoneHZ MerkmalEinheit10–2020–30 30–50 10–2020–30 30–50 ha LNha LNha LNha LNha LNha LN ReferenzbetriebeAnzahl56747619119912539 Vertretene BetriebeAnzahl8 5415 4453 0522 7061 463672 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 15.3424.2835.7014.8924.2036.45 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr.23 82137 19152 55828 32844 76062 508 FlächenbeiträgeFr.20 56333 51147 55719 06031 64645 481 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.2 5922 9194 3503 1265 6898 236 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.4154623924 1944 5145 162 HangbeiträgeFr.2512992601 9482 9113 629 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.7 24510 09214 7497 54911 03114 227 Ökologischer AusgleichFr.2 2523 1895 1842 2793 5904 487 Extensive ProduktionFr.6201 0861 6736721 0261 536 Biologischer LandbauFr.4964621 055444635547 EthobeiträgeFr.3 8775 3546 8364 1545 7807 657 Total Direktzahlungen nach DZVFr.31 06647 28367 30735 87755 79176 735 RohertragFr.196 950275 856358 111175 599244 451318 012 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag%15.817.118.820.422.824.1 Andere Direktzahlungen 2 Fr.2 1152 6825 3831 8463 2955 588 Total Direktzahlungen Fr.33 18049 96572 69037 72359 08682 323 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag%16.818.120.321.524.225.9 1Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART 2 Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,andere Beiträge Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabelle 40b
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2005
ANHANG A47
BZ IBZ II MerkmalEinheit10–2020–30 30–50 10–2020–30 30–50 ha LNha LNha LNha LNha LNha LN ReferenzbetriebeAnzahl2331255421513461 Vertretene BetriebeAnzahl3 3291 3438463 0351 742983 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 15.1024.4137.3115.0124.4437.41 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen totalFr.34 00248 74167 92339 51956 13971 414 FlächenbeiträgeFr.18 38530 05144 67617 76129 29343 467 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.4 7036 3439 7225 9118 7889 821 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.7 6558 7159 31512 04013 42213 684 HangbeiträgeFr.3 2593 6334 2103 8084 6364 441 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.6 11910 38312 6065 5038 35910 605 Ökologischer AusgleichFr.1 4842 4722 3211 3461 6351 419 Extensive ProduktionFr.1934541 6832878403 Biologischer LandbauFr.7331 0766078331 3302 041 EthobeiträgeFr.3 7086 3817 9953 2975 3166 742 Total Direktzahlungen nach DZVFr.40 12159 12480 52945 02264 49882 019 RohertragFr.151 163235 566288 259141 267193 090257 643 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag%26.525.127.931.933.431.8 Andere Direktzahlungen 2 Fr.1 7002 5314 2773 8064 6424 189 Total DirektzahlungenFr.41 82161 65584 80648 82969 14186 208 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag%27.726.229.434.635.833.5 1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART 2 Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,andere Beiträge Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabelle 40c
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2005
A48 ANHANG
BZ IIIBZ IV MerkmalEinheit10–2020–30 30–50 10–2020–30 30–50 3 ha LNha LNha LNha LNha LNha LN ReferenzbetriebeAnzahl97633371264 Vertretene BetriebeAnzahl1 5238915641 335425 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 14.6023.8635.8914.7524.38 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen totalFr.45 06966 89682 77149 88571 103 FlächenbeiträgeFr.16 88128 65141 11817 73830 575 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.9 68413 69515 44710 05712 285 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.13 88518 15018 91816 91921 046 HangbeiträgeFr.4 6186 4007 2885 1717 197 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.4 1377 54511 0224 4168 157 Ökologischer AusgleichFr.1 0751 5342 0441 2762 320 Extensive ProduktionFr.002800 Biologischer LandbauFr.8111 7853 1389492 573 EthobeiträgeFr.2 2514 2275 8132 1913 263 Total Direktzahlungen nach DZVFr.49 20674 44193 79354 30279 260 RohertragFr.118 721172 157225 415113 848174 613 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag%41.443.241.647.745.4 Andere Direktzahlungen 2 Fr.4 1124 6338 5485 6957 577 Total DirektzahlungenFr.53 31779 074102 34159 99786 837 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag%44.945.945.452.749.7
Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,andere
Aufgrund der
Ergebnisse dargestellt Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART 2
Beiträge 3
zu kleinen Stichprobe werden keine
Tabelle 41
Direktzahlungen auf Betriebsebene1 :nach Regionen 2005
ANHANG A49
MerkmalEinheitAlleTal-Hügel-BergBetrieberegionregionregion ReferenzbetriebeAnzahl3 1351 426901808 Vertretene BetriebeAnzahl50 91623 24413 73913 933 Landwirtschaftliche Nutzflächeha 19.7520.6418.9219.09 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen totalFr.37 65731 21737 31748 738 FlächenbeiträgeFr.25 09727 68623 37622 473 RaufutterverzehrerbeiträgeFr.4 9902 8195 1298 476 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden ProduktionsbedingungenFr.5 4923776 08013 446 HangbeiträgeFr.2 0783342 7334 342 Ökobeiträge und Ethobeiträge totalFr.7 9008 7968 1496 159 Ökologischer AusgleichFr.2 2742 9132 1611 320 Extensive ProduktionFr.59590561657 Biologischer LandbauFr.7295285771 212 EthobeiträgeFr.4 3024 4504 7953 569 Total Direktzahlungen nach DZVFr.45 55740 01345 46754 896 RohertragFr.210 986254 733194 361154 400 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag%21.615.723.435.6 Direktzahlungen pro haFr./ha2 3061 9392 4032 875 Andere Direktzahlungen 2 Fr.3 1882 9812 4204 288 Total DirektzahlungenFr.48 74542 99447 88759 185 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag%23.116.924.638.3 1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der ART 2 Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,andere Beiträge Quelle:Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Quelle:AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2005
A50 ANHANG
Tabelle 42a
Beanstandungen Anzahl%AnzahlAnzahlAnzahl ZH3 57946.971 681052158135321220284324 BE12 38531.213 86571989023310140264 LU5 02773.923 7160891848013341944311477 UR64844.2928726 5431000425 SZ1 65249.3981634033373 000291 OW69768.874801226531210138134 NW48935.791750416000 000020 GL40563.2125617714170 000551 ZG55359.8633103120120021434 FR3 15034.831 097294131181213615165 SO1 400100.791 411n.v.1772214 032148 BL936100.219380720213 000125 SH57191.0752001 21074231434 AR74857.7543203314203 000254 AI54640.8422302712200 000041 SG4 26746.101 967168255981222310388 GR2 65021.7457603576744332441242 AG3 050100.853 07617611653920220577379 TG2 61263.281 653301273523211223081334 TI88558.645190317333000051161 VD3 92646.741 8351314804867391822360337 VS3 68255.302 03608640428805031203765 NE91799.8991630270320061152 GE30585.9026210 00045122336 JU1 08233.5536301112106 122044 CH56 16252.4029431708961764343176263106632465984 525 Falls Anzahl kontrollierter
> Anzahl
in
Kanton n.v.=
ÖLN-Kontrollen 2005
Betriebe
direktzahlungsberechtigter Betriebe,gibt es mehr angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe
diesem
nicht vefügbar
Kanton DZ-berechtigte Betriebe (Zahlen Agrarbericht 2005) Kontrollierte Betriebe in % aller beitragsberechtigten Betriebe Kontrollierte Betriebe Nicht rechtzeitige Anmeldung Tiergerechte Haltung der Nutztiere Aufzeichnungen Ausgeglichene Düngerbilanz Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen Pufferstreifen/Grasstreifen Geregelte Fruchtfolge Geeigneter Bodenschutz Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln Andere Total Beanstandungen
ÖLN-Kontrollen 2005
Anzahl kontrollierter Betriebe > Anzahl direktzahlungsberechtigter Betriebe,gibt es mehr angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe in diesem Kanton Quelle:AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2005
ANHANG A51
Tabelle 42b
%%Anzahl%%Fr.Fr. ZH9.0519.271413.948.391 527.26215 344 BE2.136.832822.287.30740.14208 719 LU9.4912.842825.617.591 906.28537 570 UR3.868.71142.164.883 798.8653 184 SZ5.5111.15674.068.213 564.81238 842 OW19.2327.92253.595.211 162.0829 052 NW4.0911.4340.822.291 170.254 681 GL12.5919.92256.179.77671.1616 779 ZG6.1510.2761.081.814 820.1728 921 FR5.2415.041665.2715.132 319.66385 063 SO3.433.40483.433.401 188.3957 043 BL2.672.67252.672.671 606.240 155 SH5.956.54417.187.88778.1231 903 AR7.2212.50000017 586 AI7.5118.39366.5916.14911.3632 809 SG9.0919.733608.4418.3055.2019 873 GR9.1342.011525.7426.391 651.73251 063 AG12.4312.321394.564.521 453.82202 081 TG12.7920.21823.144.961 105.6990 667 TI18.1931.02384.297.321 433.3954 469 VD8.5818.371584.028.611 992.26314 777 VS20.7837.57230.621.13474.2210 907 NE5.675.6890.980.98693.336 240 GE11.8013.7472.302.672 211.7115 482 JU4.0712.12131.203.582 471.3132 127 CH8.0615.372 14390.147.281 351.072 895 337 Falls
Kanton Beanstandungen pro
direktzahlungsberechtigte Betriebe Beanstandungen pro 100 kontrollierte Betriebe Betriebe mit Kürzungen Betriebe mit Kürzungen
100 direktzahlungsberechtigte Betriebe Betriebe mit Kürzungen pro 100 kontrollierte Betriebe Kürzung in Fr.pro Betrieb mit Kürzungen Kürzungen Total
100
pro
Ausgaben für Grundlagenverbesserung
Tabelle 43
An die Kantone ausbezahlte Beiträge 2005
Tabelle 44
Beiträge an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2005
A52 ANHANG
KantonBodenverbesserungenLandwirtschaftliche GebäudeTotal Beiträge Fr.Fr.Fr. ZH1 357 948408 1001 766 048 BE8 591 9035 892 40014 484 303 LU2 820 783926 5003 747 283 UR719 329241 000960 329 SZ1 644 6131 186 1002 830 713 OW614 354634 8001 249 154 NW608 900155 351764 251 GL464 066235 100699 166 ZG79 682264 400344 082 FR5 397 2612 636 1008 033 361 SO2 378 052324 6002 702 652 BL508 013464 900972 913 SH73 915114 700188 615 AR253 700667 800921 500 AI117 819520 400638 219 SG3 384 7672 333 6005 718 367 GR11 285 5353 723 40015 008 935 AG1 026 000468 4001 494 400 TG99 66599 665 TI2 311 9841 060 9003 372 884 VD6 241 7501 269 1007 510 850 VS2 814 3951 458 1004 272 495 NE598 1102 298 5002 896 610 GE206 183206 183 JU2 740 1071 280 7004 020 807 Diverse122 144122 144 Total56 460 97828 564 95185 025 929 Quelle:BLW
MassnahmenBeiträgeGesamtkosten TalregionHügelregionBergregionTotalTotal 1000 Fr. Bodenverbesserungen Landumlegungen (inkl.Infrastrukturmassnahmen)5 3242 4518 87316 64844 656 Wegebauten2 7253 93010 59617 25157 133 Übrige Transportanlagen 255255990 Massnahmen zum Boden-Wasserhaushalt2 2787691 3684 41515 351 Wasserversorgungen1 3238 4539 77540 235 Elektrizitätsversorgungen945336272 120 Wiederherstellungen und Sicherungen628747 5488 48419 867 Grundlagenbeschaffungen154196403901 013 Periodische Wiederinstandstellung3961 6343102 34014 789 Total 10 93911 27137 97560 186196 155 Landwirtschaftliche Gebäude Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere9 22214 92624 149158 592 Alpgebäude379519887 787 Gemeinschaftsgebäude für Verarbeitung und Lagerung1 0832251 30810 322 Total 10 34216 10326 445176 701 Gesamttotal10 93921 61354 07986 631372 856 Quelle:BLW
Tabelle 45
Von den Kantonen bewilligte Investitionskredite 2005
ANHANG A53
KantonBodenverbesserungenLandwirtschaftlicher HochbauTotal Gemeinschaftliche MassnahmenGemeinschaftliche M.Einzelbetriebliche M. BaukrediteInvestitionskrediteInvestitionskrediteInvestitionskredite Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr.Anzahl1000 Fr. ZH170125011418 58911618 909 BE158 4654454101 59637848 69940759 214 LU82 730324032 01624531 46225936 448 UR1150131 216141 366 SZ102 220222121578310 9309713 528 OW1200123182 023202 246 NW 172 292172 292 GL2247101 268121 515 ZG 131 753131 753 FR172 466122 82813521 89216427 186 SO21811120578 205608 506 BL118354 324364 342 SH 222 803222 803 AR250423 700443 750 AI 272 960272 960 SG24603478652118224 36419325 823 GR117 14054889712 56011320 188 AG13210414 10110514 133 TG116010014 97510115 135 TI32 690120271201 830264 611 VD2800323 33514219 48217623 617 VS424751 230263 066354 543 NE11 3002313416 144447 757 GE104 662104 662 JU240033 318699 2887413 006 Total5626 336374 59610221 4341 990267 9262 185320 292 Quelle:BLW
Tabelle 46
Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2005 (ohne Baukredite)
KantonStarthilfeKauf desDiversi-Wohn-Ökonomie-Gemein-VerarbeitungBoden-Total Betriebesfizierunggebäudegebäudeschaftlicheund LagerungverbesdurchMass-landw.serungen
A54 ANHANG
Pächternahmen 1 Produkte 1000 Fr. ZH4 1401 1655662 09010 6282507018 909 BE16 3081 10623312 30918 7421 59645450 749 LU10 0504488 75712 2081821 83424033 718 UR3606302261 216 SZ1 7704 2004 960906722111 308 OW510250499764232 046 NW8108706122 292 GL1505335852471 515 ZG5301 2231 753 FR5 5207402001 64513 7874822 3462 46627 186 SO1 470485412 1944 0151208 325 BL1 170260851002 709184 342 SH6602971 8462 803 AR1 5702804411 409503 750 AI8401287951 1972 960 SG8 2009924334 32010 41952147825 363 GR1 5605606 0974 34348813 048 AG3 9601 0002 5996 5423214 133 TG4 1402003102 8587 46716015 135 TI8081094071201 921 VD7 8311271 9179 6072 49184422 817 VS7203542701 7221 2302474 543 NE8709972684 009392746 457 GE 3724 2904 662 JU2 8201007555 613453 27340013 006 Total76 0396 7034 35755 255125 5733 90117 5334 596293 956 1Inventarkauf,Starthilfe für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen Quelle:BLW
Tabelle 47
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2005 (Bundes- und Kantonsanteile)
ANHANG A55
KantonAnzahlSummepro FallTilgungsdauer 1000 Fr.1000 Fr.Jahre ZH6 89514915 BE13 2 22617116 LU21 3 33415918 UR SZ2 39019513 OW NW3 45015020 GL ZG1 10010016 FR6 1 02017011 SO3 2719015 BL SH1 909010 AR4 3779410 AI SG8 6408015 GR5 3036113 AG4 49012312 TG3 40013310 TI1 10010020 VD14 3 04221715 VS6 77312916 NE3 37512510 GE3 3001007 JU13 1 016787 Total120 16 592Ø:138Ø:14 Quelle:BLW
A56 ANHANG
48a
über Beiträge Massnahme Genehmigte Projekte in 1000 Fr. 200320042005 Beiträge 105 92683 45286 631 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen21 99020 40216 648 Wegebauten 15 05113 16717 251 Wasserversorgungen 9 0929 8319 775 andere Tiefbaumassnahmen30 98312 30916 512 Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere25 71526 18925 137 andere Hochbaumassnahmen3 0951 5541 308 Quelle:BLW
48b
über Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen Massnahme bewilligte Kredite in 1000 Fr. 200320042005 Investitionskredite 1 249 509286 007293 956 Starthilfe 86 80780 47776 039 Kauf Betrieb durch Pächter5 0183 8096 703 Diversifizierung 2 1094 357 Wohngebäude 40 67053 83455 255 Ökonomiegebäude 105 020119 444125 573 Gemeinschaftlicher Inventarkauf,Verarbeitung und Lagerung landwirtschaftlicher Produkte9 13723 01721 433 Bodenverbesserungen,ohne Baukredite2 8573 3174 596 Betriebshilfedarlehen 1 29 81531 17516 592 1vom Kanton bewilligt Quelle:BLW
Tabelle
Übersicht
Tabelle
Übersicht
Tabelle 49
Umschulungsbeihilfen 2005
Tabelle 50
Finanzhilfen für die Tierzucht 2005
ANHANG A57
Kantonzugesicherte Beiträgeausbezahlte Beiträge 1 AnzahlFr.AnzahlFr. ZH BE1 125 7502 19 500 LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO 2 71 900 BL SH AR AI SG GR1 153 000 AG TG TI VD VS1 136 950 NE GE JU Total3 415 700 4 91 400 1von Zusicherungen des Vorjahres Quelle:BLW
Tierart und MassnahmenBetragHerdebuchtiereZuchtorganisationen Fr.Anzahl Rinder13 759 000541 2099 Herdebuchführung2 685 000 Milch- und Fleischleistungsprüfungen10 400 000 Exterieurbeurteilungen675 000 Pferde1 071 0004 677 1 23 Schweine1 735 00015 8312 Schafe1 096 00085 4716 Ziegen und Milchschafe846 00029 6734 Herdebuchführung593 000 Milchleistungsprüfungen253 000 Gefährdete Rassen940 0001 Total19 447 000 1 identifizierte Fohlen Quellen:Staatsrechnung/Zuchtorganisationen
Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen. Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung,diejenigen zwischen 2003 und 2005 sind jedoch wieder vergleichbar.Die Zunahme der Verwaltungsausgaben ist vor allem darauf zurückzuführen,dass Leistungen wie z.B.für die Pensionskassen in der Staatsrechnung nicht mehr zentral geführt sondern auf die einzelnen Ämter aufgeteilt werden.
Quelle:Staatsrechnung
A58 ANHANG
51 Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung,in 1000 Fr. Ausgabenbereich1990/922003200420051990/92–2003/05 % Ausgaben BLW2 699 4423 547 7693 543 6133 439 97230.0 Zahlungsrahmen-3 448 0043 431 7953 318 501 Produktion und Absatz1 684 994798 028731 419676 975-56.4 Absatzförderung-59 23463 67456 676Milchwirtschaft1 127 273559 979503 513474 232-54.5 Viehwirtschaft133 90224 85122 49920 574-83.1 Pflanzenbau423 819153 964141 734125 493-66.9 Direktzahlungen772 2582 435 0002 498 3482 464 000219.3 Allgemeine Direktzahlungen758 3321 980 0002 023 0001 989 000163.4 Ökologische Direktzahlungen13 926455 000475 348475 0003 263.8 Grundlagenverbesserung185 836214 976202 028177 5266.6 Strukturverbesserungen133 879102 00094 50885 026-29.9 Investitionskredite27 13679 41876 46368 000175.0 Betriebshilfe95211 7208 8141 588674.6 Pflanzen- und Tierzucht23 86921 83822 24322 821-6.6 Ausserhalb Zahlungsrahmen-99 765111 818121 472 Verwaltung33 42950 32252 06549 21751.2 Beratungswesen und Forschungsbeiträge21 47623 73623 64123 84410.5 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge1 4493 6411 7092 98391.7 Tierverkehrskontrolle/Entsorgung Fleischabfälle-22 06634 40345 428Weitere Ausgaben348 163359 989358 193330 8210.4 Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte93 867114 900114 90090 00013.6 Familienzulagen in der Landwirtschaft77 99681 20077 80076 8000.8 Landwirtschaftliche Forschungsanstalten96 431121 685121 487120 06325.6 Gestüt6 8437 6407 7607 67012.4 Übriges73 02634 56436 24636 288-51.1 Total Landwirtschaft und Ernährung3 047 6053 907 7583 901 8063 770 79326.7 Anmerkung:Die
Tabelle
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Internationale Aspekte
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Niederlande (NL) oder Belgien (B)
EU-6:EU-4 plus Niederlande (NL) und Belgien (B)
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
Anmerkung:Einige Zahlen sind aufgrund von Eurostat-Indizes berechnet
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ANHANG A59
52
tierische Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder ProduktLandEinheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % MilchCHRp./kg104.9775.5474.6372.41-29 EU-5Rp./kg56.5547.1346.5746.10-18 - DRp./kg57.2845.6445.4544.94-21 - FRp./kg48.6745.8244.4643.65-8 - IRp./kg68.7653.9454.2754.37-21 - ARp./kg66.6445.1445.5745.58-32 - NLRp./kg57.9347.7346.8846.60-19 USARp./kg40.5737.1043.9041.611 MuniCHFr./kg SG9.288.198.177.97-13 EU-4Fr./kg SG5.594.184.304.73-21 - DFr./kg SG5.223.794.044.56-21 - FFr./kg SG5.564.134.194.67-22 - IFr./kg SG5.834.584.654.93-19 - AFr./kg SG6.494.094.144.66-34 USAFr./kg SG4.354.584.504.756 KälberCHFr./kg SG14.3912.1512.6113.20-12 EU-5Fr./kg SG8.657.958.377.92-7 - DFr./kg SG8.989.099.479.845 - FFr./kg SG8.948.919.498.751 - IFr./kg SG8.817.047.196.98-20 - AFr./kg SG9.606.977.117.29-26 - NLFr./kg SG7.836.967.426.86-10 USAFr./kg SG5.055.325.756.3315 SchweineCHFr./kg SG5.834.474.544.02-25 EU-6Fr./kg SG2.931.942.102.14-30 - DFr./kg SG2.881.902.202.23-27 - FFr./kg SG2.841.872.022.09-30 - IFr./kg SG3.482.482.512.49-28 - AFr./kg SG3.181.541.791.85-46 - NLFr./kg SG2.641.921.811.90-29 - BFr./kg SG3.011.842.072.07-34 USAFr./kg SG1.881.411.781.73-13 PouletsCHFr./kg LG3.722.722.672.60-28 EU-5Fr./kg LG1.491.131.161.10-24 - DFr./kg LG1.431.081.101.08-24 - FFr./kg LG1.301.021.061.01-21 - IFr./kg LG1.891.501.491.30-25 - AFr./kg LG2.291.221.241.25-46 - NLFr./kg LG1.360.961.001.08-26 USAFr./kg LG0.981.051.241.1918 EierCHFr./100 St.33.2923.4423.3323.88-29 EU-5Fr./100 St.10.6710.398.378.04-16 - DFr./100 St.13.1211.429.929.68-21 - FFr./100 St.8.608.055.715.60-25 - IFr./100 St.12.8613.1812.5511.32-4 - AFr./100 St.12.6716.6715.4715.1624 - NLFr./100 St.7.948.784.895.03-21 USAFr./100 St.7.558.437.265.65-6
Tabelle
Produzentenpreise
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Niederlande (NL) oder Belgien (B)
EU-6:EU-4 plus Niederlande (NL) und Belgien (B)
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–2001/04
Anmerkung:Einige Zahlen sind aufgrund von Eurostat-Indizes berechnet
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
A60 ANHANG
Produzentenpreise pflanzliche ErzeugnisseSchweiz – diverse Länder ProduktLandEinheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % WeizenCHFr./100 kg99.3461.1357.8452.42-42 EU-4Fr./100 kg28.5917.7018.3415.09-40 - DFr./100 kg26.8116.7816.9314.10-41 - FFr./100 kg28.3717.9018.8415.46-39 - IFr./100 kg35.9222.1223.4718.48-41 - AFr./100 kg43.3015.3013.7812.29-68 USAFr./100 kg15.3216.9816.3015.386 GersteCHFr./100 kg70.2445.8244.2642.24-37 EU-4Fr./100 kg25.9715.3715.9514.85-41 - DFr./100 kg24.4714.4515.0514.52-40 - FFr./100 kg25.6716.0316.6014.83-38 - IFr./100 kg34.5221.3823.0620.10-38 - AFr./100 kg36.0513.2912.3212.55-65 USAFr./100 kg12.3014.0011.3910.10-4 KörnermaisCHFr./100 kg73.5446.3143.3142.23-40 EU-4Fr./100 kg33.7220.3521.1517.41-42 - DFr./100 kg30.4418.9518.2216.01-42 - FFr./100 kg29.6318.8519.7517.15-37 - IFr./100 kg40.8023.3125.4318.88-45 - AFr./100 kg36.3719.4713.9213.51-57 USAFr./100 kg12.7612.0112.069.64-12 KartoffelnCHFr./100 kg38.5536.2133.3834.30-10 EU-6Fr./100 kg16.9919.1016.6014.93-1 - DFr./100 kg13.6917.0111.7211.39-2 - FFr./100 kg15.5016.1616.4314.491 - IFr./100 kg43.7953.5259.0055.1228 - AFr./100 kg30.3622.7815.2810.87-46 - NLFr./100 kg16.3115.4414.5711.08-16 - BFr./100 kg12.4917.6711.2511.969 USAFr./100 kg18.0818.3215.9317.98-4 ZuckerrübenCHFr./100 kg14.8411.8711.8511.77-20 EU-4Fr./100 kg7.376.286.266.07-16 - DFr./100 kg7.896.376.276.10-21 - FFr./100 kg5.845.745.565.21-6 - IFr./100 kg9.597.247.737.83-21 - AFr./100 kg9.217.117.217.23-22 USAFr./100 kg----RapsCHFr./100 kg203.6781.6976.6076.83-62 EU-4Fr./100 kg48.7135.0833.2930.08-33 - DFr./100 kg55.4534.9135.4329.99-40 - FFr./100 kg41.7735.6131.4630.42-22 - IFr./100 kg52.5325.4827.4425.39-50 - AFr./100 kg53.7031.2129.4426.67-46 USAFr./100 kg----Äpfel:Golden Delicious 1 CHFr./kg1.121.211.061.01-2 EU-5Fr./kg0.790.640.660.51-24 - DFr./kg1.070.650.610.48-46 - FFr./kg0.680.580.650.58-11 - IFr./kg0.750.690.720.46-16 - A (div.)Fr./kg1.020.650.540.46-46 - BFr./kg0.800.610.570.50-30 USA (div.)Fr./kg0.660.730.770.596
Tabelle 53a
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Niederlande (NL) oder Belgien (B)
EU-6:EU-4 plus Niederlande (NL) und Belgien (B)
EU-4/6:An die Schweiz angrenzende EU-Länder (D,F,I,A) sowie für bestimmte Erzeugnisse mit hohen Produktionsvolumen Belgien (B) und/oder die Niederlande (NL).
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–2001/04
2 Der «Standardwarenkorb» setzt sich grob aus der durchschnittlichen Produktion (1998–2000) der Schweiz von 15 der 17 landwirtschaftlichen Erzeugnisse zusammen, die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleichs sind (Tabellen 52 und 53).Da die Preisstatistik für Zuckerrüben und Raps der USA nicht verfügbar war, sind diese beiden Produkte nicht im «Standardwarenkorb» enthalten.Dieser entspricht 3.2 Mio.t Milch,2.7 Mio.Schweinen,35.5 Mio. Poulets,674.3 Mio.Eiern, 0.52 Mio.t Weizen,0.14 Mio.t Äpfeln usw.
Anmerkung:Einige Zahlen sind aufgrund von Eurostat-Indizes berechnet
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ANHANG A61 Tabelle 53b Produzentenpreise pflanzliche Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder ProduktLandEinheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % Birnen I 1 CHFr./kg1.331.240.981.09-17 EU-5Fr./kg0.960.810.810.86-14 - DFr./kg1.100.720.570.60-43 - FFr./kg1.091.061.040.92-8 - IFr./kg0.900.690.710.84-17 - AFr./kg1.201.000.830.73-29 - BFr./kg0.950.940.990.992 USAFr./kg0.570.620.610.7012 KarottenCHFr./kg1.091.371.261.3823 EU-6Fr./kg0.520.570.520.501 - DFr./kg0.480.400.360.42-18 - FFr./kg0.440.600.490.5927 - IFr./kg0.831.061.080.8520 - AFr./kg0.420.260.210.18-48 - NLFr./kg0.390.210.070.12-66 - BFr./kg0.360.260.390.16-23 USAFr./kg0.410.600.580.5944 ZwiebelnCHFr./kg0.891.061.190.9721 EU-5Fr./kg0.540.530.450.44-12 - DFr./kg0.300.270.200.10-37 - FFr./kg0.600.850.700.7428 - IFr./kg0.700.480.450.47-34 - AFr./kg0.250.240.210.12-25 - BFr./kg0.210.310.230.149 USAFr./kg0.400.580.410.3714 TomatenCHFr./kg2.422.412.372.34-2 EU-6Fr./kg0.980.880.690.84-18 - DFr./kg0.891.160.861.1317 - FFr./kg1.311.360.981.28-8 - IFr./kg0.900.760.640.74-21 - AFr./kg0.391.180.520.4783 - NLFr./kg1.251.430.881.35-3 - BFr./kg1.220.890.720.89-32 USAFr./kg1.001.111.271.2320 Standardwarenkorb 2 CHMio.Fr./Jahr7 2685 5145 4515 400-25 EU-4/6Mio.Fr./Jahr3 7152 9672 9852 962-20 DMio.Fr./Jahr3 7422 9162 9552 940-22 FMio.Fr./Jahr3 4132 9352 9352 919-14 IMio.Fr./Jahr4 4493 5103 5653 514-21 AMio.Fr./Jahr4 3792 8132 8012 804-36 USA Mio.Fr./Jahr2 5792 4262 7332 6010
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
Anmerkung zu «Land»:min und max -> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster resp.höchster Preis des betreffenden Landes
Anmerkung:Der Anteil der Labelprodukte (Bio,M-7,Coop Natura Plan) in den Geschäften ist insbesondere beim Fleisch in der Schweiz grösser als im Ausland.
Quellen:BLW,BFS,ZMP,Eurostat,nationale Statistikämter von D,F,B,A,USA,Statistikamt der Stadt Turin (I)
A62 ANHANG
54 Konsumentenpreise tierische Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder ProduktLandEinheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % KonsummilchCHFr./l1.851.531.541.54-17 EU-4Fr./l1.301.161.161.16-10 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./l1.070.880.890.88-17 - max (I:90/92,03,04,05)Fr./l1.821.961.881.946 USAFr./l1.040.981.041.05-2 KäseCH-EmmentalFr./kg20.1520.8919.9319.630 EU-4 (EU-4 mit B,ohne F)Fr./kg15.9812.8212.9212.81-20 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./kg13.529.879.749.66-28 - max (I:90/92,B:03,05,I:04)Fr./kg20.6818.2518.2918.27-12 USA (Cheddar)Fr./kg11.1411.7111.7012.036 ButterCHFr./kg13.7611.9711.8411.34-15 EU-4Fr./kg9.047.957.997.88-12 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./kg6.815.265.315.18-23 - max (I:90/92,03,04,05)Fr./kg12.9011.8811.7811.58-9 USAFr./kg5.968.349.559.0151 RahmCHFr./ 1⁄4 l3.582.912.852.86-20 EU-3 (EU-4 mit B,ohne F und I)Fr./ 1⁄4 l1.250.950.950.93-25 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./ 1⁄4 l1.130.850.850.83-26 - max (A:90/92,B:03,04,05)Fr./ 1⁄4 l2.531.691.681.69-33 USAFr./ 1⁄4 l Braten RindCHFr./kg26.3427.1628.5627.896 EU-4Fr./kg16.0015.3716.1716.470 - min (F:90/92,03,04;D:05)Fr./kg11.8512.4913.3013.5211 - max (A:90/92,03,04,05)Fr./kg24.3224.2024.7826.183 USAFr./kg9.2610.9410.1210.2513 Braten SchweinCHFr./kg18.4319.9020.3419.598 EU-4Fr./kg11.8011.4311.7311.83-1 - min (A: 90/92,02;D:03,04,05)Fr./kg10.009.429.599.67-4 - max (I:90/92,03,04,05)Fr./kg13.6714.0514.4814.274 USAFr./kg Koteletts SchweinCHFr./kg19.8821.3220.4919.924 EU-4Fr./kg10.629.659.9410.05-7 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./kg9.718.558.838.90-10 - max (I: 90/92,02;A:03,04,05)Fr./kg12.4310.8711.2512.03-8 USAFr./kg10.029.278.438.93-11 SchinkenCHFr./kg25.5629.9931.1429.6718 EU-4Fr./kg22.1320.6621.2421.50-5 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./kg20.3818.6918.8719.02-7 - max (I:90/92,03,04,05)Fr./kg27.1526.3028.0228.842 USAFr./kg8.858.578.368.68-4 Poulets frischCHFr./kg8.418.909.019.127 EU-4Fr./kg5.725.205.235.21-9 - min (F:90/92,03,04,05)Fr./kg4.844.234.454.43-10 - max (I:90/92,03,04,05)Fr./kg6.176.656.676.497 USAFr./kg2.743.072.932.908 EierCHFr./St.0.570.610.630.6210 EU-4 (EU-4 mit B,ohne F)Fr./St.0.250.260.270.278 - min (B:90/92,03,04,05)Fr./St.0.220.250.250.238 - max (A:90/92,03,04,05)Fr./St.0.330.370.390.4017 USAFr./St.0.100.120.110.118
Tabelle
1022 0012 0492 077-3 USA 2 Fr./Warenkorb1 1081 2291 1981 21610
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A) Anmerkung zu «Land»:min und max -> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster resp.höchster Preis des betreffenden Landes
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Änderung 1990/93–2001/04
2 Statistikfehler bei den Preisen für Rahm (32.27 Packungen à 2.5 dl),Schweinebraten (8.43 kg),Zwiebeln (4.53 kg) und Karotten (8.84 kg),denn der «Standardwarenkorb» der USA ist mit demjenigen der Schweiz und der EU nicht identisch:Diese 4 nicht enthaltenen Produkte werden im «Standardwarenkorb» durch 8.07 kg Butter resp.8.43 kg Schweinekoteletts,4.53 kg Tomaten und 8.84 kg Kartoffeln zusätzlich ersetzt.
3 Der «Standardwarenkorb» entspricht grob dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz pro Jahr (s.Tabelle 10) der 21 Lebensmittel,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleichs sind (Tabellen 54 und 55).«Grob»,da beispielsweise der Rinderbraten für das gesamte Rindfleischsortiment steht.Der Warenkorb entspricht 380 kg bzw.91% der 417 kg Nahrungsmittel (ohne Wein),die jährlich pro Kopf in der Schweiz konsumiert werden.Er setzt sich zusammen aus 83.03 l Milch,19.80 kg Käse, 5.77 kg Butter,32.27 Rahmpackungen à 2.5 dl,10.17 kg Rinderbraten,8.43 kg Schweinebraten,8.43 kg Schweinekoteletts,8.43 kg Schinken,9.81 kg Frischpoulet,187 Eiern, 25.25 kg Weissmehl,50.50 Weissbroten à 500 gr.,43.29 kg Kartoffeln,47.71 kg Zucker,17.09 Pflanzenöl,14.39 kg Goldenäpfeln,3.33 kg Birnen,10.15 kg Bananen, 8.84 kg Karotten,4.53 kg Zwiebeln und 9.89 kg Tomaten.
Quellen:BLW,BFS,ZMP,Eurostat,nationale Statistikämter von D,F,B,A,USA,Statistikamt der Stadt Turin (I)
ANHANG A63
Konsumentenpreise pflanzliche Erzeugnisse und Standardwarenkorb Schweiz – diverse Länder ProduktLandEinheit1990/922003200420051990/92–2003/05 % WeissmehlCHFr./kg2.051.711.791.78-14 EU-4 (EU-4 mit B,ohne F)Fr./kg1.100.940.970.96-13 - min (D:90/92;B:03,04,05)Fr./kg0.790.810.850.866 - max (A:90/92,03,04,05)Fr./kg1.671.171.301.32-25 USAFr./kg0.750.920.830.8917 WeissbrotCHFr./ 1⁄2 kg2.091.801.821.82-13 EU-4Fr./ 1⁄2 kg1.491.561.621.658 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./ 1⁄2 kg1.160.971.001.00-15 - max (A:90/92,03,04,05)Fr./ 1⁄2 kg2.983.123.293.4110 USAFr./ 1⁄2 kg1.121.481.331.4327 KartoffelnCHFr./kg1.432.162.232.2655 EU-5 (EU-4 mit B)Fr./kg0.921.161.211.1427 - min (B:90/92;D:03,04,05)Fr./kg0.560.830.900.9057 - max (A:90/92;F:03,04,05)Fr./kg1.271.661.841.7136 USAFr./kg1.041.361.241.2925 Zucker CHFr./kg1.651.591.591.65-2 EU-3 (EU-4 mit B,ohne D,F)Fr./kg1.751.511.561.54-12 - min (B:90/92,03,04,05)Fr./kg1.671.461.501.52-10 - max (A:90/92,03,04,05)Fr./kg1.891.661.681.67-12 USAFr./kg1.221.251.151.15-3 PflanzenölCH - SonnenblumenölFr./l5.054.304.894.81-8 «EU-4» (EU-4 mit B,ohne D)Fr./l2.812.482.462.40-13 - min (I:90/92,03,04,05)Fr./l1.942.192.212.1513 - max (F:90/92,03,A:04,05)Fr./l3.562.712.682.72-24 USA - SalatölFr./l2.262.812.762.7623 Äpfel:Golden Delicious 1 CHFr./kg3.153.674.043.8222 EU-4 (F und A:div.Sorten)Fr./kg3.162.762.982.88-9 - min (A:90/92,04,05;I:03)Fr./kg2.942.332.672.40-16 - max (D:90/92;F:03,04,05)Fr./kg3.253.253.443.201 USAFr./kg2.582.912.862.618 Birnen 1 CHFr./kg3.253.693.763.5613 EU-4Fr./kg3.432.972.982.95-14 - min (D:90/92,03,04;I:05)Fr./kg3.322.672.692.71-19 - max (F:90/92,03,04,05)Fr./kg3.623.533.473.40-4 USAFr./kg2.522.943.203.0422 BananenCHFr./kg2.523.032.922.8416 EU-4Fr./kg2.612.152.162.35-15 - min (D:90/92,03,04,05)Fr./kg1.891.861.911.951 - max (I:90/92;A:03,04,05)Fr./kg3.562.492.492.76-28 USAFr./kg1.451.511.361.35-3 KarottenCHFr./kg1.912.262.162.0212 EU-5 (EU-4 mit B)Fr./kg1.711.441.421.40-17 - min (B:90/92,03,04;D:05)Fr./kg1.061.121.081.093 - max (I:90/92,03,04,05)Fr./kg2.321.781.911.84-21 USAFr./kg1.35 ZwiebelnCHFr./kg1.862.392.281.9519 EU-5 (EU-4 mit B)Fr./kg1.541.701.801.7514 - min (B:90/92,03,04,05)Fr./kg0.921.091.141.0117 - max (I:90/92;F:03,04,05)Fr./kg1.752.422.552.4040 USAFr./kg1.29 TomatenCHFr./kg3.733.673.293.59-6 EU-5 (EU-4 mit B)Fr./kg3.603.603.153.39-6 - min (F:90/92;D:03,04,05)Fr./kg3.332.802.422.43-23 - max (I:90/92,03,04,05)Fr./kg4.414.714.514.685 USA (Freiland)Fr./kg3.294.484.404.4235 Standardwarenkorb (tier.+ pfl.Prod.) 3 CHFr./Warenkorb2 2712 3212 3412 3022 EU-4/5Fr./Warenkorb1 5731 4301 4591 461-8 Unteres Mittel EUFr./Warenkorb1 3141 1671 1911 184-10 Oberes Mittel EUFr./Warenkorb2
Tabelle 55
Rechtserlasse
Rechtserlasse,Begriffe und Methoden
Rechtserlasse sind im Internet unter folgender Adresse einzusehen: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00258/index.html?lang=de
Begriffe und Methoden
Begriffe und Methoden sind im Internet unter folgender Adresse einzusehen: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00258/index.html?lang=de
A64 ANHANG ■■■■■■■■■■■■■■■■
Abkürzungen
Organisationen/Institutionen
ACWForschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW
AgrideaEntwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
ALPForschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
ARTForschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
BAGBundesamt für Gesundheit,Bern
BBTBundesamt für Berufsbildung und Technologie,Bern
BFSBundesamt für Statistik,Neuenburg
BLWBundesamt für Landwirtschaft,Bern
BSVBundesamt für Sozialversicherung,Bern
BAFUBundesamt für Umwelt,Bern
BVETBundesamt für Veterinärwesen,Bern
BWLBundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung,Bern
ETHEidgenössische Technische Hochschule,Zürich
EUEuropäische Union
EVDEidg.Volkswirtschaftsdepartement,Bern
EZVEidg.Zollverwaltung,Bern
FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations,Rom
FiBLForschungsinstitut für Biologischen Landbau,Frick
IAWInstitut für Agrarwirtschaft,Zürich
OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development,Paris
OZDOberzolldirektion,Bern
SBVSchweizerischer Bauernverband,Brugg
secoStaatssekretariat für Wirtschaft,Bern
SMPSchweizerische Milchproduzenten,Bern
TSMTreuhandstelle Milch,Bern
WTOWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation),Genf
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft,Bonn
Masseinheiten
dtDezitonne = 100 kg
Fr.Franken
hStunden
haHektare = 10 000 m2
hlHektoliter
KcalKilokalorien
kgKilogramm
kmKilometer
lLiter mMeter
m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
Mio.Million
Mrd.Milliarde
ANHANG A65 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Rp.Rappen
St.Stück
tTonne
%Prozent
ØDurchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGISAgrarpolitisches Informationssystem
AHVAlters- und Hinterlassenenversicherung
AKArbeitskraft
AKZAAusserkontingentszollansatz
BSEBovine spongiforme Enzephalopathie («Rinderwahnsinn»)
BTSBesonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw.beziehungsweise
BZ I,II,…Bergzone
ca.zirka
CO2 Kohlendioxid
EOErwerbsersatzordnung
FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheit
GAPGemeinsame Agrarpolitik der EU
GGAGeschützte Geografische Angaben
GUBGeschützte Ursprungsbezeichnung
GVEGrossvieheinheit
GVOGentechnisch veränderte Organismen
inkl.inklusive
IPIntegrierte Produktion
IVInvalidenversicherung
JAEJahresarbeitseinheit
KZAKontingentszollansatz
LGLebendgewicht
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche
LwGLandwirtschaftsgesetz
MwstMehrwertsteuer
NStickstoff
NWRNachwachsende Rohstoffe
ÖAFÖkologische Ausgleichsfläche
ÖLNÖkologischer Leistungsnachweis
PPhosphor
PSMPflanzenschutzmittel
RAUSRegelmässiger Auslauf im Freien
RGVERaufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAKStandardarbeitskraft
SGSchlachtgewicht
u.a.unter anderem
vgl.vergleiche
z.B.zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B.Tabellen)
A66 ANHANG
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),verschiedene Jahrgänge. Agrarbericht 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005.
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),2005. Auswertung der Daten über die Milchkontingentierung;Milchjahr 2003/2004.
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),2005. Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente. gemäss Punkt 2 des Berichtes vom 11.Februar 2004 des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen 2003,Separatdruck.
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau,Reckenholz (FAL),2001. Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau 2001. Agrarforschung,8 (6).
Keller A.,Rossier N.,Desaules A.,2005.
Schwermetallbilanzen von Landwirtschaftsparzellen der Nationalen Bodenbeobachtung. Schriftenreihe der FAL 54.
Schweizerischer Bauernverband (SBV),verschiedene Jahrgänge. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg.
Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL),2005.
Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz und in den EU-Nachbarländern Deutschland und Frankreich.
Studie im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft,Zollikofen.
Wicki W.,Pfister M.,2000.
Wissen,Einstellungen und Handlungsstrategien von Schweizer Bauern und Bäuerinnen im Zusammenhang mit Einkommenseinbussen und materieller Knappheit. Hochschule für Sozialarbeit HSA,Bern.
ANHANG A67 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Literatur
A68 ANHANG