

Agrarbericht 2005 des Bundesamtes für Landwirtschaft
Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
Telefon:031 322 25 11
Telefax:031 322 26 34
Internet:www.blw.admin.ch
Copyright:BLW,Bern 2005
Gestaltung
Artwork,Grafik und Design,St.Gallen
Druck RDV AG,Berneck
Fotos
–Agrofot Bildarchiv
– Agroscope FAL Reckenholz
– Agroscope FAW Wädenswil
–Agroscope RAC Changins
–BLW Bundesamt für Landwirtschaft
–Christof Sonderegger,Fotograf
–Corbis
–Herbert Mäder,Fotograf
–Peter Mosimann,Fotograf
–Peter Studer,Fotograf
–PhotoDisc Inc.
–SBV Schweizerischer Bauernverband
–Tobias Hauser,Fotograf
Bezugsquelle
BBL,Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern
Bestellnummern:
Deutsch:730.680.05 d
Französisch:730.680.05 f
Italienisch:730.680.05 i
Telefax:031 325 50 58
Internet:www.bundespublikationen.ch
Das Berichtsjahr 2004 war im mehrjährigen Vergleich ein überdurchschnittliches Landwirtschaftsjahr.Gute Erträge im Pflanzenbau und stabile Verhältnisse auf den Schlachtviehmärkten trugen wesentlich zu diesem positiven Resultat bei.Für das Jahr 2005 ist wieder ein deutlicher Einkommensrückgang zu erwarten.Die Schätzungen zeigen,dass die Einkommen auf den Stand von 2003 zurückfallen dürften.

Die Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft verlangt, dass die ökonomischen,sozialen und ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik und der Leistungen der Landwirtschaft untersucht werden und darüber informiert wird. Die Berichterstattung mit Indikatoren basiert erstmals auf einem Konzept,dem die bundesrätliche Nachhaltigkeitsdefinition zu Grunde liegt.Im Einzelnen machen die Indikatoren Aussagen zu den Ressourcen,zur Effizienz und zur Gerechtigkeit.Ob eine Entwicklung nachhaltig ist,lässt sich nicht aus kurzfristigen Entwicklungstrends ablesen.Die Indikatoren in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zeigen deshalb wo möglich Entwicklungen ab 1990 auf.
Die Entwicklung in der Landwirtschaft hat aus einer Nachhaltigkeitsperspektive viele positive und einige eher negative Aspekte.Im Bereich der Ökonomie hat sich die Arbeitsproduktivität verbessert.Positiv ist,dass die Investitionen in Gebäude,Maschinen und Einrichtungen im Verhältnis zum gesamten Kapitalbestand seit 1990 konstant geblieben sind.Negativ zu Buche schlägt hingegen die Abnahme bei den ackerfähigen Böden.Langfristig wird damit die Versorgungssicherheit geschwächt.Beim Sozialen vergrösserte sich der Einkommensabstand zur übrigen Bevölkerung,was aus einer Nachhaltigkeitsperspektive negativ zu werten ist.Hier ist anzumerken,dass der Abstand vor Beginn der Agrarreform 1993 grösser wurde und seit diesem Zeitpunkt ziemlich konstant blieb.Zu den Indikatoren Lebensqualität und Ausbildung kann bezüglich Entwicklung noch keine Aussage gemacht werden.Bei der Ökologie war in den Bereichen Stickstoff,Pflanzenschutzmittel,Biodiversität und Bodenqualität eine positive Entwicklung festzustellen.Allerdings sind in allen Bereichen weitere Verbesserungen notwendig.Negativ zu beurteilen ist der Indikator Energie.Die Energieeffizienz ist zwar konstant geblieben,eine Substitution von fossiler durch erneuerbare Energie konnte hingegen nicht beobachtet werden.Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist dies eine zentrale Herausforderung,welche allerdings nicht durch die Agrarpolitik gelöst werden kann.Dasselbe gilt auch für die negative Entwicklung beim Indikator ackerfähige Böden.
Insgesamt blieb die Entwicklung in der Landwirtschaft in den Jahren der Agrarreform nachhaltig,insbesondere in jenen Bereichen,welche durch die Agrarpolitik beeinflusst werden konnten.Eine nachhaltige Entwicklung ist auch das Ziel für die Zukunft.Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe.An der Aussenfront ist mit der laufenden WTO-Runde gemäss den heutigen Kenntnissen ein wesentlicher zusätzlicher Abbau des Grenzschutzes zu erwarten.An der Innenfront wird das Agrarbudget weiter unter Spardruck stehen.Diese Herausforderungen wurden bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik für die Periode 2008 bis 2011 berücksichtigt.Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement hat am 14.September 2005 die Vernehmlassung zur Agrarpolitik 2011 eröffnet.Mit der Agrarpolitik 2011 wird der Reformkurs konsequent und vorausschauend weitergeführt.Um die Konkurrenzfähigkeit der Nahrungsmittelproduktion zu
stärken,werden alle Exportsubventionen und mehr als die Hälfte der Marktstützungsmittel in produktunabhängige Direktzahlungen umgelagert.Die finanziellen Mittel in der Höhe von 3,36 Mrd.Fr.pro Jahr für die Periode 2008 bis 2011 erlauben es,dass die Entwicklung sozialverträglich bleibt.Neu beurteilt werden muss die Situation,falls der Abschluss der WTO-Verhandlungen oder ein allfälliges Freihandelsabkommen mit den USA Einbussen für die Landwirtschaft mit sich bringen,welche über diejenigen der Agrarpolitik 2011 hinausgehen.
Die Vernehmlassung zur Agrarpolitik 2011 dauert bis zum 16.Dezember 2005.Die Stellungnahmen werden zeigen,ob die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik eine Mehrheit finden und wo allenfalls noch Änderungen vorgenommen werden müssen.Geplant ist,dass der Bundesrat im Frühjahr 2006 die Botschaft Agrarpolitik 2011 zuhanden des Parlamentes verabschiedet,damit die parlamentarischen Beratungen im Herbst 2006 in Angriff genommen werden können.Ziel ist es, dass die Ausführungsbestimmungen Ende 2007 bekannt sind und 2008 in Kraft treten können.
Manfred Bötsch
In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
c.dezentralen Besiedlung des Landes».
Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.
Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.
Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor,dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen,sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt,jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.
Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

1.1.1
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Strukturentwicklungen
Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft richtet sich das Augenmerk in diesem Jahr auf die Entwicklung der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten.Als Basis dienen dabei die Landwirtschaftlichen Betriebszählungen ab 1990 und die seit 1996 jährlich stattfindenden Betriebsstrukturerhebungen.
Seit mehreren Jahrzehnten nimmt die Zahl der Betriebe stetig ab.In den fünfziger und sechziger Jahren lag die durchschnittliche Abnahme pro Jahr bei rund 2%.Etwas schwächer war sie in den zwei darauffolgenden Jahrzehnten.Mit der Neuorientierung der Agrarpolitik in den neunziger Jahren setzte wieder ein höherer Strukturwandel ein. In den ersten vier Jahren des neuen Jahrtausends ist die jährliche Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren wieder zurück gegangen.
Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Grössenklassen und Regionen
Die zahlenmässige Abnahme der Betriebe im Zeitraum von 1990 bis 2000 betraf rund zur Hälfte Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha.Zunahmen wurden hingegen bei Betrieben der Grössenklassen über 20 ha festgestellt.
In den ersten vier Jahren des neuen Jahrtausends schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber 1990 bis 2000 etwas ab.Zugenommen hat sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3 bis 10 ha und 10 bis 20 ha. Die Wachstumsschwelle stieg von 20 auf 25 ha.Dies bedeutet,dass seit 2000 per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha abgenommen und über diesem Wert zugenommen hat.
Zwischen 1990 und 2000 nahm die Zahl der Betriebe in der Talregion um rund 10’000 ab,in der Hügel- und Bergregion wurden zirka 5’500 bzw.6’500 weniger Betriebe gezählt.Die jährliche Abnahmerate in dieser Zeit war in den drei Regionen vergleichbar.Zwischen 2000 und 2004 hat sie gegenüber den zehn Jahren zuvor in der Talregion stärker abgenommen als in der Hügel- und Bergregion.
Bei den Haupterwerbsbetrieben ist die Abnahmerate in der Periode 2000–2004 gegenüber den neunziger Jahren in allen Regionen zurückgegangen.In der Bergregion war sie mit –0,7% am tiefsten.Bei den Nebenerwerbsbetrieben ist die Abnahmerate im Vergleich zum Jahrzehnt zuvor insbesondere in der Bergregion angestiegen. Insgesamt ging zwischen 2000 und 2004 die Zahl der Haupterwerbsbetriebe um 2'833 und jene der Nebenerwerbsbetriebe um 3'238 zurück.

■ Beschäftigte
In den letzten Jahren hat parallel zur Zahl der Betriebe auch die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich abgenommen.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigten
MerkmalAnzahl BeschäftigteVeränderung pro Jahr in %
Familieneigene217 477165 977159 447–2,7–1,0
davon:
Betriebsleiter88 88974 72469 348–1,7–1,8
Betriebsleiterinnen3 9262 3462 030–5,0–3,6
Familienfremde36 08437 81630 9310,5–4,9
Total253 561203 793190 378–2,2–1,7
Quelle:BFS
Im Jahr 2000 wurden in der Landwirtschaft gesamthaft 49'768 Beschäftigte weniger gezählt als noch 1990.Abgenommen haben in diesem Zeitraum ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte erfuhr eine leichte Zunahme.
Zwischen 2000 und 2004 schwächte sich der Rückgang der Beschäftigten gesamthaft ab.Klar weniger abgenommen hat in diesem Zeitraum die Anzahl familieneigene Arbeitskräfte.Bei den familienfremden Beschäftigten war der Rückgang hingegen deutlich.Im Jahr 2004 waren fast 7'000 Personen (–18%) weniger angestellt als im Jahr 2000.Bei den Familieneigenen fällt auf,dass die Abnahmerate der Betriebsleiter gegenüber dem Jahrzehnt 1990–2000 praktisch gleich geblieben ist.

■ Bruttowertschöpfung
Wirtschaftliche Kennziffern
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ist ein Massstab für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft.Sie entspricht dem Saldo aus den Geldströmen des Bruttoproduktionswertes und der Vorleistungen.Sie dient der Bezahlung der Produktionsfaktoren – Arbeit (Personalkosten) und Kapital (Nettobetriebsüberschuss) –, Abschreibungen (Wertminderungen des Anlagevermögens) sowie der indirekten Steuern,abzüglich Subventionen.Die erwähnten Ströme (Produktion,Vorleistungen und Wertschöpfung) lassen sich nach Branchen,institutionellen Sektoren (nichtfinanzielle Unternehmen,Finanzinstitute,Versicherungsunternehmen,usw.) oder aber nach Wirtschaftssektoren gliedern.
Entwicklung der Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren Angaben zu laufenden Preisen
■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen der drei Wirtschaftssektoren entwickelte sich in der Zeitspanne 1998–2003 unterschiedlich.Während sie im Primärsektor um 18,4% sank,stieg sie im Sekundär- und Tertiärsektor um 6,4% bzw.12,6%. Gesamthaft wurde in der betrachteten Periode eine Zunahme von 10,4% festgestellt.Die gesamte Wirtschaft erreichte im Jahr 2003 eine Bruttowertschöpfung von 438'507 Mio.Fr.Der Anteil des 1.Sektors war mit 1,0% gering.Davon entfielen rund drei Viertel auf die Landwirtschaft.
Im Berichtsjahr nahmen die gesamten Einfuhren gegenüber dem Vorjahr um 6,7% zu,die gesamten Ausfuhren um 8,6%.Die Importe stiegen von total 129,7 auf 138,8 Mrd.Fr.,die Exporte von 135,4 auf 147,4 Mrd.Fr.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zog in dieser Zeitspanne zumindest auf der Ausfuhrseite wieder an.Während die Importe praktisch auf dem Niveau des Vorjahres verharrten (8,9 Mrd.Fr.),stiegen die Exporte von 3,6 auf 4,0 Mrd.Fr.
Im Berichtsjahr stammten 74,9% der Landwirtschaftsimporte (6,7 Mrd.Fr.) aus der EU (EU15).2,4% wurden aus den zehn neuen EU-Ländern eingeführt.67,3% der Exporte (2,7 Mrd.Fr.) wurden in den EU-Raum getätigt (EU15).1,9% der Ausfuhren gingen in die neuen EU-Länder.Gegenüber dem Vorjahr haben die Einfuhren von den EU15 um rund 40 Mio.Fr.und die Ausfuhren in diese Länder um rund 378 Mio.Fr.zugenommen.
OZD
Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt gefolgt von Italien und Deutschland.Fast zwei Drittel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesen drei Ländern.Das gleiche Bild zeigte sich auch 2003 und 2002.Die meisten Ausfuhren wurden nach Deutschland getätigt.Eine stark negative Bilanz weist die Schweiz mit Frankreich,Italien,der Niederlande und Spanien aus.Ausgeglichen erscheint sie hingegen auf relativ tiefem Niveau
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen
nach Produktekategorie 2004
Tabak und Diverses (13, 14, 24)
Milchprodukte (4)
Nahrungsmittel (20, 21)
Genussmittel (9, 17, 18)
Tierfutter, Abfälle (23)
Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)
Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)
Lebende Pflanzen, Blumen (6)
Gemüse (7)
Früchte (8)
Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)
Getränke (22)
Quelle: OZD
Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land.Im Berichtsjahr wurden vor allem Getränke,tierische Produkte (inkl.Fische) sowie Nahrungsmittelzubereitungen und Früchte eingeführt.Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.
Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.
Exportüberschüsse wurden bei Tabak und Diverses (+296 Mio.Fr.),Milchprodukten (+162 Mio.Fr.) sowie Nahrungsmitteln (+95 Mio.Fr.) erzielt.Gegenüber dem Vorjahr stieg der Exportüberschuss bei Tabak und Diverses um 35 Mio.Fr.,bei Milchprodukten um 40 Mio.Fr.und bei Nahrungsmitteln um 84 Mio.Fr.(Vorjahr 11 Mio.Fr.).
Die Schweizer Landwirtschaft hat gemäss Verfassung den Auftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.
Ursache der jährlichen Schwankungen beim Selbstversorgungsgrad sind die stark witterungsabhängigen Erträge im Pflanzenbau.Besonders ab der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurden grössere Ausschläge registriert.
2003 lag der Selbstversorgungsgrad mit 56% um 5 Prozentpunkte tiefer als 2002.Im Pflanzenbau sank der Wert von 44% im Jahr 2002 auf 39% infolge grosser Trockenheit.Bei tierischen Produkten lag der Inlandanteil bei 95% wie im 2002.
■ Entwicklung von Preisindices
Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ging von 1990 bis 2002 stark zurück.Für 2003 und 2004 zeigt der Index eine leicht steigende Tendenz.Im Berichtsjahr stieg der Index um 1,2 Prozentpunkte auf 76,8 Prozentpunkte an.Der Anstieg ist vor allem auf die vergleichsweise hohen Schlachtviehpreise beim Rindvieh zurückzuführen.Unterdurchschnittlich haben sich die Preise für biologische Produkte entwickelt.
Im Vergleich zum Produzentenpreisindex verlief in dieser Zeitspanne die Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise für die Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke in die entgegengesetzte Richtung.Vor allem ab 1999 ist eine Zunahme feststellbar.Mit einem Wert von 111,2 Punkten im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2003 um 0,6 Prozentpunkte zu.
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel
Produzentenpreisindex
Index (1990/92 = 100)
1 Basis Mai 1997 = 100. Der neue Index enthält zu 100% Produktionsmittel. Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen. Das Gewicht der Produktionsmittel betrug damals 75%.
Landwirtschaft
Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke
Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel 1
Importpreisindex für Nahrungsmittel 2
2 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.
Quellen: BFS, SBV
Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel wurde revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 1997 = 100).Im alten Index (Basis 1976) waren die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital mit 25% Gewicht im Gesamtindex eingeschlossen.Das Gewicht der Produktionsmittel betrug deshalb nur 75%.Beim neuen Index beträgt nun das Gewicht der Produktionsmittel 100%,die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital (Kapitalzinsen) werden getrennt ausgewiesen.
Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel zeigt seit 1999 eine leicht steigende Tendenz.Im Berichtsjahr ist der Index gegenüber 2003 um 1,3 Prozentpunkteauf 103,8 Punkte angestiegen.Der Index kann in Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut,Futtermittel) und übrige Produktionsmittel unterteilt werden.Der erste Teilindex (Produktionsmittel landwirtschaftlicher Herkunft) ist über die beobachtete Periode gesunken,der Teilindex der übrigen Produktionsmittel ist in derselben Periode angestiegen.
Im Mai 2003 wurde der Importpreisindex für Nahrungsmittel revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 2003 = 100).Zusätzliche Untergruppen wurden in den Warenkorb aufgenommen,so dass der Index nun einen grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte abdeckt.Im Berichtsjahr lag der Index bei 102,4 Punkten und somit 2 Prozentpunkte höher als 2003.
■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung
Bundesausgaben
Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 50'285 Mio.Fr.Dies entspricht einer Zunahme von 323 Mio.Fr.oder 0,6% gegenüber 2003.Für Landwirtschaft und Ernährung wurde mit 3'902 Mio.Fr.praktisch gleich viel aufgewendet wie im Vorjahr.Nach sozialer Wohlfahrt (13'813 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (9'417 Mio.Fr.),Verkehr (7'435 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'641 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag im Berichtsjahr bei 7,8% wie im Vorjahr.Dieses Verhältnis ist seit dem Jahr 2000 leicht unter 8%.
Die Ausgaben für Produktion und Absatz konnten zwischen 1998 und 2003 von 1'203 Mio.Fr.auf 798 Mio.Fr.gesenkt werden.Damit wurde die Verpflichtung gemäss Artikel 187,Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG,wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel abzubauen sind,erfüllt.Im Berichtsjahr wurden diese Mittel um weitere 67 Mio.Fr.reduziert.Dies entspricht einer Abnahme von 8,4% gegenüber dem Vorjahr.
Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung,diejenigen zwischen 2002 und 2004 sind jedoch wieder vergleichbar.
1Die Ausgaben in diesen Bereichen wurden gemäss Zahlungsrahmen neu gruppiert.Durch diese Neugruppierung hat es eine Anpassung bei den Grundlagenverbesserungen gegeben,so dass das Total dieser Rubrik nicht mehr mit dem Total früherer Agrarberichte verglichen werden kann.
2Die ausserordentlichen Ausgaben im Milchsektor sind in diesem Betrag eingerechnet.Dies ging zulasten von anderen Bereichen wie z.B.Strukturverbesserungen und Viehwirtschaft.
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Die Ausgabenerhöhung bei den Direktzahlungen im Berichtsjahr ist auf Mehrbeteiligungen an den Öko- und Ethoprogrammen zurückzuführen.
Der Ausgabenrückgang von 13 Mio.Fr.bei den Grundlagenverbesserungen im Berichtsjahrhängt insbesondere damit zusammen,dass im Jahr 2003 ein Nachtragskredit für die Behebung der Unwetterschäden 2002 bewilligt wurde.
Das Produktionsjahr 2004 verlief günstiger als das Vorjahr.Die Witterungsbedingungen ermöglichten eine normale Entwicklung der Kulturen,die entsprechend gute Ernten ergaben.Die Milchproduktion nahm leicht zu,wie auch der Absatz von Käse, Joghurts und Rahm auf den Auslandmärkten.Auf den Rind- und Schweinefleischmärkten herrschten ebenfalls gute Bedingungen.Zum erstenmal seit vielen Jahren ging hingegen der Konsum von Geflügelfleisch zurück.In der Gemüseproduktion waren Rekordernten zu verzeichnen.
Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2004

Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%
Landw. Dienstleistungen 6%
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 1%
Wein 4%
Obst 5%
Gemüse- und Gartenbau 13%
Futterpflanzen 13%
Kartoffeln, Zuckerrüben 3%
Getreide 4%
Milch 23%
Rindvieh 10%
Schweine 10%
Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%
Quelle: BFS
Die Lebensmittelproduktion (tierische und pflanzliche Produkte) erfuhr eine Steigerung von 6,6% gegenüber dem Jahr 2003,dessen ausserordentlich trockener Sommer die Produktion in mehreren Sektoren einschränkte.Während die Zunahme im Pflanzenbau 12,4% (+525 Mio.Fr.) betrug,erreichte sie in der tierischen Produktion lediglich 1,5% (+75 Mio.Fr.),was sich dadurch erklären lässt,dass dieser Bereich 2003 weniger stark unter der Trockenheit litt.Seit 2003 fallen auch Futterpflanzen,Erzeugnisse des Gartenbaus,landwirtschaftliche Dienstleistungen und nichtlandwirtschaftliche Nebenerwerbe unter den landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereich.
■ Produktion:leicht steigende Milcheinlieferungen
Milch und Milchprodukte
Die Molkereien und Käsereien verarbeiteten im Jahr 2004 rund 3,21 Mio.t Milch. Gestiegen ist die Produktion in den Bereichen Käse und Frischmilchprodukte.Es konnte wieder ein Anstieg des Käseexportes verzeichnet werden,ebenso stieg die Ausfuhr von Joghurt und Rahm.Im Berichtsjahr 2004 sanken die Produzentenpreise für Milch weiter.Hingegen wiesen die Konsumentenpreisindices,mit Ausnahme von Butter,eine leicht steigende Tendenz auf.

Die Gesamtmilchproduktion hat im Berichtsjahr um 32’800 t zugenommen und betrug 2004 3,94 Mio.t.Rund 23% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert.Die Milchleistung pro Kuh stieg weiter,und zwar im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 90 kg auf 5’680 kg.
Im Berichtsjahr haben die Milchproduzenten 3,21 Mio.t Milch oder 1,15% mehr als im Vorjahr verkauft.Diese Milchmenge stammte von 570’000 Kühen.Der Kuhbestand hat gegenüber dem Vorjahr leicht (um 5'000 Tiere) abgenommen.
Milcheinlieferungen nach Monaten 2003 und 2004
In den Monaten Januar,Februar,Mai,Juni sowie Oktober und November des Berichtsjahres waren die monatlichen Einlieferungen höher als im Vorjahr.Etwa die gleiche Menge Milch wurde in den Monaten Juli bis September und November eingeliefert. Nur im März und April wurde etwas weniger Milch vermarktet.
■ Verwertung:mehr Käse
Im Berichtsjahr 2004 wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,21 Mio.t) wie folgt verwertet:
zu Käse:1 323 000 t (+2,2%)
zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1 124 000 t (+0,8%)
zu Rahm/Butter:741 000 t (–0,3%)
Die Käseherstellung nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,4% zu.Im Berichtsjahr wurden 1'233 t (auf 70'160 t) mehr Hartkäse und 1'228 t (auf 47'878 t) mehr Halbhartkäse produziert.Beim Hartkäse ist dies eine Steigerung um 1,8%,beim Halbhartkäse um 2,6%.Das steigende Produktionsvolumen der letzten Jahre von Frischkäse konnte im Berichtsjahr nicht fortgesetzt werden.Im Vergleich zum Vorjahr sank 2004 die Produktion um 279 t auf 36'822 t.Wie in den letzten Jahren wies das Produktionsvolumen von Schaf- und Ziegenkäse eine positive Entwicklung auf (von 708 auf 810 t oder +14,5%).
Die im Vorjahr festgestellte Zunahme der Produktion von Frischmilchprodukten konnte auch im Jahr 2004 beobachtet werden.Diese betrug knapp 5,4% (auf 229’880 t).Der seit einigen Jahren sinkende Trend bei der Konsummilch änderte sich im Berichtsjahr. Die Produktionszunahme bei Konsummilch betrug 2'386 t auf 497'021 t.
Die Butterproduktion blieb stabil,hingegen war die Milchpulverproduktion rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Abnahme um 8,1% (von 55'536 t auf 51'048 t) verzeichnet.
■ Aussenhandel:steigende Joghurt-Exporte
Die Aussenhandelsbilanz ist wie in den vergangenen Jahren nach wie vor positiv.Die Schweiz exportiert mengenmässig mehr Käse,Joghurt,Milchpulver und Rahm als sie importiert.Auffallend sind die markante Zunahme beim Joghurt- und Rahmexport und die Abnahme beim Milchpulverexport.
Im Jahr 2004 nahmen die Joghurtexporte um 60,1% auf 17’033 t zu.Die Joghurteinfuhr hingegen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken.Der Export von Milchpulver sank um 18% auf 15’617 t.Der Import in diesem Bereich hat ebenfalls abgenommen.Die Buttereinfuhr für die Inlandversorgung hat um 107% zugenommen und erreichte im Jahr 2004 977 t.Der Rahmexport wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 317 t oder 29,8% auf 1'379 t.
Im dritten Jahr nach In-Kraft-Treten des Käseabkommens wurden nicht bei allen Nullzollkontingenten die zur Verfügung stehende Menge zugeteilt.Von den verfügbaren 17'000 t im dritten Jahr wurden insgesamt 14'898 t versteigert.Wie schon im ersten und zweiten Jahr konnten die beiden Kontingente 119 (Mozzarella) und 120 (Frisch- und Weichkäse) vollumfänglich zugeteilt werden.
Käse-Importkontingente der Schweiz
Kontingents-Nr.
Gemäss Abkommen standen im 3.Jahr 5'500 t für einen zusätzlichen zollfreien Käseexport in die EU zur Verfügung (Erhöhung der Nullzollkontingente um 1'250 t gegenüber dem 2.Jahr).Im Vergleich zum 2.Jahr wurde die Marktzutrittsmöglichkeit etwa gleich genutzt.Im Juli 2004 vergab die EU für den Zeitraum Juli 2004 bis Dezember 2004 Einfuhrlizenzen in der Höhe von 951 t.Verfügbar wären für diesen ersten Halbjahreszeitraum 2'750 t gewesen.Für die zweite Jahreshälfte 2004/05 standen demnach,einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,4'549 t zur Verfügung.
Zum ersten Mal wurde die gesamte zur Verfügung stehende Menge für zollfreien Joghurt- und Rahmexport in die EU verteilt (2'000 t).
■ Verbrauch:leicht sinkender Joghurtkonsum
Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Milch und Milchprodukten zeigt eine stabile Tendenz.Der Käse-,Quark- und Butterkonsum ist 2004 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert geblieben.
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums

1990/92200220032004
Der Konsum von Milchgetränken nahm im Vergleich zum Vorjahr von 4,6 kg auf 6,1 kg (+32,6%) zu.Beim Joghurtkonsum konnte eine leicht rückläufige Entwicklung beobachtet werden.Gegenüber dem Vorjahr nahm dieser um 0,6 kg ab (–3,7% auf 15,6 kg).
■ Produzentenpreise: Tendenz weiterhin sinkend
Im Jahr 2004 wurde im Vergleich zum Vorjahr ein weiterer Rückgang der Produzentenpreise festgestellt.Der schweizerische Gesamt-Milchpreis ist um 0.91 Rp.pro kg Milch auf 74.63 Rp.gesunken.Dabei waren im Berichtsjahr die Preise für Industriemilch, verkäste Milch und für Biomilch tiefer als im Vorjahr.
Milchpreise 2004 gesamtschweizerisch und nach Regionen
Die regionalen Differenzen bei der Industriemilch und der Biomilch sind 2004 im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas grösser geworden.Im Berichtsjahr betrugen sie bei der Industriemilch bis zu 1.48 Rp.und bei der Biomilch bis zu 4.59 Rp.Die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bei der verkästen Milch hingegen sind etwa gleich gross wie schon im Vorjahr:sie betrugen bis zu 7.76 Rp.Der Produzentenpreis für Biomilch sank im Vergleich zum Vorjahr um 3.76 Rp.pro kg Milch (–4,3%).Für Biomilch wird zwischen 2.71 Rp.und 15.06 Rp.pro kg Milch mehr als für die übrige Milch bezahlt.
■ Konsumentenpreise: für Butter sinkend
Die Konsumentenpreise für Käse haben sich im Berichtsjahr unterschiedlich entwickelt. Der Preis für 1 kg Emmentaler surchoix betrug durchschnittlich Fr.19.93 (–4,6% oder –96 Rp.) und für 1 kg Greyerzer surchoix Fr.20.54 (–2,3% oder –48 Rp.).Hingegen stieg der Preis für Sbrinz von Fr.21.75 auf Fr.22.71 (+4,4%) und für Appenzeller surchoix von Fr.19.76 auf Fr.19.81 (+ 0,25%).Für Camembert 45% und Weichkäse mit Schimmelreifung bezahlte der Konsument den gleichen Preis wie im Vorjahr.
Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte
1990/92200220032004
Die Konsumentenpreisindices für Käse,Rahm und andere Milchprodukte wiesen im Jahr 2004 leicht steigende Tendenzen auf.Dagegen ist der Index für Butter um 1,76 Punkte oder 1,8% gesunken.
■ Bruttomarge:Milch und Milchprodukte
Nachdem von März bis Juni 2004 eine leicht steigende Tendenz bei der Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukten beobachtet wurde,verzeichnete sie von Juli bis Oktober eine stetige Abnahme,um gegen Ende des Berichtsjahres wieder etwas anzusteigen.Dieselbe Entwicklung war bei der Bruttomarge Verarbeitung – Verteilung auf der Produktegruppe «Käse» zu beobachten sowie bei derjenigen für Joghurt.Bei der Butter dagegen war die Bruttomarge am Ende des Jahres höher als zu Beginn. Dabei gab es während des Jahres grosse Schwankungen.Diese sind auf unterschiedliche Entwicklungen bei den Produzenten- und Konsumentenpreisen zurückzuführen. Tiefere Produzentenpreise im April und Mai hatten eine markant höhere Bruttomarge zur Folge.Die Anpassung der Konsumentenpreise nach unten liess die Bruttomarge im Juli wieder sinken.Der anschliessende Anstieg ist auf die saisonal tieferen Produzentenpreise zurückzuführen.

Tiere und tierische Erzeugnisse

Seit Beginn der neunziger Jahre sinkt der schweizerische Rindviehbestand stetig.Von rund 1,85 Mio.St.ging er auf 1,54 Mio.St.zurück.Die tendenziell extensivere Bewirtschaftung der Flächen sowie der Zuchtfortschritt bei gleichzeitiger Kontingentierung der Milchproduktionsmenge sind die massgebenden Gründe dafür.Erstmals wurden im Berichtsjahr weniger als 700'000 Kühe in der Schweiz gehalten.
Die Rinderkrankheit BSE verschwand praktisch vollständig.Es wurden lediglich 3 BSEFälle registriert.In den Vorjahren traten stets über 20 Fälle auf.Zu verdanken ist diese erfreuliche Situation der Festlegung klarer Standards,der einheitlichen,konsequenten Kontrolle entlang der ganzen Produktionslinie und der verstärkten,praxisorientierten Beratung in den Betrieben.
Der Fleisch- und Eiermarkt verlief aus Sicht der Produzenten positiv.Sie erzielten,mit Ausnahme beim Lammfleisch,höhere oder mindestens gleich hohe Preise wie im Vorjahr.Als Folge der 10% tieferen Kuhschlachtungen stiegen beispielsweise die Produzentenpreise um 15%.Für Schweine wurde mit durchschnittlich Fr.4.54 je kg SG ebenfalls mehr bezahlt als in den Jahren 2002 und 2003.Hingegen erlitten die Lammfleischproduzenten,insbesondere wegen des nochmals grösseren Inlandangebotes,eine Preiseinbusse von 11%.Die inländische Produktion aller Fleischkategorien zusammen sank und wurde teilweise mit grösseren Einfuhrmengen kompensiert.Vom schweizerischen Gesamtkonsum von über 391'000 t stammten rund 85'000 t (22%) aus dem Ausland.Im Jahre 2003 waren nur 21% des konsumierten Fleisches ausländischer Provenienz.Der Fleisch- und Fischkonsum sank im Berichtsjahr um 0,6% auf 59,49 kg pro Kopf.Erstmals seit Jahren verlor dabei das Geflügelfleisch an Bedeutung und pro Kopf wurden wieder weniger als 10 kg gegessen.
■ Produktion:Steigender Pferde-,Ziegen- und Mastgeflügelbestand
Der Rindviehbestand nahm um 1,6% ab.Damit setzt sich der kontinuierliche Rückgang fort.Vor allem die Verkehrsmilchkühe wurden deutlich reduziert (–17'000 St.). Zugenommen hat hingegen der Mutter- und Ammenkuhbestand (5'000 St.).Das Rindvieh wird insgesamt auf rund 46'200 Betrieben gehalten.Der Schweinebestand von rund 1,5 Mio.St.und der Zuchtsauenbestand von rund 143'000 St.blieben demgegenüber in den vergangenen Jahren recht stabil.Allerdings hat die Zahl der Betriebe seit 2001 um 20% abgenommen.
Entwicklung der Tierbestände
Tierart19902002200320041990–2002/04
in 1 000in 1 000in 1 000in 1 000%
Rindvieh 1 8581 5941 5701 544–15,54
–Kühe für die Verkehrsmilchproduktion726605587570–19,10
– Kühe ohne Verkehrs-
Der Mastgeflügelbestand kletterte weiter und liegt nun bei fast 5 Mio.St.Im Vergleich zu 1990 steht 74% mehr Mastgeflügel in Schweizer Ställen.Im Mittel weisen die 1'084 Mastbetriebe eine Bestandesgrösse von 4'500 St.auf.Primär als Folge der stetig verbesserten Legeleistung ging der Lege- und Zuchthennenbestand zurück,und zwar um 1,3%.Im Vergleich zu 1990 sank der Bestand sogar um einen Viertel.Auch die Zahl der Betriebe ist stetig abnehmend und lag im Berichtsjahr bei 16'400 (–5,5%).
An der Spitze der inländischen Fleischproduktion steht das Schweinefleisch mit 227'085 t SG gefolgt von Rindfleisch mit 100'308 t SG.Diese beiden Fleischsorten weisen einen Anteil von rund 76% an der gesamten Inlandproduktion Fleisch von 431’745 t SG auf.Rund die Hälfte der Rindfleischproduktion ist Kuhfleisch,das vorwiegend von Milchproduktionsbetrieben stammt.
Im Jahr 2004 produzierte die Schweizer Landwirtschaft 6,8% mehr Schaf- und Lammfleisch und 6,1% mehr Geflügelfleisch als im Vorjahr.Seit 1990/92 stieg die Produktion in der Schweiz sogar um 30% beim Schaf- und Lammfleisch und um 66% beim Geflügelfleisch.Die Mehrmengen beim Geflügelfleisch nahm der Markt mühelos auf. Demgegenüber gerieten die Lämmerpreise merklich unter Druck.Seit zwei Jahren rückläufig ist die Rind-,Kalb- und Schweinefleischproduktion sowie die Erzeugung von Eiern.Dies ist die Folge der sinkenden Tierbestände.
■ Aussenhandel:Brasilien ist der bedeutendste Rindfleischlieferant
Index (1990/92 = 100)
Entwicklung der tierischen Produktion
1990/92200220032004
Quellen: Proviande, SBV
Vom konsumierten Rind- und Schweinefleisch wird 88% bzw.93% in der Schweiz produziert.Andererseits stammt lediglich jedes achte Kilogramm Pferdefleisch,jedes sechste Kilogramm Kaninchenfleisch sowie etwa jedes zweite Kilogramm Geflügel-, Ziegen- und Schaffleisch aus schweizerischer Produktion.
Die Eierproduktion fiel um 4% und betrug 652 Mio.St.97% der inländischen Eier werden im Detailhandel und in der Gastronomie verkauft.Die restlichen Eier werden aufgeschlagen und in der Lebensmittelindustrie verbraucht.Bei den eingeführten Eiern beträgt das Verhältnis Detailhandel - Lebensmittelindustrie 50:50.
Die Ausfuhr von Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnissen kletterte um 360 t auf 2'160 t.Das bekannte Rinds-Trockenfleisch nimmt davon mehr als die Hälfte ein (1'151 t) und wird zu über 99% in Frankreich und Deutschland verkauft.Der Handelswert der Fleischexporte betrug rund 25 Mio.Fr.
Schweizer Firmen führten insgesamt über 103'000 t Fleisch,Fleischerzeugnisse und Schlachtnebenprodukte ein.Diese Waren haben einen Handelswert von rund 680 Mio. Fr.Am bedeutendsten sind das Geflügel- und Schweinefleisch,wovon 45'900 t bzw. 11'600 t importiert wurden.Der wichtigste Partner ist Deutschland mit einem Anteil von 35'000 t und einem Handelswert von 82 Mio.Fr.
Aus Brasilien stammen 74% des eingeführten Rind- und Kalbfleisches.Südafrika (13%),Italien (9%) und Frankreich (7%) sind die nächstgrössten Lieferanten.Vor allem Spezialstücke des Rindsstotzens und High-Quality-Beef werden aus Brasilien bezogen. In der Gunst der Schweizerinnen und Schweizer stehen wie seit vielen Jahren australisches und neuseeländisches Schaf- und Lammfleisch,das einen Importanteil von 82% aufweist.Frankreich,Deutschland und das Vereinigte Königreich teilen sich die restlichen 18%.Kanada (38%),die USA (38%),Argentinien (11%) und Australien (9%) sind die bevorzugten Pferdefleischlieferanten.Den Import des Geflügelfleisches teilen sich hauptsächlich Frankreich und Ungarn mit Marktanteilen von je 21%. Italienische Wurstwaren sind in der Schweiz äusserst beliebt.Etwa 2'600 t kaufte der Schweizer Handel im südlichen Nachbarland ein.Importierte Fleischzubereitungen und Konserven stammen dagegen grösstenteils aus Frankreich (1'400 t).
■ Verbrauch:Schweinefleisch wird am meisten gegessen
Im Rahmen der WTO Uruguay-Runde hat sich die Schweiz verpflichtet,den Marktzutritt für eine bestimmte Fleischmenge zu tiefen Kontingentszöllen zu gewähren.Für Rind-, Schaf-,Pferde- und Ziegenfleisch beträgt die Zollkontingentsmenge seit 1996 zusammen 22'500 t.Die Schweiz hat diese Verpflichtung jedes Jahr eingehalten und im Jahresmittel der letzten neun Jahre über 27'000 t Einfuhren zugelassen.Für Schweineund Geflügelfleisch nahm die Zollkontingentsmenge von 50'020 t im Jahre 1996 auf 54'500 t im Jahre 2000 zu;seither ist sie konstant bei 54'500 t.Auch diese Verpflichtung wurde im Durchschnitt der Jahre 1996 bis 2004 mit rund 55'200 t pro Jahr übertroffen.Allerdings gab es Jahre,wo die Zollkontingentsmenge nicht ganz erreicht wurde.Diese wurden jedoch von Jahren mit Mehrimporten überkompensiert.
Der Pferde- und Eselimport ging um 4% auf 3'064 St.zurück.Jedes dritte Pferd stammt aus deutscher,jedes vierte aus französischer Provenienz.Immerhin exportierte die Schweiz im Gegenzug auch 1’035 Pferde.
Der Aussenhandel mit Eiern ist sehr einseitig.Den Eiereinfuhren von über 27'000 t stehen Ausfuhren von 1 t gegenüber.Deutsche und französische Eier im Umfang von 14'800 t werden hauptsächlich im Detailhandel verkauft.Dagegen stammen Eier, welche in der Schweiz aufgeschlagen und für die Nahrungsmittelindustrie verwendet werden,zur Hauptsache aus den osteuropäischen Ländern Bulgarien,Polen und Tschechien.Der Schweizer Handel bezieht aus diesen drei Ländern zusammen 7'400 t. Insgesamt 10'800 t flüssige und getrocknete Eiprodukte sowie Eieralbumine wurden in die Schweiz eingeführt.Mehr als die Hälfte davon liefert die Niederlande.Die Ausfuhren beliefen sich hingegen lediglich auf 190 t.
Der Fleischverbrauch lag mit 391'065 t lediglich 0,2% unter dem Vorjahreswert. Steigender Beliebtheit erfreuen sich Pferdefleisch (+6,1%),Wild und Kaninchen (+3,2%),Rindfleisch (+1,3%) sowie Schaf- und Lammfleisch (+0,9%).Der Geflügelfleischverbrauch sank hingegen um 0,6%.Ausserdem verzehrten die Konsumentinnen und Konsumenten 58'649 t Fische und Krustentiere,was einer Zunahme von 2,8% entspricht.
Der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch fiel um 0,7% auf 51,73 kg.Schweinefleisch ist nach wie vor der Spitzenreiter mit 24,80 kg,gefolgt von Rindfleisch (10,23 kg),Geflügelfleisch (9,97 kg) und Kalbfleisch (3,54 kg).Alle anderen Fleischsorten werden deutlich weniger konsumiert.Im Mittel liegen je Tag 140 g Fleisch und Fleischerzeugnisse auf den Tellern der Konsumentinnen und Konsumenten.Positiv entwickelt hat sich der ProKopf-Konsum bei Fischen und Krustentieren:er kletterte um 2,4% auf 7,76 kg.

■ Produzentenpreise:
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern
1990/92 2002 2003 2004
In Privathaushalten wird hauptsächlich Schweine- und Geflügelfleisch gegessen. Mengenmässig ebenso bedeutend sind zudem Charcuterie und Wurstwaren.In der Gastronomie liegt dagegen Rindfleisch an der Spitze gefolgt von Charcuterie.
Für Muni,Ochsen und Rinder mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurden im Jahresmittel zwischen Fr.8.07 und 8.17 je kg SG franko Schlachthof bezahlt.Die Mäster erzielten somit die gleich hohen Preise wie im Vorjahr.Hingegen kletterten die Preise für Kühe guter Qualität (Handelsklasse T3) um 15% auf Fr.6.62 je kg SG.Die Hauptursache ist die Reduktion der Schlachtungen um 10%.Wegen der rückläufigen Schweinefleischproduktion (–1,1%) stieg auch der Preis für Fleischschweine um 2% auf Fr.4.54 je kg SG.Gesunken ist der Preis für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3).Er lag im Jahresmittel auf Fr.10.21 je kg SG,was einer Einbusse von 11% gegenüber 2003 und 24% gegenüber 2002 entspricht.Diese Entwicklung ist vor allem durch das stetig steigende Inlandangebot bedingt.Im Vergleich zu 2002 wurden 11% mehr Schaf- und Lammfleisch auf dem Schweizer Markt verkauft.
Monatliche Schlachtvieh- und Fleischschweinepreise 2004,
■ Konsumentenpreise: Rind- und Kalbfleisch wurden erneut teurer
Saisonale Preisschwankungen traten wie gewohnt bei Schweinen und Kälbern auf.Der Kälberpreis stieg infolge des rückläufigen Angebotes in der zweiten Jahreshälfte von Fr.11.15 auf rund Fr.13.90 je kg SG.Für Schweine wurden wiederum im Mai–Juli mit bis zu Fr.5.40 je kg SG ab Hof die höchsten Preise bezahlt.Die Grillsaison fördert in dieser Periode die Nachfrage.Trotz Alpentladung verblieben die Kuhpreise im Herbst stabil zwischen Fr.6.40 und Fr.6.80 je kg SG.
Die höheren Produzentenpreise für Rinder und Kälber schlugen bis zum Ladentisch durch.Die Steigerung der Konsumentenpreise betrug zwischen Fr.0.50 und 2.50 je kg. Relativ stabil verblieben hingegen die Konsumentenpreise für Stücke vom Schwein und vom Lamm.Für die beobachteten Fleischstücke aller Tierkategorien mussten die Konsumentinnen und Konsumenten in den letzten drei Jahren tiefer ins Portemonnaie greifen als 1990/92.Die Preissteigerungen bewegen sich dabei in einer Bandbreite von 4% für Rindfleischbraten bis 39% fürs Kalbsvoressen.Der höhere Anteil von Labelfleisch hatte auf diese Entwicklung einen gewissen Einfluss.Die Produzentenpreise je kg SG brachen hingegen im Vergleich von 2004 zu 1990/92 um 12% bei Rindern,um 15% bei Kälbern und um 28% bei Kühen ein.
■ Bruttomarge Fleisch
Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung stieg für Rindfleisch gegenüber 2003 um 9 Prozentpunkte.Rückläufig war sie für Lammfleisch (–6 Prozentpunkte), Schweinefleisch (–1 Prozentpunkt) und Kalbfleisch (–2 Prozentpunkte).Die markanteste Margensteigerung (+38%) seit Beginn der Beobachtungen im Jahre 1999 ist beim Schweinefleisch zu beobachten.Am geringsten ist sie beim Kalbfleisch,wo eine Zunahme von 13% festzustellen ist.Die Marge des Warenkorbes aller Frischfleischsorten,inklusive der Fleisch- und Wurstwaren,kletterte seit der Basisperiode (FebruarApril 1999,Index=100) stetig nach oben.Im Jahre 2004 lag das Mittel bei 119,2 Punkten und damit 3 Punkte über dem Vorjahr.Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Lammfleisch auf,dessen Index sich zwischen 105 und 127,8 Punkten bewegte.
■ Wettersituation: sonnig und warm
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte
Die milden Wintermonate im Jahre 2003 setzten sich im Januar und Februar des Berichtsjahres im Mittelland fort.Ausser in den Monaten März und Mai übertrafen sämtliche Monatsmittelwerte auf der Alpennord- und Südseite das Temperaturmittel von 1961 bis 1990.Wärmer als im Hitzejahr 2003 waren der Januar und Februar sowie die Herbstmonate September und Oktober.Sonnig präsentierten sich die Monate Februar bis Mai und der September.Mit Ausnahme von Januar und Oktober erreichte die mittlere Sonnenscheindauer der übrigen Monate in etwa das langjährige Mittel. Niederschlagsreich gegenüber dem langjährigen Mittel fielen die sonnenarmen Monate Januar und Oktober aus.Vergleichsweise wenig Regen fiel im Februar,April, September,November und Dezember.Trotz der vom Hitzejahr 2003 konträr geprägten Empfindungen war das Berichtsjahr insgesamt warm,sonnenreich und die Niederschlagsmengen blieben leicht hinter dem langjährigen Mittel zurück.
Unter Wetterkapriolen sind die extremen Niederschläge im Januar einzuordnen,als in nördlichen und westlichen Regionen innerhalb von 2 Tagen in etwa die normale Monatsmenge fiel.Ende März erlitt die Ostschweiz einen Wintereinbruch bis in tiefe Lagen,St.Gallen erhielt 75 cm Neuschnee.Anfangs Juni lösten heftige Niederschläge vor allem im Berner Oberland Erdrutsche und Überschwemmungen aus.Ein Hagelzug mit Korngrössen bis zu 4 cm durchquerte das Mittelland vom Genfer- bis zum Bodensee am 8.Juli.Als Folge der hohen Temperaturen traten im Oktober ungewöhnlich zahlreiche und heftige Sommergewitter auf.

■ Produktion:Spitzenerträge kompensieren
Flächenrückgang
Ackerkulturen
Insgesamt nahm die offene Ackerfläche gegenüber dem Vorjahr um 2'173 ha ab (–0,8%).Den bedeutendsten Flächenrückgang verzeichnete das Futtergetreide mit 6'236 ha (–8,0%),während die Brotgetreidefläche um 1'430 ha (1,6%) anstieg. Flächengewinne verbuchten gegenüber 2003 zudem Silo- und Grünmais (5,1%), Freilandgemüse (4,9%),Raps (5,3%) und Zuckerrüben (6,2%).Futterrüben und nachwachsende Rohstoffe (Faserpflanzen) setzten bezogen auf die Anbaufläche die rückläufige Tendenz fort.
Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2004 (provisorisch)
Total 281 302 ha
Silo- und Grünmais 15% 42 433 ha
Freilandgemüse 3%
8 813 ha
Raps 6% 16 839 ha
Zuckerrüben 7% 18 622 ha
übrige Kulturen 7% 19 508 ha
Getreide 57% 161 752 ha
Kartoffeln 5% 13 335 ha
Quelle: SBV
Die Auswirkungen des Trockensommers 2003 zeigten sich anhand des Ertragseinbruchs.Im Berichtsjahr lieferten die Ackerkulturen mit Ausnahme von Kartoffeln, Sonnenblumen und Sojabohnen aufgrund günstiger Witterungsbedingungen Spitzenerträge.
Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte
1990/9219992000200120022004 2003
Produkte (Erträge 2004 provisorisch)
Winterweizen (63,1 dt/ha)
Kartoffeln (395,0 dt/ha)
Raps (34,5 dt/ha)
Gerste (68,8 dt/ha)
Zuckerrüben (779,0 dt/ha)
Quelle: SBV
■ Verwertung: Marktungleichgewichte bei Brotweizen und Kartoffeln
Im Berichtsjahr überstieg die Getreideproduktion aufgrund hoher Erträge trotz kleinerer Anbauflächen die Erntemengen der vorangegangenen drei Jahre.Während die produzierte Futtergetreidemenge problemlos am Markt platziert werden konnte, übertraf das Angebot an backfähigem Weizen den Bedarf erheblich.
■ Aussenhandel: Zuckerbilanzen und Futtermittelimporte
Günstige Witterungsbedingungen im Berichtsjahr ermöglichten nicht nur hohe Erträge, sondern sorgten auch für eine gute Qualität der Ernteprodukte.Zur Stabilisierung der Preise infolge überschüssigem Brotgetreide führte der Schweizerische Getreideproduzentenverband umfangreiche Massnahmen zu dessen Verwertung im Futtersektor durch.Im 90-tägigen Dauerbetrieb verarbeiteten die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld die Rekordernte von 1,45 Mio.t Zuckerrüben zu 221’803 t Zucker.Die reiche Kartoffelernte traf auf eine begrenzte Nachfrage zu Speise- und Veredelungszwecken.Ungenügende Qualitäten und überschüssige Mengen mussten daher teilweise mit Bundesmitteln dem Futtersektor zugeführt werden.Von den Ölsaaten übertraf einzig Raps die Zielmenge.Die Verarbeiter erklärten sich in Anbetracht der erfreulichen Nachfrage bereit,die gesamte Erntemenge vor allem zur Gewinnung von Speiseöl und ergänzend zur Herstellung von Treibstoff (Raps-Methyl-Ester) zu übernehmen.
Infolge variabler Anbauflächen und witterungsbedingter Ertragsschwankungen variierte die inländische Zuckerproduktion seit 1999 im Bereich von 200'000 t bei einem Bedarf von rund 230'000 t.Im selben Zeitraum sind die Importe von 140'000 auf 288'000 t angestiegen.Verwendet wurden die zusätzlichen Importe nahezu ausschliesslich für den Export in Verarbeitungsprodukten.Erntebedingte Unter- oder Überversorgung konnte mit einer aktiven Lagerbewirtschaftung jeweils aufgefangen werden.
Grösstenteils stammt in die Schweiz eingeführter Zucker aus der EU.Mit 47,8% der gesamten Zuckerimporte war Frankreich im Berichtsjahr der wichtigste Lieferant vor Deutschland mit 45,5% sowie Grossbritannien (3,6%),Mauritius (1,0%) und Brasilien (0,8%).Die restlichen Einfuhren von Rohr-,Rübenzucker oder reiner Saccharose verteilten sich auf 29 Länder (1,3%).
Die Mindererträge des Trockensommers 2003 wirkten sich im Aussenhandel bis zur Anschlussernte 2004 aus.Infolge erfreulicher Flächenerträge im Berichtsjahr bei Wiesen- und Ackerfutter sanken die Futtermitteleinfuhren im zweiten Halbjahr.Im Vorjahresvergleich nahmen die Ergänzungsimporte von Heu und Getreide zu Futterzwecken ab.
■ Produzentenpreise: Preise mehrheitlich tiefer als 2003
Im Berichtsjahr wirkte sich die grosse Erntemenge und die Kürzung der Beitragssätze für die Verwertung negativ auf die Kartoffelpreise aus.Im Nahrungsmittelbereich wurden ähnliche Preise wie im Vorjahr erzielt,doch verminderte die grössere Menge, die zu tiefen Preisen im Futterbereich verwertet wurde,den mittleren Produzentenpreis.Trotz rückläufiger Bundesbeiträge und grosser Ernte konnte der Zuckerrübenpreis in etwa auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.Beim Weizen belastete das Überangebot den Produzentenpreis,wobei sich auch die vom Bundesrat im November 2004 beschlossene Reduktion der Grenzbelastung per 1.Juli 2005 auswirkte.Trotz den von den Produzenten finanzierten Marktentlastungsmassnahmen gab der Weizenpreis nach.Im Vorfeld der beschlossenen Schwellenpreissenkung sank auch der Gerstenpreis,während die Auswirkungen auf die Ölsaaten und übrigen Eiweissträger eher gering blieben.
■ Konsumentenpreise: tendenziell steigend
1990/92200220032004
2004
Kl. I, 57.84 Fr./dt
11.85 Fr./dt Raps, 76.60 Fr./dt
Der Trend zu steigenden Konsumentenpreisen von Weissmehl setzte sich im Berichtsjahr fort.Hingegen blieben die Preise für Backwaren wie Ruch- und Halbweissbrot sowie Weggli und Gipfeli nahezu stabil.Gegenüber dem Vorjahr zeigte der Preis für Kristallzucker keine Veränderung.Preissteigerungen verzeichneten aber die Kartoffeln und das Sonnenblumenöl.
■ Produktion:Optimale Witterungsbedingungen
Spezialkulturen
Auf einer Fläche von 23’700 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’937 ha Reben,6’750 ha Obstanlagen und 284 ha Strauchbeeren.

Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13’500 ha.Sie vergrösserte sich gegenüber dem Vorjahr nur um einige Hektaren.Die bedeutendste Flächenzunahme ist bei den Lagergemüse zu verzeichnen.Mit einer Fläche von 733 ha wurden so viel Lagerkarotten wie noch nie angebaut.Sie erfuhren gegenüber dem Vorjahr eine Flächenzunahme von 10%.Die bedeutendste Flächenreduktion gab es bei Konservengemüse. Unter anderem verminderte sich die Anbaufläche von Konservenspinat um 28% auf 858 ha.
Bei den Obstflächen waren die gleichen Entwicklungstendenzen wie in den Vorjahren zu beobachten.Die Apfelfläche betrug 4’384 ha und nahm weiter um einige Hektaren ab – allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.Hingegen legten die Apfelsorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova weiterhin zu.In den letzten sieben Jahren verdoppelte sich deren Fläche auf 927 ha.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 958 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr wieder leicht zu.Steinobst und Beeren waren weiterhin im Trend.Die Fläche von Steinobst dehnte sich um 159 ha (13%) auf 1’353 ha und diejenigen der Beeren um 20 ha (3%) auf 671 ha aus.
Fläche der Obstkulturen unter Witterungsschutz 2004
Die Obstkulturen waren auf einer Fläche von 1'120 ha oder 17% mit Hagelnetzen und/oder Regenfolien geschützt.In Apfelkulturen besteht der umfangreichste Witterungsschutz;940 ha oder 21% waren mit Hagelnetzen versehen.Im Weiteren sind die Hagelnetze bei Birnen- (88 ha),Kirschen- (77 ha) und Zwetschgenkulturen (14 ha) verbreitet.Bei Kirschenkulturen waren zusätzlich 55 ha mit Regendächer und 9 ha mit kombinierten Hagelnetz-Foliendächer bedeckt.
■ Verwertung:Mittelgrosse Mostobsternte
Die Rebfläche betrug 14’937 ha.Das sind 8 ha mehr als ein Jahr zuvor.Davon waren 6’587 ha (–130 ha) mit weissen und 8’350 ha (+138 ha) mit roten Trauben bestockt. Der Rückgang der mit weissen Trauben bestockten Flächen dürfte aufgrund der Nachfrage und der Umstellungsbeiträge in den laufenden Jahren wenn auch in kleinerem Umfang weiter gehen.

Es wurden 320'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 134’000 t Tafelobst geerntet. Viele Gemüse- und Obstarten haben Rekordmengen erreicht.Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre handelt es sich bei Gemüse um eine Ertragssteigerung von 11% und bei Obst um 5%.
Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,betrugen 533’000 t bzw.190’000 t.Das Gemüsevolumen war 7% und das Obstvolumen 9% grösser als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre.Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen betrug rund 60% und derjenige von Obst rund 71%.Bei Gemüse ist dieser Wert 2% höher und bei Obst 3% tiefer als im Vierjahresmittel 2000/03.
Die aufgrund der Situation des Weinmarktes in den Jahren 2002 und 2003 verfügten, strengen Mengenbeschränkungen wurden weitergeführt.Im Berichtsjahr wurden 115,9 Mio.Liter Wein gekeltert.Das waren zwar 18,9 Mio.Liter mehr als im Vorjahr, wobei festzuhalten ist,dass die Ernte 2003 aufgrund der Trockenheit aussergewöhnlich tief war.Davon waren 55,2 Mio.Liter Weisswein und 60,7 Mio.Liter Rotwein.Die durchschnittlichen Erträge betrugen 0,8 Liter pro m2 bei den weissen und 0,7 Liter pro m2 bei den roten Gewächsen.
Die mittelgrosse Mostobsternte entsprach mit einer Menge von 156’670 t (Mostäpfel 133’210 t,Mostbirnen 23’460 t) dem Mittel der letzten 10 Jahre.Gemessen an der durch den SBV im August herausgegebenen Vorernteschätzung entsprach die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln genau der Schätzung und bei den Mostbirnen einer solchen von 97%.Erneut konnte der Schweizerische Obstverband auf Grund der geschätzten Erntemengen auf den Rückbehalt für die Verwertung von Übermengen verzichten.Der inländische Bedarf an Apfel- und Birnensaftprodukten wurde gemessen an der Normalversorgung bei den Mostäpfeln zu 147% und bei den Mostbirnen zu 124% gedeckt.
Der Konsum ungegorener Obstsaftgetränke war weiterhin im Trend und lag im Mittel der beiden Vorjahre.Der stetige Abwärtstrend bei den teilweise und ganz gegorenen Obstsaftgetränken setzte sich ungebrochen fort.
■ Aussenhandel:Einfuhren trotz guter Inlandernte höher
Die Einfuhren von Frischgemüse und Frischobst,die in der Schweiz angebaut werden können,beliefen sich auf 213'000 t bzw.55'000 t.Das waren 1% mehr Gemüse und 16% mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.85% dieser Frischprodukte stammten aus der EU.Die Hauptlieferländer der EU sind Italien,Frankreich,Spanien und die Niederlande.Bei den aussereuropäischen Lieferländern sind Marokko mit Tomaten,die USA mit Grünspargeln,Neuseeland mit Äpfeln und Südafrika mit Birnen von Bedeutung.Die Exporte waren mit 180 t Gemüse und 450 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren,insgesamt aber unbedeutend.
Die Einfuhren an Trinkwein betrugen 158,3 Mio.Liter Wein.Davon waren 136,0 Mio. Liter Rotwein und 22,3 Mio.Liter Weisswein.Dazu wurden noch 12,4 Mio.Liter Schaumwein,7,2 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,5 Mio.Liter so genannte Süssweine oder Spezialitäten eingeführt.Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduktion von 5,7 Mio.Liter bei den Rotwein- und eine Zunahme von 2,4 Mio.Liter bei den Weissweinimporten festzustellen.Die Schaumweinimporte blieben hingegen stabil. Die Exporte an Schweizer Flaschenweine nahmen gegenüber dem Vorjahr stark zu und erreichten 1,4 Mio.Liter (+75%).
■ Verbrauch:Erhöhter Konsum bei Gemüse und Obst
Der Pro-Kopf-Konsum von frischem Gemüse betrug 72 kg,derjenige von Tafelobst (ohne tropische Früchte) 25 kg.Gegenüber dem Vierjahresmittel 2000/03 wurden 3 kg mehr Gemüse und 2 kg mehr Obst gegessen.
Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug 275,6 Mio. Liter.Der Gesamtverbrauch war somit weiterhin rückläufig (–2,2 Mio.Liter).Der Konsum an ausländischen Weinen nahm beim Rotwein ab und beim Weisswein leicht zu.Derjenige von Schweizer Wein hingegen blieb beim Weissen stabil,ging hingegen beim Roten um rund 3 Mio.Liter zurück.Der Marktanteil von Schweizer Wein war somit ebenfalls rückläufig und betrug noch 39,7% oder 0,5% weniger als im Vorjahr. Der gesamte Weinkonsum (inkl.die Verarbeitungsweine) betrug rund 283 Mio.Liter, wovon 69% auf Rotweine entfallen.
■ Produzentenpreise: Rekordumsatz bei Gemüse
Der Umsatz von Gemüse war mit 806 Mio.Fr so gross wie noch nie zuvor.Er stieg um weitere 5% im Vergleich zum Vorjahr und 17% im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.52 Fr.pro kg gegenüber 2.59 Fr.pro kg im Jahr zuvor und 2.39 Fr.pro kg im Durchschnitt der vier Vorjahre.
Die Erntemengen von Karotten unterliegen teilweise grossen jährlichen Schwankungen.Über die Jahre hinweg zeigt das Angebot jedoch steigende Tendenz.Klarer ist dieser Trend bei der Fläche erkennbar:Seit neun Jahren nahm sie beinahe kontinuierlich jedes Jahr um durchschnittlich 40 ha zu und erreichte im Berichtsjahr 1’400 ha.Die Abbildung zeigt,wie stark die Preise auf die Angebotsmengen reagieren:Grosse Mengen führen zu tiefen Preisen und kleine Mengen zu hohen Preisen.Über die Jahre hinweg kann allerdings auch bei den Preisen eine Steigerung ausgemacht werden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen,dass in den Produzentenpreisen immer mehr Dienstleistungen (Waschen,Portionieren,Abpacken,etc.) enthalten sind.Entsprechend den höheren Mengen und Preisen sind auch die Erlöse stetig gewachsen. Sie erreichten im Berichtsjahr 88 Mio.Fr.Die Schwankungen bei den Produzentenpreisen wurden von den Konsumentenpreisen mitgemacht.Die Preismarge,das heisst die Differenz zwischen Konsumentenpreis und Preis franko Grossverteiler,war in den letzten neun Jahren konstant.

■ Konsumentenpreise,
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Gemüse
Die deutlich bessere Versorgungslage im Vergleich zum Vorjahr führte zu sinkenden Gemüsepreisen.Der Einstandspreis von sieben wichtigen Gemüsearten (Tomaten, Blumenkohl,Karotten,Chicorée,Gurken,Zwiebeln und Kartoffeln) sank um 12 Rp.auf 1.10 Fr.pro kg (–10%).Der Endverkaufspreis ging um 13 Rp.auf 2.64 Fr.pro kg zurück.Somit ging die Bruttomarge zum zweiten Mal in Folge leicht zurück (–1 Rp.) und betrug im Berichtsjahr Fr.1.53 pro kg.
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten
Bei den Früchten öffnete sich die Preisschere hingegen weiter.Der durchschnittliche Einstandspreis der sieben beobachteten Früchte (Äpfel,Birnen,Aprikosen,Kirschen, Nektarinen,Erdbeeren und Orangen) ging um 3 Rp.auf 1.81 Fr.pro kg (–1,1%) zurück, während der Endverkaufspreis um 11 Rp.auf 4.34 Fr.pro kg anstieg.Die Bruttomarge stieg demnach um 14 Rp.oder 5,9% auf 2.53 Fr.pro kg.
■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
1.1.3Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon (vgl.Abschnitt 1.1.4).
■ Sektor-Einkommen 2004
Im Jahr 2004 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 3,218 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 2001/03 war es rund 8% höher. Hauptverantwortlich dafür war die um 346 Mio.Fr.gestiegene Erzeugung (+3,4%). Um 79 Mio.Fr.(+3%) zugenommen haben auch die sonstigen Subventionen (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen).
Gegenüber dem Jahr 2003 nahm das Nettounternehmenseinkommen um 432 Mio.Fr. (+15,5%) zu.Das höhere Einkommen des Sektors im Jahr 2004 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Zunahme bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs um 478 Mio.Fr.(+4,7%) zurückzuführen.Bedeutend höher als im Jahr 2003,welches durch die lange Trockenheit im Sommer geprägt war,waren die Erträge im Pflanzenbau.Auch die ausgeglichene Marktlage im Schlachtviehsektor wirkte sich positiv auf die landwirtschaftliche Erzeugung im Jahr 2004 aus.Einen Anstieg um 57 Mio.Fr.(+2,1%) verzeichneten auch die sonstigen Subventionen.Auf der Kostenseite gab es einen Anstieg bei den Vorleistungen um 103 Mio.Fr.(+1,7%) und bei den Abschreibungen um 17 Mio.Fr.(+0,9%).Dem stehen tiefere Ausgaben für Zinsen von 17 Mio.Fr.(– 5,3%) gegenüber.Insgesamt war der Kostenanstieg bedeutend geringer als die höheren Einnahmen bei der Produktion und bei den Direktzahlungen.
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr.
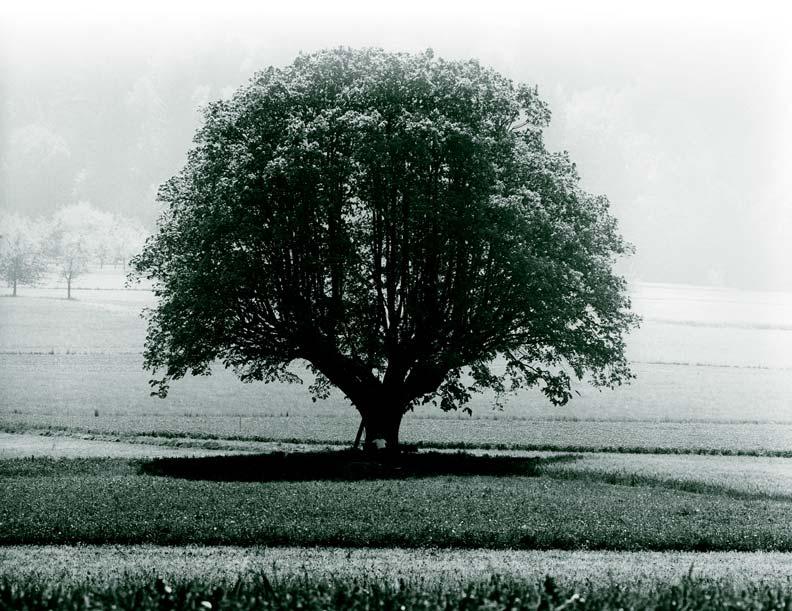
■ Schätzung des SektorEinkommens 2005
Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Sonstige Subventionen Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen)
Die Schätzung des Produktionswertes der Landwirtschaft 2005 liegt mit 9,995 Mrd.Fr. um 3,5% tiefer als das Dreijahresmittel 2002/04.Zu diesem Ergebnis tragen sowohl tiefere Einnahmen aus dem Ackerbau als auch aus der Tierhaltung bei.
Die pflanzliche Produktion (inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 4,9% tiefer geschätzt (4,202 Mrd.Fr.).
Die Getreideernte fiel qualitativ und vor allem mengenmässig schlechter aus als die gute Ernte 2004.Insbesondere beim Weizen gab es im Vergleich zum Vorjahr tiefe Hektolitergewichte,so dass einzelne Posten sofort deklassiert wurden.Auch bei der Gerste waren die Erträge tiefer als letztes Jahr.Beim Mais hingegen lässt die Ausdehnung der Fläche eine höhere Ernte erwarten.Die Richtpreise für Getreide wurden erneut gesenkt.Der Wert der Getreideernte 2005 wird deshalb um 6,3% unter dem Dreijahresmittel 2002/04 veranschlagt.
Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine mengenmässig gute Ernte erwarten.Der Zuckergehalt wird ähnlich wie im Vorjahr geschätzt.2005 wurden die Grundpreise reduziert und die Bio-Rübenproduktion aufgegeben.Die Marktstützung des Bundes zugunsten der Verwertung der Ölsaaten wurde gekürzt.So werden für alle Ölsaaten tiefere Preise bezahlt.Beim Raps waren zudem die Erträge deutlich tiefer als im Vorjahr.Zugenommen hat hingegen die Anbaufläche.Insgesamt resultiert beim Raps für 2005 ein deutlich tieferer Produktionswert als 2004.Stark rückläufig war die Anbaufläche für Soja.Insgesamt wird geschätzt,dass der Produktionswert der Handelsgewächse um 6,5% tiefer sein wird als das Dreijahresmittel 2002/04.
Bei den Futterpflanzen ist für 2005 sowohl qualitativ als auch quantitativ von einer guten bis sehr guten Ernte auszugehen.Deswegen wurden im Vergleich zum Vorjahr wesentlich tiefere Preise bezahlt.Der Produktionswert der Futterpflanzen dürfte deshalb dieses Jahr 10,2% unter dem Dreijahresmittel 2002/04 liegen.
Beim Gemüse blieben Angebot und Nachfrage meistens im Gleichgewicht,so dass gute Preise erzielt werden konnten.Bei den Lagergemüsekulturen ist wiederum eine gute Ernte zu erwarten.Die Rekordmenge des letzten Jahres dürfte aber nicht erreicht werden.Insgesamt wird mit einem Produktionswert gerechnet,der vergleichbar mit 2004 ist.
Im Bereich des produzierenden Gartenbaues hat sich die Lage deutlich verschlechtert. Verringern dürften sich sowohl die Einnahmen aus Baumschulerzeugnissen,als auch aus dem Blumenanbau.Geschätzt wird ein Rückgang des Produktionswertes von 6,5% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04.
Die Kartoffelanbaufläche ging 2005 wie in den Vorjahren zurück.Die Erträge sind tiefer als letztes Jahr.Die Qualität wird als gut bezeichnet.Bei gleichbleibenden Preisen wie letztes Jahr wird der Erntewert mit 2,3% leicht tiefer als letztes Jahr und 7,2% tiefer als das Dreijahresmittel 2002/04 geschätzt.
Beim Obst kann dieses Jahr von einer guten Ernte ausgegangen werden,die um 0,8% über dem Dreijahresmittel 2002/04 liegen dürfte.Die Preise hingegen dürften tiefer sein.Der Produktionswert wird deshalb leicht tiefer als im Vorjahr veranschlagt.
Der Produktionswert der Weine beruht teilweise auf den Vorjahren (Veränderungen der Vorräte).Die Weinverkäufe 2005 werden noch durch den Absatz der letzten Vorräte des Jahrganges 2003 geprägt,welcher qualitativ hoch stehend war.Dadurch sind die Weinpreise besser als im Dreijahresdurchschnitt 2002/04,und es wird für 2005 eine Zunahme des Weinproduktionswertes von 5,6% erwartet.Trotz schwerem Hagel im Lavaux-Gebiet wird die schweizerische Weintraubenernte 2005 mengenmässig nur leicht geringer als im Jahr 2004 geschätzt,mit durchschnittlich stabilen Weintraubenpreisen.Der Produktionswert für Weintrauben dürfte 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 6,4% zunehmen.

Bei der tierischen Produktion wird 2005 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2002/04 mit einer Abnahme von 4,0% gerechnet (4,843 Mrd.Fr.).Ein Rückgang wird sowohl bei der Nutz- und Schlachtviehproduktion als auch bei der Milchproduktion geschätzt. Beim Rindfleisch sind die Preise gegenüber 2004 ziemlich stabil geblieben,bei allerdings tieferen Schlachtungszahlen.Beim Nutzvieh wird der Absatz als gut bezeichnet. Der Viehexport dürfte trotz der Kürzung der Exportbeiträge keine Einbussen erleiden. Die höheren Schlachtzahlen bei den Schweinen waren im Vergleich zum Vorjahr mit deutlich tieferen Produzentenpreisen verbunden.Der Produktionswert dürfte deshalb gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 8% tiefer sein.Die inländische Geflügelproduktion ist bei ähnlichen Importzahlen wie im Vorjahr zurückgegangen und damit dürfte der Produktionswert leicht unter dem Wert des Dreijahresmittels 2002/04 liegen.Bei den Schlachtlämmern ist ein markanter Rückgang der Produktion festzustellen bei Preisen,die dem Vorjahresniveau entsprechen.Einem starken Druck ausgesetzt sind die Fohlenpreise,weil die Schlachtbetriebe für den Kauf von inländischen Fohlen ab diesem Jahr keine Importkontingente mehr erhalten.Weiter rückläufig ist der Produktionswert bei der Milch.Dies ist auf tiefere Produzentenpreise zurückzuführen. Bei den Eiern wird mit stabilen Preisen und einer stabilen Produktion gerechnet.Die von den Witterungsbedingungen stark abhängige Honigernte wird tiefer als in den letzten Jahren geschätzt.
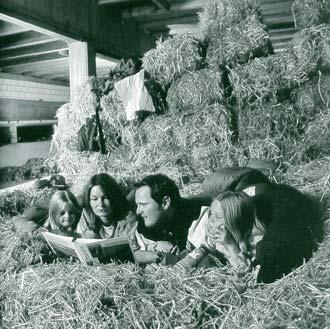
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen dürfte 2005 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2002/04 um 8,0% zunehmen und einen Wert von 667 Mio.Fr. erreichen.Gegenüber dem Vorjahr wird allerdings nur mit einer leichten Steigerung gerechnet.Dabei wird angenommen,dass die Einnahmen aus der Verpachtung von Milchkontingenten auf dem Vorjahresniveau verbleiben.
Für den Wert der nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten wird 2005 im Vergleich zum Dreijahresmittel 2002/04 ein Anstieg um 1,2% geschätzt. Der Wert dürfte sich auf 284 Mio.Fr.belaufen.Diese Position wird massgeblich von der Verarbeitungsmenge von Mostobst und den Dienstleistungen ausserhalb der landwirtschaftlichen Branche wie Strassenrand- und Landschaftspflege,der Haltung von Pensionstieren und vom Schlafen im Stroh beeinflusst.
Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2005 auf 5,971 Mrd.Fr.veranschlagt. Gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 bedeutet dies eine Abnahme um 2,1%.Die Ausgaben für Futtermittel dürften insgesamt tiefer als in den Vorjahren ausfallen.Dazu tragen sowohl die tiefere Einschätzung der innerbetrieblich erzeugten und verbrauchten Futtermittel (Gegenbuchung aus dem Produktionskonto) als auch geringere Ausgaben für die zugekauften Futtermittel bei.Bei letzteren dürfte der Rückgang der Mischfutterpreise stärker ins Gewicht fallen als die Zunahme der Menge.Die Energiekosten haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.Dies ist auf die höheren Erdölpreise zurückzuführen,welche die Ausgaben für Brenn- und Treibstoffe im Jahr 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 16% (35 Mio.Fr.) ansteigen lassen dürften.Leicht steigende Lohnkosten in der übrigen Wirtschaft verteuerten in den letzten Jahren auch die zugekauften Dienstleistungen wie Tierarztkosten und Instandhaltung sowie andere administrative Kosten.Die geschätzte Abnahme der Ausgaben für Vorleistungen im Jahr 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 ist praktisch ausschliesslich auf die tieferen Ausgaben für Futtermittel zurückzuführen.
Bei der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen wird mit einer Abnahme von 5,6% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 gerechnet (4,025 Mrd.Fr.).Die tieferen Ausgaben für Vorleistungen können den niedrigeren Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches nicht kompensieren.
Die Abschreibungen werden 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 2,4% höher geschätzt (1,973 Mrd.Fr.).Für das Jahr 2005 wird zwar ein Rückgang der Investitionen in nichtlandwirtschaftliche Güter und für Neuinvestitionen in Ausrüstungen (Fahrzeuge und Maschinen) und in Gebäude vorausgesagt.Die Abschreibungen werden jedoch zum grossen Teil von den in den Vorjahren getätigten Investitionen und der gegenwärtigen Preisentwicklung beeinflusst.Die Preisentwicklung war in den letzten Jahren sowohl für Ausrüstungsgüter wie auch für Bauten steigend.
Die sonstigen Produktionsabgaben dürften 2005 gleich bleiben wie im Dreijahresmittel 2002/04.Die übrigen Produktionsabgaben (Motorfahrzeug- und Stempelgebühren) dürften ansteigen,die Unterkompensation der Mehrwertsteuer (abhängig von Vorleistungs- und Investitionsausgaben) dagegen tiefer ausfallen.
Die sonstigen Subventionen beinhalten alle Direktzahlungen,den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite,Betriebshilfe) und die übrigen kantonalen und von Gemeinden erbrachten laufenden Beiträge.Nicht Bestandteil sind die Gütersubventionen,welche bereits im Produktionswert zu Herstellungspreisen berücksichtigt wurden (z.B.Zulage für verkäste Milch) und die Vermögenstransfers (z.B.Investitionskredite für Strukturverbesserungen),welche im Vermögensbildungskonto verbucht werden.Zusätzlich enthalten die sonstigen Subventionen auch die Überkompensation der Mehrwertsteuer,welche für 2005 auf 155 Mio.Fr.geschätzt wird.Mit voraussichtlich 2,712 Mrd.Fr.(2,557 Mrd.Fr.ohne die Überkompensation der Mehrwertsteuer) dürften die sonstigen Subventionen 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 0,2% abnehmen.Die Differenz zwischen Über- und Unterkompensation der Mehrwertsteuer liegt für 2005 bei 115 Mio.Fr.(Anstieg von 6,6% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04),was zu Lasten der Landwirtschaft zu verbuchen ist.
Das Arbeitnehmerentgelt (= Angestelltenkosten) wird 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 0,4% höher veranschlagt (1,148 Mrd.Fr.).Der Rückgang von Angestellten in der Landwirtschaft (–2,3%,in Jahresarbeitseinheiten ausgedrückt) dürfte durch den Anstieg der Lohnkosten (inkl.Sozialbeiträge der Arbeitsgeber) mehr als kompensiert werden.
Die gezahlten Pachten werden 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 0,7% tiefer eingeschätzt (199 Mio.Fr.).Die gezahlten Schuldzinsen dürften 2005 gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04 um 9,7% tiefer zu liegen kommen (309 Mio.Fr.).Dies ist zum grossen Teil auf die Senkung der Hypothekarzinsen zurückzuführen.Erwartet wird aber auch ein leichter Rückgang des Anteils der teuren kurzfristigen Kredite am gesamten Fremdkapital.
Als Nettounternehmenseinkommen würden 2,776 Mrd.Fr verbleiben.Dies entspricht einem Rückgang von 8,6% gegenüber dem Dreijahresmittel 2002/04.Das Nettounternehmenseinkommen dürfte damit etwa gleich hoch sein wie im Jahr 2003, welches durch die Trockenheit geprägt war.
1.1.4Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon.Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren wie z.B.zur finanziellen Stabilität oder zur Rentabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe.Im Tabellenanhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt.Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen.

■ Einkommen 2004 besser als 2001/03
Tabellen 16–25,Seiten A16–A26
Einkommen und betriebswirtschaftliche Kennziffern
Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel aller Regionen
1990/922004 200120022003
Im Jahr 2004 waren die wirtschaftlichen Ergebnisse besser als im Durchschnitt der Jahre 2001/03.Der Rohertrag aus landwirtschaftlicher Produktion nahm gegenüber 2001/03 um 9% zu.Beim Pflanzenbau waren die Erlöse 11% höher,zurückzuführen vor allem auf hohe Erträge im Ackerbau und bei der Raufutterproduktion sowie auf gute Obstpreise.Die Erlöse aus der Tierhaltung stiegen um 4%.Hier konnte der 5 Rp. tiefere Milchpreis durch eine positive Entwicklung beim Nutz- und Schlachtvieh kompensiert werden.So haben die Erlöse in der Schweinehaltung leicht zugenommen und jene der Geflügelhaltung sind stark gestiegen,zurückzuführen vor allem auf Bestandesvergrösserungen.Positiv beeinflusst wurde das Resultat auch durch eine höhere Bilanzbewertung des Rindviehs.Die Direktzahlungen pro Betrieb nahmen gegenüber den drei Vorjahren im Durchschnitt der Betriebe um 5% zu.Sie sind die Folge der weiterhin steigenden Beteiligung bei den Öko- und Ethoprogrammen wie BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung),RAUS (Regelmässiger Auslauf im Freien) und regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen.
Die Fremdkosten lagen im Jahr 2004 um 8% über dem Dreijahreswert 2001/03. Zugenommen haben insbesondere die Kosten für Futtermittel,Arbeiten durch Dritte, Reparaturen und das Personal.Die gestiegenen Kosten für zugekauftes oder zugemietetes Milchkontingent stehen in direktem Zusammenhang mit den höheren Erträgen in diesem Bereich.Trotz Zunahme der Hypothekarschulden konnten bei den Schuldzinsen infolge der gesunkenen Zinssätze grössere Einsparungen realisiert werden.
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten.Im Jahr 2004 lag es 10% über dem Vorjahreswert und 14% über dem Mittelwert der Jahre 2001/03.Das landwirtschaftliche Einkommen entschädigt einerseits die Arbeit der durchschnittlich 1,25 Familienarbeitskräfte und andererseits das im Betrieb durchschnittlich investierte Eigenkapital von rund 400'000 Fr.
Das landwirtschaftliche Einkommen war 2004 gegenüber 2001/03 in allen Regionen höher,am stärksten war die Zunahme in der Talregion (+15%),gefolgt von der Berg(14%) und der Hügelregion (13%).Das ausserlandwirtschaftliche Einkommen hat auch überall zugenommen,in der Talregion um 13%,in der Bergregion um 10% und in der Hügelregion um 8%.Das Gesamteinkommen stieg damit am stärksten in der Talregion (+14%),gefolgt von der Berg- (13%) und der Hügelregion (+12%).
Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2004 16% in der Talregion,24% in der Hügelregion und 38% in der Bergregion.Damit hat der Anteil in allen Regionen abgenommen,am stärksten in der Bergregion.
Die Einkommenssituation der 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) weist erhebliche Differenzen auf.
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2002/04 BetriebstypLandw.Familien- Landw.Ausserlandw.GesamtNutzflächearbeits-EinkommenEinkommeneinkommen kräfte
Im Durchschnitt der Jahre 2002/04 erzielten die Betriebstypen Spezialkulturen, Ackerbau,Veredlung und bestimmte kombinierte Betriebe (Veredlung,Verkehrsmilch/ Ackerbau) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen.Diese erwirtschafteten zusammen mit dem Betriebstyp kombiniert Mutterkühe auch die höchsten Gesamteinkommen.Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen anderes Rindvieh und Pferde,Schafe,Ziegen.Dazwischen liegen die spezialisierten Verkehrsmilchbetriebe.Ihre Ergebnisse sind in allen Einkommenskategorien unterdurchschnittlich.
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte.Gegenüber dem Dreijahresmittel 2001/03 hat sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) im Jahr 2004 um 25% verbessert.Im Vergleich zum Jahr 2003 stieg er um 10%.Der starke Anstieg gegenüber 2001/03 ist vor allem darauf zurückzuführen,dass das Zinsniveau gesunken ist und damit der kalkulatorische Zinsanspruch für das Eigenkapital stark zurückgegangen ist.
Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich.Im Durchschnitt liegt er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion.Auch die Quartile liegen weit auseinander.So erreichte 2002/04 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 24% und derjenige im vierten Quartil 197% des Mittelwertes aller Betriebe der Region.In der Hügelregion war die Streuungsbandbreite ähnlich und im Berggebiet noch extremer.
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 2002/04: nach Regionen und Quartilen
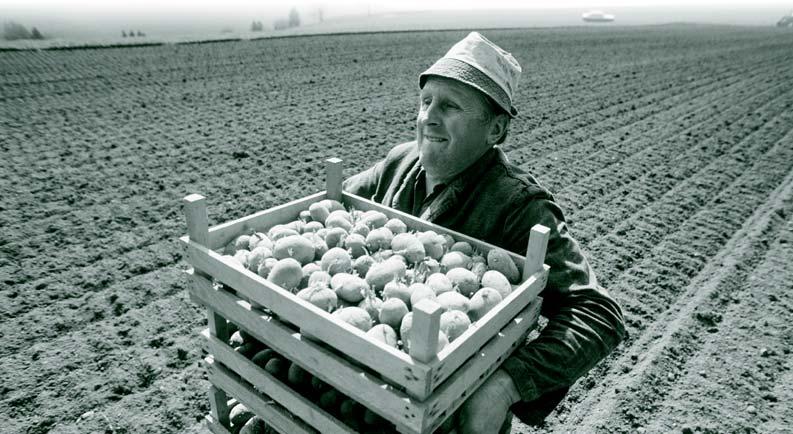
1 in Fr.pro FJAE 2
zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen:2002:3,22%;2003:2,63%,2004:2,73%
■ Finanzielle Stabilität
In der Talregion übertraf 2002/04 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung deutlich.In der Hügelregion übertraf das vierte Quartil den Vergleichslohn nur knapp,während in der Bergregion der Wert knapp 5'000 Fr.unter dem Vergleichswert lag.Im Vergleich zur Periode 2001/03 haben vor allem die Tal- und Bergregion ihre relative Situation verbessert.
Vergleichslohn 2002/04,nach Regionen RegionVergleichslohn
1Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten
Quellen:BFS,Agroscope FAT Tänikon
Zu berücksichtigen gilt,dass die landwirtschaftlichen Haushalte ihren Lebensunterhalt nicht nur aus dem Arbeitsverdienst bestreiten.Ihr Gesamteinkommen,einschliesslich der ausserlandwirtschaftlichen Einkommen,liegt wesentlich höher als der Arbeitsverdienst.
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens.Kombiniert man diese Kennzahl mit der Grösse der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen.Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält – finanziell nicht existenzfähig.
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt.
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit …
Fremdkapitalquote
Tief (<50%)Hoch (>50%)
EigenkapitalbildungPositiv...guter...beschränkter finanfinanzieller Situationzieller Selbständigkeit Negativ...ungenügendem ...bedenklicher
Einkommenfinanzieller Situation
Quelle:De Rosa
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild.44% der Betriebe befinden sich in einer finanziell guten Situation und 34% sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung).Das Dreijahresmittel 2002/04 präsentiert sich damit in allen Regionen etwas besser als 2001/03.
Beurteilung der finanziellen Stabilität 2002/04 nach Regionen

■ Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
Die Investitionen der FAT-Referenzbetriebe haben im Jahr 2004 im Vergleich zu 2001/03 zugenommen (+11%).Gleichzeitig stieg auch der Cashflow (+11%). Entsprechend hat sich das Cashflow-Investitionsverhältnis praktisch nicht verändert. Die Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen minus Privatverbrauch) ist markant besser als in der Referenzperiode (+70%),während sich die Fremdkapitalquote etwas verschlechtert hat (+5%).Der Grund für diese Zunahme liegt darin,dass die Investitions- und die Hypothekarkredite stärker zugenommen haben als das Eigenkapital.
Entwicklung von Eigenkapitalbildung,Investitionen und Fremdkapitalquote
1 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2 Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Das Soziale ist eine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit.In der Berichterstattung über die agrarpolitischen Auswirkungen nehmen die sozialen Aspekte daher einen eigenen Platz ein.Die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft befasst sich zum einen mit dem Einkommen und dem Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte und mit Bestandesaufnahmen bei fünf zentralen sozialen Themen:
–Inanspruchnahme sozialer Leistungen, –Arbeit und Ausbildung, –Gesundheit, –Einkommen und Verbrauch sowie –Lebensqualität.
Die Bestandesaufnahme bei den sozialen Themen wird periodisch,im Rhythmus von vier oder fünf Jahren,vorgenommen.Zum andern werden soziale Aspekte in Fallstudien untersucht und für die Sozialberichterstattung aufgearbeitet.
In diesem Agrarbericht werden das Einkommen und der Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der Agroscope FAT Tänikon und im Rahmen der Bestandesaufnahme die Resultate einer Umfrage über die Lebensqualität der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung aufgezeigt.

Einkommen und Verbrauch
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Bauernfamilien sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen.Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem als Mass für die Leistungsfähigkeit der Betriebe. Bei der sozialen Dimension steht die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte im Vordergrund.Daher wird das ausserlandwirtschaftliche Einkommen der Bauernfamilien ebenfalls mit in die Analyse einbezogen.Untersucht werden dabei sowohl Gesamteinkommen als auch die Entwicklung des Privatverbrauchs.
Das Gesamteinkommen,das sich aus dem landwirtschaftlichen und dem ausserlandwirtschaftlichen Einkommen zusammensetzt,lag im Durchschnitt der Jahre 2002/04 je nach Region zwischen 64’200 und 86’000 Fr.pro Betrieb:Die Betriebe der Bergregion erreichten etwa 75% des Gesamteinkommens der Betriebe der Talregion.Mit durchschnittlichen ausserlandwirtschaftlichen Einkommen von 19’300 bis 21’700 Fr.hatten die Bauernfamilien eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle:Diese machte bei den Betrieben der Talregion 22% des Gesamteinkommens aus,bei jenen der Hügelregion 29% und bei denjenigen der Bergregion 34%.Die Betriebe der Bergregion wiesen mit 21’700 Fr.auch absolut die höchsten ausserlandwirtschaftlichen Einkommen aus.
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Betrieb 2002/04
Die Eigenkapitalbildung – der nicht konsumierte Teil des Gesamteinkommens – macht in allen Regionen durchwegs rund 15% des Gesamteinkommens aus.Der Privatverbrauch liegt jeweils über der Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens.Er ist entsprechend der Höhe des Gesamteinkommens bei den Betrieben der Talregion absolut am höchsten und bei den Betrieben der Bergregion am tiefsten.
Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Betrieb lag 2004 mit rund 82’000 Fr. über jenem der Jahre 2001/03 mit 72’500 Fr.Ebenso hat der Privatverbrauch pro Betrieb im Jahr 2004 im Vergleich zu 2001/03 um etwa 3’100 Fr.zugenommen und lag bei 66’400 Fr.
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Verbrauchereinheit
nach Quartil 1 2002/04

1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.QuartilAlle Betriebe
Gesamteinkommen pro VE 2 (Fr.)13 93217 71622 43732 64121 602 Privatverbrauch pro VE (Fr.)15 45316 31918 66722 60118 219
1 Quartile nach Arbeitsverdienst je Familien-Jahresarbeitseinheit
2 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr Quelle:Zentrale Auswertung,Agroscope FAT Tänikon
Die Betriebe des ersten Quartils erreichten 43% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Betrieben des vierten Quartils.Beim Privatverbrauch war die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer:Er lag bei den Betrieben des ersten Quartils bei 68% des Verbrauchs der Betriebe des vierten Quartils.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte 2002/04 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken.Sie mussten einen Teil ihrer eigentlich für Ersatz- und Neuinvestitionen bzw.für ihre Altersvorsorge erforderlichen Mittel für den Privatverbrauch einsetzen.Die Eigenkapitalbildung ist bei diesen Betrieben negativ.Zehren diese Betriebe längerfristig von der Substanz,so müssen sie früher oder später aufgegeben werden.Bei den Betrieben in den übrigen Quartilen war der Privatverbrauch geringer als das Gesamteinkommen:Er lag bei den Betrieben des zweiten Quartils bei 92% des Gesamtenkommens,bei den Betrieben des dritten Quartils bei 83% und bei den Betrieben des vierten Quartils bei 69%.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit war 2004 in allen Quartilen im Vergleich zu den drei Vorjahren 2001/03 klar höher.Auch der Privatverbrauch hat im Jahr 2004 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2001/03 in allen Quartilen leicht zugenommen.
■ Konzept der Lebensqualität
Erhebung über die Lebensqualität
Die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit auf die Lebensqualität ist eines der fünf zentralen sozialen Themen,zu welchen periodisch eine repräsentative Erhebung durchgeführt wird.
Das BLW hatte 1999 das Institut für Agrarwirtschaft (IAW) der ETH Zürich beauftragt, Grundlagen für die Berichterstattung zur sozialen Lage der Schweizer Landwirtschaft zu entwickeln.Im Vordergrund der ETH-Arbeit stand das Konzept der Lebensqualität: Eine hohe Lebensqualität resultiert immer dann,wenn objektiv messbare Lebensbedingungen resp.Lebensbereiche von Personen aufgrund ihrer Zielsetzungen und dem aktuellen Zielerreichungsgrad subjektiv positiv bewertet werden.
Das GfS-Forschungsinstitut Zürich (heute:gfs-zürich) führte im Frühjahr 2001 im Auftrag des BLW eine telefonische Umfrage durch über die Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen,die künftige finanzielle Lage,positive und negative Seiten am Beruf Landwirt sowie das Angstbarometer.Die Ergebnisse wurden im Agrarbericht 2001 veröffentlicht und sind unter www.blw.admin.ch/agrarberichte/ zu finden.
■ Befragung im Frühjahr 2005
Das BLW liess 2005 diese Umfrage mit einer Ausnahme in genau gleicher Art und Weise wiederholen und eine Gegenüberstellung mit der Erhebung von 2001 vornehmen.Angestrebt wurde mit dieser aktuellen Befragung wiederum,die Lebenssituation der Bauern und Bäuerinnen mit derjenigen der übrigen Bevölkerung (Referenz) zu vergleichen,die entweder in Agglomerationen oder in Landgemeinden wohnhaft ist.Neu wurde neben der Zufriedenheit auch die Einschätzung der Wichtigkeit der verschiedenen Lebensbereiche erhoben.Aus diesen Angaben wurde der sogenannte Lebensqualitätsindex berechnet:Kombiniert man die Einschätzung der Zufriedenheit von Lebensbereichen mit der Einschätzung deren Wichtigkeit,kann die subjektiv empfundene Lebensqualität in einem Index zusammengefasst werden.Die oben erwähnte ETH-Arbeit diente dabei als konzeptionelle Grundlage für die Berechnung des Indices.
Neben der Zufriedenheit und Wichtigkeit in den 12 Lebensbereichen (Erwerbsarbeit, Ausbildung,Weiterbildung,Einkommen,allgemeiner Lebensstandard,Familie,soziales Umfeld,stabile Rahmenbedingungen,Freizeit,Gesundheit,genügend Zeit,kulturelles Angebot) wurden Einschätzungen zur zukünftigen Einkommenssituation,zu positiven und negativen Seiten des Bauernberufs und zu persönlichen Angst- und Bedrohungsgefühlen (Angstbarometer) erhoben.Dabei waren mit Ausnahme der Beurteilung der positiven und negativen Seiten des Bauernberufs bei den übrigen Themen die Antwortmöglichkeiten vorgegeben.Im Unterschied zu allen anderen Fragen dieser Erhebung hatte die Referenz-Bevölkerung bei den Fragen zur Einschätzung des Bauernberufs nicht ihre persönliche Situation zu beurteilen,sondern ihr Bild und ihre Wahrnehmung des Bauernberufes.
■ Zufriedenheit in der Landwirtschaft geringer

Das gfs-zürich hat die Umfrage von Mitte Februar bis Anfang März 2005 durchgeführt. Für die landwirtschaftliche Bevölkerung wurde eine repräsentative Stichprobe aus der Liste der direktzahlungsberechtigten Betriebe gezogen und 261 Bauern und 245 Bäuerinnen befragt.Bei der Referenzbevölkerung wurden ausgehend von einer Zufallsstichprobe aus dem elektronischen Telefonverzeichnis 256 Männer und 257 Frauen, repräsentativ nach Landesregion,Erwerbstätigkeit sowie Altersklasse verteilt,interviewt.
Da bei den Ergebnissen kaum geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen,werden bei den Abbildungen jeweils nur die beiden Gruppen Landwirtschaft und Referenz aufgeführt.
Bei der Frage nach der Zufriedenheit in 12 vorgegebenen Lebensbereichen zeigt sich, dass sowohl die bäuerliche als auch die übrige Bevölkerung mit den Bereichen Familie und Gesundheit am zufriedensten sind (je zufriedener umso kleiner der Mittelwert).Am unzufriedensten sind beide Gruppen mit den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.Deutlich unzufriedener als die Referenzgruppe ist die befragte bäuerliche Bevölkerung mit der zur Verfügung stehenden Zeit und der Freizeit.
Die Zufriedenheit der befragten bäuerlichen Bevölkerung hat sich in den vergangenen vier Jahren insgesamt verbessert.Besonders markant ist die gesteigerte Zufriedenheit in den Bereichen Einkommen sowie stabile politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.Dies überrascht nicht sehr,was das Einkommen anbetrifft,da die Buchhaltungszahlen diese Einschätzung bestätigen.
Veränderung der Zufriedenheit bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung
Ebenfalls zufriedener als 2001 zeigt sich die bäuerliche Bevölkerung sowohl mit ihrer Freizeit wie mit der allgemein zur Verfügung stehenden Zeit.Trotz gestiegener Zufriedenheit sind die befragten Bauern und Bäuerinnen mit diesen beiden Faktoren allerdings wie vor vier Jahren deutlich weniger zufrieden als die übrige Bevölkerung: So lag 2001 der Mittelwert der Zufriedenheit was die Freizeit anbetrifft bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung bei 2,6 und bei der Referenz-Bevölkerung bei 2,0 und jener der zur Verfügung stehenden Zeit bei 2,9 resp.2,4.2001 fanden sich die bedeutendsten Unterschiede bei der Bewertung des Einkommens und der stabilen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (beide Male Landwirtschaft:3,1; Referenz:2,4).
In den anderen Bereichen – Familie,Gesundheit,Erwerbsarbeit,soziales Umfeld,Ausbildung,allgemeiner Lebensstandard,Weiterbildung,kulturelles Angebot – hat sich die Zufriedenheit der Landwirtschaft gegenüber 2001 nur um 0,1 Punkte verändert.

■ Gesundheit und Familie am wichtigsten
Die Referenz-Bevölkerung ist 2005 unzufriedener mit den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (0,3 Punkte) und mit dem kulturellen Angebot (0,2), hingegen zufriedener mit der zur Verfügung stehenden Zeit (0,3).In den neun übrigen Lebensbereichen ist die Einschätzung der Zufriedenheit entweder genau gleich wie vor vier Jahren oder hat sich nur um 0,1 Punkte geändert.
Im Frühjahr 2005 wurde erstmals die Einschätzung der Wichtigkeit der 12 Lebensbereiche erfragt.Hierbei setzen die beiden Bevölkerungsgruppen ähnliche Prioritäten. Die höchste Bedeutung geniessen die Gesundheit und die Familie.
Wichtigkeit der einzelnen Lebensbereiche
Weiterbildung
Stabile politische/wirtschaftliche Rahmenbedingungen Freizeit
Mittelwerte: Skala von 1 = sehr wichtig bis 5 = sehr unwichtig
Quelle: gfs-zürich
Am wenigsten wichtig ist beiden Gruppen das kulturelle Angebot,bei der landwirtschaftlichen Gruppe noch ausgeprägter als bei der Referenzgruppe.In der Prioritätenliste weit hinten stehen auch der allgemeine Lebensstandard und die Freizeit,welche der bäuerlichen Bevölkerung vergleichsweise ebenfalls noch weniger wichtig sind. In diesen Bereichen ist die landwirtschaftliche Bevölkerung gewohnt,Abstriche zu machen und setzt daher die Bedeutung dieser Faktoren etwas weniger hoch an. Wichtiger als der Referenzbevölkerung sind den bäuerlichen Kreisen hingegen stabile politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
■
Um die subjektiv empfundene Lebensqualität zusammengefasst abbilden zu können werden nach der eingangs erwähnten ETH-Studie die Einschätzung zur Wichtigkeit der vorgegebenen Lebensbereiche mit der Einschätzung der ihnen zugeordneten Zufriedenheit kombiniert und in einem Lebensqualitätsindex dargestellt.Hierzu wurde die Skala der Wichtigkeit auf 0,2 bis 1 («völlig unwichtig» bis «sehr wichtig») und diejenige der Zufriedenheit von –3 bis 3 («sehr unzufrieden» bis «sehr zufrieden») umcodiert.Der Lebensqualitätsindex ist die Summe der Produkte aus dem Wert für die Wichtigkeit und der Zufriedenheit über alle zwölf Lebensbereiche.Basierend auf der gewählten Skalierung kann der Lebensqualitätsindex Werte zwischen –36 und +36 annehmen.
Berechnung des Lebensqualitätsindices
Umcodierung WichtigkeitUmcodierung Zufriedenheit völlig unwichtig0,2sehr unzufrieden–3 unwichtig0,4unzufrieden–1,5 unbestimmt0,6unbestimmt0 wichtig0,8zufrieden+1,5 sehr wichtig1sehr zufrieden+3
Der Lebensqualitätsindex ist die Summe der Produkte über alle 12 Lebensbereiche:Zuerst wird der jeweilige Code bzw.Wert für die Einschätzung der Wichtigkeit eines Lebensbereiches mit dem jeweiligen Code bzw.Wert für die Einschätzung dessen Zufriedenheit multipliziert und anschliessend werden diese 12 Ergebnisse addiert.
Der Lebensqualitätsindex beträgt maximal 36 Punkte,wenn alle 12 Lebensbereiche mit «sehr wichtig» und «sehr zufrieden» eingeschätzt werden,und minimal –36,wenn alle 12 Lebensbereiche von einer Person mit «sehr wichtig» und «sehr unzufrieden» beurteilt werden.Schätzt eine Person ihre Zufriedenheit in allen 12 Lebensbereichen als «unbestimmt» ein,so liegt ihr Lebensqualitätsindex bei 0.
Der Lebensqualitätsindex der landwirtschaftlichen Bevölkerung liegt im Mittel bei 14,6.Am häufigsten sind Indexe zwischen 8 und 18.Die Frauen in der Landwirtschaft haben tendenziell einen etwas höheren Lebensqualitätsindex.Zehn Personen aus bäuerlichen Betrieben haben einen negativen Index und sind somit unzufrieden mit ihrer Lebenssituation.
Während in den weiter oben stehenden Abbildungen jeweils nur der Mittelwert aufgezeigt wurde,zeigen die beiden folgenden Graphiken die Streuung der Antworten.
Lebensqualitätsindex der landwirtschaftlichen Bevölkerung Mittelwert 14,6

Die Referenzbevölkerung hat insgesamt einen höheren Lebensqualitätsindex als die landwirtschaftliche Bevölkerung.Der Mittelwert beträgt hier 16,5.Nur gerade drei Personen drücken eine eindeutige Unzufriedenheit über alle 12 Lebensbereiche aus.
Lebensqualitätsindex der Referenzbevölkerung Mittelwert 16,5
■ Landwirtschaft schätzt künftige finanzielle Lage weniger
Nach den Resultaten rund um den Lebensqualitätsindex resp.der Einschätzung von Zufriedenheit und Wichtigkeit der 12 Lebensbereiche folgen nun zwei Beurteilungen zur zukünftigen finanziellen Lage,eine Einschätzung der positiven und negativen Seiten des Bauernberufs sowie die Antworten zu 25 vorgegebenen Fragen bezüglich Angst- und Bedrohungsgefühlen.
Ihre künftige finanzielle Situation schätzt die bäuerliche Bevölkerung 2005 nach wie vor pessimistischer ein als die Referenzgruppe.
Möglichkeit,
%, in Klammer Werte von 2001
Etwa ein Drittel der befragten bäuerlichen Bevölkerung glaubt,in den nächsten drei Jahren eher weniger sparen zu können;bei der Referenzbevölkerung ist nur ein Viertel dieser Meinung.Analog zur weiter oben festgestellten gesteigerten Zufriedenheit mit dem Einkommen,wird auch die Einschätzung der zukünftigen finanziellen Lage in bäuerlichen Kreisen heute positiver beurteilt als vor vier Jahren.Die Abstände zwischen den beiden Gruppen haben sich gegenüber 2001 verringert,unter anderem auch,weil die übrige Bevölkerung pessimistischer geworden ist.
Entwicklung der finanziellen Lage in den kommenden 12 Monaten
■ Vor- und Nachteile des Bauernberufs
Wie bei der Referenzbevölkerung glauben etwas mehr als 60% der befragten bäuerlichen Bevölkerung,ihre finanzielle Lage werde in den nächsten 12 Monaten gleich bleiben.Von den Restlichen denkt nach wie vor die Mehrheit,ihre Lage werde sich verschlechtern.Im Vergleich zur übrigen Bevölkerung hat sich das Verhältnis aber verbessert.2001 dachte die landwirtschaftliche Bevölkerung rund dreimal häufiger als die Referenzbevölkerung (Landwirtschaft:26%;Referenz 9%),ihre finanzielle Lage werde sich verschlechtern,heute sind es weniger als doppelt so viele.
Als besonders positive Seiten am Bauernberuf werden von beiden Gruppen die Selbständigkeit und die Arbeit in der Natur genannt.

Einschätzung positiver Seiten des Bauernberufs
Selbständigkeit, freie Einteilung, eigener Chef
Der bäuerlichen Bevölkerung gegenüber 2001 wichtiger sind die Aspekte Selbstständigkeit,mit der Familie zusammen sein,Kontakt mit Tieren und Arbeiten in der Natur.Weniger häufig genannt wurden die Punkte Selbstversorger und Familienbetrieb.Neu eingebracht werden die Landschaftspflege,gesunde Arbeitsweise sowie Herstellung biologischer Produkte.Bei der Referenzbevölkerung wird das Arbeiten in der Natur am häufigsten genannt.Der Aspekt mit der Familie zusammen sein wird seltener eingebracht,dafür erhalten Konsumenten- und ökologische Themen wie Selbstversorger oder Landschaftspflege mehr Gewicht.
Einschätzung negativer Seiten des Bauernberufs
Lange Arbeitszeit/Präsenzzeit
Marktdruck Viele
Wenig Freizeit/Ferien geringer Verdienst/Einkommen
Wetterabhängigkeit Landwirtschaft Referenz 26 (36) 25 (28) 25 (25) 11 (10) 25 (18) 15 (28) 20 (21) 17 (20) 7 (14) 11 (7) 12 12 (7) 8 (4) 1 11 (7) 10 6 (4) 6 (4) 17 (21) 11
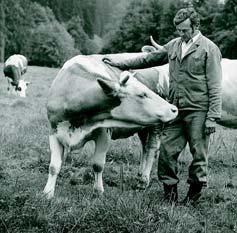
Preiszerfall, in %, in Klammer Werte von 2001 0 15 30 5 10 20 25 Quelle: gfs-zürich
Als besonders negativ werden von beiden Bevölkerungsgruppen – wie vor vier Jahren – die langen Arbeitszeiten,die vielen Vorschriften,der Mangel an Freizeit und der geringe Verdienst genannt.Von der befragten landwirtschaftlichen Gruppe weniger häufig als vor vier Jahren angeführt werden die lange Arbeitszeit,der Marktdruck und der geringe Verdienst,dafür wird die geringe Freizeit/Ferienzeit und die geringe Wertschätzung häufiger erwähnt.Neu eingebracht wird die körperliche und seelische Belastung durch den Beruf sowie die zunehmende Bürokratie.Die Referenzbevölkerung nennt allgemein weniger negative Punkte.Besonders die vielen Vorschriften, der Mangel an Freizeit / Ferien sowie die Bürokratie werden von ihr deutlich seltener erwähnt.Dies sind alles Aspekte,bei denen der nicht bäuerlichen Bevölkerung der direkte Einblick zur Beurteilung fehlt bzw.ein deutlicher Wahrnehmungsunterschied besteht.
Ängste und Bedrohungsgefühle sind 2005 bei der bäuerlichen Bevölkerung und der Referenzgruppe insgesamt etwa gleich gross.Bei beiden steht an erster Stelle aller Ängste das Unbehagen durch den Egoismus der Menschen.
Angstindikatoren
Der Egoismus der Menschen
Überfremdung durch Ausländer und Flüchtlinge
Luft- und Wasserverunreinigung/ Klimaveränderungen
Die steigende weltweite Abhängigkeit der Wirtschaft (Firmen-Fusionen)
Unheilbare Krankheiten (z.B. Krebs, AIDS)
Risiken durch die Gentechnologie Allgemeiner Sittenzerfall, weil die Moral dauernd sinkt
Wirtschaftliche Notlage im Alter
Strassenbauten, Häuserblocks, Zersiedelung der Landschaft Energieverknappung
Politische Veränderungen/ radikale Bewegungen
Zu wenig Geld haben zum Leben
Inflation/Preissteigerungen
Schwere Unfälle/Invalidität
Immer geringere Bedeutung der Religion
Kriminalität/Überfälle
Atom-Verseuchung
Technische Veränderungen und Umwälzungen auf allen Gebieten
Das Gefühl, nur noch ein unbedeutendes Rädchen zu sein Angst, die Stelle/Arbeit zu verlieren oder keine Arbeitsstelle zu finden
Das Gefühl, in der Schweiz nicht mehr zuhause zu sein Angst, allein zu sein/ keine Freunde zu haben
Mittelwerte: Skala von 1 = keine Bedrohung bis 10 = grosse Bedrohung
Quelle: gfs-zürich
■ Mehr Ängste und Bedrohungsgefühle
Bei der befragten bäuerlichen Bevölkerung auf gleicher Höhe wie das Unbehagen wegen dem Egoismus der Menschen liegt das Bedrohungsgefühl wegen Überfremdung.Beide Ängste sind ein Zeichen des Gemeinschaftsverlustes.Ebenfalls vorne zu finden sind die Sorge um Luft-/Wasserverschmutzung und Klimaveränderungen sowie die Besorgnis wegen steigender weltweiter Abhängigkeit der Wirtschaft.Bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung haben die Frauen in verschiedenen Bereichen tendenziell etwas höhere Angstwerte.Die Referenzbevölkerung sorgt sich deutlich mehr um Krieg und um ihren Arbeitsplatz.
Der Angst-Gesamtindex ist in den letzten vier Jahren sowohl bei der bäuerlichen Gruppe (von 4,0 auf 4,4) als auch bei der Referenzbevölkerung (von 4,2 auf 4,5) angestiegen.
Veränderung der Angst-Werte bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung
Gesamtindex
Betrachtet man die Veränderungen im Vergleich zu 2001 zusammengefasst nach Themengruppen,so sieht man,dass in bäuerlichen Kreisen die stärkste Zunahme des Unsicherheitsgefühls nach Krieg und Egoismus in der Dimension kulturelle Bedrohung (abnehmende Bedeutung der Religion,Sittenzerfall) zu verzeichnen ist.Offenbar fühlt sich ein erheblicher Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung gleich wie auch die übrige nicht städtische Bevölkerung durch den Bedeutungsverlust traditioneller Werte bedrängt.Stark zugenommen haben auch die Ängste um die physische Unversehrtheit (unheilbare Krankheiten,Unfall/Invalidität) und vor Entfremdung (sich in der Schweiz nicht mehr zu Hause fühlen,Überfremdung,Kriminalität,technische Umwälzungen, nur ein Rädchen in einem grossen Getriebe sein).
Veränderung der Angst-Werte bei der Referenzbevölkerung
Bei der Referenz-Bevölkerung hat die Furcht vor der kulturellen Bedrohung im Vergleich mit 2001 am stärksten zugenommen.Die Angst vor Krieg,die sozio-ökonomische Bedrohung (Angst,die Stelle/Arbeit zu verlieren,nicht genug Geld haben zum Leben, Angst,die Wohnung zu verlieren,Geldentwertung/Inflation,wirtschaftliche Notlage im Alter) und der Egoismus sind 2005 ebenfalls deutlich grösser als noch vor vier Jahren. Einzig die Angst bezüglich physischer Unversehrtheit ist 2005 gegenüber 2001 klar zurückgegangen.

■ Momentane Einschätzung der Befindlichkeit besser als vor vier Jahren
Die Befindlichkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung hat sich im Vergleich zu 2001 in verschiedenen Bereichen verbessert.Insbesondere ist sie heute zufriedener mit ihrer Einkommenssituation und den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wo nur noch kleine Unterschiede im Vergleich zur Referenzbevölkerung bestehen. Insgesamt hat sich die Befindlichkeit zwischen landwirtschaftlicher und nicht bäuerlicher Bevölkerung angeglichen.Die grösste Differenz im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung betrifft die zur Verfügung stehende Zeit und die Freizeit.
Der Lebensqualitätsindex,welcher die Einschätzung der Zufriedenheit von Lebensbereichen mit der Einschätzung deren Wichtigkeit kombiniert,liegt bei der befragten landwirtschaftlichen Bevölkerung tiefer als jener der Referenz-Bevölkerung.Die Differenz ist insgesamt signifikant.Dies ist in bedeutendem Mass darauf zurückzuführen,dass die landwirtschaftliche Bevölkerung mit den Bereichen Freizeit und genügend Zeit haben deutlich unzufriedener ist als die übrige Bevölkerung.In zwei Bereichen (Gesundheit,politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen) ist die befragte landwirtschaftliche Bevölkerung gleich zufrieden,in vier Lebensbereichen (Familie,Erwerbsarbeit,Ausbildung,Weiterbildung) etwas zufriedener und in weiteren vier Bereichen (soziales Umfeld,allgemeiner Lebensstandard,kulturelles Angebot, Einkommen) etwas unzufriedener als die Referenz-Gruppe.
Die bäuerlichen Kreise beurteilen ihre finanzielle Zukunft 2005 wie schon 2001 zwar immer noch pessimistischer als die übrige Bevölkerung,das Verhältnis zwischen Pessimisten und Optimisten hat sich aber verbessert.
Im Zusammenhang mit dem Bauernberuf werden von der landwirtschaftlichen und der übrigen Bevölkerung als positive Seiten die Selbständigkeit und die Naturverbundenheit gesehen.Als wichtigste negative Seite werden von beiden Gruppen die lange Arbeitszeit genannt.Gegenüber 2001 neu eingebracht wurden u.a.der positive Aspekt Landschaftspflege sowie der negative Punkt körperliche und seelische Belastung durch den Beruf.
Ängste und Bedrohungsgefühle sind in den letzten vier Jahren allgemein angestiegen. Stark zugenommen hat bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung die Angst vor Krieg und vor dem Egoismus,die Beunruhigung durch den Abbau traditioneller Werte,durch mögliche Unfälle und Krankheiten sowie die Sorge durch Entfremdung.Interessanterweise sind die sozio-ökonomischen Ängste in der nicht bäuerlichen Bevölkerung stärker verbreitet als bei der bäuerlichen Gruppe.Dies obschon die bäuerliche Bevölkerung ihre zukünftige finanzielle Lage pessimistischer beurteilt.
und Ethologie
1.3.1 Ökologie
Eine der Leitplanken der schweizerischen Agrarpolitik bildet der Schutz der Umwelt und der biologischen Vielfalt.Das vorliegende Kapitel ist dieses Jahr dem Themenbereich Biodiversität gewidmet.Stickstoff und Wasser sowie Energie und Klima wurden im Agrarbericht 2004 bzw.2003 behandelt.Über die Themen Phosphor und Boden gab der Agrarbericht 2002 Aufschluss.Der erste Zyklus ist hiermit abgeschlossen,sodass eine Gesamtübersicht über die Ergebnisse des Agrar-Umweltmonitorings möglich ist. Die wichtigsten Resultate sind in Kapitel 1.4 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit dargestellt.
Auf die Entwicklung der Bodennutzung und der Produktionsmittel wird wie jedes Jahr im ersten Teil des Kapitels eingegangen.Der zweite Teil befasst sich mit dem Themenbereich biologische Vielfalt und Landschaft.Im dritten Teil wird über die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Nutzung auf Qualität und Vielfalt der Lebensräume informiert. Der letzte Teil zeigt schliesslich die Vielfalt der in der Landwirtschaft eingesetzten Rassen und Sorten auf.
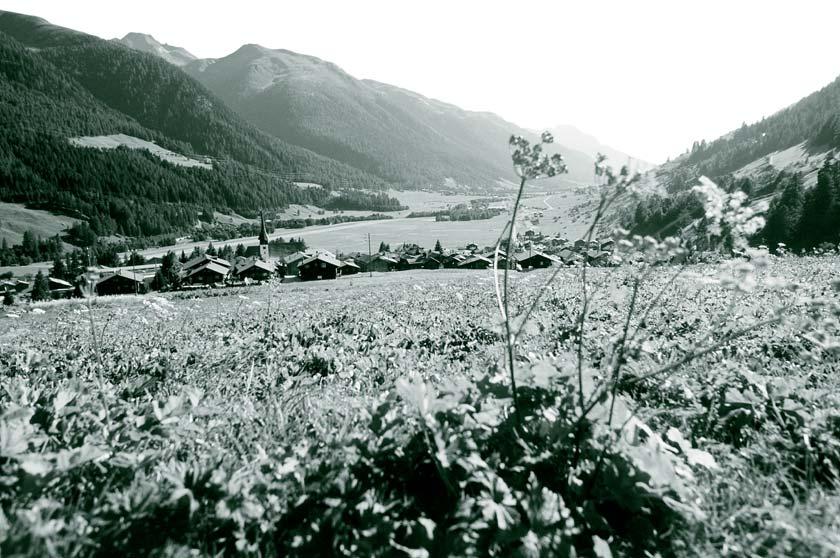
Bodennutzung und Produktionsmittel
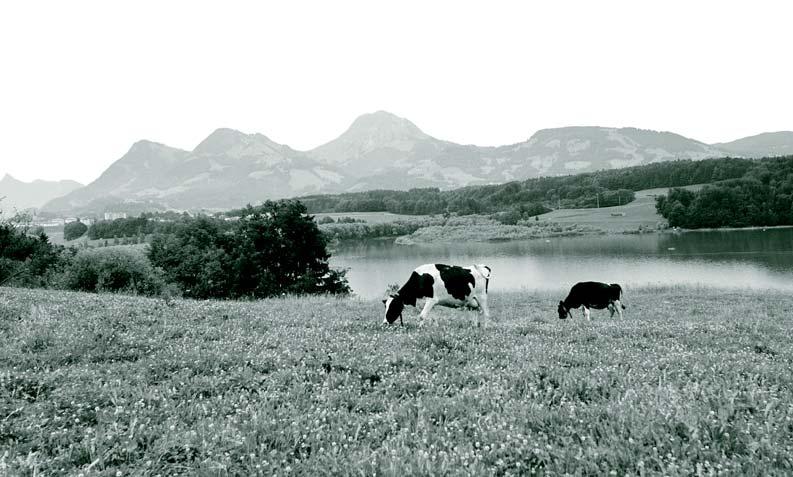
Biologische Vielfalt in der Landwirtschaft
Menschliche Einwirkungen beeinflussen und gestalten seit den letzten 6’000 Jahren die natürliche Vegetation der Schweiz.Die hauptsächlich aus Laubmischwald bestehende Vegetationsdecke wurde durch Rodungen und Weidenutzung aufgelichtet, dadurch entstand Raum für Landwirtschaft und Siedlungen.Die landwirtschaftliche Nutzung ermöglichte es lichtbedürftigen Arten aus verschiedenen Lebensräumen in die offenen Flächen einzuwandern und neue Artengesellschaften zu bilden.In der Folge entwickelten sich vielfältige Strukturen und Lebensräume.

Die seit Jahrtausenden währende Tradition der Nutztier- und Nutzpflanzenzucht brachte Sorten und Rassen,mit an die jeweiligen Umweltbedingungen und menschlichen Bedürfnissen angepassten Eigenschaften,hervor.Zusammen mit den wildlebenden Pflanzen und Tieren bilden sie standortangepasste Agrarökosysteme.Diese Vielfalt birgt ein grosses Potenzial für die Zukunft,wenn es darum geht,die Ernährung der Weltbevölkerung auch bei sich ändernden Umweltbedingungen sicherzustellen.
Durch die grosse Flächennutzung der Landwirtschaft kommt ihr im Zusammenhang mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt eine zentrale Bedeutung zu.Artenreiche Wiesen,Ackerflächen,Hecken oder Hochstammbäume sind Teil unseres kulturellen Erbes und sind Teil dessen,was landläufig unter «Kulturlandschaft» verstanden wird, deren Erhaltung und Pflege den Bauern mittels Direktzahlungen abgegolten wird.
Die biologische Vielfalt auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird als Agrobiodiversität bezeichnet.Diese Vielfalt und die Veränderlichkeit von Tieren,Pflanzen und Mikroorganismen sind notwendig,um die Schlüsselfunktionen des Agrarökosystems,seine Struktur und Prozesse aufrecht zu erhalten.Die Aufrechterhaltung der biologischen Vielfalt generell,und der Agrobiodiversität im speziellen,sind eine unabdingbare Voraussetzung,damit Grundbedürfnisse wie Ernährung,Bekleidung,Medizin oder Baumaterial auch in Zukunft sichergestellt werden können.
■ Was ist biologische Vielfalt und was leistet sie
Die biologische Vielfalt wird gemäss Biodiversitätskonvention allgemein in drei Kategorien eingeteilt:
– Ökosystem-Vielfalt: Genutzte (Landwirtschaft,Forstwirtschaft) und nicht genutzte Ökosysteme (Biotope) versorgen den Menschen mit lebenswichtigen Ressourcen wie Nahrung,Wasser,Sauerstoff und bilden die Grundlagen für die Land- und Forstwirtschaft.Sie sind wichtig für die Regulierung des Klimas,der Bodenfruchtbarkeit,des Wasserhaushaltes,Erosions- und Überschwemmungsschutz und bieten Lebens- und Erholungsräume,etwa für den Tourismus.
– Artenvielfalt: Die Millionen von Tierarten und Hunderttausenden von Pflanzenarten bilden in ihrem Zusammenleben und -wirken ein System,das sich über einen langen Zeitraum eingespielt hat.Der World Wildlife Fund for Nature (WWF) schätzt,dass in den letzten 30 Jahren ein Drittel des natürlichen Artenreichtums der Erde verloren ging und die Rote Liste der World Conservation Union (IUCN) umfasste 2004 weltweit 15'589 vom Aussterben bedrohte Arten. In der Schweiz kommen schätzungsweise 75'000 Arten vor.Die Zahl setzt sich zusammen aus ca.45'000 Tierarten (Wirbeltiere,Arthropoden,Insekten,Würmer, Mollusken) und ca.30'000 Arten von Gefässpflanzen,Moosen,Flechten und Pilzen.
– Genetische Vielfalt bezeichnet die Vielfalt innerhalb der Arten.Sie ist die Voraussetzung für die Evolution und damit für das Überleben der Arten.Diese Eigenschaften werden insbesondere auch in Züchtung und Produktion genutzt. Der Reichtum der Gen-Ressourcen ist erst ansatzweise erforscht.
Landwirtschaftliche Nutzung und biologische Vielfalt beeinflussen sich gegenseitig. Durch die Ertragssteigerung der landwirtschaftlichen Produktion,die ab Mitte des 18.Jahrhunderts einsetzte,kam sowohl die durch die Landwirtschaft hervorgebrachte biologische Vielfalt der Ökosysteme,Habitate und Lebensräume als auch die landwirtschaftsspezifische Artenvielfalt zunehmend unter Druck.Zuerst langsam,dann immer schneller,wurden die traditionellen Sorten und Rassen als Folge der Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an gesellschaftliche und ökonomische Ansprüche durch neue,ertragreichere und krankheitsresistentere Sorten und Rassen abgelöst. Diese Entwicklung führte zu einer einseitigen Selektion der vorhandenen Vielfalt auf hohe Erträge.Die einst durch die landwirtschaftliche Nutzung hervorgebrachte Vielfalt drohte dadurch wieder verloren zu gehen.
Beschleunigend auf den Verlust naturnaher Ökosysteme sowie der Artenvielfalt wirken sich grossflächige Meliorationen,der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmittel sowie die intensivere Bewirtschaftung,wie die häufigere Nutzung und stärkere Düngung der Wiesen oder weniger Brachflächen im Ackerbau,aus.Klein-Lebensräume im landwirtschaftlich genutzten Raum verschwanden zusehends.
■ Internationale Anstrengungen zum Schutz der Vielfalt
Die globale Vereinheitlichung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren verstärkt die Abnahme der Agrobiodiversität.Wenige Pflanzensorten und Nutztierrassen bilden heute die Grundlage unserer Ernährung.12 Pflanzensorten und fünf domestizierte Tierarten stellen den grössten Teil der gesamten Nahrungsmittelversorgung bereit.Der Verlust von Agrobiodiversität kann hierbei längerfristig konkrete Probleme verursachen.So ist genetische Vielfalt in der Landwirtschaft eine Absicherung gegen Missernten und Schädlings- oder Krankheitsanfälligkeit und damit die beste Garantie für die Produktion von genügend Nahrungsmitteln.
Diese Entwicklungen sind auf eine Expansion der menschlichen Tätigkeiten im letzten Jahrhundert zurückzuführen.Die Weltbevölkerung nahm dabei um einen Faktor drei zu,die wirtschaftlichen Aktivitäten um ein Mehrfaches davon.Die Ernährung der stark wachsenden Bevölkerung bedingte eine Intensivierung der Landwirtschaft,dies auf Kosten der biologischen Vielfalt.Die Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten erhöhte den Druck zusätzlich.Immer mehr Raum wird dafür benötigt.Damit sich die Vielfalt des Lebens erhalten und weiterentwickeln kann,ist es aber unabdingbar,dass genügend Flächen dafür zur Verfügung stehen.
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.Die Landwirtschaft kann ihre diesbezüglich wichtige Funktion nur dann wahrnehmen, wenn sie von der Gesellschaft in ihren Bemühungen unterstützt wird.Wichtig ist insbesondere eine finanzielle Abgeltung spezifischer Leistungen,die sie für diese Zwecke erbringt.
Mit der Globalisierung der Nutzung von natürlichen Ressourcen in Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft und dem daraus resultierenden Druck auf die natürlichen Ressourcen sind globale Regulierungsmechanismen notwendig geworden.1992 wurde an der UNO Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio die Biodiversitätskonvention verabschiedet.Harmonisiert mit dieser Konvention ist der für die Landwirtschaft wichtige internationale Vertrag der FAO über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (2004).Beide Abkommen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl eine ökologische Dimension (Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Vielfalt),als auch eine sozio-ökonomische Dimension (gerechte Aufteilung der Vorteile, welche sich aus der Nutzung der Vielfalt ergeben;Schutz des traditionellen Wissens) beinhalten.
Internationale Abkommen im Bereich der biologischen Vielfalt haben aber bereits eine viel längere Tradition.Bereits im 19.Jahrhundert führte der zunehmende Transport von Pflanzen und Nahrungsmitteln über nationale Grenzen hinweg zu ersten Vereinbarungen im Bereich Pflanzenschutz.Öffentliche Regelungen zur Bekämpfung von Schädlingen,wie beispielsweise des Kartoffelkäfers oder der Reblaus,wurden schon 1878 abgeschlossen.Neueren Datums sind die Ramsar Konvention über Feuchtgebiete (1971),insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel,das Bonner Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden,wildlebenden Tierarten (1979),oder die Berner Konvention zum Schutz der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (1979).
■ Programme der Agrarpolitik zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft
In der Schweiz stiess die alte Agrarpolitik,die den Bauern für ihre Produkte feste Preise und den Absatz garantierte,in den achtziger Jahren an ihre Grenzen.Die damit verbundene Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion führte zu ökologischen Defiziten und wurde nicht zuletzt auch durch den Verlust der Biodiversität offensichtlich.In der Konsequenz führte der Bund verschiedene Massnahmen ein,die zu einer Verbesserung der Situation beitragen sollten.
Nachfolgend werden die Massnahmen in den drei Kategorien der biologischen Vielfalt kurz vorgestellt:
Ökosystemvielfalt
–1993 wurden ökologische Direktzahlungen und Beiträge für verschiedene Programme u.a.auch für ökologische Ausgleichsflächen (ÖAF) eingeführt.Die verschiedenen Elemente des ökologischen Ausgleichs wie extensive Wiesen,Streueflächen, Buntbrachen,Hochstamm-Feldobstbäume und andere,konnten ab 1993 finanziell unterstützt werden.Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Anforderung des ÖLN, 7% der LN als ökologische Ausgleichsflächen zu bewirtschaften.Die Anforderung gilt seit 1999 für den Bezug aller Direktzahlungen.Diese Flächen wirken sich positiv auf die biologische Vielfalt aus.Die ÖAF als wichtige Übergangsflächen zwischen naturnahen Lebensräumen und der landwirtschaftlichen Produktionsfläche machen heute nahezu 10% der LN aus.Mit dem ÖLN schuf die Agrarpolitik zusätzliche Anreize,damit in der Landwirtschaft Lebensräume für wildlebende Tiere und Pflanzen erhalten,neu geschaffen und vernetzt werden.Weitere Elemente des ÖLN, wie die ausgeglichene Nährstoffbilanz,Bodenschutzanforderungen,die geregelte Fruchtfolge oder die gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln wirken zudem unterstützend.
–Im Jahr 2001 wurde zusätzlich die Ökoqualitätsverordnung (ÖQV) eingeführt.Die ÖQV fördert Flächen von hoher biologischer Qualität mit einem Sonderbeitrag. Zudem wird die gezielte Vernetzung der Ökoflächen untereinander und mit naturnahen Flächen unterstützt.
–Schon seit jeher stellt die landwirtschaftliche Nutzung als Koppelprodukt der Agrarproduktion neue Lebensräume zur Verfügung.Ackerflächen,Blumenwiesen oder Obstgärten bilden Habitate mit einer ihr eigenen und typischen Vielfalt an Pflanzen und Tieren.Durch das Aufrechterhalten einer produzierenden Landwirtschaft werden auch diese verschiedenen Ökosysteme erhalten und ein aktiver Beitrag zur Vielfalt geleistet.
Artenvielfalt
–Für verschiedene naturnahe Lebensräume (Biotope),die landwirtschaftlich genutzt werden,bestehen Inventare und Umsetzungsmassnahmen,so z.B.für Flachmoore oder Trockenwiesen und -weiden.Mit der Erhaltung dieser Lebensräume wird auch ein aktiver Beitrag zur langfristigen Absicherung der darin vorkommenden Arten geleistet.

Genetische Vielfalt
–Pflanzengenetische Ressourcen:Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt das BLW seit 1999 Massnahmen für die Inventarisierung,Absicherung und langfristige Erhaltung der in der Schweiz traditionell genutzten Kulturpflanzen (Obst,Reben,Beeren,Kartoffeln,Ackerpflanzen,Futterpflanzen,Gemüse sowie Heil- und Aromapflanzen).
–Tiergenetische Ressourcen:Sämtliche landwirtschaftliche Nutztierrassen in der Schweiz sind inventarisiert und beschrieben.Erfasst wurden Rinder,Pferde, Schweine,Schafe,Ziegen,Kaninchen,Rassenhühner und Tauben;jeder Rasse wurde ein Status nach FAO-Kriterien zugeordnet (kritisch,gefährdet,bedrängt,selten oder zu beobachten).
–Das traditionelle Wissen der Bauern über Sorten und Rassen,ihren Anbau und ihre Verwendung,wird im Rahmen der Nationalen Aktionspläne zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der genetischen Ressourcen erfasst und dokumentiert.Mit den Massnahmen der geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) kann die Wertschöpfung von Produkten aus Land-Rassen oder Land-Sorten erhöht werden.
Wechselwirkungen zwischen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden und der biologischen Vielfalt werden mit Indikatoren erfasst.Die Evaluation der Ökomassnahmen zeigt,wie weit die Landwirtschaft unter den gegebenen Rahmenbedingungen zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt beiträgt.
■ Ökologischer Ausgleich: Flächen- und Beitragsentwicklung
2004 wurden rund 116'000 ha als ökologische Ausgleichsflächen bewirtschaftet –dies entspricht 11% der LN.Parallel dazu sind auch die Ausgaben des Bundes für den ökologischen Ausgleich stetig angestiegen.
Entwicklung der Beiträge für den ökologischen Ausgleich
■ Ökologischer Ausgleich: Genutzter ÖAF-Typ je nach Region unterschiedlich
Beiträge für den ökologischen Ausgleich Beiträge nach der ÖQV
In Folge der Aufhebung der Beiträge für extensive Wiesen auf stillgelegtem Ackerland im Jahr 2000 und der Tatsache,dass die Ersatzflächen teilweise tiefere Beiträge erhielten,sind die Zahlungen 2001 etwas tiefer ausgefallen.
Seit 2001 sind die extensiv genutzten Wiesen derjenige ÖAF-Typ mit der grössten Flächenausdehnung (49’000 ha = 42% aller ÖAF).Die Gesamtfläche der beiden ÖAFTypen extensiv genutzte Wiesen und wenig intensiv genutzte Wiesen entspricht 72% aller ÖAF oder 8% der LN der Schweiz.
Die beiden ÖAF-Typen extensiv genutzte Wiesen und wenig intensiv genutzte Wiesen sind in allen biogeografischen Regionen der Schweiz dominierend.
Verteilung der Ökoausgleichsflächen nach biogeografischen Regionen 2004
Extensiv genutzte Wiesen Wenig intensiv genutzte Wiesen Andere ÖAF 1
Die anderen Typen der ÖAF sind für sich betrachtet in den meisten Gebieten wenig bedeutend.Zusammengenommen leisten sie in einzelnen Regionen dennoch einen wichtigen Beitrag.Streueflächen sind vor allem in den Gebieten der Voralpen und im östlichen Mittelland zu beobachten,Buntbrachen werden vor allem im Mittelland,im Rhein- und Genferseebecken sowie im Jura und am Randen angelegt.
Ökologischer Ausgleich 1 inklusive Hochstamm-Feldobstbäume 2004
Im Hügel- und Berggebiet ist der Anteil ÖAF an der LN generell höher als im Talgebiet. Die Futterbaugebiete weisen einen höheren Anteil auf als die Ackerbaugebiete.
Entwicklung und Zusammensetzung der ÖAF im Tal- und Berggebiet 1
199920002001200220032004199920002001200220032004 Talgebiet Berggebiet
Ökologische Ausgleichsflächen ohne Beitrag 2 Ökologische Ausgleichsflächen auf Ackerflächen 3 Wenig intensiv genutzte Wiesen Extensiv genutzte Wiesen, Streueflächen, Hecken, Feldund Ufergehölze
1 ohne Hochstammbäume
2 Extensiv genutze Weide, Waldweiden etc.
3 Extensive Wiesen auf stillgelegten Ackerflächen, Buntbrachen, Rotationsbrachen, Ackerschonstreifen
Ökologische Ausgleichsflächen im Talgebiet (Tal- und Hügelzone) werden durch die extensiv genutzten Wiesen dominiert.Im Berggebiet (Bergzonen I–IV) überwiegt der Anteil der wenig intensiv genutzten Wiesen.Der Anteil ÖAF gemessen an der LN ist im Berggebiet mit 14,2% wesentlich grösser als im Talgebiet mit 8,8%.
Beitragsberechtigte Ökoausgleichsfläche nach Tierbesatz 2004
Wenig tierintensive Betriebe entscheiden sich bei der Wahl der ökologischen Ausgleichsflächen primär für extensive und wenig intensive Wiesen.Je höher der Tierbesatz eines Betriebes,desto höher ist der Anteil an Hochstamm-Feldobstbäumen.Diese Situation ist primär darin begründet,dass tierintensive Betriebe vermehrt auf düngbare Flächen angewiesen sind,um die anfallenden Hofdünger auszubringen.
Die im Jahr 2001 eingeführten Massnahmen im Rahmen der ÖQV sind auf ein gutes Echo gestossen.2003 beteiligten sich bereits 25% aller Betriebe an einem der angebotenen Programme.
■ Ökologischer Ausgleich: Positive Effekte auf die biologische Vielfalt
Der ökologische Ausgleich wirkt sich positiv auf die Erhaltung und die Förderung der biologischen Vielfalt im Agrarraum aus.Im Vergleich zu intensiv bewirtschafteten Flächen gibt es auf den ökologischen Ausgleichsflächen eine höhere Artenvielfalt. Untersuchungen in Fallstudiengebieten bestätigen,dass je nach Region bis zu 80% der auf der LN vorgefundenen Vielfalt direkt mit den ÖAF gekoppelt sind.
Biologische Vielfalt auf der LN
Die ÖAF (Buntbrachen,Hecken,Hochstamm-Feldobstbäume,extensiv und wenig intensiv genutzte Wiesen) nehmen maximal 20% der LN der Untersuchungsgebiete ein,im Vergleich zu intensiv genutzten Wiesen und Weiden sowie zu Ackerkulturen tragen sie aber jeweils 50 bis 80% zur gesamten Diversität der untersuchten Pflanzenund Arthropodenarten bei.Die Förderung der Nützlinge ist ein zentraler Grundsatz der ÖAF,die erreichten Resultate dokumentieren eindrücklich die Zielerreichung.

Gemessen am Qualitätsmassstab der ÖQV weisen gemäss Evaluation der FAL 20% der ÖAF im Talgebiet eine gute botanische Qualität auf.Dieser Anteil ist bei den extensiv genutzten Wiesen höher (29%) als bei den wenig intensiv genutzten Wiesen (11%). 7% der extensiv genutzten Wiesen des Mittellandes enthalten bedrohte Arten,bei den wenig intensiv genutzten Wiesen sind es 3%.Im Berggebiet entsprechen rund 82% der Ökoflächen den Anforderungen des ÖQV-Standards.Generell hohe Qualität haben Buntbrachen und Streueflächen.Die Unterschiede erklären sich einerseits durch die natürlichen Gegebenheiten der biogeografischen Regionen,welche zu verschiedenen Artenpools geführt haben.Die Regionen unterscheiden sich andererseits aber auch in ihren Anbausystemen und landwirtschaftlichen Traditionen,welche ebenfalls Einfluss auf die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft haben.

Die Pflanzenbestände der Ökowiesen im Talgebiet,welche die Qualitätsanforderungen der ÖQV nicht erfüllen,sind noch geprägt durch die Nutzung vor der Bewirtschaftung als ÖAF.In Fallstudien konnte aber aufgezeigt werden,dass auch diese Flächen generell mehr Pflanzen- und Arthropodenarten beherbergen als intensiv bewirtschaftete Wiesen.Ein beachtlicher Teil der im Wiesland gefundenen Arten kam ausschliesslich auf den Ökowiesen vor (Spinnen:33%;Laufkäfer:15%;Tagfalter:7%).
Bei den auf den ÖAF untersuchten 16 bedrohten Brutvogelarten wurde für drei Arten eine statistisch signifikante Zunahme festgestellt.Fünf Vogelarten nahmen weiterhin ab,die restlichen Arten haben sich auf tiefem Niveau positiv entwickelt.Durch die vermehrte Anlage von Buntbrachen konnte der Malvendickkopffalter wieder häufiger beobachtet werden.In Fallstudien konnte zudem gezeigt werden,dass auch seltene Heuschreckenarten vom ökologischen Ausgleich profitieren.Dies insbesondere dann, wenn die Flächen gut mit Naturschutzgebieten vernetzt sind.
■ Pflanzen- und tiergenetische Ressourcen: Situation in der Schweiz
Die Ausgleichsflächen sind vor allem in den Gebieten artenreich,wo noch Reste naturnaher Lebensräume vorkommen.Bedrohte Tier- und Pflanzenarten können nur dann wieder auftreten,wenn sie als Restpopulation in der Umgebung noch vorhanden sind. Ist eine Art in einer Region ausgestorben,so ist ihre Wiederansiedlung auch in sehr langen Zeiträumen nicht garantiert.Die Wirkung der ÖAF liegt darin,dass sie nicht gefährdete Arten in der Agrarlandschaft fördern und potenziell gefährdete Arten davor bewahren,so selten zu werden,dass sie «Rote Liste Status» bekommen.
Die Welternährung basiert heute zu einem grossen Teil nur noch auf einigen wenigen Pflanzen- und Tierarten.Der weitaus grösste Teil der Agrobiodiversität bleibt hingegen «unternutzt».Nach Schätzungen der FAO zur Gen-Erosion beläuft sich der Verlust an biologischer Vielfalt seit Beginn des 20.Jahrhunderts auf über 90%.
In der Schweiz ist bezüglich Einträge in die Herdenbücher resp.in den Sortenkatalog eine Zunahme zu verzeichnen.Die zusätzlichen Herdenbucheinträge sind primär auf das Freihandelsabkommen Schweiz – EU zurückzuführen,nach dessen Abschluss neu EU-Rassen auch in die Schweizer Herdenbücher eingetragen werden können.
Die Zunahme der im Sortenkatalog eingetragenen Nutzpflanzen ist in erster Linie auf raschere Zuchtfortschritte und kürzere Produktlebenszyklen zurückzuführen.Zusätzlich zu den im Sortenkatalog eingetragenen Kartoffel- und Weizensorten waren im Jahre 2002 67 resp.14 Schweizer Lokalsorten gemäss Art.29 der Saat- und PflanzgutVerordnung des EVD aufgelistet.
Anteil und Entwicklung der wichtigsten Nutztierrassen und Nutzpflanzensorten an der gesamten Produktion
Obwohl eine relativ grosse Palette an Nutztierrassen und Nutzpflanzensorten zur Verfügung steht,wird nur ein Teil der genetischen Vielfalt für Zucht und Anbau verwendet. Bei den Schweinen machen zwei,beim Milchvieh drei Rassen nahezu 100% des schweizerischen Bestandes aus.
Anteil der wichtigsten Getreidesorten an der jeweiligen Gesamtproduktion
Im Pflanzenbau macht die am häufigsten genutzte Sorte bei den Weizenarten zwischen 25% und 50% der jeweiligen Gesamtproduktion aus.Seit 1985 nimmt der Anteil dieser Hauptrassen und -sorten aber ab.
Im Rahmen der zwei Spezialprogramme «Nationaler Aktionsplan für pflanzengenetische Ressourcen» und «Konzept zur Erhaltung der Rassenvielfalt bei den landwirtschaftlichen Nutztieren» wird die in der Schweiz vorhandene Vielfalt inventarisiert und abgesichert.
■ Pflanzengenetische Ressourcen:Nationaler Aktionsplan
Als Reaktion auf die zunehmende Gen-Erosion im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Kulturpflanzen erarbeitete die Kommission für pflanzengenetische Ressourcen der FAO einen Bericht über den Weltzustand der pflanzengenetischen Ressourcen in Ernährung und Landwirtschaft sowie einen globalen Aktionsplan.

Das BLW konkretisierte den globalen Aktionsplan für die Schweiz und schuf damit die Basis zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (NAP).Der 1997 verabschiedete NAP ergänzt die bestehenden agrarpolitischen Massnahmen und Anstrengungen im Bereich der Arten- und Ökosystemvielfalt.
In der Einführungsphase (1999 bis 2002) standen die Inventarisierung der verschiedenen Kulturpflanzen,die Abschätzung des Gefährdungsgrades und der Start erster konkreter Erhaltungs- und Nutzungsprogramme im Zentrum der Aktivitäten.In der laufenden zweiten Phase (2003 bis 2006) geht es darum,auf Basis der kulturspezifisch erstellten Analysen der Ist-Situation und dem definierten Soll-Zustand,die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen voranzutreiben.Die Erhaltung geschieht dabei ex situ,das heisst ausserhalb ihres ursprünglichen Herkunftsgebietes.Innerhalb der ex situ Erhaltung wird unterschieden zwischen in vitro Sammlungen,das heisst der Erhaltung im Labor/Reagenzglas (Kartoffeln und Beeren), Sammlungen in Genbanken/Samenbanken (Getreide und Gemüse) sowie Feldsammlungen (Obst und Reben).Die in situ Erhaltung,das heisst die Erhaltung im Herkunftsgebiet,geschieht nur bei den Futterpflanzen,für welche die Schweiz ein wichtiges Ursprungsland ist.
Ein weiteres Element ist die Nationale Datenbank (NDB).Mit der NDB sollen die umfangreichen Informationen zu den im Rahmen dieses Spezialprogramms abgesicherten Kulturpflanzen zentral verwaltet,öffentlich zugänglich gemacht und der nationale und internationale Datenaustausch ermöglicht werden.Die NDB ist im Internet zugänglich unter www.bdn.ch.
Im Rahmen von Sensibilisierungsarbeiten soll die breite Öffentlichkeit über die Bedeutung der Agrobiodiversität,die Erhaltung des alten Kulturgutes und des damit verbundenen Wissens über Anbau,Verwertung und Eigenschaften informiert werden. Agrobiodiversität muss gelebt werden – soll sie erhalten bleiben.
NAP Projekte in der Phase II
Futterpflanzen (4)
Kartoffen (4)
Reben (6)
Gemüse (7)
Beeren (6)
Aroma- und Heilpflanzen (2)
Nationale Datenbank (1)
Obst (26)
Kommunikation (8)
Ackerpflanzen (8)
Quelle: BLW
Die Ziele des NAP werden in Projekten umgesetzt.Interessierte Organisationen können dem BLW entsprechende Vorschläge einreichen.Dem BLW obliegt die Gesamtleitung und die Oberaufsicht.Rund 70 Projekte wurden im Jahr 2004 mit 2,8 Mio.Fr. unterstützt.
Die Agroscope RAC Changins ist für die wissenschaftlichen Aspekte des NAP verantwortlich und leitet insbesondere die Arbeiten betreffend die Genbanken und die in vitro Erhaltung.Sie sichert zudem die Koordination im Forschungsbereich.
Die Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen (SKEK) begleitet die Arbeiten als beratendes Organ.Sie koordiniert die vielfältigen Arbeiten der involvierten Akteure auf nationaler Ebene (Erhalterorganisationen,Saatgutproduzenten, Bauern,Züchter,Landwirtschaftliche Forschung,Universitäten etc.) sowie den internationalen Informationsaustausch und erstattet dem BLW Bericht über die Situation im Bereich der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft.
Mit dem NAP erfasste Obst-Genressourcen
Edelkastanie (50)
Walnuss (100)
Zwetschge (209)
Kirsche (590)
Andere (49)
Apfel (1104)
Birne (701)
Quelle: BLW
Die im NAP behandelten Kulturgruppen unterscheiden sich in ihrer Sortenvielfalt stark. Dominierend ist der Bereich Obst mit 2800 bekannten,erhaltenswerten Sorten und Zuchtlinien (Apfel (1104),Birne (701),Süsskirsche (590),Zwetschge (209),Walnuss (100),Edelkastanie (50),Haselnuss (15),Quitte (12),Sauerkirsche (11) und Aprikose (11)).
Im Rahmen des Obst-Inventarisierungsprojektes wurden über 190'000 einzelne Obstund Beerenstandorte in die Projektdatenbank aufgenommen.
Anteil Apfelbäume aller Meldungen pro Kanton
Quelle:
Apfelbäume machen mit einem Drittel den grössten Anteil der aufgenommenen Meldungen aus.Am meisten Apfelbäume wurden in den Kantonen Thurgau,St.Gallen und Bern inventarisiert.
Quelle: Fructus/Agroscope FAW Wädenswil
Jede fünfte Meldung betraf einen Birnbaum.Birnenbäume wurden in den Kantonen Nid- und Obwalden am häufigsten vorgefunden.

Rund ein Viertel der eingegangenen Meldungen aus den Kantonen Baselland und Baselstadt,Schwyz,Zug,Schaffhausen und Waadt betreffen Kirschen.Aus den Kantonen Bern und Luzern wurden insgesamt am meisten Bäume gemeldet.Dies sind auch jene zwei Kantone,in welchen gemäss der Feldobstzählung 2001,noch am meisten Hochstämme standen.
Nebst dem Obst sticht der Bereich Getreide mit gut 1850 erhaltenswerten Landsorten, Populationen und Zuchtlinien hervor (Gerste (800),Weizen (440),Dinkel (400),Triticale (200) und Roggen (10)).Der Bereich Gemüse beeindruckt weniger mit der Sorten- als vielmehr mit der Artenvielfalt;rund 100 Arten werden bzw.wurden in der Schweiz genutzt.
Den eigentlichen Reichtum der schweizerischen Agrobiodiversität bilden aber die Futterpflanzen.Nach Expertenschätzungen existieren über 13'000 Hofsorten,Populationen und Zuchtlinien.Die Ursache dieser immensen genetischen Vielfalt der Futterpflanzen liegt in den klimatisch,bodenkundlich und geographisch sehr unterschiedlichen Regionen der Schweiz begründet.Die Inventarisierung der Futterpflanzen ist sehr aufwändig,da,im Gegensatz zu den anderen im Rahmen des NAP behandelten Kulturgruppen,nicht einzelne Individuen,sondern an die unterschiedlichen Standorte angepasste Populationen betrachtet werden müssen.Das Programm NAP unterstützt aktuell Erhaltungsprojekte für Mattenklee,Esparsette,Wiesenschwingel und Raigras.Die Absicherung der Futterpflanzen erfolgt aber primär über ÖAF (extensiv genutzte Wiesen und Weiden,Waldweiden sowie wenig intensiv genutzte Wiesen).
■ Tiergenetische Ressourcen:Konzept zur Erhaltung der Rassenvielfalt bei den landwirtschaftlichen Nutztieren
Von 1996 bis 1998 hat eine vom BLW beauftragte Arbeitsgruppe die Bestände der in der Schweiz gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere erhoben,eine Bewertung der Rassen u.a.bezüglich des Gefährdungsgrades vorgenommen und ein Konzept für die Erhaltung der Rassenvielfalt erarbeitet.
Mit rund 90 registrierten Rinder-,Pferde-,Schweine-,Schaf- und Ziegenrassen verfügt die Schweiz über eine eindrückliche Vielfalt an landwirtschaftlichen Nutztieren.Davon gelten 24 Rassen als ursprünglich (Ursprung in der Schweiz) oder angestammt (seit mindestens 50 Jahren nachweislich in der Schweiz gezüchtet).Diese sind bestens an die topografischen und klimatischen Gegebenheiten angepasst und eng mit der Tradition unseres Landes verbunden.
Seit 1999 unterstützen Bund und Kantone die Umsetzung des Konzepts mit Beiträgen. Für sämtliche Schweizerrassen der Gattungen Rind,Pferd,Schwein,Schaf und Ziege, die gemäss internationalen Kriterien als gefährdet gelten,werden seither Erhaltungsprogramme durchgeführt.Es handelt sich dabei um das Evolèner Rind,das Engadinerschaf,das Bündner Oberländerschaf,das Spiegelschaf,das Walliser Landschaf,die Stiefelgeiss,die Appenzellerziege,die Bündner Strahlenziege und die Pfauenziege. Weiter sind Präventivmassnahmen für das Freiberger Pferd,das Original Braunvieh,die Schweizer Landrasse (Schwein),die Walliser Schwarzhalsziege und die Nera Verzascaziege erarbeitet und bewilligt worden.Finanzielle Unterstützung erhalten ausserdem Programme zur Förderung gefährdeter Schweizer Hühner- und Bienenrassen.
Die Projekte werden von den anerkannten Tierzuchtorganisationen durchgeführt und stehen unter der Oberaufsicht des Bundes.Die meisten Rassen werden über Aktivitäten zur in situ Erhaltung (lebend vor Ort) unterstützt,hingegen soll die Erhaltung des Evolèner Rindes,des Freiberger Pferdes und der Schweizer Ziegenrassen zusätzlich über eine Samenbank (ex situ Methode) sichergestellt werden.
Im Jahr 2002 hat eine breitgefächerte Arbeitsgruppe im Auftrag des BLW die heutige Situation der tiergenetischen Ressourcen ein weiteres Mal analysiert und bewertet sowie aufgezeigt,in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht.Der daraus resultierende Bericht ist ein Beitrag an den Weltzustandsbericht über tiergenetische Ressourcen,der von der FAO bis im Jahr 2007 erarbeitet wird.
Seit Beginn der Unterstützung von Projekten zur Erhaltung der Rassenvielfalt sind dem BLW gegen 40 Eingaben für insgesamt 17 Rassen eingereicht und von einer externen Fachkommission beurteilt worden.Davon erfüllten 30 Projekte die Anforderungen für einen Unterstützungsbeitrag.Im vergangenen Jahr waren 12 einheimische Nutztierrassen in Erhaltungsprogramme eingebunden.Wie eine Zwischenauswertung von bereits abgeschlossenen Projekten zeigt,kann bezüglich der Wirksamkeit der bisher durchgeführten Erhaltungsmassnahmen eine positive Bilanz gezogen werden.Bei sämtlichen Rassen konnte entweder der Tierbestand erhöht oder dessen Abbau gestoppt werden.
1.3.2Ethologie
Beteiligung bei Tierhaltungsprogrammen RAUS und BTS

Mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) wird die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere gefördert.Das RAUSProgramm enthält hauptsächlich Bestimmungen zum Auslauf auf der Weide bzw.im Laufhof oder im Aussenklimabereich beim Geflügel.Im BTS-Programm werden vor allem qualitative Anforderungen an den Liegebereich und den Bewegungsraum (u.a. keine Anbindung) gestellt.Die Teilnahme an einem solchen Programm ist freiwillig.
Seit der Einführung von RAUS (1993) und BTS (1996) stieg die Teilnahme an beiden Programmen stetig:So nahm die Beteiligung der Betriebe an RAUS seit 1993 bis 2004 von 4'500 auf 37'400 zu,jene bei BTS seit 1996 bis 2004 von 4'500 auf 19'600 Betriebe.
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS und BTS
Zwischen 1996 und 2004 stieg der Anteil der nach den RAUS-Bedingungen gehaltenen Nutztiere von 19 auf 68%.Beim BTS-Programm nahm der Anteil in der gleichen Zeitspanne von 9 auf 37% zu.Diese Werte sind Durchschnittszahlen der vier Nutztiergruppen (Rindvieh,übrige Raufutter Verzehrer,Schweine,Geflügel).
Beteiligung bei RAUS 2004
Die Beteiligung bei RAUS nach Nutztiergruppe und Betrieb zeigt,dass bei Betrieben mit Rindvieh der Betriebs- und der GVE-Anteil praktisch gleich hoch waren.Bei den anderen Nutztiergruppen nahmen dagegen mehrheitlich Betriebe mit überdurchschnittlich grossen Tierbeständen am RAUS-Programm teil.
Beteiligung bei BTS 2004
Anteil Tiere (in GVE)Anteil Betriebe

Die Tierbestände der Betriebe mit Geflügel,übrigen Raufutter Verzehrern sowie Schweinen,die am BTS-Programm teilnahmen,lagen noch weiter über dem Schweizer Durchschnitt als bei RAUS.Auffällig ist die Situation beim Geflügel:Hier hielten 18% der Betriebe im Jahr 2004 81% der Tiere nach den BTS-Vorschriften.Beim Rindvieh war hingegen der Anteil Betriebe höher als der Anteil Tiere.Dies bedeutet,dass viele Betriebe mit kleineren Rindviehbeständen am BTS-Programm teilnahmen.
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS, nach Nutztiergruppe
Der Anteil der nach dem RAUS-Programm gehaltenen Tiere nahm zwischen 1996 und 2004 bei allen Nutztiergruppen – ausser beim Geflügel – zu.Zum einen ist der Rückgang beim Geflügel auf die tiefere Anzahl Mastpoulets,die gemäss RAUS-Programm gehalten werden,zurückzuführen,zum andern ist der totale Geflügelbestand in den letzten Jahren stärker angestiegen als die Beteiligung beim RAUS-Programm.Die rückgängige Teilnahme bei den Mastpoulets dürfte sich damit erklären,dass jene Mastpoulets mit weniger als 56 Masttagen aus dem RAUS-Programm ausgeschlossen wurden.
Entwicklung der Beteiligung bei BTS, nach Nutztiergruppe
Beim BTS-Programm sticht die hohe Beteiligung beim Geflügel heraus.Der Hauptgrund dafür ist der Erfolg der bestehenden Labels am Markt.Das BTS-Programm für Schweine wurde erst 1997 eingeführt.Die Entwicklung war auch dort sehr erfreulich. Gegenüber dem Einführungsjahr nahm der Anteil der nach den BTS-Bedingungen gehaltenen Schweine von 8 auf 61% im Jahr 2004 zu.
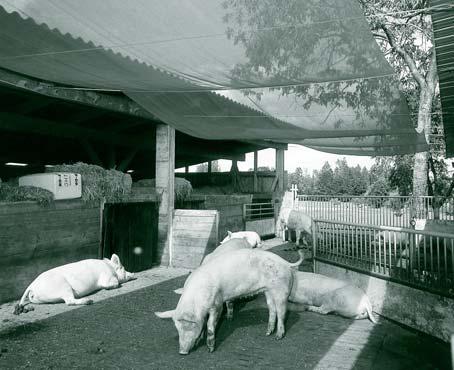
■ Ausgangslage
1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit
Die neue Bundesverfassung von 1999 verlangt den Einbezug von Nachhaltigkeitsüberlegungen in allen Politikbereichen (Art.2 und 73).Bereits seit 1996 ist das Prinzip der Nachhaltigkeit im Verfassungsartikel über die Landwirtschaft verankert (Art.104).
Die Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sieht vor, dass das BLW im Agrarbericht die Lage der Landwirtschaft und die Resultate der Agrarpolitik einer Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unterzieht. Die Berichterstattung mit Indikatoren basiert erstmals auf dem im Agrarbericht 2001 vorgestellten Konzept.Geplant ist eine Berichterstattung alle vier Jahre.
■ Beurteilungskonzept
Das im Agrarbericht 2001 vorgestellte Konzept ist auf andere relevante Arbeiten zur Nachhaltigkeitsbeurteilung abgestimmt.Seine Umsetzung erlaubt eine ex-ante Beurteilung gemäss der vom Bundesamt für Raumentwicklung erarbeiteten Methodik zur Nachhaltigkeitsbeurteilung von Grossprojekten (vgl.Kasten für die entsprechenden Literaturhinweise).
Literaturhinweise zur nachhaltigen Entwicklung und zur Nachhaltigkeitsbeurteilung:
–Mauch Consulting,INFRAS,Ernst Basler und Partner AG,Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz:Standortbestimmung und Perspektiven (im Auftrag des IDARio),2001
–BFS/BUWAL/ARE,MONET (Monitoring der Nachhaltigen Entwicklung) Schlussbericht,Methoden und Resultate,2003
–BFS,Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz,Indikatoren und Kommentare, 2003
–ARE,Nachhaltigkeitsbeurteilung:Rahmenkonzept und methodische Grundlagen,2004
–Europäische Kommission,Generaldirektion Landwirtschaft,Ein Konzept für Indikatoren der wirtschaftlichen und sozialen Dimension einer nachhaltigen Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums,2001
Die Nachhaltigkeit ist ein zukunfts- und ressourcenorientiertes Konzept.Das Ziel ist, dass auch zukünftige Generationen die Möglichkeit haben,ihre Bedürfnisse zu decken. Damit dies möglich ist,muss ihnen ein bestimmter Bestand an Ressourcen in einer bestimmten Qualität zur Verfügung stehen.Die Ressourcen umfassen natürliche Ressourcen,Humanressourcen (Wissen) und reproduzierte Ressourcen (in Anlagevermögen investiertes Geldkapital).
Da die quantitativen und qualitativen Bedürfnisse der zukünftigen Generationen nicht bekannt sind und nicht abgeschätzt werden kann,wie der technische Fortschritt die Ressourcenproduktivität und den Substitutionsgrad zwischen verschiedenen Ressourcen beeinflussen wird,kann nicht gesagt werden,wie viele Ressourcen welcher Art zukünftigen Generationen weitergegeben werden müssen.Die Endlichkeit insbesondere von fossilen Energieträgern ist aber absehbar.Im Sinne der Vorausschau ist deshalb aktiv eine Substitution von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen durch erneuerbare natürliche Ressourcen anzustreben.Erneuerbare natürliche Ressourcen müssen zudem so genutzt werden,dass sie sich regenerieren können und Humanressourcen (Wissen) sowie reproduzierte Ressourcen müssen aktiv und kontinuierlich erneuert werden.Die Knappheit insbesondere der natürlichen Ressourcen gebietet zudem einen effizienten Einsatz.
Dies sind notwendige,jedoch noch nicht hinreichende Kriterien für Nachhaltigkeit. Deren Beachtung kann zwar zu einem maximalen intergenerationellen Gesamtwohl führen,sie verhindert jedoch nicht,dass Ungleichgewichte bei der Verteilung des Gemeinwohls eintreten können.Ein zentrales Element des Konzepts der Nachhaltigkeit ist deshalb auch eine gerechte Verteilung von Wohlfahrt,nicht nur zwischen den gegenwärtigen und zukünftigen Generationen,sondern auch innerhalb der gegenwärtigen Generation.
Elemente des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung:
–Ressourcen: Nutzung der natürlichen Ressourcen unter Bewahrung von Mindestbeständen.Substitution von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen durch erneuerbare natürliche Ressourcen sowie sorgsamer Umgang mit den erneuerbaren natürlichen Ressourcen.Kontinuierliche Erneuerung der Humanressourcen (Wissen) und der reproduzierten Ressourcen (Kapital).
–Effizienz: Effizienz im Transformationsprozess zwischen Inputs und Outputs auf allen Stufen des Leistungserbringungsprozesses.
–Gerechtigkeit: Generationsinterne und generationsübergreifende gerechte Verteilung von Wohlfahrt (Ein enger Zusammenhang besteht zwischen der generationsübergreifenden Gerechtigkeit und der Weitergabe eines bestimmten Ressourcenbestandes,wobei die erstere ein Ziel und die letztere ein Mittel zum Erreichen dieses Ziels darstellt).
■ Darstellung der Ergebnisse
Nachhaltigkeitsindikatoren für die Landwirtschaft zeigen,ob sich die Landwirtschaft bei gegebenen Rahmenbedingungen (Ernährungsverhalten,staatliche Rahmenbedingungen) in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt.Die Indikatoren greifen die erwähnten Nachhaltigkeitsthemen auf (Ressourcen,Effizienz,Gerechtigkeit).Je nach Nachhaltigkeitsdimension (Ökonomie,Soziales,Ökologie) haben die Themen ein unterschiedliches Gewicht.In allen drei Dimensionen spielt die Ressourcenfrage eine zentrale Rolle (natürliches Kapital,Humankapital und reproduziertes Kapital).Bei der Ökologie und der Ökonomie ist zudem die Effizienz zentral,während beim Sozialen zusätzlich die Gerechtigkeit im Vordergrund steht.
Auf der Grundlage interner Arbeiten,Arbeiten in der Begleitgruppe Agrar-Umweltindikatoren und einem Expertengutachten (Bürgenmeier,Beat,Nachhaltigkeitsindikatoren der ökonomischen und sozialen Dimensionen in der Landwirtschaft, Gutachten zuhanden des BLW,2003) wurden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren definiert:
Übersicht Nachhaltigkeitsindikatoren
DimensionenÖkonomieSozialesÖkologie
Themen
Ressourcen
Kapitalerneuerung
Ausbildung
Biodiversität:
–Potenzielle Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf die Biodiversität
–oder:ökologische Ausgleichsflächen mit Mindestqualität
Wasser:
–Risiko aquatischer Ökotoxizität
Boden (Quantität)
Effizienz
Arbeitsproduktivität
Gerechtigkeit
Boden (Qualität): –Erosionsrisiko
–P-Gehalt im Boden
Potenzielle N-Emissionen
Energieeffizienz
Einkommensvergleich mit übriger Bevölkerung
Lebensqualitätsvergleich mit übriger Bevölkerung
Bei den Indikatoren im Bereich Ökologie ist die Entwicklungsphase noch nicht abgeschlossen.Deshalb werden für die erstmalige Beurteilung Ersatzindikatoren verwendet.Diese werden direkt bei den Indikatoren zur Ökologie vorgestellt.
Für die Darstellung der Entwicklung der Indikatoren und deren Beurteilung wird die vom BFS für MONET entwickelte Symbolik verwendet:
Trend (seit 1990)
Beurteilung
➚ Zunahme+ Positiv (in Richtung Nachhaltigkeit)
➘ Abnahme– Negativ (weg von der Nachhaltigkeit)
➙ Keine wesentliche Veränderung ≈ Neutral
~ Unregelmässig

❏ Keine Aussage
Für jeden Indikator wird zuerst mit Hilfe der Pfeilsymbole angegeben,in welche Richtung er sich grundsätzlich entwickeln muss,damit von einer nachhaltigen Entwicklung gesprochen werden kann.Anschliessend wird der Trend seit 1990 anhand derselben Pfeilsymbole dargestellt.Aus der Gegenüberstellung der beiden Symbole ergibt sich die Beurteilung der Entwicklung.
Indikatoren zur Ökonomie
Definition
Kapitalstock zu konstanten Preisen 1990 / Bruttoanlageinvestitionen zu konstanten Preisen 1990.
Aussage
Der Indikator zeigt,wie viele Jahre die Erneuerung des Kapitalstocks bei gleich bleibenden Bruttoanlageinvestitionen dauern würde.
Beurteilung
Der Kapitalstock erneuert sich heute gleich schnell wie zu Beginn der neunziger Jahre, d.h.im Durchschnitt alle 25–30 Jahre.Das bedeutet,dass die Landwirtschaft ausreichend Mittel zur Erneuerung von Gebäuden und Maschinen generieren kann wie vor 10–15 Jahren.Sowohl der Kapitalstock als auch die Bruttoanlageinvestitionen haben um rund 10 Prozent abgenommen,was angesichts der Strukturentwicklung der Landwirtschaft normal ist.
Definition
Fläche,die gemäss den Kriterien der Kulturlandkarte der Schweiz sehr gut bis mässig für den Ackerbau geeignet ist.Dieser Boden muss,gemäss Arealstatistik,zum günstigen Wies- und Ackerland,zum übrigen Wies- und Ackerland oder zu den Heimweiden zählen,unter 900 m ü.M.liegen und eine Hangneigung von weniger als 20% aufweisen.Dieser Indikator wurde für MONET entwickelt.
Aussage
Der Indikator zeigt,wie sich derjenige Teil der LN entwickelt,der eine substanzielle Grundlage dafür darstellt,dass die Landwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln leisten kann.
Beurteilung
Die Abnahme der ackerfähigen Fläche um 2,1% entspricht fast der Hälfte der Fläche des Neuenburgersees.Nahezu das gesamte eingebüsste Terrain wurde durch neue Siedlungsflächen und Infrastrukturanlagen in Anspruch genommen,ist also zu einem beträchtlichen Teil versiegelt worden und für die landwirtschaftliche Nutzung langfristig verloren gegangen.Der Schutz der ackerfähigen Böden ist die Aufgabe des Raumplanungsrechts (Sachplan Fruchtfolgeflächen).Der Agrarpolitik stehen keine Instrumente zur Verfügung,um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten.Auf der verbleibenden ackerfähigen Fläche ist der Einfluss der Agrarpolitik positiv.Sie hat sichergestellt,dass diese Fläche nachhaltig bewirtschaftet wurde.
■
Definition
Bruttowertschöpfung zu konstanten Herstellungspreisen 1990 / Total Jahresarbeitseinheiten.
Aussage
Die Arbeitsproduktivität zeigt,wie effizient die Schweizer Landwirtschaft die Arbeitskraft einsetzt.Die Verbesserung der Arbeitsproduktivität ist eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

Beurteilung
Die Entwicklung ist positiv.Aus der starken Abnahme der eingesetzten Arbeit (–26%) und der weniger starken Abnahme der Bruttowertschöpfung (–10%) resultiert zwischen 1990 und 2004 eine Zunahme der Arbeitsproduktivität um 21% oder im Durchschnitt 1,4% pro Jahr.
Indikatoren zum Sozialen
Definition
Anteile der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen mit praktischer Erfahrung,mit Grundausbildung und mit weiterführender Ausbildung.
Aussage
Dieser Indikator zeigt auf,wie sich der Ausbildungsstand der Betriebsleiter und -leiterinnen entwickelt.Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist es positiv,wenn die Anteile der Personen mit Ausbildung zunehmen.
Beurteilung
Rund zwei Drittel der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter verfügen 2003 über eine Grundausbildung resp.über eine weiterführende Ausbildung.Aus methodologischen Gründen lassen sich diese aktuellsten Zahlen nicht mit früheren Erhebungen direkt vergleichen.
Richtung NachhaltigkeitTrend 1990–2004Beurteilung
➚ Zunahmekeine Aussage möglich ❏ Keine Aussage da nur eine Messung
Definition
Arbeitsverdienst je FJAE / Vergleichslohn.
Aussage
Dieser Indikator zeigt auf,wie sich die Einkommensunterschiede zwischen der landwirtschaftlichen und der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung entwickeln.Aus Nachhaltigkeitssicht wäre es optimal,wenn sich das Verhältnis in Richtung 1 bewegt (und somit die eingesetzte Arbeiteinheit in der Landwirtschaft annähernd gleich entschädigt wird wie diejenige in der übrigen Wirtschaft) und dieses im Zeitablauf konstant bleibt.
Beurteilung
Der Abstand zwischen den Einkommen in der Landwirtschaft und denjenigen der übrigen Bevölkerung ist zwischen 1990 und 2004 grösser geworden.Das Verhältnis ging bereits vor der Agrarreform 1993 mit der Entkoppelung von Preisen und Einkommen deutlich zurück und erreichte 1995 einen Tiefpunkt.Ab 1997 ist der Abstand mehr oder weniger gleich geblieben.Teilweise kompensierten die Bauernfamilien ihren Kaufkraftverlust gegenüber der übrigen Bevölkerung mit Einkommen aus ausserlandwirtschaftlicher Tätigkeit.Sie schränkten aber auch den Verbrauch ein, real ging er um rund 9% zurück.
Definition
Lebensqualitätsindex der landwirtschaftlichen Bevölkerung / Lebensqualitätsindex der übrigen Bevölkerung.
Aussage

Dieser Index zeigt auf,wie sich anhand einer Selbsteinschätzung die Lebensqualität der bäuerlichen Bevölkerung im Vergleich mit jener der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung entwickelt.
Der Lebensqualitätsindex deckt folgende 12 Lebensbereiche ab:Erwerbsarbeit,Ausbildung,Weiterbildung,Einkommen,allgemeiner Lebensstandard,Familie,soziales Umfeld,stabile Rahmenbedingungen,Freizeit,Gesundheit,genügend Zeit,kulturelles Angebot.Beim Lebensqualitätsindex wird die Einschätzung der Zufriedenheit der 12 Lebensbereiche mit der Einschätzung deren Wichtigkeit kombiniert (Summe der Produkte).
Beurteilung
Der Lebensqualitätsindex 2005 liegt bei der bäuerlichen Bevölkerung tiefer als jener der übrigen Bevölkerung.Die Differenz ist signifikant.Dies ist in bedeutendem Mass darauf zurückzuführen,dass die landwirtschaftliche Bevölkerung mit den Bereichen Freizeit und genügend Zeit deutlich unzufriedener ist als die übrige Bevölkerung.In zwei Bereichen (Gesundheit,politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen) ist die befragte landwirtschaftliche Bevölkerung gleich zufrieden,in vier Lebensbereichen (Familie,Erwerbsarbeit,Ausbildung,Weiterbildung) etwas zufriedener und in weiteren vier Bereichen (soziales Umfeld,allgemeiner Lebensstandard,kulturelles Angebot,Einkommen) etwas unzufriedener als die Referenz-Gruppe. Richtung
1990–2004Beurteilung
➚ Zunahmekeine Aussage möglich ❏ Keine Aussage da nur eine Messung
Indikatoren zur Ökologie
Die für die Beurteilung des Umweltaspekts der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft berücksichtigten Indikatoren befinden sich grösstenteils in der Entwicklungsphase,die sich noch über mehrere Jahre erstrecken wird.Während dieser Übergangszeit wird daher mit folgenden Ersatzindikatoren gearbeitet:
Nachhaltigkeitsindikatoren2005 publizierte Indikatoren
Potenzielle Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf die Biodiversität oder ökologische Ausgleichsflächen mit Mindestqualität

Risiko aquatischer Ökotoxizität
Erosionsrisiko
Phosphorgehalt der Böden
Potenzielle N-Emissionen
Energieeffizienz
Ökologische Ausgleichsflächen
Pflanzenschutzmittelverkäufe
-
Phosphoreffizienz (auf Grund der P-Bilanz,OSPAR)
Stickstoffeffizienz (auf Grund der N-Bilanz,OSPAR)
Energieeffizienz
Definition
Anrechenbare ökologische Ausgleichsflächen (mit und ohne Beitragsberechtigung) ohne Hochstamm-Obstbäume nach Landwirtschaftszonen.
Aussage
Bei den ökologischen Ausgleichsflächen handelt es sich um naturnahe Lebensräume für zahlreiche Wildarten.Sie tragen zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei,was eine eigenständige Umweltleistung ist und die Stabilität der Ökosysteme langfristig sicherstellt.Zudem handelt es sich um eine wichtige Ressource für den Menschen,der in Zukunft insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft,Ernährung,Medizin und Industrie eine grosse Bedeutung zukommt.
Beurteilung
2004 waren in der Schweiz rund 11% der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) ökologische Ausgleichsflächen (Berggebiet 14%;Talgebiet 9%).Die bestehenden Lebensräume konnten erhalten und deren ökologischer Wert bisweilen sogar noch verbessert werden.Ausserdem wurden neue ökologische Ausgleichsflächen vor allem im Talgebiet angelegt.
Definition
Gesamtmenge der verkauften Pflanzenschutzmittel in Tonnen Wirkstoffe.
Aussage
Die Verkäufe an Pflanzenschutzmitteln sind eine Grössenordnung für die Gefahr von Emissionen in die Umwelt,insbesondere in Wasser,Böden und Luft,sowie für die Auswirkungen auf die Biodiversität.
Beurteilung
Seit 1990 ist der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln um rund 40% zurückgegangen. Die Optimierung des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes durch die integrierte Produktion und die Anwendung neuer Produkte mit höherer biologischer Wirksamkeit und entsprechend reduzierter Einsatzmenge sind Gründe für diesen Rückgang.Von der Wirkstoffmenge kann allerdings nicht direkt auf die aquatische Ökotoxizität geschlossen werden.
Definition
Die Phosphorbilanz und -effizienz berechnen sich nach derselben Methode wie jene für den Stickstoff.
Aussage
Der Phosphor ist eine nicht erneuerbare Ressource.Da die weltweiten P-Vorräte begrenzt sind,hat der haushälterische Einsatz von P aus einer Nachhaltigkeitsperspektive hohe Priorität.Überschüsse in der Bilanz sind möglichst zu vermeiden.
Beurteilung
Der P-Bilanzüberschuss hat in zehn Jahren um fast zwei Drittel auf heute 6’270 t P abgenommen.Dies ist vor allem auf den stark verminderten P-Mineraldüngerverbrauch zurückzuführen.Die Effizienz des P-Einsatzes in der Landwirtschaft hat in diesem Zeitraum von ca.25% auf heute 55% zugenommen.Der noch vorhandene Überschuss ist ein Hinweis darauf,dass im Vollzug Probleme mit der ausgeglichenen Nährstoffbilanz bestehen.Regional gibt es Belastungen mit P-Einträgen in die Seen. Bekannt für diesen Umstand sind die Mittellandseen wie Hallwiler- und Baldeggersee.
■ Stickstoffeffizienz
Definition
Die Stickstoffeffizienz ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Input und Output nach der N-Bilanz,wobei der Output in Prozenten des Inputs ausgedrückt wird.
Beim Stickstoffkreislauf handelt es sich um einen komplexen und dynamischen Kreislauf,für welchen verschiedene Modellberechnungen erstellt wurden.In der nach der OSPAR-Methode berechneten Stickstoffbilanz wird die Schweizer Landwirtschaft als ein einziger Betrieb betrachtet.Der jährliche Stickstoff-Input stammt aus Mineraldüngern,zugekauften Futtermitteln und Samen,aus Abfalldüngern und anderen Düngern sowie aus der Fixierung und Deposition von Stickstoff.Die Outputs entsprechen dem in pflanzlichen bzw.tierischen Nahrungsmitteln und anderen marktfähigen Erzeugnissen enthaltenen Stickstoff.
Aussage
Effizienzverbesserungen vermindern u.a.den Anteil Stickstoff,der in Form von Ammoniak in die Luft entweicht oder als Nitrat ins Grundwasser ausgewaschen wird.Es wird geschätzt,dass mit den Bedingungen der heutigen Landwirtschaft die N-Effizienz aufgrund der natürlich bedingten Prozessabläufe auf maximal etwa 30% gesteigert werden kann.Dank eines effizienten Stickstoffeinsatzes können die Emissionen in die Umwelt,insbesondere in Wasser und Luft,pro produzierte Einheit (Output) verringert werden.
Beurteilung
Der N-Bilanzüberschuss in der Landwirtschaft hat seit 1990 (132'000 t N) um rund 13% abgenommen und beträgt heute noch 115'000 t N.Dies ist insbesondere auf einen verminderten Einsatz von N-Mineraldünger sowie den Rückgang der NDeposition zurückzuführen.Diese Entwicklung ist in den letzten Jahren zum Stillstand gekommen.Die Effizienz des N-Einsatzes hat sich von 1990 bis 2002 von ca.22% auf ca.27% verbessert,wobei die Effizienz in den letzten Jahren nicht mehr angestiegen ist.

Richtung NachhaltigkeitTrend 1990–2004Beurteilung
➚ Zunahme ➚ Zunahme +Positiv
Definition
Die Energieeffizienz der schweizerischen Landwirtschaft lässt sich nach der vom Service romand de vulgarisation agricole entwickelten Ökobilanz-Methode bestimmen. Der Energieverbrauch berechnet sich auf Grund der Energie aus nicht erneuerbaren Quellen,die in Gebäuden und Maschinen,Elektrizität,anderen fossilen Energieträgern sowie Düngern,Pestiziden,Futtermitteln und Samen enthalten ist.Das Verhältnis zwischen diesem Energieverbrauch und der produzierten Nahrungsenergie ergibt die Energieeffizienz.
Aussage
Die Vorräte an fossiler Energie sind begrenzt.Ausserdem entsteht bei der Verbrennung das klimawirksame Treibhausgas CO2.Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist deshalb der effiziente Einsatz dieser Energie angebracht.Zudem ist anzustreben,dass die Energie aus fossilen Ressourcen rechtzeitig ersetzt wird durch Energie,die aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird.
Beurteilung
Nach einem Rückgang des Energieverbrauchs in der Mitte der 90er-Jahre zeigt sich wieder eine steigende Tendenz.Seit 1990 liegt die Energieeffizienz der Landwirtschaft bei rund 40% mit leichten Jahresschwankungen.
Positiv zu werten ist,dass die Energieeffizienz keine wesentliche Veränderung erfahren hat,obwohl in diesem Zeitraum der Arbeitseinsatz erheblich zurückgegangen ist.Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist aber negativ,dass der Einsatz der fossilen Energie nicht reduziert wurde.Dies ist allerdings nicht erstaunlich,da die heutigen Rahmenbedingungen kaum Anreize für eine Substitution von fossiler Energie schaffen.Die Agrarpolitik hat auf diese allgemeinen Rahmenbedingungen aber keinen Einfluss. Richtung
Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist die Bilanz insgesamt gemischt.Im Bereich der Ökonomie hat sich die Arbeitsproduktivität verbessert.Positiv ist,dass die Investitionen in Gebäude,Maschinen und Einrichtungen im Verhältnis zum gesamten Kapitalbestand seit 1990 konstant geblieben sind.Negativ ist hingegen die Abnahme des fruchtbaren Bodens,einem entscheidenden und gleichzeitig nicht vermehrbaren Produktionsfaktor der Landwirtschaft.Diese Abnahme ist allerdings nicht agrarpolitisch bedingt.Beim Sozialen vergrösserte sich der Einkommensabstand zur übrigen Bevölkerung,was aus einer Nachhaltigkeitsperspektive negativ zu werten ist.Hier ist anzumerken,dass der Abstand vor Beginn der Agrarreform grösser wurde und seit diesem Zeitpunkt ziemlich konstant blieb.Zu den anderen beiden Indikatoren kann bezüglich Entwicklung noch keine Aussage gemacht werden,da nur je eine Messung vorliegt.Der tiefere Lebensqualitätsindex der Landwirtschaft gegenüber der übrigen Bevölkerung bedeutet,dass dieser Indikator besonders im Auge zu behalten ist.Es darf hier zu keiner Verschlechterung kommen.Bei der Ökologie gingen die Entwicklungen mit Ausnahme des Indikators Energie in Richtung Nachhaltigkeit.Allerdings sind in allen Bereichen weitere Verbesserungen notwendig.Vom Ausmass und von der Dringlichkeit der Problematik her gilt dies vor allem für die Energieeffizienz.Die landwirtschaftliche Produktion wie im übrigen die Produktion von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen insgesamt beruhen zu einem hohen Anteil auf fossiler Energie.Diese wird schon in absehbarer Zeit nicht mehr im heutigen Umfang zur Verfügung stehen. Aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ist der Ersatz der fossilen Energie durch erneuerbare Energieressourcen deshalb eine zentrale Herausforderung.Diese Problematik kann allerdings nicht durch die Agrarpolitik gelöst werden,sondern muss im Rahmen der Energiepolitik angegangen werden.Dasselbe gilt auch für die negative Entwicklung beim Indikator Boden.In diesem Bereich ist die Raumplanung gefordert.
Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren seit 1990
DimensionenIndikatorenBeurteilung
ÖkonomieKapitalerneuerung+ Positiv Boden (Quantität)– Negativ (nicht Resultat der Agrarpolitik)
Arbeitsproduktivität+ Positiv
SozialesAusbildung ❏ Keine Aussage Einkommensvergleich mit übriger Bevölkerung– Negativ Lebensqualitätsvergleich mit übriger Bevölkerung ❏ Keine Aussage
ÖkologieÖkologische Ausgleichsflächen+ Positiv Pflanzenschutzmittelverkauf+ Positiv Phosphoreffizienz+ Positiv Stickstoffeffizienz+ Positiv Energieeffizienz–Negativ

Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln.Die finanziellen Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz nehmen laufend ab.Im Jahr 2004 wurden dafür 731 Mio.Fr.eingesetzt,fast 1 Mrd.Fr.weniger als vor der Agrarreform in den Jahren 1990/92.
– Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab.Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht,weil dafür kein Markt besteht.Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher,dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden.
– Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte,sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion.Im einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung,im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz.
■ Finanzielle Mittel 2004
2.1 Produktion und Absatz
Artikel 7 LwG beschreibt die Zielsetzungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse.Die Landwirtschaft soll nachhaltig und kostengünstig produzieren und aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen können.Dazu stehen die Massnahmen in den Bereichen Qualität,Absatzförderung und Kennzeichnung,Ein- und Ausfuhr,Milchwirtschaft,Viehwirtschaft,Pflanzenbau und Weinwirtschaft zur Verfügung.

Im Jahr 2004 sind zur Förderung von Produktion und Absatz 731 Mio.Fr.eingesetzt worden.Gegenüber dem Vorjahr gingen die Ausgaben um 67 Mio.Fr.oder 8,4% zurück.
Ausgaben für Produktion und Absatz
Rechnung 2004Budget 2005
AusgabenbereichBetragAnteilBetragAnteil Mio.Fr.%Mio.Fr.% Absatzförderung648,8578,3 Milchwirtschaft50469,247469,3 Viehwirtschaft223,1284,1
Pflanzenbau (inkl.Weinbau)14218,912518,3
Total731100684100
Quellen:Staatsrechnung,BLW
■ Unterstützung der Branchenorganisationen fördert gemeinsames
Vorgehen
2.1.1 Übergreifende Instrumente
Produzenten- und Branchenorganisationen
Branchen- und Produzentenorganisationen dienen als Diskussions-,Verhandlungsund Koordinationsforen für die Akteure des Ernährungssektors,in denen strategische Ausrichtungen für die Positionierung der Produkte definiert werden können.Sie geben den Produzenten die Möglichkeit,sich an den Entscheiden über den Marketing-Mix der Produkte und über gewisse Regeln zur Funktionsweise der Märkte zu beteiligen.Dank der Zusammenlegung der Ressourcen,die auf einzelbetrieblicher Ebene oft begrenzt sind,stehen ausserdem auf kollektiver Stufe effiziente Dienstleistungen zur Verfügung (Absatzförderung,Marktbeobachtung,Qualitätskontrolle,Information,Unternehmensberatung usw.).
Im Rahmen der Landwirtschaftsgesetzgebung (Art.8 und 9) kann der Bundesrat die von Branchen- und Produzentenorganisationen gemeinschaftlich beschlossenen Massnahmen zur Qualitätsverbesserung,Absatzförderung und Anpassung des Angebots an die Nachfrage auch für Nichtmitglieder verbindlich erklären.Man spricht in diesem Fall von «Ausdehnung» gemeinschaftlicher Massnahmen.Die Unterstützung des Bundesrates ist für Massnahmen gerechtfertigt,die einem ganzen Sektor oder einer ganzen Branche zugute kommen und deren Nutzen nicht den Mitgliedern der Organisation vorbehalten werden kann (Problem der «Trittbrettfahrer»).Ohne Eingreifen des Bundesrates würden Unternehmen,die sich nicht an den Massnahmen beteiligen,aber dennoch davon profitieren,schnell jegliche gemeinschaftliche Initiative unterbinden. Mit seinem Einschreiten fördert der Bundesrat die Bündelung der Kräfte.Die Branchenorganisationen können unter bestimmten Bedingungen auch Richtpreise veröffentlichen (Art.8a LwG).Die Massnahmen von Artikel 8 und 9 LwG,mit denen der Bund die Akteure subsidiär unterstützt,stärken die Position der Produzenten bei der Definition der Produkte und in den Geschäftsverhandlungen.
■ Strenge Bedingungen für die Ausdehnung durch den Bundesrat
Die Anforderungen,die für eine Ausdehnung durch den Bundesrat erfüllt sein müssen, sind strikt:(1) Die Massnahmen müssen durch Unternehmen gefährdet sein oder gefährdet sein können,die von diesen zwar profitieren,aber sie nicht anwenden oder sich nicht an deren Finanzierung beteiligen;(2) die Organisation darf selbst keine Handelstätigkeit ausüben;(3) sie muss repräsentativ sein und (4) die Massnahmen mit grosser Mehrheit ihrer Mitglieder verabschiedet haben.Die Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen enthält die Durchführungsbestimmungen. Die Auflagen an die Repräsentativität der Organisationen und ihr Entscheidverfahren sind besonders streng:Die Beschlüsse müssen von den Delegiertenversammlungen mit Zweidrittelmehrheiten gefällt werden,wobei die Wahl der Delegierten demokratisch durch die Basis zu erfolgen hat.Im Falle einer Branchenorganisation sind die Beschlüsse mit Zweitdrittelmehrheit der Delegierten auf jeder Stufe der Branche zu fassen.Mit diesen Anforderungen legt der Bundesrat Gewicht auf die Legitimität und die Transparenz der Organisationen.Im Weiteren müssen die Massnahmen,für die eine Ausdehnung beantragt wird,zwingend im Interesse aller Betriebe eines Sektors oder einer Branche sein und dürfen zu keinen Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Marktakteuren führen.
■
Rückblick nach einigen Jahren
Der Bundesrat fällte die ersten Ausdehnungsentscheide im Jahre 2001.Die seither gemachten Erfahrungen waren insgesamt positiv.Durch die effiziente Lösung des Problems der «Trittbrettfahrer» wurde der Zusammenhalt der Branchen gestärkt.Die Organisationen müssen allerdings mit Beschwerden von Unternehmen rechnen,die sich den gemeinschaftlichen Massnahmen nicht anschliessen wollen,was in diesen Unternehmen zu einer Verzögerung der Umsetzung führen kann.Die Branchenorganisation Emmentaler Switzerland war mit diesem Problem konfrontiert.Zwei Fälle sind beim Bundesgericht immer noch hängig.Bisher haben die zuständigen Gerichtsbehörden den vom Bundesrat praktizierten Vollzug dieses Instruments gestützt.
Dennoch bedarf das Instrument einer stetigen Verbesserung.Die Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen wird der Praxis und der juristischen Entwicklung regelmässig angepasst.Die Organisationen,denen der Bundesrat eine Ausdehnung der Massnahmen gewährt hat,müssen dem EVD jährlich einen Bericht über die Durchführung und die Wirkung der Massnahmen liefern.Das Finanzinspektorat des BLW nimmt ebenfalls Kontrollen vor,damit gewährleistet ist,dass die von Nichtmitgliedern erhobenen Beiträge auch tatsächlich für die vorgesehenen gemeinschaftlichen Massnahmen verwendet werden.Im Jahre 2005 haben drei Produzentenorganisationen (Schweizerischer Bauernverband,Schweizer Milchproduzenten,GalloSuisse) sowie drei Branchenorganisationen (Interprofession du Gruyère, Interprofession du Vacherin fribourgeois,Emmentaler Switzerland) von einer Ausdehnung der von ihnen vereinbarten Massnahmen profitiert.Die Ausdehnung kann verlängert werden,wobei aber zuvor eine erneute Beurteilung erfolgen muss.
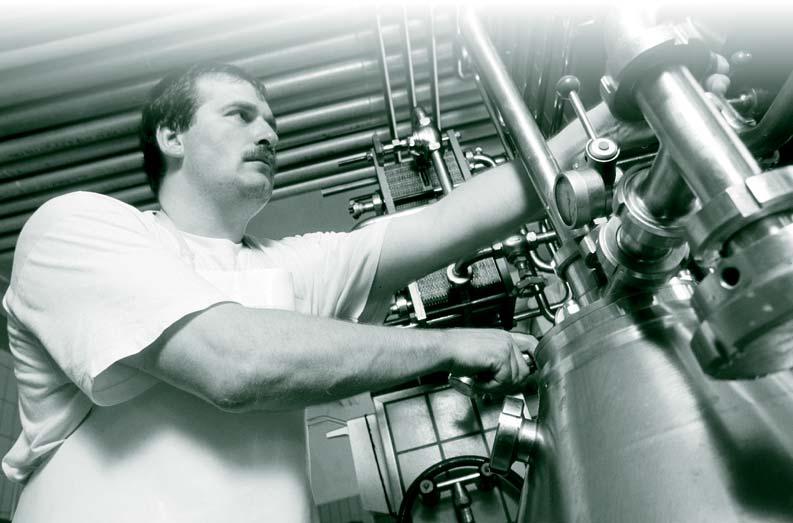
■ Kommunikationsarbeit wird immer wichtiger
Absatzförderung
Die Absatzförderung für landwirtschaftliche Erzeugnisse setzt bei der Marketingkommunikation an.Innerhalb des Marketing-Mix unterstützt der Bund nur Kommunikationsmassnahmen.Dadurch sollen Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Der Bund zahlt an die Kosten von Kommunikationsmassnahmen der Branchen maximal 50%.Die Unterstützung im Rahmen der Absatzförderung hat subsidiären Charakter. Im Vordergrund steht die Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Akteure.
Mit der zunehmenden Wettbewerbsintensität in der Landwirtschaft wird es immer wichtiger,durch effektive (do the right thing) und effiziente (do the things right) Kommunikationsarbeit Wettbewerbsvorteile im Markt zu realisieren.In diesem Umfeld gilt es auch,die knapper werdenden Mittel des Bundes ökonomisch einzusetzen. Kostenaspekte werden deshalb künftig auch bei der Beurteilung der Wirkungen der Massnahmen eine grössere Rolle spielen.
■ Wirkung der Absatzförderung
Die vom Bund unterstützten Absatzförderungsmassnahmen zeigen Wirkung:Trotz steigender Unterschiede der Konsumentenpreise zum benachbarten Ausland und wachsender Importkonkurrenz konnte die Präferenz für schweizerische Produkte gehalten und teilweise ausgebaut werden.In den letzten Jahren hat sich ein deutlich wahrnehmbarer Auftritt der Schweizer Landwirtschaft am Markt entwickelt.Im Export konnte das Image der Schweizer Produkte ebenfalls auf hohem Niveau gehalten werden.
Die Wirkungen der Absatzförderung sind zum Teil indirekter Natur.Werbewirkungen, die sich im konkreten Kaufverhalten äussern,wären wünschenswert.Eine eindeutige Zuordnung von Ausgaben und Wirkungen ist jedoch kaum möglich,da nicht nur Zeitverzögerungen zu beachten sind,sondern auch die Einbindung der Kommunikation in den gesamten Marketing-Mix.Exogene Faktoren wie Preis- oder Wettbewerbsentwicklung und das Verhalten von Mitbewerbern haben ebenfalls Einfluss auf die Wertschöpfung und Absatzmenge.Die positive Wirkung der Kommunikation auf den Absatz ist wissenschaftlich jedoch unbestritten.
■ Wirkungskontrolle wird ausgebaut
Für die Absatzförderungsprojekte 2005 wurde die Wirkungskontrolle erweitert.Bisher baute diese vor allem auf den Umfragen zu den Präferenzen der Konsumentinnen und Konsumenten sowie freiwilligen Angaben der Projektinhaber auf.Ab 2005 sind alle Projektinhaber verpflichtet,Daten zu bestimmten Indikatoren an das BLW zu liefern. Zudem fordert das BLW,dass die Wirkung im Verhältnis zu den Kosten berücksichtigt wird.Die Wirkungseffizienz wird so mit der Dimension der Ressourceneffizienz ergänzt.
Die Wirkungskontrolle soll Rückmeldungen zu laufenden Projekten und entscheidungsrelevante Informationen für zukünftige Projekte liefern.Die Ergebnisse und Erkenntnisse dienen aber vor allem auch als Grundlage für die Evaluation und Weiterentwicklung der Absatzförderung.
Kennzeichnung
Die Schweiz verfügt seit 1997 über eine gesetzliche Grundlage für die Geschützte Ursprungsbezeichnung/Geschützte Geografische Angabe (GUB/GGA).Mehrere Branchen wählten dieses Instrument,um die Kennzeichnung ihres Produkts zu schützen,und entschieden sich für eine Differenzierungsstrategie aufgrund der mit der Herkunft verbundenen Qualität.Bisher wurden 19 Kennzeichnungen (13 GUB und 6 GGA) im Eidgenössischen Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingetragen. Im Jahre 2004 wurden 3 GUB (Walliser Roggenbrot,Munder Safran und Berner Alpkäse) sowie 2 GGA (Saucisse aux choux vaudoise und Saucisson vaudois) registriert.Bei weiteren Produkten,wie Raclette du valais und Emmentaler,ist das Registrierungsverfahren im Gang. Diese beiden Dossiers werden derzeit durch die Rekurskommission des EVD behandelt.
GUB/GGA-Register am 31.Dezember 2004
AnzahlAnzahltt
Käse
L’EtivazGUB671290354OIC
GruyèreGUB3 00025925 12028 000OIC
SbrinzGUB52034-1 750Procert
Tête de MoineGUB2699-1 669OIC
Formaggio d’alpe ticineseGUB25--135OIC
Vacherin Mont-d'OrGUB20013592590OIC
Berner AlpkäseGUB549--1 012OIC
Fleischwaren
BündnerfleischGGA-31658950Procert
Saucisse d’AjoieGGA-11-56OIC
Walliser TrockenfleischGGA-28-337OIC
Saucisse neuchâteloise / Saucisson neuchâtelois GGA-18-123OIC
Saucisson vaudoisGGA-51-620OIC Saucisse aux choux vaudoiseGGA-50-480OIC
Spirituosen
Eau-de-vie de poire
du ValaisGUB3974 OIC
Abricotine
Andere Erzeugnisse
GUB1003OIC
Rheintaler RibelGUB632829Procert
Cardon épineux genevoisGUB923870Procert
Walliser RoggenbrotGUB3957-35OIC
Munder SafranGUB116--0,003OIC
Gesamttotal5 297574
Quelle:BLW
■ Internationale Entwicklungen
Im Rahmen der Umsetzung der bilateralen Verträge eröffnete die Schweiz mit der EU Gespräche über die gegenseitige Anerkennung der Register.Dabei erkannte die GUB/GGA-Expertengruppe des Gemischten Ausschusses die Gleichwertigkeit der schweizerischen und der europäischen Gesetzgebung über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und der geografischen Angaben.Zudem wurden Listen sensibler Produkte ausgetauscht,über die zu verhandeln sein wird.Die beiden Parteien arbeiten nun ihre Verhandlungsmandate aus.
Die Schweiz ist auch in der Welthandelsorganisation (WTO) sehr aktiv und bemüht,den Schutz der geografischen Angaben auf internationaler Ebene zu verbessern.Sie fordert dabei,dass der heute bei Wein und Spirituosen gewährte Schutz (Art.23 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, TRIPS-Abkommen) auf alle Produkte ausgedehnt wird.Mehrere Mitglieder,darunter die EU,dürften diese Position in den laufenden Verhandlungen ebenfalls vertreten.
Instrumente des Aussenhandels
■ Differenzierte Massnahmen zur Einfuhrregelung
Zur Unterstützung einer produktiven Landwirtschaft werden Einfuhren von Agrarerzeugnissen mit geeigneten zolltarifarischen Massnahmen gesteuert.Einfuhrzölle werden auf zwei Arten als Steuerungsinstrument eingesetzt:Beim Schwellenpreissystem,das einzig im Bereich von Futtergetreide und Futtermitteln Anwendung findet, wird der Importpreis mit variablen Zollansätzen in einer bestimmten Bandbreite stabilisiert.Bei anderen Agrarprodukten sind Zollkontingente festgelegt.Die Einfuhrmengen,die zum tiefen Kontingentszollansatz (KZA) eingeführt werden dürfen,sind beschränkt.Einfuhren ausserhalb des Zollkontingents sind möglich,werden aber mit wesentlich höheren Zöllen belastet.
Die administrativen Verfahren der Einfuhrregelungen werden laufend den veränderten Rahmenbedingungen angepasst.Änderungen ergeben sich aus aussenhandelspolitischen Entwicklungen,internen Reformen der Agrarpolitik,Veränderungen bei der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen,oder durch das Ziel,möglichst einfache und effiziente Verfahren bei der Zuteilung von Zollkontingentsanteilen anzuwenden.
Mit Ausnahme des administrativ einfachsten Verfahrens,dem Windhund an der Grenze (Reihenfolge der Verzollung),ist das BLW für die zeitliche und mengenmässige Verteilung der Zollkontingente zuständig.Bei der Versteigerung von Zollkontingenten ist mit der «eVersteigerung» eine technische Lösung realisiert,bei der Abonnenten die Ausschreibungen per E-Mail erhalten.Die Bietenden können ihre Gebote in einem geschützten Bereich des Internets eingeben.Diese neue Möglichkeit wurde von Anfang an rege benutzt.Von Oktober bis Dezember 2004 sind bereits 27 Versteigerungen elektronisch ausgeschrieben worden und für die «eVersteigerung» registrierte Bietende haben 640 Gebote per Internet eingereicht.Die Ausschreibungen der Versteigerungen werden zwar auch in Zukunft im SHAB und auf der Internetseite des BLW unter der Rubrik «Import» veröffentlicht,die Information auf dem Postweg entfällt jedoch in der Regel.
■ Osterweiterung der EU –Weiterführung von Zollpräferenzen
Die besondere Situation beim Brotgetreide (hohe,nur ausnahmsweise voll ausgenützte Kontingentsmenge und hoher KZA) machte es möglich,für diesen Bereich eine Änderung einzuführen.Das Kontingent von 70'000 t wird seit anfangs 2005 nicht mehr versteigert,sondern in vier Tranchen nach dem Windhundverfahren an der Grenze vergeben.
Vereinfachungen durch technische Lösungen werden im Rahmen der neuen elektronischen Einfuhrabfertigung «e-dec Import» realisiert,die das bisherige Zollmodell 90 ablösen wird.Sie werden ermöglichen,dass die Verwaltung der individuellen Zollkontingentsanteile ab 1.Januar 2006 bereits an der Grenze vollzogen werden kann, statt wie bisher nachträglich durch das BLW.Als eine von vielen Vorbereitungen auf diesen Schritt sei die Abschaffung des Zuteilungskriteriums «Inlandleistung Zug um Zug» erwähnt,die bereits per Anfang 2005 vollzogen wurde.Eine Teilmenge des Zollkontingents für Schnittblumen wird deshalb neu versteigert.Bei einigen Gemüsesorten wird für die Zuteilung im Folgejahr neben der Importtätigkeit neu die im Vorjahr erbrachte Inlandleistung berücksichtigt.
Einen detaillierten Überblick über alle Zuteilungsverfahren von Zollkontingenten,die zugeteilten Mengen und deren Ausnützung durch die Importfirmen bietet der Separatdruck zum Bericht des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen «Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente»,der auf der Internetseite des BLW unter der Rubrik «Import» eingesehen werden kann.
Im Berichtsjahr wurden die ehemaligen Zollpräferenzen der Länder,die seit 1.Mai 2004 der EU angehören,in präferenzielle Zollkontingente umgewandelt,die allen EUMitgliedstaaten zugänglich sind.Die Verteilung dieser Kontingente erfolgt,bezogen auf die Zollpräferenz,nach dem Windhundverfahren an der Grenze.Soweit für die Verteilung von Zollkontingenten Kriterien nach Artikel 22 Absatz 2 des LwG Anwendung finden,obliegt die Zuteilung und Verwaltung der Kontingentsanteile dem BLW.Für das Jahr 2004 wurden die präferenziellen Zollkontingentsmengen pro rata rückwirkend ab 1.Mai 2004 vergeben,so dass das BLW bei Gesuchen zu klären hatte, ob der Importeur für die zollbegünstigte Einfuhr berechtigt war.Die Rückerstattung von Zollabgaben erfolgte danach durch die Zollverwaltung.Die Ausnützung der aktuellen und der bereits vergebenen Kontingente ist auf der Internetseite der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) www.zoll.admin.ch unter «Zollkontingente» zu finden.

■ Revision des Zollgesetzes – Änderungen mit Auswirkung auf die Landwirtschaft und den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen
Am 18.März 2005 haben die Eidgenössischen Räte das neue Zollgesetz verabschiedet. Dieses wird voraussichtlich auf den 1.Juli 2006 in Kraft treten.Für die Landwirtschaft von besonderer Bedeutung sind folgende Bestimmungen:
Artikel 12 Aktiver Veredelungsverkehr: Das Zollverfahren beim aktiven Veredelungsverkehr (AVV) dient dazu,ausländische Rohstoffe zum Bearbeiten oder Verarbeiten,unter Gewährung von Zollermässigung oder Zollbefreiung,in die Schweiz einführen zu können.Diese Art des grenzüberschreitenden Warenverkehrs ist bereits im geltenden Zollgesetz geregelt.Für Landwirtschaftsprodukte und landwirtschaftliche Grundstoffe,wird der AVV nur dann gewährt,wenn gleichartige inländische Erzeugnisse nicht in genügender Weise verfügbar sind oder für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachteil nicht ausgeglichen werden kann.Diese Sonderabfertigung setzt immer eine Bewilligung der EZV voraus.Neu wird die Bewilligung erteilt,wenn keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.Die Entscheidkompetenz liegt bei der EZV.
Heute werden Bewilligungen für landwirtschaftliche Produkte in der Regel auf der Basis des Identitätsprinzips und nur in Ausnahmefällen auf der Basis des Äquivalenzprinzips erteilt.Das heisst,es muss diejenige Ware wieder ausgeführt werden,die zur Be- oder Verarbeitung eingeführt worden ist.Neu gilt,dass das Identitätsprinzip die Ausnahme und das Äquivalenzprinzip die Regel bilden wird.Das heisst,die eingeführten Waren können gegen inländische Erzeugnisse ausgetauscht werden.
Vom Prinzip der Äquivalenz wird dann abgewichen,wenn der Veredelungsbetrieb die Menge,Beschaffenheit und Qualität der wieder ausgeführten Ware nicht glaubhaft garantieren kann,oder wenn der Veredelungsverkehr bei Waren mit saisonal unterschiedlichen Zollansätzen zu Marktstörungen führen könnte.Damit sollen die öffentlichen Interessen bezüglich Lebensmittelsicherheit und Produktionsmethoden gewahrt und Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.
Artikel 13 Passiver Veredelungsverkehr: Das Zollverfahren des passiven Veredelungsverkehrs (PVV) wird im neuen Zollgesetz separat geregelt,weil dieses nicht mehr mit der Regelung des AVV identisch ist.Das Verfahren dient dazu,inländische Rohstoffe zum Bearbeiten oder Verarbeiten ins Zollausland verbringen zu können,und zwar unter Gewährung der Zollermässigung oder Zollbefreiung bei der Wiedereinfuhr. Wirtschaftlich gesehen ist der PVV das Spiegelbild des AVV.
Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Grundstoffen,die zur Verarbeitung vorübergehend ausgeführt werden,bewilligt die Zollverwaltung den PVV nur dann,wenn dadurch nicht wesentliche Interessen der Wirtschaft im Inland beeinträchtigt werden.
Artikel 15 Landwirtschaftliche Erzeugnisse: Diese Bestimmung regelt das Verfahren betreffend die Behandlung von Warenvorräten bei Früchten und Gemüse, beim Übergang von der freien Phase in eine bewirtschaftete Periode.Zielsetzung ist es, zu verhindern,dass während der freien Phase übermässig Waren zum KZA eingeführt werden,die nach Beginn der Bewirtschaftungsperiode auf den Markt gebracht werden.Die Gesetzesbestimmung schafft Rechtssicherheit,indem sie für betroffene Warenvorräte eine neue Zollanmeldung verlangt,die verbunden werden kann mit der Verpflichtung,die Zollabgabendifferenz zu den Ausserkontingentszollansätzen nachzuentrichten.
Artikel 43 Grenzzonenverkehr: Der Grenzzonenverkehr soll vor allem die Güterbewirtschaftung in der Grenzzone erleichtern.Als Grenzzone gilt heute gegenüber Deutschland,Frankreich und Italien die Radialzone,das heisst sie umfasst das in- und ausländische Gebiet innerhalb eines Umkreises von 10 km ab der nächstgelegenen benutzbaren Zollstelle.Mit Österreich wurde vereinbart,die Grenzzone als Parallelzone zu definieren,was einem Gebietsstreifen von 10 km Tiefe längs der Zollgrenze mit unserem östlichen Nachbarland entspricht.
Nach dem Willen des Gesetzgebers besteht die Grenzzone,ausser bei anderslautenden völkerrechtlichen Vereinbarungen,inskünftig gegenüber allen Nachbarstaaten aus der Parallelzone.Das heisst,der Gebietsstreifen von 10 km Tiefe entlang der gesamten Landesgrenze fällt unter die Regelung des Grenzzonenverkehrs.
Die Statistiken zeigen für das Berichtsjahr 2004 eine erneute Zunahme an ausgeführten landwirtschaftlichen Grundstoffen von rund 30%.Diese Zunahme ist praktisch ausschliesslich auf vermehrte Ausfuhren von Zucker zurückzuführen,der mit wenig Ausnahmen im Veredelungsverkehr ein- und ausgeführt wird.Über 50% dieses Zuckers werden in Frucht- und Gemüsesäften,10% in Schokolade,4% in Mineralwasser,rund 4% in Zucker- und Backwaren sowie Konfitüren exportiert.Die Fruchtund Gemüsesäfte liegen nicht im Deckungsbereich des Schoggigesetzes.

Von den 360'000 t in Verarbeitungsprodukten ausgeführten landwirtschaftlichen Rohstoffen erhielten 2004 nur rund 82'000 t einen Preisausgleich auf der Basis des Schoggigesetzes.Gegenüber 2003 betrug die Zunahme 10'000 t.Rund die Hälfte dieser Zunahme (ca.5'000 t) betrifft ausgeführte Frischmilch,die mit rund 15'600 t einen Rekord erzielte.Zweiter im Rennen ist Weichweizenmehl,welches mit einer Zunahme von rund 2'500 t insgesamt 27'700 t erreichte.
Das Parlament hat,wie schon im Vorjahr,mit einem Nachtragskredit das anfänglich auf 100 Mio.Fr.gekürzte Budget wieder auf den WTO-Plafonds von 114,9 Mio.Fr.aufgestockt.Dieser Betrag wurde voll ausgeschöpft.Bei der EZV wurden aber Anträge eingereicht,welche diesen Betrag um rund 15 Mio.Fr.überschreiten.Für das Jahr 2005 hat das Parlament nur noch 80 Mio.Fr.budgetiert,wovon der Übertrag aus 2004 von rund 15 Mio.Fr.in Abzug zu bringen ist.
Am 1.Februar 2005 haben die Schweiz und die EU das revidierte Protokoll Nr.2 zum Freihandelsabkommen Schweiz – EG von 1972 in Kraft gesetzt.Die Exportwirtschaft rechnet,auch dank dem revidierten Protokoll Nr.2 mit einer guten Entwicklung im 2005.Der Bedarf an Ausfuhrbeiträgen für 2005 wurde deshalb von der Branche auf rund 113 Mio.Fr.geschätzt.In dieser Schätzung sind die Auswirkungen des revidierten Protokolls Nr.2 bereits inbegriffen.Damit ergibt sich auch für 2005 eine Lücke zwischen budgetierten und voraussichtlich benötigten Mitteln für den Preisausgleich. Als Massnahmen zur Deckung dieser Erstattungslücke bieten sich an:Nachtragskredit zur Aufstockung des Budgets für Ausfuhrbeiträge (vom Parlament zu beschliessen), andere geeignete Massnahmen (Beiträge der Produzentenorganisationen und der 1.Verarbeitungsstufe) und der Veredelungsverkehr für betroffene landwirtschaftliche Grundstoffe.
Massnahmen 2004/05
2.1.2Milchwirtschaft
Die Absatzlage bei den Milchprodukten hat sich im Jahre 2004 weiter erholt.Die erhöhten Milcheinlieferungen konnten durch Produktionszunahmen bei den Käse- und Frischmilchprodukte-Herstellern aufgefangen werden.Der steigende Export von Milchprodukten hat ebenfalls zur Entspannung beigetragen.

Gegenüber 2003 sank der durchschnittliche Produzentenpreis für Milch um knapp
1 Rp.je kg auf rund 74.6 Rp.je kg.Der Preis für Biomilch fiel um 3.76 Rp.je kg und damit deutlich stärker.Die Stützungsmassnahmen sind mit den Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage schwerpunktmässig weiterhin auf den Käse ausgerichtet.
■ Finanzielle Mittel 2004 Mittelverteilung 2004
Im Jahr 2004 sind die Ausgaben des Bundes zugunsten der Milchwirtschaft weiter abgebaut worden.Im Vergleich zum Vorjahr standen 55,7 Mio.Fr.oder 10,1% weniger zur Verfügung.
Im Jahr 2004 wurden im Milchbereich insgesamt 503,5 Mio.Fr.ausgegeben.Davon beanspruchte der Käse 350 Mio.Fr.(69,5%).71,7 Mio.Fr.(14,2%) wurden für Butter und 75,5 Mio.Fr.(14,9%) für Pulver und andere Milchprodukte eingesetzt.Die Administration kostete 6,4 Mio.Fr.(1,4%).

■ Änderungen der Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion (MKV)
Milchkontingentierung
Im Milchjahr 2003/04 vermarkteten noch 33'072 Produzentinnen und Produzenten Milch.Damit verringerte sich die Anzahl Produzentinnen und Produzenten um 1'599 oder 4,6% gegenüber dem Milchjahr 2002/03.Dies entspricht der durchschnittlichen jährlichen Abnahme seit dem 1.Mai 1999.Im Talgebiet haben 993 und im Berggebiet 606 Produzenten aufgehört,Milch zu vermarkten.Das durchschnittliche Kontingent erreicht gesamtschweizerisch 91'612 kg.Es nahm um 4'449 kg oder 5,1% gegenüber dem Vorjahr und um 15'923 kg oder 21% gegenüber dem Milchjahr 1999/2000 zu. Während im Talgebiet das durchschnittliche Kontingent von 103'467 kg auf 109'306 kg (+5,6%) wuchs,erhöhte es sich im Berggebiet von 65'684 kg auf 68'542 kg (+4,4%). Seit dem Milchjahr 1999/2000 wuchs das Kontingent im Talgebiet um knapp 21'000 kg (+23%) und im Berggebiet um 10'000 kg (+17,4%).
Mit Wirkung ab 1.Mai 2004 wurde die Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe von 60 auf 10 Rp.je kg Milch herabgesetzt.In diesem Zusammenhang mussten die Kontingentsübertragungen von Sömmerungsbetrieben an Heimbetriebe stark eingeschränkt werden (Art.3 Abs.3bis MKV).Im Vorfeld dieser Änderung wurde ein Teil der Alpkontingente noch auf die Betriebe übertragen.Im Milchjahr 2002/03 betrug das Grundkontingent im Sömmerungsgebiet 86,9 Mio.kg.Im Milchjahr 2003/04 erreichte es noch 79,9 Mio.kg.Während dem Sömmerungsgebiet rund 19 Mio.kg durch endgültige Übertragung entzogen wurden,flossen ihm rund 12 Mio.kg durch Miete wieder zu.
Nachdem die Menge verteilter Zusatzkontingente in der Vorjahresperiode um beachtliche 77% auf 43,6 Mio.kg stieg,verringerte sie sich im Milchjahr 2003/04 um 5,4 Mio.kg auf 38,2 Mio.kg.Die Anzahl berechtigter Tiere betrug 19'095.
Ab dem 1.Mai 2006 bis zum 30.April 2009 wird neben der Milchkontingentierung ein zweites Produktionslenkungssystem bestehen.Um eine gewisse Flexibilität zu wahren, wurden die beiden Systeme durchlässig gestaltet.Mit den Anpassungen der Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion (MKV,SR 916.350.1) werden die erforderlichen Schnittstellen zur Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung (VAMK,SR 916.350.4) geschaffen.
Der im Frühjahr 2004 in die MKV eingefügte Artikel 3a bewirkt eine Einschränkung der Kontingentsübertragung und hat einen direkten Zusammenhang mit den Diskussionen über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung.So kann ein nicht endgültig übertragenes Kontingent,welches nach dem 1.Mai 2004 an den Kontingentsinhaber zurückgegeben wird,nicht mehr weiterübertragen werden.Davon ausgenommen ist die Rückübertragung nach Ablauf eines Aufzuchtvertrages.Eine Änderung erfahren hat die Haltedauer von Tieren,die zur Aufzucht ins Berggebiet gegeben werden und bei der Rücknahme zu Zusatzkontingenten berechtigen.Diese wurde von 22 Monaten auf 18 Monate herabgesetzt (Art.11).
Nach dem Ausstieg aus der Milchkontingentierung und dem Entzug des Kontingentes muss die Administrationsstelle Milchkontingentierung die einzelnen Produzenten für das abgelaufene Milchjahr abrechnen.Dabei ist eine Schlussabrechnung zu erstellen. Das heisst,dass die Produzenten von den Möglichkeiten der rollenden Abrechnung im letzten Kontingentsjahr keinen Gebrauch mehr machen können.In Artikel 17 wurde die spezielle Abrechnungsformel für diese Fälle aufgenommen.Die Übertragungsmöglichkeit von maximal 5'000 kg (Art.16) wurde aufgehoben.Die aussteigenden Produzenten müssen so für jedes kg Überlieferung eine Abgabe bezahlen.Auf den ersten 5'000 kg Überlieferung wird eine reduzierte Abgabe erhoben.Bei der Kontingentsabrechnung können die beiden Systeme nicht durchlässig sein.Die aus der Milchkontingentierung ausgestiegenen Produzenten werden öffentlich-rechtlich nicht mehr abgerechnet.Ein Ausgleich von Einlieferungen ist nicht möglich.
Am 1.Januar 2004 ist Artikel 36a LwG in Kraft getreten,der die Aufhebung der Milchkontingentierung regelt.Darin erhält der Bundesrat auch die Kompetenz, Produzentinnen und Produzenten vorzeitig von der Milchkontingentierung auszunehmen,wenn sie und ihre Organisationen bestimmte Voraussetzungen erfüllen.Der Bundesrat hat am 10.November 2004 die Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung (VAMK,SR 916.350.4) verabschiedet,welche Ausführungsbestimmungen für den vorzeitigen Ausstieg,also die Periode zwischen dem 1.Mai 2006 und der generellen Aufhebung der Milchkontingentierung am 30.April 2009 enthält.Generell wird die Milchkontingentierung am 30.April 2009 aufgehoben. Während dieser drei Jahre wird parallel zur bestehenden öffentlich-rechtlichen Milchkontingentierung ein privat-rechtliches System der Mengensteuerung geführt.
Im zweiten Abschnitt der VAMK stehen in den Artikeln 3 bis 5 die Regelungen für die Organisationsformen,als deren Mitglied ein Produzent vorzeitig aus der Milchkontingentierung aussteigen kann.Als Organisationsformen zulässig sind Branchen- und Produzentenorganisationen oder Produzenten-Milchverwerter-Organisationen (PMO). Die PMO ist eine Organisation,in der Produzentinnen und Produzenten mit einem bedeutenden regionalen Milchverwerter zusammengeschlossen sind.In den Artikeln 3 bis 5 wurden auch die Anforderungen,welche die verschiedenen Organisationen erfüllen müssen,wie beispielsweise Art der Entschlussfassung oder Mindestmenge, festgelegt.
Im dritten Abschnitt werden die Bedingungen zur Berechnung und Anpassung der Basis-Milchmenge geregelt.Am Tag des Ausstiegs (1.Mai 2006,2007 oder 2008) wird dem einzelnen Produzenten das Grundkontingent entzogen.Dieses entspricht dem Kontingent,das für die Abrechnung der letzten Periode vor dem Ausstieg massgebend war,exklusive Zusatzkontingente.Mit der Basismenge ist der Organisation nach wie vor ein Mengendach ähnlich einer Kontingentierung gegeben.Diese Einschränkung der Freiheiten der Ausgestiegenen ist so vorgesehen worden,damit nicht die in der Kontingentierung verbleibenden Produzenten durch eine übermässige Mengenausdehnung und einem damit verbundenen Preisdruck beeinträchtigt werden.Die Basismenge erhöht oder vermindert sich durch Anpassungen wie sie in den Artikeln 7 bis 10 festgehalten sind.
Im vierten Abschnitt sind die Regelungen für die Mengenaufteilung und die Aufgaben der Organisationen festgehalten.Den Organisationen ist grundsätzlich freigestellt,auf welche Weise sie die Menge auf die Mitglieder aufteilen und in der Folge bei Bedarf anpassen wollen.Die Aufteilungs- und Anpassungsregeln müssen jedoch in einem Reglement festgehalten sein (Art.13).Eine Voraussetzung für den Ausstieg aus der Kontingentierung ist,dass die Organisation eine Administrationsstelle einrichtet oder den Auftrag dazu einer geeigneten Stelle erteilt (Art.14).Ebenfalls eine Aufgabe der Organisation und ein Teil des Mengenmanagements ist die Sanktionierung der eigenen Mitglieder,die sich nicht an die Vorgaben der Organisation halten (Art.15).
Im fünften Abschnitt ist in Artikel 17 detailliert aufgelistet,welche sachdienlichen Unterlagen die Organisation ihrem Gesuch beizulegen hat.
Trotz hoher Kosten wird die Möglichkeit des Kontingentsaustausches weiterhin rege genutzt:6’315 Produzenten haben im Milchjahr 2004/05 Kontingente gekauft und 8’835 Produzenten haben Kontingente gemietet.Die übertragene Menge erreichte rund 308’080 t oder 10,1% des Grundkontingentes.
Im Hinblick auf den Ausstieg dehnte sich der Kontingentshandel stark aus.Die nach Artikel 3 MKV übertragene Menge (Kauf plus Miete) erreichte im Milchjahr 2003/04 knapp 300 Mio.kg oder 10% des Grundkontingentes.Während die Menge gemieteter Kontingente gegenüber dem Vorjahr um 25,9 Mio.kg zunahm (+18%),erhöhte sich die Menge gekaufter Kontingente in bedeutendem Umfang (+37,1 Mio.kg oder +40%).
Die Menge total vermieteter Kontingente betrug im Milchjahr 2003/04 rund 440 Mio.kg. Dies entspricht 14,2% des Grundkontingents.Seit Einführung des Kontingentshandels im Milchjahr 1999 wurden rund 428 Mio.kg Kontingente endgültig erworben.Im Milchjahr 2003/04 wurden somit 868 Mio.kg oder 27,9% des Grundkontingents durch flächenungebundene Kontingentsübertragungen von anderen Produzenten genutzt.

■ Frühzeitiger Ausstieg
Milchkontingentierung: Bericht über die anlaufende Gesuchsbehandlung
Bis zur Sommerpause 2005 haben eine Produzentenorganisation (PO) und drei Produzenten-Milchverwerter-Organisationen (PMO) ein Gesuch um vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung gestellt.Diese Zahl ist kleiner als angekündigt und erwartet,hängt jedoch damit zusammen,dass sich die Vorbereitungen auf den vorzeitigen Ausstieg einerseits aufwändiger erweisen als von den Organisationen angenommen und die Gesuchsfrist für den Ausstieg auf 1.Mai 2006 erst Ende Oktober 2005 abläuft.
Die geschilderte Situation ist aus Sicht des BLW insbesondere aber Ausdruck dafür, dass sich die rund 20 interessierten Organisationen allgemein sehr gut auf den angestrebten Wechsel vorbereiten.Im Vorfeld der Gesuchstellung fand denn auch eine erfreulich breite und bisweilen intensive Diskussion zum Thema statt und die Organisationen suchten fast ausnahmslos vorgängig Kontakt mit dem BLW,um die erforderlichen Gesuchsunterlagen (vor allem die Statuten und Reglemente für das Mengenmanagement) möglichst ordnungskonform beschliessen zu können.
Das BLW hat in dieser Phase zu den meisten Dokumenten bereits Stellung nehmen können,was schliesslich die im Herbst einsetzende Gesuchsbehandlung stark erleichtern wird.
Marktstützung mit Zulagen und Beihilfen
Das Instrumentarium zur Marktstützung hat im Berichtsjahr 2004 keine grundsätzliche Änderung erfahren.Als Folge des eingangs erwähnten Stützungsabbaus von 55,7 Mio.Fr.mussten jedoch verschiedene Beihilfen gekürzt werden.Im Hinblick auf die verfügbaren Mittel im laufenden Jahr 2005 musste ab 1.Mai 2005 die Zulage für verkäste Milch von 19 auf 18 Rp.je kg reduziert werden.Auf das gleiche Datum ist die Ausfuhrbeihilfe nach Gehaltsäquivalent erneut um 2 Rp.auf 27 Rp.je Gehaltsäquivalent gesenkt worden.Ebenfalls wurde die Höhe der Ausfuhrbeihilfen für Käseausfuhren in andere Länder als jene der EU für die Sorten Emmentaler,Switzerland Swiss,Sbrinz und Weichkäse um 50 Rp.je kg gekürzt.
Der Grenzschutz in Form von Zöllen und Zollkontingenten ist das wichtigste Instrument zur Unterstützung der inländischen Fleischproduktion.Für den Fleisch- und Eiermarkt sowie für den Export von Zucht- und Nutzvieh werden ausserdem Beihilfen ausgerichtet.
Auf Ende 2003 lief die Übergangsfrist für die Auszahlung von Umstellungsbeiträgen zu Gunsten der tierfreundlichen Legehennenhaltung (RAUS und/oder BTS) aus.Das BLW unterstützte die Umstellungsbetriebe seit 1997 mit insgesamt rund 19 Mio.Fr. Dank diesen zusätzlichen Mitteln stieg der Anteil der Legehennen,die nach den Anforderungen von RAUS und/oder BTS gehalten werden,auf über zwei Drittel.Infolge der guten Marktlage verzichtete die Proviande auf einige Entlastungsmassnahmen auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt:Weder führte sie die Marktabräumung von Rindern,Kälbern,Schweinen und Pferden in Schlachtbetrieben durch,noch entlastete sie den Markt mit Einlagerungsaktionen von Rind- oder Schweinefleisch.
■ Finanzielle Mittel 2004
Von den 40,2 Mio.Fr.für Massnahmen in der Viehwirtschaft budgetierten Bundesmitteln wurden lediglich 22,5 Mio.Fr.ausgegeben.5 Mio.Fr.der restlichen Mittel wurden zur Kompensation eines Nachtragskredites zu Gunsten von Ausfuhrbeiträgen für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte eingesetzt.Der Hauptgrund für die Minderausgaben in der Viehwirtschaft war die positive Nachfrage auf dem Fleischmarkt.Dank dem guten Konsum von Rindfleisch musste nicht wie üblich in der zweiten Jahreshälfte auf dem Markt interveniert werden.Die Mittel für die saisonalen Verwertungsmassnahmen auf dem Eiermarkt wurden nicht vollständig ausgenützt,weil das Eierangebot nach Ostern und im Sommer geringer war als angenommen.
Mittelverteilung 2004

Total 22,5 Mio. Fr.
Verwertungsbeiträge
Schafwolle 3%
Einlagerungs- und Verbilligungsbeiträge für Rind- und Kalbfleisch 22%
Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 13%
Ausfuhrbeihilfen
Zucht- und Nutzvieh 29%
Leistungsvereinbarungen
Proviande 33%
Quelle: Staatsrechnung
■ Schlachtvieh und Fleisch: Leistungsvereinbarungen
Die Proviande erfüllt seit dem 1.Januar 2000 Aufträge des BLW auf den öffentlichen Schlachtvieh- und Schafmärkten sowie in Schlachtbetrieben.Seit dem 1.Januar 2004 sind neue,befristete Verträge in Kraft.Aus personeller und finanzieller Sicht ist die neutrale Qualitätseinstufung von Lebendtieren und Schlachtkörpern die wesentlichste Aufgabe.
1.Neutrale Qualitätseinstufung
Der Klassifizierungsdienst der Proviande stufte die Qualität von rund 85% aller geschlachteten Tiere der Rinder- und Schweinegattung sowie von 60% aller Tiere der Schafgattung ein.Ausserdem bestimmte der Dienst die Qualität der Lebendtiere der Rinder- und Schafgattung auf öffentlichen Märkten.Für diese Arbeiten leisteten die Mitarbeitenden der Proviande mehr als 46'000 Arbeitsstunden in Schlachtbetrieben und waren auf 1’641 öffentlichen Märkten präsent.
Der Magerfleischanteil,das Qualitätsmerkmal von Schweineschlachtkörpern,wird mit technischen Geräten bestimmt.Der Mittelwert des Magerfleischanteils aus einer Stichprobe von 1,4 Mio.Schlachtungen (54% aller Schlachtungen) betrug 55,5%. Damit ist er im Vergleich mit dem Jahr 2003 um einen halben Prozentpunkt gestiegen. Die Fettqualität von Schweinen ist ein weiteres Qualitätsmerkmal,das für die Konsistenz und Oxidationsstabilität der Wurstwaren wesentlich ist.Die Messung der Fettqualität (Bestimmung der so genannten Fettzahl) ist für Schlachtbetriebe indessen fakultativ.
Verteilung der Schlachtkörper auf die Fleischigkeitsklassen 2004
Bei Tieren der Rinder-,Schaf-,Ziegen- und Pferdegattung wird die Qualität des Schlachtkörpers optisch bestimmt.Für die Fleischigkeit gibt es fünf Klassen:C = sehr vollfleischig,H = vollfleischig,T = mittelfleischig,A = leerfleischig und X = sehr leerfleischig.Die Fettabdeckung wird ebenfalls in fünf Klassen unterteilt.Die Auswertung einer Stichprobe aus dem Jahr 2004 offenbart wesentliche Unterschiede zwischen Schlachtkörpern von Muni und Kühen.Die Stichprobe umfasste rund 70% aller geschlachteten Tiere.Von den Kühen waren 24% leerfleischig und 22% sehr leerfleischig.Gegenüber dem Jahr 2002 sank der Anteil der sehr leerfleischigen Tiere immerhin um 6 Prozentpunkte.Dieser Rückgang dürfte eine Folge der Zunahme des Mutter- und Ammenkuhbestandes sein.Bei den Muni waren 95% der Tiere aus der Stichprobe mittel- bis sehr vollfleischig.Die Optimierung der Munimast in den vergangenen Jahren führte zur sehr stabilen hohen Anzahl von fleischigen Tieren.Die Fleischigkeit der geschlachteten Lämmer hat ebenfalls generell zugenommen,was auf eine hochwertige Mast zurückzuführen ist.Bei den Lämmern überwogen mit einem Anteil von 47% die mittelfleischigen Schlachtkörper.Die Klassifizierungsexperten stuften zwei Drittel der geschlachteten Gitzi als vollfleischig ein.
2.Überwachung von öffentlichen Märkten sowie Organisation von Marktentlastungsmassnahmen
Lokale bäuerliche Organisationen und/oder kantonale Stellen organisierten für Tiere der Rinder- und Schafgattung während des ganzen Jahres öffentliche Schlachtviehmärkte.Die Zahl der aufgeführten Tiere der Schafgattung sank gegenüber 2003 um 8%,diejenige von Grossvieh um 11% und von Kälbern um 9%.Diese Rückgänge sind auf das gesunkene Angebot zurückzuführen.Auf den Schafmärkten wurden trotz dieser Entwicklung 10’001 Tiere (11,9% der aufgeführten Tiere) nicht auf freiwilliger Basis gekauft.Deshalb musste die Proviande den übernahmepflichtigen Schlacht- und Handelsfirmen diese Tiere zuteilen.Die Firmen bezahlten für die zugeteilten Tiere von der Proviande festgestellte marktübliche Preise.Beim Grossvieh und bei den Kälbern wurden hingegen nur 398 bzw.5 Tiere im Rahmen der Marktabräumung zugeteilt.
Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten 2004
MerkmalEinheitKälberGrossviehTiere der Schafgattung
Überwachte öffentliche MärkteAnzahl420882339
Aufgeführte TiereSt.47 79564 76784 123
Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen%171829
Zugeteilte Tiere (Marktabräumung)St.539810 001
Quelle:Proviande
Überwachte öffentliche Märkte werden in 20 Kantonen auf insgesamt 187 Marktplätzen organisiert.Märkte für Grossvieh,Schafe und Lämmer werden beinahe in jedem Kanton durchgeführt,wohingegen Kälbermärkte nur in 8 Kantonen veranstaltet werden.Bereits seit einigen Jahren sind die Märkte in den Kantonen Aargau,Basel Stadt,Genf,Schaffhausen,Zürich und Zug aufgehoben worden.Im Kanton Bern befinden sich mit 50 öffentlichen Marktplätzen am meisten Marktplätze,gefolgt vom Kanton Graubünden (20) und dem Kanton Wallis (19).Die Grösse des Kantons einerseits und die des Berggebiets andrerseits sind dabei die Hauptursachen.Eine marginale Bedeutung weisen die Schlachtviehmärkte in den Kantonen Nidwalden und Solothurn auf,wo jeweils nur ein Grossviehmarktplatz vorhanden ist.
Obschon wesentlich weniger öffentliche Kälber- (18) als Grossvieh- (74) oder Schafmarktplätze (95) bestehen,ist jedes vierte aufgeführte Tier ein Kalb.Auf einem Kälbermarktplatz wurden im Berichtsjahr im Durchschnitt 2'655 Tiere aufgeführt.Beim Grossvieh waren es demgegenüber im Mittel nur 875 und bei den Schafen 886 Tiere pro Marktplatz.
Anzahl öffentliche Marktplätze je Kanton 2004
KantonKälber-Grossvieh-Schaf-Total marktplätzemarktplätzemarktplätze

Quelle:Proviande
Das BLW zahlte für das Einfrieren von Kalbfleisch und das Verbilligen von Rindfleisch insgesamt Beihilfen im Umfang von 4,9 Mio.Fr.aus.Rund 70 Schlacht- und Handelsbetriebe lagerten im Frühjahr 1'011 t Kalbfleisch ein,welches bis Ende des Berichtsjahres wieder dem Markt zugeführt wurde.Erstmals wurden 447 t Rinds-Vorderviertelfleisch für die Verarbeitung verbilligt.Ausserdem förderte das BLW die Verwendung von 10'847 Rindsstotzen zur Trockenfleischproduktion.
3.Erfassung und Kontrolle der Gesuche um Zollkontingentsanteile
Im Sommer 2004 wurden insgesamt 762 Gesuche um Zollkontingentsanteile für die Kontingentsperiode 2005 eingereicht.Mit den Gesuchen werden die Inlandleistungsdaten gemeldet,die für die Verteilung von 67% der Menge einer Fleischkategorie massgebend sind.Seit dem Jahr 2000,in dem 1'003 Gesuche gestellt wurden,ist die Zahl der Gesuche stetig rückläufig.Die Proviande prüfte die gemeldeten Inlandleistungen auf die Vollständigkeit und auf die Plausibilität.Dabei kontrollierte sie die Menge der eingesalzenen Rindsbinden in jedem Betrieb einmal vor Ort;die anderen gemeldeten Inlandleistungen wie Schlachtungen und freie Käufe wurden lediglich stichprobenweise überprüft.Die Bemessungsperiode der Inlandleistung umfasste den Zeitraum vom 1.Juli 2003 bis zum 30.Juni 2004.Die erfassten und kontrollierten Daten der Inlandleistungen übermittelte die Proviande dem BLW.Basierend auf diesen Daten teilte das BLW für das Jahr 2005 insgesamt 761 juristischen und natürlichen Personen Zollkontingentsanteile mittels Verfügung zu:630 Personen erhielten Anteile für Fleisch von Tieren der Rindergattung (ohne Rindsbinden),392 für Fleisch von Tieren der Schweinegattung,174 für Fleisch von Tieren der Schafgattung,150 für Rindsbinden,33 für Fleisch von Tieren der Pferdegattung und 28 für Fleisch von Tieren der Ziegengattung.Auf ein Gesuch konnte nicht eingetreten werden,da dieses zu spät eingereicht wurde.Den grössten Rückgang mit minus 11% Zollkontingentanteilsinhabern weist die Kategorie Fleisch von Tieren der Rindergattung auf.Entgegen dem allgemeinen Trend stieg die Zahl der Zollkontingentanteilsinhaber beim Schaffleisch von 171 (2004) auf 174.Die Zollkontingentsanteile für Geflügelfleisch wurden im Jahr 2005 zu 67% nach einer Inlandleistung zugeteilt.Anteile an dieser Fleischkategorie erhielten insgesamt 42 Personen.
Für die Kontingentsperiode 2005 werden 33% aller periodisch frei gegebenen Fleischeinfuhrmengen versteigert.Dieser Anteil steigt im Jahr 2006 auf 66% und wird ab 2007 100% betragen.Gleichzeitig nimmt der Anteil,der nach Kriterien der Inlandleistung verteilt wird,entsprechend ab.Für die Zollkontingentsanteile Fleisch von Tieren der Rindergattung (ohne Rindsbinden) und Fleisch von Tieren der Schafgattung gilt eine Sonderbestimmung.Diese Kategorien werden auch nach 2006 stets zu 10% nach der Zahl der ersteigerten Tiere auf öffentlichen Märkten verteilt.
Das BLW legt die Einfuhrmengen für eine Einfuhrperiode nach Anhörung des Verwaltungsrates der Proviande und nach Beurteilung der Marktlage fest.Als Einfuhrperiode gilt für Fleisch von Tieren der Rindergattung und für Schweinefleisch in Hälften ein Zeitraum von vier Wochen und für Fleisch von Tieren der Schaf-,Ziegenund Pferdegattung,Geflügelfleisch und Schlachtnebenprodukte das Jahresquartal.Seit Ende 2004 schreibt das BLW periodisch Einfuhrmengen aus.Die Ausschreibung fasst alle wesentlichen Bestimmungen und Informationen zur Versteigerung zusammen.Sie wird auf der Website des BLW und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert sowie per E-Mail (Newsletter) verschickt.An der Versteigerung sind alle natürlichen und juristischen Personen sowie Personengemeinschaften teilnahmeberechtigt,die im schweizerischen Zollgebiet Wohnsitz oder Sitz haben.
Aus administrativer Sicht verliefen die ersten Versteigerungen sowohl für die teilnehmenden Personen als auch für die Verwaltung ohne Probleme.Die Bietenden können ihre Steigerungsgebote durch einen gesicherten Internetzugang auf der WebApplikation «eVersteigerung» des BLW einreichen.Mehr als 80% der Gebote werden bereits auf diese Weise übermittelt.Die restlichen Gebote werden per Fax oder per Post zugestellt und müssen anschliessend von Hand erfasst werden.Die Zuteilung der Zollkontingentsanteile erfolgt,beginnend beim höchsten gebotenen Preis,in abnehmender Reihenfolge der gebotenen Preise.Der Zuschlagspreis entspricht dem Gebotspreis.Nach Ablauf der Einreichungsfrist verfügt und publiziert das BLW innerhalb eines Tages die Zuteilung.
Die Versteigerungsergebnisse zeigen,dass einige neue Firmen am Importmarkt partizipieren und bisherige Importeure auch in anderen Fleisch- und Fleischwarenkategorien Zollkontingentsanteile ersteigern.Damit zeichnet sich bereits ab,dass mit der Versteigerung ein intensiverer Wettbewerb unter den Fleischimporteuren entsteht und damit das volkswirtschaftliche Ziel der AP 2007 erreicht werden kann.Der dadurch entstehende Druck auf die Margen der nachgelagerten Stufen der Fleischwirtschaft und die am 1.Juli 2005 abgelaufene zehnjährige Übergangsfrist betreffend der Anpassung von Räumen und Einrichtungen bestehender Schlachtanlagen führen zu einer Aufweichung bestehender Strukturen und zum Abbau vorhandener Überkapazitäten.Verschiedene Verbände und Organisationen prognostizierten als Folge der Versteigerung höhere Konsumenten- und tiefere Produzentenpreise.Ein konkreter preislicher Zusammenhang konnte bisher aber nicht nachgewiesen werden.
Ergebnisse der Versteigerungen 2005
■ Eier:Unterstützung der inländischen Produktion und Verwertungsmassnahmen
Das BLW hat auch im Berichtsjahr wieder Investitionsbeiträge für den Um- und Neubau von besonders tierfreundlichen Geflügelställen ausgerichtet.Die Beiträge sind ausschliesslich zu Gunsten von Ställen für Geflügel zur Eierproduktion und müssen weder zurückgezahlt noch verzinst werden.13 Betriebe mit Legehennen und 2 Betriebe mit Junghennen profitierten von einer zugesicherten Unterstützung von 357'000 Fr. Zusammen mit den im Jahr 2003 zugesicherten Beiträgen zahlte das BLW im Berichtsjahr Investitionsbeiträge in der Höhe von 439'000 Fr.aus.Die begünstigten Betriebe halten durchschnittlich rund 4'800 Lege- oder 4'900 Junghennen.Von den 15 Betrieben,denen im Berichtsjahr Unterstützung zugesichert wurde,produzieren 3 Betriebe oder 20% nach biologischen Richtlinien.
Vor allem nach Ostern und in den Sommermonaten ist die Nachfrage nach inländischen Eiern gegenüber der Zeit vor Weihnachen und vor Ostern schwach.Um die Auswirkungen dieser saisonalen Nachfrageschwankungen zu mildern,stellte das BLW maximal 3 Mio.Fr.für Verwertungsmassnahmen zur Verfügung.Die Eiprodukthersteller schlugen 13,7 Mio.überschüssige Inlandeier auf.Das Aufschlagen wurde mit einem Beitrag von 9 Rp.je Ei unterstützt.Zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten verbilligten die Anbieter 10,9 Mio.Eier.Dafür erhielten sie 5 Rp.je Ei.Das BLW überprüfte die Einhaltung der Bestimmungen der Aufschlags- und Verbilligungsaktionen mit Domizilkontrollen und Kontrollen von Nachweisdokumenten.
Das BLW unterstützte im Berichtsjahr praxisnahe Versuche beim Geflügel sowie die Verbreitung der entsprechenden Ergebnisse bei der Bildung und Beratung mit rund 580'000 Fr.Nutzniesser waren das Aviforum und das Zentrum für tiergerechte Haltung: Geflügel und Kaninchen (ZTHZ).Folgende Projekte erhielten finanzielle Mittel: Evaluation der Legeleistung von zwei Hybriden mit Bio-Futter resp.Biofutterzusätzen in Futter und Einstreue;Beeinflussung des Anteils Grosseier (>70g) bei zwei braunschalig legenden Hybridherkünften über die Aufzuchtbeleuchtung und den Linolsäuergehalt des Legehennenfutters;Beeinflussung des Anteils Grosseier (>70g) über die Beleuchtung und die Steuerung des Körpergewichtes während der Aufzucht sowie den Linolsäuregehalt des Legehennenfutters;Einfluss des Rohprotein- und Methioningehaltes sowie der Hybridherkunft auf die Leistung,die Abgangsrate und das Gefieder von Legehennen;Schnabelkürzen bei Legehennen – Eintagesküken in der Schweiz: Wie häufig sind Missbildungen in Folge des Eingriffes;Optimierung der Legehennenhaltung mit Grünauslauf – Management und Zucht.
■ Nutz- und Sportpferde: Versteigerung von Zollkontingentsanteilen
Auch im Berichtsjahr hat das BLW das Zollkontingent «Tiere der Pferdegattung (ohne Zuchttiere,Esel,Maulesel und Maultiere)» in zwei Hälften von je 1'461 St.ausgeschrieben und versteigert.An beiden Versteigerungen reichten jeweils über 250 Personen Gebote für mehr als 2'500 Tiere ein.Im Mittel lag der Zuschlagspreis bei 360 Fr.pro Nutz- und Sportpferd.Der Versteigerungserlös zu Gunsten der Bundeskasse belief sich auf über 1 Mio.Fr.
2.1.4Pflanzenbau
Die AP 2007 brachte im Bereich Pflanzenbau nur wenige Veränderungen am Massnahmenkatalog zur Stützung der Inlandproduktion.Neu gibt es seit 2004 Beiträge für die Umstellung von Obstanlagen und die Pflanzung innovativer Obst- und Gemüsekulturen.Der Grenzschutz bleibt das zentrale Instrument zur Sicherstellung der Inlandproduktion.
Mit Ausnahme des Beitrages für die Verarbeitung von Zuckerrüben,welcher für die Zahlungsrahmenperiode 2004 bis 2007 gekürzt wurde,blieben die finanziellen Mittel für die Unterstützung der übrigen Massnahmen im Rahmen der Vorperiode. Massnahmen 2004
für Umstellung
1Je nach Verwendungszweck bzw.Zolltarifposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung
2Betrifft nur Teile der Erntemenge (Frischverfütterung und Trocknung von Kartoffeln,Marktreserven Kernobstsaftkonzentrate)

3Kartoffeln:nur für Kartoffelprodukte zu Speisezwecken / Saatgut:nur für Saatkartoffeln / Obst:nur für verarbeitete Konservenkirschen und diverse Kernobstprodukte
4Betrifft nur bestimmte Kulturen
Quelle:BLW
■ Finanzielle Mittel 2004
Im Berichtsjahr sanken die zur Marktstützung ausgerichteten Mittel gegenüber dem Vorjahr von 154 auf 142 Mio.Fr.Rückläufig waren die Ausgaben für Verarbeitungsund Verwertungsbeiträge sowie Diverses,während die Aufwendungen für Anbau- und Exportbeiträge nahezu unverändert blieben.
Mittelverteilung 2004
Total 142 Mio. Fr.
Exportbeiträge 12%
Diverses 3%
Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 54%
Anbaubeiträge 31%
Quelle: Staatsrechnung
Insgesamt blieben die für die Ackerkulturen aufgewendeten Mittel im Vorjahresvergleich stabil.Allerdings wurden infolge der Beitragskürzung für die Verarbeitung der Zuckerrübenernte 2003 lediglich 38,2 Mio.Fr.ausgerichtet,während für die Ernte 2004 im Berichtsjahr bereits 7,1 Mio.Fr.ausbezahlt wurden.Geringere Aufwendungen für die Kartoffeln waren auf einen kleineren Bedarf an Exportförderungsbeiträgen für Kartoffelprodukte zurückzuführen.Infolge rückläufiger Anbauflächen bei den Körnerleguminosen sank die Stützung über Anbaubeiträge entsprechend.Im Weinbau ist verglichen mit den Vorjahren ein markanter Ausgabenrückgang zu verzeichnen.Dafür gibt es folgende Gründe:Die Beiträge für die Verwertung von Traubensaft waren auf die Jahre 2002 und 2003 begrenzt und die Beiträge für die Absatzförderung werden neu in der allgemeinen Budgetrubrik verrechnet.
Zuckerrüben 1 KartoffelnKörnerleguminosen Ölsaaten (inkl. NWR) Nachwachsende Rohstoffe (Faserpflanzen)
200220032004
1 für Ernte 2003: 38,2 Mio. Fr.; für Ernte 2004: 7,1 Mio. Fr.
2 ab 2004 ohne Absatzförderung, 2002 und 2003 Verwertung von Traubensaft
Saatgutproduktion
Quelle: Staatsrechnung
■ Massnahmen an der Grenze
Ausgaben für Obstverwertung 2004
Total 18,5 Mio. Fr.
Export andere Kernobstprodukte 2,1%
Export Kirschen 2,0%
Verwertung von Äpfel und Birnen im Inland 4,3%
Marktanpassungsmassnahmen bei Obst und Gemüse 3,1%
Export von Apfelsaftkonzentrat 57,8%
Export von Birnensaftkonzentrat 29,0%
Anderes 1,7% davon Marktentlastung Kirschen und Zwetschgen 1,3%
Quelle: BLW
Im Berichtsjahr betrug die Unterstützung für die Obstverwertung 18,5 Mio.Fr.Dies entspricht den durchschnittlichen Ausgaben der vier Vorjahre.Im Vergleich zu 2003 wurden für den Export von Apfelsaftkonzentrat 1,4 Mio Fr.mehr aufgewendet.Dafür gingen die Ausgaben für den Export von Birnensaftkonzentrat um beinahe den selben Betrag zurück.
Ackerkulturen
Im zweiten Semester des Berichtsjahres beschlossen die Behörden,das Zollkontingent Brotgetreide ab 2005 in vier jeweils bis Jahresende gültigen Tranchen mittels Windhundverfahren an der Grenze zuzuteilen.Zudem senkte der Bundesrat die Schwellenpreise für Futtermittel (Futtergetreide minus Fr.3.– und Eiweissträger minus Fr.1.– je 100 kg) sowie den Kontingentszollansatz von Brotgetreide (minus Fr.3.– je 100 kg) per 1.Juli 2005.
■ Entwicklung der Zuckermarktordnung
Ergänzend zum Grenzschutz wurde bis 1995 am Prinzip der gemeinsamen Verlustdeckung der inländischen Zuckerproduktion durch Bund,Konsumenten und Produzenten festgehalten.Von 1995 bis 1998 deckte der Bund das Defizit in der Rechnung der Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG (nachfolgend Zuckerfabrik),die 1996 aus der Fusion der Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld hervorging.Mit der AP 2002 erteilte der Bund der Zuckerfabrik einen Verarbeitungsauftrag für die Produktion von 120'000 bis maximal 185'000 t Zucker.Dieser wurde und wird mit einem pauschalen Beitrag abgegolten.Dem durch fluktuierende Weltmarktpreise grösseren Betriebsrisiko wurde mit einem Preisband Rechnung getragen.Tiefe Zuckerpreise auf dem Weltmarkt haben höhere Bundesbeiträge und hohe Zuckerpreise tiefere Bundesbeiträge zur Folge.Per 1.März 2001 wurde die Obergrenze mit einem Produktionskontingent von maximal 2'000 t Biozucker ergänzt.Der Bundesbeitrag für die Verarbeitung der Zuckerrüben sank von ursprünglich 45 Mio.Fr.jährlich auf 38,2 Mio.Fr.im Berichtsjahr für die jeweilige Verarbeitung der vorausgegangenen Rübenernte.Im Einklang mit der Liberalisierung der Agrarmärkte hob der Bundesrat die Obergrenze für die Produktion von Zucker per 1.Oktober 2004 auf.
Bis zur Aufhebung der Produktionsobergrenze musste die Zuckerfabrik überschüssige Zuckermengen auf das Folgejahr übertragen oder ausserhalb des Verwertungsauftrages verwerten.Mit der Befreiung von der maximalen Produktionsmenge wurde festgelegt,dass die Zuckerfabrik den Zuckerexport nicht mit Bundesmitteln verbilligen darf.Den Produktionseinschränkungen trug die Zuckerfabrik mit einem Quotensystem Rechnung,womit sie unter Berücksichtigung der Marktlage die Liefermengen jährlich mit den Rübenpflanzern vereinbart.Steigt ein Rübenpflanzer aus der Produktion aus, wird sein Lieferrecht nach einer von der Zuckerfabrik zusammen mit dem Schweizerischen Verband der Zuckerrübenpflanzer ausgehandelten Regelung anderen Pflanzern zugeteilt.
Die Entlastungsprogramme brachten eine zusätzliche Reduktion des Budgetsfür die Verarbeitung von Zuckerrüben.Die in der Zuckerverordnung festgelegte Abgeltung an die Zuckerfabrik muss gegenüber den im Zahlungsrahmen vorgesehenen Mitteln weiter reduziert werden.Für die Zuckerjahre 2004/05 sind 35 Mio.Fr.,für 2005/06 28,8 Mio.Fr.und für 2006/07 26,3 Mio.Fr.vorgesehen.Ebenfalls auf Beginn des Zuckerjahres 2005/06 (Beginn 1.Oktober 2005) wurde die Berücksichtigung von Mehroder Mindererträgen aus dem Zuckerverkauf infolge von variablen Weltmarktpreisen aufgehoben.
Das seit dem 1.Februar 2005 gültige Protokoll Nr.2 des Freihandelsabkommens CH-EU der Bilateralen II beinhaltet die so genannte Doppel-Null-Lösung für Zucker. Diese enthält ein Verbot für Preisausgleichsmassnahmen (Ausfuhrbeiträge/Zollrückerstattung und Einfuhrabgaben) bezogen auf Zucker in landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten,die unter den Deckungsbereich des Abkommens fallen.Somit besteht ein Freihandel zwischen der Schweiz und der EU für den in verarbeiteten Produkten enthaltenen Zucker.Die Konsequenz dieser Regelung ist,dass der Zuckerpreis für die Verarbeitungsindustrie in der Schweiz zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit in etwa jenem in der EU entsprechen muss.

■ Strukturentwicklung im Zuckerrübenanbau
In den vergangenen Jahren wandelte sich der Zuckerrübenanbau von einer arbeitsintensiven zu einer hochmechanisierten Kultur.Wurden früher die Jungpflanzen mit der Handhacke ausgedünnt,so erlaubt heute leistungsfähiges Saatgut die Saat auf den gewünschten Endabstand.Die so genannte Vereinzelung der Pflanzen entfällt,wodurch je ha Zuckerrüben rund 70 Arbeitsstunden eingespart werden können.
Entwicklung der Strukturen im Zuckerrübenanbau
übrige Betriebe mit offener Ackerfläche Betriebe mit Zuckerrüben Zuckerrübenfläche mittlere offene Ackerfläche je Betrieb mittlere Rübenfläche je Betrieb
Eine Analyse der Strukturen im Zuckerrübenanbau zeigt,dass im Jahre 2003 in der Grössenklasse <10 ha LN rund 350 Betriebe auf 440 ha Zuckerrüben anbauten.In derselben Grössenklasse stiegen von 1999 bis 2003 rund 20% der Betriebe aus der Rübenproduktion aus,während die Betriebszahl der übrigen Betriebe mit offener Ackerfläche um 35% abnahm.In der Grössenklasse 10 bis 30 ha LN stieg die mittlere Zuckerrübenfläche je Betrieb von 1999 bis 2003 lediglich um 0,1 ha an.Hingegen sank die mittlere Zuckerrübenfläche auf Betrieben mit über 60 ha LN um über 1 ha.
Die gesamte Rübenanbaufläche veränderte sich seit 1999 nur unwesentlich,doch sank die Zahl der Zuckerrüben anbauenden Betriebe kontinuierlich.In Bezug auf die Strukturveränderungen ist bemerkenswert,dass a) die Anzahl der kleinen Betriebe mit Zuckerrüben weniger stark abnahm als die Zahl der Betriebe mit offener Ackerfläche, b) der Anteil der Zuckerrüben an der offenen Ackerfläche mit zunehmender Betriebsgrösse abnimmt und c) die mittlere Rübenfläche je Betrieb trotz vergleichsweise hoher Wertschöpfung nicht im selben Masse wie die mittlere offene Ackerfläche je Betrieb anstieg.Alle drei Beobachtungen deuten auf ein Hemmnis hin,das den Strukturwandel im Zuckerrübenanbau beeinträchtigt.
■
Die EU-Zuckermarktreform wird durch interne und externe Kräfte vorangetrieben. Einerseits war die EU-Zuckermarktordnung im Jahre 2003 von der grossen Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ausgenommen.Andererseits klagten im Jahre 2003 die grossen Zucker exportierenden Länder Brasilien,Australien und Thailand bei der WTO gegen das EU-Zuckermarktregime,das sich durch einen weit über dem Weltmarkt liegenden Zuckerpreis und umfangreiche Zuckerexporte auszeichnet.
Im Juli 2004 präsentierte die EU-Kommission einen ersten Reformvorschlag,der eine Reduktion des Zuckerpreises um einen Drittel und eine Teilkompensation von 60% für die Rübenmindererlöse vorsah.Im April 2005 hiess das WTO-Organ die Klage der grossen Zuckerexporteure gut.Subventionen zum Reexport von präferenziell eingeführten Zucker aus afrikanischen,karibischen und pazifischen Ländern sind ebenso zur Exportförderung zu zählen,wie die indirekte Exportsubventionierung von EU-Zucker.Im Juni 2005 stellte die EU-Kommission einen neuen Reformvorschlag vor,der dem WTOPanel Rechnung trägt und den Zuckerpreis ab dem Wirtschaftsjahr 2007/08 um 39% herabsetzt.In derselben Periode erfährt der Mindestrübenpreis eine Kürzung um 42,6%.
Reformvorschlag der EU-Kommission vom 22.Juni 2005
20052006/072007/082008/092009/10
Referenzpreis Zucker
(ab Zuckerfabrik)Fr./t960960724684586
Referenzpreis Zucker
(ab Zuckerfabrik)%10010075,471,261,0
RestrukturierungsbeitragFr./t0192138980
Referenzpreis Zucker
(Produktion)Fr./t960768586586586
MindestrübenpreisFr./t6650383838
Mindestrübenpreis%10075,357,457,457,4
Umrechnungskurs:1 C = = 1.52 Fr.
Trotz der in Aussicht gestellten entkoppelten Kompensation an die Erzeuger von Zuckerrüben dürften die von der Kommission vorgelegten Massnahmen eine substanzielle Strukturbereinigung in der Zuckerwirtschaft auslösen.Weniger konkurrenzfähige EU-Länder könnten mittelfristig aus der Zuckerproduktion ausscheiden.Ziel der EUKommission ist,dass der Ministerrat die Reformvorschläge im November 2005 gutheisst.Seit Februar 2005 herrscht Freihandel zwischen der EU und der Schweiz für Zucker in Verarbeitungsprodukten,die in den Deckungsbereich der Bilateralen II fallen. Rund 80% des gesamten Zuckerverbrauchs verarbeitet die Nahrungsmittelindustrie, die zur Wahrung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit auf vergleichbare Rohstoffpreise angewiesen ist.Somit wirkt sich die EU-Zuckermarktreform unmittelbar auf die Zuckerwirtschaft in der Schweiz aus.Die dreistufige Senkung des Zuckerreferenzpreises (ab Zuckerfabrik) in den Jahren 2007 bis 2009 erfordert zur kostendeckenden Zuckerherstellung geringere Zuckerrübenpreise.Trotz geplanter Massnahmen zur teilweisen Kompensation der Einkommensverluste werden auch in der Rübenproduktion lokal realisierbare Kostensenkungspotenziale sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Verarbeitungsstufe die Anbauwürdigkeit mitbestimmen.Zu erwarten ist,dass mit der durch die EU-Zuckermarktreform ausgelösten Attraktivitätseinbusse des inländischen Zuckerrübenanbaus das Quotensystem seine heutige Bedeutung weitgehend einbüssen wird.
■ Erste Erfahrungen mit den Marktanpassungsmassnahmen bei Obst und Gemüse
Spezialkulturen
Die beitragsberechtigte Umstellung von Obstanlagen und die Pflanzung innovativer Obst- und Gemüsekulturen wurden im Rahmen der AP 2007 mit der Verordnung über Massnahmen zu Gunsten des Obst- und Gemüsemarktes (Obst- und Gemüseverordnung) auf den 1.Januar 2004 in Kraft gesetzt.Diese Massnahmen sind bis Ende 2011 befristet.Die zu beantragende Mindestfläche ist für die Umstellung auf 1,5 ha und die Pflanzung innovativer Kulturen auf 1 ha festgelegt.Die Gesuchsteller müssen Produzentengruppen oder einzelne Produzenten sein,welche die oben aufgeführte Mindestflächen erreichen.Diese Anforderungen erlauben eine gewisse Angebotsbündelung,wobei mit dem Anbieten von angemessenen Mengen die Marktinteressen der Detaillisten verbessert werden können.
Eine Umstellung ist beitragsberechtigt,wenn auf eine Rodung von Äpfel-,Birnen-, Kirschen- oder Zwetschgenkulturen eine Wiederanpflanzung von Kirschen- und Zwetschgenkulturen erfolgt.Die Ernte der gepflanzten Sorten muss grossmehrheitlich vor oder nach einer Zeit stattfinden,in der im Vierjahresdurchschnitt der Versorgungsgrad des Schweizer Marktes mit dem einheimischen Produkt 80% übersteigt.So wird gewährleistet,dass die Produktion den Bedürfnissen des Marktes entspricht und keine Überversorgung entsteht.Beiträge an innovative Kulturen sind für jene Dauerkulturen von Obst und Gemüse möglich,für die kein Grenzschutz besteht.Im Weiteren müssen die geernteten Produkte den Anforderungen der Tafelware entsprechen.Eine Unterstützung wird für beide Massnahmen nur gewährleistet,wenn die Vermarktung des betreffenden Produktes sorgfältig geplant und die Wirtschaftlichkeit geprüft wurde.
Eingereichte Gesuche für die Pflanzung innovativer Obst- und Gemüsekulturen 2004
Im ersten Jahr wurden Gesuche für die Umstellung von 4 ha und für innovative Kulturen von 70 ha eingereicht.Für Umstellungen wurden drei Gesuche eingereicht. Auf ein Gesuch konnte nicht eingetreten werden,weil die Fläche für die Wiederanpflanzung die Mindestfläche von 1,5 ha nicht erreichte.Die Mitglieder dieser Produzentengruppe haben die Möglichkeit,die Fläche aufzustocken und ein neues Gesuch einzureichen.Bei den verbleibenden zwei Gesuchen sind Rodungen von Äpfel(2,1 ha),Birnen- (0,5 ha),Kirschen- (1 ha) und Zwetschgenkulturen (0,4 ha) geplant. Die Wiederanpflanzung ist ungefähr je zur Hälfte der Fläche mit Tafelkirschen und Tafelzwetschgen vorgesehen.Für die Pflanzung innovativer Kulturen wurden im Berichtsjahr 24 Gesuche eingereicht.Tafeltrauben und schüttelbare Konservenkirschen haben mit je 14 ha den grössten Flächenanteil.Weisse Spargeln folgen mit 11 ha.
Dahinter liegen die Kulturen von Holunder,Heidelbeeren und Kiwi/-Minikiwi mit 6,7 bis 8 ha im mittleren Bereich.Nach den Mirabellen mit 4,6 ha und den Pflaumen mit 3,7 ha belegen die Nektarinen und Pfirsiche mit je 1 Are den geringsten Flächenanteil.
Für die Bejahung der Unterstützung arbeitet das BLW eng mit den kantonalen Fachstellen für Obst- und Gemüsebau zusammen,welche die regionalen Bedingungen bestens kennen.Die Gesuche werden eingehend geprüft,damit lediglich Projekte unterstützt werden,die erfolgsversprechend sind und den wirtschaftlichen Grundsätzen genügen.
Im Rahmen der AP 2011 schlägt der Bundesrat im Vernehmlassungsbericht vor,die Exportsubventionen u.a.im Obstbereich aufzuheben.Mit diesem Vorschlag soll der zunehmenden Marktöffnung und den zu erwartenden Verpflichtungen der DohaRunde im Bereich der Exportunterstützung sowie einem möglichst langen Umsetzungszeitraum Rechnung getragen werden.Die Marktbedingungen zeigen,dass die Produktion von Konservenkirschen für den Inlandmarkt und der Export von verarbeiteten Konservenkirschen wettbewerbsfähig bleiben können.Allerdings müssen dafür die Produktions-,die Liefer- und Verarbeitungsbedingungen laufend verbessert werden.Mit der AP 2007 wurde vorzeitig eine Hilfe für die Modernisierung des Anbaus von Konservenkirschen eingeführt,um die Verwertung dieser Früchte dank geringerer Produktionskosten von Bundeshilfe unabhängig zu machen.Die Beiträge für die Anpflanzung innovativer Kulturen und die Umstellung von Obstanlagen entsprechen diesem Konzept und unterstützen die Produzenten in ihren Bemühungen zur Marktorientierung.Angesichts der Bedeutung dieser Massnahmen für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,ist es vorgesehen,sie beizuhalten und den Gesuchstellern zu gewähren,wenn die Marktentwicklung es erlaubt.Die Massnahmen sind im Gesetz bis 2011 befristet.
2.2 Direktzahlungen
Die Direktzahlungen sind eines der zentralen Elemente der Agrarpolitik.Sie gelten die von der Gesellschaft geforderten Leistungen ab.Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen.

Ausgaben für die Direktzahlungen
Anmerkung:Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr;die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
2.2.1Bedeutung der Direktzahlungen
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten.Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere.Diese Beiträge haben das Ziel,die Nutzung und Pflege der landwirtschaftlichen Nutzfläche sicherzustellen.In der Hügelund Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen.Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt.Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).

■ Abgeltung besonderer ökologischer und ethologischer Leistungen
Die ökologischen Direktzahlungen geben einen Anreiz für besondere ökologische Leistungen,die über den ÖLN hinausgehen.Zu ihnen gehören die Öko-,Öko-Qualitäts-, Gewässerschutz- und Sömmerungsbeiträge sowie ethologische Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (BTS,RAUS).Mit diesen Beiträgen werden Leistungen der Landwirtschaft,welche über die gesetzlichen Anforderungen und den ÖLN hinausgehen,mit wirtschaftlichen Anreizen gefördert.Ziele sind unter anderem,die Artenvielfalt in den Landwirtschaftsgebieten zu erhalten und zu erhöhen,landwirtschaftliche Nutztiere besonders tierfreundlich zu halten,den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln zu vermindern,die Nitrat- und Phosphorbelastung der Gewässer zu reduzieren,und das Sömmerungsgebiet nachhaltig zu nutzen.
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2004
Die Direktzahlungen machten 2004 rund 70% der Ausgaben des BLW aus.Von den Direktzahlungen kamen 63% der Berg- und Hügelregion zugute.
Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle:BLW
■ Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
Die Abgeltung der erschwerenden Bewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion führt dazu,dass die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis ansteigt.Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zahlreiche Anforderungen zu erfüllen.Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen wie Rechtsform,zivilrechtlicher Wohnsitz usw.,anderseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend wie beispielsweise ein minimaler Arbeitsbedarf,das Alter der Bewirtschafter,das Einkommen und Vermögen. Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen,die unter den Begriff «Ökologischer Leistungsnachweis» fallen.Die Anforderungen des ÖLN umfassen:eine ausgeglichene Düngerbilanz,ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen,eine geregelte Fruchtfolge,ein geeigneter Bodenschutz,eine gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere.Mängel bei den massgebenden Vorschriften haben Kürzungen oder eine Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge.

■ Agrarpolitisches Informationssystem
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem).Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen,welche die Kantone zusammentragen und übermitteln und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart (Massnahme) gespiesen.Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge.Eine weitere Funktion des Systems besteht in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen.Dank der Informationsfülle und der leistungsfähigen EDV-Hilfsmittel können zahlreiche agrarpolitische Fragen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden.
Von den 62’692 über der Erhebungslimite des Bundes liegenden und im Jahre 2004 in AGIS erfassten Betrieben beziehen deren 57’076 Direktzahlungen.
■ Auswirkungen der Begrenzungen und Abstufungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus.Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro SAK,bei den Abstufungen um die Degressionen nach Fläche und Tieren.
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2004
BegrenzungBetroffene Gesamtbetrag Anteil am Anteil an der BetriebeKürzungenBeitragstotalDirektzahlungsder Betriebesumme
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge,insbesondere für jene 200 Betriebe,deren Vermögen zu hoch ist.Von den Einkommensgrenzen waren im Jahr 2004 rund 890 Betriebe betroffen.Die Kürzung der Direktzahlungen betrug bei diesen Betrieben im Durchschnitt 10,18%.Insgesamt wurden aufgrund der Begrenzungen 9,4 Mio.Fr.an Direktzahlungen gekürzt;dies entspricht 0,38% des Gesamtbetrages.
Wirkung der Abstufungen der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl 2004 MassnahmeBetroffene Fläche oder Reduktion Anteil am Anteil am BetriebeTierbestandBeitrag derTotal der pro BetriebBetriebeDirektzahlungsart
Insgesamt sind 8'579 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen.Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenen Massnahmen.Die Reduktionen betragen total 35,6 Mio.Fr.Gemessen an allen Direktzahlungen,die abgestuft sind,beträgt der Anteil sämtlicher Reduktionen 1,44%.Die Beitragsdegressionen wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus, wo die Abstufungen bei knapp 7’200 Betrieben (rund 12,6% aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen.Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 220 von dieser Reduktion betroffen,da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite und der Milchabzug bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken.Von der Beitragsreduktion betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen.So werden z.B.die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei 2’864 Betrieben (ohne Doppelzählungen) um 10,2% (BTS) beziehungsweise um 8,3% (RAUS) reduziert.734 Bio-Betriebe erhalten um 7,3% herabgesetzte Direktzahlungen.
■ Vollzug und Kontrolle
Die Kontrolle des ÖLN wird gemäss Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert.Diese ziehen akkreditierte Organisationen,die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten,zum Vollzug bei.Sie müssen die Kontrolltätigkeit stichprobenweise überprüfen.Direktzahlungsberechtigte Bio-Betriebe müssen neben den Auflagen des Biolandbaus die Vorgaben des ÖLN erfüllen und alle Nutztiere nach den RAUS-Anforderungen halten. Sie werden von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle überprüft.Die Kantone überwachen diese Kontrollen.Artikel 66 Absatz 4 der Direktzahlungsverordnung präzisiert,nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben.
Zu kontrollieren sind: –alle Betriebe,welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen; –alle Betriebe,bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden;und –mindestens 30% der übrigen Betriebe,die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind.
Bei einer mangelhaften Erfüllung des ÖLN werden die Beiträge nach einheitlichen Kriterien gekürzt.Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren hat eine entsprechende Richtlinie erlassen.
■ Durchgeführte Kontrollen und Beitragskürzungen
2004
Im Jahr 2004 waren insgesamt 57’076 Landwirtschaftsbetriebe beitragsberechtigt. Von ihnen wurden 33'697 (59%) durch die Kantone bzw.durch die von ihnen beauftragten Kontrollstellen auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert.Allerdings variiert der Anteil der kontrollierten Betriebe sehr stark zwischen den Kantonen (24 bis 100%). Wegen Mängeln beim ÖLN wurden bei 1’896 Betrieben (5,6% der kontrollierten Betriebe) die Beiträge gekürzt.
Gemäss Bio-Verordnung müssen alle Bio-Betriebe jedes Jahr kontrolliert werden. Wegen Mängeln erhielten 3,2% gekürzte Beiträge.
Beim BTS-Programm wurden 69,2% (33 bis 100%) und beim RAUS-Programm 51,6% (20 bis 100%) der beitragsberechtigten Betriebe kontrolliert.Beim BTS-Programm erhielten 5,3% aller direktzahlungsberechtigten Betriebe gekürzte Beiträge,beim RAUS-Programm belief sich die Anzahl Kürzungen auf 6% der kontrollierten Betriebe.
Gesamthaft wurden bei 5’606 Betrieben Mängel festgestellt,was Beitragskürzungen von rund 5 Mio.Fr.zur Folge hatte.
mangelhafte Aufzeichnungen,nicht tiergerechte Haltung der Nutztiere,andere Gründe (fehlende Bodenproben,abgelaufener Spritzentest),nicht ausgeglichene Düngerbilanz,ungenügende Pufferund Grasstreifen,Auswahl und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,nicht rechtzeitige Anmeldung, nicht angemessener Anteil ÖAF.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (anderweitige Nutzung,Schnittzeitpunkt und Pflegemassnahmen nicht eingehalten),zu frühe oder unzulässige Nutzung,falsche Angabe der Anzahl Bäume, Verunkrautung,falsche Flächenangaben,unzulässige Düngung,nicht rechtzeitige Anmeldung und Pflanzenschutz.
nicht rechtzeitige Anmeldung,Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung,unzulässige Pflanzenschutzmittel.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Verstoss Fütterungsvorschriften,Hobbybetriebe nicht nach Bio-Vorschriften,Tierhaltung,Gewässerschutz, Aufzeichnungen u.a.),im Bio-Landbau nicht zugelassene Dünger und Pflanzenschutzmittel,nicht rechtzeitige Anmeldung,falsche Angaben.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Einstreu unzweckmässig),nicht rechtzeitige Anmeldung,kein Mehrflächen-Haltungssystem,Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften,mangelhafter Liegebereich,falsche Angaben,mangelhafte Stallbeleuchtung.
andere als auf der Liste erwähnte Elemente (Mindestmastdauer nicht erreicht,Liegebereich mit Spalten/Löcher,Tierschutz,zu kleine Weidefläche, verspäteter Einzug u.a.),zu wenig Auslauftage,nicht rechtzeitige Anmeldung,mangelhafte Aufzeichnungen,nicht alle Tiere einer Kategorie nach den Vorschriften gehalten,falsche Angaben,ungenügender Laufhof.
Unter- oder Überschreitung des Normalbesatzes, unsachgemässe Weideführung,Nutzung nicht beweidbarer Flächen,Verstösse gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften,nicht rechtzeitige Anmeldung,Ausbringen nicht erlaubter Dünger, andere Elemente (Überlieferung Milchkontingent) falsche Angaben zum Tierbestand,fehlende Dokumente,nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden,Erschweren von Kontrollen,falsche Angaben betreffend Sömmerungsdauer,fehlende Daten, unerlaubter Herbizideinsatz,Wiederholungsfälle.
Zusammenstellung der Beitragskürzungen 2004
KategorieBeitrags- Kontrollierte BetriebeKürzungenHauptgründe berechtigteBetriebemit BetriebeKürzungen
Tabellen 42a–42b,Seiten A50–A51
falsche Flächenangaben,falsche Tierbestandesangaben,andere Elemente (falsche Angaben ÖLN, weniger als 50% betriebseigene Arbeitskräfte,nicht rechtzeitige An-/Abmeldung eines Programmes,Kontrollen erschwert),falsche Angaben zum Betrieb oder Bewirtschafter,falsche Angaben zur Sömmerung. keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
■ Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz
In witterungs- und standortbedingten Spezialfällen wird,um die Kultur zu schützen, der Einsatz im ÖLN nicht erlaubter Pflanzenschutzmittel oder Behandlungsarten zugelassen.Deshalb können die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen,gestützt auf Anhang 6.4 der Direktzahlungsverordnung,Sonderbewilligungen ausstellen.Im Jahr 2004 gab es für 8’721 ha LN 3‘416 Sonderbewilligungen.Am häufigsten bewilligt wurde analog zu den Vorjahren die Behandlung von Verunkrautung in Naturwiesen. Dabei ging es vor allem um die Bekämpfung von Blacken (Ampfer) und Hahnenfuss.
Erteilte Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz 2004
Bekämpfungsmittel BewilligungenFläche
Anzahl% allerha% der BetriebeBetriebetotalen Fläche
Vorauflauf-Herbizide203694210,8
Insektizide94927,83 47739,9
Mais-Granulate601,82683,1
Rüben-Granulate3159,21 01511,6
Wiesen-Herbizide1 56545,82 60829,9
Andere3249,54114,7
Total3 4161008 721100
Quelle:BLW
2.2.2
Allgemeine Direktzahlungen
Flächenbeiträge
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Schutz und Pflege der Kulturlandschaft,Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab.Die Flächenbeiträge werden seit dem Jahr 2001 mit einem Zusatzbeitrag für das offene Ackerland und die Dauerkulturen ergänzt.
Ansätze 2004Fr./ha 1
– bis 30 ha 1 200
– 30 bis 60 ha900
– 60 bis 90 ha600
– über 90 ha 0
1Der Zusatzbeitrag für offenes Ackerland und Dauerkulturen beträgt 400 Fr.pro ha und Jahr;auch er unterliegt der Flächenabstufung
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25%.Insgesamt handelt es sich um rund 5’000 ha,welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden.Schweizer Betriebe,die heute Flächen im der ausländischen Wirtschaftszone zukaufen oder pachten,erhalten für diese Flächen keine Direktzahlungen.
Flächenbeiträge 2004 (inkl.Zusatzbeitrag)
Der Zusatzbeitrag wurde für insgesamt 270’936 ha offenes Ackerland und 18'217 ha Dauerkulturen ausgerichtet.
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen 2004
Von der Beitragsdegression betroffen sind 9,2% der LN.Im Durchschnitt wird pro ha ein Flächenbeitrag von 1'281 Fr.ausbezahlt (inkl.Zusatzbeitrag).Die Betriebe mit einer Fläche bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 9,3% der gesamten LN.Eine Betriebsgrösse von mehr als 60 ha weisen lediglich 1,1% aller Betriebe aus;sie bewirtschaften 5,1% der gesamten LN.

■ Flächennutzung mit Grünland
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere
Die Massnahme hat zum Ziel,die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig die Flächen im Grasland Schweiz durch die Nutzung zu pflegen.
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere,die während der Winterfütterung (Referenzperiode:1.Januar bis Stichtag des Beitragsjahrs) auf einem Betrieb gehalten werden.Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe,Ziegen,Bisons,Hirsche, Lamas und Alpakas.Die Beiträge werden in Abhängigkeit der vorhandenen Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt.Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE) und sind je ha begrenzt. Die Begrenzung ist abgestuft nach Zonen.

Die RGVE sind in zwei Beitragsgruppen aufgeteilt.Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung,Bisons,Milchziegen und Milchschafe werden 900 Fr.,für die übrigen Ziegen und Schafe,sowie Hirsche,Lamas und Alpakas 400 Fr.je RGVE ausgezahlt.
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2004
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion
Zu Beiträgen berechtigende
RGVEAnzahl93 27885 951158 268337 497
BetriebeAnzahl10 33310 82615 68236 841
Zu Beiträgen berechtigende
RGVE pro BetriebAnzahl9,07,910,19,2
Beiträge pro BetriebFr.7 7276 7888 4677 766 Total Beiträge1 000 Fr.79 84873 487132 785286 120
Bei den Verkehrsmilchproduzenten wurde im Jahr 2004 pro 4‘400 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE vom beitragsberechtigten Bestand in Abzug gebracht.Die Beitragssumme ist gegenüber dem Vorjahr um ca.1,6 Mio.Fr.tiefer ausgefallen.
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2004
MerkmalEinheitBetriebe mit Betriebe ohne vermarkteter vermarktete MilchMilch
BetriebeAnzahl18 60518 236
Tiere pro BetriebRGVE23.612,9 Abzug aufgrund Beitragsbegrenzung der GrünflächeRGVE1,11,2 MilchabzugRGVE15,90,0
Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE6,611,8 Beiträge pro BetriebFr.5 8099 763
Quelle:BLW
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar rund 3'950 Fr.weniger RGVEBeiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch.Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z.B.Zulage für verkäste Milch).
■ Abgeltung der Produktionserschwernisse
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen.Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere,bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung),werden bei dieser Massnahme auch soziale,strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt.Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere.Die Beiträge werden für höchstens 20 RGVE je Betrieb ausgerichtet.
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 2004
Gegenüber dem Vorjahr haben die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen infolge des laufenden Strukturwandels um rund 3,3 Mio.Fr. abgenommen.Dementsprechend verzeichnen die zu Beiträgen berechtigenden RGVE eine Abnahme um 2’829 Einheiten.Weiter zurückgegangen ist die Betriebszahl,und zwar um 181 Einheiten.
Verteilung der Raufutter verzehrenden Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen nach Grössenklassen 2004
Im Beitragsjahr 2004 standen rund 64% der RGVE in beitragsberechtigten Betrieben, die von der Limite betroffen sind.Bei diesen Betrieben betrug der Anteil der RGVE ohne Beitrag 34%.
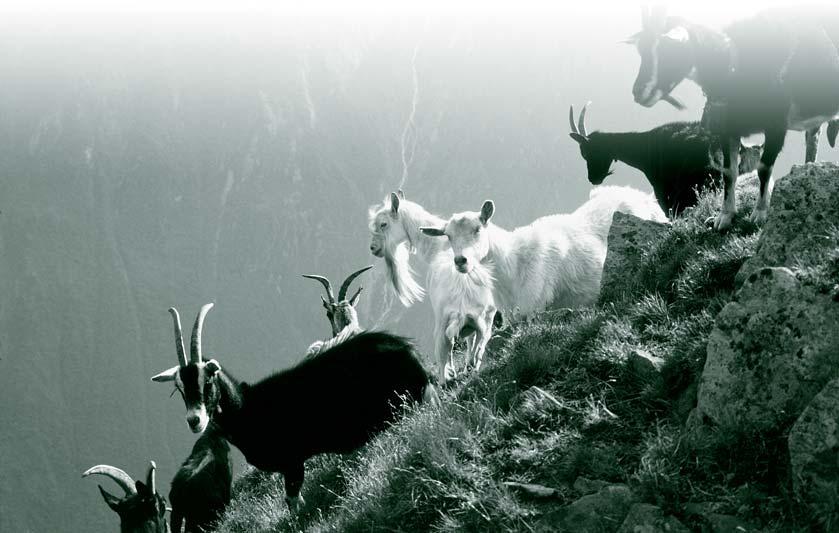
■ Allgemeine Hangbeiträge:Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Hangbeiträge
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion abgegolten.Sie werden nur für Wies-,Streuund Ackerland ausgerichtet.Wiesen müssen jährlich mindestens einmal,Streueflächen alle ein bis drei Jahre geschnitten werden.Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt.
Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert leicht von Jahr zu Jahr.Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab,die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben.
■ Hangbeiträge für Rebflächen:Zur Erhaltung der Rebflächen in Steilund Terrassenlagen
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei,Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten.Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden,wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden.Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden nur für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet.Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig.
Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2004
Der Anteil der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 29% und der Anteil Betriebe gemessen an der Gesamtzahl aller Rebbaubetriebe 52%.

2.2.3Ökologische Direktzahlungen

Ökobeiträge
Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab,deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen.Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten,bei denen sie freiwillig mitmachen können.Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig;die Beiträge können kumuliert werden.
Ökologischer Ausgleich
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert werden.Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei.Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich beim ÖLN angerechnet werden.Daneben gibt es Elemente,die nur für den ökologischen Ausgleich beim ÖLN anrechenbar sind,nicht aber mit Beiträgen abgegolten werden.
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Beim ÖLN anrechenbare Elemente Beim ÖLN anrechenbare Elemente mit Beiträgen ohne Beiträge
extensiv genutzte Wiesenextensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte WiesenWaldweiden
Streueflächeneinheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen
Hecken,Feld- und UfergehölzeWassergräben,Tümpel,Teiche BuntbrachenRuderalflächen,Steinhaufen und -wälle RotationsbrachenTrockenmauern
Ackerschonstreifenunbefestigte natürliche Wege Hochstamm-FeldobstbäumeRebflächen mit hoher Artenvielfalt
weitere,von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN
Die Flächen dürfen nicht gedüngt und während mindestens sechs Jahren in Abhängigkeit zur Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt werden.Das späte Mähen soll gewährleisten,dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird.So bleibt auch zahlreichen wirbellosen Tieren,bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion.Der Anteil an extensiven Wiesen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Die Ansätze je ha für extensiv genutzte Wiesen,Streueflächen,Hecken,Feld- und Ufergehölze sind einheitlich und richten sich nach der Zone,in der sich die Fläche befindet.
■ Hecken,Feld- und Ufergehölze
Beiträge für extensiv genutzte Wiesen 2004
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten,welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden.
Beiträge für Streueflächen 2004
Als Hecken,Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-,Hoch- oder Baumhecken,Windschutzstreifen,Baumgruppen,bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze. Die Flächen müssen während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet werden und sachgerecht gepflegt werden.
Beiträge für Hecken,Feld- und Ufergehölze 2004
■ Wenig intensiv genutzte Wiesen
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden.
Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen 2004
Als Buntbrachen gelten mehrjährige,mit einheimischen Wildkräutern angesäte,ungedüngte Streifen von mindestens 3 m Breite.Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter.In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung.Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung.Für Buntbrachen werden pro ha 3'000 Fr.ausgerichtet.Die Beiträge gelten für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone.

■ Rotationsbrachen
Beiträge für Buntbrachen 2004
Die Buntbrache ist im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Getreidemarktes eine wirtschaftlich interessante Alternative zu den Ackerkulturen geworden.
Als Rotationsbrachen gelten ungedüngte ein- bis zweijährige,mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen,die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen.In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel,Hasen und Insekten Lebensraum.In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich. Für die Rotationsbrachen werden in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone pro ha 2'500 Fr.ausgerichtet.
Beiträge für Rotationsbrachen 2004
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben.Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen wie Getreide,Raps,Sonnenblumen,Eiweisserbsen,Ackerbohnen und Soja,nicht jedoch Mais.Im Jahr 2004 wurden pro ha 1’500 Fr.bezahlt. Beiträge gibt es nur für Flächen in der Tal- und Hügelzone.
Beiträge für Ackerschonstreifen 2004
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1
BetriebeAnzahl98180116
Flächeha305035
Fläche pro Betriebha0,310,290,000,30
Beitrag pro BetriebFr.4604380457
Beiträge1 000 Fr.458053
Beiträge 20031 000 Fr.389046
1Hier handelt es sich um Betriebe,die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften Quelle:BLW
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume,die nicht in einer Obstanlage stehen,sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven. Im Jahr 2004 wurden pro angemeldeten Baum 15 Fr.ausgerichtet.
Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume 2004
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 2004
Verteilung der ökologischen Ausgleichflächen nach Regionen 2004

Öko-Qualitätsverordnung
Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern,unterstützt der Bund auf der LN ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen mit Finanzhilfen.Die Anforderungen, welche die Flächen für die Beitragsberechtigung gemäss der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) erfüllen müssen,werden durch die Kantone festgelegt.Der Bund überprüft die kantonalen Vorgaben auf Grund von Mindestanforderungen.Entsprechen die kantonalen Anforderungen den Mindestanforderungen des Bundes und ist die regionale Mitfinanzierung gewährleistet,so leistet der Bund Finanzhilfen an die von den Kantonen an die Landwirte ausgerichteten Beiträge.Die Finanzhilfen des Bundes bewegen sich je nach Finanzkraft der Kantone zwischen 70 und 90% der anrechenbaren Beiträge.Die restlichen 10–30% müssen durch Dritte (Kanton,Gemeinde, Private,Trägerschaften) übernommen werden.Beiträge für die biologische Qualität und die Vernetzung sind kumulierbar.Die Verordnung beruht auf Freiwilligkeit,finanziellen Anreizen und der Berücksichtigung regionaler Unterschiede bezüglich der Biodiversität.
Anrechenbare Ansätze
Ansätze 2004Fr.
– für die biologische Qualität500.–/ha
– für die biologische Qualität der Hochstamm-Feldobstbäume20.–/Baum
– für die Vernetzung500.–/ha
Eine ökologische Ausgleichsfläche trägt vor allem dann zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei,wenn sie bestimmte Zeigerarten und Strukturmerkmale ausweist und/oder an einem ökologisch sinnvollen Standort liegt.Während sich der Bewirtschafter einer ökologischen Ausgleichsfläche für die biologische Qualität direkt anmelden kann,braucht es für die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen ein Konzept,das mindestens eine landschaftlich und ökologisch begründbare Einheit abdeckt.
Beiträge gemäss Öko-Qualitätsverordnung 2004
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2004
Ökologische Ausgleichsflächen mit Qualität (inklusive Hochstammbäume)
Ökologische Ausgleichsflächen mit Vernetzung (inklusive Hochstammbäume)
Extensive Produktion von Getreide und Raps
Diese Massnahme hat zum Ziel,den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren,Fungizide,chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide zu fördern.Im Jahr 2004 wurden pro ha 400 Fr.ausgerichtet.
Extensive Produktion von Getreide und Raps 2004
Biologischer Landbau
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform.Um Beiträge zu erhalten,müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der Bio-Verordnung erfüllen.
Beim biologischen Landbau wird auf chemisch-synthetisch hergestellte Hilfsstoffe,wie Handelsdünger oder Pestizide,gänzlich verzichtet.Dies spart Energie und schont Wasser,Luft und Boden.Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig,die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen.Biobauern benötigen zwar mehr Energie für Infrastruktur und Maschinen.Gesamthaft erreicht der Biolandbau aber eine höhere Effizienz in der Nutzung der vorhandenen Ressourcen.Dies ist ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit des Produktionssystems.
Der Verzicht auf Herbizide fördert die Entwicklung zahlreicher Beikrautarten.Wo eine vielfältige Flora vorhanden ist,finden auch mehr Kleinlebewesen Nahrung.Dies wiederum verbessert die Ernährung der räuberisch lebenden Gliedertiere,wie der Laufkäfer,und damit die Voraussetzungen für eine natürliche Bekämpfung von Schädlingen.Zahlreicher vorkommende Pflanzen,Tiere und Mikroorganismen machen das Ökosystem robuster gegen Störungen und Stress.
Durch die organische Düngung,die schonende Bodenbearbeitung und den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel fördert der Biobauer eine grosse Menge und Vielfalt an Bodenorganismen.Die Bodenfruchtbarkeit wird durch die biologische Aktivität gefördert.Es wird Humus angereichert,die Bodenstruktur verbessert und die Bodenerosion vermindert.
Um eine optimale Abstimmung von Pflanzen,Boden,Tier und Mensch im Betrieb zu erreichen,strebt der Biobauer die Schliessung der Nährstoffkreisläufe auf dem Betrieb an.Erreicht wird dies durch die Bindung der Tierhaltung an die betriebseigene Futtergrundlage.Der Anbau von Leguminosen verbessert das Stickstoffangebot im Boden. Hofdünger und organisches Material aus Gründüngungen und Ernterückständen stellen über die Ernährung der Bodenlebewesen eine ausgewogene Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen sicher.
In der Nutztierhaltung müssen die RAUS-Anforderungen erfüllt sein.Sie bilden die Minimalanforderungen für die Tierhaltung im Biolandbau.Als weitere Massnahmen sind elektrisierende Steuerungseinrichtungen (Viehtrainer) und der Einsatz von Medizinalfutter verboten.Die Verwendung von grösstenteils betriebseigenem Futter soll eine angemessene Leistung und eine gute Gesundheit der Tiere sicherstellen. Natürliche Heilmethoden kommen im Bedarfsfall vorrangig zur Anwendung.
Im Jahr 2004 umfasste der biologische Landbau 10,3% der gesamten LN.
Beiträge für den biologischen Landbau 2004
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche nach Region 2004

■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
Besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere
Unter diesem Titel werden die beiden im Folgenden beschriebenen Programme BTS und RAUS zusammengefasst (vgl.auch Abschnitt 1.3.2).
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen,welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen.
Ansätze 2004Fr./GVE
– Tiere der Rindergattung ohne Kälber,Ziegen,Kaninchen 90 – Schweine155
– Legehennen,Junghennen und -hähne,Zuchthennen und -hähne,Küken280
– Mastpoulets und Truten180
Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 2004
■ Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren,auf einer Weide oder in einem Laufhof bzw.in einem Aussenklimabereich,der den Bedürfnissen der Tiere entspricht.
Ansätze 2004Fr./GVE
– Tiere der Rinder- und Pferdegattung,Bisons,Schafe,Ziegen, Dam- und Rothirsche sowie Kaninchen180
– Schweine155
– Geflügel 280
Beiträge für den regelmässigen Auslauf im Freien 2004

Sömmerungsbeiträge
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege der ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden. Das Sömmerungsgebiet wird mit rund 300'000 GVE genutzt und gepflegt.Der Viehbesatz wird nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Nutzung festgelegt.Man spricht dabei vom sogenannten Normalbesatz.Ausgehend vom Normalbesatz werden die Beiträge nach Normalstoss (NST) ausgerichtet.Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen.
Ansätze 2004Fr.
–Für gemolkene Kühe,Milchziegen und Milchschafe pro GVE (56–100 Tage Sömmerung)300
–Für Schafe ohne Milchschafe pro NST
– bei ständiger Behirtung300
– bei Umtriebsweide220 – bei übrigen Weiden120
–Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 300
2004
1Bei dieser Zahl handelt es sich um das Total der beitragsberechtigten Sömmerungsbetriebe (ohne Doppelzählungen) Quelle:BLW
Seit dem Beitragsjahr 2003 werden differenzierte Sömmerungsbeiträge für Schafe (ohne Milchschafe) nach Weidesystem ausgerichtet.Mit den höheren Beiträgen für die ständige Behirtung und Umtriebsweide werden einerseits die höheren Kosten abgegolten,andererseits wird,in Analogie zu den Ökobeiträgen,der Anreiz für eine nachhaltige Schafalpung erhöht.Eine ständige Behirtung bedeutet,dass die Herdenführung durch einen Hirten mit Hunden erfolgt und die Herde täglich auf einen vom Hirten ausgewählten Weideplatz geführt wird.Bei einer Umtriebsweide hat die Beweidung während der ganzen Sömmerung abwechslungsweise in verschiedenen Koppeln zu erfolgen,die eingezäunt oder natürlich klar abgegrenzt sind.
■ Nachhaltige Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete
Schafsömmerung nach Weidesystem 2004
Entwicklung der Sömmerung 2000–2004:

Beiträge für den Gewässerschutz
Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes ermöglicht dem Bund,Massnahmen der Landwirte zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in ober- und unterirdische Gewässer abzugelten.Das Schwergewicht wird auf die Verminderung der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen gelegt,in denen der ÖLN,der Biolandbau,Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso,ökologischer Ausgleich) nicht genügen.Neu wurde auch ein Pilotprojekt im Kanton Waadt zur Verminderung von Pestizidbelastungen ausgearbeitet.
Gemäss der Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet,für ober- und unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen.Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen für die Betriebe mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und 50% für Bewirtschaftungsmassnahmen.Im Jahr 2004 wurden rund 5,5 Mio.Fr.ausbezahlt.
Überblick über die Projekte 2004
■ Abschwemmungen und Auswaschung von Stoffen verhindern
2.3Grundlagenverbesserung
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion sowie die Erfüllung der multifunktionalen Aufgaben.
Finanzhilfen für die Grundlagenverbesserung
MassnahmeRechnung Rechnung Budget 200320042005
Mio.Fr.
Beiträge Strukturverbesserungen102 1 9591
Investitionskredite797670
Betriebshilfe12915
Umschulungsbeihilfen--3 Beratungswesen und Forschungsbeiträge242424
Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge423
Pflanzen- und Tierzucht222223
Total242228229
1 inkl.Nachtragskredit Unwetter (7 Mio.Fr.)
Quelle:BLW
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt:
– Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Produktionskosten;
– Förderung des ländlichen Raums;
– Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen;
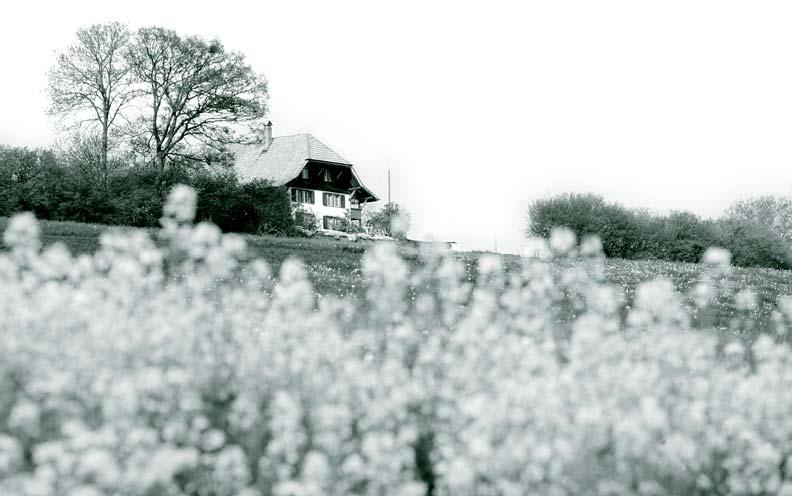
– Effiziente und umweltgerechte Produktion;
– Ertragreiche,möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte;
– Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt;
– Genetische Vielfalt.
■ Erste Erfahrungen aus der AP 2007
2.3.1 Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert.Dies betrifft insbesondere das Berggebiet und die Randregionen.
Investitionshilfen werden für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.Es stehen zwei Instrumente zur Verfügung:
–Beiträge (à-fonds-perdu) mit Beteiligung der Kantone,vorwiegend für gemeinschaftliche Massnahmen;
–Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen,vorwiegend für einzelbetriebliche Massnahmen.
Investitionshilfen unterstützen die landwirtschaftlichen Infrastrukturen und ermöglichen somit die Anpassung der Betriebe an die sich ändernden Rahmenbedingungen. Die Produktionskosten sollen gesenkt,die Ökologisierung gefördert und damit die Wettbewerbsfähigkeit einer nachhaltig produzierenden Landwirtschaft gestärkt werden. Auch in anderen Ländern,insbesondere in der EU,zählen die Investitionshilfen zu den wichtigsten Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raums.
Die Erfahrungen mit den Gesetzesbestimmungen der AP 2002 und den Anpassungen in der AP 2007 sind im Bereich der Strukturverbesserungen überwiegend positiv.Bei den einzelbetrieblichen Massnahmen brachte der Wechsel von der Einkommensverteilung (Verhältnis Landwirtschaft zu Nebenerwerb) zur minimal erforderlichen standardisierten Arbeitkraft (SAK) als Eintretenskriterium sowie die Einführung der Unterstützungsmöglichkeit der Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich eine erhöhte Flexibilität.Die neuen Unterstützungsmöglichkeiten für die periodische Wiederinstandstellung von Bodenverbesserungen, für gemeinschaftliche Bauten zur Vermarktung in der Region erzeugter Produkte und für die Gewährung von Starthilfedarlehen zur Gründung bäuerlicher Selbsthilfeorganisationen brachten zusätzliche Erleichterungen und Entwicklungsmöglichkeiten für die bäuerlichen Betriebe.
Projekte zur regionalen Entwicklung und zur Förderung von einheimischen und regionalen Produkten,an denen die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt ist,können gemäss LwG seit 2004 mit Beiträgen gefördert werden.Damit sollen die regionale Ausrichtung der Agrarpolitik und der Beitrag der Landwirtschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums verstärkt werden.Im Hinblick auf die Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen wurden 2004 zwei Forschungsarbeiten in Auftrag gegeben und abgeschlossen sowie zwei Pilotprojekte in den Kantonen Tessin (Brontallo) und Wallis (St.Martin) gestartet (vgl.Ausführungen auf den Seiten 191 bis 194).
■ Finanzielle Mittel für Beiträge
Für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten standen im Jahr 2004 Beiträge im Umfang von 98,5 Mio.Fr.zur Verfügung.Das BLW genehmigte neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 83,5 Mio.Fr.Damit wurde ein Investitionsvolumen von 373 Mio.Fr.ausgelöst.Die Summe der Bundesbeiträge an die genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen»,da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird.
Genehmigte Beiträge des Bundes 2004
Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
Wegebauten
Wasserversorgungen
Unwetterschäden und andere Tiefbaumassnahmen
Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere andere Hochbaumassnahmen
Der Bund setzte im Jahr 2004 7% weniger finanzielle Mittel in Form von Beiträgen ein als im Vorjahr.Diese Abnahme ist zu einem grossen Teil auf die Bewältigung der Unwetterschäden 2002 zurückzuführen.Das Parlament hat dazu im Jahr 2003 einen Nachtragskredit im Umfang von 7 Mio.Fr.bewilligt.2004 betrug die Auszahlung von Beiträgen an laufende und abgeschlossene Projekte 95 Mio.Fr.
Ausbezahlte Beiträge des Bundes an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten 1994–2004
Im Jahre 2004 bewilligten die Kantone für 2’159 Fälle Investitionskredite von insgesamt 301,2 Mio.Fr.Von diesem Kreditvolumen entfallen 86,2% auf einzelbetriebliche und 8,8% auf gemeinschaftliche Massnahmen.Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite,so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren,gewährt werden.
Investitionskredite 2004
BestimmungFälleBetragAnteil AnzahlMio.Fr.%
Einzelbetriebliche Massnahmen1 978259,786,2 Gemeinschaftliche Massnahmen,ohne Baukredite14326,38,8 Baukredite3815,25,0
Total2 159301,2100
Quelle:BLW
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden hauptsächlich als Starthilfe sowie für den Neu- oder Umbau von landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomiegebäuden eingesetzt.Sie werden in durchschnittlich 14 Jahren zurückbezahlt.Auf die neue Massnahme Diversifizierung entfallen 20 Fälle mit einem Kreditvolumen von 2,1 Mio.Fr.
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen und bauliche Massnahmen (Bauten und Einrichtungen für die Milchwirtschaft sowie für die Verarbeitung und die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte) unterstützt.
Im seit 1963 geäufneten Fonds de roulement wurde die Grenze von 2 Mrd.Fr.überschritten.Im Jahre 2004 wurden den Kantonen neue Bundesmittel von 76,5 Mio.Fr. zugeteilt.Diese werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt.
Investitionskredite 2004 nach Massnahmenkategorie, ohne Baukredite

■ Betriebshilfe
Soziale Begleitmassnahmen
Die Betriebshilfe wird in Form von zinslosen Darlehen gewährt und dient dazu,eine vorübergehende,unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben. In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen indirekten Entschuldung.
Im Jahr 2004 wurden in 371 Fällen insgesamt 31,2 Mio.Fr.Betriebshilfedarlehen ausbezahlt.Das durchschnittliche Darlehen betrug 84'030 Fr.,die Rückzahlungsdauer betrug im Mittel 10 Jahre.
162 Fälle mit insgesamt 4'237'000 Fr.betreffen zinslose Darlehen basierend auf der Verordnung vom 5.November 2003 über Massnahmen in der Landwirtschaft auf Grund der Trockenheit im Jahr 2003 (Trockenheitsverordnung).Diese Massnahmen waren bis zum 31.Dezember 2004 befristet.
Betriebshilfedarlehen 2004
Umfinanzierung bestehender Schulden15221,9 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung575,1 Trockenheitsbedingte Betriebshilfedarlehen1624,2
Total37131,2
Quelle:BLW
Der seit 1963 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufnete Fonds de roulement beträgt zusammen mit den Kantonsanteilen rund 202,2 Mio.Fr.Im Jahr 2004 wurden den Kantonen 8,814 Mio.Fr.neu zur Verfügung gestellt.Diese sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden,die je nach Finanzkraft 20 bis 80% des Bundesanteils beträgt.Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt.
■ Umschulungsbeihilfen
Die Umschulungsbeihilfe ist eine neue soziale Begleitmassnahme und erleichtert ab 2004 für selbständig in der Landwirtschaft tätige Personen den Wechsel in einen nichtlandwirtschaftlichen Beruf.Sie beinhaltet Beiträge an Umschulungskosten und Lebenskostenbeiträge für Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter,die das 52.Altersjahr noch nicht beendet haben.Die Gewährung einer Umschulungsbeihilfe setzt die Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs voraus.Im Berichtsjahr wurden für vier Fälle Beiträge im Umfang von 401'400 Fr.zugesichert.Die Umschulungsdauer beträgt,je nach Ausbildung,ein bis drei Jahre.In allen vier Fällen wird der Betrieb längerfristig verpachtet. Die erste Teilauszahlung der 2004 zugesicherten Beiträge wurde 2005 getätigt.
■ Neue Gesetzesbestimmung mit AP 2007
Projekte zur regionalen Entwicklung und zur Förderung von einheimischen Produkten
Das Parlament hat in den Beratungen zur Agrarpolitik 2007 eine neue Gesetzesbasis beschlossen,welche eine «Unterstützung von Projekten zur regionalen Entwicklung und zur Förderung von einheimischen und regionalen Produkten» ermöglicht (Art.93 Abs.1 Bst.c LwG).Damit soll die regionale Ausrichtung der Agrarpolitik und der Beitrag der Landwirtschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums verstärkt werden. Als Einschränkung gilt,dass «die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt ist».Die Unterstützung bedingt eine Co-Finanzierung zwischen Bund und Kantonen,da der 5.Titel des LwG (Strukturverbesserungen) auch mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) eine Verbundaufgabe bleibt.
Die neue Gesetzesbestimmung wurde unter den Strukturverbesserungen eingegliedert,weist aber auch Berührungspunkte zu bestehenden Förderinstrumenten auf, namentlich zur regionalen Absatzförderung (Art.12 LwG),zu regional ausgerichteten Ökomassnahmen sowie zur Regionalpolitik.Um die offenen Fragen betreffend die Abstimmung dieser Förderbereiche zu klären,wurden im Hinblick auf die Umsetzung auf Stufe Verordnung verschiedene Aktivitäten lanciert.
Zusammen mit dem für die Regionalpolitik zuständigen Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) und dem Amt für Landwirtschaft,Vermessung und Strukturverbesserungen des Kantons Graubünden hat das BLW eine «Regionsanalyse» und eine «Bedürfnisanalyse» in Auftrag gegeben.Die Forschungsarbeiten wurden Ende 2004 abgeschlossen und sind auf der Homepage des BLW (Rubrik News > Studien und Evaluationen, www.blw.admin.ch/news/publikationen) einsehbar.

■ Regionsanalyse
BHP Hanser und Partner hat in der Regionsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Institut für Agrarwirtschaft (IAW) der ETH Zürich die branchenübergreifenden Verknüpfungen und die Entwicklungspotenziale von peripheren Regionen am Beispiel des Bleniotals im Kanton Tessin untersucht.Aus der Analyse leiten die Autoren der Studie sieben Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Art.93 Abs.1 Bst.c LwG ab:
■ Bedürfnisanalyse
Markt: Die Projekte müssen mittel- bis langfristig selbst tragfähig sein;Marktchancen müssen ins Zentrum gerückt werden.
Anschubfinanzierung: Keine Dauerfinanzierung von der öffentlichen Hand;die Mittel sind für eine «Initialzündung» zu verwenden.
Branchenübergreifende Strukturen: Synergien müssen genutzt werden.
Diversifizierung: Das Angebot (Produkte und Dienstleistungen) muss überregional abgestimmt werden.
Know-how: Häufig sind Projektideen vorhanden;der Engpass besteht aber in der Konkretisierung des Projektes.
Umsetzung: Die erfolgreiche Umsetzung steht im Zentrum.
Trägerschaft: Für die Projekte ist eine lokale Trägerschaft notwendig.
In der Bedürfnisanalyse wurden laufende und abgeschlossene Gesamtmeliorationen im Unterengadin und im Val Müstair des Kantons Graubünden untersucht mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Region zu erfassen.Die Untersuchungen wurden durch eine Arbeitsgemeinschaft unter Führung des Beratungsbüros emac und Mitarbeit des Ingenieurbüros Kindschi und des IAW der ETH Zürich durchgeführt.Zur regionalen Abstützung diente eine lokal verankerte Begleitgruppe.
Als Synthese aus den Analysen schlagen die Autoren der Bedürfnisanalyse ein Zielbeurteilungsverfahren vor,das die Überprüfung erlaubt,inwieweit konkrete Projektziele den regionalen Entwicklungszielen entsprechen bzw.mit diesen gekoppelt werden können.Diese Konformitätsprüfung beruht auf der Idee einer Zielmatrix,indem die Projektziele den allgemeinen Regionalzielen gegenübergestellt und die Zielkombinationen nach verschiedenen Kriterien (Zielunterstützung,Zielkonflikt,räumliche und sachliche Wirkungsbereiche,beeinflussbare Systemvariablen) beurteilt werden. Voraussetzung ist,dass eine Region ihre Ziele für eine zukünftige Entwicklung in Form eines Zielsystems definiert hat.Dieses sollte gemäss dem Prinzip der Nachhaltigkeit in wirtschaftliche,soziale und umweltrelevante Ziele hierarchisch und thematisch gegliedert sein.Gleiches gilt für die Definition der Projektziele.

■ Empfehlungen aus den Analysen
Die Regionsanalyse brachte klar zu Tage,dass es in den Regionen primär an Know-how fehlt,um ein Projekt umsetzungsreif zu konkretisieren.Dazu dient ein fundierter Businessplan mit der Darlegung von Produktideen,Marktchancen,betriebswirtschaftlichen Analysen,Finanzierungsmöglichkeiten etc.Die Autoren schlagen vor,die Weiterentwicklung von Projektideen zu fördern,indem ein Coaching angeboten wird. Akteure aus peripheren Regionen sollen eine Projektidee einreichen,diese überprüfen lassen und ein Coaching beantragen können.Die professionelle Begleitung der Projektentwicklung soll dazu beitragen,dass die Akteure in der Lage sind,die nötigen Vorabklärungen für die Umsetzung der Projektidee voranzutreiben.Im Anschluss an die zeitlich befristete Begleitung soll ein Fachgremium den Businessplan überprüfen und ein Qualitätsattest ausstellen,das für die Projektqualität und den Businessplan bürgt und als Ausweis für allfällige Kapitalgeber dienen kann.
Die Autoren der Bedürfnisanalyse leiten aus den Untersuchungen folgende Empfehlungen ab:
–Die Anwendungsmöglichkeiten für Art.93 Abs.1 Bst.c LwG müssen sich auf klare Entscheidungs- und Beurteilungskriterien stützen.Wichtig ist,dass das «BottomUp» Prinzip beibehalten wird und ein Abgleich mit den Zielen der Regionalentwicklung erfolgt.
–Für die formelle Umsetzung werden verschiedene Ergänzungen in der Strukturverbesserungsverordnung vorgeschlagen.Die Ausführungsbestimmungen sollen möglichst eng auf die Absatzförderung abgestimmt werden.Das vorgeschlagene Ablauf- und Entscheidungsschema erlaubt,zukünftige Beitragsgesuche zum neuen Gesetzesartikel auf Grund verschiedener Kriterien zu beurteilen.Dabei sollen Synergien zwischen bisherigen Instrumenten der Strukturverbesserungen (Art.93 LwG) und der Absatzförderung (Art.12 LwG) genutzt werden.
–Das Instrument der integralen Meliorationen weist bereits in der heutigen Form eine grosse Wirkung für die Regionalentwicklung auf.Diese Stärke ist gezielt auszunutzen und auszubauen.Das Pflichtenheft einer integralen Melioration könnte beispielsweise mit einer Marktanalyse (als Bestandteil der landwirtschaftlichen Planung) ergänzt werden.
■ Pilotprojekte Brontallo TI und St.Martin VS
Neben den Forschungsarbeiten hat das BLW in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden und Kantonen Pilotprojekte im Tessin (Brontallo,Lavizzara) und im Wallis (St.Martin,Val d’Hérens) gestartet,um auch praxisorientierte Erfahrungen sammeln zu können.Die zentrale Zielsetzung beider Pilotprojekte besteht in der Schaffung von Wertschöpfung in der Landwirtschaft,indem das agrotouristische Angebot und die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte ausgebaut werden.Flankierend sollen ökologische Anliegen wie die Aufwertung und Pflege der Kulturlandschaft, Vernetzungen und die Förderung der Artenvielfalt realisiert sowie ländliches Kulturgut erhalten werden.Die für die Umsetzung der Ziele notwendigen Massnahmen sind konzeptionell aufeinander abgestimmt und in einer Programmvereinbarung zwischen Bund und Kanton gebündelt,welche im Jahr 2004 unterzeichnet werden konnte.Bei der Umsetzung wird das Controlling eine wichtige Rolle einnehmen.Durch den Bund und den Kanton sollen jährliche Zwischenevaluationen vorgenommen werden.Nach Ablauf der Programmdauer von vier Jahren wird eine Schlussevaluation erfolgen.
■ Ausführungsbestimmungen
Die Erkenntnisse aus den Forschungsarbeiten und den Pilotprojekten bilden die Basis für die Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen zu Art.93 Abs.1 Bst.c LwG.Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des laufenden Reformprozesses zur Agrarpolitik 2011 und wird Anpassungen in der Strukturverbesserungsverordnung bedingen.Dabei werden verschiedene Anforderungen und Bedingungen festzulegen sein,insbesondere betreffend lokale Initiative,vorwiegend landwirtschaftliche Beteiligung,Wertschöpfungspotenzial,Wirtschaftlichkeit nach Abschluss der öffentlichen Unterstützung,Abstimmung und Koordination mit der Regionalentwicklung und integrales Konzept der Massnahmen.
Parallel zur Umsetzung von Art.93 Abs.1 Bst.c LwG wird im Rahmen der Agrarpolitik 2011 auch der Vorschlag aus der Regionsanalyse aufgegriffen und konkretisiert: abgestützt auf die Rechtsbestimmungen der landwirtschaftlichen Beratung soll die Projektentwicklung bereits in der Phase der Vorabklärungen mit einem finanziellen Beitrag an eine professionelle fachliche Begleitung (Coaching) unterstützt werden können.Die Hilfe soll allen gemeinschaftlichen Projektinitiativen mit landwirtschaftlicher Beteiligung und regionaler Ausstrahlung offen stehen.Damit soll ein Anreiz geschaffen werden,dass die Markt- und Realisierungschancen in einer frühen Phase kompetent und vertieft abgeklärt sowie sämtliche Potenziale einer Region im Rahmen integrierter Projekte ausgelotet und gebündelt werden.
■ Schmerzhafte Konsequenzen
2.3.2 Forschung,Gestüt,Beratung,Berufsbildung,CIEA
Landwirtschaftliche Forschung
Das Budget 2004 der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten (Agroscope) belief sich netto auf rund 110 Mio.Fr.Als Folge des Entlastungsprogramms und der Aufgabenverzichtsplanung des Bundes muss Agroscope ab 2008 im Vergleich zu 2004 rund 12 Mio.Fr.einsparen.Aus diesem Grund ist Agroscope gezwungen,bis 2008 über 100 Stellen abzubauen.Auf Entlassungen soll wenn möglich verzichtet werden.Wegen den Sparmassnahmen baut Agroscope bisher erbrachte Leistungen ab.
Die Forschungsanstalten vermindern ihre Ausgaben seit Jahren.Bisher gelang es,mit strukturellen Änderungen und Effizienzsteigerungen Kostensenkungen zu erreichen. Schmerzhaft ist nun die Reduktion von über 100 Arbeitsstellen.Wegen der Budgetkürzungen gibt Agroscope bisher erbrachte Leistungen und Tätigkeiten auf,reduziert sie oder gibt sie an Dritte weiter.Die Forschungsanstalten können nicht mehr alle von ihren Kunden erwarteten Leistungen erbringen.Mit dem Stellen- und Leistungsabbau verlieren die Forschungsanstalten an Erfahrung und Wissen.Für junge Akademiker sinken die Chancen für den Einstieg in die Forschung.Trotz den Einsparungen will Agroscope weiterhin erstklassige Forschung gewährleisten.
Der laufende Fusionsprozess – drei statt sechs Forschungsanstalten – wurde bereits durch Budgetkürzungen ausgelöst.Agroscope optimiert die Abläufe.In der Forschung werden Bereiche an einem Standort zusammengefasst und Arbeitsstellen teilweise nicht mehr besetzt.Die Fusionen leisten ihren Teil zu den geforderten Einsparungen.
■ Auf GVO-Züchtungen verzichten
Künftig verzichtet Agroscope auf die Entwicklung von gentechnisch veränderten Pflanzen (GVO).Agroscope will jedoch weiterhin Beiträge in der Risikoforschung und der Technologiefolgen-Abschätzung leisten.Agroscope reduziert ebenfalls die Obstzüchtung und fokussiert diese auf die Apfelzüchtung.Zudem wird die Versuchskäserei Moudon geschlossen.Die Käsereiversuche werden an den Standorten Liebefeld und Uettligen (BE) konzentriert.
Einen Abbau werden auch die Leistungen im Feldbau erfahren.Darunter fallen Feldversuche und Laboranalysen für Pflanzenernährung,Pflanzenbau und -qualität.Die Anzahl Versuche und die Anzahl Analysen werden auf das Notwendigste reduziert.Im Futterbau verzichtet Agroscope teilweise auf aufwändige botanische Analysen.Die Zahl bearbeiteter Pflanzen in der Futterpflanzenzüchtung wird kleiner.Ausserdem werden weniger Ressourcen im landwirtschaftlichen Umweltschutz eingesetzt.Dies bedeutet z.B.,dass Untersuchungen von Ackerböden und die Forschung zum Umweltverhalten von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden.
Auch die Agrartechnik ist von der Aufgabenverzichtsplanung betroffen,so die Arbeiten rund um die Bodenbelastung durch landwirtschaftliche Maschinen.Stark zurückgenommen werden zudem verfahrenstechnische Untersuchungen des Anbaus und der Ernte von Ackerkulturen.
■ Gemeinsam profitieren
Die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten arbeiten eng mit institutionellen Partnern zusammen.Ob Lehre,gemeinsamer Vollzug oder Einbezug der Praxis:Aus den Kooperationen ergibt sich ein intensiver Wissensaustausch.Infrastrukturen werden gemeinsam genutzt und dadurch Kosten eingespart.
Über 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Agroscope haben Lehraufträge an Schweizer Hochschulen.Mitarbeitende der Forschungsanstalten betreuen Doktor-, Diplom- und Semesterarbeiten.Zudem bilden sie Doktoranden aus – rund 50 per Ende 2004.An der ETH Zürich betreuen Mitarbeitende aller Forschungsanstalten Lehrveranstaltungen in den jeweiligen Fachbereichen.
Auch mit ausländischen Universitäten bestehen Kooperationen.Z.B.arbeitet Agroscope FAL Reckenholz bei der Biosicherheit mit der Universität Newcastle (England) zusammen.Die beiden Partner erforschen transgene Pflanzen,die an der Universität Newcastle hergestellt wurden.Spezielle molekulare Untersuchungen führt die FAL in Newcastle durch.Zwischen Agroscope FAW Wädenswil und der Cornell University aus New York besteht ein Memorandum of Understanding.Ein FAW-Forscher hat eine Gastprofessur an der Cornell University.Weiter laufen eine gemeinsame Doktorarbeit sowie verschiedene Forschungsarbeiten.

Die Vorteile der Zusammenarbeit liegen auf der Hand:Angewandte wissenschaftliche Aufgabenstellungen werden zwischen den Mitarbeitenden der Hochschulen und von Agroscope diskutiert und oft gemeinsam bearbeitet.Ein wertvolles Beziehungsnetzwerk entsteht.Vom Wissensaustausch profitieren alle Beteiligten.
■ Am Puls der Zeit
Diese Vorteile gelten auch für die Zusammenarbeit mit Fachhochschulen.Z.B.besitzen rund 20 Forscherinnen und Forscher von Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) Lehraufträge oder betreuen Diplom- und Semesterarbeiten an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL) in Zollikofen (BE).
Traditionelle Kooperationen mit Fachhochschulen bestehen auch zwischen der FAW und der Hochschule Wädenswil (HSW) sowie zwischen Agroscope RAC Changins und den Ingenieurschulen von Changins (EIC) und von Lullier.
■ Gegenseitig Infrastruktur nutzen
Neben der fachlichen Zusammenarbeit geht es auch um die gegenseitige Nutzung von Infrastruktur.So betreut die FAW die Obstanlagen der HSW.Weiter legten die beiden Nachbarn FAW und HSW ihre Werkstätten und Bibliotheken zusammen.
Auch in Changins nutzen die Nachbarn RAC und EIC gemeinsame Räumlichkeiten wie Kellerei,Bibliothek,Wäscherei,Aula,Restaurant und die gemeinsamen Versuchsfelder für den Weinbau.Die beiden führen zusammen Informationstage wie die Agrovina oder Tage der offenen Tür durch.
■ Forschung und Vollzug
Eine langjährige Partnerschaft verbindet auch ALP und das Landwirtschaftliche Institut (LIG) (FR).Die beiden nutzen gegenseitig Felder,Tiere und den biologisch geführten Landwirtschaftsbetrieb in Sorens (FR).Eine ähnliche Lösung praktizieren auch die Landwirtschaftsschule Châteauneuf (VS) und das Centre des Fougères der RAC in Conthey.
Dank den Kooperationen FAW/HSW,RAC/EIC und ALP/LIG können erheblich Kosten eingespart werden.
Eine besondere Art der Zusammenarbeit besteht zwischen Agroscope FAT Tänikon und dem Bundesamt für Veterinärwesen (BVET).Bei der FAT ist das Zentrum für tiergerechte Haltung,Wiederkäuer und Schweine,angesiedelt,das neben der Forschung den Vollzug des Tierschutzgesetzes unterstützt.Es ergeben sich dabei wertvolle Synergien zur FAT-Forschung in der Nutztierhaltung.
Mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) aus Dübendorf kooperiert die FAT ebenfalls.Die EMPA delegiert die Leistungs-,Verbrauchsund Emissionsmessungen (Abgasqualität) von Traktoren an die FAT.Die EMPA ihrerseits unterstützt die FAT mit ihrer Messtechnik,z.B.bei der Partikelmessung in Abgasen oder bei der Erfassung der Feinstaubentwicklung aus Stallsystemen.
■ Wissensaustausch mit der Praxis
Eine Partnerschaft verbindet die FAL mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau aus Frick (FiBL).FAL und FiBL tauschen fachliche Informationen aus,gleichen ihre Methoden ab und unterstützen einander in Projekten.
FAL,FAT und ALP arbeiten auch eng mit dem Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum (LBBZ) aus Schüpfheim (LU) zusammen.Auf dem LBBZ-Gutsbetrieb Burgrain werden in einem Langzeitversuch verschiedene Ackerbausysteme miteinander verglichen.Die FAL unterstützt dabei das LBBZ mit Spezialerhebungen zu verschiedenen Bodenparametern sowie zur Biodiversität und erstellt Energiebilanzen.
Die FAL profitiert vom intensiven Kontakt mit der Praxis,mit der Beratung und dem Unterricht.Die FAT unterstützt dabei beratend die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Anbausysteme.ALP überprüft mit dem LBBZ ein alternatives FreilandHaltungssystem mit Schweinen,wobei das LBBZ die Fragen der Wirtschaftlichkeit und ALP produktionstechnische Aspekte dieses Systems bearbeitet.Gleichzeitig beteiligt sich ALP am Kuhtypenprojekt.
Im «Centre des Fougères» der RAC befasst sich das Forschungszentrum Médiplant,ein von mehreren interessierten Partnern getragener Verein,mit der Domestikation und der Züchtung von Heil- und Gewürzpflanzen.Die RAC stellt Médiplant ihre Infrastruktur wie Labors,Gewächshäuser und Felder zur Verfügung.Vom Wissensaustausch profitieren Médiplant- und RAC-Forschende.
Nationalgestüt

Seit einigen Jahren ist ein Aufschwung der Pferdehaltung in ländlichen Gebieten zu beobachten,vor allem in den Bergregionen und in Stadtnähe.Als naturnaher und umweltfreundlicher Produktionszweig spielt die Zucht und die Haltung von Pferden, vor allem der Freibergerrasse,eine immer wichtigere Rolle bei der Diversifizierung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten,sowie für die regionale Entwicklung und die dezentrale Besiedlung.Zwar gibt es heute mehr Pferdehalter,aber deren Kenntnisstand ist zurückgegangen,insbesondere bezüglich Rentabilität,Haltungsbedingungen und Beachtung der natürlichen Bedürfnisse der Tiere.
Das schweizerische Nationalgestüt ist ein auf nationaler und internationaler Ebene anerkanntes Kompetenzzentrum.Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Genetik und Bildung an,mit dem Ziel,die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionszweigs und das Wohlbefinden der Pferde nachhaltig zu fördern.Im Rahmen von Projekten der angewandten Forschung entwickelt es Techniken und Methoden für die Pferdezucht und -haltung,die es selber anwendet und auch interessierten Kreisen zur Kenntnis bringt.
Diese logistische und technische Unterstützung bedingt die Vermittlung professioneller Kenntnisse und sehr spezifischer Informationen.Das Dokumentationszentrum und das Beratungsbüro des Gestüts gewinnen somit an Bedeutung,indem sie eine grosse Auswahl an Dokumenten und Publikationen zur Verfügung stellen,die aktuelle Fragestellungen der Zucht und der Pferdehaltung behandeln,wie etwa die Förderung der Freibergerrasse,die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung von Massnahmen zum Wohlbefinden der Pferde im ländlichen Raum.Die praktischen Kenntnisse kommen den Züchtern und Tierhaltern zugute,die am Ausbildungszyklus Equigarde® teilnehmen oder sich an das Beratungsbüro wenden.Die wissenschaftlichen Informationen werden für Forschungsprojekte des Gestüts verwendet,die zu seinen strategischen Aufgaben gehören.In Zusammenarbeit mit den Pferdezuchtverbänden verwaltet das Zentrum auch Dokumente über den Ursprung der in der Schweiz gezüchteten Pferde.
Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung
Der Bund gewährt Finanzhilfen für die Beratung.Diese machen bei den Beratungsdiensten im Durchschnitt 20 bis 25% und bei der Schweizerischen Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft (SVBL) rund 55% der Aufwendungen aus.Die SVBL trägt die beiden Beratungszentralen in Lindau ZH (LBL) und in Lausanne (SRVA).
Ausgaben für die Beratung 2004
EmpfängerBetrag
Mio.Fr.
Landwirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone8,3
Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone0,8
Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen0,8
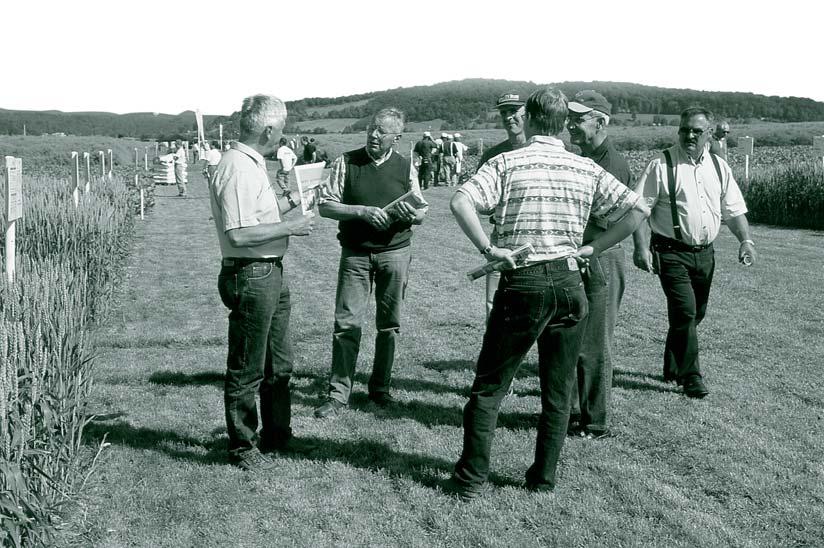
Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft8,4
Total18,3
Quelle:Staatsrechnung
■ Neue Leistungsvereinbarung mit der SVBL
Ende 2004 unterzeichneten das BLW und die SVBL die neue Leistungsvereinbarung 2006 bis 2007.Inhaltlich verlängert sie im Wesentlichen den Auftrag an die beiden Beratungszentralen LBL und SRVA,in den fünf definierten Produkten weiterzuarbeiten, in welche die Leistungen der Zentralen aufgegliedert sind:
ProduktBeschreibung der wichtigsten Leistungen
Grundlagenbeschaffung und Methodenentwicklung
Einführung,Qualifizierung und Weiterbildung der Beratungskräfte
Information,Dokumentation, Hilfsmittel,Informatik
Erprobte Methoden und aktuelle Datengrundlagen sind als Rohstoff für verschiedene Produkte vorhanden.Aktuelle Praxisdaten werden erhoben und ausgewertet,sofern sie nicht schon verfügbar sind,und erlauben Kontakte zu Praxis- und Beratungsgruppen.
Die Beratungszentralen bieten ein breites Einführungs- und Weiterbildungsprogramm an. Sie fördern die Qualifizierung der Beratungskräfte.
Ein breites Informations-,Dokumentations- und Hilfsmittelangebot in den Fachbereichen und speziell in Unternehmens- und Haushaltführung wird für Beratungskräfte bereitgestellt,das möglichst so konzipiert ist,dass es auch direkt auf den Bauernbetrieben eingesetzt werden kann.Softwareprodukte sollen in erster Linie die Leistungsfähigkeit der Beratungskräfte erhöhen.
Direkte Unterstützung von Beratungsdiensten,Branche und Regionen
Koordinationsnetzwerke (initiieren,managen,mitmachen)
Die Beratungszentralen stellen auf Anfrage gegen angemessene Bezahlung der Leistung für Beratung,Berufsbildung,Organisations- und Teamentwicklung befristet Spezialwissen und Problemlösungskapazität zur Verfügung.Sie unterstützen Projekte in der Startphase, die im aktuellen öffentlichen Interesse liegen.
Auf Anfrage bzw.in Absprache mit den Verantwortlichen oder Beteiligten übernehmen die Beratungszentralen innerhalb des landwirtschaftlichen Wissenssystems Netzwerkfunktionen.
Wie bei FLAG (Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget),das der Bund intern verwendet,gibt es auch hier zu jedem Produkt mehrere Ziele,jedes mit Indikatoren und Standards (Messgrössen) versehen.Diese helfen Ende Jahr festzustellen,ob und in welchem Ausmass die Ziele erreicht wurden.Dadurch erhält das BLW Informationen über den Einsatz seiner Geldmittel und die Zentralen verschaffen sich einen Überblick über den Absatz und die Qualität ihrer Leistungen.Die Resultate aus den ersten drei Jahren,in denen mit diesem FLAG-Werkzeug gearbeitet wird,sind sehr zufrieden stellend.
Die neue Leistungsvereinbarung gilt für die Jahre 2006 und 2007.Danach wird sie in den üblichen Vier-Jahres-Rhythmus überführt,der z.B.beim Leistungsauftrag für Agroscope oder bei der Vereinbarung mit dem FiBL zur Anwendung kommt.Wegen den Sparmassnahmen des Bundes stehen für die SVBL jährlich nur noch 8 Mio.Fr.zur Verfügung,gegenüber 8,4 Mio.Fr.während zehn Jahren vorher.
Landwirtschaftliche Berufsbildung
Das neue Berufsbildungsgesetz (BBG),das ab 1.Januar 2004 in Kraft getreten ist,trägt dem markanten Wandel in der Berufs- und Arbeitswelt Rechnung und ist bestrebt, neue,differenzierte Wege der beruflichen Bildung,sowie eine grösstmögliche Durchlässigkeit im Berufsbildungssystem zu erreichen.Anstelle der bisherigen Aufwandsubventionierung tritt neu ein System von leistungsorientierten Pauschalen,welches auch aus finanzieller Sicht eine stärkere Zusammenarbeit der drei Partner fordert.Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstützt die landwirtschaftliche Berufsbildung mit jährlich ca.10 Mio.Fr.
Das neue Gesetz überträgt die Verantwortung für den Inhalt der geregelten Ausbildungen (Lernziele) und deren Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Erwartungen des Arbeitsmarktes an die national tätigen Organisationen der Arbeitswelt (OdA).
Die Berufsorganisationen in den Bereichen Landwirtschaft,biologische Landwirtschaft, Gemüse-,Obst- und Weinbau,Oenologie und Geflügelzucht haben im Frühjahr 2005 die für die Berufsbildung verantwortliche Dachorganisation gegründet.Zusammen mit den Vertretern der kantonalen Berufsbildungsämter und dem BBT unterziehen sie die berufliche Grundbildung in den genannten Bereichen einer Totalrevision.Es soll eine attraktive und umfassende Ausbildung angeboten werden,die eine maximale Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Berufszweigen und eine optimale Nutzung der Ressourcen ermöglicht,ohne dass die einzelnen Berufsgattungen ihre Identität verlieren.Die neuen Verordnungen und Anhänge sollen am 1.Januar 2008 in Kraft treten und ab Schulbeginn im folgenden Herbst zur Anwendung kommen.
Auch bei den Berufen der Pferdezucht und -haltung hat eine Reform eingesetzt. Mehrere in diesem Bereich tätige Verbände haben bei der verantwortlichen Vereinigung ihr Interesse dafür bekundet.Die OdA ist gegründet und hat den offiziellen Reformprozess diesen Sommer lanciert,damit die Gesetzestexte am 1.Januar 2008 in Kraft gesetzt werden können.

■ Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen

Für die Durchführung einer eidgenössischen Berufs- oder Höheren Fachprüfung bilden die entsprechenden OdA eine Trägerschaft.Die Prüfungsordnungen regeln die Zulassungsbedingungen,Lerninhalte,Qualifikationsverfahren,Ausweise und Titel.Sie unterliegen der Genehmigung durch das BBT.
Die Anpassung aller Berufs- und Höheren Fachprüfungen wird spätestens bei einer Überarbeitung oder bei einer Neueingabe umgesetzt.Bei einem Revisionsantrag oder einer Neueingabe einer Prüfungsordnung werden auch alle bereits vorhandenen Prüfungsordnungen,welche sich mit der erstgenannten im Fachgebiet wesentlich überschneiden,in Betracht gezogen.Im Bereich Landwirtschaft werden die Prüfungsordnungen,welche momentan in Bearbeitung sind,gemäss den neuen gesetzlichen Grundlagen genehmigt werden können.
Die Bildungsgänge und Nachdiplomstudien im gesamten Bereich der Landwirtschaft sind nun im Anhang 4 (Land- und Waldwirtschaft) der Verordnung des EVD über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen geregelt.Sämtliche Bildungsgänge beruhen auf Rahmenlehrplänen.Diese werden von den Bildungsanbietern im Zusammenhang mit den Organisationen der Arbeitswelt entwickelt und erlassen.Das BBT genehmigt sie auf Antrag der eidgenössischen Kommission für höhere Fachschulen.
■ Bildungs- und Beratungsbedürfnisse erkennen und darauf reagieren?
Centre international d’études agricoles (CIEA)
Im Auftrag des BLW und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) plant und realisiert das CIEA (Internationales Studienzentrum für Bildung und Beratung im ländlichen Raum) seit vielen Jahren Bildungsangebote für Fachleute der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes.Die Teilnehmenden stammen gut zur Hälfte aus Entwicklungsländern.Direktor und Geschäftsführerin des CIEA orientieren sich dabei besonders an den aktuellen Problemen im Bildungswesen und an den wichtigsten Bedürfnissen der Zielgruppen.
■ Das CIEA am Puls der Zeit
Welche Probleme,Fragestellungen stehen zurzeit im Vordergrund? Es sind dies:
–die Veränderung von Bildung- und Beratungsbedürfnissen;
–die Weiterentwicklung der Qualität von Bildung und Beratung;
–das Analysieren und Implementieren neuer methodisch-didaktischer Trends;
–die Veränderung der Rahmenbedingungen zur Organisation und Leitung von Bildungsinstitutionen;
–die Entwicklung neuer Bildungskonzepte im Hinblick auf die Veränderung im ländlichen Raum an verschiedenen Orten der Welt.
■ Die Hauptaktivitäten des CIEA
Das CIEA kann mit verschiedenen Massnahmen auf diese Bedürfnisse reagieren:
–planen und durchführen von Weiterbildungsangeboten für verschiedene Zielgruppen (z.B.Leitungspersonen von Beratungs- oder Bildungsinstitutionen,Lehrpersonen und Entscheidungsträger im landwirtschaftlichen Bildungswesen);
–beitragen zum Dialog und zum Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Akteuren im ländlichen Raum (z.B.zwischen Bauernfamilie und Bildungsverantwortlichen);
–bereitstellen von Informationen und eines Netzwerkes von Fachleuten zu Bildungsund Beratungsfragen im ländlichen Raum.
■ Aktuelle Projekte des CIEA
Konkret werden im Jahr 2005 drei aktuelle Projekte geplant oder realisiert: –ein Weiterbildungsseminar für Schuldirektoren,Lehrpersonen und Entscheidungsträger aus lateinamerikanischen Ländern; –ein Workshop zur Analyse der Bildungsbedürfnisse im ländlichen Raum Westafrikas; –die Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre CIEA,welche im Jahr 2006 in Grangeneuve durchgeführt wird.
Mit all diesen Aktivitäten hilft das CIEA gezielt mit,Bildungs- und Beratungsangebote für die Landwirtschaft weiter zu entwickeln und zu verbessern.
■ Bilaterales Agrarabkommen mit der EU: Anerkennung von Sortenkatalog und Zertifizierung
2.3.3 Produktionsmittel
Saat- und Pflanzgut
Im Agrarabkommen,das seit dem 1.Juni 2002 in Kraft ist,wurde die gegenseitige Anerkennung für das Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial ausgehandelt.Die EU ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner in diesem Bereich.Der Abbau der technischen Handelshemmnisse bietet der Schweizer Landwirtschaft den Zugang zu einem viel breiteren Angebot an Sorten von Acker- und Futterpflanzen.Seit dem 5.Juli 2004 sind alle Arten in Bezug auf die Sortenzulassung und Saatgutanerkennung als gleichwertig anerkannt.
Anhang 6 des Agrarabkommens mit der EU regelt die Anerkennung im Bereich Vermehrungsmaterial von Kulturpflanzen der Landwirtschaft,des Gartenbaus,des Zierpflanzenbaus und des Weinbaus.Er beinhaltet insbesondere Regeln für die Anerkennung der Rechtsvorschriften und Bescheinigungen (z.B.Etiketten),für das Vorgehen zur Angleichung der Rechtsvorschriften und für die Einfuhr von Material aus Drittländern (andere Länder als Mitglieder der EU).Die Anlagen zum Anhang 6 bezeichnen den Status der betroffenen Rechtsvorschriften,die Kontroll- und Anerkennungsstellen und die Liste der Drittländer.
■ Sortenkatalog
In der Schweiz sind momentan 520 Sorten im Nationalen Sortenkatalog aufgenommen.Mit der Anerkennung des Gemeinsamen Sortenkataloges der Europäischen Gemeinschaft haben Schweizer Landwirte Zugang zu weiteren rund 16’000 Sorten aus dem ganzen EU-Raum.Damit der Landwirt aus diesem grossen Angebot die für Schweizer Bedingungen besten Sorten auswählen kann,erarbeiten die verschiedenen Branchenorganisationen aufgrund der Versuchsergebnisse der Forschungsanstalten die Empfohlenen Sortenlisten.
Anzahl zugelassene Sorten – Schweiz und EU
ArtSchweizEUCH in % EU
Weizen441 2543,5
Dinkel101855,6
Mais473 6621,3
Kartoffeln361 0123,6
Italienisches und Westerwoldisches Raigras313179,8
Rotklee2516615,1
Raps36730,5
Quellen:Nationaler Sortenkatalog,BLW;Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten, Amtsblatt der Europäischen Union – Stand März 2005
■ Saatgutanerkennung
Die gegenseitige Anerkennung ermöglicht es auch den Schweizer Züchtern oder Zuchtfirmen,welche ihre Sorten in der Schweiz prüfen lassen,ihre im Nationalen Sortenkatalog eingetragenen Sorten europaweit in Verkehr zu bringen.Diese Exportmöglichkeit wird denn auch z.B.bei hochstehenden Futterbaumischungen oder bei Brotgetreidesorten,die sich durch herausragende Qualitäts- respektive Resistenzeigenschaften auszeichnen,zunehmend genutzt.
Die Anerkennung (Zertifizierung) von Saat- und Pflanzgut beinhaltet die Feldbesichtigung,Laborkontrolle von Mustern und die nach klar definierten Vorgaben durchgeführte Verpackung,Verschliessung und Etikettierung der Vermehrungsposten.Die diesbezüglichen Bestimmungen sind in der Saatgut-Verordnung (SR 916.151) und der Saat- und Pflanzgut-Verordnung des EVD (SR 916.151.1) festgelegt.Diese Verordnungen wurden,neben weiteren vom genannten Anhang 6 des Agrarabkommens betroffenen Rechtsvorschriften,von der EU als gleichwertig mit den entsprechenden EU-Richtlinien anerkannt.Bedingung für die Aufrechterhaltung dieser Anerkennung ist die periodische Angleichung der Rechtserlasse im Falle von Änderungen der Vorschriften der EU oder der Schweiz.

■ Einbezug neuer Bereiche
Die im Abkommenstext verankerte Evolutivklausel verpflichtet die Vertragsparteien,bei Erlass neuer Rechtsvorschriften zu prüfen,ob der neue Bereich in das Abkommen einbezogen werden kann.Die Schweiz strebt im Sinne eines weiteren Abbaus technischer Handelshemmnisse eine Ausweitung auf Vermehrungsmaterial von Obstgehölzen,Rebpflanzen und Gemüse an.
■ Phytosanitarische Massnahmen:

Pflanzenpass ersetzt Pflanzenschutzzeugnis
Pflanzenschutz
Seit Ende des 19.Jahrhunderts ist man bemüht,die versehentliche Einschleppung neuer Pflanzenschädlinge und -krankheiten im internationalen Handel zu verhindern. Der internationale Pflanzenhandel wird heute noch durch das Internationale Pflanzenschutzübereinkommen (CIPV) von 1951 geregelt.Darin ist insbesondere für jede Exportsendung von Pflanzenmaterial ein Pflanzenschutzzeugnis vorgeschrieben, aus dem der Pflanzenschutzdienst des Importlandes entnehmen kann,dass der entsprechende Dienst im Exportland die Ware untersucht hat und befand,sie erfülle die phytosanitären Anforderungen des Importlandes.
Vor einigen Jahren wurde dieses Pflanzenschutzzeugnis in Europa durch den Pflanzenpass ersetzt.Dieser wurde 1993 bei der Schaffung des europäischen Binnenmarkts durch die EU eingeführt,als die Warenkontrollen an der Grenze der Mitgliedstaaten entfielen.Der Pflanzenpass beruht auf dem Grundsatz,dass die phytosanitären Kontrollen nicht mehr kurz vor dem Inverkehrsetzen der Pflanzen erfolgen,sondern zu einem angemessenen Zeitpunkt der Vegetationsperiode am Produktionsort.Er ist für bestimmte Pflanzenarten obligatorisch;bestätigt wird damit,dass das betreffende Pflanzenmaterial aus einem Produktionsbetrieb stammt,der von der nationalen Pflanzenschutzorganisation offiziell zugelassen ist und dass die Produktionsparzellen einer phytosanitarischen Kontrolle unterzogen wurden.Ein Pflanzenpass kann nur ausgestellt werden,wenn in den Kulturen des Produktionsbetriebs keine Quarantäneorganismen gefunden wurden.Beim Inverkehrsetzen müssen die Sendungen passpflichtiger Pflanzen über die gesamte Vermarktungskette hinweg mit dem Pflanzenpass versehen sein.Werden Sendungen aufgeteilt oder im Gegenteil zusammengelegt, müssen die Handelspartner,die ebenfalls einer Zulassung bedürfen,einen Austauschpass ausstellen und darüber Buch führen,damit vor allem bei phytosanitären Problemen die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.
■ Harmonisierung der phytosanitarischen Bestimmungen der Schweiz und der EU
In der Schweiz ist der Pflanzenpass seit dem 1.April 2002 für verholzende Pflanzen vorgeschrieben,das heisst für Pflanzenmaterial aus Baumschulen.In einem ersten Schritt wurde er nur in der Schweiz verwendet,wo er insbesondere dazu diente,den Handelsverkehr mit Feuerbrand-Wirtspflanzen zu regeln.Dank des bilateralen Agrarabkommens im phytosanitären Bereich anerkennen die EU und die Schweiz seit dem 1.April 2004 gegenseitig die von ihnen ausgestellten Pflanzenpässe.Die Schweiz dehnte damals die Passpflicht,mit einigen wenigen Ausnahmen,auf alle Pflanzen aus,die ihr auch in der EU unterstehen.Zudem übernahm sie die europäischen Anforderungen an den Import von Pflanzen aus so genannten Drittländern.Diese Harmonisierung hat zur Folge,dass heute die Schweiz in Bezug auf den Handel mit Pflanzenmaterial den EU-Mitgliedern gleichgestellt ist.Dies bedeutet unter anderem, dass nichtpasspflichtige Pflanzen frei gehandelt werden können,wobei Bestimmungen ausserhalb des phytosanitären Bereichs vorbehalten sind.
■ Zusammenarbeit mit Branchenorganisationen
Betriebe,die passpflichtige Pflanzenmaterialien produzieren und/oder in Verkehr bringen,müssen vom Eidg.Pflanzenschutzdienst zugelassen werden.Die Produktionsparzellen werden mindestens einmal jährlich inspiziert.Die Produzenten sind verpflichtet,in einem Verzeichnis sowohl die Angaben aus den Pflanzenpässen einzutragen,mit denen ihre Pflanzensendungen versehen sind,als auch das Datum und Angaben zu den Empfängern.Dies gilt auch für Handelsunternehmen,die solches Pflanzenmaterial kaufen und wiederverkaufen.Diese müssen zusätzlich in der Lage sein,unverzüglich Informationen zum Ursprung des Materials zu geben,und zu diesem Zweck die Pflanzenpässe aufbewahren.Produzenten,die Pflanzen für den Eigenbedarf produzieren,sind von den Vorschriften des Pflanzenpasses nicht betroffen.
In der Schweiz und in einigen Mitgliedländern der EU wurden Branchenorganisationen mit den amtlichen Kontrollen betraut.Unter Branchenorganisation versteht man eine Organisation,der mindestens zwei Berufsverbände der Branche angeschlossen sind, die eine Beziehung des Typs Lieferant-Kunde unterhalten,damit die Interessen beider Parteien vertreten sind.Solche Organisationen wurden bei der Einführung der von ihnen betreuten Zertifizierungssysteme für Saat- und Pflanzgut gebildet.Sie verfügen also über die notwendigen Strukturen und das erforderliche Wissen,um schweizweit auch die ihnen vom Pflanzenschutzdienst übertragene Aufgabe zu erfüllen.
■ Ausblick
Die Gleichwertigkeit der phytosanitarischen Bestimmungen der Schweiz und der EU ist eine für die gegenseitige Anerkennung unabdingbare Voraussetzung.Die Schweiz muss daher ihre einschlägige Gesetzgebung periodisch überprüfen.Dabei werden die neuen Bestimmungen der EU nicht unbesehen übernommen.

■ Landwirtschaft verwertet 50% des produzierten Komposts und Gärgutes
Kompost und Gärgut in der Landwirtschaft
Die Verwendung von Kompost und Gärgut in der Landwirtschaft als Dünger und/oder Bodenverbesserungsmittel ist stark im Zunehmen begriffen.Während Kompost für die landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Verwendung beim BLW angemeldet sein muss,unterstehen Gärgut oder Presswasser (bei der Vergärung von pflanzlichem und tierischem Material anfallendes Wasser) einer Bewilligungspflicht.
In die rund 300 Kompostieranlagen der Schweiz,die jährlich mehr als 100 t biogene Abfälle verarbeiten,wurden im Jahr 2002 728'300 t Grüngut angeliefert.Dies entspricht einer Pro-Kopf-Menge von 103 kg.Das Potential der Einsammlung von Grünabfällen ist heute bei weitem noch nicht ausgeschöpft.Das BUWAL schätzt,dass weitere 650'000 t kompostierungswürdiges Grüngut im Müll landen.
In der Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft machen Kompost und Gärgut etwas weniger als 10% der gesamten umgesetzten Nährstoffmenge aus.
Der Rotteschwund während der Kompostierung beträgt etwa 45%.Von den verbleibenden 400'000 t Kompost und Gärgut gehen nach Schätzungen des BUWAL rund 50% in die Landwirtschaft.
Während bei der Kompostierung pflanzliches und tierisches Material mit hohem organischen Anteil aerob (unter Luftzutritt) verrottet,unterscheidet sich die Vergärung durch einen vollständig anderen mikrobiologischen Abbau.Sie verläuft anaerob (unter Luftabschluss).Neben Gärgut und Presswasser entsteht Biogas,das zur Erzeugung von elektrischer und Wärmeenergie sowie als Treibstoff genutzt werden kann.
Der Einsatz von Kompost und Gärgut kann mit besonderen Problemen verbunden sein, da die Ausgangsmaterialien heterogen sind.Mangelnde Hygiene,Schwermetalle, organische Schadstoffe oder ungenügende agronomische Eigenschaften (C:N-Verhältnis,pH-Wert,Salzgehalt etc.) können sowohl die Lebensmittelsicherheit,als auch den Schutz des Boden auf lange Sicht beeinträchtigen bzw.in Frage stellen.

Damit die Lebensmittelsicherheit und der Bodenschutz gewährleistet werden kann,hat die Kontrolle der Qualität von Kompost und Gärgut eine hohe Priorität.Eine wichtige Funktion hat dabei die fachlich neutrale und unabhängige Inspektoratskommission.Sie setzt sich aus Vertretern der Branchenverbände,der Fachstellen von Bund (BLW, BUWAL),Kantonen und Forschungsanstalten zusammen.Die Kommission organisiert, begleitet und überwacht die Inspektionen der Anlagen.Sie entwickelt Vorschläge für eine einheitliche Qualitätskontrolle der Branche und dient als Plattform zum Informationsaustausch.Ihren Aktivitäten liegen die Ziele von Umweltschutz,Lebensmittelsicherheit und Arbeitnehmersicherheit zugrunde.
Im Dezember 2004 wurde zudem ein Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche Schweiz gegründet.In dieser Arbeitsgemeinschaft sind alle relevanten Organisationen der Branche vertreten.Damit erhalten die Kantone,die für die Kontrolle der Anlagen verantwortlich sind,die Möglichkeit,eine fachlich unabhängige Organisation mit diesen Aufgaben zu beauftragen.Die Qualitätskontrolle bietet der Landwirtschaft und den anderen Kompostabnehmern die Gewähr,dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestqualität eingehalten wird.
■ Kontrolle der Qualität von Kompost und Gärgut
■ Wie sicher sind Pflanzenschutzmittel für Bienen?

Pflanzenschutzmittel
In den letzten Jahren wurde zunächst in Frankreich,später aber auch in anderen Ländern über eine beunruhigende Dezimierung der Bienenvölker berichtet.Ab 2002 und verstärkt im Jahr 2003 wurden analoge Beobachtungen auch in der Schweiz zum Thema.Die Medien berichteten wiederholt über ein Bienensterben,und die Sorge um das Wohlergehen der Bienen wurde zum Gegenstand verschiedener parlamentarischer Interventionen.Dabei wurde vor allem auch aus Imker-Kreisen die Meinung vertreten, dass das Bienensterben durch Pflanzenschutzmittel verursacht sei,welche als Beizmittel auf das Saatgut aufgebracht werden.
Die Bienenhaltung nimmt zweifellos wichtige und vielfältige Funktionen in der Landwirtschaft wahr.Das BLW befasst sich deshalb bereits seit mehreren Jahren mit der Ursache und möglichen Lösungen für das Problem des Bienensterbens.Dabei wurde untersucht,ob tatsächlich bestimmte Pflanzenschutzmittel schuld am Bienensterben sind oder andere Ursachen in Frage kommen.Nur so lässt sich die vorschnelle Festlegung auf eine falsche Ursache und eine vermeintliche Lösung,die nicht greift, vermeiden.
■ Prüfung der Pflanzenschutzmittel auf Bienenverträglichkeit
Im Folgenden wird dargelegt,wie bei der Prüfung der Pflanzenschutzmittel vorgegangen wird,um deren Sicherheit für die Bienen zu gewährleisten.Mit diesem Verfahren wurden auch jene Produkte grundsätzlich getestet,welche im Zentrum der Debatte bezüglich Bienensterben stehen.
Grundsätzlich dürfen Pflanzenschutzmittel in der Schweiz nur in Verkehr gebracht werden,wenn sie zugelassen sind.Mit der Zulassungspflicht wird sichergestellt,dass einerseits ein Pflanzenschutzmittel nur in Verkehr gebracht werden kann,wenn dieses zum vorgesehenen Gebrauch geeignet ist,und andererseits sein vorschriftsgemässer Gebrauch keine unannehmbaren nachteiligen Nebenwirkungen hat sowie weder die Umwelt noch Mensch und Tier gefährden kann.Namentlich sind auch detaillierte Studien zur Sicherheit für Bienen ein fester Bestandteil der Zulassungsanforderungen. Falls Bienen durch eine Anwendung gefährdet sind,wird keine Bewilligung erteilt.
Die Versuchsmethoden zur Klärung der Bienengiftigkeit eines Produktes umfassen drei Schritte:
Labortests: Bei den Labortests werden Bienen in einem Käfig einer bestimmten Dosis eines Produktes ausgesetzt.Diese Tests ermöglichen es,die akute Toxizität eines Pestizids durch orale Aufnahme oder durch Kontakt festzustellen.Das Verhältnis zwischen der Toxizität des Produktes und der Gebrauchsdosis erlaubt es,seine Gefährlichkeit für Bienen,das so genannte Risikoverhältnis,vorherzusagen.Zeigen diese Laborversuche,dass absolut kein Risiko für Bienen besteht,steht der Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels unter dem Aspekt der Bienen-Toxizität nichts im Wege. Lassen diese Labortests auf eine mögliche Toxizität des Produktes für Bienen schliessen,so muss ein Versuch durchgeführt werden,der dem praktischen Einsatz schon näher kommt als ein Laborversuch.
■ Zentrum für Bienenforschung bei Agroscope LiebefeldPosieux

Zeltversuche: In einem Zelt von rund zehn Quadratmetern Grundfläche wird eine für Bienen attraktive Kultur mit der normalen Gebrauchsdosis des zu prüfenden Produktes behandelt.Ein kleines Bienenvolk wird im Zelt eingestellt.Dann wird die Flugintensität bestimmt und registriert,ob Verhaltensstörungen auftreten und ob und wie viele tote Bienen beim Abflugloch oder im Feld zu finden sind.Bei Insektiziden auf der Basis von Insekten-Wachstumsregulatoren wird dieser Test mit spezifischen Indikatoren für die Entwicklung der Brut erweitert.Auch in diesem Test sind die Bienen dem Produkt stärker ausgesetzt als bei seiner normalen Verwendung,da sie die behandelte Fläche nicht verlassen können.Lassen auch Zeltversuche auf eine mögliche Toxizität des Produktes schliessen,müssen Freiland- oder Grosszeltversuche durchgeführt werden.
Freiland- oder Grosszeltversuche: Hier erfolgt der Test unter Bedingungen,die der landwirtschaftlichen Realität nahe kommen.Die Grosszelte sind aus durchlässiger Kunststoffgaze angefertigt,und die Testfläche enthält sowohl unbehandelte als auch behandelte Zonen.Wiederum wird bestimmt,ob am Flugloch tote Bienen auftreten, und Messungen der Volksstärke erlauben es,mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Völker zu beobachten.Natürlich können bei einer solch gross angelegten Versuchanordnung unkontrollierbare äussere Einflüsse ebenfalls eine Rolle spielen, was die Interpretation der Resultate sehr anspruchsvoll machen kann.
Diese Versuchsmethoden sind international im Kreise von Fachleuten erarbeitet worden und finden bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ihre Anwendung, besonders auch in der EU.Sie widerspiegeln also den heutigen Stand von Technik und Wissenschaft und bieten Gewähr,dass die Sicherheit für Bienen nach bestem Wissen und Gewissen geprüft wird,bevor ein Pflanzenschutzmittel auf den Markt gebracht werden darf.
Aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der Bienenhaltung wie z.B.die Ursache für das beobachtete Bienensterben werden vom Zentrum für Bienenforschung in Liebefeld bearbeitet.Im konkreten Fall nutzt es sowohl seine direkten Kontakte zu den zuständigen Fachbehörden in Nachbarländern als auch jene zu den Imkerverbänden im Inund Ausland.In diese Ursachenforschung werden auch die Pflanzenschutzmittel einbezogen,aber ebenso eine Reihe anderer Faktoren,die für das beobachtete Bienensterben verantwortlich sein könnten.Bisher gibt es keine Hinweise,dass Pflanzenschutzmittel die Ursache für das Bienensterben sind.
■ Schweizerische Tierzucht hat Tradition

2.3.4Tierzucht
Die Zucht von landwirtschaftlichen Nutztieren hat in der Schweiz eine lange Tradition und geniesst ein hohes Ansehen auch jenseits der Grenze.An internationalen Schauen halten Schweizer Tiere dem direkten Vergleich mit ausländischer Genetik in jeder Beziehung stand und nehmen bei der Rangierung immer öfter vordere Plätze ein.Die Sicherstellung einer eigenständigen inländischen Tierzucht bedingt auch in Zukunft eine staatliche Unterstützung der Züchter und ihrer Organisationen in ihren züchterischen Tätigkeiten.Für die Herdebuchführung,die Durchführung von Leistungsprüfungen,die Auswertung der züchterischen Daten einschliesslich der Zuchtwertschätzung sowie für Erhaltungsprogramme für gefährdete Schweizer Rassen wenden Bund und Kantone zusammen jährlich rund 40 Mio.Fr.auf.
Ein wichtiges öffentliches Anliegen ist die Erhaltung der Rassenvielfalt bei den landwirtschaftlichen Nutztieren.Die Schweizer Rassen sind nicht nur genetisch von Interesse,sie stellen auch ein wertvolles und erhaltenswertes Kulturgut dar.Die Zuchtorganisationen haben die Wichtigkeit der Biodiversität erkannt und sind bestrebt, die Schweizer Rassen mit speziellen Programmen zu fördern und zu erhalten.
■ Einfuhr und Ausfuhr von Zuchttieren und Sperma
Die Zollkontingente für Pferde,Schweine,Schafe und Ziegen werden im Gegensatz zum Zollkontingent für Zuchtrinder nicht ausgeschöpft.Die seit längerem anhaltende Tendenz,Milchwirtschaftsbetriebe auf Mutterkuhhaltung umzustellen,bewirkt eine stetige Nachfrage nach Tieren der Fleischrinderrassen.Für die im Berichtsjahr versteigerten 1'200 Kontingente für Zuchtrinder wurden über 6'000 Gebote eingereicht.
Ein geringeres Angebot an Zucht- und Nutztieren auf dem Inlandmarkt führte dazu, dass gegenüber dem Vorjahr weniger Tiere exportiert werden konnten.Rund 4'500 Zuchtrinder der Rassen Fleckvieh,Braunvieh und Holstein wurden 2004 in 16 verschiedene Länder ausgeführt.Erstmals wurden 30 Fleischrinder nach Estland verkauft.
■ Verwertung der inländischen Schafwolle
Seit anfangs 2004 anerkennt und unterstützt der Bund Selbsthilfeorganisationen aus Wollverwertern und Schafhaltern für das Einsammeln,das Sortieren,das Pressen,die Lagerung und die Vermarktung der inländischen Wolle mit Beiträgen.Zusätzlich können auch innovative Projekte der Schafhalter und Wollverarbeiter zur Verwertung der inländischen Wolle im Inland mit Beiträgen gefördert werden.Der Bund setzt für diese Massnahmen jährliche Beträge von 600'000 Fr.bzw.200'000 Fr.ein.
Im 2004 haben vier anerkannte Selbsthilfeorganisationen knapp 400 t inländische Schafwolle verwertet.Von den eingereichten Projekten für die innovative Wollverwertung erfüllten zwei die gestellten Anforderungen und konnten mit rund 40'000 Fr. unterstützt werden.
2.4 Sektion Finanzinspektorat
Das Inspektionsprogramm des Finanzinspektorates wird mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle abgestimmt und vereinbart.Die Feldkontrollen werden in Absprache mit den Fachbereichen oder nach Risikoüberlegungen durchgeführt.
Finanzinspektorat
Im Berichtsjahr wurden folgende Revisionstätigkeiten vorgenommen:
–BLW-externe Revisionen bei acht Leistungsempfängern resp.Subventionsempfängern und deren ausführende Beauftragte; –BLW-interne Revision in drei Fachsektionen;
–Periodische Belegkontrollen im Amt inkl.Forschungsanstalten und Gestüt; –Abschlussrevisionen bei drei Subventionsempfängern; –Folgeprozess von abgeschlossenen Revisionen.
Sämtliche Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit den Standards für die berufliche Praxis des Institute of Internal Auditors (IIA) sowie des Schweizerischen Verbandes für Interne Revision (SVIR) vorgenommen und einer Qualitätssicherung unterzogen.
Bei den externen Revisionen wurden insgesamt gute Resultate festgestellt – die inhaltlichen Ziele sind fast vollumfänglich erreicht worden.Die vom BLW beauftragten Organisationen sind in der Regel gut organisiert,verfügen über angemessene Strukturen und zweckmässige,interne Abläufe.Im Rahmen dieser Tätigkeiten bildete die System- und Wirkungsprüfung des Direktzahlungssystems in sechs Kantonen einen Hauptschwerpunkt.Die Auswahl der Kantone erfolgte aufgrund ihrer Grösse.Die Internen Kontrollsysteme (IKS) der Kantone sind allgemein zweckmässig organisiert.Es bestehen aber durchaus noch Weiterentwicklungspotenziale.Die Aufsicht über die Kontrolldienste sollte besser gewährleistet werden.Übereinstimmend wird die Wirkung der allgemeinen Direktzahlungen als entscheidend für die Einkommenssituation der bäuerlichen Bevölkerung beurteilt.
BLW-interne Revisionen (sog.Dienststellenrevisionen) beinhalten eine unabhängige und systematische Beurteilung der betrieblichen Organisation und der Tätigkeiten der Organisationseinheit.Sie umfassen insbesondere die Aufbau- und Ablauforganisation einer Sektion.Ein wichtiges Element ist auch die Überprüfung der internen Kontrolle (IKS).Das Augenmerk richtet sich nicht nur auf eine Soll-Ist-Abweichung,sondern auch auf deren Ursachen.Die Resultate unserer Prüfungen fallen mehrheitlich positiv aus. Die öffentlichen Mittel werden rechtmässig und zielgerichtet eingesetzt.Die dabei im Einsatz stehenden Führungs- und Steuerungsinstrumente sind in vielen Fällen angemessen und transparent.Die administrativen Vollzugsaufgaben werden mit guter Qualität erfüllt.
■ Folgeprozess

Die Finanzrevision im BLW umfasste mehrere Teilprüfungen in periodischen Abständen. Aufgrund der stichprobenweisen Prüfung ausgewählter Rubriken und deren Konti können wir die Ordnungs- und Rechtmässigkeit der getätigten Ausgaben bestätigen.
Die Abschlussrevisionen führten in zwei Fällen zu unbefriedigenden Resultaten.Im ersten Fall konnten wir die Ordnungsmässigkeit der Abrechnung gegenüber dem BLW nicht bestätigen und im zweiten nur eingeschränkt.Bei einer weiteren Abschlussrevision konnten wir die Ordnungs- und Rechtmässigkeit bescheinigen.Trotzdem wurden bei allen drei Revisionsobjekten die vereinbarten Leistungen erbracht und die Bundesgelder,abgesehen von einigen Ausnahmen,zweckmässig und wirtschaftlich verwendet.
Im Rahmen des Folgeprozesses haben wir den Umsetzungsstand der offenen Empfehlungen aus 11 Revisionen der Jahre 2002 und 2003 bei den betroffenen Sektionen überprüft.Wir stellen fest,dass die meisten Sektionen die anlässlich der Schlussbesprechungen vereinbarten Empfehlungen in der praktischen Arbeit umsetzen.Die noch nicht umgesetzten Empfehlungen werden wir im laufenden Jahr nochmals auf ihren Umsetzungsstand hin überprüfen.
Das Finanzinspektorat unterhält zu allen Organisationseinheiten des BLW angepasste, partnerschaftliche Beziehungen.Bei Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten des Finanzinspektorates weisen wir jeweils darauf hin,dass die Linieninstanzen selber für ihre Entscheidungen verantwortlich sind.
■ Kontrolltätigkeit im Berichtsjahr
Feldkontrolle
Die Inspektoren des Bereichs Feldkontrolle führen Kontrollen,Abklärungen,Ermittlungen und Untersuchungen in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Gesetzgebung von Produktion und Absatz bzw.für die Fachstellen des BLW durch.Im Jahr 2004 wurden durch die Equipe 864 Kontrollen durchgeführt.Die Prüfungen fanden in den folgenden Bereichen statt:
–Milch- und Milchprodukte mit 652 Kontrollen; –Gemüse,Obst,Schnittblumen und Obstkonzentrat mit 100 Kontrollen; –Fleisch und Eier mit 28 Kontrollen; –Acker- und Futterbaubereich mit 9 Kontrollen und einer Preiserhebung; –Reben bezüglich Umstellungsmassnahmen mit 44 Kontrollen.
Bei den im Bereich Milch- und Milchprodukte durchgeführten Kontrollen wurden in 25% aller Fälle Unregelmässigkeiten festgestellt.Davon waren etwas weniger als die Hälfte Beanstandungen innerhalb der Toleranzgrenzen;die andere Hälfte musste der Fachsektion zur weiteren Beurteilung übergeben werden.
Im Bereich der Domizilkontrollen von frischen Früchten und Gemüse wurden in etwas mehr als der Hälfte aller Kontrollen Verfehlungen beanstandet.Daraus resultierten für den Bund Mehreinnahmen in Form von zusätzlichen Zollabgaben und Bussgeldern.
In den übrigen Bereichen gaben die Kontrollen und Beanstandungen zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
■ Widerhandlungen
Abklärungen,Untersuchungen und Befragungen im Zusammenhang mit Widerhandlungen gegen die Landwirtschaftsgesetzgebung werden in Zusammenarbeit mit eidgenössischen und kantonalen Untersuchungsbehörden,mit privaten Organisationen und anderen Rechtshilfestellen vorgenommen.Im Berichtsjahr wurden sechs Widerhandlungsfälle eröffnet und zur Bearbeitung weitergeleitet.Gesamthaft wurden drei Fälle definitiv erledigt.
■ Umsetzung der Agrarpolitik 2007
2.5 Weiterentwicklung der Agrarpolitik
Die Umsetzung der mit der Agrarpolitik 2007 verabschiedeten Neuerungen kam im Berichtsjahr wie vorgesehen voran,so auch die Vorarbeiten zum vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung.Endgültig wird die Milchkontingentierung am 1.Mai 2009 aufgehoben.Bei der Versteigerung der Fleischimportkontingente wird schrittweise vorgegangen.Die 2004 durchgeführte Versteigerung verlief problemlos.
■ Agrarreform in Etappen
Die Landwirtschaft wird auch künftig mit einem hohen Rhythmus von Veränderungen konfrontiert bleiben.Insbesondere die bilateralen Verträge mit der EU,verschiedene Freihandelsabkommen mit Drittstaaten und die zu erwartenden Auswirkungen der laufenden WTO-Verhandlungen führen zu einer weiteren Öffnung der Agrarmärkte. Von dieser Entwicklung ist nicht nur die Landwirtschaft,sondern die gesamte Nahrungsmittelbranche betroffen.Hinzu kommt ein zunehmender Spardruck bei den Bundesmitteln und damit einhergehend eine schwindende Akzeptanz staatlicher Marktstützung.Parallel zur Umsetzung der Agrarpolitik 2007 wurden deshalb verwaltungsintern Vorschläge für eine nächste Reformetappe erarbeitet.Diese Etappe folgt der bisherigen Periodizität,die der jeweils für vier Jahre gültige Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft vorgibt und erhielt deshalb die Bezeichnung «Agrarpolitik 2011» (AP 2011).
Reformetappen seit 1992
Etappe 1
■ Einführung produktunabhängiger Direktzahlungen
■ Preissenkungen
■ Anreiz für besondere ökologische Leistungen (z.B Biodiversität)
Etappe 2
■ Abschaffung Preis- und Absatzgarantien
■ Aufhebung Butyra und Käseunion
■ Bindung
Etappe 3
■ Aufhebung Milchkontingentierung
■ Versteigerung
Fleischimportkontingente
■ Umbau des Grenzschutzes (WTO)
Direktzahlungen an ökologischen Leistungsnachweis
■ Ausbau Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen Entkoppelung
Die AP 2011 ist ein weiterer konsequenter Schritt in der seit Beginn der neunziger Jahre laufenden Reform der Agrarpolitik.Die Landwirtschaft soll ihre gemeinwirtschaftlichen Leistungen auch künftig durch eine nachhaltige,auf den Markt ausgerichtete Produktion erbringen.
■ Leitbild der Beratenden Kommission
Die vom Bundesrat gestützt auf Artikel 186 des LwG eingesetzte Beratende Kommission hat im Jahr 2004 ein Leitbild der Schweizer Agrarwirtschaft für den Zeithorizont 2015 erarbeitet.Es enthält die Erwartungen der Gesellschaft an die Land- und Ernährungswirtschaft und konkretisiert damit die in der Verfassung festgehaltenen Ziele und Aufgaben der Landwirtschaft.In ihrem Leitbild lehnt die Beratende Kommission den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen und Tiere bei der Produktion von Lebensmitteln ab.Dieser Standpunkt entspricht dem Willen vieler Konsumenten und Produzenten,steht aber im Widerspruch zur offenen Haltung des Bundesrats in dieser Sache.
Leitbild der Beratenden Kommission Landwirtschaft für die Schweizer Agrarwirtschaft
Lebensmittelproduktion
Die Schweizer Landwirtschaft und ihre Partner in der Produkteverarbeitung und -verteilung gehören zu den international Führenden in der nachhaltigen Produktion von Rohstoffen und Lebensmitteln und tragen zur Ernährungssicherheit der Schweiz bei.
■ Sie nehmen in der umwelt- und tiergerechten Produktion von sicheren Lebensmitteln eine führende Position ein.
■ Sie bearbeiten erfolgreich wertschöpfungsstarke Marktsegmente im In- und Ausland und erschliessen neue Märkte.
■ Sie bieten den Konsumentinnen und Konsumenten hervorragende Produkte für eine gesunde Ernährung an und nutzen ihre Möglichkeiten für eine eigenständige Versorgung der Schweiz mit Lebensmitteln.
■ Sie verzichten bei der Produktion oder Verarbeitung von Lebensmitteln auf den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen und Tiere.
Öffentliche Güter und Dienstleistungen
Die Schweizer Landwirtschaft sichert die Bodenfruchtbarkeit,gestaltet die Kulturlandschaften und ist eine starke Partnerin im ländlichen Raum.
■ Sie gestaltet die Kulturlandschaften durch Bewirtschaftung und Pflege und erhält die Vielfalt von Pflanzen und Tieren.
■ Sie erhält die Bodenfruchtbarkeit und sichert das für die Versorgung der Bevölkerung notwendige Produktionspotenzial.
■ Sie ergänzt ihr Angebot an Rohstoffen und Lebensmitteln mit vielfältigen Dienstleistungen.
■ Sie stärkt das wirtschaftliche,soziale und kulturelle Leben im ländlichen Raum.
Unternehmer / Strukturen
Die Landwirtinnen und Landwirte sowie ihre Partner in der Produktverarbeitung und -verteilung handeln vorausschauend,unternehmerisch und vernetzt.
■ Sie sind innovativ,entscheiden weitsichtig und stellen sich den ändernden Rahmenbedingungen.
■ Sie erreichen gemeinsam hohe Marktanteile durch faire Preisbildung und Marktbedingungen sowie eine nachhaltige und effiziente Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette.
■ Sie handeln verantwortungsbewusst gegenüber Gesellschaft und Umwelt.
■ Die Landwirtinnen und Landwirte sichern die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Betriebe durch Wachstum,Spezialisierung,Diversifizierung oder Nebenerwerb.
■ Agrarpolitik 2011: Die nächste Etappe der Agrarreform
Die Grundzüge der AP 2011 wurden innerhalb der Verwaltung erarbeitet.Leitlinien bildeten dabei die in Art.104 der Bundesverfassung verankerten Ziele und das Leitbild der Beratenden Kommission.Der Bundesrat hat die Grundzüge der AP 2011 am 2.Februar 2005 verabschiedet.Bei der Erarbeitung der konkreten Massnahmen wurden nach dem Entscheid des Bundesrates breite Kreise einbezogen.Die interessierten Organisationen wurden im Rahmen von so genannten Landsgemeinden informiert,die landwirtschaftlichen Interessenvertreter mittels Produzentenforen laufend konsultiert.Die betroffenen Kreise haben die strategische Ausrichtung der AP 2011 mehrheitlich akzeptiert.Umstritten war hauptsächlich das Tempo der Reform.
■ Zentrale Herausforderungen
Obschon die Differenz in den vergangenen Jahren abgenommen hat,sind die Produzentenpreise für landwirtschaftliche Produkte in der Schweiz nach wie vor höher als jene in den umliegenden Ländern.Dasselbe gilt für die Kosten.Es besteht die Gefahr, dass bei einem Abbau des Grenzschutzes die Kosten nicht in dem Masse gesenkt werden können,dass die bäuerlichen Einkommen stabil bleiben.
Das Angebot und der Absatz für Schweizer Landwirtschaftsprodukte sind noch stärker auf die Bedürfnisse des Marktes auszurichten.Das Potenzial zur besseren Inwertsetzung der Produkte muss konsequent ausgenützt werden.
Die negativen Auswirkungen der landwirtschaftlichen Produktion auf die Umwelt haben stark abgenommen.Punktuell bestehen jedoch weiterhin Defizite.Bezüglich der Stickstoffbilanzüberschüsse und der ökologischen Ausgleichsflächen im Talgebiet wurden die gesteckten Ziele noch nicht erreicht.
Die Reduktion des Preisabstandes zu den umliegenden Ländern soll sozialverträglich ablaufen.Das heisst,dass der Abstand zwischen dem Einkommen der landwirtschaftlichen und der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung nicht mehr weiter zunehmen sollte.
■ Offensive Strategie
Die Strategie der AP 2011 besteht darin,die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produktion durch die Umlagerung eines grossen Teils der heute zur Preisstützung eingesetzten Mittel in nicht produktgebundene Direktzahlungen und durch eine Senkung der Futtermittelzölle zu verbessern.Dadurch wird die Schweizer Landwirtschaft in eine bessere Ausgangslage gebracht,spätere Reduktionen des Grenzschutzes (WTO,Freihandelsabkommen) zu bewältigen.Der Wegfall der Unterstützung von Verwertungsarten,die nur eine geringe Wertschöpfung erzielen,verbessert zudem die Marktausrichtung von Produktion und Verarbeitung.Die Qualität und der hervorragende Ruf der Schweizer Produkte kommen dadurch besser zur Geltung.Zur Unterstützung ihrer Inwertsetzung werden das bestehende Instrumentarium der Absatzförderung effizienter ausgestaltet und die Möglichkeiten zur Produktedifferenzierung erweitert.Die Weitergabe der Preissenkungen an die Konsumenten und Konsumentinnen soll mit einer konsequenteren Anwendung der Wettbewerbspolitik gefördert werden.Auch zur Reduktion der Preisdifferenzen auf der Kostenseite soll die Wettbewerbspolitik aktiv werden.Ergänzend dazu soll die Landwirtschaft mit weiteren Kostensenkungsmassnahmen wie der Aufhebung von Vorschriften entlastet werden.
Das sinkende Preisniveau verringert den Druck zur Intensivierung der Produktion.Die ökologischen Ausgleichflächen werden konkurrenzfähiger und der Anreiz für einen effizienteren Ressourceneinsatz wird grösser.Mit der Unterstützung von Projektinitiativen zur nachhaltigen Ressourcennutzung soll dieser Anreiz weiter verstärkt und ein Instrument zur gezielten Lösung der regionalen ökologischen Probleme geschaffen werden.Eine generelle Verschärfung der Auflagen ist nicht notwendig.Vielmehr sollen unter Beibehaltung des ökologischen Leistungsstandards verschiedene Auflagen vereinfacht werden.
Der Strukturwandel soll durch Lockerungen im Boden- und Pachtrecht sowie Erleichterungen bei der Rückzahlung von Investitionskrediten gefördert werden.Wie sich die Strukturen entwickeln,hängt auch von der Entwicklung der übrigen Wirtschaft und den Arbeitsmöglichkeiten im ländlichen Raum ab.Im Weiteren sollen die Familienzulagen für die Landwirtschaft erhöht werden.Insgesamt soll mit der AP 2011 eine sozialverträgliche Entwicklung der Landwirtschaft ermöglicht werden.
Ausgehend von den Herausforderungen und der Strategie wurden der AP 2011 die folgenden fünf Handlungsachsen zugrunde gelegt:
1Die Konkurrenzfähigkeit von Produktion und Verarbeitung durch Umlagerung von Marktstützungsmitteln in Direktzahlungen und durch Massnahmen zur Kostensenkung verbessern.
2Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft unter Einbezug der umgelagerten Mittel mit einem vereinfachten Direktzahlungssystem sicherstellen.
3Die Wertschöpfung und die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums fördern durch Erweiterung der Produktdifferenzierungsmöglichkeiten,Straffung der Absatzförderung und Unterstützung landwirtschaftlicher Projektinitiativen.
4Den Strukturwandel sozial abfedern und durch eine Lockerung des Boden- und Pachtrechts fördern.
5Die Administration vereinfachen und die Kontrollen besser koordinieren.
Das Gesamtkonzept der AP 2011 wird im Rahmen der Vernehmlassung dargestellt (www.blw.admin.ch;Dossier «Agrarpolitik 2011»).In der Vernehmlassungsunterlage werden nebst den Gesetzesänderungen auch die geplanten Anpassungen auf Verordnungsstufe skizziert.Im Bereich des Landwirtschaftsgesetzes können die Vorschläge zu einem grossen Teil auf Verordnungsebene realisiert werden.Insbesondere die Gesetzesgrundlage für eine Umlagerung von Milchpreisstützungsmitteln in Direktzahlungen hat das Parlament bereits mit der Agrarpolitik 2007 geschaffen.
Kernelement der AP 2011 ist die Umlagerung der heute zur Preisstützung eingesetzten Mittel in produktunabhängige Direktzahlungen und die Senkung der Futtermittelzölle. Ab 2009 sollen praktisch keine Marktstützungsmittel mehr an die nachgelagerten Verarbeitungs- und Handelsstufen fliessen.Im Gegenzug soll die Landwirtschaft auf der Kostenseite entlastet werden.
■ Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft
Seit dem Jahr 2000 wird der grösste Teil der Ausgaben zur Stützung der Landwirtschaft vom Parlament in drei Zahlungsrahmen für jeweils vier Jahre beschlossen.Für die Jahre 2008 bis 2011 sieht der Bundesrat in den drei Zahlungsrahmen insgesamt 13’458 Mio.Fr.vor;dazu kommen 80 Mio.Fr.für die Finanzierung der Anpassungen bei den Familienzulagen in der Landwirtschaft.
Entwicklung der drei Zahlungsrahmen
■ Auswirkungen und weiteres Vorgehen
Quellen:EFD,BLW
Innerhalb der drei Zahlungsrahmen ergibt sich aufgrund der Umlagerung eine Verschiebung von der Marktstützung zu den Direktzahlungen.Nach 2009 werden sich die jährlichen Ausgaben für die Marktstützung noch auf rund 300 Mio.Fr.pro Jahr belaufen.
Mit der AP 2011 können die Verfassungsziele auch in Zukunft erreicht werden.Gemäss den ersten Modellrechnungen der Agroscope FAT Tänikon ist davon auszugehen,dass die landwirtschaftliche Produktion flächendeckend erhalten bleibt und die Landwirtschaft so die gemeinwirtschaftlichen Leistungen weiterhin erbringen wird.Nachfolgend werden provisorische Resultate dargestellt.Der Wert der Erzeugung sinkt von 9,2 im Jahr 2001 auf 7,7 Mrd.Fr.im Jahr 2009 (–15,9%).Ein Teil dieses Verlustes wird aufgefangen durch den Rückgang der Fremdkosten um 4,8%.Dies ergibt unter Berücksichtigung der von der Marktstützung zu den Direktzahlungen umgelagerten Mittel einen Rückgang des Nettounternehmenseinkommens von rund 520 Millionen Franken (–17,4%).
Der Druck auf die Landwirtschaft bleibt somit hoch.Das Nettounternehmenseinkommen nimmt jährlich um 2,4% ab.Nimmt die Anzahl Betriebe im bisherigen Rhythmus ab,bleibt das Einkommen pro Betrieb nominal konstant.Damit die Kaufkraft der betrieblichen Einkommen erhalten bleibt,müsste der Strukturwandel gemäss den Modellrechnungen in der Periode 2001 bis 2009 mindestens 3,2% pro Jahr betragen.
Der Bundesrat hat das EVD am 14.September 2005 ermächtigt,eine breite Vernehmlassung zur AP 2011 durchzuführen.Diese dauert bis am 16.Dezember 2005.Nach Auswertung der Stellungnahmen will der Bundesrat die Botschaft im Frühling 2006 verabschieden,damit die parlamentarischen Beratungen zwischen September 2006 und März 2007 stattfinden können.Die Gesetzesanpassungen sollen gleichzeitig mit den neuen Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft auf den 1.Januar 2008 in Kraft treten.

Die Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen betrifft auch die Landwirtschaft in zunehmendem Masse.Auf globaler Ebene ist die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk der WTO eingeflochten.Angesichts der geographischen Konzentration des Agrarhandels sind die vertraglichen Beziehungen zur EU und die zunehmende Integration in Europa für die Schweizer Landwirtschaft von grösster Bedeutung.
Um ihre Exportmöglichkeiten zu erhalten und verbessern,ist die Schweiz auf einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten angewiesen.Die Schweiz setzt sich zudem auf internationaler Ebene stark dafür ein,dass die multifunktionalen Eigenschaften der Landwirtschaft in den internationalen Abkommen stärker berücksichtigt werden.
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung und behandelt die internationalen Themen im dritten Kapitel.
–Abschnitt 3.1 enthält Informationen über den aktuellen Stand im Europa-Dossier, bei den WTO-Verhandlungen und bei den Freihandelsabkommen.
–In Abschnitt 3.2 geht es um internationale Vergleiche.Im vorliegenden Bericht werden die im Jahr 2000 begonnenen internationalen Preisvergleiche fortgeführt sowie ein Vergleich zwischen Schweizer- und EU-Betrieben auf der Basis von Buchhaltungszahlen und eine vergleichende Analyse von Cross Compliance in der EU und Ökologischem Leistungsnachweis in der Schweiz präsentiert.
3.1 Internationale Entwicklungen

In der Berichtsperiode beschränkten sich die Entwicklungen im Verhältnis zur Europäischen Union hauptsächlich auf die Inkraftsetzung des revidierten Protokolls 2 über verarbeitete Landwirtschaftsprodukte.Dieses Abkommen bringt für die Nahrungsmittelindustrie erhebliche Verbesserungen und einige Einsparungen für den Steuerzahler.Als Neuerung bei den Marktordnungen ist damit auch die Andockung des schweizerischen Zuckerregimes an dasjenige der EU verbunden.Im Agrarabkommen wurden lediglich einige Anpassungen technischer Natur vereinbart.Auch der Agrarhandel mit der EU verlief in ruhigen Bahnen;die Käseexporte konnten leicht zunehmen. Positiv vermerkt werden kann eine weitereadministrative Erleichterung an der Grenze zu unseren Nachbarländern.Bedauerlich ist hingegen,dass die der Schweiz gewährten Zollpräferenzen bisher weniger gut genutzt werden als in umgekehrter Richtung.
Intensiv,aber ohne massgebliche Entscheide verlief die Agrarverhandlung im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO).Nach der Einigung über das weitere Vorgehen am 1.August 2004 wurden in acht Verhandlungsrunden und vier «Miniministerkonferenzen» die Parameter für die «Modalitäten» etwas näher definiert,mit welchen nach einem erfolgreichen Abschluss der nächsten Ministerkonferenz (Hongkong, Dezember 2005) die neuen Konzessionslisten erstellt und finalisiert werden sollen.Die Auswirkungen der daraus resultierenden Marktöffnungen können natürlich erst nach Vorliegen der genauen Zollreduktionszahlen und anderen Verpflichtungen berechnet werden.Doch zeichnet sich schon jetzt ein erheblicher Druck auf Produzentenpreise und Produktionsvolumen im Inland ab,welcher über die mit der nächsten Etappe der Agrarreform (AP 2011) verbundenen Anpassungen gehen dürfte.Eine wirtschaftlich und sozial verträgliche Umsetzung der WTO-Verhandlungsresultate wird deshalb nur über zwei solche Reformperioden und mit besonders grossen Anstrengungen seitens der produzierenden Landwirtschaft möglich sein.Dabei wird sie auch auf die Unterstützung von aussen angewiesen sein.
■ Entwicklungen
Agrarabkommen Schweiz – EU
Das Abkommen vom 21.Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrarabkommen) ist am 1.Juni 2002 in Kraft getreten.Es strebt eine Verbesserung des gegenseitigen Marktzutritts für Agrarprodukte durch Abbau von Zöllen,Exportsubventionen sowie technischen Handelshemmnissen an und anerkennt die technischen Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz,biologische Landwirtschaft und teilweise Veterinärmedizin sowie die Qualitätsnormen für Früchte und Gemüse als gleichwertig.
Schwerpunkt des tarifären Teils ist die vollständige gegenseitige Liberalisierung des Käsehandels.Ab 1.Juni 2007 können zwischen der Schweiz und der EU alle Käsesorten frei,d.h.ohne jegliche mengenmässigen Beschränkungen,Exportbeihilfen oder Zölle,gehandelt werden.Aufgrund der Entwicklung im Käsehandel seit dem Inkrafttreten gibt es keine Anzeichen dafür,dass 2007 substanzielle Marktanteilsverschiebungen zu erwarten sind.Hingegen eröffnen sich durch den ungehinderten Zugang (auch durch den Wegfall der gesundheitspolizeilichen Zertifikate und Gebühren) besonders für neue und KMU-Exporteure von verschiedenen Käsespezialitäten Marktchancen,die erfreulicherweise bereits heute zunehmend genutzt werden.

Der Gemischte Ausschuss zum Agrarabkommen Schweiz – EG tagte am 27.Oktober 2004 zum vierten Mal.Die Sitzung fand unter dem Vorsitz der EG-Kommission in Bern statt.Schwerpunkte waren die Arbeiten der zehn vom Ausschuss eingesetzten Arbeitsgruppen sowie die Umsetzung der im Rahmen der EU-Osterweiterung gewährten Konzessionen.
Das Agrarabkommen wurde in den Bereichen Pflanzenschutz,Saatgut,biologische Erzeugnisse sowie Früchte und Gemüse aktualisiert.Die Gleichwertigkeit biologischer Erzeugnisse konnte auf die tierischen Produkte,inklusive Imkereiprodukte,ausgedehnt werden.Anpassungen der Anhänge Weinbauprodukte und Spirituosen sind vorbereitet,bedürfen aber noch der Zustimmung durch den EG-Ministerrat.
Nachdem das BSE-Problem im Rahmen des Veterinärabkommens gelöst werden konnte,wird das bilaterale Abkommen auch im Bereich Trockenfleisch umgesetzt.Die gegenseitig eingeräumten Kontingente können nun seit dem 1.Januar 2005 vollständig genutzt werden.
Als Folge der EU-Erweiterung am 1.Mai 2004 wurden die existierenden Freihandelsund Agrarabkommen von den neuen Mitgliedsstaaten gekündigt.Die diesen Ländern vordem gewährten Präferenzzölle wurden der EU-25 in der Form von Zollkontingenten übertragen.Im Gegenzug zu gewissen WTO-Zollerhöhungen in einigen der neuen Mitgliedsstaaten erhält die Schweiz Konzessionen im Bereich Lebendvieh und Gemüse (Witloof).Sämtliche Konzessionen sind rückwirkend per 1.Mai 2004 in Kraft getreten.
Eine speziell dafür eingesetzte Arbeitsgruppe befasst sich mit der Frage der in der Schweiz und EU geschützten geographischen Angaben.Die laufenden Gespräche sollen zu einer gegenseitigen Anerkennung der geographischen Angaben in Form eines neuen Anhanges zum Agrarabkommen führen.
Das Protokoll Nr.2 zum Freihandelsabkommen Schweiz – EG von 1972 regelt den Handel von verarbeitete Landwirtschaftsprodukten zwischen der Schweiz und der EU. Am 1.Februar 2005 trat das im Rahmen der «Bilateralen 2» revidierte Protokoll Nr.2 vorzeitig in Kraft.Die beiderseitige Ratifizierung erfolgte bereits auf den 1.April 2005. Die Revision bringt folgende Verbesserungen:
1.Revision des Preisausgleichmechanismus:Im Rahmen eines vereinfachten Preisausgleichmechanismus verpflichtet sich die EU ihre Zölle auf Schweizer Produkte vollständig abzubauen und verzichtet zudem auch auf Exportsubventionen.Die Schweiz reduziert ihrerseits ihre Zölle und Exportrückerstattungen oder baut sie in bestimmten Fällen ebenfalls ganz ab.
2.Ausdehnung und Revision des Deckungsbereichs:Die Palette der vom Abkommen abgedeckten Produkte wurde ausgedehnt.
Nutzen der Revision:
–verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Nahrungsmittelproduktion im EURaum durch den zollfreien Zugang zu einem Markt von 450 Mio.Konsumenten;
–der erweiterte Deckungsbereich umfasst ein Handelsvolumen von rund 1,3 Mrd.Fr. oder rund einen Drittel mehr;
–sinkende Preise für Schweizer Konsumenten durch verstärkten Wettbewerb;
–neue Chancen für die Schweizer Landwirtschaft als Zulieferer einer wettbewerbsfähigeren Nahrungsmittelindustrie;
–Einsparung von rund 30 Mio.Fr.an Ausfuhrbeiträgen und 30 Mio.Fr.an Zollrückerstattungen;
–der Produktions- und Forschungsstandort Schweiz für Nahrungsmittel wird gestärkt.
Kosten der Revision:
–rund 90 Mio.Fr.weniger Zolleinnahmen durch die Einführung der Netto-PreisKompensation;
–stark zuckerhaltige Exportprodukte können nicht mehr mit Zucker zum Weltmarktpreis hergestellt werden (Doppel-Null-Lösung Zucker:beidseits der Grenze wird nur noch Zucker aus dem freien Marktverkehr zur Herstellung der Exportprodukte beschafft);
–durch den Abbau des Grenzschutzes werden u.a.Schweizer Brennereien,Bierbrauereien und Essighersteller zusätzlichem Druck ausgesetzt.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
Die Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union (EU) konzentriert sich einerseits auf die Neuordnung des Zuckermarktes und andererseits auf die Budgetrevision.
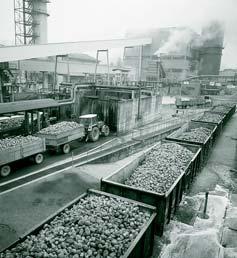
Die Europäische Kommission hat am 22.Juni 2005 vorgeschlagen,den Referenzpreis für Zucker als Ersatz für den Interventionspreis 2006/07 auf 505.5 Euro/t (–20%) und ab 2007/08 auf 385.5 Euro/t (insgesamt –39%) herabzusetzen.Der Mindestpreis für Zuckerrüben würde 2006/07 von 32.86 Euro/t (–24,7 %) auf 25.05 Euro ab 2007/08 zurückgehen (insgesamt –42,6%).Zwar plant die Kommission die Zusammenfassung der A- und B-Quote,sie hat aber eingesehen,dass obligatorische Quotensenkungen oder Quotentransfers zwischen den Mitgliedstaaten nicht durchsetzbar wären.Aus diesem Grund erarbeitet sie nun ein freiwilliges Umstrukturierungskonzept für den Zuckersektor,das über einen Zeitraum von vier Jahren umgesetzt werden soll.Auf diese Weise könnte Fabriken,die ihre Tätigkeit einstellen und auf ihre Quote verzichten,eine degressive Finanzhilfe von 730 Euro pro Quotentonne 2006/07 bzw.noch 370 Euro 2009/10 ausgerichtet werden.Zuckerrübenpflanzer,die infolge dieser Fabrikschliessungen ihre Produktion aufgeben,erhielten indessen Ergänzungszahlungen. Deren Finanzierung würde durch eine entsprechende Abgabe auf allen Süssstoffquoten erfolgen.Dank dieser Direktzahlungen über die nationalen Zahlungsrahmen (insgesamt 896 Mio.Euro 2006/07 bzw.1,531 Mrd.ab 2007/08) könnten 60% des erwarteten Einkommensverlusts ausgeglichen werden.Der Ministerrat wird voraussichtlich erst anfangs 2006 über die Vorschläge befinden.Die Auswirkungen dieser europäischen Zuckermarktreform auf die Schweiz werden unter Punkt 2.1.4 behandelt.
Betreffend die Budgetrevision schlagen sechs Mitgliedstaaten eine Kürzung auf 1% des BIP vor.Da 46% des Budgets (2005 = 44 Mrd.Euro,davon 5 Mrd.für ländliche Entwicklung) der Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik dient,würde eine solche Reduktion die am EU-Gipfel im Oktober 2002 beschlossene Stützung der Einkommen und Agrarmärkte in Frage stellen (Finanzperspektiven 2007–2013).Dieser Budgetdruck könnte auch zu spürbaren Einschnitten bei den von der Europäischen Kommission gewährten Geldern für die ländliche Entwicklung führen.
WTO
Nach der Verabschiedung des Rahmenabkommens («Framework») am 1.August 2004 traten die Agrarverhandlungen in eine intensive Phase,während welcher vier Ministerkonferenzen im kleinen Kreis stattfanden.An einem dieser Ministertreffen im Mai in Paris,an dem ebenfalls der EVD-Vorsteher teilnahm,fand mit der Einigung über die Umrechnungsmethode für Zölle in Wertzölle (englische Abkürzung:AVE) ein seit vergangenem Jahr auf dem Verhandlungsprogramm stehendes Kapitel seinen Abschluss. An einem weiteren Treffen in der chinesischen Stadt Dalian im Juli 2005 präsentierte die G-20 den 32 anwesenden Ministern einen sehr weitreichenden Vorschlag zu allen drei Verhandlungsfeldern des Agrardossiers.Dank dieser Vorlage konnte die jeweilige Position der WTO-Mitglieder geklärt werden.Im Bereich Marktzutritt begrüssten die meisten Konferenzteilnehmer den Vorschlag der G-20 als brauchbare Grundlage für die Fortsetzung der Verhandlungen.
Wertzolläquivalente
Damit die verschiedenen Schutzniveaus (und die künftigen Zugeständnisse) miteinander vergleichbar sind,müssen alle Nicht-Wertzölle (NAV) in Wertzolläquivalente (AVE) umgewandelt werden.Dank des Umrechnungsverfahrens können die Zollpositionen in die Bänder einer abgestuften Abbauformel eingeteilt werden.Dabei werden nur abbaupflichtige Zölle ausserhalb eines Kontingents bzw.ohne Kontingent berücksichtigt.
Mit dem «Paris-Kompromiss» über die Zollumrechnung konnte ein zwar technisches, aber deswegen nicht weniger wichtiges Etappenziel der Verhandlungen erreicht werden.Die betroffenen Mitglieder unterbreiteten darauf der WTO ihre Wertzolläquivalente,deren Überprüfung immer noch im Gange ist.
Abgestufte Formel
Seit Juni 2005 konzentrierten sich die Verhandlungsgespräche auf die Zollabbauformel selbst,die strittigste Frage im Dossier Marktzutritt.Folgende Punkte standen zur Diskussion:
– Anzahl Tarifbänder;
– Schwellen für jedes einzelne Band;
– Abbaurate für jedes einzelne Band;
– Inversionsproblem bei den Bandübergängen (grössere Reduktion bei Zöllen des unteren Bandes als bei denjenigen des unmittelbar darüber liegenden Bandes);
– Sensible Produkte,deren Auswahl und insbesondere Behandlung ebenfalls von der Zollabbauformel abhängt;
– Spezielle Produkte (von Interesse für die Entwicklungsländer);
– besondere Schutzmassnahmen.
■ Inlandstützung
Beim Zollabbau lagen während einiger Monate die so genannte «Harbinson-Formel» (lineare Zollsenkung mit einer durchschnittlichen und einer minimalen Senkungsrate) und die «Swiss Formula» (stark harmonisierende Formel mit einer Obergrenze in jedem Band) auf dem Verhandlungstisch.An der Mini-Ministerkonferenz im Juli 2005 stiess der Vorschlag der G-20 einer strikt linearen Abbauformel mit von Band zu Band zunehmenden Senkungsraten auf grosses Interesse.Nach dem Plan der G-20 sollen die Zolltarife der WTO-Mitglieder in fünf Bänder (Schwellenwerte von 20,40,60 bzw.80% AVE) mit einer strikt linearen Reduktion eingeteilt werden.Bedingt durch die fünf Bänder,den tiefen Schwellen zwischen den einzelnen Bändern und den vom ersten zum fünften Band ansteigenden Kürzungskoeffizienten ergibt sich ein starker Progressionseffekt.Ausserdem sollen die Zölle der Industriestaaten auf 100% begrenzt werden.Die Europäische Kommission forderte ihrerseits flexiblere Kürzungssätze für die einzelnen Bänder,sodass bestimmte Zolltarife innerhalb einer zulässigen Spanne vom Zielwert ausgehend begrenzt variabel sind.
Eine grössere Flexibilität ist für die Europäische Gemeinschaft und insbesondere die Netto-Agrarimporteure wie die Schweiz und die restlichen Mitglieder der G-10 ein konkretes Bedürfnis.Es bleibt daher abzuklären,ob die geforderte Flexibilität innerhalb der Abbauformel oder bloss bei der Definition der sensiblen Produkte gewährt wird. Die Zölle auf den sensiblen Produkten werden nach einer anderen Methode gekürzt werden.Die Exporteure möchten die Abbauformel möglichst progressiv gestalten und die Frage der Flexibilität ausschliesslich über die sensiblen Produkte regeln.Den Importeuren ist indessen bewusst,dass der Preis für Zugeständnisse bei der Auswahl der sensiblen Produkte ebenfalls zu harten Verhandlungen führen wird.Aus diesem Grund hat für sie die Flexibilisierung innerhalb der Abbauformel Vorrang.
In diesem Kapitel stehen die Modalitäten des substanziellen Abbaus der Inlandstützung mit handelsverzerrenden Auswirkungen auf dem Verhandlungsprogramm. Genauer geht es darum,zu entscheiden,wie die Inlandstützung abzubauen ist,das heisst die Anzahl Bänder und die Einteilung der Länder mit einem relevanten Agrarstützungsniveau in diese Bänder sind festzulegen.Bei den abzuschaffenden handelsverzerrenden Stützungen und den Subventionen der Amber-Box zeichnet sich eine Kompromisslösung ab,indem die WTO-Mitglieder in drei Reduktionsbändern ihrem absoluten Stützungsniveau entsprechend eingeteilt werden (EU,USA/Japan,restliche Staaten),wobei jene Mitglieder mit einer gemessen am Produktionswert relativ hohen Stützung (Japan und EFTA-Länder) einen zusätzlichen Subventionsabbau zu leisten haben.
Die weiteren Formen der Inlandstützung und insbesondere die Überarbeitung der im Agrarabkommen festgelegten Kriterien der Green Box wurden ebenfalls behandelt.In der jetzigen Phase wird es sich hauptsächlich um formelle Präzisierungen und unter Umständen einen gewissen Durchbruch für die Entwicklungsländer handeln.Die Direktzahlungen werden grundsätzlich nicht in Frage gestellt.Die WTO wird auch keine Maximalhöhe vorsehen.
■ Exportwettbewerb
Nachdem im August 2004 die Aufhebung aller Exportsubventionen beschlossen wurde,drehen sich die Gespräche um alle weiteren den internationalen Handel beeinträchtigenden Instrumente wie Exportkredite,Staatshandel und Nahrungsmittelhilfe. Für die Nahrungsmittelhilfe werden von einigen WTO-Mitgliedern die Überschüsse an Agrarerzeugnissen dafür verwendet.In der Verhandlung geht es daher um die Unterscheidung zwischen «echter» Nahrungsmittelhilfe und derjenigen,die bloss der Umgehung der WTO-Disziplinen im Bereich Exportsubventionen dient.Die Abschaffung der Exportsubventionen – ev.bereits 2010 – könnte als Teil des gesamten Verhandlungspakets mit einer Finalisierung der noch offenen Punkte in den betreffenden Dossiers schnell beschlossen werden.
■ Verhandlungsfahrplan
Seit der Verabschiedung des «Framework» hielt der Agrarausschuss acht Sitzungen ab. Da Ende Juli 2005 die Verhandlungen für eine Einigung über eine erste Approximation der Modalitäten zu wenig fortgeschritten waren,musste sich der Präsident des Agrarausschusses mit einer Art Bestandesaufnahme über die noch zu behandelnden Fragen begnügen.Ab September 2005 nehmen die Unterhändler die Verhandlungen erneut auf,um einen Modalitätenentwurf zu erarbeiten.Dieser soll in Hongkong von den Ministern genehmigt werden und der Erstellung der Konzessionslisten für die einzelnen WTO-Mitglieder dienen.
Nach Fahrplan sind die neuen Listen für 2006 vorgesehen und das Schlussabkommen dürfte frühestens Ende 2006 abgeschlossen werden.Die Ratifizierung auf nationaler Ebene könnte demzufolge 2007 erfolgen und die Umsetzung der Ergebnisse der DohaRunde 2008 beginnen.
Freihandelsabkommen
Neben den «Bilateralen I und II» mit der EU hat die Schweiz im Rahmen der EFTA bereits seit den neunziger Jahren mit verschiedenen Ländern Freihandelsabkommen abgeschlossen.Zurzeit bestehen 14 Freihandelsabkommen:Israel (in Kraft seit 1.7.1993),Jordanien (2002),Marokko (1999),Palästinensische Befreiungsorganisation PLO (1999),Türkei (1992),Bulgarien (1994),Kroatien (2002),Mazedonien (2002),Rumänien (1994),Mexiko (2001),Singapur (2003);in der Berichtsperiode traten gleich drei neue Abkommen in Kraft:mit Chile (1.12.2004),Libanon (1.1.2005) und Tunesien (1.6.2005).
Es ist weltweit eine rasch zunehmende Tendenz zu Freihandelsabkommen festzustellen.Die Schweiz ist bekanntlich eine stark exportorientierte Wirtschaft.Um zu verhindern,dass die Schweizer Exportindustrie gegenüber ihren Hauptkonkurrentinnen auf Drittmärkten diskriminiert wird,muss sie mittels Freihandelsabkommen für «gleich lange Spiesse» sorgen.Sie tut dies vornehmlich in Zusammenarbeit mit den EFTAPartnern Norwegen,Island und Liechtenstein.Die Auswahl der Partnerländer wird massgeblich durch die von der EU bereits ausgehandelten Freihandelsabkommen bestimmt,da die Exporteure unserer Nachbarländer auf Drittmärkten in der Regel die wichtigsten Konkurrenten für Schweizer Anbieter darstellen.
Die Abkommen decken folgende Gebiete ab:
–Warenverkehr (Industrie und Landwirtschaft);

–Dienstleistungen (Finanzen,Versicherungen usw.);
–Öffentliches Beschaffungswesen;
–Investitionen;
–Geistiges Eigentum.
Mit den nachfolgenden Staaten sind Verhandlungen im Gange oder werden in Kürze aufgenommen:
–Ägypten und Algerien (Barcelona-Prozess zur Errichtung einer Euromediterranen Freihandelszone bis 2010)
–Südafrika
–Südkorea
–Thailand
–Kanada
–Mercosur (Argentinien,Uruguay,Paraguay und Brasilien)
–Indonesien
–Japan
–Ukraine
–Russland (sobald dieses Land WTO-Mitglied ist)
–Korporation der Golf-Staaten (Kuwait,Katar,Oman,Saudi-Arabien,Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate)
–Syrien
–Serbien und Montenegro
–USA (eventuell)
■ High Level Meeting des Agrarkomitees
OECD
Unter dem Vorsitz des ehemaligen EU-Agrarkommissars Franz Fischler fand am 14.und 15.Juni 2005 in Paris ein High Level Meeting (HLM) des OECD-Agrarkomitees statt. Die OECD organisiert alle vier bis fünf Jahre solche Treffen,mit welchen der informelle Austausch zu aktuellen Themen der Agrarpolitik zwischen hohen Regierungsvertretern gefördert werden soll.Nebst den Delegationen der OECD-Mitgliedsländer und internationalen Organisationen wie der Weltbank und der FAO nahmen auch Delegationen aus Brasilien,China,Indien und Südafrika an der Veranstaltung teil.
Zwei Fragen wurden ins Zentrum der Diskussion gerückt:Welches sind die aktuellen Ziele der Agrarpolitik,und in welchem Zusammenhang stehen die diesbezüglich ergriffenen Massnahmen mit der Liberalisierung des Agrarhandels?
Aus der Debatte ging hervor,dass die Agrarpolitik zunehmend von gesellschaftspolitischen Bedürfnissen gesteuert wird – ein Phänomen,welches auch die Schweiz zu Reformen veranlasste.Dies führt dazu,dass immer mehr Länder die Agrarstützung von der Produktion entkoppeln und gezielte Direktzahlungen einführen,um auch ökologische und soziale Funktionen der Landwirtschaft berücksichtigen zu können.Uneinigkeit beherrschte die Diskussion um die interne Marktstützung.Während vor allem die Agrarexportländer diese nur als zeitlich beschränkte Massnahme anerkennen wollten, unterstrichen die vorwiegend importierenden Länder deren Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung der agrarpolitischen Zielerreichung,insbesondere im Bereich der Vergütung von landwirtschaftlichen Leistungen,welche nicht vom Markt abgegolten werden.
Aus Schweizer Sicht verlief das Treffen befriedigend.Die Schweizer Delegation nutzte die Gelegenheit,auf die Notwendigkeit einer Unterscheidung der Agrargüter nach Qualität und Herkunft hinzuweisen und die Bedeutung der zusätzlich zur landwirtschaftlichen Aktivität anfallenden Leistungen und die in diesem Zusammenhang ergriffenen Massnahmen zu unterstreichen.Für beide Anliegen konnte ein wachsendes Verständnis auch von Seiten der Agrarexportländer festgestellt werden.Die Schweiz kritisiert hingegen nach wie vor die Tatsache,dass die Verlagerung der Agrarstützung im Producer Support Estimate (PSE) nur ungenügend zum Ausdruck kommt.Beim PSE handelt es sich um einen Indikator,welcher den Anteil der Agrarstützung am Markterlös der Landwirtschaft ausdrückt.Die OECD beabsichtigt,die Berechnung des PSE diesbezüglich zu verbessern.
3.2Internationale Vergleiche

Wozu ein internationaler Preisvergleich?
Ein internationaler Preisvergleich erlaubt eine Standortbestimmung.Er zeigt die Unterschiede bei den Produktionskosten der miteinander verglichenen Länder und beleuchtet die Gründe für den Einkaufstourismus über die Landesgrenzen.Folglich dient der Preisvergleich auch dazu,entsprechende Massnahmen an den Grenzen zu treffen (Zölle und Exportbeihilfen).Schliesslich führt er den Steuerzahlern auch vor Augen, dass die Schweizer Landwirtschaft enorme Anstrengungen unternimmt,um im Preiswettbewerb bestehen zu können.
Methode und Definition
Der internationale Preisvergleich erfolgt auf Grund identischer,ähnlicher oder wichtiger Märkte.Damit sind jedoch gewisse Schwierigkeiten verbunden wie die Auswahl der Produkte,die Verfügbarkeit der Daten,die Relevanz der Messgrössen,die unterschiedlichen Produktions- und Verkaufsformen oder die währungsspezifischen Einflüsse.Bei den in diesem Kapitel verwendeten Preisen handelt es sich um:
–Nationale Durchschnittswerte:minimale bzw.maximale Werte werden je nach Region oder Verwertung des Erzeugnisses (Produzentenpreis) verdeckt.
–Grössenordnungen,denn die Erzeugnisse (Qualitäts-,Labelprodukte),Vermarktungsbedingungen (Menge,Vermarktungsgrad),Absatzkanäle und Berechnungsmethoden des Durchschnittswertes unterscheiden sich von Land zu Land.

–Bruttopreise;das heisst: –die auf dem Markt beobachteten Preise (im Rahmen der Agrarpolitik jedes einzelnen Landes).Die Produzentenpreise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Diese ist jedoch in den Konsumentenpreisen eingeschlossen,da es sich um eine vom Konsumenten zu leistende Abgabe handelt. –Die Preise sind nicht nach der unterschiedlichen Kaufkraft der beobachteten Länder bereinigt.Siehe hierzu die UBS-Studie «Preise und Löhne».Ein Kaufkraftund Lohnvergleich rund um die Welt,2003.(http://www.ubs.com/1/f/about/ newsalert?newsId=74356)
Es stehen daher nicht die absoluten Werte,sondern die Veränderungen im Verlaufe der Zeit im Vordergrund.
Die aus dem Verkauf eines «Standardwarenkorbes» erzielten Einnahmen der Produzenten dienen als Vergleichsgrundlage.Der Standardwarenkorb setzt sich aus der durchschnittlichen Produktion (1998–2000) der Schweiz von 15 der 17 landwirtschaftlichen Erzeugnisse zusammen,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleichs sind.Da die Statistiken über Zuckerrüben und Raps der USA nicht verfügbar waren,sind diese beiden Produkte nicht im Standardwarenkorb enthalten.Seine genaue Zusammensetzung ist am Ende der Tabelle 52b im Anhang aufgeführt.Er entspricht 3,2 Mio.t Milch,2,7 Mio.Schweinen,35,5 Mio.Poulets usw.Die schweizerische Struktur wird folglich auf die verglichenen Länder übertragen.
Die Preise der EU (EU-4/6) beziehen sich auf die vier Nachbarstaaten.Die Länder fünf und sechs sind die Niederlande und Belgien.Sie werden für jene Produkte berücksichtigt,bei denen sie hohe Produktionsvolumen ausweisen.Der Durchschnittspreis für die EU-4/6 berechnet sich aus dem Produktionsvolumen 1995/2001 der betreffenden Länder.Die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes und das Gewicht der Länder der EU-4/6 sind als fix über die Zeit angenommen,um die Preisschwankungen aufzuzeigen.
Wie ist der Stand der schweizerischen Agrarpreise im Vergleich zur EU und den USA?
–Würden die Landwirte der EU-4/6 oder der USA den schweizerischen Standardwarenkorb produzieren und 2002/04 in ihren Ländern verkaufen,erzielten sie rund die Hälfte (54 resp.47%) der Einnahmen ihrer Schweizer Kollegen.In Kaufkraftparität ausgedrückt ergibt sich nach der oben erwähnten UBS-Studie ein weniger grosser Unterschied zur EU-4/6:Der Erlös würde in der EU-4/6 etwa 64% und in den USA 47% betragen.
–Je nach EU-Land sind jedoch Unterschiede auszumachen:Der Erlös des «Standardwarenkorbes» entspricht in Italien 63%,in Deutschland 54%,in Frankreich 53% und in Österreich 51% des Schweizer Preises 2002/04.
–Unterschiedliche Entwicklungen zeigten auch die einzelnen Produkte.Der Preis der Ackerbauprodukte wie Weizen (29% des schweizerischen Preises),Gerste (33%), Raps (44%) und Kartoffeln (51%) bewegt sich 2002/04 in der EU-4/6 auf einem ausgesprochen tiefen Niveau.Eine Ausnahme bilden die in der EU kontingentierten Zuckerrüben (52%).Im Gegensatz zu diesen Erzeugnissen erreicht die Milch,die ebenfalls kontingentiert ist,in der EU-5 einen ziemlich hohen Preis (62%).
–Im Vergleich «Land-Produkt» zeigen sich folglich noch viel grössere Abweichungen. Während 2002/04 in Frankreich Birnen zu 92% des schweizerischen Preises verkauft wurden,erhielten österreichische Bauern für Karotten lediglich 19% des Entgelts der Schweizer Landwirte.
Entwicklung der Produzentenpreise in der EU und der Schweiz
(100 kg)
(20 kg)
(5 kg)
(10 kg)
(10 kg)
(10 kg)
(10 kg)
(5 kg)
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV Eurostat, ZMP, Agreste
Produzentenpreise in der EU-4/6 im Vergleich zur CH
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV Eurostat, ZMP, Agreste
Ist eine Annäherung der schweizerischen Agrarpreise an diejenigen der EU und der USA zu beobachten?
–In der Zeitspanne zwischen 1990/92 und 2002/04 gingen die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) für den Standardwarenkorb nicht nur in der Schweiz (–25%), sondern auch im EU-Raum (–21%) zurück.In der EU ist die Entwicklung nicht nur auf die Agrarreformen,sondern auch auf die Schwächung des Euro zurückzuführen, der gegenüber dem Schweizer Franken 15% eingebüsst hat.
–Der relative Abstand zwischen der Schweiz und der EU hat daher im beobachteten Zeitraum nur leicht abgenommen.1990/92 betrug der Preis des Standardwarenkorbes in der EU 51% gegenüber aktuell 54% (2002/04) der Schweizer Preise.
–Die grösste Angleichung an die EU-Preise wird indessen in absoluten Werten verzeichnet.Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den benachbarten EULändern,die 1990/92 noch 49% (3’553 Mio.Fr.) der schweizerischen Preise betrug, sank 2002/04 auf 46% (2’546 Mio.Fr.).Die absolute Preisdifferenz zwischen der Schweiz und der EU hat sich zwischen den beiden Perioden um mehr als einen Viertel (–28%) verkleinert.
–Je nach EU-Land sind jedoch Unterschiede auszumachen:Zwischen den genannten Zeitspannen reduzierte sich die absolute Preisdifferenz für einen Standardwarenkorb am meisten zu Frankreich (–33%),Deutschland (–28%) und Italien (–28%), während das Preisgefälle zu Österreich nach dessen EU-Beitritt am 1.Januar 1995 etwas weniger deutlich abnahm (–7%).
–Unterschiede ergeben sich auch nach Produkten:Zwischen 1990/92 und 2002/04 reduzierte sich der absolute Abstand zwischen der EU und der Schweiz am meisten bei Raps (–71%),Eiern (–44%),Milch (–40%) und Weizen (–42%),während sich die Preisschere bei den Schweinen (–11%) und bei den Grossrindern (0%) weniger schloss und bei den Zwiebeln (+99%) sogar weiter öffnete.
■ Konsumentenpreise
–In den USA nahm die Entwicklung seit 1990/92 einen anderen Verlauf.Die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) zeigten bis 2001 eine steigende Tendenz (+28%) und verzeichneten danach bis 2003 einen Rückgang.2004 war erneut ein Anstieg feststellbar.In den Jahren 2002/04 bewegten sich die Preise des Standardwarenkorbes in den USA praktisch auf dem Stand der Referenzperiode 1990/92 (+1%).Der Dollarkurs blieb während des beobachteten Zeitraums gegenüber dem Schweizer Franken ebenfalls nahezu unverändert (–2%).Gegenüber der Referenzperiode 1990/92 verringerte sich das Preisgefälle zu den USA sowohl in relativen (Preise USA entsprachen 47% der Schweizer Preise 2002/04 gegenüber 35% im Zeitraum 1990/92) als auch in absoluten Werten (–38%).
Der Preis ist für die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft zwar ein wichtiger Faktor,aber nicht der einzige:Qualität,Sicherheit und Ruf des Produktes, Werbung,Verteilernetz,Absatzkraft und die mit den Erzeugnissen verbundenen Dienstleistungen sind ebenfalls für den Erfolg in einem Marktsegment entscheidend.
Das Preisgefälle bei den Lebensmitteln zwischen der Schweiz und den beobachteten Ländern wurde aus dem Konsumentenpreis für einen Standardwarenkorb im Ladenverkauf inkl.MwSt.berechnet.Dieser Standardwarenkorb entspricht grob dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz pro Jahr (s.Tabelle 10) der 21 Lebensmittel,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleiches sind.«Grob»,da beispielsweise der Rinderbraten für das gesamte Rindfleischsortiment steht.Der Warenkorb entspricht 380 kg bzw.91% der 417 kg Nahrungsmittel (ohne Wein),die jährlich pro Kopf in der Schweiz konsumiert werden.Seine genaue Zusammensetzung ist am Ende der Tabelle 54 im Anhang aufgeführt.
Entwicklung der Konsumentenpreise des Warenkorbs
Zur Gruppe «EU-4» gehören wie bei den Produzentenpreisen die Nachbarländer Deutschland,Frankreich,Italien und Österreich.Für Italien dienten die Preise der Stadt Turin als Bezugsbasis.Beim Gemüse und bei fehlenden Zahlen aus den Nachbarländern wurde Belgien zusätzlich einbezogen.Zudem wurde aus den minimalen und maximalen nationalen Preisen ein oberer und unterer Durchschnittswert der EU-4/5 ermittelt.
Das Gewicht der einzelnen Länder der EU-4/6 (Ausgaben der Privathaushalte im Jahr 1998) und die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes wurden als fix angenommen,damit ausschliesslich die Preisschwankungen über die Jahre ersichtlich sind.
2002/04 machten die Konsumentenpreise eines Standardwarenkorbs im EU-Raum 61% der in der Schweiz für denselben Warenkorb bezahlten Preise aus gegenüber den 54%,welche die Produzentenpreise für den Standardwarenkorb erzielen.Die relativ höheren Konsumentenpreise im EU-Raum lassen sich einerseits durch die unterschiedliche Zusammensetzung des Warenkorbes auf Produzenten- und Konsumentenebene sowie andererseits durch das Ausmass der Nahrungsmitteleinfuhren und den höheren Mehrwertsteuersatz in der EU erklären (rund 7% gegenüber 2,4% in der Schweiz mit Schwankungen je nach Land und Produkt).

In der Schweiz blieben die Konsumentenpreise für den Standardwarenkorb zwischen 1990/92 und 2002/04 nahezu unverändert,während die EU eine Abnahme um 10% verzeichnete.Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den benachbarten EULändern,die 1990/92 noch 31% (697 Fr.) der schweizerischen Preise betrug,stieg 2002/04 auf 39% (892 Fr.) an.Der absolute Preisabstand zwischen der Schweiz und der EU vergrösserte sich gar um einen Viertel (+28% bzw.+195 Fr.) zwischen diesen beiden Zeitspannen.
Im Gegensatz zu den Produzentenpreisen vertieft sich folglich der Graben zwischen den Konsumentenpreisen in der Schweiz und der EU.Diese Entwicklung lässt sich zumindest teilweise durch den deutlich gestiegenen Anteil der Label-Produkte (Bio, M-7,Coop,Natura Plan) insbesondere beim Fleisch erklären.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bleiben aber beträchtlich:Während in Italien (Turin) die Konsummilch und in der EU der Zucker mehr kosten als in der Schweiz,sind die Schweinekoteletts in der EU nur halb so teuer,denn das in der EU-4 angebotene Schweinefleisch stammt mehrheitlich aus konventioneller Produktion.Das in den schweizerischen Geschäften im Jahr 2001 angebotene Schweinefleisch setzte sich hingegen zu 60% aus Marken- oder Labelerzeugnissen zusammen.
Im Zeitraum 1990/92 bis 2002/04 stiegen die Konsumentenpreise (in Schweizer Franken) in den USA um 18% an,während sie in der Schweiz stabil blieben.Entsprechend wurde die Preisschere zur Schweiz kleiner:2002/04 betrug der Abstand nur noch 44% gegenüber 51% in der Periode 1990/92.
■ Buchhaltungsnetz INLB der EU Begriffe und Methoden,Seite A64
Schweizer Landwirtschaftsbetriebe im EU-Vergleich
Die EU-Kommission betreibt zusammen mit allen EU-Mitgliedstaaten ein Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB),das auf einer einheitlichen Methodik beruht.Die Agroscope FAT Tänikon hat die Daten in der schweizerischen Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der Jahre 2000–2002 gemäss der INLB-Methodik umgerechnet.Damit stehen aktuelle vergleichbare Ergebnisse zur Verfügung.Diese werden den Resultaten der Jahre 1996–1998,welche im Agrarbericht 2001 publiziert worden sind,gegenübergestellt.Der Vergleich erfolgt auf Euro-Basis.1 Euro entspricht 2000 bis 2002 rund Fr.1.50.
Zwischen dem INLB und der Zentralen Auswertung bestehen methodische Unterschiede.Zu den wichtigsten Unterschieden,die bei der Umrechnung berücksichtigt werden müssen,gehören die Betriebsdefinition und -typologie,die Bewertung der Aktiven sowie die Definition der Grundgesamtheit und die Gewichtung der Ergebnisse.
Die wichtigsten INLB-Standardvariablen
Bruttogesamterzeugung
+Saldo Betriebsbeihilfen und -steuern (v.a.Direktzahlungen)
–Vorleistungen
=Bruttobetriebseinkommen
–Abschreibungen
=Betriebseinkommen
– Fremdfaktoren (Löhne,Pachten,Zinsen)
+Saldo aus Investitionsbeihilfen und –steuern
=Familienbetriebseinkommen
Quelle:EU-Kommission,INLB
Das Familienbetriebseinkommen entschädigt die nichtentlohnten Familienarbeitskräfte und im Betrieb eingesetztes Eigenkapital,entspricht also begrifflich dem landwirtschaftlichen Einkommen in der Zentralen Auswertung.
Die Standardvariable «Saldo Betriebsbeihilfen und -steuern» entspricht im Wesentlichen den Direktzahlungen der öffentlichen Hand.In den Abbildungen weiter unten werden diese mit den «Investitionsbeihilfen und -steuern» als «Beihilfen und Steuern» zusammengefasst.
■ Einkommen der Schweizer Betriebe über EU-Durchschnitt
Die durchschnittliche Fläche der ausgewerteten Buchhaltungsbetriebe liegt in der Schweiz deutlich unter dem Niveau der Nachbarländer und der EU 15 (Mittelwert).Der Umfang der Tierbestände und der eingesetzten Arbeit ist mit Österreich und dem EUMittel vergleichbar.
Mittlere Betriebsstrukturen von Buchhaltungsbetrieben in ausgewählten europäischen Ländern 1996/98 und 2000/02
1 Vergleichbarkeit mit Referenzbetrieben der Agroscope FAT Tänikon nicht gegebenQuellen:EU-Kommission,Agroscope
Trotz der kleineren Betriebe ist die Summe von Bruttoerzeugung,Betriebs- und Investitionsbeihilfen der Schweizer Betriebe mit Deutschland und Frankreich vergleichbar.Die Direktzahlungen sind in der Schweiz absolut betrachtet am bedeutendsten.2000/02 liegt der Anteil «Beihilfen und Steuern» an der Bruttoerzeugung in Österreich bei 24%, in der Schweiz bei 20%,in Deutschland und Frankreich sowie im Mittel der EU-Länder bei 14%.
Bruttoerzeugung und Beihilfen 1996/98 und 2000/02
Die Schweizer Betriebe schneiden auf der Aufwandseite vergleichsweise gut ab,so dass ein Familienbetriebseinkommen resultiert,das deutlich über demjenigen der Vergleichsländer liegt.Bei der Interpretation muss beachtet werden,dass die schweizerischen Betriebe bezogen auf das mengenmässige Produktionsvolumen gegenüber den deutschen und französischen Betrieben deutlich kleiner sind,aber auch,dass in der Schweiz die Kaufkraft eines Euro um 20–30% geringer ist als in den verglichenen Ländern.
Vergleicht man die relative Änderung zwischen den Dreijahresmitteln 1996/98 und 2000/02,zeigt sich Folgendes:
–Das Wachstum der durchschnittlichen Fläche liegt in der Schweiz hinter jenem der Vergleichsländer.
–Die Ausdehnung des Tierbestandes ist etwas grösser als in Österreich aber tiefer als im Durchschnitt der EU-15.
–Die Veränderung der eingesetzten Arbeit ist mit Österreich vergleichbar.
–Deutschland und Frankreich weisen bei der Fläche,den Tierbeständen und auch bei den Arbeitskräften einen überdurchschnittlichen Zuwachs auf.Dies ist teilweise auf methodische Anpassungen (Stichprobe und Gewichtung) zurückzuführen.
–Die Steigerung beim Familienbetriebseinkommen ist mit Deutschland und Österreich vergleichbar.
■ Vergleich ähnlich grosser Milchbetriebe ■
Der Vergleich zwischen ähnlich grossen Milcherzeugungsbetrieben zeigt,wie Schweizer Betriebe mit vergleichbaren strukturellen Voraussetzungen im internationalen Vergleich dastehen.Für den Vergleich werden Betriebe mit einer Fläche zwischen 30 und 50 ha ausgewählt.
Um den Effekt der erschwerenden Produktionsbedingungen im Berggebiet sichtbar zu machen,werden für die Schweiz die Betriebe in der Tal- und der Hügelregion separat dargestellt.Zum Vergleich werden INLB-Regionen herangezogen,in denen die Milchproduktion eine grosse Bedeutung hat.Neben Bayern und Schleswig-Holstein wird auch die französische Region Rhônes-Alpes betrachtet,die neben dem Alpengebiet auch Teile des Rhonetals umfasst.Für Österreich sind nur auf nationaler Ebene Daten verfügbar.
Bei dieser stark eingeschränkten Auswahl der Betriebe muss berücksichtigt werden, dass diese in der Schweiz und Österreich im Vergleich zu allen Milcherzeugungsbetrieben überdurchschnittlich gross sind,während sie in Deutschland etwa dem nationalen Mittel entsprechen.Die Betriebe der Region Rhônes-Alpes sind deutlich kleiner als der mittlere französische Milcherzeugungsbetrieb.
Der Arbeitseinsatz in der Schweiz von über zwei Arbeitskräften ist vergleichbar hoch wie in Österreich.In den übrigen Vergleichsregionen werden deutlich weniger Arbeitskräfte eingesetzt.Angestellte kommen in den Betrieben der EU-Vergleichsregionen kaum vor,machen in den Schweizer Betrieben aber 0,6 bis 0,8 Arbeitskräfte aus.Die Milchleistung je Kuh ist in der Schweiz eher überdurchschnittlich.
Betriebstrukturen spezialisierter Milcherzeugungsbetriebe mit 30–50 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche,Mittelwert 2000/02
CH 1 CH 1 Tal- und BayernSchleswig-Rhônes-Österreich
■ Bruttoerzeugung und Direktzahlungen in Schweizer Milchbetrieben wesentlich höher
Bei ähnlicher Betriebsstruktur erwirtschaften die Schweizer Tal- und Hügelbetriebe aus der landwirtschaftlichen Produktion die 1,8 bis 2,5-fache Bruttoerzeugung der EU-Vergleichsbetriebe.Dazu kommen noch Direktzahlungen,die mit rund 47’000 Euro auch von Österreich mit 23’000 Euro nicht annähernd erreicht werden.Die analysierten deutschen und französischen Betriebe kommen auf Direktzahlungen von 6’000 bis 13'000 Euro.
Bruttoerzeugung und Beihilfen Milchbetriebe 2000/02
■ Aufwand in Schweizer Milchbetrieben rund doppelt so hoch
Beihilfen und Steuern Sonstige Bruttoerzeugung
Auch beim Aufwand unterscheiden sich die Schweizer Betriebe deutlich von ihren Nachbarn.Bei allen dargestellten Aufwandpositionen liegen die beiden Gruppen mit Schweizer Betrieben deutlich über den EU-Vergleichsgruppen.Am stärksten stechen die Lohnkosten ins Auge,die bei EU-Betrieben dieser Grösse kaum vorkommen.Auch die Kosten für Pacht- und Schuldzinsen sind in der Schweiz überdurchschnittlich.Der Anteil gepachteter Flächen liegt bei den Schweizer Betrieben bei rund 60% und wird nur durch die Betriebe in der Region Rhônes-Alpes übertroffen,wobei die Pachtkosten in den französischen Betrieben vergleichsweise gering sind.Die deutschen Betriebe weisen Pachtanteile zwischen 40% und 50% aus,die österreichischen Betriebe liegen bei einem Drittel.Der Aufwand für Unterhalt von Gebäude und Reparaturen beträgt in den untersuchten Schweizer Betrieben mindestens das Doppelte der deutschen und österreichischen Nachbarn,verglichen mit der französischen Region sogar das Vierfache.Die bayerischen Betriebe erreichen bei den Abschreibungen fast das schweizerische Niveau,während die anderen Regionen tiefer liegen.
Der Gesamtaufwand erreicht in den französischen und österreichischen Betrieben nur 35% bzw.37% des Gesamtaufwandes der schweizerischen Tal- und Hügelbetriebe. Die deutschen Betriebe liegen bei rund 50% des schweizerischen Wertes.
■ Schweizer Familienbetriebseinkommen am höchsten
Euro/Betrieb
Aufwand und Familienbetriebseinkommen Milchbetriebe 2000/02
■ Einkommen seit 1996/98 in allen Regionen verbessert
Pacht,
Quellen:
Die grossen Kostenunterschiede sind nicht durch die Betriebsgrösse erklärbar,da Betriebe ähnlicher Grösse verglichen werden.Höhere Preise sind beispielsweise bei den Futtermitteln im Wesentlichen für die Mehrkosten in schweizerischen Betrieben verantwortlich.Bei anderen Aufwandspositionen dürften aber auch höhere Einsatzmengen eine Rolle spielen.Vor allem bei der Arbeit,beim eingesetzten Fremdkapital und beim Gebäude- und Maschinenunterhalt fällt dies auf.Sicher sind auch topographische und klimatische Voraussetzungen sowie Umwelt- und Tierschutzauflagen mitverantwortlich für den höheren Produktionsaufwand in der Schweiz.Die grossen Differenzen,z.B.zu Österreich,können damit aber nicht vollständig erklärt werden.
Die Differenz von Bruttoerzeugung inkl.Beihilfen und Gesamtaufwand ergibt das Familienbetriebseinkommen.Liegt dieses bei den Schweizer Betrieben bei 53’000 bzw. 57'000 Euro,so erreichen die Österreicher Betriebe dank vergleichsweise geringen Kosten noch 44'000 Euro,während die anderen Gruppen zwischen 21’000 und 26'000 Euro erzielen.Beim Quervergleich ist zu berücksichtigen,dass die österreichischen Betriebe rund 2,2 nicht entlohnte Arbeitskräfte ausweisen,während in allen anderen Betriebsgruppen das Familienbetriebseinkommen zwischen 1,3 und 1,6 nicht entlohnte Arbeitskräfte entschädigt.Zu berücksichtigen ist auch die tiefere Kaufkraft in der Schweiz.
Im Vergleich zu 1996/98 (vgl.Agrarbericht 2001) wurde die Milchproduktion der Betriebe in dieser Grössenklasse in der Schweiz,Bayern und Österreich kräftig ausgedehnt.In Schleswig-Holstein und in der Region Rhônes-Alpes blieb sie konstant.In der Schweizer Tal- und Hügelregion betrug die Zunahme 18%,in Österreich gar 28%.Die Summe aus Bruttoerzeugung und Beihilfen stieg in Österreich (+16%),der Schweiz (Alle Regionen:+18%,Tal- und Hügelregion:+15%) und Rhônes-Alpes (+10%) an, während sie in den übrigen Regionen stagnierte.Das Familienbetriebseinkommen konnte nominal in allen Regionen gesteigert werden,am stärksten in der Schweiz (+20%),gefolgt von Schleswig-Holstein (+14%) und Österreich (+14%).

■ Integration von Umweltzielen in die Agrarpolitiken der EU und der Schweiz
Cross Compliance in der EU und Ökologischer Leistungsnachweis in der Schweiz –eine vergleichende Analyse
Vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedingungen war die Agrarpolitik in der Europäischen Union (EU) in den letzten Jahren von grundlegenden Reformen geprägt. Nötig wurden Veränderungen vor allem aufgrund von Forderungen nach einer Liberalisierung der Agrarmärkte im Rahmen der WTO-Verhandlungen.Ein weiteres Ziel war eine verstärkte Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Agrarpolitik.Im Zuge dieser Weiterentwicklung haben Agrarumweltprogramme an Bedeutung gewonnen, und es kam verstärkt zu einer Verknüpfung von Umweltstandards mit dem Förderrecht. Auch in der Schweiz wurden Umweltziele mit in die Agrarpolitik integriert.Hier gilt vorab der Ökologische Leistungsnachweis (ÖLN) als zentrales Element.In beiden Fällen ist der Erhalt von Direktzahlungen nun davon abhängig,dass Mindeststandards in der landwirtschaftlichen Praxis eingehalten werden,ein Konzept,das in der EU als «Cross Compliance» (CC) bezeichnet wird.Eine Nichteinhaltung dieser Bewirtschaftungsauflagen kann zu einer Kürzung der Zahlungen führen.
Das Institut für Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig/Deutschland hat beide Ansätze miteinander verglichen.Dabei wurden Übereinstimmungen und Unterschiede herausgearbeitet.
■ Die Agrarpolitik der EU und ihre jüngste Reform
Die politischen Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Flächennutzung in der EU werden massgeblich durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gesetzt.Die GAP wird auf Grundlage gemeinsamer Beschlüsse aller Mitgliedstaaten weiterentwickelt.
In der Markt- und Preispolitik,der so genannten 1.Säule der GAP,besteht ein relativ geringer Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der EU-Vorgaben. Hierunter fallen Instrumente zur Preisstützung und die Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe.Mit der im Jahr 1999 beschlossenen Agrarreform «Agenda 2000» wurden die Massnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums in der 2.Säule der GAP zusammengefasst.Diese erfordern,im Gegensatz zu Zahlungen der 1.Säule,eine nationale Kofinanzierung und beinhalten unter anderem Agrarumweltmassnahmen, Ausgleichszulagen für benachteiligte Gebiete und die einzelbetriebliche Investitionsförderung.Bei diesen umwelt- und strukturpolitischen Massnahmen besteht ein grösserer nationaler Ausgestaltungsspielraum.
Die jüngste Agrarreform der EU wurde im Juni 2003 von den EU-Agrarministern vor dem Hintergrund der Zwischenbewertung der «Agenda 2000»,der EU-Osterweiterung und den WTO-Verhandlungen beschlossen.Sie führte zu einer neuen Verordnung über Direktzahlungen und daraus resultierenden Durchführungsverordnungen,die für die Mitgliedstaaten direkt bindend sind.
Kernelemente der Reform sind:
– die Entkopplung der Direktzahlungen von der Agrarproduktion und
– die Bindung der Direktzahlungen an die Einhaltung von Mindeststandards in den Bereichen Umwelt-,Tier- und Verbraucherschutz (Cross Compliance,CC).
■ Cross Compliance in der EU
Nach der jüngsten EU-Agrarreform werden die meisten Direktzahlungen der 1.Säule in der EU von der Produktion entkoppelt.Bis zu 100% der Betriebsflächen können nun stillgelegt werden,ohne die Beihilfefähigkeit zu verlieren.Es bestehen jedoch zahlreiche Umsetzungsvarianten,einschliesslich der Möglichkeit,die Entkopplung bis zum Jahr 2007 zu verschieben.Eine weitestmögliche Entkopplung geschieht in Grossbritannien und Deutschland,während andere Mitgliedstaaten Teile der Tierprämien gekoppelt lassen (z.B.Österreich,Frankreich und Dänemark).
Entkoppelte Direktzahlungen überlassen dem Landwirt die Entscheidung über die Nutzung seiner Flächen und sollen zu einer stärkeren Marktorientierung führen.Nach der Entkopplung der Direktzahlungen wird die landwirtschaftliche Nutzung in den Fällen aufgegeben werden,in denen betroffene Produktionsverfahren unter Marktbedingungen und ohne gekoppelte Direktzahlungen unrentabel sind.Die Möglichkeit,die gesamte Betriebsfläche stillzulegen,unterscheidet sich von der bisherigen Stilllegungsregelung,und bringt vor allem auf ertragsschwachen Standorten einen Anreiz zur vollständigen Produktionsaufgabe mit sich.Ferner wird von einer Entkopplung der Tierprämien ein Rückgang insbesondere der extensiven,an Grünland gebundenen Tierhaltungsverfahren wie der Mutterkuh- und Schafhaltung erwartet,da die Prämien hier eine hohe Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit haben.Neben Risiken beinhaltet die Entkopplung auch Chancen für den Naturschutz:Landschaftselemente zählen im Gegensatz zur bisherigen Stützungsregelung im Ackerbau in Zukunft zur beihilfefähigen Fläche.
Mit Beginn des Jahres 2005 wurde ein neuer obligatorischer,EU-weit harmonisierter CC-Ansatz durchgesetzt und jeder Mitgliedstaat muss CC-Auflagen,basierend auf vorgegebenen Kriterien,einführen.
CC setzt sich zusammen aus: –den auf 19 EU-Verordnungen und -Richtlinien basierenden und bis 2007 schrittweise einzuführenden «Grundanforderungen an die Betriebsführung» für die Bereiche Umweltschutz,Tierschutz und Lebensmittelsicherheit; –Standards zum «guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand»,betreffend Bodenschutz,Mindestinstandhaltung von Flächen und Erhaltung von Landschaftselementen und –Anforderungen zur Erhaltung von Dauergrünland,wobei der Anteil von Dauergrünland an der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf der Ebene der Mitgliedstaaten bzw.Regionen um nicht mehr als 10% abnehmen darf.Reduziert sich der Anteil deutlich,müssen Massnahmen auf einzelbetrieblicher Ebene angewendet werden, die den Umbruch von Dauergrünland verbieten oder eine Neuansaat vorschreiben können.
■ Inwieweit ist der ÖLN mit CC in der EU vergleichbar?
Für einen Vergleich mit CC wurden nur die Anforderungen zum Erhalt der allgemeinen Direktzahlungen im Rahmen des ÖLN und einige weitere in der Direktzahlungsverordnung (DZV) der Schweiz festgelegten Voraussetzungen für den Erhalt von Direktzahlungen herangezogen.
Mit der Voraussetzung Auflagen des Umwelt- und Tierschutzes für den vollständigen Erhalt von Direktzahlungen zu erfüllen,entspricht der ÖLN den Grundzügen von CC der EU.Viele Standards des ÖLN decken sich mit CC-Auflagen,die in EU-Mitgliedstaaten definiert wurden,z.B.Standards zu Fruchtfolge und Bodenbedeckung.Der Verpflichtung zur Mindestpflege wird de facto durch die in der DZV der Schweiz festgeschriebene Nutzungsauflage für direktzahlungsberechtigte Flächen entsprochen.In vielen Fällen liegen die Anforderungen des ÖLN über jenen der EU,in anderen ist der ÖLN jedoch nicht vergleichbar mit dem EU-Ansatz.Oft handelt es sich dabei aber um eher formale Unterschiede,die in den verschiedenen Konzepten begründet liegen.
■ Über die Anforderungen der EU hinausgehende Bestandteile des ÖLN
Besonders mit den Auflagen zu Tier- und Pflanzenschutz und zum ökologischen Ausgleich geht der ÖLN über die EU-Standards hinaus.Auch die Anforderungen betreffend der Nährstoffbilanz und zur Anlage von Pufferstreifen und die detaillierten Aufzeichnungspflichten zeugen vom anspruchsvollen Ansatz des ÖLN.
Das Nutzungsgebot von Flächen nach der DZV schliesst alleiniges Mulchen von Flächen grundsätzlich aus,während in der EU die Mitgliedstaaten entsprechende Praktiken für die Mindestpflege von Flächen zulassen können.Unabhängig vom ÖLN begrenzt die Schweiz die maximale förderbare Viehbesatzdichte für den Erhalt von Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere.Der ÖLN gilt überdies auch als Grundlage für den Erhalt ökologischer Direktzahlungen und für Beiträge und Investitionskredite für einzelbetriebliche Strukturverbesserungsmassanhmen,während in der EU für Agrarumweltmassnahmen und die Ausgleichsmassnahmen noch der im Vergleich zu CC meist weniger breite Ansatz der «guten fachlichen Praxis» zu Grunde gelegt wird.
■ Unterschiede zwischen EU-Ansatz und ÖLN
In der EU müssen definierte,bereits bestehende Landschaftselemente in den Mitgliedstaaten der EU erhalten werden.Eine Beseitigung kann über eventuelle Bussgelder hinaus zur Kürzung der Direktzahlungen führen.Der Schutz solcher Strukturen durch die Naturschutzgesetzgebung allein entspricht nicht diesen Auflagen.In der Schweiz gibt es keine diesbezügliche Regelung für den ÖLN.Der Schutz von Landschaftselementen ist in der Schweiz durch einen anderen Instumentenmix geregelt und macht diesen Aspekt mit CC in der EU schwer vergleichbar.Durch das NHG sind Hecken, sobald sie einmal angelegt sind,gesetzlich geschützt.
Ein zentrales Element in der Agrarumweltpolitik der Schweiz ist der ökologische Ausgleich,mit dem sehr viel stärker als beim EU-Ansatz auf die Neuschaffung,die Pflege und ökologische Aufwertung von Landschaftselementen abgezielt wird.Der Ansatz der Schweiz,für den ÖLN einen bestimmten,auf die Landwirtschaftsfläche bezogenen Prozentsatz an ökologischen Ausgleichsflächen nachzuweisen,geht über die EU-Auflagen hinaus.Ausgleichsflächen müssen gegebenenfalls aktiv geschaffen oder zugepachtet werden und müssen mindestens 6 Jahre als solche erhalten bleiben. Die Ausgleichsflächen der Schweiz umfassen ein deutlich grösseres Spektrum genau definierter anrechenbarer Flächen.Darüber hinaus beinhaltet der ökologische Ausgleich teilweise auch Auflagen für Pflege oder Bewirtschaftung der Wiesen,Bunt- und Rotationsbrache,Ackerschonstreifen,Einzelbäume,Hecken,Feld- und Ufergehölze usw.Die ökologischen Direktzahlungen bauen auf dem obligatorischen ökologischen Ausgleich auf.Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit ÖkoBeiträgen abgegolten,und die Öko-Qualitätsverordnung von 2001 zielt auf eine Förderung von Qualität und Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen ab.Dem eher «aufbauenden» und flexiblen System der Schweiz steht somit ein eher statischer EU-Ansatz gegenüber,der Landschaftselemente inventarisiert und vor Beseitigung bewahrt.
Beim Grünlandschutz schreibt die EU vor,dass das Verhältnis von Acker- zu Dauergrünland um nicht mehr als 10% abnehmen darf.Vergleichbare Regelungen zum Erhalt der Grünlandflächen gibt es in der Schweiz nicht.Der Umbruch von Grünland ist in der Schweiz jedoch bei weitem nicht so relevant wie in vielen EU-Mitgliedstaaten. Die CC-Vorgaben der EU unterscheiden nicht nach der ökologischen Qualität von Grünland.Solange die regionale Grünlandfläche nicht zu stark abnimmt,sind einzelne Flächen nicht vor Umbruch geschützt,soweit kein anderweitiger Schutz z.B.durch Naturschutzauflagen gilt.In der Schweiz kann Grünland unter bestimmten Bedingungen als ökologische Ausgleichsfläche angerechnet werden.
Im Bereich Bodenschutz werden einige Standards der EU nicht ausdrücklich im ÖLN genannt.Die Erhaltung von Terrassen und ein geeigneter Maschineneinsatz,der in der Schweiz nicht flächendeckend verlangt wird,können aber Teil von Erosionsschutzplänen sein.Auch zur Weiterbehandlung von Stoppelfeldern werden im ÖLN keine Angaben gemacht.
Weiterhin sind in der Schweiz gesetzliche Regelungen zur Kennzeichnung von Tieren, zur Lebensmittelsicherheit,zum Verbot bestimmter Stoffe in der tierischen Erzeugung, zu BSE und zur Meldung von Krankheiten nicht relevant für den Erhalt von Direktzahlungen.
Nicht vergleichbar mit den EU-Vorgaben ist die Tatsache,dass in der Schweiz die Einhaltung landwirtschaftsrelevanter Erlasse des Gewässerschutz-,des Umweltschutzund des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) zwar eine Voraussetzung für den Erhalt von Direktzahlungen ist,aber nicht als Teil des ÖLN einer einheitlich geregelten systematischen Kontrolle unterliegen.

Was die Organisation von Kontrollen betrifft,so werden in der EU die Kontrollen von staatlichen Stellen ohne direkte finanzielle Beteiligung der Landwirte durchgeführt.Die Einführung eines Betriebsberatungssystems auf privater oder staatlicher Basis zur Begleitung von CC ist erst ab 2007 obligatorisch.Obwohl dieses System schon jetzt über die 2.Säule förderfähig ist,haben bisher nur sehr wenige Mitgliedstaaten davon Gebrauch gemacht.In der Schweiz besteht zwischen Kontrolle,die in der Regel durch akkreditierte private Organisationen durchgeführt wird,und Beratung eine engere Verknüpfung.Die Landwirte zahlen für die Kontrollen und holen bei den Kontrollorganisation gleichzeitig häufig Informationen über mit dem ÖLN vereinbare landwirtschaftliche Praktiken ein.
Im Gegensatz zum ÖLN steht der Praxistest für CC in der EU noch aus.Der ÖLN in der Schweiz zeigt,dass ein anspruchsvoller CC-Ansatz umsetzbar ist.
Mitarbeit am Agrarbericht 2005
■ Projektleitung, Werner Harder
Sekretariat
■ Autoren
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Jacques Gerber,Simon Hasler,Katja Hinterberger,Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Wirtschaftliche Lage
Vinzenz Jung
Soziales
Esther Grossenbacher
Ökologie und Ethologie
Brigitte Decrausaz,Ruth Badertscher,Anton Candinas,Heinz Hänni, Esther Grossenbacher,Hans-Jörg Lehmann,Olivier Roux
Beurteilung der Nachhaltigkeit
Brigitte Decrausaz,Esther Grossenbacher,Vinzenz Jung
■ Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Jacques Gerber
Übergreifende Instrumente
Friedrich Brand,Jean-Marc Chappuis,Emanuel Golder,Samuel Heger
Milchwirtschaft
Katja Hinterberger
Viehwirtschaft
Simon Hasler
Pflanzenbau
Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Direktzahlungen
Thomas Maier,Janine Markwalder,Hugo Roggo,Olivier Roux,Martin Weber
■ Übersetzungsdienste
Grundlagenverbesserung
Strukturverbesserungen und soziale Begleitmassnahmen
René Weber,Willi Riedo,Markus Wildisen
Forschung,Gestüt,Beratung,Berufsbildung,CIEA
Anton Stöckli,Jacques Clément,Urs Gantner,Geneviève Gassmann,Roland Stähli
Produktionsmittel
Lukas Barth,Martin Huber,Alfred Klay,Albrecht Siegenthaler
Tierzucht
Karin Wohlfender
Sektion Finanzinspektorat
Rolf Enggist
Weiterentwicklung der Agrarpolitik
Thomas Meier
■ Internationale Aspekte
Internationale Entwicklungen
Krisztina Bende,Friedrich Brand,Jean Girardin,Gisèle Jungo
Internationale Vergleiche
Jean Girardin,Vinzenz Jung,Thomas Maier
Deutsch:Yvonne Arnold
Französisch:Christiane Bokor,Pierre-Yves Barrelet,Yvan Bourquard, Giovanna Mele,Elisabeth Tschanz,Marie-Thérèse Von Graffenried, Magdalena Zajac
Italienisch:Patrizia Singaram,Floriana Dondina,Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Technische Unterstützung Hanspeter Leu,Peter Müller
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Strukturen
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Märkte
1 provisorisch 2 Durchschnitt der Jahre 1990/93 3 Veränderung 1990/93–2001/04
Quellen: Milch und -produkte:SBV (1990–98),ab 1999 TSM
Fleisch:Proviande
Eier:Aviforum Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:SBV
Obst:Schweizerischer Obstverband
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein:BLW,Kantone
1 0406.1010,0406.1020,406.1090
2 0406.2010,0406.2090
3 0406.3010,0406.3090
4 0406.4010,0406.4021,0406.4029,0406.4081,0406.4089
5 0406.9011,0406.9019
6 0406.9021,0406.9031,0406.9051,0406.9091
7 0406.9039,0406.9059,0406.9060,0406.9099
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–2001/04
3 Preise franko Schlachthof,ausgenommen Fleischschweine ab Hof,QM:Qualitätsmanagement Schweizer Fleisch
4 Preis gilt nicht für Übermengen
Quellen:
Milch:BLW
Schlachtvieh,Geflügel,Eier:SBV
Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:FAT
Obst:Schweizerischer Obstverband,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Tabelle 12
Konsumentenpreise
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–2001/04
Quellen:
Milch,Fleisch (Warenkorb aus Labelfleisch und konventionell produziertem Fleisch):BLW
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte:BLW,BFS
Tabelle 13
Selbstversorgungsgrad
1 inkl.Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide,jedoch ohne Ölkuchen;ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 einschliesslich Hartweizen,Speisehafer,Speisegerste und Mais
3 Äpfel,Birnen,Kirschen,Zwetschgen und Pflaumen,Aprikosen und Pfirsiche
4 Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5 einschliesslich Fleisch von Pferden,Ziegen,Kaninchen sowie Wildbret,Fische,Krusten- und Weichtiere
6 verdauliche Energie in Joules,alkoholische Getränke eingeschlossen
7 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen,Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
Quelle:SBV
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse
Tabelle 16
Betriebsergebnisse:Alle Regionen
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Agroscope
Tabelle 17
Betriebsergebnisse:Talregion*
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion:Ackerbauzone plus Übergangszonen
Tabelle 18
Betriebsergebnisse:Hügelregion*
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Tabelle 19
Betriebsergebnisse:Bergregion*
(1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion:Bergzonen II bis IV
Tabelle 20a
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 2002/04
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen*2002/04
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Tabelle 21
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Alle Regionen 2002/04
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Tabelle 22
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Talregion* 2002/04
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Talregion:Ackerbauzone plus Übergangszonen Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Tabelle 23
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Hügelregion* 2002/04
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Betriebsergebnisse nach Quartilen:Bergregion* 2002/04
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2002:3.22%;2003:2.63%;2004:2.73%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Bergregion:Bergzonen II bis IV
Betriebsergebnisse nach Regionen,Betriebstypen und Quartilen:1990/92–2002/04
■■■■■■■■■■■■■■■■
Tabellen Ausgaben des Bundes
Ausgaben für Produktion und Absatz
Ausgaben Viehwirtschaft
1Im Budget 2004 neu in der Rubrik «übrige Sachausgaben» (3190.000)
2 ehemals Förderung des Rebbaus
3 Weinabsatzförderung im Ausland / In der Rechnung 2003 sind die Umstellungsbeiträge für Wein enthalten./ Ab dem Jahre 2004 ist die Absatzförderung in der Rubrik 3601.200 enthalten.
4 ohne Ölsaaten
5Im Rechnungsjahr 2004 wurden für die Verarbeitung der Ernte 2003 38,2 Mio.Fr.und für die Ernte 2004 7,1 Mio.Fr.ausgerichtet Quellen:Staatsrechnung,BLW
Ausgaben für Direktzahlungen
Tabelle 30
Entwicklung der Direktzahlungen
direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte betreffend Direktzahlungen beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Allgemeine Direktzahlungen 2004
Tabelle 31b
Allgemeine Direktzahlungen 2004
Ökobeiträge 2004
Tabelle 33a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2004
Tabelle 33b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2004 StreueflächenHecken,Feld- und Ufergehölze
Tabelle 33c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2004
Tabelle 33d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2004 AckerschonstreifenHochstamm-Feldobstbäume
Tabelle 34
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2004
Tabelle 35
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2004
der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
Tabelle 36
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2004
Tabelle 37
Beteiligung am BTS-Programm 2004
Tabelle 38
Beteiligung am RAUS-Programm 2004
Tabelle 39a
Sömmerungsbeiträge 2004
Kühe gemolken,Milchschafe Übrige Raufutter Betriebe und (ohne Milchschafe)und Milchziegen 1 verzehrende TiereBeiträge
Tabelle 39b
Sömmerungsstatistik 2004:Betriebe und Normalstösse nach Kantonen
Tabelle 40a
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2004
Tabelle 40b
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2004
Tabelle 40c
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2004
Tabelle 41
Direktzahlungen auf Betriebsebene1 :nach Regionen 2004
kontrollierter Betriebe > Anzahl direktzahlungsberechtigter Betriebe,gibt es mehr angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe in diesem Kanton
Quelle:AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2004
ÖLN-Kontrollen 2004
Falls Anzahl kontrollierter Betriebe > Anzahl direktzahlungsberechtigter Betriebe,gibt es mehr angemeldete als direktzahlungsberechtigte Betriebe in diesem Kanton
Quelle:AGIS und Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen 2004
Ausgaben für Grundlagenverbesserung
Tabelle 43
An die Kantone ausbezahlte Beiträge 2004
Tabelle 44
Beiträge an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2004
Tabelle 45
Von den Kantonen bewilligte Investitionskredite 2004
Tabelle 46
Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2004 (ohne Baukredite)
Tabelle 47
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2004 (Bundes- und Kantonsanteile)
Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen. Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung,diejenigen zwischen 2002 und 2004 sind jedoch wieder vergleichbar.Die Zunahme der Verwaltungsausgaben ist vor allem darauf zurückzuführen,dass Leistungen wie z.B.für die Pensionskassen in der Staatsrechnung nicht mehr zentral geführt sondern auf die einzelnen Ämter aufgeteilt werden.
1 Die Ausgaben in diesen Bereichen wurden gemäss den Zahlungsrahmen neu gruppiert.Durch diese Neugruppierung hat es eine Anpassung bei den Grundlagenverbesserungen gegeben,so dass das Total dieser Rubrik nicht mehr mit dem Total früherer Agrarberichte verglichen werden kann.
2 Die ausserordentlichen Ausgaben im Milchsektor sind in diesem Betrag eingerechnet.Dies ging zulasten von anderen Bereichen wie z.B.Strukturverbesserungen und Viehwirtschaft.
Quellen:Staatsrechnung,BLW
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Internationale Aspekte
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6:EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
Anmerkung:Einige Zahlen sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6:EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–2001/04
Anmerkung:Einige Zahlen sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6:EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
EU-4/6:An die Schweiz angrenzende EU-Länder (D,F,I und A) sowie für bestimmte Erzeugnisse mit hohen Produktionsvolumen Belgien (B) und/oder die Niederlande (NL).
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–2001/04
2 Der «Standardwarenkorb» setzt sich grob aus der durchschnittlichen Produktion (1998–2000) der Schweiz von 15 der 17 landwirtschaftlichen Erzeugnisse zusammen,die Gegenstand des vorliegenden Preisvergleiches sind (Tabellen 52 und 53).Da die Preisstatistik für Zuckerrüben und Raps der USA nicht verfügbar war,sind diese Produktionen nicht im «Standardwarenkorb» eingeschlossen.Dieser entspricht 3.2 Mio.t Milch,2.7 Mio.Schweinen,35.5 Mio.Poulets,674.3 Mio.Eiern,0.52 Mio.t Weizen, 0.14 Mio.t Äpfeln usw.
Anmerkung:Einige Zahlen sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
USAFr./Sk.0.100.140.120.1118
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A) Anmerkung zu Land:(min) und (max) --> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster,resp.höchster Preis des betreffenden Landes
Anmerkung:Der Anteil der Labelprodukte (Bio,M-7,Coop Natura Plan) in den Geschäften ist insbesondere beim Fleisch in der Schweiz grösser als im Ausland
Quellen:BLW,BFS,ZMP,nationale Statistikämter von F,B,A,USA,Statistikamt der Stadt Turin (I)
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A) Anmerkung zu Land:(min) und (max) --> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster,resp.höchster Preis des betreffenden Landes
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–2001/04
2 Statistikfehler bei den Preisen für Rahm (32.27 Packungen à 2.5 dl),Schweinebraten (8.43 kg),Zwiebeln (4.53 kg) und Karotten (8.84 kg),denn der «Standardwarenkorb» der USA ist mit demjenigen der CH und der EU nicht identisch:Diese 4 nicht enthaltenen Produkte werden im «Standardwarenkorb» durch 8.07 kg Butter, 8.43 kg Schweinekotletten,4.53 kg Tomaten und zusätzlichen 8.84 kg Kartoffeln ersetzt.
3 Der «Standardwarenkorb» entspricht grob dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz pro Jahr (Tabelle 10) der 21 Lebensmittel,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleichs sind (Tabellen 53 und 54).«Grob»,da z.B.der Rinderbraten für das gesamte Rindfleischsortiment steht.Der Warenkorb entspricht 380 kg bzw.91% der 417 kg Nahrungsmittel (ohne Wein),die jährlich pro Kopf in der Schweiz konsumiert werden.Er setzt sich zusammen aus 83.03 l Milch,19.80 kg Käse, 5.77 kg Butter,32.27 Rahmpackungen à 2.5 dl,10.17 kg Rinderbraten,8.43 kg Schweinebraten,8.43 kg Schweinekoteletts,8.43 kg Schinken,9.81 kg Frischpoulet, 187 Eiern,25.25 kg Weissmehl,50.50 Weissbroten à 500 gr.,43.29 kg Kartoffeln,47.71 kg Zucker,17.09 Pflanzenöl,14.39 kg Goldenäpfeln,3.33 kg Birnen,10.15 kg Bananen, 8.84 Kilo Karotten,4.53 kg Zwiebeln und 9.89 kg Tomaten zusammen.
Quellen:BLW,BFS,ZMP,nationale Statistikämter von F,B,A,USA,Statistikamt der Stadt Turin (I)
Gesetze
–Bundesgesetz vom 29.April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz,LwG,SR 910.1)
–Bundesgesetz vom 4.Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB,SR 211.412.11)
–Bundesgesetz vom 4.Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG,SR 221.213.2)
–Bundesgesetz vom 8.Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz,LVG,SR 531)
–Bundesgesetz vom 13.Dezember 1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72)
–Zolltarifgesetz vom 9.Oktober 1986 (ZTG,SR 632.10)
–Bundesgesetz vom 20.März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz,SR 232.16)
–Bundesgesetz vom 20.Juni 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG,SR 836.1)
–Bundesgesetz vom 22.Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz,RPG,SR 700)
–Bundesgesetz vom 9.Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz,LMG,SR 817.0)
–Bundesgesetz vom 24.Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz,GSchG,SR 814.20)
–Tierschutzgesetz vom 9.März 1978 (TSchG,SR 455)
–Bundesgesetz vom 1.Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG,SR 451)
–Bundesgesetz vom 7.Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz,USG,SR 814.01)
Verordnungen
Allgemeines
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung,LBV,SR 910.91)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Erhebung und Bearbeitung von landwirtschaftlichen Daten (Landwirtschaftliche Datenverordnung,SR 919.117.71)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (SR 919.118)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den landwirtschaftlichen Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung,SR 912.1)
Produktion und Absatz
–Verordnung vom 30.Oktober 2002 über die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen (Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen,SR 919.117.72)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Unterstützung der Absatzförderung von Landwirtschaftsprodukten (Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung,SR 916.010)
–Verordnung vom 28.Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung,SR 910.12)
–Verordnung vom 22.September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung,SR 910.18)
–Verordnung des EVD vom 22.September 1997 über die biologische Landwirtschaft (SR 910.181)
–Verordnung vom 3.November 1999 über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung;LDV,SR 916.51)
–Allgemeine Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV,SR 916.01)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Kontingentierung der Milchproduktion (Milchkontingentierungsverordnung, MKV,SR 916.350.1)
–Verordnung vom 10.November 2004 über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung (VAMK,SR 916.350.4)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über Zulagen und Beihilfen im Milchbereich (Milchpreisstützungsverordnung, MSV,SR 916.350.2)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über die Höhe der Beihilfen für Milchprodukte und Vorschriften für die Einfuhr von Vollmilchpulver (SR 916.350.21)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Milchwirtschaft (Milchqualitätsverordnung,MQV,SR 916.351.0)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der industriellen Milchverarbeitung (SR 916.351.021.2)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der gewerblichen Milchverarbeitung (SR 916.351.021.3)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der Käsereifung und Käsevorverpackung (SR 916.351.021.4)
–Verordnung vom 8.März 2002 über die Ein- und Ausfuhr von Käse zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft (Verordnung über den Käsehandel mit der EG,SR 632.110.411)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten,Speiseöl und Speisefetten sowie von Kaseinen und Kaseinaten (Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung,VEMSK,SR 916.355.1)
–Verordnung des BLW vom 30.März 1999 über die Buttereinfuhr (SR 916.357.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung (Pferdeeinfuhrverordnung,PfEV,SR 916.322.1)
–Verordnung vom 26.November 2003 über den Schlachtvieh- und Fleischmarkt (Schlachtviehverordnung,SV,SR 916.341)
–Verordnung des BLW vom 23.September 1999 über die Einschätzung von Tieren der Schweinegattung sowie die Verwendung von technischen Geräten zur Qualitätseinstufung (SR 916.341.21)
–Verordnung des BLW vom 23.September 1999 über die Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der Rindvieh-,Pferde-,Schafund Ziegengattung (SR 916.341.22)
–Verordnung vom 26.November 2003 über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion (Höchstbestandesverordnung, HBV,SR 916.344)
–Verordnung vom 26.November 2003 über die Verwertung der inländischen Schafwolle (SR 916.361)
–Verordnung vom 26.November 2003 über den Eiermarkt (Eierverordnung,EiV,SR 916.371)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über Flächen- und Verarbeitungsbeiträge im Ackerbau (Ackerbaubeitragsverordnung, ABBV,SR 910.17)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr von Getreide,Futtermitteln,Stroh und Waren,bei deren Verarbeitung Futtermittel anfallen (Einfuhrverordnung Getreide und Futtermittel,SR 916.112.211)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über die Zollbegünstigung für Futtermittel und Ölsaaten (SR 916.112.231)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Verwertung sowie die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln (Kartoffelverordnung, SR 916.113.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben (Zuckerverordnung,SR 916.114.11)
–Verordnung des BLW vom 6.Dezember 2004 über die Freigabe des Zollkontingentes Brotgetreide (Brotgetreide-Freigabeverordnung, SR 916.111.4)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse,Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG,SR 916.121.10)
–Verordnung des BLW vom 12.Januar 2000 über die Festlegung von Perioden und Fristen sowie die Freigabe von Zollkontingentsteilmengen für die Einfuhr von frischem Gemüse,frischem Obst und von frischen Schnittblumen (VEAGOG-Freigabeverordnung,SR 916.121.100)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Massnahmen zu Gunsten des Obst- und Gemüsemarktes (Obst- und Gemüseverordnung,SR 916.131.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung,SR 916.140)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über das Rebsortenverzeichnis und über die Prüfung der Rebsorten (SR 916.143.5)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über die Kontrolle von Traubenmosten,Traubensäften und Weinen für die Ausfuhr (SR 916.145.211)
–Verordnung vom 28.Mai 1997 über die Kontrolle des Handels mit Wein (SR 916.146)
Direktzahlungen
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung,DZV,SR 910.13)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS-Verordnung,SR 910.132.4)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren im Freien (RAUS-Verordnung,SR 910.132.5)
–Verordnung vom 29.März 2000 über Sömmerungsbeiträge (Sömmerungsbeitragsverordnung,SöBV,SR 910.133)
–Verordnung vom 4.April 2001 über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung,ÖQV,SR 910.14)
Grundlagenverbesserung
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (Strukturverbesserungsverordnung, SVV,SR 913.1)
–Verordnung des BLW vom 26.November 2003 über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (IBLV,SR 913.211)
–Verordnung vom 26.November 2003 über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV,SR 914.11)
–Verordnung vom 26.November 2003 über die landwirtschaftliche und die bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung (Landwirtschaftsberatungsverordnung,SR 915.1)
–Verordnung vom 26.November 2003 über die landwirtschaftliche Forschung (VLF,SR 915.7)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Produktion und das Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Saatgut-Verordnung,SR 916.151)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über Saat- und Pflanzgut von Acker- und Futterpflanzenarten (Saat- und PflanzgutVerordnung des EVD,SR 916.151.1)
–Verordnung des EVD vom 11.Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von anerkanntem Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Obst,Beerenobst und Reben (Obst-,Beerenobst- und Rebenpflanzenverordnung des EVD,SR 916.151.2)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über den Sortenkatalog für Getreide,Kartoffeln,Futterpflanzen,Öl- und Faserpflanzen sowie Betarüben (Sortenkatalog-Verordnung,SR 916.151.6)
–Verordnung vom 18.Mai 2005 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-Verordnung,PSMV, SR 916.161)
–Verordnung vom 10.Januar 2001 über das Inverkehrbringen von Düngern (Dünger-Verordnung,DüV,SR 916.171)
–Verordnung des EVD vom 28.Februar 2001 über das Inverkehrbringen von Düngern (Düngerbuch-Verordnung,DüBV,SR 916.171.1)
–Verordnung vom 28.Februar 2001 über Pflanzenschutz (Pflanzenschutzverordnung,PSV,SR 916.20)
–Verordnung vom 26.Mai 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung, SR 916.307)
–Verordnung des EVD vom 10.Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln,Zusatzstoffen für die Tierernährung,Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung,FMBV,SR 916.307.1)
–Verordnung des BLW vom 1.Februar 2005 über die GVO-Futtermittelliste (SR 916.307.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Tierzucht (SR 916.310)
Es bestehen folgende Möglichkeiten,die Gesetzestexte einzusehen oder zu beschaffen:
–Zugriff via Internetwww.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
–Bestellen beim BBL,Vertrieb Publikationen
– via Internetwww.bundespublikationen.ch/
– via Fax031/325 50 58
Begriffe und Methoden
Begriffe
Abiotische Eigenschaften: Chemische oder physikalische Eigenschaften eines Raumes,wie klimatische Faktoren (Licht,Temperatur, usw.),Bodeneigenschaften,hydrologische Verhältnisse,Relief.
Biotische Eigenschaften: Eigenschaften eines Raumes,der durch die darin vorkommenden Pflanzen und Tiere hervorgehen.
Evaluation: Synonym auch für Erfolgskontrolle.Evaluation ist eine Methode zur Ermittlung und Beurteilung der Effektivität (Mass der Zielerreichung),Wirksamkeit (Ursache-Wirkungs-Beziehung) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) von Massnahmen oder Instrumenten.Im Voraus definierte Ziele sind Voraussetzung für eine Evaluation.Evaluationen dienen v.a.für Vergleiche:Kontrollgruppenvergleich, vorher/nachher-Vergleich,Querschnittsvergleich.
Externe Effekte: Externe Effekte oder Externalitäten sind positive oder negative Nebeneffekte auf Dritte oder die Gesellschaft,die durch Konsum- oder Produktionsvorgänge einzelner Akteure entstehen.Sie werden nicht unmittelbar über den Markt bzw.den Marktpreis erfasst und führen deshalb zu Marktverzerrungen und Fehlallokation von Gütern und Produktionsfaktoren.Ziel einer rationalen Wirtschaftspolitik ist es,die externen Effekte zu internalisieren.
Beispiele von Externen Effekten:
ProduktionKonsum
Negativ externe Effekte (soziale Kosten) Negative Beeinträchtigung von Übermässiger Konsum von Alkohol und Tabak Trink-,Grund- und Oberflächenwasser bringt hohe Kosten im Gesundheitswesen durch unsachgemässe Düngung
Positiv externe Effekte (soziale Nutzen) Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft Breitensport als Freizeitbeschäftigung durch die landwirtschaftliche Produktionsenkt die Kosten des Gesundheitswesens
Landwirtschaftlicher Umweltindikator: Repräsentative Erhebung,die Daten über eine Ursache,einen Zustand,eine Umweltveränderung oder ein Umweltrisiko vereint,welche aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten hervorgehen und für die Entscheidungsträger von Bedeutung sind (z.B.Erosionsgrad der Böden;Definition der OECD).
Marktspanne: Differenz zwischen Konsumenten- und Produzentenpreis (absoluter Wert) bzw.Anteil am Konsumentenfranken,der den Marktstufen Verarbeitung und Handel zukommt (relativer Wert).Der Begriff Marge wird als Synonym verwendet.
Median: Zentralwert (statistische Grösse):Wert,der bei der Abzählung einer Reihe von der Grösse nach geordneten Merkmalswerten (z.B.Messreihe) in der Mitte liegt.
Milchäquivalent: Ein Milchäquivalent entspricht dem durchschnittlichen Fett- und Proteingehalt eines kg Rohmilch (73 g) und dient als Massstab zur Berechnung der in einem Milchprodukt verarbeiteten Milchmenge.
Mittel(wert): Durchschnitt (statistische Grösse):Summe der Zahlen einer Reihe dividiert durch die Anzahl der Zahlen.
Monitoring: Laufendes Beobachten anhand von Indikatoren über einen Zeitraum ohne problemorientiertes Erkennen der kausalen Zusammenhänge.Resultat eines Monitorings sind Entwicklungen aufzuzeigen.Beispiele:Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche,Vogelpopulationen usw.
Multifunktionalität der Landwirtschaft: Das Konzept einer multifunktionalen Landwirtschaft umschreibt die vielfältigen Funktionen, die die Landwirtschaft erfüllt.Es umfasst die Leistungen,die über die eigentliche Agrarproduktion hinausgehen.Hierzu zählen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln,die Pflege der Kulturlandschaft,die Erhaltung der natürlichen Produktionsgrundlagen und Artenvielfalt,sowie der Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes.Eine multifunktionale Landwirtschaft trägt wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.Die multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft sind in der Bundesverfassung (Art.104) festgehalten.
Öffentliche Güter: Öffentliche Güter zeichnen sich durch zwei Merkmale aus:Nichtrivalität und fehlendes Ausschlussprinzip. Nichtrivalität im Konsum heisst,dass aufgrund des Konsums andere Konsumenten und Konsumentinnen nicht beeinträchtigt werden. Fehlendes Ausschlussprinzip heisst,dass es bei öffentlichen Gütern nicht möglich ist,einzelne NutzerInnen vom Konsum auszuschliessen. Öffentliche Güter sind zum Beispiel die Landesverteidigung,die Freizeiterholung im Wald,der Genuss einer naturnahen Landschaft. Für öffentliche Güter existiert kein Markt und damit auch kein Marktpreis.Aus diesem Grund müssen öffentliche Güter durch den Staat selbst oder in dessen Auftrag von Dritten bereitgestellt werden.
Quartil: Viertel (statistische Grösse):Aufteilung einer der Grösse nach geordneten Reihe in vier Teile.
Schoggigesetz: Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72):Umsetzung des Protokolls 2 des Freihandelsabkommens Schweiz – EG von 1972.Ausgleich der Rohstoffpreisdifferenz zwischen Inland- und Weltmarktpreis für landwirtschaftliche Grundstoffe (Ausfuhr:Ausfuhrbeiträge / Einfuhr:bewegliche Teilbeträge).
Streuung: Varianz (statistische Grösse):Verteilung der Beobachtungen oder Messwerte um einen Mittelwert.
Veredlungsverkehr: Veredlungsverkehr bedeutet,dass für Waren,die zur Bearbeitung,Verarbeitung oder Reparatur vorübergehend eingeführt werden,unter bestimmten Voraussetzungen Zollermässigung oder -befreiung gewährt wird.Bei Landwirtschaftsprodukten und landwirtschaftlichen Grundstoffen wird der Veredlungsverkehr gewährt,wenn gleichartige inländische Erzeugnisse nicht in genügender Menge verfügbar sind oder für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachteil für die schweizerische Nahrungsmittelindustrie nicht durch andere geeignete Massnahmen ausgeglichen werden kann.
Zielpreis: Vom Bundesrat festgelegte Orientierungsgrösse je kg vermarktete Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein.Der Zielpreis soll für Milch erreicht werden können,die zu Produkten mit hoher Wertschöpfung verarbeitet und gut vermarktet wird.Die Höhe des Zielpreises hängt insbesondere von der Einschätzung der Marktlage und den verfügbaren Mitteln zur Marktstützung ab.Die Zulage für die Fütterung ohne Silage wird dabei nicht berücksichtigt.
Weitere Begriffe sind zu finden in: –«Betriebswirtschaftliche Begriffe in der Landwirtschaft» (Bezug bei:Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale,Länggasse 79,3052 Zollikofen). –Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (SR 910.91).
Methoden
Milchpreiserhebung
Das BLW erhebt die Produzentenpreise monatlich und orientiert über die Ergebnisse in der Publikation «Marktbericht Milch».Unterschieden werden dabei folgende vier Preise:gesamte Milch,Industriemilch,verkäste Milch und Biomilch.Die Milchpreise werden nicht nur gesamtschweizerisch erhoben,sondern auch aufgeteilt in fünf Regionen: Region I: Genf,Waadt,Freiburg,Neuenburg,Jura und Teile des französischsprachigen Gebiets des Kantons Bern (Bezirke La Neuveville,Courtelary und Moutier). Region II: Bern (ausser Bezirke der Region I),Luzern,Unterwalden (Obwalden,Nidwalden),Uri,Zug und ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Schwyz und Küssnacht). Region III: Baselland und Basel-Stadt,Aargau und Solothurn. Region IV: Zürich,Schaffhausen,Thurgau,Appenzell (Innerrhoden und Ausserrhoden),St.Gallen,ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Einsiedeln,March und Höfe),Glarus,Graubünden. Region V: Wallis und Tessin.
An der Milchpreiserhebung,die gemäss Übergangsverordnung Milch bei den Milchverwertern durchzuführen ist,nehmen alle wichtigen industriellen Milchverarbeiter sowie eine repräsentative Auswahl an Käsereien teil.Auf diese Weise können über 60% der produzierten Milch erfasst werden.Als ausbezahlter Milchpreis gilt gemäss Übergangsverordnung der Preis für Milch am Erfassungsort (ab Hof oder Sammelstelle),einschliesslich ortsüblicher Zulagen und Abzüge.Die Zulage für die Fütterung ohne Silage,freiwillige Verbandsbeiträge sowie Abzüge für Molke sind im erhobenen Milchpreis nicht enthalten.
Berechnung der Bruttomargen
Milch und Milchprodukte
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung bei Milch und Milchprodukten beinhaltet in einem ersten Schritt eine theoretische Wertschöpfungsberechnung in den Segmenten Konsummilch,Käse,Butter,Konsumrahm und Joghurt.Dabei wird die Wertschöpfung für die einzelnen Produkte je kg eingesetzte Rohmilch berechnet.So können die Werte untereinander verglichen werden.Die Wertschöpfung Milch und Milchprodukte stellt also die Differenz zwischen dem erzielten Grundpreis pro kg Rohmilch des Produzenten einerseits und dem Verkaufspreis je kg eingesetzte Rohmilch des des verarbeiteten Endprodukts dar.
Die so berechnete Wertschöpfung wird in einem zweiten Schritt korrigiert um die jeweiligen produktspezifischen Eigenschaften.So fliessen z.B.Beihilfen des Bundes,produktgebundene Ab- bzw.Zuschläge und der Wert der anfallenden Nebenprodukte in die Berechnung der Einzelmargen ein.Die Bruttomarge bei Milch und Milchprodukten ist das Resultat aus der Wertschöpfung und den produktspezifischen Eigenschaften.Bei der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte handelt es sich um einen Zusammenzug aller Bruttomargen der Produktgruppen Konsummilch,Käse,Butter,Konsumrahm und Joghurt.Diese setzen sich ihrerseits aus den Kalkulationen der beobachteten Indikatorprodukten zusammen.
Basis für die Berechnung der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte,sowie der Einzelmargen Konsummilch,Käse,Butter,Rahm und Joghurt bildet die in der Schweiz verwertete jährliche Rohmilchmenge.Entsprechend ihrem Anteil an der Rohmilchmenge wird jede Verwertungsart gewichtet.
Die Margenberechnung beschränkt sich auf die Wertschöpfung der in der Schweiz produzierten und konsumierten Milchprodukte.Die verarbeitete Milchmenge muss daher um den exportierten Anteil korrigiert werden.
Für die Erhebung der Konsumentenpreise wird zwischen den drei Verkaufskanälen Grossverteiler,Discounter und Fachhandel unterschieden.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des Institutes für Marktanalysen,Hergiswil (IHA·GfK),nach Marktanteilen gewichtet.
8%Beihilfen, Abgaben Wert der Nebenprodukte,
Fleisch
Die Bruttomarge Verarbeitung – Verteilung ist ein Schätzwert der effektiven Marge auf dem Fleisch im Ladenverkauf (Kollektivhaushalte und Gastgewerbe ausgenommen).Sie wird als Realwert (konstante Preise von 01.99) und ohne Mehrwertsteuer ausgedrückt.Sie ist die Differenz zwischen den Nettoeinnahmen und dem Einstandspreis.Zwischen dem Ankauf des Schlachtviehs und des Rohmaterials für Fleischerzeugnisse und dem Verkauf im Detailhandel wird (von 1999 bis 2001) eine durchschnittliche Frist von 4 Wochen und seit 2002 eine Frist von 3 Wochen angenommen.Die Bruttomarge auf Frischfleisch ist in Fr./kg Schlachtgewicht (SG) warm angegeben.Bei der Bruttomarge der Warenkörbe Fleisch- und/oder Wurstwaren und des Warenkorbes Frischfleisch,Fleisch- und Wurstwaren ist die Einheit Fr./kg Verkaufsgewicht (VG).
Der Einstandspreis ist ein Realpreis (01.99),ohne MwSt.(oMwSt.).Beim Einstandspreis (EPk) von Rind-,Kalb- und Schweinefleisch sind sämtliche Vorteile aus den Einfuhren innerhalb des Zollkontingents (TIV) abgezogen.Der Einstandspreis bei Lammfleisch ist nicht der dem Produzenten bezahlte Schlachtviehpreis,sondern entspricht dem Preis für Teilstücke (verkaufsfertiges Fleisch) auf Grossistenstufe.Er wird per standardisiertes Kilo gemischtes (Inland und Import) Schlachtgewicht definiert.Bei den Warenkörben Fleisch- und/oder Wurstwaren versteht man unter dem Einstandspreis den Grosshandelspreis des Rohmaterials (Stotzen,Brust,Brät) zur Herstellung von einem kg Verkaufsgewicht (VG).Die Warenkörbe beruhen auf einer fixen Zusammensetzung (durchschnittlicher Monatskonsum der Privathaushalte von 01.1997–11.2000).
Bei den Nettoeinnahmen handelt es sich um den Rohertrag zum Realpreis (01.99) ohne MwSt.abzüglich den Entsorgungskosten,der LSVA,dem Basismarketing und Verlusten bei der Verarbeitung.Dies entspricht einer vereinfachten Form für den beobachteten Konsumentenpreis.Der Rohertrag entspricht dem Umsatz des Verarbeitungs- und Verteilungssektors resp.den Ausgaben der Konsumenten (Privathaushalte und Grosshandel).Darin eingeschlossen sind der Verkauf von Frischfleisch zum Konsum sowie die Verwertung von Wurstfleisch,Haut und Schlachtnebenprodukten (Grossistenpreis).Beim Frischfleisch werden die Nettoeinnahmen in kg Schlachtgewicht (SG) warm ausgedrückt.Die Angabe der Nettoeinnahmen bei den Warenkörben Fleisch- und/oder Wurstwaren erfolgt in Fr./kg Verkaufsgewicht (VG).Die Entsorgungskosten,die LSVA,das Basismarketing und die Verluste sind bei diesen beiden Warenkörben nicht berücksichtigt.
Rohertrag (= Konsumentenfranken): 16.74 Fr./kg SG
Frisches Bankfleisch (Einzelhandelspreis) 15.54 Fr./kg SG
Nettoeinnahmen 16.62 Fr./kg SG
Einstandspreis beobach. (EPb) 9.11 Fr./kg SG
Bruttomarge (BM2) 8.28 Fr./kg SG
Wurstfleisch (Grosshandelspreis) 0.56 Fr./kg SG
Schlachtabfälle für Verkauf (Grosshandelspreis) 0.64 Fr./kg SG
Schlachtabfälle und Knochen für Verbrennung LSVA, Marketing, 0.12 Fr./kg SG
Imp. (TIV) 0.77 Fr./kg SG
Einstandspreis bereinigt (EPk) 8.34 Fr./kg SG
Total variable Kosten: 8.46 Fr./kg SG
Anmerkung: Die Verhältnisse in dieser Abbildung sind nicht realitätsgetreu. Die angegebenen Preise stellen ein Beispiel für die Berechnung der Bruttomarge auf frischem Rindfleisch im Jahr 2000 dar. Rechnungseinheit sind Fr. pro kg Schlachtgewicht warm (SG) zu Festpreisen (Realwert 01.1999) ohne MwSt. Quelle: BLW
Die detaillierte Definition der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung findet sich in den Sonderausgaben des «Marktberichtes Fleisch» von Januar 2001 und April 2002 (Nummer 140 und 155),der von der Sektion Marktbeobachtung des BLW herausgegeben wird.Diese Nummern sind auf Anfrage erhältlich.
Früchte und Gemüse
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse ist die Differenz zwischen dem Einstandspreis der ersten Handelsstufe eines Produktes,ausgenommen Gebinde- und Verpackungskosten,und dem Endverkaufspreis (inkl.allfällige Gebinde- und Verpackungskosten).Sowohl die Daten des Inlandmarktes als auch diejenigen des Importmarktes fliessen in die Margenberechnungen ein.Beim Import sind die Zollabgaben enthalten.Berücksichtigt werden dabei je sieben bedeutende,umsatzstarke Früchte und Gemüse.Bei den Früchten sind dies Äpfel (Werte von Golden Delicious und den wichtigsten Lagersorten,sowie Granny Smith Import,mengengewichtet), Birnen (Werte Inlandbirnen und importierten Birnen ohne Abate- und Nashibirnen,mengengewichtet),Erdbeeren,Nektarinen,Kirschen, Aprikosen und Orangen.Beim Gemüse sind es Tomaten (Fleischtomaten,runde Tomaten,beide mit mengengewichtetem Anteil), Blumenkohl,gelbe Zwiebeln,Karotten,Brüsseler Witloof,Gurken und Kartoffeln.Die Mengengewichtungen stützen sich auf Zahlen des IHA· GfK,der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG),des Schweizerischen Obstverbandes (SOV),des Bundesamtes für Statistik (BFS) und der Oberzolldirektion (OZD).
Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse
Bruttomarge Gemüse
Der Einstandspreis der einzelnen Produkte setzt sich bei Inlandware aus dem Preis franko Verlader (bei Lagerware werden die Lagerkosten mitberücksichtigt) und bei Importware dem Importwert franko Grenze verzollt,beide mengengewichtet,zusammen.Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA·GfK nach Marktanteilen gewichtet.Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Gemüse zusammengefasst.
Bruttomarge Früchte
Hier ist das periodische Hinzustossen und Wegfallen von nur kurz auftretenden saisonalen Früchten eine Besonderheit bei der Gesamtmarge.Trotzdem kann diese Gesamtbetrachtung gerade im Mehrjahresvergleich wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Der Einstandspreis setzt sich bei Inlandware aus dem Produzentenpreis franko Sammelstelle und bei der Importware dem Importwert franko Grenze verzollt,beide mengengewichtet,zusammen.Lager- und Zinskosten sind berücksichtigt.Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA · GfM nach Marktanteilen gewichtet.Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Früchte zusammengefasst.
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung – neue Methodik
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung wird durch das BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV nach dem europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (Eurostat) berechnet.Die neu zur Anwendung gelangende Methode basiert auf der LGR97Nomenklatur von Eurostat (vorher LGR89).Mit der Revision sind die Ergebnisse wieder direkt mit jenen der EU vergleichbar.
Im folgenden werden die methodischen Anpassungen dargestellt.Anhand eines Beispiels wird aufgezeigt,wie sich diese quantitativ auswirken.Bei der Revision handelt sich um eine umfassende Weiterentwicklung.Deshalb können die Ergebnisse nicht mit den Ergebnissen der Vorjahre verglichen werden,wie sie in den Agrarberichten 2000–2002 publiziert worden sind.
Zwei Gruppen von Anpassungen können unterschieden werden.Erstens die methodischen Änderungen im engeren Sinn und zweitens eine Reihe von Anpassungen,die sich auf die erfasste Grundgesamtheit und die berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen beziehen.
Methodische Änderungen im engeren Sinn
Abkehr vom Bundeshofkonzept
Im alten System wurde die Landwirtschaft als «Black Box» betrachtet.In der LGR berücksichtigt wurden somit lediglich die Waren- und Dienstleistungsflüsse zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft.Neu werden auch die innerlandwirtschaftlichen und die innerbetrieblichen Flüsse erfasst,letztere aber nur dann,wenn diese zwei verschiedene Produktionszweige betreffen (z.B.Futtermittelproduktion als Input für die Milch- oder Fleischproduktion).
Neudefinition der Preise
Der «Herstellungspreis» ersetzt den alten «Ab-Hof-Preis».Der Unterschied liegt darin,dass neu auch die Subventionen berücksichtigt werden,welche den Produkten direkt zugeordnet werden können (z.B.Siloverbotsentschädigung,Exportbeiträge für Tiere,Unterstützung der Kartoffelverwertung).Auch die Preise der Beschaffungsgüter («Anschaffungspreise») werden entsprechend korrigiert (z.B.Berücksichtigung der Treibstoffzollrückerstattungen bei Treibstoffen).
LGR89, alte MethodeLGR97, neue Methode
Produzentenpreis
Ab-Hof-Preis
+ Gütersteuer
Produzentenpreis+ Gütersubvention
Herstellungspreis– Gütersteuer
Anpflanzungen
Neupflanzungen sowie deren Zuwachs an Wert bis zu ihrer Reife werden bei der Produktion wie auch bei den Bruttoanlageinvestitionen erfasst.Nach Erreichen der Reife werden auf dem Wert auch Abschreibungen verbucht.Nach alter Methode wurden lediglich die gesamthaften Bestandesveränderungen erfasst (d.h der Zuwachs oder die Abnahme des Gesamtbestands,ohne Berücksichtigung der Ersatzpflanzungen).
LGR89, alte MethodeLGR97, neue Methode
Rebfläche 2001
Rebfläche 2002
BAI: Bruttoanlageinvestitionen
NAI: Nettoanlageinvestitionen
Produktion = BAI
Rebfläche 2001
Rebfläche 2002
Produktion = BAI
Anpassungen der erfassten Grundgesamtheit und der berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen
Neu werden folgende Bereiche in die LGR einbezogen: –Ziergartenbau (Pflanzen und Blumen,Baumschulerzeugnisse).
–Dienstleistungen,angeboten von spezialisierten Betrieben (Bsp.Lohnarbeiten,künstliche Besamung) oder Landwirten (Bsp.Lohnarbeiten).
–Nichtlandwirtschaftliche (aber mit der landwirtschaftlichen Aktivität direkt verbundene) Nebentätigkeiten (nichtlandwirtschaftliche nicht trennbare Tätigkeiten).Dazu gehören einerseits die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Rohstoffen,andererseits aber auch der Einsatz landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren zu weiteren Zwecken (Bsp.Schneeräumungen,Tierpensionen).
–Wein:Die Bewertung der Trauben erfolgt neu nach Verwertungszweck (Tafelwein,Qualitätswein,Tafeltrauben,Most) (LGR89: Bewertung der gesamten Traubenernte zu Preisen für Traubenmost).
Aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen werden Kleinproduzenten unter bestimmten Schwellenwerten.Betroffen sind vor allem ein Teil der Weinproduzenten,die Bienen- und Kaninchenzucht.
Kleinstproduzenten
Quantifizierung der Anpassungen
Landwirtschaftliche Produktion der von der LGR89 abgedeckten Betriebe
+ Ziergartenbau
+ Landwirtschaftliche Dienstleistungen der spezialisierten Betriebe
+ Bewertung des Weins aus eigener Produktion
+ Landwirtschaft. Dienstleistungen (Nebentätigkeit)
+ Nicht landwirtschaftliche, nicht trennbare Tätigkeiten
In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse der alten (LGR89) und der neuen (LGR97) Methode der LGR für den Durchschnitt der Jahre 1999/2001 verglichen.Auf jeder Stufe der LGR werden die Unterschiede den drei Gründen «methodische Anpassungen im engeren Sinn» «Einfluss Gartenbau» und «andere Einflüsse» zugeordnet.Gesamthaft betrachtet führen die Anpassungen dazu,dass auf allen Stufen der LGR die Werte zunehmen.
Auf der Stufe Gesamtproduktionswert und Vorleistungen kommt die Abkehr vom Bundeshofkonzept stark zum Ausdruck (Einbezug gewisser innerbetrieblichen und der zwischenbetrieblichen Flüsse).Der Einbezug des Gartenbaus und der Dienstleistungen wirkt sich ebenfalls auf beiden Stufen aus.Die Berücksichtigung des Gartenbaus wirkt sich zusätzlich besonders stark beim Arbeitnehmerentgelt aus.Die nicht landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten finden Eingang beim Gesamtproduktionswert und beeinflussen auch die Höhe des gesamthaften Arbeitnehmerentgelts,naturgemäss aber kaum die Vorleistungen.
Relativ stark wirkt sich auch der Übergang zu den neuen Herstellungspreisen aus.Die Berücksichtigung der produktgebundenen Subventionen bei den Preisen bedeutet auch,dass diese bei der Rubrik «sonstige Subventionen» nicht mehr aufgeführt werden.
Die Summe aller Anpassungen führt dazu,dass das Unternehmenseinkommen um rund 30% steigt.
Darstellung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs
Zusammensetzung des Gesamtproduktionswertes
Innerbetrieblicher Verbrauch
Verarbeitung durch die Produzenten
Eigenkonsum durch landwirtschaftliche Haushalte
Verkäufe an andere landwirtschaftliche Einheiten
Verkäufe ausserhalb der Landwirtschaft, im Inland und ins Ausland
Gütersubventionen
Selbsterstellte Anlagen
Vorratsveränderung
Sonstige Subventionen
Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen
Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen
Faktoreinkommen
Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen
Nettounternehmenseinkommen 1
Pachten und Schuldzinsen
Arbeitnehmerentgelt Sonstige Produktionsabgaben
AbschreibungenVorleistungen
Zentrale Auswertung der Agroscope FAT Tänikon
Neue Auswertungsmethodik
Mit den Buchhaltungsabschlüssen des Jahres 1999 erfuhr die Zentrale Auswertung grundlegende methodische Änderungen.In der Vergangenheit wurden für die Ermittlung der Einkommen restriktiv abgegrenzte «Testbetriebe» verwendet (z.B.Beschränkung des Nebenverdienstes,Forderung einer Fachschulbildung).Auf Grund der bewussten positiven Selektion der Testbetriebe konnten konsequenterweise auch nur Aussagen über diese Betriebe selbst gemacht werden.Im neuen System erlauben die sogenannten «Referenzbetriebe» repräsentative Aussagen über die gesamte Landwirtschaft.
Überblick über die methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung
–Als Grundgesamtheit werden diejenigen schweizerischen Betriebe bezeichnet,die grundsätzlich als Referenzbetriebe für die Zentrale Auswertung in Frage kommen.Dazu müssen sie minimale physische Schwellen erreichen.Sobald ein Betrieb z.B.mindestens 10 ha Land bewirtschaftet oder mindestens 6 Kühe hält,gehört er zur Grundgesamtheit.Die Grundgesamtheit umfasst rund 57‘000 Betriebe,was rund 90% der bewirtschafteten Fläche und rund 90% der Produktion entspricht.
–Aus der Grundgesamtheit werden ca.3‘500 Referenzbetriebe ausgewählt.
–Da die Strukturen der Referenzbetriebe der Zentralen Auswertung von den Strukturen in der Gesamtlandwirtschaft abweichen, werden die Buchhaltungsergebnisse gewichtet.Dazu wird aus der Betriebsstrukturerhebung die Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrössen,Betriebstypen und Zonen herangezogen.Mit diesem Vorgehen ist gewährleistet,dass z.B.Buchhaltungsergebnisse von kleineren Betrieben,die in der Auswahl der Referenzbetriebe untervertreten sind,in der Auswertung das entsprechende Gewicht erhalten.
–Eine neue Betriebstypologie erlaubt eine bessere Unterscheidung der agrarpolitisch bedeutenden Betriebstypen.Rund zwei Drittel der Betriebe entfallen auf sieben spezialisierte Betriebstypen,die eine Konzentration auf bestimmte Betriebszweige des Pflanzenbaus oder in der Tierhaltung aufweisen.Das restliche Drittel teilt sich auf in vier Typen kombinierter Betriebe (vgl.weiter unten).
Die weiter gefasste Grundgesamtheit und die Gewichtung verbessert die Aussagekraft der Ergebnisse der Zentralen Auswertung für die gesamte Landwirtschaft erheblich.Auch die internationale Vergleichbarkeit der Buchhaltungsdaten wird erleichtert.Die methodischen Änderungen sind insgesamt derart bedeutend,dass eine Vergleichbarkeit mit älteren Berichten der Zentralen Auswertung nicht mehr gegeben ist.Um dennoch Mehrjahresvergleiche anstellen zu können,wurden die Buchhaltungsergebnisse der Vorjahre ebenfalls mit der neuen Methodik berechnet.
Die neue Betriebstypologie FAT99
Im Rahmen der methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon wurde die alte Betriebstypologie nach Grüner Kommission (1966) durch eine neue Typologie (FAT99) ersetzt.Neben der Verwendung in der Ergebnisdarstellung wird die Betriebstypologie für den Auswahlplan der Betriebe der Zentralen Auswertung und für die Gewichtung der einzelbetrieblichen Ergebnisse eingesetzt.
Die Einteilung der Betriebe nach der neuen Typologie erfolgt ausschliesslich auf der Basis von physischen Kriterien,nämlich Flächen und GVE verschiedener Tierkategorien.Mit insgesamt zehn Kennzahlen bzw.acht Quotienten je Betrieb ist eine differenzierte und eindeutige Einteilung möglich.
Definition der neuen Betriebstypologie FAT99
BereichBetriebstypGVE/OAF/SKul/RiGVE/VMiK/MAK/PSZ/SG/Andere LNLNLNGVERiGVERiGVEGVEGVEBedingungen
11PflanzenbauAckerbaumax.übermax. 170%10%
12Spezialkulturenmax.über 110%
21TierhaltungVerkehrsmilchmax.max.über über max. 25%10%75%25%25%
22Mutterkühemax.max.über max.über 25%10%75%25%25%
23Anderes Rindviehmax.max.übernicht 21 25%10%75%oder 22
31Pferde/Schafe/max.max.über Ziegen25%10%50%
41Veredlungmax.max.über 25%10%50%
51KombiniertVerkehrsmilch/überüberübermax.nicht Ackerbau40%75%25%25%11–41
52Mutterküheübermax.übernicht 75%25%25%11–41
53Veredlung übernicht 25%11–41
54Andere nicht 11–53
Die Kriterien in einer Zeile müssen alle gleichzeitig erfüllt sein.
Abkürzungen:
GVEGrossvieheinheit
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche in ha
GVE/LNViehbesatz je ha LN
OAF/LNAnteil offene Ackerfläche an LN
SKul/LNAnteil Spezialkulturen an LN
RiGVE/GVEAnteil Rindvieh-GVE am Gesamtviehbestand
VMiK/RiGVEAnteil Verkehrsmilchkühe am Rindviehbestand
MAK/RiGVEAnteil Mutter-/Ammenkühe am Rindviehbestand
PSZ/GVEAnteil Pferde-,Schaf- und Ziegen-GVE am Gesamtviehbestand
SG/GVEAnteil Schweine- und Geflügel-GVE am Gesamtviehbestand
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Es werden sieben spezialisierte und vier kombinierte Betriebstypen unterschieden.Die spezialisierten Pflanzenbaubetriebe (11 und 12) verfügen über einen Viehbesatz von weniger als einer GVE je ha LN.Bei den Ackerbaubetrieben überschreitet der Anteil offener Ackerfläche 70% der LN,für die Spezialkulturbetriebe liegt der Anteil entsprechender Kulturen über 10%.Die spezialisierten Tierhalter (21 bis 41) haben als gemeinsame Beschränkung maximal 25% offene Ackerfläche und maximal 10% Spezialkulturfläche.Die Verkehrsmilchbetriebe weisen über 25% des Rindviehbestandes als Milchkühe mit vermarkteter Milch (Verkehrsmilch) aus,analog werden die Mutterkuhbetriebe abgegrenzt.In der verbleibenden Gruppe «Anderes Rindvieh» befinden sich vor allem Betriebe mit Milchkühen ohne Kontingent (spezialisierte Kälbermäster oder Aufzuchtbetriebe im Berggebiet).In den Veredlungsbetrieben machen Schweine- und Geflügel-GVE mehr als die Hälfte des Viehbestandes aus.Betriebe,die sich keinem der sieben spezialisierten Betriebstypen zuteilen lassen, gelten als kombinierte Betriebe (51 bis 54).
Aspekte der Darstellung
Artikel 7 der Nachhaltigkeits-Verordnung legt fest,dass die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft auch regionenweise zu beurteilen ist. Dementsprechend werden auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung drei Regionen definiert:
–Talregion:Ackerbauzone,Übergangszonen –Hügelregion:Hügelzone,Bergzone I –Bergregion:Bergzonen II bis IV
Abgrenzung Tal-, Hügel- und Bergregion (Zuteilung der Gemeinden nach grösstem Zonenanteil)
Talregion
Hügelregion Bergregion
Quelle: AGIS-Daten 1998
Um eine differenzierte Beurteilung der Streuung von bestimmten Kennzahlen zu erreichen,werden die Betriebe in Quartile eingeteilt. Einteilungskriterium ist der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft (FJAE).In jedem Quartil (0–25% / 25–50% / 50–75% / 75–100%) befinden sich je ein Viertel der Betriebe aus der Grundgesamtheit.
Die Darstellung nach Quartilen erlaubt eine ökonomisch differenzierte Beurteilung.Auf eine ökologische Differenzierung wird verzichtet, weil der Anteil der Referenzbetriebe ohne ÖLN weniger als 3% ausmacht und die Differenz der Arbeitsverdienste minimal ist.
Gemäss Artikel 5 LwG ist die wirtschaftliche Lage «im Durchschnitt mehrerer Jahre» zu beurteilen.Bei Entwicklungen werden deshalb mehrere Jahre dargestellt.Die statischen Betrachtungen stellen auf das aktuellste verfügbare Drei-Jahresmittel (1998/2000) ab.
Einkommensvergleich
Für die Gegenüberstellung der Arbeitseinkommen wird auf der Seite der Landwirtschaft der Arbeitsverdienst und auf der Seite der übrigen Bevölkerung ein Jahres-Bruttolohn ermittelt.Die Lohnsituation der übrigen Bevölkerung wird durch die vom BFS alle zwei Jahre durchgeführte Lohnstrukturerhebung erfasst.In den dazwischen liegenden Jahren werden die Werte mit Hilfe der Entwicklung des Lohnindexes aktualisiert.Die Lohnstrukturerhebung gibt einen repräsentativen Überblick über die Lohnsituation der Beschäftigten in der Industrie (Sekundärsektor) und im Dienstleistungsbereich (Tertiärsektor).
Erfasste Lohnkomponenten (gemäss Lohnstrukturerhebung BFS)
Bruttolohn im Monat Oktober (inkl.Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherung,Naturalleistungen,regelmässig ausbezahlte Prämien-,Umsatz- oder Provisionsanteile),Entschädigungen für Schicht-,Nacht- und Sonntagsarbeit, 1⁄12 vom 13.Monatslohn und 1⁄12 von den jährlichen Sonderzahlungen.
Standardisierung: Umrechnung der erhobenen Beiträge (inkl.Sozialabgaben) auf eine einheitliche Arbeitszeit von 4 1⁄3 Wochen à 40 Stunden.
Die Werte der Lohnstrukturerhebung werden auf Jahres-Bruttolöhne umgerechnet.Anschliessend wird für jede Region der Median über alle im 2.und 3.Sektor Beschäftigten gebildet.
Auf Seite der Landwirtschaft wird als Pendent zu den Jahres-Bruttolöhnen der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst pro FJAE berechnet. Die Basis für eine FJAE sind 280 Arbeitstage,wobei eine Person maximal 1,0 FJAE entspricht.
Berechnung des landwirtschaftlichen Arbeitsverdienstes
Landwirtschaftliches Einkommen
–Zins für das im Betrieb investierte Eigenkapital (mittlerer Zinssatz für Bundesobligationen)
=Arbeitsverdienst der Betriebsleiterfamilie
:Anzahl Familienarbeitskräfte (FJAE) (Basis:280 Arbeitstage)
=Arbeitsverdienst pro FJAE
Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen (Stand August 2005)
Allgemeine Anforderungen
Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,welche einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben.Keine Direktzahlungen gibt es für Betriebe des Bundes,der Kantone und der Gemeinden sowie für Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,deren Tierbestände die Grenzen der Höchstbestandesverordnung überschreiten.Ebenfalls ausgeschlossen sind juristische Personen,sofern es sich nicht um Familienbetriebe handelt (Artikel 2 Direktzahlungsverordnung).
Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen,welche Direktzahlungen beantragen,müssen der kantonalen Behörde den Nachweis erbringen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ÖLN oder nach vom BLW anerkannten Regeln bewirtschaften (vgl.hierzu Ausführungen weiter hinten).
Weitere Bedingungen
Die Beitragsberechtigung ist an weitere strukturelle und soziale Kriterien geknüpft.Die Übersicht fasst die Bedingungen für die Ausrichtung der Direktzahlungen stichwortartig zusammen.
Bedingungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen
Minimaler Arbeitsbedarf
Betriebseigene Arbeitskräfte
0,25 Standard-Arbeitskräfte (SAK)
Mindestens 50% der für die Bewirtschaftung erforderlichen Arbeiten mit betriebseigenen Arbeitskräften (Familie und Angestellte) ausführen
Alter des Bewirtschafters bis 65 Jahre
Beitragsbegrenzungen
–AbstufungFläche in haTiere in GVEAnsatz in % bis3045100
30–6045–9075
60–9090–13550 über901350
–maximaler Betrag pro SAK 65 000 Fr.
–massgebliches Einkommen (steuerbares Einkommen vermindert um Summe der Direktzahlungen wird ab 80 000 Fr.massgebliches Einkommen 40 000 Fr.für verheiratete Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter)reduziert.
–massgebliches Vermögen (steuerbares Vermögen,vermindert umSumme der Direktzahlungen wird ab 800 000 Fr.massgebliches Vermögen 240 000 Fr.pro SAK und um 300 000 Fr.für verheiratetereduziert;übersteigt das massgebliche Vermögen 1 Mio.Fr.werden keine Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter) Direktzahlungen ausbezahlt.
Quelle:Direktzahlungsverordnung
Die Berechnung der SAK wird mit Umrechnungsfaktoren für die LN und die Nutztiere vorgenommen.Für gewisse Nutzungen wie z.B.den arbeitsaufwendigeren biologischen Landbau,gibt es Zuschläge.Die Faktoren sind abgeleitet aus der standardmässigen Erfassung arbeitswirtschaftlicher Abläufe.Sie sind für den Vollzug der Direktzahlungen und der Massnahmen zur Strukturverbesserung vereinfacht worden. Für die Berechnung des effektiven Arbeitsbedarfs sind sie nicht geeignet,weil dieser von den speziellen Eigenschaften des einzelnen Betriebes wie der Oberflächengestaltung,der Arrondierung,den Gebäudeverhältnissen oder dem Mechanisierungsgrad abhängt.
Abstufung der Beiträge nach Artikel 20 Direktzahlungsverordnung
Die prozentuale Abstufung gilt für sämtliche Beitragsarten mit Ausnahme der Sömmerungs- und der Gewässerschutzbeiträge.
Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN)
Der ÖLN strebt eine gesamtheitliche Betrachtung der Agro-Ökosysteme und der landwirtschaftlichen Betriebe an.Zu diesem Zweck wurden der bei der Integrierten Produktion (IP) entwickelte Ansatz übernommen.So wird der ÖLN aufgrund der Auflagen der IP konkretisiert.Zusätzlich hat der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachzuweisen,dass die Vorschriften des Tierschutzgesetzes eingehalten werden.Somit ist die IP,ergänzt mit den Auflagen der Tierschutzbestimmungen,zum Standard der Landwirtschaft in der Schweiz geworden.Direktzahlungen werden nur an Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ausbezahlt,die den ÖLN erbringen.Mit der Einführung des ÖLN wurden Auflagen der Integrierten Produktion (IP,Stand 1996) übernommen.Die Einführung von Direktzahlungen hat die Bewirtschaftungsmethoden und dadurch die Ökologie ganz wesentlich beeinflusst.Dies zeigt die starke Zunahme der nach den ÖLN- und Bio-Richtlinien bewirtschafteten Flächen:Zu Beginn der ersten Etappe der Agrarreform im Jahre 1993 betrug dieser Anteil knapp 20% der LN.Heute sind es etwa 96% der LN.Dank gezielten finanziellen Anreizen konnte diese hohe Beteiligung der Betriebe erreicht werden.
Der ÖLN umfasst die folgenden Punkte:
–Aufzeichnungs- und Nachweispflicht:Wer Direktzahlungen beansprucht,erbringt der kantonalen Behörde den Nachweis,dass er die ökologischen Leistungen auf dem gesamten Betrieb erfüllt.Als Nachweis gilt das Attest einer vom Kanton beigezogenen Kontrollorganisation.Um diese Bestätigung zu erhalten,macht der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin regelmässige Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs.
–Tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere:Die Bestimmungen der Tierschutzverordnung sind einzuhalten.Dabei gilt die Beweislastumkehr,das heisst,der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat zu belegen,dass auf dem Betrieb das Tierschutzgesetz eingehalten wird.
–Ausgeglichene Düngerbilanz:Um die Nährstoffverluste in die Umwelt zu verringern und möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe zu erzielen,muss die Stickstoff- und Phosphorzufuhr aufgrund des Bedarfs der Pflanzen und des Produktionspotenzials des Betriebs berechnet werden.Eine Toleranzgrenze von plus 10% wird gewährt.Mit der Düngerbilanz werden prioritär die Hofdünger eingesetzt; Mineraldünger und Abfalldünger kommen nur wenn nötig zur Anwendung.
–Mindestens alle zehn Jahre sind parzellenweise Bodenanalysen durchzuführen,um die Nährstoffreserven im Boden zu ermitteln und die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit notwendige Düngermenge entsprechend anzupassen.
–Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF):Mindestens 3,5% der LN bei Spezialkulturen und 7% bei der übrigen LN sind mit ÖAF zu belegen.Entlang von Wegen sind Wiesenstreifen von mindestens 0,5 m und entlang von Oberflächengewässern, Hecken,Feldgehölzen,Ufergehölzen und Waldrändern von mindestens 3 m zu belassen.
–Geregelte Fruchtfolge:Für Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche muss zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit der Pflanzen die Fruchtfolge jedes Jahr mindestens vier Kulturen umfassen.Zudem sind Höchstanteile der Hauptkulturen an der Ackerfläche oder Anbaupausen vorgeschrieben.
–Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln:Pflanzenbehandlungsmittel können in die Luft,den Boden und die Gewässer gelangen und nachteilige Auswirkungen auf Organismen haben.Daher sind natürliche Regulationsmechanismen und biologische Verfahren vorzuziehen.Im Acker- und Futterbau sind gewisse Behandlungsverfahren (z.B.Vorauflaufbehandlung mit Herbiziden bei Weizen) verboten.Bei den Spezialkulturen werden mit gewissen Verwendungseinschränkungen zugelassene Produkte in regelmässig aktualisierten Listen aufgeführt.
Einhaltung von Gesetzen
Wird die Einhaltung landwirtschaftsrelevanter Vorschriften wie diejenigen des Gewässer-,des Umwelt- sowie des Natur- und Heimatschutzgesetzes verletzt,kommt zusätzlich zur Busse eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Direktzahlungen hinzu.
Nachfolgend einige Beispiele von Vorschriften,deren Verletzung Sanktionen zur Folge haben kann:
–Einhaltung der Sorgfaltspflicht um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Artikel 3 Gewässerschutzgesetz);
–Verbot,Stoffe die Gewässer verunreinigen können in ein Gewässer einzubringen,oder versickern zu lassen oder so zu lagern oder auszubringen,dass dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (Artikel 6 Gewässerschutzgesetz);
–Nichteinhalten der DGVE-Grenzwerte nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz (gemessen an der düngbaren LN);
–Nicht vorschriftsgemässe Lagerkapazität für Hofdünger nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz;
–Zerstörung oder Beschädigung eines vom Bund oder Kanton geschützten Biotopes,insbesondere Riedgebiete und Moore,Hecken, Feldgehölze und Trockenstandorte ,sowie eines geschützten Natur- oder Kulturdenkmals,eine geschützte geschichtliche Stätte oder eine geschützte Naturlandschaft (inkl.Moorlandschaft),sofern sie durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung verursacht wird (Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 18 Absatz 1bis Natur- und Heimatschutzgesetz);
–Verstösse gegen das Verbot von Verbrennen von Abfällen (Artikel 26 Luftreinehalteverordnung).
Verstösse gegen die Vorschriften werden je nach Vorgeschichte und Wirkung der Widerhandlung im Einzelfall einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet:
–Erstmalige Verstösse ohne Dauerwirkung.Beispiel:Einmaliges gewässerschutzwidriges Güllen (Kürzung um 5 bis 25%,höchstens 2‘500 Fr.);
–Erstmalige Verstösse,deren Wirkung andauert oder deren Handlung oder Unterlassung sich über eine mehrere Tage,Wochen oder Monate umfassende Zeitspanne erstreckt.Beispiel:Unbefestigter Miststock.Mehrmaliges gewässerschutzwidriges Güllen an verschiedenen Tagen (Kürzung um 10 bis 50%,höchstens 10‘000 Fr.);
–Wiederholte Verstösse,also Widerhandlungen gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von drei Jahren Massgebend sind die Vorfälle ab dem Jahr 1999 (Kürzung um 20 bis 100%).
EU-Buchhaltungsvergleich
Was ist das INLB?
Das Informationsnetz Landwirtschaftlicher Buchführungen der Europäischen Union (INLB) wurde 1965 geschaffen.Der Zweck besteht in der Sammlung von Buchführungsdaten landwirtschaftlicher Betriebe zur Ermittlung der Einkommen und zur Analyse ihrer betriebswirtschaftlichen Verhältnisse.
Zur Zeit umfasst die jährliche Stichprobe etwa 60‘000 Betriebe,mit denen über 90% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche und über 90% der gesamten landwirtschaftlichen Produktion der EU abgebildet werden.
In den meisten EU-Ländern werden auch nationale Buchhaltungsnetze betrieben,aus denen die INLB-Daten für die EU-Kommission entnommen werden können.Das INLB bildet die einzige Datenquelle mit EU-weit vergleichbaren wirtschaftlichen Ergebnissen landwirtschaftlicher Betriebe.
Umsetzung der INLB-Methodik
Die Datenerhebung und Auswertung im INLB weicht in mehreren Bereichen von der Methodik in der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT ab.Um schweizerische Buchhaltungsergebnisse INLB-vergleichbar darzustellen,nimmt die FAT Umrechnungen an den Schweizer Daten auf verschiedenen Ebenen vor.Dadurch sind die im Textteil dargestellten Ergebnisse von Schweizer Betrieben nicht mit den Auswertungen der Referenzbetriebe vergleichbar.
Der Ausschluss des Wohnhauses bedingt Anpassungen bei den Gebäudekosten inkl.Abschreibungen,den Erträgen aus Gebäudevermietung,einer anteiligen Reduktion der Schuldzinsen,der Pachtzinsen bei reinen Pachtbetrieben,der Aktiven und der Passiven.
Buchwerte und Abschreibungen werden auf Wiederbeschaffungswerte korrigiert:Maschinen +5%,Gebäude +20%.Für Boden und andere Aktiven werden die Werte der Zentralen Auswertung übernommen (auch Deutschland und Irland machen eine Ausnahme von der Bewertung zu Marktpreisen).Für die Erfolgsrechnung inkl.Korrektur der Tierbewertung,die Bilanzdarstellung und Finanzierungsindikatoren werden die INLB-Standardvariablen berechnet.Die Erfassungsschwelle für die Schweiz wird bei 16 Europäischen Grösseneinheiten festgelegt.Mit der Umsetzung der EU-Betriebstypologie und einer analogen Gewichtung werden knapp 50‘000 Betriebe mit über 90% der Fläche und der Produktion abgebildet.Die Umsetzung der INLB-Methodik für die Schweiz wurde durch die FAT erstmals 1996 vorgenommen.
Methodische Unterschiede INLB und Zentrale Auswertung
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen der EU
Betriebsdefinition
Landwirtschaftlicher Betrieb ohne Wohnhaus.
Bewertung und Abschreibung
Boden,Tiere,Vorräte und Naturallieferungen zu Marktpreisen, Anlagen zu Wiederbeschaffungswerten bewertet.
Abschreibungen aufgrund von Wiederbeschaffungswerten; regelmässige Bilanzbrüche.
Erfolgsrechnung
Gesamterzeugung und Vorleistungen inkl.innerbetriebliche Lieferungen; Wertveränderungen bei den Zuchttieren nur bei mengenmässiger Veränderung erfolgswirksam.
Betriebstypologie
EU-Betriebstypologie:Jeder Betriebszweig (ha oder Tierzahl) wird mit einem Standarddeckungsbeitrag (SDB) multipliziert.Die Zusammensetzung des gesamtbetrieblichen Standarddeckungsbeitrags ergibt die Betriebswirtschaftliche Ausrichtung (BWA).Die Summe des Standarddeckungsbeitrages ergibt die wirtschaftliche Betriebsgrösse in Europäischen Grösseneinheiten (EGE;1 EGE= 1200 Euro SDB).
Grundgesamtheit und Stichprobe
Das INLB bildet Haupterwerbsbetriebe ab.Haupterwerbsbetriebe müssen eine wirtschaftliche Mindestgrösse (in EGE) überschreiten. Diese Schwellen werden landesabhängig unterschiedlich festgelegt. Die Nachbarländer der Schweiz haben meist 8 EGE als Erfassungsschwelle, Italien 2 EGE.
Gewichtung der Ergebnisse
Grundlage bildet Schichtung der Betriebe nach Betriebstyp (BWA), wirtschaftlicher Betriebsgrösse (in EGE) und INLB-Regionen (z.B.Bundesländer in Deutschland).
Referenzbetriebe Zentrale Auswertung
Wohnhaus gehört zum Betrieb;kalkulatorische Vermietung an Betriebsleiterfamilie.
Bewertung nach Gestehungskostenprinzip,d.h.Boden meist zum Ertragswert; Richtzahlen für Tiere,Vorräte und Naturallieferungen.
Abschreibung der historischen Netto-Anschaffungskosten;Bilanzkonstanz.
Rohertrags-Fremdkostenrechnung ohne innerbetriebliche Lieferungen.
Jede Bewertungsänderung bei Tieren ist erfolgswirksam.
Betriebstypologie FAT99:Der Betriebstyp wird aufgrund physischer Kriterien (Bodennutzung und Zusammensetzung des Tierbestandes) ermittelt.Im Gegensatz zur EU-Typologie mit jährlich schwankenden SDB führt die FAT99Typologie im Zeitablauf zu einer stabileren Einteilung.
Als Betriebsgrössenmass wird meistens die landwirtschaftliche Nutzfläche verwendet.
Die Grundgesamtheit der Referenzbetriebe wird durch minimale physische Schwellen abgegrenzt und umfasst mit gut 55‘000 Betrieben auch viele Nebenerwerbsbetriebe.
Grundlage:Schichtung der Betriebe nach Betriebstyp (FAT99),Grössenklasse (LN ) und Region (Tal-,Hügel- und Bergregion,abgeleitet aus Produktionszonen).
Quelle:EU-Kommission,Agroscope FAT Tänikon
Organisationen/Institutionen
BAGBundesamt für Gesundheit,Bern
BBTBundesamt für Berufsbildung und Technologie,Bern
BFSBundesamt für Statistik,Neuenburg
BLWBundesamt für Landwirtschaft,Bern
BSVBundesamt für Sozialversicherung,Bern
BUWALBundesamt für Umwelt,Wald und Landschaft,Bern
BVETBundesamt für Veterinärwesen,Bern
BWLBundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung,Bern
ETHEidgenössische Technische Hochschule,Zürich
EUEuropäische Union
EVDEidg.Volkswirtschaftsdepartement,Bern
EZVEidg.Zollverwaltung,Bern
FALEidg.Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau,Zürich-Reckenholz
FAMEidg.Forschungsanstalt für Milchwirtschaft,Bern-Liebefeld
FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations,Rom
FATEidg.Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik,Tänikon
FAWEidg.Forschungsanstalt für Obst-,Wein- und Gartenbau,Wädenswil
FiBLForschungsinstitut für Biologischen Landbau,Frick
IAWInstitut für Agrarwirtschaft,Zürich
LBLLandwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development,Paris
OZDOberzolldirektion,Bern
RACEidg.Forschungsanstalt für Pflanzenbau,Changins
RAPEidg.Forschungsanstalt für Nutztiere,Posieux
SBVSchweizerischer Bauernverband,Brugg
secoStaatssekretariat für Wirtschaft,Bern
SMPSchweizerische Milchproduzenten,Bern
SRVAService romand de vulgarisation agricole,Lausanne
TSMTreuhandstelle Milch,Bern
WTOWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation),Genf
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft,Bonn
Masseinheiten
dtDezitonne = 100 kg
Fr.Franken
hStunden
haHektare = 10 000 m2
hlHektoliter
KcalKilokalorien
kgKilogramm
kmKilometer
lLiter
mMeter
m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
Mio.Million
Mrd.Milliarde
Rp.Rappen
St.Stück
tTonne
%Prozent
ØDurchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGISAgrarpolitisches Informationssystem
AHVAlters- und Hinterlassenenversicherung
AKArbeitskraft
AKZAAusserkontingentszollansatz
BSEBovine spongiforme Enzephalopathie («Rinderwahnsinn»)
BTSBesonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw.beziehungsweise
BZ I,II,…Bergzone
ca.zirka
CO2 Kohlendioxid
EOErwerbsersatzordnung
FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheit
GAPGemeinsame Agrarpolitik der EU
GGAGeschützte Geografische Angaben
GUBGeschützte Ursprungsbezeichnung
GVEGrossvieheinheit
GVOGentechnisch veränderte Organismen inkl.inklusive
IPIntegrierte Produktion
IVInvalidenversicherung
JAEJahresarbeitseinheit
KZAKontingentszollansatz
LGLebendgewicht
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche
LwGLandwirtschaftsgesetz
MwstMehrwertsteuer
NStickstoff
NWRNachwachsende Rohstoffe
ÖAFÖkologische Ausgleichsfläche
ÖLNÖkologischer Leistungsnachweis
PPhosphor
PSMPflanzenschutzmittel
RAUSRegelmässiger Auslauf im Freien
RGVERaufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAKStandardarbeitskraft
SGSchlachtgewicht
u.a.unter anderem
vgl.vergleiche
z.B.zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B.Tabellen)
Organisationen/Institutionen
BAGBundesamt für Gesundheit,Bern
BBTBundesamt für Berufsbildung und Technologie,Bern
BFSBundesamt für Statistik,Neuenburg
BLWBundesamt für Landwirtschaft,Bern
BSVBundesamt für Sozialversicherung,Bern
BUWALBundesamt für Umwelt,Wald und Landschaft,Bern
BVETBundesamt für Veterinärwesen,Bern
BWLBundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung,Bern
ETHEidgenössische Technische Hochschule,Zürich
EUEuropäische Union
EVDEidg.Volkswirtschaftsdepartement,Bern
EZVEidg.Zollverwaltung,Bern
FALEidg.Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau,Zürich-Reckenholz
FAMEidg.Forschungsanstalt für Milchwirtschaft,Bern-Liebefeld
FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations,Rom
FATEidg.Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik,Tänikon
FAWEidg.Forschungsanstalt für Obst-,Wein- und Gartenbau,Wädenswil
FiBLForschungsinstitut für Biologischen Landbau,Frick
IAWInstitut für Agrarwirtschaft,Zürich
LBLLandwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development,Paris
OZDOberzolldirektion,Bern
RACEidg.Forschungsanstalt für Pflanzenbau,Changins
RAPEidg.Forschungsanstalt für Nutztiere,Posieux
SBVSchweizerischer Bauernverband,Brugg
secoStaatssekretariat für Wirtschaft,Bern
SMPSchweizerische Milchproduzenten,Bern
SRVAService romand de vulgarisation agricole,Lausanne
TSMTreuhandstelle Milch,Bern
WTOWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation),Genf
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft,Bonn
Masseinheiten
dtDezitonne = 100 kg
Fr.Franken
hStunden
haHektare = 10 000 m2
hlHektoliter
KcalKilokalorien
kgKilogramm
kmKilometer
lLiter
mMeter
m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
Mio.Million
Mrd.Milliarde
Rp.Rappen
St.Stück
tTonne
%Prozent
ØDurchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGISAgrarpolitisches Informationssystem
AHVAlters- und Hinterlassenenversicherung
AKArbeitskraft
AKZAAusserkontingentszollansatz
BSEBovine spongiforme Enzephalopathie («Rinderwahnsinn»)
BTSBesonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw.beziehungsweise
BZ I,II,…Bergzone
ca.zirka
CO2 Kohlendioxid
EOErwerbsersatzordnung
FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheit
GAPGemeinsame Agrarpolitik der EU
GGAGeschützte Geografische Angaben
GUBGeschützte Ursprungsbezeichnung
GVEGrossvieheinheit
GVOGentechnisch veränderte Organismen inkl.inklusive
IPIntegrierte Produktion
IVInvalidenversicherung
JAEJahresarbeitseinheit
KZAKontingentszollansatz
LGLebendgewicht
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche
LwGLandwirtschaftsgesetz
MwstMehrwertsteuer
NStickstoff
NWRNachwachsende Rohstoffe
ÖAFÖkologische Ausgleichsfläche
ÖLNÖkologischer Leistungsnachweis
PPhosphor
PSMPflanzenschutzmittel
RAUSRegelmässiger Auslauf im Freien
RGVERaufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAKStandardarbeitskraft
SGSchlachtgewicht
u.a.unter anderem
vgl.vergleiche
z.B.zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B.Tabellen)
