Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l’agriculture
Ufficio federale dell’agricoltura
Uffizi federal d’agricultura


Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l’agriculture
Ufficio federale dell’agricoltura
Uffizi federal d’agricultura

Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
Telefon:031 322 25 11
Telefax:031 322 26 34
Internet:www.blw.admin.ch
Copyright:BLW,Bern 2004
Gestaltung
Artwork,Grafik und Design,St.Gallen
Druck RDV AG,Berneck
Fotos
–Agrofot Bildarchiv
– Agroscope FAL Reckenholz
– Agroscope FAT Tänikon
– Agroscope FAW Wädenswil
– Amelia Magro,Fotografin
–BLW Bundesamt für Landwirtschaft
–Christiane Dörig,Fotografin
–Getty Images GmbH
–Herbert Mäder,Fotograf
–ImagePoint AG
–Incolor AG
–LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
–Peter Mosimann,Fotograf
–Peter Studer,Fotograf
–PhotoDisc Inc.
–Prisma Dia-Agentur AG
–Switzerland Cheese Marketing AG
Bezugsquelle
BBL,Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern
Bestellnummern:
Deutsch:730.680.04 d
Französisch:730.680.04 f
Italienisch:730.680.04 i
Telefax:031 325 50 58
Internet:www.bundespublikationen.ch
Das Berichtsjahr 2003 war geprägt durch die Hitze und Trockenheit im Sommer.Das extreme Wetter hat sich zum Glück nicht negativ auf die wirtschaftliche Situation der Betriebe ausgewirkt.Vor allem die guten Verhältnisse auf dem Schlachtviehmarkt stützten die Einkommen.
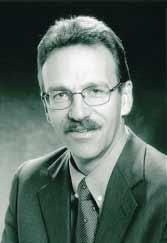
2003 war das letzte Jahr der Reformperiode 1999 bis 2003.Der fünfte Agrarbericht zeigt,dass die wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren relativ stabil geblieben ist.Im Vergleich zu Beginn der neunziger Jahre sind die Gesamteinkommen heute aber um 8% tiefer.Die Einkommen der bäuerlichen Haushalte sind denn auch erheblich niedriger als jene von entsprechenden Vergleichshaushalten.Die Resultate der Einkommens- und Verbrauchserhebung des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2002 machen dies deutlich.Die Unterschiede werden zwar kleiner,wenn die Besonderheiten der bäuerlichen Haushalte wie günstiges Wohnen,Eigenversorgung oder Wegfall von Kosten für Arbeitsweg und Ausserhausverpflegung berücksichtigt werden.Eine Differenz bleibt aber bestehen.Die Einkommen sind nach wie vor tief,obwohl in der Landwirtschaft seit 1990 eine grosse Strukturanpassung stattgefunden hat.Zum einen gaben jährlich mehr als 2% der Betriebe die landwirtschaftliche Tätigkeit auf,zum andern investierten die verbleibenden Betriebe laufend in neue,leistungsfähigere Maschinen und arbeitssparendere Einrichtungen,wie ein Vergleich der Betriebszählungsergebnisse von 1990 und 2003 zeigt.
Die angespannte wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Kantonen zum Aufbau von Angeboten für Bauernfamilien in Schwierigkeiten geführt.Die Bauernfamilien erhalten damit die Möglichkeit, sich bei sozialen und wirtschaftlichen Problemen an eine kompetente und vertrauenswürdige Stelle zu wenden.Die Erfahrungen in den Kantonen haben gezeigt,dass die Angebote eine wertvolle Hilfe in der Zeit des Umbruchs sind und die sozialverträgliche Entwicklung in der Landwirtschaft wirkungsvoll unterstützen.Im vorliegenden Agrarbericht werden diese Angebote im Abschnitt Soziales dargestellt.
Erfreulich ist,dass die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft im Jahr 2003 im Vergleich zum Vorjahr weiter zugenommen haben.So wurden die ökologischen Ausgleichsflächen um 3% ausgedehnt und die biologisch bewirtschaftete Fläche stieg auf über 10%.Je 4 Prozentpunkte höher sind die nach den Regeln des RAUS-Programms gehaltenen GVE und diejenigen in besonders tierfreundlichen Ställen.Auch die von der Landwirtschaft ausgehenden Umweltbelastungen gingen bis 1998 stark zurück. Seither ist eine Stagnation eingetreten.Der Agrarbericht 2004 zeigt im Bereich Stickstoff,dass regional und lokal insbesondere bei den Ammoniakemissionen noch Handlungsbedarf da ist.Diese Probleme gilt es mit regionalen Projekten anzugehen.
Die Landwirtschaft steht vor verschiedenen Herausforderungen.An der Innenfront ist es die Sanierung der Bundesfinanzen,welche das Budget für die Landwirtschaft reduziert.Das vom Bundesrat verabschiedete Entlastungsprogramm 04 sieht in diesem Bereich ab 2007 Einsparungen von jährlich 130 Mio.Fr.vor.Damit stehen pro Jahr über 3% weniger finanzielle Mittel als geplant zur Verfügung.An der Aussenfront gab es in diesem Jahr Bewegung bei den WTO-Verhandlungen.In Genf wurde anfangs August ein Rahmenabkommen verabschiedet,welches im Agrarbereich einen substanziellen Zollabbau,eine Reduktion der produktgebundenen internen Stützung sowie die mittelbis längerfristige Abschaffung aller Formen von Exporthilfen vorsieht.Die konkreten Zahlen und Modalitäten sind noch nicht bekannt.Sie werden Gegenstand von Verhandlungen im nächsten Jahr sein.Es lässt sich aber schon heute sagen,dass für die Schweizer Landwirtschaft die Einnahmen aus dem Produkteverkauf erheblich zurückgehen dürften.Der Beginn der Umsetzung der voraussichtlichen Verpflichtungen dürfte sich zeitlich mit der nächsten Periode der Zahlungsrahmen von 2008 bis 2011 decken. Dies bedeutet,dass die Auswirkungen in die Überlegungen zur weiteren Entwicklung der Agrarpolitik miteinbezogen werden müssen und diese stark beeinflussen werden.
Die endgültigen Ergebnisse der WTO-Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde werden eine grosse Herausforderung sein bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik. Wir werden uns dafür einsetzen,dass für die Landwirtschaft in den Detailverhandlungen tragbare Ergebnisse erzielt werden können.Die betroffenen und interessierten Kreise werden bei der Weiterentwicklung der Agrarpolitik einbezogen,so im Rahmen des Produzentenforums,welches eine Plattform zur Diskussion aktueller Probleme ist oder in so genannten Landsgemeinden,wo zweimal jährlich breit über den Stand der Arbeiten informiert wird.Die ordentliche Vernehmlassung über die weitere Entwicklung der Agrarpolitik soll im nächsten Herbst eröffnet werden.
Manfred Bötsch Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft1.Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
c.dezentralen Besiedlung des Landes».
Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.
Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.
Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor,dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen,sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt,jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.
Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt.

■
Bei der Analyse der Strukturen in der Landwirtschaft richtet sich das Augenmerk in diesem Jahr auf die Entwicklung der Zahl der Betriebe und Beschäftigten sowie der technischen Ausrüstung.Als Basis dienen dabei die Landwirtschaftlichen Betriebszählungen ab 1990 und die seit 1996 jährlich stattfindenden Betriebsstrukturerhebungen.
Seit mehreren Jahrzehnten nimmt die Zahl der Betriebe stetig ab.In den fünfziger und sechziger Jahren lag die durchschnittliche Abnahme pro Jahr bei rund 2%.Etwas schwächer war sie in den zwei darauffolgenden Jahrzehnten.Mit der Neuorientierung der Agrarpolitik in den neunziger Jahren setzte wieder ein höherer Strukturwandel ein. In den ersten drei Jahren des neuen Jahrtausends ist die jährliche Abnahmerate gegenüber den neunziger Jahren wieder leicht zurück gegangen.
Die zahlenmässige Abnahme der Betriebe im Zeitraum 1990–2000 betraf rund zur Hälfte Kleinstbetriebe mit einer Fläche bis 3 ha.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen bis 20 ha.Zunahmen wurden hingegen bei Betrieben der Grössenklassen über 20 ha festgestellt.
In den ersten drei Jahren des neuen Jahrtausends schwächte sich die jährliche Abnahmerate bei den Kleinstbetrieben gegenüber 1990–2000 etwas ab.Höher war sie hingegen bei den Betrieben der Grössenklassen 3–10 ha und 10–20 ha.Die Wachstumsschwelle lag im Jahr 2003 bei 25 ha.Dies bedeutet,dass per Saldo die Anzahl Betriebe in den Grössenklassen bis 25 ha abgenommen und über diesem Wert zugenommen hat.
Im Jahrzehnt 1990–2000 nahm die Zahl der Betriebe in der Talregion um rund 10'000 ab,in der Hügel- und Bergregion wurden zirka 5'500 bzw.6'500 weniger Betriebe gezählt.Die jährliche Abnahmerate in dieser Zeit war in den drei Regionen vergleichbar.

Zwischen 2000 und 2003 wurden in der Talregion rund 2'500 weniger Betriebe gezählt,in der Hügelregion lag der Rückgang bei rund 1'000 Betrieben und in der Bergregion bei rund 1'200 Betrieben.Die jährliche Abnahmerate war in der Talregion gleich hoch wie in den zehn Jahren zuvor,in der Hügel- und Bergregion deutlich geringer.
Entwicklung der Anzahl Haupterwerbsbetriebe nach Region
Entwicklung der Anzahl Nebenerwerbsbetriebe nach Region
Talregion11 4518 076–3,47 5517 095–4,2
Hügelregion7 0895 164–3,14 8644 755–2,7
Bergregion10 0338 058–2,27 5526 890–5,1
Total28 57321 298–2,919 96718 740–4,2
Quelle:BFS
Bei der Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe sind deutliche Unterschiede festzustellen.So ist die Abnahmerate bei den Haupterwerbsbetrieben in den letzten Jahren gegenüber den neunziger Jahren zurückgegangen.In der Bergregion wurden 2003 praktisch gleich viele Haupterwerbsbetriebe gezählt wie im Jahr 2000.Auf der anderen Seite ist die Abnahmerate bei den Nebenerwerbsbetrieben angestiegen,insbesondere in der Bergregion.Insgesamt wurden zwischen 2000 und 2003 2’113 Haupterwerbsbetriebe und 2’558 Nebenerwerbsbetriebe aufgegeben.
Der Pachtlandanteil hat in der Zeit von 1990 bis 2003 in allen Regionen zugenommen. Am grössten war die Verschiebung im Berggebiet.Dort erhöhte sich der Anteil um 4 Prozentpunkte.In absoluten Zahlen nahm die Pachtfläche je Betrieb in dieser Region um 2,7 ha zu,die Fläche im Eigentum um 2,2 ha.In der Tal- und Hügelregion bestand der Flächenzuwachs je zur Hälfte aus Zupacht und Kauf.Die Ausdehnung des Pachtlandanteils war in diesen Regionen mit rund 3 Prozentpunkten etwas geringer als in der Bergregion.Interessant ist,dass die Verschiebung zugunsten des Pachtlandes zwischen 1990 und 1996 stattfand.Seit diesem Zeitpunk ging der Anteil in allen Regionen wieder leicht zurück.
Zwischen 1990 und 2003 wurden in allen Regionen Zunahmen der duchschnittlichen LN pro Betrieb festgestellt.In der Talregion stieg die bewirtschaftete Fläche um 4,9 ha auf 17,2 ha,in der Hügelregion um 4 ha auf 15,4 und in der Bergregion um 4,9 ha auf 15,1 ha.
Parallel zum Rückgang der Anzahl Betriebe nahmen auch die Beschäftigten in den letzten Jahren kontinuierlich ab.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigte
Im Jahr 2000 wurden in der Landwirtschaft gesamthaft 49'768 Beschäftigte weniger gezählt als noch 1990.Abgenommen haben in diesem Zeitraum ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte erfuhr eine leichte Zunahme.
Zwischen 2000 und 2003 schwächte sich der Rückgang der Beschäftigten in ähnlichem Ausmass ab wie bei der Anzahl Betriebe.Sowohl die Zahl der Familieneigenen als auch die der Familienfremden nahm ab.Bei den familieneigenen Arbeitskräften fällt auf,dass die Zahl der Betriebsleiterinnen zugenommen hat.

Der Einsatz der Technik hat es der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten ermöglicht,die Arbeitsproduktivität stark zu erhöhen.Die technische Ausrüstung hat sich auch seit 1990 weiter entwickelt.

Entwicklung der technischen Ausrüstung in der Landwirtschaft
1990:inkl.Kleinstbetriebe
1996:neue Erhebungsnorm 2003:hochgerechnete Stichprobenergebnisse
In den letzten Jahren hat der Einsatz schlagkräftigerer Maschinen und Einrichtungen zugenommen.So stieg beispielsweise die Anzahl Traktoren mit über 75 PS Leistung und die Anzahl Sammelpressen für Grossballen stark.Mehr als verdreifacht hat sich ebenfalls die Anzahl drei- oder mehrschariger Anbaupflüge.Die Zahl der Mähdrescher zeigt wie schon in früheren Erhebungen eine sinkende Tendenz,dafür kommen aber grössere und leistungsfähigere Maschinen zum Einsatz.Bei den Einrichtungen ist eine rasche Entwicklung in Richtung arbeitssparender Anlagen beobachtbar.So verringerte sich im betrachteten Zeitraum die Zahl der Eimermelkanlagen zu Gunsten von Rohrmelkanlagen und Melkständen deutlich,und die Anzahl der eingesetzten Futtermischwagen hat sich seit 1996 mehr als verdoppelt.
Zwischen 1996 und 2003 gab es in der Rindviehhaltung eine weitere markante Verlagerung der Anzahl Stallplätze vom Anbinde- zum Laufstall.Rund 45% der Plätze befanden sich 2003 in Laufställen.1996 lag der Anteil bei 32%.Diese Entwicklung in Richtung vermehrter Laufstallhaltung wurde u.a.durch die Ausrichtung von Beiträgen für die besonders tierfreundliche Stallhaltung (ab 1996) und zusätzlich seit 1999 durch erhöhte Investitionshilfen beim Bau dieser Ställe beeinflusst.
■
Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR) wird vom BFS in Zusammenarbeit mit dem SBV nach dem europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen berechnet.2003 wurde die LGR einer umfassenden Weiterentwicklung unterzogen. Mit der Revision sind die Ergebnisse direkt mit jenen der EU vergleichbar.
Bruttowertschöpfung 1 der Landwirtschaft und ihrer vor- und nachgelagerten Branchen
■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten
Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung in der Zeitspanne 1997–2001 zeigt für die Landwirtschaft einen anderen Verlauf als für die vor- und nachgelagerten Branchen. Während in den vor- und nachgelagerten Branchen die Bruttowertschöpfung um 815 Mio.Fr.oder 12,4% bzw.1,6 Mrd.Fr.oder 8,5% zunahm,ging der Wert der Landwirtschaft um fast 800 Mio.Fr.oder rund 15% zurück.Gesamthaft erhöhte sich in diesen Jahren die Wertschöpfung des Nahrungsmittelsektors um 1,6 Mrd.Fr.oder 5,4%. Anteilsmässig trugen 2001 die nachgelagerten Branchen mit 63% am meisten zur Wertschöpfung bei.Der Anteil der vorgelagerten Branchen lag bei rund 23%,derjenige der Landwirtschaft bei 14%.
Im Berichtsjahr haben die gesamten Einfuhren gegenüber dem Vorjahr um 0,3% abgenommen,die gesamten Ausfuhren um 0,8%.Die Importe sanken von total 130,2 auf 129,7 Mrd.Fr.,die Exporte von 136,5 auf 135,4 Mrd.Fr.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen hingegen zog in dieser Zeitspanne wieder leicht an.Die Importe stiegen von 8,5 auf 8,9 Mrd.Fr.,die Exporte von 3,5 auf 3,6 Mrd.Fr.
Im Berichtsjahr stammten 75,2% der Landwirtschaftsimporte (6,7 Mrd.Fr.) aus der EU.
67,6% der Exporte (2,5 Mrd.Fr.) wurden in den EU-Raum getätigt.Gegenüber dem Vorjahr haben die Einfuhren von der EU um gut 330 Mio.Fr.und die Ausfuhren in die EU um rund 120 Mio.Fr.zugenommen.
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2003
Tabak und Diverses (13, 14, 24)
Milchprodukte (4)
Nahrungsmittel (20, 21)
Genussmittel (9, 17, 18)
Tierfutter, Abfälle (23)
Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)
Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)
Lebende Pflanzen, Blumen (6)
Gemüse (7)
Früchte (8)
Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)
Getränke (22)
Einfuhren Import- bzw. Exportüberschuss Ausfuhren
Quelle: OZD
Die Schweiz ist bezüglich Nahrungsmittel ein stark importorientiertes Land.Im Berichtsjahrwurden vor allem Getränke,tierische Produkte (inkl.Fische) sowie Nahrungsmittelzubereitungen und Früchte eingeführt.Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser.Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.
Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.
Exportüberschüsse wurden bei Tabak und Diverses (+261 Mio.Fr.) sowie Milchprodukten (+122 Mio.Fr.) erzielt.Gegenüber dem Vorjahr ging der Exportüberschuss bei Milchprodukten um 34 Mio.Fr.zurück,bei Tabak und Diverses blieb er praktisch stabil (2002:+259 Mio.Fr.).
Die schweizerische Landwirtschaft hat den Verfassungsauftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.
Von Jahr zu Jahr sind Schwankungen festzustellen.Dies trifft vor allem auf die stark witterungsabhängigen Erträge im Pflanzenbau zu.Besonders ab der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurden grössere Ausschläge registriert.
2002 lag der Selbstversorgungsgrad bei 61% und war damit 2 Prozentpunkte höher als 2001.Im Pflanzenbau stieg der Wert von 40 im Jahr 2001 auf 45 Prozentpunkte. Bei tierischen Produkten lag der Inlandanteil gleich hoch wie 2001 (94%).
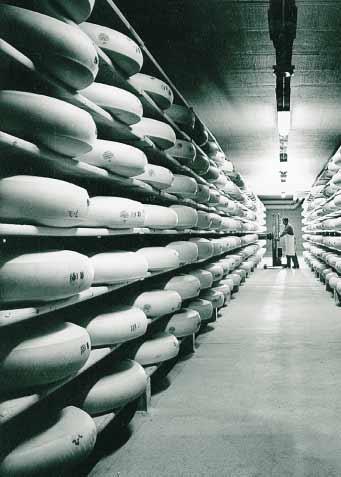
Der Produzentenpreisindex landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist in den neunziger Jahren und in den ersten beiden Jahren des neuen Jahrtausends mit Ausnahme des Jahres 2000 kontinuierlich gesunken.Im Berichtsjahr stieg der Index um 1,1 auf 75,6 an.Der Anstieg ist einerseits auf hohe Produktepreise vor allem bei Gemüse infolge extremer Trockenheit und guten Preisen beim Fleisch zurückzuführen.Aber auch die biologische Produktion (Gemüse,Obst,Milch) und die Labelproduktion (Natura Beef), welche neu seit der Revision des Indexes im Mai 2003 berücksichtigt werden,dürften zum Anstieg beigetragen haben.
Im Vergleich zum Produzentenpreisindex verlief in dieser Zeitspanne die Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise in die entgegengesetzte Richtung.Vor allem ab 1999 ist eine starke Zunahme feststellbar.Mit einem Wert von 110,6 Prozentpunkten im Berichtsjahr legte der Index gegenüber 2002 um weitere 1,3 Prozentpunkte zu.
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel
Produzentenpreisindex
Index (1990/92 = 100)
Landwirtschaft
Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke
Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel
Importpreisindex
1 Basis Mai 2003 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Bis April 2003 enthielt der Importpreisindex für die Gruppe «Nahrungsmittel» lediglich die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Mit der Revision von Mai 2003 wurden zusätzliche Untergruppen aufgenommen. So deckt der Index nun einen weit grösseren Bereich der Nahrungsmittelimporte ab.
für Nahrungsmittel 1 Quellen: BFS, SBV
Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel ist im Berichtsjahr gegenüber 2002 um 0,1 Prozentpunkte auf 99,7 Prozentpunkten leicht angestiegen. Der Index ist seit 2001 praktisch konstant.Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch,dass sich in diesem Index sowohl Produktionsmittel aus hauptsächlich landwirtschaftlicher Herkunft (Saatgut,Futtermittel) und solche aus der übrigen Wirtschaft ausdrücken.Der erste Teilindex ist zwar über die beobachtete Periode gesunken,der letztere jedoch in derselben Periode angestiegen.
Im Mai 2003 wurde der Importpreisindex für Nahrungsmittel revidiert und auf eine neue Basis gestellt (Mai 2003 = 100).Zusätzliche Untergruppen wurden in den Warenkorb aufgenommen.Durch die Basisanpassung hat sich das Niveau der ganzen Kurve nach unten verschoben (vgl.Agrarbericht 2003).Im Berichtsjahr lag der Index bei 100,4 Prozentpunkten und somit 0,2 Prozentpunkten tiefer als 2002.
Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 49'962 Mio.Fr. Dies entspricht einer Reduktion von 1,5% gegenüber 2002.Für Landwirtschaft und Ernährung wurden 3'907 Mio.Fr.oder 3,9% weniger als im Vorjahr aufgewendet.Nach sozialer Wohlfahrt (13'388 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (9'622 Mio.Fr.),Verkehr (7'338 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'700 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag im Berichtsjahr bei 7,8%.Der Wert ist tiefer als 2002 (8%) sowie 2001 und 2000 (7,9%).
Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187,Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet,wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind.Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio.Fr.1998 betrugen die Ausgaben für Produktion und Absatz 1‘203 Mio.Fr.2003 waren es noch 798 Mio.Fr.Mit einem Abbau von 405 Mio.Fr.zwischen 1998 und 2003 wurden somit die Verpflichtungen erfüllt.
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung.
1Die ausserordentlichen Ausgaben im Milchsektor sind in diesem Betrag eingerechnet.Dies ging zulasten von anderen Bereichen wie z.B.Strukturverbesserungen und Viehwirtschaft.
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Die leichte Ausgabenerhöhung bei den Direktzahlungen im Berichtsjahr ist auf Mehrbeteiligungen an Ökoprogrammen wie Bio,BTS und RAUS zurückzuführen.
Der Ausgabenzuwachs von rund 20 Mio.Fr.bei den Grundlagenverbesserungen im Berichtsjahr ist u.a.mit dem Nachtragskredit für die Behebung der Unwetterschäden
2002 in Verbindung zu setzen.
Der heisse Sommer 2003 hat die Produktion verschiedener landwirtschaftlicher Erzeugnisse beeinflusst.Die Milchproduktion ging gegenüber dem Vorjahr leicht zurück, ebenso der Absatz von Käse auf den Exportmärkten.Dafür konnte der Rind- und Schweinefleischmarkt von einem guten Jahr profitieren.Auch der Geflügelfleischkonsum stieg weiter an.Die Trockenheit führte bei den Ackerkulturen zu Ertragseinbussen. Wegen Futtermangel wurde Körnermais vorzeitig siliert.Im Vergleich zu den vier Vorjahren stiegen die Erntemengen von Gemüse leicht an,die Obstmengen verzeichneten einen leichten Rückgang.
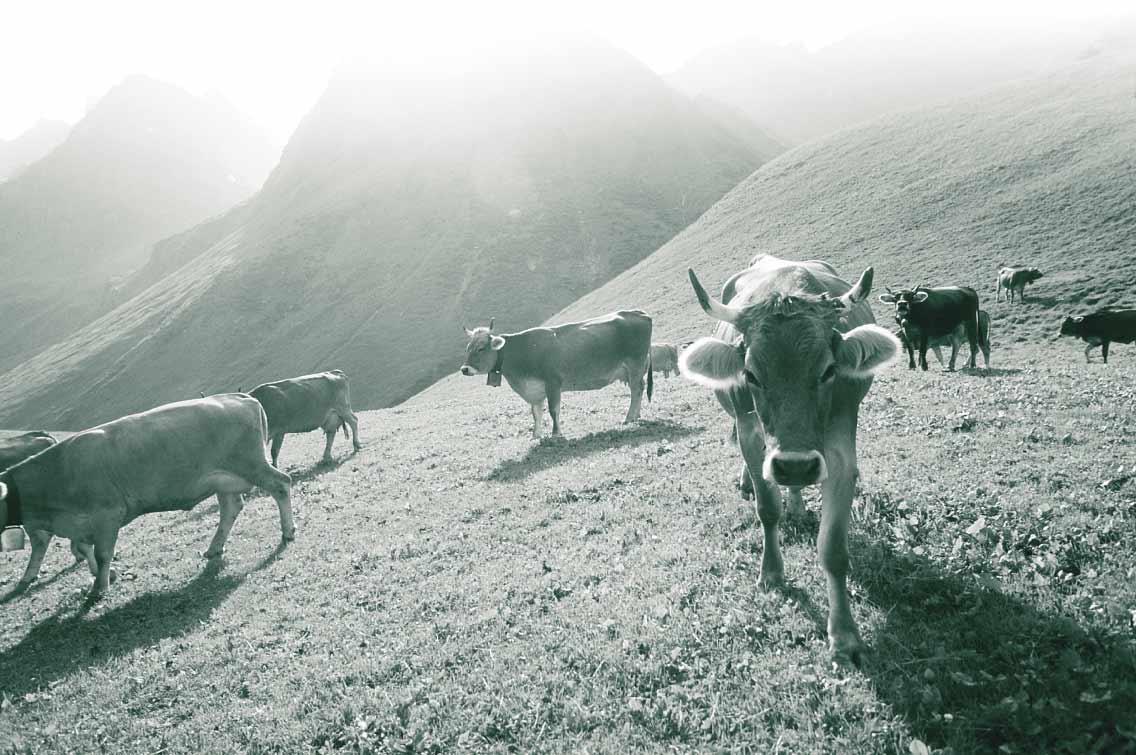
Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches 2003
Nichtlandw. Nebentätigkeiten 3%
Landw. Dienstleistungen 6%
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 2%
Wein 4%
Obst 5%
Gemüse- und Gartenbau 14%
Futterpflanzen 10%
Kartoffeln, Zuckerrüben 3% Getreide 4%
Milch 23%
Rindvieh 10%
Schweine 11%
Geflügel, Eier 4% Sonstige tierische Erzeugnisse 1%
Quelle: BFS
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Güter (Tierische und pflanzliche Erzeugnisse) hat gegenüber dem Vorjahr um 4,0% abgenommen:Pflanzliche Erzeugung minus 7,8% (–357 Mio.Fr.);tierische Erzeugung minus 0,4% (–22 Mio.Fr.).In der pflanzlichen Erzeugung sind neu auch die Futterpflanzen,die Erzeugnisse des Gartenbaus,die landwirtschaftlichen Dienstleistungen sowie die nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten (z.B.Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Betrieb) enthalten.
■ Produktion:leichter Rückgang der Milcheinlieferungen
Das Berichtsjahr 2003 war wiederum ein schwieriges Milchjahr für Produzenten, Verarbeiter und Handel.Obwohl weniger Milch eingeliefert wurde,erholten sich die Produktemärkte nicht.Speziell der Käseexport stagnierte weiter.Dagegen stieg der Import von Käse.Diese Marktsituation führte im Ergebnis auch zu tendenziell tieferen Erlösen der Milchproduzenten.
Die gesamte Milchproduktion betrug im Jahr 2003 3,91 Mio.t (–20’000 t gegenüber 2002).Rund 19% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert.Die Milchleistung pro Kuh nahm im Berichtsjahr weiter auf 5'590 kg (+40 kg) zu.
Im Berichtsjahr verkauften die Produzenten 3,17 Mio.t Milch oder 1,2% weniger als 2002.Diese Milch stammte von gut 600’000 Kühen.
In den ersten acht Monaten des Berichtsjahres waren die monatlichen Milcheinlieferungen tiefer als im Vorjahr.In den Monaten September bis Dezember wurde mehr Milch als im Jahr 2002 eingeliefert.Der leichte Rückgang der Produktion (–37’817 t oder –1,2%) ist auf folgende Gründe zurückzuführen:
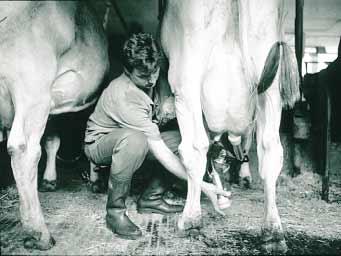
die Milchkontingentsmenge wurde von 102,5% auf 100% des Grundkontingents gekürzt; – der Sommer 2003 war heiss und trocken;
der Käseabsatz auf den Exportmärkten war schlecht.
Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,17 Mio.t) wie folgt verwertet (in t Milch):
Zu Käse:1 295 000 t (–0,2%)
Zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1 115 000 t (–0,7%)
Zu Rahm/Butter:743 000 t (–3,4%)
Im Jahr 2003 veränderte sich die Käseproduktion gegenüber dem Vorjahr kaum (Rückgang von 160'403 t auf 160'165 t oder –0,15%).Die Produktion von Hartkäse nahm um 46 t auf 68'927 t zu,hingegen sank diejenige von Halbhartkäse um 785 t und erreichte 46'650 t.Die in den letzten Jahren kontinuierlich steigende Produktion von Frischkäse konnte auch im Berichtsjahr,in etwas kleinerem Umfang,beobachtet werden:+1,7% (auf 37'101 t).Ebenfalls eine leicht positive Entwicklung wies das Produktionsvolumen von Schaf- und Ziegenkäse auf (von 652 auf 708 t oder +8,6%).
Nachdem letztes Jahr ein Rückgang im Bereich der Frischmilchprodukte festgestellt wurde,konnte im Jahr 2003 eine Produktionszunahme (ausser bei Konsummilch) um 7,9% auf 218’199 t verzeichnet werden.Bei der Konsummilch änderte der seit einigen Jahre sinkende Trend auch im Berichtsjahr nicht (von 503'325 t auf 494'635 t).
Rückläufig waren die Rahm- und die Butterproduktion.Gegenüber dem Vorjahr nahm die Produktion bei Rahm um 7,1% (von 68'873 t auf 63'997 t) und bei Butter um 3,2% (von 42’226 t auf 40'857 t) ab.
■ Aussenhandel:Deutlich mehr Joghurt-Exporte
Die Aussenhandelsbilanz hat sich auch im Berichtsjahr kaum verändert:sie ist nach wie vor positiv.Die Schweiz exportiert mengenmässig mehr Käse,Joghurt,Milchpulver und Rahm als sie importiert.Folgende Entwicklungen fallen auf:die grosse Zunahme des Joghurt- und Rahmexportes und der Wegfall des Butterexportes.
Im Berichtsjahr wurden 10'642 t Joghurt exportiert.Im Vergleich zum Jahr 2002 entspricht dies einer Zunahme von 6'834 t oder 179%.Auch die Ausfuhr von Milchmischgetränken konnte gesteigert werden.Auf der anderen Seite nahmen die Einfuhren von 192 t auf 718 t (+274%) zu.Der Rahmexport wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 493 t oder 87% auf 1'062 t.
Der Käseimport aus der EU ist im Zeitraum Juni 2003 bis März 2004 gegenüber derselben Vorjahresperiode um 2,6% gestiegen.
Im zweiten Jahr nach In-Kraft-Treten des Käseabkommens wurden nicht bei allen Nullzollkontingenten die zur Verfügung stehende Menge zugeteilt.Von den verfügbaren 14'500 t im zweiten Jahr wurden insgesamt 12'706 t versteigert.Wie schon im ersten Jahr überschritt die Gebotsmenge die Kontingentsmenge der beiden Kontingente 119 (Mozzarella) und 120 (Frisch- und Weichkäse).Im zweiten Jahr war auch erstmals ein grösseres Interesse am Kontingent 123 (Hart- und Halbhartkäse) zu beobachten.Die Mengen dieser drei Kontingente konnten vollumfänglich zugeteilt werden.
Gemäss Abkommen standen im 2.Jahr 4'250 t für einen zusätzlichen zollfreien Käseexport in die EU zur Verfügung (Erhöhung des Nullzollkontingentes um 1'250 t gegenüber dem 1.Jahr).Im Gegensatz zum 1.Jahr wurde die Marktzutrittsmöglichkeit etwas besser genutzt.Im Juli 2003 vergab die EU für den Zeitraum Juli 2003 bis Dezember 2003 Einfuhrlizenzen in der Höhe von 963 t.Verfügbar wären für diesen ersten Halbjahreszeitraum 2'125 t.Für die zweite Jahreshälfte 2003/04 standen demnach, einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,3'287 t zur Verfügung.
■ Verbrauch:stabiler Käsekonsum
Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Milch und Milchprodukten zeigt eine schwach steigende Tendenz.Der Käse- und Quarkkonsum ist 2003 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert geblieben.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums
1990/92200120022003
Der Konsum von Milchgetränken nahm im Vergleich zum Vorjahr von 3,7 kg auf 4,6 kg (+24,3%) zu.Ein leichter Anstieg konnte ebenfalls im Frisch- (+0,2 kg auf 4,8 kg) und Hartkäsekonsum (+0,2 kg auf 6,2 kg) verzeichnet werden.
■ Produzentenpreise: Tendenz weiter sinkend
Im Jahr 2003 wurde im Vergleich zum Vorjahr ein weiterer Rückgang der Produzentenpreise festgestellt.Der Zielpreis (per 1.Januar 2004 aufgehoben) von 73 Rp.wurde im Berichtsjahr aber dennoch übertroffen.Der Durchschnittspreis lag 2003 gegenüber dem Vorjahr 2.85 Rp.pro kg Milch tiefer bei 75.54 Rp.
Milchpreise 2003 gesamtschweizerisch und nach Regionen
Die regionalen Differenzen bei der Industriemilch und der Biomilch sind 2003 im Vergleich zum Vorjahr kleiner geworden.Im Berichtsjahr betrugen sie bei der Industriemilch bis zu 1.16 Rp.und bei der Biomilch bis zu 0.52 Rp.Die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bei der verkästen Milch hingegen sind wie schon im Vorjahr wiederum angestiegen:sie betrugen bis zu 7.77 Rp.Der Preis für Biomilch nahm um 4,3% ab und erreichte durchschnittlich 89.21 Rp.pro kg Milch.Für Biomilch wird zwischen 7.44 Rp.und 15.21 Rp.pro kg Milch mehr als für die übrige Milch bezahlt.
■ Konsumentenpreise: für Käse steigend trotz sinkenden Produzentenpreisen
Mit Ausnahme des Mozzarella bezahlte der Konsument für den Käse einen etwas höheren Preis als im Vorjahr.Der Preis für 1 kg Emmentaler betrug durchschnittlich 20.89 Fr.(+2,8% oder +56 Rp.) und für 1 kg Greyerzer 21.02 Fr.Für einen halben Liter Vollrahm wurde im Vergleich zum Vorjahr 12 Rp.weniger (4.80 Fr.) verlangt.
Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte
Die Konsumentenpreisindices für Rahm und Milch wiesen im Jahr 2003 sinkende Tendenzen auf.Der Index für Rahm sank um 2,5 Punkte oder 3,2%.Dagegen blieben diejenigen für Käse,andere Milchprodukte und Butter praktisch unverändert.
Von Juni bis Dezember 2003 wurde bei der Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukten eine sinkende Tendenz beobachtet.Im Dezember hingegen verzeichnete sie eine Zunahme,die hauptsächlich auf den gesunkenen Produzentenpreis für Milch zurückzuführen ist.Nachdem die Bruttomarge für Butter im Mai den höchsten Wert des Berichtsjahres erreicht hatte,notierte sie im November 2003 ihren Tiefststand.Infolge von Verkaufsaktionen eines Grossverteilers sind sowohl die Verkaufspreise als auch die Bruttomarge auf dem Produkt «Die Butter» gesunken.Bei der Bruttomarge Joghurt war der Tiefststand im November,auch dies lässt sich in erster Linie durch die Aktionsangebote eines Grossverteilers erklären.Im März und April erhöhte sich die Bruttomarge Verarbeitung – Verteilung auf der Produktegruppe «Käse».Ursache dafür sind hauptsächlich der Abschluss der Aktionsverkäufe auf Hart- und Halbhartkäsen und der in den vergangenen Monaten gesunkene Milchpreis.

■ Produktion:Steigender Schaf-,Ziegen- und Mastgeflügelbestand

Die Rind- und Schweinefleischproduzenten profitierten von einem guten Jahr.Sie lösten 5 bis 40% höhere Preise als im Vorjahr.Hingegen erlitten die Lammfleischproduzenten infolge des grösseren Inlandangebotes eine Preiseinbusse von 9%.Der Fleisch- und Fischkonsum lag im Berichtsjahr bei 59,86 kg pro Kopf.Ungebrochen ist dabei der Trend des steigenden Geflügelfleischkonsums.Er ist mit rund 10 kg pro Kopf nun beinahe so hoch wie der Rindfleischkonsum.Erneut ist der Bestand an Verkehrsmilchkühen gesunken,und zwar erstmals auf unter 600'000 St.
Durch einen Entscheid des EU-Agrarrats vom 17.November 2003 anerkennt die EU die Schweizer Vorschriften zur Rinderkrankheit BSE als gleichwertig an.Handelsschranken einzelner EU-Mitgliedsländer gegen Schweizer Rinder sind damit unzulässig.Seit 2002 haben Deutschland,Frankreich und Spanien die Grenzen schrittweise geöffnet.Nach dem Agrarrats-Entscheid mussten auch Italien,der vor 1996 grösste Abnehmer,und Österreich ihre Grenzen für Schweizer Rinder öffnen.Im Berichtsjahr traten 21 BSEFälle auf.Damit hat sich der Rückgang der letzten Jahre in abgeschwächter Form fortgesetzt:2002 waren es 24 BSE-Fälle,2001 gar 42.Untersucht wurden im Rahmen des behördlichen Untersuchungsprogramms rund 26'000 Tiere und auf freiwilliger Basis über 150'000 Tiere.
Der Rindviehbestand nahm wiederum um 1,5% ab.Vor allem die Verkehrsmilchkühe wurden deutlich reduziert (–18'000 St.).Zugenommen hat hingegen der Mutter- und Ammenkuhbestand (7'000 St.).Bereits jede zehnte Kuh ist eine Mutter- oder Ammenkuh.Die Bedeutung der Kuhhaltung wird unterstrichen durch die Tatsache,dass 94% der Rindvieh haltenden Betriebe Kühe besitzen.
Ziegen und Schafe sind geeignete Tiere für die Beweidung von steilen Flächen und zur sinnvollen Nutzung von kleineren Parzellen in Siedlungsgebieten.Gegenüber 1990 werden 25% mehr Schafe und 10% mehr Ziegen gehalten.Stark zugenommen haben dürfte der Bestand bei Hobbyhaltern und Nebenerwerbsbetrieben.Wie in den vergangenen Jahren beträgt der Zuwachs des Mastgeflügelbestandes 5%.Im Vergleich zu 1990 stehen 57% mehr Mastgeflügel in Schweizer Ställen.Seit 1990 (38'000 Tiere) vergrösserte sich der Pferdebestand stetig und erreichte im Berichtsjahr 53'000 Tiere. Pferde werden zwar für landwirtschaftliche Arbeiten wesentlich weniger als früher gebraucht,sie sind aber ein überaus beliebtes Freizeittier.Als Folge der stetig verbesserten Legeleistung liegt der Lege- und Zuchthennenbestand erstmals unter 2 Mio. Tieren.Im Vergleich zu 1990 sank der Bestand sogar um 29%.
Im Jahr 2003 produzierte die Schweizer Landwirtschaft 4,2% mehr Schaffleisch und 3,7% mehr Geflügelfleisch als im Vorjahr.Das Mehrangebot an Schaffleisch führte zu einem Preisdruck auf dem Inlandmarkt.Lediglich Fr.10.– je kg SG bezahlten die Abnehmer für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) gegen Ende des Berichtsjahres.Der steigende Konsum von Geflügelfleisch absorbierte demgegenüber die Mehrmengen problemlos.Die Produktion von Schweine- und Rindfleisch sank infolge des sinkenden Tierbestandes um 2,5 bzw.1,9%.
Lediglich jedes achte Kilogramm Pferdefleisch,jedes fünfte Kilogramm Kaninchenfleisch sowie etwa jedes zweite Kilogramm Geflügel-,Ziegen- und Schaffleisch stammt aus einheimischer Produktion.Vom konsumierten Rind- und Schweinefleisch wird demgegenüber 91% bzw.93% in der Schweiz produziert.
Die Eierproduktion sank gegenüber dem Vorjahr um 3% und belief sich auf 680 Mio.St. 96% der inländischen Eier werden im Detailhandel und in der Gastronomie verkauft. Lediglich 4% werden aufgeschlagen und als Eiprodukte in der Lebensmittelindustrie verwendet.
■ Aussenhandel: Geflügelfleisch stammt grösstenteils aus Europa
1'800 t Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnisse wurden ausgeführt,was 300 t mehr ist als im Vorjahr.Das bekannte Trockenfleisch nimmt mit 1'042 t den Hauptanteil ein. Es wird zu über 99% in Frankreich und Deutschland konsumiert.
Schweizer Firmen führten über 86'000 t Fleisch und Fleischerzeugnisse ein.Diese Waren wiesen an der Grenze einen Wert von rund 650 Mio.Fr.auf.Am bedeutendsten sind das Geflügel- und Schweinefleisch,wovon gegen 46'000 t bzw.12'000 t importiert wurden.Wegen des geringeren Inlandangebots stiegen die Einfuhren von Schweinefleisch um 34%.Um 5% zugenommen hat auch die Einfuhr des in der Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten liegenden Geflügelfleisches.
Hauptlieferländer von Rind- und Kalbfleisch sind Brasilien (74%),Südafrika (7%),die USA (5%) und Frankreich (4%).Aus Brasilien stammen vor allem die zugeschnittenen Rindsbinden für die Trockenfleischherstellung,aus den USA das so genannte US-Beef. Schweizerinnen und Schweizer bevorzugen australisches und neuseeländisches Schafund Lammfleisch,das einen Importanteil von 82% aufweist.Frankreich,Deutschland und das Vereinigte Königreich teilen sich die restlichen 18%.Kanada (38%),die USA (32%),Argentinien (13%) und Australien (12%) sind die beliebtesten Pferdefleischlieferanten.Vier Fünftel des eingeführten Geflügelfleisches stammen aus Europa.An erster Stelle stehen Frankreich (25%) und Ungarn (20%).China als Hauptlieferant des Jahres 2000 ist als Importeur fast bedeutungslos geworden.Sein Importanteil brach infolge der Rückstandsproblematik von Antibiotika von 35 auf 1% ein.Profitiert von diesem Einbruch haben vorab Brasilien und Deutschland,die ihre Importanteile signifikant vergrösserten.Traditionell sind italienische Wurstwaren in der Schweiz äusserst beliebt.Etwa 2'500 t kauft der Schweizer Handel im südlichen Nachbarland ein. Fleischzubereitungen und Konserven stammen dagegen grösstenteils aus Deutschland und Frankreich.
3'201 Tiere der Pferdegattung und Esel führten die Schweizerinnen und Schweizer ein. So viele Tiere wurden seit zehn Jahren nicht mehr importiert.Jedes dritte Pferd ist aus deutscher,jedes vierte aus französischer Provenienz.Immerhin exportierte die Schweiz im Gegenzug auch 832 Pferde.
Die Eierimporte (Schaleneier und Eiprodukte) kommen zu rund 35% aus Deutschland, zu 26% aus den Niederlanden und zu 18% aus Frankreich.
■ Verbrauch: Die Hälfte des Fleisches wird in Privathaushalten gegessen
Der Fleischverbrauch lag mit 393'000 t 0,3% unter dem Vorjahreswert.Sehr beliebt sind Geflügelfleisch (+4,9%),Ziegenfleisch (+4%) sowie Schaf- und Lammfleisch (+1,4%).Der Rindfleischverbrauch sank hingegen um 3,7%.Ausserdem verzehrten die Konsumentinnen und Konsumenten 57'000 t Fische und Krustentiere,was einer Zunahme von 2,5% entspricht.
Der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch,Fisch und Krustentieren sank bei wachsender Bevölkerung um 0,9% auf 59,86 kg.Schweinefleisch ist nach wie vor das am meisten konsumierte Fleisch (25,15 kg),gefolgt von Rindfleisch (10,15 kg),Geflügelfleisch (10,09 kg),Fische und Krustentiere (7,58 kg) und Kalbfleisch (3,67 kg).Marginal konsumiert werden die anderen Fleischsorten.
Schätzungsweise die eine Hälfte des Fleisches wird in Privathaushalten konsumiert, während die andere Hälfte ausser Haus (Gastronomie und Kantinen) verzehrt wird.Die traditionellen Fleischprodukte (Charcuterie,Würste,Schweine-,Geflügel- und Rindfleisch) werden von 90% der Konsumentinnen und Konsumenten mindestens einmal pro Jahr gekauft.Wild-,Pferde- oder Kaninchenfleisch wird dagegen von weniger als einem Drittel mindestens einmal pro Jahr zuhause zubereitet.Ausser Haus wird bei jeder fünften Fleischmahlzeit Rindfleisch gegessen,bei jeder sechsten Schweinefleisch und bei jeder achten Geflügelfleisch.Praktisch bedeutungslos ist Wild- und Lammfleisch,das nur bei 2,3% der Ausserhausmahlzeiten auf dem Teller liegt.
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern
1990/92200120022003
Quellen: Proviande und SBV
■ Produzentenpreise: Preise für Kühe,Banktiere und Schweine im Hoch
Trotz regional grosser Sommertrockenheit nahmen die Kuh- und Banktierpreise um 10 bis 40% gegenüber 2002 zu.Die Befürchtungen,die Kuh- und Rinderschlachtungen könnten sich infolge des Futtermangels in einigen Regionen erhöhen,trafen nicht zu. Die Produktion ging sogar um 2% zurück – wohl auch wegen des gesunkenen Rindviehbestandes.Erstmals seit 2000 lösten die Produzenten im Jahresmittel mehr als Fr.8.– je kg SG für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3).Wegen der rückläufigen Schweinefleischproduktion (–2,5%) stiegen auch die Preise für Fleischschweine um 5% auf Fr.4.47 je kg SG.Als Folge des Mehrangebotes in der zweiten Jahreshälfte rutschten die Preise für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) im Jahresmittel auf Fr.11.53 je kg SG ab.
Monatliche Schlachtvieh- und Fleischschweinepreise 2003,
■ Konsumentenpreise: steigende Rind- und Schweinefleischpreise
Saisonale Preisschwankungen treten bei Schweinen und Tieren der Rindergattung auf. Die Kälberpreise kletterten infolge des rückläufigen Angebotes in der zweiten Jahreshälfte von Fr.10.80 auf rund Fr.14.– je kg SG.Für Schweine wurden wiederum im MaiJuli mit gegen Fr.5.20 je kg SG die höchsten Preise bezahlt.Das Grillieren kurbelte in dieser Periode die Nachfrage kräftig an.Wider dem gängigen Marktverlauf stiegen die Kuhpreise im Herbst an.Trotz Alpentladung war das Angebot gering und die Preise für Kühe guter Qualität (Handelsklasse T3) kletterten im vierten Quartal auf über Fr.6.–je kg SG.
Infolge der höheren Produzentenpreise für Rind- und Schweinefleisch nahmen auch die Konsumentenpreise gegenüber dem Vorjahr bis zu Fr.3.– je kg zu.Für Entrecôtes bezahlten Konsumentinnen und Konsumenten im Mittel Fr.53.39 je kg,was etwa Fr.2.– mehr ist als im Vorjahr.Die tieferen Produzentenpreise für Lämmer schlugen nicht bis zum Ladentisch durch.Für inländisches Lammfleisch legte man im Laden bis zu 5% mehr aus.Für alle untersuchten Fleischstücke gaben die Konsumentinnen und Konsumenten in den letzten drei Jahren zwischen 1 und 34% mehr je kg aus als im Mittel der Jahre 1990/92.Im Gegensatz dazu sanken die Produzentenpreise zwischen 15 und 52% je kg SG.
Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung stieg im Berichtsjahr für Schweinefleisch um 7 und für Lammfleisch um 8 Prozentpunkte.Rückläufig war sie beim Rindfleisch (–2 Prozentpunkte). Über alle Frischfleischsorten,Fleisch- und Wurstwaren betrachtet stagnierte die Bruttomarge gegenüber dem Jahr 2002.Im Vergleich zur Basisperiode Februar bis April 1999 weist Schweinefleisch mit 38,8% den stärksten Zuwachs auf.Die Bruttomargen bei Rindfleisch (15%),bei Lammfleisch (24%),bei Kalbfleisch (15%) sowie beim Warenkorb aus mehreren Frischfleischsorten,Fleischund Wurstwaren (16%) liegen deutlich über der Basisperiode.Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Lammfleisch auf,dessen Index sich zwischen 115,1 und 134,6 Punkten bewegte.
Entwicklung der Bruttomargen Fleisch 2003

■ Wettersituation: Hitzerekorde
Milden Temperaturen zu Jahresbeginn folgte eine andauernde Kälteperiode,die Mitte Februar im Mittelland teilweise zehntägigen Dauerfrost zur Folge hatte.Im März führten um rund 65% über dem langjährigen Mittel liegende Temperaturen im Mittelland und um rund 50% geringere Niederschlagsmengen bereits im Vorfrühling zu einer negativen Wasserbilanz (Verdunstungsmenge > Niederschlagsmenge).Ausgedehnter Hochdruckeinfluss bis Ende August ergab einen viel heisseren Sommer als alle bis 1753 zurückreichenden Klimareihen aufzeigen.Einem vergleichsweise kühlen und niederschlagsreichen Oktober folgten milde Wintermonate mit wenig Niederschlägen.Das Jahr 2003 war insgesamt 1,6 bis 2 Grad wärmer als das Mittel der Jahre 1961 bis 1990.Geringe Niederschlagsmengen von Jahresbeginn bis September führten zusammen mit den hohen Sommertemperaturen zu einer ausgedehnten Trockenheit.Die Jahresniederschläge erreichten nur 70 bis 85% der üblichen Werte.Besonders trocken war es vom Delsberger Becken bis in den Aargauer Jura,im Oberwallis,im nördlichen und mittleren Tessin,im Misox,Bündner Oberland und in Mittelbünden,wo nur 55 bis 70% der normalen Jahresniederschläge fielen.Im Mittelland erreichte die Jahresbesonnung 130 bis 140% der Normalwerte.Das Berichtsjahr war das sonnenreichste seit 1949.
■ Produktion:mehr Hülsenfrüchte und Konzentration im Obstbau
Im Vorjahresvergleich nahm die Getreideanbaufläche um rund 6'600 ha ab (–3,8%), wobei die Wintersaaten im Herbst 2002 infolge grosser Niederschlagsmengen grösstenteils unter misslichen Bodenbedingungen eingebracht werden mussten. Flächenrückgänge verzeichneten Weizen,Dinkel und Roggen,währenddem die Futtergetreidefläche stabil blieb.Durch die anhaltende Ausdehnung des Eiweisserbsenanbaus nahm die Anbaufläche der Hülsenfrüchte um 23% zu.Bei den Futterrüben setzte sich der Trend einer rückläufigen Anbaufläche fort.Hingegen verzeichneten die Ölsaaten seit dem Vorjahr eine Flächenzunahme von 4%.
Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2003
Total 284 281 ha
Silo- und Grünmais 14% 40 388 ha
Freilandgemüse 3% 8 459 ha
Raps 6% 16 006 ha
Zuckerrüben 6% 17 545 ha
übrige Kulturen 7% 21 458 ha
Getreide 59% 166 846 ha
Kartoffeln 5% 13 579 ha
Quelle: SBV
Auf einer Fläche von 23’689 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 14’929 ha Reben,6’584 ha Obstanlagen und 283 ha Strauchbeeren.
Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Gemüsefläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13’400 ha.Sie veränderte sich nur um einige Hektaren gegenüber dem Vorjahr.Die bedeutendste Flächenreduktion war im Gewächshausanbau zu verzeichnen.Es ist anzunehmen,dass im Vorjahr mit 990 ha der Flächenzenit erreicht wurde.Im Beobachtungsjahr wurden 80 ha weniger Gemüse im Gewächshaus angebaut.
Der Apfel ist mit Abstand die wichtigste Obstart.Er belegte mit 4’410 ha zwei Drittel der Baumobstfläche.Bei den Flächenentwicklungen waren die gleichen Tendenzen wie im Vorjahr zu beobachten:die Apfelfläche nahm um einige Prozent (–155 ha) ab, wobei die Sorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova um 68 ha zulegten.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 947 ha und nahm gegenüber dem Vorjahr wieder leicht zu. Steinobst und Beeren waren weiterhin im Trend.Die Flächen von Steinobst dehnten sich um 52 ha (5%) auf 1’194 ha und diejenigen der Beeren um 11 ha (2%) auf 651 ha aus.
In den letzten zehn Jahren fand eine Konzentration des Apfelanbaus statt.Weniger Produzenten kultivieren grössere Apfelanlagen.Die Anzahl Apfelproduzenten sank in diesem Zeitraum von 2’850 auf 2’400 (–16%).Betroffen von dieser Abnahme waren lediglich die kleinen Produzenten mit Apfelanlagen von weniger als 5 ha.Hingegen gibt es deutlich mehr grosse Apfelproduzenten mit Apfelanlagen von mehr als 5 ha. Nicht nur die Anzahl Grossproduzenten ist gestiegen sondern auch deren Apfelfläche pro Betrieb.Während in den Jahren 1990/93 die grössten Produzenten ein Drittel der gesamten Apfelfläche bewirtschafteten,waren es in den Jahren 2000/03 schon die Hälfte aller Apfelanlagen.Charakteristisch für diese grossen Obstbetriebe ist ausserdem der Spezialisierungsgrad.Die Apfelanlagen machten nämlich bei ihnen im Durchschnitt 45% der LN aus,bei den kleinen Produzenten hingegen lediglich 7% der LN.

Die Rebfläche betrug im Berichtsjahr 14'929 ha.Das sind 85 ha weniger als ein Jahr zuvor.Davon waren 6'717 ha (–248 ha) mit weissen und 8’212 ha (+163 ha) mit roten Trauben bestockt.Der Rückgang der mit weissen Trauben bestockten Flächen dürfte auch aufgrund der Nachfrage und der Umstellungsbeiträge in den kommenden Jahren weiter gehen.

Sämtliche mittleren Erträge bedeutender Ackerkulturen fielen gegenüber dem Vorjahr kleiner aus.Den Wintersaaten setzten Staunässe im Herbst 2002 sowie tiefe Temperaturen im Februar zu und nachfolgend führten Hitze und ausgedehnte Trockenheit zu weiteren Ertragseinbussen.Im Extremjahr 2002/03 bewiesen die Ölsaaten und Zuckerrüben insgesamt eine erstaunliche Ertragssicherheit,hingegen litten die Kartoffeln und der Weizen stark unter den Stressfaktoren.
Die geringere Körnermaisproduktion ist primär auf dessen vorzeitige Ernte zu Silagezwecken zurückzuführen,da sich dadurch Mindererträge im Futterbau teilweise kompensieren liessen.Ausserdem konnte in Trockengebieten durch die Verwendung als Maissilage dürftigen Kornerträgen aufgrund kleiner Kolben mit geringem Kornansatz vorgebeugt werden.Geringere Erntemengen von Gerste und Weizen sind primär auf geringere Erträge zurückzuführen,zumal die Gerstenfläche unverändert blieb.
Es wurden 297'000 t Gemüse (ohne Verarbeitung) und 123’000 t Tafelobst geerntet. Die Mengen waren im Vergleich zum Vorjahr bei Gemüse vor allem wegen der Trockenheit 4% und bei Obst wegen der Alternanz 8% geringer.Im Vergleich zu den vier Vorjahren waren die Gemüsemengen jedoch grösser (6%) und die Obstmengen kleiner (–5%).Unter der Trockenheit litten besonders die Blattgemüse wie Lattich,Lollo, Endivien,Eisbergsalat und Kopfsalat.
Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,betrugen 504’000 t bzw.167’000 t.Das Gemüsevolumen war 2,3% grösser, dasjenige von Obst 3,1% kleiner als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre.Der Anteil der Schweizer Gemüse am Marktvolumen war im letzten Jahrzehnt konstant bei rund 60%.Betrachtet man nur die inländische Saison,also diejenige Zeit während der das Schweizer Gemüse angeboten wird,betrug der Schweizer Anteil 80%.Auch dieser Wert unterlag in den letzten Jahren nur geringfügigen Schwankungen.Bei Obst betrug der Anteil Schweizer Obst am Marktvolumen 73%.Dieser Wert ist vergleichbar mit denjenigen der Vorjahre.
Die aufgrund der Situation des Weinmarktes im Jahre 2002 verfügten strengen Mengenbeschränkungen wurden 2003 weitergeführt.Zusammen mit der aussergewöhnlichen Trockenheit des Sommers 2003 wurden somit im Berichtsjahr nur 97 Mio. Liter Wein gekeltert.Das sind nochmals 14 Mio.Liter weniger als im unterdurchschnittlichen Vorjahr.Davon waren 48,4 Mio.Liter Weisswein und 48,6 Mio.Liter Rotwein.Die durchschnittlichen Erträge betrugen 0,7 Liter pro m2 bei den weissen und 0,6 Liter pro m2 bei den roten Gewächsen.
■ Verwertung:Topqualität bei Getreide,aber wenig Mostäpfel
Ausser auf die Erträge wirkte sich die extreme Witterung auch auf die Qualität und damit auf die Verwertungsmöglichkeiten der Ernteprodukte aus.Die Qualität des Brotweizens wurde insgesamt als gut bis sehr gut eingestuft.Hohe Gehalte an Nichtzuckerstoffen wirkten sich verlangsamend auf die Zuckerverarbeitung aus.Trotz der reduzierten Verarbeitungskapazität erreichten die Zuckerfabriken den termingerechten Kampagnenabschluss.Infolge von trockenheitsbedingtem Durchwuchs ergaben sich insbesondere bei den Fritteskartoffeln qualitätsbedingte Ausfälle.Gegenüber dem Vorjahr verdoppelte sich die der Frischverfütterung zugeführte Menge auf rund 85'000 t,währenddem die der kostenintensiveren Trocknung zu Futterzwecken zugeführte Menge um rund 25% auf 50'400 t abnahm.

Die eingebrachte und in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 76’366 t und jene der Mostbirnen 45’673 t.Gemessen an der durch den SBV im August 2003 herausgegebenen Vorernteschätzung verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Plus von 2% und bei den Mostbirnen ein solches von 37%.Aufgrund der als klein veranschlagten Ernte hat die Branchenorganisation seit 1997 zum ersten Mal auf den Einzug von Rückbehalten zur Verwertung von Übermengen verzichtet.Der Deckungsgrad gemessen an der Normalversorgung betrug bei den Mostbirnen 250%, jener der Mostäpfel 86%.Dank der Lager (Marktreserven) aus der Ernte 2002 bei den Mostäpfeln,konnte der inländische Bedarf an Apfelsaftprodukten vollumfänglich gedeckt werden.Der Ausstoss von ungegorenen Obstsaftgetränken hat gegenüber dem Vorjahr um 7% zugenommen.
■ Aussenhandel:hoher Bedarf an Körnermais und Heu
Die insgesamt deutlich geringeren Erntemengen im Acker- und Futterbau wirken sich bis zur Ernte 2004 auf den Aussenhandel aus.Im Berichtsjahr verdreifachten sich die Körnermaisimporte auf 121’802 t und die Heuimporte stiegen um 90% auf 108'757 t an.Relativ grosse Importzunahmen verzeichneten bei den Futtermitteln auch Luzernemehl und Sorghum,doch sind die Handelsmengen im Vergleich zu Getreide von untergeordneter Bedeutung.Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Kartoffelimporte um 25%.Die Zuckerimporte stiegen um 36'810 t (+18%),gleichzeitig nahmen aber auch die Exporte um 49'925 t zu.
Im Berichtsjahr wurden 206'000 t Frischgemüse und 46'500 t Frischobst in die Schweiz eingeführt.Das waren 2% weniger Gemüse und 4% weniger Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.Die Exporte waren mit 130 t Gemüse und 2’000 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren.In diesen Mengen sind die Gemüseund Obstarten enthalten,welche in der Schweiz angebaut werden.
Die Einfuhren an Trinkwein (inkl.die Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz) betrugen im Jahr 2003 total 160,7 Mio.Liter Wein.Davon waren 141,0 Mio.Liter Rotwein und 19,7 Mio.Liter Weisswein.Dazu sind noch 12,5 Mio.Liter Schaumwein, 7,7 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,4 Mio.Liter so genannte Süssweine oder Spezialitäten eingeführt worden.Gegenüber 2002 ist eine Zunahme von rund 5 Mio. Liter bei den Rotwein- als auch eine solche von rund 2 Mio.Liter bei den Weissweinimporten festzustellen.Die Schaumweinimporte blieben hingegen stabil.Die Exporte an Schweizer Flaschenweine haben gegenüber 2002 zugenommen und erreichten 0,9 Mio.Liter.
Die Verkäufe von Speisekartoffeln in Kleinpackungen betragen jährlich rund 85'000 t. War 1990 Bintje mit 41% Marktanteil noch die Hauptsorte,sank deren Anteil bis 2003 auf 22%.Begünstigt wurde diese Entwicklung der im Anbau auf Pilzkrankheiten hochanfälligen Sorte durch die vermehrte Anpreisung des Kochtyps statt des Sortennamens an der Verkaufsfront.Seit 2002 ist Charlotte Spitzenreiter und erreichte 2003 mit rund 24'000 t einen Marktanteil von 29%.Der Rückgang der Sammelrubrik Diverse veranschaulicht,dass sich der Handel auf weniger Sorten konzentriert und das Sortenspektrum entsprechend abnimmt.
Quelle: swisspatat
Der Pro-Kopf-Konsum beim frischen Gemüse betrug 68 kg,bei Tafelobst (ohne tropische Früchte) 23 kg.Gegenüber dem Vierjahresmittel 1999/2002 wurden gleich viel Gemüse und 1 kg weniger Obst gegessen.
Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug im Weinjahr 2002/03 rund 277 Mio.Liter.Der Gesamtverbrauch war somit weiterhin rückläufig (–3 Mio.Liter).Der Konsum an ausländischen Weinen hat sowohl beim Rot- als auch beim Weisswein um je 2 Mio.Liter zugenommen.Derjenige von Schweizer Wein hingegen ging um rund 5 Mio.Liter beim Weissen und um 2 Mio.Liter beim Roten zurück.Der Marktanteil von Schweizer Wein war somit ebenfalls rückläufig und betrug noch 40,2% oder 2% weniger als in der Vorjahresperiode.Der gesamte Weinkonsum, das heisst inkl.die Verarbeitungsweine betrug rund 286 Mio.Liter,wovon rund 70% auf Rotweine entfielen.
■ Produzentenpreise: Rekordumsatz bei Gemüse
Bei einem Inlandbedarf von rund 480'000 t Brotgetreide beträgt das zugehörige Zollkontingent 70'000 t.Seit der Aufhebung der Preis- und Abnahmegarantie für Brotgetreide durch den Bund per 1.Juli 2001 ist der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) bestrebt,die Anbaufläche von Brotweizen dem effektiven Bedarf anzupassen.Andauernde Niederschläge unmittelbar vor der Ernte 2002 führten zu qualitätsbedingten Deklassierungen zu Futtergetreide und trockenheitsbedingte Mindererträge reduzierten die Inlandernte 2003.Als Folge der aussergewöhnlichen Witterung entsprach die Erntemenge an backfähigem Getreide in den vergangenen beiden Jahren annähernd dem effektiven Bedarf.Der Weizenpreis blieb stabil,ohne dass der mit Produzentenbeiträgen geäufnete Marktentlastungsfonds stark beansprucht werden musste.
1990/92200120022003
Produzentenpreise 2003
Weizen Kl. I, 61.13 Fr./dt
Zuckerrüben, 11.87 Fr./dt Raps, 81.69 Fr./dt
Gerste, 45.82 Fr./dt
Kartoffeln, 36.21 Fr./dt
Quelle: Agroscope FAT Tänikon
Bei Obst und Gemüse führte das tiefe Angebot dazu,dass die Produzenten pro kg meist mehr lösten als im Vorjahr.
Der Umsatz von Gemüse war noch nie so gross.Er stieg um 5% und erreichte 770 Mio.Fr.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.59 Fr.pro kg gegenüber 2.38 Fr.pro kg im Jahr zuvor und bedeutet den absoluten Preisrekord.

Eisbergsalat: Angebot und Preise 2002 und 2003
■ Konsumentenpreise, Bruttomarge:leicht rückläufige Marge bei Gemüse
Im Berichtsjahr wurde 10'500 t Schweizer Eisbergsalat angeboten.Das sind 1'000 t oder 8% weniger als im Vorjahr.Hingegen erfuhr der Schweizer Kilopreis eine durchschnittliche Steigerung von 0.39 Fr.pro kg bzw.18% (2003 2.56 Fr.pro kg).Die Angebotsmenge und die gelösten Preise führten zu einem Erlös von rund 27 Mio.Fr. Dieser Wert ist 17% höher als im Vorjahr.Während der Schweizer Saison waren die Importmengen mit 3’360 t beinahe 1’500 t höher als im Vorjahr.Der durchschnittliche Importwert war mit 1.77 Fr.pro kg ebenfalls wesentlich höher (35%).
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewähltem Gemüse
Die ausserordentlich trockene und heisse Witterung hat einen deutlichen Preisschub im Gemüsesektor verursacht.Der Einstandspreis von sieben ausgewählten Gemüsearten (Tomaten,Blumenkohl,Karotten,Chicorée,Gurken,Zwiebeln und Kartoffeln) ist um 10 Rp.auf 1.22 Fr.pro kg (plus 9%) angestiegen und der Endverkaufspreis um 8 Rp. auf Fr.2.76 Fr.pro kg (plus 3%).Erstmals seit 1997 war bei der Bruttomarge,die nun 1.54 Fr.beträgt,ein leichter Rückgang zu beobachten (–2 Rp.oder minus 1%).
Entwicklung der Preise und der Bruttomargen von ausgewählten Früchten
Auch bei den Früchten sind die Preise deutlich gestiegen.Der durchschnittliche Einstandspreis der sieben Früchte (Äpfel,Birnen,Aprikosen,Kirschen,Nektarinen,Erdbeeren und Orangen) erhöhte sich um 9 Rp.oder 5% auf 1.84 Fr.pro kg,während der Endverkaufspreis mit 4.22 Fr.pro kg um 15 Rp.oder 4% anzog.Die Bruttomarge stieg um 6 Rp.oder 3% auf 2.39 Fr.pro kg.
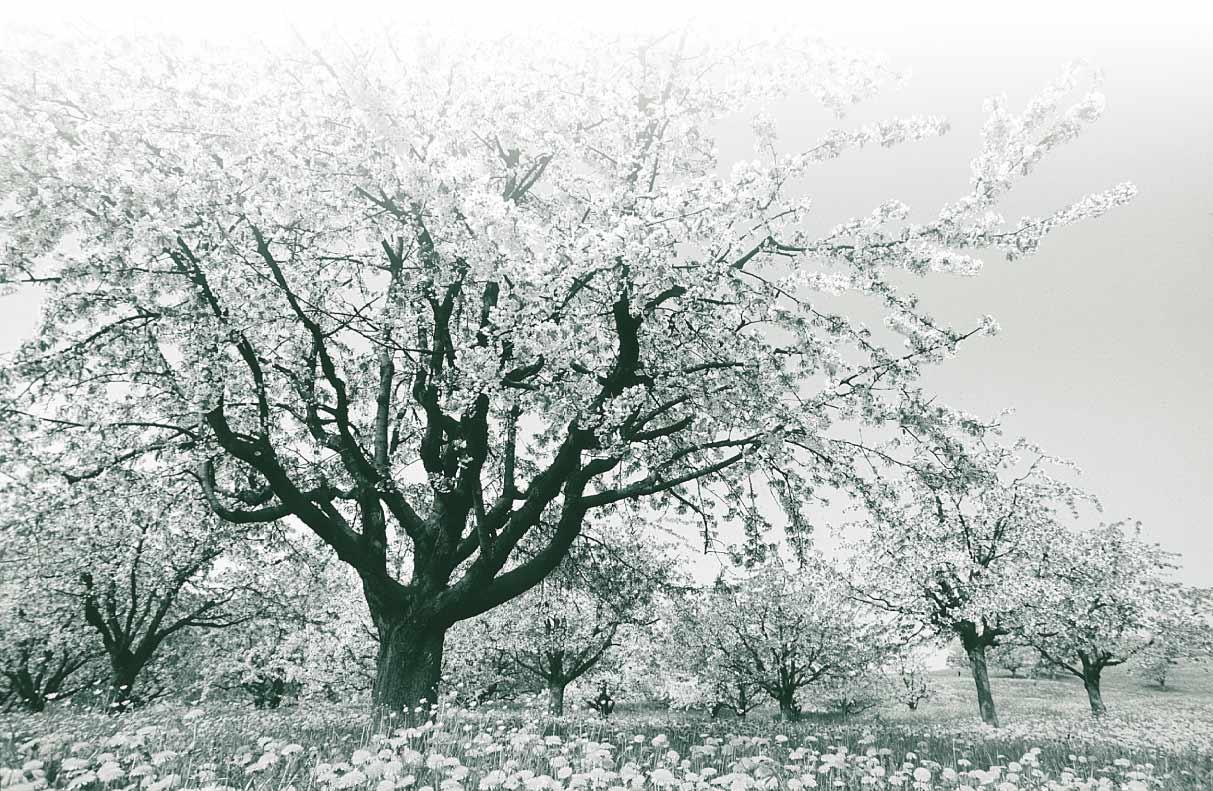
■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon (vgl.Abschnitt 1.1.4).
■ Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: Revidierte Methodik
Zum zweiten Mal werden die Ergebnisse der LGR gemäss revidierter Methodik publiziert.Die Anpassungen hatten zum Zweck,die Resultate wieder direkt mit jenen der EU vergleichbar zu machen.Die Ergebnisse der LGR nach revidierter Methodik liegen für alle Jahre ab 1990 vor.
Es können zwei Arten von Anpassungen unterschieden werden.Erstens wurden methodische Änderungen im klassischen Sinn vorgenommen.Dazu gehören die Neudefinition der Preise,mit deren Hilfe die Produktionsleistungen der Landwirtschaft bewertet werden sowie die Abkehr vom Bundeshofkonzept.Das bedeutet,dass in der neuen LGR nicht mehr nur der Austausch zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft erfasst wird.Neu werden auch inner- und zwischenbetriebliche Waren- und Dienstleistungsflüsse bewertet.Die zweite Gruppe von Änderungen bezieht sich auf Anpassungen bezüglich der erfassten Grundgesamtheit und die berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen.Zu den wichtigsten gehört,dass neu auch der Gartenbau,landwirtschaftliche Dienstleistungen und direkt mit der Landwirtschaft verbundene nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten erfasst werden.
■ Sektor-Einkommen 2003
Im Jahr 2003 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 2,790 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 2000/02 war es rund 13% tiefer. Hauptverantwortlich dafür war die um 452 Mio.Fr.gesunkene Erzeugung (–4%) und der gleichzeitige Anstieg der Vorleistungen um 122 Mio.Fr.(+2%).Die Zunahme bei den sonstigen Subventionen (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen) um 139 Mio.Fr.(+5%) konnte die Einbussen bei der Erzeugung und die Kostensteigerung nicht wettmachen.
Gegenüber dem Jahr 2002 sank das Nettounternehmenseinkommen um 316 Mio.Fr. (–10%).Das tiefere Einkommen des Sektors im Jahr 2003 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Abnahme bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichsum 328 Mio.Fr.(–3%) zurückzuführen.Diese Verschlechterung konnte weder auf der Kostenseite noch bei den sonstigen Subventionen kompensiert werden.Die Vorleistungen blieben praktisch stabil.Die einzige nennenswerte Kostenreduktion konnte bei den gezahlten Zinsen (–51 Mio.Fr.resp. –13%) erzielt werden.Hauptgrund für das tiefere Nettounternehmenseinkommen im Jahr 2003 gegenüber dem Dreijahresmittel ist die lange Trockenperiode im Berichtsjahr.
Die einzelbetrieblichen Einkommen sind 2003 gegenüber den Jahren 2000/02 nur um 2% tiefer (vgl.Abschnitt 1.1.4).Zwei Faktoren sind für die unterschiedlichen Entwicklungen von Gesamtrechnung und Buchhaltungsergebnissen hauptsächlich verantwortlich.Zum einen sind die Effekte der Trockenheit in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung voll im Kalenderjahr wirksam.Bei den einzelbetrieblichen Einkommen dürfte sich ein Teil der Auswirkungen hingegen erst im Jahr 2004 in den Ergebnissen niederschlagen.Zum andern hat bei den einzelbetrieblichen Einkommen die Erhöhung der Inventarwerte für das Rindvieh die Resultate positiv beeinflusst.
Dividiert man das Nettounternehmenseinkommen durch die Anzahl der in der Landwirtschaft eingesetzten nicht entlohnten Jahresarbeitseinheiten,so ergibt sich das Einkommen pro eingesetzte Einheit.2003 lag der entsprechende Wert mit 41’284 Fr. um 9% unter dem Mittel der drei vorangegangenen Jahre.
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr.

Die Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes 2004 liegt mit 10,678 Mrd.Fr.um 4% höher als das Dreijahresmittel 2001/03.Die guten Erträge im Pflanzenbau und die ausgeglichene Marktlage im Schlachtviehsektor tragen hauptsächlich zu diesem Ergebnis bei.

Die pflanzliche Produktion (inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 9% höher geschätzt (4,743 Mrd.Fr.).Nach dem trockenen Sommer 2003 lassen die diesjährigen Witterungsverhältnisse gute bis sehr gute Erträge erwarten.
Die Getreideernte fiel qualitativ und vor allem mengenmässig wesentlich besser aus als die letztjährige kleine Ernte.Der Weizen zeichnete sich durch besonders hohe Hektolitergewichte und dem fast vollständigen Ausbleiben von Auswuchs aus.Die Brotgetreideernte überstieg den Bedarf,so dass bereits Posten deklassiert wurden.Da beim Futtergetreide die Erträge ebenfalls gut waren,könnten die Preise unter Druck geraten. Der Wert der Getreideernte 2004 wird deshalb 1% unter dem Dreijahresmittel veranschlagt.
Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine mengenmässig sehr gute Ernte erwarten. Der Zuckergehalt dürfte jedoch unter dem langjährigen Durchschnitt zu liegen kommen. Die Garantiemenge der Inlandzuckerproduktion wurde auf 200’000 t erhöht,was zu einer Ausdehnung der Zuckerrübenfläche führte.Die Fläche für die Ölsaatenproduktion wurde auch dieses Jahr erweitert.Erstmals wurde in der Schweiz Öllein angepflanzt. Bei Soja und Sonnenblumen werden ähnliche Produktionswerte wie im Vorjahr erwartet.Der gute Rapsertrag und die Ausdehnung der Fläche lassen auf einen deutlich höheren Produktionswert schliessen.Für die Handelsgewächse insgesamt wird er für das Jahr 2004 um 12% höher eingeschätzt als für die Jahre 2001/03.
Bei den Futterpflanzen ist das Ergebnis dieses Jahr sowohl qualitativ als auch quantitativ gut bis sehr gut.Nur die Bündner Südtäler,das Tessin und die Regionen am Jurafuss litten unter Futtermangel.Die hohen Raufutter- und Graspreise des ersten Semesters 2004 als Folge der letztjährigen Trockenheit trieben den Wert dieser Position zusätzlich in die Höhe.Der Produktionswert der Futterpflanzen wird dieses Jahr 28% über dem Dreijahresmittel geschätzt.
Im ersten Halbjahr blieben die Gemüsepreise aufgrund der letztjährigen Trockenheit auf hohem Niveau.Allerdings ist das zweite Halbjahr für die Gemüseproduktion viel entscheidender.Die Preise dürften sich aufgrund der erwarteten guten Mengen beim Lagergemüse kaum halten.Insgesamt wird aber mit einem guten Gemüsejahr gerechnet,das vergleichbar mit dem Jahr 2003 ist.
Für den produzierenden Gartenbau wird im Jahr 2004 eine leichte Abnahme des Produktionswertes um 1% gegenüber dem Dreijahresmittel erwartet.Damit setzt sich die in den neunziger Jahren beobachtete Entwicklung fort.
Bei einer leicht kleineren Fläche als 2003 wird für die Kartoffeln sowohl von einer vergleichbaren Erntemenge als auch von vergleichbaren Preisen wie 2003 ausgegangen.Die gute Ernte lässt ein Überangebot an Speiseware erwarten,so dass ein Teil als Futter verwertet werden muss.Da die finanziellen Mittel des Verwertungsfonds
bereits 2003 aufgebraucht wurden,dürften Beiträge für die Überschussverwertung (im Produktionswert inbegriffen) tiefer als in den Vorjahren ausfallen.Darum wird der Erntewert 5% unter dem Dreijahresmittel geschätzt.
Beim Obst kann dieses Jahr von einer mittleren Ernte ausgegangen werden,die vergleichbar mit 1999 ist,aber 7% über dem Dreijahresmittel liegen dürfte.In dieser Position sind neben dem Frischobst (Birnen, Äpfel,Steinobst und Beeren) teilweise auch die Weintrauben (Frischkonsum und Verwertung ausserhalb des Bereiches Landwirtschaft) enthalten.
Der Produktionswert des Weinbaus (Wein und Weintrauben) wird für 2004 um 1% höher als der Dreijahresdurchschnitt geschätzt.2004 dürfte die Weintraubenernte grösser ausfallen als 2003,die Preise für die Trauben hingegen tiefer.Besser als im Dreijahresdurchschnitt werden die Weinpreise sein,da der qualitativ hochstehende Jahrgang 2003 teilweise im Jahr 2004 auf den Markt kommt.
Die tierische Produktion weist im Mehrjahresvergleich eine leichte Zunahme von 1% aus.Während die Nutz- und Schlachtviehproduktion um 7% ansteigen dürfte,wird der Wert bei der Milch und bei den Eiern um 5% tiefer eingeschätzt.Der Schlachtviehmarkt wird insgesamt dank einem knappen Angebot von guten Preisen profitieren. Nur die Preise für Schlachtlämmer und -fohlen stehen unter Druck.Beim Geflügel ist der höhere Produktionswert auf eine Ausdehnung der Produktion zurückzuführen.Die leicht höhere Milchproduktion vermag die tieferen Preise nicht auszugleichen.Bei den Eiern wird mit stabilen Preisen aber mit einer tieferen Produktion als im Vorjahr gerechnet.Die Honigernte wird höher als im Vorjahr geschätzt.
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen dürfte im Mehrjahresvergleich um 4% steigen und 589 Mio.Fr.betragen.Während die Verpachtung von Milchkontingenten eher stagniert,nehmen insbesondere die Einnahmen aus Arbeiten für Dritte kontinuierlich zu.
Der Wert der nicht trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten wird auf 274 Mio.Fr.geschätzt.Gegenüber den Vorjahren ist dies 3% weniger.Diese Position wird massgeblich von der Verarbeitungsmenge von Mostobst und den Dienstleistungen ausserhalb der landwirtschaftlichen Branche wie Strassenrand- und Landschaftspflege,der Haltung von Pensionstieren und vom Schlafen im Stroh beeinflusst.
Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2004 auf 6,314 Mrd.Fr.veranschlagt, was 6% höher ist als der Dreijahresdurchschnitt.Die Kosten für Futtermittel werden insgesamt höher sein als in den Vorjahren.Dies ist fast ausschliesslich auf die innerbetrieblich erzeugten und verbrauchten Futtermittel zurückzuführen.Trotz einer Abnahme der Mischfutterpreise werden die Ausgaben für die aus der Futtermittelindustrie zugekauften Futtermittel als konstant geschätzt.Auch bei vielen anderen Vorleistungsposten wird ein Anstieg der Ausgaben erwartet.Dies gilt insbesondere für die Instandhaltung der baulichen Anlagen.Die um 2% höheren Energiekosten gehen auf das Konto der steigenden Preise auf dem Erdölmarkt.Zudem bewirken leicht steigende Lohnkosten in der übrigen Wirtschaft eine Verteuerung der zugekauften Dienstleistungen wie der Tierarztkosten.
Bei der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen wird mit einer Zunahme von 2% gegenüber dem Dreijahresmittel gerechnet.Die im Mehrjahresvergleich höheren Ausgaben für Vorleistungen dürften durch den um 4% gestiegenen Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches kompensiert werden können.
Die Abschreibungen werden auf 1,944 Mrd.Fr.oder um 1% höher als das Dreijahresmittel geschätzt.Im Vergleich zu 2003 dürften die Bruttoanlageinvestitionen 2004 steigen.Einerseits wird vorausgesagt,dass die diesjährigen Neuinvestitionen für Ausrüstungen (Fahrzeuge und Maschinen) um 3% zunehmen werden,anderseits werden die Neuinvestitionen in Gebäude um 5% tiefer als das Dreijahresmittel eingestuft.Die Abschreibungen werden jedoch stark von den in den Vorjahren getätigten Investitionen beeinflusst.
Die Zunahme der sonstigen Produktionsabgaben um 2% ist gleichmässig auf die Unterkompensation der Mehrwertsteuer (abhängig von Vorleistungs- und Investitionsausgaben) und die übrigen Produktionsabgaben (insbesondere Stempelgebühren) zurückzuführen.
Die sonstigen Subventionen beinhalten alle Direktzahlungen,den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite,Betriebshilfe) und die übrigen kantonalen und von Gemeinden erbrachten Beiträge sowie die Überkompensation der Mehrwertsteuer,welche für 2004 auf 169 Mio.Fr.geschätzt wird.Nicht dabei sind die Gütersubventionen,welche bereits im Produktionswert berücksichtigt wurden (z.B.Anbauprämien).Mit voraussichtlich 2,741 Mrd.Fr.(2,573 Mrd.Fr.ohne die Überkompensation der Mehrwertsteuer,Kreditsperre von 3% einberechnet) dürften die sonstigenSubventionen gegenüber dem Dreijahresdurchschnitt um 3% zunehmen. Die Differenz zwischen Über- und Unterkompensation der Mehrwertsteuer wird 2004 bei 112 Mio.Fr.(Anstieg von 7% gegenüber Dreijahresmittel) zu liegen kommen.Die negative Differenz geht zu Lasten der Landwirtschaft.
Für 2004 wird das Arbeitnehmerentgelt schätzungsweise 1,138 Mrd.Fr.betragen. Das wären 1% mehr als das Dreijahresmittel.Der Rückgang von Angestellten in der Landwirtschaft dürfte kompensiert werden durch den Anstieg der Lohnkosten.
Bei den gezahlten Pachten wird eine Abnahme um 0,3% gegenüber dem Dreijahresmittel erwartet.Die gezahlten Schuldzinsen sollen gegenüber dem Dreijahresmittel um 12% sinken.Dies als Folge der tieferen Hypothekarzinsen.Dazu erwartet man einen Rückgang bei den teuren kurzfristigen Krediten.
Als Nettounternehmenseinkommen würden 3,153 Mrd.Fr verbleiben.Dies würde eine Zuname um 6% gegenüber den vorangegangenen drei Jahren bedeuten.Das Dreijahresmittel wurde durch das tiefe Ergebnis im Trockenheitsjahr 2003 geprägt.
Das Nettounternehmenseinkommen pro nicht entlohnte Jahresarbeitseinheit wird mit 47’364 Fr.um 10% höher als der entsprechende Wert für die Jahre 2001/03 geschätzt.
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon.Deren methodische Grundlagen wurden 1999 vollständig überarbeitet.Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren wie z.B.zur finanziellen Stabilität oder zur Rentabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe.Im Anhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt.Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen.

■
Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel aller Regionen 1990/922000200120022003
Im Jahr 2003 waren die wirtschaftlichen Ergebnisse leicht besser als im Jahr 2002.Im Vergleich zu 2000/02 ist das landwirtschaftliche Einkommen hingegen um 2% gesunken.Der Rohertrag aus landwirtschaftlicher Produktion nahm gegenüber 2000/02 um 4% ab.Beim Pflanzenbau waren die Erlöse massiv tiefer (–20%),was vor allem auf die lange Trockenheit und tiefere Getreidepreise zurückzuführen ist.Der Rohertrag aus der Tierhaltung nahm hingegen leicht zu (+2%).Während bei der Milch preisbedingte Einbussen zu verzeichnen waren (–5%),war die Entwicklung beim Schlachtvieh positiv (+15%).Aufgrund der Marktentwicklung wurde die Bilanzbewertung der Tiere angepasst,was das Ergebnis in der Rindviehhaltung zusätzlich günstig beeinflusste.Auch die Geflügelhaltung konnte ihr Ergebnis wesentlich verbessern (+19%).Die Direktzahlungen nahmen gegenüber den drei Vorjahren im Durchschnitt der Betriebe zu (+10%).Etwas überdurchschnittlich ist der Anstieg in der Hügel- und Bergregion.Dies liegt an den Anpassungen bei den Beiträgen für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen und den Beiträgen für die Haltung von raufutterverzehrenden Tieren,die im Jahre 2002 in Kraft traten.Die höheren Direktzahlungen pro Betrieb sind auch eine Folge der steigenden Beteiligung bei den Öko- und Ethoprogrammen wie BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung), RAUS (Regelmässiger Auslauf im Freien),Biolandbau oder regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen.Die Fremdkosten lagen im Jahr 2003 um rund 6% über dem Dreijahreswert 2000/02.Dazu beigetragen haben insbesondere höhere Aufwendungen für die Gebäude,die Miete und Abschreibung von Milchkontingenten sowie die Paralandwirtschaft.Letztere Mehrausgaben stehen in direktem Zusammenhang mit den höheren Erträgen in diesem Bereich.Abgenommen haben vor allem die Schuldzinsen aufgrund des Rückgangs des Zinsniveaus.
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten.Im Jahr 2003 lag es höher als 2002 (+7%),aber leicht tiefer als 2000/02 (–2%).Das landwirtschaftliche Einkommen entschädigt einerseits die Arbeit der durchschnittlich 1,24 Familienarbeitskräfte und andererseits das im Betrieb durchschnittlich investierte Eigenkapital von rund 400'000 Fr.
Das landwirtschaftliche Einkommen war 2003 gegenüber 2000/02 in der Talregion um 6% tiefer,in der Hügelregion jedoch um 1% und in der Bergregion um 5% höher.Das Nebeneinkommen hat überall zugenommen,in der Talregion um 20%,in der Hügelregion um 5% und in der Bergregion um 10%.Das Gesamteinkommen war damit 2003 in der Talregion praktisch unverändert,während es in der Hügelregion und in der Bergregion zunahm (um 2% respektive 7%).
Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2003 16% in der Talregion,25% in der Hügelregion und 39% in der Bergregion.Damit blieb der Anteil in der Tal- und Bergregion gegenüber 2000/02 stabil,während er in der Hügelregion etwas gestiegen ist.
Die Einkommenssituation in den 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) zeigt erhebliche Differenzen auf.
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2001/03
Landw.Neben-GesamtNutzflächearbeits-Einkommeneinkommeneinkommen kräfte
Im Durchschnitt der Jahre 2001/03 erzielten die Veredlungs-,Ackerbau- und bestimmte kombinierte Betriebe (Kombiniert Veredlung,Verkehrsmilch/Ackerbau) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen.Diese (mit Ausnahme der kombinierten Verkehrsmilch/Ackerbau-Betriebe) erwirtschafteten auch die höchsten Gesamteinkommen.Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen «Pferde,Schafe,Ziegen» sowie «anderes Rindvieh»
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte.Gegenüber dem Dreijahresmittel 2000/02 hat sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) im Jahr 2003 um 12% verbessert.Im Vergleich zum Jahr 2002 stieg er gar um 22% an.Der Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen,dass das Zinsniveau gesunken ist und damit der kalkulatorische Zinsanspruch für das Eigenkapital stark zurückgegangen ist.
Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich.Im Durchschnitt liegt er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion.Auch die Quartile liegen weit auseinander.So erreichte 2001/03 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 20% und derjenige im vierten Quartil 200% des Mittelwertes aller Betriebe der Region.In der Hügelregion war die Streuungsbandbreite ähnlich und im Berggebiet noch extremer.
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 2001/03: nach Regionen und Quartilen

1 in Fr.pro FJAE 2
1Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen:2001:3,36%;2002:3,22%;2003:2.63%
280 Arbeitstage
FAT Tänikon
In der Talregion übertraf 2001/03 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung deutlich.In der Hügelregion erreichte das vierte Quartil den Vergleichslohn hingegen nur knapp,während in der Bergregion der Wert rund 8'000 Fr.unter dem Vergleichswert lag.Im Vergleich zur Periode 2000/02 hat die Bergregion ihre relative Situation etwas verbessert,während sie sich in der Tal- und Hügelregion verschlechtert hat.
Vergleichslohn 2001/03,nach Regionen
RegionVergleichslohn 1
Fr.pro Jahr
Talregion66 832
Hügelregion61 758
Bergregion56 053
Quellen:BFS,Agroscope FAT Tänikon
Zu berücksichtigen gilt,dass die landwirtschaftlichen Haushalte ihren Lebensunterhalt nicht nur aus dem Arbeitsverdienst bestreiten.Ihr Gesamteinkommen,einschliesslich der Nebeneinkommen,liegt wesentlich höher als der Arbeitsverdienst.
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens.Kombiniert man diese Kennzahl mit der Grösse der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen.Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält – finanziell nicht existenzfähig.
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt.
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit
Fremdkapitalquote
Tief (<50%)Hoch (>50%)
EigenkapitalbildungPositiv...guter...beschränkter finanfinanzieller Situationzieller Selbständigkeit
Negativ...ungenügendem ...bedenklicher
Einkommenfinanzieller Situation
Quelle:De Rosa
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild.42% der Betriebe befinden sich in einer finanziell guten Situation und 38% sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung).Das Dreijahresmittel 2001/03 präsentiert sich in allen Regionen etwas schlechter als 2000/02.
Beurteilung der finanziellen Stabilität 2001/03 nach Regionen
Die Investitionen der FAT-Referenzbetriebe haben im Jahr 2003 im Vergleich zu 2000/02 zugenommen (+5%).Gleichzeitig stieg auch der Cashflow (+7%).Entsprechend hat sich das Cashflow-Investitionsverhältnis nur wenig verändert (+2%). Die Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen minus Privatverbrauch) ist besser als in der Referenzperiode (+13%),während sich die Fremdkapitalquote etwas verschlechtert hat (+5%).Der Grund für diese Zunahme liegt darin,dass sowohl die Investitionsals auch die Hypothekarkredite zugenommen haben,während die Eigenkapitalausstattung leicht gesunken ist.
Entwicklung von Eigenkapitalbildung,Investitionen und Fremdkapitalquote
1 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2 Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Nachfolgend werden Auswertungen präsentiert,welche einen tieferen Einblick in die Ergebnisse der Voll-,Zu- und Nebenerwerbsbetriebe erlauben.Grundlage für die Analyse sind die Buchhaltungsdaten 2000/02 der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon.Die Gliederung nach der Erwerbsform basiert auf dem Anteil des landwirtschaftlichen Einkommens am Gesamteinkommen.Bei Vollerwerbsbetrieben liegt dieser Anteil bei über 90%,bei Zuerwerbsbetrieben zwischen 50 und 90% und bei Nebenerwerbsbetrieben bei unter 50%.
Quelle:Agroscope FAT Tänikon

Insgesamt sind ein Drittel (17'357) der Betriebe gemäss der eingangs aufgeführten Definition Vollerwerbsbetriebe,48% (25'246) zählen zu den Zu- und 19% (9'993) zu den Nebenerwerbsbetrieben.In der Talregion ist der Vollerwerb übervertreten,in der Bergregion ist er untervertreten.Die Nebenerwerbsbetriebe verteilen sich ziemlich gleichmässig auf die drei Regionen.
Strukturen
MerkmalEinheitVoll-Zu-Neben-Total erwerberwerberwerb
2000/02
Arbeitskräfte BetriebJAE1,861,671,351,68
FamilienarbeitskräfteFJAE1,371,321,041,29
AngestellteAJAE0,490,350,310,39
Landwirtschaftliche Nutzflächeha22,8218,6413,6719,09
davon:Offene Ackerflächeha7,914,213,015,20
Fläche je Arbeitskraftha LN/JAE12,2611,1710,1011,40
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Vollerwerbsbetriebe sind erwartungsgemäss grösser als Zu- und Nebenerwerbsbetriebe.Vollerwerbsbetriebe bewirtschaften je Arbeitskraft rund 21% mehr Fläche als Nebenerwerbsbetriebe resp.10% mehr als Zuerwerbsbetriebe.Mit einem Anteil von 35% an der LN ist die offene Ackerfläche bei den Vollerwerbsbetrieben bedeutend grösser als bei den Zu- und Nebenerwerbsbetrieben mit je rund 22%.Dies hängt mit der Verteilung der Betriebe in den Regionen zusammen.
Betriebstyp
MerkmalEinheitVoll-Zu-Neben-Total erwerberwerberwerb
2000/02
Ackerbau% 9486
Verkehrsmilch%29413536
Anderes Rindvieh%38127
Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau%159510
Kombiniert Veredelung%1412611
Kombiniert Andere%14141314
Übrige%16122116
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Es überrascht,wie hoch der Anteil der spezialisierten Verkehrsmilchbetriebe bei den Nebenerwerbsbetrieben ist (35%).Von den insgesamt rund 19'000 Betrieben mit dieser Ausrichtung werden 3'500 im Nebenerwerb bewirtschaftet.
Quartile (nach Arbeitsverdienst)
Ein Kennzeichen gemäss Definition der Nebenerwerbsbetriebe ist ihr tiefes Einkommen aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit.Es ist deshalb nicht erstaunlich,dass sich 70% der Nebenerwerbsbetriebe im ersten Quartil befinden.Auf der anderen Seite sind 43% der Vollerwerbsbetriebe im vierten Quartil anzutreffen. Rohertrag,Kosten
Zwischen den Voll- und Nebenerwerbsbetrieben bestehen sowohl beim Rohertrag Landwirtschaft als auch bei den Fremdkosten grosse Unterschiede.Bei den Nebenerwerbsbetrieben ist je ha LN der Rohertrag Landwirtschaft geringer und die Fremdkosten sind höher,dabei fallen vor allem die Strukturkosten je ha ins Gewicht.Mit ein Grund dafür dürfte sein,dass bei den Nebenerwerbsbetrieben die vom Wohnhaus ausgehenden Strukturkosten sich auf weniger ha als bei den Voll- und Zuerwerbsbetrieben verteilen.Die Nebenerwerbsbetriebe erhalten je ha mehr Direktzahlungen als die Vollerwerbsbetriebe,absolut betrachtet jedoch nicht.Die Differenz je ha LN machen die allgemeinen Direktzahlungen aus.Dies lässt sich damit erklären,dass sich zwei Drittel der Nebenerwerbsbetriebe in der Hügel- und Bergregion befinden.
Haushalt
MerkmalEinheitVoll-Zu-Neben-Total erwerberwerberwerb
2000/02
Alter der BetriebsleitendenJahre46464646 Kinder unter 16 JahrenAnzahl0,91,51,21,2 Verbrauchereinheiten (VE)Anzahl3,13,73,63,5
Quelle:Agroscope FAT Tänikon

Das Alter der Betriebsleitenden liegt – ungeachtet der Erwerbsform – im Durchschnitt bei 46 Jahren.Zu- und Nebenerwerbsbetriebe haben tendenziell mehr Kinder unter 16 Jahren und grössere Haushalte als Vollerwerbsbetriebe.
Interessanterweise ist der Unterschied beim durchschnittlichen Gesamteinkommen zwischen Voll- und Nebenerwerbsbetrieben relativ gering (80'000 Fr.resp.67'000 Fr.). Der Privatverbrauch der Familie ist bei allen Erwerbsformen praktisch gleich hoch (rund 63'000 Fr.),wobei Nebenerwerbsbetriebe weniger Ausgaben für Steuern und AHV haben.
Voll-,Zu- und Nebenerwerbsbetriebe haben per Definition eine unterschiedliche Struktur der Einnahmen.Das landwirtschaftliche Einkommen der Nebenerwerbsbetriebe ist bedeutend tiefer.Folgende Faktoren sind dafür im wesentlichen verantwortlich:Bei den Nebenerwerbsbetrieben ist der Rohertrag je ha aus der Landwirtschaft am tiefsten,zum andern sind die Fremdkosten je ha am höchsten.Diese Differenzen je ha werden in absoluten Zahlen verstärkt,da die Nebenerwerbsbetriebe die geringste LN ausweisen.Die Direktzahlungen je ha sind zwar bei ihnen etwas höher,sie vermögen die Unterschiede bezüglich Einkommen gegenüber den anderen Erwerbsformen aber nur geringfügig zu verkleinern.Aus den Daten ist ersichtlich,dass die allgemeinen Direktzahlungen der Grund für die höheren Direktzahlungen je ha bei den Nebenerwerbsbetrieben sind.Dies hängt mit dem Umstand zusammen,dass zwei Drittel der Nebenerwerbsbetriebe in der Hügel- und Bergregion liegen.Die Analyse liefert keine Hinweise,dass es sich bei den Nebenerwerbsbetrieben vor allem um Betriebe handelt, welche Direktzahlungen maximieren.
Interessant ist,dass die Gesamteinkommen der drei Erwerbsformen nicht so weit auseinander liegen wie es die Unterschiede beim landwirtschaftlichen Einkommen vermuten liessen.Die Vollerwerbsbetriebe erwirtschaften mit 80'000 Fr.die höchsten Gesamteinkommen,die Zuerwerbsbetriebe folgen mit gut 74'000 Fr.,die Nebenerwerbsbetriebe schliesslich mit 67'000 Fr.Die Vollerwerbsbetriebe weisen also im Durchschnitt gute wirtschaftliche Ergebnisse aus.Voll auf die Landwirtschaft zu setzen, lohnt sich nach wie vor.Den Nebenerwerbsbetrieben gelingt es mit der ausserlandwirtschaftlichen Tätigkeit,das grosse Defizit beim landwirtschaftlichen Einkommen zu einem beträchtlichen Teil wettzumachen.Nebenerwerbsbetriebe können trotz durchschnittlich tieferem Gesamteinkommen ökonomisch stabile Einheiten sein.So ist der Privatverbrauch ungeachtet der Erwerbsform im Durchschnitt praktisch gleich hoch. Die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sind bei allen Betriebsformen im Mittel gleich alt.Auch dies ist ein Hinweis,dass alle Erwerbsformen ihre Attraktivität haben.
Das Soziale ist eine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit.In der Berichterstattung über die agrarpolitischen Auswirkungen nehmen die sozialen Aspekte daher einen eigenen Platz ein.Die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft – der Abschnitt Soziales – gliedert sich in die folgenden drei Teile:Einkommen und Verbrauch,periodische Bestandesaufnahme bei fünf zentralen sozialen Themen sowie Fallstudien zu sozialen Themen.
Im Folgenden werden im Abschnitt Soziales die Einkommen und der Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der Agroscope FAT,ferner eine Auswertung der Einkommens- und Verbrauchserhebung sowie eine Zusammenstellung zum Thema kantonale Beratungsangebote für Bauernfamilien in Schwierigkeiten dargestellt.

■ Gesamteinkommen und Privatverbrauch
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Bauernfamilien sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen.Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe.Bei der sozialen Dimension steht die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte im Vordergrund.Daher wird das Nebeneinkommen der Haushalte ebenfalls mit in die Analyse einbezogen.Neben dem Gesamteinkommen wird auch die Entwicklung des Privatverbrauchs verfolgt.
Das Gesamteinkommen,das sich aus dem landwirtschaftlichen Einkommen und dem Nebeneinkommen zusammensetzt,lag im Durchschnitt der Jahre 2001/03 je nach Region zwischen rund 61’100 und knapp 81’500 Fr.pro Betrieb:Die Betriebe der Bergregion erreichten etwa 75% des Gesamteinkommens der Betriebe der Talregion. Mit Nebeneinkommen von 18’100 bis 20’600 Fr.hatten die Betriebe eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle:Diese machte bei den Betrieben der Talregion 22% des Gesamteinkommens aus,bei jenen der Hügelregion 30% und bei denjenigen der Bergregion 34%.Die Betriebe der Bergregion wiesen mit 20’600 Fr.auch absolut die höchsten Nebeneinkommen aus.
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Betrieb 2001/03
Quelle: Zentrale
Agroscope
Der Privatverbrauch macht in allen Regionen durchwegs rund 87% des Gesamteinkommens aus und liegt jeweils über der Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens.Er ist entsprechend der Höhe des Gesamteinkommens bei den Betrieben der Talregion absolut am höchsten und bei den Betrieben der Bergregion am tiefsten.
Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Betrieb lag 2003 mit rund 76’200 Fr. über jenem aus dem Durchschnitt der Jahre 2000/02 mit 75’000 Fr.Der Privatverbrauch pro Betrieb hat hingegen im Jahr 2003 im Vergleich zu 2000/02 um etwa 330 Fr.abgenommen und lag bei 62’900 Fr.
nach Quartil 1 2001/03
1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.QuartilAlle Betriebe
Gesamteinkommen
pro VE 2 (Fr.)13 44416 95321 55930 73620 661
Privatverbrauch
pro VE (Fr.)15 58316 15018 60821 90518 054
1 Quartile nach Arbeitsverdienst je Familien-Jahresarbeitseinheit
2 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr Quelle:Zentrale Auswertung,Agroscope FAT Tänikon

Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte 2001/03 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken.Sie mussten einen Teil ihrer eigentlich für Ersatz- und Neuinvestitionen bzw.für ihre Altersvorsorge erforderlichen Mittel für den Privatverbrauch einsetzen.Die Eigenkapitalbildung ist bei diesen Betrieben negativ.Bei den Betrieben in den übrigen Quartilen war der Privatverbrauch geringer als das Gesamteinkommen.Die Betriebe des ersten Quartils erreichten 44% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Betrieben des vierten Quartils.
Der Privatverbrauch pro Verbrauchereinheit macht im ersten Quartil rund 116% des Gesamteinkommens aus,bei Betrieben des vierten Quartils 71%.Beim Privatverbrauch ist die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer als beim Gesamteinkommen.Er lag bei den Betrieben des ersten Quartils bei 71% des Verbrauchs der Betriebe des vierten Quartils.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit war 2003 nur im dritten Quartil leicht tiefer im Vergleich zu den drei Vorjahren 2000/02,in den übrigen drei Quartilen lag es etwas höher.Beim Privatverbrauch fällt auf,dass dieser im Jahr 2003 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2000/02 bloss im vierten Quartil leicht zugenommen hat.
■ Schweizerische Einkommens- und Verbrauchserhebung als Grundlage
Im Rahmen der zentralen sozialen Themenbereiche,von welchen alle fünf Jahre eine Bestandesaufnahme gemacht wird,werden in diesem Bericht die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE) 2002 des Bundesamtes für Statistik (BFS) präsentiert.Dabei werden die Resultate der Landwirtschaft im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung aus ländlichen Gemeinden dargestellt.
Das BFS hat 1990 sowie 1998 zwei grosse EVE durchgeführt.Seit 2000 erhebt das BFS die Daten für die EVE im jährlichen Rhythmus.Die EVE ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Einnahmen der privaten Haushalte und analysiert den Konsum in Abhängigkeit verschiedener sozialer und demografischer Merkmale.Im Jahre 2002 wurden – verteilt auf 12 monatliche Stichproben – insgesamt 3’726 zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählte Haushalte dazu befragt.
Die monatlichen Erhebungen erfolgen in drei Etappen:
Im Rahmen eines Rekrutierungsinterviews werden allgemeine Informationen erhoben.
– Während einem Monat führt dann jeder Haushalt ein Tagebuch,ein Haushaltsbuch sowie einzelne Haushaltsmitglieder gegebenenfalls ein persönliches Tagebuch,um die Ausgaben und Einnahmen schriftlich festzuhalten.
– Beim Schlussinterview werden zusätzliche Fragen gestellt zu Organisation des Haushalts,Wohnung,Umgebung usw.
Grundgesamtheit ist die ständig innerhalb der schweizerischen Grenzen wohnhafte Bevölkerung.Für die Erfassung der Haushaltscharakteristika weist man in jedem befragten Haushalt jener Person,welche am meisten zum Haushaltseinkommen beiträgt, die Rolle der Referenzperson zu.
Im Rahmen der EVE 2002,den aktuellsten vorliegenden Daten,wurden 56 bäuerliche Haushalte in ländlichen Gemeinden befragt,das heisst die Referenzperson war ein Landwirt oder eine Landwirtin.Um eine Vergleichbarkeit dieser Haushalte mit den übrigen nicht landwirtschaftlichen Haushalten zu gewährleisten,wurden analog der Haushaltsgrössenverteilung bei den bäuerlichen Haushalten (das heisst Anteil der 1- und 2-Personen-Haushalte,der 3- und 4-Personen-Haushalte sowie der 5- und mehr Personen-Haushalte) entsprechend strukturierte Vergleichsgruppen aus ländlichen Gemeinden gebildet: «Unselbständige in ländlichen Gemeinden» und «Selbständige in ländlichen Gemeinden».Zusammen mit den «Landwirten in ländlichen Gemeinden» bilden diese die «Aktiven in ländlichen Gemeinden».
Aufgrund der kleinen Stichprobengrösse bei den untersuchten Haushalten können verschiedene Detailaufteilungen nicht gemacht werden,da sie statistisch nicht gesichert sind.
1 Wegen Rundungsdifferenzen können aufaddierte Werte leicht vom Total abweichen
2 Spezialgewichtung BLW:Gleichverteilung nach Haushaltsgrössenklassen bei den aktiven Haushalten ländlicher Gemeinden
() Ergebnis kann nicht publiziert werden,da Anzahl Einträge ungenügend ist (28) Wert mit starker Streuung:Variationskoeffizient >10%
Quelle:BFS
Die Einkommensresultate zeigen,dass das Haushaltseinkommen der bäuerlichen Haushalte unter Berücksichtigung der Haushaltsgrösse deutlich niedriger ist als jenes der Vergleichshaushalte.So liegen die Einkommen der befragten landwirtschaftlichen Haushalte im Mittel bei 6'200 Fr.pro Monat,jene der Unselbständigen bei 10'200 Fr. und 10'900 Fr.bei den Selbständigen.Der Anteil «Einkommen aus Arbeit» macht bei den bäuerlichen Haushalten dabei 81% aus,bei den Unselbständigen 87% sowie 85% bei den Selbständigen.Prozentual sind somit die «Einnahmen aus Vermietung und Vermögenseinkommen» sowie der «Transfereinkommen» bei den bäuerlichen Haushalten leicht höher als bei den Vergleichshaushalten.Wegen der kleinen Fallzahl bei den bäuerlichen Haushalten kann nicht ausgewiesen werden,wie sich die «Einnahmen aus Vermietung und Vermögenseinkommen» sowie «Transfereinkommen» (das heisst Sozialleistungen,Alimente etc.) zusammensetzen.
1 Wegen Rundungsdifferenzen können aufaddierte Werte leicht vom Total abweichen
2 Spezialgewichtung BLW:Gleichverteilung nach Haushaltsgrössenklassen bei den aktiven Haushalten ländlicher Gemeinden
() Ergebnis kann nicht publiziert werden,da Anzahl Einträge ungenügend ist
(28) Wert mit starker Streuung:Variationskoeffizient >10%
Entsprechend den niedrigen Einkommen der bäuerlichen Haushalte sind auch ihre Ausgaben geringer als jene der Vergleichshaushalte – wiederum unter Berücksichtigung der Haushaltsgrösse.Ein Teil der Ausgabendifferenz kann durch die Besonderheiten der bäuerlichen Haushalte erklärt werden.Eine grosse Differenz ist bei den Ausgaben für «Wohnen und Energie» zu beobachten.Diese Kosten sind bei den bäuerlichen Haushalten 800 bis 1'000 Fr.tiefer pro Monat.Erklären lässt sich dieser Unterschied damit,dass das Wohnhaus Teil des landwirtschaftlichen Betriebs ist und somit auf der Basis des Ertragswertes übernommen werden konnte.Entsprechend tiefer fallen deshalb auch die Eigenmietwerte aus.Bei den Ausgaben für «Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke» ist zu beachten,dass die Naturalbezüge – Eigenversorgung aus Stall und Garten – mitberücksichtigt sind.Diese werden mit den entsprechenden Ladenpreisen bewertet.Für eine bäuerliche Familie reduzieren sich die effektiven Ausgaben für diesen Posten um 187 Fr.oder 22%.Bei den Vergleichshaushalten sind die Naturalbezüge bedeutend geringer.Eine andere bäuerliche Besonderheit ist die räumliche Nähe bzw.Einheit von Wohn- und Arbeitsort.Die Kosten für den Arbeitsweg und die Ausserhausverpflegung am Mittag belasten deshalb das Budget nicht sehr.Ein Teil der tieferen Ausgaben für «Verkehr» sowie «Gast- und Beherbergungsstätten» dürften auf diesen Umstand zurückzuführen sein.Die niedrigeren Einkommen der bäuerlichen Haushalte haben auch zur Folge,dass die «Transferausgaben»,insbesondere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge (degressive Beitragsskala),pro Monat bedeutend tiefer ausfallen – 900 bis 2'100 Fr. – als bei den Vergleichshaushalten.
Die Einkommensresultate der EVE 2002 zeigen auf,dass das Einkommen der befragten bäuerlichen Haushalte unter Berücksichtigung der Haushaltsgrösse bedeutend geringer ist als jenes der Vergleichshaushalte aus ländlichen Gemeinden.
Entsprechend den niedrigeren Einkommen der bäuerlichen Haushalte sind auch ihre Ausgaben im Vergleich geringer.Etwa zwei Drittel dieses Unterschieds zu den Vergleichshaushalten kann einerseits durch die Besonderheiten der bäuerlichen Haushalte – wie günstiges Wohnen,Eigenversorgung aus Stall und Garten,kein langer Arbeitsweg und keine Ausserhausverpflegung am Mittag – erklärt werden.Andererseits auch durch die tieferen Transferausgaben (Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) aufgrund der niedrigeren Einkommen der bäuerlichen Haushalte.


Zu den wichtigsten Elementen des bäuerlichen Selbstverständnisses gehört der Wille, selbständig und unabhängig zu sein und zu bleiben.Vielen Bauernfamilien fällt es daher schwer, über Probleme und Existenzsorgen zu reden.Ein Zugeben von Schwierigkeitenwird häufig einem Versagen im Beruf gleichgestellt,sowohl von den Bauern selbst als auch von ihrem Umfeld.
In der deutschen Schweiz besteht seit 1996 die Möglichkeit,bei Problemen und Nöten anonym das «Sorgentelefon für Bauern,Bäuerinnen und ihre Angehörigen» anzurufen und sich über Unsicherheiten und Ängste auszusprechen.Seit 2001 wird im Tessin auf dem jährlich erscheinenden landwirtschaftlichen Weiterbildungsprogramm unter dem Namen «Telefono amico per contadine,contadini e i loro familiari» die Telefonnummer des landwirtschaftlichen Beratungsdienstes abgedruckt.In der Westschweiz steht eine spezielle Telefonlinie für Bauernfamilien kurz vor der Einführung.
Übersicht über die bestehenden kantonalen Angebote
Kurzbeschreibung
Seit 1997.Interventionsprogramm der Prométerre für Bauernfamilien in finanziellen Krisensituationen.Ansprechpartner sind drei Berater.Ein Netzwerk mit Vertretern von Banken steht zur Verfügung.
Seit 1998.Eine Arbeitsgruppe (Beratung,Landwirtschaftskammer, Kreditkasse,Amt für Sozialwesen) berät und unterstützt Bauernfamilien in finanziellen Schwierigkeiten.
Seit 1999.Dreiteiliges Konzept zur Hilfestellung:Probleme erkennen, Analyse und Sanierungsvorschläge,Betreuung.Zwei Berater sind Ansprechpartner.Ein Netzwerk steht bereit.
Seit 2000.Die Beratungsstelle unterstützt Bauernfamilien in akuten Schwierigkeiten.Die Anlaufstelle gibt die Fälle an ein für die Problematik ausgebildetes Mitglied des Beratungsteams weiter (Agronom,Bäuerin,Theologe,Arzt,Jurist).
Seit 2001.Bauernfamilien werden unterstützt,mit dem Wandel fertig zu werden.Je ein Berater eines Inforama-Standortes ist Anlaufstelle. Es steht ein Netzwerk aus Fachpersonen bereit.
Seit 2002.Zwei Berater sind Ansprechpersonen und begleiten landwirtschaftliche Familienbetriebe im Wandel.Das Angebot versteht sich auch als Familienberatungsstelle.
Seit 2003.Ein Netzwerk mit 17 Kontaktpersonen bietet Hilfestellung an.Die Kommission Soziales des Thurgauischen Bauernverbandes koordiniert Angebote in der Prävention sozialer Probleme.
Seit 2003.Es gibt eine Anlaufstelle,sechs Berater sind Ansprechpersonen:Spezifische Beratung und enge Zusammenarbeit mit Bauern- und Bäuerinnenverband,Kreditkasse,Hilfswerke etc.
Offeni Türe
Seit 2003.Die Anlaufstelle nimmt eine Lageanalyse vor und stellt, falls notwendig,den Kontakt zu einem Mitglied des Beratungsteams her (Psychologe,Agronom,Pfarrer,Berater,Jurist,Bäuerin).
Kompass –Neue Wege in der Landwirtschaft
Seit Herbst 2003.Vier Berater sind Ansprechpersonen,im Zweierteam werden die Bauernfamilien begleitet und unterstützt.
Im Kanton Neuenburg besteht seit Herbst 2004 eine Pilotgruppe «politique sociale agricole».Im Kanton Aargau befindet sich ein Beratungsangebot für Bauernfamilien in Schwierigkeiten kurz vor der Einführung.Im Kanton Schwyz ist es im Aufbau:Eine Projektgruppe mit Vertretern und Vertreterinnen verschiedener Institutionen wurde bereits gebildet.In anderen Kantonen werden die Bauernfamilien über mehrere Jahre begleitet,wenn sie die Betriebshilfe in Anspruch nehmen.Im Kanton Jura beispielsweise werden in einem Vertrag die jeweiligen Verpflichtungen des Betriebsleiters und des Beraters genau festgelegt.
Im Allgemeinen nehmen viele Betriebsberater infolge ihrer langjährigen Beratungstätigkeit und der damit erworbenen sozialen Kompetenz – ohne dass ein institutionalisiertes Angebot besteht – zum Teil Beratungsaufgaben wahr,die weit über ihren eigentlichen Aufgabenbereich hinausgehen.Darüber hinaus bieten die landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentralen spezifische Kurse an,zum Beispiel «ARC –Brücken in die Zukunft».Dieses Weiterbildungsangebot für Bäuerinnen und Bauern vermitteltWerkzeuge und Entscheidungshilfen,um die Entwicklung des Betriebes aktiv und nachhaltig anzugehen,bevor Schwierigkeiten auftauchen.
Den kantonalen landwirtschaftlichen Beratungsdiensten fehlen im Allgemeinen die Kompetenzen für das Analysieren und die Begleitung bei zwischenmenschlichen, familiären und sozialen Problemen.Diese Aufgaben kann daher die herkömmliche Beratung in der Regel alleine nicht lösen.Den jeweiligen Fachstellen fehlen demgegenüber meist Kenntnisse über die bäuerlichen Verhältnisse und Besonderheiten,und sie sind ihrerseits froh um Hilfestellungen,wenn sie Bauernfamilien zu betreuen haben. Der Aufbau von Netzwerken,ein Kennzeichen der Angebote,war naheliegend.
Neben dem Netzwerkansatz gibt es folgende Grundprinzipien,die sich durch alle Angebote für Bauernfamilien in schwierigen Situationen durchziehen:
– Die Bauernfamilie muss aktiv werden,das heisst sie selbst muss an die Anlaufstellen gelangen.Auch den Kontakt zu weiterführenden Fachstellen muss sie selber aufnehmen.
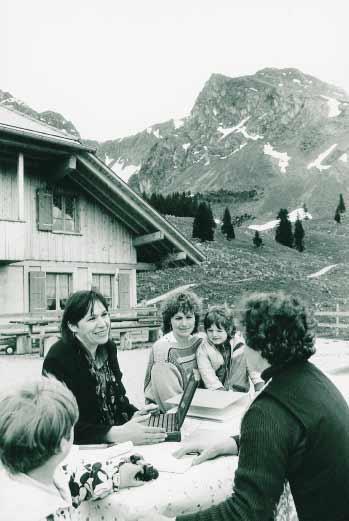
– Beratung ist nicht grundsätzlich gratis,insbesondere spezielle Leistungen wie etwa Therapien müssen von den hilfesuchenden Personen bezahlt werden.Die Finanzierung der Beratung durch die Betroffenen ist Teil der Problemlösung,sie sind nicht einfach Bittsteller.
– Die Personen,die bei diesen Angeboten eine Funktion wahrnehmen,engagieren sich stark für das entsprechende Angebot.
Drei Angebotstypen für Bauernfamilien in schwierigen Situationen haben sich herausgebildet:Angebote bei vorwiegend finanziellen Problemen,solche bei vorwiegend sozialen Problemen sowie jene bei finanziellen und sozialen Problemen.Ganz klar und eindeutig lassen sich die Angebote jedoch nicht zuordnen.Basis für die Einteilung bilden die Schwerpunkte der jeweiligen Angebote.
Im Folgenden werden die bestehenden institutionalisierten Angebote näher vorgestellt.Die entsprechenden Informationen wurden in Gesprächen mit den Verantwortlichen resp.den Ansprechpersonen der verschiedenen kantonalen Angebote zusammengetragen.Nachfolgend wird auch versucht zu zeigen,wer die Bauernfamilien sind,die sich an diese spezifischen Angebote wenden.
■ Angebote bei vorwiegend finanziellen Problemen
Das Ziel der Angebote mit Schwerpunkt finanzielle Beratung ist,einerseits mit Sofortmassnahmen Liquiditätsengpässe zu beseitigen und anderseits längerfristig eine tragbare Lösung für die betreffende Bauernfamilie zu finden,damit sie wieder ohne Hilfe von Dritten leben und wirtschaften kann.
Das Angebot «Cellule de crise» der Prométerre im Kanton Waadt hat sich auf Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten spezialisiert.Die Initiative für den Aufbau dieser Dienstleistung kam von der landwirtschaftlichen Kreditkasse,welche bei einigen ihrer Kunden feststellte,dass sie in finanziellen Engpässen steckten.Prométerre – ein Zusammenschluss von Landwirtschaftskammer,Beratungsdienst sowie ländlichem Verein (fédération rurale vaudoise) – nahm sich der Sache an und baute mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erfolgreich ein Beratungsangebot auf.Prométerre selber ist ein Netzwerk mit den für die Beratung benötigten betriebswirtschaftlichen und juristischen Kompetenzen.Die drei Ansprechpersonen der «Cellule de crise»,die rund 150 Stellenprozente besetzen,haben zudem informelle Kontakte mit verschiedenen Banken.Die Beratungsabläufe sind klar geregelt:Nach Vorliegen einer Anfrage um finanzielle Hilfe wird der betreffende Betrieb zuerst genau analysiert.Anschliessend werden tragbare Lösungen entwickelt.Die «Cellule de crise»-Mitarbeiter arbeiten dabei eng mit den Betriebsleitern zusammen.Die Betriebe werden nötigenfalls mehrere Jahre begleitet.Entsprechend wenige Rückfälle sind zu verzeichnen.Bei etwa einem Viertel der bisher behandelten Fälle konnte keine betriebliche Lösung gefunden und der Betrieb musste aufgegeben werden.Pro Jahr werden rund 100 Dossiers bearbeitet, seit Beginn der Dienstleistung sind es 735 (Stand März 2004).
Im Kanton Wallis wurde Ende 1998 eine Arbeitsgruppe «conseil financier» gegründet. Diese berät und unterstützt Bauernfamilien in finanziellen Schwierigkeiten.Sie setzt sich aus einem Vertreter der landwirtschaftlichen Beratung,der Landwirtschaftskammer,der landwirtschaftlichen Kreditkasse sowie des Amtes für Sozialwesen (Service de l’action sociale) zusammen.Es bestehen gute Kontakte zu Banken.Liegt eine Anfrage einer Bauernfamilie nach finanzieller Hilfe vor – in der Regel wegen Überschuldung –,wird der entsprechende Betrieb besucht und Betrieb sowie Buchhaltung genau analysiert.In der Arbeitsgruppe werden anschliessend mögliche Lösungen diskutiert und das weitere Vorgehen (Umstrukturierungen,Höhe des Kredits etc.) festgelegt.Die finanzielle Hilfe wird dabei u.a.als Investitionskredit im Rahmen eines speziellen Budgets für Bauernfamilien in finanziellen Notlagen gesprochen.Die Betriebsleiter verpflichten sich ihrerseits,eine detaillierte Buchhaltung zu führen und diese regelmässig vorzuweisen.Pro Jahr werden heute rund 10 Dossiers bearbeitet.In den Jahren 2000 und 2001 waren es je rund 40 Fälle.
Im Zuge der Agrarreform zeichnete sich im Kanton Freiburg ab,dass ein Teil der Bauern in Zukunft ein hochspezifisches,technisches Beratungsangebot suchen und ein anderer Teil Beratung benötigen würde,um die Herausforderungen der neuen Agrarpolitik bewältigen zu können.Daraus entstand das Angebot «AED – Aide aux Exploitations en Difficulté»,das im Prinzip wie folgt funktioniert:Die beiden Ansprechpartner des Beratungsangebotes nehmen die Anfragen entgegen und koordinieren das weitere Vorgehen. Über die hilfesuchenden Bauernfamilien wird eine Art von Schutzschirm gespannt.Zunächst wird versucht,eine Lösung für die dringendsten Probleme zu finden.Anschliessend werden,falls notwendig,Strategien für die mittel- und längerfristige Ausrichtung der Betriebe ausgearbeitet.Ursprünglich wollte man ein Buchhaltungs-Frühwarnsystem aufbauen.Dieses scheiterte jedoch am Datenschutz und auch
daran,dass Bauernfamilien häufig nicht klar sehen wollten,wie es um ihren Betrieb steht.Eine kantonale Plattform mit Vertretern von Sozialdienst,Tierschutz,Gewässerschutz,Kreditkasse,Bank und anderen Fachstellen trifft sich einmal pro Jahr.Dort werden Probleme und Entwicklungstendenzen besprochen.Im Budget der kantonalen Beratung ist eine Summe für «AED – Aide aux Exploitations en Difficulté» reserviert. Die Bauernfamilien müssen je nach ihren finanziellen Möglichkeiten an die Kosten der Beratung beisteuern.Pro Jahr werden rund 30 Dossiers bearbeitet.
Belastungen und Überforderungen,Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben,Verdrängung durch Suchtverhalten,Versagensangst und Verlust von Selbstvertrauen, Sturheit und unflexibles Verhalten sowie Zukunftsangst werden als soziale Phänomene vermehrt auch in der Landwirtschaft festgestellt.In drei Kantonen werden speziell für soziale Probleme Hilfestellungen und Begleitung angeboten.
Im Kanton Zürich gibt es seit 2000 das Angebot «Offeni Tür» der kantonalen Bauernund Landfrauenverbände. «Offeni Tür» liegt also in privaten Händen,dies in der Hoffnung,dass die Hemmschwelle – im Gegensatz zu einer offiziellen staatlichen Anlaufstelle – dadurch niedriger ist und sich die Bauernfamilien an das Angebot zu wenden wagen.Das Ziel von «Offeni Tür» ist die Unterstützung von Bauernfamilien in akuten Schwierigkeiten.Das Beraterteam,das sich aktuell aus zwei pensionierten Landärzten,zwei Seelsorgern,zwei Agronomen – wovon einer auch Jurist ist –,einer Person der landwirtschaftlichen Beratungszentrale Lindau,einer Bäuerin sowie dem Leiter des Beratungsteams zusammen setzt,unterstützt hilfesuchende Bäuerinnen und Bauern unbürokratisch vor Ort oder an einem diskreten Treffpunkt.Das Beraterteam ist ein Netzwerk und trifft sich alle vier Monate beziehungsweise je nach Bedarf:Die Fälle werden dabei besprochen und der Stand der Beratung geklärt.Die Problemfelder der Hilfesuchenden kreisen insbesondere um Generationen- und Partnerschaftskonflikte. Es zeigt sich deutlich,dass im zwischenmenschlichen Bereich,vor allem in Paarkonflikten,sehr oft zu lange zugewartet wird,bevor Hilfe von Aussenstehenden geholt wird.Jährlich werden etwa 35 Dossiers bearbeitet,seit Januar 2000 sind es 142 (Stand März 2004).
«Weitblick»,die Hilfestellung für Bauernfamilien in Schwierigkeiten im Kanton Appenzell-Ausserrhoden,wird von der landwirtschaftlichen Beratung angeboten. Von ihr kam auch die Initiative für den Aufbau dieser Dienstleistung.Bäuerliche Organisationen sind nicht involviert.Ein Auslöser war das vermehrte Antreffen von Problemfällen:Bei Beratungen spürten sie teilweise grosse Spannungen in den Familien.Wie sollten sie sich als Berater verhalten? Sie waren für ein Beratungs- und nicht für ein Betreuungsgespräch auf den Betrieb gekommen.Als Reaktion darauf entstand «Weitblick – Bauernfamilien orientieren sich im Zeitwandel».Bei «Weitblick» geht es um ein Sichtbarmachen der Ressourcen bzw.der vorhandenen Möglichkeiten der einzelnen Familienmitglieder.Dies soll anschliessend die Entscheidfindung erleichtern.Mit einer der beiden Ansprechpersonen – einem Berater und einer Beraterin,die beide eine familientherapeutische Ausbildung gemacht haben
kann die ratsuchende FamilieKontakt aufnehmen und ein erstes Gespräch vereinbaren.Dieses dient dem Kennenlernen und Klären der betrieblichen und familiären Situation.In einem zweiten Gespräch werden mögliche Lösungen geprüft,wobei die Familie ihre Ziele selber formulieren und auch umsetzen muss.Die Fähigkeiten und Begabungen der einzelnen Familienmitglieder werden in den Veränderungsprozess miteinbezogen.Gemeinsam
wird Neues entdeckt und das Vertrauen in die persönliche Zukunft gestärkt.Pro Jahr werden rund vier Beratungen durchgeführt.
Bis Ende der neunziger Jahre waren im Kanton Luzern während rund 40 Jahren zwei Kapuzinerpatres als Bauernseelsorger tätig,seither war die Schaffung einer bäuerlichen Seelsorgestelle im Kanton Luzern ein Thema.Nun wird seit Januar 2003 unter dem Namen «Offeni Türe» vom Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband eine entsprechende Dienstleistung angeboten.Mitgetragen wird es vom Sozialdepartement, dem Wirtschaftsdepartement und von gemeinnützigen Stiftungen.Das Zürcher Angebot diente als Modell. «Offeni Türe» ist eine nicht staatliche Anlaufstelle für Bauernfamilien,die unter zwischenmenschlichen Spannungen,Konflikten im Zusammenleben oder wirtschaftlichen Engpässen leiden.Im Einvernehmen mit den Ratsuchenden wird eine geeignete Fachperson aus dem Berater-Team beigezogen.Dieses Team besteht aus einem Seelsorger,einem Psychologen,einem Juristen,einer Bäuerin und einem Vertreter aus der Betriebsberatung.Die häufigsten Anfragen betreffen Generationenund Partnerschaftsprobleme.Bei Beziehungsproblemen steht zum Teil Suchtverhalten im Vordergrund. «Offeni Türe» wird oft auch dazu benutzt,um Sorgen und Ängste zu deponieren.Die Beratung ist grundsätzlich unentgeltlich.Therapien z.B.werden jedoch verrechnet.Im Jahr 2003 wurden knapp 30 Fälle verzeichnet,davon sechs komplizierte und aufwändige.
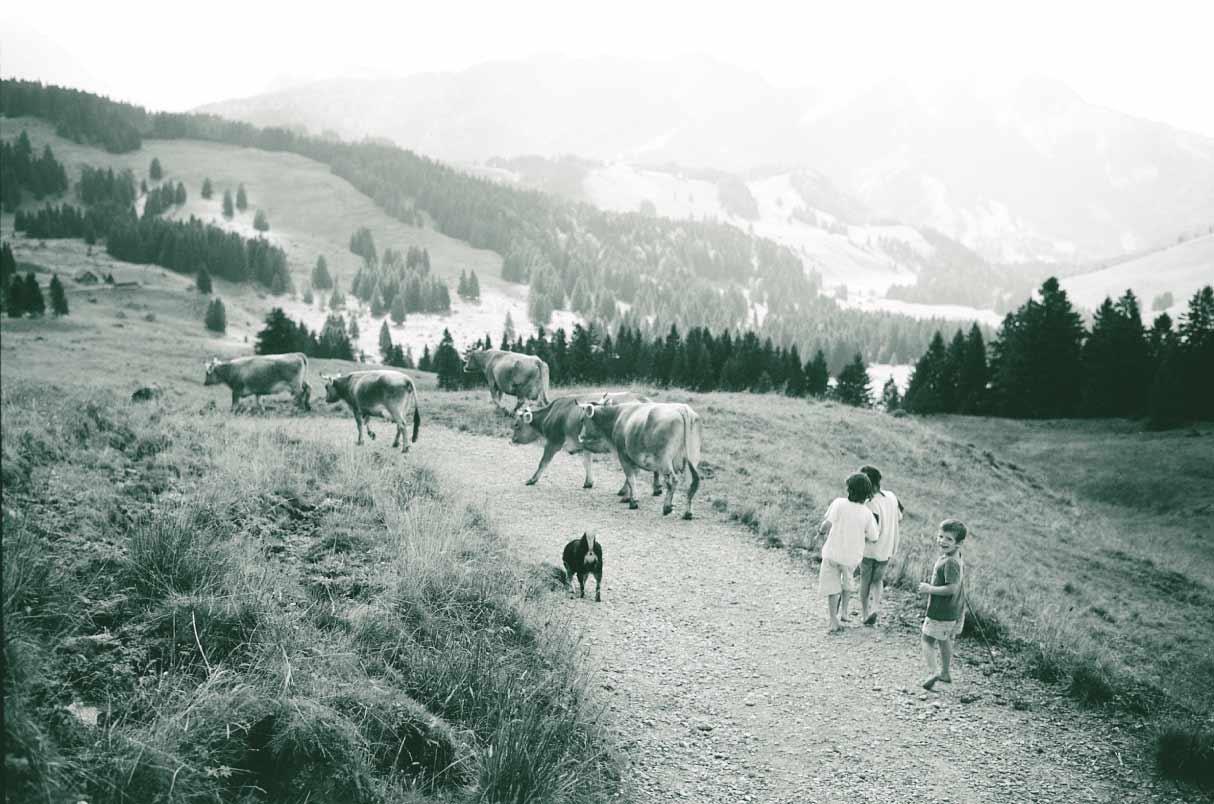
In einer Existenznotsituation ist oft nicht nur der Betrieb,sondern auch die Ehe und damit die Familie gefährdet.Es belastet eine Familie sehr stark,wenn sie dauernd Geldsorgenhat.Einige Kantone bieten daher eine breite,eng vernetzte Dienstleistung an.
Im Kanton Bern ist je ein landwirtschaftlicher Berater der sechs Inforama-Standorte im betreffenden Kantonsteil verantwortlich für das Beratungsangebot für Bauernfamilien in Schwierigkeiten.Zur Zeit wird «AufWind»,das ursprüngliche Angebot,ausgebaut und überarbeitet und im ganzen Kanton standardisiert,breiter abgestützt und besser koordiniert.Bereits 1997 wurde durch die Agro-Treuhand ein Leitfaden für die Früherkennung bei finanziellen Schwierigkeiten entwickelt.Dieses Frühwarnsystem wird aber nicht im ganzen Kanton angeboten bzw.durchgeführt.Die Berater sind Anlaufstelle und Ansprechpersonen.Je nach Fall leiten diese die Bauernfamilien an andere Fachstellen weiter,je nach Situation an Hausarzt,Psychiater,Sozialdienst oder an die Gemeinde.Vielfach sind auf den hilfesuchenden Betrieben verschiedene Kombinationen von mehreren belastenden Situationen vorzufinden.Die Bauernfamilienwollen in der Regel nichts mit den Sozialdiensten zu tun haben,obwohl sie Anspruch auf Unterstützung hätten.Für die Beratung und Begleitung leisten die Bauernfamilien einen eher symbolischen Beitrag.Manche Familien gelangen nach einiger Zeit wieder an die Beratung.Total werden im Kanton Bern (ohne Berner Jura) etwa 100 Fälle pro Jahr bearbeitet.
Im Kanton Thurgau steht ein kantonsweites Netzwerk von 17 Kontaktpersonen und Fachleuten zur Hilfestellung bei Notfällen bereit.Die Kommission Soziales des Thurgauer Bauernverbandes koordiniert Angebote in der Prävention sozialer Probleme. Der «Wegweiser» für Thurgauer Bauernfamilien in Notlagen macht insbesondere die bereits bestehenden Angebote sichtbar und motiviert die Ratsuchenden zum schrittweisen Anpacken ihrer Schwierigkeiten.Die zum Meistern der Probleme verfügbaren Leistungsangebote reichen von Gesamtbetriebsberatung über Ehe- und Familienberatung,Seelsorge,Vermittlung von Helfern im Betrieb und Haushalt bis zu Treuhand-, Versicherungs- und Rechtsberatungen.Zugang zu allen weiteren benötigten Hilfen, wie die Sozialdienste der Gemeinden,werden direkt von den Kontaktpersonen oder über eine geeignete Fachperson hergestellt.Oft bringt bereits das Gespräch mit einer Berufskollegin oder einem Berufskollegen den entscheidenden Zugang zu einer Problemlösung.Da nicht nachgefragt wird,wer sich aufgrund des Flyers an eine Kontaktstelle wendet,ist auch nicht bekannt,wie viele Fälle dem «Wegweiser» zugeschrieben werden können.
■ Angebote bei finanziellen und sozialen Problemen
Seit 2003 bietet die landwirtschaftliche Beratung des Kantons St.Gallen im Rahmen ihres Beratungsauftrages eine neue Dienstleistung an.Sie nennt sich «Offni Tür» und richtet sich an Bäuerinnen und Landwirte,die aufgrund einer besonderen Belastungssituation auf spezifische Beratung und Unterstützung angewiesen sind.Dieses Angebot ist in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen wie dem St.Gallischen Bauern- und Bäuerinnenverband,der landwirtschaftlichen Kreditkasse und dem Beratungs- und Buchhaltungsverein St.Gallen – Appenzell entstanden.Mit «Offni Tür» soll Hilfe zur Meisterung von schwierigen menschlichen und finanziellen Problemen in Bauernfamilien geleistet werden.Eine Anlaufstelle erleichtert die Kontaktaufnahme.Das sechsköpfige Beratungsteam sichert die enge Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen,welche zuständig sind oder einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten können.Grundsätzlich werden die Leistungen mit den üblichen Ansätzen der Beratung verrechnet.Bei Sozialfällen werden allerdings Ausnahmen gemacht.
Bearbeitete Anfragen von «Offni Tür – St.Gallen» von März bis Dezember 2003

Eheprobleme,Trennungen,Scheidungen19 IV-Renten- und Hilfsmittel Abklärungen36 Wohnrechtsanpassungen und -auflösungen6 Sozialhilfe Abklärungen6 Zukunftsängste5 Krankheitsbedingte Betriebsumstellungen2
1 Wobei die Beratung bei mindestens 30 Fällen,die landwirtschaftliche Kreditkasse zusätzlich bei etwa 20 Fällen Unterstützung geleistet haben 2 Nicht inbegriffen sind eine grössere Anzahl von telefonischen Auskünften
Quelle:Landwirtschaftliche Beratung St.Gallen
Im Kanton Nidwalden gibt es seit Herbst 2003 das Einzelberatungsangebot «Kompass – Neue Wege in der Landwirtschaft».Die Projektträgerschaft bilden der Bäuerinnenund der Bauernverband Nidwalden sowie das Forum Nidwalden.Verantwortlich ist das Landwirtschaftsamt.Ansprechpersonen sind vier Berater.Mit «Kompass» wird eine breite Zielgruppe angesprochen:Bauernfamilien,die ihren Betrieb auf die Zukunft ausrichten wollen,Bauernfamilien mit ungenügender Eigenkapitalbildung,aber auch solche mit gesundheitlichen oder familiären Problemen resp.mit akuten wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten.Die Beratung wird im Zweierteam (Beraterin und Berater) unter Einbezug der gesamten Bauernfamilie durchgeführt.Bei Betrieben mit akuten finanziellen Schwierigkeiten wird eng mit der Sozialberatung der Gemeinden und den Hilfswerken zusammen gearbeitet.Während der Einführungsphase 2004 –2005 wird «Kompass» zum Pauschalpreis von 200 Fr.angeboten,bei Sozialfällen erfolgt sie unentgeltlich.Im ersten Halbjahr wurden sechs Dossiers bearbeitet,darunter war eine Bauernfamilie in grossen Schwierigkeiten.
Wer sind die Bauernfamilien,die an diese Beratungsangebote gelangen? Lassen sie sich allenfalls durch typische Merkmale identifizieren? Und warum wenden sie sich an die kantonalen Angebote? Obwohl keine klare Typisierung der von Schwierigkeiten betroffenen Bauernfamilien gemacht werden kann,ist dennoch ein Skizzieren von hauptsächlich vorzufindenden Situationen bzw.familiären und betrieblichen Eigenheiten möglich.
Kumulation von Problemen: Teilweise ist auf den hilfesuchenden Betrieben eine Kumulation von mehreren belastenden Situationen anzutreffen:Finanzielle Schwierigkeiten mit Liquiditätsengpässen,Alkohol- und/oder gesundheitliche Probleme,Depressionen,schlechte Schulbildung,Isolation.Die Betroffenen sind oft handlungsunfähig und haben Angst:vor dem Versagen,vor den Geschwistern und den Nachbarn.Vielfach ist nicht klar,was Ursache und was Wirkung ist.Wenden sich die Bauernfamilien in einer solch späten Phase an die Angebote,so ist die Beratung und Begleitung äusserst schwierig.
Überforderung durch Agrarreform: Einige Landwirte und Bäuerinnen finden sich mit der neuen Agrarpolitik nicht zurecht und sind mit der Führung des Betriebes überfordert.Sie müssen sich um mehr und neue Dinge kümmern.Es sind häufig «Chrampfer»,aber weder Buchhalter noch Betriebsleiter.Sie fühlen sich an die Wand gedrückt und ungerecht behandelt.Das bäuerliche Selbstverständnis wird erschüttert: Wenn früher ein Bauer «rechtschaffen und bescheiden» war,konnte er seinen Betrieb erfolgreich führen.Heute reicht das nicht mehr.In Berggebieten sind die Bauernfamilien teilweise von der engen Umwelt und Abgeschiedenheit geprägt,ein rasches Umdenken ist schwierig.
Umstrukturierungen: Bei einer Anzahl von Landwirten lösen finanzielle Schwierigkeiten oft unüberlegte Aktionen aus:Sie produzieren mehr vom Gleichen,versuchen die Strukturkosten durch Entlassung des Angestellten zu senken,nehmen einen Nebenerwerbauf,beginnen direkt zu vermarkten oder Gäste zu bewirten.Dabei übersehen diese Bauernfamilien meist,welche Konsequenzen überstürzte Umstrukturierungen haben.Zum einen können daraus Arbeitsüberlastungen entstehen.Zum andern hat z.B.die Umstellung von Milchproduktion auf Mutterkuhhaltung in einigen Betrieben zu Liquiditätsengpässen geführt,weil das Milchgeld plötzlich fehlte und Erträge aus der Mutterkuhhaltung erst mit der Zeit fliessen.Andere Betriebe unterschätzen die Lasten, die sich aus Investitionen ergeben,ohne dass diesen ausreichende Einnahmen gegenüberstehen.
■ Wer nimmt die Beratungsangebote in Anspruch?
Ehescheidungen und Generationenkonflikte: Eine Scheidung – insbesondere in der Landwirtschaft – ist oft ein Armutsrisiko.Es können sich daraus jahrelange finanzielle Verpflichtungen ergeben.In einigen Fällen ist das Ende der Ehe auch das Ende des Betriebes.Bei Generationenkonflikten und Partnerschaftsproblemen nehmen Frauen eher Kontakt auf als Männer,denen das Ansprechen von Problemen schwerer fällt.
Auslaufende Betriebe: Die hilfesuchenden,häufig ledigen Betriebsleiter von auslaufenden Betrieben sind meist zwischen 50 und 60 Jahre alt.Sie kommen in der Regel in einer sehr späten Problemphase und fragen voll Panik,ob sie wirtschaftlich noch bis zum AHV-Rentenalter durchhalten können.Sie sind sich bewusst,dass sie auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben und ihr einziger Halt der Betrieb ist.

Die Angebote für Bauernfamilien in schwierigen Situationen erweisen sich als sehr praktische Ansätze,um soziale Probleme in der Landwirtschaft effektiv und situationsgerecht angehen zu können.Sie bauen auf bestehenden Fachkompetenzen auf und in den meisten Fällen auf bestehenden Organisationsstrukturen.Ein wesentliches Element ist die Vernetzung der Kompetenzen und/oder Organisationen.So profitiert die bäuerliche Beratung z.B.von den Fachkompetenzen eines Psychiaters und umgekehrt Verantwortliche von Sozialdiensten von den Kenntnissen der bäuerlichen Berater und Beraterinnen über die Besonderheiten des bäuerlichen Familien- und Arbeitsalltags.
Ein Teil der Beratungsfälle ist sehr aufwändig.Zum einen absorbieren sie zeitlich viel Ressourcen,zum andern können die konkret vorliegenden Probleme psychisch belastend sein.In der Betriebsberatung befassen sich deshalb in der Regel erfahrene Berater oder Beraterinnen mit diesen Angeboten.Empfehlenswert ist ausserdem,dass sie sich in Gesprächsführung,Moderation oder Umgang mit Konflikten speziell weiterbilden.Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Beratungsangebote haben gezeigt,dass die Angebote eine wertvolle Unterstützung in der Zeit des Umbruchs in der Landwirtschaft darstellen.Damit eine sozialverträgliche Entwicklung in der Landwirtschaft gewährleistet werden kann,ist es sinnvoll,wenn die eingesetzten Ressourcen auch diese problematischen Fälle abdecken und sich nicht nur auf die zukunftsfähigen Betriebe konzentrieren.
Eine der Leitplanken der schweizerischen Agrarpolitik bildet der Schutz der Umwelt und der Natur.In diesem Kapitel sollen die Bereiche Stickstoff und Wasser behandelt werden.
Das agroökologische Monitoring ist eine Antwort auf den Umweltteil der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (SR 919.118).Die für dieses Monitoring verwendeten Agrarumweltindikatoren lassen sich in sechs Bereiche (Stickstoff,Phosphor,Energie-Klima,Wasser,Boden,Biodiversität-Landschaft) und in drei Arten (landwirtschaftliche Praxis,Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt,Zustand der Umwelt in Zusammenhang mit der Landwirtschaft) einteilen.

Gegenwärtig setzt sich das Monitoring im Hinblick auf die erwarteten methodischen Entwicklungen und statistischen Daten aus operationellen Indikatoren und Ersatzindikatoren zusammen.
Die Entwicklung der Bodennutzung und der Produktionsmittel wird wie jedes Jahr dargestellt.


■ Stickstoff ist der «Treibstoff» der landwirtschaftlichen Produktion
Die Pflanzen und mit ihnen die Ökosysteme brauchen für ihr Gedeihen nebst Licht, Wasser und Wärme auch Nährstoffe verschiedenster Art.Darunter hat Stickstoff eine herausragende Bedeutung.Er ist fast überall auf dem Land derjenige Nährstoff,der am ehesten zu Ertragseinbussen führt,weil er besonders knapp vorhanden ist.Damit bestimmt die N-Zufuhr weitgehend die Höhe des Pflanzenertrags.Stickstoff ist somit ein besonders wichtiger Produktionsfaktor der Landwirtschaft.
Stickstoff ist ein «Verwandlungskünstler» und kann die Umwelt belasten
N-Formen, N-Flüsse und Wirkungen
Quellen
■ Die Landwirtschaft ist die Hauptemittentin von Ammoniak,Nitrat und Lachgas
Stickstoff unterliegt einem stetigen komplizierten Kreislauf und ist ein «Verwandlungskünstler»,der sich in den unterschiedlichsten Formen zeigt.Ein Teil des in der Landwirtschaft umgesetzten Stickstoffs gelangt in pflanzliche und tierische Produkte oder wird in die organische Substanz des Bodens eingebaut.Ein anderer Teil geht für die Landwirtschaft unproduktiv verloren.Geschieht dies in Form von elementarem Stickstoff (N2),bedeutet das einen Verlust für die Landwirtschaft,ist aber für die Umwelt unproblematisch.Geht Stickstoff aber als Ammoniak (NH3),als Nitrat (NO3),oder als Lachgas (N2O) verloren,kann er Luft,Wasser,Boden und Pflanzengesellschaften, besonders sensible Ökosysteme wie Wälder,Hochmoore und Magerwiesen belasten. Die Folgen sind Versauerung und Überdüngung von Böden,Eutrophierung von Oberflächengewässern,Grundwasserbelastung,Ozonabbau in der Stratosphäre (Ozonloch) und Verstärkung des Treibhauseffekts.Zudem trägt Ammoniak zur Bildung von sekundären Aerosolen in der Atmosphäre bei,welche als feine Partikel (PM10) die menschliche Gesundheit gefährden (vgl.dazu Agrarbericht 2003).Bei Verbrennungsprozessen wird Stickstoff zudem in Form von Stickoxiden (NO2) emittiert,welche zur N-Deposition und zur Bildung bodennahen Ozons beitragen.Ozon ist ein Reizgas,das die Gesundheit von Pflanze,Tier und Mensch beeinträchtigen kann.
Im Folgenden werden die wichtigsten umweltrelevanten N-Verbindungen mengenmässig auf ihre Verursacher aufgeteilt.Dann werden die internationalen Vereinbarungen und die auf die schweizerische Landwirtschaft bezogenen Ziele bezüglich der Reduktion dieser Emissionen vorgestellt.Anschliessend werden Ergebnisse über die N-Emissionen aus der Landwirtschaft auf der Basis der N-Bilanz und der so genannten umweltrelevanten N-Verluste präsentiert.Auf die beiden wichtigsten umweltrelevanten N-Fraktionen aus der Landwirtschaft,Ammoniak und Nitrat,wird in zwei besonderen Abschnitten noch detaillierter eingegangen.Abschliessend wird Fazit gezogen.
Die Projektgruppe «Stickstoffhaushalt Schweiz» hat im Auftrag des Eidg.Volkswirtschaftsdepartements (EVD) und des Eidg.Departements des Innern (EDI) einen Bericht verfasst (SR Umwelt Nr.273,BUWAL 1996),der für die relevanten Gruppen von Stickstoffverbindungen die Gesamtemissionen aufzeigt.Die Landwirtschaft ist demzufolge die Hauptquelle für die umweltrelevanten Verbindungen Ammoniak,Nitrat und Lachgas.Ebenfalls von grosser ökologischer Bedeutung sind die Stickoxide sowie Ammonium,das in die Oberflächengewässer gelangt.Diese N-Verbindungen stammen zum grössten Teil aus den Sektoren Verkehr,Haushalt,Industrie und Gewerbe.Rund die Hälfte der N-Verluste,die im Bereich Ernährung-Landwirtschaft entstehen,erfolgt in Form von elementarem Stickstoff (in der nachfolgenden Grafik nicht aufgeführt).
■ Ökologisch motivierte Reduktionsziele können nur langfristig erreicht werden
Um den Menschen und die Ökosysteme vor schädlichen Einwirkungen zu schützen, müssen die Frachten der wichtigsten N-Verbindungen reduziert werden.Als langfristiges Ziel hat der Bundesrat in seinem Bericht über die lufthygienischen Massnahmen des Bundes und der Kantone vom 23.Juni 1999 zu Handen des Parlaments auf den hohen Handlungsbedarf hingewiesen.Um die ökologischen Ziele erreichen zu können, ist bei Ammoniak langfristig eine Emissionsminderung um 40–50% gegenüber dem Stand von 1995 nötig.Bei Stickoxiden ist gemäss dem gleichen Bericht ebenfalls eine Reduktion um ca.50% notwendig.Allerdings beziehen sich die vom Bundesrat aufgestellten lufthygienisch motivierten Reduktionsziele auf alle N-Emissionen.Als Hauptemittenten sind bei Ammoniak vor allem die Landwirtschaft und bei Stickoxiden besonders Haushalte,Gewerbe und Verkehr gefordert.Die Nordseeanliegerstaaten und die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) haben als Folge der im Laufe der achtziger Jahre deutlich gewordenen Überdüngungserscheinungen beschlossen,die Stickstoffeinträge in die Nordsee von 1985 so bald als möglich (Zielgrösse 2002/05) um 50% zu vermindern.Dieses Ziel bezieht sich auf die gesamten N-Einträge,nicht nur diejenigen der Landwirtschaft.1985 stammten 52% der N-Fracht aus Punktquellen (Kläranlagen,Industrie) und 48% aus diffusen Quellen (andere Stoffeinträge,davon 60–70% aus der Landwirtschaft).2001 betrugen die entsprechenden Werte 46% resp.54%.Insgesamt beträgt der Rückgang 22%,derjenige aus der Landwirtschaft 18%.
Bei den übrigen N-Emissionen gibt es keine vom Bundesrat vorgegebenen langfristigen ökologischen Reduktionsziele.Im Bericht «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissionen» (SR Umwelt Nr.273,BUWAL 1996) zeigt die von EVD und EDI eingesetzte Kommission aber auch bei Nitrat einen langfristigen Reduktionsbedarf von rund 50% (14'000–19'000 t N) gegenüber 1994 auf.Dieses Reduktionsziel ergibt sich aus der abgeschätzten Menge Sickerwasser der Landwirtschaftsböden.Nur wenn die ausgewaschene N-Menge entsprechend abnimmt,kann das Ziel gemäss Gewässerschutzverordnung von 25 mg/l Nitrat eingehalten werden.
Würden die ökologischen Zielwerte eingehalten,so wären nach heutigem Wissen die Ökosysteme – und damit auch die Menschen und Tiere – in der Schweiz nachhaltig geschützt.Diese Zielwerte können aber nur langfristig erreicht werden.Deshalb legte der Bundesrat mittelfristige agrarökologische Etappenziele fest (Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik,2002),welche die Landwirtschaft innert festgelegter Frist erreichen sollte.
Von sieben aufgeführten agrarökologischen Zielen für 2005 betreffen drei den Stickstoff.Konkret werden erwähnt:
– die N-Bilanz (Reduktion der umweltrelevanten N-Verluste um 22'000 t N/Jahr bzw. 22,9% gegenüber 1994 auf 74'000 t N/Jahr)
– die Ammoniakemissionen (Reduktion der Ammoniakemissionen gegenüber 1990 um 9%,das heisst um rund 4'800 t N/Jahr)
das Nitrat (die Nitratgehalte von Grundwasser liegen in 90% der Trinkwasserfassungen,deren Zuströmbereich von der Landwirtschaft genutzt wird,unter 40 mg/l).
Die umweltrelevanten N-Verbindungen aus der schweizerischen Landwirtschaft umfassen die Summe der ökologisch relevanten N-Emissionen aus der Landwirtschaft (Ammoniak,Nitrat,Lachgas).Für die beiden wichtigsten Einzelverbindungen Ammoniak und Nitrat wurden zusätzlich spezifische Ziele formuliert,die aber nur für Ammoniak in Form einer konkreten Frachtreduktion vorliegen.Deshalb kann für Nitrat keine Zielmenge für 2005 dargestellt werden.
N-Emissionen aus der Landwirtschaft, agrarökologische Etappenziele
Bezüglich Ammoniak gibt es zudem eine internationale Vereinbarung,welche die Schweiz zu konkreten Massnahmen verpflichtet.So ist als weiteres Etappenziel die Reduktion der Ammoniakemissionen um 13% bis 2010 gemäss UN/ECE-Protokoll über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen zu erwähnen (Basis 1990).
■ Die landwirtschaftliche Produktion ist untrennbar mit N-Emissionen verbunden
Auch langfristig gesehen wird es nicht möglich sein,die schädlichen N-Emissionen ganz zu vermeiden.Insbesondere in der landwirtschaftlichen Produktion laufen biologische Prozesse ab,die natürlicherweise mit unvermeidbaren N-Verlusten verbunden sind.So scheidet jede Kuh Kot und Harn aus,wovon ein gewisser Anteil als Ammoniak verloren geht.Jede Bodenbearbeitung führt zum Abbau von Humus und zur Freisetzung von Nitrat,wovon ein von den jeweiligen klimatischen und pedologischen Bedingungen abhängiger Teil unvermeidbar ins Grundwasser verloren geht.Die landwirtschaftliche Produktion ist damit unabwendbar mit N-Verlusten verbunden.
Durch einfache technische Massnahmen (z.B.optimierte Fütterung der Nutztiere, Ausbringen von Gülle mit Schleppschläuchen,noch besser auf den Bedarf der Nutzpflanzen abgestimmte Düngung u.s.w.) können die unerwünschten N-Emissionen insgesamt vermutlich auf das agrarökologische Etappenziel reduziert werden.Sollen die Emissionen aber noch weiter reduziert werden,müssten weitergehende technische Massnahmen ins Auge gefasst werden (z.B.die weitgehende technische Aufbereitung von Hofdüngern mittels Separierung,Vergärung,Entsalzung,Osmose und die Produktion von Düngstoffen,die wie Handelsdünger verwendet werden können). Darüber hinaus gibt es nur noch die Reduktion des Tierbestands.Dies ist nur dann sinnvoll,wenn der Konsum von tierischen Produkten zurückgeht.Wäre dies nicht der Fall,würden die in der Schweiz vermiedenen N-Emissionen einfach im Ausland anfallen.In Ländern mit tiefem Tierbesatz ist ein gewisser Anstieg der Nutztierzahlen allerdings als ökologisch nicht bedenklich einzustufen.
■ Die N-Emissionen aus der Landwirtschaft werden auf verschiedenen Wegen ermittelt
Stickstoff ist ein äusserst komplexer Stoff.Er kann in allen Umweltbereichen in den verschiedensten Formen auftreten und verwandelt sich ständig.So verwundert es auch nicht,dass mit verschiedenen Methoden versucht wird,den N-Umsatz in der Landwirtschaft und seine Bedeutung für die Umwelt zu erfassen.Alle diese Methoden haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.Deshalb werden im Folgenden einige wichtige Methoden und Teilbetrachtungen mit ihren spezifischen zentralen Aussagen vorgestellt.Die quantitativen Ergebnisse dürfen wegen unterschiedlichen methodischen Grundlagen aber nicht direkt miteinander verglichen werden.

Mit der N-Bilanz soll auf möglichst einfache Art ein Überblick über die Entwicklung der In- und Outputgrössen von Stickstoff gewonnen werden.Bei der von der OECD verwendeten Methode «N-Bilanz an der Bodenoberfläche» wird die Differenz gemessen zwischen der gesamten,während eines Jahres zugeführten N-Menge (Hofdünger, Recyclingdünger,Mineraldünger,biologische N-Fixierung und Einträge aus der Luft) und der dem Boden entzogenen N-Menge durch Acker- und Futterbauprodukte.Die wichtigste Inputgrösse sind die Hofdünger mit rund 50% des Gesamteintrags.Rund 25% stammen aus den Mineral- und Recyclingdüngern,ebenfalls rund 25% tragen andere Quellen bei (vor allem Eintrag über die Luft und biologische N-Fixierung). Mit der OECD-Methode werden die jährlichen Schwankungen bei den N-Entzügen besonders deutlich sichtbar.Dies ist auf die unterschiedlichen Ernteerträge je nach Witterung zurückzuführen.In Jahren mit einem tiefen N-Entzug ist die Gefahr von erhöhten N-Emissionen besonders gross.
N-Bilanz pro ha genutzte Fläche
Bis im Jahr 2000 hat der N-Input in die Landwirtschaft langsam aber stetig abgenommen.Seitdem gibt es eine uneinheitliche Entwicklung.Während in den Jahren 2001–2002 ein erhöhter N-Input festzustellen ist,erreicht er im Jahr 2003 ein neues Minimum.Bei den N-Outputs fallen die grossen,witterungsbedingten Schwankungen von Jahr zu Jahr auf.Insgesamt lässt sich aber – analog zum abnehmenden Tierbestand
auch ein leichter Trend zu abnehmender Futterproduktion ausmachen.Im Ackerbau blieb die Produktion in etwa auf der gleiche Höhe,mit Ausnahme des extrem trockenen Jahres 2003,in dem auch die Ackerbauerträge stark zurückgingen.Diese gegenläufigen Entwicklungstendenzen führten zum Ergebnis,dass der N-Bilanz-Überschuss in der Schweiz von 1990 bis heute in etwa auf der gleichen Höhe blieb.Er schwankt in dieser Zeit immer zwischen rund 70 und 80 kg pro ha.
Denkt man sich die gesamte Landwirtschaft der Schweiz als einen einzigen Betrieb, erlaubt dies,einen vertieften Blick auf die Entwicklung der Inputgrössen zu werfen, welche von den Landwirten selbst beeinflusst werden können.Bei der OSPAR-Methode gilt nur als Input,was von aussen in die Landwirtschaft gelangt,also z.B.die importierten Futtermittel,nicht jedoch die Hofdünger.Auf der Seite des Outputs wird nur die von der Landwirtschaft weggeführte N-Menge in Form von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln sowie anderen Marktprodukten berechnet,nicht jedoch die Erträge im Futterbau und die übrigen selbst produzierten Futtermittel.
Der N-Bilanzüberschuss ging zwischen 1990 und 1997 deutlich zurück.Seither steigt er jedoch wieder leicht an.Die Ursache ist vor allem bei den zunehmenden Futtermittelimporten zu suchen.Dies ist teilweise auf den Ersatz von eiweissreichen Futtermitteln nach dem Verbot der Verwertung von Fleischmehl (1996:rund 5'000 t N) zurückzuführen.Zusätzlich ist auch der N-Mineraldüngerverbrauch wieder angestiegen.Eine mögliche Ursache dafür könnte der notwendige Ersatz von Stickstoff aus Klärschlamm (1999:rund 4000 t N) sein,dessen Verwertungsrate in den letzten Jahren stark abgenommen hat (das genaue Ausmass ist aber noch nicht bekannt).

■ Die Entwicklung der N-Effizienz
Die Effizienz des N-Einsatzes wird aus dem Verhältnis von N-Wegfuhr zu N-Zufuhr gemäss der N-Bilanz berechnet.Dabei wird die Wegfuhr in Prozent der Zufuhr ausgedrückt.Ein Verhältnis von 1 würde bedeuten,dass eine 100%-ige Effizienz besteht und absolut keine Verluste entstehen,sofern der N-Vorrat im Boden während dieser Zeit unverändert bleibt.Eine 100%-ige Effizienz ist aber wie oben erklärt bei der Verwendung von Stickstoff in der Landwirtschaft ausgeschlossen.
Entwicklung von N-Input, N-Output und N-Effizienz nach OSPAR-Methode
■ Berechnung der umweltrelevanten Stickstoffverluste
Von 1990 bis 1999 hat sich die Effizienz um 4 Prozentpunkte verbessert.Seitdem ging sie jedoch wieder um einen Prozentpunkt zurück.
Die Berechnung der umweltrelevanten N-Verluste erfolgt anhand der Methode von Häfliger et al.(IAW,1995).Es werden zwei verschiedene Berechnungsmethoden angewendet.Die Hochrechnung basiert auf den Ergebnissen von rund 240 Buchhaltungsabschlüssen.Unter Verwendung von Emissionsfaktoren wird das N-Verlustpotenzial für den ganzen Sektor hochgerechnet.Daraus können die umweltrelevanten N-Frachten –aufgeteilt auf Ammoniak,Nitrat und Lachgas – mittels Modellrechnung abgeleitet werden.Diese Berechnung erlaubt,Aussagen zu verschiedenen Betriebstypen und Zonen zu machen.Die Globalrechnung andererseits vergleicht den N-Bedarf aller Kulturen mit dem gesamten Anfall an Hof-,Mineral- und Abfalldüngern der schweizerischen Landwirtschaft und weist ebenfalls die umweltrelevanten N-Verluste aus.Die Ergebnisse der Globalrechnung dienen zur Überprüfung der Plausibilität der Ergebnisse der Hochrechnung.Die Ergebnisse beider Methoden sind jedoch nicht vergleichbar mit den Ergebnissen der übrigen Berechnungen,die in diesem Kapitel beschrieben werden.
Die Berechnung der umweltrelevanten N-Verluste wurde bereits zum dritten Mal durchgeführt.Es liegen nun Zahlen für 1994,1998 und 2002 vor.Zudem können die Ergebnisse einer ersten vereinfachten Berechnung von 1990 einbezogen werden.Die Aufteilung der N-Verluste auf die verschiedenen Verlustpfade wie auch die Analyse der betriebstypischen N-Emissionen konnte allerdings 2002 nicht zuverlässig vorgenommen werden.Damit können zum heutigen Zeitpunkt nur qualitative Aussagen bezüglich der Zielerreichung der Gesamtemissionen gemacht werden.
Es zeigt sich,dass nach einer positiven Entwicklung von 1990 bis 1998 die umweltrelevanten N-Emissionen im Jahr 2002 wieder zugenommen haben.Unabhängig von dieser Entwicklung dürfte das agrarökologische Etappenziel für 2005 nicht erreicht werden.Ein Grund für diese Entwicklung lässt sich im Anstieg der Düngung seit 1997/98 finden.Möglicherweise spielen aber auch weitere Faktoren wie die Zunahme der Anzahl Laufställe in dieser Zeit, Änderungen bei den Fütterungsempfehlungen, Veränderungen bei den N-Emissionen in Form von molekularem Stickstoff (Denitrifikation) oder – rein theoretisch – eine Zwischenlagerung von organisch gebundenem Stickstoff im Boden eine Rolle.Möglicherweise liegt eine wichtige Ursache aber auch darin,dass der Fehlerbereich dieser Berechnung relativ gross ist und deshalb noch keine zuverlässigen Aussagen möglich sind.Die möglichen Ursachen werden derzeit abgeklärt.
Zwei weitere wichtige Grössen werden im Zusammenhang mit den umweltrelevanten N-Verlusten gerechnet.Eine ist die so genannte Normabweichung.Sie zeigt,wie stark die effektive Düngung die Düngung gemäss Düngungsnormen überschreitet.Die andere ist das N-Verlustpotenzial.Es umfasst nebst den umweltrelevanten auch die nicht-umweltrelevanten N-Verluste.Damit werden mögliche Fehler bei der Aufteilung von umweltrelevanten in nicht-umweltrelevante N-Verluste vermieden.Hier werden die Ergebnisse der Globalrechnung präsentiert,da die Zuverlässigkeit der Aussage wegen der bedeutend grösseren Stichprobe besser ist.Bei der Globalrechnung liegen die Ergebnisse für 1993,1997 und 2001 vor.
Entwicklung der Abweichung von der Normdüngung und des Verlustpotenzials

Es zeigt sich,dass das N-Verlustpotenzial und die Normabweichung im Jahre 2001 deutlich unter den Werten von 1993 liegen,auch wenn seit 1998 eine erneute Zunahme erfolgt.
Bei den in der Landwirtschaft ablaufenden biologischen Prozessen geht ein Teil des umgesetzten Stickstoffs unproduktiv verloren,so auch in Form von Ammoniak (NH3). Im Jahr 2000 betrugen die landwirtschaftlichen NH3-Emissionen rund 43’500 t NH3-N. Dies sind ca.92% der gesamtschweizerischen Emissionen von NH3.Im Durchschnitt wird etwa die Hälfte dieser Emissionen in einem Radius von einigen Kilometern wieder deponiert.Der Rest wandelt sich in Ammonium um,welches in der Atmosphäre über weite Strecken (hunderte von Kilometern) verfrachtet werden kann,bevor es mit dem Niederschlag oder als Staub wieder auf die Erdoberfläche gelangt.Wird das NH3 auf Wiesen- oder Ackerflächen deponiert,ist dies nicht umweltrelevant.Wird der Stickstoff aber auf naturnahe Ökosysteme abgelagert,kann dies zur Überbelastung sensibler Gebiete führen.
Regionale Verteilung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft
Bei der Betrachtung der regionalen Verteilung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft fällt auf,dass das Gesamtbild stark von der Verteilung der Nutztiere geprägt ist.In Gebieten mit einer hohen Tierdichte fallen höhere NH3-Emissionen an,als in tierschwachen Gebieten oder Ackerbauregionen.
Herkunft der gesamten Ammoniakverluste 2000
nicht-landwirtschaftliche
Quellen 9%
Pflanzenbau 11%
Tierhaltung 80%
Quelle: SHL
Von den landwirtschaftlichen NH3-Emissionen stammten im Jahr 2000 89% aus der Nutztierhaltung (75% aus der Rindviehhaltung,17% aus der Schweinehaltung,4% aus der Geflügelhaltung sowie 4% aus diversen Tierkategorien).Die restlichen 11% der Emissionen gehen zu Lasten der im Pflanzenbau verwendeten Mineral- und Recyclingdünger.
NH3 -Emissionsquellen aus der Tierhaltung 2000

Stall inkl. Laufhof 34%
Hofdüngeranwendung
53%
Hofdüngerlagerung 11%
Weide 2%
Quelle: SHL
Die tierbedingten Emissionen entweichen beim Ausbringen von Hofdünger,im Stall (inkl.Laufhof),bei der Hofdüngerlagerung,sowie beim Weidegang.
Landwirtschaft gingen 70 60 50 40 30 20 10 0 199019911992199319941995199619971998199920002001 2002
■ NH3-Emissionen aus der Entwicklung der NH3 -Emissionen der Landwirtschaft in 1 000 t N Quelle: SHL
Gesamtschweizerisch haben die landwirtschaftlichen NH3-Emissionen zwischen 1990 und 2000 von 53’500 t N auf 43’500 t N abgenommen.Zu dieser Reduktion von 19% haben verschiedene Faktoren beigetragen:Rund zwei Drittel der Verminderungen sind auf die Abnahme der Tierzahlen zurückzuführen,der Rest auf Veränderungen bei der Produktionstechnik.Dazu zählen der aufkommende Einsatz moderner,emissionsarmer Ausbringtechniken für Hofdünger und der verringerte Einsatz von Mineraldüngern.Seit 2000 scheinen die Emissionen wieder leicht zuzunehmen.
■ NH3-Emissionen:
Die Tierhaltung ist unabwendbar mit NH3-Emissionen verbunden.Problematisch ist insbesondere die regionale Konzentration der Tierzahlen in gewissen Gebieten der Zentralschweiz sowie der Nordostschweiz.
Ausser in hochgelegenen,inneralpinen Tälern,wird die kritische Belastungsgrenze (critical load for nitrogen) für sensible Ökosysteme praktisch in der ganzen Schweiz überschritten.Bei den Critical Loads handelt es sich um jene N-Einträge,unterhalb derer nach dem heutigen Stand des Wissens bei längerfristigem Eintrag nicht mit schädlichen Auswirkungen auf Funktion und Struktur des Ökosystems gerechnet werden muss.Bei Waldökosystemen liegen die Critical Loads meist im Bereich von 10–20 kg N pro ha und Jahr,bei Hochmooren im Bereich von 5–10 kg N pro ha und Jahr und bei artenreichen Trockenrasen im Bereich von 10–25 kg N pro ha und Jahr.In tierstarken Gebieten werden stellenweise jedoch N-Depositionsraten von über 60 kg N pro ha und Jahr gemessen,die lokal aber auch 120 kg N pro ha und Jahr überschreiten können.Im Mittel trägt der reduzierte Stickstoff (Ammoniak und Ammonium) etwa zwei Drittel und der oxidierte Stickstoff einen Drittel zur gesamten N-Fracht bei.
Die landwirtschaftsbedingten NH3-Emissionen im Kanton Solothurn beliefen sich im Jahr 2003 auf rund 1'100 t NH3-N (berechnet nach der Methode Dynamo der SHL). Davon stammen rund 90% aus den 1'800 Bauernbetrieben des Kantons.Die landwirtschaftlichen Betriebe des Kantons Solothurn bewirtschaften rund 3,1% der gesamtschweizerischen LN und halten rund 2,6% des gesamtschweizerischen Bestands an Grossvieheinheiten.Von der Gesamtfläche des Kantons werden rund 42% landwirtschaftlich genutzt,dies bei einem durchschnittlichen Tierbesatz von ca.1 DGVE/ha LN. Dieser Tierbesatz liegt im gesamtschweizerischen Vergleich im mittleren Bereich.Mit rund 14 kg NH3-N sind die durchschnittlichen NH3-Emissionen pro ha Gesamtfläche relativ tief.Auf 22% aller Flächenquadrate von 1 km2 liegt die NH3-Deposition allein (ohne NOx) trotzdem über 20 kg N/ha,also beispielsweise über der oberen Grenze der Critical Loads für Waldökosysteme.Dass im Kanton Solothurn Überschreitungen der Critical Loads empfindlicher Ökosysteme vorkommen,hängt insbesondere mit der N-Depositionen aus weiträumigen Verfrachtungen zusammen.

■ NH3-Emissionen im Kanton Luzern Häufigkeitsverteilung der Ammoniak-Emissionen, Luzern
≤11–1011–2021–30 NH3 -Emissionen (kg N/ha und Jahr) 31–4041–50>50
Quelle: Meteotest
Akzentuierter präsentiert sich die Situation im Kanton Luzern.Die NH3-Emissionen betrugen im Jahr 2002 rund 5'300 t NH3-N.Von den NH3-Emissionen stammen 97% aus der Landwirtschaft.Die 5’800 Luzerner Bauernbetriebe bewirtschaften rund 7,4% der gesamtschweizerischen LN und halten rund 11,5% des schweizerischen Bestands an Grossvieheinheiten.Von der Gesamtfläche des Kantons werden über 54% landwirtschaftlich genutzt.Dies bei einem durchschnittlichen Tierbesatz von 1,9 DGVE/ha LN. Dieser Tierbesatz zählt zu den höchsten in der ganzen Schweiz.Weite Regionen des Kantons Luzern zählen zu den Gebieten mit hohen Emissionen.Die durchschnittlichen NH3-Emissionen pro ha Gesamtfläche betragen rund 35,5 kg N/ha.Auf 63% aller Flächenquadrate von 1 km2 liegt die NH3-Deposition über 20 kg N/ha,also beispielsweise über den Critical Loads von Waldökosystemen.
Vergleich der landwirtschaftlichen Strukturen eines durchschnittlichen Schweizerbetriebes mit den Durchschnittsbetrieben in den Kantonen Luzern und Solothurn (2000).
CHLUSO
Gesamtfläche (ha)4 129 300149 20079 100
Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha)1 072 49278 84632 868
% Landwirtschaftliche Nutzfläche an Gesamtfläche265342
Landwirtschaftsbetriebe Total70 5375 7791 806
Ø Betriebsgrösse (ha)15,213,618,2
Grossvieheinheiten (GVE)1 299 512148 99933 837
% GVE am Gesamttierbestand CH10011,52,6
Ø GVE/ha LN1,21,91,0
Quelle:BFS
■ Nitrat:Höhere Gehalte in Ackerbaugebieten
Nitrat ist äusserst gut wasserlöslich.Nitrat kann deshalb mit den versickernden Niederschlägen ins Grundwasser ausgewaschen werden.Besonders hoch sind die Nitratgehalte in einigen Gebieten im schweizerischen Mittelland.Hier liegen sie mancherorts über der Anforderung der Gewässerschutzverordnung von 25 mg/l.
Maximaler Nitratgehalt des Grundwassers nach Hauptbodennutzung 2002
Gemäss dem agrarökologischen Ziel im Bereich Nitrat müssen 2005 90% der Trinkwasserfassungen,deren Zuströmbereich von der Landwirtschaft genutzt wird,einen Nitratgehalt von unter 40 mg/l aufweisen.Erhöhte Nitratwerte im Grundwasser stammen hauptsächlich aus Einzugsgebieten,in denen der Ackerbau dominiert.In diesen Gebieten werden teilweise auch diese Werte überschritten.Unter Grünland kommt es kaum zu Nitratproblemen.Werden aus den vom Nationalen Netz zur Qualitätsbeobachtung des Grundwassers (NAQUA) repräsentativ ausgewählten Messstellen diejenigen 298 mit vorwiegend landwirtschaftlicher Nutzung im Einzugsgebiet als Grundlage genommen,ist dieses Ziel heute erfüllt.

Entwicklung der Nitratgehalte in 158 Grundwasser-Messstellen
Auch der durchschnittliche Nitratgehalt in 158 Messstellen mit langjährigen Messreihen ist zurückgegangen.Allerdings sind die Einzugsgebiete dieser Messstellen nicht ausschliesslich durch die Landwirtschaft beeinflusst.
Entwicklung des Nitratgehaltes in der Grundwasserfassung Torfmoos der Gemeinden Stetten und Niederrohrdorf / Aargau
Ein Beispiel für die Entwicklung der Nitratgehalte zeigt die Nitratganglinie der Grundwasserfassung Torfmoos der beiden Gemeinden Stetten und Niederrohrdorf im Kanton Aargau.Die Fassung nutzt ein grosses Grundwasservorkommen im Aargauer Reusstal, wobei auch ein gewisser Hangwassereinfluss vom Rohrdorferberg her eine Rolle spielt. Die Fassung liegt im Wald,das Einzugsgebiet wird jedoch mehrheitlich landwirtschaftlich genutzt (Ackerbau und Wiesland).Seit anfangs der neunziger Jahre wird jährlich eine N-Kampagne zur Sensibilisierung der Bewirtschafter durchgeführt.In einem gewissen Rahmen werden Begrünungen zur Vermeidung von Winterbrache sowie Direktund Streifenfrässaaten mit kommunalen und kantonalen Beiträgen gefördert.Die Reduktion der Nitratbelastung seit 1999 wird mehrheitlich der Umsetzung der AP 2002 zugeschrieben.
In einigen Gebieten reicht der ÖLN zur Reduktion des N-Eintrags nicht aus.Hier können regionale Programme nach Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes eingesetzt werden.Ein Beispiel ist das Nitratprojekt Wohlenschwil,Kanton Aargau.Mit der Umwandlung von Ackerland in Grünland,Einschränkungen beim Einsatz von stickstoffhaltigem Dünger,Einschränkungen in der Bodenbearbeitung und Fruchtfolge sowie Einschränkung der Freilandhaltung von Schweinen konnte der Nitratgehalt auf das gewünschte Niveau gesenkt werden.
Die Ergebnisse der Entwicklungen der verschiedenen umweltrelevanten N-Emissionen aus der Landwirtschaft zwischen 1990 und 2002 geben kein eindeutiges Bild.
Die Ammoniakemissionen haben zwischen 1990 und 2002 deutlich abgenommen.Die agrarökologischen Ziele wurden rascher als erwartet erreicht.Es zeigt sich aber,dass regional immer noch Probleme bestehen.Beim Nitrat können ebenfalls Erfolge vorgewiesen werden.Die gezielten Anstrengungen mit den Massnahmen nach Art.62a des Gewässerschutzgesetzes zeigen deutlich Wirkung.Die agrarökologischen Ziele werden voraussichtlich ebenfalls erreicht.
Das agrarökologische Etappenziel,die umweltrelevanten N-Verluste bis 2005 gegenüber 1994 um 22'000 t N/Jahr zu senken,wird verfehlt werden.Um dieses Ziel zu erreichen,sind gemäss Bericht über die Reduktion der Umweltrisiken von Düngern und Pflanzenschutzmitteln (Bundesrat) weitere Anstrengungen unerlässlich.Massnahmen im Rahmen der derzeit geltenden umweltrechtlichen und agrarpolitischen Vorschriften sind:
a)eine Düngung und Bodenbewirtschaftung namentlich in empfindlichen Gebieten nach den Bewirtschaftungspotenzialen der Standorte;
b)der Vollzug vorsorglicher Emissionsbegrenzungen nach Luftreinhalteverordnung (LRV) zur Senkung der landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen sowie kantonale Massnahmenpläne nach LRV zum Abbau übermässiger N-Belastungen.
Weitere Fortschritte können erzielt werden:
– Durch verminderten Einsatz von Stickstoff in das System Landwirtschaft.Dies würde bei sämtlichen N-Emissionen zu Verbesserungen führen.Er kann z.B.erreicht werden durch die Reduktion des Futtermittel- oder Düngerzukaufs von Betrieben oder den Einsatz von nährstoffreduziertem Futter.
– Bei gleichbleibender Produktion:Dies bedingt eine Steigerung der Effizienz des N-Einsatzes.Eine Effizienzsteigerung erzielt man insbesondere durch eine Verminderung der N-Verluste (z.B.durch entsprechende Ausbringtechniken),da dadurch mehr Stickstoff für die Produktion zur Verfügung steht und nicht von aussen zugeführt werden muss.Eine Effizienzsteigerung kann auch durch die technische Aufbereitung von Hofdüngern erzielt werden,wenn die dabei gewonnenen Düngerprodukte gezielter eingesetzt werden. – Bei Verminderung der Produktion tierischer Erzeugnisse:Dies bringt vor allem dann einen Fortschritt,wenn der Konsum dieser Produkte ebenfalls abnimmt.Ist dies nicht der Fall,werden vermehrte Importe dazu führen,dass die Emissionen einfach im Ausland anstatt in der Schweiz anfallen.
– Durch eine gleichmässigere Verteilung der Hofdünger auf die Fläche.Dadurch könnten regionale Probleme entschärft werden,an der Höhe der Gesamtemissionen würde sich dadurch allerdings nichts ändern.Eine gleichmässigere Verteilung der Hofdünger kann ebenso gut durch die bessere Verteilung der Tiere wie durch die weitgehende technische Aufbereitung von Hofdüngern erzielt werden.N- (und P-) Überschüsse könnten aus tierintensiven Gebieten weggeführt und gezielt als Mineraldüngerersatz in Ackerbaugebieten verwendet werden.
Ein wichtiges Kriterium,das darüber entscheidet,wie hoch die N-Emissionen in Zukunft sein werden,sind die Absatzmöglichkeiten für Milch,Fleisch und Pflanzenprodukte.Diese haben – nebst den Anreizen,welche durch die Direktzahlungen geschaffen werden – einen grossen Einfluss darauf,wie viele Tiere gehalten werden und wie viel Ackerbau betrieben wird.Und damit entscheidet sich auch weitgehend, wie viel Ammoniak-Emissionen anfallen und wie hoch die Nitratauswaschung ist.

Das Konzept des virtuellen Wassers erlaubt es,die Bedeutung von Wasser als politischen und ökonomischen Faktor aufzuzeigen.Damit lässt sich auf anschauliche Weise darlegen,wie lokale Wasserdefizite durch globale ökonomische Prozesse beeinflusst werden.
Der Begriff «virtuelles Wasser» bezeichnet die Menge Wasser,welche zur Produktion eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses gebraucht wird.So braucht es z.B.rund 1’000 Liter Wasser,um 1 kg Weizen oder 2’500 Liter Wasser,um 1 kg Reis zu produzieren.Für die Produktion von tierischen Nahrungsmitteln (Fleisch,Milch,Eier) wird wesentlich mehr Wasser benötigt als dies für pflanzliche Lebensmittel der Fall ist.Je nach Region und Anbau- bzw.Haltungssystem kann die erforderliche Wassermenge stark variieren.
Wasserbedarf für die Erzeugung von Nahrungsmitteln
ErzeugnisWasserbedarf in m3/kg
Rindfleisch,frisch15
Schaf-/Lammfleisch,frisch10
Geflügelfleisch,frisch6 Reis2,5 Weizen1 Mais0,7
Hirse0,5
Quellen:FAO und Barthelemy et al.
Weltweit bestehen grosse Unterschiede in der Verfügbarkeit von Wasser.Insbesondere der asiatische Kontinent ist einer grossen Belastung ausgesetzt.Dort lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung,welcher 36% der Wasserressourcen der Welt zur Verfügung stehen.Durch die Nahrungsmittelimporte importiert Asien auch viel virtuelles Wasser.Dagegen sind die Kontinente Amerika und Australien,welche im Verhältnis zur Bevölkerung über viel Wasser verfügen,Exporteure von virtuellem Wasser.
Verfügbarkeit von Wasser und virtuelle Wasserbilanz im Vergleich zur Bevölkerung
KontinentAnteil der Anteil derVirtuelle Wasserbilanz Wasserressourcen Weltbevölkerung(Importe–Exporte) der Welt
Quellen:UNESCO-WWAP und Chapagain & Hoekstra
Wasser ist eine zunehmend knappe Ressource.Annähernd eine halbe Milliarde Menschen lebt in Ländern,in denen Wasser bereits knapp ist.Bis zum Jahr 2050 wird voraussichtlich mindestens ein Viertel der Weltbevölkerung mit chronischem oder immer wiederkehrendem Wassermangel leben.
Wenn ein Land,welches unter Wassermangel leidet,Nahrungsmittel importiert statt sie selbst zu produzieren,kann dies den Druck auf das verfügbare Wasser senken. Berechnungen haben ergeben,dass z.B.Jordanien 80–90% seines gesamten InlandWasserverbrauchs durch den Import von virtuellem Wasser deckt.Im Gegenzug können Länder mit reichen Wasserressourcen virtuelles Wasser exportieren.Problematisch ist dagegen,wenn Länder mit Wassermangel landwirtschaftliche Produkte exportieren, die nur mit künstlicher Bewässerung hergestellt werden können.
Die Berücksichtigung des virtuellen Wassers in der nationalen und internationalen Politik ist eine Möglichkeit,um das Problem des Wassermangels zu vermindern.Die Überlegungen zum virtuellen Wasser führen auch zum Schluss,dass die Landwirtschaft in der wasserreichen Schweiz weiterhin einen grossen Teil des Schweizer Nahrungsmittelbedarfs decken soll.Dies setzt allerdings voraus,dass die landwirtschaftliche Nutzfläche – insbesondere die Fruchtfolgefläche – in ihrem Bestand erhalten bleibt.
Mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) soll die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere gefördert werden. Das RAUS-Programm enthält hauptsächlich Bestimmungen zum Auslauf auf der Weide bzw.im Laufhof oder im Aussenklimabereich beim Geflügel.Im BTS-Programm werden vor allem qualitative Anforderungen an den Liegebereich gestellt.Die Teilnahme an einem solchen Programm ist freiwillig.
Seit der Einführung von RAUS (1993) und BTS (1996) nahm die Beteiligung an beiden Programmen stetig zu:So hat sich die Beteiligung der Betriebe an RAUS von 1993 bis 2003 mehr als verachtfacht (von rund 4'500 auf 36‘600) und diejenige am BTS mehr als vervierfacht (von knapp 4'500 auf etwa 18‘500).

Gemessen am gesamten schweizerischen Nutztierbestand betrug der Anteil der GVE, die nach RAUS- bzw.BTS-Anforderungen gehalten wurden,1996 19% bzw.9%.Im Jahr 2003 waren es 65% bei RAUS und 34% bei BTS;diese Werte sind Durchschnittszahlen der vier Tierkategorien (Rindvieh, übrige Raufutter Verzehrer,Schweine, Geflügel).
Die Beteiligung bei RAUS nach Tierkategorie und Betrieb zeigt,dass bei Betrieben mit Rindvieh prozentual etwas weniger Tiere als Betriebe mitmachten.Bei den anderen Tierkategorien nahmen dagegen Betriebe mit überdurchschnittlich grossen Tierbeständen am RAUS-Programm teil.

Beteiligung bei BTS 2003
Die Tierbestände der Betriebe mit Geflügel, übrigen Raufutter Verzehrern sowie Schweinen,die am BTS-Programm teilnahmen,lagen noch weiter über dem Schweizer Durchschnitt als bei RAUS.Insbesondere beim Geflügel hielten 16% der Betriebe im Jahr 2003 78% der Tiere nach den BTS-Vorschriften.Beim Rindvieh war hingegen der Anteil Betriebe höher als der Anteil Tiere.
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS
Bei RAUS nahm die Beteiligung zwischen 1996 und 2003 bei allen Tierkategorien
ausser beim Geflügel – deutlich zu.Der Grund für den Rückgang beim Geflügel nach 1999 dürfte darauf zurückzuführen sein,dass die Mastpoulets mit weniger als 56 Masttagenaus dem RAUS-Programm ausgeschlossen wurden.
Beim BTS-Programm sticht die hohe Beteiligung beim Geflügel heraus.Der Hauptgrund dafür ist,dass bei vielen Labels die BTS-Anforderungen eine Grundvoraussetzung sind.Das BTS-Programm für Schweine wurde erst 1997 eingeführt.Die Entwicklung war auch dort sehr erfreulich.Gegenüber dem Einführungsjahr wurden über siebenmal mehr Schweine in BTS-Ställen gehalten.
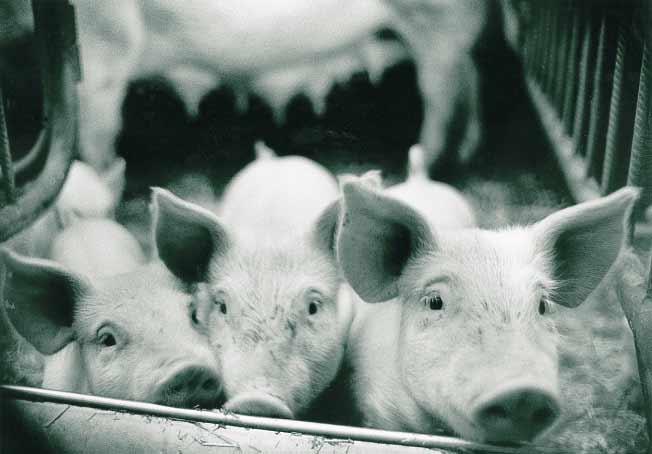
■ Ökonomie
Die Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sieht vor, dass das BLW im Agrarbericht die Resultate der Untersuchungen einer Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unterzieht.Das heisst,dass die ökonomische,soziale und ökologische Lage der Landwirtschaft und die Auswirkungen der Agrarpolitik aufgezeigt und beurteilt werden sollen.Nachfolgend wird die Beurteilung auf der Basis der heute verfügbaren Zahlen vorgenommen.Basierend auf dem im Agrarbericht 2001 vorgestellten Konzept zur Beurteilung der Nachhaltigkeit wurden im Berichtsjahr die Arbeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung von quantitativen Indikatoren weitergeführt,welche künftig zur Beurteilung der Nachhaltigkeit mit einbezogen werden sollen.
Das Jahr 2003 war wirtschaftlich vom langen und trockenen Sommer geprägt.Die Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs nahm im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre um 4% ab,während die Vorleistungen um 2% zulegten. Die Zunahme bei den Direktzahlungen um 5% konnte die Einbussen bei der Erzeugung und die Kostensteigerung nicht wettmachen.Gesamthaft resultierte ein Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors,welches mit 2,790 Mrd.Fr.um 13% tiefer war als der Durchschnittswert der drei vorangegangenen Jahre.Für das Jahr 2004 wird gemäss den Schätzungen erwartet,dass das Nettounternehmenseinkommen mit 3,153 Mrd.Fr.den Durchschnitt der Jahre 2000/02 fast wieder erreichen wird.
Die Ergebnisse der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten zeigen,dass die landwirtschaftlichen Einkommen je Betrieb in den Jahren 2001/03 um 16% tiefer sind als 1990/92.Die Fremdkosten (+18%) sind in dieser Zeitspanne stärker gestiegen als der Rohertrag (+7%).Die Reduktion der landwirtschaftlichen Einkommen in den neunziger Jahren konnte teilweise kompensiert werden durch höhere Nebeneinkommen (+20%).Die Gesamteinkommen der Jahre 2000/02 liegen damit 8% unter dem Niveau der Jahre 1990/92.Die Investitionen und die Fremdkapitalquote sind dagegen praktisch auf dem gleichen Stand wie 1990/92.
Wie Anfang der neunziger Jahre gibt es Betriebe,deren langfristige Existenz gefährdet ist.Im Durchschnitt der Jahre 2001/03 war die finanzielle Situation bei 38% der Betriebe ungenügend für die langfristige Sicherung der betrieblichen Existenz. 1990/92 war dies bei 22% der Betriebe der Fall.
Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Lage im Durchschnitt der Betriebe gegenüber dem Beginn der neunziger Jahre verschlechtert.Wie damals gibt es grosse Unterschiede zwischen den Betrieben.Das Gesamteinkommen der Betriebe im vierten Quartil (25% der Betriebe mit den besten Ergebnissen) ist mehr als doppelt so hoch wie dasjenige der Betriebe im ersten Quartil.Die Differenz in absoluten Zahlen ist in diesem Zeitraum nur unwesentlich grösser geworden.Wie zu Beginn der neunziger Jahre übertrifft der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft der Betriebe im vierten Quartil den Vergleichslohn.
Ein Vergleich bezüglich Einkommen und Verbrauch zwischen Voll-,Zu- und Nebenerwerbsbetrieben zeigt,dass die Gesamteinkommen der drei Erwerbsformen nicht so weit auseinander liegen,wie es die Unterschiede beim landwirtschaftlichen Einkommen vermuten liessen.Die Vollerwerbsbetriebe erwirtschaften mit 80'000 Fr.die höchsten Gesamteinkommen,die Zuerwerbsbetriebe folgen mit gut 74'000 Fr.und die Nebenerwerbsbetriebe schliesslich mit 67'000 Fr.Die Unterschiede sind damit beim Gesamteinkommen fast fünf Mal kleiner als beim landwirtschaftlichen Einkommen. Den Nebenerwerbsbetrieben gelingt es,mit der ausserlandwirtschaftlichen Tätigkeit, das grosse Defizit beim landwirtschaftlichen Einkommen zu einem beträchtlichen Teil wettzumachen.Nebenerwerbsbetriebe können trotz durchschnittlich tieferem Gesamteinkommen ökonomisch stabile Einheiten sein.So ist der Privatverbrauch ungeachtet der Erwerbsform im Durchschnitt praktisch gleich hoch.Die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sind bei allen Betriebsformen im Mittel gleich alt.Auch dies ist ein Hinweis,dass alle Erwerbsformen attraktiv sein können.
2003 lag das für die landwirtschaftlichen Haushalte massgebende durchschnittliche Gesamteinkommen mit 76'200 Fr.knapp 2% über jenem der Jahre 2000/02.Der Privatverbrauch nahm hingegen im Jahr 2003 im Vergleich zum Wert des Dreijahresmittels 2000/02 etwas ab (–0,5%) und betrug 62'900 Fr.
Die Einkommensresultate der Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE) des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahre 2002 zeigen,dass das Haushaltseinkommen der bäuerlichen Haushalte unter Berücksichtigung der Haushaltsgrösse deutlich niedriger ist als jenes der Vergleichshaushalte.Entsprechend den niedrigen Einkommen der bäuerlichen Haushalte sind auch ihre Ausgaben geringer als jene der Vergleichshaushalte.Ein Teil der Ausgabendifferenz kann durch die Besonderheiten der bäuerlichen Haushalte – wie günstiges Wohnen,Eigenversorgung aus Stall und Garten,kein langer Arbeitsweg und keine Ausserhausverpflegung am Mittag – erklärt werden.Zudem sind auch die Transferausgaben (Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) aufgrund der niedrigeren Einkommen der bäuerlichen Haushalte tiefer.
In verschiedenen Kantonen (VD,FR,ZH,BE,VS,AR,TG,SG,LU,NW und NE) bestehen zum Teil seit Jahren staatliche oder private Angebote für Bauernfamilien in Schwierigkeiten.Diese Angebote bauen in den meisten Fällen auf bestehenden Organisationsstrukturen und Fachkompetenzen auf.Ein wesentliches Element ist die Vernetzung der Kompetenzen und/oder Organisationen.So profitiert etwa die bäuerliche Beratung von den Fachkompetenzen eines Psychiaters und umgekehrt Verantwortliche von Sozialdiensten von den Kenntnissen der bäuerlichen Berater und Beraterinnen über die Besonderheiten des bäuerlichen Familien- und Arbeitsalltags.Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Beratungsangebote haben gezeigt,dass diese Angebote eine wertvolle Unterstützung in der Zeit des Umbruchs in der Landwirtschaft darstellen. Damit eine sozialverträgliche Entwicklung in der Landwirtschaft gewährleistet werden kann,ist es sinnvoll,wenn die eingesetzten Ressourcen auch diese Fälle abdecken und sich nicht nur auf die zukunftsfähigen Betriebe konzentrieren.
Die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft haben 2003 im Vergleich zum Vorjahr weiter zugenommen.Im Jahr 2003 gab es im Talgebiet (Ackerbauzonen und Hügelzone) 50'100 ha beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen,3% mehr als 2002.Die Biobetriebe bewirtschafteten im Jahr 2003 total 10,4% der LN im Vergleich zu 9,7% im Jahr 2002.Gegenüber 61% im Vorjahr wurden 2003 65% der GVE nach den Regeln des RAUS-Programms gehalten.34% der GVE wurden gemäss Bestimmungen des BTS-Programms gehalten,was gegenüber 2002 einer Zunahme von 4 Prozentpunkten entspricht.
Die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft gingen seit Beginn der neunziger Jahre bis 1998 stark zurück.Seither ist eine Stabilisierung sowohl beim Mineraldüngerwie auch beim Pflanzenschutzmitteleinsatz eingetreten.
Bezüglich der Entwicklung der verschiedenen umweltrelevanten N-Emissionen aus der Landwirtschaft zwischen 1990 und 2002 ergibt sich kein einheitliches Bild:Die Ammoniakemissionen haben in dieser Zeit deutlich abgenommen,das entsprechende agrarökologische Ziel konnte bereits erreicht werden.Regional bestehen allerdings immer noch Probleme.Die Ziele beim Nitrat dürften voraussichtlich ebenfalls erreicht werden,die gezielten Massnahmen nach Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes zeigen deutlich Wirkung.

Das Etappenziel,die umweltrelevanten N-Verluste bis 2005 gegenüber 1994 um 22'000 t N/Jahr zu senken,dürfte verfehlt werden.Weitere Anstrengungen sind deshalb unerlässlich.Im Rahmen der geltenden umweltrechtlichen und agrarpolitischen Vorschriften stehen folgende Massnahmen im Vordergrund:Düngung und Bodenbewirtschaftung namentlich in empfindlichen Gebieten nach den Bewirtschaftungspotenzialen der Standorte,Vollzug vorsorglicher Emissionsbegrenzungen nach Luftreinhalteverordnung zur Senkung der landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen sowie kantonale Massnahmenpläne nach Luftreinhalteverordnung zum Abbau übermässiger N-Belastungen.Weitere Fortschritte können erzielt werden, indem dem System Landwirtschaft weniger Stickstoff zugeführt wird.Dies könnte erreicht werden durch eine Verbesserung der Effizienz des N-Einsatzes bei gleichbleibender Produktion (z.B.durch bessere Ausbringtechniken) oder eine Reduktion der Produktion und des Konsums tierischer Produkte.Zur Entschärfung regionaler Probleme ist auch eine gleichmässigere Verteilung der Hofdünger auf die Fläche denkbar. Ansatzpunkte dafür sind die bessere Verteilung der Tiere oder die technische Aufbereitung von Hofdüngern.
Eine entscheidende Umweltressource für die Landwirtschaft ist das Wasser,das in einigen Regionen auf dem Globus bereits knapp ist.Für die Zukunft wird eine weitere Verknappung erwartet.Der Begriff des virtuellen Wassers bezeichnet die Menge Wasser,welche zur Produktion eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses gebraucht wird.Für die Produktion von tierischen Nahrungsmitteln wird wesentlich mehr Wasser benötigt als für die Herstellung pflanzlicher Lebensmittel.Der Handel mit Nahrungsmitteln ermöglicht es,Defizite in wasserarmen Regionen auszugleichen.Für die Schweiz als wasserreiches Land macht es auf Grund dieser Betrachtungsweise Sinn, Nahrungsmittel selber zu produzieren und nur eine begrenzte Menge zusätzliches Wasser in der Form von Nahrungsmitteln – unter Umständen aus wasserarmen –Regionen zu importieren.

Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln.Das Gesetz gibt vor,dass die Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz innerhalb von fünf Jahren nach In-Kraft-Treten gegenüber den Ausgaben 1998 um einen Drittel abgebaut werden müssen.Im Jahr 2003 können für diese Massnahmen noch rund 800 Mio.Fr.eingesetzt werden.
Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab.Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht,weil dafür kein Markt besteht.Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher,dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden.
– Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte,sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion.Im einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung,im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz.
Artikel 7 LwG beschreibt die Zielsetzungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse.Die Landwirtschaft soll nachhaltig und kostengünstig produzieren und aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen können.Dazu stehen die Massnahmen in den Bereichen Qualität,Absatzförderung und Kennzeichnung,Ein- und Ausfuhr,Milchwirtschaft,Viehwirtschaft,Pflanzenbau und Weinwirtschaft zur Verfügung.

■ Finanzielle Mittel 2003
Im Jahr 2003 sind zur Förderung von Produktion und Absatz rund 798 Mio.Fr.eingesetzt worden.Gegenüber dem Vorjahr sind dies rund 28 Mio.Fr.oder 3% weniger Ausgaben.

Ausgaben für Produktion und Absatz
Rechnung 2003Budget 2004
AusgabenbereichBetragAnteilBetragAnteil Mio.Fr.%Mio.Fr.%
Absatzförderung597,4648,5
Milchwirtschaft56070,250467,0
Viehwirtschaft253,1405,4 Pflanzenbau (inkl.Weinbau)15419,314419,1
Total798100751100
Quellen:Staatsrechnung,BLW
■ Ausblick
Mit dem 2.Entlastungsprogramm muss ab 2005 mit weiteren Budgetkürzungen gerechnet werden.
■ Durch Unterstützung der Branchenorganisationen gemeinsames Handeln fördern
Die Branchen- und Produzentenorganisationen spielen für die Unternehmen des Ernährungssektors eine wichtige Rolle als Diskussions-,Verhandlungs- und Koordinationsplattform.Vor dem Hintergrund der Liberalisierung der Agrarmärkte und des Abbaus der öffentlichen Ausgaben ist eine Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit schweizerischer Agrarerzeugnisse von zentraler Bedeutung.Die Beschlüsse über den Marketing-Mix der Produkte und bestimmte Regeln des Marktgeschehens sollen zu kohärenten Kollektivlösungen verhelfen.Dank der Zusammenlegung der Ressourcen, die auf einzelbetrieblicher Ebene oft begrenzt sind,stehen ferner auf kollektiver Stufe effiziente Dienstleistungen zur Verfügung (Marktbeobachtung,Qualitätskontrolle, Information,Unternehmensberatung usw.)
Im Rahmen der Landwirtschaftsgesetzgebung (Artikel 8 und 9) kann der Bundesrat die von Branchen- und Produzentenorganisationen gemeinschaftlich beschlossenen Massnahmen zur Qualitätsverbesserung,Absatzförderung und Anpassung des Angebots an die Nachfrage auch für Nichtmitglieder verbindlich erklären.Hierbei wird von «Ausdehnung» gemeinschaftlicher Massnahmen gesprochen.Die Unterstützung des Bundesrates wird für Massnahmen zu Gunsten eines gesamten Sektors oder einer gesamten Branche gewährt,von denen nicht nur die Mitglieder einer Organisation profitieren (Problem der «Trittbrettfahrer»).Ohne Eingreifen des Bundesrates würden Unternehmen,die sich nicht an den Massnahmen beteiligen,aber dennoch davon profitieren,schnell jegliche gemeinschaftliche Initiative unterbinden.Mit seinem Einschreiten fördert der Bundesrat die Bündelung der Kräfte.
■ Ausdehnung ist an strenge Auflagen geknüpft
Die Anforderungen,die für eine Ausdehnung durch den Bundesrat erfüllt sein müssen, sind strikt:(1) Die Massnahmen müssen durch Unternehmen gefährdet sein,die von diesen zwar profitieren,aber sie nicht anwenden oder sich nicht an deren Finanzierung beteiligen;(2) die Organisation darf selbst keine Handelstätigkeit ausüben;(3) sie muss repräsentativ sein und (4) die Massnahmen mit grosser Mehrheit ihrer Mitglieder verabschiedet haben.Die Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen enthält die Durchführungsbestimmungen.Die Auflagen an die Repräsentativität der Organisationen und ihr Entscheidverfahren sind besonders streng:Die Beschlüsse müssen von den Delegiertenversammlungen mit Zweidrittelmehrheiten gefällt werden, wobei die Wahl der Delegierten demokratisch durch die Basis zu erfolgen hat.Im Falle einer Branchenorganisation sind die Beschlüsse mit Zweitdrittelmehrheit der Delegierten auf jeder Stufe der Branche zu fassen.Mit diesen Anforderungen legt der Bundesrat ein besonderes Gewicht auf die Legitimität und Transparenz der Organisationen.Im Weiteren müssen die Massnahmen,für die eine Ausdehnung beantragt wird,zwingend im Interesse aller Betriebe eines Sektors oder einer Branche sein und dürfen zu keinen Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Marktakteuren führen.
Per 1.Januar 2004 hat der Bundesrat beschlossen,die von drei Produzentenorganisationen (Schweizerischer Bauernverband,Schweizer Milchproduzenten,GalloSuisse) und vier Branchenorganisationen (Interprofession du Gruyère,Interprofession du Vacherin fribourgeois,Emmentaler Switzerland,Sbrinz GmbH) vereinbarten Massnahmen auf alle betroffenen Betriebe auszudehnen.Die meisten dieser Massnahmen haben die Finanzierung der gemeinschaftlichen Absatzförderung zum Gegenstand.
Die von einer vom Bundesrat beschlossenen Ausdehnung profitierenden Organisationen müssen dem Volkswirtschaftsdepartement einen Bericht über die Durchführung und Wirkung der Massnahmen liefern.Das Finanzinspektorat des BLW nimmt ebenfalls Kontrollen vor,damit gewährleistet ist,dass die von Nichtmitgliedern erhobenen Beiträge auch tatsächlich für die vorgesehenen gemeinschaftlichen Massnahmen verwendet werden.
Ausschlaggebend für den Erfolg des Agrarmarketings ist ein ausgewogener und auf den Zielmarkt zugeschnittener Marketing-Mix,der professionell umgesetzt wird.Produkt-, Sortiments- und Qualitätsmanagement,Preisgestaltung und Distribution sowie die Kommunikation sind aufeinander abgestimmt einzusetzen.
Mit der Absatzförderung nach Artikel 12 des LwG werden aus dem gesamten Spektrum aber nur die Kommunikationsaufgaben und teilweise die Marktforschung unterstützt. Dies ist damit zu begründen,dass der Bund sich nicht in die intrasektoralen Konkurrenzbeziehungen einmischen will,um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.Der gewählte Ansatz der Gemeinschaftskommunikation hat aber zur Folge,dass meistens bäuerliche Organisationen in den Genuss von Finanzhilfen kommen.Diese bestimmen in der Regel nicht über den gesamten Marketing-Mix und sind selbst nicht direkt am Markt tätig.
Die Absatzförderung ist föderalistisch organisiert und wird nach dem Subsidiaritätsprinzip unterstützt.Dieser Ansatz fördert die Selbstorganisation und Selbstverantwortung der einzelnen Akteure.Die Organisationen müssen die strategische und operative Verantwortung für Vorhaben übernehmen und mindestens die Hälfte der Kosten tragen.Mit diesem Vorgehen sind sie fachlich wie auch organisatorisch gefordert.Ein Imageaufbau für die Schweizer Landwirtschaft kann nur breit abgestützt und durch eine klar strukturierte Kommunikation,vergleichbar mit einem Unternehmen,erreicht werden.
Eine produzierende Landwirtschaft hat im aktuellen Verdrängungsmarkt Aufgaben zur Information über die gemeinsame Leistung der Landwirtschaft bis zur Kommunikation über das einzelne Produkt zu bewältigen.Dazu braucht es eine verbindliche Koordination in der gesamten schweizerischen Landwirtschaft.Der Bund übernimmt hier über die Finanzhilfe eine wesentliche Rolle.Absatzförderungsprojekte werden nur unterstützt,wenn sie zumindest innerhalb der Produkt-Marktbereiche und besser über diese Grenzen koordiniert sind.Damit sind bereits für mehrere Bereiche wie beispielsweise für Bioprodukte,Eier und Rapsöl gemeinsame Kommunikationsauftritte erreicht worden.Positionierungen gegenüber den Importprodukten werden so gezielt und wirksam umgesetzt.
■ Künftige Ausrichtung
Die Absatzförderung ist WTO-konform und in der liberalisierten Landwirtschaft ein wichtiges Instrument.Mit dem Subsidiaritätsprinzip entstehen jedoch unterschiedliche Marketingkonzepte mit einem geringen übergreifenden Zusammenhang.Die Absatzförderung des Bundes wirkt dem entgegen.Bei Kommunikationsprojekten ist auch in Zukunft besonders darauf hinzuwirken,dass die Kommunikationsinhalte mit den weiteren Massnahmen der betroffenen Marktpartner und Firmen abgestimmt werden.
In Bezug auf den heterogenen Auftritt der Schweizer Landwirtschaftsprodukte verspricht sich das BLW einiges vom neuen Herkunftszeichen «Suisse Garantie».Dieses könnte die Grundlage für eine einheitlichere Kommunikation bilden.Dazu beitragen könnten auch sogenannte «Positivdeklarationen»,die es erlauben würden,die Vorteile von einheimischen Produkten gegenüber Importware hervorzuheben.Das Parlament debattiert derzeit darüber im Rahmen der Parlamentarischen Initiative Ehrler:«Nahrungsmittel – Kenzeichnung von besonderen Eigenschaften aufgrund der schweizerischen Gesetzgebung».
Die Förderung und Aufrechterhaltung der Professionalität der Finanzhilfeempfänger ist eine Daueraufgabe.Das BLW hat entsprechende Anforderungen an die Ausbildung der Projektverantwortlichen festgelegt und prüft bei der Gesuchseingabe auch die Qualität der Marketingkonzeption.Zudem werden ab 2005 neue,präzise Anforderungen an das Marketingcontrolling festgelegt.
Im Rahmen dieses Instrumentariums sind auch weitergehende gemeinsame Initiativen, wie im Bereich der Exportförderung und der Vermarktung von regionalen Spezialitäten notwendig.Solche Aufgaben sollten einer schlagkräftigen Organisation übertragen werden können,die dazu auch die Führungsrolle übernimmt.Das BLW prüft deshalb, ob nicht ein Teil der Bundesmittel für solche gemeinsamen Massnahmen bzw.eine solche Organisation (in Art.12 Abs.3 LwG als gesetzliche Grundlage) reserviert werden müssten.
■ Ergänzungen in der Absatzförderung 2004
Die landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung wurde auf 2004 mit den Bestimmungen zum Wein und im Bereich der regionalen Absatzförderung ergänzt.
Neu kann der Absatz von Wein auch im Inland unterstützt werden.Damit ist der Wein den übrigen Landwirtschaftsprodukten gleichgestellt.Das Ziel der Finanzhilfe ist nicht, den Weinkonsum zu steigern,sondern das Image und damit die Präferenz für die einheimischen Produkte zu verbessern.In der regionalen Absatzförderung werden Projekte während einer Konsolidierungsphase für weitere vier Jahre,jedoch mit einem reduzierten Finanzierungsanteil des Bundes,unterstützt.Zudem wird,als wichtige Erneuerung,die Finanzhilfe an überregionale Vorhaben im Interesse regionaler Spezialitäten explizit möglich.Damit die Synergien genutzt und die Kosten,insbesondere die Kommunikationskosten,gesenkt werden können,ist die Absprache unter den Gesuchstellenden bereits während dem Gesuchsverfahren unerlässlich.Das BLW organisierte zu diesem Zweck seit anfangs 2004 mehrere Veranstaltungen.
Das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB/AOC) und geografischen Angaben (GGA/IGP) existiert seit 1997.Es handelt sich um ein Instrument des geistigen Eigentums,das die geografischen Namen der traditionellen landwirtschaftlichen Erzeugnisse (ausgenommen Wein) schützt.2003 wurden die drei AOC Vacherin Mont d’Or,Abricotine und Cardon épineux genevois sowie die zwei IGP Walliser Trockenfleisch und Saucisse neuchâteloise/Saucisson neuchâtelois in das Bundesregister eingetragen.Am 31.Dezember 2003 zählte das Register 14 Eintragungen und für 18 Gesuche um Anerkennung einer AOC bzw.IGP lief ein Registrierungsverfahren.
AOC/IGP-Register am 31.Dezember 2003
AnzahlAnzahltt
Käse
L’EtivazAOC681270290OIC
GruyèreAOC3 10525925 12025 119OIC
SbrinzAOC24135--Procert
Tête de MoineAOC2589--OIC
Formaggio d’alpe TicineseAOC14---OIC Vacherin Mont d’OrAOC24211-592OIC
Fleischwaren
BündnerfleischIGP-11645658Procert
Saucisse d’AjoieIGP-14--OIC Walliser TrockenfleischIGP-53--OIC
Saucisse neuchâteloise / Saucisson neuchâtelois IGP-18--OIC
Spirituosen
Eau-de-vie de poire du ValaisAOC4197 OIC
Abricotine
Andere Erzeugnisse
AOC2223-OIC
Rheintaler RibelAOC1122728Procert
Cardon épineux genevoisAOC96-38
Total4589429--
Quelle:BLW

■ Beschwerdeverfahren
Mit sechs als AOC geschützten Bezeichnungen ist die Kategorie der Käse hinsichtlich der betroffenen Landwirtschaftsbetriebe die wichtigste:Milch von über 4000 Schweizer Milchbetrieben wird zu Käse mit einer AOC verarbeitet.Als AOC anerkannt werden nur Käse,deren typische Eigenschaften auf das Produktionsgebiet zurückzuführen sind. Auf Grund der schweizerischen Käsetradition konnten diesbezüglich fünf Kriterien aufgestellt werden:
–Die zur Herstellung von Käse bestimmte Milch muss von Kühen stammen,die keine Silage,sondern nur Gras oder Heu und Nahrungsergänzungen verzehren.
–Die Frischmilch wird innerhalb von weniger als 24 Stunden zu Käse verarbeitet.
–Die Käse werden aus Rohmilch hergestellt mit Ausnahme des Vacherin Mont d’Or, bei dem die Milch thermisiert wird.
–Es sind keine Zusatzstoffe in den Käsen zugelassen und nur traditionelle Milchkulturen dürfen verwendet werden.
–Eine Mindestreifezeit gewährleistet,dass die Käse ihr organoleptisches Potential entwickeln.
Diese Kriterien gehören zu den Schlüsselelementen der typischen Eigenschaften der Schweizer Käse,deren weltweiter Ruf sich darauf gründet.
Mit ihrem ersten Entscheid in Sachen AOC hat die Rekurskommission des EVD (REKO EVD) die Verfügung auf Eintragung von Walliser Roggenbrot bestätigt.Die in einer demoskopischen Umfrage ermittelte Konsumentenmeinung spielt eine zentrale Rolle bei der Feststellung,ob sich eine Herkunftsbezeichnung in eine Gattungsbezeichnung umgewandelt hat oder nicht.Die Konsumentinnen und Konsumenten verbinden das Walliser Roggenbrot mit dem Kanton Wallis.Demzufolge handelt es sich bei Walliser Roggenbrot nicht um eine Gattungsbezeichnung.Da der Entscheid vor Bundesgericht nicht angefochten wurde,konnte das BLW die Bezeichnung Walliser Roggenbrot 2004 als AOC eintragen.
■ Differenzierte Massnahmen zur Einfuhrregelung
Zur Unterstützung einer produktiven Landwirtschaft werden Einfuhren von Agrarerzeugnissen mit geeigneten zolltarifarischen Massnahmen gesteuert.Einfuhrzölle werden auf zwei Arten als Steuerungsinstrument eingesetzt:Beim Schwellenpreis,der im Bereich der Futtermittel Anwendung findet,wird mit variablen Zollansätzen ein Importpreis in einer bestimmten Bandbreite erreicht.Bei anderen Agrarprodukten sind Zollkontingente festgelegt.Die Einfuhrmengen,die zum tiefen Kontingentszollansatz eingeführt werden dürfen,sind beschränkt.Einfuhren ausserhalb des Zollkontingents sind möglich,werden aber mit wesentlich höheren Zöllen belastet.
Die administrativen Verfahren der Einfuhrregelungen sollen möglichst einfach sein.Die einfachste zolltarifarische Massnahme wäre die Festlegung eines Einheitszolls für jedes Erzeugnis.Ein einheitlicher Zoll gewährt zwar der inländischen Produktion einen gewissen Schutz,lässt aber ansonsten die Kräfte des Marktes spielen.Bei der Festlegung des Einheitszolls stehen jedoch bezüglich seiner Höhe und der Umsetzung des Systemwechsels in Bezug auf die internationalen Vereinbarungen noch Fragen offen. Zudem ist das Instrument nur bedingt geeignet,der Saisonalität von gewissen Erzeugnissen Rechnung zu tragen.Aus diesen Gründen werden zur Zeit überwiegend Zollkontingente als Instrument zur Steuerung der Einfuhren verwendet.
Mit Ausnahme des Windhundverfahrens an der Grenze ist das BLW zuständig für die zeitliche und mengenmässige Verteilung der Zollkontingente.Vermehrt werden Zollkontingentsanteileversteigert.Die Versteigerung ist ein ökonomisch sinnvolles Verfahren und kann auch Hinweise liefern,wie hoch ein Einheitszoll sein sollte im Falle einer Abschaffung des Zollkontingents.Ausschreibungen von Versteigerungen und die Zuteilungen werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.Die Möglichkeit,Gebote in einem geschützten Bereich des Internets einzugeben,ist vorbereitet.
Da die Verwaltung der individuellen Zollkontingentsanteile in Zukunft bereits an der Grenze vollzogen werden soll und nicht mehr nachträglich durch das BLW aufgrund der Einfuhrdaten,wird das Zuteilungskriterium «Inlandleistung Zug um Zug» abgeschafft.Diese Art der Zuteilung erlaubt es nämlich nicht,den Zollkontingentsanteil vor der Verzollung zuzuteilen,sondern erst,nachdem der Importeur seine im Inland übernommene Ware der entsprechenden Periode angemeldet hat.
Einen detaillierten Überblick über alle Zuteilungsverfahren von Zollkontingenten,den zugeteilten Mengen und deren Ausnützung durch die Importfirmen bietet der Separatdruck zum Bericht des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen «Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente»,der auf der Internetseite des BLW unter «Rubriken > Import» eingesehen werden kann.
Die einfachsten Verfahren zur Zuteilung von Zollkontingenten sind die Zuteilung entsprechend der Reihenfolge der Verzollung («Windhundverfahren an der Grenze»), und diejenige entsprechend der Reihenfolge des Eingangs der Gesuche («Windhundverfahren an der Bewilligungsstelle»).Aber auch diese Verfahren können Hürden enthalten,die im folgenden Abschnitt mit einem Vergleich der Abläufe in der EU und der Schweiz erläutert werden.
■ Sind Windhundverfahren einfach und schnell?

Für die Zuteilung von Zollkontingenten wendet die Schweiz u.a.zwei so genannte Windhundverfahren an.Das «Windhundverfahren an der Grenze» wird durch die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) vollzogen.So wird z.B.das Zollkontingent für Konsumeier entsprechend der Reihenfolge der Verzollung verteilt.Die aktuelle Ausnützung ist im Internet einsehbar.Voraussetzung ist die elektronische Verzollung. Zudem braucht es eine Generaleinfuhrbewilligung (GEB) des BLW für Konsumeier. Einzige Voraussetzung für eine GEB ist in der Regel,dass die natürliche oder juristische Person im schweizerischen Zollgebiet Wohnsitz bzw.einen Sitz hat.Eine GEB ist kostenlos und unbefristet gültig,braucht also nicht periodisch oder gar bei jedem Import neu beantragt zu werden.
Beim «Windhundverfahren an der Bewilligungsstelle» werden Zollkontingentsanteile auf Gesuch hin vom BLW an die Inhaber einer GEB verteilt.Solange das Zollkontingent nicht aufgebraucht ist,erhalten die Antragsteller die gewünschte Menge zugeteilt. Damit nicht Einzelne das ganze Zollkontingent beanspruchen können,wird eine Maximalmenge pro Gesuch festgelegt und zugleich die Importzeit beschränkt. Dadurch besteht die Möglichkeit,ungenutzte Anteile später erneut zuzuteilen.Darüber hinaus wird denjenigen Gesuchstellern im Folgejahr die Zuteilung gekürzt,die bei Kontingenten mit Nachfrageüberhang ihre zugeteilte Menge zu weniger als 90% ausnützen.Finanziert wird das System durch Verwaltungsgebühren,die erst nach dem Import in Rechnung gestellt werden.
Anders ist der Ablauf eines vergleichbaren Verfahrens in der EU geregelt.Für Käse beispielsweise ist das so genannte Lizenzverfahren in der «Verordnung (EG) Nr.2535/2001 der Kommission vom 14.Dezember 2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr.1255/1999 des Rates zur Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröffnung der betreffenden Zollkontingente» festgelegt.Das Verfahren ist nicht nur komplizierter,weil sowohl die Zulassungsstellen der Mitgliedstaaten als auch die EU-Kommission am Vollzug beteiligt sind,sondern es enthält vor allem viel mehr Auflagen für die Importeure,die an einem Zollkontingentsanteil interessiert sind.Die EU kennt zwar ebenfalls ein Windhundverfahren,das jedoch im Vergleich zum Lizenzverfahren keine wesentlichen administrativen Erleichterungen bringt.
Vergleich eines Windhundverfahrens der Schweiz mit dem Lizenzverfahren der EU
Import in die Schweiz 1
BLW erteilt GEB auf Gesuch hin 2
Import in die EU
Zulassungsnummer wird erteilt,wenn Zulassungsverfahren erfolgreich
Voraussetzungen für Importeur
Sitz in Zollgebiet CH
Für ganze Produktgruppe,z.B.Käse
Unbefristete GEB-Erteilung
GEB-Gesuche immer möglich
Handelsregistereintrag nicht zwingend –für Zuteilung jedoch z.T.Nachweis der gewerbsmässigen Einfuhr entsprechender Waren erforderlich
Verteilung ein Mal pro Jahr,ohne Unterbruch, solange ZK nicht ausgeschöpft
Unbegrenzte Anzahl Anträge.Einreichung frühestens am 1.Werktag im Dezember für Folgejahr
Teilweise nach oben begrenzt pro Gesuch, kein Minimum
Keine Verpflichtung in Bezug auf Wert der Ware
Keine Kaution
Sitz in EU
Nur für 1 Erzeugnis gültig
Zulassung befristet auf 1 Jahr
Zulassung nur per 1.Juli
Nachweis «Händlerberuf» und «regelmässige Tätigkeit» (bereits im Vorjahr Import/Export gleicher Erzeugnisse,Mindestanzahl und -menge sind festgelegt),dazu Betriebsführungsunterlagen und je nach Land Registereintrag und Umsatzsteuernummer
Verteilung in 2 Halbjahrestranchen,mit je 10 Tagen Zeit für Einreichung der Anträge
Nur 1 Antrag pro Zollkontingent und Semester zulässig (Widerhandlung strafbar,führt zu Entzug aller Anteile)
Maximal 10% des Zollkontingents 3,mindestens 10 t
Verpflichtung zur Einhaltung Mindestwert
Vorherige Bezahlung einer Sicherheit 35 EUR/100 kg netto (Kaution)
Zulassungsstellen der Länder müssen fristgerecht alle Gesuche an EU-Kommission einreichen
1Für
2
BLW kürzt nur Gesuche des Tages, an dem Nachfrage Zollkontingentsmenge überschreitet,proportional
Je nach Produkt 3 Monate bis ganzes Jahr
Recht zur Ausnützung übertragbar an andere GEB-Inhaber mit Meldung an BLW
Warenbescheinigung + Ursprungsnachweis erforderlich
Kommission verteilt Einfuhrlizenzen an Mitgliedstaaten aufgrund eingereichter Gesuche,proportionale Kürzung aller Gesuche bei Nachfrageüberhang
150 Tage gültig nach Erteilung durch Zulassungsstelle des Mitgliedstaates,jedoch maximal bis Ende Kalenderjahr
Zuteilung übertragbar an Zugelassene mit Meldung an Zulassungsstelle
Warenbescheinigung + Ursprungsnachweis erforderlich
3
das Schweizer Verfahren «Windhund an der Grenze» ist ausser der GEB keine Bewilligung nötig.
Bewilligungsstelle der Schweiz ist immer das BLW.In der EU hat jeder Mitgliedstaat eine Zulassungsstelle. Informationen zu den Bewilligungsstellen der EU sind auf der Internetseite des BLW unter Rubriken > Export zu finden.
Diese maximale Begrenzung ist auf Intervention der Schweiz ab der 2.Zuteilung 2004 nicht mehr in Kraft.
Im Berichtsjahr verzeichneten die Ausfuhren von landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten mit einer mengenmässigen Zunahme von rund 8% einen erfreulichen Aufschwung.
Mit einer Steigerung von über 14% gegenüber 2002 (+30% seit 2001) haben die Mehlmischungen und die ungebackenen Teige zur Zubereitung von Brot,Backwaren und Zuckerbäckerwaren am Meisten zum Erfolg beigetragen.«Schokolade und andere kakaohaltige Nahrungsmittel» sind schon seit 2001 rückläufig und verzeichneten mit –6% gegenüber dem Vorjahr eine erneute Abnahme.Die zuckerlosen Bonbons und Kaugummi (+18% gegenüber 2002) sowie Fonduemischungen (+7% gegenüber 2002) sind die wichtigsten Vertreter und auch Gewinner der Produktegruppe «Nahrungsmittelzubereitungen».In derselben Gruppe gehören die Sportlerergänzungsnahrungen mit rund –11% zu den Verlierern.
Der Anteil Butter,welcher im Veredlungsverkehr ein- und ausgeführt wurde,reduzierte sich um die Hälfte auf noch 500 t.Zudem haben die Ausfuhren von Kondensmilch in Verarbeitungsprodukten um über 40% abgenommen.Demgegenüber wurde annähernd die doppelte Menge Frischmilch in Verarbeitungsprodukten ausgeführt.Offensichtlich wurde in der Produktion Kondensmilch zumindest teilweise durch Frischmilch ersetzt.
Das Parlament hat mit einem Nachtragskredit das anfänglich auf 100 Mio.Fr.gekürzte Budget wieder auf den WTO-Plafonds von 114,9 Mio.Fr.aufgestockt.Dieser Betrag wurde erneut voll ausgeschöpft.

■ Ein- und Ausfuhr von Verarbeitungsprodukten (Schoggigesetz)
Anmerkung: In den Ausfuhrmengen sind Butter, Hartweizengriess und Zucker, welche im Veredlungsverkehr ein- und ausgeführt wurden, ebenfalls enthalten.
Quellen: EZV, BLW
Am 25.November 2002 wurden in Brüssel die Verhandlungen über das neue Protokoll Nr.2 zum Freihandelsabkommen von 1972 abgeschlossen.Im Laufe des Berichtsjahres fanden zwei weitere Gespräche zur Klärung verschiedener technischer Einzelheiten statt.Dabei ging es in erster Linie um Fragen der technischen Umsetzung.Beide Partner sind bereit,das Abkommen im Rahmen der anderen Dossiers der «Bilateralen II» zu unterzeichnen.
2003/04
Nach dem schwierigen Jahr 2002 mit zahlreichen Betriebsschliessungen im Käsereiund Molkereisektor,zu hohen Käselagern,Marktanteilsverlusten auf ausländischen Käsemärkten sowie entsprechend gestiegenen Butter- und Milchpulverbeständen hat sich der Milchmarkt im Berichtsjahr wieder etwas erholt.Geringfügig tiefere Milcheinlieferungen sowie Zunahmen bei der Produktion von Frischmilchprodukten trugen zur Stabilisierung bei.
1nur für bestimmte Verwendungszwecke
2nur bei Importverzicht
3nur für Ausfuhren in andere Länder als EU und nach Käsesorte differenziert
4nicht für Konsummilch
Gegenüber 2002 fiel der Produzentenpreis für Milch um knapp 3 Rp.je kg auf rund 75.5 Rp.je kg.Die Preise für Käserei- und Biomilch sanken dabei etwas stärker als jener für Industriemilch.Die Stützungsmassnahmen sind mit den Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage schwerpunktmässig weiterhin auf den Käse ausgerichtet.Der vom Zahlungsrahmen her gegebene Stützungsabbau wurde bei den Beihilfen vorgenommen.
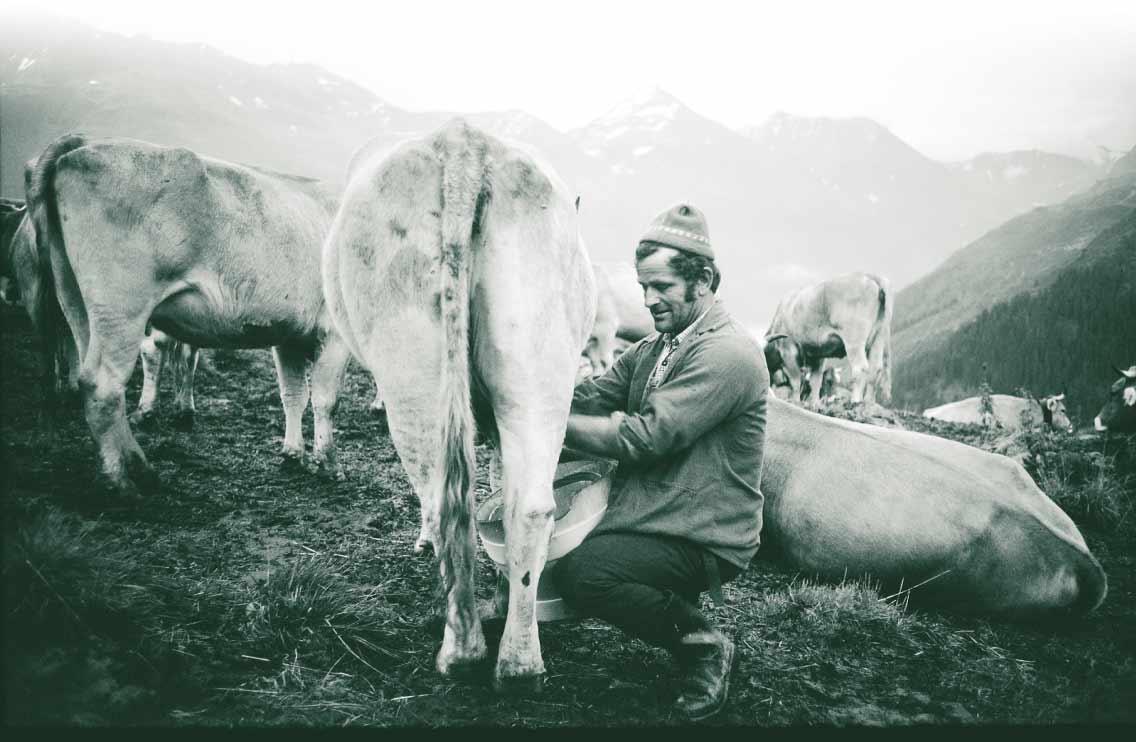
Im Jahr 2003 sind die Ausgaben des Bundes zugunsten der Milchwirtschaft entsprechend der gesetzlichen Vorgabe weiter abgebaut worden.Im Vergleich zum Vorjahr standen rund 41 Mio.Fr.oder 6,8% weniger zur Verfügung.

Total 559,9 Mio. Fr.
Für die Preisstützung wurden im Milchbereich insgesamt 559,9 Mio.Fr.ausgegeben. Davon beanspruchte der Käse 378,4 Mio.Fr.(67,6%).93,1 Mio.Fr.(16,6%) wurden für Butter und 81,3 Mio.Fr.(14,5%) für Pulver und andere Milchprodukte eingesetzt. Die Administration kostete 7,1 Mio.Fr.(1,3%).
Im Milchjahr 2002/03 vermarkteten noch 34'671 Produzenten Milch.Dies entspricht einer Abnahme von 4,3% gegenüber dem Vorjahr oder rund 13% gegenüber 1999/2000.Das durchschnittliche Kontingent pro Betrieb erreichte im Milchjahr 2002/03 gesamtschweizerisch 87'163 kg.Es nahm um 3'756 kg oder 4,5% gegenüber dem Vorjahr zu.Das mittlere Kontingent überschritt im Talgebiet erstmals die Marke von 100'000 kg.Während dort das durchschnittliche Kontingent von 98'197 auf 103'467 kg wuchs,erhöhte es sich im Berggebiet von 63'535 kg auf 65'684 kg. Dies entspricht einer Zunahme von 3,4% gegenüber dem Milchjahr 2001/02.
Die Ausdehnung der Zukaufsperiode auf das ganze Jahr und die Erhöhung des Zusatzkontingentes von 1'500 kg auf 2'000 kg haben dazu geführt,dass erheblich mehr Gesuche für Zusatzkontingente gestellt wurden.Die Anzahl berechtigter Tiere erreichte 21'808 gegenüber 16'444 im Vorjahr.Die Menge verteilter Zusatzkontingente stieg von 24,6 auf 43,6 Mio.kg (+77%).
In der Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion (MKV) wurden folgende Änderungen und Anpassungen vorgenommen:
– Reduktion der Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe;
– Verhinderung missbräuchlicher Kontingents- und Einlieferungstransfers; – Verfahren für Gesuche von Branchenorganisationen;
– Trockenheit 2003:Ermöglichung der Übertragung von Unterlieferungen von mehr als 5'000 kg auf das folgende Milchjahr.
Die Überlieferungsabgabe beträgt im ganzjährig bewirtschafteten Gebiet 60 Rp.je kg. Für Sömmerungsbetriebe beträgt sie seit dem 1.Mai 2004 im Sinne einer Förderungsmassnahme für die Bewirtschaftung der Alpen noch 10 Rp.Wenn für Kontingentsüberlieferungen etwa gleich viel bezahlt werden muss wie für die Jahresmiete eines Kontingentes,kann ein Interesse entstehen,diese Alpkontingente auf die Heimbetriebe zu transferieren,wo sie mit grösserem Nutzen eingesetzt werden können.Um dieser nicht beabsichtigten Entwicklung vorzubeugen,sind die entsprechenden Übertragungsmöglichkeiten eingeschränkt worden (Artikel 3,4 und 20 MKV).
Artikel 31 LwG gibt der Gesamtbranche und einzelnen Branchenorganisationen die Möglichkeit,die Milchmenge,die ihre Mitglieder in einem Milchjahr produzieren und vermarkten möchten,autonom festzulegen und den Bundesrat zu ersuchen,die Kontingente der Produzenten für diese Periode entsprechend anzupassen.Diese Regelung erlaubt eine Anpassung an einen segmentierten und schnell ändernden Markt.Die Verantwortung für die Menge und den Preis liegt in den gleichen Händen. Zudem hat der Bundesrat bestätigt,dass künftig auf allgemeine Mengenanpassungen verzichtet wird.In diesem Zusammenhang wurde ein neuer Abschnitt 2a «Anpassung aufBegehreneinerBranchenorganisation» in die MKV eingefügt.Er ermöglicht die gezielte Anpassung der Kontingente aller Mitglieder einer einzelnen Branche.Der einzige Artikel dieses Abschnittes regelt wo,mit welchem Inhalt und mit welchen Unterlagen ein Begehren zu stellen ist.Insbesondere hat die Branchenorganisation darzulegen,dass die zusätzliche Menge verwertet und vermarktet werden kann,die Verhältnisse auf Teilmärkten berücksichtigt wurden und die wünschbare Entwicklung der Milchwirtschaft oder der Branche nicht gefährdet wird.
Schliesslich haben die Produzenten im Milchjahr 2003/04 die Möglichkeit bekommen, eine als Folge der Trockenheit im Sommer 2003 nicht ausgeschöpfte Menge im Folgejahr (Milchjahr 2004/05) nachliefern zu können (Artikel 16 MKV).
Die Möglichkeit des Kontingentsaustausches wird weiterhin rege genutzt:5’697 Produzenten haben im Milchjahr 2003/04 Kontingente gekauft und 9’573 Produzenten haben Kontingente gemietet.Die übertragene Menge erreichte rund 297’300 t oder 9,6% des Grundkontingentes.Auf Ende des Milchjahres wurden 121’120 t gemietete Kontingente dem Vermieter zurück übertragen.
Kontingentshandel
Die nach Artikel 3 MKV übertragene Menge (Kauf plus Miete) erreichte im Milchjahr 2002/03 rund 234,4 Mio.kg oder 7,8% des Grundkontingentes.Während die Menge gemieteter Kontingente gegenüber dem Vorjahr nur leicht zunahm (plus 2 Mio.kg),erhöhte sich die Menge gekaufter Kontingente in bedeutendem Umfang (plus 19,1 Mio. kg oder 26%).
Die total vermietete Kontingentsmenge betrug im Milchjahr 2002/03 rund 388,5 Mio. kg.Dies entspricht 12,9% des Grundkontingentes.Seit der Einführung des Kontingentshandels im Milchjahr 1999 wurden knapp 300 Mio.kg Kontingente endgültig erworben.In diesem Milchjahr wurden somit 688 Mio.kg oder 22,8% des Grundkontingentes durch flächenungebundene Kontingentsübertragungen von anderen Produzenten genutzt.
Im Vergleich zur gesamtschweizerisch vermarkteten Milchmenge von rund 3,2 Mio.t fällt die Milchproduktion der 2'857 Sömmerungsbetriebe bescheiden aus.Mit knapp 90 Mio.kg Milch entsprach die Produktion während der Sömmerung 2003 einem Anteil von weniger als 3%.19 Produzenten mussten für die Milch,die über der Kontingentsmenge vermarktet wurde,eine Abgabe von 60 Rp.je kg bezahlen,insgesamt rund 20'000 Fr.
Die Senkung der Überlieferungsabgabe auf nur noch 10 Rp.je kg entzieht dem Instrument der Milchkontingentierung einen grossen Teil seiner Wirkung.Ohne rasche Anpassung der Verordnung über die Milchkontingentierung wären einerseits viele Alpkontingente auf den Heimbetrieb übertragen worden,um sie dort selber zu nutzen oder an andere Produzenten zu übertragen.Andererseits musste davon ausgegangen werden,dass die Älpler allfällige Überlieferungen von Heimbetrieben auf das Alpkontingent übertragen werden.Aus diesem Grund wurde die Möglichkeit,Alpkontingente an Betriebe im Tal- oder Berggebiet zu übertragen,unterbunden.Vermarktete Milch kann dem Sömmerungsbetrieb nur noch bis zur Höhe des Alpkontingentes übertragen werden.Diese Einschränkungen sind auf den 1.Januar 2004 in Kraft getreten.Die Möglichkeit,Kontingente von Betrieben an Sömmerungsbetriebe zu übertragen,bleibt dagegen weiterhin erhalten.

■ Rückforderung vermieteter Kontingente zur Eigennutzung
In der Schweiz hatten im Milchjahr 2002/03 knapp 11'000 Produzenten Milchkontingente in der Höhe von rund 380 Mio.kg gemietet.Dafür kassierten die Vermieter jährlich schätzungsweise 40 Mio.Fr.Miete.Sie befürchteten,dass die Mieterträge beim vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung schon in zwei Jahren verloren gehen werden.Deshalb wollten viele Vermieter ihre Kontingente so rasch als möglich noch verkaufen.Zahlreiche Mieter dagegen können sich den Kauf der bis anhin gemieteten Kontingente nicht leisten.Im Interesse der aktiven Milchproduzenten musste die spekulative Rücknahme von vermieteten Milchkontingenten deshalb möglichst rasch unterbunden werden.Als Sofortmassnahme war dazu eine Änderung der Milchkontingentierungsverordnung erforderlich.Seit dem 1.Mai 2004 können nun vermietete Kontingente von den Vermietern nur noch zurückverlangt werden,wenn sie diese auf dem eigenen Betrieb nutzen wollen.Ein Verkauf oder eine Weitervermietung hingegen ist nicht mehr möglich.Um zu verhindern,dass diese Einschränkung der Weiterübertragung durch die Schliessung von Betriebszweiggemeinschaften unterlaufen wird, wurde die Nutzung auch hier ausgeschlossen.Ein Verkauf bzw.eine Weitervermietung durch den Inhaber bleibt hingegen weiterhin möglich,wenn der Mieter selber den Mietvertrag gekündigt hat.Auch werden jene Kontingente nicht blockiert,welche lediglich für die Dauer einer Kontingentierungsperiode vermietet wurden (Spitzenausgleich am Ende einer Periode).
■ Anpassung und Erneuerung der Leistungsvereinbarungen mit den Milchverbänden
Während die Aufsicht über die Durchführung der Milchkontingentierung und die Kontrolltätigkeit Sache des Bundes sind,ist die Administration und die eigentliche Durchführung der Massnahme aussenstehenden Stellen übertragen.Mit der Einführung der neuen Milchmarktordnung auf den 1.Mai 1999 wurde die Durchführung der Milchkontingentierung mittels Leistungsauftrag den 13 Administrationsstellen Milchkontingentierung,den regionalen Milchverbänden, übertragen.Die Laufzeit der Verträge endete am 30.April 2004.Ohne schriftliche Kündigung auf den Apriltermin laufen sie jeweils um ein Jahr weiter.Wegen der seit 1999 eingetretenen Strukturentwicklung und der vorgesehenen Aufhebung der Milchkontingentierung im Jahre 2009 wurden im Sommer 2003 neue Verhandlungen mit den Milchverbänden geführt, um die Verträge der neuen Situation anzupassen.
Art und Umfang der Aufgaben sind in einem Pflichtenheft ausführlich festgehalten. Insbesondere haben die Milchverbände von jedem Produzenten,der Milch vermarktet, den Datenstamm und die Einlieferungen zu erfassen,die Kontingentsabrechung zu erstellen und Änderungen des Kontingents laufend zu registrieren.Zudem müssen sie dem BLW je Milchjahr eine Zusammenstellung der Daten aller Produzenten ihres Einzuggebietes übermitteln.Die Anzahl zu verwaltender Betriebe beträgt rund 45'000 Einheiten.Darin inbegriffen sind sämtliche Betriebe mit Milchproduktion inkl.der Sömmerungsbetriebe,sowie Betriebe mit stillgelegtem Kontingent und diejenigen,die ihr Kontingent vermietet haben.
■ Ausblick:Vorzeitiger Ausstieg aus der Milchkontingentierung
Für die im Rahmen der Milchkontingentierung erbrachten Leistungen wurden die Milchverbände jährlich mit einen Betrag von rund 3,5 Mio.Fr.entschädigt.Während die Gesamtsumme gegenüber 1999 unverändert blieb,wurde die Abgeltung je Milchverband 2003 nach neuen Kriterien ermittelt.Im Berechnungsschlüssel berücksichtigt wurden namentlich die notwendigen Stellenprozente,die durchschnittlichen Informatik- und Betriebskosten der Administrationsstellen,die Anzahl Betriebe mit Milchproduktion,die höheren Kosten der kleinen Administrationsstellen und der Mehraufwand bei Mehrsprachigkeit.
Das Ende der Milchkontingentierung ist in Sicht.Generell wird die öffentlich-rechtliche Mengenbegrenzung im Frühjahr 2009 aufgehoben.Der Gesetzgeber hat ermöglicht, dass Produzenten bereits per 1.Mai 2006,2007 und 2008 aussteigen können.Das BLW hat dieses Frühjahr den betroffenen und interessierten Kreisen einen Verordnungsentwurf über den vorzeitigen Ausstieg von der Milchkontingentierung zur Stellungnahme unterbreitet mit dem Ziel,diese auf den 1.Mai 2005 in Kraft zu setzen. Die bis anhin staatlich geregelte Mengenbegrenzung soll bei einem vorzeitigen Ausstieg nicht einfach aufgehoben werden.Vielmehr wird die Verantwortung über die produzierte Milchmenge den aussteigenden Organisationen übergeben.Im Verordnungsentwurf wird dargelegt,dass wenn eine Organisation ihr Produktionsvolumen steigern möchte,sie dem Bund den Nachweis erbringen muss,dass die beantragte Mehrmenge nicht grösser ist als jene des Mengenbedarfes der hergestellten Produkte. Ist keine Steigerung des Inlandabsatzes erzielbar,müssen Mehrmengen demnach ausschliesslich über den Export abgesetzt werden.
Die Rahmenbedingungen für den vorzeitigen Ausstieg stehen Ende 2004 also fest.Der Ball liegt ab diesem Zeitpunkt bei den Produzenten.Es liegt an ihnen,sich zu entscheiden,sich entsprechend zu organisieren und sich für den Ausstieg aus der Milchkontingentierung vorzubereiten.
In der Branche besteht ein reges Interesse am vorzeitigen Ausstieg.Um sich darauf vorzubereiten,werden zunehmend mehr Informationen über die entsprechenden Voraussetzungen,die für einen allfälligen vorzeitigen Ausstieg aus der Milchkontingentierung erfüllt werden müssen,verlangt.
Das Instrumentarium zur Marktstützung hat im Berichtsjahr 2003 keine grundsätzliche Änderung erfahren.Als Folge des eingangs erwähnten Stützungsabbaus von 41 Mio.Fr. mussten jedoch verschiedene Beihilfen gekürzt werden.Im Hinblick auf die verfügbaren Mittel im laufenden Jahr 2004 musste ab 1.Mai 2004 zudem erstmals auch die Zulage für verkäste Milch von 20 auf 19 Rp.je kg reduziert werden.Auf das gleiche Datum sind auch die letzten Ausfuhrbeihilfen für Käseausfuhren in die EU gestrichen und die Höhe derjenigen in andere Länder um weitere 50 Rp.je kg gekürzt worden. Auch die Ausfuhrbeihilfe nach Gehaltsäquivalent ist auf 1.Mai 2004 um 2 Rp.auf 29 Rp.je Gehaltsäquivalent gesenkt worden.In der Verordnung des EVD über die Höhe der Beihilfen für Milchprodukte und Vorschriften für die Einfuhr von Vollmilchpulver wurden zudem die Regelungen über das Verfahren zur Herstellung von Buttermischungen und die Aufgaben im Buttersektor aufgehoben.
Der bisherige Zielpreis (Artikel 1 der Milchpreisstützungsverordnung) wurde gestrichen. Er hat für das weitere Funktionieren des Milchmarktes nach vollzogenem Übergang in die neue Ordnung seine Bedeutung und Berechtigung verloren.Mit der Aufhebung von Artikel 29 LwG im Rahmen der AP 2007 bestand dafür ohnehin keine gesetzliche Grundlage mehr.Bisher wurde der Milchpreis im Bereich Butter mit differenzierten Beihilfen gestützt.Dies war nötig,um den beim Übergang in die neue Milchmarktordnung geltenden Verhältnissen gerecht zu werden.Die Absicht war jedoch schon damals,nach Ablauf der Übergangsphase das Stützungssystem im Butterbereich grundsätzlich jenem anzugleichen,das seit Beginn für die verkäste Milch angewendet wird.Ziel ist demnach eine einheitliche Stützung für jene Segmente des Buttermarktes, welche noch einer Stützung bedürfen.Dies ist heute weitgehend erreicht;es wird nur noch je eine Beihilfe für entwässerte und nicht entwässerte Butter für die gewerblichindustrielle Verwendung gewährt.

Der Grenzschutz in Form von Zöllen und Zollkontingenten ist das wichtigste Instrument zur Unterstützung der inländischen Fleischproduktion.Für den Fleisch- und Eiermarkt sowie für den Export von Zucht- und Nutzvieh werden ausserdem Beihilfen ausgerichtet. Massnahmen
Der Bundesrat beschloss,die Höchstbestände für Tiere der Schweinegattung,Kälber, Mastpoulets,Truten und Legehennen auf den 1.Januar 2004 um 50% zu erhöhen. Gleichzeitig hob er sie für Junghennen auf.Die Änderungen dürften keine Nachteile für Ökologie und Tierschutz haben,weil die Gewässerschutzvorschriften und der ökologische Leistungsnachweis genügend begrenzend wirken.Als Folge der guten Marktlage verzichtete die Proviande auf einige Entlastungsmassnahmen:Weder führte sie die Marktabräumung von Rindern,Kälbern,Schweinen und Pferden in Schlachtbetrieben durch,noch entlastete sie den Markt mit Verbilligungsaktionen von Rind-,Kalb- oder Schweinefleisch.
■ Finanzielle Mittel 2003
Vom Bundesbudget von 43,6 Mio.Fr.für Massnahmen in der Viehwirtschaft wurden lediglich 24,9 Mio.Fr.ausgegeben.Die restlichen Mittel wurden zur Kompensation von Nachtragskrediten in anderen Bereichen eingesetzt:7 Mio.Fr.für die Verwertung der Traubenernte und 9,4 Mio.Fr.für allgemeine und ökologische Direktzahlungen. Gestützt auf die Eierverordnung ergänzte der Bund ferner die Direktzahlungen für besonders tierfreundliche Legehennenhaltung aus dem Budget für die Viehwirtschaft.
Hauptfaktoren für die Minderausgaben in der Viehwirtschaft waren die erfreuliche Nachfrage auf dem Fleischmarkt sowie der im Berichtsjahr noch eingeschränkte Zuchtund Nutzviehexport.Durch einen Entscheid des EU-Agrarrats vom 17.November 2003 anerkennt die EU die Schweizer Vorschriften zur Rinderkrankheit BSE als gleichwertig. Handelsschranken einzelner EU-Mitgliedsländer sind damit unzulässig.Seit Ende des Berichtsjahres können Schweizer Rinder grundsätzlich wieder nach ganz Europa exportiert werden.
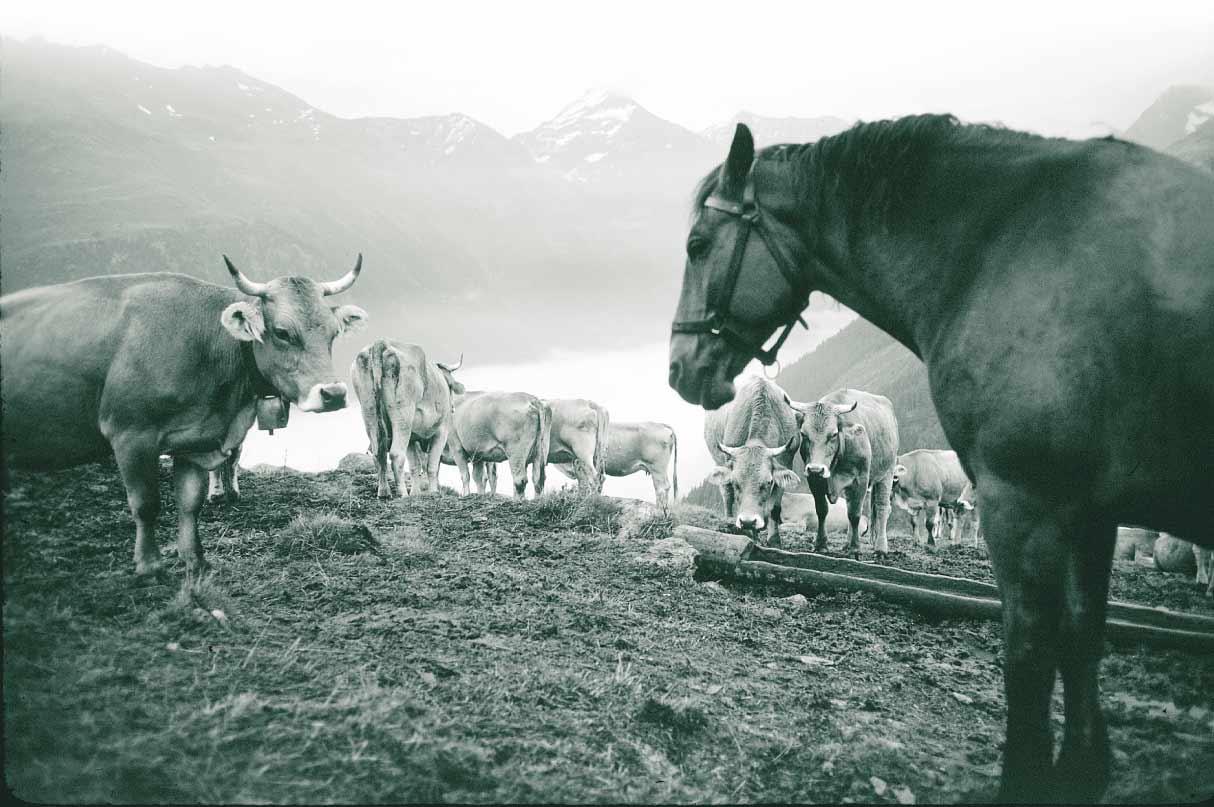
Total 24,9 Mio. Fr.
Verwertungsbeiträge
Schafwolle 2%
Einlagerungs- und Verbilligungsbeiträge für Rind- und Kalbfleisch 19%
Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 12%
Ausfuhrbeihilfen
Zucht- und Nutzvieh 37%
Leistungsvereinbarungen
Proviande 30%
Quelle: Staatsrechnung
■ Schlachtvieh und Fleisch: Leistungsvereinbarungen
Die Proviande erfüllt seit dem 1.Januar 2000 Aufträge des BLW auf den öffentlichen Schlachtvieh- und Schafmärkten sowie in Schlachtbetrieben.Auf den 1.Januar 2004 traten neue,befristete Verträge in Kraft.Aus personeller und finanzieller Sicht ist die neutrale Qualitätseinstufung von Lebendtieren und Schlachtkörpern die wesentlichste Aufgabe der Proviande.
Der Klassifizierungsdienst der Proviande stufte die Qualität von über 80% der geschlachteten Tiere der Rinder-,Schweine-,Schaf-,Ziegen- und Pferdegattung neutral ein.Ausserdem bestimmte er auch die Qualität aller Tiere der Rinder- und Schafgattung auf öffentlichen Märkten.Für diese Arbeiten sind über 140 Voll- und Teilzeitmitarbeiter angestellt.Sie leisteten zusammen 48'000 Arbeitsstunden in Schlachtbetrieben und waren auf rund 1'700 öffentlichen Schlachtvieh- und Schafmärkten präsent.
Der Magerfleischanteil,das Qualitätsmerkmal von Schweineschlachtkörpern,wird mit technischen Geräten bestimmt.Der Mittelwert des Magerfleischanteils aus einer Stichprobe von 925'000 Schlachtungen (35% aller Schlachtungen) betrug rund 55%. Damit ist er im Vergleich mit dem Jahr 2002 konstant geblieben.Die Fettqualität von Schweinen ist ein weiteres Qualitätsmerkmal,das für die Konsistenz und Oxidationsstabilität der Wurstwaren wesentlich ist.Die Messung der Fettqualität (Bestimmung der sogenannten Fettzahl) ist für Schlachtbetriebe indessen fakultativ.
Verteilung der Schlachtkörper auf die Fleischigkeitsklassen 2003
Bei Tieren der Rinder-,Schaf-,Ziegen- und Pferdegattung wird die Qualität des Schlachtkörpers optisch bestimmt.Für die Fleischigkeit gibt es fünf Klassen:C = sehr vollfleischig,H = vollfleischig,T = mittelfleischig,A = leerfleischig und X = sehr leerfleischig.Die Fettabdeckung wird ebenfalls in fünf Klassen unterteilt.Die Auswertung einer Stichprobe aus dem Jahr 2003 offenbart wesentliche Unterschiede zwischen Schlachtkörpern von Muni und Kühen.Die Stichprobe umfasste rund 60% aller geschlachteten Tiere.Ein Viertel der Kühe war leerfleischig und ein Viertel sehr leerfleischig.Gegenüber dem Jahr 2002 nahm der Anteil der sehr leerfleischigen Tiere immerhin um 3 Prozentpunkte ab.Bei den Muni waren 95% der Tiere aus der Stichprobe mittel- bis sehr vollfleischig,wobei die sehr vollfleischigen Tiere innerhalb eines Jahres um 50% zugenommen haben.Tiere der Rindergattung wiesen im Berichtsjahr generell einen höheren Fleischanteil aus als im Jahr 2002.Bei den Lämmern überwogen mit einem Anteil von 51% die mittelfleischigen Schlachtkörper. Die Klassifizierungsexperten stuften mehr als zwei Drittel der geschlachteten Gitzi in Schlachtbetrieben als vollfleischig ein,was auf eine gute Mast zurückzuführen ist.
2. Überwachung des Marktgeschehens in Schlachtbetrieben sowie Organisation von Marktentlastungsmassnahmen
Lokale bäuerliche Organisationen und/oder kantonale Stellen veranstalteten auf 76 Plätzen Grossviehmärkte,auf 18 Plätzen Kälbermärkte und auf 96 Plätzen Schafmärkte.Marktplätze für Grossvieh befinden sich in 20 Kantonen,für Kälber in 7 Kantonen und für Schafe in 17 Kantonen.Die Zahl der aufgeführten Tiere der Schafgattung stieg gegenüber 2002 um 21%,diejenige von Tieren der Rindergattung um 3%.Das ausserordentlich grosse Angebot auf den Schafmärkten wurde vom Handel nicht vollständig auf freiwilliger Basis gekauft.Deshalb teilte die Proviande den übernahmepflichtigen Schlacht- und Handelsfirmen 15’957 Schafe und Lämmer (17,5% der aufgeführten Tiere) zu.Das sind zehnmal mehr Tiere als im Vorjahr.Die Firmen bezahlten für die zugeteilten Tiere von der Proviande festgestellte marktübliche Preise. Beim Grossvieh und bei den Kälbern wurden hingegen nur 1'001 bzw.56 Tiere im Rahmen der Marktabräumung zugeteilt.
Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten 2003
MerkmalEinheitKälberGrossviehTiere der Schafgattung
Überwachte öffentliche MärkteAnzahl465911350
Aufgeführte TiereSt.52 61873 00291 099
Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen%181933
Zugeteilte Tiere (Marktabräumung)St.561 00115 957
Quelle:Proviande
Das BLW zahlte für das Einfrieren und das Lagern von Kalb- und Kuhfleisch insgesamt Beihilfen im Umfang von 4,6 Mio.Fr.aus.Firmen lagerten im Frühjahr 1'003 t Kalbfleisch und im August und September 539 t Kuhfleisch ein.Alle Fleischlager wurden bis Ende des Berichtsjahres wieder dem Markt zugeführt.
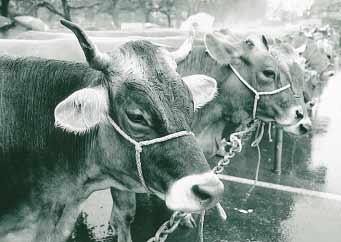
Insgesamt wurden 854 Gesuche um Zollkontingentsanteile eingereicht.Seit dem Jahr 2000,in dem 1'003 Gesuche gestellt wurden,ist die Zahl stetig rückläufig.Die Proviande prüfte die gemeldeten Inlandleistungen auf die Vollständigkeit und auf die Plausibilität.Dabei kontrollierte sie die Menge der eingesalzenen Rindsbinden in jedem Betrieb einmal vor Ort;die anderen gemeldeten Inlandleistungen wie Schlachtungen und Nierstückzukäufe wurden hingegen stichprobenweise in rund 100 Betrieben überprüft.Die erfassten und kontrollierten Daten der Inlandleistungen übermittelte die Proviande dem BLW.Basierend auf diesen Daten teilte das BLW am 19.November 2003 insgesamt 840 juristischen und natürlichen Personen Zollkontingentsanteile mittels Verfügung zu:711 Personen erhielten Anteile für Fleisch von Tieren der Rindergattung (ohne Rindsbinden),417 für Fleisch von Tieren der Schweinegattung,171 für Fleisch von Tieren der Schafgattung,158 für Rindsbinden,34 für Fleisch von Tieren der Pferdegattung und 29 für Fleisch von Tieren der Ziegengattung.Auf 14 Gesuche konnte nicht eingetreten werden,da diese entweder zu spät eingereicht wurden oder die gesuchstellende Person die minimale Inlandleistung nicht erreichte.Für Geflügelfleisch mussten keine Gesuche gestellt werden.Die Zuteilung der Zollkontingentsanteile basiert auf monatlichen Meldungen der Inlandleistung (direkte Zukäufe von Geflügelfleisch ab inländischen Schlachtbetrieben) ans BLW.Im Berichtsjahr gab es 85 Zollkontingentanteilsinhaber für Geflügelfleisch.
Zollkontingentsanteile sind Anteile an den Einfuhren zum tiefen Kontingentszollansatz. Sie wurden im Berichtsjahr nach verschiedenen Kriterien zur Bemessung der Inlandleistungen zugeteilt.Die Inlandleistung in der Periode vom 1.Juli 2002 bis zum 30.Juni 2003 diente als Grundlage für die Zuteilung der Zollkontingentsanteile im Kalenderjahr 2004.Die Ausnahme bildet das Geflügelfleisch,bei dem beide Perioden genau dem Berichtsjahr entsprechen.Wie nachfolgende Abbildung zeigt,konzentrieren sich Zollkontingentsanteile bei allen Fleischkategorien auf wenige natürliche und juristische
■ Kantonale Unterstützung der öffentlichen Schlachtviehmärkte
Die stärkste Konzentration weist das Geflügelfleisch auf.Alleine der grösste Inhaber hat einen Anteil von mehr als einem Drittel am Zollkontingent.Für Schweine- und Pferdefleisch ist die Schlachtung das alleinige Kriterium der Inlandleistung.Aus diesem Grund lässt sich aus der Struktur der Zollkontingentanteilsinhaber unmittelbar auch die Struktur der Schlachtbetriebe ableiten:jedes vierte Schwein und jedes fünfte Pferd wird im grössten Betrieb geschlachtet;in den zehn grössten Betrieben sind es 73% der Schweine und 80% der Pferde.Für Rindfleisch (ohne Rindsbinden) zählen dieselben Kriterien wie für Lammfleisch und zusätzlich auch die Nierstück-Zukäufe ab Schlachtbetrieben.Es gibt beim Rindfleisch absolut die meisten Inhaber von Zollkontingentsanteilen.Zwar verfügen die zehn grössten Inhaber über 64% der Zollkontingentsanteile,die restlichen 36% verteilen sich hingegen auf 701 Personen.
Die öffentlichen Schlachtvieh- und Schafmärkte dienen der Zusammenfassung und Sichtbarmachung des Angebotes.Die Proviande ist vom BLW beauftragt,solche Märkte zu überwachen,alle Tiere neutral einzustufen und nicht verkaufte Tiere übernahmepflichtigen Firmen zuzuteilen.Der Bund bezahlt diese Arbeiten mit rund 2 Mio.Fr. pro Jahr.Die Kantone Bern,Freiburg,Graubünden,Jura,Neuenburg,Obwalden und Waadt fördern die öffentlichen Märkte mit zusätzlichen Finanzmitteln.Nutzniesser dieser Gelder sind Schlachtviehproduzenten,welche Tiere auf die Märkte bringen,und in der Regel auch die Marktorganisatoren.Die Produzenten erhalten Tierprämien.Für grosses Schlachtvieh setzen sie sich meistens zusammen aus einem Sockelbeitrag (Auffuhrbeitrag) und Zuschlägen für die Transportdistanz sowie für die Qualität.Sie liegen in einer Bandbreite von 50 bis 250 Fr.pro Tier.Für Schafe gibt es nur im Kanton Graubünden Prämien,und zwar in Abhängigkeit der Transportdistanz zum Markt 6 bis 9 Fr.pro Tier. Überall von Prämien ausgeschlossen sind Kälber und Lämmer.Die Marktorganisatoren sind in der Regel bäuerliche Organisationen,z.B.Schlachtviehgenossenschaften und kantonale Bauernverbände.Gedeckt werden ihre Aufwände einerseits durch kantonale Finanzmittel,andererseits durch Unkostenbeiträge der Produzenten. Die Unkostenbeiträge bewegen sich in der Bandbreite von Fr.3.40 pro Schaf bis zu Fr.37.50 pro Stück Rindvieh.
Kantonale Beiträge zu Gunsten öffentlicher Schlachtviehmärkte 2003
KantonEinheitPrämien für Prämien für Beiträge anTotal Rindvieh-Schaf-MarktProduzentenProduzentenorganisatoren
■ Eier:Unterstützung der inländischen Produktion und Verwertungsmassnahmen
Der Kanton Graubünden richtet darüber hinaus Prämien für direkt vermarktetes Rindvieh aus.Ebenfalls prämienberechtigt ist Rindvieh,das in einem speziellen Labelprogramm aufgezogen wurde oder das in einem Schlachtbetrieb im Kanton geschlachtet wurde.
Die Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte wurde bis Ende 2003 aus zweckgebundenen Zollanteilen alimentiert.Für die Unterstützung der Inlandeierproduktion und für Verwertungsmassnahmen standen im Berichtsjahr rund 10 Mio.Fr.zur Verfügung. Ab 2004 stammen die Marktstützungsmittel aus allgemeinen Bundesmitteln.

Das BLW hat auch im Berichtsjahr wieder Investitionsbeiträge für den Um- und Neubau von tierfreundlichen Geflügelställen ausgerichtet.Die Beiträge sind ausschliesslich zu Gunsten von Ställen für Geflügel zur Eierproduktion und müssen weder zurückgezahlt noch verzinst werden.26 Betriebe mit Legehennen,4 Betriebe mit Junghennen und 2 Betriebe mit Lege- und Junghennen profitierten von einer zugesicherten Unterstützung von 471'000 Fr.Zusammen mit den im Jahr 2002 zugesicherten Beiträgen zahlte das BLW im Berichtsjahr Investitionsbeiträge in der Höhe von 598'000 Fr.aus. Die begünstigten Betriebe halten durchschnittlich rund 2'600 Lege- und/oder 4'300 Junghennen.Von den 32 Betrieben,die im Berichtsjahr einen Beitrag zugesichert erhielten,produzieren 15 Betriebe oder 47% biologisch.Dies erklärt auch die gegenüber dem Vorjahr tieferen mittleren Tierbestände der begünstigten Betriebe.
Vor allem nach Ostern und in den Sommermonaten ist die Nachfrage nach inländischen Eiern gegenüber der Zeit vor Weihnachen und vor Ostern schwach.Um die Auswirkungen dieser saisonalen Nachfrageschwankungen zu mildern,stellte das BLW 3 Mio.Fr.für Verwertungsmassnahmen zur Verfügung.Die Eiprodukthersteller schlugen 16,9 Mio. überschüssige Inlandeier auf.Das Aufschlagen wurde mit einem Beitrag von 9 Rp.je Ei unterstützt.Zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten verbilligten die Anbieter 11,9 Mio.Eier.Dafür erhielten sie 5 Rp.je Ei.Das BLW überprüfte die Einhaltung der Bestimmungen der Aufschlags- und Verbilligungsaktionen mit Domizilkontrollen und Kontrollen von Nachweisdokumenten.
Das BLW unterstützte im Berichtsjahr praxisnahe Versuche beim Geflügel sowie die Verbreitung der entsprechenden Ergebnisse bei der Bildung und Beratung mit rund 205'000 Fr.Nutzniesser waren das Aviforum in Zollikofen und das FiBL in Frick. Folgende Projekte erhielten finanzielle Mittel aus der Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte:Optimierung der Legehennenhaltung mit Grünauslauf - Management und Zucht;Einfluss des Rohprotein- und Methioningehaltes sowie der Hybridherkunft auf die Leistung,die Abgangsrate und das Gefieder von Legehennen;Evaluation der Aufzuchtresultate zweier Legehybriden mit Bio-Futter resp.einem Biofutterzusatz.
■ Nutz- und Sportpferde: Versteigerung von Zollkontingentsanteilen
Auch im Berichtsjahr hat das BLW das Zollkontingent «Tiere der Pferdegattung (ohne Zuchttiere,Esel,Maulesel und Maultiere)» in zwei Hälften von je 1'461 St.ausgeschrieben und versteigert.An jeder Versteigerung reichten über 180 Personen Gebote für mehr als 2'000 St.ein.Im Mittel lag der Zuschlagspreis bei 351 Fr.pro Nutz- und Sportpferd.Der Versteigerungserlös zu Gunsten der Bundeskasse belief sich auf 1 Mio.Fr.
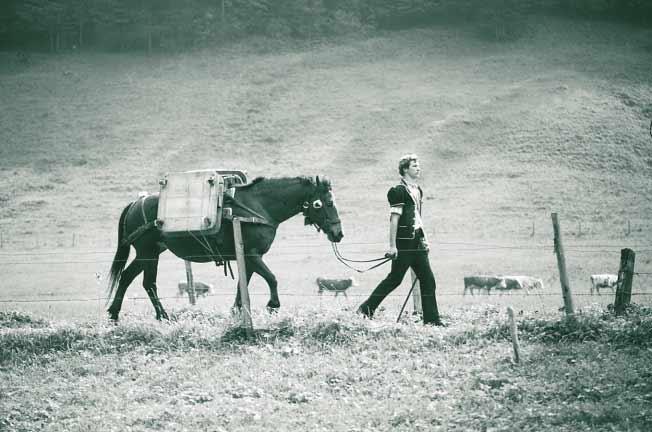
Massnahmen 2003
Im Bereich Pflanzenbau wurden am Massnahmenkatalog zur Inlandpreisstützung im Berichtsjahr keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.Der Grenzschutz bleibt im Ackerbau die Hauptstütze der Produzentenpreise.Der innerlandwirtschaftliche Zielkonflikt zwischen hohen Produzentenerlösen im Anbau von Futtergetreide,Körnerleguminosen und Ölsaaten sowie günstigen Einstandspreisen von Kraftfutter für die Nutztierhalter erhöhte den Druck zur Senkung der Zollbelastung bei den Kraftfutterkomponenten.
Bei Obst,Gemüse und Schnittblumen ist ebenfalls der Grenzschutz die wichtigste Massnahme.Bei Obst ist zudem die finanzielle Beteiligung an der Übermengen-Verwertung von Mostobst und die Marktentlastung für Steinobst von Bedeutung.
1Je nach Verwendungszweck bzw.Zolltarifposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung
2Betrifft nur Teile der Erntemenge (Frischverfütterung und Trocknung von Kartoffeln,Marktreserven Kernobstsaftkonzentrate)

3Für Kartoffelprodukte zu Speisezwecken
4Nur für Saatkartoffeln
5Alkoholfreie Verwertung von 2’655 t Trauben
■ Finanzielle Mittel
Gegenüber dem Vorjahr stiegen die zur Marktstützung ausgerichteten Mittel im Pflanzenbau von 146 auf 154 Mio.Fr.(inkl.Absatzförderung Weinbau,5,1 Mio.Fr.) an. 4,5 Mio.Fr.davon sind auf die Flächenausdehnung bei Körnerleguminosen und Ölsaaten zurückzuführen.Davon entfielen 3 Mio.Fr.auf die Ölsaaten.Die Anbaubeiträge für Körnerleguminosen erhöhten sich entsprechend um 1,5 Mio.Fr.(+24%).

Mittelverteilung 2003
Total 154 Mio. Fr.
Exportbeiträge 11%
Diverses 7%
Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 54%
Diverses: inkl. Absatzförderung Wein
Anbaubeiträge 28%
Quelle: Staatsrechnung
Die Aufwendungen für die Verarbeitung von Ölsaaten zu Speisezwecken,zu Futterzwecken oder zu technischen Zwecken beliefen sich wie im Vorjahr auf 8,5 Mio.Fr.
leguminosen ÖlsaatenNachwachsende Rohstoffe
Quelle: Staatsrechnung
Total 17,8 Mio. Fr.
Export andere Kernobstprodukte 3,0%
Export Kirschen 2,1%
Verwertung von Äpfel und Birnen im Inland 4,1%
Export von Apfelsaftkonzentrat 52,3%
Export von Birnensaftkonzentrat 36,8%
Anderes 1,7% davon Marktentlastung Kirschen und Zwetschgen 0,8%
Quelle: BLW
Im Berichtsjahr betrug die Unterstützung für die Obstverwertung 17,8 Mio.Fr.Im Vergleich zu 2002 wurden für den Export von Birnensaftkonzentrat 3,6 Mio Fr.mehr aufgewendet.Dafür gingen die Ausgaben für den Export von Apfelsaftkonzentrat um beinahe den selben Betrag zurück.
Innerhalb der Ackerkulturen nehmen die Kartoffeln eine besondere Rolle ein,da sie frisch oder als verarbeitete Kartoffelprodukte in den Verkauf gelangen.Rund 130'000 t (70%) der Frischkartoffeln werden in Privathaushalten konsumiert.Verarbeitungsprodukte hingegen werden zu 70% im Ausser-Haus-Konsum nachgefragt.Die unterschiedlichen Qualitätsansprüche der Verarbeiter und Endverbraucher stellen bezüglich Sortenwahl und jeweilige Produktionsmengen hohe Anforderungen an die Kartoffelproduzenten.
Entwicklung der Strukturen im Kartoffelanbau
Die Instrumente zur Stützung des Kartoffelmarkts waren bereits vor der Umsetzung der Agrarpolitik 2002 auf eine liberale Marktordnung ausgerichtet.In der Betrachtungsperiode seit 1997 verlief die Strukturentwicklung deshalb kontinuierlich.Die Anzahl Kartoffeln produzierender Betriebe sinkt,währenddem die Anbaufläche nach wie vor rund 14'000 ha erreicht.Durch diese Entwicklung stieg die mittlere Anbaufläche je Betrieb auf 1,4 ha an.
Das mittlere Handelsvolumen marktfähiger Kartoffeln beträgt insgesamt um 350'000 t. Die Ertragssicherheit im Kartoffelanbau unterliegt erheblich den Witterungseinflüssen, da der Krankheitsdruck bei Nässe zunimmt und Trockenheit zur Bildung unregelmässiger Knollen führen kann.Entsprechend variiert das Importvolumen zur Deckung des Inlandverbrauchs,das bei Bedarf über den im Rahmen des GATT/WTO-Übereinkommens zu gewährenden Mindestmarktzutritt von 22'250 t hinaus geht.Das Verhältnis von Importanteil zur Inlandproduktion belief sich von 1997 bis 2003 bei den Saatkartoffeln auf 12% bis 22%,bei den Speisekartoffeln auf 3% bis 9% und bei den Veredelungskartoffeln auf 2% bis 18%.Die Exportmengen von Saat- und Frischkartoffeln waren seit 1997 stets gering.Auch dem grenzüberschreitenden Handel mit Verarbeitungsprodukten (Halbfabrikate und Fertigprodukte) – umgerechnet auf Kartoffeläquivalente – kam relativ zum Inlandverbrauch eine untergeordnete Bedeutung zu.Das Verhältnis von importierten zu exportierten Verarbeitungsprodukten variierte von 47% bis 113%.Die Zuteilung der Importkontingente für Verarbeitungsprodukte erfolgt durch Versteigerungen,währenddem Frischkartoffeln proportional zur Inlandleistung importiert werden können.
Die wichtigsten Marktstützungsinstrumente im Kartoffelbau sind der Grenzschutz und die Ausrichtung von Verwertungsbeiträgen (2003:18 Mio.Fr.).Zusätzlich wird die Verwertung von Saatkartoffeln (2003:2,6 Mio.Fr.) und der Export von Kartoffelprodukten (2003:0,9 Mio.Fr.) mit Beiträgen unterstützt.Finden Kartoffeln aufgrund der Qualität oder der Nachfrage im Nahrungsmittelbereich keinen Absatz,können sie unerlesen nach der Kontrolle und Deklassierung durch die zuständige Kontrollorganisation unter Beanspruchung von Beiträgen verwertet werden.Als beitragsberechtigte Verwertungsmassnahmen gelten die Frischverfütterung von deklassierten Kartoffeln,die Lagerhaltung von Speisekartoffeln und die Verarbeitung von unerlesenen Kartoffeln sowie Speise- und Veredelungskartoffeln zu Futtermitteln durch Trocknung.Die Branche erhält zur Verwertung der Kartoffeln mittels Leistungsvereinbarung einen Pauschalbeitrag und kann mit diesen Mitteln nach eigenem Ermessen die Frischverfütterung,die Lagerhaltung oder die Trocknung fördern.Der nicht marktfähige Sortierabgang wird ohne Beiträge verfüttert.Mit der Ausrichtung von Finanzhilfen für die Verwertung unerlesener Kartoffeln lassen sich insbesondere witterungsbedingte Anbaurisiken senken.

Zur Erhaltung der Marktanteile in der Schweine- und Geflügelhaltung im sich liberalisierenden Markt wollen die Tierhalter ihre Kraftfutterkosten durch eine Reduktion der Zollbelastung senken.Die Kehrseite dieser Bestrebungen ist,dass die inländischen Futtergetreidepreise ebenfalls zurückgehen werden,was zu einem innerlandwirtschaftlichen Zielkonflikt führt.Im Zusammenhang mit den durchzuführenden Sparmassnahmen und den von Produzentenseite geforderten Umverteilungen der Direktzahlungen wird eine Senkung der Zollbelastung geprüft,die frühestens Mitte 2005 umgesetzt werden kann.
Das Brotgetreidekontingent von 70'000 t wurde bis 2003 zweimal jährlich und 2004 aufgrund der geringen Inlandernte im Berichtsjahr in vier Tranchen versteigert.Von der Branche ist beantragt worden,die Versteigerung ab 2005 durch das Windhundverfahren ebenfalls in vier Tranchen zu ersetzen.

Die Direktzahlungen sind eines der zentralsten Elemente der Agrarpolitik.Sie ermöglichen eine Trennung der Preis- und Einkommenspolitik und gelten die von der Gesellschaft geforderten Leistungen ab.Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen.
Ausgaben für die Direktzahlungen Ausgabenbereich19992000200120022003
Anmerkung:Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr;die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten.Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere.Diese Beiträge haben das Ziel,eine flächendeckende Nutzung und Pflege sicherzustellen.In der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen.Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt.Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).

■ Abgeltung besonderer ökologischer Leistungen
Die ökologischen Direktzahlungen geben einen Anreiz für besondere ökologische Leistungen,die über den ÖLN und die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.Zu ihnen gehören die Öko-,Öko-Qualitäts-,Gewässerschutz- und Sömmerungsbeiträge. Ziele sind unter anderem,die Artenvielfalt in den Landwirtschaftsgebieten zu erhalten und zu erhöhen,landwirtschaftliche Nutztiere besonders tierfreundlich zu halten,den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln zu vermindern,die Nitrat- und Phosphorbelastung der Gewässer zu reduzieren,und das Sömmerungsgebiet nachhaltig zu nutzen.
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2003
Die Direktzahlungen machten 2003 rund zwei Drittel der Ausgaben des BLW aus.Von den Direktzahlungen kamen 59% der Berg- und Hügelregion zugute.
Anmerkung:
Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr;die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle:BLW
Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von Referenzbetrieben nach Regionen 2003
Die Abgeltung der erschwerenden Bewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion führt dazu,dass die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis zunimmt.Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zahlreiche Anforderungen zu erfüllen.Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen wie Rechtsform,zivilrechtlicher Wohnsitz usw.,anderseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend wie beispielsweise ein minimaler Arbeitsbedarf,das Alter der Bewirtschafter,das Einkommen und Vermögen. Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen,die unter den Begriff «Ökologischer Leistungsnachweis» fallen.Die Anforderungen des ÖLN umfassen:eine ausgeglichene Düngerbilanz,ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen,eine geregelte Fruchtfolge,ein geeigneter Bodenschutz,eine gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere.Eine Verletzung oder ein Verstoss gegen die massgebenden Vorschriften haben Sanktionen in Form einer Kürzung oder Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge.

■ Agrarpolitisches Informationssystem
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem).Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen,welche die Kantone zusammentragen und übermitteln und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart gespiesen.Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge. Eine weitere Funktion des Systems besteht in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen.Dank der Informationsfülle und der leistungsfähigen EDVHilfsmittel können zahlreiche agrarpolitische Fragen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden.
Von den 63’418 über der Erhebungslimite des Bundes liegenden und im Jahre 2003 in AGIS erfassten Betrieben erfüllen deren 57’556 die Grundvoraussetzungen für Direktzahlungen.
■ Auswirkungen der Begrenzungen und Abstufungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus.Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro Standardarbeitskraft (SAK),bei den Abstufungen um die Degressionen nach Fläche und Tieren.
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2003
BegrenzungBetroffene Gesamtbetrag Anteil am Anteil an der BetriebeKürzungenBeitragstotalDirektzahlungsder Betriebesumme
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge,insbesondere für jene 213 Betriebe,deren Vermögen zu hoch ist.Von den Einkommensgrenzen waren im Jahr 2003 rund 980 Betriebe betroffen.Die Kürzung der Direktzahlungen betrug bei diesen Betrieben im Durchschnitt 10,2%.Insgesamt wurden aufgrund der Begrenzungen 9 Mio.Fr.an Direktzahlungen gekürzt;dies entspricht 0,37% des Gesamtbetrages.
Wirkung der Abstufungen der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl 2003
Insgesamt sind 8'265 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen.Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenen Massnahmen.Die Reduktionen betragen total rund 34 Mio.Fr.Gemessen an allen Direktzahlungen,die abgestuft sind,beträgt der Anteil sämtlicher Reduktionen 1,6%. Die Beitragsdegressionen wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus,wo die Abstufungen bei über 7’000 Betrieben (rund 12% aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen.Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 212 Betriebe von dieser Reduktion betroffen,da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite und der Milchabzug bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken. Von der Beitragsreduktion betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen.So werden z.B.die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei 2’656 Betrieben (ohne Doppelzählungen) um 10,2% (BTS) beziehungsweise um 8,1% (RAUS) reduziert.705 Bio-Betriebe erhalten um 7,4% herabgesetzte Direktzahlungen.
■ Vollzug und Kontrolle
Die Kontrolle des ÖLN wird gemäss Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert.Diese können Organisationen,die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten,und akkreditierte Organisationen zum Vollzug beiziehen.Sie müssen die Kontrolltätigkeit stichprobenweise überprüfen.Direktzahlungsberechtigte Bio-Betriebe müssen neben den Auflagen des Biolandbaus die Vorgaben des ÖLN erfüllen und alle Nutztiere nach den RAUS-Anforderungen halten.Sie werden von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle überprüft.Die Kantone überwachen diese Kontrollen.Artikel 66 Absatz 4 der Direktzahlungsverordnung präzisiert,nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben.
Zu kontrollieren sind: –alle Betriebe,welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen; –alle Betriebe,bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden;und –mindestens 30% der übrigen Betriebe,die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind.
Bei Verstössen im ÖLN,wie z.B.falschen Angaben,werden die Betriebe nach einheitlichen Kriterien sanktioniert.Die Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren hat ein entsprechendes Sanktionsschema gutgeheissen.
■ Durchgeführte Kontrollen und Sanktionen 2003
Im Jahr 2003 waren insgesamt 57’566 Landwirtschaftsbetriebe beitragsberechtigt. Von ihnen wurden 38'999 (68%) durch die Kantone bzw.den von ihnen beauftragten Kontrollstellen auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert.Allerdings variiert der Anteil der kontrollierten Betriebe sehr stark zwischen den Kantonen (35 bis 100%).Wegen Missachtung von ÖLN-Vorschriften wurden 2’159 Betriebe (6% der kontrollierten Betriebe) sanktioniert.
Gemäss Bio-Verordnung müssen alle Bio-Betriebe jedes Jahr kontrolliert werden. Wegen Verstössen erhielten 4% eine Sanktion.
Beim BTS-Programm wurden 78% (30 bis 100%) und beim RAUS-Programm 72% (32 bis 100%) der beitragsberechtigten Betriebe kontrolliert.Bei beiden Programmen erhielten 3% der kontrollierten Betriebe eine Sanktion.
Gesamthaft wurden bei 6’136 Betrieben Mängel festgestellt,was Beitragskürzungen von rund 8,2 Mio.Fr.zur Folge hatte.
nicht rechtzeitige Anmeldung,mangelhafte Aufzeichnungen,nicht tiergerechte Haltung der Nutztiere,ungenügender ökologischer Ausgleich, ungenügende Puffer- und Grasstreifen,nicht ausgeglichene Düngerbilanz,nicht geregelte Fruchtfolge,nicht geeigneter Bodenschutz, mangelhafte Auswahl und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
nicht rechtzeitige Anmeldung,zu frühe oder unzulässige Nutzung,falsche Flächenangaben, Verunkrautung,unzulässige Düngung und Pflanzenschutz,falsche Angabe der Anzahl Bäume
nicht rechtzeitige Anmeldung,Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung,falsche Flächenangaben,unzulässige Pflanzenschutzmittel
falsche Angaben,nicht rechtzeitige Anmeldung, im Bio-Landbau nicht zugelassene Dünger und Pflanzenschutzmittel
nicht rechtzeitige Anmeldung,Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften,kein Mehrflächen-Haltungssystem,mangelhafter Liegebereich,mangelhafte Stallbeleuchtung, falsche Angaben
zu wenig Auslauftage,mangelhafte Aufzeichnungen,nicht alle Tiere einer Kategorie nach den Vorschriften gehalten,ungenügender Laufhof,nicht rechtzeitige Anmeldung,falsche Angaben
nicht rechtzeitige Anmeldung,Unter- oder Überschreitung des Normalbesatzes,unsachgemässe Weideführung,Nutzung nicht beweidbarer Flächen,falsche Angaben zu Fläche / Tierbestand / Daten / Sömmerungsdauer
falsche Flächenangaben,falsche Angaben zum Betrieb oder Bewirtschafter,falsche Tierbestandesangaben,falsche Angaben zur Sömmerung
keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
keine Angaben möglich
Quelle:Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen
■ Nichterfüllung des ÖLN wegen höherer Gewalt

In speziellen Fällen,wo die Auflagen des ÖLN aufgrund höherer Gewalt nicht oder nur teilweise erfüllt werden können,kann der Kanton gemäss Artikel 15 Absatz 2 der Direktzahlungsverordnung Ausnahmen gewähren.Für die Aufrechterhaltung der Beitragsberechtigung muss ein bewilligtes Gesuch vorliegen.Im Jahr 2003 wurden wegen der Trockenheit von den Kantonen in Absprache mit dem BLW Ausnahmebewilligungen im Bereich Ökoausgleich,Nährstoffbilanz und Bodenschutz erlassen.
In witterungs- und standortbedingten Spezialfällen wird,um die Kultur zu schützen, der Einsatz im ÖLN nicht erlaubter Pflanzenschutzmittel oder Behandlungsarten zugelassen.Deshalb können die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen,gestützt auf Anhang 6.4 der Direktzahlungsverordnung,Sonderbewilligungen ausstellen.Im Jahr 2003 gab es für 7’651 ha LN 2‘975 Sonderbewilligungen.Am meisten bewilligt wurde analog zu den Vorjahren die Behandlung von Verunkrautung in Naturwiesen.Dabei ging es vor allem um die Bekämpfung von Blacken (Ampfer) und Hahnenfuss.Der Einsatz von Insektiziden nahm gegenüber dem Vorjahr stark zu,da die Schadschwelle für Getreidehähnchen wegen der Wärme und der Trockenheit oft überschritten wurde.
Erteilte Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz 2003
Tabellen
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Schutz und Pflege der Kulturlandschaft,Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab.Die Flächenbeiträge werden seit dem Jahr 2001 mit einem Zusatzbeitrag für das offene Ackerland und die Dauerkulturen ergänzt.
Ansätze 2003Fr./ha 1
– bis 30 ha 1 200
– 30 bis 60 ha900
– 60 bis 90 ha600
– über 90 ha 0
1Der Zusatzbeitrag für offenes Ackerland und Dauerkulturen beträgt 400 Fr.pro ha und Jahr;auch er unterliegt der Flächenabstufung
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25%.Insgesamt handelt es sich um 5’001 ha,welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden.
Flächenbeiträge 2003 (inkl.Zusatzbeitrag)
Der Zusatzbeitrag wurde für insgesamt 272’141 ha offenes Ackerland und 17'872 ha Dauerkulturen ausgerichtet.
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen 2003
Von der Beitragsdegression betroffen sind 8,9% der LN.Im Durchschnitt wird pro ha ein Flächenbeitrag von 1'283 Fr.ausbezahlt (inkl.Zusatzbeitrag).Die Betriebe mit einer Fläche bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 9,5% der gesamten LN.Eine Betriebsgrösse von mehr als 60 ha weisen lediglich 1,2% aller Betriebe aus;sie bewirtschaften 4,8% der gesamten LN.

Die Massnahme hat zum Ziel,die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig im Grasland Schweiz die flächendeckende Pflege durch Nutzung sicherzustellen.
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere,die während der Winterfütterung (Referenzperiode:1.Januar bis Stichtag des Beitragsjahrs) auf einem Betrieb gehalten werden.Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe,Ziegen,Bisons,Hirsche, Lamas und Alpakas.Die Beiträge werden für Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt.Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE) und sind je ha begrenzt.Die Begrenzung ist abgestuft nach Zonen.

Die RGVE sind in zwei Beitragsgruppen aufgeteilt.Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung,Bisons,Milchziegen und Milchschafe werden 900 Fr.,für die übrigen Ziegen und Schafe,sowie Hirsche,Lamas und Alpakas 400 Fr.je RGVE ausgezahlt.
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2003
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion
Zu Beiträgen berechtigende
RGVEAnzahl91 34285 850159 699336 891
BetriebeAnzahl10 69811 13815 86137 697
Zu Beiträgen berechtigende
RGVE pro BetriebAnzahl8,57,710,18,9
Beiträge pro BetriebFr.7 3466 6328 5267 632
Total Beiträge1 000 Fr.78 58873 870135 234287 692
Total Beiträge 20021 000 Fr.76 71473 489133 018283 221
Quelle:BLW
Bei den Verkehrsmilchproduzenten wurde im Jahr 2003 pro 4‘400 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE vom beitragsberechtigten Bestand in Abzug gebracht. Die Beitragssumme ist gegenüber dem Vorjahr um ca.4,5 Mio.Fr.höher ausgefallen, was insbesondere auf die Aufgabe der Verkehrsmilchproduktion in rund 1'500 Betrieben zurückzuführen ist.
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2003
MerkmalEinheitBetriebe mit Betriebe ohne vermarkteter vermarktete MilchMilch
BetriebeAnzahl20 09817 599
Tiere pro BetriebRGVE23,612,8 Abzug aufgrund Beitragsbegrenzung der GrünflächeRGVE1,21,2 MilchabzugRGVE15,80,0
Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE6,611,6 Beiträge pro BetriebFr.5 8159 706
Quelle:BLW
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar rund 3'900 Fr.weniger RGVEBeiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch.Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z.B.Zulage für verkäste Milch).
■ Abgeltung der Produktionserschwernisse
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone abgegolten.Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere,bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung),werden bei dieser Massnahme auch soziale,strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt.Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere.Die Beiträge werden für höchstens 20 RGVE je Betrieb ausgerichtet.
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 2003
region 1 regionregion
Gegenüber dem Vorjahr haben die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen infolge des laufenden Strukturwandels um rund 2,3 Mio.Fr. abgenommen.Dementsprechend verzeichnen die zu Beiträgen berechtigenden RGVE eine Abnahme um ca.4’700 Einheiten.Weiter zurückgegangen ist die Betriebszahl, und zwar um 312 Einheiten.
Verteilung der Raufutter verzehrenden Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen nach Grössenklassen 2003
Im Beitragsjahr 2003 standen rund 40% des RGVE-Bestandes in beitragsberechtigten Betrieben,die von der Limite betroffen sind.Bei diesen Betrieben betrug der Anteil der RGVE ohne Beitrag 33%.
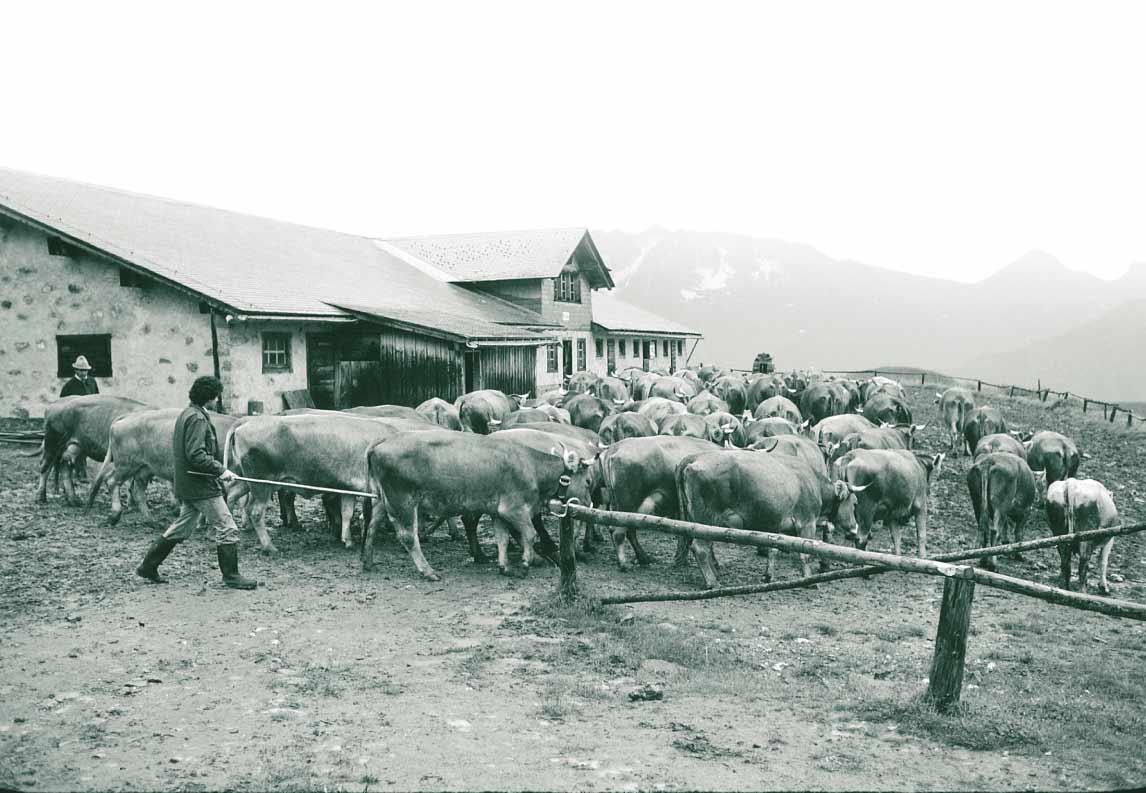
■ Allgemeine Hangbeiträge:Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion abgegolten.Sie werden nur für Wies-,Streuund Ackerland ausgerichtet.Wiesen müssen jährlich mindestens einmal,Streueflächen alle ein bis drei Jahre geschnitten werden.Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt.
2003
Total 558 642 ha
Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert von Jahr zu Jahr.Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab,die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben.
■ Hangbeiträge: Zur Erhaltung der Rebflächen in Steilund Terrassenlagen
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei,Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten.Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden,wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden.Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden nur für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet.Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig.

Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2003
Der Anteil der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 28% und der Anteil Betriebe gemessen an der Gesamtzahl aller Rebbaubetriebe 50%.
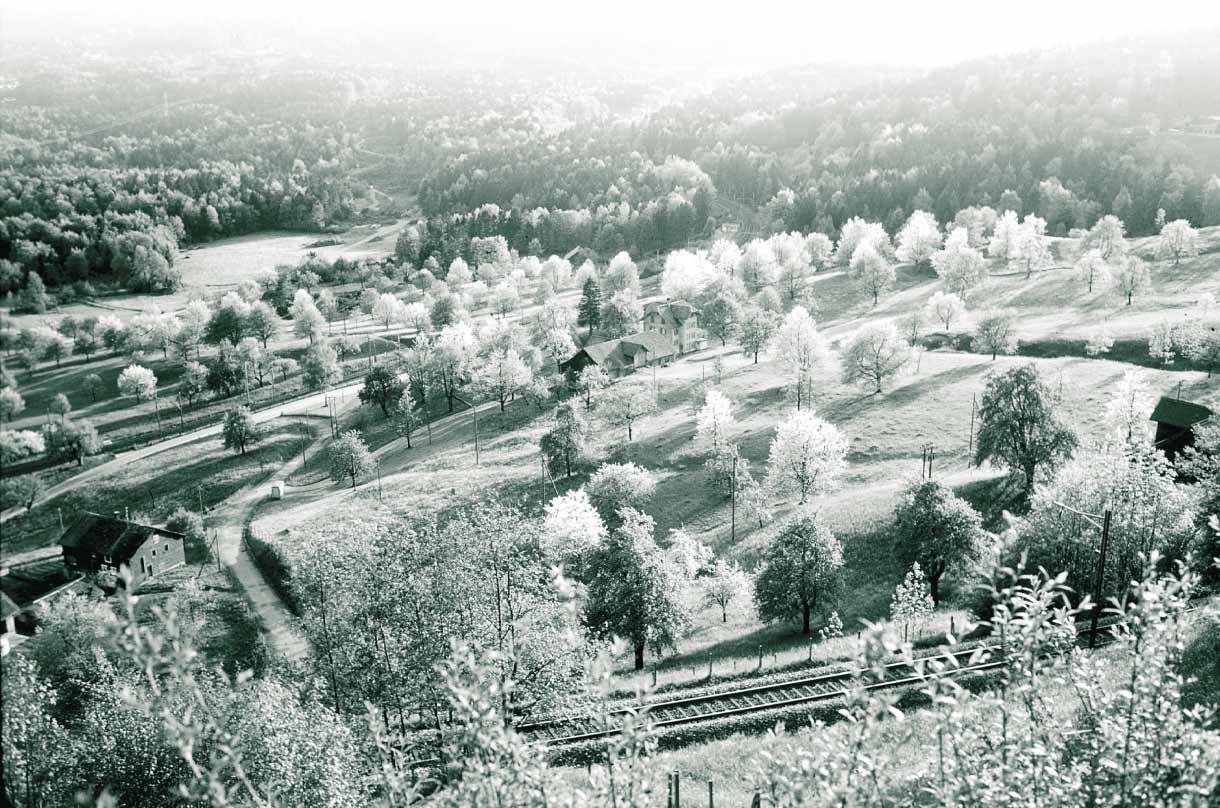
Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab,deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen.Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten,bei denen sie freiwillig mitmachen können.Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig;die Beiträge können kumuliert werden.
■ Extensiv genutzte Wiesen
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert werden.Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei.Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN angerechnet werden.Daneben gibt es Elemente,die nur für den ökologischen Ausgleich beim ÖLN anrechenbar sind,nicht aber mit Beiträgen abgegolten werden.
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Beim ÖLN anrechenbare Elemente Beim ÖLN anrechenbare Elemente mit Beiträgen ohne Beiträge extensiv genutzte Wiesenextensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte WiesenWaldweiden
Streueflächeneinheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen
Hecken,Feld- und UfergehölzeWassergräben,Tümpel,Teiche BuntbrachenRuderalflächen,Steinhaufen und -wälle RotationsbrachenTrockenmauern
Ackerschonstreifenunbefestigte natürliche Wege Hochstamm-FeldobstbäumeRebflächen mit hoher Artenvielfalt
weitere,von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN
Die Flächen dürfen nicht gedüngt und während sechs Jahren in Abhängigkeit zur Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt werden.Das späte Mähen soll gewährleisten,dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird.So bleibt auch zahlreichen wirbellosen Tieren,bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion.
Die Beiträge für extensiv genutzte Wiesen,Streueflächen,Hecken,Feld- und Ufergehölze sind einheitlich geregelt und richten sich nach der Zone,in der sich die Fläche befindet.Der Anteil an extensiven Wiesen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
■ Streueflächen
Beiträge für extensiv genutzte Wiesen 2003
■ Hecken,Feld- und Ufergehölze
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten,welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden.
Beiträge für Streueflächen 2003
Als Hecken,Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-,Hoch- oder Baumhecken,Windschutzstreifen,Baumgruppen,bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze. Die Flächen müssen während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet und sachgerecht gepflegt werden.
Beiträge für Hecken,Feld- und Ufergehölze 2003
■ Wenig intensiv genutzte Wiesen
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden.
Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen 2003
■ Buntbrachen
Als Buntbrachen gelten mehrjährige,mit einheimischen Wildkräutern angesäte,ungedüngte Streifen von mindestens 3 m Breite.Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter.In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung.Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung.Für Buntbrachen werden pro ha 3'000 Fr.ausgerichtet.Die Beiträge gelten für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone.

Beiträge für Buntbrachen 2003
Die Buntbrache ist im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Getreidemarktes eine wirtschaftlich interessante Alternative zu den Ackerkulturen geworden.
Als Rotationsbrachen gelten ungedüngte ein- bis zweijährige,mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen,die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen.In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich.In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel,Hasen und Insekten Lebensraum.Für die Rotationsbrachen werden in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone pro ha 2'500 Fr. ausgerichtet.
Beiträge für Rotationsbrachen 2003
■ Ackerschonstreifen
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben.Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen wie Getreide,Raps,Sonnenblumen,Eiweisserbsen,Ackerbohnen und Soja,nicht jedoch Mais.Im Jahr 2003 wurden pro ha 1’500 Fr.bezahlt. Beiträge gibt es nur für Flächen in der Tal- und Hügelzone.
Beiträge für Ackerschonstreifen 2003
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1
BetriebeAnzahl106300136
Flächeha256031
Fläche pro Betriebha0,240,190,000,23
Beitrag pro BetriebFr.3562850340
Beiträge1 000 Fr.389046
Beiträge 20021 000 Fr.448052
1Hier handelt es sich um Betriebe,die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften Quelle:BLW
■ HochstammFeldobstbäume
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume,die nicht in einer Obstanlage stehen,sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven. Im Jahr 2003 wurden pro angemeldeten Baum 15 Fr.ausgerichtet.
Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume 2003

Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 2003
Total 96 887 ha
Ackerschonstreifen 0,0% Buntbrachen 2,5%
Rotationsbrachen 1,4%
Wenig intensiv genutzte Wiesen 36,4%
Feld- und Ufergehölze 2,4%

1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume
Extensiv genutzte Wiesen 50,3%
Streueflächen 7,0%
Quelle: BLW
Seit dem 1.Mai 2001 ist die Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (ÖkoQualitätsverordnung, ÖQV,SR 910.14) in Kraft.
Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern,unterstützt der Bund auf der LN ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen mit Finanzhilfen.Die Anforderungen, welche die Flächen für die Beitragsberechtigung gemäss der ÖQV erfüllen müssen, werden durch die Kantone festgelegt.Der Bund überprüft die kantonalen Vorgaben auf Grund von Mindestanforderungen.Entsprechen die kantonalen Anforderungen den Mindestanforderungen des Bundes und ist die regionale Mitfinanzierung gewährleistet,so leistet der Bund Finanzhilfen an die von den Kantonen an die Landwirte ausgerichteten Beiträge.Die Finanzhilfen des Bundes bewegen sich je nach Finanzkraft der Kantone zwischen 70 und 90% der anrechenbaren Beiträge.Die restlichen 10–30% müssen durch Dritte (Kanton,Gemeinde,Private,Trägerschaften) übernommen werden.Beiträge für die biologische Qualität und die Vernetzung sind kumulierbar.Die Verordnung beruht auf Freiwilligkeit,finanziellen Anreizen und der Berücksichtigung regionaler Unterschiede bezüglich der Biodiversität.
Anrechenbare Ansätze
Ansätze 2003Fr.
– für die biologische Qualität500.–/ha
– für die biologische Qualität der Hochstamm-Feldobstbäume20.–/Baum
– für die Vernetzung500.–/ha
Eine ökologische Ausgleichsfläche trägt vor allem dann zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei,wenn sie bestimmte Zeigerarten und Strukturmerkmale ausweist und/oder an einem ökologisch sinnvollen Standort liegt.Während sich der Bewirtschafter einer ökologischen Ausgleichsfläche für die biologische Qualität direkt anmelden kann,braucht es für die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen ein Konzept,das mindestens eine landschaftlich und ökologisch begründbare Einheit abdeckt.
Beiträge gemäss Öko-Qualitätsverordnung 2003
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion
BetriebeAnzahl5 0494 4716 91416 434
Fläche 1 ha6 8997 58814 55929 046
Fläche 1 pro Betriebha1,371,702,111,77
Beitrag pro BetriebFr.879995832891
Beiträge1 000 Fr.4 4414 4485 74914 638
Beiträge 20021 000 Fr.2 6563 5002 7788 934
1Hochstamm umgerechnet:1 Baum = 1 AreQuelle:BLW
■ Umsetzung der ÖkoQualitätsverordnung im Vernetzungsprojekt Seedorf
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2003
MerkmalEinheitbiologische Vernetzungbiologische Qualität Qualität und Vernetzung 1
Extensiv genutze Wiesen,wenig intensiv genutze Wiesen,Streueflächen
BetriebeAnzahl 11 6131 0881 790
Flächeha17 3271 2045 865
Beiträge1 000 Fr.6 6345802 458
Hecken,Feld- und Ufergehölze
BetriebeAnzahl 475536215
Flächeha11017073
Beiträge1 000 Fr.437648
Hochstammfeldobstbäume
BetriebeAnzahl 3 412388826
BäumeStück200 46315 61879 892
Beiträge1 000 Fr.3 232711 007
Andere Elemente
BetriebeAnzahl -951-
Flächeha-1 337-
Beiträge1 000 Fr.-489-
1 Als Verbund der beiden Programme Quelle:BLW
Im Weiler Seedorf der Freiburger Gemeinde Noréaz hat ein initiativer Landwirt ein ÖQV-Projekt zur Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen lanciert und seine Kollegen und Nachbarn zur Teilnahme bewegt.Von Beginn an sind die Bauern vom Landwirtschaftlichen Institut Grangeneuve unterstützt worden.Das Projekt umfasst sechs Betriebe und 267 ha landwirtschaftliche Nutzfläche.In der Ebene wird Futterund Ackerbau betrieben,an den Hängen Gras- und Weidewirtschaft.Naturgüter des Perimeters sind der für Amphibien und Libellen sehr wertvolle Seedorfsee,die Feuchtwiesen an dessen Ufer,die Bäche und Bachufer,die Hochstamm-Obstgärten,die südlich ausgerichteten Hänge am Waldrand sowie die Waldlichtungen.
Der Landwirt begründet seine Initiative mit der guten Ausgangslage durch die bereits vorhandenen Naturelemente und dem ökologischen Potenzial.Auch schätzen seine Bienen die Blüten der Hochstammbäume,Buntbrachen und extensiven Wiesen.Die Beiträge von Bund und Kanton bieten einen interessanten finanziellen Anreiz.Zudem ist es möglich,eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen.
Die ÖQV-Richtlinie des Kantons Freiburg orientiert sich am «bottom-up»-Prinzip.In Abkehr zum bislang in der Landwirtschaftspolitik angewandten «top-down»-Prinzip wird nicht von oben bis ins Detail vorgeschrieben,was zu tun ist.Gefragt ist die Initiative der Direktbetroffenen.Innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen entscheidet die lokale Projektträgerschaft selbst,wie sie ihr Vernetzungsprojekt gestalten und organisieren will.
Für die Ausarbeitung des Projektes und die Projektleitung haben die Landwirte einen Biologen beauftragt.Dieser erstellte eine detaillierte Aufnahme der bestehenden ökologischen Ausgleichsflächen und weiterer naturnaher Elemente.Es wurden Zielund Leitarten bestimmt,welche mit den getroffenen Massnahmen gefördert werden sollen.Die Kriterien dabei waren Vorhandensein und Verbreitung im Perimeter,Gefährdungsstatus gemäss Roter Liste,charakteristische Naturelemente des Perimeters und Raumbedürfnisse.Unter den gewählten Arten sind Feldhase,Grünspecht,Goldammer, Gartenrotschwanz,Feldlerche,Zauneidechse,Kleiner Perlmutterfalter,Prachtlibelle und Sumpffarn.
Der beauftragte Biologe hat für jeden Betrieb Ziele festgelegt und Massnahmen vorgeschlagen.Die Landwirte konnten zwischen mehreren Möglichkeiten wählen.Um die für eine Vernetzung erforderliche maximale Distanz von 200 m zwischen zwei Naturelementen zu erreichen,wurden neue ökologische Ausgleichsflächen geplant.Es erfolgt nun unter anderem die Anlage von mindestens 5 m breiten extensiven Wiesen entlang der Fliessgewässer,von mindestens 10 m breiten extensiven Wiesen entlang der stehenden Gewässer,von Buntbrache- und Waldrandstreifen sowie die Pflanzung von Hochstamm-Feldobstbäumen.Zudem werden wenig intensiv genutzte Wiesen umgewandelt in extensiv genutzte Wiesen,Altgrasstreifen stehen gelassen und Strukturelemente wie Ast- und Steinhaufen neu angelegt.Für das Projekt werden Synergien genutzt mit dem Forstamt (Unterhalt der Waldränder),mit dem kantonalen Büro für Natur- und Landschaftsschutz (Unterhalt der Naturschutzzonen),dem Landwirtschaftlichen Institut Grangeneuve (Koordination mit Grundwasserschutzprojekt nach Art.62a des Gewässerschutzgesetzes) und der Vogelwarte Sempach (Monitoring der Vogelfauna).
Zur Überprüfung werden die umgesetzten Massnahmen auf einem Plan eingezeichnet und vom Projektleiter kontrolliert.Auch macht er floristische und faunistische Erhebungen und erstellt nach drei bzw.sechs Jahren einen Zwischen- bzw.Schlussbericht.
Das ÖQV-Projekt bewirkt neben der Verbesserung der Lebensräume für Fauna und Flora auch eine Sensibilisierung der Landwirte und der Bevölkerung für die biologische Vielfalt.Es fördert zudem die Eigenverantwortung und die Zusammenarbeit der Landwirte.Dies kommt dem Image der Landwirtschaft zugute.

Diese Massnahme hat zum Ziel,den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren,Fungizide,chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide zu fördern.Die Anforderungen sind auf der gesamten Brotgetreide-,Futtergetreide- oder Rapsfläche eines Betriebes einzuhalten.Im Jahr 2003 wurden pro ha 400 Fr.ausgerichtet.
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform.Um Beiträge zu erhalten,müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb mindestens die Anforderungen der im August 2000 revidierten Bio-Verordnung vom 22.September 1997 erfüllen.

Beim biologischen Landbau wird auf chemisch-synthetisch hergestellte Hilfsstoffe,wie Handelsdünger oder Pestizide gänzlich verzichtet.Dies spart Energie und schont Wasser,Luft und Boden.Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig,die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen.Biobauern benötigen zwar mehr Energie für Infrastruktur und Maschinen.Gesamthaft erreicht der Biolandbau aber eine höhere Effizienz in der Nutzung der vorhandenen Ressourcen.Dies ist ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit des Produktionssystems.
Der Verzicht auf Herbizide fördert die Entwicklung zahlreicher Beikrautarten.Wo eine vielfältige Flora vorhanden ist,finden auch mehr Kleinlebewesen Nahrung.Dies wiederum verbessert die Ernährung der räuberisch lebenden Gliedertiere,wie der Laufkäfer,und damit die Voraussetzungen für eine natürliche Bekämpfung von Schädlingen.Zahlreicher vorkommende Pflanzen,Tiere und Mikroorganismen machen das Ökosystem robuster gegen Störungen und Stress.
Durch die organische Düngung,die schonende Bodenbearbeitung und den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel fördert der Biobauer eine grosse Menge und Vielfalt an Bodenorganismen.Die Bodenfruchtbarkeit wird durch die biologische Aktivität gefördert. Es wird Humus angereichert,die Bodenstruktur verbessert und die Bodenerosion vermindert.
Um eine optimale Abstimmung von Pflanzen,Boden,Tier und Mensch im Betrieb zu erreichen,strebt der Biobauer die Schliessung der Nährstoffkreisläufe auf dem Betrieb an.Erreicht wird dies durch die Bindung der Tierhaltung an die betriebseigene Futtergrundlage.Der Anbau von Leguminosen verbessert das Stickstoffangebot im Boden. Hofdünger und organisches Material aus Gründüngungen und Ernterückständen stellen über die Ernährung der Bodenlebewesen eine ausgewogene Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen sicher.
In der Nutztierhaltung müssen die RAUS-Anforderungen erfüllt sein.Sie bilden die Minimalanforderungen für die Tierhaltung im Biolandbau.Als weitere Massnahmen sind elektrisierende Steuerungseinrichtungen (Viehtrainer) und der Einsatz von Medizinalfutter verboten.Die Verwendung von grösstenteils betriebseigenem Futter soll eine angemessene Leistung und eine gute Gesundheit der Tiere sicherstellen. Natürliche Heilmethoden kommen im Bedarfsfall vorrangig zur Anwendung.
Im Jahr 2003 umfasste der biologische Landbau 10,3% der gesamten LN.
Beiträge für den biologischen Landbau 2003
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche nach Region 2003
19%
■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
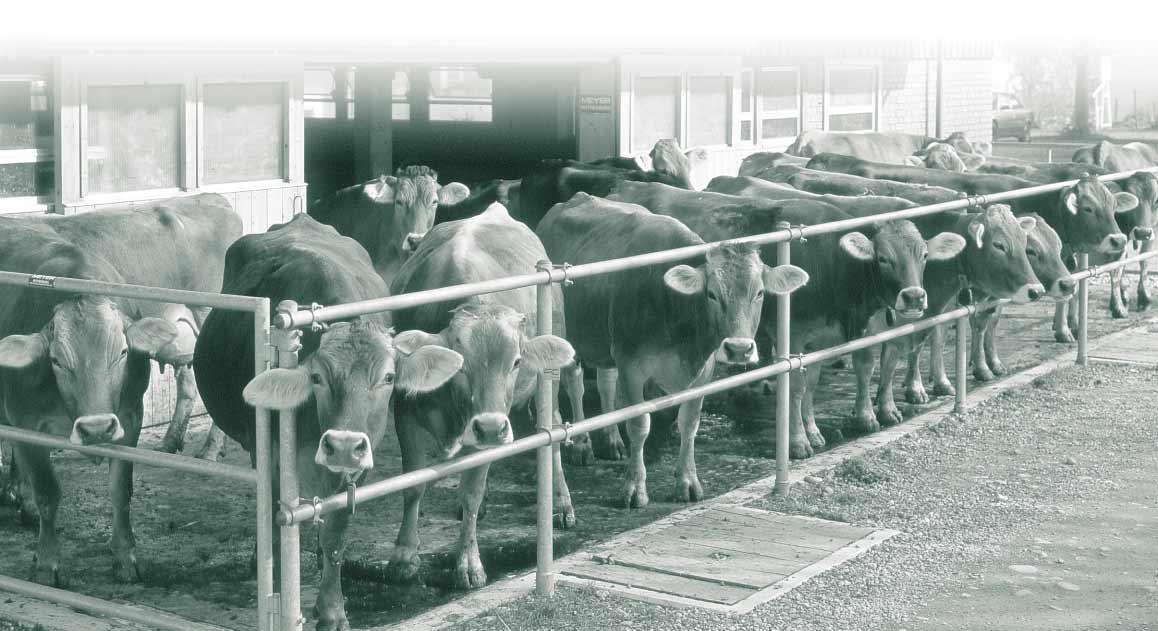
Unter diesem Titel werden die beiden im Folgenden beschriebenen Programme BTS und RAUS zusammengefasst (vgl.auch Abschnitt 1.3.2).
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen,welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen.
Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 2003
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren,auf einer Weide oder in einem Laufhof bzw.in einem Aussenklimabereich,der den Bedürfnissen der Tiere entspricht.
Beiträge für den regelmässigen Auslauf im Freien 2003
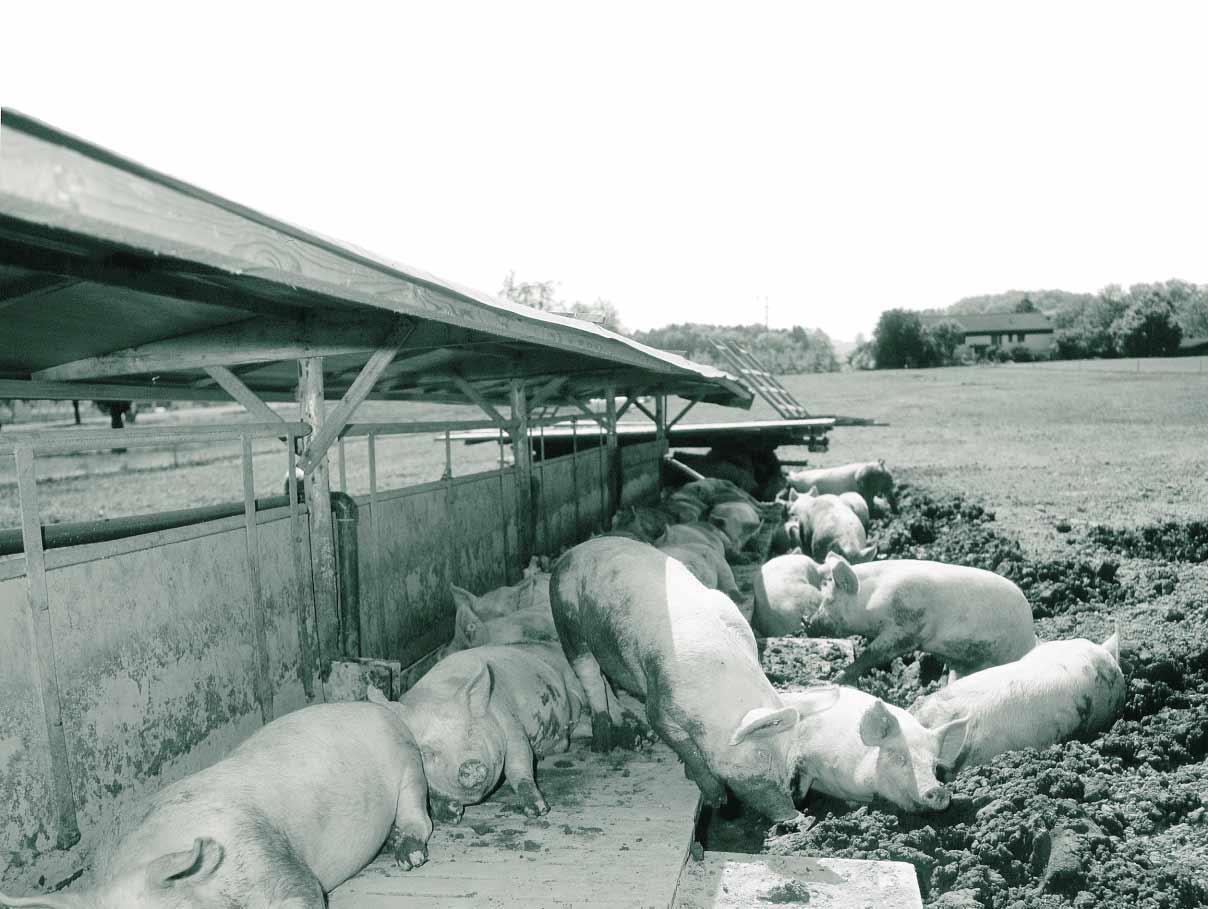
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege unserer ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden.Das Sömmerungsgebiet wird mit über 300'000 GVE genutzt und gepflegt.Die Beiträge werden nach Normalstoss (NST) bzw.GVE ausgerichtet.Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen.
Im Beitragsjahr 2003 konnten erstmals differenzierte Sömmerungsbeiträge für Schafe (ohne Milchschafe) nach Weidesystem ausgerichtet werden.Mit den höheren Beiträgen für Behirtung und Umtriebsweide werden einerseits die höheren Kosten abgegolten, andererseits wird auch,in Analogie zu den Ökobeiträgen,der Anreiz für eine besonders ökologische Schafalpung erhöht.Durch die höheren Beiträge für Behirtung und Umtriebsweide hat sich die ausbezahlte Beitragssumme für Schafe im Vergleich zum Vorjahr um ca.1,5 Mio.Fr.erhöht.
Ansätze 2003Fr.
Für gemolkene Kühe,Milchziegen und Milchschafe pro GVE (56–100 Tage Sömmerung)300
– Für Schafe ohne Milchschafe pro NST – bei ständiger Behirtung300
– bei Umtriebsweide220
– bei übrigen Weiden120
Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 300
Sömmerungsbeiträge 2003
Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes ermächtigt den Bund,Massnahmen der Landwirte zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in ober- und unterirdische Gewässer abzugelten.Das Schwergewicht wird auf die Verminderung der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen gelegt,in denen der ÖLN,der Biolandbau, Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso, ökologischer Ausgleich) nicht genügen.
Gemäss der Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet,für ober- und unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen.Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen für die Betriebe mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und 50% für Bewirtschaftungsmassnahmen.Im Jahr 2003 wurden rund 4 Mio Fr.ausbezahlt.
Aufgrund der vermehrten Beteiligung am Nitrat-Programm haben sich auch die durch den Bund geleisteten Beiträge gegenüber dem letzten Jahr erhöht.
Überblick über die Projekte 2003
ProjektgebietProjektierte Beiträge
■ Abschwemmungen und Auswaschung verhindern
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion sowie die Erfüllung der multifunktionalen Aufgaben.
Finanzhilfen für die Grundlagenverbesserung
MassnahmeRechnung Rechnung Budget 200220032004
Mio.Fr.
Beiträge Strukturverbesserungen90102 1 99
Investitionskredite707984
Betriebshilfe91237
Umschulungsbeihilfen--2
Beratungswesen und Forschungsbeiträge242424
Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge943
Pflanzen- und Tierzucht212222
Total223242271
1 inkl.Nachtragskredit Unwetter (7 Mio.Fr.)
Quelle:BLW
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt:
– Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Produktionskosten;
– Förderung des ländlichen Raums;
– Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen;

– Effiziente und umweltgerechte Produktion;
– Ertragreiche,möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte;
– Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt;
– Genetische Vielfalt.
■ Neue Massnahmen ab 2004
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert.Dies betrifft insbesondere das Berggebiet und die Randregionen.
Investitionshilfen werden für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.Es stehen zwei Instrumente zur Verfügung:
–Beiträge (à-fonds-perdu) mit Beteiligung der Kantone,vorwiegend für gemeinschaftliche Massnahmen;
–Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen,vorwiegend für einzelbetriebliche Massnahmen.
Investitionshilfen unterstützen die Landwirtschaft in der Entwicklung und der Erhaltung wettbewerbsfähiger Strukturen,ohne dass sie sich dafür untragbar verschulden muss.Auch in anderen Ländern,insbesondere in der EU,zählen die Investitionshilfen zu den wichtigsten Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raums.
Für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und die Förderung des ländlichen Raums wurden im Rahmen der Agrarpolitik 2007 im Bereich der Strukturverbesserungen neue Unterstützungsmöglichkeiten geschaffen.

Die Unterstützung an die periodische Wiederinstandstellung von Bodenverbesserungen mit pauschalen Beiträgen sichert die längerfristige Funktionstüchtigkeit der Bauten und Anlagen.Die Landwirtschaft ist zwingend auf ausreichende Infrastrukturen,wie Hofzufahrten,Bewirtschaftungs- und Alpwege sowie Anlagen zur Sanierung des Boden-/Wasser-Haushalts,angewiesen.Die Arbeiten werden planmässig in Abständen von mindestens acht bis zehn Jahren ausgeführt.
Massnahmen zur Diversifizierung der Tätigkeit im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich werden neu mit Investitionskrediten unterstützt,um zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten für bäuerliche Betriebe zu schaffen.Darlehen sollen unter anderem gewährt werden für die Aufnahme eines neuen landwirtschaftlichen Betriebszweigs in einer Produktionsnische oder für Aktivitäten,welche sich mit dem Landwirtschaftsbetrieb sinnvoll kombinieren lassen,z.B.Ferien auf dem Bauernhof, Direktvermarktung etc.
Der Aufbau bäuerlicher Selbsthilfeorganisationen kann neu ebenfalls mit Investitionskrediten im Sinne einer Starthilfe unterstützt werden.Dabei stehen die überbetriebliche Koordination des Einsatzes von Aushilfsarbeitskräften,der Abtausch von Produktionsmöglichkeiten,die Hilfeleistung in der Betriebsorganisation,der Austausch von Spezialwissen und die Verbesserung des Marktzutritts im Vordergrund.
Projekte zur regionalen Entwicklung und zur Förderung von einheimischen und regionalen Produkten,an denen die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt ist,können gemäss LwG neu mit Beiträgen gefördert werden.Damit werden die Anwendungsmöglichkeiten der Strukturverbesserungen ausgedehnt und die regionale Ausrichtung der Projekte gestärkt.Im Hinblick auf die Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen hat das BLW mehrere Forschungs- und Pilotprojekte initialisiert.
Für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten standen im Jahr 2003 Beiträge im Umfang von 102 Mio.Fr.zur Verfügung.Das BLW genehmigte neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 106 Mio.Fr.Damit wurde ein Investitionsvolumen von 410 Mio.Fr.ausgelöst.Die Summe der Bundesbeiträge an die genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen»,da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen,und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird.
Beiträge des Bundes 2003 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
Wegebauten Wasserversorgungen
Unwetterschäden und andere Tiefbaumassnahmen
Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere andere Hochbaumassnahmen
Der Bund setzte im Jahr 2003 13% mehr finanzielle Mittel in Form von Beiträgen ein als im Vorjahr.Diese Zunahme ist zu einem grossen Teil auf die Bewältigung der Unwetterschäden 2002 zurückzuführen.Das Parlament hat dazu im Jahr 2003 einen Nachtragskredit im Umfang von 7 Mio.Fr.bewilligt.Ebenso ist in den ordentlichen Rubriken 2000 und 2001 eine Erhöhung der Bundeskredite zur Behebung von Unwetterschäden enthalten.
Beiträge des Bundes an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten 1994–2003
Im Jahre 2003 bewilligten die Kantone für 2’193 Fälle Investitionskredite von insgesamt 264,3 Mio.Fr.Von diesem Kreditvolumen entfallen 89,9% auf einzelbetriebliche und 10,1% auf gemeinschaftliche Massnahmen.Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite,so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren,gewährt werden.
Investitionskredite 2003
BestimmungFälleBetragAnteil AnzahlMio.Fr.%
Einzelbetriebliche Massnahmen2 024237,589,9
Gemeinschaftliche Massnahmen,ohne Baukredite12112,04,5 Baukredite4814,85,6
Total2 193264,3100
Quelle:BLW
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden z.B.als Starthilfe,für den Neubau,den Umbau oder die Verbesserung von landwirtschaftlichen Wohn-, Ökonomieoder Alpgebäuden eingesetzt.Sie werden in durchschnittlich 14 Jahren zurückbezahlt.
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen und bauliche Massnahmen (Alpgebäude,Gebäude und Einrichtungen für die Milchwirtschaft sowie für die Verarbeitung und die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte) unterstützt.
Im seit 1963 geäufneten Fonds de roulement befinden sich rund 1,9 Mrd.Fr.Den Kantonen werden jährlich neue Bundesmittel zur Verfügung gestellt;im Jahre 2003 waren es 79,4 Mio.Fr.Diese werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt.
Investitionskredite 2003 nach Massnahmenkategorie, ohne Baukredite

■ Betriebshilfe
Die Betriebshilfe wird in Form von zinslosen Darlehen gewährt und dient dazu,eine vorübergehende,unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben. In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen indirekten Entschuldung.
Im Jahr 2003 wurden in 249 Fällen insgesamt 29,8 Mio.Fr.Betriebshilfedarlehen gewährt.Das durchschnittliche Darlehen betrug 119’737 Fr.und wird in 13 Jahren zurückbezahlt.
30 Fälle mit insgesamt 726’000 Fr.betreffen zinslose Darlehen basierend auf der Verordnung vom 5.November 2003 über Massnahmen in der Landwirtschaft auf Grund der Trockenheit im Jahr 2003 (Trockenheitsverordnung).Diese Massnahmen sind bis zum 31.Dezember 2004 befristet.
Betriebshilfedarlehen 2003
Umfinanzierung bestehender Schulden21228,6 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung371,2
Total24929,8
Quelle:BLW
Der seit 1963 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufnete Fonds de roulement beträgt zusammen mit den Kantonsanteilen 190,7 Mio.Fr.Im Jahr 2003 wurden den Kantonen 11,7 Mio.Fr.neu zur Verfügung gestellt.Diese sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden,die je nach Finanzkraft 20–80% des Bundesanteils beträgt.Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt.
■ Umschulungsbeihilfen
Die Umschulungsbeihilfe ist eine neue soziale Begleitmassnahme und erleichtert ab 2004 für selbständig in der Landwirtschaft tätige Personen den Wechsel in einen nichtlandwirtschaftlichen Beruf.Sie beinhaltet Beiträge an Umschulungskosten und Lebenskostenbeiträge für Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter,die das 52.Altersjahr noch nicht beendet haben.Die Gewährung einer Beihilfe setzt die Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs voraus.
■ Pauschalisierung der Beiträge zeigt Wirkung
Kostenreduktionen im landwirtschaftlichen Hochbau

Investitionen in landwirtschaftliche Bauten können die Produktionskosten eines Betriebes stark belasten.Sie sollten daher möglichst tief sein;es muss ein Optimum gefunden werden zwischen den Baukosten und den gewünschten Arbeitserleichterungen.Agroscope FAT Tänikon hat im Auftrag des BLW Untersuchungen durchgeführt, die den Investitionsbedarf für landwirtschaftliche Betriebsgebäude feststellen und die Baukosten mit dem benachbarten Ausland vergleichen.Die Resultate dieser Untersuchungen wurden im Agrarbericht 2003 ab Seite 230 dargestellt.
Bei der Unterstützung eines landwirtschaftlichen Hochbaus mit Investitionshilfen analysieren das BLW und die kantonalen Fachstellen die Baukosten.Eine Umfrage bei den Kantonen und Erfahrungen aus Besichtigungen und begutachteten Bauprojekten liefern weitere Elemente zu diesem Thema.Nachfolgend werden die Ergebnisse dieser Abklärungen dargestellt.
Die Analyse der in den letzten Jahren ausgeführten Bauprojekte zeigt,dass ein Trend hin zu kostengünstigeren Bauten festzustellen ist.Dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf:
– die Pauschalisierung der Investitionshilfen
Die Baukosten verlieren den direkten Einfluss auf die Höhe der Unterstützung,da die Investitionshilfen nicht mehr nach den Restkosten bestimmt werden.Einfache, kostengünstige Baulösungen (unisolierte Laufställe,Mehrraumställe,Kuhhütten, etc.) werden dadurch gefördert.Zudem wird der Landwirt mit den Pauschalen zu Eigenleistungen animiert.
– die Erhöhung der Limiten
Die Erhöhung der Limiten von 40 auf 80 GVE für Beiträge,respektive von 60 auf 120 GVE für zinslose Darlehen (IK),gibt Ansporn zum gemeinsamen Bauen und Bewirtschaften,denn grössere Einheiten weisen tiefere spezifische Kosten aus.
– die Pauschalen für Hauptelemente
Mit Pauschalen für die Hauptelemente Stall,Heu- und Siloraum,Hofdüngeranlage sowie Remise wird das etappenweise Vorgehen erleichtert und der administrative Aufwand reduziert.
einfache und rasche Verfahren
Bei grösseren Unternehmen werden die möglichen Finanzhilfen frühzeitig mit einem Vorbescheid in Aussicht gestellt.Auf Grund eines Gesuches durch den Kanton erlässt das BLW eine Verfügung der Investitionshilfen,die dem Landwirt gestattet, die Arbeitsvergebungen in einem optimalen Zeitpunkt und zu günstigen Konditionen auszuhandeln.
– den FAT-Preisbaukasten
Der Preisbaukasten der FAT,der alle 2–3 Jahre den aktuellen Baukosten angepasst wird,ist ein gutes Arbeitsinstrument für die frühe Abschätzung der zu erwartenden Baukosten und für den Vergleich von Varianten.
■ Wo sind Sparpotenziale vorhanden?
Bei einem landwirtschaftlichen Bauvorhaben können die Kosten wie folgt aufgeteilt werden:
Bereich
Arbeiten vor Ort: Aushub, Eisenbeton, Maurerarbeiten, Montagen
standardisierte Gebäudehülle: Tragwerke, Fassaden, Wände, Dach Installationen, Einrichtungen: Milchgewinnung, Futterlagerung, Fütterung, Boxen

Güllengrube
min. 13 m2 Bodenfläche/GVE für Liegen, Fressen, Füttern, Melken
Arbeiten vor Ort werden in der Regel von einheimischen Unternehmen ausgeführt. Dabei fallen vor allem die hohen Kosten für die Bodenplatte und die Hofdüngerlagerung ins Gewicht.Allerdings wird in der Schweiz die Decke der Güllengrube oft als Laufhof benutzt,was die Mehrkosten gegenüber freistehenden,standardisierten Güllensilos relativiert.Ausserdem werden heute in den meisten Kantonen aus Gründen der Ammoniak-Emissionen bei Neuanlagen gedeckte Güllebehälter verlangt.
Gebäudehüllen mit einfacher Ausführung und billigen Materialien bringen kurzfristig Kostenvorteile,sofern während der Verwendungsdauer keine grösseren Reparaturen anfallen.Nach dem Ende der Nutzung müssen die Baumaterialien umweltgerecht entsorgt werden.Dies kann später zu grossen Kosten führen.Standardisierte Gebäudehüllen können im billigeren Ausland eingekauft und durch die ausländische Firma montiert werden.Diese Position stellt aber nur ca.20% der Baukosten dar.Es ist zu beachten,dass die Montage nach Schweizer Normen (Statik,Gesamtarbeitsverträge, Unfallverhütung während und nach dem Bau,etc.) ausgeführt werden muss.Umfragen bei Firmen im In- und Ausland,die schlüsselfertige Scheunen zu Festpreisen anbieten, brachten ein ernüchterndes Ergebnis.Es wurde wenig Interesse am eher kleinen Schweizer Markt gezeigt.Zudem müssen auch bei schlüsselfertigen Bauten die Grundplatte,Fundamente und weitere Bauarbeiten vor Ort separat vergeben werden, dies meistens an einheimische Unternehmen.
Bei den Installationen und Einrichtungen lassen sich am ehesten Kosten einsparen, indem das Wünschbare vom Notwendigen getrennt wird.Einsparungen am Gebäude werden leider oft von luxuriösen,teuren Installationen wieder wettgemacht.Diese Feststellung wiegt noch schwerer,weil beim Gebäude mit einer Nutzungsdauer von über 30 Jahren gerechnet werden kann (sofern mit flexiblen Elementen gebaut wurde), die Installationen aber innerhalb von zehn Jahren abzuschreiben sind.
Trotz der anhaltenden Baukrise darf kaum erwartet werden,dass im Rohbau (Aushub, Baumeisterarbeiten,Stahlbeton,Zimmerarbeiten,Fenster,Türen,Tore,Dach,Fassaden etc.) grosse Preisreduktionen eintreten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten,die Baukosten zu begrenzen.So kann ein breites Submissionsverfahren für die Arbeiten vor Ort (Aushub,Eisenbeton,Baumeister etc.) zu günstigen Angeboten führen.Dazu ist allerdings ein erfahrener Projektverfasser empfehlenswert,der Unterlagen für Offerten erstellt,womit auch Dumpingangebote ausgeschieden werden können.Solche beinhalten die Gefahr von Kostenüberschreitungen infolge Regiearbeiten,Verzögerungen,unfachmännischer Bauausführung,etc.
Werden die Arbeiten nach Stundenansatz (Regie) ausgeführt,z.B.durch Baugenossenschaften unter Mithilfe des Landwirtes,so ist eine gewissenhafte Kontrolle von Arbeitsstunden und Materiallieferungen notwendig um zu verhindern,dass Arbeiter und Maschinen bei schlechtem Wetter auf der Baustelle zu Lasten des Bauherrn herumstehen.Auch mit Eigenleistungen lassen sich Kostenreduktionen erzielen.Diese sollten jedoch gezielt geplant sein.Risiken und Unsicherheiten wie Unfälle,Haftung des Landwirts,Mängelrügen,etc.dürfen nicht vernachlässigt werden.
Weitere Möglichkeiten für die Senkung von Baukosten sind:
– das Optimieren von Betriebskonzept und Baukonzept mit gesamtheitlichen Lösungen.Insbesondere sind Lösungen zu prüfen,die eine Zusammenarbeit mit einem Nachbarbetrieb beinhalten (z.B.Verzicht auf Jungvieh,keine Produktion von Käsereimilch,Umstellung auf Mutterkühe etc.);
– das Integrieren von bestehenden Bauteilen;
– die Wahl eines eigenleistungsfreundlichen Projektes,z.B.mit niedrigen Gebäuden und einfachen Baumaterialien wie Holz etc;
so wenig Beton und Mauerwerk wie möglich;
– Terrainaufnahmen,um das Gebäude optimal in das Gelände einzugliedern mit dem Resultat,Aushub und Auffüllungen auf ein Minimum zu begrenzen;
– das etappenweise Vorgehen mit Erweiterungsmöglichkeiten;
– das Rad nicht noch einmal erfinden,besser ähnliche Ausführungen kopieren;
– einen Projektverfasser mit Erfahrung engagieren für grössere Arbeiten vor Ort und die Hauptarbeitsbereiche offerieren lassen;
– Zimmereiarbeiten,Dachdeckerarbeiten,Einrichtungen,Installationen etc.pauschal zu Festpreisen vergeben;
– bei Auftragsverhandlungen Rabatt und Skonto verlangen mit dem Argument,dass mit den öffentlichen Investitionshilfen die Finanzierung seriös abgeklärt wurde und als gesichert gilt;
– die Arbeitsvergebungen zu einem günstigen Zeitpunkt vornehmen,bei noch leeren Auftragsbüchern der Unternehmer;
– die Orientierung des Bauherrn über seine Rechte und Pflichten gegenüber dem Projektverfasser und den Unternehmern;
– das rechtzeitige Festlegen der tragbaren Restkosten anhand des Betriebsvoranschlages und den möglichen Investitionshilfen.Nachträgliche Projektreduktionen bringen vielfach nicht die erwünschten Kosteneinsparungen;
– die Zurückhaltung bei den Installationen und Einrichtungen.Allenfalls können vorerst nur die baulichen Vorkehrungen getroffen werden,um den späteren Einbau zu erleichtern;
die Erteilung von klaren Aufträgen und die Erstellung von Verträgen und Pflichtenheften mit dem Projektverfasser,den Unternehmern und den Lieferanten;
– die Vermeidung von Projektänderungen und Projekterweiterungen;
– das Abklären des finanziellen Hintergrunds bei Haftpflichtfällen und Kostenüberschreitungen.
■ Was unternehmen die Kantone?
Bei der Beurteilung der Baukosten und des Nutzens der Ökonomiegebäude sollten die Gesamtsicht und die Kontrolle über weitere Investitionen des Landwirtschaftsbetriebs nicht verloren gehen.Oft werden Maschinen angeschafft,Milchkontingente gekauft, Land und Betriebe übernommen oder Wohnhäuser erstellt,ohne dass eingehend nach dem gesamtwirtschaftlichen Nutzen und der Notwendigkeit nachgefragt wird.
Eine Umfrage zeigt,dass auch die Kantone ein Hauptgewicht auf kostengünstiges Bauen legen und dem Landwirt bei der Ausführung grösstmöglichste Freiheiten im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen gewähren.Diverse Kantone bieten den Landwirten Bauberatungen an oder führen Kurse für Bauwillige durch.Einige Amtsstellen sollten jedoch noch verstärkt auf kostengünstiges Bauen und zweckdienliche Baulösungen achten.Statistische Erhebungen der Baukosten würden bei spezifischen Kostenfragen eine Sicherheit geben.Es darf nicht unterschätzt werden,dass ein Landwirt meistens nur einmal in seinem Leben baut,währenddem bei den Amtsstellen oft eine langjährige Erfahrung auf Grund unzähliger Projekte vorhanden ist.Dort liegen auch gute Informationen über die Projektverfasser und das einheimische Baugewerbe vor.
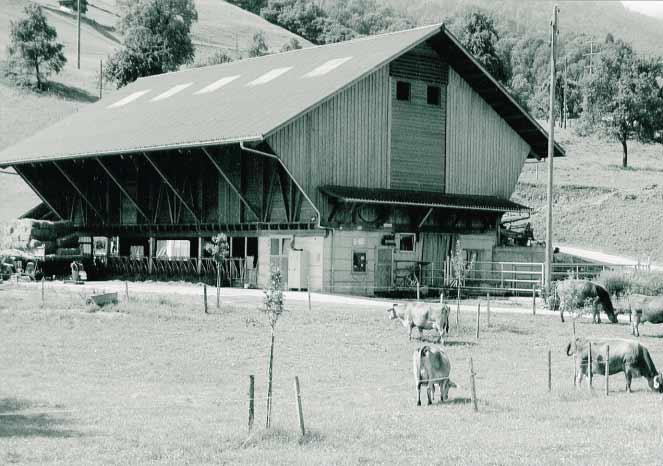
■ Agroscope – Landwirtschaftliche Forschung unter neuem Namen
Die eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten sind dem BLW unterstellt.Ihre Tätigkeiten in der anwendungsorientierten Forschung beanspruchen rund 60%,Vollzugs- und Kontrollaufgaben rund 40% der Mittel.Dank der Verbindung von angewandter Forschung mit Vollzug und Kontrolle wird gewährleistet,dass das aktuellste Know-how und eine hochwertige Infrastruktur optimal genutzt werden.
Agroscope heisst die Dachmarke,unter der die fünf landwirtschaftlichen Forschungsanstalten (Liebefeld-Posieux (ALP),FAL Reckenholz,FAT Tänikon,FAW Wädenswil und RAC Changins) ab 1.Januar 2004 gemeinsam auftreten.Agroscope gehört zum BLW.
Agroscope steht für den genauen Blick auf die Landwirtschaft:Der Name geht auf die griechischen Begriffe «agrós» (Acker,Feld) und «skopein» (ansehen,beobachten) zurück.Unter dem Dach von Agroscope deckt jedes Institut einen bestimmten Forschungsbereich konsequent ab,und die Zusammenarbeit untereinander wird weiter intensiviert.Der gemeinsame Auftritt erlaubt auch,Synergien im Bereich Kommunikation zu nutzen.
■ Fusionen von Forschungsanstalten
Im Rahmen des Entlastungsprogramms 2003 des Bundes werden die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten bis 2006 Einsparungen von rund 5 Mio.Fr.realisieren müssen.Es wurden verschiedene Lösungsvorschläge erarbeitet,die unter anderem auch Varianten für Fusionen von Forschungsanstalten beinhalten.Ausgehend von diesen Vorschlägen wurde entschieden:FAL und FAT einerseits und FAW und RAC andererseits werden fusioniert.Die heutigen Standorte werden beibehalten.Deshalb das Motto:Jeweils eine Führung,jeweils zwei Standorte.Bereits früher entschieden wurde,dass sich die ehemaligen Forschungsanstalten für Milchwirtschaft (FAM) und für tierische Produktion (RAP) ab 1.Januar 2004 zu Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) zusammen schliessen.
FAW und RAC werden sich der Pflanzenproduktion,ALP der Tierproduktion widmen. Mit FAL und FAT werden die Querschnittsbereiche Ökonomie, Ökologie und Agrartechnik unter einem Dach zusammengeführt.
Die landwirtschaftliche Forschung des Bundes wird sich noch klarer profilieren können, weil die Zusammenarbeit einfacher und der Auftritt nach aussen einheitlicher wird.Die drei neuen Einheiten werden dank fachlicher Stärke neue Forschungsperspektiven eröffnen.Die Wettbewerbsfähigkeit auf dem nationalen und internationalen Forschungsmarkt wird gesteigert.
■ Zielsetzungen zu 95% erreicht
Die Beurteilung der Forschungsleistungen erfolgt anhand konkreter Indikatoren und Standards.Die Zielvorgaben wurden zu rund 95% erreicht.Agroscope konnte das im vergangenen Jahr erreichte,hohe Leistungsniveau halten.Nur einige wenige Projekte liessen sich wegen fehlendem Fachpersonal oder einer im Laufe des Jahres erforderlichen neuen Prioritätensetzung nicht verwirklichen.
Der Leistungsauftrag 2000–2003 ist ausgelaufen.Während der gesamten Periode hat die landwirtschaftliche Forschung mit ihren Kontroll- und Zulassungsaufgaben im Produktionsmittelbereich insbesondere einen Beitrag zur Erhöhung der Ernährungssicherheit geleistet.Die Qualität der pflanzlichen und tierischen Erzeugnisse sowie der Umweltschutz waren ebenfalls Schwerpunkte dieses Zeitraums.Die Forschung unterstützt die landwirtschaftlichen Betriebe,indem sie neue Produktionsformen (extensive Mast usw.) entwickelt und Empfehlungen erarbeitet (Optimierung des Maschinenparks,Einsatz neuer Techniken).
Die Resultate des Nationalgestüts für das Jahr 2003 sind sehr zufrieden stellend.Von insgesamt 39 in der Leistungsvereinbarung 2003 festgelegten Zielen wurden deren 38 (97%) erreicht oder sogar übertroffen.Die Haltungsbedingungen der Hengste auf dem Gestüt müssen noch verbessert werden,damit sie den 2001 veröffentlichten BVETRichtlinien voll und ganz entsprechen.
■ Neuer Leistungsauftrag 2004–2007 für Agroscope
Der neue Leistungsauftrag für Agroscope ist das Ergebnis von drei Jahren Arbeit in mehreren Etappen:langfristige Strategie der landwirtschaftlichen Forschung (Foresight),Forschungskonzept 2004–2007 und Leistungsauftrag (2004–2007).Anhand dieser verschiedenen Vorgaben und nach mehrfacher eingehender Befragung der Kunden haben die Forschungsanstalten ihre Tätigkeitsprogramme 2004–2007 erstellt.

Im Leistungsauftrag hat jede Produktegruppe ihre jeweiligen Zielsetzungen für diese Periode festgelegt:
Produktegruppe 1:Ackerbau,Grasland und Agrarökologie
Die Produktegruppe 1 unterstützt mit der Erforschung der Ursachen-Wirkungsbeziehungen in Ackerbausystemen die Ökologisierung der Produktion.Der biologische Landbau ist dabei ein besonderes Anliegen.Durch Optimierung der ökologischen Nutzung von Wiesen und Weiden fördert die Produktegruppe 1 die Entwicklung nachhaltiger Gras- und Alpwirtschaftssysteme.Ein Kernanliegen besteht darin,die Sicherheit der Agrarsysteme im Dienste einer sowohl gesunden und qualitativ hoch stehenden Lebensmittel- und Futtermittelproduktion zu erhöhen und die Qualitätssicherung zu gewährleisten.
Die Produktegruppe 1 erarbeitet die für eine langfristige Sicherheit und Schonung der natürlichen Ressourcen sowie der Biodiversität erforderlichen Grundlagen.Dabei stehen die Früherkennung und Beurteilung der Gefährdung der natürlichen Ressourcen und die Abschätzung der Chancen und Risiken durch den Einsatz transgener Pflanzen und exotischer Organismen in der Landwirtschaft im Zentrum.Die agrarökologische Erfolgskontrolle prüft die Wirkung der verschiedenen Massnahmen und liefert Grundlagen zur Weiterentwicklung der agrarökologischen und umweltpolitischen Ziele und Massnahmen.
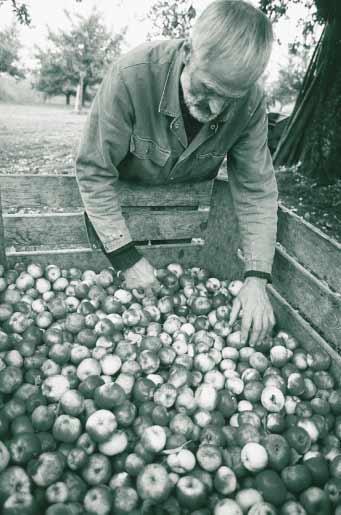
Durch ihre Tätigkeit trägt die Produktegruppe 2 zu einer nachhaltigen Landwirtschaft mit einem starken,wettbewerbsfähigen und marktgerecht produzierenden Sektor Spezialkulturen in den Hauptanbaugebieten und in Randregionen bei.Dank ihres wichtigen Beitrags an die Qualität und Sicherheit der Produkte aus den Spezialkulturen (Obst,Beeren,Gemüse,Medizinalpflanzen) und deren Veredelungsprodukte (z.B. Fruchtsäfte,Wein) verschafft die Produktegruppe 2 den Schweizer Spezialkulturen in der Schweiz einen Standortvorteil.Die einwandfreie Qualität und ein gutes Image fördern das Vertrauen und die Treue der Bevölkerung für gesunde,unbedenkliche und attraktive Produkte,die hohen ökologischen Standards entsprechen.
Die Produktegruppe 2 generiert einen Mehrwert für die Produzenten (inkl.vor- und nachgelagerte Bereiche),für die Öffentlichkeit (Konsumenten) und den Staat (Politik und Behörden) durch die Nutzung der Synergien,die sich aus der angewandten Forschung,dem Wissenstransfer und dem Vollzug hoheitlicher Aufgaben unter einem Dach ergeben.Dank der Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern kann die Produktegruppe 2 ihre Kompetenzen erweitern und ihre wichtige Funktion als Quelle für Neuerungen stärken.Die Produktegruppe 2 arbeitet interdisziplinär und fördert den systemischen Ansatz (vom Anbau zur Lagerung über die Verarbeitung der Erzeugnisse aus den Spezialkulturen).Sie ist in der Lage,neue Technologien einzusetzen (z.B. molekularbiologische Methoden) und deren Chancen und Risiken abzuwägen.
Produktegruppe 3:Tierische Produktion und Lebensmittel tierischer Herkunft
Die Produktegruppe 3 erarbeitet wissenschaftliche und technische Grundlagen auf dem Gebiet der tierischen Produktion (z.B.Milch,Fleisch) und Lebensmittel tierischer Herkunft.Dabei versucht sie,wichtige Entwicklungen im Bereich Qualität,Sicherheit, Ernährung,Gesundheit und natürliche Ressourcen vorauszusehen.Im Weiteren liefert sie Grundlagen für Rahmenbedingungen,Anleitungen,Kontrollen und für die Exportfähigkeit schweizerischer Agrarprodukte (insbesondere Käse).Die praxisbezogene Forschung und Beratung haben zum Ziel,gesunde,unbedenkliche Lebensmittel herzustellen,die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern,eine ökologische und marktgerechte Produktion zu fördern und Produktionssysteme in Randregionen zu unterstützen. Wichtige Elemente zur Zielerreichung sind:
Kenntnisse über den Einfluss von Futtermittelqualität,Fütterung,Tierhaltung sowie weiteren Parametern auf die Produktion,Qualität und Sicherheit von Milch,Fleisch und Bienenprodukten;
– nachhaltige Technologien für die Käseherstellung und Grundlagen für Milch- und Fleischverarbeitung;
Vollzugsaufgaben und Referenzlabor in den Bereichen Futtermittel und Milchwirtschaft;
– Umsetzung der Forschungsergebnisse für die Praxis und die Öffentlichkeit.
■ Nationalgestüt
Die Produktegruppe 4 erarbeitet agrarökonomische und agrartechnische Erkenntnisse sowie Grundlagen zur Erleichterung von Entscheidungen und Vollzugsmassnahmen anhand folgender Schwerpunkte:
–ökonomische Analysen,Prognosen,Konzepte und Evaluationen des Agrarsektors;
– Entwicklung und Betrieb technisch-ökonomischer Informationssysteme für die Politik- und Landwirtschaftsberatung;
– Betriebs- und arbeitswirtschaftliche Methoden,Analysen,Konzepte und Evaluationen für Produktionsverfahren und landwirtschaftliche Unternehmen einschliesslich geeigneter Umweltmanagementinstrumente;
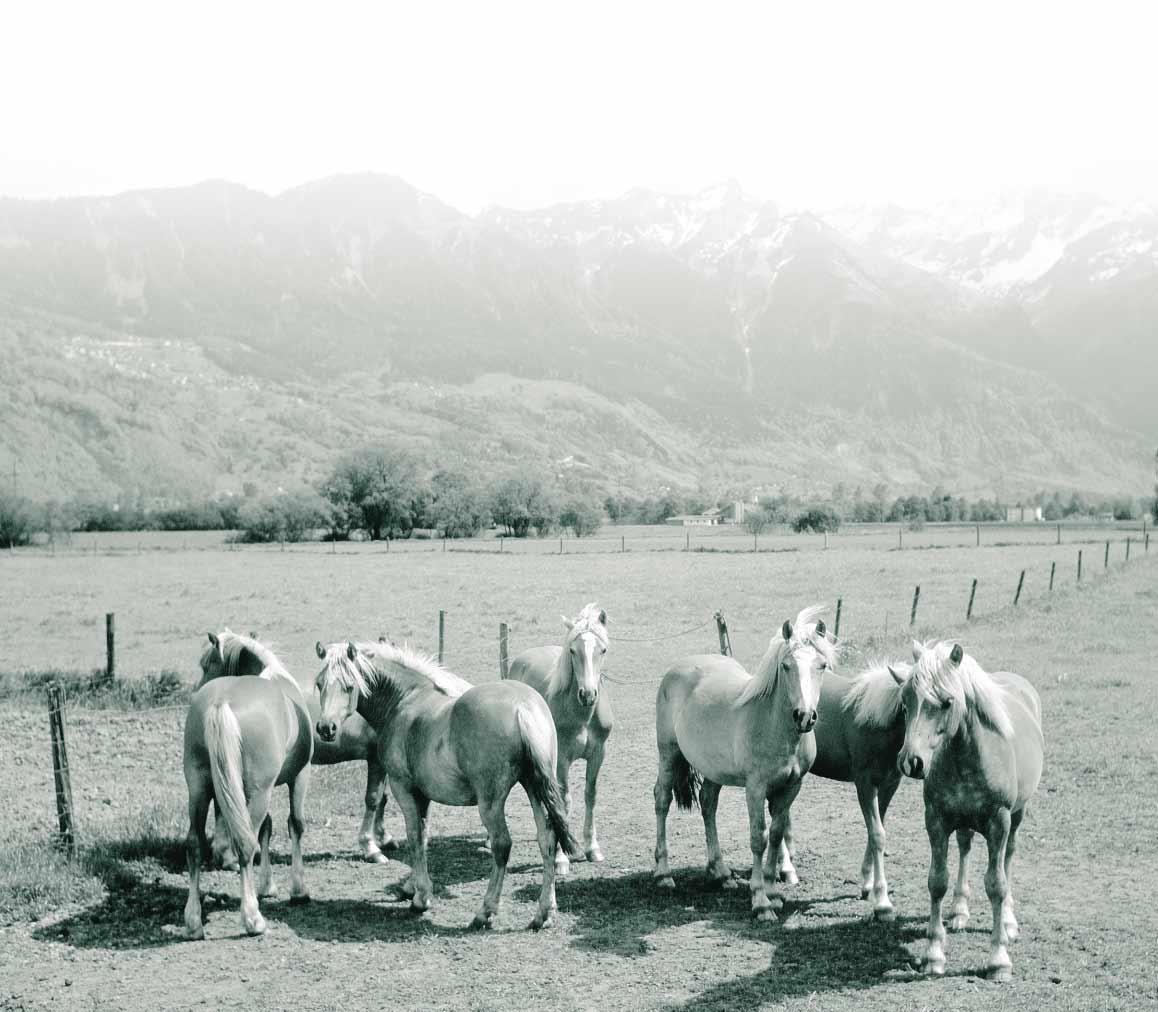
– Entwicklung technischer Verfahren in Pflanzenbau und Tierhaltung nach funktionalen,wirtschaftlichen,qualitätsfördernden sowie umwelt- und tierfreundlichen Kriterien;
– Studien zur nachhaltigen Nutzung des Energie- und Biomassenpotentials sowie von Nebenprodukten.
Das Gestüt positioniert sich in seinem neuen Leistungsauftrag 2004–2007 als national und international anerkanntes Kompetenzzentrum,das unter Berücksichtigung der anderen agrarpolitischen Ziele in der Schweiz eine wettbewerbsfähige und nachhaltige landwirtschaftliche Pferdehaltung unterstützt.Es erbringt in Ausbildung,Zucht und Forschung Dienstleistungen,die den Bedürfnissen der Produzentinnen und Produzenten und ihrer Partner entsprechen.

Der Bund gewährt Finanzhilfen für die Beratung.Diese machen bei den Beratungsdiensten im Durchschnitt 20 bis 25% und bei der Schweizerischen Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft (SVBL) rund 55% der Aufwendungen aus.Die SVBL trägt die beiden Beratungszentralen in Lindau ZH (LBL) und in Lausanne (SRVA).
Ausgaben für die Beratung 2003
EmpfängerBetrag
Mio.Fr. Landwirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone8,2 Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone0,8 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen0,9 Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft8,4
Total18,3
Quelle:Staatsrechnung
Jährlich geben die kantonalen Beratungsdienste Auskunft über ihre Beratungsleistungen in den einzelnen Tätigkeitsbereichen.2002 lag das Schwergewicht in der Produktionsberatung sowie im Tätigkeitsbereich Betriebs-,Hauswirtschaft und Technik.
Bei der pflanzlichen Produktion standen Beratungen zur neuen Düngungsbilanz (Suisse-Bilanz),Feldbesichtigungen,das Angebot von Obstkursen,Fragen zum Pflanzenschutzund Umstellungsberatungen auf Biolandbau im Vordergrund.Ausserdem nahmen Weiterbildung und Auskünfte zur neuen Ökoqualitätsverordnung viel Zeit in Anspruch.In der tierischen Produktion beschäftigten sich die kantonalen Beratungskräfte hauptsächlich mit der Milchproduktion.So hatten sich die kantonalen Beratungsdienste mit dem Ausstieg,der Neuausrichtung,wie z.B.den Möglichkeiten bei der Verarbeitung der künftig zu produzierenden Biomilch,sowie der überbetrieblichen Zusammenarbeit von Milchproduktionsbetrieben auseinander zu setzen.Eine wichtige Rolle spielten aber auch Fragen im Futterbau,wie z.B.die Bekämpfung des giftigen Kreuzkrauts und Aspekte der Fütterungstechnik,sowie Kurse in Mutterkuhhaltung und das Aufzeigen von Extensivierungs-,Intensivierungs- und Alternativmöglichkeiten der Milchproduktion,Kostenanalysen und technische Beratung.
Im Bereich Betriebs-,Hauswirtschaft und Technik bildeten Hofübergaben und Bauvorhaben wie Investitionen an Haus oder Stall,Landkäufe und Bauvorschriften sowie finanzielle Fragen bei Stallbauten,Wohnsanierungen und Maschinenanschaffungen den Hauptbestandteil der Arbeiten.Weiter war das Wissen der Beraterinnen und Berater in Verträgen über Tierhalter- und Generationengemeinschaften und über das Pachtrecht gefragt.
■ 30% der Arbeit entfallen auf Einzelberatungen
Im Tätigkeitsbereich Ländlicher Raum und Lebensgrundlagen fanden hauptsächlich Beratungen zu ökologischen Vernetzungsprojekten,Naturschutz,insbesondere Gewässerschutz,sowie zu Vermarktung und Zusammenarbeit im regionalen Raum statt.
Im Bereich Ausrichtung auf den Markt wurden hauptsächlich Fragen zur Marken- und Labelproduktion bearbeitet.
Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wurden vereinzelt Kurse in Unternehmerschulung für Betriebsleiterinnen und Bäuerinnen angeboten.
Neben der Unterscheidung nach Tätigkeitsbereichen teilen die kantonalen Beratungsdienste ihre Leistungen nach so genannten Leistungskategorien auf.2002 wendeten die kantonalen Berater je rund 30% für Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie für Einzelberatungen auf.Bei den Einzelberatungen wurde rund drei Mal mehr Zeit für private als für öffentliche Interessen ausgewiesen.Projekt- und Prozessbegleitung hatten einen Anteil von etwa 16% an der gesamten Arbeitszeit. Gegenüber dem Vorjahr verschoben sich die zeitlichen Anteile leicht von der Einzelberatung zu den beiden Kategorien Informations- /Weiterbildungsveranstaltungen und Projektbegleitung.Den Rest machten Grundlagenbeschaffung,Informations-,Auskunfts- und Dokumentationstätigkeiten sowie die eigene Weiterbildung und die überkantonale Zusammenarbeit aus.
■ Internationale Vernetzungen
Zunehmend bedeutender werden für die Beratungszentralen und -dienste die internationalen Beziehungen.Dabei profitieren Schweizer Beratungskräfte,indem sie sich z.B. an ausländischen Seminaren oder Tagungen weiterbilden,wie sie unter anderem die Internationale Akademie land- und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater (IALB) jedes Jahr anbietet.Andererseits übernehmen Fachleute aus der Schweiz Mandate im Ausland,für die spezifisch schweizerisches Fachwissen gefragt ist.
Verschiedene Institutionen aus beinahe 20 Ländern,die sich mit landwirtschaftlichem Wissensaustausch beschäftigen,haben sich letztes Jahr zum Rural Extension Network in Europe zusammengeschlossen.Neben einem vielfältigen Weiterbildungs- und Seminarangebot steht der Erfahrungsaustausch über die Grenzen hinweg im Vordergrund.An Bedeutung gewonnen haben Fragen zur Entwicklung im ländlichen Raum.
Während die beiden Beratungszentralen LBL und SRVA teilweise gemeinsam Exkursionen ins Ausland anbieten,bearbeiten die grenznahen kantonalen Beratungsdienste spezifische Projekte direkt mit ihren Partnern auf der anderen Seite der Grenze. Formelle Institutionen wie die IALB oder informelle wie das Bioberaternetzwerk erleichtern den Erfahrungsaustausch.
■ Gesetzesänderung
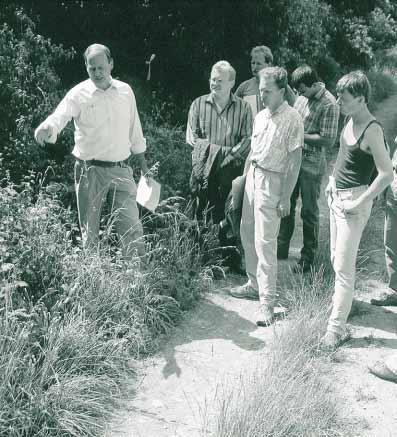
Das neue Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) und die Ausführungsverordnung (BBV) sind am 1.Januar 2004 in Kraft getreten.Gemäss Bundesverfassung gelten sie für die Berufsausbildungen aller Wirtschaftszweige.Die landwirtschaftlichen Berufsausbildungen fallen somit nicht mehr unter das LwG.Sie unterstehen neu denselben Regelungen wie die Ausbildungen in den Bereichen Technik,Gewerbe,Handel, Gesundheit,Sozialwesen und Kunst.Das Gesetz sieht für die Anpassung der Bestimmungen über die Ausbildung zu Landwirt/Landwirtin,Gemüsegärtner/Gemüsegärtnerin, Obstbauer/Obstbäuerin,Winzer/Winzerin,Weintechnologe/Weintechnologin,Geflügelzüchter/Geflügelzüchterin,Pferdepfleger/Pferdepflegerin,Bereiter/Bereiterin,Rennreiter/Rennreiterin,Pferdewärter/Pferdewärterin sowie verwandte Tertiärausbildungen eine fünfjährige Frist vor.Die Revision dieser Texte ist gemeinsame Aufgabe des Bundes,der Kantone und der Organisationen der Arbeitswelt (Art.1 Abs.1 BBG).
■ Berufliche Grundbildung
Jeder Bildungsgang einschliesslich der Qualifikationsverfahren wird in einer Verordnung geregelt,welche die drei in Artikel 1 BBG bezeichneten Partner erarbeiten.Unter anderem legen sie die allgemeinen und besonderen Ziele sowie die Dauer der Ausbildung,die Qualifikationsverfahren und die Methoden der Qualitätsentwicklung fest.Diese Grundlagen,die eine Synthese der Positionen der verschiedenen Partner bilden,gewährleisten den Auszubildenden eine hohe,landesweit vergleichbare und arbeitsmarktbezogene Qualifikation (nach Art.1 Abs.1 BBV).Ergänzt werden sie durch weitere Dokumente wie den Katalog der Leistungsziele,der die jeweiligen Lernziele je nach Ausbildungsort (Schule,Unternehmen,praktischer Lehrgang,Praktika usw.) beschreibt.
Die Ausbildungsgänge,die mit einer zum Eidgenössischen Berufsattest führenden Prüfung abschliessen,dauern zwei Jahre und diejenigen,die zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis berechtigen,drei bis vier Jahre.
■ Höhere Berufsbildung
Gemäss BBG sind alle Prüfungsreglemente zu aktualisieren.Den Organisationen der Arbeitswelt wird für diese Anpassungen eine Übergangsfrist bis Ende 2009 eingeräumt.Eine neue Verordnung über die Mindestvorschriften für die Anerkennung höherer Bildungsgänge und Nachdiplomkurse an höheren Fachschulen soll noch vor Ende 2004 in Kraft treten.Sie betrifft auch die höheren Fachschulen des Land- und Forstwirtschaftssektors.
■ Neue Aufgaben und Verantwortung für die Berufsverbände
Das neue Gesetz überträgt die Verantwortung für den Inhalt der geregelten Ausbildungen (Lernziele) und deren Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Erwartungen des Arbeitsmarktes an die national tätigen Organisationen der Arbeitswelt.Damit die für die verschiedenen landwirtschaftlichen Berufe zuständigen Verbände bestimmt werden können,ist zunächst abzuklären,welche Verbände an der Förderung und Sicherung des Nachwuchses in ihren Berufen ein wirtschaftliches und politisches Interesse haben.
Die Verantwortung für die landwirtschaftliche Berufsbildung liegt demnach klar bei den Berufsverbänden,denn die Ausbildung ist ebenfalls ein Instrument der Interessenvertretung.
■ Finanzhilfen des BBT für die landwirtschaftliche Berufsbildung
Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) unterstützt die landwirtschaftliche Berufsbildung mit jährlich ca.10 Mio.Fr.Es übernimmt damit einen Anteil an den anrechenbaren Kosten der beitragsberechtigten landwirtschaftlichen Schulen, Institutionen und Verbände.Für Berufsorganisationen und Schulen von interkantonaler Bedeutung gilt ein spezieller Ansatz von 43% der anrechenbaren Kosten.
Das am 1.Januar 2004 in Kraft getretene BBG sieht einen Systemwechsel von der Aufwand- zur Pauschalfinanzierung vor.Bis Ende 2007 werden die Finanzhilfen noch nach dem bisherigen System festgelegt.Nach der vierjährigen Übergangsphase erhält jeder Kanton – gestützt auf die Anzahl Personen in beruflichen Vollzeitschulen und solchen in der betrieblich organisierten Grundbildung – eine so genannte Kantonspauschale.Damit werden sämtliche Berufsbildungsleistungen,welche die Kantone zu erbringen haben,abgegolten.Die Verteilung respektive Verwendung der jeweiligen Mittel ist Sache der Kantone.
Die Übergangsphase gibt den Kantonen Gelegenheit,die für die künftige Subventionierung unerlässlichen innerkantonalen Regelungen zu treffen und interkantonale Abkommen zu schliessen.
Der Bund wird sich künftig vor allem darauf ausrichten,die Einhaltung des BBG (Leistungskatalog gemäss Artikel 53,Absatz 2) zu überwachen und darauf achten,dass der Bundesanteil an den Berufsbildungskosten der öffentlichen Hand – im Rahmen der bewilligten Kredite – stufenweise von heute ca.18% auf ca.25% erhöht wird.
■ CIEA 2004: «Lebenslanges Lernen für den ländlichen Raum»
CIEA-Seminare sind wichtige Weiterbildungsveranstaltungen,die das BLW zusammen mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und seit 1995 mit der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL) organisiert.Ziel der Seminare ist es,landwirtschaftlichen Lehr- und Beratungspersonen aus verschiedenen Ländern der Welt Gelegenheit zur Aktualisierung von fachlichem und methodischem Wissen sowie zum umfassenden Erfahrungsaustausch zu bieten.Die im August 2004 in Grangeneuve durchgeführte Veranstaltung stand unter dem Motto «Lebenslanges Lernen für den ländlichen Raum».86 Personen aus 39 Ländern nahmen daran teil.
■ Lernen bewusst gestalten
Das CIEA-Seminar 2004 leistete einen Beitrag zu einem «bewussten» Lernprozess. Diese Art des Lernens weist unter anderem folgende Merkmale auf:
– das Lernen geschieht bewusst,mit Absicht;
– das Lernen verfolgt bestimmte,klar definierte Ziele.Es wird gelernt,um diese Ziele wirklich zu erreichen;
– die Lernenden wollen sich,was sie über einen bestimmten Zeitraum gelernt haben, merken und anwenden.
So wird Lernen zu einem bewussten,gewinnbringenden Prozess,der es den Fach- und Berufsleuten in der Landwirtschaft erlaubt,grosse Veränderungen anzugehen und zu meistern.
■ Die neue Homepage
Weitere Informationen zum CIEA stehen auf der Homepage unter www.ciea.ch.Dort findet sich auch die Grundidee zum Begriff «Lebenlanges Lernen»,die für alle Menschen gilt: «Bewusstes Lernen kann und soll im Verlauf des gesamten Lebens eines Menschen stattfinden»
■ Hoher Selbstversorgungsgrad bei Getreide und Kartoffeln
Bei allen Getreidearten (ausser Roggen) und bei Kartoffeln kann die schweizerische Landwirtschaft auf einen sehr hohen Anteil an zertifiziertem Saat- und Pflanzgut aus dem Inland zählen.In einzelnen Jahren wurde bei Weizen und Triticale netto sogar mehr exportiert als importiert.Bei Roggen,Mais,Soja sowie Futterpflanzensaatgut wird zum Teil ein Selbstversorgungsgrad bis 40% erreicht.Bei Raps-,Sonnenblumenund Rübensaatgut herrscht eine vollständige Abhängigkeit von ausländischen Vermehrern.
Produktion und Aussenhandel von Saat- und Pflanzgut 1999–2002
100% = Gesamtverbrauch
Weizen
Sonnenblumen
Saatkartoffeln Rüben
Quellen: swisssem, OZD
Die Produktion von zertifiziertem Saat- und Pflanzgut in der Schweiz ist aus mehreren Gründen sinnvoll.Zu nennen sind kurze Transportwege,in der Schweiz (noch) nicht vorhandene,besonders gefährliche Schadorganismen,welche über Vermehrungsmaterial verschleppt werden können,sowie die Erhaltung einer Wertschöpfungsstufe.
Der Vorteil von zertifiziertem Saat- und Pflanzgut gegenüber dem eigenen Nachbau besteht in der garantierten Sortenechtheit,der hohen Keimfähigkeit und dem Garant einer hohen Pflanzengesundheit.Die Rückverfolgbarkeit,ein zentrales Element, welches zunehmend von Verarbeitungsbetrieben gefordert wird,kann mit der Zertifizierung sichergestellt werden.
Entwicklung der Saat- und Pflanzgutproduktion
Die Bedürfnisse der Märkte wiederspiegeln sich auch in den anerkannten Saat- und Pflanzgutposten.Damit die erforderlichen Mengen rechtzeitig verfügbar sind,ist ein gutes Einvernehmen der Marktpartner wichtig.Diese sind in verschiedenen Branchenorganisationen zusammengeschlossen.
Das BLW ist zuständig für die Zulassung von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln. Dies betrifft Pflanzenschutzmittel,Dünger,Saatgut und Futtermittel.

Dünger – wollen sie in Verkehr gebracht werden – bedürfen einer Zulassung.Die Dünger müssen sich zur vorgesehenen Verwendung eignen,bei vorschriftgemässem Gebrauch unbedenklich für Mensch,Tier und Umwelt sein und die Produktion von gesetzeskonformen Lebensmitteln erlauben.
Dünger sind Stoffe oder Erzeugnisse,die der Pflanzenernährung dienen.Sie fördern das Wachstum der Pflanzen,erhöhen ihren Ertrag oder verbessern ihre Qualität. Welche Produkte rechtlich als Dünger gelten,ist in der Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngern (DüV,SR 916.171) aufgelistet.Nicht zu den Düngern im Sinn des Gesetzes zählen Kohlendioxid,Wasser und Licht.
Für die Zulassung von Düngern gibt es grundsätzlich zwei Wege:die Zulassung via Listen oder die Bewilligung.
Das Inverkehrbringen von Düngern
■ anmeldepflichtige (DüBV, Anhang 1, Teile 3–6)
■ nicht anmeldepflichtige (DüBV, Anhang 1, Teile 1+2)
In der Düngerbuch-Verordnung (DüBV,SR 916.171.1) sind jene Düngertypen aufgelistet,welche für die Zulassung lediglich eine Anmeldung brauchen;für gewisse allgemein bekannte Produkte entfällt auch die Anmeldung.Es sind dies vor allem jene Dünger,welche als «EG-Düngemittel» bezeichnet werden dürfen und auch in der EG frei gehandelt werden.Selbstverständlich müssen auch diese Dünger den rechtlichen Bestimmungen entsprechen und den Kennzeichnungsvorschriften genügen.
Entspricht ein Dünger keinem der aufgeführten Düngertypen oder enthält er Mikroorganismen,so muss beim BLW eine Bewilligung eingeholt werden,damit er in Verkehr gebracht werden kann.Zu diesem Zweck sind beim BLW die notwendigen Unterlagen einzureichen.Das BLW prüft vor allem die Umweltverträglichkeit und die Wirksamkeit der zuzulassenden Produkte.
Bei der Beurteilung von Düngern und anderen Produktionsmitteln arbeitet das BLW eng mit den landwirtschaftlichen Forschungsanstalten zusammen.Im Zulassungsverfahren sind ebenfalls die Bundesämter für Umwelt,Wald und Landschaft (BUWAL), für Gesundheit (BAG) und für Veterinärwesen (BVET) eingebunden.
Gegenwärtig werden jährlich gegen 200 Produkte vom BLW bewilligt oder dort angemeldet.Die Marktkontrolle obliegt den Kantonen.Das BLW nimmt diese Aufgaben unterstützend wahr und koordiniert die Vollzugsaufgaben der Kantone.
Pflanzenschutzmittel im Wasser –eine Gefährdung von Mensch und Umwelt?
Funde von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern sind immer wieder Gegenstand von Medienberichten.Im Jahre 2003 löste beispielsweise die Veröffentlichung einer Studie über Funde von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser eine Medien-Kampagne aus, und im Herbst des gleichen Jahres erschienen auch wieder Presseberichte,die eine Schädigung der männlichen Fruchtbarkeit mit Funden von Pflanzenschutzmitteln im Trink- und Badewasser in Verbindung brachten.Solche Berichte lösen in der Bevölkerung Ängste und Bedenken aus,die sich in Fragen etwa folgender Art ausdrücken: Haben wir in der Schweiz vergiftetes Hahnenwasser? Warum werden Pflanzenschutzmittel nicht verboten,wenn sie doch so giftig sind? Vergiften Pflanzenschutzmittel nicht Tiere und Pflanzen in Bächen und Seen? Solche Fragen müssen ernst genommen und mit sachlicher Information beantwortet werden.
Pflanzenschutzmittel sind für eine produzierende Landwirtschaft,wo der Pflanzenbau einen wichtigen Platz einnimmt,unverzichtbar.Denn der Ertrag an pflanzlichen Erzeugnissen ist ständig durch Krankheiten,tierische Schaderreger und Unkräuter bedroht,und gewisse Pilzerkrankungen bei Pflanzen können gar zu Stoffwechselprodukten führen,die für den Menschen gesundheitsgefährdend sind.Pflanzenschutzmittel werden bei der konventionellen Produktion,bei der integrierten Produktion und auch im biologischen Landbau eingesetzt.
Pflanzenschutzmittel haben aber nicht nur nützliche Auswirkungen.Sie können auf Grund ihrer gewollten biologischen Aktivität auch Gefahren und Risiken für Umwelt, Mensch und Tier in sich bergen,vor allem,wenn sie ungeprüft und unsachgemäss angewendet werden.Pflanzenschutzmittel sind deshalb in der Schweiz der Kontrolle unterstellt und dürfen nur in Verkehr gebracht werden,wenn sie zugelassen sind.Um die Risiken eines Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln abschätzen zu können und eine gute Entscheidungsbasis für eine Zulassung zu haben,müssen umfangreiche Studien zur Beurteilung möglicher Auswirkungen auf den Anwender,die Umwelt und auf den Konsumenten erarbeitet und bei der Zulassungsbehörde zur Beurteilung eingereicht werden.Ein Pflanzenschutzmittel darf nur dann in Verkehr gebracht werden,wenn diese Beurteilung zeigt,dass es zum vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und bei vorschriftsgemässer Anwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen hat,weder auf die zu schützenden Kulturen,noch insbesondere auf Umwelt,Mensch und Tier.
Die einzureichenden Studien müssen im Speziellen auch darüber Aufschluss geben,ob Spuren von Pflanzenschutzmitteln im Wasser auftreten können,und ob diese keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit von Mensch und Tier,insbesondere über Trink- oder Grundwasser,haben.
Zu diesem Zweck müssen die Studien Auskunft geben über das Verhalten und die Auswirkungen eines Pflanzenschutzmittels in fliessenden und stehenden Gewässern, sowie im Grundwasser.Dazu wird das Verhalten des Pflanzenschutzmittels im Labor,in verschiedenen Böden und im Freiland untersucht,namentlich der Abbau,aber auch,ob es sich möglicherweise anreichert.Geprüft wird ferner,ob und wie es durch Wassereinwirkung und bei Lichteinwirkung zersetzt wird und ob und wie es im Boden versickert und so in tiefere Bodenhorizonte und letztlich ins Grundwasser ausgewaschen wird.

Aus der Summe dieser und weiterer Umweltstudien lässt sich ableiten,wie viel eines bestimmten Pflanzenschutzmittels und seiner Abbauprodukte im Wasser wiedergefunden werden könnten.Die Zulassungsbedingungen verlangen dabei,dass es sich höchstens um Spuren handeln darf.
Im nächsten Schritt muss geklärt werden,ob und welche Auswirkungen solche Spuren von Pflanzenschutzmitteln auf Umwelt,Tier und Mensch haben.Für das aquatische Ökosystem werden dazu Untersuchungen an Organismen durchgeführt,die als Bioindikatoren gelten können.Hierzu gehören unter anderem die Studien zur Fischtoxizität an Karpfen,Goldorfe und Forelle.Geprüft wird ausserdem der Einfluss auf Algen und Fischnährtiere wie etwa Flohkrebse.
Ein Pflanzenschutzmittel kann nur bewilligt und in Verkehr gebracht werden,wenn die Spuren von Pflanzenschutzmitteln,welche allenfalls im Wasser auftreten,weitab von der Konzentration liegen,die unannehmbare Auswirkungen auf die Wasserlebewesen haben.Bei empfindlichen Spezies,wie etwa bei Fischen,wird in den StandardZulassungsstudien verlangt,dass die Konzentration,welche erreicht werden darf,um einen Faktor 100 unter jener Konzentration liegen muss,bei der unannehmbare Effekte beobachtet werden können.

Die Zulassung stützt sich also nicht auf die unerfüllbare Forderung nach einer NullKonzentration von Pflanzenschutzmitteln im Wasser ab,sondern auf wissenschaftliche Prinzipien.Diese richten sich insbesondere auf das Fundamental-Prinzip der Toxikologie aus,welches seit seiner Formulierung durch Paracelsus seine Gültigkeit bewahrt hat: «Alle Dinge sind Gift und nichts ist Gift,allein die Dosis macht,dass ein Ding kein Gift ist».Einem Zulassungsentscheid liegt die Festlegung solcher nach diesem Fundamentalprinzip tolerierbaren Konzentrationen zu Grunde.Das gilt für die Lebewesen im Wasser,es gilt aber namentlich auch für Mensch und Tier.
Die Forderung nach einer Null-Konzentration würde dazu führen,dass faktisch alle Pflanzenschutzmittel nicht mehr zugelassen werden könnten.Diese wäre gleichbedeutend mit dem Verzicht auf eine produzierende Landwirtschaft.Mit der heutigen Analytik ist es möglich,auch Ultraspuren von Pflanzenschutzmitteln – und anderen Substanzen – im Wasser nachzuweisen.Messungen von so kleinen Konzentrationen wie 0,000'000'1 Gramm in einem Liter Wasser oder noch tiefer sind heute möglich.Zur Illustration:Soll ein Stück Würfelzucker in Wasser aufgelöst und auf diese Konzentration gebracht werden,so wäre dazu das Wasser eines Eisenbahn-Tanklastzuges von rund 3 km Länge nötig!
Die Zulassung muss ferner sicherstellen,dass auch für den Konsumenten keine Gefahren vom Trinkwasser in jenen Fällen ausgeht,in welchen es Ultraspuren von Pflanzenschutzmitteln enthält.Zu diesem Zweck müssen den Behörden umfangreiche Daten zu toxikologischen Untersuchungen an Tiermodellen eingereicht werden.Diese umfassen unter anderem die nachfolgend genannten Studientypen:

Untersuchungen zur akuten Toxizität bei der Aufnahme über den Mund,durch die Haut oder über die Atemwege;
– Prüfung der Hautreizung und der Schleimhautreizung;
– Studien zur chronischen Toxizität,z.B.an Ratten und Mäusen,die während der gesamten Lebensdauer bestimmten Konzentrationen eines Wirkstoffes im Futter ausgesetzt sind;
– Untersuchungen zur Kanzerogenität,ob also Tumore ausgelöst werden können und bei welchen Dosen;
Reproduktionsstudien,um zu prüfen,ob die Aufnahme eines Wirkstoffes durch die Elterntiere nachteilige Wirkungen auf die folgenden Generationen haben könnte.
Die Gesamtheit dieser Studien dient der Abschätzung jener Menge eines Pflanzenschutzmittels,die täglich während des ganzen Lebens aufgenommen werden kann, ohne dass dabei mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet werden muss.Diese tolerierbare Menge beinhaltet sehr grosse Sicherheitsabstände – hier einen Faktor von 100 bis 1000 – zur toxikologisch kritischen Menge,bei der erste negative Auswirkungen auftreten können.
Konzentration eines Pflanzenschutzmittels im Wasser
Die spezielle Stellung des Wassers für Mensch,Tier und Umwelt findet auch im schweizerischen Recht ihren Ausdruck.So gehen sowohl beim Grundwasser als auch beim Trinkwasser die gesetzlichen Anforderungen über die bis dahin beschriebenen wissenschaftlich tolerierbaren Werte hinaus.Die Gewässerschutzverordnung legt fest,dass ein organisches Pflanzenschutzmittel nur in der Konzentration von 0,000'000’1 Gramm pro Liter,abgekürzt 0,1 ppb,vorkommen darf.Vorbehalten bleiben allerdings andere Werte,nämlich jene,die im Zulassungsverfahren auf Grund von wissenschaftlichen Beurteilungen bestimmt wurden.Für Trinkwasser legt die Fremd- und Inhaltsstoffverordnung die gleiche Konzentration von 0,1 ppb als Toleranzwert für jedes einzelne Pflanzenschutzmittel fest.Der Toleranzwert ist die Höchstkonzentration,bei dessen Überschreitung Trinkwasser als verunreinigt oder sonst im Wert vermindert gilt. Diese Werte sind zwar nicht wissenschaftlich begründet,sie sind aber rechtlich festgelegte Qualitätsziele,denen im Zulassungsverfahren Nachachtung verschafft werden muss.
Die Ausführungen zeigen,dass bei Funden von Pflanzenschutzmitteln unter dem gesetzlichen Toleranzwert von 0,1 ppb keine Gefährdung der Gesundheit von Umwelt, Tier und Mensch ausgeht.Sie sind vielmehr das Resultat unglaublich empfindlicher analytischer Messmethoden und Messbarkeit ist nicht gleichzusetzen mit Gefährdung. Dasselbe kann gesagt werden für Konzentrationen zwischen dem gesetzlichen Toleranzwert und der wissenschaftlich festgelegten Limite.Das schweizerische Recht sieht für diese Fälle trotzdem vor,dass die Behörde Art und Ausmass der Verunreinigung feststellt,und dass die erforderlichen Massnahmen getroffen werden,um den vom Recht geforderten Zustand der Gewässer wieder herzustellen.


Bleibt schliesslich noch die Frage nach einer eventuellen Gefährdung für jene Fälle zu beantworten,bei welchen die wissenschaftlich tolerierbare Konzentration überschritten wird.Da bei der Berechnung dieser Konzentration sehr grosse Sicherheitsfaktoren berücksichtigt werden und zudem die Annahme einer langandauernden Zufuhr oder Exposition zu Grunde gelegt wird,resultiert zwar auch hier aus gelegentlichen geringfügigen Überschreitungen keine echte Gefährdung.Eine solche ist aber zu befürchten,wenn die Konzentration Werte erreicht,bei welchen in den wissenschaftlichen Studien die ersten negativen Effekte aufgetreten sind.Die tolerierbare Konzentration ist deshalb eine echte,materiell begründete Alarmschwelle.Deshalb gilt hier nun ganz besonders,dass die Behörden die Ursache abklären und die erforderlichen Korrekturmassnahmen treffen müssen,um den vom Recht geforderten Zustand des Wassers wieder herzustellen.
Betrachtet man die Berichte über Funde von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern über viele Jahre,so stellt man fest,dass am häufigsten von Konzentrationen berichtet wird, die unter dem politisch-rechtlichen Toleranzwert von 0,1 ppb liegen,die also weder wissenschaftlich noch rechtlich zu beanstanden sind.Schon sehr viel weniger häufig wird von Funden berichtet,die zwar über 0,1 ppb aber unterhalb der wissenschaftlich tolerierbaren Konzentration liegen.In solchen Fällen wurden und werden die rechtlich geforderten Korrekturmassnahmen ergriffen;so wurde beispielsweise die Anwendung des Herbizids Atrazin im Maisbau eingeschränkt und auf Bahngeleisen,an Strassenrändern in Karstgebieten und in den Grundwasserschutzzonen (S2) verboten.
In jenen seltenen Fällen,bei denen Pflanzenschutzmittel wirkliche Schäden am Ökosystem Wasser verursacht haben,hat sich bisher herausgestellt,dass dafür die nicht vorschriftsgemässe Anwendung oder unsachgemässer Umgang als Ursache angesehen werden können.Als Beispiele können Unfälle und Havarien genannt werden,oder der unsachgemässe Umgang mit Spritzbrühe-Resten.
Insgesamt kann gesagt werden,dass die strengen Anforderungen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zusammen mit den Bestimmungen des Gewässerschutzrechtes in der Schweiz eine hohe Wasserqualität insbesondere auch derjenigen des Trinkwassers sicherstellen.
■ Schweizerische Tierzuchtgesetzgebung von EU anerkannt
Im Rahmen der bilateralen Verhandlungen wurde festgestellt,dass das Schweizer Tierzuchtrecht die von der EU vorgegebenen Anforderungen und Richtlinien vollständig erfüllt.Seit dem In-Kraft-Treten der Verträge sind die schweizerischen Zuchtverbände denjenigen der EU gleichgestellt.Das bedeutet unter anderem die gegenseitige Anerkennung von Abstammungsausweisen und damit eine Vereinfachung des Tierverkehrs zwischen der Schweiz und der EU.
■ Einfuhr und Ausfuhr von Zuchttieren und Sperma
Die Nachfrage nach Rinderrassen und Sperma ausländischer Provenienz ist nach wie vor gross.Während der Import von Kleinviehrassen in den letzten Jahren rückläufig war,blieb die Nachfrage nach Zuchtpferden stabil.Die Zollkontingente für Pferde, Schweine,Schafe und Ziegen wurden im Gegensatz zum Zollkontingent für Zuchtrinder nicht ausgeschöpft.Für das im Berichtsjahr zur Versteigerung ausgeschriebene Zollkontingent von 800 Zuchtrindern wurden über 3'000 Gebote eingereicht.
Der Export von Zuchttieren gewinnt wieder an Bedeutung.Rund 5'500 Zuchtrinder der Rassen Fleckvieh,Braunvieh und Holstein wurden 2003 nach Deutschland,Frankreich, England,Spanien,Bosnien,Kosovo,Polen und Irland ausgeführt.

Jährlich fallen in der Schweiz rund 900 t Schafwolle an.Die unbefriedigende Nachfrage nach Rohwolle und die tiefen Weltmarktpreise führen dazu,dass die Schafhalter aus dem Verkauf der Wolle kaum mehr eine Wertschöpfung realisieren können.Als Folge davon ist deren korrekte Verwertung zu einem Problem geworden.Die Schafwolle wird zunehmend als Abfall oder auf andere Weise umweltbelastend entsorgt.Die Unterstützung des Bundes stellt daher eine wichtige Grundlage für eine ökonomisch tragbare, ökologisch sinnvolle und ethisch vertretbare Verwertung des Naturproduktes Wolle dar.Aber auch die Schafhalter und die Verarbeiter müssen grössere Anstrengungen für die Verwertung der im Inland anfallenden Schurwolle unternehmen wie die Realisierung innovativer Projekte oder ein geschicktes Marketing für Produkte aus einheimischer Wolle.
Gestützt auf den neuen Artikel 51bis des LwG wird der Bund das Einsammeln,das Sortieren,das Pressen,die Lagerung und die Vermarktung der inländischen Wolle weiterhin mit Beiträgen unterstützen.Zusätzlich können auch innovative Projekte der Schafhalter und Wollverarbeiter zur Verwertung der inländischen Wolle im Inland mit Beiträgen gefördert werden.Der Bund wird für diese Massnahmen ab 2004 jährlich einen Betrag von 800'000 Fr.einsetzen.

Die Sektion Finanzinspektorat gliedert sich in die Bereiche Finanzinspektorat (Interne Revision) und Feldkontrolle.Das Inspektionsprogramm des Finanzinspektorates wird mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle abgestimmt und koordiniert,damit Überschneidungen und Doppelspurigkeiten vermieden werden können.
Im Berichtsjahr wurden folgende Revisionstätigkeiten vorgenommen: –externe Revisionen bei sieben Leistungsempfängern resp.Subventionsempfängern; –System- und Wirkungsprüfungen in zwei Kantonen im Bereich der Direktzahlungen; –interne Revisionen bei vier Sektionen des BLW; –Finanzrevision im Amt inkl.Forschungsanstalten und Gestüt; –Wirkungsprüfung und Abschlussrevision bei einem Subventionsempfänger und Abschlussrevisionen bei zwei Subventionsempfängern.
Bei den externen Revisionen wurden insgesamt befriedigende Resultate festgestellt –die inhaltlichen Ziele sind fast vollumfänglich erreicht worden.Die beauftragten Organisationen für die Umsetzung der verschiedenen Leistungsaufträge sind in der Regel gut organisiert,haben angemessene Strukturen und zweckmässige,effiziente interne Abläufe.Aus unserer Sicht werden jedoch mögliche Synergien und Vereinfachungen zwischen den Organisationen zuwenig genutzt.
Die Komplexität des Direktzahlungssystems hat uns bewogen,die System- und Wirkungsprüfungen in verschiedenen Etappen durchzuführen.In einem ersten Schritt wurden das Vollzugssystem und die Schnittstellen bei den Vollzugsaktivitäten zwischen dem BLW und den Kantonen geprüft.Die Qualität der Arbeiten in den zwei untersuchten Kantonen ist gut.Die Schnittstellen BLW – Kantone sind klar definiert und geben zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.Die bestehenden internen Kontrollsysteme betrachten wir als zweckmässig und gut.Die Wirkung der allgemeinen Direktzahlungen wird übereinstimmend als entscheidend für die Einkommenssituation der bäuerlichen Bevölkerung beurteilt.
BLW-interne Revisionen (sog.Dienststellenrevisionen) beinhalten eine unabhängige und systematische Beurteilung der betrieblichen Organisation und der Tätigkeiten einer Organisationseinheit.Sie umfassen insbesondere die Aufbau- und Ablauforganisation einer Sektion.Ein wichtiges Element ist auch die Überprüfung der internen Kontrolle (Internes Kontrollsystem IKS).Das Augenmerk richtet sich nicht nur auf eine Soll-Ist-Abweichung,sondern auch auf deren Ursachen.Die Resultate unserer Prüfungen fallen positiv aus.Die öffentlichen Mittel werden rechtmässig und zielgerichtet eingesetzt.Die dabei im Einsatz stehenden Führungs- und Steuerungsinstrumente sind in vielen Fällen angemessen und transparent.Die administrativen Vollzugsaufgaben werden mit einer guten Qualität ausgeführt.
■ Folgeprozess
Die Finanzrevision im BLW umfasste mehrere Teilprüfungen in periodischen Abständen und erfolgte nach den anerkannten Revisionsstandards.Erstmals wurde zudem zur Unterstützung und Entlastung der Eidgenössischen Finanzkontrolle die Abschlussrevision in unserem Amt durchgeführt.
Die Abschlussrevision und die Wirkungsprüfung führten insgesamt zu guten Resultaten. Die ordnungsgemässe finanzielle Abwicklung konnte bestätigt werden.Wir haben festgestellt,dass die vereinbarten Leistungen erbracht und die Bundesgelder zweckmässig und wirtschaftlich verwendet worden sind.Nur in einem Fall wurde dies nicht eingehalten.
Einmal jährlich werden die vom Direktor und den Linieninstanzen festgelegten Termine für die Umsetzung der akzeptierten Empfehlungen durch uns überprüft.Im vergangenen Jahr fand eine solche Überprüfung bei drei abgeschlossenen Revisionen statt. Die Empfehlungen sind – mit drei Ausnahmen – fristgerecht umgesetzt worden.
■ Kontrolltätigkeiten im Berichtsjahr
Die Inspektoren des Bereichs Feldkontrolle führen Kontrollen,Abklärungen,Ermittlungen und Untersuchungen in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Gesetzgebung von Produktion und Absatz bzw.für die Fachstellen des BLW durch.Im Jahr 2003 fanden 1015 Kontrollen in den folgenden Bereichen statt:
–Milch und Milchprodukte mit 825 Kontrollen;
–Gemüse,Obst ,Schnittblumen und Obstkonzentrat mit 163 Kontrollen;
–Fleisch und Eier mit 20 Kontrollen;
–Acker- und Futterbaubereich mit 7 Kontrollen und 1 Preiserhebung.
Im Bereich Milch und Milchprodukte wurden in 19% aller Fälle Unregelmässigkeiten festgestellt.Davon waren etwas weniger als die Hälfte Beanstandungen innerhalb der Toleranzgrenzen;die andere Hälfte musste der Fachsektion zur weiteren Beurteilung übergeben werden.Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um keine schwerwiegenden Tatbestände,die Ermittlungen und Untersuchungen nach sich gezogen hätten.
Im Bereich der Domizilkontrollen von frischen Früchten und Gemüse wurden in etwas mehr als der Hälfte aller Kontrollen Verfehlungen beanstandet;dies mit finanziellen Folgen zugunsten der Bundeskasse.In den übrigen Bereichen gaben die Kontrollen und Beanstandungen zu keinen Bemerkungen Anlass.
■ Widerhandlungen
Abklärungen,Untersuchungen und Befragungen im Zusammenhang mit Widerhandlungen gegen die Landwirtschaftsgesetzgebung werden von unserem juristischen Dienst in Zusammenarbeit mit eidgenössischen und kantonalen Untersuchungsbehörden,mit privaten Organisationen und anderen Rechtshilfestellen vorgenommen.
Im Berichtsjahr wurden 7 Widerhandlungsfälle eröffnet und zur Bearbeitung weitergeleitet.10 Fälle wurden definitiv erledigt.Die Statistik präsentiert sich dabei wie folgt:
Stand der offenen Fälle per 31.12.20023 Fälle
Im Berichtsjahr eröffnete Fälle7 Fälle
Im Berichtsjahr weitergeleitete Fälle oder von der Sektion Finanzinspektorat direkt erledigte Fälle10 Fälle
Stand der offenen Fälle per 31.12.20030 Fälle
■ Akkreditierung der Kontrollen im Bereich Milchverarbeitungsbetriebe
Die Vorbereitungsarbeiten zur Akkreditierung wurden im Berichtsjahr weitergeführt,so dass im Herbst 2003 der Antrag zur Akkreditierung an die schweizerische Akkreditierungsstelle beim Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung (metas) gestellt werden konnte.Die Begutachtung fand im Februar 2004 statt und die Inspektionsstelle Feldkontrolle erhielt per 29.April 2004 die Anerkennung als akkreditierte Inspektionsstelle.Diese Anerkennung ist gültig bis zum 28.April 2009.
Die Inspektionsstelle kann mit dieser Akkreditierung garantieren,dass die Inspektionen in der ganzen Schweiz nach einem einheitlichen,professionellen und effizienten Verfahren durchgeführt werden.
■ Vorbereitung der Agrarpolitik 2011
Mit dem Jahr 2004 begann die Umsetzung der vom Parlament im Juni 2003 verabschiedeten Gesetzesanpassungen im Rahmen der Agrarpolitik 2007.Zentrale Elemente waren dabei der Beschluss zum Ausstieg aus der Milchkontingentierung im Jahr 2009 und die Einführung der Versteigerung der Fleischimportkontingente bis 2007.Am 26.November 2003 hat der Bundesrat die entsprechenden Ausführungsbestimmungen beschlossen.
Die schweizerische Landwirtschaft wird auch über 2007 hinaus vor weiteren Herausforderungen stehen.So wird der Käsemarkt gegenüber der EU im Jahr 2007 vollständig offen sein und der Abschluss der nächsten WTO-Verhandlungsrunde (DohaRunde) dürfte einen weiteren Abbau des Grenzschutzes mit sich bringen.Die Agrarpolitik 2011 soll die Voraussetzungen schaffen,dass die Landwirtschaft und der Ernährungssektor als Ganzes die künftigen Herausforderungen meistern können.
Verfassungsgrundlage (Art. 104 BV)
Agrarpolitik 2002
Agrarpolitik 2007
Milchbericht
Leitbild + Teilrevision LwG + Zahlungsrahmen 08-11
EU-Agrarabkommen (Bilaterale I)
Weitere Verhandlungen mit der EU
WTOVerhandlungen
Agrarpolitik 2011
Doha WTO-Agrarabkommen
2002200320042005200620072008200920102011
Die Vorbereitungen für die Agrarpolitik 2011 sind in vollem Gang.Die folgenden Elemente sind dabei von Bedeutung:
Der Landwirtschaftsartikel in der Bundesverfassung (Artikel 104) gibt nach wie vor die Zielrichtung an.Diese ist unbestritten.
Es ist davon auszugehen,dass mit dem Abschluss der Doha-Runde der WTO der Grenzschutz,die interne Marktstützung und die Exportsubventionen weiter abgebaut werden müssen (vgl.Abschnitt 3.1).Die Umsetzung der Doha-Verpflichtungen wird voraussichtlich im Zeitraum 2008 bis 2001 beginnen und sich über 5 bis 10 Jahre (Abbau der Exportsubventionen) erstrecken.Die endgültigen Ergebnisse der WTO-Verhandlungen dürften allerdings bei der Ausarbeitung und Beratung der Agrarpolitik 2001 noch nicht oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt vorliegen.
Das vom Bundesrat vorgeschlagene Entlastungsprogramm 04 (EP04) sieht für das Jahr 2008 Einsparungen im Bundeshaushalt von rund 1,5 Mrd.Fr.vor.130 Mio.Fr. davon entfallen auf die Landwirtschaft.Das Entlastungsprogramm soll ab 2006 wirksam werden.Bei der Landwirtschaft ist die vorgesehene Abschaffung der Rückerstattung der Mineralölsteuer im Umfang von 70 Mio.Fr.direkt einkommenswirksam.Der Restbetrag von 60 Mio.Fr.soll bei der Marktstützung,den Investitionskrediten,der Betriebshilfe und den Beiträgen für den Export von Verarbeitungsprodukten eingespart werden.Von den Kürzungen nicht betroffen sind die Direktzahlungen.
– Um einen geordneten Übergang zur Milchmarktordnung ohne Milchkontingentierung zu gewährleisten,hat das Parlament mit der Agrarpolitik 2007 bereits bis 2012 befristete Übergangsbestimmungen im LwG eingeführt.Gleichzeitig hat es den Bundesrat beauftragt,bis 2006 einen Bericht vorzulegen,der Auskunft gibt über die Ausgestaltung der Milchmarktordnung und über die flankierenden Massnahmen nach dem Ausstieg aus der Milchkontingentierung.Damit die betroffenen Landwirte,Organisationen und Verbände rechtzeitig über die künftigen Rahmenbedingungen informiert sind,wird der Bundesrat diesen Bericht dem Parlament voraussichtlich bereits im Frühjahr 2005 unterbreiten.
Der Prozess und die Diskussionen zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik sollen möglichst offen und transparent geführt werden.Die betroffenen und interessierten Kreise sollen deshalb umfassend und frühzeitig miteinbezogen werden.
– Die für 2004 bis 2007 neu konstituierte Beratende Kommission Landwirtschaft des Bundesrates hat unter der Leitung des neuen Präsidenten Regierungsrat Christian Wanner (SO) ihre Arbeit aufgenommen.Sie hat sich als Erstes zum Ziel gesetzt,ein Leitbild der Schweizer Landwirtschaft zu erarbeiten.Dieses soll für die strategische Ausrichtung und die konkrete Ausgestaltung der Massnahmen richtungsweisend sein.
– Im «Produzentenforum» sind über 20 Fachorganisationen der Landwirtschaft vertreten.In regelmässigen Abständen gibt es Treffen mit einer Vertretung des BLW. Dabei werden insbesondere die anstehenden kurzfristigen Verordnungsanpassungen diskutiert.Dieses Jahr wurden im Produzentenforum auch die Möglichkeiten zur Umsetzung der Sparaufträge (EP04) erörtert.
In Form einer so genannten «Landsgemeinde» informiert das BLW alle agrarpolitisch interessierten Kreise halbjährlich über den Stand der Agrarpolitik 2011.

Die Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen betreffen die Landwirtschaft in zunehmendem Masse.Auf globaler Ebene ist die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk der WTO eingeflochten.Angesichts der geographischen Konzentration des Agrarhandels sind die vertraglichen Beziehungen zur EU und die zunehmende Integration in Europa für die Schweizer Landwirtschaft von grösster Bedeutung.
Um ihre Exportmöglichkeiten zu erhalten und verbessern,ist die Schweiz auf einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten angewiesen.Die Schweiz setzt sich zudem auf internationaler Ebene stark dafür ein,dass die multifunktionalen Eigenschaften der Landwirtschaft in den internationalen Abkommen stärker berücksichtigt werden.
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung und behandelt die internationalen Themen im dritten Kapitel.
–Abschnitt 3.1 enthält Informationen über den aktuellen Stand im Europa-Dossier und bei den WTO-Verhandlungen sowie über ein Seminar betreffend Multifunktionalität,welches im September 2004 in der Schweiz abgehalten wurde.
–In Abschnitt 3.2 geht es um internationale Vergleiche.Im vorliegenden Bericht werden die im Jahr 2000 begonnenen internationalen Preisvergleiche fortgeführt.
Die politischen Entwicklungen im internationalen Bereich verlaufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.Sie beeinflussen zwar die Entwicklung der Agrarpolitik im Inland,sind aber von der Schweiz nur beschränkt steuerbar.Entgegen den Erwartungen mancher Beobachter wurden in der Berichtsperiode weder in Bezug auf die im bilateralen Agrarabkommen Schweiz-EU vereinbarten Marktöffnungen noch in der Welthandelsorganisation (WTO) weitere Liberalisierungsschritte vereinbart.
–Die seit längerer Zeit erwarteten Zusatzforderungen der EU nach einer Erweiterung des Geltungsbereichs des bilateralen Agrarabkommens wurden von der EUKommission zugunsten der Forderungen der neuen EU-Mitgliedländer in Osteuropa zurückgestellt.Diese verlangten die Weiterführung der Präferenzen,welche ihnen die Schweiz im Rahmen von acht jeweils bilateralen Agrarabkommen zugestanden hatte.Es gelang im Gegenzug zu dieser Weiterführung,auch von der EU einige Konzessionen für Schweizer Rohstoffe und verarbeitete Agrarprodukte zu erhalten.
–Die WTO-Ministerkonferenz in Cancún im September 2003 scheiterte zwar nicht an den nach wie vor grossen Gegensätzen im Agrardossier.Aber ein Erfolg der gesamten,im November 2001 an der Ministerkonferenz von Doha eingeläuteten ersten WTO-Verhandlungsrunde ist nur möglich,wenn auch im Agrardossier eine umfassende Einigung erzielt werden kann.
Diese beiden für die Schweizer Landwirtschaft wichtigsten internationalen Dossiers werden unten näher geschildert.Weitere Ereignisse können wie folgt zusammengefasst werden:
–Die am 26.Juni 2003 beschlossene Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) umfasst im Wesentlichen die Ausrichtung einer produktionsunabhängigen einzelbetrieblichen Zahlung,welche an Vorschriften in den Bereichen Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit,Tiergesundheit und Tierwohl sowie an die Bedingung,dass alle landwirtschaftlichen Flächen in einem agronomisch und ökologisch befriedigenden Zustand erhalten werden («Cross compliance») gebunden sind;eine Politik der stärkeren ländlichen Entwicklung mit einer Aufstockung der Finanzmittel und neuen Massnahmen zur Förderung der Umwelt,der Qualität und des Tierwohls;eine schrittweise Reduzierung der Direktzahlungen («Modulation») zur Finanzierung der neuen Politik der ländlichen Entwicklung.In der Marktpolitik wurden asymmetrische Preissenkungen im Milchbereich beschlossen (Herabsetzung des Interventionspreises für Butter um 25% über vier Jahre,für Magermilchpulver um 15% über drei Jahre) sowie eine Halbierung der monatlichen Zuschläge im Getreidebereich,wobei hier der Interventionspreis beibehalten wurde.
–Im Rahmen der «Bilateralen 2» konnte mit der EU das erweiterte Protokoll 2 des Freihandelsabkommens CH-EU von 1972 betreffend die verarbeiteten Agrarprodukte verabschiedet werden.Neu sind:
– Vereinfachung des Preisausgleichmechanismus: Die EU schafft ihre Zölle und Exportsubventionen vollständig ab,während die Schweiz die ihrigen reduziert und zum Teil ebenfalls abschafft;
– Ausdehnung des Geltungsbereichs: Der Anwendungsbereich dieses Ausgleichsmechanismus von Zoll- und Exportsubventionsreduktionen wird auf weitere Produkte ausgedehnt.
Die Schweizer Exporteure erhalten zollfreien Zutritt zu einem Markt mit 450 Mio. Konsumentinnen und Konsumenten.Die Ausdehnung auf weitere Produkte erhöht das vom Protokoll 2 erfasste Handelsvolumen um rund einen Drittel.Die Exportmöglichkeiten unserer Nahrungsmittelindustrie werden verbessert,wovon auch die Schweizer Produzenten von landwirtschaftlichen Grundstoffen profitieren werden.

–Ein neues Freihandelsabkommen der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) wurde mit Chile unterzeichnet.Verhandlungen sind im Jahr 2004 abgeschlossen worden mit Libanon und Tunesien.Die beiden Abkommen wurden anlässlich der Ministerkonferenz im Juni 2004 unterzeichnet.Weitere Verhandlungen laufen mit Ägypten und den SACU-Staaten (Zollunion südliches Afrika mit Botswana,Namibia, Lesotho,Südafrika und Swasiland).Die Freihandelsabkommen sichern den Zugang für die Schweizer Industrie und gewisse Dienstleistungssektoren zu vergleichbaren Bedingungen wie für ihre Konkurrenten in der EU.Sie enthalten in separaten bilateralen Agrarabkommen Zugeständnisse für Agrarrohstoffe.Ziel in diesen Verhandlungen bleibt,den Schutz der Schweizer Landwirtschaft weitestgehend zu erhalten und keine Zugeständnisse für sensible Produkte zu machen.Zudem können auch für schweizerische Agrarausfuhren günstigere Importbedingungen erzielt werden.
–Die OECD hat dieses Jahr wiederum eine Einschätzung der Finanzmittel vorgenommen,die der Landwirtschaft von den Konsumentinnen und Konsumenten sowie den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gewährt werden.Hauptindikator ist dabei der PSE-Wert (Producer Support Estimate),mit dem sich alle Einnahmen der Landwirtschaftsbetriebe,auch die durch den Grenzschutz erzielten,ermitteln lassen. Nach den Berechnungen der OECD lag der PSE der Schweiz im Jahr 2003 bei 74%. Er blieb seit 2002 stabil und erreichte 2003 erneut den höchsten Wert aller Mitgliedsländer,vor Norwegen (72%),Island (70%),Korea (60%) und Japan (58%). Mit einem Wert von 37% verzeichnete die EU eine leichte Erhöhung ihres PSE gegenüber 2002.Die einzelnen Komponenten des PSE ermöglichen es auch,die nationalen Agrarreformen und die Entwicklung der verschiedenen Massnahmen aufzuzeigen.So entfiel 2003 in der Schweiz ein Anteil von 66% der gesamten Unterstützung auf die Marktstützung (inkl.Grenzschutz),während dieser Anteil in den Jahren 1986-88 noch 90% erreichte.
■ Entwicklungen
Das Abkommen vom 21.Juni 1999 zwischen der EU und der Schweiz über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrarabkommen) ist am 1.Juni 2002 in Kraft getreten.Es strebt eine Verbesserung des gegenseitigen Marktzutritts für Agrarprodukte durch Abbau von Zöllen und Exportsubventionen sowie von technischen Handelshemmnissen an und anerkennt die technischen Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz,biologische Landwirtschaft und teilweise Veterinärmedizin sowie die Qualitätsnormen für Früchte und Gemüse usw.als gleichwertig.Schwerpunkt des tarifären Teils ist die vollständige gegenseitige Liberalisierung des Käsehandels.Ab 1.Juni 2007 können somit zwischen der Schweiz und der EU alle Käsesorten frei,das heisst ohne jegliche mengenmässigen Beschränkungen und Zölle,allerdings auch ohne Exportbeihilfen,gehandelt werden.
Im Fleischsektor wurden die BSE-bedingten Importverbote von Italien und Österreich für Schweizer Produkte Ende 2003 aufgehoben.Die gegenseitig gewährten Trockenfleischkontingente werden somit per 1.Januar 2005 in Kraft treten können.
■ Die Arbeiten im Gemischten Agrarausschuss
Gemäss Artikel 6 des Agrarabkommens wurde ein Gemischter Ausschuss eingesetzt, der mit der Verwaltung des Abkommens betraut ist und für dessen ordnungsgemässe Anwendung sorgt.Unter dem Vorsitz der Schweiz trat dieser Ausschuss am 11.Juni 2003 in Bern und am 4.Dezember 2003 in Brüssel zusammen.Schwerpunkt waren die Arbeiten in zehn Arbeitsgruppen,welche die Anpassungen bzw.Aufdatierung der Anhänge und Anlagen des Abkommens vorzubereiten hatten.Die Notwendigkeit zur Aufdatierung hat sich im Zuge von gemeinschaftsrechtlichen Entwicklungen seit Inkrafttreten sowie im Sinne von Handelserleichterungen gemäss Artikel 5 des Abkommens ergeben,mit dem sich die Vertragsparteien verpflichten,die technischen Handelshemmnisse weiter abzubauen.Um die Äquivalenz der entsprechenden schweizerischen Regelungen mit denjenigen der EU beizubehalten und das korrekte Funktionieren des Abkommens zu gewährleisten,wurden technische Änderungen bei folgenden Anhängen bzw.deren Anlagen in die Wege geleitet:Anhang 4 (Pflanzenschutz),Anhang 7 (Weinbauprodukte),Anhang 8 (Spirituosen),Anhang 9 (Ökologische Erzeugnisse),Anhang 10 (Obst & Gemüse) sowie Anhang 11 (Veterinärabkommen).
Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Arbeiten ist der Bereich der geographischen Angaben.Schwierige Dossiers dieser Gruppe betreffen Emmentaler,Raclette und Greyerzer Käse.Die vom Gemischten Ausschuss eingesetzte und bislang informelle Arbeitsgruppe «AOC» soll in ein formelles Verhandlungsgremium umgewandelt werden,dessen Aufgabe die Erstellung einer Liste gegenseitig anerkannter geschützter Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben sein wird.
Im Zuge der Osterweiterung der EU wurden die bis anhin in den Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und dem entsprechenden Neumitglied gewährten Konzessionen der gesamten EU zugänglich gemacht und somit beibehalten.Im Gegenzug gewährt die EU der Schweiz neue Zollfreikontingente für Mastremonten und Treibzichorien.
Die Evolutivklausel (Artikel 13) erlaubt eine Weiterentwicklung des Abkommens.Mit dem Agrarabkommen haben sich die Parteien verpflichtet,«ihre Bemühungen fortzusetzen,um den Handel mit Agrarerzeugnissen schrittweise weiter zu liberalisieren» und «auf der Grundlage gegenseitiger und beiderseits vorteilhafter Präferenzregelungen den weiteren Abbau von Handelshemmnissen im Agrarbereich zu beschliessen.»
Die EU hat ein Verhandlungsmandat verabschiedet,welches der Kommission erlaubt, mit Forderungen an die Schweiz heranzutreten und neue Konzessionen auszuhandeln. Doch wurde die Erstellung der Forderungsliste vorübergehend zugunsten der Osterweiterung zurückgestellt und dürfte nicht vor 2005 zu erwarten sein.Auch die Schweizer Landwirtschaft sieht inzwischen bei mehreren Produkten neue Exportmöglichkeiten,welche in diese Verhandlung eingebracht werden sollen.
Am 1.Mai 2004 traten zehn neue Staaten der EU bei:Estland,Litauen,Lettland,Polen, Tschechische Republik,Slowakei,Ungarn,Slowenien,griechischer Teil Zyperns und Malta.Diese EU-Erweiterung leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit,zur Stabilität und zum Wohlstand Europas und vergrössert den europäischen Markt um 76 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten.
Das 1999 von der Schweiz und der EU geschlossene bilaterale Agrarabkommen gilt automatisch seit dem 1.Mai 2004 auch für die zehn neuen Mitglieder.Es erleichtert den Handel mit Agrarprodukten zwischen der Schweiz und diesen Ländern durch einen Zollabbau und die Aufhebung nichttarifarischer Handelshemmnisse (Gleichwertigkeit der phytosanitarischen Vorschriften,der minimalen Qualitätsnormen und der Vorschriften im Veterinärbereich).Dadurch bietet es der Schweiz Exportmöglichkeiten für ihre Agrarprodukte,wo traditionellerweise ihre Stärke liegt.Das Abkommen stellt aber auch eine Herausforderung dar,denn die Importe (vor allem billige Industriekäse) aus den genannten Ländern werden ebenfalls erleichtert.
Schliesslich werden die Bedingungen für den Export verarbeiteter Landwirtschaftsprodukte (Biskuits,Schokolade usw.) in die neuen Mitgliedländer verbessert.Das oben erwähnte neue Protokoll 2 des Freihandelsabkommens Schweiz-EU von 1972 bietet mehr Vorteile als das Protokoll A,das vor dem EU-Beitritt zwischen der Schweiz und den betroffenen Ländern galt.
Gemäss dem Abkommen über den freien Personenverkehr werden ab dem zweiten Semester 2005,allenfalls schon früher,Personen,die sich weniger als drei Monate in der Schweiz aufhalten oder Leistungserbringer,deren Unternehmen seinen Sitz auf dem Territorium eines neuen Mitgliedstaates hat,für die Ausübung ihrer Tätigkeit in der Schweiz keine Bewilligung mehr brauchen.Dadurch werden mehr saisonale Arbeitskräfte für die Landwirtschaft verfügbar sein.
■ Durchbruch bei der Doha-Runde
Nach dem Scheitern der WTO-Ministerkonferenz in Cancún,Mexiko,im September 2003,beschlossen die WTO-Mitglieder Anfang 2004,dass so rasch wie möglich nachgeholt werden sollte,was in Cancún nicht gelang.In der Nacht auf den 1.August 2004 trafen nun die WTO-Mitglieder in Genf die nötigen Entscheide,damit die DohaVerhandlungsrunde fortgesetzt werden kann.
Das Treffen hatte zum Ziel,Impulse für die weiteren Verhandlungen zu geben und die entsprechenden operationellen Entscheide zu fällen.Es gelang,Rahmenabkommen («frameworks») je über die Landwirtschaft und über Industrieprodukte abzuschliessen sowie Verhandlungen über Erleichterungen im Handel zu lancieren.Bei den Dienstleistungen und den restlichen Verhandlungsthemen wurden Impulse für die Fortsetzung der Verhandlungen gegeben.Schliesslich wurde beschlossen,die nächste reguläre WTO-Ministerkonferenz im Dezember 2005 in Hong Kong abzuhalten.
■ Verhandlungen im Bereich Landwirtschaft
Die Agrarverhandlungen sind seit dem Beginn der Doha-Runde zentral.Gegenstand der Verhandlungen seit März 2003 war die Festlegung des Verhandlungsrahmens in den drei Bereichen Marktzutritt,interne Stützung und Exportsubventionen.Es wurde nur über den Rahmen («framework») und – mit zwei Ausnahmen bei der internen Stützung – nicht über konkrete Zahlen («modalities») verhandelt.
In Genf standen sich – abgesehen von den Initianten der Baumwoll-Initiative – im Wesentlichen sechs Gruppen von Mitgliedern gegenüber:Die EU,die USA (beide an ein positives Resultat in hohem Masse angewiesen wegen dem Ausscheiden ihrer zuständigen Minister),die Gruppe 20 mit Argentinien,Bolivien,Brasilien,Chile,China, Kolumbien,Costa Rica,Kuba,Ecuador,Ägypten,El Salvador,Guatemala,Indien, Mexiko,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Südafrika,Thailand und Venezuela,die Cairns-Gruppe mit Australien,Argentinien,Bolivien,Brasilien,Chile,Costa Rica, Guatemala,Indonesien,Kanada,Kolumbien,Malaysia,Neuseeland,Paraguay,den Philippinen,Südafrika,Thailand und Uruguay und die G10 mit Bulgarien,Island,Israel, Japan,Liechtenstein,Korea,Mauritius,Norwegen,Taiwan und der Schweiz als Koordinatorin,sowie eine eher heterogene Gruppe von strukturschwachen Entwicklungsländern (G90,darunter die Afrikanische Union und die AKP-Länder),deren primäre Sorge der Verlust ihres Marktvorteils aufgrund ihrer Zollpräferenzen ist.
Da das «framework» in vielen Bereichen Differenzen zwischen den Mitgliedern mit vagen Formulierungen überdeckt,werden die weiteren Verhandlungen über die genauen Modalitäten bis zur Ministerkonferenz in Hong Kong ebenso intensiv wie schwierig sein.
Gegenüber dem in Cancún gescheiterten Vorschlag ergeben sich für die Schweiz mehrheitlich Verbesserungen,wobei der Detaillierungsgrad höher ist und damit weniger Unsicherheiten bestehen.Der Inhalt des «framework» kann wie folgt zusammengefasst werden:
Marktzutritt
Substantieller und harmonisierender Zollabbau,wobei die hohen Zölle stärker reduziert werden sollen als die tiefen (Einrichtung von Zollbändern mit einer «tiered formula»).Das von den USA mit Vehemenz geforderte «capping» (Festlegung eines maximalen Zollansatzes pro Zolltariflinie,z.B.100 oder 150% des Warenwerts zu Weltmarktpreisen) konnte im Vergleich zum Text in Cancún stark abgeschwächt werden (nur noch «Prüfung»).Gleichzeitig können sensible Produkte milder als mit der für das jeweilige Zollband geltenden Reduktionsformel behandelt werden.Als «Preis» dafür wird aber mit einer gewissen Ausweitung der Zollkontingente und/oder einem zusätzlichen Zollabbau zu bezahlen sein.
Interne Stützung
Abbau der produktgebundenen Stützung,wobei der Abbau in denjenigen Ländern grösser sein soll,wo die Stützung grösser ist (wie beim Marktzutritt:substantieller und harmonisierender Abbau).Als maximale Variante kann der Vorschlag einer globalen Reduktion der Stützung um 60% gelten,die dem Spielraum der EU entspricht.Damit werden jedoch die USA Mühe haben.Zusätzlich soll eine Obergrenze auf der Stützung für jedes einzelne Produkt («product specific capping») eingeführt werden.
Exportsubventionen
Abschaffung aller Formen von Exporthilfen (Exportsubventionen,Exportkredite mit Laufdauer von mehr als 180 Tagen,gewisse Praktiken von Staatshandelsunternehmen, gewisse Arten von Nahrungsmittelhilfe).Über den Zeitpunkt dieser Abschaffung wird in der Modalitätenphase zu verhandeln sein (Übergangsfrist von 5–10 Jahren).
Bewertung
Zeitlich dürfte sich die Umsetzung der voraussichtlichen Doha-Verpflichtungen in etwa mit der AP 2011 decken.Eine längere Frist gibt es wahrscheinlich für den Abbau der Exportsubventionen.Das Ausmass der Auswirkungen dürfte dasjenige der UruguayRunde jedoch deutlich übersteigen und zweier Reformperioden bedürfen,um im Grundsatz sozialverträglich zu sein.
Damit wird klar,dass die bisher geleisteten Reformanstrengungen mit unvermindertem Tempo weitergeführt werden müssen,damit die Schweizer Landwirtschaft auch den zukünftigen internationalen Herausforderungen genügen und gleichzeitig ihren verfassungsmässigen Auftrag im Sinne einer marktfähigen und nachhaltigen Produktion weiterhin erfüllen kann.Neben den Eigenanstrengungen ist dabei vor allem die Unterstützung durch die Gesellschaft unerlässlich.
Im Verlauf des Jahres 2003 ermittelte das BLW in enger Zusammenarbeit mit der Branche für jede einzelne der 2'246 Tariflinien,die bei der WTO unter den Begriff Landwirtschaft fallen,sowohl die schweizerischen Grosshandelspreise als auch die Einstandpreise bei der Einfuhr.Diese Preise,die praktizierten und in Genf notifizierten Zölle sowie insbesondere der landwirtschaftliche Produktionswert der direkt substituierbaren Produkte bilden ein Instrument,dank dem sich heute einige für unsere Landwirtschaft entscheidende Fragen beantworten lassen.So kann das BLW die Auswirkungen der verschiedenen Formeln zum Zollabbau auf die Produktion,die Vorleistungen und die Wertschöpfung des Primärsektors vergleichen.Zudem ist es nun möglich,bei einer gegebenen Formel die Verluste auf Produktionsebene zu minimieren,indem diejenigen Tarifpositionen bezeichnet werden,die am ehesten in den Genuss der im Rahmenabkommen vom Juli 2004 vorgesehenen Bestimmungen für sensible Produkte kommen könnten.

Das Parlament hat den Bundesrat ermächtigt,den Entwicklungsländern allgemeine Zollpräferenzen zu gewähren (Zollpräferenzenbeschluss).Bei der Verlängerung dieses Beschlusses im Jahre 2006 wird es auch die Zweckmässigkeit prüfen,den 49 am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) ausnahmslos und ohne Einschränkung durch Kontingente Nullzölle zuzugestehen.
Zwei Abbauetappen sind bereits erfolgt.Die erste,auf den 1.Januar 2002,bestand in einer durchschnittlichen Herabsetzung der Zölle auf allen Agrarprodukten um 30%,die somit noch 70% des Normaltarifs betrugen (Zollpräferenzenverordnung).Dabei variierte die Zollsenkung je nach Sensibilität der Produkte zwischen 10 und 50%.In einer zweiten Etappe wurden auf den 1.April 2004 diese Restzölle um die Hälfte reduziert,so dass sie heute im Durchschnitt auf 35% der ordentlichen Zölle gesunken sind.
Falls die Auswirkungen der Zollsenkungen auf den Warenverkehr wesentliche Wirtschaftsinteressen der Schweiz tangieren könnten,hat der Bundesrat die Möglichkeit, die Präferenzen zu ändern oder aufzuheben solange die Umstände es erfordern (autonome Schutzklausel).Diese Klausel ist allerdings seit Einführung der Präferenzen nicht zur Anwendung gelangt.
■ Internationale Konferenz über die «Landwirtschaft und ihren Beitrag an die Gesellschaft»
Vom 8.bis 10.September 2004 fand in Charmey eine internationale Konferenz zum Thema «Landwirtschaft und ihr Beitrag an die Gesellschaft» statt.Rund 60 Teilnehmer aus gut dreissig Ländern fanden sich zu dieser Veranstaltung ein.Die internationalen Organisationen FAO,WTO und OECD,mehrere Regierungen und Verwaltungen sowie akademische Kreise waren in Charmey vertreten.
An der Konferenz trafen erstmals die verschiedenen Ausrichtungen der wichtigsten von dieser Thematik betroffenen internationalen Organisationen und akademische Denkströmungen aufeinander.Während sich die FAO mit den «Rollen der Landwirtschaft» beschäftigt,spricht man in der OECD von «Multifunktionalität» und in der WTO von «nicht handelsbezogenen Anliegen» (NTC,Non Trade Concerns).Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen der Protagonisten war die Verabschiedung einer gemeinsamen Doktrin über den gesellschaftlichen Beitrag der Landwirtschaft am Ende des Kongresses illusorisch.Das Seminar hatte daher die folgenden Zielsetzungen:
–Die Wahrnehmung der Entwicklung der Landwirtschaft und ihres Beitrages an die Gesellschaft durch die teilnehmenden internationalen Organisationen und Länder beurteilen.Bei der Einladung zur Konferenz wurde daher auf eine angemessene Vertretung der verschiedenen Nationen und Tendenzen geachtet.
–Gespräche und Austausch zwischen Regierungen und Universitätskreisen,um das gegenseitige Verständnis für die entsprechenden Ansätze zu fördern und die Sichtweise der Teilnehmer zur Thematik zu erweitern.
–Die politischen Berater mit den akademischen Ansätzen konfrontieren.
■ Inhalt
Die verschiedenen Ansätze innerhalb der internationalen Organisationen:
HauptzieleHerausforderungen
Rollen der Landwirtschaft
(FAO)
Beurteilung der Rollen der Landwirtschaft und deren Bedeutung in diversen Entwicklungskontexten
Beiträge der Landwirtschaft ermitteln und messen,um auf die verschiedenen Herausforderungen in geeigneter Weise zu reagieren
Multifunktionalität
(OECD)
Erarbeitung einer gemeinsamen Terminologie zur Festlegung der wichtigsten politischen Fragen und eines Analyserahmens, dank dem optimale Landwirtschaftspolitiken eingeführt werden können.
Gezielte Massnahmen zur Produktion von Erzeugnissen und Erbringung von Dienstleistungen der Landwirtschaft,die über deren Grundaufgaben hinausgehen,mit minimaler Wettbewerbsverzerrung
Nicht handelsbezogene Anliegen (WTO)
Berücksichtigung nicht handelsbezogener Anliegen der Landwirtschaft bei den Verhandlungen
Umsetzung nicht handelsbezogener Ziele mit möglichst wenig Marktverzerrung auf Massnahmenebene ermöglichen
Die Workshops der Konferenz behandelten die vier folgenden Themenkreise:
1.Umweltexternalitäten
2.Kultur,Landwirtschaft und deren Wahrnehmung
3.Ernährungssicherheit
4.Landwirtschaft,Beschäftigung und ländliche Entwicklung
Die Diskussionen des ersten Workshops (Umweltexternalitäten) haben erkennen lassen,wie sehr die Frage der Externalitäten in der Landwirtschaft lokal geprägt ist und von den jeweiligen Gegebenheiten und Besonderheiten der Regionen oder Kleinstregionen abhängt.Ebenso kamen die Schwierigkeiten bei der Umsetzung makroökonomischer Massnahmen zur Sprache.Eine Analyse der Auswirkungen der Politiken und Massnahmen auf Stufe Einzelperson,Haushalt oder Betrieb erwies sich dabei als zentral.Insgesamt ergaben die Gespräche,dass es für die Beurteilung der verschiedenen Programme und der Umsetzung geeigneter Massnahmen noch an praktischen Erfahrungen fehlt.
«Have you eaten your rice today?»,womit man sich in Korea nach der Befindlichkeit seines Gegenübers erkundigt,fasst die Debatten der zweiten Arbeitsgruppe (Kultur, Landwirtschaft und ihre Wahrnehmung) treffend zusammen.Denn selbst in einer modernen Gesellschaft wie Korea ist der Einfluss der landwirtschaftlichen Traditionen auf die Grundfesten der nationalen Kultur nach wie vor sehr gross.Die Diskussionen haben ein breites Wahrnehmungsspektrum in Bezug auf die Rolle der Landwirtschaft offen gelegt:Die Wahrnehmungen scheinen stark vom gesellschaftlichen Entwicklungsniveau abzuhängen.Sie fallen bei armen Bevölkerungen sehr negativ und in reichen Gesellschaften – mit einem deutlichen Einfluss jedoch auf das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten – nahezu verklärt aus.Zudem öffnet sich zwischen den städtischen und ländlichen Bevölkerungen eine grosse Schere.Diese Wahrnehmung ist allerdings nicht statisch und wandelt sich parallel zur Entwicklung der Gesellschaft.
Im dritten Workshop (Ernährungssicherheit) mündete der Meinungsaustausch in der Erkenntnis,dass die Versorgungssicherheit nur wenig mit der Multifunktionalität zusammenhängt,wenn die Haushalte betroffen sind.Auf nationaler Ebene hingegen kann die Inlandproduktion unter gewissen Voraussetzungen eines der Mittel zur Sicherung der Ernährung sein.Die Präsentation und Kommentare der Teilnehmer waren ebenso vielfältig wie die Ansätze und Auffassungen zu dieser Problematik: Einige Teilnehmer möchten die Ernährungssicherheit lieber über den freien Handel gewährleisten und eventuell Lager anlegen,um die Gefahren in turbulenten und krisengeschüttelten Zeiten in Grenzen zu halten.Ihrer Meinung nach erlauben nur ein vorhersehbarer internationaler Handel,sichere Transporte und offene Grenzen eine ausreichende Versorgungssicherheit.Für andere bleibt die landwirtschaftliche Produktion einheimischer Grundprodukte ein zentrales Element der Ernährungssicherung eines Landes.Demzufolge ist auch die Entwicklungsstufe eines Landes massgebend für die Wahl der entsprechenden Strategie.
■ Beurteilung
Der vierte Workshop befasste sich mit den Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Beschäftigung und ländlicher Entwicklung.In den entwickelten Ländern kann der Landwirtschaft kaum mehr eine vorherrschende Rolle in der Entwicklung des ländlichen Raumes zugeschrieben werden.Unter bestimmten Gegebenheiten kann sie jedoch eine wesentliche Funktion erfüllen:Verfügt beispielsweise eine Region über einen starken Agrarsektor,ist die Abwanderung in die Städte gering und die Besiedelung dicht.Die Produktivität der Faktoren,die Absatzmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeiten sowie die Dynamik der Akteure müssen indessen berücksichtigt werden,wenn der Beitrag der Landwirtschaft zur ländlichen Entwicklung nachhaltig sein soll.Wie sich auch aus den Gesprächen herauskristallisiert hat,kommt der Beseitigung entwicklungshemmender Sachzwänge (z.B.Bodenrecht),der Diversifizierung der lokalen Wirtschaft,der Differenzierung der Produkte und der Anpassung der Strukturen grosse Bedeutung zu.Sind diese Voraussetzungen gegeben,kann die Interaktion zwischen ländlicher Entwicklung und Landwirtschaft die Beschäftigung in den ländlichen Gebieten und dadurch die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit fördern.
Das Seminar hat die vielfältigen Ansätze der internationalen Organisationen und nationalen Agrarpolitiken,aber auch die gemeinsamen Herausforderungen gezeigt,die in erster Linie sind:
–Verbesserter Marktzugang für Entwicklungsländer;
–Einführung effizienter und effektiver Massnahmen,damit sich die Landwirtschaft als Motor für wirtschaftliches Wachstum und als Instrument zur Reduktion der Armut positionieren kann;
–Reformbedarf der Agrarpolitiken zur Erreichung eines ausgewogenen Gleichgewichts zwischen freiem Handel (hauptsächlich Marktzutritt für sehr wettbewerbsstarke Exporteure) und Produktion anderer Güter als Grunderzeugnisse (im Falle von «Marktversagen»);
–Bessere Harmonisierung der Konzepte für die Umsetzung landwirtschaftlicher,dem jeweiligen Umfeld angepasster Stützungsmassnahmen im Bemühen um möglichst wenig Wettbewerbsverzerrungen.
Das Seminar in Charmey bot Gelegenheit,die in der politischen Analyse und Debatte erzielten Fortschritte zu erkennen.Die Diskussionen wurden objektiver und sachlicher geführt als noch vor gut zehn Jahren.So scheinen die verwendeten Begriffe denn auch weniger Kontroversen auszulösen als früher,auch wenn die Ansätze unterschiedlich bleiben.Die neuen Kontakte,die sich in Charmey zwischen Agrarpolitik und akademischen Kreisen knüpfen liessen,werden diese Entwicklung zweifelsohne verstärken.
Ein internationaler Preisvergleich erlaubt eine Standortbestimmung.Er lässt die Unterschiede bei den Produktionskosten der miteinander verglichenen Länder erkennen und beleuchtet die Gründe für den Einkaufstourismus über die Landesgrenzen.Folglich hilft der Preisvergleich auch,entsprechende Massnahmen an den Grenzen zu treffen (Zölle und Exportbeihilfen).Schliesslich führt er den Steuerzahlern vor Augen,dass die Schweizer Landwirtschaft grosse Anstrengungen unternimmt,um im Preiswettbewerb bestehen zu können.

Der internationale Preisvergleich erfolgt auf Grund identischer,ähnlicher oder wichtiger Märkte.Damit sind jedoch gewisse Schwierigkeiten verbunden wie die Auswahl der Produkte,die Verfügbarkeit der Daten,die Relevanz der Messgrössen,die unterschiedlichen Produktions- und Verkaufsformen oder die währungsspezifischen Einflüsse.Bei den in diesem Kapitel verwendeten Preisen handelt es sich um:
–Nationale Durchschnittswerte.Das bedeutet,sie können minimale bzw.maximale Werte je nach Region oder Verwertung des Erzeugnisses (Produzentenpreis) verdecken.
–Grössenordnungen,denn die Erzeugnisse (Qualitäts-,Labelprodukte),Vermarktungsvoraussetzungen (Menge,Vermarktungsgrad),Absatzkanäle und Berechnungsmethoden des Durchschnittswertes unterscheiden sich von Land zu Land.

–Bruttopreise;das heisst:
–die auf dem Markt beobachteten Preise (im Rahmen der Agrarpolitik jedes einzelnen Landes).Die Produzentenpreise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Diese ist jedoch in den Konsumentenpreisen eingeschlossen,da es sich um eine vom Konsumenten zu leistende Abgabe handelt.
–Die Preise sind nicht nach der unterschiedlichen Kaufkraft der beobachteten Länder bereinigt.Siehe hierzu die UBS-Studie «Preise und Löhne»,ein Kaufkraftund Lohnvergleich rund um die Welt,Ausgabe 2003.(http://www.ubs.com/ 1/f/media_overview/media_switzerland/mediareleases?newsId=60256)
Es stehen daher nicht die absoluten Werte,sondern die Veränderungen im Verlaufe der Zeit im Vordergrund.
Die aus dem Verkauf eines «Standardwarenkorbes» erzielten Einnahmen der Produzenten dienen als Vergleichsgrundlage.Der Standardwarenkorb setzt sich aus der durchschnittlichen Produktion (1998–2000) der Schweiz von 15 der 17 landwirtschaftlichenErzeugnisse zusammen,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleichs sind.Da die Statistiken über Zuckerrüben und Raps der USA nicht verfügbar waren, sind diese beiden Produkte nicht im «Standardwarenkorb» enthalten.Dieser entspricht 3,2 Mio.t Milch,2,7 Mio.Schweine,35,5 Mio.Poulets usw.Die Struktur der schweizerischen Produktion wird folglich auf die verglichenen Länder übertragen.
Die Preise der EU (EU-4/6) beziehen sich auf die vier Nachbarstaaten.Die Länder fünf und sechs betreffen die Niederlande und Belgien.Sie werden für jene Produkte berücksichtigt,bei denen sie hohe Produktionsvolumen ausweisen.Der Durchschnittspreis für die EU-4/6 berechnet sich aus dem Produktionsvolumen 1995/2001 der betreffenden Länder.Auf diese vier bzw.sechs Länder entfällt mehr als die Hälfte der von den 15 EUMitgliedern produzierten Gesamtmenge.Die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes und das Gewicht der Länder der EU-4/6 sind als fix über die Zeit angenommen, damit nur die Preisschwankungen aufgezeigt werden.
Auf welchem aktuellen Stand (2001/03) befinden sich die schweizerischen Agrarpreise im Vergleich zur EU und den USA?
–Würden die Landwirte der EU-4/6 oder der USA den schweizerischen Standardwarenkorb produzieren und 2001/03 in ihren Ländern verkaufen,erzielten sie rund die Hälfte (54 bzw.51%) der Einnahmen ihrer Schweizer Kollegen.
–Je nach EU-Land sind jedoch Unterschiede auszumachen:Der Erlös des Standardwarenkorbes entspricht in Italien 63%,in Deutschland 54%,in Frankreich 53% und in Österreich 52% des Schweizer Preises.
–Unterschiedliche Entwicklungen werden auch je nach Produkt beobachtet:Der Preis der Ackerbauprodukte wie Weizen (29% des schweizerischen Preises),Gerste (33%),Raps (43%) und Kartoffeln (44%) bewegt sich 2001/03 in der EU-4/6 auf einem ausgesprochen tiefen Niveau.Eine Ausnahme bilden die in der EU kontingentierten Zuckerrüben (51%).Im Gegensatz zu diesen Erzeugnissen erreicht die Milch,die ebenfalls kontingentiert ist,in der EU-5 einen ziemlich hohen Preis (62%).
–Im Vergleich «Land-Produkt» zeigen sich folglich noch viel grössere Abweichungen: Während 2000/03 in Frankreich Birnen zu 99% des schweizerischen Preises verkauft wurden,erhielten 2001/03 österreichische Bauern für Karotten lediglich 23% des Entgelts der Schweizer Landwirte.
Entwicklung der Produzentenpreise in der EU und der Schweiz
(10 kg)
(kg SG) Kalb (kg SG) Schwein (kg SG) Poulet (2 kg LG) Eier (20 St.) Weizen (10 kg) Gerste (10 kg)
K ö rnermais (10 kg)
Zuckerr ü ben (100 kg) Kartoffeln (20 kg) Raps (5 kg) Ä pfel (10 kg) Birnen (10 kg) Karotten (10 kg) Zwiebeln (10 kg)
Tomaten (5 kg)
Standardwarenkorb (Mrd. Fr./Jahr)
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste
Produzentenpreise der Schweiz im Verhältnis zur EU
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste
Nähern sich die schweizerischen Agrarpreise denjenigen in der EU und den USA an?
– In der Zeitspanne zwischen 1990/92 und 2001/03 gingen die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) für den Standardwarenkorb nicht nur in der Schweiz (–24%), sondern auch in der EU (–20%) zurück.Die niedrigeren Preise im EU-Raum lassen sich nicht nur durch die Agrarreformen,sondern auch durch die Schwächung des Euro erklären,der gegenüber dem Schweizer Franken 16% eingebüsst hat.
– Der relative Abstand zwischen der Schweiz und der EU hat im beobachteten Zeitraum daher nur leicht abgenommen.1990/92 betrug der Preis des Standardwarenkorbes in der EU 51% gegenüber aktuell 54% (2001/03).
– Deutlicher zeigt sich indessen die Angleichung an die EU-Preise in absoluten Werten.1990/92 belief sich der Preisunterschied beim Standardwarenkorb zwischen der Schweiz und den benachbarten EU-Ländern auf 49% (3’553 Mio. CHF) der Schweizer Preise und 2001/03 auf 46% (2’545 Mio.CHF).Zwischen den beiden Perioden hat sich die absolute Preisdifferenz zwischen der Schweiz und der EU um mehr als einen Viertel (–28%) verringert.
– Je nach EU-Land sind jedoch Unterschiede auszumachen:Zwischen den genannten Zeitspannen reduzierte sich die absolute Preisdifferenz beim Standardwarenkorb am meisten zu Frankreich (–33%),Deutschland (–28%) und Italien (–27%),während das Preisgefälle zu Österreich (–7%) nach dessen EU-Beitritt am 1.Januar 1995 etwas weniger deutlich abnahm.
– Unterschiedliche Entwicklungen zeigten auch die einzelnen Produkte:Zwischen 1990/92 und 2001/03 reduzierte sich der absolute Abstand zwischen der EU und der Schweiz am meisten bei Raps (–71%),Eiern (–48%),Milch (–39%) und Weizen (–42%),während sich die Preisschere bei den Schweinen (–15%) und bei den Grossrindern (–5%) weniger schloss und bei den Zwiebeln (+97%) sogar weiter öffnete.
– In den USA nahm die Entwicklung seit 1990/92 einen anderen Verlauf.Die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) zeigten bis 2001 eine steigende Tendenz (+28%).Seitdem ist ein Rückgang feststellbar.In den Jahren 2001/03 näherten sich die Preise des Standardwarenkorbes in den USA denjenigen der Referenzperiode 1990/92 wieder leicht an,blieben aber dennoch um 8% höher.Diese Differenz hängt fast ausschliesslich mit dem Anstieg des Dollarkurses gegenüber dem Schweizer Franken (+9%) während des beobachteten Zeitraumes zusammen. Gegenüber der Referenzperiode (1990/92) verringerte sich das Preisgefälle zu den USA sowohl in relativen (Preise USA entsprachen 42% der Schweizer Preise 2001/03 gegenüber 35% im Zeitraum 1990/92) als auch in absoluten Werten (–42%).
Der Preis ist zwar ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft,aber nicht der einzige:Qualität,Sicherheit und Ruf des Produktes,Werbung,Verteilernetz,Absatzkraft und die mit den Erzeugnissen verbundenen Dienstleistungen sind ebenfalls für den Erfolg auf einem bestimmten Markt entscheidend.

■ Konsumentenpreise
Das Preisgefälle bei den Lebensmitteln zwischen der Schweiz und den beobachteten Ländern wurde aus dem Konsumentenpreis eines Standardwarenkorbes im Ladenverkauf inkl.MwSt.berechnet.Dieser Standardwarenkorb entspricht grob dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz pro Jahr (s.Tabelle 10) der 21 Lebensmittel,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleiches sind. «Grob»,da beispielsweise der Rinderbraten für das gesamte Rindfleischsortiment steht.Der Warenkorb entspricht 380 kg bzw.91% der 417 kg Nahrungsmittel (ohne Wein),die jährlich pro Kopf in der Schweiz konsumiert werden.Seine genaue Zusammensetzung ist am Ende der Tabelle 55 im Anhang aufgeführt.
Entwicklung der Konsumentenpreise eines Standardwarenkorbes
Zur Gruppe «EU-4» gehören wie bei den Produzentenpreisen die Nachbarländer Deutschland,Frankreich,Italien und Österreich.Für Italien dienten die Preise der Stadt Turin als Bezugsbasis.Beim Gemüse und bei fehlenden Zahlen aus den Nachbarländern wurde Belgien zusätzlich einbezogen.Zudem wurde aus den minimalen und maximalen nationalen Preisen ein oberer und unterer Durchschnittswert der EU-4/5 ermittelt.
Das Gewicht der einzelnen Länder der EU-4/6 (Ausgaben der Privathaushalte im Jahr 1998) und die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes wurden als fix angenommen,damit ausschliesslich die Preisschwankungen über die Jahre ersichtlich sind.
In den Jahren 2001/03 machten die Konsumentenpreise eines Standardwarenkorbs im EU-Raum 62% der in der Schweiz für denselben Warenkorb bezahlten Preise aus gegenüber den 54%,welche die Produzentenpreise für den Standardwarenkorb erzielten.Die relativ höheren Konsumentenpreise im EU-Raum lassen sich einerseits durch die unterschiedliche Zusammensetzung des Warenkorbes auf Produzenten- und Konsumentenebene sowie andererseits durch das Ausmass der Nahrungsmitteleinfuhren und den höheren Mehrwertsteuersatz in der EU erklären (rund 7% gegenüber 2,4% in der Schweiz mit Schwankungen je nach Land und Produkt).
In der Schweiz blieben die Konsumentenpreise für den Standardwarenkorb zwischen 1990/92 und 2001/03 nahezu unverändert,während die EU eine Abnahme um 11% verzeichnete.Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den benachbarten EULändern,die 1990/92 noch 31% (697 Fr.) der schweizerischen Preise betrug,stieg 2001/03 auf 38% (873 Fr.) an.Der absolute Preisabstand zwischen der Schweiz und der EU vergrösserte sich gar um einen Viertel (+25% bzw.+176 Fr.) zwischen diesen beiden Zeitspannen.
Im Gegensatz zu den Produzentenpreisen vertieft sich folglich der Graben zwischen den Konsumentenpreisen in der Schweiz und der EU.Diese Entwicklung lässt sich teilweise durch den deutlich gestiegenen Anteil der Label-Produkte (Bio,M-7,Coop, Natura Plan) insbesondere beim Fleisch erklären.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bleiben aber beträchtlich:Während in der EU der Zucker und in Italien (Turin) die Konsummilch mehr kosten als in der Schweiz,sind die Schweinekoteletts in der EU nur halb so teuer.Das in der EU-4 angebotene Schweinefleisch stammt denn auch mehrheitlich aus konventionellen Züchtungen.Das in den schweizerischen Geschäften im Jahr 2001 angebotene Schweinefleisch setzte sich hingegen zu 60% aus Marken- oder Labelerzeugnissen zusammen.
Im Zeitraum 1990/92 bis 2001/03 stiegen die Konsumentenpreise in den USA um 28% an,während sie in der Schweiz stabil blieben.Entsprechend wurde die Preisschere zur Schweiz kleiner:2001/03 betrug der Abstand nur noch 38% gegenüber 51% in der Periode 1990/92.Einer der Gründe dafür ist der Anstieg des Dollarkurses,der im Vergleich zum Schweizer Franken um 9% zulegte.
■ Projektleitung, Werner Harder
Sekretariat
■ Autoren
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Ursula Gautschi,Simon Hasler,Katja Hinterberger,Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Wirtschaftliche Lage
Vinzenz Jung
Soziales
Esther Grossenbacher
Ökologie und Ethologie
Brigitte Decrausaz,Ruth Badertscher,Anton Candinas,Benedikt Elmiger,Heinz Hänni, Esther Grossenbacher,Deborah Renz
Beurteilung der Nachhaltigkeit
Vinzenz Jung
■ Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Ursula Gautschi
Übergreifende Instrumente
Frédéric Brand,Friedrich Brand,Jean-Marc Chappuis,Emanuel Golder,Samuel Heger
Milchwirtschaft
Katja Hinterberger
Viehwirtschaft
Simon Hasler
Pflanzenbau
Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Direktzahlungen
Thomas Maier,Simone Aeschbacher,Hugo Roggo,Olivier Roux,Samuel Vogel
■ Übersetzungsdienste
Strukturverbesserungen und Betriebshilfe
René Weber,Peter Klaus,Willi Riedo
Forschung,Gestüt,Beratung,Berufsbildung,CIEA
Anton Stöckli,Fabio Cerutti,Jacques Clément,Urs Gantner,Geneviève Gassmann, Roland Stähli
Produktionsmittel
Lukas Barth,Olivier Félix,Markus Hardegger,Martin Huber,Albrecht Siegenthaler
Tierzucht
Karin Wohlfender
Sektion Finanzinspektorat
Rolf Enggist
Weiterentwicklung der Agrarpolitik
Thomas Meier
■ Internationale Aspekte
Internationale Entwicklungen
Nicole Bays,Christoph Eggenschwiler,Jacques Gerber,Jean Girardin
Internationale Vergleiche
Jean Girardin
Deutsch:Yvonne Arnold
Französisch:Christiane Bokor,Pierre-Yves Barrelet,Yvan Bourquard, Giovanna Mele,Elisabeth Tschanz,Marie-Thérèse Von Graffenried, Magdalena Zajac
Italienisch:Patrizia Singaram,Gisella Crivelli,Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Technische Unterstützung Hanspeter Leu,Peter Müller
1Durchschnitt der Jahre 1990/93
2Veränderung 1990/93–2000/03
Quellen:
Milch und -produkte:SBV (1990–98),ab 1999 TSM
Fleisch:Proviande
Eier:GalloSuisse
Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:SBV,alle Mengen 2003 provisorisch
Obst:Schweizerischer Obstverband
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein:BLW,Kantone
1 0406.1010,0406.1020,406.1090
2 0406.2010,0406.2090
3 0406.3010,0406.3090
4 0406.4010,0406.4021,0406.4029,0406.4081,0406.4089
5 0406.9011,0406.9019
6 0406.9021,0406.9031,0406.9051,0406.9091
7 0406.9039,0406.9059,0406.9060,0406.9099
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–2000/03
3 Restzahlung nicht berücksichtigt,effektiver Preis 10% bis 15% höher
4 geschätzt
Quellen:
Milch:BLW
Schlachtvieh,Geflügel,Eier:SBV
Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:Agroscope FAT Tänikon
Obst:Schweizerischer Obstverband,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
(Warenkorb aus Labelfleisch und konventionell produziertem Fleisch):BLW
Tabelle 14
1 inkl.Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide,jedoch ohne Ölkuchen;ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 einschliesslich Hartweizen,Speisehafer,Speisegerste und Mais
3 Äpfel,Birnen,Kirschen,Zwetschgen und Pflaumen,Aprikosen und Pfirsiche
4 Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5 einschliesslich Fleisch von Pferden,Ziegen,Kaninchen sowie Wildbret,Fische,Krusten- und Weichtiere
6 verdauliche Energie in Joules,alkoholische Getränke eingeschlossen
7 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen,Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
Tabelle 17
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Agroscope FAT Tänikon
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion:Ackerbauzone plus Übergangszonen
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion:Bergzonen II bis IV
Tabelle 21a
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
Tabelle 21b
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*neue Betriebstypologie FAT99
Tabelle 22
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Tabelle 23
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Talregion:Ackerbauzone plus Übergangszonen
Tabelle 24
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Tabelle 25
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Bergregion:Bergzonen II bis IV
Tabelle 26
Ausgaben für Produktion und Absatz
Tabelle 28
Tabelle 30
Ausgaben Pflanzenbau
1 Im Budget 2004 neu in der Rubrik «übrige Sachausgaben» (3190.000)
2 ehemals Förderung des Rebbaus
3 Weinabsatzförderung im Ausland / In der Rechnung 2003 sind die Umstellungsbeiträge für Weinenthalten / Im Budget 2004 ist die Absatzförderung neu in der Rubrik 3601.200
4 Kreditsperre berücksichtigt
direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte betreffend Direktzahlungen beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Tabelle 32b
1 Hochstammobstbäume umgerechnet in Aren
2Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
Tabelle 33b
Extensive Produktion von Besonders tierfreundliche Haltung Getreide und Rapslandwirtschaftlicher Nutztiere
Tabelle 34a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2003
Extensiv
Tabelle 34b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2003
Tabelle 34c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2003
Tabelle 34d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2003
Tabelle 35
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2003
Nur biologische Qualität 1 Nur Vernetzung 1 Biologische Qualität Beiträge Bund und Vernetzung 1
Tabelle 36
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2003
Tabelle 37
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2003
Tabelle 38
Beteiligung am BTS-Programm 2003
Tabelle 39
Beteiligung am RAUS-Programm 2003
Tabelle 40
KantoneSchafe Kühe gemolken,Milchschafe Übrige Raufutter Betriebe und (ohne Milchschafe)und Milchziegen 1 verzehrende TiereBeiträge
für gemolkene Tiere mit einer Sömmerungsdauer von 56 bis 100 Tagen
Tabelle 41a
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2003
Tabelle 41b
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2003
Tabelle 41c
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2003
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon
3 Aufgrund der zu kleinen Stichprobe werden keine Ergebnisse dargestellt
Tabelle 42
Direktzahlungen auf Betriebsebene1 :nach Regionen 2003
n.v.:nicht verfügbar
Quelle:Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen
Tabelle44
An die Kantone ausbezahlte Beiträge 2003
KantonBodenverbesserungenLandwirtschaftliche
Tabelle45
Beiträge an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2003
Tabelle46
Tabelle47
Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2003 (ohneBaukredite)
KantonStarthilfeKauf desWohn-Ökonomie-Gemein-VerarbeitungBoden-Total Betriebesgebäudegebäudeschaftlicherund LagerungverbesdurchInventar-landw.serungen PächterkaufProdukte
Tabelle48
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2003 (Bundes-undKantonsanteile)
FallTilgungsdauer 1000 Fr.1000 Fr.Jahre
Tabelle49a
Übersicht über Beiträge
Wasserversorgungen596855669092
AndereTiefbaumassnahmen19285568430983
ÖkonomiegebäudefürRaufutterverzehrendeTiere284833141025715
andereHochbaumassnahmen248526243095
Quelle:BLW
Tabelle49b
Übersicht über Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen
Anmerkung:DieStaatsrechnung1999bildetdieBasisfürdieAufteilungderfinanziellenMittelaufdieeinzelnenAufgabengebiete Sowurdenz.B.dieAufwendungenfürdieKartoffel-undObstverwertungoderdieAusgabenfürdieGetreideverwaltung1990/92alsAusgabendesBLWeinbezogen. ZudiesemZeitpunktgabesdafürnochseparateRechnungen.DieZahlenfür1990/92sinddeshalbnichtidentischmitdenAngabeninderStaatsrechnung. DieZunahmederVerwaltungsausgabenistvorallemdaraufzurückzuführen,dassLeistungenwiez.B.fürdiePensionskasseninderStaatsrechnungnichtmehrzentralgeführt sondernaufdieeinzelnenÄmteraufgeteiltwerden.
1DieausserordentlichenAusgabenimMilchsektorsindindiesemBetrageingerechnet.DiesgingzulastenvonanderenBereichen wiez.B.StrukturverbesserungenundViehwirtschaft.
Quellen:Staatsrechnung,BLW
■■■■■■■■■■■■■■■■
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6:EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
Anmerkung:Die Zahlen in Kursivschrift sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6:EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–2000/03
Anmerkung:Die Zahlen in Kursivschrift sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
EU-5:EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6:EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
EU-4/6:An die Schweiz angrenzende EU-Länder (D,F,I und A) sowie für bestimmte Erzeugnisse mit hohen Produktionsvolumen Belgien (B) und/oder die Niederlande (NL).
D:Bundesrepublik Deutschland (inkl.ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–1998/2001
2 Der «Standardwarenkorb» setzt sich grob aus der durchschnittlichen Produktion (1998–2000) der Schweiz von 15 der 17 landwirtschaftlichen Erzeugnisse zusammen, die Gegenstand des vorliegenden Preisvergleiches sind (Tabellen 52 und 53).Da die Preisstatistik für Zuckerrüben und Raps der USA nicht verfügbar war, sind diese Produktionen nicht im «Standardwarenkorb» eingeschlossen.Dieser entspricht 3.2 Mio.t Milch,2.7 Mio.Schweinen,35.5 Mio.Poulets,647.3 Mio.Eiern, 0.52 Mio.t Weizen,0.14 Mio.t Äpfeln usw.
Anmerkung:Die Zahlen in Kursivschrift sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,Schweizerische Nationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
USAFr./Sk.0.100.160.140.1232
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A)
Anmerkung zu Land:(min) und (max) --> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster,resp.höchster Preis des betreffenden Landes
Anmerkung:Der Anteil der Labelprodukte (Bio,M-7,Coop Natura Plan) in den Geschäften ist insbesondere beim Fleisch in der Schweiz grösser als im Ausland.
Quellen:BLW,BFS,ZMP,nationale Statistikämter von F,B,A,USA,Statistikamt der Stadt Turin (I)
Oberes Mittel EUFr./Warenkorb2 1021 8851 8732 001-9 USA 2 Fr./Warenkorb1 1081 5471 4651 23828
EU-4:Nachbarländer Deutschland (D),Frankreich (F),Italien (I) und Österreich (A) Anmerkung zu Land:(min) und (max) --> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster,resp.höchster Preis des betreffenden Landes
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–1998/2001
2 Statistikfehler bei den Preisen für Rahm (32.27 Packungen à 2.5 dl),Schweinebraten (8.43 kg),Zwiebeln (4.53 kg) und Karotten (8.84 kg),denn der «Standardwarenkorb» der USA ist mit demjenigen der CH und der EU nicht identisch:Diese 4 nicht enthaltenen Produkte werden im «Standardwarenkorb» durch 8.07 kg Butter, 8.43 kg Schweinekotletten,4.53 kg Tomaten und zusätzlichen 8.84 kg Kartoffeln ersetzt.
3 Der «Standardwarenkorb» entspricht grob dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz pro Jahr (Tabelle 10) der 21 Lebensmittel,die Gegenstand dieses internationalen Preisvergleichs sind (Tabellen 54 und 55).«Grob»,da z.B.der Rinderbraten für das gesamte Rindfleischsortiment steht.Der Warenkorb entspricht 380 kg bzw.91% der 417 kg Nahrungsmittel (ohne Wein),die jährlich pro Kopf in der Schweiz konsumiert werden.Er setzt sich zusammen aus 83.03 l Milch,19.80 kg Käse, 5.77 kg Butter,32.27 Rahmpackungen à 2.5 dl,10.17 kg Rinderbraten,8.43 kg Schweinebraten,8.43 kg Schweinekoteletts,8.43 kg Schinken,9.81 kg Frischpoulet,187 Eiern, 25.25 kg Weissmehl,50.50 Weissbroten à 500 gr.,43.29 kg Kartoffeln,47.71 kg Zucker,17.09 Pflanzenöl,14.39 kg Goldenäpfeln,3.33 kg Birnen,10.15 kg Bananen, 8.84 Kilo Karotten,4.53 kg Zwiebeln und 9.89 kg Tomaten zusammen.
Quellen:BLW,BFS,ZMP,nationale Statistikämter von F,B,A,USA,Statistikamt der Stadt Turin (I)
Gesetze
–Bundesgesetz vom 29.April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz,LwG,SR 910.1)
–Bundesgesetz vom 4.Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB,SR 211.412.11)
–Bundesgesetz vom 4.Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG,SR 221.213.2)
–Bundesgesetz vom 8.Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz,LVG,SR 531)
–Bundesgesetz vom 13.Dezember 1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72)
–Zolltarifgesetz vom 9.Oktober 1986 (ZGT,SR 632.10)
–Bundesgesetz vom 20.März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz,SR 232.16)
–Bundesgesetz vom 20.Juni 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG,SR 836.1)
–Bundesgesetz vom 22.Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz,RPG,SR 700)
–Bundesgesetz vom 9.Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz,LMG,SR 817.0)
–Bundesgesetz vom 24.Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz,GSchG,SR 814.20)
–Tierschutzgesetz vom 9.März 1978 (TSchG,SR 455)
–Bundesgesetz vom 1.Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG,SR 451)
–Bundesgesetz vom 7.Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz,USG,SR 814.01)
Verordnungen
Allgemeines
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung,LBV,SR 910.91)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Erhebung und Bearbeitung von landwirtschaftlichen Daten (Landwirtschaftliche Datenverordnung,SR 919.117.71)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (SR 919.118)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den landwirtschaftlichen Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung,SR 912.1)
Produktion und Absatz
–Verordnung vom 30.Oktober 2002 über die Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen (Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen,SR 919.117.72)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Unterstützung der Absatzförderung von Landwirtschaftsprodukten (Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung,SR 916.010)
–Verordnung vom 28.Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung,SR 910.12)
–Verordnung vom 22.September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung,SR 910.18)
–Verordnung des EVD vom 22.September 1997 über die biologische Landwirtschaft (SR 910.181)
–Verordnung vom 3.November 1999 über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung;LDV,SR 916.51)
–Allgemeine Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung,AEV,SR 916.01)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Kontingentierung der Milchproduktion (Milchkontingentierungsverordnung,MKV,SR 916.350.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über Zulagen und Beihilfen im Milchbereich (Milchpreisstützungsverordnung,MSV,SR 916.350.2)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über die Höhe der Beihilfen für Milchprodukte und Vorschriften für die Einfuhr von Vollmilchpulver (SR 916.350.21)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Milchwirtschaft (Milchqualitätsverordnung,MQV,SR 916.351.0)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der industriellen Milchverarbeitung (SR 916.351.021.2)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der gewerblichen Milchverarbeitung (SR 916.351.021.3)
–Verordnung des EVD vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der Käsereifung und Käsevorverpackung (SR 916.351.021.4)
–Verordnung vom 8.März 2002 über die Ein- und Ausfuhr von Käse zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft (Verordnung über den Käsehandel mit der EG,SR 632.110.411)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten,Speiseöl und Speisefetten sowie von Kaseinen und Kaseinaten (Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung,VEMSK,SR 916.355.1)
–Verordnung des BLW vom 30.März 1999 über die Buttereinfuhr (SR 916.357.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung (Pferdeeinfuhrverordnung,PfEV,SR 916.322.1)
–Verordnung vom 26.November 2003 über den Schlachtvieh- und Fleischmarkt (Schlachtviehverordnung,SV,SR 916.341)
–Verordnung des BLW vom 23.September 1999 über die Einschätzung von Tieren der Schweinegattung sowie die Verwendung von technischen Geräten zur Qualitätseinstufung (SR 916.341.21)
–Verordnung des BLW vom 23.September 1999 über die Einschätzung und Klassifizierung von Tieren der Rindvieh-,Pferde-,Schafund Ziegengattung (SR 916.341.22)
–Geflügelverordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 (SR 916.341.61)
–Verordnung vom 26.November 2003 über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion (Höchstbestandesverordnung,HBV,SR 916.344)
–Verordnung vom 26.November 2003 über die Verwertung der inländischen Schafwolle (SR 916.361)
–Verordnung vom 26.November 2003 über den Eiermarkt (Eierverordnung,EiV,SR 916.371)
–Eierverordnung des EVD vom 18.Juni 1996 (SR 916.371.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über Flächen- und Verarbeitungsbeiträge im Ackerbau (Ackerbaubeitragsverordnung,ABBV,SR 910.17)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr von Getreide,Futtermitteln,Stroh und Waren,bei deren Verarbeitung Futtermittel anfallen (Einfuhrverordnung Getreide und Futtermittel,SR 916.112.211)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über die Zollbegünstigung für Futtermittel und Ölsaaten (SR 916.112.231)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Verwertung sowie die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln (Kartoffelverordnung,SR 916.113.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben (Zuckerverordnung,SR 916.114.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse,Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG,SR 916.121.10)
–Verordnung des BLW vom 12.Januar 2000 über die Festlegung von Perioden und Fristen sowie die Freigabe von Zollkontingentsteilmengen für die Einfuhr von frischem Gemüse,frischem Obst und von frischen Schnittblumen (VEAGOGFreigabeverordnung,SR 916.121.100)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Massnahmen zu Gunsten des Obst- und Gemüsemarktes (Obst- und Gemüseverordnung,SR 916.131.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung,SR 916.140)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über das Rebsortenverzeichnis und über die Prüfung der Rebsorten (SR 916.143.5)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über die Kontrolle von Traubenmosten,Traubensäften und Weinen für die Ausfuhr (SR 916.145.211)
–Verordnung vom 28.Mai 1997 über die Kontrolle des Handels mit Wein (SR 916.146)
Direktzahlungen
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung,DZV,SR 910.13)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS-Verordnung,SR 910.132.4)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren im Freien (RAUS-Verordnung,SR 910.132.5)
–Verordnung vom 29.März 2000 über Sömmerungsbeiträge (Sömmerungsbeitragsverordnung,SöBV,SR 910.133)
–Verordnung vom 4.April 2001 über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung,ÖQV,SR 910.14)
Grundlagenverbesserung
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (Strukturverbesserungsverordnung, SVV,SR 913.1)
–Verordnung des BLW vom 26.November 2003 über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (IBLV,SR 913.211)
–Verordnung vom 26.November 2003 über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV,SR 914.11)
–Verordnung vom 8.November 1995 über die landwirtschaftliche Forschung (VLF,SR 426.10)
–Verordnung vom 26.November 2003 über die landwirtschaftliche und die bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung (Landwirtschaftsberatungsverordnung,SR 915.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Tierzucht (SR 916.310)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Produktion und das Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Saatgut-Verordnung,SR 916.151)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über Saat- und Pflanzgut von Acker- und Futterpflanzenarten (Saat- und Pflanzgut-Verordnung des EVD,SR 916.151.1)
–Verordnung des EVD vom 11.Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von anerkanntem Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Obst,Beerenobst und Reben (SR 916.151.2)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über den Sortenkatalog für Getreide,Kartoffeln,Futterpflanzen,Öl- und Faserpflanzen sowie Betarüben (Sortenkatalog-Verordnung,SR 916.151.6)
–Verordnung vom 23.Juni 1999 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-Verordnung,SR 916.161)
–Verordnung vom 10.Januar 2001 über das Inverkehrbringen von Düngern (Dünger-Verordnung,DüV,SR 916.171)
–Verordnung vom 28.Februar 2001 über Pflanzenschutz (Pflanzenschutzverordnung,PSV,SR 916.20)
–Verordnung vom 26.Mai 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung,SR 916.307)
–Verordnung des EVD vom 10.Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln,Zusatzstoffen für die Tierernährung,Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung,FMBV,SR 916.307.1)
–Verordnung des BLW vom 16.Juni 1999 über die GVO-Futtermittelliste (SR 916.307.11)
Es bestehen folgende Möglichkeiten,die Gesetzestexte einzusehen oder zu beschaffen:
–Zugriff via Internethttp://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
–Bestellen beim BBL,Vertrieb Publikationen
– via Internethttp://www.bundespublikationen.ch/
– via Fax031 325 50 58
Abiotische Eigenschaften: Chemische oder physikalische Eigenschaften eines Raumes,wie klimatische Faktoren (Licht,Temperatur, usw.),Bodeneigenschaften,hydrologische Verhältnisse,Relief.
Biotische Eigenschaften: Eigenschaften eines Raumes,der durch die darin vorkommenden Pflanzen und Tiere hervorgehen.
Evaluation: Synonym auch für Erfolgskontrolle.Evaluation ist eine Methode zur Ermittlung und Beurteilung der Effektivität (Mass der Zielerreichung),Wirksamkeit (Ursache-Wirkungs-Beziehung) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) von Massnahmen oder Instrumenten.Im Voraus definierte Ziele sind Voraussetzung für eine Evaluation.Evaluationen dienen v.a.für Vergleiche:Kontrollgruppenvergleich, vorher/nachher-Vergleich,Querschnittsvergleich.
Externe Effekte: Externe Effekte oder Externalitäten sind positive oder negative Nebeneffekte auf Dritte oder die Gesellschaft,die durch Konsum- oder Produktionsvorgänge einzelner Akteure entstehen.Sie werden nicht unmittelbar über den Markt bzw.den Marktpreis erfasst und führen deshalb zu Marktverzerrungen und Fehlallokation von Gütern und Produktionsfaktoren.Ziel einer rationalen Wirtschaftspolitik ist es,die externen Effekte zu internalisieren.
Beispiele von Externen Effekten:
ProduktionKonsum
Negativ externe Effekte (soziale Kosten) Negative Beeinträchtigung von Übermässiger Konsum von Alkohol und Tabak Trink-,Grund- und Oberflächenwasser bringt hohe Kosten im Gesundheitswesen durch unsachgemässe Düngung
Positiv externe Effekte (soziale Nutzen) Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft Breitensport als Freizeitbeschäftigung durch die landwirtschaftliche Produktionsenkt die Kosten des Gesundheitswesens
Landwirtschaftlicher Umweltindikator: Repräsentative Erhebung,die Daten über eine Ursache,einen Zustand,eine Umweltveränderung oder ein Umweltrisiko vereint,welche aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten hervorgehen und für die Entscheidungsträger von Bedeutung sind (z.B.Erosionsgrad der Böden;Definition der OECD).
Marktspanne: Differenz zwischen Konsumenten- und Produzentenpreis (absoluter Wert) bzw.Anteil am Konsumentenfranken,der den Marktstufen Verarbeitung und Handel zukommt (relativer Wert).Der Begriff Marge wird als Synonym verwendet.
Median: Zentralwert (statistische Grösse):Wert,der bei der Abzählung einer Reihe von der Grösse nach geordneten Merkmalswerten (z.B.Messreihe) in der Mitte liegt.
Milchäquivalent: Ein Milchäquivalent entspricht dem durchschnittlichen Fett- und Proteingehalt eines kg Rohmilch (73 g) und dient als Massstab zur Berechnung der in einem Milchprodukt verarbeiteten Milchmenge.
Mittel(wert): Durchschnitt (statistische Grösse):Summe der Zahlen einer Reihe dividiert durch die Anzahl der Zahlen.
Monitoring: Laufendes Beobachten anhand von Indikatoren über einen Zeitraum ohne problemorientiertes Erkennen der kausalen Zusammenhänge.Resultat eines Monitorings sind Entwicklungen aufzuzeigen.Beispiele:Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche,Vogelpopulationen usw.
Multifunktionalität der Landwirtschaft: Das Konzept einer multifunktionalen Landwirtschaft umschreibt die vielfältigen Funktionen, die die Landwirtschaft erfüllt.Es umfasst die Leistungen,die über die eigentliche Agrarproduktion hinausgehen.Hierzu zählen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln,die Pflege der Kulturlandschaft,die Erhaltung der natürlichen Produktionsgrundlagen und Artenvielfalt,sowie der Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes.Eine multifunktionale Landwirtschaft trägt wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.Die multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft sind in der Bundesverfassung (Art.104) festgehalten.
Öffentliche Güter: Öffentliche Güter zeichnen sich durch zwei Merkmale aus:Nichtrivalität und fehlendes Ausschlussprinzip. Nichtrivalität im Konsum heisst,dass aufgrund des Konsums andere Konsumenten und Konsumentinnen nicht beeinträchtigt werden. Fehlendes Ausschlussprinzip heisst,dass es bei öffentlichen Gütern nicht möglich ist,einzelne NutzerInnen vom Konsum auszuschliessen. Öffentliche Güter sind zum Beispiel die Landesverteidigung,die Freizeiterholung im Wald,der Genuss einer naturnahen Landschaft. Für öffentliche Güter existiert kein Markt und damit auch kein Marktpreis.Aus diesem Grund müssen öffentliche Güter durch den Staat selbst oder in dessen Auftrag von Dritten bereitgestellt werden.
Quartil: Viertel (statistische Grösse):Aufteilung einer der Grösse nach geordneten Reihe in vier Teile.
Schoggigesetz: Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72):Umsetzung des Protokolls 2 des Freihandelsabkommens Schweiz – EG von 1972.Ausgleich der Rohstoffpreisdifferenz zwischen Inland- und Weltmarktpreis für landwirtschaftliche Grundstoffe (Ausfuhr:Ausfuhrbeiträge / Einfuhr:bewegliche Teilbeträge).
Streuung: Varianz (statistische Grösse):Verteilung der Beobachtungen oder Messwerte um einen Mittelwert.
Veredlungsverkehr: Veredlungsverkehr bedeutet,dass für Waren,die zur Bearbeitung,Verarbeitung oder Reparatur vorübergehend eingeführt werden,unter bestimmten Voraussetzungen Zollermässigung oder -befreiung gewährt wird.Bei Landwirtschaftsprodukten und landwirtschaftlichen Grundstoffen wird der Veredlungsverkehr gewährt,wenn gleichartige inländische Erzeugnisse nicht in genügender Menge verfügbar sind oder für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachteil für die schweizerische Nahrungsmittelindustrie nicht durch andere geeignete Massnahmen ausgeglichen werden kann.
Zielpreis: Vom Bundesrat festgelegte Orientierungsgrösse je kg vermarktete Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein.Der Zielpreis soll für Milch erreicht werden können,die zu Produkten mit hoher Wertschöpfung verarbeitet und gut vermarktet wird.Die Höhe des Zielpreises hängt insbesondere von der Einschätzung der Marktlage und den verfügbaren Mitteln zur Marktstützung ab.Die Zulage für die Fütterung ohne Silage wird dabei nicht berücksichtigt.
Weitere Begriffe sind zu finden in: –«Betriebswirtschaftliche Begriffe in der Landwirtschaft» (Bezug bei:Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale,Länggasse 79,3052 Zollikofen). –Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (SR 910.91).
Das BLW erhebt die Produzentenpreise monatlich und orientiert über die Ergebnisse in der Publikation «Milchbericht».Unterschieden werden dabei folgende vier Preise:gesamte Milch,Industriemilch,verkäste Milch und Biomilch.Die Milchpreise werden nicht nur gesamtschweizerisch erhoben,sondern auch aufgeteilt in fünf Regionen: Region I: Genf,Waadt,Freiburg,Neuenburg,Jura und Teile des französischsprachigen Gebiets des Kantons Bern (Bezirke La Neuveville,Courtelary und Moutier). Region II: Bern (ausser Bezirke der Region I), Luzern,Unterwalden (Obwalden,Nidwalden),Uri,Zug und ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Schwyz und Küssnacht). Region III: Baselland und Basel-Stadt,Aargau und Solothurn. Region IV: Zürich,Schaffhausen,Thurgau,Appenzell (Innerrhoden und Ausserrhoden), St.Gallen,ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Einsiedeln,March und Höfe),Glarus,Graubünden. Region V: Wallis und Tessin.
Quelle: BLW
An der Milchpreiserhebung,die gemäss Übergangsverordnung Milch bei den Milchverwertern durchzuführen ist,nehmen alle wichtigen industriellen Milchverarbeiter sowie eine repräsentative Auswahl an Käsereien teil.Auf diese Weise können über 60% der produzierten Milch erfasst werden.Als ausbezahlter Milchpreis gilt gemäss Übergangsverordnung der Preis für Milch am Erfassungsort (ab Hof oder Sammelstelle),einschliesslich ortsüblicher Zulagen und Abzüge.Die Zulage für die Fütterung ohne Silage,freiwillige Verbandsbeiträge sowie Abzüge für Molke sind im erhobenen Milchpreis nicht enthalten.
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung bei Milch und Milchprodukten beinhaltet in einem ersten Schritt eine theoretische Wertschöpfungsberechnung in den Segmenten Konsummilch,Käse,Butter,Konsumrahm und Joghurt.Dabei wird die Wertschöpfung für die einzelnen Produkte je kg eingesetzte Rohmilch berechnet.So können die Werte untereinander verglichen werden.Die Wertschöpfung Milch und Milchprodukte stellt also die Differenz zwischen dem erzielten Grundpreis pro kg Rohmilch des Produzenten einerseits und dem Verkaufspreis je kg eingesetzte Rohmilch des des verarbeiteten Endprodukts dar.
Die so berechnete Wertschöpfung wird in einem zweiten Schritt korrigiert um die jeweiligen produktspezifischen Eigenschaften.So fliessen z.B.Beihilfen des Bundes,produktgebundene Ab- bzw.Zuschläge und der Wert der anfallenden Nebenprodukte in die Berechnung der Einzelmargen ein.Die Bruttomarge bei Milch und Milchprodukten ist das Resultat aus der Wertschöpfung und den produktspezifischen Eigenschaften.Bei der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte handelt es sich um einen Zusammenzug aller Bruttomargen der Produktgruppen Konsummilch,Käse,Butter,Konsumrahm und Joghurt.Diese setzen sich ihrerseits aus den Kalkulationen der beobachteten Indikatorprodukten zusammen.
Basis für die Berechnung der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte,sowie der Einzelmargen Konsummilch,Käse,Butter,Rahm und Joghurt bildet die in der Schweiz verwertete jährliche Rohmilchmenge.Entsprechend ihrem Anteil an der Rohmilchmenge wird jede Verwertungsart gewichtet.
Die Margenberechnung beschränkt sich auf die Wertschöpfung der in der Schweiz produzierten und konsumierten Milchprodukte.Die verarbeitete Milchmenge muss daher um den exportierten Anteil korrigiert werden.
Für die Erhebung der Konsumentenpreise wird zwischen den drei Verkaufskanälen Grossverteiler,Discounter und Fachhandel unterschieden.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des Institutes für Marktanalysen,Hergiswil (IHA GfM),nach Marktanteilen gewichtet.
8%Beihilfen, Abgaben Wert der Nebenprodukte,
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung auf Frischfleisch für den Konsum im Ladenverkauf ist ein Realwert (zum Preis von Januar 1999) ohne MwSt.(oMwSt.).Sie wird in Fr.pro kg Schlachtgewicht (SG) ausgedrückt.Die Bruttomarge stellt die Differenz zwischen dem Rohertrag und dem Total der variablen Kosten dar.Dieser Wert besteht auch aus der Differenz zwischen den Nettoeinnahmen und dem Einstandspreis.
Der Rohertrag entspricht dem Umsatz des Verarbeitungs- und Verteilungssektors bzw.den Ausgaben der Konsumentinnen und Konsumenten (Privathaushalte und Grosshandel).Darin eingeschlossen sind der Verkauf von Frischfleisch für den Konsum sowie die Verwertung von Wurstfleisch,Haut und Schlachtnebenprodukten auf Grosshandelsstufe.
Die gesamten variablen Kosten umfassen einerseits den bereinigten Einstandspreis des Viehs.Es handelt sich hierbei um einen gewichteten Durchschnittspreis (konventionell,Label),franko Schlachthof.Eine eventuelle Handelsspanne oder Transportkosten sind also in diesem Preis eingeschlossen,von dem jedoch sämtliche Vorteile aus den Einfuhren innerhalb des Zollkontingents abgezogen wurden. Andererseits sind in den variablen Kosten die Auslagen für die Entsorgung von Schlachtabfällen,Kopf und Füssen;die Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und der Beitrag zum Basismarketing der Proviande enthalten.
8.46 Fr./kg SG
variable
Anmerkung: Die Verhältnisse in dieser Abbildung sind nicht realitätsgetreu. Die angegebenen Preise stellen ein Beispiel für die Berechnung der Bruttomarge auf frischem Rindfleisch im Jahr 2000 dar. Rechnungseinheit sind Fr. pro kg Schlachtgewicht warm (SG) zu Festpreisen (Realwert 01.1999) ohne MwSt. Quelle: BLW
Die detaillierte Definition der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung findet sich in den Sonderausgaben des «Marktberichtes Fleisch» von Januar 2001 und April 2002 (Nummer 140 und 155),der von der Sektion Marktbeobachtung des BLW herausgegeben wird.Diese Nummern sind auf Anfrage erhältlich.
Früchte und Gemüse
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse ist die Differenz zwischen dem Einstandspreis der ersten Handelsstufe eines Produktes,ausgenommen Gebinde- und Verpackungskosten,und dem Endverkaufspreis (inkl.allfällige Gebinde- und Verpackungskosten).Sowohl die Daten des Inlandmarktes als auch diejenigen des Importmarktes fliessen in die Margenberechnungen ein.Beim Import sind die Zollabgaben enthalten.Berücksichtigt werden dabei je sieben bedeutende,umsatzstarke Früchte und Gemüse.Bei den Früchten sind dies Äpfel (Werte von Golden Delicious und den wichtigsten Lagersorten,sowie Granny Smith Import,mengengewichtet), Birnen (Werte Inlandbirnen und importierten Birnen ohne Abate- und Nashibirnen,mengengewichtet),Erdbeeren,Nektarinen,Kirschen, Aprikosen und Orangen.Beim Gemüse sind es Tomaten (Fleischtomaten,runde Tomaten,beide mit mengengewichtetem Anteil), Blumenkohl,gelbe Zwiebeln,Karotten,Brüsseler Witloof,Gurken und Kartoffeln.Die Mengengewichtungen stützen sich auf Zahlen des IHA · GfM,der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG),des Schweizerischen Obstverbandes (SOV),des Bundesamtes für Statistik (BFS) und der Oberzolldirektion (OZD).
Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse
Bruttomarge Gemüse
Der Einstandspreis der einzelnen Produkte setzt sich bei Inlandware aus dem Preis franko Verlader (bei Lagerware werden die Lagerkosten mitberücksichtigt) und bei Importware dem Importwert franko Grenze verzollt,beide mengengewichtet,zusammen.Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA · GfM nach Marktanteilen gewichtet.Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Gemüse zusammengefasst.
Bruttomarge Früchte
Hier ist das periodische Hinzustossen und Wegfallen von nur kurz auftretenden saisonalen Früchten eine Besonderheit bei der Gesamtmarge.Trotzdem kann diese Gesamtbetrachtung gerade im Mehrjahresvergleich wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Der Einstandspreis setzt sich bei Inlandware aus dem Produzentenpreis franko Sammelstelle und bei der Importware dem Importwert franko Grenze verzollt,beide mengengewichtet,zusammen.Lager- und Zinskosten sind berücksichtigt.Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA GfM nach Marktanteilen gewichtet.Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Früchte zusammengefasst.
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung wird durch das BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV nach dem europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (Eurostat) berechnet.Die neu zur Anwendung gelangende Methode basiert auf der LGR97Nomenklatur von Eurostat (vorher LGR89).Mit der Revision sind die Ergebnisse wieder direkt mit jenen der EU vergleichbar.
Im folgenden werden die methodischen Anpassungen dargestellt.Anhand eines Beispiels wird aufgezeigt,wie sich diese quantitativ auswirken.Bei der Revision handelt sich um eine umfassende Weiterentwicklung.Deshalb können die Ergebnisse nicht mit den Ergebnissen der Vorjahre verglichen werden,wie sie in den Agrarberichten 2000–2002 publiziert worden sind.
Zwei Gruppen von Anpassungen können unterschieden werden.Erstens die methodischen Änderungen im engeren Sinn und zweitens eine Reihe von Anpassungen,die sich auf die erfasste Grundgesamtheit und die berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen beziehen.
Methodische Änderungen im engeren Sinn
Abkehr vom Bundeshofkonzept
Im alten System wurde die Landwirtschaft als «Black Box» betrachtet.In der LGR berücksichtigt wurden somit lediglich die Waren- und Dienstleistungsflüsse zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft.Neu werden auch die innerlandwirtschaftlichen und die innerbetrieblichen Flüsse erfasst,letztere aber nur dann,wenn diese zwei verschiedene Produktionszweige betreffen (z.B.Futtermittelproduktion als Input für die Milch- oder Fleischproduktion).
Neudefinition der Preise
Der «Herstellungspreis» ersetzt den alten «Ab-Hof-Preis».Der Unterschied liegt darin,dass neu auch die Subventionen berücksichtigt werden,welche den Produkten direkt zugeordnet werden können (z.B.Siloverbotsentschädigung,Exportbeiträge für Tiere,Unterstützung der Kartoffelverwertung).Auch die Preise der Beschaffungsgüter («Anschaffungspreise») werden entsprechend korrigiert (z.B.Berücksichtigung der Treibstoffzollrückerstattungen bei Treibstoffen).
LGR89, alte MethodeLGR97, neue Methode
Produzentenpreis
Ab-Hof-Preis
+ Gütersteuer
Produzentenpreis+ Gütersubvention
Herstellungspreis – Gütersteuer
Anpflanzungen
Neupflanzungen sowie deren Zuwachs an Wert bis zu ihrer Reife werden bei der Produktion wie auch bei den Bruttoanlageinvestitionen erfasst.Nach Erreichen der Reife werden auf dem Wert auch Abschreibungen verbucht.Nach alter Methode wurden lediglich die gesamthaften Bestandesveränderungen erfasst (d.h der Zuwachs oder die Abnahme des Gesamtbestands,ohne Berücksichtigung der Ersatzpflanzungen).
LGR89, alte MethodeLGR97, neue Methode
Rebfläche 2001
Rebfläche 2002
BAI: Bruttoanlageinvestitionen
NAI: Nettoanlageinvestitionen
Produktion = BAI
Rebfläche 2001
Rebfläche 2002
Produktion = BAI
Anpassungen der erfassten Grundgesamtheit und der berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen
Neu werden folgende Bereiche in die LGR einbezogen:
Ziergartenbau (Pflanzen und Blumen,Baumschulerzeugnisse).
– Dienstleistungen,angeboten von spezialisierten Betrieben (Bsp.Lohnarbeiten,künstliche Besamung) oder Landwirten (Bsp.Lohnarbeiten).
– Nichtlandwirtschaftliche (aber mit der landwirtschaftlichen Aktivität direkt verbundene) Nebentätigkeiten (nichtlandwirtschaftliche nicht trennbare Tätigkeiten).Dazu gehören einerseits die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Rohstoffen,andererseits aber auch der Einsatz landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren zu weiteren Zwecken (Bsp.Schneeräumungen,Tierpensionen).
– Wein:Die Bewertung der Trauben erfolgt neu nach Verwertungszweck (Tafelwein,Qualitätswein,Tafeltrauben,Most) (LGR89: Bewertung der gesamten Traubenernte zu Preisen für Traubenmost).
Aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen werden Kleinproduzenten unter bestimmten Schwellenwerten.Betroffen sind vor allem ein Teil der Weinproduzenten,die Bienen- und Kaninchenzucht.
–Kleinstproduzenten
Landwirtschaftliche Produktion der von der LGR89 abgedeckten Betriebe
+ Ziergartenbau
+ Landwirtschaftliche Dienstleistungen der spezialisierten Betriebe
+ Bewertung des Weins aus eigener Produktion
+ Landwirtschaft. Dienstleistungen (Nebentätigkeit)
+ Nicht landwirtschaftliche, nicht trennbare Tätigkeiten
In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse der alten (LGR89) und der neuen (LGR97) Methode der LGR für den Durchschnitt der Jahre 1999/2001 verglichen.Auf jeder Stufe der LGR werden die Unterschiede den drei Gründen «methodische Anpassungen im engeren Sinn» «Einfluss Gartenbau» und «andere Einflüsse» zugeordnet.Gesamthaft betrachtet führen die Anpassungen dazu,dass auf allen Stufen der LGR die Werte zunehmen.
Auf der Stufe Gesamtproduktionswert und Vorleistungen kommt die Abkehr vom Bundeshofkonzept stark zum Ausdruck (Einbezug gewisser innerbetrieblichen und der zwischenbetrieblichen Flüsse).Der Einbezug des Gartenbaus und der Dienstleistungen wirkt sich ebenfalls auf beiden Stufen aus.Die Berücksichtigung des Gartenbaus wirkt sich zusätzlich besonders stark beim Arbeitnehmerentgelt aus.Die nicht landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten finden Eingang beim Gesamtproduktionswert und beeinflussen auch die Höhe des gesamthaften Arbeitnehmerentgelts,naturgemäss aber kaum die Vorleistungen.
Relativ stark wirkt sich auch der Übergang zu den neuen Herstellungspreisen aus.Die Berücksichtigung der produktgebundenen Subventionen bei den Preisen bedeutet auch,dass diese bei der Rubrik «sonstige Subventionen» nicht mehr aufgeführt werden.
Die Summe aller Anpassungen führt dazu,dass das Unternehmenseinkommen um rund 30% steigt.
Darstellung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs
Zusammensetzung des Gesamtproduktionswertes
Innerbetrieblicher Verbrauch
Verarbeitung durch die Produzenten
Eigenkonsum durch landwirtschaftliche Haushalte
Verkäufe an andere landwirtschaftliche Einheiten
Verkäufe ausserhalb der Landwirtschaft, im Inland und ins Ausland
Gütersubventionen
Selbsterstellte Anlagen
Vorratsveränderung
Sonstige Subventionen
Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen
Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen
Faktoreinkommen
Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen
Nettounternehmenseinkommen 1
Pachten und Schuldzinsen
Arbeitnehmerentgelt Sonstige Produktionsabgaben
1 Wird in der Literatur und Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet.
AbschreibungenVorleistungen
Zentrale Auswertung der Agroscope FAT Tänikon
Neue Auswertungsmethodik
Mit den Buchhaltungsabschlüssen des Jahres 1999 erfuhr die Zentrale Auswertung grundlegende methodische Änderungen.In der Vergangenheit wurden für die Ermittlung der Einkommen restriktiv abgegrenzte «Testbetriebe» verwendet (z.B.Beschränkung des Nebenverdienstes,Forderung einer Fachschulbildung).Auf Grund der bewussten positiven Selektion der Testbetriebe konnten konsequenterweise auch nur Aussagen über diese Betriebe selbst gemacht werden.Im neuen System erlauben die sogenannten «Referenzbetriebe» repräsentative Aussagen über die gesamte Landwirtschaft.
Überblick über die methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung
– Als Grundgesamtheit werden diejenigen schweizerischen Betriebe bezeichnet,die grundsätzlich als Referenzbetriebe für die Zentrale Auswertung in Frage kommen.Dazu müssen sie minimale physische Schwellen erreichen.Sobald ein Betrieb z.B.mindestens 10 ha Land bewirtschaftet oder mindestens 6 Kühe hält,gehört er zur Grundgesamtheit.Die Grundgesamtheit umfasst rund 57‘000 Betriebe,was rund 90% der bewirtschafteten Fläche und rund 90% der Produktion entspricht.
– Aus der Grundgesamtheit werden ca.3‘500 Referenzbetriebe ausgewählt.
Da die Strukturen der Referenzbetriebe der Zentralen Auswertung von den Strukturen in der Gesamtlandwirtschaft abweichen, werden die Buchhaltungsergebnisse gewichtet.Dazu wird aus der Betriebsstrukturerhebung die Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrössen,Betriebstypen und Zonen herangezogen.Mit diesem Vorgehen ist gewährleistet,dass z.B.Buchhaltungsergebnisse von kleineren Betrieben,die in der Auswahl der Referenzbetriebe untervertreten sind,in der Auswertung das entsprechende Gewicht erhalten.
– Eine neue Betriebstypologie erlaubt eine bessere Unterscheidung der agrarpolitisch bedeutenden Betriebstypen.Rund zwei Drittel der Betriebe entfallen auf sieben spezialisierte Betriebstypen,die eine Konzentration auf bestimmte Betriebszweige des Pflanzenbaus oder in der Tierhaltung aufweisen.Das restliche Drittel teilt sich auf in vier Typen kombinierter Betriebe (vgl.weiter unten).
Die weiter gefasste Grundgesamtheit und die Gewichtung verbessert die Aussagekraft der Ergebnisse der Zentralen Auswertung für die gesamte Landwirtschaft erheblich.Auch die internationale Vergleichbarkeit der Buchhaltungsdaten wird erleichtert.Die methodischen Änderungen sind insgesamt derart bedeutend,dass eine Vergleichbarkeit mit älteren Berichten der Zentralen Auswertung nicht mehr gegeben ist.Um dennoch Mehrjahresvergleiche anstellen zu können,wurden die Buchhaltungsergebnisse der Vorjahre ebenfalls mit der neuen Methodik berechnet.
Die neue Betriebstypologie FAT99
Im Rahmen der methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung der Agroscope FAT Tänikon wurde die alte Betriebstypologie nach Grüner Kommission (1966) durch eine neue Typologie (FAT99) ersetzt.Neben der Verwendung in der Ergebnisdarstellung wird die Betriebstypologie für den Auswahlplan der Betriebe der Zentralen Auswertung und für die Gewichtung der einzelbetrieblichen Ergebnisse eingesetzt.
Die Einteilung der Betriebe nach der neuen Typologie erfolgt ausschliesslich auf der Basis von physischen Kriterien,nämlich Flächen und GVE verschiedener Tierkategorien.Mit insgesamt zehn Kennzahlen bzw.acht Quotienten je Betrieb ist eine differenzierte und eindeutige Einteilung möglich.
BereichBetriebstypGVE/OAF/SKul/RiGVE/VMiK/MAK/PSZ/SG/Andere LNLNLNGVERiGVERiGVEGVEGVEBedingungen
11PflanzenbauAckerbaumax. übermax.
170%10%
12Spezialkulturenmax. über 110%
21TierhaltungVerkehrsmilchmax.max. über über max. 25%10%75%25%25%
22Mutterkühemax.max. über max. über 25%10%75%25%25%
23Anderes Rindviehmax.max. übernicht 21 25%10%75%oder 22 31Pferde/Schafe/max.max. über Ziegen25%10%50%
41Veredlungmax.max. über 25%10%50%
51KombiniertVerkehrsmilch/ über über übermax.nicht Ackerbau40%75%25%25%11– 41
52Mutterkühe übermax. übernicht 75%25%25%11– 41
53Veredlung übernicht 25%11– 41
54Andere nicht 11– 53
Die Kriterien in einer Zeile müssen alle gleichzeitig erfüllt sein.
Abkürzungen:
GVEGrossvieheinheit
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche in ha
GVE/LNViehbesatz je ha LN
OAF/LNAnteil offene Ackerfläche an LN
SKul/LNAnteil Spezialkulturen an LN
RiGVE/GVEAnteil Rindvieh-GVE am Gesamtviehbestand
VMiK/RiGVEAnteil Verkehrsmilchkühe am Rindviehbestand
MAK/RiGVEAnteil Mutter-/Ammenkühe am Rindviehbestand
PSZ/GVEAnteil Pferde-,Schaf- und Ziegen-GVE am Gesamtviehbestand
SG/GVEAnteil Schweine- und Geflügel-GVE am Gesamtviehbestand
Quelle:Agroscope FAT Tänikon
Es werden sieben spezialisierte und vier kombinierte Betriebstypen unterschieden.Die spezialisierten Pflanzenbaubetriebe (11 und 12) verfügen über einen Viehbesatz von weniger als einer GVE je ha LN.Bei den Ackerbaubetrieben überschreitet der Anteil offener Ackerfläche 70% der LN,für die Spezialkulturbetriebe liegt der Anteil entsprechender Kulturen über 10%.Die spezialisierten Tierhalter (21 bis 41) haben als gemeinsame Beschränkung maximal 25% offene Ackerfläche und maximal 10% Spezialkulturfläche.Die Verkehrsmilchbetriebe weisen über 25% des Rindviehbestandes als Milchkühe mit vermarkteter Milch (Verkehrsmilch) aus,analog werden die Mutterkuhbetriebe abgegrenzt.In der verbleibenden Gruppe «Anderes Rindvieh» befinden sich vor allem Betriebe mit Milchkühen ohne Kontingent (spezialisierte Kälbermäster oder Aufzuchtbetriebe im Berggebiet).In den Veredlungsbetrieben machen Schweine- und Geflügel-GVE mehr als die Hälfte des Viehbestandes aus.Betriebe,die sich keinem der sieben spezialisierten Betriebstypen zuteilen lassen, gelten als kombinierte Betriebe (51 bis 54).
Aspekte der Darstellung
Artikel 7 der Nachhaltigkeits-Verordnung legt fest,dass die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft auch regionenweise zu beurteilen ist. Dementsprechend werden auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung drei Regionen definiert:
Talregion:Ackerbauzone, Übergangszonen
– Hügelregion:Hügelzone,Bergzone I
– Bergregion:Bergzonen II bis IV
Abgrenzung Tal-, Hügel- und Bergregion (Zuteilung der Gemeinden nach grösstem Zonenanteil)
Talregion Hügelregion Bergregion
Gemeindegrenzen: © BFS GEOSTAT
Quelle: AGIS-Daten 1998
Um eine differenzierte Beurteilung der Streuung von bestimmten Kennzahlen zu erreichen,werden die Betriebe in Quartile eingeteilt. Einteilungskriterium ist der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft (FJAE).In jedem Quartil (0–25% / 25–50% / 50–75% / 75–100%) befinden sich je ein Viertel der Betriebe aus der Grundgesamtheit.
Die Darstellung nach Quartilen erlaubt eine ökonomisch differenzierte Beurteilung.Auf eine ökologische Differenzierung wird verzichtet, weil der Anteil der Referenzbetriebe ohne ÖLN weniger als 3% ausmacht und die Differenz der Arbeitsverdienste minimal ist.
Gemäss Artikel 5 LwG ist die wirtschaftliche Lage «im Durchschnitt mehrerer Jahre» zu beurteilen.Bei Entwicklungen werden deshalb mehrere Jahre dargestellt.Die statischen Betrachtungen stellen auf das aktuellste verfügbare Drei-Jahresmittel (1998/2000) ab.
Für die Gegenüberstellung der Arbeitseinkommen wird auf der Seite der Landwirtschaft der Arbeitsverdienst und auf der Seite der übrigen Bevölkerung ein Jahres-Bruttolohn ermittelt.Die Lohnsituation der übrigen Bevölkerung wird durch die vom BFS alle zwei Jahre durchgeführte Lohnstrukturerhebung erfasst.In den dazwischen liegenden Jahren werden die Werte mit Hilfe der Entwicklung des Lohnindexes aktualisiert.Die Lohnstrukturerhebung gibt einen repräsentativen Überblick über die Lohnsituation der Beschäftigten in der Industrie (Sekundärsektor) und im Dienstleistungsbereich (Tertiärsektor).
Erfasste Lohnkomponenten (gemäss Lohnstrukturerhebung BFS)
Bruttolohn im Monat Oktober (inkl.Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherung,Naturalleistungen,regelmässig ausbezahlte Prämien-,Umsatz- oder Provisionsanteile),Entschädigungen für Schicht-,Nacht- und Sonntagsarbeit, 1⁄12 vom 13.Monatslohn und 1⁄12 von den jährlichen Sonderzahlungen.
Standardisierung: Umrechnung der erhobenen Beiträge (inkl.Sozialabgaben) auf eine einheitliche Arbeitszeit von 4 1⁄3 Wochen à 40 Stunden.
Die Werte der Lohnstrukturerhebung werden auf Jahres-Bruttolöhne umgerechnet.Anschliessend wird für jede Region der Median über alle im 2.und 3.Sektor Beschäftigten gebildet.
Auf Seite der Landwirtschaft wird als Pendent zu den Jahres-Bruttolöhnen der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst pro FJAE berechnet. Die Basis für eine FJAE sind 280 Arbeitstage,wobei eine Person maximal 1,0 FJAE entspricht.
Berechnung des landwirtschaftlichen Arbeitsverdienstes
Landwirtschaftliches Einkommen
Zins für das im Betrieb investierte Eigenkapital (mittlerer Zinssatz für Bundesobligationen)
=Arbeitsverdienst der Betriebsleiterfamilie
:Anzahl Familienarbeitskräfte (FJAE) (Basis:280 Arbeitstage)
=Arbeitsverdienst pro FJAE
Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen (Stand August 2004)
Allgemeine Anforderungen
Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,welche einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben.Keine Direktzahlungen gibt es für Betriebe des Bundes,der Kantone und der Gemeinden sowie für Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,deren Tierbestände die Grenzen der Höchstbestandesverordnung überschreiten.Ebenfalls ausgeschlossen sind juristische Personen,sofern es sich nicht um Familienbetriebe handelt (Artikel 2 Direktzahlungsverordnung).
Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen,welche Direktzahlungen beantragen,müssen der kantonalen Behörde den Nachweis erbringen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ÖLN oder nach vom Bundesrat anerkannten Regeln bewirtschaften (vgl.hierzu Ausführungen weiter hinten).
Weitere Bedingungen
Die Beitragsberechtigung ist an weitere strukturelle und soziale Kriterien geknüpft.Die Übersicht fasst die Bedingungen für die Ausrichtung der Direktzahlungen stichwortartig zusammen.
Mindestgrösse des Betriebes
Minimaler Arbeitsbedarf
Betriebseigene Arbeitskräfte
1 ha
Spezialkulturen:50 Aren
Reben in Steil- und Terrassenlagen:30 Aren
0,3 Standard-Arbeitskräfte (SAK)
Mindestens 50% der für die Bewirtschaftung erforderlichen Arbeiten mit betriebseigenen Arbeitskräften (Familie und Angestellte) ausführen
Alter des Bewirtschafters bis 65 Jahre
Beitragsbegrenzungen
AbstufungFläche in haTiere in GVEAnsatz in % bis3045100
30–6045–9075
60–9090–13550
über901350
maximaler Betrag pro SAK
55 000 Fr.
– massgebliches Einkommen (steuerbares Einkommen vermindert um Summe der Direktzahlungen wird ab 80 000 Fr.massgebliches Einkommen 30 000 Fr.für verheiratete Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter)reduziert.
– massgebliches Vermögen (steuerbares Vermögen,vermindert umSumme der Direktzahlungen wird ab 800 000 Fr.massgebliches Vermögen 200 000 Fr.pro SAK und um 200 000 Fr.für verheiratetereduziert; übersteigt das massgebliche Vermögen 1 Mio.Fr.werden keine Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter) Direktzahlungen ausbezahlt.
Quelle:Direktzahlungsverordnung
Die Berechnung der SAK wird mit Umrechnungsfaktoren für die LN und die Nutztiere vorgenommen.Für gewisse Nutzungen wie z.B.den arbeitsaufwendigeren biologischen Landbau,gibt es Zuschläge.Die Faktoren sind abgeleitet aus der standardmässigen Erfassung arbeitswirtschaftlicher Abläufe.Sie sind für den Vollzug der Direktzahlungen und der Massnahmen zur Strukturverbesserung vereinfacht worden. Für die Berechnung des effektiven Arbeitsbedarfs sind sie nicht geeignet,weil dieser von den speziellen Eigenschaften des einzelnen Betriebes wie der Oberflächengestaltung,der Arrondierung,den Gebäudeverhältnissen oder dem Mechanisierungsgrad abhängt.
Abstufung der Beiträge nach Artikel 20 Direktzahlungsverordnung
Die prozentuale Abstufung gilt für sämtliche Beitragsarten mit Ausnahme der Sömmerungs- und der Gewässerschutzbeiträge.
Der ÖLN strebt eine gesamtheitliche Betrachtung der Agro-Ökosysteme und der landwirtschaftlichen Betriebe an.Zu diesem Zweck wurden der bei der Integrierten Produktion (IP) entwickelte Ansatz übernommen.So wird der ÖLN aufgrund der Auflagen der IP (Stand 1996) konkretisiert.Zusätzlich hat der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachzuweisen,dass die Vorschriften des Tierschutzgesetzes eingehalten werden.Somit ist die IP,ergänzt mit den Auflagen der Tierschutzbestimmungen,zum Standard der Landwirtschaft in der Schweiz geworden.Direktzahlungen werden nur an Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ausbezahlt,die den ÖLN erbringen. Bewirtschafter von Betrieben auf denen der ÖLN nicht erfüllt ist,erhielten bis zum 31.Dezember 2001 Direktzahlungen;diese aber mit einer Kürzung.Mit der Einführung des ÖLN wurden Auflagen der Integrierten Produktion (IP,Stand 1996) übernommen.Die Einführung von Direktzahlungen hat die Bewirtschaftungsmethoden und dadurch die Ökologie ganz wesentlich beeinflusst.Dies zeigt die starke Zunahme der nach den ÖLN- und Bio-Richtlinien bewirtschafteten Flächen:Zu Beginn der ersten Etappe der Agrarreform im Jahre 1993 betrug dieser Anteil knapp 20% der LN.Heute sind es mehr als 99% der LN.Dank gezielten finanziellen Anreizen konnte diese hohe Beteiligung der Betriebe erreicht werden.Zusätzlich ist noch zu vermerken,dass gewisse Betriebe,wie z.B.Staatsbetriebe oder juristische Personen im Direktzahlungssystem nicht erfasst sind,obwohl sie die ÖLN- oder Bio-Anforderungen erfüllen.
Der ÖLN umfasst die folgenden Punkte:
– Aufzeichnungs- und Nachweispflicht:Wer Direktzahlungen beansprucht,erbringt der kantonalen Behörde den Nachweis,dass er die ökologischen Leistungen auf dem gesamten Betrieb erfüllt.Als Nachweis gilt das Attest einer vom Kanton beigezogenen Kontrollorganisation.Um diese Bestätigung zu erhalten,macht der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin regelmässige Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs.
– Tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere:Die Bestimmungen der Tierschutzverordnung sind einzuhalten.Dabei gilt die Beweislastumkehr,das heisst,der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat zu belegen,dass auf dem Betrieb das Tierschutzgesetz eingehalten wird.
Ausgeglichene Düngerbilanz:Um die Nährstoffverluste in die Umwelt zu verringern und möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe zu erzielen,muss die Stickstoff- und Phosphorzufuhr aufgrund des Bedarfs der Pflanzen und des Produktionspotenzials des Betriebs berechnet werden.Mit der Düngerbilanz werden prioritär die Hofdünger eingesetzt;Mineraldünger und Abfalldünger werden nur wenn nötig eingesetzt.Eine Toleranzgrenze von plus 10% wird gewährt.
Mindestens alle zehn Jahre sind parzellenweise Bodenanalysen durchzuführen,um die Nährstoffreserven im Boden zu ermitteln und die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit notwendige Düngermenge entsprechend anzupassen.
Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF):Mindestens 3,5% der LN bei Spezialkulturen und 7% bei der übrigen LN sind mit ÖAF zu belegen.Entlang von Wegen sind Wiesenstreifen von mindestens 0,5 m und entlang von Oberflächengewässern, Hecken,Feldgehölzen,Ufergehölzen und Waldrändern von mindestens 3 m zu belassen.
– Geregelte Fruchtfolge:Für Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche muss zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit der Pflanzen die Fruchtfolge jedes Jahr mindestens vier Kulturen umfassen.Zudem sind Höchstanteile der Hauptkulturen an der Ackerfläche oder Anbaupausen vorgeschrieben.
Geeigneter Bodenschutz:Für jede Kultur ist ein Bodenschutzindex festgelegt.Damit Bodenerosion,Nährstoffverluste und Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln verringert werden,muss jeder Betrieb mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche einen minimalen mittleren Bodenschutzindex erreichen.Beim Ackerbau beträgt dieser 50 Punkte,beim Gemüsebau 30 Punkte.Die Stichtage sind jeweils der 15.November und der 15.Februar.
Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln:Pflanzenbehandlungsmittel können in die Luft,den Boden und die Gewässer gelangen und nachteilige Auswirkungen auf Organismen haben.Daher sind natürliche Regulationsmechanismen und biologische Verfahren vorzuziehen.Im Acker- und Futterbau sind gewisse Behandlungsverfahren (z.B.Vorauflaufbehandlung mit Herbiziden bei Weizen) verboten.Bei den Spezialkulturen werden mit gewissen Verwendungseinschränkungen zugelassene Produkte in regelmässig aktualisierten Listen aufgeführt.
Wird die Einhaltung landwirtschaftsrelevanter Vorschriften wie diejenigen des Gewässer-,des Umwelt- sowie des Natur- und Heimatschutzgesetzes verletzt,kommt zusätzlich zur Busse eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Direktzahlungen hinzu.
Nachfolgend einige Beispiele von Vorschriften,deren Verletzung Sanktionen zur Folge haben kann:
Einhaltung der Sorgfaltspflicht um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Artikel 3 Gewässerschutzgesetz);
– Verbot,Stoffe die Gewässer verunreinigen können in ein Gewässer einzubringen,oder versickern zu lassen oder so zu lagern oder auszubringen,dass dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (Artikel 6 Gewässerschutzgesetz);
Nichteinhalten der DGVE-Grenzwerte nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz (gemessen an der düngbaren LN); – Nicht vorschriftsgemässe Lagerkapazität für Hofdünger nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz;
– Zerstörung oder Beschädigung eines vom Bund oder Kanton geschützten Biotopes,insbesondere Riedgebiete und Moore,Hecken, Feldgehölze und Trockenstandorte ,sowie eines geschützten Natur- oder Kulturdenkmals,eine geschützte geschichtliche Stätte oder eine geschützte Naturlandschaft (inkl.Moorlandschaft),sofern sie durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung verursacht wird (Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 18 Absatz 1bis Natur- und Heimatschutzgesetz);
– Verstösse gegen das Verbot von Verbrennen von Abfällen (Artikel 26 Luftreinehalteverordnung).
Verstösse gegen die Vorschriften werden je nach Vorgeschichte und Wirkung der Widerhandlung im Einzelfall einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet:
– Erstmalige Verstösse ohne Dauerwirkung.Beispiel:Einmaliges gewässerschutzwidriges Güllen (Kürzung um 5 bis 25%,höchstens 2‘500 Fr.); – Erstmalige Verstösse,deren Wirkung andauert oder deren Handlung oder Unterlassung sich über eine mehrere Tage,Wochen oder Monate umfassende Zeitspanne erstreckt.Beispiel:Unbefestigter Miststock.Mehrmaliges gewässerschutzwidriges Güllen an verschiedenen Tagen (Kürzung um 10 bis 50%,höchstens 10‘000 Fr.);
Wiederholte Verstösse,also Widerhandlungen gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von drei Jahren. Massgebend sind die Vorfälle ab dem Jahr 1999 (Kürzung um 20 bis 100%).
Organisationen/Institutionen
BAGBundesamt für Gesundheit,Bern
BBTBundesamt für Berufsbildung und Technologie,Bern
BLWBundesamt für Landwirtschaft,Bern
BSVBundesamt für Sozialversicherung,Bern
BUWALBundesamt für Umwelt,Wald und Landschaft,Bern
BVETBundesamt für Veterinärwesen,Bern
BWLBundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung,Bern
ETHEidgenössische Technische Hochschule,Zürich
EUEuropäische Union
EVDEidg.Volkswirtschaftsdepartement,Bern
EZVEidg.Zollverwaltung,Bern
FALEidg.Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau,Zürich-Reckenholz
FAMEidg.Forschungsanstalt für Milchwirtschaft,Bern-Liebefeld
FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations,Rom
FATEidg.Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik,Tänikon
FAWEidg.Forschungsanstalt für Obst-,Wein- und Gartenbau,Wädenswil
FiBLForschungsinstitut für Biologischen Landbau,Frick
IAWInstitut für Agrarwirtschaft,Zürich
LBLLandwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development,Paris
OZDOberzolldirektion,Bern
RACEidg.Forschungsanstalt für Pflanzenbau,Changins
RAPEidg.Forschungsanstalt für Nutztiere,Posieux
SBVSchweizerischer Bauernverband,Brugg
secoStaatssekretariat für Wirtschaft,Bern
SMPSchweizerische Milchproduzenten,Bern
SRVAService romand de vulgarisation agricole,Lausanne
TSMTreuhandstelle Milch,Bern
WTOWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation),Genf
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft,Bonn
Masseinheiten
dtDezitonne = 100 kg
Fr.Franken
hStunden
haHektare = 10 000 m2
hlHektoliter
KcalKilokalorien
kgKilogramm kmKilometer
lLiter
mMeter
m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
Mio.Million
Mrd.Milliarde
Rp.Rappen
St.Stück
tTonne
%Prozent
ØDurchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGISAgrarpolitisches Informationssystem
AHVAlters- und Hinterlassenenversicherung
AKArbeitskraft
AKZAAusserkontingentszollansatz
BSEBovine spongiforme Enzephalopathie («Rinderwahnsinn»)
BTSBesonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw.beziehungsweise
BZ I,II,…Bergzone
ca.zirka
CO2 Kohlendioxid
EOErwerbsersatzordnung
FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheit
GAPGemeinsame Agrarpolitik der EU
GGAGeschützte Geografische Angaben
GUBGeschützte Ursprungsbezeichnung
GVEGrossvieheinheit
GVOGentechnisch veränderte Organismen
inkl.inklusive
IPIntegrierte Produktion
IVInvalidenversicherung
JAEJahresarbeitseinheit
KZAKontingentszollansatz
LGLebendgewicht
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche
LwGLandwirtschaftsgesetz
MwstMehrwertsteuer
NStickstoff
NWRNachwachsende Rohstoffe
ÖAFÖkologische Ausgleichsfläche
ÖLNÖkologischer Leistungsnachweis
PPhosphor
PSMPflanzenschutzmittel
RAUSRegelmässiger Auslauf im Freien
RGVERaufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAKStandardarbeitskraft
SGSchlachtgewicht
u.a.unter anderem
vgl.vergleiche
z.B.zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B.Tabellen)
BarthelemyF.,RenaultD.,WallernderW.,1993.
Water for a sustainable human nutrition:inputs and resources analysis for arid areas. UCDavisInternalreport.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),verschiedeneJahrgänge. Agrarbericht 2000 / 2001 / 2002 / 2003.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2003.
Auswertung der Daten über die Milchkontingentierung;Milchjahr 2002/2003.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2004.
Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente.
gemässPunkt2desBerichtesvom11.Februar2004desBundesratesüberzolltarifarischeMassnahmen2003,Separatdruck.
BundesamtfürStatistik(BFS),verschiedeneJahrgänge.
Einblicke in die schweizerische Landwirtschaft, Neuenburg.
ChapagainA.K.,HoekstraA.Y.,2003.
Virtual water flows between nations in relation to trade in livestock and livestock products. UNESCO-IHE,Delft,Netherlands.
FAO,1997.
Water Resources of the Near East Region:A Review. Rom.
LandwirtschaftlicheBeratungSt.Gallen,2004. Tätigkeitsbericht 2003.
SchweizerischerBauernverband(SBV),verschiedeneJahrgänge. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg.
UNESCO-WWAP,2003.
Water for People – Water for Life.The United Nations World Water Development Report. http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/table_contents.shtml.