Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture
Ufficio federale dell’agricoltura
Uffizi federal d’agricultura


Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture
Ufficio federale dell’agricoltura
Uffizi federal d’agricultura

Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
Telefon:031 322 25 11
Telefax:031 322 26 34
Internet:www.blw.admin.ch
Copyright:BLW,Bern 2003
Gestaltung
Artwork,Grafik und Design,St.Gallen
Druck
RDV,Berneck
Fotos
–Agrofot Bildarchiv
–BLW Bundesamt für Landwirtschaft
–Christof Sonderegger,Fotograf
–FAL Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau
–FAT Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik
–Incolor Bildagentur
–LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
–Markus Redier,LID
–Peter Mosimann,Fotograf
–Peter Studer,Fotograf
–PhotoDisc Inc.
–Prisma Dia-Agentur
–SBV Schweizerischer Bauernverband
–Schweizer Milchproduzenten SMP
–Switzerland Cheese Marketing AG
–Tobias Hauser,Fotograf
– Zefa Blue Planet
Bezugsquelle
BBL,Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern
Bestellnummern:
Deutsch:730.680.03 d
10.2003 2800 103409
Französisch:730.680.03 f
10.2003 1400 103409
Italienisch:730.680.03 i
10.2003 200 103409
Telefax:031 325 50 58
Internet:www.bundespublikationen.ch
Das Berichtsjahr 2002 war geprägt durch die Schwierigkeiten in der Milchwirtschaft. Dank dem Einsatz aller Beteiligten konnten die Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Jahr 2002 in Grenzen gehalten werden.Insgesamt sind die wirtschaftlichen Ergebnisse 2002 vergleichbar mit denjenigen im Jahr 2001.Die Milchpreise sind gegen Ende 2002 um rund 5 Rp./kg gesunken.Diese Reduktion wirkt sich erst im laufenden Jahr voll aus.Dazu kommen die Einbussen auf Grund der Hitze und Trockenheit in diesem Sommer.Die Schätzungen der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung gehen davon aus,dass die Einkommen 2003 um 13% tiefer sein werden als im Vorjahr.

Im laufenden Jahr standen für die Landwirtschaft in der Innen- und Aussenpolitik wichtige Themen auf der Traktandenliste.Innenpolitisch waren es die Entscheidungen über die Agrarpolitik 2007 und das Entlastungsprogramm 2003 zur Sanierung der Bundesfinanzen,aussenpolitisch die WTO-Verhandlungsrunde in Cancun und die Verhandlungen mit der EU über den Rohstoffausgleich bei verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten.Die innenpolitischen Entscheide geben der Landwirtschaft für die nächsten Jahre wieder eine gewisse Sicherheit.Es ist nun klar,dass die Milchkontingentierung 2009,spätestens aber 2011 aufgehoben wird.Vorgegeben sind auch die finanziellen Mittel,welche für die Landwirtschaft in den nächsten vier Jahren eingesetzt werden können.Das Parlament bewilligte drei Zahlungsrahmen in der Höhe von 14,092 Mrd.Fr.Davon muss die Landwirtschaft einen Beitrag zur Entlastung der Bundesfinanzen leisten.Dieser Beitrag schmerzt,ist aus einer gesamtheitlichen Betrachtung heraus aber nötig.Weniger klar als die innenpolitische Entwicklung ist diejenige in der WTO.Die Verhandlungen in Cancun wurden abgebrochen.Davon abzuleiten,dass damit die Landwirtschaft vor weiteren Liberalisierungen verschont bleiben wird,wäre aber ein Trugschluss.Vielmehr ist davon auszugehen,dass der Druck weiter zunehmen wird,sei es auf der Ebene der WTO,oder aber im Rahmen von bilateralen Abkommen.Insgesamt wird die Landwirtschaft in den nächsten Jahren weiterhin einem hohen Anpassungsdruck unterworfen sein.
Der vierte Agrarbericht zeigt,dass die Entwicklung in der Landwirtschaft in den letzten Jahren ziemlich konstant verlief.So war der Strukturwandel zwischen 2000 und 2002 mit 2,2% pro Jahr vergleichbar mit der Rate zwischen 1990 und 2000.Kaum Veränderungen gab es bei den betriebswirtschaftlichen Kennziffern.Die Fremdkapitalquote stagnierte bei 41%,die Investitionen schwanken zwar von Jahr zu Jahr,ein Trend nach unten ist aber nicht festzustellen.Die Auswertung der Daten aus den drei ersten Gesundheitsbefragungen geben keine Hinweise,dass bei den Bäuerinnen und Bauern im Jahr 2002 gegenüber 1997 oder 1992 vermehrt gesundheitliche oder psychische Probleme auftraten.Die Einkommen in der Landwirtschaft sind im Durchschnitt im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung unbestreitbar tief.Und die Schere ist in den letzten Jahren eher etwas auseinandergegangen.Eine bedeutende Zahl von Betrieben übertrifft das Vergleichseinkommen aber nach wie vor und dies zum Teil deutlich.Der mit Abstand wichtigste Faktor,der Betriebe mit guten und schlechten Ergebnissen unterscheidet,ist die Arbeitsproduktivität.Dies zeigt eine vertiefte Analyse der ETH Zürich im Rahmen des Projektes «Performance in der Landwirtschaft».Mit anderen Worten bedeutet dieses Resultat,dass es zweifellos noch ein erhebliches Potential zur Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse gibt.
Der Prozess zur Anpassung der Strukturen dürfte sich deshalb in den nächsten Jahren unvermindert fortsetzen.Das muss im Einzelfall nicht unbedingt die Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit heissen.In Betrieben,die kein ausreichendes Einkommen allein aus der Landwirtschaft erwirtschaften können,wird es aber auch notwendig sein,die Arbeitsproduktivität zu steigern,damit Arbeitszeit frei wird für einen Nebenerwerb.Ein Patentrezept,wie es auf dem einzelnen Betrieb weitergehen soll,gibt es nicht.Verantwortliches Handeln setzt voraus,dass unvermeidliche Veränderungen nicht ignoriert werden.Wichtig ist auch eine ehrliche Analyse der eigenen Stärken und Schwächen,der eigenen Wünsche und Möglichkeiten,bevor Entscheide getroffen werden.
Bestimmt werden die nächsten Jahre für die Landwirtschaft nicht einfach sein. Bäuerinnen und Bauern,welche die Zukunft als Herausforderung und nicht als Bedrohung sehen,werden auch künftig die zentralen Stützen einer wettbewerbsfähigen und nachhaltig produzierenden Landwirtschaft sein.
Manfred Bötsch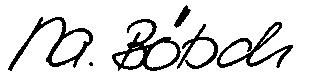
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.Bedeutung und Lage der Landwirtschaft

In Artikel 104 der Bundesverfassung ist festgehalten,dass «der Bund dafür zu sorgen hat,dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a.sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b.Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
c.dezentralen Besiedlung des Landes».
Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich,dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt,die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft.Die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen,die im öffentlichen Interesse liegen,welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen.
Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert.Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden.
Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen.Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen.Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor,dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind.Absatz 2 hält fest,dass die wirtschaftlichen,sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind.Das BLW wird beauftragt,jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten.Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach.
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts.Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.
Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen,damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann.Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung.Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe,über die Strukturentwicklungen,über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten.
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt,Informationen über Produktion,Verbrauch,Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt,die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt sowie ein zweiter Teil der Studie «Performance in der Schweizer Landwirtschaft» vorgestellt.


Die Landwirtschaft ist eng mit der übrigen Wirtschaft verbunden.Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen wirken sich auf die Landwirtschaft aus.Die Landwirtschaft selbst beeinflusst andere Wirtschaftsbereiche.Von der vorgelagerten Stufe bezieht die Landwirtschaft Produktionsmittel.Abnehmer ihrer Produkte und Leistungen sind Verarbeitungs- und Handelsunternehmen der nachgelagerten Stufe.Im Folgenden werden die Strukturentwicklungen in der Landwirtschaft und in ausgewählten Betrieben der vor- und nachgelagerten Stufe aufgezeigt.
Die Tätigkeit der Landwirtinnen und Landwirte zeitigt eine Beschäftigungswirkung in den Betrieben,die der Landwirtschaft vor- und nachgelagert sind.Ohne produktive Landwirtschaft würden deren Aktivitäten ganz oder teilweise wegfallen.
Die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft und in den vor- und nachgelagerten Betrieben ging von 1995 bis 2001 gesamthaft um 50'000 Personen zurück.Je rund zur Hälfte waren es Beschäftigte in der Landwirtschaft und in den nachgelagerten Betrieben.Stabil blieb hingegen die Zahl der Arbeitskräfte in den vorgelagerten Betrieben.
Im Jahr 2001 waren rund 12% der Beschäftigten direkt in der Landwirtschaft oder in Branchen,die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben,tätig.Die Betriebe der nachgelagerten Stufe beschäftigten rund 215'000 Personen,diejenigen der vorgelagerten Stufe rund 60'000 Personen.Die Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft betrug rund 200'000 Personen.
Im Zeitraum 1990–2000 wurden gesamthaft 22'278 Betriebe aufgegeben.Rund die Hälfte davon waren Kleinstbetriebe mit einer Fläche zwischen 0 und 3 ha.Ihre Zahl ging in dieser Periode um rund 60% zurück.Durch die Aufgabe dieser Betriebe wurden aber nur 16’546 ha oder ca.1,5% der LN frei.Klar rückläufig waren auch die Betriebe der Grössenklassen 3–10 ha und 10–20 ha.Eine Zunahme wurde hingegen bei den Betrieben mit einer Fläche über 20 ha festgestellt.Zahlenmässig am Bedeutendsten war diese bei der Grössenklasse 30–50 ha.Die Schwelle im Hinblick auf die Ab- bzw. Zunahme der Betriebe liegt somit gesamtschweizerisch etwa bei 20 ha.
Zwischen 2000 und 2002 ist die Zahl der Betriebe um 3’116 Einheiten gesunken.Dies entspricht 2,2% pro Jahr.Dabei war die Veränderungsrate bei den Betrieben bis 3 ha geringer als in den Jahren 1990–2000.Von 1,6% auf 2,1% angestiegen ist die Veränderungsrate bei den Betrieben mit mehr als 3 ha.
Entwicklung der Anzahl Betriebe nach Region
Im Jahrzehnt 1990–2000 nahm die Zahl der Betriebe in der Talregion um rund 10'000 ab,in der Hügel- und Bergregion wurden 5'500 bzw.6'500 weniger Betriebe gezählt. Die jährliche Abnahmerate in dieser Zeit war in den drei Regionen vergleichbar.
Zwischen 2000 und 2002 war der jährliche Rückgang in der Tal-,Hügel- und Bergregion etwas geringer als in den zehn Jahren zuvor.
Entwicklung der Anzahl Beschäftigte
KategorieAnzahl VeränderungAnzahlVeränderung Beschäftigte1990–2000Beschäftigte2000–2002 pro Jahrpro Jahr in %in %
Im Jahr 2000 wurden in der Landwirtschaft gesamthaft 49'768 Beschäftigte weniger gezählt als noch 1990.Abgenommen haben ausschliesslich die familieneigenen Arbeitskräfte.Die Zahl der familienfremden Arbeitskräfte erfuhr eine leichte Zunahme.
Zwischen 2000 und 2002 wurde ein weiterer Rückgang der Beschäftigten festgestellt. Die jährliche Abnahmerate war aber geringer als im Jahrzehnt zuvor.Abgenommen haben sowohl die familieneigenen als auch die familienfremden Arbeitskräfte.

■ Vor- und nachgelagerte Stufe Die Strukturen der vor- und nachgelagerten Stufe haben sich unterschiedlich entwickelt.
Entwicklung ausgewählter Betriebe, die der Landwirtschaft vorgelagert sind
Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen Grosshandel mit Getreide, Saatgut und Futtermitteln
199519982001
Quellen: BFS, SBV, BLW
Die Betrachtung ausgewählter Branchen der vorgelagerten Stufe in der Periode 1995–2001 zeigt für die Bereiche Herstellung von Futtermitteln und Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen sowohl bei den Betrieben als auch bei den Beschäftigten eine Stagnation bzw.eine leichte Zunahme.Im Grosshandel mit Getreide, Saatgut und Futtermitteln nahmen zwar die Beschäftigten zu,die Betriebe jedoch ab.
Entwicklung der Beschäftigten in ausgewählten Betrieben, die der Landwirtschaft vorgelagert sind
Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen Grosshandel mit Getreide, Saatgut und Futtermitteln
199519982001
Quellen: BFS, SBV, BLW
Bei ausgewählten Branchen der nachgelagerten Stufe wurde in der Zeitspanne 1995–2001 tendenziell eine Konzentration festgestellt.Im Jahr 1995 waren beispielsweise im Bereich Schlachten und Fleischverarbeitung 10’171 Personen auf 282 Betrieben tätig.Sechs Jahre später waren es 10'683 Beschäftigte (+5%) auf 262 Betrieben (–7%).Im Bereich Milchverarbeitung gingen in dieser Zeit sowohl die Betriebe als auch die Beschäftigten zurück.Während 1995 11'091 Personen in 1'445 Betrieben Arbeit fanden,waren es 2001 10'058 in 1'148 Betrieben.Rückläufige Zahlen verzeichneten in diesem Zeitraum ebenfalls der Gross- und Detailhandel mit Nahrungsmitteln,Getränken und Tabakwaren.
Entwicklung ausgewählter Betriebe, die der Landwirtschaft nachgelagert sind
Verarbeitung von MilchSchlachten und Fleischverarbeitung
Herstellung von Brot und Backwaren
Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
Fachdetailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
Quellen: BFS, SBV, BLW
Entwicklung der Beschäftigten in ausgewählten Betrieben, die der Landwirtschaft nachgelagert sind
Verarbeitung von MilchSchlachten und Fleischverarbeitung
Herstellung von Brot und Backwaren
Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
Fachdetailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
Quellen: BFS, SBV, BLW
■ Milchwirtschaftsbetriebe Die Strukturen in der Milchproduktion haben sich im Zeitraum 1990/91–2001/02 wesentlich verändert.Die Einführung des Kontingentshandels im Jahr 1999 hat den Anpassungsprozess noch beschleunigt.
Entwicklung der Milchwirtschaftsbetriebe
Entwicklung der Milchwirtschaftsbetriebe
Die Zahl der Milchwirtschaftsbetriebe im Talgebiet verringerte sich von 1990/91 bis 2001/02 um rund einen Drittel.Das durchschnittliche Kontingent stieg in der gleichen Zeitspanne um 50% an.Die bewirtschaftete LN pro Betrieb erhöhte sich annähernd um 20% von 17,2 auf 20,6 ha.
Die Zahl der Milchwirtschaftsbetriebe im Berggebiet nahm in diesen elf Jahren um ein Viertel ab.Das durchschnittliche Kontingent erhöhte sich im selben Zeitraum um gut 30%.Die bewirtschaftete LN pro Betrieb stieg von 15,6 auf 18,2 ha (+17%).
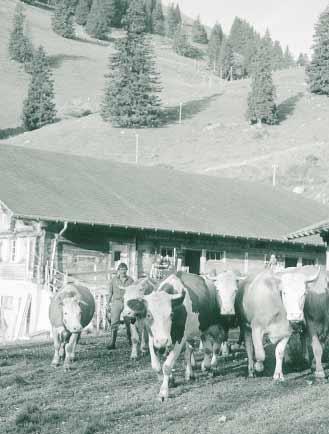
Entwicklung der Milchwirtschaftsbetriebe seit Einführung des Kontingentshandels
Der 1999 eingeführte Kontingentshandel führte zu einer Beschleunigung bei der Aufgabe der Milchproduktion.Die verbleibenden Betriebe konnten dabei sowohl die Kontingentsmenge ausdehnen als auch die LN vergrössern.So wuchs die Kontingentsmenge je Betrieb zwischen den Milchjahren 1999/2000 und 2001/02 um jährlich 5,1% (insgesamt knapp 8'000 kg),die LN um jährlich 3,5% (insgesamt 1,3 ha).
Veränderung der Milchkontingente 1999/2000–2001/02
Die Veränderungen der Milchkontingente zwischen 1999/2000 und 2001/02 zeigen, dass der Kontingentshandel einem Bedürfnis der Milchproduzenten entsprach.Profitiert davon haben vor allem Gebiete im westlichen Teil der Schweiz.Insbesondere zwei Faktoren dürften diese Entwicklung begünstigt haben:Gute Verwertungsmöglichkeiten für die Milch und relativ tiefe Kontingente je ha.Regionen,welche durch Betriebe mit hohen Kontingenten pro ha und hohen Tierbesatzdichten geprägt sind,waren in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eher eingeschränkt.Dass die Gebiete mit Kontingentszunahmen überwiegen,hängt mit der vom Bundesrat gewährten Erhöhung der Kontingentsmenge im Milchjahr 2001/02 (+3%) zusammen.
■ Bruttowertschöpfung
Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren 1999–2001
■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten
2.Sektor100
3.Sektor276
1provisorisch Quellen:BFS,SBV

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen der gesamten Wirtschaft erreichte 2001 einen Wert von 407'821 Mio.Fr.Im Vergleich zum Vorjahr nahm sie leicht zu.Der Anteil des Primärsektors war mit 1,1% gering.Davon machte die Landwirtschaft mit 74,1% den grössten Anteil aus.
Infolge der Konjunkturbaisse und den gedämpften Erwartungen mit rückläufigen Bauund Ausrüstungsinvestitionen nahmen die gesamten Einfuhren im Berichtsjahr gegenüber 2001 um 8,2% ab,die gesamten Ausfuhren um 1,4%.Die Importe sanken von total 141,9 auf 130,2 Mrd.Fr.,die Exporte von 138,5 auf 136,6 Mrd.Fr.Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen war ebenfalls leicht rückläufig.Die Importe verringerten sich hier von 8,6 auf 8,5 Mrd.Fr.,die Exporte von 3,6 auf 3,5 Mrd.Fr.
Im Berichtsjahr stammten 74,1% der Landwirtschaftsimporte (6,3 Mrd.Fr.) aus der EU. 66,2% der Exporte (2,3 Mrd.Fr.) wurden in den EU-Raum getätigt.Gegenüber dem Vorjahr haben die Einfuhren um knapp 150 Mio.Fr.zu-,die Ausfuhren hingegen um 10 Mio.Fr.abgenommen.
Landwirtschaftlicher Aussenhandel mit der EU 2002
Einfuhren Importüberschuss
Quelle: OZD
Landwirtschaftsprodukte hat die Schweiz im Berichtsjahr wertmässig am meisten aus Frankreich eingeführt.Etwa ein Viertel der gesamten Importe aus der EU stammten aus diesem Land.Am wenigsten wurde aus Österreich importiert.Das gleiche Bild zeigte sich auch im Vorjahr.Die meisten Ausfuhren wurden nach Deutschland getätigt.Eine stark negative Bilanz weist die Schweiz mit Frankreich,Italien,der Niederlande und Spanien aus.Ausgeglichen erscheint sie hingegen auf relativ tiefem Niveau mit Österreich.
Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie 2002
Tabak und Diverses (13, 14, 24)
Milchprodukte (4)
Nahrungsmittel (20, 21)
Genussmittel (9, 17, 18)
Tierfutter, Abfälle (23)
Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)
Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)
Lebende Pflanzen, Blumen (6)
Gemüse (7)
Früchte (8)
Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)
Getränke (22)
Einfuhren Import- bzw. Exportüberschuss Ausfuhren
Quelle: OZD
Die Schweiz ist ein stark importorientiertes Land.Eingeführt wurden im Berichtsjahr vor allem Getränke und tierische Produkte (inkl.Fische).Die Getränkeeinfuhren setzen sich zusammen aus rund 67% Wein und je rund 10% Spirituosen und Mineralwasser. Von den Gesamteinfuhren unter dem Titel «tierische Produkte» sind rund 40% dem Sektor Fleisch,30% dem Sektor Fisch und der Rest dem Sektor zubereitetes Fleisch und Fleischkonserven zuzuordnen.
Bei den Ausfuhren lagen Nahrungsmittel und Genussmittel an der Spitze.Hauptanteile bei den Nahrungsmittelausfuhren bilden die Lebensmittelzubereitungen,KaffeeExtrakte,Suppen und Saucen.Unter dem Titel «Genussmittel» wurden vorwiegend Röstkaffee,Zuckerwaren sowie Schokolade ausgeführt.Bei Früchten,Gemüse und tierischen Produkten blieben die Exporte bescheiden.
Exportüberschüsse wurden bei Tabak und Diverses (+249 Mio.Fr.) sowie Milchprodukten (+156 Mio.Fr.) erzielt.Eine vorübergehende Fabrikationszunahme in der Schweiz mit einer sehr hohen Wertschöpfung (Zigaretten und im Inland für den Export hergestellte Tabakrohmischungen) führte zu einem hohen Exportüberschuss bei Tabak (Zolltarifkapitel Nr.24).Dies hebt deutlich die Bedeutung der Tabakindustrie für den Export hervor.In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten,dass diese Ausfuhren von Jahr zu Jahr stark schwanken können.

Die schweizerische Landwirtschaft hat den Verfassungsauftrag,mit ihrer Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten.Der Anteil der Inlandproduktion am inländischen Gesamtverbrauch wird allgemein als Selbstversorgungsgrad definiert.
Die einheimische Landwirtschaft produzierte im vergangenen Jahrzehnt im Durchschnitt 61,3% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittel (gemessen in Kalorien).Im Bereich pflanzliche Nahrungsmittel lag dieser Wert bei 43,3%,bei den tierischen Nahrungsmitteln bei 95,0%.Von Jahr zu Jahr sind Schwankungen festzustellen.Dies trifft vor allem auf die stark witterungsabhängigen Erträge im Pflanzenbau zu.Besonders in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurden grössere Ausschläge registriert.
2001 lag der Selbstversorgungsgrad bei 59% und war damit 3 Prozentpunkte tiefer als 2000.Den Ausschlag gaben die wesentlich geringeren Ernten im Pflanzenbau,welche den Anteil der im Inland produzierten Nahrungsmittel in diesem Bereich von 47 auf 41% drückten.Bei tierischen Produkten lag der Inlandanteil 2001 bei 94% gegenüber 91% im Jahre 2000.
Mit Ausnahme des Zwischenhochs 2000 ist der Produzentenpreisindex in den neunziger Jahren kontinuierlich gesunken.Auch im Berichtsjahr ging der Index gegenüber 2001 um weitere 0,9 Prozentpunkte zurück.Für die Produzenten spürbar waren insbesondere die Preisabschläge bei Getreide,Weinmost,Milch,Schlachtschweinen, Schlachtgeflügel und Eiern.
Im Landesindex der Konsumentenpreise wirken sich die Kosten und Margen der Nahrungsmittelverarbeitung und des Nahrungsmittelhandels,die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Nahrungsmittelrohstoffe (rund 40% des Nahrungsmittelverbrauchs in Kalorien gemessen werden importiert),der Wechselkurs des Schweizer Frankens und etwa zu einem Siebtel die inländischen Produzentenpreise aus.Der Index hat im Berichtsjahr gegenüber 2001 (106,9) um 2,4 Prozentpunkte zugelegt.
Importpreisindex
für Nahrungsmittel 1
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel Index (1990/92 = 100)
Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke
Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel
Produzentenpreisindex
1 Basis Mai 1993 = 100. Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden. Im Importpreisindex enthält die Gruppe «Nahrungsmittel» die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Diese umfassen ausgewählte Produkte und widerspiegeln nicht den gesamten Bereich der Nahrungsmittelimporte.
Quellen: BFS, SBV
Im Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel drücken sich in erster Linie die Preise von Futtermitteln,Saat- und Pflanzgut,Dünge-,Bodenverbesserungsund Pflanzenschutzmitteln sowie von Bau- und Ausrüstungsinvestitionen aus. Ausserdem fliesst ein Teil der mit dem Landesindex der Konsumentenpreise gemessenen Preisentwicklungen unmittelbar in den entsprechenden Index ein.Dazu gehören u.a.Energie (Treibstoffe,Strom),Telefon,Wasser,Unterhalts- und Reparaturkosten.Im Jahr 2002 ist der Index um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr (99,9) gesunken.
Im Importpreisindex für Nahrungsmittel ist nicht der gesamte Warenkorb der Nahrungsmittelimporte enthalten.Seine Aussagekraft ist deshalb nicht derjenigen des Produzenten- oder Konsumentenpreisindexes gleichzustellen.Nach zwei Jahren auf dem Niveau von 111,8 Prozentpunkten ist der Index im Berichtsjahr auf 112,8 Prozentpunkte angestiegen.
Die Gesamtausgaben des Bundes beliefen sich im Berichtsjahr auf 50'715 Mio.Fr., das entspricht einem Ausgabenplus von 1% gegenüber 2001.4'067 Mio.Fr.davon wurden für Landwirtschaft und Ernährung aufgewendet.Nach sozialer Wohlfahrt (12'797 Mio.Fr.),Finanzen und Steuern (9'472 Mio.Fr.),Verkehr (8'091 Mio.Fr.) und Landesverteidigung (4'788 Mio.Fr.) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes lag im Berichtsjahr mit 8% praktisch auf dem Niveau der beiden Vorjahre.
Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187,Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet,wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind.Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio.Fr.1998 betrugen die Ausgaben für Produktion und Absatz 1‘203 Mio.Fr.2002 waren es noch 979 Mio.Fr.Der Anstieg von 77 Mio.Fr.im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr ist auf ausserordentliche Ausgaben im Milchsektor zurückzuführen (insbesondere im Zusammenhang mit dem Konkurs der Swiss Dairy Food).Ohne diese ausserordentlichen Ausgaben hätten die finanziellen Aufwendungen für Produktion und Absatz nur noch 826 Mio.Fr.betragen.
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Anmerkung:Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete.So wurden z.B.die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen.Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen.Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung.
1Die ausserordentlichen Ausgaben im Milchsektor sind in diesem Betrag eingerechnet.Dies ging zulasten von anderen Bereichen wie z.B.Strukturverbesserungen und Viehwirtschaft.
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Bei den Direktzahlungen sind die um rund 100 Mio.Fr.höheren Ausgaben im Berichtsjahr gegenüber 2001 auf die Erhöhung der Limiten bei den Beiträgen an Raufutter verzehrende Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen sowie auf Mehrbeteiligungen an Ökoprogrammen wie Bio,BTS und RAUS zurückzuführen.
Der Ausgabenrückgang zwischen 2001 und 2002 im Bereich Grundlagenverbesserung ist mit der Sperrung eines Teils der Mittel (rund 50 Mio.Fr.) zu Gunsten von ausserordentlichen Massnahmen im Milchsektor in Verbindung zu setzen.
Ein milder Frühling und ein regnerischer Sommer haben das Landwirtschaftsjahr 2002 gekennzeichnet.Die Milchwirtschaft hat mit den Absatzproblemen beim Emmentaler und dem Zusammenbruch der Swiss Dairy Food (SDF) ein turbulentes Jahr hinter sich. Massnahmen des Bundes haben geholfen,die Lage zu stabilisieren.Die Schlachtviehpreise blieben tief.Insbesondere beim Schweinefleisch war dafür das hohe Angebot verantwortlich.Beim Brotgetreide musste viel Auswuchsgetreide zu Futtergetreide deklassiert werden.Die Kirschenernte war rund 80% höher als im Vorjahr.
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Güter (vgl.dazu Ausführungen zur neuen Methodik der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in Abschnitt 1.1.3 und im Anhang A73) hat 2002 im Vergeich zu 2001 um 180 Mio.Fr.(+1,9%) zugenommen.Während die pflanzliche Erzeugung um 228 Mio.Fr.(+5,2%) zulegte,ging die tierische Erzeugung um 48 Mio.Fr.(–0,9%) zurück.

■ Produktion:leichter

Das Jahr 2002 war für die Milchwirtschaft schwierig:Verlust von Marktanteilen auf den ausländischen Käsemärkten, überdurchschnittliche Käselager,Verlagerung bei der Milchverwertung von der Käseproduktion zur Butter-,Magermilchpulver- und Vollmilchpulverherstellung und Nachlassstundung für den grössten Milchverwerter SDF.
Im Berichtsjahr summierte sich die Gesamtmilchproduktion auf 3,93 Mio.t.Davon wurden 744'000 t zur Selbstversorgung verwendet oder auf dem Hof verfüttert.Im Vergleichzum Vorjahr nahm die Milchleistung pro Kuh um weitere 30 kg auf 5'570 kg zu.
Entwicklung des Bestandes von Verkehrsmilchkühen und
1990200020012002
Die Milchproduzenten verkauften im Berichtsjahr 3,19 Mio.t Milch,produziert von 605'404 Kühen.Im Jahr 2002 wurde wiederum ein Rückgang des Bestandes der Kühe mit Verkehrsmilchproduktion verzeichnet (von 614'608 auf 605'404 Tiere).Dank dem Zuchtfortschritt,der besseren Fütterung und dem optimaleren Management wurde dieselbe Milchmenge mit weniger Kühen produziert.
■ Verwertung: Weniger Käse
Milcheinlieferungen nach Monaten 2001 und 2002
2002
2001
In den Monaten Februar bis März und Juni bis September waren die monatlichen Milcheinlieferungen ungefähr gleich gross wie im Vorjahr.Im Mai wurde mehr,im Januar und Oktober bis Dezember hingegen weniger Milch als im Jahr 2001 eingeliefert.Zum insgesamt leicht kleineren Milchaufkommen (–18'657 t oder –0,6%) haben beigetragen:
die Kürzung der Milchkontingentsmenge von 104,5% auf 102,5% des Grundkontingentes;
– der schlechte Absatz für unsere Käse auf den Exportmärkten;
die schwierige Situation auf dem Milchmarkt nach dem Kollaps der SDF.
Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,19 Mio.t) wie folgt verwertet (in t Milch):
zu Konsummilch und anderen Milchprodukten:1'123'000 t (+5,3%)
zu Käse:1'298'000 t (–8,6%)
zu Rahm/Butter:769'000 t (+6,2%)
■ Aussenhandel: Auswirkungen des bilateralen Agrarabkommens
Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch
Die hergestellte Menge Käse sank 2002 gegenüber 2001 um 6,9%.Die Abnahme betrug beim Hartkäse 14,6% (auf 68'881 t),beim Halbhartkäse 1,5% (auf 47'435 t) und beim Weichkäse 0,4% (auf 6'949 t).Eine leicht positive Entwicklung wies das Produktionsvolumen von Frischkäse und von Spezialprodukten (Schaf- und Ziegenkäse) auf.Beträchtliche Absatzeinbussen musste auch der Schmelzkäse hinnehmen.
Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich die Butterproduktion kaum.Im Jahr 2002 wurden 42'226 t (+0,8%) Butter hergestellt.
Im Berichtsjahr stieg dagegen die Milchpulverproduktion stark an.Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Zunahme der Produktion um 22,6% (von 44'527 t auf 54’569 t) verzeichnet.Insbesondere beim Magermilchpulver war im Berichtsjahr eine Steigerung um 44,2% (von 18'736 t auf 27'017 t) festzustellen.Die stark eingeschränkte Käseproduktion führte dazu,dass die freiwerdende Milch überwiegend getrocknet werden musste.
Die Aussenhandelsbilanz hat sich im Berichtsjahr nicht grundlegend geändert.Die Schweiz exportiert mengenmässig mehr Käse,Milchpulver,Joghurt und Rahm als sie einführt.Auffallend sind aber folgende Entwicklungen:die starke Zunahme des Milchpulverexportes,der erstmalige namhafte Butterexport und der Rückgang des Käseexportes.
Im Berichtsjahr wurden 16'168 t Milchpulver exportiert.Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Jahr 2001 von 11'263 t oder 329%.Die Einfuhren stiegen von 784 t auf 837 t.Der Butterexport als Entlastungsmassnahme erreichte im Vergleich zum Vorjahr 1'306 t.Importiert wurden im Berichtsjahr 1'982 t (–3'547 t oder –64%).
Seit dem 1.Juni 2002 ist das bilaterale Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in Kraft.Eine Analyse des ersten Jahres nach In-Kraft-Treten des Käseabkommens zeigt folgendes Bild:
Der Käseimport aus der EU ist im Zeitraum Juni 2002 bis Mai 2003 gegenüber derselben Vorjahresperiode um 2,2% gesunken.Ebenso nahm in diesem Zeitraum der Export in die EU um rund 4,6% ab.
Ausnützung der Käse-Zollkontingente der Schweiz von Juni 2002 bis Mai 2003
ProduktKontingents-KontingentZugeteilte
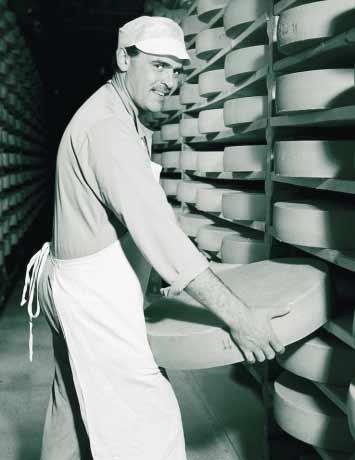
Nicht alle Nullzollkontingente der Schweiz wurden ausgenützt.Von den gewährten 12'000 t im ersten Jahr wurden insgesamt 8'999 t über das Versteigerungsverfahren zugeteilt.Das Interesse an den fünf Nullzollkontingenten war unterschiedlich gross.Bei den beiden Kontingenten 119 (Mozzarella),und 120 (Frisch- und Weichkäse), überschritt die Gebotsmenge die Kontingentsmenge deutlich,somit konnte die gesamte Kontingentsmenge von 1’500 t zugeteilt werden.Die zugeteilte Menge der drei anderen Kontingente erreichte die Kontingentsmenge hingegen nicht.
Die Gewährung von Nullzollkontingenten für die Einfuhr von Käse aus der EU hat an den effektiven Importen wenig geändert.Die Käseimporte sind dadurch nicht angestiegen.
Gemäss Abkommen können pro Jahr 3'000 t Käse (im 1.Jahr 3'354 t) zollfrei in die EU exportiert werden.Die Ausnützung dieser Marktzutrittsmöglichkeit ist bisher gering.Im ersten Halbjahr (Juli 02 – Dezember 02) wurden 436 t von möglichen 1’677 t Käse in die EU ausgeführt.Somit standen für die zweite Jahreshälfte 2002/03,einschliesslich der im ersten Halbjahr nicht ausgenützten Kontingente,2'918 t Käse zur Verfügung. Davon wurden von der EU im Januar 2003 angemeldete Lizenzen in der Höhe von nur 302 t (rund 10% des verfügbaren Kontingents) zugeteilt.
■ Verbrauch: Stagnierender Konsum
Die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums an Milch und Milchprodukten stagniert insgesamt.Der Joghurt-,Quark- Käse- und Butterkonsum ist 2002 im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert geblieben.
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums
1990/92200020012002
Auch der Konsum von Frischkäse pro Kopf blieb 2002 im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 5,9 kg.Einmal mehr war hingegen ein Rückgang des Verbrauchs an Konsummilch von 84,4 kg auf 81,4 kg (–3,6%) festzustellen.

■ Produzentenpreise: Tendenz sinkend
Im Jahr 2002 wurde im Vergleich zu 2001 generell ein leichter Rückgang der Produzentenpreise festgestellt.Der Zielpreis von 77 Rp.wurde im Berichtsjahr dennoch übertroffen.Der Bundesrat hat den Zielpreis pro kg Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein per 1.November 2002 von 77 auf 73 Rp.gesenkt.
Milchpreise 2002 gesamtschweizerisch und nach Regionen
Der schweizerische Durchschnittspreis sank 2002 gegenüber dem Vorjahr um 1.5 Rp. pro kg Milch und lag bei 78.39 Rp.Die regionalen Unterschiede bei Industriemilch und verkäster Milch sind 2002 im Vergleich zu 2001 angestiegen.Die Preisdifferenzen zwischen den Regionen bei der Industriemilch betrugen bis zu Rp.2.77,bei der verkästen Milch bis zu Rp.5.77.Im Berichtsjahr wurde mit durchschnittlich 93.17 Rp. (–2.15 Rp.oder –2,3%) auch für Biomilch weniger ausbezahlt.Für Biomilch liessen sich zwischen 14.8 und 16 Rp.pro kg Milch höhere Preise erzielen.
■ Konsumentenpreise: stabil bis leicht steigend
Die Konsumentenpreise stiegen im Berichtsjahr leicht oder blieben stabil,mit Ausnahme des Emmentalers.Für 1 kg Emmentaler zahlte der Konsument durchschnittlich Fr.20.33.Die Abnahme beträgt gegenüber dem Vorjahr 26 Rp.Hingegen wurde für 1 kg Greyerzer im Vergleich zum Vorjahr 51 Rp.mehr (Fr.20.88) verlangt.
Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte
1990/92200020012002
Quelle: BFS
Auch im Jahr 2002 wiesen die Konsumentenpreisindices für die Produkte Käse,Butter und andere Milchprodukte weiter steigende Tendenzen auf.Wie schon im Vorjahr ist der Index für Butter mit 2,3 Punkten oder 2,4% am stärksten gestiegen.Die Indices für Milch und Rahm blieben unverändert.
Im November und Dezember 2002 notierte die Bruttomarge für die Verarbeitung und Verteilung von Milch und Milchprodukten die tiefsten Werte des Berichtsjahres.Der Rückgang der Bruttomargen auf Käse und Konsummilch ist in erster Linie auf zahlreiche Verkaufsaktionen zurückzuführen.Beim Konsumrahm und bei Joghurt wurde er durch die Verteuerung des Rohstoffes verursacht.Trotz des tieferen Rohmilchpreises blieb im Dezember die Gesamtbruttomarge auf Milch und Milchprodukten aufgrund der Verkaufsaktionen für Käse und Butter im Vergleich zum November nahezu unverändert.

■ Produktion: Steigender Mutter- und Ammenkuhbestand
Der Fleisch- und Fischkonsum erreichte im Berichtsjahr mit 60,39 kg pro Kopf beinahe wieder die Höhe wie vor der ersten BSE-Krise im Jahre 1996.Entgegen den Prognosen wurde erfreulicherweise mehr Rindfleisch gegessen.In der Folge realisierten die Produzenten für Muni,Rinder und Ochsen trotz des grösseren Inlandangebotes rund 5% höhere Preise als im Vorjahr.
In eingeführtem Geflügelfleisch aus China wurden bei Kontrollen zu hohe Antibiotikarückstände festgestellt.Die Schweizer Behörden verhängten umgehend einen Importstopp gegen chinesisches Geflügelfleisch.Diese Einschränkung konnte nach Abschluss der Untersuchungen und nach der Erweiterung der Sicherheitsauflagen teilweise wieder aufgehoben werden.Trotz dieses negativen Vorkommnisses stieg der Geflügelkonsum um 1%.
Die Zahl der BSE-Fälle ging im Berichtsjahr deutlich zurück:Es wurden nur 24 Fälle diagnostiziert,während es im Jahre 2001 noch 42 Fälle waren.Damit ist die Schweiz eines der wenigen Länder weltweit,das einen solchen Rückgang verzeichnen kann. Diese erfreulichen Resultate zeigen,dass die Massnahmen zur Bekämpfung der BSE Früchte tragen.Am 4.Juli 2002 hob auch Polen die auf Grund der BSE verhängten Handelseinschränkungen gegen Schweizer Zucht- und Nutzvieh auf.Für die wichtigen Absatzmärkte in Deutschland und Frankreich gingen die Grenzen bereits Ende 2001 bzw.Anfang 2002 wieder auf,diejenigen von Italien dagegen bleiben weiterhin geschlossen.
Der Rindviehbestand pendelte sich in den letzten drei Jahren bei rund 1,6 Mio.Stück ein.Er hängt hauptsächlich von der Milchkontingentsmenge und der Milchleistungje Kuh ab.Im Berichtsjahr wurden 716'000 Kühe gehalten.Davon dienten 85% zur Verkehrsmilchproduktion,7% zur Kälbermast (Kühe ohne Verkehrsmilchproduktion, die aber gemolken werden) und 8% zur extensiven Fleischproduktion (Mutter- und Ammenkühe).Die Haltung von Mutter- und Ammenkühen als Alternative zur Milchproduktion liegt seit Jahren im Trend.Gegenüber 1990 hat sich der Bestand mehr als vervierfacht und erreichte im Berichtsjahr 58'000 Stück.Dies führte indes nicht zu einer grösseren Fleischproduktion,weil der Bestand an Milchkühen zur Verkehrsmilchproduktion im selben Zeitraum um 121'000 Stück (–16,7%) abnahm.
Der Bestand an Mastgeflügel,Schafen,Ziegen und Pferden stieg in den vergangenen drei Jahren stetig an.Die Zunahme des Mastgeflügelbestandes ist hauptsächlich auf das starke Wachstum des Geflügelfleischkonsums zurückzuführen.Für den Zuwachs bei Pferden dürfte die vermehrte Nutzung als Freizeitpferd verantwortlich sein.Ziegen und Schafe gelten als wenig anspruchsvolle Raufutterverzehrer,die sich ausgezeichnet für die extensive Bewirtschaftung von steilen Flächen eignen.Die gezielte Ausrichtung der agrarpolitischen Massnahmen auf die Förderung von Raufutterverzehrern dürfte wesentlich dazu beigetragen haben,dass der Schafbestand gegenüber 1990 um 21% und der Ziegenbestand um 8% gestiegen sind.Als Folge des langfristig rückläufigen Konsums von Schaleneiern und der stetig verbesserten Legeleistung liegt der Legeund Zuchthennenbestand im Berichtsjahr gegenüber 1990 um 28% tiefer.
Dank der grossen Nachfrage wurde 8,7% mehr Geflügelfleisch produziert als im Vorjahr.Mit 43,1% ist der Anteil des inländischen Geflügelfleisches am Konsum weiterhin tief.Bei Rind-,Kalb-,Schweine-,Pferde- und Schaffleisch blieb die inländische Produktion ziemlich konstant.Bei Pferdefleisch stammte lediglich 12,5% aus der Schweiz,wohingegen beim Kalbfleisch der Anteil aus einheimischer Produktion bei 97,2% lag.

■ Aussenhandel: Deutschland und Österreich liefern
Entwicklung der tierischen Produktion
Quellen: Proviande und GalloSuisse
Die Eierproduktion stieg 2002 gegenüber dem Vorjahr um 3% und belief sich auf 703 Mio.St.Ungefähr ein Drittel der Produktion wird direkt vermarktet,und zwei Drittel werden vom Grosshandel übernommen.
Die Ausfuhr von Schweizer Fleisch und Fleischerzeugnissen ist seit Jahren gering.Im Berichtsjahr wurden lediglich 1'500 t ausgeführt.Traditionsgemäss das bekannteste Exportprodukt ist Trockenfleisch.Firmen aus Frankreich (87%) und Deutschland (10%) sind die wichtigsten Käufer der ausgeführten 967 t Trockenfleisch.
Die Einfuhren von Rindfleisch stiegen dank der besseren Nachfrage von 5'900 t auf 6'900 t.Eingeführt wurden grösstenteils zugeschnittene Rindsbinden und Spezialstücke wie Filets,Entrecôtes,Huft und US-Beef.Rindsbinden werden zur Fabrikation von Trockenfleisch verwendet.Spezialstücke fliessen hauptsächlich in die Gastronomie. Hauptlieferanten waren Brasilien (78%),Südafrika (8%) und die USA (7%).Kalbfleisch wird hauptsächlich aus den Niederlanden geliefert (47%).Aus Deutschland und Österreich stammen beinahe 100% des eingeführten Schweinefleisches.Die vergleichbare Fleischqualität,tierfreundliche Haltungssysteme und kurze Transportwege dürften der Grund sein,weshalb diese Nachbarländer bevorzugt werden.Der Schweinefleischimport stieg ebenfalls dank der lebhaften Nachfrage von 6'500 t auf 8'600 t. Neuseeland (47%) und Australien (36%) blieben die wichtigsten Schaf- und Lammfleischexporteure in die Schweiz;das gleiche gilt für Kanada (37%),die USA (29%) und Australien (14%) beim Pferdefleisch.Rund 70% des eingeführten Geflügelfleisches wurden aus Frankreich,Deutschland und Ungarn geliefert.Der Anteil von China,dem wichtigsten Lieferanten in den Jahren 2000 und 2001,sank infolge der Antibiotikaproblematik dagegen auf 9%.
Im Berichtsjahr wurden 200 Esel,Maultiere und Maulesel und rund 2'950 Pferde und Kleinponys importiert.Dies entspricht einer Zunahme von 3% gegenüber 2001.Die wichtigsten Lieferländer waren Deutschland (33%) und Frankreich (24%).Aus der Schweiz wurden im Gegenzug 832 Pferde exportiert,wovon rund zwei Drittel nach Deutschland und Frankreich.
■ Verbrauch: Rindfleischkonsum steigt wieder
Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Fleisch- und Fischverbrauch im Berichtsjahr um 1,6% auf 450'000 t zu.Im Trend liegen Rindfleisch (+10%) und Wild (+8,2%). Abgenommen hat der Verbrauch von Kaninchenfleisch (–17,3%),Pferdefleisch (–7,1%),Fischen und Krustentieren (–5%) sowie Schaffleisch (–3,7%).
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern
■ Produzentenpreise: Bankviehpreise erholten sich
1990/92200020012002
Nachdem der Fleisch- und Fischkonsum bereits 2001 um 0,3% wuchs,stieg er im Berichtsjahr nochmals um 1% auf 60,39 kg pro Kopf.Damit hat der Pro-Kopf-Konsum beinahe wieder das Niveau wie vor der ersten BSE-Krise im Jahre 1996 erreicht.In der Schweiz wird Schweinefleisch bevorzugt (25,48 kg),gefolgt von Rindfleisch (10,64 kg) und Geflügelfleisch (9,71 kg).Schaf-,Ziegen-,Pferde-,Wild- und Kaninchenfleisch weisen weiterhin eine marginale Bedeutung beim Konsum auf.Von diesen Fleischsorten wurden lediglich rund 3 kg pro Kopf gegessen.
Die Kuh- und Schweinepreise verharrten 2002 auf dem Vorjahresniveau.Dies ist die Folge eines konstanten Angebotes und einer unveränderten Nachfrage nach diesen Fleischsorten.Vor allem ein um 13% gestiegener Rindfleischkonsum in Privathaushalten dürfte die Ursache für Preissteigerungen beim Bankvieh (Muni,Ochsen und Rinder) sein.Die Bankviehproduzenten erzielten mit Fr.7.23 je kg SG für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) zwar 5% mehr als im Vorjahr,aber immer noch beinahe 20% weniger als im Jahr 2000.Die Rindfleischlager im Umfang von 2'000 t aus dem Jahr 2001 konnten bis Ende des Berichtsjahres wieder dem inländischen Markt zugeführt werden,ohne dass dies die Produzentenpreise spürbar unter Druck setzte. Für Lämmer mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurde im Berichtsjahr mit Fr.12.61 je kg SG beinahe 2% mehr bezahlt als 2001.
Saisonale Preisschwankungen traten wie üblich bei Schweinen und Tieren der Rindergattung auf.Als Folge der grossen Nachfrage nach Schweinefleisch zum Grillieren stiegen die Preise im Juni und Juli auf Fr.4.60 je kg SG,fielen indes ab September wieder unter Fr.4.– je kg SG.Von September bis Dezember kletterten die Kälberpreise wegen des kleinen Angebotes von Fr.10.50 auf fast Fr.14.– je kg SG.Die Bankviehpreise standen seit November 2000 infolge der wieder ausgebrochenen Diskussionen rund um die Tierseuche BSE stark unter Druck.Für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) wurde zeitweise lediglich Fr.6.10 je kg SG bezahlt.Ab September 2002 erholte sich der Bankfleischmarkt markant und die Preise stiegen vom absoluten Tiefstand um rund 30%.
Bei allen Tierkategorien lagen die durchschnittlichen Produzentenpreise der letzten drei Jahre gegenüber 1990/92 15–25% tiefer.Die Preise für Kühe rutschten sogar bis zu 52% ab.Für diese langfristige Entwicklung dürften verschiedene Gründe massgebend sein:Bei den Tieren der Rindergattung und den Schweinen sank die Nachfrage deutlicher als das Angebot.So ging das inländische Angebot an Schweinefleisch um 13% zurück,währenddessen der Pro-Kopf-Konsum um 22% einbrach.Bei Tieren der Rindergattung dürften ausserdem die gestiegenen Entsorgungskosten für Schlachtund Fleischabfälle sowie die gesunkenen Erlöse für gewisse Schlachtnebenprodukte und Reststoffe (Haut,Knochen) hinzukommen.Diese Kosten bzw.Mindererlöse wurden zumindest teilweise in die Produzentenpreiskalkulation der Fleischverwerter einbezogen.
Der Preis für verkaufte Eier an Sammelstellen stieg im Berichtsjahr um 0,32 Rp.auf 23,44 Rp.je Stück.Er liegt somit 2 Rp.je Ei über dem in der Vergangenheit tiefsten Niveau des Jahres 2000.Seit 1990 nimmt der Pouletpreis stetig ab.Dies dürfte vor allem mit den sinkenden Futtermittelkosten zusammenhängen.

Infolge der höheren Produzentenpreise für Rindfleisch nahmen auch die Konsumentenpreise gegenüber dem Vorjahr zwischen Fr.1 bis 3.– je kg zu.Der seit Jahren steigende Preistrend für Fleischwaren und frische Inlandpoulets hat sich bestätigt.Stabil blieben hingegen die Konsumentenpreise beim Schweinefleisch.Für alle untersuchten Fleischstücke mussten die Konsumentinnen und Konsumenten in den letzten drei Jahren zwischen 1 und 32% mehr pro kg bezahlen als im Mittel der Jahre 1990/92.Im Gegensatz dazu sanken die Produzentenpreise im Mittel zwischen 15 und 52% je kg SG.
Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung stieg 2002 bei allen untersuchten Fleischkategorien im Mittel um 4 bis 11 Prozentpunkte.Gegenüber der Basisperiode Februar bis April 1999 weist Schweinefleisch mit 31,4% den stärksten Zuwachs auf.Die Bruttomarge bei Rindfleisch (17%),bei Lammfleisch (16%),bei Kalbfleisch (15%) sowie beim Warenkorb aus mehreren Frischfleischsorten,Fleischund Wurstwaren (16%) liegt ebenfalls deutlich über der Basisperiode.Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Lammfleisch auf,dessen Index sich zwischen 101 und 128,1 Punkten bewegte.
■ Wettersituation: wechselhaft mit vielen Niederschlägen
Nach der trockenkalten Witterung stiegen ab Mitte Januar die Temperaturen für die Jahreszeit auf milde Werte an.Im Februar fielen überdurchschnittliche Niederschlagsmengen.Auf milde Frühlingsmonate mit mässigen Niederschlägen folgte ein regenreicher Mai.Relativ trockene und sonnige Witterung führte zu einem insgesamt sehr warmen Juni.Die Temperaturen der folgenden Sommermonate entsprachen in etwa dem langjährigen Mittel.Im Juni und Juli unterschieden sich die Niederschlagsmengen regional beträchtlich.Der August war sonnig,aber regenreich.Der Herbst begann im September mit kühlen Temperaturen und häufigen Niederschlägen.Bezogen auf das langjährige Mittel waren der Oktober und November bei milden Temperaturen von Niederschlägen geprägt.Im Mittelland lagen die Niederschlagsmengen im Oktober um 85% und im November um 124% über dem langjährigen Mittel.Insbesondere im Kanton Graubünden und auf der Alpensüdseite führten die extremen Niederschlagsmengen durch Rutschungen und Überschwemmungen zu grossen Schäden.Der Dezember wies bei gängigen Niederschlagsmengen überaus milde Temperaturen auf, doch lag die Sonnenscheindauer auf der Alpennordseite weit unter dem Mittel.
■ Produktion:Mehr Gemüse,weniger Weizen und weniger Wein
Die Reduktion der Getreideanbaufläche wurde durch die übrigen Kulturen nicht vollumfänglich wettgemacht,weshalb gegenüber dem Vorjahr eine Reduktion der offenen Ackerfläche um 0,9% resultierte.Die Anbaufläche von Futtergetreide sank 2002 gegenüber 2001 um rund 7%.Die Ausdehnung der Anbaufläche von Triticale konnte die Reduktion von Gerste und Körnermais nicht kompensieren.Die Kulturfläche der Hülsenfrüchte nahm durch die Flächenausdehnung der Eiweisserbsen um einen Drittel zu.Die Flächenanteile sämtlicher Ölsaaten stiegen an,wobei sich die Soja-Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr verdreifachte.

Total 287 634 ha
Silo- und Grünmais 14% 40 202 ha
Freilandgemüse 3% 8 437 ha
Raps 5% 15 310 ha
Zuckerrüben 6% 18 175 ha
übrige Kulturen 7% 18 568 ha
Getreide 60% 173 482 ha
Kartoffeln 5% 13 460 ha

Quelle: SBV
Auf einer Fläche von 23’848 ha oder 2,2% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 15’014 ha Reben,6’663 ha Obstanlagen und 276 ha Strauchbeeren.
Es wurde noch nie soviel Gemüse angebaut wie im Berichtsjahr.Die von der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG) erhobene Fläche (inkl.Mehrfachanbau pro Jahr) betrug 13'500 ha.Der Anbau von Gemüse wurde im Vergleich zum Vorjahr um 800 ha gesteigert.Die grössten Flächenzuwachsraten waren bei den Gewächshauskulturen und beim Saisongemüse zu beobachten.Sie nahmen gegenüber 2001 um 21% bzw.um 11% zu.Zwiebel hatte die grösste Flächenzunahme (+143 ha).Es folgten auf den nächsten Plätzen Lauch,Lollo und Eisbergsalat mit je rund 100 ha.
Die Fläche der Apfelanlagen betrug 2002 noch 4’565 ha.Trotz den Zunahmen bei den Sorten Gala,Braeburn,Topaz und Pinova um 86 ha ging die Fläche der Apfelanlagen 2002 gegenüber 2001 insgesamt um 140 ha zurück.Die Fläche der Birnenanlagen betrug 2002 wie im Jahr zuvor 940 ha.Die Steinobst- und die Beerenkulturen sind weiterhin im Trend und deren Flächen nahmen wiederum um einige ha auf 1’260 ha, bzw.auf 635 ha zu.
Entwicklung der Altersstruktur von Apfelanlagen
1–56–1011–15 Anlagealter in Jahren
16–2021–25>25
1990/931999/2002
Quelle: BLW
58% der Apfelanlagen waren jünger als zehn Jahre.Der Anteil der jungen Anlagen konnte während den letzten zehn Jahren um einige Prozent erhöht werden.Bei den Birnen betrug der Anteil der jungen Anlagen zwischen 1 und 10 Standjahren 39%.Die Alterstruktur hat sich im letzten Jahrzehnt auch bei den Birnen um einige Prozente zugunsten der Junganlagen verschoben.
Die Rebfläche betrug im Berichtsjahr 15'014 ha,das sind 72 ha weniger als ein Jahr zuvor.Davon waren 6'965 ha (–90 ha) mit weissen und 8'049 ha (+18 ha) mit roten Sorten bepflanzt.
Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte
1990/92200020012002
Produkte (Erträge 2002)
Winterweizen (61,8 dt/ha)
Kartoffeln (390,9 dt/ha)
Raps (33,9 dt/ha)
Gerste (65,1dt/ha)
Zuckerrüben (782,4 dt/ha)
Quelle: SBV
Im Berichtsjahr stiegen die mittleren Erträge der bedeutendsten Ackerkulturen gegenüber 2001 an.Ein sehr hoher mittlerer Gerstenertrag von 65 dt je ha zeigt,dass die Witterungsbedingungen insgesamt günstig waren.Offenbar wurden durch die Reduktion der Anbaufläche weniger produktive Standorte nicht mehr genutzt.Der Anteil Sommergerste an der geernteten Gerstenmenge betrug rund 5%.Trotz der widrigen Erntebedingungen konnte die Zuckerproduktion im Berichtsjahr auf 221’865 t gesteigert werden.Zu diesem guten Resultat trug die Ausdehnung der Zuckerrüben-Anbaufläche um 418 ha (+2%) auf 18’175 ha bei.Die Kartoffelernte konnte unter optimalen Bedingungen in kurzer Zeit eingebracht werden.Alle Sorten waren in genügender Menge vorhanden,doch wiesen die Kartoffelknollen eine unterdurchschnittliche Grösse auf.
Obwohl die Getreideanbaufläche im Berichtsjahr um 3% abnahm,stieg infolge höherer Erträge die gesamte Getreideproduktion auf 1,081 Mio.t an.Ende Juli verzögerte eine Schlechtwetterperiode die Weizenernte.In der Folge trat bei rund 15% der gesamten Weizenernte Auswuchs auf,was Qualitätsminderungen nach sich zog. Insgesamt tendieren die Landwirte zum Anbau von Brotgetreide,was sich bei einer Grossernte auf die Produzentenpreise auswirken könnte.
Trotz Frost,Hagel und viel Niederschlag gab es bei Gemüse und Obst 2002 im Allgemeinen gute bis sehr gute Ernten.Es wurden 309'000 t Gemüse und 133'000 t Tafelobst geerntet.Diese Mengen waren beachtliche 16% bzw.12% höher als im Vorjahr.Die Zunahmen waren insbesondere bei den Blattsalaten und beim Steinobst auffallend gross.
Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten,die in der Schweiz angebaut werden können,waren mit 522'000 t bzw.183'000 t wesentlich grösser als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre (Gemüse +8%,Tafelobst +7%).Beim Gemüse trug die Inlandmenge (+12%) wesentlich stärker zur Volumensteigerung bei als die Importmenge (+3%).Der Anteil Schweizer Gemüse am Marktvolumen konnte somit um 2% auf 59% gesteigert werden.Bei Obst erfolgten die Zunahmen der Inland- und der Importmenge gleich stark.Der Anteil Schweizer Obst am Marktvolumen betrug 73%.
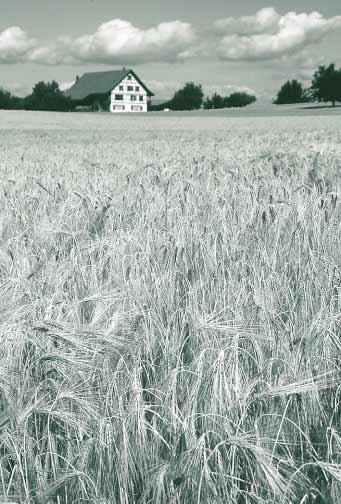
Tafelkirschen: Saisonaler Ernteverlauf
1991/941999/2002
Die Ernten von Steinobst und von Beeren unterliegen einem saisonalen Verlauf.Die beiden Abbildungen über die Verteilung der Erntemengen zeigen,dass in den letzten zehn Jahren die Ernteperioden von Tafelkirschen und von Himbeeren nicht verlängert werden konnte.Im Gegensatz zu den Tafelkirschen hatte sich jedoch bei den Himbeeren der Ernteverlauf verändert.Im Herbst werden heute deutlich mehr Himbeeren geerntet.
Die aufgrund der schwierigen Lage auf dem Weinmarkt verfügten Mengenbeschränkungen für die Ernte 2002 – insbesondere diejenigen in den drei grossen Weinbaukantonen Wallis,Waadt und Genf – haben ihre Wirkung gezeigt.Die Gesamternte für das Jahr 2002 betrug 111,3 Mio.Liter (minus 6,1 Mio.Liter gegenüber dem Vorjahr).Davon waren 56,6 Mio.Liter weisser und 54,7 Mio.Liter roter Traubenmost. Die durchschnittlichen Erträge bei den europäischen Reben,das heisst ohne die Direktträger,betrugen 81,5 hl pro ha bei den weissen und 68,3 hl pro ha bei den roten Traubensorten.Sie liegen somit deutlich tiefer als die vom Bundesrat in der Weinverordnung festgelegten Höchsterträge von 112 und 96 hl pro ha.
■ Verwertung: Mostobsternte unter dem Durchschnitt der vier Vorjahre
Die unterdurchschnittliche Grösse der geernteten Kartoffeln führte 2002 zu einem Mangel an grossknolligem Veredelungsrohstoff.Zudem wurde die Qualität vieler Posten von Veredelungskartoffeln beanstandet,da die Backfähigkeit aufgrund tiefer Stärkegehalte teilweise für die Herstellung von Pommes Chips und Pommes Frites nicht ausreichte.Zu Mindererträgen kam es auch bei der Pflanzkartoffelvermehrung.Die warme Witterung im Frühjahr führte zu einer starken Vermehrung der Blattläuse.Diese verbreiten durch das Saugen von Pflanzensäften Kartoffelviren.Der vergleichsweise schlechte Gesundheitszustand vieler Knollen erforderte eine Verwertung ausserhalb der Gewinnung von Vermehrungsmaterial.
Nach den Gesetzmässigkeiten der Alternanz war im Berichtsjahr mit einer grösseren Mostobsternte zu rechnen.Die eingebrachte und in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 115’600 t und jene der Mostbirnen 16’300 t.Gemessen an der Vorernteschätzung des SBV verzeichnete die eingebrachte Ernte bei den Mostäpfeln ein Minus von 25% und bei den Mostbirnen ein Minus von 51%.Die Mostapfelernte 2002 erreichte trotzdem einen Deckungsgrad von 147%,gemessen am Jahresbedarf von 78‘700 t.Die Birnenernte überstieg den Jahresbedarf (15‘700 t) hingegen nur um 4%.Der seit dem Jahr 2000 bei den ungegorenen Obstsaftgetränken verzeichnete Aufwärtstrend beim Getränkeausstoss konnte im Berichtsjahr noch leicht ausgebaut werden.
■ Aussenhandel:Tiefer Selbstversorgungsgrad bei pflanzlichen Fetten und Ölen
Im Inland werden für die Ölgewinnung Raps,Sonnenblumen und Soja kultiviert.Der Selbstversorgungsgrad mit pflanzlichen Ölen und Fetten beträgt rund 20%.Geprägt wird der Speise- und Futterölmarkt vom Sonnenblumenöl,wovon zur Bedarfsdeckung 90% importiert wird.Rapsöl stammt zumeist aus inländischer Erzeugung,hingegen deckt das Sojaöl aus heimischer Produktion lediglich 2% des Bedarfs.Je nach Preissituation auf dem Weltmarkt lassen sich die Öle für Verarbeitungszwecke teilweise substituieren.

Die Schweiz hat sich im Rahmen der GATT/WTO-Übereinkommen verpflichtet,einen minimalen Marktzutritt für Kartoffeln von 5% zuzulassen.Der Marktzutritt wird in Form des Zollkontingentes Nr.14 gewährt,welches in sechs Schritten erhöht wurde und seit dem Jahr 2000 auf 22’250 t Kartoffeln festgesetzt ist.Diese Menge entspricht 5% des damals auf 445'000 t geschätzten Marktvolumens.Inzwischen ist der Inlandverbrauch zurückgegangen und wird heute auf 350'000 t geschätzt.Diese Menge setzt sich aus 30'000 t Pflanzkartoffeln,180'000 t Speisekartoffeln und 140'000 t Veredlungskartoffeln zusammen.Die Schweiz gewährt heute somit einen minimalen Marktzutritt von etwas über 6%.Seit 1998 übertrafen die zum Kontingentszollansatz eingeführten Kartoffelmengen den geforderten Mindestmarktzutritt.Das Zollkontingent musste jedes Jahr vorübergehend erhöht werden,um die Marktversorgung zu gewährleisten.Begründet wurde der Mehrbedarf grösstenteils mit zu geringen Erntemengen im Inland sowie ungenügender Qualität inländischer Pflanz- und Veredelungskartoffeln.
■ Verbrauch: Rapsöl im Trend
Im Jahr 2002 wurden 214'000 t Frischgemüse und 51'000 t Frischobst in die Schweiz eingeführt.Das waren 3% mehr Gemüse und 6% mehr Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre.Die Exportmengen waren mit 400 t Gemüse und 1’000 t Obst in den gleichen Grössenordnungen wie in den Vorjahren.In diesen Mengen sind die Gemüseund Obstarten enthalten,welche in der Schweiz angebaut werden.
Die Einfuhren an Trinkwein (inkl.Einfuhren zum Ausserkontingentszollansatz) betrugen im Berichtsjahr total 161,1 Mio.Liter.Davon waren 137 Mio.Liter Rotwein und 24,1 Mio.Liter Weisswein.Dazu kommen noch 12,4 Mio.Liter Schaumweine,8,3 Mio.Liter Verarbeitungsweine und 1,7 Mio.Liter so genannte Süssweine.Gegenüber 2001 ist ein Rückgang von 5,2 Mio.Liter beim Rotwein festzustellen,hingegen haben die Einfuhren an Weisswein erneut zugenommen und zwar um 1,6 Mio.Liter.Auch beim Schaumwein kann eine leichte Zunahme der Einfuhren festgestellt werden (+0,2 Mio.Liter). Die Exporte an Schweizer Wein sind rückläufig und betrugen für das Berichtsjahr nur noch 586'000 Liter.
Der inländische Ölsaatenmarkt wird von der Nachfrage nach Speiseöl, Öl zu Futterzwecken und nach eiweissreichen Presskuchen geprägt.Rapsöl weist für die menschliche Ernährung ein günstiges Fettsäuremuster auf.Durch die positiven physiologischen Eigenschaften und intensiven Informationsbemühungen fand Rapsöl zunehmend Verwendung in der Schweizer Küche.Sojaöl hat durch den grossflächigen Anbau genetisch veränderter Sorten im Ausland eine Imageeinbusse erlitten und wird im Inland nur noch in geringem Umfang zu Speisezwecken nachgefragt.Vom importierten Sojaöl sind über 90% für Futterzwecke bestimmt,währenddem vom importierten Sonnenblumenöl lediglich 0,5% über die Tierhaltung veredelt werden.Für die Futtermittelindustrie ist die Fettqualität – Gehalt an ungesättigten Fettsäuren – der eiweissreichen Presskuchen für die Verwendung in Futtermitteln limitierend.Im Inland anfallende Presskuchen weisen gegenüber importierten Extraktionsschroten ein ungünstigeres Fett-Eiweissverhältnis auf,wodurch sich die Verwendungsmöglichkeiten für eine ausgewogene Futterration vermindern.Bei Sonnenblumen und Raps wirkt sich die Nachfrage nach Presskuchen und bei Soja die Nachfrage nach Speiseöl mit höherer Wertschöpfung limitierend auf den inländischen Anbau aus.
Im April 2002 verunsicherten die Erkenntnisse schwedischer Forscher die Konsumentinnen und Konsumenten von Kartoffelprodukten.Sie hatten festgestellt,dass sich durch starkes Erhitzen stärkehaltiger Lebensmittel Acrylamid bilden kann.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Acrylamid als möglicherweise krebserregende Substanz.Negativ in die Schlagzeilen gerieten vor allem frittierte Verarbeitungsprodukte und gebratene Gerichte aus Kartoffeln.Schweizerische Forschungsarbeiten zum Thema Acrylamid werden vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) koordiniert.Eine Studie der Universität Lausanne vom Juni 2003 schreibt Acrylamid keine erhöhte kanzerogene Wirkung zu.Die Eidgenössischen Forschungsanstalten werden nach verschiedenen Voruntersuchungen im Jahre 2004 ein umfassendes Projekt starten,um die Einflussfaktoren zur Bildung von Acrylamid zu untersuchen.
■ Produzentenpreise:
Stabile Erlöse im Ackerbau
In der Schweiz wurde 2002 wieder mehr Gemüse und Obst konsumiert.Der Pro-KopfKonsum betrug 72 kg frisches Gemüse und 25 kg Tafelobst (ohne tropische Früchte). Gegenüber dem Vierjahresmittel 1998/2001 wurden 1 kg mehr Gemüse und 4 kg mehr Obst gegessen.
Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug im Weinjahr 2001/02 noch zirka 280 Mio.Liter.Der Verbrauch lag somit um rund 5,7 Mio.Liter tiefer als im Vorjahr.Während der Konsum an ausländischem Rotwein rückläufig ist (–6,2 Mio.Liter),nahm derjenige an Schweizer Rotwein leicht zu (+0,5 Mio.Liter).Beim Weisswein blieb der Konsum an ausländischen Provenienzen stabil (–0,1 Mio.Liter), derjenige von Schweizer Weinen nahm um rund 0,2 Mio.Liter zu.Der Marktanteil von Schweizer Wein stieg um etwas mehr als 1% und lag 2002 bei 42,2%.Beim Weisswein blieb der Anteil konstant bei rund 76% während er beim Rotwein um 1% auf 30% stieg.Der Gesamtverbrauch an Wein,das heisst inkl.dem Verarbeitungswein betrug 288,3 Mio.Liter,wovon 69% auf Rotweine entfielen.
Entwicklung der Produzentenerlöse für Ackerprodukte
1990/92200020012002
Produzentenpreise 2002
Weizen Kl. I, 56.63 Fr./dt Zuckerrüben, 11.64 Fr./dt Raps, 78.56 Fr./dt
Gerste, 44.88 Fr./dt Kartoffeln, 34.94 Fr./dt
Quelle: FAT
Die Produzentenerlöse der wichtigsten Ackerkulturen konnten 2002 das Niveau vom Vorjahr weitgehend halten.Infolge der Rekordproduktion an inländischem Zucker mit Quotenüberträgen aufs Zuckerjahr 2003 fiel der mittlere Produzentenerlös auf 11.64 Fr. je dt.Die Angebotsausdehnung von Brotroggen übte im Berichtsjahr Druck auf die Produzentenpreise aus.Im Frühjahr 2003 deklassierte der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) 7'700 t Roggen zu Futterware,um die Preise zu stützen. Aufgrund des Auswuchses bei Weizen ergab sich ein knappes Angebot an inländischem Brotweizen mit leicht höheren Preisen.
Bei Gemüse und Obst führte das hohe Angebot dazu,dass die Produzenten im Jahr 2002 pro kg meist etwas weniger lösten als im Vorjahr.Der durchschnittliche Gemüsepreis (verpackt,franko Grossverteiler) betrug 2.36 Fr.je kg.Dieser Wert lag 4% tiefer als im Vorjahr und 6% höher als in den drei Vorjahren.Im Obstbereich waren besonders die Kirschenpreise erfreulich:sie blieben trotz mengenmässig guten Ernten aber dank ausgezeichneter Qualitäten auf Vorjahreshöhe.
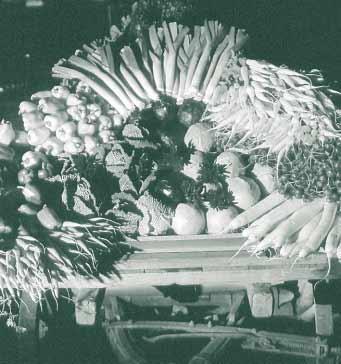
Das Beispiel von Lollo rot zeigt wie sich die Angebotsmengen auf die Preise und die Erlöse auswirken.Im Berichtsjahr wurde mit 3'200 t 37% mehr Schweizer Ware angeboten als im Vorjahr.Der Schweizer Preis sank dadurch von durchschnittlich Fr.4.20 im Jahre 2001 auf Fr.3.20 je kg im Berichtsjahr.Dies entspricht einer Preissenkung von 24%.Der Erlös konnte somit lediglich um 6% von 8,8 auf 9,3 Mio.Fr. gesteigert werden.Die Importmengen spielten in beiden Jahren nur eine untergeordnete Rolle.Die Marktanteile der Importware waren 4% im Jahr 2002 bzw.8% im Vorjahr.

1 Addierte Konsumentenpreise (unabhängig der Inland- und der Importware) von Auberginen (250 g), Champignons (250 g), Fenchel (500 g), Karotten (1 kg), Blumenkohl (1 kg), Chinakohl (350 g), Weisskabis (500 g), Krautstiel (250 g), Lauch grün (250 g), Peperoni (200 g), Knollensellerie (600 g), Tomaten rund (2 kg), Zucchetti (600 g), Speisezwiebeln (500 g), Brüsseler Witloof (500 g), Gurken (1 kg), Kopfsalat (1 Stück), Radieschen (2 Bund), Kartoffeln (2,5 kg), Äpfel (1 kg), Orangen (1 kg), Bananen (1 kg), Kiwi (4 Stück), Trauben (1 kg).
Der Warenkorb Früchte und Gemüse hat im Berichtsjahr einen markanten Teuerungsschub von 4,3% erfahren.Besonders hohe Konsumentenpreise wurden im ersten Quartal beobachtet,welche um mehr als 30% höher lagen als 2001.Fröste und Nässe in den Herkunftsländern haben die Ernten deutlich geschmälert und zu europaweiten Preishaussen geführt.Nur gerade im Juli lagen die Preise unter dem Mittelwert der Jahre 1998–2001.
Die deutlich besseren Witterungsbedingungen im Berichtsjahr verglichen mit dem Vorjahr haben für eine leicht frühere und mengenmässig bessere Kirschenernte gesorgt.Die Inlandernte der Tafelkirschen erhöhte sich um 60% auf 2'045 t,während die Importe (nur Sommersaison) um 8% zunahmen.Der Anteil Inlandware an der Gesamtmenge stieg um 10 Prozentpunkte auf 63%.Dies schlug sich sowohl im Einstandspreis (–2,4%) als auch im Konsumentenpreis (–4%) nieder.Die Bruttomarge sank um 25 Rp.auf 4.13 Fr.je kg.

■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt,dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können,die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme.Eine sektorale Beurteilung basiert auf der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR),welche vom BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV erstellt wird (vgl.Abschnitt 1.1.3).Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der FAT (vgl.Abschnitt 1.1.4).
■ Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: Revidierte Methodik
Im Rahmen des Projekts SAKO-1 (Satellitenkonten des Primärsektors) hat das BFS in enger Zusammenarbeit mit dem SBV die LGR revidiert.Mit der Revision wird sichergestellt,dass die Ergebnisse wieder direkt mit jenen der EU vergleichbar sind.
Bei der Revision handelt es sich um eine umfassende Weiterentwicklung.Deshalb können die Ergebnisse nicht mit jenen der Vorjahre verglichen werden,wie sie in den Agrarberichten 2000–2002 publiziert worden sind.Um trotzdem Aussagen über die Entwicklung machen zu können,wird die neue Methode auch auf vergangene Jahre angewandt.Bis heute liegen die Resultate 1997–2003 (2003 als Schätzung) vor.Für den Agrarbericht 2004 ist geplant,die LGR ab 1990 nach neuer Methodik darzustellen. Es können zwei Arten von Anpassungen unterschieden werden.Erstens wurden methodische Änderungen im klassischen Sinn vorgenommen.Dazu gehören die Neudefinition der Preise,mit deren Hilfe die Produktionsleistungen der Landwirtschaft bewertet werden sowie die Abkehr vom Bundeshofkonzept.Das bedeutet,dass in der neuen LGR nicht mehr nur der Austausch zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft erfasst wird.Neu werden auch inner- und zwischenbetriebliche Waren- und Dienstleistungsflüsse bewertet.Die zweite Gruppe von Änderungen bezieht sich auf Anpassungen bezüglich der erfassten Grundgesamtheit und die berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen.Zu den wichtigsten gehört,dass neu auch der Gartenbau, landwirtschaftliche Dienstleistungen und direkt mit der Landwirtschaft verbundene nicht landwirtschaftliche Nebentätigkeiten erfasst werden.
Begriffe und Methoden,Seite A73
Die Anpassungen sind im Anhang ausführlicher beschrieben.Anhand eines Beispiels wird auch aufgezeigt,wie sich diese quantitativ auswirken.
Im Jahr 2002 betrug das Nettounternehmenseinkommen des landwirtschaftlichen Sektors 3,242 Mrd.Fr.Im Vergleich zu den Jahren 1999/2001 war es rund 1% tiefer. Ein entscheidender Faktor auf der Kostenseite waren die um 229 Mio.Fr.(+4%) höheren Ausgaben für die Vorleistungen.Der Ausbau bei den sonstigen Subventionen (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen) um 196 Mio.Fr.(+8,3%) konnte auf der Erlösseite die Kostenzunahme bei den Vorleistungen nicht ganz ausgleichen.
Gegenüber dem Jahr 2001 stieg der Wert des Nettounternehmenseinkommens um 146 Mio.Fr.(+4,7%).Das höhere Einkommen des Sektors im Jahr 2002 im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf Zunahmen bei der Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs um 188 Mio.Fr.(+1,8%) und bei den sonstigen Subventionen um 100 Mio.Fr.(+4,1%) zurückzuführen.Diese Verbesserungen waren insgesamt grösser als die Steigerung bei den Kosten.Dort standen einem höheren Wert bei den Vorleistungen von 159 Mio.Fr.(+2,7%) tiefere Arbeitnehmerentgelte von 27 Mio.Fr. (–2,4%) gegenüber.Die übrigen Kostenpositionen blieben in etwa gleich.
Beim Sektoreinkommen zeigen sich die Schwankungen der landwirtschaftlichen Einkommen in den letzten Jahren.Einem Rückgang 1999 gegenüber 1998 folgte ein Anstieg im Jahr 2000.Im Jahr 2001 fielen die Einkommen erheblich zurück und legten 2002 wieder zu.Gemäss den Schätzungen für das Jahr 2003 dürfte das Einkommen des Sektors wieder deutlich fallen und zwar auf den tiefsten bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Wert der Zeitreihe.
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen,in Mio.Fr.
1Stand 1.9.2003.Aufgrund der erstmals angewandten neuen Methodik sind die Werte noch nicht definitiv
2Provisorisch,Stand 1.9.2003
3Schätzung,Stand 1.9.2003
4wird in der Literatur und in der Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet
Erzeugung des
Ausgaben (Vorleistungen, sonstige Produktionsabgaben, Abschreibungen, Arbeitnehmerentgelt, gezahlte Pachten, gezahlte Zinsen abzüglich empfangene Zinsen)
1 Stand 1.9.2003. Aufgrund der erstmals angewandten neuen Methodik sind die Werte noch nicht definitiv
Quelle: BFS

■ Schätzung des SektorEinkommens 2003
Der Sommer 2003 war geprägt durch Hitze und Trockenheit.Neben den landwirtschaftlichen Kulturen in der Westschweiz und in weiten Teilen des Mittellandes litten auch die Kulturen in den Kantonen Schaffhausen,Graubünden und Tessin.
Die Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes 2003 liegt mit 9,902 Mrd.Fr.um 6,2% tiefer als das Dreijahresmittel 2000/02.Geringere Einnahmen aus der pflanzlichen Produktion als Folge der lang anhaltenden Trockenheit haben zu diesem Ergebnisgeführt.
Die pflanzliche Produktion (inbegriffen Gartenbau) wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 11,1% tiefer geschätzt (4,067 Mrd.Fr.).Das Getreide,die Kartoffeln und die Futterpflanzen ertrugen die trockenen Bedingungen besonders schlecht.
Die Getreideernte 2003 fiel qualitativ besser aber mengenmässig wesentlich kleiner aus als die Ernte 2002.Vor allem der Weizen und der Körnermais bekamen die für ihr Wachstum ungünstigen Witterungsverhältnisse zu spüren.Ein grosser Teil des Körnermaises wurde schon frühzeitig geerntet und als Silomais verwertet.Die Getreideernte 2003 wird deshalb um 20,8% unter dem Dreijahresmittel veranschlagt.
Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine mengenmässig und auch in Bezug auf den Zuckergehalt mittlere Ernte erwarten.Der Wert von Soja und Sonnenblumen wird dank einer Flächenausdehnung höher als im Vorjahr eingestuft.Der tiefere Rapsertrag lässt auf einen leicht tieferen Produktionswert schliessen.Insgesamt dürfte der Produktionswert der Handelsgewächse nur leicht unter dem Vorjahreswert zu liegen kommen.
Die Futterpflanzen haben besonders stark unter der Hitze und Trockenheit gelitten. Nach einer qualitativ und quantitativ guten Heuernte blieben die folgenden Schnitte in den von der Trockenheit betroffenen Regionen fast oder ganz aus.Der Produktionswert der Futterpflanzen,der auch in den Vorleistungen als Gegenbuchung erscheint,liegt dieses Jahr 23,2% unter dem Dreijahresmittel.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden beim Gemüse infolge der Trockenheit tiefere Erträge erzielt.Im Wert der Gemüseproduktion ist ebenfalls der Anteil der Pilzproduktion enthalten.Ganz Europa litt unter der Trockenheit,so dass die Preise in den Sommermonaten stark anstiegen.Sie dürften aufgrund der erwarteten kleineren Mengen beim Lagergemüse auf hohem Niveau verbleiben.Deshalb wird insgesamt mit einem guten Gemüsejahr gerechnet,vergleichbar mit 2002.Gegenüber dem Dreijahresmittel ist der Produktionswert 2003 um 4,8% höher.
Ein Teil des Gartenbaus ist neu ebenfalls Bestandteil der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung.Dazu zählt die Produktion der Baumschulen und der Betriebe im Zierpflanzenbereich einschliesslich der Weihnachtsbaumproduktion.Nicht dazu gehören die gartenbaulichen Dienstleistungen.Der Gartenbau steht nach einer Ausdehnungsphase in den neunziger Jahren seit 2001 unter Druck.Der Produktionswert für das Jahr 2003 wird deshalb tiefer als das Dreijahresmittel geschätzt.
Für die Kartoffeln wird bei einer um 3,5% grösseren Fläche als 2002 eine kleine und qualitativ schlechte Erntemenge angenommen.Der Speiseanteil wurde verglichen mit den Vorjahren noch nie so tief beurteilt.Die Preise werden sich an der oberen Grenze des Preisbandes bewegen.
Beim Obst kann dieses Jahr von einer unterdurchschnittlichen Ernte ausgegangen werden,die vergleichbar mit 1997 ist und 9,5% unter dem Dreijahresmittel liegt.In dieser Position sind neben dem Frischobst (Birnen, Äpfel,Steinobst und Beeren) auch die Weintrauben enthalten.
Der Produktionswert des Weinbaus wird teilweise beeinflusst durch die Vorräte aus den Vorjahren.Er wird für 2003 um 7,4% tiefer als der Dreijahresdurchschnitt geschätzt,der durch die beiden grossen Ernten 1999 und 2000 geprägt war.Es wird quantitativ ein kleinerer,aber dafür ein qualitativ guter bis ausgezeichneter Jahrgang erwartet.
Die tierische Produktion weist im Mehrjahresvergleich eine Abnahme von 3,2% aus.Die Schätzung geht davon aus,dass die Nutzvieh- und Schlachtviehproduktion um 1,7% ansteigt,der Wert aus der Produktion von Milch und Eiern hingegen um 7,3% abnimmt.Die Befürchtungen,dass die Preise der Schlachtkühe infolge der angespannten Lage im Milchmarkt und der Trockenheit unter Druck kommen,haben sich bis zum Zeitpunkt der Schätzungen nicht bewahrheitet.
Bei den Schweinen zeigte sich der Markt ausgeglichen.Wegen der abnehmenden Nachfrage sanken gegen Ende des Sommers erwartungsgemäss die Produzentenpreise.Die höhere Geflügelproduktion und die stabilen Preise lassen auf einen höheren Produktionswert als in den Vorjahren schliessen.
Der tiefere Produktionswert der Milch wurde durch die tieferen Preise und sinkende Milcheinlieferungen beeinflusst.Bei den Eiern wird mit höheren Preisen aber mit einer tieferen Produktion als im Vorjahr gerechnet.
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Dienstleistungen ist in dieser Form neu in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung.Sie wird für das Jahr 2003 auf 581 Mio.Fr. veranschlagt.Im Mehrjahresvergleich sind dies 2,2% mehr.Es wird damit gerechnet, dass die Arbeit der Lohnunternehmungen auf Vorjahresniveau bleibt,die Verpachtung von Milchkontingenten hingegen leicht ansteigt.
Die nicht trennbaren nicht landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten sind ebenfalls neu Bestandteil der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung.Sie werden auf 321 Mio.Fr.geschätzt.Gegenüber den Vorjahren dürfte der Wert damit um 1,2% sinken.Das ist vor allem auf die kleinere Verarbeitungsmenge von Mostobst zurückzuführen.Dienstleistungen wie Strassenrand- und Landschaftspflege,Haltung von Pensionstieren und Schlafen im Stroh,welche ausserhalb der landwirtschaftlichen Branche angeboten werden,dürften dagegen gegenüber dem Dreijahresmittel um 4,2% zunehmen.
Die Ausgaben für Vorleistungen werden für 2003 auf 5,777 Mrd.Fr.veranschlagt, 1,7% tiefer als der Dreijahresdurchschnitt.Hauptgrund dafür sind die geringeren Ausgaben für Futtermittel bedingt durch die kleine Raufutterernte.Diese innerbetrieblich erzeugten und verbrauchten Futtermittel werden in den Vorleistungen gegengebucht.Dagegen sind,trotz einer Abnahme der Mischfutterpreise,die Ausgaben für die aus der Futtermittelindustrie zugekauften Futtermittel gestiegen.Zur Kostensenkung trug ebenfalls das Saatgut bei.Vor allem im Bereich der Baumschulen und der Zierpflanzenproduktion wird bei tieferen Preisen ein Rückgang der Nachfrage nach Pflanzgut erwartet.
Bei der Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen wird im Mehrjahresvergleich mit einer Abnahme von 11,9% gerechnet.Die leicht tieferen Ausgaben für die Vorleistungen dürften den tieferen Produktionswert des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereiches nicht kompensieren.
Die Abschreibungen werden auf 2,010 Mrd.Fr.oder im Mehrjahresvergleich um 1,2% höher geschätzt.Die Abschreibungen werden stark von den in den Vorjahren getätigten Investitionen beeinflusst.
Die Zunahme der sonstigen Produktionsabgaben von 5,9% ist vor allem auf die Unterkompensation der Mehrwertsteuer zurückzuführen.Einerseits stiegen die Mehrwertsteuersätze im Jahr 2001 für Primärgüter von 2,3% auf 2,4% und für übrige Güter von 7,5% auf 7,6%.Andererseits gab es bei der Zusammensetzung der Vorleistungspositionen eine gewisse Verschiebung von den Positionen mit tiefem Mehrwertsteuersatz (Saatgut,Dünger,Futtermittel etc.) zu den Positionen mit hohem Mehrwertsteuersatz (Reparaturen und Unterhalt,andere Dienstleistungen).Zudem wurde mehr für Motorfahrzeug- und Stempelgebühren ausgegeben.
Die sonstigen Subventionen beinhalten alle Direktzahlungen (allgemeine und für Ökoleistungen erbrachte Entschädigungen),den berechneten Zins für zinslose öffentliche Darlehen (Investitionskredite,Betriebshilfe) und die übrigen kantonalen und von Gemeinden erbrachten Beiträge.Sie beinhalten nicht die Gütersubventionen,welche bereits im Produktionswert berücksichtigt wurden (z.B.Anbaubeiträge).Die sonstigen Subventionen dürften sich auf 2,527 Mrd.Fr.belaufen.Das ist eine Zunahme um 5,2% gegenüber dem Dreijahresdurchschnitt.Im Vergleich zum Vorjahr liegt dieser Wert jedoch um 0,8% tiefer.
Das Arbeitnehmerentgelt (= Angestelltenkosten) wird 2003 auf 1,075 Mrd.Fr. geschätzt.Dies ist um 4,3% tiefer als der Mehrjahreswert.Der besonders starke Rückgang von Angestellten in den Baumschulen und den Betrieben der Zierpflanzenproduktion (Verlagerung der Angestellten in gartenbauliche Dienstleistungen) erwies sich als stärker als die Zunahme der Lohnkosten (inkl.Sozialbeiträge) pro Jahresarbeitskrafteinheit.
Bei den gezahlten Pachten ist mit einer Abnahme um 2,1% gegenüber dem Dreijahresmittel zu rechnen.Die gezahlten Schuldzinsen werden um 3,5% höher veranschlagt.
Als Nettounternehmenseinkommen verbleiben 2,835 Mrd.Fr.,13% weniger als in den vorangegangenen Jahren.Gegenüber dem Vorjahr liegt der Wert auch um 13% tiefer.
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der FAT.Deren methodische Grundlagen wurden 1999 vollständig überarbeitet.Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren wie z.B.zur finanziellen Stabilität oder zur Rentabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe.Im Anhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt.Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen.Zudem wird der zweite Teil einer Arbeit des Instituts für Agrarwirtschaft der ETH Zürich zum Thema Performance der Schweizer Landwirtschaft präsentiert.

Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel alle Regionen 1990/921999200020012002
Im Jahr 2002 sind die wirtschaftlichen Ergebnisse leicht tiefer ausgefallen als im Jahr 2001.Im Vergleich zu den drei Vorjahren beträgt der Rückgang des landwirtschaftlichen Einkommens je Betrieb 10%.Der Rohertrag konnte gegenüber dem Wert von 1999/2001 um knapp 2% gesteigert werden.Beim Pflanzenbau sind tiefere Erlöse zu verzeichnen (–8%),was teilweise durch die Witterungsverhältnisse,aber auch durch die gesunkenen Preise zu erklären ist.Der Rohertrag aus der Tierhaltung blieb praktisch stabil.Trotz der Krise in der Milchbranche nahmen die Erlöse aus der Milch im Vergleich zu den drei Vorjahren leicht zu (+2,3%).Tiefere Ergebnisse gab es bei der übrigen Rindviehhaltung (–16%).Ein Hauptgrund dafür ist die Bewertungskorrektur bei den Beständen aufgrund der Marktsituation beim Schlacht- und Nutzvieh.Schweine- und Geflügelhaltung weisen höhere Werte aus (+3,8% resp.+14,1%).Dies ist vor allem auf eine Bestandesausdehnung zurückzuführen.Die Direktzahlungen waren 12,8% höher als in den drei Vorjahren.Neben dem betrieblichen Wachstum (Fläche +3,3%, Tiere +2,5%) trugen Anpassungen im Direktzahlungssystem und Umstellungen auf geförderte Produktionsformen zu diesem Anstieg bei.Die Fremdkosten lagen im Jahr 2002 um rund 6% über dem Dreijahreswert 1999/2001.Ein Teil der Kostensteigerung lässt sich auch hier durch das betriebliche Wachstum erklären.Gestiegen sind vor allem die Kosten für Futtermittel (+10,4%),Gebäude (+14,2%) sowie die allgemeinen Betriebskosten (+9,5%).Abgenommen haben die Personalkosten (–4,4%).
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten.Im Jahr 2002 lag es leicht tiefer als 2001.Ohne die Bewertungskorrektur beim Rindvieh wäre es leicht höher ausgefallen.Das landwirtschaftliche Einkommen entschädigt einerseits die Arbeit der durchschnittlich 1,3 Familienarbeitskräfte und andererseits das im Betrieb durchschnittlich investierte Eigenkapital von etwas über

Das landwirtschaftliche Einkommen war 2002 gegenüber 1999/2001 in der Talregion um 6%,in der Hügelregion um 11% und in der Bergregion um 14% tiefer.In der Tal(–4%) und in der Hügelregion (–7%) war ebenfalls das Nebeneinkommen rückläufig. In der Bergregion hingegen erhöhte sich dieses um 8%.Das Gesamteinkommen lag damit 2002 in der Talregion um 6%,in der Hügelregion um 10% und in der Bergregion um 8% unter dem Durchschnitt der Jahre 1999/2001.
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Regionen
Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2002 17% in der Talregion,24% in der Hügelregion und 42% in der Bergregion.Damit liegt der Anteil in allen drei Regionen etwas höher als 1999/2001,was vor allem auf die gestiegene Direktzahlungssumme im Jahr 2002 zurückzuführen ist.
Die Einkommenssituation in den 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) zeigt erhebliche Differenzen auf.
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 2000/02
Im Durchschnitt der Jahre 2000/02 erzielten die Ackerbau-,Spezialkultur- und bestimmte kombinierte Betriebe (Verkehrsmilch/Ackerbau,Kombiniert Veredlung) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen.Zusammen mit den kombinierten Mutterkuhbetrieben erwirtschafteten diese auch die höchsten Gesamteinkommen.Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen «Pferde,Schafe,Ziegen» sowie «anderes Rindvieh»
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte.Gegenüber dem Dreijahresmittel 1999/2001 hat sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) im Jahr 2002 um 10% verschlechtert.Im Vergleich zum Jahr 2001 ist er auf demselben Niveau geblieben.
Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich.Im Durchschnitt liegt er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion.Auch die Quartile liegen weit auseinander.So erreichte 2000/02 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 23% und derjenige im vierten Quartil 196% des Mittelwertes aller Betriebe der Region.In den anderen Regionen sind die Streuungsbandbreiten ähnlich.
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 2000/02: nach Regionen und Quartilen

Arbeitsverdienst 1 in Fr.pro FJAE 2
1Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen:2000:3,95%;2001:3,36%;2002:3,22% 2Familien-Jahresarbeitseinheiten:Basis 280 Arbeitstage Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
In der Tal- und Hügelregion übertraf bzw.erreichte 2000/02 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung.In der Bergregion lag der mittlere Arbeitsverdienst im vierten Quartil rund 9'000 Fr.unter dem Vergleichswert.
Vergleichslohn 2000/02,nach Regionen

1Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten Quellen:BFS,FAT
Zieht man das Nebeneinkommen mit in die Beurteilung ein,sieht die Situation der landwirtschaftlichen Haushalte deutlich besser aus,als der alleinige Vergleich von Arbeitsverdienst mit Vergleichslohn erscheinen lässt.Die durchschnittlichen Nebeneinkommen lagen 2000/02 bei rund 19'000 Fr.
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens.Kombiniert man diese Kennzahl mit der Grösse der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen.Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält –finanziell nicht existenzfähig.
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt.
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit ... Fremdkapitalquote
Tief (<50%)Hoch (>50%)
Positiv...guter...beschränkter finanEigenkapitalbildung finanzieller Situationzieller Selbständigkeit
Negativ...ungenügendem ...bedenklicher
Einkommenfinanzieller Situation
Quelle:De Rosa
■ Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild.Knapp die Hälfte der Betriebe befindet sich in einer finanziell guten Situation und etwas über 30% sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung).Im Vergleich zu 1999/2001 hat sich die Situation in den drei Regionen leicht verschlechtert.
Beurteilung der finanziellen Stabilität 2000/02: nach Regionen
bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle
Die Investitionen der FAT-Referenzbetriebe haben im Jahr 2002 im Vergleich zu 1999/2001 leicht abgenommen (–2,4%).Gleichzeitig ist auch der Cashflow gesunken (–3,2%).Entsprechend hat sich das Cashflow-Investitionsverhältnis nur wenig verändert (–1,4%).Die Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen minus Privatverbrauch) ist wesentlich tiefer als in der Referenzperiode (–51%).Die Fremdkapitalquote hat sich hingegen nicht verändert.
Entwicklung von Eigenkapitalbildung,Investitionen und Fremdkapitalquote
1 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2 Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
Die Entwicklung der Kosten auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb wird anhand der Ergebnisse der Zentralen Auswertung einerseits pro Betrieb und andererseits pro ha dargestellt.

■ Kostenentwicklung pro Betrieb Entwicklung von Rohertrag und Fremdkosten pro Betrieb
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Die Fremdkosten sind in den neunziger Jahren um 14% gestiegen,der Rohertrag um 6%.Der stärkere Anstieg der Fremdkosten hat dazu geführt,dass die landwirtschaftlichen Einkommen in dieser Zeit um 11% abgenommen haben.
Entwicklung der Fremdkosten pro Betrieb
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Die Zunahme der Fremdkosten geht vor allem auf das Konto der Strukturkosten 1 (z.B. Kosten für Gebäude,Maschinen,allgemeine Betriebskosten).Daneben verzeichnen auch die Sachkosten der Tierhaltung einen Anstieg.Die Sachkosten Pflanzenbau und die Strukturkosten 2 (Personalkosten,Zinsen) haben dagegen abgenommen.
Veränderung 1990/92–2000/02 nach Kostengruppen pro Betrieb
Sachkosten Pflanzenbau
Sachkosten Tierhaltung
Arbeiten durch Dritte, Maschinenmiete
Anteil Autokosten
Maschinen, Geräte
Abschreibungen Pflanzen
Feste Einrichtungen Gebäude
■ Kostenentwicklung pro ha
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Eine weitere Untergliederung zeigt,dass fünf Positionen besonders stark zugenommen haben:Gebäudekosten,allgemeine Betriebskosten,Sachkosten Tierhaltung,Kosten für Maschinen und Geräte sowie Arbeiten durch Dritte (inkl.Maschinenmiete).Bei den Gebäudekosten sind die Abschreibungen hauptverantwortlich für die Zunahme.Abgenommen haben besonders stark die Schuldzinsen,etwas weniger stark die Personalkosten und die Sachkosten Pflanzenbau.
Die Referenzbetriebe sind zwischen 1990/92 und 2000/02 von 16,1 auf 19,1 ha um durchschnittlich 3 ha gewachsen.Wie sich dieses Wachstum auf die Kostenentwicklung ausgewirkt hat,zeigt die nachfolgende Analyse.
Entwicklung der Fremdkosten pro ha
1990/922000/02
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Die Betrachtung der Kostenentwicklung pro ha zeigt,dass nur die Strukturkosten 1 gewachsen sind.Die anderen Kostenpositionen waren 2000/02 tiefer als vor zehn Jahren.Dies gilt auch für das Total der Fremdkosten.Sie lagen 2000/02 um 4% unter dem Niveau von 1990/92.
Veränderung 1990/92–2000/02 nach Kostengruppen pro ha
Sachkosten Pflanzenbau
Sachkosten Tierhaltung Arbeiten durch Dritte, Maschinenmiete
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Die Betrachtung auf einer tieferen Ebene zeigt,dass pro ha nur die Gebäudekosten, die allgemeinen Betriebskosten sowie die Kosten für Arbeiten durch Dritte (inkl. Maschinenmiete) wesentlich gewachsen sind.
Insgesamt macht die Analyse deutlich,dass unter Berücksichtigung des Wachstumseffektes die Fremdkosten in der Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren nicht gestiegen sind.Festzuhalten gilt es aber,dass die Kosten nicht im selben Ausmass reduziert werden konnten,wie sich die Erlöse zurückgebildet haben.
Die Mittelflussrechnung zeigt für die Einheit Unternehmen/Haushalt sämtliche Zu- und Abflüsse finanzieller Mittel auf.Es lassen sich drei Bereiche unterscheiden.Im Umsatzbereich werden die Mittelzuflüsse aus der beruflichen Tätigkeit der Mitglieder des landwirtschaftlichen Haushalts (Mittelfluss Landwirtschaft und Mittelfluss betriebsfremd) sowie die Mittelabflüsse aufgrund des Privatverbrauchs des Haushalts erfasst.Aus der Differenz zwischen den beiden Grössen ergibt sich der Cashflow (Mittelfluss aus Umsatzbereich).Im Investitionsbereich werden die Mittelabflüsse festgehalten,die sich aus den betrieblichen Investitionen ergeben (inkl.Mittelzuflüsse aus Desinvestitionen).Vermag der erarbeitete Cashflow die Investitionen zu decken, ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss,ansonsten ein Finanzierungsmanko.Ein Finanzierungsmanko ist möglich,weil dem Betrieb neben dem Cashflow noch weitere Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen.Diese sind im Finanzierungsbereich festgehalten.Dieser erfasst die Mittelzuflüsse und -abflüsse,welche sich durch die Aufnahme respektive Rückzahlung von Fremdkapital und privatem Kapital der Haushaltmitglieder (Privater Ausgleich) ergeben.Der Saldo aus Umsatzbereich,Investitionsbereich und Finanzierungsbereich ergibt die Veränderung des Nettomonetären Umlaufvermögens (NMUV).

■ Mittelfluss Landwirtschaft und landwirtschaftliches Einkommen
Der Mittelfluss Landwirtschaft ist neben dem betriebsfremden Mittelfluss und den Privatausgaben eine Teilkomponente des Umsatzbereichs der Mittelflussrechnung.Zur Berechnung des Mittelflusses Landwirtschaft wird das landwirtschaftliche Einkommen um alle nicht liquiditätswirksamen Buchungen des Betriebs korrigiert (Abschreibungen,Veränderung von Vorräten und Tiervermögen,Selbstversorgung,kalkulierte Wohnungsmiete etc.).
Entwicklung von Mittelfluss und Einkommen
■ Umsatz- und Investitionsbereiche im Spiegel des Betriebszyklus
Der Mittelfluss Landwirtschaft schwankt über die Jahre weniger stark als das landwirtschaftliche Einkommen.Die stärkeren Schwankungen des landwirtschaftlichen Einkommens werden in erster Linie durch Inventarveränderungen des Tiervermögens und der Vorräte verursacht.Vor allem die steigenden Abschreibungen lassen die Differenz zwischen Mittelfluss und landwirtschaftlichem Einkommen grösser werden.
Sowohl die Höhe des Mittelflusses aus betrieblicher und betriebsfremder Beschäftigung als auch die Investitionstätigkeit sind abhängig vom Betriebs- und Familienzyklus.Die beobachteten Unterschiede lassen sich in einem hohen Ausmass durch das Alter erklären,da die Betriebe der vier dargestellten Altersklassen sich nur geringfügig bezüglich Grösse und Höhenlage unterscheiden.
Mittelfluss und Verwendung nach Altersklassen 1990/92
Mittelfluss und Verwendung nach Altersklassen 1999/2001
unter 3535–45 Jahre45–55 Jahre über 55 Jahre
Die Gruppe 35–45 Jahre erzielte 1999/2001 den höchsten Mittelfluss vor Privatausgaben.Der tiefere Mittelfluss vor Privatausgaben bei der jüngsten und ältesten Gruppe steht in engem Zusammenhang zu den Personalkosten,die bei diesen zwei Gruppen am höchsten sind.Eine Erklärung kann die verstärkte Mitarbeit der abtretenden Generation (vor Erreichen des AHV-Alters) in der Gruppe unter 35 Jahre und der erwachsenen Nachkommen in den Betrieben mit älteren Betriebsleitern sein.Diese werden heute in der Regel als Angestellte voll entlöhnt.Bei der Gruppe über 55 Jahre spielt auch die Tatsache eine Rolle,dass es sich hier im Durchschnitt um etwas kleinere Betriebe handelt.Die Privatausgaben waren bei der Gruppe unter 35 Jahre am kleinsten.Dies dürfte mit der noch kleinen Familiengrösse in diesem Lebenszyklus respektive den noch vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten für Kleinkinder zusammenhängen.Die Höhe der Investitionen nimmt mit fortschreitendem Alter ab.Daraus lässt sich schliessen,dass die Betriebe in der Regel erst nach der Hofübernahme auf die neuen Herausforderungen ausgerichtet werden.
Im Vergleich zu 1990/92 lassen sich verschiedene Unterschiede feststellen.1990/92 nahm die Betriebsgrösse mit dem Alter zu,während 1999/2001 das Gegenteil der Fall war.1990/92 waren die Betriebe der jungen Betriebsleiter unter 35 Jahre mit 15,4 ha und 23,1 GVE die kleinsten,1999/2001 mit 19,7 ha und 25,6 GVE hingegen die grössten.
1990/92 war der Mittelfluss vor Privatausgaben für alle Altersklassen ab 35 vergleichbar,während er 1999/2001 ab Altersklasse 35 sank.Dies spiegelt sich auch in der Investitionstätigkeit.1990/92 waren die Investitionen über die Altersklassen hinweg praktisch konstant,während sie 1999/2001 mit zunehmendem Alter deutlich abnahmen.
■ Kapitalbeschaffung und -bildung im Spiegel des Betriebszyklus
Die Höhe und Zusammensetzung des im Betrieb investierten Kapitals verändern sich im Verlauf des Betriebszyklus beträchtlich.
Zusammensetzung des Kapitals nach Altersklasse 1990/92
unter 35 Jahre35–45 Jahre
Verschiedenes mittel- und langfristiges Fremdkapital
Zusammensetzung des Kapitals nach Altersklasse 1999/2001
unter 35 Jahre35–45 Jahre Alter
Eigenkapital
Verschiedenes mittel- und langfristiges Fremdkapital
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
■ Datengrundlage und methodisches Vorgehen
1999/2001 wies die Gruppe unter 35 Jahre das tiefste Eigenkapital,das höchste Fremdkapital und gleichzeitig das tiefste Gesamtkapital aus.Die Gruppen 35–45 Jahre und 45–55 Jahre verfügten über ein wesentlich höheres Gesamtkapital bei steigendem Eigenkapital- und sinkendem Fremdkapitalanteil.Bei der Gruppe über 55 Jahre liegt das Gesamtkapital aufgrund der Betriebsgrösse und der geringeren Investitionen wieder etwas tiefer.Während das verschiedene mittel- und langfristige Fremdkapital, die Investitionskredite und die Wohnrechte abnehmen,steigen die Hypothekarkredite zu Beginn an,um anschliessend auf konstantem Niveau zu verharren.Das kurzfristige Fremdkapital bleibt praktisch unverändert.
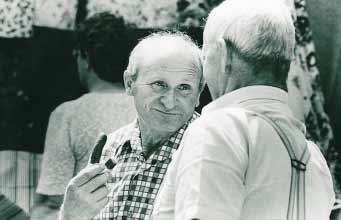
Für die Jahre 1990/92 fällt im Vergleich zu 1999/2001 auf,dass vor allem die Betriebe, welche am Anfang des Zyklus stehen (Gruppe unter 35 Jahre) bedeutend weniger Kapital einsetzen.Dies dürfte unter anderem damit zusammenhängen,dass diese Betriebe 1990/92 kleiner waren als heute.Im Unterschied zu 1999/2001 nahm die Ausstattung der Betriebe mit Fremdkapital über die verschiedenen Altersklassen hinweg weniger stark ab.
Aufgrund der Analyse ist keine Tendenz erkennbar,dass die Betriebe nicht mehr in der Lage sind,die Schulden im Laufe des Betriebszyklus zu amortisieren.
Das Institut für Agrarwirtschaft (IAW) der ETH Zürich hat 2002 im Auftrag des BLW ein «Monitoring Tool Performance Schweizer Landwirtschaftsbetriebe» entwickelt.Es handelt sich dabei um ein Instrument,mit dem die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe hinsichtlich ihrer betriebswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – ihrer Performance –unter gegebenen Rahmenbedingungen und hinsichtlich des Wettbewerbsdrucks im europäischen Umfeld klassifiziert werden können.
Die im Agrarbericht 2002 veröffentlichten Resultate haben unter anderem gezeigt, dass die Performance in Abhängigkeit der Betriebsgruppe und Flächenklasse sowie auch innerhalb der Betriebsgruppen stark variiert.Im vorliegenden Vertiefungsprojekt geht das IAW nun der Frage nach den Hauptbestimmungsfaktoren der Performance nach (vgl.auch www.blw.admin.ch).
Datengrundlage für die vorliegende Studie waren die Ergebnisse der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT des Jahres 2000.Die Untersuchungseinheit umfasste 1'718 Betriebe,welche repräsentativ für die Schweizer Landwirtschaft sind.
In einem ersten Schritt wurden die Betriebsgruppen der Untersuchungseinheit in zehn Untersuchungsgruppen aufgeteilt.In einem zweiten Schritt wurden mit Hilfe deskriptiver statistischer Analysen und aufgrund von Gesprächen mit Experten insgesamt 49 Bestimmungsfaktoren der Performance definiert.In einem dritten Schritt wurden mit Hilfe der so genannten multiplen linearen Regressionsanalyse für jede der zehn Untersuchungsgruppen eine Auswahl von Bestimmungsfaktoren – Hauptbestimmungsfaktoren – identifiziert,welche einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Performance ausüben.
Performance der Untersuchungsgruppen
Performance in % –8 –6 –4 –202468101214
Veredlung ohne Mutterkühe, Tal / Hügel / Bergzone 1+2
Ackerbau, Tal
Kombiniert Verkehrsmilch / Ackerbau, Tal Verkehrsmilch, Tal
Mutterkühe, alle Regionen
Verkehrsmilch, Hügel
Verkehrsmilch, Bergzone 1
Verkehrsmilch, Bergzone 2
Verkehrsmilch, Bergzone 3
Verkehrsmilch, Bergzone 4
Standardabweichung
Die Performance ist im Durchschnitt bei der Gruppe «Veredlung ohne Mutterkühe» am höchsten,bei «Verkehrsmilch,Bergzone 4» am tiefsten.Es zeigt sich,dass die Performance in den untersuchten Gruppen stark variiert.
Über die Regressionsanalyse können von den ursprünglich 49 Faktoren insgesamt 29 identifiziert werden,welche in einer oder mehreren Untersuchungsgruppen als Hauptbestimmungsfaktoren wirken.
In der Tabelle wird jeweils farblich unterschieden,ob ein Hauptbestimmungsfaktor positiv (grün) oder negativ (grau) wirkt. «Positiv» bedeutet,dass eine Wertzunahme des entsprechenden Faktors zu einer Steigerung der Performance führt.Umgekehrt verhält es sich mit einem negativen Hauptbestimmungsfaktor.Das R2 – das Bestimmtheitsmass – gibt darüber Auskunft,wie viel Prozent der Varianz der Performance durch das Regressionsmodell bzw.durch die Varianz der Hauptbestimmungsfaktoren erklärt werden kann.Es liegt meist über 80%,das heisst die Performanceschwankungen können zum grössten Teil durch die Regressionsmodelle erklärt werden.
Hauptbestimmungsfaktoren in Gruppe
Untersuchungsgruppen
Veredlung ohne Mutterkühe, Tal / Hügel / Bergzone 1+2
Anzahl Betriebe R 2 in % Anzahl
Anteil Arbeitskosten am Umsatz
Anteil allgemeine Betriebskosten am Umsatz
Effizienz Tierhaltung
Anteil Geb ä udekosten am Umsatz
Anteil Maschinenkosten am Umsatz
Anteil Kosten Arbeiten von Dritten am Umsatz
Hauptfutterfl ä che pro Raufutterverzehrer
Pachtbetrieb
Anteil verschiedene Rohertr ä ge am Umsatz
Durchschnittliche Milchleistung
Schweinehaltung
Angestellte ausserfamili ä r
Kunstwiesenanbau
Zuckerr ü benanbau
Durchschnittliche Arbeitskosten pro Arbeitskraft K ä lbermasthaltung
Betriebsgruppe « Gefl ü gel » Gefl ü gelhaltung
Anteil Aufzucht-Rindvieh am Rindviehbestand
Waldnutzung
Haltung von Grossmast Rindvieh
Bewirtschaftungsform « Bio »
Dreschkulturenanbau
Anteil Direktzahlungen am Umsatz Ausbildungsklasse Gr ü nlandanteil Direktvermarktung Effizienz
ä che an Hauptfutterfl ä che
Häufigkeit, dass der Faktor als Hauptbestimmungsfaktor auftritt
Hauptbestimmungsfaktor mit positivem Einfluss Hauptbestimmungsfaktor mit negativem Einfluss
R 2: Anteil der Varianz der Performance, welche durch die Hauptbestimmungsfaktoren erklärt werden kann
Quelle: IAW
Der Faktor «Effizienz Tierhaltung» (Rohertrag Tierhaltung/ Sachkosten Tierhaltung) ist bei neun von zehn Untersuchungsgruppen ein positiver Hauptbestimmungsfaktor der Performance.Der Faktor «Anteil Arbeitskosten am Umsatz» wird in allen zehn Untersuchungsgruppen als negativer Hauptbestimmungsfaktor identifiziert.Weitere negative Faktoren,welche relativ häufig als Hauptbestimmungsfaktoren der Performance vorkommen,sind «Anteil allgemeine Betriebskosten am Umsatz», «Anteil Gebäudekosten am Umsatz», «Anteil Maschinenkosten am Umsatz» sowie «Anteil Kosten Arbeiten von Dritten am Umsatz»
■ Arbeitskosten:Wichtigste Ursache für PerformanceUnterschiede
Mit Hilfe der Regressionsanalyse kann u.a.die Einflussstärke der einzelnen Hauptbestimmungsfaktoren quantifiziert werden.Zur vereinfachten Interpretation und grafischen Darstellung der Resultate werden die statistisch gemessenen Einflussstärken der Hauptbestimmungsfaktoren einer Untersuchungsgruppe transformiert.Dabei nimmt der Absolutwert der Summe der Einflussstärken aller Hauptbestimmungsfaktoren einer Untersuchungsgruppe jeweils den vorgegebenen Wert zehn an.
Aus den Resultaten ist zu schliessen,dass sich die Betriebe in der Schweiz hauptsächlich wegen unterschiedlicher Arbeitsproduktivitäten (Umsatz monetär / Arbeitskosten für Familien- und Fremdarbeit) in ihrer Performance unterscheiden.
Stellvertretend für die zehn Untersuchungsgruppen werden die Resultate der Untersuchungsgruppe «Kombiniert Verkehrsmilch / Ackerbau,Tal» aufgezeigt.Mit 349 Betrieben ist dies die grösste Untersuchungsgruppe.11 Hauptbestimmungsfaktoren konnten in dieser Gruppe identifiziert werden.Fünf davon haben einen positiven und sechs einen negativen Einfluss.Den weitaus grössten Einfluss auf die Performance hat der Faktor «Anteil Arbeitskosten am Umsatz».Das zweitgrösste Gewicht hat der Faktor «Effizienz Tierhaltung» Über alle Untersuchungsgruppen betrachtet,sind dies die beiden einflussreichsten Faktoren.
Ergebnisse der Untersuchungsgruppe «Kombiniert Verkehrsmilch / Ackerbau, Tal»
Effizienz Tierhaltung
Direktvermarktung
Effizienz Pflanzenbau
Angestellte ausserfamiliär
Hauptfutterfläche pro Raufutterverzehrer
Anteil Arbeitskosten am Umsatz
Anteil Maschinenkosten am Umsatz
Anteil Kosten Arbeit von Dritten am Umsatz
Anteil allgemeine Betriebskosten am Umsatz
Anteil Gebäudekosten am Umsatz
Anteil Naturwiesenfläche an Hauptfutterfläche
Quelle: IAW
Nachfolgend werden aus den wichtigsten Ergebnissen Schlussfolgerungen in Form von betrieblichen Empfehlungen zur Verbesserung der Performance formuliert.
Dass eine Erweiterung der Produktionskapazitäten und/oder Verlagerung des Produktionsschwerpunktes zu einer Verbesserung der Performance führen kann,sei hier nur am Rande erwähnt.Dies haben bereits die veröffentlichten Resultate im Agrarbericht 2002 aufgezeigt.
Arbeitsproduktivität
Die Steigerung der Arbeitsproduktivität muss eines der Hauptziele im Zusammenhang mit der Verbesserung der Performance von Schweizer Landwirtschaftsbetrieben sein. Da das Potential zur Umsatzsteigerung als gering eingeschätzt werden muss – einerseits sinken die Preise der meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse stetig und andererseits stagnieren tendenziell die physischen Erträge der Landwirtschaft – kann die Arbeitsproduktivität nur über eine Senkung der Arbeitskosten erreicht werden.
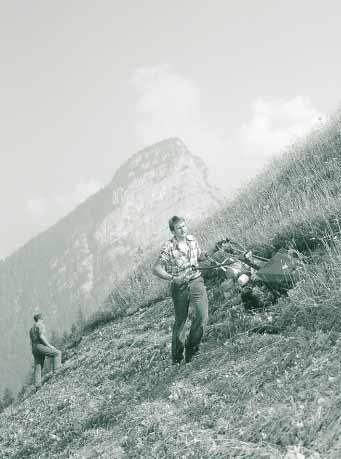
Ein Betrieb muss für jedes produzierte Erzeugnis den Produktionsprozess genauestens analysieren.Es müssen Schwachstellen identifiziert werden und Wege zur Reduktion der Arbeitskosten aufgezeigt und umgesetzt werden.Häufig stellt sich die Frage des «make or buy».Soll man einen Teilprozess der Produktion oder ein Vorprodukt zur Bereitstellung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses zukaufen oder selbst anbieten? Dabei muss als weitere Option auch eine überbetriebliche Bereitstellung in Betracht gezogen werden.Zur Beurteilung verschiedener Varianten kann u.a.das Effizienzkriterium herangezogen werden.Dabei geht es darum,die Menge oder den Marktwert einer Einheit eines Erzeugnisses oder eines Vorproduktes mit den entsprechenden Kosten in Relation zu bringen (Output/Input).Für die Bewertung der Kosten der eigenen Arbeit müssen Annahmen getroffen werden.Möglich ist es im Sinne der Opportunitätskosten,den Stundenlohn einer möglichen alternativen Tätigkeit einzusetzen.Wird ein Arbeitsprozess wie z.B.die Weizensaat durch Dritte verrichtet,muss bei der Berechnung der Kosten dieses Arbeitsprozesses berücksichtigt werden,dass neben den Ausgaben für das Lohnunternehmen je nach Situation auch die unbenutzte eigene Sämaschine Kosten verursacht.Im Zusammenhang mit der Arbeitsextensivierung,kann sich die Möglichkeit ergeben,die frei werdenden Arbeitskapazitäten der Familie anderweitig innerhalb oder ausserhalb des Betriebes gewinnbringend einzusetzen.
Effizienz von Tierhaltung und Pflanzenproduktion Neben der Arbeitsproduktivität kann auch die Effizienz der Tierhaltung und des Pflanzenbaus verbessert werden.Dies ist wiederum durch eine Reduktion des Inputs, in diesem Fall der Sachkosten,erreichbar.Sachkosten können durch Reduktion des Inputs (weniger Kraftfutter,weniger Düngemittel,etc.) gesenkt werden.Die Möglichkeit besteht aber auch,den Einkauf von Betriebsmitteln zu optimieren,indem dieser z.B. überbetrieblich organisiert wird.Auf diesem Weg können tiefere Preise ausgehandelt werden.Ausserdem können gerade Verkehrsmilchbetriebe Sachkosten reduzieren, wenn auf eine «Low-Input-Milchproduktion» umgestellt wird.Diese Produktionsweise kann zusätzlich eine Reduktion der Arbeitskosten nach sich ziehen.
■ Fazit

Spezialisierung
Es bestehen Anzeichen dafür,dass eine Konzentration der Betriebe auf ihre Kernkompetenzen – in diesem Zusammenhang soll darunter auch eine standortgerechte Produktionsausrichtung verstanden werden – einen positiven Einfluss auf die Performance haben.Es ist empfehlenswert,die Stärken und Schwächen des Betriebes genau zu analysieren und die Betriebsplanung dementsprechend zu gestalten.
Strukturkosten (ohne Arbeitskosten)
Bei Immobilien ist eine Desinvestition nur schwer realisierbar.Hingegen muss darauf geachtet werden,dass die Gebäude optimal ausgelastet werden.Eine Möglichkeit wäre beispielsweise,nicht genutzten Gebäuderaum als Lagerraum an andere Landwirte oder anderes Gewerbe zu vermieten – solange dies zonenkonform ist.Maschinenkostenkönnen reduziert werden,wenn Maschinen besser ausgelastet werden wie etwa durch überbetrieblichen Einsatz.Je nach Situation kann es sich lohnen, bestimmte Maschinen zu verkaufen und Arbeiten von Dritten in Anspruch zu nehmen.
Qualifizierung
Die Ausbildung der Arbeitskräfte – vor allem die des Betriebsleiters bzw.der Betriebsleiterin – kann mitbestimmend für die Höhe der Performance sein.Der Betriebsleiter resp.die Betriebsleiterin muss sich genügend Freiraum lassen für die Aus- und Weiterbildung und zur Informationsbeschaffung über die neusten Entwicklungen im Umfeld des Betriebes.
Ökologisierung
Eine ökologischere Ausrichtung der Schweizer Landwirtschaft kann sich positiv auf die Performance auswirken.Es ist deshalb einzelbetrieblich abzuklären,ob sich eine Umstellung auf Biolandbau oder eine andere umwelt- und tierfreundliche Produktionsausrichtung positiv auf die Performance auswirkt.
Das Vertiefungsprojekt der Performanceanalyse hat Vermutungen und bereits bekannte Zusammenhänge mit Hilfe einer statistischen Analysemethode,der Regressionsanalyse,untermauern können.Zentral für die Schweizer Landwirtschaft ist,dass sich die Betriebe hauptsächlich wegen unterschiedlicher Arbeitsproduktivitäten und zu einem grossen Teil auch wegen Effizienzunterschieden bei der Produktion tierischer Erzeugnisse so stark in ihrer Performance unterscheiden.Zu bemerken ist ausserdem, dass sich die Konzentration der Kräfte auf die Kernkompetenz,die Aus- und Weiterbildung der Betriebsleiterinnen und -leiter sowie extensivere Bewirtschaftungsformen positiv auf die Performance auswirken können.
Das Soziale ist eine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit.In der Berichterstattung über die agrarpolitischen Auswirkungen nehmen die sozialen Aspekte deshalb einen eigenen Platz ein.Die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft – der Abschnitt Soziales – gliedert sich in drei Teile:Einkommen und Verbrauch,periodische Bestandesaufnahme bei fünf zentralen sozialen Themen sowie Fallstudien zu sozialen Themen. Für die Landwirtschaft wichtig sind auch gesellschaftliche Aspekte wie etwa das Mittragen der sozialen Strukturen im ländlichen Raum durch die Landwirtschaft,was im Abschnitt Gesellschaft behandelt wird.
Im Folgenden werden im Abschnitt Soziales die Einkommen und der Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT,ferner eine Bestandesaufnahme im Bereich Gesundheit sowie eine Analyse zum Thema Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft dargestellt.Im Abschnitt Gesellschaft folgt ein Beitrag zum Thema ländlicher Raum.
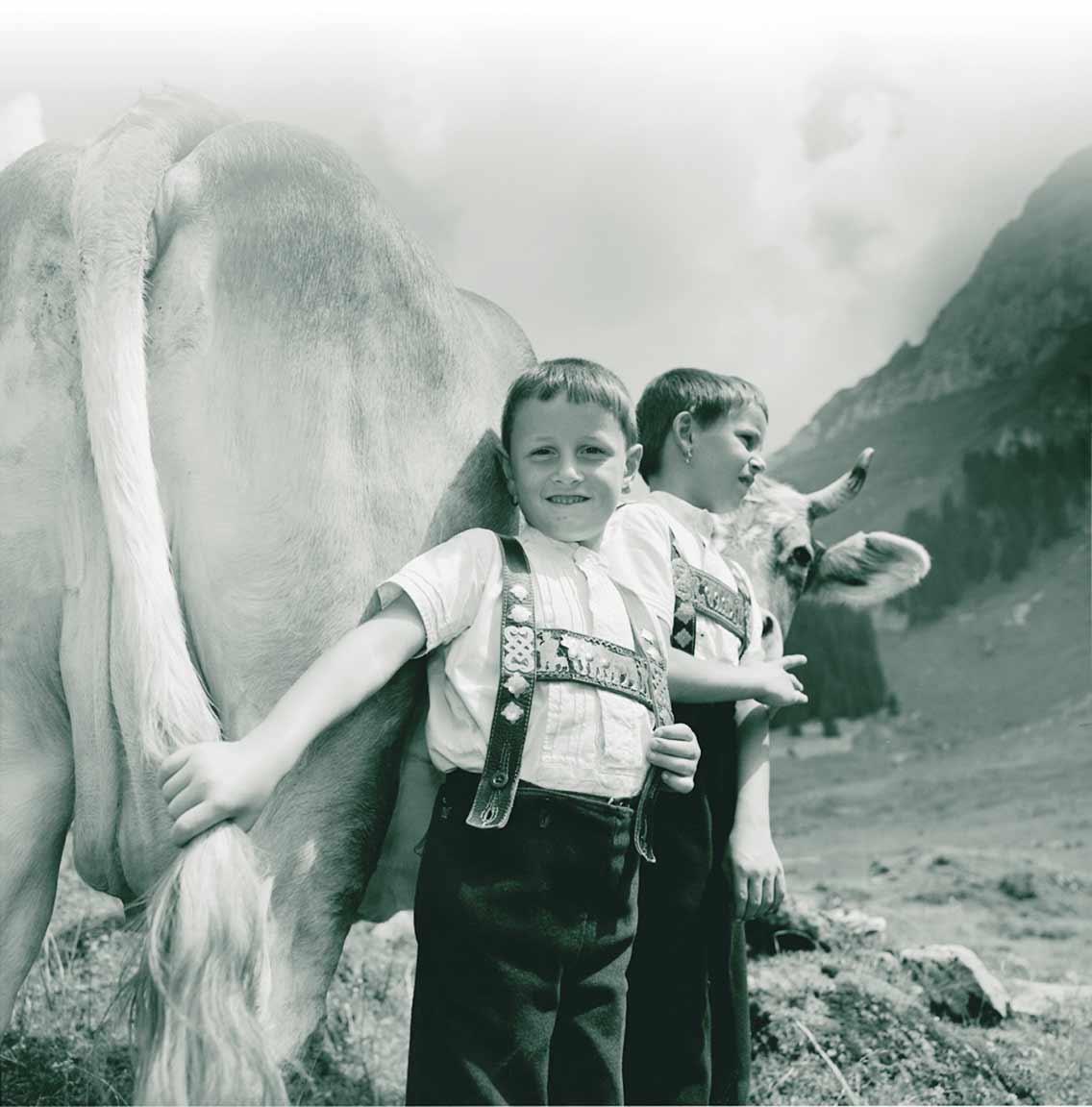
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Bauernfamilien sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen.Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe.Bei der sozialen Dimension steht dagegen die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte im Vordergrund.Daher wird das Nebeneinkommen der Haushalte ebenfalls mit in die Analyse einbezogen.Neben dem Gesamteinkommen wird auch die Entwicklung des Privatverbrauchs verfolgt.
Das Gesamteinkommen,das sich aus dem landwirtschaftlichen Einkommen und dem Nebeneinkommen zusammensetzt,lag im Durchschnitt der Jahre 2000/02 je nach Region zwischen 61’500 und knapp 85’100 Fr.pro Betrieb:Die Betriebe der Bergregion erreichten etwa 72% des Gesamteinkommens der Betriebe der Talregion.Mit Nebeneinkommen von 17’200 bis 20’600 Fr.hatten die Betriebe eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle:Diese machte bei den Betrieben der Talregion 20% des Gesamteinkommens aus,bei jenen der Hügelregion 29% und bei denjenigen der Bergregion 32%.Die Betriebe der Hügelregion wiesen mit 20’600 Fr.absolut die höchsten Nebeneinkommen aus.
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Betrieb 2000/02
TalregionHügelregionBergregion
Der Privatverbrauch macht je nach Region zwischen 83 und 86% des Gesamteinkommens aus und liegt jeweils über der Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens. Er ist entsprechend der Höhe des Gesamteinkommens bei den Betrieben der Talregion absolut am höchsten und bei den Betrieben der Bergregion am tiefsten.
Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Betrieb lag 2002 mit rund 70’100 Fr. unter jenem aus dem Durchschnitt der Jahre 1999/2001 mit 75’800 Fr.Der Privatverbrauch pro Betrieb hat hingegen im Jahr 2002 im Vergleich zu 1999/2001 um 1’350 Fr.zugenommen und lag bei 63’200 Fr.
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Verbrauchereinheit
nach
1.Quartil2.Quartil3.Quartil4.QuartilAlle
1 Quartile nach Arbeitsverdienst je Familien-Jahresarbeitseinheit
2 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr Quelle:Zentrale Auswertung FAT
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte 2000/02 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken.Sie mussten einen Teil ihrer eigentlich für Ersatz- und Neuinvestitionen bzw.für ihre Altersvorsorge erforderlichen Mittel für den Privatverbrauch einsetzen.Die Eigenkapitalbildung ist bei diesen Betrieben negativ.Bei den Betrieben in den übrigen Quartilen war der Privatverbrauch geringer als das Gesamteinkommen.Die Betriebe des ersten Quartils erreichten 43% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Betrieben des vierten Quartils.
Der Privatverbrauch pro Verbrauchereinheit machte im ersten Quartil rund 112% des Gesamteinkommens aus,bei Betrieben des vierten Quartils 68%.Beim Privatverbrauch ist die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer als beim Gesamteinkommen.Er lag bei den Betrieben des ersten Quartils bei 71% des Verbrauchs der Betriebe des vierten Quartils.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit war 2002 in allen Quartilen tiefer im Vergleich zu den drei Vorjahren 1999/2001.Am geringsten ist die Differenz im ersten Quartil,am höchsten im vierten Quartil.Beim Privatverbrauch fällt auf,dass dieser im Jahr 2002 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1999/2001 im ersten Quartil leicht abgenommen hat.In den übrigen Quartilen hat er wie in den Vorjahren etwas zugenommen.
Eine vertiefte Analyse – insbesondere jener Quartile,die sich gemäss ihrem Arbeitsverdienst in der unteren Hälfte befinden – folgt im nächsten Agrarbericht.
■ Schweizerische Gesundheitsbefragung als Grundlage
Die Erwerbstätigkeit beeinflusst die Gesundheit.Gesundheit ist eines der fünf zentralen sozialen Themen,von welchen alle fünf Jahre eine Bestandesaufnahme gemacht wird. Gesundheitliche Vor- und Nachteile des Bauernlebens werden im Vergleich mit der restlichen Bevölkerung dargestellt.Als Datengrundlage dazu dient die Schweizerische Gesundheitsbefragung.
Die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB),eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS),wird seit 1992 alle fünf Jahre durchgeführt.Erhoben werden Daten zu Gesundheitszustand,Lebensgewohnheiten,gesundheitsrelevantem Verhalten,Gesundheitsvorsorge,Lebensbedingungen,sozialer Sicherheit und Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems.Im Jahre 2002 wurden rund 19'700 zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählte Personen dazu mündlich und schriftlich befragt.Grundgesamtheit der SGB ist die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren,die in privaten Haushalten lebt.
Im Rahmen der Gesundheitsbefragung 2002 wurden 218 Landwirte und 150 Bäuerinnen befragt.Um die Vergleichbarkeit dieser Gruppe mit der übrigen Bevölkerung zu gewährleisten,wurde jedem dieser Landwirte und jeder Bäuerin je zwei Personen mit gleichem Alter,gleichem Geschlecht und in der gleichen Region wohnend aus den restlichen rund 19'300 Personen zufällig zugeordnet.Dadurch ergab sich eine Vergleichsgruppe von 436 Männern und 300 Frauen.Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse stammen aus den Analysen dieser beiden Gruppen.

■ Allgemeiner Gesundheitszustand
Wissenschaftliche Studien zeigen,dass Menschen gut in der Lage sind,ihren allgemeinen Gesundheitszustand selber realistisch einzuschätzen.Aus den Angaben zur selbst wahrgenommenen Gesundheit (Frage:Wie geht es ihnen zurzeit gesundheitlich?) lässt sich deshalb eine zuverlässige Aussage über den generellen Gesundheitszustand der Bevölkerung ableiten.Weiter werden hier noch die beiden Risikofaktoren für die Gesundheit, Übergewicht und Bluthochdruck,dargestellt.
Die Männer der Vergleichsgruppe schätzen ihren Gesundheitszustand als etwas besser ein als die Landwirte.Der selbsteingeschätzte Gesundheitszustand der Bäuerinnen liegt dagegen leicht höher als jener der Vergleichsgruppe Frauen.Die Frauen beurteilen ihren Gesundheitszustand allgemein als etwas schlechter als die Männer.
Körpergewicht (Body Mass Index BMI) 0
(25<=BMI<30) 70 60 50 30 20
stark übergewichtig (30<=BMI) Quelle: BFS 40 10
Rund ein Drittel der befragten Bäuerinnen hat zu hohen Blutdruck,das sind etwa 5 Prozentpunkte mehr als bei der Vergleichsgruppe Frauen.Etwa 20% der Landwirte und der Vergleichsgruppe Männer haben ebenfalls erhöhten Blutdruck.Bedeutend mehr Landwirte und Bäuerinnen als andere Personen wissen nicht Bescheid über ihren Blutdruck.Das deutet möglicherweise auf weniger Vorsorgeuntersuchungen hin.
Die emotionale Befindlichkeit stellt eine wichtige Komponente der psychischen Gesundheit dar.Sie setzt sich aus Fragen zu «Niedergeschlagenheit», «Ausgeglichenheit», «Nervosität» sowie «voll Optimismus und Energie» zusammen.Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Befund in der Woche vor der Befragung.
Emotionale Befindlichkeit (in der Woche vor der Befragung)
Das emotionale Befinden ist bei den Männern (Landwirte und Vergleichsgruppe Männer) leicht besser als bei den Frauen (Bäuerinnen und Vergleichsgruppe Frauen). Bei den Landwirten ist der Index «niedrig» mit einem Anteil von 11% tiefer als bei der Vergleichsgruppe Männer (15%).Bei den Bäuerinnen ist er hingegen mit 21% höher als bei der Vergleichsgruppe Frauen (16%).

Hohe Arbeitsbelastungen können zu körperlichen und psychosomatischen Symptomen führen.
Rücken- oder Kreuzschmerzen (in den vier Wochen vor der Befragung)
Landwirte leiden stärker unter Rücken- oder Kreuzschmerzen als die Vertreter ihrer Vergleichsgruppe.Sowohl bei den Bäuerinnen als auch bei der Vergleichsgruppe Frauen treten Rücken- oder Kreuzschmerzen noch etwas häufiger auf.Bei den Bäuerinnen ist der Anteil mit starken Schmerzen am höchsten (15%).
Kopf- oder Gesichtsschmerzen (in den vier Wochen vor der Befragung)
Bei den befragten Männern – Landwirte und Vergleichsgruppe Männer – treten Kopfschmerzen etwa gleich oft auf.Bei den Frauen sind die Bäuerinnen etwas weniger stark davon betroffen als die Vergleichsgruppe Frauen.Ein Drittel der Vergleichsgruppe Frauen leidet unter Kopfschmerzen.
Schwäche, Müdigkeit (in den vier Wochen vor der Befragung)
Landwirte leiden gemäss Auswertung etwas mehr unter Schwäche und Müdigkeit als die Vergleichsgruppe Männer,die Bäuerinnen hingegen weniger als die Vergleichsgruppe Frauen.Die befragten Frauen (Bäuerinnen und Vergleichsgruppe Frauen) sind jedoch deutlich stärker von Schwäche und Müdigkeit betroffen als die Männer.
Ein- und Durchschlafstörungen (in den vier Wochen vor der Befragung)
Wesentlich weniger Landwirte (1%) sind von starken Schlafstörungen betroffen als Männer der Vergleichsgruppe (9%).Frauen leiden allgemein häufiger unter Schlafproblemen:Die Auswertung zeigt,dass bei rund der Hälfte der befragten Bäuerinnen und der Vergleichsgruppe Frauen starke oder leichte Ein- und Durchschlafstörungen auftreten.Der Anteil mit starken Ein- und Durchschlafstörungen ist allerdings bei den Bäuerinnen tiefer als bei der Vergleichsgruppe Frauen.
Gesundheitsfördernde Verhaltensweisen wie eine ausgewogene Ernährung und regelmässige körperliche Betätigung helfen mit,das Wohlbefinden und die Gesundheit zu stärken,Krankheiten zu vermeiden und die Folgen von Krankheit zu lindern.
90 70 80 60 20 10
30 40 50
■ LandwirteVergleichsgruppe Männer BäuerinnenVergleichsgruppe Frauen
Ich achte auf die Ernährung 0
Die Bejahung der Frage «Denken sie,dass sie sich für ihre Gesundheit genug bewegen?» liegt bei den Landwirten und den Bäuerinnen (beide um 80%) jeweils deutlich höher als bei ihren Vergleichsgruppen.
Bäuerinnen trinken bedeutend weniger häufig Alkohol als ihre Kolleginnen aus der restlichen Bevölkerung.50% der Bäuerinnen sind abstinent,bei der Vergleichsgruppe sind es 30%.Bei den Männern – sowohl bei den Landwirten als auch bei der Vergleichsgruppe – liegt dieser Anteil bei 10%.Häufiger Alkoholkonsum (täglich oder mehrmals pro Tag) ist bei Männern beider Gruppen ähnlich,bei Bäuerinnen weniger verbreitet als bei den anderen Frauen.

■ Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und Medikamentenkonsum
Allgemein wird vermutet,dass Landwirte eher weniger zum Arzt gehen und eher zu Hausmitteln greifen,wenn sie sich gesundheitlich nicht gut fühlen.Zur Darstellung der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen und Medikamentenkonsum wurde die Anzahl Arztbesuche in den 12 Monaten vor der Befragung und Konsum von Schmerzmitteln in der Woche vor der Befragung herangezogen.
Anzahl Arztbesuche (in den 12 Monaten vor der Befragung)
Die Resultate der Gesundheitsbefragung bestätigen die Vermutung,dass insbesondere Landwirte weniger oft zum Arzt gehen als Männer in der übrigen Bevölkerung.
Schmerzmittelkonsum (in der Woche vor der Befragung)
Der Schmerzmittelkonsum ist bei der befragten bäuerlichen Bevölkerung leicht (Männer) bzw.deutlich tiefer (Frauen) als jener der entsprechenden Vergleichsgruppe.90% der befragten Männer nehmen nie Schmerzmittel.Der höchste Konsum liegt bei der Vergleichsgruppe Frauen,wo 23% Schmerzmittel eingenommen haben.
■ Fazit Gesundheit Die Gesundheit der Landwirte und Bäuerinnen unterscheidet sich in verschiedenen Aspekten von derjenigen der übrigen Bevölkerung.Die Unterschiede zeigen,dass diese zum Teil als positiv,zum Teil als negativ einzustufen sind.So sind die befragten Landwirte und die Bäuerinnen häufiger übergewichtig als die Vergleichsgruppen und sie leiden stärker unter Rückenschmerzen.Landwirte respektive Bäuerinnen sind hingegen weniger von starken Schlafstörungen betroffen.Sie sind auch deutlich weniger ernährungsbewusst.Insbesondere die befragten Bäuerinnen sind weit häufiger abstinent respektive trinken weniger Alkohol als die übrigen Frauen.Landwirte suchen ausserdem verglichen mit anderen Personen seltener einen Arzt auf.
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind in der Landwirtschaft die selben wie in der restlichen Bevölkerung:Gemeinsam schätzen die befragten Frauen ihren Gesundheitszustand als etwas schlechter ein als die befragten Männer.Sowohl die befragten Bäuerinnen als auch die übrigen Frauen haben häufiger hohen Blutdruck und leiden verglichen mit den Männern stärker an Schwäche und Müdigkeit.Rund die Hälfte der befragten Frauen ist von Ein- und Durchschlafstörungen betroffen.Etwa 70% der Männer leiden hingegen überhaupt nicht unter Schlafproblemen.Es trinken allgemein deutlich mehr Frauen keine alkoholischen Getränke.

■ Postulat Bugnon: Arbeitsbelastung und soziale Auswirkungen der Agrarpolitik
Am 21.Juni 2002 hat Nationalrat Bugnon ein Postulat mit dem Titel «Neue Agrarpolitik – Bericht über die erhöhte Arbeitsbelastung und ihre sozialen Auswirkungen» (02.3355) eingereicht.Das Postulat wurde vom Bundesrat entgegengenommen.
Um die negativen Auswirkungen der neuen Agrarpolitik zu erfassen und mögliche Lösungen für die Probleme zu finden,ist es wichtig,zuerst ihr Ausmass zu kennen. Deshalb fordere ich den Bundesrat auf,die Entwicklung dieser Problematik von 1990 bis heute zu untersuchen und darüber einen Bericht und Schlussfolgerungen vorzulegen.Dieser Bericht soll zudem ein Szenario für die nächsten zehn Jahre enthalten,das über die Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft und über die voraussichtlichen sozialen Auswirkungen der neuen Agrarpolitik Auskunft gibt.
Die im Postulat aufgeworfenen Fragestellungen werden nachfolgend von verschiedenen Seiten her beleuchtet:Es wird,auf der Grundlage einer Statistik des BFS,einerseits die Entwicklung der Jahresarbeitszeit in der Landwirtschaft,anderseits ein Branchenvergleich gezeigt.Ferner wird anhand von Modellkalkulationen der FAT die Arbeitszeit und die physische Arbeitsbelastung in mehreren landwirtschaftlichen Betriebszweigen und Betriebstypen dargelegt.Ausserdem werden verschiedene soziale Aspekte aufgrund von Auswertungen der Gesundheitsbefragungen des BFS und der Volkszählungen aufgezeigt.
■ Hohe Jahresarbeitszeit in der Landwirtschaft
Die seit 1991 bestehende Arbeitsvolumenstatistik des BFS gibt Auskunft über die so genannte tatsächliche Jahresarbeitszeit unter Berücksichtigung der Überstunden und Absenzen.
Die tatsächliche Jahresarbeitszeit von Frauen und Männern in der Land- und Forstwirtschaft – es stehen keine die Landwirtschaft allein betreffenden Zahlen zur Verfügung – nahm zwischen 1991 und 2001 leicht ab:Sie ist dabei insbesondere bei den Vollzeitbeschäftigten zurückgegangen.Bei teilzeitlich im Nebenerwerb geführten Betrieben – gesamtschweizerisch 1991 wie auch 2001 rund 30% der Betriebe – ist die zeitliche Belastung in diesem Zeitraum leicht angestiegen.
Tatsächliche Jahresarbeitszeit in der Land- und Forstwirtschaft
Jahresarbeitszeit von Selbständigen aus verschiedenen Branchen 1
1 Wirtschaftsabschnitte NOGA (allg.Systematik der Wirtschaftszweige)
Während die obenstehende Grafik die Entwicklung der Jahresarbeitszeit von 1991 bis 2001 der in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Männer und Frauen nach Beschäftigungsgrad aufzeigt,wird in der Tabelle die Veränderung der Jahresarbeitszeit nach Erwerbsstatus (Selbständige) wiedergegeben.Es sind dabei die sechs Branchen mit den höchsten Jahresarbeitszeiten aufgeführt.Die Jahresarbeitszeit für selbständige Landwirte und Förster ist im Betrachtungszeitraum gesunken,insbesondere zwischen 1991 und 1996.Sie ist aber im Branchenvergleich am höchsten.Nur im Gastgewerbe sind die Arbeitszeiten ebenfalls deutlich höher als in den anderen Branchen.

■ Belastung und Belastbarkeit
Was ist unter Belastung zu verstehen? Und was unter Belastbarkeit? Die nachstehende Abbildung zeigt,dass sich – aus arbeitswissenschaftlicher Sicht
die Arbeitsbelastung aus psychischer und physischer Belastung zusammensetzt,die Belastbarkeit hingegen aus Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit.Ist die Belastung höher als die Belastbarkeit,so liegt eine Überlastung bzw. Überforderung vor.Dauert diese längere Zeit an,so kann dies zu einer erhöhten Sensibilisierung gegenüber verschiedensten Belastungsfaktoren führen und schliesslich sogar zu Beziehungsproblemen und gesundheitlichen Konsequenzen.
Psychische BelastungLeistungsdefizit (Saldo)
Mehr Büroarbeit
Geringer Arbeitsverdienst
Überlastung bzw. Überforderung
Sinkende ProduktepreiseLeistungsbereitschaft
Wachsender KonkurrenzdruckSelbständigkeit
Tägliche Fixtermine bei der TierhaltungArbeit in/mit der Natur
EntscheidungsdruckArbeit mit der Familie GeldknappheitNachhaltigkeit der Arbeit
ZukunftsangstAnerkennung,Identität BeziehungsproblemeGlaube,Hoffnung Etc.Etc.
Physische BelastungLeistungsfähigkeit Schwerarbeit (Massenumschlag)Gesundheit
Ungünstige KörperhaltungFachkompetenz
Lange ArbeitszeitFührungskompetenz
Wenig Zeit für Erholung / FerienSozialkompetenz
Kälte,Hitze,Staub,LärmSelbstkompetenz
Etc.Etc.
Quelle:FAT
Wie in der übrigen Wirtschaft,so bekommen auch in der Landwirtschaft die psychischen Belastungsfaktoren mehr und mehr Bedeutung.Diese «weichen» Faktoren können durch eine Erhöhung der entsprechenden Kompetenzen – sprich Leistungsfähigkeit – jedoch entschärft werden.So müssen die wachsenden Anforderungen an das Betriebsmanagement nicht zwangsläufig zu einer hohen Belastung führen.Aus dieser Perspektive gesehen könnte daher von höheren Anforderungen statt von stärkerer Belastung gesprochen werden.Bei gut ausgebildeten und/oder erfahrenen Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen wird der Punkt der Überlastung respektive Überforderung weniger rasch erreicht:Sie können die ansteigenden Ansprüche leichter meistern.
Die arbeitswissenschaftliche Forschung der FAT hat mit dem sogenannten Arbeitsvoranschlag ein wichtiges Hilfsmittel zur Abschätzung der zeitlichen Belastung bereitgestellt.Aus dem Bereich der Ergonomie liegen ausserdem Messmethoden und Grenzwerte für physische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz vor.Die physischen Belastungen können damit nachvollzogen und quantifiziert werden.Im Gebiet der komplexeren psychischen Belastung ist die Arbeitswissenschaft jedoch noch nicht in der Lage,vergleichbare Hilfsmittel und Berechnungsgrössen anzubieten.
■ Technik reduziert Arbeitszeit und physische Arbeitsbelastung
Im Folgenden werden die Arbeitszeit und die physische Arbeitsbelastung in mehreren landwirtschaftlichen Betriebszweigen und Betriebstypen betrachtet.
Alle nachfolgenden Berechnungen des Arbeitszeitbedarfes erfolgten mit einem Modellkalkulationssystem und dem detaillierten Arbeitsvoranschlag der FAT.Sie sind dabei aufgeteilt in den Arbeitszeitbedarf für direkt produktionsbezogene Tätigkeiten wie Pflügen oder Melken und so genannte Restarbeiten wie Unterhalts- oder Organisationsarbeiten.Die Restarbeiten werden jeweils als konstant angenommen.Für die Berechnung des Arbeitszeitbedarfes in den Jahren 1990 und 1996 wurden repräsentative Arbeitsverfahren gemäss Betriebsstrukturerhebungen des BFS herangezogen.Für 2001 und die Prognose für das Jahr 2010 wurde auf eine Expertenbefragung zurückgegriffen.
Die folgenden sieben Grafiken zeigen die technische Entwicklung und die Veränderung des Arbeitszeitbedarfes bei den Betriebszweigen Getreide-,Zuckerrüben-,Kartoffelanbau,Futterbau Tal- und Bergregion sowie Milchviehhaltung in Anbinde- und Laufställen auf.Dabei wird für die vier Betrachtungsjahre jeweils pro Betriebszweig auf eine gleichbleibende Anzahl ha bzw.Kühe Bezug genommen.Diese Bezugsgrössen wurden so gewählt,dass sie sowohl für 1990 als auch für 2010 realistisch sind.
Zeitbedarf Getreideanbau
1990199620012010
Zweischarpflug
Egge 2,5 m
Sämaschine 2,5 m
Pflanzenschutzspritze 10 m
Mähdrescher 3 m
Stroh in Hochdruckund Rundballen
Restarbeit Getreide
Bezugsgrösse: 11 ha
Dreischarpflug Egge 3 m
Sämaschine 3 m
Pflanzenschutzspritze 12 m
Mähdrescher 4,5 m
Stroh in Hochdruckund Rundballen
Dreischarpflug
Egge 3 m
Sämaschine 3 m
Pflanzenschutzspritze 15 m
Mähdrescher 5 m
Stroh in Hochdruckund Rundballen
Vierscharpflug
Egge 3 m
Sämaschine 3 m
Pflanzenschutzspritze 18 m
Mähdrescher 5 m
Stroh in Hochdruckund Rundballen
Quelle: FAT
Zeitbedarf Zuckerrübenanbau
1990199620012010
Zweischarpflug Egge 2,5 m Rübensägerät 6 Reihen
Vereinzeln von Hand
Pflanzenschutzspritze 10 m Rübenroder einreihig gezogen
Dreischarpflug Egge 3 m
Rübensägerät 6 Reihen
Vereinzeln von Hand
Pflanzenschutzspritze 12 m
Rübenroder zweireihig gezogen
Dreischarpflug Egge 3 m
Rübensägerät 6 Reihen
Saat auf Endabstand
Pflanzenschutzspritze 15 m
Rübenroder sechsreihig Selbstfahrer
Bezugsgrösse: 3 ha
Zeitbedarf Kartoffelanbau
Vierscharpflug Egge 3 m
Rübensägerät 6 Reihen
Saat auf Endabstand
Pflanzenschutzspritze 18 m Rübenroder sechsreihig Selbstfahrer
Quelle: FAT
1990199620012010
Zweischarpflug Egge 2,5 m
Kartoffellegegerät 4 Reihen
Halbautomat Häufelgerät 4 Reihen
Pflanzenschutzspritze 10 m
Krautschlegler 1,5 m
Kartoffelroder einreihig gezogen
Dreischarpflug Egge 3 m
Kartoffellegegerät 4 Reihen
Halbautomat
Häufelgerät 4 Reihen
Pflanzenschutzspritze 12 m
Krautschlegler 3 m
Kartoffelroder einreihig gezogen
Bezugsgrösse: 1,7 ha
Dreischarpflug Egge 3 m
Kartoffellegegerät 2 Reihen
Vollautomat
Häufelgerät 4 Reihen
Pflanzenschutzspritze 15 m
Krautschlegler 3 m
Kartoffelroder einreihig gezogen
Vierscharpflug Egge 3 m
Kartoffellegegerät 4 Reihen
Vollautomat Häufelgerät 4 Reihen
Pflanzenschutzspritze 18 m
Krautschlegler 3 m

Kartoffelroder zweireihig gezogen
Quelle: FAT
Zeitbedarf Futterbau Talregion
1990199620012010
Kreiselmähwerk 1,8 m
Kreiselheuer 4 m
Kreiselschwader 2,8 m
Ladewagen 13 m3
Gebläse mit Teleskopverteiler
Restarbeit Futterbau
Kreiselmähwerk 2,1 m
Kreiselheuer 5,5 m
Kreiselschwader 3,5 m
Ladewagen 15 m3
Dosieranlage Gebläse mit Teleskopverteiler
Kreiselmähwerk 2,4 m
Kreiselheuer 6,5 m
Kreiselschwader 3,5 m
Ladewagen 20 m3
Greiferkrananlage
Kreiselmähwerk 3,5 m
Kreiselheuer 8,5 m
Kreiselschwader 9 m
Ladewagen 30 m3
Greiferkrananlage
Bezugsgrösse: 20 ha 4 Schnittnutzungen, mittelintensiv, Belüftungsheu, inkl. Wiesenpflege und Düngung
Zeitbedarf Futterbau Bergregion
Quelle: FAT
1990199620012010
Motormäher 1,9 m
Kreiselheuer 4,5 m
Bandrechen 2,8 m
Transporter 9 m3
Gebläse mit Teleskopverteiler
Restarbeit Futterbau
Bezugsgrösse: 25 ha
Zweiachsmäher 2,2 m
Kreiselheuer 5 m
Bandrechen 2,8 m
Transporter 11 m3
Gebläse mit Teleskopverteiler
Zweiachsmäher 2,5 m
Kreiselheuer 5 m
Bandrechen 3 m
Transporter 15 m3
Gebläse mit Teleskopverteiler
Hangneigung 18–25%, 3 Schnittnutzungen, mittelintensiv, Belüftungsheu, inkl. Wiesenpflege und Düngung
Zweiachsmäher 2,8 m
Kreiselheuer 5 m
Bandrechen 3 m
Transporter 18 m3 Greiferkrananlage
Quelle: FAT
Es ist bei allen untersuchten Betriebszweigen für die vier betrachteten Jahre ein technischer Fortschritt und damit verbunden ein Rückgang der benötigten Arbeitszeit zu verzeichnen.Besonders eindrücklich ist die Abnahme der Arbeitszeit beim Kartoffelanbau von rund 380 Stunden pro ha 1990 – bei einer Bezugsgrösse von 1,7 ha – auf voraussichtliche 275 Stunden im Jahre 2010.Der Rückgang ist beim Getreideanbau am geringsten,da hier der Stand der Mechanisierung bereits 1990 sehr hoch war.
In der Milchviehhaltung wurde nebst dem Arbeitszeitbedarf auch der sogenannte Massenumschlag zur Charakterisierung der körperlichen Arbeitsbelastung mit einem Modellkalkulationssystem der FAT berechnet.Dabei wurden bei den Arbeitsverfahren die jeweilige Körperhaltung – insgesamt gibt es 84 Körperhaltungscodes –,deren Zeitanteil sowie die dabei von Hand zu bewegenden Massen miteinander verrechnet und aufsummiert.
Zeitbedarf und Massenumschlag für Milchvieh im Anbindestall

Masse je Kuh: Melken 5 t Füttern 33 t Misten 0,3 t 120 100 60 40
1990199620012010
Kurzstand Eimermelkanlage 2 Melkeinheiten Motormäher Ladewagen 120 Weidetage Portionenfütterung Futterrüsten von Hand Futtervorlage von Hand
Masse je Kuh: Melken 39 t Füttern 41 t Misten 0,4 t
Misten Füttern Restarbeit Melken
Kurzstand Eimermelkanlage 2 Melkeinheiten Motormäher Ladewagen 120 Weidetage Halbtags-Vorratsfütterung Futterrüsten von Hand Futtervorlage von Hand
Kurzstand Rohrmelkanlage 2 Melkeinheiten Motormäher Ladewagen 180 Weidetage Halbtags-Vorratsfütterung Greiferkrananlage
Bezugsgrösse: 20 Milchkühe
Masse / Kuh
je Kuh: 80 20 0
Melken 120 100 60 40
Kurzstand Rohrmelkanlage 3 Melkeinheiten Frontmähwerk Ladewagen 180 Weidetage Futtermischwagen Greiferkrananlage
5 t 80 20
Füttern
15 t
0,3 t
Quelle: FAT
Zeitbedarf und Massenumschlag für Milchvieh im Laufstall
Auch beim Betriebszweig Milchviehhaltung geht der Arbeitszeitbedarf im Betrachtungszeitraum zurück.Dank dem technischen Fortschritt wird 2010 eine Arbeitskraft bei konstanter Bestandesgrösse weit weniger Masse heben müssen als noch 1990:Der Massenumschlag in der Milchviehhaltung halbiert sich im Anbindestall mit dem Ersetzen einer Eimermelkanlage durch eine Rohrmelkanlage.Bei Melkständen in Laufställen ist die Arbeitserleichterung noch bedeutender.Der grösste Teil der Gesamtmasse fällt jeweils bei der Fütterung an.Dort sind die grössten Einsparungen durch den Einsatz von Futtermischwagen und die Ausdehnung des Weideganges erreichbar.
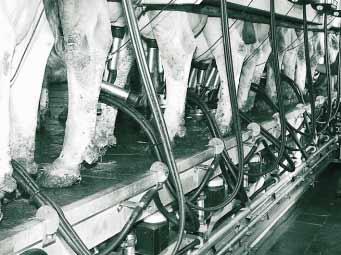
■ Arbeitszeitbedarf und Massenumschlag bei ausgewählten Betriebsgruppen
Wie wirken sich nun diese technischen Entwicklungen auf die Arbeitsbelastung in den Betrieben aus? Zur Beantwortung dieser Frage wurden Modellkalkulationen durchgeführt für «Durchschnittsbetrieb,alle Regionen», «Ackerbaubetrieb,Talregion» sowie «Verkehrsmilchbetrieb,Talregion».Die Basis für die Berechnungen liefern gewichtete Strukturdaten von Referenzbetrieben der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT.
Bei der Berechnung des Arbeitszeitbedarfes für die Milchviehhaltung wird jeweils eine Mischgrösse verwendet,das heisst die Anteile der in Anbinde- und Laufställen gehaltenen Kühe werden aufsummiert.So wurden 1990 97% der Kühe in Anbinde- und 3% in Laufställen gehalten,1996 war das Verhältnis 93% zu 7%,2001 lag es bei 82% zu 18%.Für das Jahr 2010 wird ein Verhältnis von 60% (Anbindestall) zu 40% (Laufstall) angenommen.Die den Berechnungen zugrundeliegenden Arbeitsverfahren können den vorangegangenen Abbildungen entnommen werden.
Zeitbedarf «Durchschnittsbetrieb, alle Regionen»
Arbeit / Betrieb Milchvieh
Arbeit / Betrieb
Quelle:
Ein beträchtlicher Teil der Arbeitszeit wird bei einem «Durchschnittsbetrieb,alle Regionen» für das Melken und Füttern des Milchviehs eingesetzt.Diese nimmt jedoch trotz zunehmender Bestandesgrösse wegen des technischen Fortschritts im Verlauf der vier Betrachtungsjahre ab.Beim Betriebszweig Futterbau kann die technische Entwicklung die Mehrarbeit als Folge der grösseren Fläche hingegen nicht auffangen.Im Jahr 2010 wird sich deshalb der Aufwand für den Futterbau auf einem Durchschnittsbetrieb demjenigen für die Milchviehhaltung annähern.Geht der Strukturwandel bis 2010 weiter wie in den letzten 10 Jahren und wird weiterhin wie bisher in die neueste Technik investiert kann insgesamt davon ausgegangen werden,dass der Arbeitszeitbedarf je Betrieb gegenüber 2001 leicht zurückgehen wird.Die physische Belastung dürfte gleichzeitig nochmals deutlich abnehmen.
Der Arbeitszeitbedarf beim «Ackerbaubetrieb,Talregion» ist bis 2001 ebenfalls gesunken.Er dürfte aber bis 2010 gegenüber 2001 leicht ansteigen.Der technische Fortschritt kann die Flächenausdehnung bei allen Kulturen nicht ganz kompensieren. Insgesamt bleibt der Arbeitszeitbedarf gegenüber den anderen Betriebstypen jedoch auf einem wesentlich tieferen Niveau.

Die Untersuchung der Verkehrsmilchbetriebe beschränkt sich auf jene der Talregion,da in der Bergregion die Sömmerungsarbeiten mitberücksichtigt werden müssten,diese aber derzeit nur unzureichend bekannt sind.
Zeitbedarf «Verkehrsmilchbetrieb, Talregion»
1990199620012010
18,3 Kühe Masse je Bestand:
1 168 t Masse je Kuh: Melken 39 t
Füttern 24 t
Misten 0,4 t
Getreide 0,65 ha
Zuckerrüben 0,02 ha
Kartoffeln 0,04 ha
Futterbau 12,04 ha
19,3 Kühe Masse je Bestand:
1 195 t Masse je Kuh: Melken 37 t
Füttern 24 t
Misten 0,4 t
Getreide 0,80 ha
Zuckerrüben 0,03 ha
Kartoffeln 0,06 ha
Futterbau 13,79 ha
Arbeit / Betrieb Misten
Arbeit / Betrieb Füttern
Arbeit / Betrieb Restarbeit
Arbeit / Betrieb Melken
Arbeit / Betrieb Futterbau
21,7 Kühe Masse je Bestand: 590 t Masse je Kuh: Melken 5 t
Füttern 22 t
Misten 0,4 t
Getreide 0,94 ha
Zuckerrüben 0,04 ha
Kartoffeln 0,05 ha
Futterbau 15,37 ha
26,5 Kühe Masse je Bestand: 380 t Masse je Kuh: Melken 4 t
Füttern 10 t Misten 0,4 t
Getreide 1,20 ha
Zuckerrüben 0,06 ha
Kartoffeln 0,05 ha
Futterbau 18,50 ha
Arbeit / Betrieb Kartoffeln
Arbeit / Betrieb Zuckerrüben
Arbeit / Betrieb Getreide
Quelle: FAT
Der Arbeitszeitbedarf des «Verkehrsmilchbetriebes,Talregion» ist im Betriebstypenvergleich deutlich am höchsten.Am meisten Arbeit verursacht dabei erwartungsgemäss die Milchviehhaltung.Insgesamt nimmt der Arbeitszeitbedarf trotz zunehmender Bestandesgrösse seit 1996 leicht ab.Dies ist zum einen auf die konsequente Nutzung des technischen Fortschritts zurückzuführen,zum andern aber insbesondere auch darauf,dass immer mehr Milchkühe in Laufställen stehen.Es wird damit gerechnet, dass bis im Jahr 2010 rund 40% der Milchkühe in Laufställen gehalten werden bei einer durchschnittlichen Bestandesgrösse von 30 Kühen.In der Milchviehhaltung ermöglicht dieser Anpassungsprozess eine erhebliche Vergrösserung der Betriebe im Durchschnitt,ohne dass die Arbeit je Betrieb ansteigt.Gleichzeitig nimmt die physische Belastung deutlich ab.
Die Landwirtschaft ist in den letzten Jahren unter zunehmenden wirtschaftlichen Druck geraten.Nachfolgend interessiert uns,ob sich diese Veränderung der beruflichen Belastung möglicherweise auch in den gesundheitlichen und sozialen Entwicklungen niedergeschlagen hat.Als Datengrundlagen für diese Analysen dienten die Schweizerischen Gesundheitsbefragungen (1992,1997 und 2002) und die Volkszählungen (1970,1980,1990 und 2000) des BFS.
Obwohl der Anteil der Landwirte,die ihren Gesundheitszustand als «mittelmässig», «schlecht» oder «sehr schlecht» einschätzen,in den letzten zehn Jahren stetig zurückgegangen ist,beurteilen sie ihre Gesundheit immer noch als schlechter als die übrigen Männer.Deren Bewertung ist seit 1992 stabil geblieben.
Im Gegensatz zu den Landwirten sind es bei den Frauen die Bäuerinnen,die ihre Gesundheit als besser einschätzen als die übrigen Frauen.1997 wurde der subjektive Gesundheitszustand sowohl von den Bäuerinnen als auch von der Vergleichsgruppe als schlechter eingeschätzt als in den Jahren 1992 und 2002.Praktisch keine Bäuerinnen beurteilen ihren Gesundheitszustand als sehr schlecht.
Niedergeschlagenheit (in der Woche vor der Befragung)
LandwirteVergleichsgruppe Männer
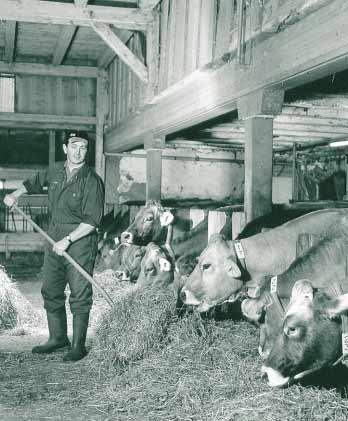
an 1–2 Tagen pro Woche an 3–4 Tagen pro Woche praktisch jeden Tag
Quelle: BFS
1992 gaben 33% der befragten Landwirte an,in der Woche vor der Befragung an mindestens einem Tag niedergeschlagen gewesen zu sein,2002 waren es 28%.Bei der Vergleichsgruppe Männer nahm dieser Anteil ähnlich ab:1992 waren 28% von Niedergeschlagenheit betroffen,2002 24%.
Niedergeschlagenheit (in der Woche vor der Befragung)
BäuerinnenVergleichsgruppe Frauen 40 35 30 15
25 20 5 10
an 1–2 Tagen pro Woche an 3–4 Tagen pro Woche praktisch jeden Tag
1992 waren 39% der Bäuerinnen in der Woche vor der Befragung mindestens an einem Tag niedergeschlagen,2002 31%.1992 trat bei 31% der Vergleichsgruppe Frauen Niedergeschlagenheit auf,2002 sank dieser Anteil auf 25%.
Ein- und Durchschlafstörungen (in den vier Wochen vor der Befragung)
Die starken Schlafstörungen sind bei den Landwirten von 1992 bis 2002 zurückgegangen.Bei der Vergleichsgruppe Männer nahmen sie dagegen eher zu.
Ein- und Durchschlafstörungen (in den vier Wochen vor der Befragung)
Bei den Bäuerinnen und der Vergleichsgruppe Frauen haben insbesondere die leichten Schlafstörungen 1997 gegenüber 1992 zugenommen,2002 sind sie aber wieder zurückgegangen.Beinahe die Hälfte der befragten Frauen gab 2002 an unter Schlafproblemen zu leiden,10 bis 15% sind stark davon betroffen.
Der Alkoholkonsum der Landwirte nahm in der Zeitspanne 1992 bis 2002 insgesamt etwas zu,bei der Vergleichsgruppe ging er leicht zurück.2002 unterscheidet er sich bei den beiden Gruppen wenig.
Bei den Bäuerinnen ist ein beachtlicher Anstieg derjenigen festzustellen,welche nie Alkohol trinken:2002 lag der Anteil bei 50%.Auch bei der Vergleichsgruppe Frauen ist ein ähnlicher Trend festzustellen,aber auf einem tieferen Niveau.
Berufliche Situation und hohe Arbeitsbelastung können Einschränkungen der sozialen Integration zur Folge haben.Als Indikator für die Teilnahme am öffentlichen Leben wird hier die Vereinstätigkeit betrachtet.
Landwirte nehmen etwas weniger an Vereinsanlässen teil als die übrigen Männer. Knapp die Hälfte der Landwirte wies sowohl 1992 als auch 2002 eine Mitgliedschaft in einem Verein auf.Bei der Vergleichsgruppe nahm der Anteil jener mit einer Vereinsmitgliedschaft von 1992 bis 2002 leicht ab.
Frauen sind allgemein seltener Mitglied eines Vereins als Männer.Bei den Bäuerinnen wiesen 1992 45% eine Mitgliedschaft auf,2002 sank dieser Anteil auf 37%.Bei der Vergleichsgruppe Frauen lag er 1992 bei 29% und 2002 bei 31%.Bäuerinnen machen gemäss Auswertung im Vereinsleben aktiver mit als ihre Kolleginnen aus der restlichen Bevölkerung.

Scheidungen in der Landwirtschaft
Eine berufsspezifische Scheidungsrate wird nicht erhoben,jedoch können die Volkszählungen nach Berufskategorien und Zivilstand ausgewertet werden.
Die Scheidungen in der Landwirtschaft haben seit 1970 kontinuierlich zugenommen. Ein sprunghafter Anstieg zwischen 1990 und 2000 als Folge der Agrarreform ist nicht festzustellen.Der Anteil der Landwirte,die geschieden sind,ist im Vergleich zu der Gruppe «übrige erwerbstätige Männer» markant tiefer.Er lag im Jahr 2000 bei 2%,im Vergleich zu 6% bei den Männern der Vergleichsgruppe.
Der Arbeitszeitbedarf verringert sich im Betrachtungszeitraum 1990 bis 2001 und voraussichtlich auch bis 2010 bei allen untersuchten Acker- und Futterbauverfahren –auf ein ha bezogen – deutlich.In der Innenwirtschaft ist ebenfalls ein deutlicher Rückgang im Arbeitszeitbedarf je Milchkuh erkennbar.Die Untersuchungen zeigen auch,dass die Arbeitszeit im Durchschnitt der Betriebe trotz des betrieblichen Wachstums leicht zurückgegangen ist.Auf einzelnen Betrieben kann die Situation aber durchaus anders aussehen.So kann eine Aufstockung des Betriebes zu einer grösseren zeitlichen Beanspruchung führen,falls keine bedeutenden technischen oder organisatorischen Anpassungen (Lohnunternehmereinsatz,Aufgabe eines anderen Betriebszweiges etc.) vorgenommen werden.Beim Massenumschlag ist ebenfalls eine Abnahme von 1990 bis 2001 festzustellen,sowohl je Einzelkuh als auch je Betrieb.Für 2010 wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet.Die physische Arbeitsbelastung ist in den letzten zehn Jahren geringer geworden.Insgesamt dürfte der technische Fortschritt es ermöglichen,dass das Betriebsgrössenwachstum auf Grund des Strukturwandels bis 2010 im Durchschnitt keine Ausdehnung der Arbeitszeit und eine weitere Abnahme der physischen Arbeitsbelastung des einzelnen Landwirts mit sich bringen wird.
Die ausgewerteten Daten der Gesundheitsbefragungen zeigen,dass das gesundheitliche Befinden bei den Landwirten und Bäuerinnen insgesamt eher besser geworden ist.So fühlen sich Landwirte im Jahr 2002 nach eigenem Urteil gesünder als vor zehn Jahren.Bei Indikatoren,die das psychische Befinden abbilden,sind die Ergebnisse 2002 sowohl bei den Landwirten als auch bei den Bäuerinnen besser als 1992.Die Befragungen zeigten ausserdem,dass sich Landwirte 2002 immer noch gleich oft am öffentlichen Leben beteiligen,hier durch die Teilnahme an Vereinsanlässen repräsentiert,wie vor zehn Jahren.Bei den Bäuerinnen war die Teilnahme dagegen rückläufig. Sie ist allerdings nach wie vor grösser als bei den Frauen der Vergleichsgruppe.Die Zahl der geschiedenen Landwirte schliesslich ist seit 1970 kontinuierlich gestiegen.Ein erhöhter Anstieg in den neunziger Jahren als Folge der Agrarreform konnte nicht festgestellt werden.
■ Reaktionen bleiben nicht aus
Die vergangenen Jahre haben gezeigt,dass Massnahmen,Instrumente und Konzepte, die den ländlichen Raum betreffen (z.B.Service public,neue Regionalpolitik,Agrarpolitik) in der Öffentlichkeit mit grossem Interesse verfolgt werden und zu intensiven Diskussionen führen.Eine eigentliche,umfassende und konsistente «Politik des ländlichen Raumes» existiert aber nicht.Es sind vielmehr zahlreiche Sektoral- und Sachpolitiken,die den ländlichen Raum unterschiedlich in seiner Entwicklung beeinflussen. Mit dem Bericht «Agglomerationspolitik des Bundes» von Ende 2001 hat der Bund deutlich gemacht,dass er künftig einen grösseren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der schweizerischen Agglomerationen leisten will.Das Projekt ist inzwischen gestartet.Damit wurden aber auch die Akteure des ländlichen Raumes herausgefordert,eine Politik aus einer Gesamtsicht für diese Gebiete zu formulieren.
Prägendste Merkmale,welche die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der letzten Dekade verändert haben,sind technologische Innovationen,sinkende Mobilitätskosten sowie die Globalisierung und damit die einhergehende Liberalisierung.Die Folgen hierfür sind durchlässigere Grenzen,grössere Märkte,intensiverer Wettbewerb der Unternehmungen und Standorte,Zwang zu Effizienz und Innovation sowie eine eingeschränkte nationale Autonomie.Diese Herausforderungen an die gesamte Volkswirtschaft betreffen aber auch die ländlichen Räume.Teilweise treten sie dort aber akzentuierter auf,zumal die Wirtschaft eher wertschöpfungsschwach und kleinstrukturiert ist.Der Druck zur Abwanderung nimmt zu,nicht zuletzt sind es die jungen und gut ausgebildeten Leute,die aufgrund der mangelnden Alternativen von Arbeitsplätzen wegziehen oder pendeln.Das Disparitätengefälle Zentrum – Peripherie verstärkt sich. Der Abbau staatlicher oder parastaatlicher Monopole verändert das Angebot der Grundversorgung.Die Verschiebungen der demographischen Strukturen führen zu einer gewissen Überalterung.Dörfliche Strukturen verbunden mit ihren sozialen und kulturellen Werten drohen an Stabilität zu verlieren.Der Strukturwandel in der Landwirtschaft beeinflusst vor- und nachgelagerte Gewerbe.Leerstehende,ungenutzte Ökonomiegebäude,vergandende Landwirtschaftsflächen sind weitere Effekte auf das Siedlungsbild und die Landschaft.Die Zersiedelung und Zerstörung der Landschaft insbesondere in agglomerationsnahen oder touristisch attraktiven Räumen geht weiter.
Um auf die Herausforderungen zu reagieren,wurden in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Revisionen und Reformen auf Bundesebene gestartet.Einige sind bereits abgeschlossen und treten in Kraft.
Regionalpolitik
NRP = Neue Regionalpolitik
Strategiewechsel:Weg von der interregionalen Umverteilung hin zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen.Beabsichtigt wird, die Regionalpolitik neu auf Programme und Projekte auszurichten,welche in den Regionen das Unternehmertum und Innovationen unterstützen.Es soll dafür gesorgt werden,dass ländliche Räume und Berggebiete vermehrt von der Dynamik starker nationaler und regionaler Zentren profitieren.
Expertenbericht:Veröffentlicht am 6.Februar 2003;
Vorbereitung einer Botschaft an das Parlament 2004.
Wald / Forstpolitik
WAP = Waldprogramm
Im WAP soll umschrieben werden,wie der Wald im Jahr 2015 mit Hilfe des staatlichen Handelns aussehen soll.Im Hinblick auf die Umsetzung des Programms werden konkrete staatliche Eingriffe definiert.
Ende 2003:BUWAL wird den Schlussbericht mit entsprechenden Massnahmenvorschlägen dem Departementsvorsteher vorlegen.
Finanzausgleich
NFA = Neuer Finanzausgleich
Der NFA soll die Aufgaben,Kompetenzen und Finanzströme zwischen Bund und Kantonen so weit wie möglich und sinnvoll entflechten.Die Verantwortlichkeiten der beiden Staatsebenen sollen gemäss dem Subsidiaritätsprinzip und dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz geklärt werden.Ziel ist es,Bund und Kantone zu stärken, indem jeder staatlichen Ebene jene Aufgaben zugeteilt werden,die sie am besten zu erfüllen vermag.
Zweistufiges Verfahren:
1.Erste NFA-Botschaft (14.November 2001) mit dem Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA) sowie sämtlichen Verfassungsänderungen und Totalrevision Bundesgesetz über den Finanzausgleich (FAG).Parlamentarische Beratung im Gange.
2.Zweite NFA-Botschaft mit Anpassungen in den übrigen Bundesgesetzen (ausstehend).
Landwirtschaft
Agrarpolitik 2007
Mit dem Revisionspaket Agrarpolitik 2007 verfolgte der Bundesrat den in den neunziger Jahren eingeschlagenen Reformweg konsequent weiter.Die agrarpolitischen Massnahmen werden auf die neuen Herausforderungen hin optimiert. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen für die weitere Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft.
Revision LwG:abgeschlossen (20.Juni 2003);
Revidiertes LwG tritt am 1.Januar 2004 in Kraft.
Laufende oder abgeschlossene Projekte
SachbereichZielBemerkungen
Tourismus
Innotour
Für die Finanzierung der Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus wird ein Verpflichtungskredit von 35 Mio.Fr. für die Jahre 2003–2007 bewilligt.Der Bundesbeschluss vom Oktober 1997 über die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus bezweckt,das touristische Angebot der Schweiz möglichst rasch und gezielt an die neuen Weltmarktbedingungen heranzuführen.Eine Kombination von Wettbewerb und Kooperation soll dabei Innovationen und neue Strukturen hervorbringen.
Stand der Arbeiten (Herbst 2003)
Botschaft Bundesrat: 20.September 2002;
Parlamentarische Beratung abgeschlossen.
Umwelt
Neues Parkkonzept
Teilrevision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG):In vielen Regionen prüfen zurzeit Bevölkerung,Gemeinden und regionale Körperschaften die Gründung von Natur- und Landschaftspärken.Dabei streben sie an, wertvolle Lebensräume zu schützen und zu pflegen sowie besonders schöne Landschaften in die regionalen Wirtschaftskreisläufe einzubetten und auf dem ökotouristischen Markt anzubieten.
Vernehmlassung abgeschlossen.
BUWAL erarbeitet eine Botschaft zur Gesetzesrevision (Herbst 2003).
Raumplanung
Teilrevision der Raumplanungsverordnung (RPV)

Die RPV wird durch einen Artikel ergänzt,der präzisiert,in welchem Ausmass Wohnbauten geändert werden können,die ursprünglich landwirtschaftlich genutzt wurden und neu landwirtschaftsfremd bewohnt werden sollen.
Änderung trat am 1.Juli 2003 in Kraft.
■ Eine Definition des ländlichen Raumes gibt es ebenso wenig …
Kommt man auf ländliche Räume zu sprechen,so gibt es eine grosse gesellschaftliche Übereinstimmung:Wir alle wollen ländliche Räume,die ökonomisch, ökologisch,sozial und kulturell intakt sind und in denen das Leben lebenswert ist und bleibt.Mit ihrer jeweils eigenen geographischen,historischen,kulturellen und wirtschaftlichen Prägung zeichnen sich die Räume der Schweiz durch eine erstaunliche Vielfalt aus.Die Frage bleibt:Was ist der ländliche Raum?
Eine einheitliche bzw.für alle Regionen verbindliche Definition des ländlichen Raumes ist nicht möglich.Weder die Einwohner- oder Arbeitsplatzdichte noch die Nähe von Zentren oder die Qualität der Verkehrsnetze sind hinreichende Kriterien für eine eindeutige Definition.Der Ansatz,den ländlichen Raum gemäss der Raumstatistik von den Agglomerationsräumen als nicht-städtischen Raum zu definieren und nur als eine Restgrösse festzulegen,ist unzureichend,da er der Dynamik,Vielfalt und Eigenständigkeit ländlicher Räume nicht gerecht wird.Die ausserordentliche Vielfalt von Tätigkeiten und die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstände in der Schweiz geben Anlass zur Annahme,dass es den ländlichen Raum nicht gibt,sondern eben nur viele und mannigfaltige.Dies ergibt sich durch die Geschichte,die demographische Entwicklung,die geographische Lage,den Charakter der Landschaft,die Siedlungsstruktur,die Art der Landbewirtschaftung,die ausseragrarische Wirtschaftsstruktur,die Pendlerverflechtungen,die Sprachen,Traditionen und Mentalitäten der hier lebenden Menschen.
■ wie eine Koordination der zahlreichen Politiken zugunsten des ländlichen Raumes
Praktisch jede Politik wirkt direkt oder indirekt in den Raum.Einige rechtliche Erlasse sind sogar explizit nur an einen räumlichen Geltungsbereich gebunden.Flächenbetont sind insbesondere die Sektoralpolitiken Land- und Forstwirtschaft,Tourismus,Naturund Heimatschutz.Hinzu kommen die Sachpolitiken wie Raumplanung,Regional- und Verkehrspolitik sowie der Finanzausgleich.Darüber hinaus verfügen die subnationalen Gebietseinheiten,das heisst die Kantone und Gemeinden,ebenso über ausgedehnte eigene Regelungsbefugnis (z.B.Steuern und Wirtschaftsförderung).Daraus entsteht ein enorm komplexes System an Gebiets- und Sachpolitiken,die sich ergänzen, überschneiden,konkurrenzieren und zum Teil auch widersprechen.Erschwerend kommt hinzu,dass die räumlichen Entwicklungstendenzen der letzten Jahre nicht an den institutionellen Grenzen Halt machen,mit anderen Worten:Die politische Gebietsaufteilung und die sozioökonomischen,räumlichen Realitäten entwickeln sich laufend auseinander.Es besteht ein Handlungsbedarf insbesondere in der Koordination der raumrelevanten Politiken in horizontaler und vertikaler Sicht.
■ Stärken nutzen im ländlichen Raum
Ländliche Räume sind nicht blosse Zulieferanten von Rohstoffen oder nur einfach Hinterland für Erholungssuchende.Sie verstehen sich als Komplementärräume mit zahlreichen Trümpfen,um auf die oben erwähnten Herausforderungen zu reagieren. Sie haben damit auch Chancen,sich dynamisch zu entwickeln und nicht zwingend Muster der grossen Städte und deren Umfeld zu übernehmen.Es gilt die eigenen regionaltypischen Strukturen kreativ weiter zu entwickeln und die endogenen Kräfte zu mobilisieren.Die Möglichkeiten von Zusammenarbeitsformen mit Städten und Agglomerationen sind aktiv zu nutzen.
■ Eine Handlungsachse der AP 2007 lautet: Den ländlichen Raum stärken!
Ohne die Landwirtschaft,die mit Abstand die grösste Flächennutzerin in der Schweiz darstellt,kann keine Entwicklung des ländlichen Raumes erfolgen.Gleichzeitig ist die Landwirtschaft aber überfordert,allein eine wirtschaftliche Dynamik im ländlichen Raum zu entfachen.Der Landwirtschaftssektor bietet – regional unterschiedlich –lediglich zwischen 2% und 10% der Arbeitsplätze.Ländliche Entwicklung ist daher als eine komplexe Aufgabe zu verstehen,die sich nicht nur auf die Landwirtschaft konzentrieren darf.

Eine der fünf Handlungsachsen bei der Revision des LwG (vgl.auch Kapitel Agrarpolitik 2007) beinhaltet die Stärkung des ländlichen Raumes.Beschlossen wurde,die Fördermöglichkeiten – insbesondere im Bereich der Strukturverbesserungen – so auszubauen,damit lokale und regionale Wertschöpfung generiert werden kann.Angestrebt werden auch Kooperationen mit Tourismus,Gewerbe,Handwerk,Dienstleistung usw.
■ Bundesnetzwerk: Entwicklung des ländlichen Raumes
Das Thema «Politik des ländlichen Raumes» wird auf Bundesebene vertieft.Im Frühjahr 2003 wurde mit dem Aufbau eines Netzwerkes begonnen,das versucht die Koordination der raumrelevanten Politiken zu verbessern und so eine Kohärenz im ländlichen Raum zu schaffen.Das Netzwerk versteht sich als Plattform zur Förderung der Information zwischen den Bundesstellen.Es will die Anliegen des ländlichen Raumes aufnehmen und in eine Gesamtsicht bringen.Darüber hinaus soll das Netzwerk die Kontakte mit Vertretern von Kantonen,Regionen und Organisationen knüpfen.
Das Netzwerk steht unter dem Dach der Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK). Diese Konferenz befasst sich als departements- und amtsübergreifendes Organ mit den Informations- und Koordinationsfragen der Raumordnungspolitik.In ihr sind sämtliche Verwaltungseinheiten vertreten,denen die Erfüllung von Aufgaben übertragen ist,die im weitesten Sinne als raumordnungspolitisch relevant bezeichnet werden können.Da die Erfüllung raumordnungspolitisch bedeutsamer Aufgaben regelmässig eng mit finanziellen Aspekten gekoppelt ist,ist auch das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) im Kreis der ROK-Mitglieder vertreten.Die ROK wird durch die für Regionalpolitik und Raumplanung zuständigen Fachstellen des Staatssekretariates für Wirtschaft (seco) und des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) gemeinsam geleitet.
Im vorliegenden Agrarbericht werden neben den Grunddaten zu Bodennutzung und Produktionsmitteln die Themen Klima,Luft und Energie vertieft behandelt.Durch menschliche Tätigkeiten werden jährlich grosse Mengen von mehr oder weniger schädlichen Gasen,Aerosolen und Staubteilchen in die Atmosphäre ausgestossen.Dies führte vor allem seit den fünfziger Jahren zu einer erheblichen und andauernden Belastung der Umwelt,welche sich für Menschen,Tiere und Pflanzen schädlich auswirkt.Aus den Bereichen Verkehr,Feuerungen,Industrie und Gewerbe,Landwirtschaft und Haushalte stammt denn auch der Grossteil der Emissionen.Je nach Schadstoff ist der Anteil der verschiedenen Sektoren am Gesamtausstoss der Emissionen aber sehr unterschiedlich.
Die Landwirtschaft ist Hauptemittent der Stoffe Ammoniak (NH3),Methan (CH4) und Lachgas (N2O),aber auch Emissionsquelle von Feinstaub mit Partikelgrösse kleiner als 10 µm (PM10).Die Wirkung von CH4 und N2O als Treibhausgase,deren Emissionsquellen und die Massnahmen zur Reduktion werden im Abschnitt über das Kapitel Klima ausführlich beschrieben.Die Emissionen von NH3 wie auch die Dieselrussemissionen (insbesondere von Traktoren) stehen in direktem Zusammenhang mit der Bildung von zum Teil umweltbelastendem,toxischem Feinstaub (PM10) in der Luft. Informationen dazu gibt es im Abschnitt über die Luft.Im Abschnitt über die Energie wird der Verbrauch und der Umgang mit Energieressourcen näher unter die Lupe genommen.

Die Art und Weise der Bodennutzung und der Einsatz von Produktionsmitteln geben Hinweise über den Stand wichtiger,umweltrelevanter Entwicklungen im landwirtschaftlichen Produktionsprozess.Aussagen über die Umweltauswirkungen der Prozesse lassen sich daraus nicht ableiten.
Entwicklung des Anteils der Fläche mit umweltschonender Bewirtschaftung

■ Der natürliche Treibhauseffekt ist lebenswichtig
Die Temperatur auf der Erde hängt vom natürlichen Treibhauseffekt ab.Die kurzwellige Sonnenstrahlung kann die Erdatmosphäre vergleichsweise ungehindert durchdringen. Die Erdoberfläche absorbiert die einfallende kurzwellige Sonnenstrahlung und strahlt sie zum Teil als langwellige Wärmestrahlung in die Atmosphäre zurück.Wasserdampf (H2O),Kohlendioxid (CO2),Methan (CH4),Lachgas (N2O) und andere Gase in der Erdatmosphäre nehmen diese Wärmestrahlung auf,beziehungsweise strahlen einen grossen Teil davon wieder zurück an die Erdoberfläche.Dank diesem natürlichen Treibhauseffekt gibt es überhaupt Leben auf der Erde.Ohne diesen Effekt würde die globale Durchschnittstemperatur bei etwa –18 Grad Celsius liegen anstelle der zur Zeit herrschenden +16 Grad Celsius.
Funktionsweise des Treibhauseffektes
Die Infrarotstrahlung wird durch die Treibhausgase teilweise absorbiert und zurückgestrahlt. Dadurch werden die untere Atmosphäre und die Erdoberfläche erwärmt
Sonnenstrahlung dringt durch die Atmosphäre



Die Erdoberfläche absorbiert den grössten Teil der Strahlung und erwärmt sich dadurch
Erdoberfläche strahlt infrarote Wärmestrahlung ab
Der natürliche Treibhauseffekt wird nun aber zunehmend durch den Menschen verstärkt.Als Folge der Emissionen von CO2,CH4,N2O sowie weiterer Gase,findet eine zusätzliche Erwärmung der Erdoberfläche und der unteren Atmosphäre statt.Die Durchschnittstemperatur auf der Erde hat im Laufe der letzten 100 Jahre um 0,6 Grad zugenommen.In der Schweiz erwärmte sich die Atmosphäre in den letzten 100 Jahren je nach Landesregion sogar um 1 bis 1,6 Grad Celsius.Je nach Prognose könnte die globale,mittlere Temperatur in den nächsten 100 Jahren um weitere 1,4 bis 5,8 Grad Celsius steigen.Die Erwärmung führt zu einer Intensivierung des atmosphärischen Wasserkreislaufs,was in unseren geographischen Breiten mehr Niederschläge,häufigere Unwetter und mehr Überschwemmungen zur Folge haben kann.
■ Dienstleistungssektor 10,8% Industrie 18,1%
Angesichts der drohenden Klimaänderung verabschiedeten 1992 154 Länder das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen.Ziel dieser Konvention ist die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau,auf dem eine gefährliche,vom Menschen verursachte Störung des Klimas verhindert wird.Ein solches Niveau sollte innerhalb eines Zeitraumes erreicht werden,der ausreicht,damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaänderungen anpassen können,die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann.
1997 kam ein Protokoll zur Klimakonvention,das so genannte «Kyotoprotokoll» zu Stande.Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich darin,ihre Treibhausgasemissionen bezogen auf das Referenzjahr 1990 um einen bestimmten Prozentsatz bis zur Periode 2008–2012 zu reduzieren.Für die Schweiz gilt,gleich wie für die EU,eine Reduktionsverpflichtung von –8%.Diese Reduktion hat die Schweiz als Gesamtes zu erbringen. Bis heute gibt es denn auch keine Zuteilung spezifischer Reduktionsziele auf die verschiedenen Emissionsquellen.Gemäss der Botschaft des Bundesrates zur Ratifizierung des Kyotoprotokolls sind für die Umsetzung insbesondere das CO2-Gesetz,das Energiegesetz und das dazu gehörige Programm Energie Schweiz sowie weitere Massnahmen auf dem Gebiet der Verkehrs-,Land- und Forstwirtschaftspolitik und im Zusammenhang mit dem Umweltschutzgesetz bedeutsam.
■ Landwirtschaftliche
Die landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen hängen primär mit der Tierproduktion zusammen.Die dabei entstehenden CH4- und N2O-Emissionen tragen zum Treibhauseffekt und damit zur Klimaveränderung bei.Die Emissionen von CO2,die in der Landwirtschaft durch den Einsatz von Motorfahrzeugen ebenfalls in geringem Umfang anfallen,werden im Rahmen der so genannten Offroad-Emissionen statistisch erfasst und im schweizerischen Treibhausgasinventar ausgewiesen.Sie belaufen sich auf unter 2% der gesamten CO2-Emissionen.
Die CH4-Emissionen hatten 2000 einen Anteil von rund 8% an den Treibhausgasemissionen der Schweiz.Hauptemittent für CH4 ist die Landwirtschaft (63% der Emissionen).Rund 86% der landwirtschaftlichen CH4-Emissionen entstehen im Verdauungstrakt der Nutztiere durch die mikrobielle Vergärung der Kohlenhydrate aus dem Raufutter (enterische Fermentation).Die restlichen 14% der landwirtschaftlichen CH4-Emissionen entweichen bei der Lagerung und Ausbringung der Hofdünger.
N2O trug im Jahr 2000 rund 7% zu den Treibhausgasemissionen der Schweiz bei, wovon 72% landwirtschaftlichen Ursprungs sind.N2O wird grösstenteils beim Umbau (Nitrifizierung,Denitrifizierung) der durch die Düngung (Hof- und Mineraldünger) oder mit Pflanzenresten in den Boden eingebrachten Stickstoffverbindungen durch Bodenlebewesen freigesetzt.Auch bei der Hofdüngerlagerung und -aufbereitung treten Emissionen auf.Die Emission von N2O nimmt mit steigendem N-Überschüssen zu. Diese wiederum finden sich vor allem dort,wo mit hohem Tierbesatz auch viel Hofdünger anfällt.
Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Werte aller Nicht-CO2-Emissionen (CH4,N2O, synthetische Gase) ihrem Klima-Erwärmungspotential entsprechend in CO2-Äquivalente (CO2eq) umgerechnet:1 kg Methan (CH4) entspricht 21 kg Kohlendioxid (CO2) und 1 kg Stickstoffoxid (N2O) entspricht 310 kg Kohlendioxid (CO2) (Umrechungswerte gemäss Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),1996,für einen Zeithorizont von 100 Jahren).

■ Emissionen aus der Landwirtschaft gehen zurü
Die Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlichen Quellen haben in den letzten zehn Jahren stetig abgenommen.Zu diesem positiven Resultat beigetragen haben die mit dem Ökologischen Leistungsnachweis verlangte ausgeglichene Düngerbilanz,die Ausdehnung der wenig oder nicht gedüngten ökologischen Ausgleichsflächen sowie die Reduktion der Tierbestände.Dadurch ging der Anfall von Hofdünger zurück.Gleichzeitig setzten die Landwirte 23% weniger N-Handelsdünger ein.
■ Graue Treibhausgasemissionen
Mit diesen Erfolgen hat die Schweizer Landwirtschaft bereits einen wichtigen Beitrag an die Reduktionsverpflichtung gemäss Kyotoprotokoll geleistet.Dieser ist umso wertvoller,als sich die Reduktion der Emissionen in anderen Sektoren als bedeutend schwieriger erweist.In der Gesamtbilanz der Treibhausgasemissionen ist denn auch noch kein Rückgang feststellbar.
Nicht alle in der Schweiz konsumierten landwirtschaftlichen Produkte werden auch im Inland produziert.Um ein realitätsnaheres Bild der durch die Schweiz im Ernährungssektor mitverursachten Treibhausgas-Emissionen zu erhalten,wurden auch die so genannten grauen,das heisst jenseits der Landesgrenzen anfallenden Emissionen untersucht.Um abzuschätzen,wie viele Treibhausgase im Ausland entweichen,um den Schweizer Nahrungsmittelbedarf zu decken,wurde eine Bilanz gerechnet,in die sowohl Emissionen im Zusammenhang mit der Produktion,der Verarbeitung,der Verpackung,dem Transport,als auch verschiedene Vorprodukte (Dünger,Pflanzenschutzmittel,Tierfutter,etc.) einfliessen.
Der Ernährungssektor wies 1998 einen Import-Überschuss grauer Treibhausgase in Höhe von rund 4,3 Mio.t CO2eq pro Jahr auf.Diese Zahl entspricht rund 11% der von der Schweiz im Ausland verursachten,grauen Treibhausgasemissionen.Für das globale Klimasystem ist es unbedeutend,wo auf der Welt menschliche Aktivitäten zu Treibhausgasemissionen führen.
Vergleich der grauen Treibhausgas-Emissionen des Ernährungssektors mit der direkten, energiebedingten Emission des Landwirtschaftssektors in der Schweiz
Vergleicht man die den importierten Produkten anzurechnenden grauen Emissionen mit den Emissionen der Schweizer Landwirtschaft fällt auf,dass bei den Importen hohe CO2-Emissionen anfallen.Diese sind vor allem transportbedingt.Sie sind bedeutend grösser als die CO2-Emissionen der Schweizer Landwirtschaft,obwohl die Schweizer Produktion rund 60% der konsumierten Nahrungsmittel abdeckt.Anders sieht es bei den CH4- und N2O-Emissionen aus.Der Anteil der Schweizer Produktion ist im Vergleich zu den Importen relativ hoch.Dies hängt mit dem hohen Selbstversorgungsgrad bei Fleischprodukten und den damit verbundenen CH4- und N2O-Emissionen zusammen. Bei den Importen handelt es sich vorwiegend um pflanzliche Erzeugnisse,die geringere CH4- und N2O-Emissionen verursachen.Die regionale Produktion und Vermarktung von Landwirtschaftserzeugnissen hat also auch positive Auswirkungen auf das Klima. Wichtig ist aber auch die Erkenntnis,dass weniger Emissionen in der Schweiz z.B. durch eine geringere Fleisch- oder Milchproduktion,bei gleichbleibendem Konsum lediglich eine Verlagerung der Emissionen ins Ausland bewirken würde.Zusätzlich würde der entsprechende Mehrimport dieser Produkte noch höhere CO2-Emissionen nach sich ziehen.
Bei den tierischen Produkten stehen den Importen Exporte (insbesondere Käse) in erheblicher Grösse gegenüber.Insgesamt sind sowohl die Importe als auch die Exporte zwischen 1990 und 1998 leicht zurückgegangen.Deutlich weniger hoch waren die Importe von grauen Treibhausgasemissionen bei den Produktionsmitteln.Hier werden Erfolge der schweizerischen Landwirtschaftspolitik sichtbar,die zu geringeren Düngeund Pflanzenschutzmitteleinsätzen führt.Bei den Getreideprodukten gab es eine leichte Senkung der Importe und eine Steigerung der Exporte.Bei Obst,Gemüse und anderen pflanzlichen Produkten sowie bei Getränken aus landwirtschaftlicher Produktion sind die grauen Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 1998 gestiegen.
Die Speicherung von Kohlenstoff in Böden (Kohlenstoffsequestrierung) ist eine von mehreren Möglichkeiten,um den CO2-Anstieg in der Atmosphäre zu verlangsamen und damit die globale Klimaveränderung teilweise abzupuffern.In einer Studie wurde der gesamte Kohlenstoffvorrat der Schweiz in landwirtschaftlichen Böden auf ca.170 Mio.t Kohlenstoff geschätzt (Leifeld et al.,2003).Die Studie zeigt auf,dass das maximale Bindungspotential eines Bodens bei den verschiedenen Bewirtschaftungssystemen und Fruchtfolgen unterschiedlich stark ausgenutzt wird.Eine dauerhafte Bodenbedeckung (z.B.durch Grünland),hohe Produktivität (diese bewirkt einen hohen Kohlenstoffeintrag in den Boden),minimale Bodenbearbeitung (verringerter oxidativer Kohlenstoffverlust) und limitierende Bedingungen für den Kohlenstoffabbau im Boden unterstützen steigende oder hohe Kohlenstoffgehalte im Boden.
■ Fazit
Der Anteil der landwirtschaftlichen Produktion an den Treibhausgasemissionen der Schweiz ist mit knapp 12% nicht unbedeutend.Die Emissionen sind in den neunziger Jahren aber kontinuierlich zurückgegangen.Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Reduktionsvorhaben gemäss Kyotoprotokoll geleistet.Für die Zukunft ist eine weitere Reduktion möglich.Tiefere Emissionen können erreicht werden mit einer qualitativ hochstehenden und bedarfsgerechten Tierernährung,dem Einsatz emissionsarmer Lagerungs- und Ausbringtechniken für Hofdünger,der Vermeidung von Stickstoffüberschüssen,sowie mit einer schonenden Bodenbearbeitung.Der Reduktion von Treibhausgasemissionen bei der landwirtschaftlichen Produktion allein sind aber Grenzen gesetzt.Der Abbau der Tierbestände wäre eine weitere Möglichkeit,allerdings würde dies ohne eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten zu einem Mehrimport von Fleisch führen,was unter dem Strich einer Verlagerung der Emissionen ins Ausland bedeutet.Für die Höhe der Treibhausgasemissionen der gesamten Ernährungskette sind die Ernährungsgewohnheiten und das Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten ebenso entscheidend.So können die Konsumentinnen und Konsumenten mit der bewussten Wahl regionaler Produkte,die nach klar definierten ökologischen Standards produziert wurden,einen wesentlichen Beitrag zu tieferen Treibhausgasemissionen leisten.

Saubere Luft ist für Pflanzen,Tiere und Menschen eine unentbehrliche Lebensgrundlage und gehört zu einer intakten Umwelt.Heute atmen wir ein mehr oder weniger stark durch menschliche Einflüsse mit Spurengasen und Partikeln angereichertes Luftgemisch.Emittierte Schadstoffe können in der Nähe der Quelle und weit davon entfernt zu erheblichen und andauernden Belastungen des Menschen und seiner Umwelt führen.Nachfolgend wird auf einige Aspekte der Luftbelastung mit Schadstoffen eingegangen,welche auch für die Landwirtschaft relevant sind.Nicht eingetreten wird auf alle Ammoniakemissionen,bei denen die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle einnimmt.Diese werden im nächsten Agrarbericht vertieft behandelt.
Zu den wichtigen Luftschadstoffen zählt Feinstaub,PM10,der ein physikalischchemisch komplexes Gemisch aus Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser kleiner gleich 10 Mikrometer ist.Er besteht sowohl aus primär emittierten wie aus sekundär gebildeten Komponenten natürlichen und anthropogenen Ursprungs (z.B. Russ,geologisches Material,Abriebspartikel,biologisches Material) und ist in seiner Zusammensetzung sehr vielfältig.Wegen der geringen Grösse der Partikel kann PM10 leicht in den Atemtrakt gelangen und zu Erkrankungen der Atemwege und des HerzKreislaufsystems führen.
Rund die Hälfte der PM10-Partikel bestehen aus so genannten sekundären Komponenten,die aus der Umwandlung von gasförmigen Vorläufern entstehen.Solche Vorläufer sind Schwefeldioxid (SO2),Stickoxide (z.B.NOX),Ammoniak (NH3) und flüchtige organische Verbindungen.
Die Land- und Forstwirtschaft ist,nebst den Baumaschinen und der Luftfahrt mit einem Anteil von rund 24% (rund 6'700 t pro Jahr) eine wesentliche Quellengruppe für primäre PM10-Emissionen in der Schweiz.

Eine wichtige Quelle von Feinstaub (PM 10) ist der Russ in den Abgasen von Dieselmotoren.Heute können diese ultrafeinen Feststoff-Partikel mit Partikelfiltern um 95% reduziert werden.Bei den neuen Baumaschinen sind diese Filter heute weitgehend Standard.Die Offroad-Emissionen der nichtlandwirtschaftlichen Bereiche dürften damit bis ins Jahr 2020 stark gesenkt werden.Eine Ausstattung aller land- und forstwirtschaftlichen Dieselmotoren mit Partikelfiltern bis ins Jahr 2020 würde es erlauben, den Ausstoss von Dieselruss jährlich von 966 auf 49 t zu reduzieren.Aus Kostengründen werden Russpartikelfilter von den Herstellern von Land- und Forstwirtschaftsmaschinen zurzeit aber nicht eingebaut.Aufgrund der bekannten,gesundheitlichen Gefährdung durch PM 10 wäre es aber schon aus Eigeninteresse heraus angebracht,den Einsatz von Partikelfiltern zu fordern.
Weitere relevante Luftschadstoffe,zu denen der Offroad-Sektor einen wesentlichen Teil beiträgt,umfassen die Stickoxide (NOX) (rund 19% der totalen NOX-Emissionen), Kohlenwasserstoffe (HC) (rund 13% der totalen HC-Emissionen) und Kohlenmonoxide (CO) (rund 16% der totalen CO-Emissionen).Bezüglich HC und CO sind es insbesondere die Landwirtschaft und der Gartenpflege- und Hobbysektor mit ihren vielen kleinen,hochemittierenden Ottomotoren (vor allem 2-Takt-Motoren),die zu den Hauptverursacherngehören.
Der Einsatz von Technik und von Hilfsstoffen hat in den letzten 100 Jahren auch in der Landwirtschaft stark zugenommen.Entsprechend angestiegen ist der Einsatz von Energie.
Der Anteil der Landwirtschaft am gesamten Energieverbrauch ist zwar gering,die Energieeffizienz der Agrarsysteme,das heisst der Energieaufwand in Form von Produktionsfaktoren bezogen auf den Energieertrag in Agrarprodukten nahm in den letzten rund 100 Jahren aber stark ab.
Rund 50% des Energiekonsums der Landwirtschaft gehen aktuell auf die Nutzung von Elektrizität und fossilen Energieformen wie Diesel,Benzin und Heizöl zurück.Die graue Energie,welche in Maschinen und Gebäuden steckt,stellt mit rund 40% einen weiteren bedeutenden Posten dar.Rund 6% der Energie wird für die Bereitstellung von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln wie Dünger und Pflanzenschutzmittel sowie Futtermittel und Samen aufgewendet.
Der Einsatz von Energie in der Landwirtschaft ist bis 1990 angestiegen.Seit diesem Zeitpunkt ist er stabil geblieben.Zu diesem Ergebnis beigetragen haben insbesondere der geringere Import von Kraftfutter und der Rückgang beim Einsatz von Mineraldüngern.
Bei der in Agrarerzeugnissen enthaltenen Energie ist eine parallele Entwicklung zum Energieverbrauch zu beobachten,das heisst die in Agrarerzeugnissen enthaltene Energie ist ebenfalls gestiegen.Mit 20% war die Steigerung aber geringer als beim Energieverbrauch.Die Energieeffizienz verschlechterte sich entsprechend um über 10 Prozentpunkte zwischen 1970 und 1990.Seit 1990 ist bei der in Agrarerzeugnissen enthaltenen Energie eine Stabilisierung eingetreten.Die Entwicklung der letzten zehn Jahre zeigt,dass sich das Verhältnis zwischen Energieeinsatz für die Produktion und Energieinhalt in den Agrarerzeugnissen nicht weiter verschlechtert hat.Dies bedeutet, dass der Trend «mehr Energie je produzierte Nahrungseinheit» gebrochen werden konnte.

■ Energieverbrauch für Fleisch- und Pflanzenproduktion
Nachdem im Agrarbericht 2001 der Energieverbrauch für die Milchproduktion etwas genauer unter die Lupe genommen wurde,wird in diesem Bericht der Energieeinsatz für die Produktion von Fleisch und Ackerkulturen vorgestellt.Wie 2001 stützen sich die Berechnungen auf eine vereinfachte Ökobilanz für 52 Betriebe unterschiedlicher Produktionsausrichtung und in verschiedenen Produktionszonen ab.
Energieverbrauch je kg Fleisch 1998
Der Verbrauch an nicht erneuerbarer Energie in der Fleischproduktion variiert wie bei der Milchproduktion beträchtlich.Die Unterschiede zwischen den Betrieben sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen,können aber noch nicht abschliessend erklärt werden.Ein Projekt «Zentrale Auswertung – Ökobilanzierung» (eine Erhebung und Auswertung von umfassenden ökologischen Daten auf 300 Praxisbetrieben und ihre Verknüpfung mit Buchhaltungsergebnissen) das vom BLW beschlossen wurde und 2003 gestartet werden soll,wird wichtige Informationen zum besseren Verständnis der Ursachen liefern.
Auch bei den Ackerkulturen sind zwischen den Betrieben beträchtliche Unterschiede im Energieaufwand festzustellen.Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Wahl der Kulturen.Für die Ackerkulturen ist typisch,dass der Energieeinsatz vor allem bei Maschinen,Dünger und Saatgut und weniger bei den Gebäuden anfällt.

Mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) soll die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere gefördert werden. Das RAUS-Programm enthält hauptsächlich Bestimmungen zum Auslauf auf der Weide bzw.im Laufhof oder im Aussenklimabereich beim Geflügel.Im BTS-Programm werden vor allem qualitative Anforderungen an den Liegebereich gestellt.Die Teilnahme an einem solchen Programm ist freiwillig.
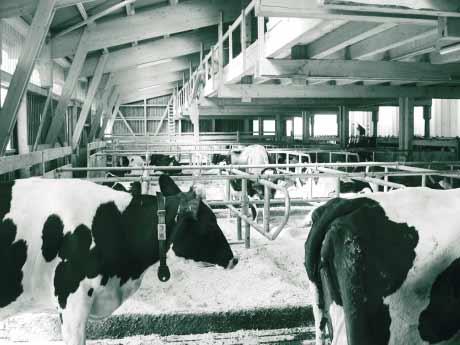
Seit der Einführung von RAUS (1993) und BTS (1996) nahm die Beteiligung an beiden Programmen stetig zu:So hat sich die Beteiligung der Betriebe an RAUS von 1993 bis 2002 fast verachtfacht (von rund 4'500 auf 34‘800) und diejenige am BTS beinahe vervierfacht (von knapp 4'500 auf etwa 16‘700).
Gemessen am gesamten schweizerischen Nutztierbestand betrug der Anteil der GVE, die nach RAUS- bzw.BTS-Anforderungen gehalten wurden,1996 19% bzw.9%.Im Jahr 2002 waren es 61% bei RAUS und 30% bei BTS;diese Werte sind Durchschnittszahlen der vier Tierkategorien (Rindvieh, übrige Raufutter Verzehrer,Schweine, Geflügel).
bei RAUS 2002 80 70 60 50 40 30 20 10
übrige Raufutter
Anteil Tiere (in GVE)Anteil Betriebe Quelle: BLW
Die Beteiligung bei RAUS nach Tierkategorie und Betrieb zeigt,dass bei Betrieben mit Rindvieh prozentual etwas weniger Tiere als Betriebe mitmachten.Bei den anderen Tierkategorien nahmen dagegen Betriebe mit überdurchschnittlich grossen Tierbeständen am RAUS-Programm teil.
Beteiligung Rindvieh übrige Raufutter Verzehrer SchweineGeflügel 0
Anteil Tiere (in GVE)Anteil Betriebe

Bei RAUS nahm die Beteiligung zwischen 1996 und 2002 bei allen Tierkategorien –ausser beim Geflügel – deutlich zu.Der Grund für den Rückgang beim Geflügel nach 1999 dürfte darauf zurückzuführen sein,dass die Mastpoulets mit weniger als 56 Masttagen aus dem RAUS-Programm ausgeschlossen wurden.

Beim BTS-Programm sticht die hohe Beteiligung beim Geflügel heraus.Der Hauptgrund dafür ist,dass bei vielen Labels die BTS-Anforderungen eine Grundvoraussetzung sind.Das BTS-Programm für Schweine wurde erst 1997 eingeführt.Die Entwicklung war auch dort erfreulich.Gegenüber dem Einführungsjahr wurden beinahe sechsmal mehr Schweine in BTS-Ställen gehalten.
Die Wirkungsanalyse der Tierhaltungsprogramme hat zum Ziel,deren Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlergehen der Nutztiere unter Praxisbedingungen aufzuzeigen. Die Untersuchungen wurden bei Milchkühen und Mastschweinen durchgeführt.Die Schlussresultate bei den Milchkühen wurden im Agrarbericht 2002 vorgestellt.Diese zeigten,dass Betriebe mit BTS+RAUS deutlich besser abschneiden als Betriebe ohne Programm.Auch das Programm RAUS alleine bewirkt Verbesserungen,die jedoch nur bei Lahmheit und Zitzenverletzungen signifikant waren.Nachfolgend werden nun die Schlussergebnisse zu den Untersuchungen bei den Mastschweinen präsentiert.
Die Gesundheit und das Wohlergehen der Mastschweine wurden anhand von folgenden Indikatoren beurteilt:Vorkommen von Husten,Durchfall,Lahmheit,Anzeichen von Schwanzbeissen,Verletzungen oder Sonnenbrand.Auffälliges Verhalten wie Hundesitz oder Aggression gegenüber der Untersuchungsperson wurde ebenfalls aufgezeichnet. Weiter wurden Einzeltieruntersuchungen auf Hautveränderungen durchgeführt.An der Studie nahmen 47 Betriebe,die sich an BTS+RAUS beteiligten,und 37 Betriebe ohne Programm teil.Auf jedem Betrieb wurden zwei Mastgruppen beobachtet,wobei jede Mastgruppe kurz nach dem Einstallen und kurz vor der Schlachtung untersucht wurde.
Insgesamt wiesen die untersuchten Mastschweine einen sehr guten Gesundheitszustand auf.Veränderungen des Schwanzes durch Schwanzbeissen waren bei BTS+RAUS-Betrieben signifikant seltener als in Betrieben ohne Programm.Ebenfalls signifikant tiefer war auf BTS+RAUS-Betrieben die Anzahl Schweine,die im Hundesitz verharrten oder festlagen.Veränderungen der Haut an den Gelenken wie Verletzungen, verstärkte Verhornung der Haut oder Liegeschwielen wurden in BTS+RAUS-Betrieben signifikant weniger festgestellt.Tendenziell wurden in BTS+RAUS-Betrieben seltener Antibiotika im Einstallfutter eingesetzt,um Erkrankungen zu behandeln oder vorzubeugen.Der Unterschied war jedoch nicht signifikant.
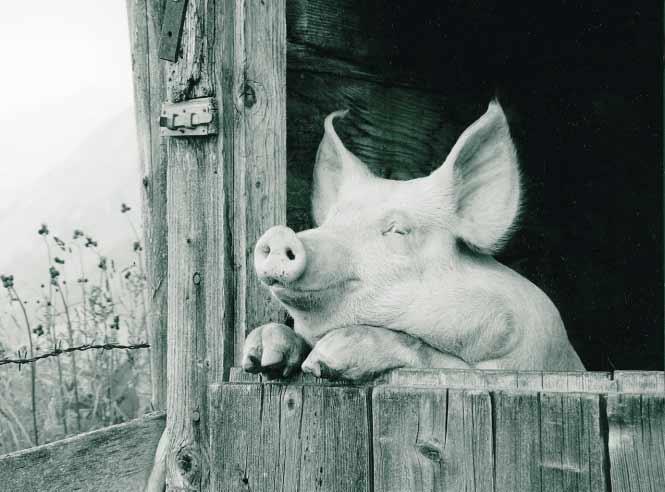
Sonnenbrand wurde erwartungsgemäss nur in BTS+RAUS-Betrieben beobachtet, betraf jedoch meist nur einzelne Tiere.Diesem Problem kann sehr wirkungsvoll entgegengewirkt werden,indem der Laufhof teilweise überdacht wird.
Innerhalb der beiden Betriebsgruppen gab es grosse Unterschiede zwischen einzelnen Betrieben.So gab es einerseits Betriebe ohne Programm,die einen sehr guten Gesundheitszustand der Mastschweine aufwiesen.Andererseits wurden auch bei einzelnen BTS+RAUS-Betrieben vermehrt Tiere mit Veränderungen beobachtet.Dies zeigt,dass die Haltungsprogramme BTS+RAUS vor allem dann einen positiven Einfluss auf Gesundheit und Wohlergehen haben,wenn sie optimal in die Praxis umgesetzt werden.
Keine Unterschiede zwischen Betrieben mit BTS+RAUS und Betrieben ohne Programm wurden für Atemwegserkrankungen,Durchfall,Lahmheit,Abszesse,Veränderungen der Organe bei der Schlachtung,Befall mit Darmparasiten und Sauberkeit der Tiere gefunden.Letztere Punkte bestätigt auch eine weitere Studie,welche Schweine in BTS+RAUS-Betrieben auf den Befall von Zoonoseerregern untersuchte.Bei keinem der untersuchten Erreger bestand ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Produktionsarten.Die Resultate zeigen,dass mit den Bedingungen von BTS+RAUS Schweinefleisch produziert werden kann,das höchsten gesundheitlichen Qualitätsansprüchen genügt.
Die Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sieht vor, dass das BLW im Agrarbericht die Resultate der Untersuchungen einer Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unterzieht.Das heisst,dass die ökonomische,soziale und ökologische Lage der Landwirtschaft und die Auswirkungen der Agrarpolitik aufgezeigt und beurteilt werden sollen.Nachfolgend wird die Beurteilung auf der Basis der heute verfügbaren Zahlen vorgenommen.Basierend auf dem im Agrarbericht 2001 vorgestellten Konzept zur Beurteilung der Nachhaltigkeit wurden im Berichtsjahr die Arbeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung von quantitativen Indikatoren weitergeführt,welche künftig zur Beurteilung der Nachhaltigkeit mit einbezogen werden sollen.
Die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2002 sind vergleichbar mit jenen des Dreijahresmittels 1999/2001.Die Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs blieb im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorjahre praktisch konstant.Die Abnahme des Nettounternehmenseinkommens um 1% ist auf höhere Ausgaben für Vorleistungen zurückzuführen (+4%),welche durch die Zunahme der sonstigen Subventionen (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen) nicht ganz kompensiert werden konnten (+8%).Die Schätzungen für das Jahr 2003 zeigen einen Rückgang,der einerseits auf die tieferen Einnahmen aus der Milchproduktion,anderseits auf die sommerliche Hitze und Trockenheit zurückzuführen ist.Das Nettounternehmereinkommen dürfte 2,835 Mrd.Fr.betragen.Dies wären 13% weniger als 2002.
Die Ergebnisse von Betrieben der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten zeigen,dass die Werte der Jahre 2000/02 für das landwirtschaftliche Einkommen je Betrieb um 11% tiefer sind als 1990/92.Die Fremdkosten (+14%) sind in dieser Zeitspanne stärker gestiegen als der Rohertrag (+6%).Die Zunahme der Fremdkosten ist auf das betriebliche Wachstum zurückzuführen.Pro Hektar sind die Fremdkosten 4% unter dem Niveau von 1990/92.Dennoch war die Kostenreduktion zu gering,um den Rückgang der Erlöse kompensieren zu können.Eine Analyse der ETH Zürich über die Performance der Betriebe zeigt auf,dass die Arbeitsproduktivität der mit Abstand wichtigste Faktor ist,welcher Betriebe mit guten Resultaten von denjenigen mit schlechten unterscheidet.Die Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse sind noch nicht ausgeschöpft.
Die Reduktion der landwirtschaftlichen Einkommen in den neunziger Jahren konnte teilweise kompensiert werden durch höhere Nebeneinkommen.Die Gesamteinkommen der Jahre 2000/02 liegen nur 5% unter dem Niveau der Jahre 1990/92.Die Investitionen und die Fremdkapitalquote sind ungefähr auf dem gleichen Stand wie zu Beginn der neunziger Jahre.Die Investitionen haben im gleichen Zeitraum von 46’900 Fr.auf 45'400 Fr.leicht abgenommen,ebenso der Fremdfinanzierungsgrad von 43 auf 41%.Die Fähigkeit,Schulden im Verlauf einer Generation zu amortisieren,ist im Vergleich zum Anfang der neunziger Jahre nicht zurückgegangen.Dies ist das Resultat einer entsprechenden Analyse der FAT.
Wie zu Beginn der neunziger Jahre gibt es aber Betriebe,deren langfristige Existenz gefährdet ist.Im Durchschnitt der Jahre 2000/02 war die finanzielle Situation bei etwas über 30% der Betriebe ungenügend für die langfristige Sicherung der betrieblichen Existenz.
Insgesamt sind im Durchschnitt der Betriebe bei den betriebswirtschaftlichen Kennziffern der letzten Jahre keine markanten Veränderungen gegenüber den Werten zu Beginn der neunziger Jahre festzustellen.Es gibt aber wie damals Betriebe,deren langfristige Existenz gefährdet ist.Die Analyse der ETH über die Performance macht deutlich,dass bei der Arbeitsproduktivität ein grosses Potential besteht,um die wirtschaftlichen Ergebnisse nachhaltig zu verbessern.

Das für die landwirtschaftlichen Haushalte massgebende Gesamteinkommen lag im Jahr 2002 um 8% unter dem Wert des Dreijahresmittels 1999/2001.Trotzdem stieg der Privatverbrauch im Durchschnitt um 2% oder 1'350 Fr.je Haushalt an,wobei er bei den Betrieben des ersten Quartils – im Gegensatz zu den übrigen Quartilen – ganz leicht zurückging.
Die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) des Bundesamtes für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2002 zeigt,dass es bezüglich Gesundheit Unterschiede zwischen Landwirten resp.Bäuerinnen und der übrigen Bevölkerung gibt:Die befragten Landwirte,aber auch die Bäuerinnen,sind häufiger übergewichtig und leiden stärker unter Rückenschmerzen als die Kontrollgruppen.Hingegen sind Landwirte resp. Bäuerinnen weniger von starken Schlafstörungen betroffen.Insbesondere die befragten Bäuerinnen sind weit öfters abstinent als ihre Kontrollgruppe.Interessant ist auch,dass Landwirte und Bäuerinnen verglichen mit ihren Kontrollgruppen deutlich weniger ernährungsbewusst sind und seltener einen Arzt aufsuchen.Oft sind die Unterschiede grösser zwischen den Männern (Landwirte und Vergleichsgruppe Männer) und den Frauen (Bäuerinnen und Vergleichsgruppe Frauen).
Im Zusammenhang mit dem Postulat Bugnon wurden die Entwicklung der Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft untersucht und Daten über den Gesundheitszustand der Bauern und Bäuerinnen ausgewertet.Im Branchenvergleich ist die Jahresarbeitszeit für selbständige Landwirte und Förster am höchsten.Modellrechnungen der FAT zeigen,dass die Arbeitszeit pro Betrieb im Durchschnitt der Betriebe trotz des betrieblichen Wachstums in etwa gleich geblieben ist.Auf einzelnen Betrieben kann die Situation aber anders aussehen.So kann eine Aufstockung zu einer grösseren zeitlichen Beanspruchung führen,falls keine bedeutenden technischen oder organisatorischen Anpassungen vorgenommen werden.Bei der körperlichen Arbeitsbelastung in der Milchviehhaltung ist zwischen 1990 und 2001 eine Abnahme festzustellen.Die ausgewerteten Daten der Gesundheitsbefragungen zeigen,dass der Gesundheitszustand bei den Bauern und Bäuerinnen insgesamt stabil geblieben ist.Beim psychischen Befinden sind die Ergebnisse 2002 eher besser als vor zehn Jahren.Die Befragung zeigt ausserdem,dass Landwirte im Jahr 2002 immer noch gleich oft an Vereinsanlässen teilnehmen wie 1992.Bei den Bäuerinnen war die Teilnahme dagegen rückläufig.Sie ist allerdings nach wie vor grösser als bei den Frauen der Vergleichsgruppe.Die Anzahl Landwirte,die geschieden sind,ist seit 1970 auch in der Landwirtschaft kontinuierlich gestiegen.Ein erhöhter Anstieg in den neunziger Jahren als Folge der Agrarreform konnte nicht festgestellt werden.
Auf Grund der Auswertungen bezüglich Arbeitsbelastung und Gesundheit gibt es keinen Hinweis,dass die Agrarreform zu sozialunverträglichen Entwicklungen geführt hat.
Die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft haben 2002 im Vergleich zum Vorjahr wieder zugenommen.Im Jahr 2002 gab es im Talgebiet (Ackerbauzonen und Hügelzone) 48'800 ha beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen,3% mehr als 2001.Die Biobetriebe bewirtschafteten im Jahr 2002 total 9,6% der LN,was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 1% entspricht.Gegenüber 56% im Vorjahr wurden 2002 61% der GVE nach den Regeln des RAUS-Programms gehalten.30% der GVE wurden gemäss Bestimmungen des BTS-Programms gehalten,was gegenüber 2001 einer Zunahme von 3% entspricht.
Die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft gingen seit Beginn der neunziger Jahre bis 1998 stark zurück.Der Phosphor- und Stickstoffeinsatz nehmen seit 1998 wieder leicht zu,während bei den Pflanzenschutzmitteln eine Stagnation eingetreten ist.Die Treibhausgasemissionen durch die Landwirtschaft sind in den neunziger Jahren um rund 10% zurückgegangen.Damit hat die Landwirtschaft bereits einen wichtigen Beitrag an die Schweizer Reduktionsverpflichtung gemäss Kyotoprotokoll geleistet.Zur Reduktion der Emissionen beigetragen haben die mit dem Ökologischen Leistungsnachweis verlangte ausgeglichene Düngerbilanz,die Ausdehnung der wenig oder nicht gedüngten ökologischen Ausgleichsflächen,die Reduktion der Tierbestände und des eingesetzten Handelsdüngers.Ein Potenzial für die Zukunft besteht mit einer qualitativ hochstehenden und bedarfsgerechten Tierernährung,dem Einsatz emissionsarmer Lagerungs- und Ausbringtechniken für Hofdünger,der Vermeidung von Stickstoffüberschüssen sowie mit einer schonenden Bodenbearbeitung.Für die Höhe der Treibhausgasemissionen der gesamten Ernährungskette sind aber die Ernährungsgewohnheiten und das Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten ebenso entscheidend.
Die Energieeffizienz,das heisst der Energieaufwand im Verhältnis zum Energieertrag in Agrarprodukten,ist seit 1990 stabil.Eine vereinfachte Ökobilanz zeigt,dass wie bei der Milchproduktion auch beim Fleisch und den Ackerkulturen zwischen den Betrieben beträchtliche Unterschiede im Energieaufwand bestehen.Daraus ergibt sich ein weiteres Verbesserungspotenzial.
Insgesamt ist die Entwicklung im ökologischen Bereich der Nachhaltigkeit insbesondere bei den Leistungen erfreulich.Bei den Belastungen sind weitere Anstrengungen nötig.Anzusetzen ist hier vor allem auf regionaler oder lokaler Ebene.

Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln.Das Gesetz gibt vor,dass die Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz innerhalb von fünf Jahren nach In-Kraft-Treten gegenüber den Ausgaben 1998 um einen Drittel abgebaut werden müssen.Im Jahr 2003 können für diese Massnahmen noch rund 800 Mio.Fr.eingesetzt werden.
Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege,die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab.Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht,weil dafür kein Markt besteht.Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher,dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden. – Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte,sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion.Im einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung,im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz.
Das Parlament hat am 25.Juni 2003 die Vorlagen zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2007) verabschiedet.Als Kernpunkt der Revision des LwG wurde die Aufhebung der Milchkontingentierung auf den 1.Mai 2009 beschlossen.Das Parlament bewilligte gleichzeitig 14,092 Mrd.Fr.für die Landwirtschaft in den Jahren 2004 bis 2007.Davon muss die Landwirtschaft gemäss Beratung des Parlamentes in der Herbstsession auch einen Beitrag zum Entlastungsprogramm 2003 im Rahmen der Sanierung der Bundesfinanzen leisten.
In Artikel 7 LwG sind die Zielsetzungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse festgelegt.Die Landwirtschaft soll nachhaltig und kostengünstig produzieren sowie aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen können.Dazu stehen die Massnahmen in den Bereichen Qualität, Absatzförderung und Kennzeichnung,Ein- und Ausfuhr,Milchwirtschaft,Viehwirtschaft,Pflanzenbau und Weinwirtschaft zur Verfügung.

■ Finanzielle Mittel 2002
Im Jahr 2002 sind zur Förderung von Produktion und Absatz im ordentlichen Rahmen rund 826 Mio.Fr.aufgewendet worden.Gegenüber dem Vorjahr sind dies rund 76 Mio.Fr.oder 8% tiefere Ausgaben.
Ausgaben für Produktion und Absatz
Rechnung 2002Budget 2003 1
AusgabenbereichBetragAnteilBetragAnteil Mio.Fr.%Mio.Fr.%
Absatzförderung597,1597,2
Milchwirtschaft60172,756568,8
Viehwirtschaft202,5445,4
Pflanzenbau (inkl.Weinbau)14617,715318,6
Total826100821100
1 Kreditsperre berücksichtigt
■ Ausblick
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Zur Linderung der Turbulenzen auf dem Milchmarkt wurden zusätzlich ausserordentliche Mittel von rund 153 Mio.Fr.aufgewendet.
Für das Jahr 2003 ist im Zahlungsrahmen ein weiterer Abbauschritt im Bereich Produktion und Absatz vorgesehen.Zusätzlich muss eine Kürzung der Budgetpositionen von 1% (Kreditsperre) vorgenommen werden.
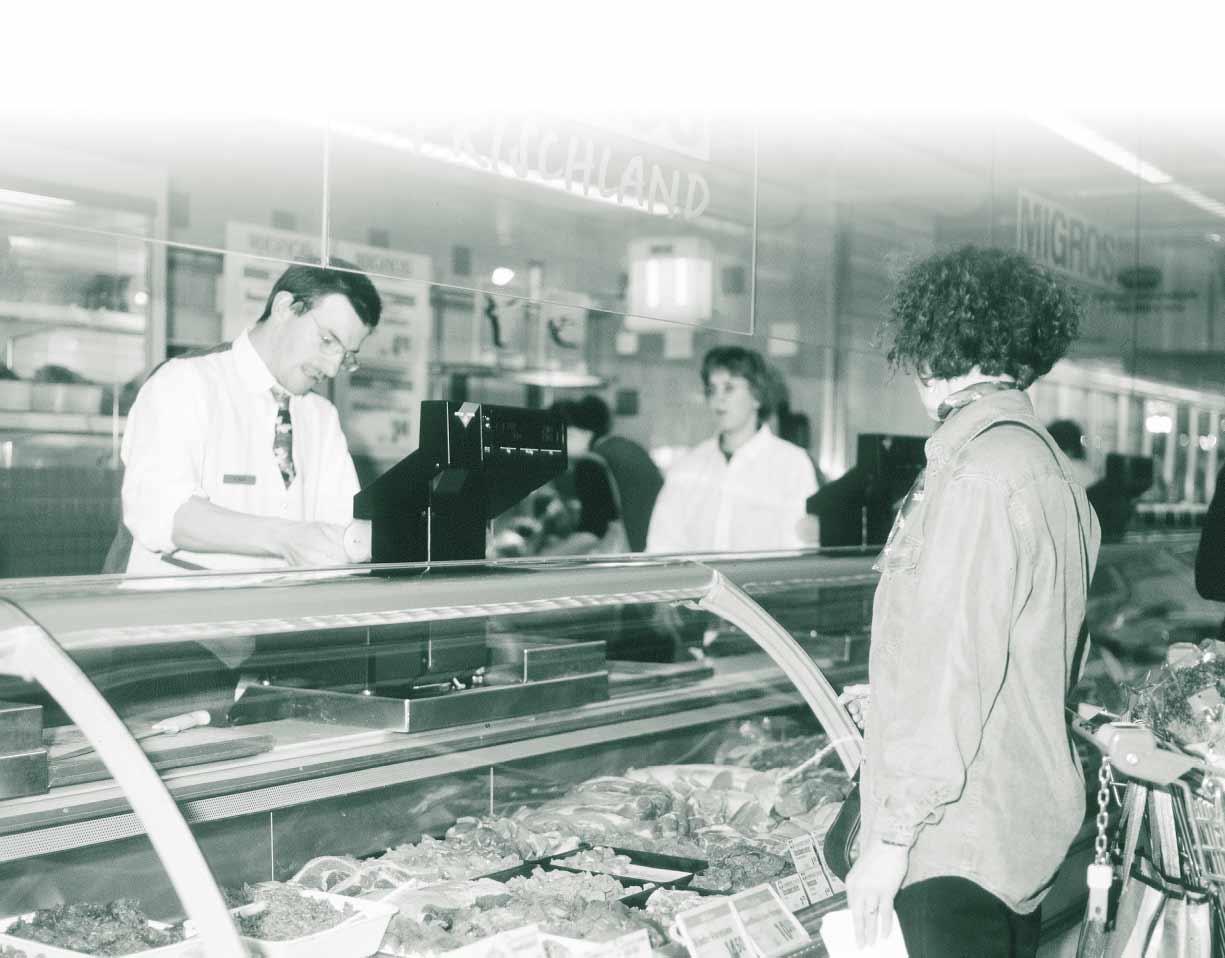
■ Erste Erfahrungen
Die Branchen- und Produzentenorganisationen spielen bei der Liberalisierung der Agrarmärkte eine wichtige Rolle:Sie dienen den Unternehmen des Ernährungssektors als Informations-,Verhandlungs- und Koordinationsplattform.Die Beschlüsse über den Marketing-Mix der Produkte und bestimmte Regeln des Marktgeschehens sollen zu kohärenten Kollektivlösungen verhelfen,damit der Mehrwert und die Marktanteile der schweizerischen Landwirtschaftsprodukte gestärkt werden können.
Die landwirtschaftlichen Organisationen legen bei der Bildung von Branchen- und Produzentenorganisationen grosse Dynamik an den Tag.Die Realität konfrontiert sie allerdings mit verschiedensten Situationen,und der Erfolg stellt sich nicht immer ein. Die Schaffung leistungsfähiger Strukturen hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit und dem Willen der Beteiligten ab,gemeinsame Ziele festzulegen und für alle tragbare Lösungen zu finden.Der Bund hat auf dieser Ebene kaum Einfluss,auch wenn das BLW die Organisationen auf Wunsch aktiv berät.
Im Rahmen der Landwirtschaftsgesetzgebung kann der Bundesrat in bestimmten Fällen Massnahmen zur Qualitätsverbesserung,Absatzförderung und Anpassung des Angebots an die Nachfrage auch für Nichtmitglieder der Branchen- und Produzentenorganisationen für verbindlich erklären.Hierbei wird von «Ausdehnung der Massnahmen» gesprochen.Bisher hat der Bundesrat im Falle von drei Produzentenorganisationen (Schweizerischer Bauernverband,Schweizer Milchproduzenten,GalloSuisse) sowie drei Branchenverbänden (Interprofession du Gruyère,Interprofession du Vacherin fribourgeois,Emmentaler Switzerland) die von ihnen vereinbarten Massnahmen ausgedehnt.
■ Die wichtigsten Elemente der Revision
Aufgrund der ersten Erfahrungen mit der Behandlung der Ausdehnungsgesuche durch das BLW revidierte der Bundesrat Ende 2002 die Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen.Die Anforderungen an die Rechtspersönlichkeit der Organisationen,ihren repräsentativen Charakter und ihre Entscheidungsabläufe wurden näher festgelegt.
Die revidierte Verordnung trat am 1.Januar 2003 in Kraft.Diese bringt für die Anwender eine grössere Klarheit mit sich.Zudem können auch die Bedenken der Minderheiten verringert werden,da die Wahl der Vertreter durch die Basis erfolgt und die Entscheidungen mit Zwei-Drittels-Mehrheiten innerhalb der Delegiertenversammlungen getroffen werden müssen.Das demokratische Funktionieren der Branchen- und Produzentenorganisationen wird also gefördert.Diese Änderungen helfen die Legitimität derjenigen Organisationen zu verbessern,die den Bundesrat um eine Ausdehnung der Selbsthilfemassnahmen ersuchen.Die Nichtmitglieder werden in Zukunft auch von besseren Informationen profitieren können.
■ Ausblick
Das System der Ausdehnung von Vereinbarungen der Branchenorganisationen ist ein agrarpolitisches Instrument,das sich ständig weiterentwickelt.Neue Ausdehnungsgesuche wurden im Laufe des Jahres 2003 eingereicht.Das BLW wird sein Augenmerk auf die Ausgestaltung der auszudehnenden Massnahmen richten.Denn diese müssen zwingend im Interesse sämtlicher Unternehmen eines Sektors oder einer Branche sein und dürfen den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Marktakteuren nicht verzerren.
■ Absatzförderung auf regionaler Ebene
Die Bundesunterstützung steht auch Trägerschaften offen,welche den Absatz regionaler Spezialitäten fördern.Dies hielt der Bundesrat in der Botschaft zur Reform der Agrarpolitik AP 2002 fest.Damit soll ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung einer koordinierten Regionalpolitik geleistet werden.
Seit 1999 hat das BLW im Rahmen der landwirtschaftlichen Absatzförderung 24 regionalen Projekten eine Finanzhilfe von total 17,3 Mio.Fr.zugesichert.Die Unterstützung ist im Sinne einer Starthilfe je Projekt auf maximal vier Jahre begrenzt.Für mehrere Projekte ist die Finanzhilfe bereits abgeschlossen oder wird demnächst auslaufen.
Das Gesuchsverfahren ist eng mit dem Programm Regio Plus (Bundesbeschluss über die Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen Raum) verbunden und hat sich bewährt.Mit dem Ziel,Erkenntnisse im Bereich des Vollzugs und über die ersten Wirkungen zu erhalten,wurde die landwirtschaftliche Absatzförderung auf regionaler Ebene gemeinsam mit dem Programm Regio Plus im Rahmen einer Zwischenevaluation (Zwischenevaluation Interface/Evaluanda 02) im ersten Halbjahr 2002 untersucht.Die Ergebnisse der Evaluation werden nachstehend präsentiert.
■ Erste Bilanz ist positiv
Die Zwischenevaluation zeigt insgesamt eine positive Bilanz und bezeichnet die beiden Förderprogramme als «problemgerecht und zukunftsweisend».Besonders der Aufbau von Netzwerken im ländlichen Raum wird als wertvoll erachtet.Die im Rahmen der Evaluation befragten Vollzugsträger und Projektverantwortlichen erachten die Unterstützung von gemeinde-,branchen-,und produktübergreifenden Kooperationen mit gemeinsamen Zielsetzungen als entscheidenden Faktor,um regionale Entwicklungspotenziale auszuschöpfen.Der Vollzug durch die kantonalen und eidgenössischen Behörden wird insgesamt als vorbildlich bezeichnet.
Die Finanzhilfe an die regionale Absatzförderung hat Impulse ausgelöst.Es bestehen kaum unerwünschte Mitnahmeeffekte.Das heisst,es werden keine Projekte mitfinanziert,die ohnehin und ohne Finanzhilfe realisiert worden wären.Diese Starthilfe wird von den Projektverantwortlichen als Anreizsystem des Bundes befürwortet.
■ Mögliche Verbesserungen Die Qualität der eingereichten Gesuche vermochte in vielen Fällen nicht auf Anhieb den hohen und für die Antragsteller ungewohnten Anforderungen zu genügen.Ein Teil der Gesuche musste nach der ersten Prüfung überarbeitet werden.Schwierigkeiten zeigten sich insbesondere bei der Formulierung überprüfbarer qualitativer und quantitativer Zielsetzungen.
Die Zwischenevaluation zeigt,dass die Aktivitäten der unterstützten Projekte bisher vor allem die Bewusstseinsbildung und den Netzwerkaufbau gefördert haben.Direkte wirtschaftliche Auswirkungen der Projekte sind jedoch wenig nachweisbar.

Die Evaluationsresultate heben folgende Merkmale als Erfolgsfaktoren hervor:Ausreichende Managementkapazität,langfristige Finanzierungsperspektive,Planung mit überprüfbaren Zielen und Erfolgskontrollen,überregionale Ausrichtung,solide Partnerschaften sowie starke regionale Verankerung.Weiter wird betont,dass besonders bei Projekten nach Landwirtschaftlicher Absatzförderungsverordnung an Stelle der regionalpolitischen,die betriebswirtschaftliche Ausrichtung im Vordergrund stehen muss. Zudem genügt die einseitige Realisierung von Kommunikationsmassnahmen nicht.Die Ergebnisse werden bei der Prüfung künftiger Gesuchseingaben Berücksichtigung finden,indem vermehrt die betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Aspekte der Vorhaben geprüft und in Bezug auf das Marketing der gesamte Instrumentenmix beurteilt werden soll.
Die kritische Grösse,um selbsttragend funktionieren zu können,wird von den meisten Projekten nach vier Jahren der Förderung nicht erreicht.Mit der teilweise ungenügenden betriebswirtschaftlichen Ausrichtung der Projekte wurde diesem Aspekt zu wenig Bedeutung beigemessen.Verschiedene Akteure haben dies realisiert und beginnen,sich überregional zu organisieren.Mit einer Änderung der landwirtschaftlichen Absatzförderungsverordnung soll auch dieser Entwicklung Rechnung getragen werden.Die vorgeschlagene Revision sieht daher folgende Elemente vor:Neu sollen Projekte während einer Konsolidierungsphase für weitere vier Jahre,jedoch mit einem reduzierten Finanzierungsanteil des Bundes,unterstützt werden.Zudem wird die Finanzhilfe an überregionale Vorhaben im Interesse regionaler Spezialitäten explizit möglich.
■ Repräsentative Umfrage zur Herkunft Schweiz
Mit der Abatzförderung soll besonders eine positive Einstellung der Konsumentinnen und Konsumenten zu Schweizer Landwirtschaftsprodukten erreicht und damit das Kaufverhalten beeinflusst werden.Die Haushalt führenden Personen sollen bewusster auf die Herkunft achten,die Vorzüge der Schweizer Erzeugnisse kennen,und diese bevorzugen.Seit 1999 unterstützt das BLW die Massnahmen der Akteure aus der Landwirtschaft im Bereich der Marketingkommunikation und Marktforschung.In einer regelmässigen Befragung wird ermittelt,welche Wirkung damit erzielt wird.
Die anfangs 2003 im Auftrag des BLW durchgeführte repräsentative Umfrage wird seit 1998 alle zwei Jahre realisiert.Dabei steht das Einkaufsverhalten der Schweizer Wohnbevölkerung bei landwirtschaftlichen Produkten im Mittelpunkt des Interesses. Insbesondere wird analysiert,ob beim Einkauf auf die Herkunft der einzelnen Produkte geachtet und inwieweit Schweizer Produkten gegenüber ausländischen der Vorzug gegeben wird.
Mit der jüngsten Umfrage wurden zudem der Informationsstand der Konsumentinnen und Konsumenten zur Herkunft ihrer Einkäufe und ihre Bedürfnisse zur Herkunftsbezeichnung von Schweizer Landwirtschaftsprodukten erhoben.Diese Fragestellungen stehen in Zusammenhang mit der geplanten Einführung eines einheitlichen Herkunftszeichens für Schweizer Produkte.Und schliesslich wurde auch zum wiederholten Male die Einstellung der Bevölkerung zur Schweizer Landwirtschaft erhoben.
■ Präferenz für Schweizer Produkte
Bei der generellen Beachtung der Herkunft Schweiz ist ein geringfügig rückläufiger Trend zu beobachten.Dies könnte darauf zurück zu führen sein,dass auch Importprodukte eine hohe Qualität aufweisen und im Preisvergleich die Wahl auf sich lenken. Umso mehr sind Anstrengungen für die Schweizer Landwirtschaftsprodukte notwendig.
Die Resultate zeigen,dass sich bei denjenigen Konsumentinnen und Konsumenten, welche überhaupt auf die Herkunft der Erzeugnisse achten,die Präferenz für Schweizer Produkte im Verlauf der letzten vier Jahre nicht signifikant verändert hat.Es kann somit auf eine gewisse Kontinuität im Kaufverhalten der Konsumenten geschlossen werden. Bestätigt wird,dass die Präferenz für einheimische Lebensmittel bei den tierischen Erzeugnissen wie Eier,Fleisch,Honig,Käse,Milch und Frischmilchprodukte am höchsten ist.Beim Kauf dieser Produkte werden Schweizer Produkte den ausländischen vorgezogen.Produkte aus dem Pflanzenbau wie Getreideprodukte oder Speiseöl können weniger von der Herkunft Schweiz profitieren.Bei Non-Food-Artikeln wie Schnittblumen,Wolle und Topfpflanzen spielt die Herkunft nur eine untergeordnete Rolle für den Kaufentscheid.
■ Kennzeichnung der Herkunft Schweiz
Bis heute besteht kein breit verwendetes und einheitliches Herkunftszeichen für SchweizerLandwirtschaftsprodukte.Somit interessiert die Frage besonders,wie sich die Haushalt führenden Personen über die Herkunft der Schweizer Produkte informieren.
■ Wichtigkeit der Kennzeichnung landwirtschaftlicher Produkte
Bevorzugung von Schweizer Produkten gegenüber ausländischen

Eier (454)
Milch und Frischmilchprod. (491)
Fleisch (ohne Wurstwaren) (468)
Kartoffeln (449)
Honig (352)
Wurstwaren (423)
Käse (489)
Obst/Beeren (475)
Gemüse (484)
Getreideprodukte (453)
Zucker (458)
Kartoffelprodukte (313)
Speiseöl (465)
Wein (414)
Schnittblumen (367)
Topfpflanzen (296)
Wolle (101)
Die meisten Konsumentinnen und Konsumenten erkennen Schweizer Landwirtschaftsprodukte durch einen Hinweis im Laden,am Gestell,auf den Waren oder der Verpackung.Einige wenige erkundigen sich auch direkt beim Verkaufspersonal.Die Kennzeichnung der einheimischen Erzeugnisse erachten 56% der Käuferinnen und Käufer als sehr wichtig und weitere 32% als ziemlich wichtig.Eine erstaunlich hohe Anzahl der Befragten messen der Herkunftskennzeichnung hohe Bedeutung zu.
Wichtigkeit der Herkunftskennzeichnung landwirtschaftlicher Produkte
weiss nicht 1% eher unwichtig 7%
ziemlich wichtig 32%
völlig unwichtig 4% sehr wichtig 56%
DemoScope 2003
■
Rund 80% würden denn auch ein einheitliches Herkunftszeichen für Schweizer Landwirtschaftsprodukte begrüssen.Nur gut die Hälfte der Verbraucher findet,dass die inländischen Erzeugnisse heute genügend deutlich erkennbar sind.Zur Frage,ob darauf geachtet würde,wenn auch die Region als Herkunft angegeben wäre, äusserten sich drei Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten überwiegend positiv.
Eine Mehrheit der Befragten erwartet,dass ein Produkt,das ein Schweizer Herkunftszeichen trägt,zu 100% aus der Schweiz stammen muss.Zudem werden weitere Eigenschaften der so gekennzeichneten Produkte erwartet,wie vor allem Frische,hohe Qualität,GVO-frei sowie artgerechte Tierhaltung und umweltgerechter Anbau.
Im Rahmen der Umfrage wird auch periodisch die Einstellung zur Schweizer Landwirtschaft bzw.deren Image erhoben.Die Schweizer Landwirtschaft hat das Vertrauen der Konsumenten nach wie vor mehrheitlich auf ihrer Seite.Sie wird als professionell, konsumentennah,zeitgemäss,umweltgerecht und konkurrenzfähig beschrieben.Dennoch zeigen die Resultate dieser Umfrage eine tendenzielle Verunsicherung seitens der Verbraucher auf.Im Jahre 2000 war der Anteil der Konsumenten,die deutlich ja zu den genannten Eigenschaften sagten,höher als im Jahr 2002.
■ Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA)
Im Jahr 1997 ist die Verordnung über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung) in Kraft getreten.Diese Massnahme war insofern keine völlige Neuerung,als es seit 1962 bereits ein sektorielles Käseregister gibt.
Bei den GUB und GGA geht es um die Verwendung von Gebietsnamen für Produkte, deren Qualität und Haupteigenschaften durch ihre geografische Herkunft bestimmt werden.Bei der Ursprungsbezeichnung müssen alle Erzeugungsschritte in derselben Gegend erfolgen,während der Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet bei den GGA weniger stark ist.Es genügt in diesem Fall,wenn das Produkt in der betreffenden Gegend produziert,verarbeitet oder veredelt wird.
Dank dem Register können die Berufskreise,die mit der Herstellung eines traditionellen landwirtschaftlichen Erzeugnisses zu tun haben,ihre Errungenschaften schützen.Es können nur Produkte eingetragen werden,bei denen ein Bezug zwischen Qualität und geografischer Herkunft besteht,und zwar in menschlicher (gewerbliches Know-how) und natürlicher Hinsicht (Höhenlage,Bodenbeschaffenheit,Bakterienflora usw.).Die gemeinsamen Regeln für die Verwendung von GUB und GGA werden in einem Pflichtenheft festgelegt;sie beschreiben das Produkt,das geografische Gebiet sowie die Produktions-,Verarbeitungs- und Veredelungsmethode.Unabhängige,akkreditierte Zertifizierungsstellen kontrollieren,ob diese vom Berufsstand freiwillig definierten Regeln eingehalten werden und garantieren dadurch,dass GUB und GGA nur für Produkte verwendet werden,die dem jeweiligen Pflichtenheft entsprechen.Das mittelfristige Ziel ist die Anerkennung des schweizerischen Registers durch die EU und damit ein Schutz der Bezeichnungen auf unserem Hauptexportmarkt.Bis zum 31.Dezember 2002 hat das BLW 24 GUB/GGA-Gesuche behandelt,davon 8 registriert.
Stand des GUB/GGA-Registers am 31.Dezember 2002
BezeichnungSchutzLandwirtBetriebeZertifizierteZertifizieschafts-(Verarbeitung/Produktions-rungsstelle betriebeVeredelung)menge 2002
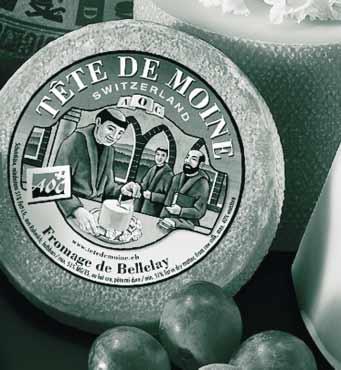

In vielen Ländern Europas wurden in den letzten Jahren Inventare von kulinarischen Spezialitäten erstellt.In der Schweiz besteht bis zum heutigen Tag keine systematische Sammlung mit alten,regionaltypischen Produkten,auch wenn die schweizerische Eidgenossenschaft das kulturelle Erbe des Landes auf vielfältige Weise fördert und unterstützt.Aufgrund dieser Begebenheit reichte Nationalrat Josef Zisyadis am 6.Oktober 2000 ein Postulat mit dem Titel «Inventar der regionalen Spezialitäten» ein. Darin fordert er den Bundesrat auf,ein solches Inventar zu schaffen.Das Postulat wurde am 15.Dezember 2000 angenommen.
Im Dezember 2001 setzte sich das BLW mit den kantonalen Landwirtschaftsämtern in Verbindung und ersuchte sie um aktive Mitarbeit zur Erstellung eines Pilotinventars. 19 Kantone erklärten sich bereit,in der bis Ende August 2002 dauernden Pilotphase mitzuwirken.Die Teilnehmer der interkantonalen Arbeitsgruppe erstellten daraufhin eine Anzahl vollständiger Produktbeschreibungen und listeten weitere mögliche Erzeugnisse auf.Die meisten Beteiligten zogen eine überwiegend positive Bilanz aus ihrer Arbeit,und man war sich einig,dass das Projekt weitergeführt und künftig auf alle Kantone ausgedehnt werden sollte.Ein Inventar erlaubt es,die spezifischen Besonderheiten unserer lokalen und traditionellen Produkte zu identifizieren und damit besser zu verstehen.Es kann mithelfen,bisher vernachlässigte Produktionszweige wieder anzukurbeln und/oder bestehende zu stärken.Mit dem Inventar kann ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung dieses Bestandteils unseres kulturellen Erbes geleistet und der Absatz schweizerischer Landwirtschaftsprodukte gefördert werden. Durch die enge Verbindung zur Landwirtschaft und zu den Regionen fügt es sich auch nahtlos in den agrar- und regionalpolitischen Kontext ein.Für eine zukünftige Nutzung der Sammlung und dessen Leitung besteht seitens einer privaten Trägerschaft Interesse.Eine subsidiäre Mitfinanzierung durch den Bund auf der Grundlage von Artikel 12 des LwG und der Landwirtschaftlichen Absatzförderungsverordnung ist möglich.
■ Einfuhrregelungen im Zeichen eines effizienten
Vollzugs
Zur Unterstützung einer produktiven Landwirtschaft werden Einfuhren von Agrarerzeugnissen mit geeigneten zolltarifarischen Massnahmen gesteuert.Einfuhrzölle werden auf zwei Arten als Steuerungsinstrument eingesetzt:Beim Schwellenpreis,der im Bereich der Futtermittel Anwendung findet,wird mit variablen Zollansätzen ein Importpreis in einer bestimmten Bandbreite erreicht.Bei anderen Agrarprodukten sind Zollkontingente festgelegt.Die Einfuhrmengen,die zum tiefen Kontingentszollansatz eingeführt werden dürfen,sind beschränkt.Einfuhren ausserhalb des Zollkontingents sind möglich,werden aber mit wesentlich höheren Zöllen belastet.Das BLW ist bei den meisten Zollkontingenten zuständig für die zeitliche und mengenmässige Verteilung. Ausschreibungen von Versteigerungen und die Zuteilungen werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.Einen detaillierten Überblick über die zugeteilten Mengen und deren Ausnützung durch die Importfirmen bietet der Separatdruck zum Bericht des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen «Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente».Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ihrerseits teilt diejenigen Zollkontingente zu,die entsprechend der Reihenfolge der Verzollung («Windhundverfahren an der Grenze») verteilt werden.Die Ausnützung dieser Zollkontingente ist unter www.zoll.admin.ch einsehbar.
Bei der Verteilung von Zollkontingenten soll der Wettbewerb gewahrt bleiben.Werden die Anteile mit einem Versteigerungs- oder einem Windhundverfahren (an der Grenze oder der Bewilligungsstelle) verteilt,kann diesem Grundsatz am einfachsten entsprochen werden.Zugleich sind diese Verfahren im Vollzug einfach und effizient,was ein weiterer Grund ist,dass sie zunehmend Anwendung finden.Erfolgt die Verteilung der Zollkontingentsanteile aufgrund der Inlandleistung oder den bisherigen Einfuhren der Gesuchsteller,werden Massnahmen angewendet,die es insbesondere neu einsteigenden Importeuren erlauben,Importrechte zu erlangen.Zur Wahrung des Wettbewerbs gehört aber auch,dass für alle Beteiligten die gleichen Regeln gelten.Verstösse können durch transparente Regelungen und gezielte Information verhindert werden. Treten trotzdem Unstimmigkeiten auf,liegt es im Interesse der Beteiligten,diese rasch festzustellen,und wenn möglich ohne langwierige Verfahren zu bereinigen.
In den folgenden Abschnitten werden die Ein- und Ausfuhr von Verarbeitungsprodukten sowie die Nachforderungen von Einfuhrabgaben näher erläutert.Dies sind beides Bereiche,bei denen im Berichtsjahr Schritte zur Verbesserung der Effizienz eingeleitet oder bereits umgesetzt wurden.Der erste Teil ist dem Zuteilungskriterium «aufgrund des Marktanteils im Vorjahr» gewidmet.
Bei den meisten bewirtschafteten frischen Früchten und beim Gemüse erfolgt die Zuteilung der Zollkontingentsanteile aufgrund der Importe im Vorjahr.Bei den vier Produkten Äpfel,Salatgurken,Fleischtomaten und gewöhnliche Tomaten bildet seit dem Jahr 2000 der Marktanteil im Vorjahr die Berechnungsgrundlage.Das heisst,die Importe und die gemeldeten Inlandleistungen werden addiert,und aus dieser Kombination die prozentualen Anteile der einzelnen Zollkontingentsinhaber errechnet und zugeteilt.Dabei gilt als Inlandleistung der Bezug von gleichartigen Erzeugnissen direkt vom inländischen Produktionsbetrieb.Die prozentualen Anteile dienen dem Inhaber zur Berechnung seines Anteils an einer freigegebenen Kontingentsteilmenge.
Die Zuteilung aufgrund des Marktanteils bietet einen Anreiz,inländische Ware zu übernehmen,insbesondere auch während den freien Perioden und den Laufzeiten von Zollkontingentsfreigaben.Als Nachteil ist der grosse Aufwand zu erwähnen,der sich durch das Melde- und Kontrollwesen,sowie durch die Erfassung der Meldungen ergibt.Durch die Inlandleistung gelangen auch Handelsbetriebe,die sich vorher ausschliesslich im Inlandhandel betätigten,zu Importrechten.Wie werden diese Rechte genutzt? Nachfolgend werden die Zuteilungen bei Äpfeln und Tomaten für die Kontingentsperioden 1999 und 2003 miteinander verglichen.1999 war die letzte Periode mit Zuteilungen ausschliesslich nach Massgabe von Importen im Vorjahr.
Zollkontingentszuteilung bei Äpfeln und Tomaten 1999 und 2003
Verhältnis Inland zu Import für Berechnung der Anteile0 :10088 :120 :10037 :63
Firmen / Personen mit ZollkontingentsanteilAnzahl189158189199 davon nur aufgrund von ImportenAnzahl-76-108 davon nur aufgrund von InlandleistungAnzahl-20-20 Anteile zur Ausnützung weitergegeben 1 %-52-26
Inhaber mit zusammen 75% Anteilen vor bzw.nach Weitergabe zur Ausnützung 1
Anzahl815 / 11 2129 / 23 Zehn grösste Anteile kumuliert, vor bzw.nach Weitergabe von Anteilen zur Ausnützung 1
%8063 / 73 5748 / 58
Anmerkung:Die Importe der Jahre 1996–98 bei Äpfeln,bzw.von 1998 bei Tomaten bilden die Basis für die Zuteilungen der Kontingentsperiode 1999.Die Marktanteile des Jahres 2002 bilden die Basis für die Zuteilungen der Kontingentsperiode 2003 (bei Äpfeln wird für die Inlandleistung anstelle des Kalenderjahrs die Zeit vom 1.9.01 bis 31.8.02 als Basis verwendet)
1 Seit 1999 dürfen nach Artikel 14 der Agrareinfuhrverordnung Zollkontingentsanteile zur Ausnützung weitergegeben werden.Die Möglichkeit,prozentuale Anteile am Zollkontingent weiterzugeben,wird jedoch erst seit dem Jahr 2000 genutzt.Die mengenmässigen Anteile,die jeweils bei Freigaben von Zollkontingentsteilmengen zur Ausnützung weitergegeben wurden,sind nicht aufgeführt.
Quelle:BLW
■ Vergleich der Zollkontingentszuteilung vor und nach dem Einbezug der Inlandleistung
■ Ein- und Ausfuhr von Verarbeitungsprodukten (Schoggigesetz)
Folgende Tendenzen sind zu erkennen:Die Konzentration der Importrechte ist vor der Weitergabe der Ausnützungsberechtigung von Zollkontingentsanteilen zwar kleiner als früher,nach der Weitergabe ist sie hingegen ähnlich,z.T.sogar eher grösser.Insbesondere die Firmen mit den grössten Anteilen haben gegenüber früher noch zugelegt. Die Übertragung von Importrechten wird bei allen vier betroffenen Produkten mit Zuteilung aufgrund des Marktanteils viel intensiver genutzt als bei den meisten Produkten,deren Zuteilung nur auf den Importen im Vorjahr basiert.Die Übertragungsrate beträgt bei diesen nur ausnahmsweise über 10%,z.B.bei Aprikosen 8,7% oder beim Blumenkohl 6,8%.Hingegen beträgt sie bei Salatgurken,Fleischtomaten und den gewöhnlichen Tomaten je rund ein Viertel.Bei den Äpfeln werden prozentual am meisten Zollkontingentsanteile zur Ausnützung weitergegeben,nämlich über die Hälfte.Dies dürfte in direktem Zusammenhang stehen mit dem hohen Inlandanteil von 88%.Es fällt allgemein auf,wie stark die Zuteilungen,die auf den erfassten Handelstätigkeiten resultieren,durch privatrechtliche Vereinbarungen nachträglich abgeändert werden.Den Impuls dazu geben die Endvermarkter,welche die Zwischenhändler und die Lagerhalter auffordern,ihnen die gesamten oder zumindest Teile der Importrechte abzutreten,die jene aufgrund der direkten Übernahme ab Produktion zugeteilt bekommen.Produzentennahe Handelsunternehmen verfügen trotzdem über grössere Importrechte als früher.Dass sie viele Anteile weiter geben,lässt sich neben den bereits erwähnten Lieferbedingungen vielleicht auch mit dem mangelnden Importbedarf dieser Firmen begründen.Unter dem Strich verfügen zudem die Grossverteiler als die wichtigsten Endvermarkter über grössere Kontingentsanteile,was zum grössten Teil auf das erst seit dem Jahr 1999 mögliche Übertragen von Importrechten zurückzuführen ist.Auf der anderen Seite gehören die spezialisierten Importfirmen zu den Verlierern des neuen Systems.
Nach den Ereignissen im Jahr 2001 erholten sich die Exporte von Verarbeitungsprodukten im Jahr 2002 nur zögerlich.Am Ende des Berichtsjahres lagen die Gesamtausfuhren an Verarbeitungsprodukten rund 4% über denjenigen des Vorjahres.Die Zunahme ist ausschliesslich auf rein zuckerhaltige Verarbeitungsprodukte zurückzuführen.Zucker zur Herstellung von Verarbeitungsprodukten für den Export wird fast ausnahmslos im Veredelungsverkehr ein- und ausgeführt.
Die Butterausfuhren in Verarbeitungsprodukten sind stabil geblieben.Durch die Weiterführung des Dualsystems bei Butter (wahlweise Butter im Veredelungsverkehr oder mit Ausfuhrbeiträgen zu verarbeiten) wurden aber für deutlich mehr Ausfuhren von verarbeiteter Butter Ausfuhrbeiträge beansprucht.Der im Bundesbudget für Ausfuhrbeiträge enthaltene Betrag von 114,9 Mio.Fr. – er entspricht dem WTO-Plafonds
wurde nicht nur voll ausgeschöpft,sondern es waren im Januar 2003 Auszahlungen für Dezember-Ausfuhren von rund 3,8 Mio.Fr.zulasten der neuen Rechnung 2003 zu leisten.
Die wirtschaftliche Lage und der Irak-Konflikt haben keine allzu positive Entwicklung der Ausfuhren von Verarbeitungsprodukten ermöglicht.Die Entwicklungen der Preise im Milchsektor im In- und Ausland dürften in etwa parallel verlaufen,so dass sich die Preisschere zwischen in- und ausländischen Rohstoffen nicht weiter öffnen sollte.Die im Inland erfolgte Preiserhöhung beim Backmehl wirkte sich nur geringfügig auf die Ausfuhrbeiträge aus.
In den Ausfuhrmengen sind Butter,Hartweizengriess und Zucker,welche im Veredelungsverkehr ein- und ausgeführt wurden,ebenfalls enthalten.

■ Nachforderungen von Einfuhrabgaben durch das BLW
Für das Berichtsjahr stellte das BLW das erste Mal geschuldete Einfuhrabgaben (Zoll inkl.MwSt) im Auftrag der EZV in Rechnung.Abgaben sind geschuldet,wenn Importfirmen ihre Anteile an Zollkontingenten überschreiten oder Waren im Kontingent einführen,obwohl sie über keinen Anteil verfügen.Ziel der Aufgabendelegation ist eine Beschleunigung und eine Vereinfachung der administrativen Verfahren.Vor allem erlaubt das neue Instrument den fehlbaren Importeuren Unstimmigkeiten bei der Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch die Zahlung der geschuldeten Einfuhrabgaben weitgehend und ohne Verzögerung zu bereinigen.Die Begleichung der BLW-Rechnungen ist freiwillig,da die Rechnungsstellung ohne Beschwerdemöglichkeit erfolgt,und somit verfahrenstechnisch als rechtliches Gehör gilt.Je nach Produktregime ist die Zahlungsmoral gut,wobei die Zahlungsfrist im Übergangsjahr 2002 grosszügig gehandhabt wurde.In der Tabelle sind die wichtigsten Ergebnisse dieser ersten Nachforderungsperiode dargestellt.
1Nach Ablauf der Zahlungsfrist übergibt das BLW die Fälle mit unbezahlten Rechnungen an die EZV,welche die geschuldeten Abgaben verfügt.
Von diesen Fällen sind 14 über einen Betrag von Fr.34 000 durch Zahlung erledigt.Stand 19.September 2003
Quellen:BLW,EZV
Das neue System hat dazu geführt,dass wesentlich weniger Unstimmigkeiten zur weiteren Behandlung an die EZV überwiesen werden mussten.Bei Einfuhrregimes,bei denen die Rechnungsstellung monatlich erfolgt,lässt sich auch bereits eine Verbesserung der Sorgfaltspflicht bei der Zolldeklaration feststellen.Zudem reagieren die Importfirmen rascher und nutzen vermehrt die Möglichkeit,gegen fehlerhafte Verzollungen bei der EZV fristgerecht Beschwerde einzureichen.In diesem Bereich zeigten sich noch gewisse Schwächen der Neuerung.Um Doppelspurigkeiten (Rechnungsstellung durch BLW bereits während laufenden Korrekturverfahren bei der EZV) zu vermeiden,drängt sich eine Beschleunigung der Beschwerdeverfahren sowie eine raschere Übermittlung der bewilligten Zolldeklarationskorrekturen an das BLW auf. Dadurch liessen sich Rückerstattungen von Zahlungen weitgehend vermeiden.
■ Ausblick
Gemäss den Artikeln 7 und 23 der Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen kann das BLW bei frischen Früchten und Gemüse den Importeur verpflichten,auf denjenigen Waren den Ausserkontingentszollansatz zu entrichten,welche beim Übergang von einer Periode mit mengenmässig unbeschränkten Importen zum Kontingentsansatz zu einer Periode mit beschränkten Mengen zu viel eingeführt wurden.Im Berichtsjahr stellte das BLW in 21 Fällen zu grosse Lagerbestände von Karotten,Eisbergsalat, Äpfeln oder Aprikosen fest und erliess Verfügungen zur Zahlung der Zolldifferenz von insgesamt 57’776 Fr.
Inskünftig sollen die vom BLW zugeteilten individuellen Zollkontingentsanteile direkt an der Grenze verwaltet werden.Die EZV hat ein Projekt zur Erneuerung und Erweiterung der elektronischen Verzollung lanciert (Redesign Zollmodell 90,bzw. elektronische Deklaration e-dec).Ein Ziel des Projekts ist,Einfuhren von kontingentierten landwirtschaftlichen Erzeugnissen,die den Zollkontingentsanteil eines Importeurs überschreiten,zu verhindern.Das System soll so aufgebaut werden,dass in solchen Fällen eine elektronische Zolldeklaration gar nicht zugelassen wird.Die Kontingentsverwaltung kann voraussichtlich ab 2006 in dieser Form umgesetzt werden.Die Systemänderung wird ermöglichen,die effektiv geschuldeten Einfuhrabgaben unmittelbar beim Grenzübertritt der Ware zu erheben,so dass die aufwändigen Nacherhebungsverfahren entfallen.
Spätestens auf den Zeitpunkt,an dem die Kontingentskontrolle mit e-dec an der Grenze vollzogen wird,ist auch die Abschaffung des Zuteilungskriteriums «Inlandleistung Zug um Zug» vorgesehen,das bei einigen Produkten zurzeit noch angewendet wird.Importrechte sollen also nicht mehr durch Übernahme gleichartiger Erzeugnisse im Inland während der gleichen Periode erlangt werden können.Diese Form der Zollkontingentszuteilung ist nicht nur geprägt durch einen hohen administrativen Aufwand aller Beteiligten,sondern eignet sich vor allem nicht für die elektronische Kontingentsverwaltung zum Zeitpunkt der Einfuhr.
Beim Versteigerungsverfahren soll in Zukunft auf die Festlegung von maximalen Kontingentsanteilen pro Person verzichtet werden.Der rechtsgleiche Vollzug einer derartigen Beschränkung ist nicht möglich,aufgrund der häufigen Verflechtungen von natürlichen oder juristischen Personen,etwa im Falle von Mutter- und Tochtergesellschaften.Zudem macht eine solche Beschränkung wenig Sinn,wenn gleichzeitig Vereinbarungen über die Ausnützung von Zollkontingentsanteilen getroffen werden dürfen.Schliesslich ist es aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zweckmässig,auf eine Beschränkung zu verzichten.
Massnahmen 2002/03
Als Folge der schlechten Absatzlage,insbesondere im Export,stellten die milchwirtschaftlichen Organisationen im Berichtsjahr den Antrag,die Milchkontingentsmenge um 2% zu senken.Die vom Parlament beschlossene Änderung des LwG auf dem Dringlichkeitswegerlaubte dem Bundesrat diese Kürzung rasch umzusetzen.Der vom Zahlungsrahmen her gegebene Stützungsabbau wurde vollumfänglich bei den Beihilfen vorgenommen.Einzelne Ansätze (Inlandbeihilfen für Käse) wurden auf Null gesenkt.
1nur für bestimmte Verwendungszwecke
2nur bei Importverzicht
3nach Käsesorte und Destination (EU – andere Länder) differenziert

4nicht für Konsummilch Quelle:BLW
Die Stützungsmassnahmen sind mit den Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage schwerpunktmässig weiterhin auf den Käse ausgerichtet.
Im Jahr 2002 wurden die Ausgaben des Bundes zugunsten der Milchwirtschaft weiter abgebaut.Im Vergleich zum Vorjahr standen im Berichtsjahr mit 600,6 Mio.Fr.rund 66 Mio.Fr.oder 10% weniger zur Verfügung.Im Laufe des Berichtsjahres ergriff der Bund verschiedene Massnahmen,wofür zusätzliche Mittel im Umfang von 152,9 Mio.Fr. eingesetzt wurden (vgl.Turbulenzen auf dem Milchmarkt).

Total 600,6 Mio. Fr.
Administration 1%
Inlandbeihilfen 26%
Quelle: BLW
Für die Preisstützung wurden im Milchbereich insgesamt 600,6 Mio.Fr.ausgegeben. Davon beanspruchte der Käse 410,1 Mio.Fr.(68,3%).92,9 Mio.Fr.(15,5%) wurden für Butter und 90,6 Mio.Fr.(15,1%) für Pulver und andere Milchprodukte eingesetzt. Wie im Vorjahr wurde für die Administration 1,1% (7,0 Mio.Fr.) benötigt.
■ Schwieriges Jahr für die Milchwirtschaft
Im Jahr 2002 hatte die Milchbranche grosse Herausforderungen zu bewältigen,deren Auswirkungen auch im Folgejahr noch nachwirken:
– markante Einbusse von Marktanteilen auf den ausländischen Käsemärkten; –überdurchschnittliche Käselagerbestände;
– Verlagerung der Milchverwertung von der Käseproduktion zur Butter-,Magermilchpulver- und Vollmilchpulverherstellung; –überdurchschnittliche Butterlager- und Magermilchpulverbestände;
– fehlende Möglichkeit für Butterimporte;
– finanzielle Schwierigkeiten beim grössten Milchverwerter Swiss Dairy Food AG; Nachlassstundung am 22.September 2002 beantragt.
Das schwierige Umfeld,dem sich die Milchwirtschaft ausgesetzt sah,veranlasste auch den Bund ausserordentliche Massnahmen zu ergreifen:
Aussetzen der jährlichen Amortisationstranche von 30,6 Mio.Fr.bei den Käselagerdarlehen verbunden mit der Verlängerung der Rückzahlungsfrist um ein Jahr;
– Gewährung von verzinslichen rückzahlbaren Darlehen in der Höhe von 65 Mio.Fr.an Branchenorganisationen zum Abbau der überhöhten Käse- und Milchpulverlager;
–Übernahme der Milchgeldzahlung an mehrere Tausend Milchlieferanten der Swiss Dairy Food AG in der Zeit von 1.August bis 22.September 2002 in der Höhe von 57,3 Mio.Fr.Das Vorgehen des Bundes wurde von den Banken durch die Gewährung eines Massakredites unterstützt und ermöglichte nach dem 22.September 2002 die geordnete Milchverwertung und die Veräusserung von Unternehmensteilen im Nachlassstundungsverfahren.Die Liquidationsarbeiten konnten bis Frühling 2003 grösstenteils abgeschlossen werden.Diese Massnahmen wurden mit nicht ausgeschöpften Budgetmitteln aus anderen Sektoren finanziert.
■ Botschaft zur Änderung des Landwirtschaftsgesetzes auf dem Dringlichkeitsweg
Aufgrund der schwierigen Situation auf dem Milchmarkt drängte sich gegenüber den Vorschlägen der Agrarpolitik 2007 ein Zwischenschritt auf,mit dem der Branche ein grösserer Handlungsspielraum und entsprechende Verantwortung übertragen werden kann.Ziel war,neu den Beschlüssen und Anträgen der Branche bezüglich Milchmenge unter bestimmten Bedingungen für den Bundesrat eine vermehrte Verbindlichkeit zu geben.
Der Bundesrat hat am 16.Oktober 2002 dem Parlament eine Revision von Artikel 31 LwG beantragt,welche die vom Markt verlangte differenzierte Anpassung der Milchmenge ermöglicht.Die Botschaft zur Änderung des LwG auf dem Dringlichkeitsweg zeigt zwei Möglichkeiten auf,wie die Milchkontingentsmenge angepasst werden kann. Einerseits kann die Gesamtbranche,jedoch nur für die Milchjahre 2002/03 und 2003/04,dem Bundesrat einen gemeinsamen Antrag zur Anpassung der Kontingentsmenge vorlegen.Andererseits können die einzelnen Branchenorganisationen ihre Mengen separat beantragen.Das Parlament hat diese Änderungen in der Wintersession 2002 beschlossen.
Das Bedürfnis der Gesamtbranche nach einer Mengenanpassung war Ende 2002 offensichtlich.Voraussetzung für eine solche nach Dringlichkeitsrecht befristete Massnahme sind gleichlautende Beschlüsse sowohl der Organisationen der Milchverarbeiter als auch der Milchproduzenten.Mit der entsprechenden Gesetzesanpassung werden die Akteure der Milchbranche zeitlich vorgezogen in die Verantwortung für die Mengenanpassung eingebunden.
Die Gesamtbranche,das heisst der Verband der Schweizer Milchproduzenten (SMP), die Vereinigung der schweizerischen Milchindustrie (VMI) und die Fromarte,hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,die Gesamtmilchmenge anzupassen.Dem Bundesrat wurde noch im Dezember 2002 das Begehren gestellt,ihren gemeinsamen Beschluss um Reduktion der Milchmenge um 2% für das Milchjahr 2002/03 umzusetzen.
Im April 2003 haben SMP,VMI und Fromarte eine weitere Reduktion der Milchmenge um 2,5% für das Milchjahr 2003/04 beantragt.Mit den beiden Begehren wurde somit die Milchmenge von 104,5 auf 100% der Grundkontingente reduziert.

Die zweite neue Regelung sieht vor,dass beispielsweise die Branchenorganisation einer bestimmten Käsesorte eine Mengenänderung beschliesst und dass der Bundesrat diesen Beschluss in der Milchkontingentierungsverordnung umsetzt.Dies wird möglich wenn:
– der Beschluss der Branchenorganisation die Anforderungen nach LwG erfüllt;
– Gewähr dafür besteht,dass die festgelegte Menge in der Verantwortung der Branchenorganisation verwertet oder vermarktet wird;
– Gewähr dafür besteht,dass die Branchenorganisation die Verhältnisse auf Teilmärkten wie dem Biomarkt oder regionalen Märkten berücksichtigen.
Von dieser Massnahme hat bis im Sommer 2003 keine Branchenorganisation Gebrauch gemacht.Sie wird den einzelnen Branchenorganisationen auch im Rahmen der Agrarpolitik 2007 offen stehen.Mit der Änderung des LwG auf den 1.Januar 2004 wird das Dringlichkeitsrecht ins ordentliche Recht überführt.
■ Handel mit Milchkontingenten bleibt beliebt
Im Milchjahr 2001/02 vermarkteten noch 36'231 Produzenten Milch.Dies entspricht einer Abnahme von 4,9% gegenüber dem Vorjahr.Dieser Prozentsatz ist fast doppelt so hoch wie die durchschnittliche Abnahmerate von 2,5% in den Perioden 1995/96 bis 1999/2000.Mit 83'407 kg hat das durchschnittliche Kontingent pro Betrieb gesamtschweizerisch erstmals die 80'000 kg Marke überschritten.Es nahm um 4'226 kg oder 5,3% gegenüber dem Vorjahr zu und liegt heute um mehr als einen Viertel über jenem von 1995/96.
Trotz der generellen Mengenerhöhung von 3% im Milchjahr 2001/02 erreichten die abgabepflichtigen Kontingentsüberlieferungen um mehr als 5'000 kg rekordhafte 7'341 t.Daraus ergaben sich Abgaben von rund 4,4 Mio.Fr.zu Gunsten der Bundeskasse.
Der Kontingentshandel wird geschätzt:3’948 Produzenten haben im Milchjahr 2002/03 Kontingente gekauft und 8’806 Produzenten haben Kontingente gemietet.Die übertrageneMenge erreichte rund 234’506 t oder 7,8% des Grundkontingentes.Auf Ende des Milchjahres wurden 115’861 t gemietete Kontingente dem Vermieter zurück übertragen. Kontingentshandel
Seit Einführung des Kontingentshandels (1999) wurden rund 208'100 t Kontingente endgültig erworben.Im Milchjahr 2001/02 betrug die total vermietete Kontingentsmenge rund 380'500 t.Insgesamt wurden somit in diesem Milchjahr 588'600 t oder knapp 20% des Grundkontingentes durch flächenungebundene Kontingentsübertragung von anderen Produzenten gemolken.
Die mit der Milchkontingentierung eingeführte Massnahme,für zugekaufte Tiere aus dem Berggebiet ein Zusatzkontingent von heute 2'000 kg Milch zu gewähren,wurde zu Gunsten der Landwirte leicht geändert.

Die Ausdehnung der Zukaufsperiode auf das ganze Jahr,der Verzicht auf den zwingenden Herdebucheintrag der zugekauften Tiere und die Funktionsänderung der Zuchtbuchführer ab dem 1.Januar 2002 hat die Kontrolle der Anforderungen,welche die zugekauften Tieren erfüllen müssen,schwieriger gemacht.
Die beteiligten kantonalen Amtsstellen sowie das BLW haben sich deshalb entschlossen,die Zusatzkontingente gestützt auf die in der Tierverkehrs-Datenbank (TVD) und im Agrarpolitischen Informationssystem (AGIS) vorhandenen Angaben zu administrieren.Mit einer am 1.Januar 2003 in Kraft getretenen Änderung der Milchkontingentierungsverordnung hat der Bundesrat diesen Systemwechsel vollzogen.
Milchkontingente für zugekaufte Tiere aus dem Berggebiet können nun ab 1.Januar 2003 bei der TVD beantragt werden.
Die TVD enthält im Prinzip alle Angaben für eine vollständige Tiergeschichte (Rückverfolgbarkeit aller Aufenthalte).Wegen fehlender Meldungen weist die Datenbank heute aber noch gewisse Lücken auf,so dass eine elektronische Kontrolle nicht vollumfänglich möglich ist.Im Jahr 2003 besteht deshalb noch die Möglichkeit,den Kantonen bei unvollständigen Tiergeschichten eine Kopie der Begleitdokumente einzureichen,die beweisen,dass das Tier vor dem Kauf während mindestens 22 Monaten ununterbrochen im Berggebiet gehalten wurde.Die kantonalen Amtstellen leiten die Beweismittel mit einem Antrag auf Gutheissung oder Ablehnung an das BLW weiter.Nach der Kontrolle des Gesuches wird der Milchverband das Zusatzkontingent zuteilen.
Die neue Gesuchsregelung zielt einerseits auf eine Vereinfachung der Administration und andererseits auf eine Verbesserung des Meldewesens bei der TVD.Deshalb wird die Übergangsregelung nur im Jahr 2003 anwendbar sein.Ab 1.Januar 2004 werden nur noch Tiere mit einer vollständigen Tiergeschichte einen Anspruch auf ein Zusatzkontingent auslösen.
Am Instrumentarium zur Marktstützung wurde im Berichtsjahr nichts geändert. Allerdings wurden als Folge des Stützungsabbaus die Beihilfen teilweise stark gekürzt. Die Verschlechterung der Lage auf dem Milchmarkt im Laufe des Berichtsjahres und die rückläufigen Käseexporte können jedoch nicht diesem Stützungsabbau angelastet werden.Preisanpassungen,die gestützt auf die zunehmend angespannte Marktlage eigentlich nötig gewesen wären,blieben aus oder erfolgten zu spät.Der Bundesrat hat in diesem Zusammenhang ein Zeichen gesetzt und den Zielpreis pro kg Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein von 77 auf 73 Rp.gesenkt.
■
Die Kontrolltätigkeit des BLW ist vielschichtig und weit gefasst.Nebst den Kontrollen durch das amtsinterne Inspektorat übernehmen die Fachsektionen bei der Milch in zwei Bereichen Kontrollfunktionen.
Auf der einen Seite kontrollieren sie die Durchführung der Milchkontingentierung, welche den Administrationsstellen Milchkontingentierung (in der Regel sind dies die regionalen Milchverbände) übertragen ist.Dies beinhaltet sowohl eine Überwachung der Tätigkeit dieser Stellen in engerem Sinne wie beispielsweise die periodischen Kontrollen der Erfüllung der in der Leistungsvereinbarung genau umschriebenen Aufgaben,wie auch die Kontrolle der Ergebnisse,die sich aus der Anwendung der Ausführungsbestimmungen ergeben.
Das Hauptaugenmerk soll in diesem Bericht dem zweiten Bereich gelten.Es geht dabei um die Kontrolltätigkeit im Rahmen der Massnahmen zur Stützung des Milchpreises. Auch in diesem Bereich wurde der Auftrag zur Administration der Zulagen und Beihilfen einer externen Stelle erteilt;er wurde beim Wechsel in die neue Milchmarktordnung auf den 1.Mai 1999 hin der Treuhandstelle Milch GmbH (TSM) übertragen.Neben den Kontrollen des Inspektorates nehmen die Fachsektionen umfangreiche Aufgaben zur Überwachung der Leistungsvereinbarung und zur Erledigung aufgetauchter Unregelmässigkeiten wahr.Bei der Umsetzung der Massnahmen zur Milchpreisstützung ist viel Geld im Spiel;monatlich geht es um Stützungsmittel von rund 50 Mio.Fr.,welche zur Auszahlung an die Milchverwerter und Exporteure gelangen.Angesichts dieser Dimension ist es notwendig,auf verschiedenen Ebenen möglichst gut und lückenlos zu kontrollieren.
Aufsichtsfunktion des BLW
Zur Überwachung der TSM prüft die Fachsektion stichprobenweise,ob die TSM die Daten der Meldepflichtigen korrekt erfasst hat und beispielsweise auch,ob die einzelnen Gesuchsteller überhaupt existieren und gesuchsberechtigt sind.Auf diese Weise werden monatlich 25 zufällig ausgewählte Gesuche geprüft.Diese Kontrollen erfordern nur selten Rückmeldungen oder Korrekturen,was bedeutet,dass die TSM die ihr übertragenen Aufgaben exakt und gewissenhaft ausführt.
Grobkontrolle durch die TSM
Zur Administrierung der Zulagen und Beihilfen wurde ein EDV-System entwickelt.Die TSM kann damit alle Daten der Gesuchsteller bzw.Verwerter und Exporteure erfassen. Bereits auf dieser Stufe werden erste Kontrollen durchgeführt (bezüglich Termineinhaltung,Vollständigkeit,offensichtlicher Fehler etc.).Im Rahmen der Zahlungsvorbereitungen durch die TSM erstellt das System automatisch eine Reihe von Auswertungen, welche eine lückenlose Kontrolle aller Meldepflichtigen erlauben.Diese sind auch Hilfsmittel zur Arbeitsvorbereitung des Inspektorates und stehen den Fachsektionen für ihre ergänzenden Kontrollen zur Verfügung.Das EDV-System erlaubt produkt- und betriebsbezogene Plausibilisierungen,indem Angaben auf ihre Richtigkeit überprüft werden.Mängel und deren Auswirkungen können damit ermittelt werden (wie z.B.zu Unrecht bezogene Zulagen oder Beihilfen).Aus diesen Analysen ergeben sich schliesslich wichtige Hinweise für die gezielten Kontrollen des Inspektorates.
Kontrolle vor Ort durch das Inspektorat Werden schliesslich in den kontrollierten Betrieben Verstösse gegen die Bestimmungen der Milchkontingentierung oder der Milchpreisstützung festgestellt,so erstellt das Inspektorat im Einzelfall einen Kontrollbericht.Bagatellfälle werden mit einer Mitteilung an die Betroffenen durch das Inspektorat direkt erledigt.Die Dossiers mit den Verstössen,welche Verwaltungsmassnahmen erfordern,gehen zur Erledigung an die Fachsektionen Milch.
In der Fachsektion werden diese Fälle erfasst und darüber eine Geschäftskontrolle geführt.Es wird abgeklärt,ob und welche Sanktionen gegen die fehlbaren Personen ergriffen werden müssen.Zur Sicherstellung der Gleichbehandlung der Fälle wurde ein Sanktionskatalog erstellt.Er enthält Regeln wie der rechtmässige Zustand bei Verstössen gegen milchwirtschaftliche Bestimmungen wieder herzustellen ist und welche Sanktionen im Einzelfall zu verfügen sind.Vor Erlass einer Verfügung wird den Betroffenen das rechtliche Gehör gewährt und nachdem ein Entscheid in Kraft getreten ist,stellt die Fachsektion die Durchsetzung wie beispielsweise die Rückforderung zu Unrecht bezogener Beihilfen oder die Kürzung eines Kontingentes sicher.
Kontrollen der Fachsektion im Jahr 2002
MerkmalAnzahl
Berichte des Inspektorates mit Beanstandungen207
Erledigte Fälle154
davon Fälle mit mangelhafter Milchverwertungskontrolle91 davon Fälle mit Falschangaben im Gesuch um Zulagen oder Beihilfen45 davon Fälle mit einem Verstoss gegen die Milchkontingentierung18
In Bearbeitung stehende Fälle38
Offene Fälle15
Rückforderungen
Fälle 20
Betrag in Fr.53 754
Auferlegte Gebühren
Fälle34
Betrag in Fr.6 580
Quelle:BLW
Ziel dieser Tätigkeit ist primär,dass die Vorschriften eingehalten und die Bundesmittel, die zur Stützung des Milchmarktes eingesetzt werden,rechtmässig geltend gemacht und verteilt werden.Diese Tätigkeit dient letztlich dazu,das reibungslose Funktionieren der Massnahmen sicherzustellen.Dass die Daten vollständig und von guter Qualität sind,ist nicht nur für die Ausrichtung von Zulagen und Beihilfen wichtig, sondern auch für eine zuverlässige Milchstatistik von entscheidender Bedeutung. Deshalb möchte das BLW nicht einfach den rechtmässigen Zustand herstellen und gegen die Fehlbaren die festgelegten Verwaltungsmassnahmen ergreifen,sondern durch moderate Massnahmen in jenen Fällen,in welchen nicht strafbare Handlungen vorliegen,die Betroffenen gleichzeitig zu verbesserter Meldedisziplin motivieren.
Der Grenzschutz in Form von Zöllen und Zollkontingenten ist das wichtigste Instrument zur Unterstützung der inländischen Fleischproduktion.Für den Fleisch- und Eiermarkt sowie für den Export von Zucht- und Nutzvieh werden ausserdem Beihilfen ausgerichtet.
Für den Neu- und Umbau von besonders tierfreundlichen Ställen für Geflügel zur Eierproduktion wurden im Berichtsjahr erstmals Beiträge bezahlt.Nach einer fünfjährigen Übergangsfrist wurden dagegen die Sammel- und Sortierkostenbeiträge für Konsumeier per 31.Dezember 2001 aufgehoben.
Dank der erfreulichen Marktlage mussten einige Entlastungsmassnahmen nicht ergriffen werden:So verzichtete die Proviande auf die Durchführung der Marktabräumung von Tieren der Rinder-,Pferde- und Schweinegattung in Schlachtbetrieben.Ausserdem wurden mit finanzieller Unterstützung des Bundes weder Rind- und Schweinefleisch eingelagert noch Kalb- und Schweinefleisch verbilligt.
Vom Bundesbudget von 46,3 Mio.Fr.für Massnahmen in der Viehwirtschaft wurden lediglich 20,3 Mio.Fr.ausgegeben.Die restlichen Mittel wurden grösstenteils mittels Nachtragskrediten in andere Bereiche umgelagert:2 Mio.Fr.wurden an die Aktion zur alkoholfreien Traubenverwertung beigesteuert,6 Mio.Fr.an die Schlacht- und Fleischabfallentsorgung und 10,8 Mio.Fr.waren für die Ausrichtung von Milchgeldforderungen an die Swiss Dairy Food-Lieferanten bestimmt.Ausserdem wurden gestützt auf die Eierverordnung 3 Mio.Fr.zur ergänzenden Finanzierung von Direktzahlungen für besonders tierfreundliche Legehennenhaltung verwendet.Wesentliche Gründe für die Minderausgaben in der Viehwirtschaft waren die erfreuliche Marktlage auf dem Fleischund Eiermarkt sowie der immer noch durch Restriktionen behinderte Export von Zuchtund Nutzvieh.Zwar erlauben Deutschland und Frankreich seit dem 30.November 2001 bzw.dem 3.Mai 2002 wieder die Einfuhr von Schweizer Vieh,doch hält das frühere Hauptabnehmerland Italien weiterhin ein Einfuhrverbot aufrecht.Dank dem etwa 10% höheren Rindfleischkonsum musste nicht wie sonst üblich in der zweiten Jahreshälfte auf dem Markt interveniert werden.Die für saisonale Verwertungsmassnahmen auf dem Eiermarkt verfügbaren Gelder wurden zudem nicht vollständig ausgenützt.
Total 20,3 Mio. Fr.
Leistungsvereinbarung
Proviande 37%
Ausfuhrbeihilfen
Zucht- und Nutzvieh 11%
Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 18% Verwertungsbeiträge Schafwolle 4%
Einlagerungs- und Verbilligungsbeiträge für Rind- und Kalbfleisch 30%
Quellen: Staatsrechnung, BLW

Seit dem 1.Januar 2000 erbringt die Proviande im Auftrag des BLW Dienstleistungen auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt.Die Aufträge werden mit zweckgebundenen Mitteln aus dem Fleischfonds finanziert:
1.Neutrale Qualitätseinstufung auf überwachten öffentlichen Märkten und in Schlachtbetrieben
Der Klassifizierungsdienst der Proviande stufte 80 bis 90% der geschlachteten Tiere und alle Lebendtiere auf öffentlichen Märkten neutral ein.Mit dieser Arbeit sind über hundert Voll- und Teilzeitangestellte der Proviande betraut.Sie leisteten zusammen über 53'000 Arbeitsstunden.
Für die Einstufung von Schweineschlachtkörpern verwenden bereits vier Betriebe in der Schweiz das so genannte Autofom,um das Qualitätsmerkmal Magerfleischanteil zu schätzen.Das Autofom ist ein komplexes,vollautomatisch arbeitendes Klassifizierungsgerät,welches den Magerfleischanteil letztlich unter Einbeziehung von Hunderten von Messungen schätzt.Für die Bedienung der anderen zugelassenen Geräte zur Einstufung der geschlachteten Schweine,wie dem Fat-O-Meater oder dem CSB-Ultra-Meater, ist der personelle Aufwand höher.Der Mittelwert des Magerfleischanteils aus einer Stichprobe von 850'000 Schlachtungen (30% aller Schlachtungen) betrug rund 55%.
Für die Qualitätsbeurteilung von geschlachteten Tieren der Rinder-,Schaf-,Ziegen- und Pferdegattung ist der optische Eindruck des Schlachtkörpers massgebend.Die Fleischigkeits- und Fettgewebeklasse am Schlachtkörper wird dabei mit Hilfe von Referenzbildern beurteilt.Die so genannte CH-TAX Skala für die Beurteilung der Fleischigkeit beinhaltet 5 Klassen:C = sehr vollfleischig,H = vollfleischig,T = mittelfleischig,A = leerfleischig und X = sehr leerfleischig.Zur Beurteilung der Fettabdeckung stehen ebenfalls fünf Klassen zur Auswahl.Bei Lebendtieren der Rinder- und Schafgattung wenden Klassifizierungsexperten die gebräuchlichen Metzgergriffe an, um die Qualität nach CH-TAX zu bestimmen.
Die Auswertung einer Datenstichprobe aus den Ergebnissen der Qualitätseinstufung des Jahres 2002 zeigt besonders klare Unterschiede zwischen Muni und Kühen. Geliefert wurden die Daten aus zehn Schlachtbetrieben,die zusammen beinahe 40% aller Schlachtungen von Tieren der Rindergattung durchführen.Bei den Muni waren 33% in den Spitzenklassen C und H,61% in der mittleren Klasse T und lediglich 6% in den schwachen Fleischigkeitsklassen A und X.Bei den Kühen entfielen nur 2% auf die besten Klassen C und H,42% auf die Klasse T und 56% auf die Klassen A und X.Bei den Lämmern dominierten die mittelfleischigen Schlachtkörper mit einem Anteil von 57%.Zwei Drittel der geschlachteten Gitzi wurden von den Klassifizierungsexperten als vollfleischig eingestuft.
■ Schlachtvieh und Fleisch: Leistungsvereinbarungen
Verteilung der Schlachtkörper auf die Fleischigkeitsklassen 2002
In Zusammenarbeit mit bäuerlichen Organisationen und/oder kantonalen Stellen organisierte die Proviande auf 75 Marktplätzen Grossviehmärkte,auf 19 Marktplätzen Kälbermärkte und auf 101 Marktplätzen Schafmärkte.Die Plätze verteilen sich auf 19 Kantone beim Grossvieh,auf 7 Kantone bei den Kälbern und auf 16 Kantone bei den Schafen.Für die Winter-Wanderherden der Schafe und Lämmer wurden vom 15.November 2001 bis zum 15.März 2002 auf zusätzlichen Plätzen,die über eine passende Infrastruktur verfügten,Märkte durchgeführt.Auf den Grossviehmärkten werden hauptsächlich Milchkühe gehandelt.Weniger bedeutend ist die Auffuhr von Muni und Ochsen,die dem Handel oder dem Schlachtbetrieb in der Regel direkt ab Stall verkauft werden.Die Zahl der aufgeführten Tiere der Schafgattung nahm gegenüber 2001 um 15% zu.Kälber wurden gleich viele aufgeführt und beim Grossvieh nahmen die Auffuhren um 5% ab.Die Proviande teilte den übernahmepflichtigen Zollkontingentanteilsinhabern im Rahmen der Marktabräumung mit 2'029 St.Grossvieh sowie 1'614 Schafen und Lämmern jeweils rund einen Drittel weniger zu als im Vorjahr.Auf den Kälbermärkten mussten lediglich 139 Tiere abgeräumt werden.
Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten 2002
MerkmalEinheitKälberGrossviehTiere der Schafgattung
Überwachte öffentliche MärkteAnzahl473899308
Aufgeführte TiereSt.52 96069 13375 937
Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen%171826
Zugeteilte Tiere
(Marktabräumung)St.1392 0291 614
Quelle:Proviande
Gegenüber dem Jahr 2001 verbesserte sich im Berichtsjahr die Lage auf dem Rindfleischmarkt.Mit staatlichen Beihilfen wurde die Einlagerung von lediglich 1'061 t Kalbfleisch und die Verbilligung von rund 4'500 Rindsstotzen unterstützt.Die Proviande überprüfte die Einhaltung der Einlagerungs- und Verbilligungsbestimmungen.Das BLW zahlte Beiträge im Umfang von 6 Mio.Fr.aus.Alle Fleischlager,auch die Rindfleischlager im Umfang von 2'200 t aus dem Jahre 2001,konnten bis Ende des Berichtsjahres vollständig dem Markt zugeführt werden.

Die Zahl der eingereichten Gesuche lag 2002 mit 886 nochmals um 5% tiefer als im Vorjahr.Die Proviande prüfte die gemeldeten Inlandleistungen auf Vollständigkeit und Plausibilität.Dabei kontrollierte sie die Menge der eingesalzenen Rindsbinden in jedem Betrieb einmal vor Ort;die anderen gemeldeten Inlandleistungen wie Schlachtungen und Nierstückzukäufe wurden hingegen stichprobenweise kontrolliert.Die erfassten und kontrollierten Daten der Inlandleistungen übermittelte die Proviande dem BLW. Basierend auf diesen Daten teilte das BLW am 21.November 2002 insgesamt 872 juristischen und natürlichen Personen Zollkontingentsanteile mittels Verfügung zu: 745 Personen erhielten Anteile für Fleisch von Tieren der Rindergattung (ohne Rindsbinden),450 für Fleisch von Tieren der Schweinegattung,203 für Fleisch von Tieren der Schafgattung,155 für Rindsbinden,36 für Fleisch von Tieren der Pferdegattung und 34 für Fleisch von Tieren der Ziegengattung.Auf 14 Gesuche konnte nicht eingetreten werden,da diese entweder zu spät eingereicht wurden oder die minimale Inlandleistung nicht erreichten.
■ Verwertung der Schafwolle
Von der inländischen Schafhaltung fallen jährlich 900 t Wolle an.Davon werden etwa 40–45% durch die Inlandwollzentrale des schweizerischen Schafzuchtverbandes übernommen und vermarktet.Etwa ein Drittel wird als Abfall entsorgt und ein Viertel wird von den Schafzüchtern direkt vermarktet.Seit je her wird Wolle als Grundstoff für die Fabrikation von Textilien verwendet.Eine sinnvolle Alternative dazu ist der Gebrauch als Dämm- und Isoliermaterial.Infolge der ungenügenden Nachfrage der inländischen Textilindustrie muss die von der Inlandwollzentrale gesammelte,sortierte und gepresste Wolle grossmehrheitlich zum Weltmarktpreis exportiert werden.Der Bund richtete der Inlandwollzentrale im Berichtsjahr 0,8 Mio.Fr.zur Verwertung der inländischen Wolle aus.Einen Viertel dieses Beitrages benötigte sie,um einen Teil ihrer Betriebskosten zu decken.Den Rest des Verwertungsbeitrages konnte sie den Produzenten für die angelieferte Wolle ausrichten.
■ Strukturwandel beim Fleisch- und Fleischwarenhandel
Gleich dem Strukturwandel in der Landwirtschaft sind auch Teile der nachgelagerten Fleischbranchen einer bedeutenden Strukturveränderung unterworfen.Die Zahl der Metzgereien,deren Hauptaktivität der Verkauf von Fleisch und Fleischwaren ist,hat von 2'659 im Jahre 1991 auf 1'871 im Jahre 2001 (–29,6%) abgenommen.In dieser Periode sank die Zahl der Beschäftigten in diesen Metzgereien um einen Drittel auf 9'300 Personen.Die Läden,in denen der Verkauf von Fleisch- und Fleischwaren nicht die Haupttätigkeit ist,sind in den erwähnten Zahlen nicht enthalten.Dazu zählen insbesondere Grossverteiler oder Lebensmittelgeschäfte mit einem breiten und tiefen Sortiment von Produkten (Milch,Gemüse,Obst,Fleisch etc.).Lediglich in etwa 40% der Metzgereien werden pro Jahr mehr als 30 St.Grossvieh oder 100 Schweine geschlachtet.Zwei Drittel schlachten weniger oder gar nicht und beziehen ihr Fleisch hauptsächlich von den professionellen Schlachtbetrieben.Für 97 Betriebe war das Schlachten von Rindern,Schweinen,Schafen,Ziegen und Pferden die Hauptaktivität im Jahre 2001,für 10 Betriebe das Schlachten von Geflügel und für 155 die Fleischverarbeitung.Die Zahl der Betriebe in diesen Branchen ist seit 1995 relativ konstant. Die Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe beschäftigten im Jahre 2001 etwa 11'000 Personen.
■ Fischerei und Fischzucht: Kleine Sektoren
Gestützt auf das LwG werden Massnahmen zur Strukturverbesserung und zur Förderung der Qualität und des Absatzes in der Berufsfischerei und in der Fischzucht unterstützt.Für Marktentlastungsmassnahmen oder Direktzahlungen werden jedoch keine Mittel ausgerichtet.Nach einer Neuorganisation der statistischen Erhebung im Jahre 2000 wies die Fischzucht 83,die Berufsfischerei 224 Arbeitsstätten auf.Im gleichen Jahr arbeiteten in beiden Branchen insgesamt 644 Personen,wovon 437 Personen als Vollzeitbeschäftigte.
■
Die Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte wird aus zweckgebundenen Zollanteilen alimentiert.Für die Unterstützung der Inlandeierproduktion und für Verwertungsmassnahmen standen im Berichtsjahr 12,5 Mio.Fr.aus der Kasse zur Verfügung.
Seit dem 1.Januar 2002 richtet das BLW Investitionsbeiträge für den Um- und Neubau von tierfreundlichen Geflügelställen aus.Die Beiträge sind ausschliesslich zu Gunsten von Ställen für Geflügel zur Eierproduktion bestimmt und müssen weder zurückgezahlt noch verzinst werden.17 Betriebe mit Legehennen,5 Betriebe mit Junghennen und 1 Betriebmit Lege- und Junghennen profitierten von einer zugesicherten Unterstützung von insgesamt 415'000 Fr.Davon zahlte das BLW im Berichtsjahr bereits 248'000 Fr. aus.Die begünstigten Betriebe halten durchschnittlich rund 3'800 Tiere.Gebaut wurden in erster Linie Aussenklimabereiche,die eine ausreichend eingestreute und gedeckte Fläche ausserhalb des Stalles aufweisen müssen.Ein Aussenklimabereich ist für die Erfüllung der BTS- und RAUS-Bestimmungen zwingend erforderlich.
Vor allem nach Ostern und in den Sommermonaten ist die Nachfrage nach inländischen Eiern gegenüber der Zeit vor Weihnachen und vor Ostern schwach.Um die Auswirkungen dieser saisonalen Nachfrageschwankungen zu mildern,stellte das BLW 3 Mio.Fr.für Verwertungsmassnahmen zur Verfügung.Die Eiprodukteunternehmen schlugen 18,6 Mio. überschüssige Inlandeier auf.Das Aufschlagen wurde mit einem Beitrag von 9 Rp.je Ei unterstützt.Zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten verbilligten die Anbieter 12,6 Mio.Eier.Dafür erhielten sie 5 Rp.je Ei.Das BLW überprüfte die Einhaltung der Bestimmungen der Aufschlags- und Verbilligungsaktionen mit Domizilkontrollen und Kontrollen von Nachweisdokumenten.

Eier:Unterstützung der inländischen Produktion und Verwertungsmassnahmen
■ Nutz- und Sportpferde: Versteigerung von Zollkontingentsanteilen
Das BLW unterstützte im Jahr 2002 praxisnahe Versuche beim Geflügel sowie die Verbreitung der entsprechenden Ergebnisse bei der Bildung und Beratung mit rund 319'000 Fr.Nutzniesser waren das Aviforum in Zollikofen,das Zentrum für tiergerechte Haltung für Geflügel und Kaninchen in Zollikofen und das FiBL in Frick.Folgende Projekte wurden mit Mitteln aus der Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte unterstützt:Optimierung der Legehennenhaltung mit Grünauslauf - Management und Zucht;Schnabelkürzen bei Legehennen-Eintagesküken in der Schweiz:Wie häufig sind Missbildungen in Folge des Eingriffes;Effekt der Ganzweizenfütterung bei Junghennen auf die späteren Legehennen;Vergleich des Coupierens und des Touchierens der Schnäbel von Eintagesküken auf die Entwicklung und die Leistung von braunen Jungund Legehennen;Legeleistungsprüfung für Legehennen in Bodenhaltung.
Mit der Aufhebung der Sammel- und Sortierkostenbeiträge auf den 31.Dezember 2001 sank die Stützung des Eiermarktes um rund 3,3 Mio.Fr.pro Jahr.Entgegen den Prognosen der Eierabnehmer hatte dieser Schritt keinen Druck auf die Produzentenpreise zur Folge.Die Preise stiegen gar um 1 Rp.je Ei.Die Sammel- und Sortierkostenbeiträge waren aufgrund dieser Beobachtungen keine wirksame Massnahme zur Stützung des Produzentenpreises.
Das BLW hat das Zollkontingent «Tiere der Pferdegattung (ohne Zuchttiere,Esel, Maulesel und Maultiere)» in zwei Hälften von je 1'461 St.ausgeschrieben und versteigert.An jeder Versteigerung reichten über 200 Personen Gebote für mehr als 2'000 St. ein.Im Mittel lag der Zuschlagspreis bei 360 Fr.pro Nutz- und Sportpferd.Der Versteigerungserlös zu Gunsten der Bundeskasse belief sich auf 1 Mio.Fr.Seit dem 1.Januar 2002 wurde das Teilzollkontingent Esel,Maulesel und Maultiere im Umfang von 200 St.nach dem Windhund an der Grenze verteilt.Das Teilzollkontingent war bereits im August vollständig ausgenützt.

Das Jahr 2002 war im Pflanzenbau ein Konsolidierungsjahr,nachdem die Umsetzung der AP 2002 im Jahre 2001 abgeschlossen werden konnte.Bei sämtlichen Ackerkulturen bildet der Grenzschutz die wichtigste Massnahme zur Inlandpreisstützung. Die Übertragung der Produktions- und Absatzkoordination vom Bund an die Kartoffel-, Ölsaaten- und Getreidebranche führte insgesamt zu einer marktorientierteren Produktion bezüglich Erntemengen und Produktqualitäten.
Bei Obst,Gemüse und Schnittblumen ist ebenfalls der Grenzschutz die wichtigste Massnahme.Ausserdem ist bei Obst die finanzielle Beteiligung an der Verwertung von Mostobst und die Marktentlastung für Steinobst von Bedeutung. Massnahmen
1Je nach Verwendungszweck bzw.Zolltarifposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung
2Betrifft nur Teile der Erntemenge (Frischverfütterung und Trocknung von Kartoffeln,Marktreserve für Kernobstkonzentrat)

3Für Kartoffelprodukte zu Speisezwecken
4Nur für Saatkartoffeln
5Alkoholfreie Verwertung von Trauben
Gegenüber dem Jahr 2001 stieg die direkte Marktstützung um 16,9 Mio.Fr.an.Die ausgerichteten Anbaubeiträge für Ölsaaten nahmen um 5,0 Mio.Fr.und für Körnerleguminosen um 2,4 Mio.Fr.zu.Die Leistungsvereinbarung Ölsaaten belastete mit 8,5 Mio.Fr.im Berichtsjahr erstmals das Konto Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge.Die Stärkung der inländischen Ölsaatenproduktion ergab verglichen mit 2001 Mehraufwendungen von 3,7 Mio.Fr.Für die Verwertung von Saatkartoffeln und für die Förderung der Produktion von Mais- und von Futterpflanzensaatgut wurden insgesamt 3,9 Mio.Fr.aufgewendet.Die Kartoffelverwertung (ausgenommen Saatkartoffeln) wurde mit 19 Mio.Fr.und die Verarbeitung der Zuckerrüben mit 45 Mio.Fr.unterstützt.

Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 59%
13%
1%
27%
Quelle: Staatsrechnung
Die Zunahme der aufgewendeten Mittel für Körnerleguminosen resultiert aus den per Januar 2002 von 1'260 auf 1'500 Fr.je ha erhöhten Anbaubeiträgen und der erfolgten Flächenausdehnung aufgrund der gestiegenen wirtschaftlichen Attraktivität der eiweissreichen Kulturarten.Höhere Verarbeitungsbeiträge und die grössere Anbaufläche von Ölsaaten waren im Jahr 2002 für die gestiegenen Aufwendungen massgebend.Hinzu kommt die Auszahlung von Beiträgen für die Verarbeitung von Ölsaaten zu technischen Zwecken in Pilot- und Demonstrationsanlagen zu Lasten der Leistungsvereinbarung Ölsaaten.Diese Beiträge wurden bis zur Ernte 2001 der Rubrik nachwachsende Rohstoffe belastet.
Quelle: Staatsrechnung
Zur Marktentlastung im Weinbau wurden von der Traubenernte 3,47 Mio.Liter Traubensaftder alkoholfreien Verwertung zugeführt.Der ausserordentliche Bundesbeitrag für diese Verwertung betrug 6,96 Mio.Fr.
Total 18,2 Mio. Fr.
Export andere Kernobstprodukte 3,4%
Export Kirschen 2,2%
Verwertung von Äpfel und Birnen im Inland 5,8% Anderes 2,1% davon Marktentlastung (Kirschen und Zwetschgen) 1,3%
Export von Apfelsaftkonzentrat 70,1%
Export von Birnensaftkonzentrat 16,4%
Quelle: BLW
Für den Export von Obstprodukten wurden 16,36 Mio.Fr.verwendet.Dies entspricht einem Anteil von 89,8% der eingesetzten Bundesmittel für Obst.Die Marktentlastungsmassnahmen für Kirschen und Zwetschgen kamen auf rund 0,63 Mio.Fr.zu stehen.
Im 19.Jahrhundert erlebte die inländische Landwirtschaft dank bedeutenden Exporten von Vieh,Käse und Obst eine Blüte ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung.Mit der Etablierung der dampfgetriebenen Schifffahrt und Eisenbahn konkurrenzierte preisgünstiger Weizen aus den USA die europäische Produktion,wodurch die Produzentenpreise in der zweiten Jahrhunderthälfte einbrachen und die inländische Getreideanbaufläche bis zur Jahrhundertwende auf rund 150'000 ha abnahm.Mit dem Aufbau einer internen Preisstützung für Agrarprodukte,eines Importschutzes mittels Zöllen und der Förderung der landwirtschaftlichen Forschung Ende des 19.Jahrhunderts wirkte der Bund dieser ersten Agrarkrise entgegen.
übrige Kulturen
Silomais
Raps
Zuckerrüben
Kartoffeln
übriges Getreide
Körnermais
Dinkel
Weizen
1880190019101920193019401950196019701980199020002002
Trotz der ergriffenen agrarpolitischen Massnahmen vor der Jahrhundertwende betrug der Selbstversorgungsgrad mit Getreide zu Beginn des Ersten Weltkrieges nur rund 20%,während durch eingeschränkte Exportmöglichkeiten Milchüberschüsse den Markt belasteten.Mit Anbauvorschriften für die Getreide- und Kartoffelproduktion und erstmaliger Preis- und Absatzgarantie für Getreide (Importmonopol für Getreide beim Bund) konnte der Abwärtstrend der offenen Ackerfläche bis nach dem Krieg gestoppt werden (a).Der wiedererstarkte internationale Güterverkehr brachte preisgünstige Importe auf den Markt und liess die Anbaufläche in der Folge weiter absinken (b).Das Getreidegesetz von 1929 gewährte den Produzenten erneut eine Preis- und Abnahmegarantie,nachdem 1926 das staatliche Getreidemonopol aufgegeben wurde.Die Krisenvorsorge im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges funktionierte und mit der im Jahre 1939 ausgelösten Anbauschlacht stieg die Anbaufläche bis nach Kriegsende markant an (c).Mit fortschreitender Mechanisierung der Anbau- und Konservierungstechnik gewann der Maisanbau seit den sechziger Jahren zunehmend an Bedeutung und mit der Inbetriebnahme der Zuckerfabrik Frauenfeld im Jahre 1963 (Aarberg 1899) dehnte sich die Zuckerrübenanbaufläche aus (d).Mit der Kontingentierung der Milchmenge 1977 und der Einführung von Höchstbeständen in der Fleischproduktion 1980 verlagerte sich die Produktion noch verstärkt auf den Ackerbau.Die Getreideanbaufläche stieg in den achtziger Jahren markant an (e). Überschüsse an Brotgetreide,das zu Lasten der Bundeskasse zu Futtergetreide deklassiert werden musste,erforderten Anpassungen in der Getreidemarktordnung.Seit 1990 nimmt die Getreideanbaufläche wieder ab (f).
■ Ertragsleistung Die Ertragsleistung der wichtigsten Kulturarten konnte im vergangenen Jahrhundert durch die züchterische Bearbeitung,eine optimierte Anbautechnik,eine bessere Versorgung mit Pflanzennährstoffen und einen intensiveren Pflanzenschutz mehr als verdoppelt werden.Der Vergleich der Hektarerträge zeigt erst ab den achtziger Jahren die Dominanz des Weizens gegenüber Dinkel,wobei primär die vom Markt geforderten Qualitätseigenschaften über die Anbauwürdigkeit einer Kultur entscheiden.Mittlere Erträge um die 60 dt je ha von Winterweizen-Sorten des Nationalen Sortenkataloges zeigen,dass das Leistungspotenzial im Vergleich zu intensiveren Weizenanbaugebieten (z.B.Bundesland Hessen mit einem mittleren Winterweizenertrag der Periode 1995 bis 2000 von 74 dt je ha) nicht ausgeschöpft wird.Die Integrierte Produktion (ab 1993) bzw.der Ökologische Leistungsnachweis (ab 1999) sowie die Extenso-Programme bei Getreide und Raps bewirkten eine Reduktion des Nährstoffeinsatzes und eine abgeschwächte Ertragssteigerung der Kulturen.

Beim Futtergetreide soll das Schwellenpreisniveau bis Ende 2007 reduziert werden. Die Reduktion hat eine Erlösminderung im Ackerbau zur Folge,jedoch eine Verbesserung der Wettbewerbsstärke der Geflügel- und Schweineproduktion durch tiefere Futtermittelkosten.Es ist davon auszugehen,dass tiefere Futterkosten weitgehend über tiefere Verkaufspreise der tierischen Produkte an den Handel und die Konsumenten weitergegeben werden müssen.
Im Einklang mit den Massnahmen zur AP2007 soll die Mengensteuerung auch in der Zuckerproduktion der Branche übertragen werden.Die Höchstmenge für die Zuckergewinnung soll aufgehoben werden.Die Verantwortung für eine optimale Auslastung der bestehenden Verarbeitungskapazitäten und für die Erzielung angemessener Erlöse für die Rübenpflanzer geht damit an die Branche über.Im Interesse einer effizienten Nutzung der beschränkten finanziellen Mittel sind Produktionsüberschüsse mit kostenintensiver Verwertung zulasten der Rübenpflanzer zu vermeiden.
Das Inlandangebot an Kartoffeln reichte zusammen mit dem Zollkontingent in der Vergangenheit wiederholt für die Bedarfsdeckung nicht aus,weshalb das Manko durch eine vorübergehende Erhöhung des Zollkontingentes gedeckt wurde.Bislang wurde das Teilzollkontingent Kartoffeln aufgrund der Inlandleistung zugeteilt.In den bestehenden Marktgefügen mit ungenügendem Konkurrenzdruck kann dies zu Importrenten führen.Deshalb wird eine Änderung der Einfuhrregelung geprüft.
Das aktuelle Einfuhrsystem beim Wein ist ein Kompromiss zwischen einer vollständigen Liberalisierung der Weineinfuhren,die von der einen Seite,gestützt unter anderem auf das angenommene Referendum von 1990 gegen den Bundesbeschluss über den Rebbau,verlangt wurde,und einem grösstmöglichen GATT/WTO-verträglichen Grenzschutz,dessen Beibehaltung das andere Lager verfocht.Anfänglich notifizierte der Bund in der Liste seiner GATT/WTO-Verpflichtungen drei Zollkontingente:ein Rotweinkontingent in der Höhe von 1,62 Mio.hl,ein Kontingent für offenen Weisswein von 30'600 hl und ein Kontingent für weissen Flaschenwein von 45'000 hl.In Übereinstimmung mit der Branche wurde beschlossen,mit der Umsetzung der Abkommen die beiden Weissweinkontingente zu einem einzigen Kontingent zusammenzulegen.Die Gesamtmenge der Zollkontingente entsprach der Summe der während der Referenzjahre eröffneten Kontingente.

■ Weissweineinfuhren seit der Umsetzung der WTO-Abkommen
Die Verdoppelung des Kontingents im Jahr 1996,die anschliessende jährliche Erhöhung um 10'000 hl und der Zusammenschluss der Rot- und Weissweinkontingente auf den 1.Januar 2001 hatten eine Zunahme der Weissweineinfuhren zur Folge.Diese waren im Berichtsjahr schliesslich auf rund 240'000 hl angewachsen.Der Importanstieg wirkte sich nachteiligauf den Konsum von Schweizer Weissweinen aus:Seit Umsetzung der GATT/WTO-Abkommen ging dieser von 656'954 hl (1995/96) auf 625'705 hl (2001/02) zurück.Damit hielt der ganz zu Beginn der neunziger Jahre eingesetzte Trend an.Anzumerken ist,dass der Konsumrückgang vor dem In-Kraft-Treten der WTOVereinbarungen grösserwar als danach (vgl.Agrarbericht 2002,S.168 ff.).Die gesamten Rot- und Weissweineinfuhren zum Kontingentszollansatz beliefen sich im Jahr 2001 auf 1,64 Mio.hl und im Jahr 2002 auf 1,61 Mio.hl.
Die häufigsten Weissweinimporte in die Schweiz (2002)
■ Vergleich der Importe von Offen- und Flaschenwein
Weisswein
Die Einfuhren von Flaschen- und von Offenwein verzeichneten seit 1997 einen Anstieg. Angesichts der Erhöhung des Importvolumens nahm der Anteil der Flaschenweine kontinuierlich von 55% auf 42% ab.Gemessen am Gesamtwert der Weineinfuhren blieb dieser Anteil hingegen praktisch konstant.Der durchschnittliche Literpreis für weisse Flaschenweine bewegt sich praktisch nicht.
Entwicklung von Importen und Preisen des weissen
1 Erzeugnisse mit höchstens 13 Volumenprozent Alkohol
2 Die Importzahlen für 1996 werden durch das in diesem Jahr angewandte Windhundverfahren verfälscht, das einen hohen Import von offenen Weissweinen zur Folge hatte.
Quelle: OZD
Beim Offenwein sind die Einfuhrmengen ebenso deutlich angestiegen,wie sich der Wert der Erzeugnisse mit höchstens 13 Volumenprozent Alkohol verringert hat.Diese mit Schweizer Weinen teilweise vergleichbaren Erzeugnisse konkurrenzieren die Inlandproduktion.Die durchschnittlichen Literpreise zeigen einen anhaltenden Abwärtstrend. Von 1.74 Fr./l im Jahr 1997 sind sie im Berichtsjahr auf 0.74 Fr./l gefallen.Aus dieser erstaunlichen Entwicklung darf jedoch nicht abgeleitet werden,dass gleichzeitig auch die Qualität der Weine gesunken ist.Die Preisentwicklung lässt sich teilweise durch die grossen Überschüsse auf den internationalen Märkten,insbesondere Europa,erklären (30 bis 40 Mio.hl pro Jahr).Ein weiterer Grund ist aber auch die Globalisierung des Handels,denn die Transportkosten haben nur geringen Einfluss auf die Produktepreise. Die weltweite Überproduktion hält weiter an,und es bestehen keine Anzeichen für eine Trendumkehr.
Ebenfalls zugenommen haben die Importe von weissen Flaschenweinen.Im Gegensatz zum Offenwein ist das Preisniveau auf einem relativ hohen Niveau geblieben. Insgesamt sind die Offenweineinfuhren stärker angestiegen als die Importe von Flaschenweinen.Diese starke Konkurrenzsituation wirkt sich auch auf die schweizerische Weissweinproduktion aus,und zwar sowohl auf die Mengen als auch auf die Preise der Weine und somit der Ernte.
Die importierten Billigweine stammen in erster Linie aus Frankreich,Italien,Spanien und Südafrika.Einen deutlich höheren Einheitspreis erzielen die Weine aus der Neuen Welt,obwohl sie oft für die Überflutung des Schweizer Weinmarktes verantwortlich gemachtwerden.
Rotwein
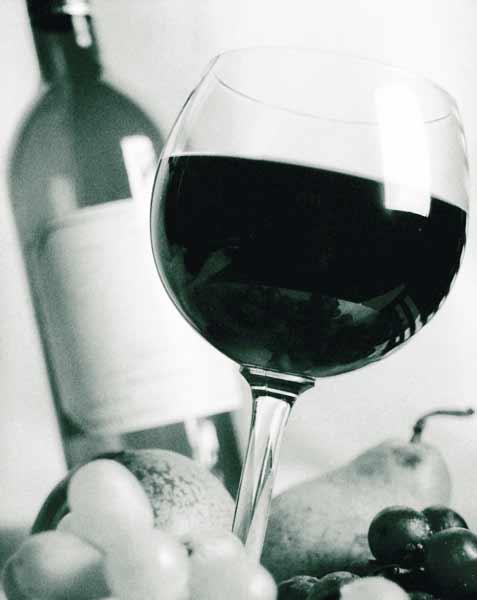
Bei den Flascheneinfuhren stiegen die Mengen und Preise konstant an.Die Einfuhren haben sich zwischen 1995 und 2002 mehr als verdoppelt.Der durchschnittliche Literpreis erhöhte sich in einer ersten Phase beträchtlich,bevor er in den vergangenen zwei Jahren zurückfiel.Im Gegensatz zum Weisswein legte beim Rotwein der teurere und folglich wahrscheinlich auch qualitativ bessere Flaschenwein deutlich zu.
Die Einfuhren von roten Offenweinen mit höchstens 13 Volumenprozent Alkohol sind sowohl mengen- als auch wertmässig konstant rückläufig.Der durchschnittliche Literpreis blieb indessen ziemlich stabil.Der Rückgang der Importvolumen gekoppelt mit einem nahezu stabilen Literpreis ermöglichte eine positive Entwicklung des Schweizer Rotweins,der sogar Marktanteile gewinnen konnte.
Der Bundesrat ist sich der schwierigen Phase,in der sich der schweizerische Weinbau befindet,bewusst und hat daher zusammen mit der Branche eine Drei-PunkteStrategie für die AP 2007 entwickelt.Diese lässt sich wie folgt zusammenfassen:die Umstellung der schweizerischen Rebflächen durch Rodung der überschüssigen mit Chasselas und Müller-Thurgau bestockten Rebflächen und deren Ersatz durch andere marktfähige Reben;die Unterstützung der Absatzförderung im Inland geknüpft an gewisse Bedingungen sowie die Fortsetzung der Absatzförderung beim Export.Es handelt sich also um Struktur- und Absatzförderungsmassnahmen,mittels denen die Überproduktion bekämpft werden soll.All diese Massnahmen haben zum Ziel,dass mittel- bis langfristig der schweizerische Weinbau der Nachfrage des Marktes mit einem ausgeglichenen Angebot begegnen kann.Nach dieser Anpassungsphase müssen sich die Schweizer Weine,die rund 40% der Marktanteile ausmachen,ohne Hilfe gegen die ausländischen Weine behaupten,selbst wenn die Letzteren zu sehr tiefen Preisen eingeführt werden.Der schweizerische Weinbau ist insgesamt in der Lage,diese Herausforderung zu meistern.Ein Teil des Weinsektors bringt schon jetzt seine Weine zu durchaus ansprechenden Preisen auf den Markt.

■
Im Rahmen des Forschungsauftrages des BLW «Umlagerung der Milchpreisstützung» können nun die zwei weiteren Teilprojekte «Milchproduktion im Talgebiet» und «Sektorale Auswirkungen einer Kontingentsaufhebung» vorgestellt werden.Die Ergebnisse aller vier Teilprojekte wurden in einem Synthesebericht «Effekte einer Aufhebung der Milchkontingentierung und einer Umlagerung der Milchpreisstützung» zusammengefasst.Der Synthesebericht ist auf der BLW-Homepage www.blw.admin.ch verfügbar.
Als Basis für die Abschätzung der Auswirkungen einer Aufhebung der Milchkontingentierung bzw.einer Umlagerung werden in den Modellstudien vier Szenarien untersucht:
– Kontingent65: Referenzszenario,Beibehaltung der Milchkontingentierung und der Marktstützung,Produzentenmilchpreis von Fr.0.65.
– Markt60: Referenzszenario 2,Aufhebung der Milchkontingentierung,Beibehaltung der Marktstützung,Produzentenmilchpreis von Fr.0.60.
– Rind42: Aufhebung der Milchkontingentierung,Umlagerung der Milchpreisstützung in RGVE-Stützung,das heisst auch die Milchkühe erhalten einen Raufutterbeitrag von Fr.900.– (kein Milchabzug mehr).Produzentenmilchpreis von Fr.0.42.
– Grünland42: Aufhebung der Milchkontingentierung,Umlagerung der Milchpreisstützung in Grünlandstützung,das heisst Beiträge von Fr.1’000 pro ha Grünland. Produzentenmilchpreis von Fr.0.42.
Diese Szenarien beschreiben vier mögliche Entwicklungen der Rahmenbedingungen für die Schweizer Landwirtschaft bis ins Jahr 2007.
Die Resultate der Untersuchung bestehen aus Vergleichen zwischen den heutigen und den errechneten Produktionsstrukturen in den verschiedenen Szenarien untereinander sowie Schätzungen des Produktionspotenzials für Milch und Kälber (Basis für die Fleischproduktion) im Talgebiet.Für die Milchproduktion wurde zwischen drei Kuhtypen (Leistungsklassen) unterschieden:einer Weidekuh mit Milchleistung 5’800 kg, einer Kuh mit Milchleistung 7’800 kg und einer Hochleistungskuh mit Milchleistung 10’800 kg.
Die Untersuchung zeigt,dass bei einer Aufhebung der Milchkontingentierung (Markt60) spezialisierte Milchproduktionsbetriebe resultieren,die relativ zu heute auf den grösseren Betrieben deutlich mehr Milch produzieren.Bei der Umlagerung der Produktstützungauf den Produktionsfaktor Tier (Rind42) werden die Betriebsstrukturen dahingehend angepasst,dass grosse Bestände von Weidekühen gehalten werden und diese in der Vegetationsperiode hauptsächlich Weidefutter fressen.Damit wird eine Reduktion des Arbeitsaufwandes pro Tier erreicht,gleichzeitig wird eine tiefere Produktivität des Tieres (Milchleistung) in Kauf genommen.Bei einer Umlagerung der Stützung auf den Produktionsfaktor Fläche (Grünland42) werden die Betriebsstrukturen so angepasst,dass ein Optimum zwischen einer Minimierung des Arbeits-
aufwandes und einer Maximierung der Bewirtschaftung von Wies- und Ackerland gesucht wird.Die Produktion von Milch oder Kälbern ist im Vergleich zu anderen Szenarien tiefer.
Die Entwicklung der Milchproduktion im Talgebiet in den drei Szenarien Markt60, Rind42 und Grünland42 hängt stark von den Kuhtypen (Leistungsklassen) ab.Unter der Annahme einer Gleichverteilung aller drei Kuhtypen resultiert bei einer Aufhebung der Kontingentierung (Markt60) ein Anstieg des Milchproduktionspotenzials um 75%, in den beiden Umlagerungsszenarien verbleibt das Produktionspotenzial auf dem heutigen Niveau (Rind42) oder sinkt sogar (Grünland42: –25%).Aus den Produktionspotenzialen nach den einzelnen Kuhtypen lassen sich direkt die Veränderungen der Konkurrenzkraft und deren Auswirkung auf das Milchproduktionspotenzial ableiten: Unter Markt60 steigt das Produktionspotenzial im Fall einer einseitigen Ausrichtung auf die Milchproduktion mit Hochleistungskühen um etwa 120%,bei einer Umlagerung auf RGVE- oder Grünlandbeiträge sind diese Steigerungen wesentlich tiefer oder negativ.Im Gegensatz dazu resultieren aus einer alleinigen Ausrichtung auf Weidekühe wesentlich tiefere oder sogar leicht rückläufige Produktionspotenziale.
Milchproduktion und Einkommen nach Betriebsgrössen, Milchkuhtypen und
Milchproduktion und Einkommen nach Betriebsgrössen, Milchkuhtypen und Szenarien
In der Abbildung ist für drei unterschiedliche Betriebsgrössen (15,27 und 39 ha Fläche, 50% ackerbare Fläche) in Abhängigkeit der Produktionssysteme die produzierte Milchmenge (linke vertikale Achse in Abbildungen,grüne Säulen) und das Einkommen (rechte vertikale Achsen in Abbildungen,graue Säulen) dargestellt.Vergleichsbasis für das Einkommen (=100%) ist jeweils das Einkommen der Betriebe mit Kuhtyp 10800 im Szenario Kontingent65.Aus der Abbildung zeigt sich die Konkurrenzkraft der verschiedenen Produktionssysteme deutlich.Unter Beibehaltung der Kontingentierung (Kontingent65) produzieren die Betriebe mit einer Fläche von 15 ha keine Milch mehr (fehlende Säulen der Milchproduktion).Bei den Betrieben mit einer Fläche von 27 und 39 ha erzielt dagegen der Weidekuhtyp 5800W die höchsten Einkommen.Bei Aufhebung der Milchkontingentierung (Markt60) produzieren mit Ausnahme der 15 ha Betriebe mit Kuhtyp 7800 alle Betriebe Milch;insbesondere können die 15 ha Betriebe über eine starke Ausdehnung der Milchproduktion ihre Kostennachteile kompensieren. Bei den Umlagerungsszenarien (Rind42 und Grünland42) steigen nicht nur die Milchproduzenten mit 15 ha,sondern auch teilweise diejenigen mit 27 ha aus der Milchproduktion aus.Die Weidekuh ist deutlich am konkurrenzfähigsten.
Mit dem Sektoralen Informations- und Prognosesystem für die Landwirtschaft Schweiz (SILAS) wurden die regionalen und sektoralen Auswirkungen der Aufhebung der Milchkontingentierung und der Umlagerung der Stützung untersucht.Zu beantworten waren fünf Forschungsfragen bezüglich der Entwicklung der Milch- und Rindfleischerzeugung, der regionalen Verlagerung der Produktion,des Einkommens,der Bundesausgaben für die Landwirtschaft und der Fördereffektivität.Dafür wurde das Modellsystem verwendet,mit dem die FAT im Frühjahr 2002 bereits Berechnungen zu den Auswirkungen der AP 2007 durchgeführt hat (SILAS 2002).
Die Modellrechnungen erfolgten für die vier erwähnten Szenarien.Im Übrigen gelten für alle Szenarien die Preise und Direktzahlungen,die in den Berechnungen zu den Auswirkungen der AP 2007 verwendet wurden (SILAS 2002).
Die Ergebnisse lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:
– In der Talregion resultiert bei einer Aufhebung der Kontingentierung (Markt60) eine Zunahme der Milcherzeugung von 13% bis 16%.In der Hügelregion ergibt sich ein Wachstum von 3% bis 6%,in der Bergregion eine Abnahme von 5% bis 8%. Gesamtsektoral resultiert daraus eine Zunahme um 5% bis 8%.
– In allen Szenarien ohne Kontingentierung ändert sich die Verwendung der produzierten Milch:Der Milchverkauf steigt gesamtsektoral um über 20%,während die Frischmilchverfütterung um mehr als 50% zurückgeht.Bei sinkenden Magermilchpulverpreisen ist eine Substitution von Frischmilch durch Milchpulver zu erwarten.
– Die Arbeitsteilung zwischen Tal- und Bergregion nimmt zu.Die Talregion dehnt den Milchkuhbestand aus und schränkt vor allem in den Umlagerungsszenarien Rind42 und Grünland42 die Grossvieh- und Kälbermast ein.Die Bergregion spezialisiert sich auf die Rinderaufzucht und Kälbermast und schränkt den Milchkuhbestand ein.Die Talregion wird intensiver,die Bergregion extensiver bewirtschaftet.
– In allen Aufhebungsszenarien ist mit einem Rückgang des Sektoreinkommens zu rechnen.Beim Szenario Rind42 sind die Einkommenseinbussen am geringsten,beim Szenario Grünland42 am höchsten.Die Talregion profitiert finanziell eher von RGVEBeiträgen für Milchkühe (Rind42) als von Grünlandbeiträgen (Grünland42),die Bergregion eher von Grünlandbeiträgen als von RGVE-Beiträgen für Milchkühe.
Für den Steuerzahler ist aus rein finanzieller Sicht das Szenario Markt60 am interessantesten,da bei diesem Szenario am meisten Finanzmittel eingespart werden können.Im Szenario Grünland42 entspricht die Zunahme der Direktzahlungen etwa den eingesparten Mitteln für die Preisstützung.Beim Szenario Rind42 ist gemäss den Modellrechnungen damit zu rechnen,dass die eingesparten Mittel aus der Marktstützung nicht ausreichen,um den zusätzlichen Bedarf an Direktzahlungen zu decken.
■ Sektorale Auswirkung einer Kontingentsaufhebung
Die Direktzahlungen sind eines der zentralsten Elemente der Agrarpolitik.Sie ermöglichen eine Trennung der Preis- und Einkommenspolitik und gelten die von der Gesellschaft geforderten Leistungen ab.Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen.
Ausgaben für die Direktzahlungen
Ausgabenbereich1999200020012002
Anmerkung:Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr;die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle:BLW

■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten.Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere.Diese Beiträge haben das Ziel,eine flächendeckende Nutzung und Pflege sicherzustellen.In der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen.Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt.Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).

■ Abgeltung besonderer ökologischer Leistungen
Die ökologischen Direktzahlungen geben einen Anreiz für besondere ökologische Leistungen,die über den ÖLN hinausgehen.Zu ihnen gehören die Öko-,Öko-Qualitäts-, Sömmerungs- und Gewässerschutzbeiträge.Diese Beiträge bezwecken,die Artenvielfalt in den Landwirtschaftsgebieten zu erhalten und zu erhöhen,die Nitrat- und Phosphorbelastung der Gewässer sowie die Verwendung von Hilfsstoffen zu vermindern,landwirtschaftliche Nutztiere besonders tierfreundlich zu halten und das Sömmerungsgebiet nachhaltig zu nutzen.
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2002
Die Direktzahlungen machten 2002 rund zwei Drittel der Ausgaben des BLW aus.Von den Direktzahlungen kamen 59% der Berg- und Hügelregion zugute.
1Im Beitragstotal nicht enthalten:BE,VD:Daten unvollständig;GR,UR,TI:Daten nicht rechtzeitig geliefert
Anmerkung:
Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich.Die Werte in Abschnitt 2.2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr;die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs.Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen.
Quelle:Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen
■ Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
Die Hügel- und Bergregion sind bei den Produktionsbedingungen benachteiligt.Die wichtigsten Nachteile sind:

–Die kürzere Vegetationsperiode,welche geringere Erträge und höhere Aufwendungen für die Futterkonservierung sowie hohe Arbeitsspitzen zur Folge hat.
–Die Bewirtschaftung von Hanglagen ist aufwändiger,die Mechanisierung teurer und weniger leistungsfähig.
–Die im Durchschnitt ungünstigere Verkehrslage bedingt einen höheren Zeitaufwand und Mehrkosten für Transporte,Märkte,Produkteabnehmer,Einkäufe usw.
Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von Referenzbetrieben nach Regionen 2002
Die erschwerende Bewirtschaftung in diesen Regionen wird mit den Beiträgen für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen und den Hangbeiträgen abgegolten.Folgerichtig nimmt die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis zu.Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zahlreiche Anforderungen zu erfüllen.Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen wie Rechtsform,zivilrechtlicher Wohnsitz usw.,anderseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend wie beispielsweise die Mindestgrösse des Betriebes,der Arbeitsbedarf von mindestens 0,3 Standardarbeitskräften (SAK),das Alter der Bewirtschafter,das Einkommen und Vermögen. Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen,die unter den Begriff «Ökologischer Leistungsnachweis» (ÖLN) fallen.Die Anforderungen des ÖLN umfassen:eine ausgeglichene Düngerbilanz,ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen,eine geregelte Fruchtfolge,ein geeigneter Bodenschutz,eine gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere. Verstösse gegen die massgebenden Vorschriften haben Sanktionen in Form einer Kürzung oder Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge.
■ Agrarpolitisches Informationssystem
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem).Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen,welche die Kantone zusammentragen und übermitteln und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart (Massnahme) gespiesen.Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge.Eine weitere Funktion des Systems besteht in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen.Dank der Informationsfülle und der leistungsfähigen EDV-Hilfsmittel können zahlreiche agrarpolitische Fragen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden.
Von 67'544 im AGIS erfassten Betrieben im Jahr 2002 beziehen deren 58'013 Direktzahlungen.Die meisten der restlichen 9'531 Betriebe sind zu klein,um Anspruch auf Beiträge zu haben,das heisst,sie weisen zu wenig Fläche oder zu wenig SAK auf.
■ Auswirkungen der Begrenzungen und Abstufungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus.Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro SAK,bei den Abstufungen um die Degressionen nach Fläche und Tieren.
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2002
BegrenzungBetroffene Gesamtbetrag Anteil am Anteil an der BetriebeKürzungenBeitragstotalDirektzahlungsder Beriebesumme
Quelle:BLW
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge,insbesondere für jene 185 Betriebe,deren Vermögen zu hoch ist.Von der Einkommensgrenze waren im Jahr 2002 rund 950 Betriebe betroffen.Die Kürzung der Direktzahlungen betrug bei diesen Betrieben im Durchschnitt 10,9%.Insgesamt wurden aufgrund der Begrenzungen 9 Mio.Fr.an Direktzahlungen gekürzt;dies entspricht 0,37% des Gesamtbetrages.
Wirkung der Abstufungen der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl 2002 MassnahmeBetroffene Fläche oder Reduktion Anteil am Anteil am BetriebeTierbestandBeitrag derTotal der pro BetriebBetriebeDirektzahlungsart
Insgesamt sind 7’888 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen.Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenen Massnahmen.Die Reduktionen betragen total 31,6 Mio.Fr.Gemessen an allen Direktzahlungen,die abgestuft sind,beträgt der Anteil sämtlicher Reduktionen 1,5%.Die Beitragsdegressionen wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus,wo die Abstufungen bei über 6‘800 Betrieben (knapp 12% aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen.Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 177 Betriebe von dieser Reduktion betroffen,da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite und der Milchabzug bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken.Von der Beitragsreduktion betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen.So werden z.B.die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei rund 3’450 Betrieben mit durchschnittlich 7,6% (RAUS) resp.9,7% (BTS) reduziert.631 Bio-Betriebe erhalten um durchschnittlich 7,2% herabgesetzte Direktzahlungen.
■ Vollzug und Kontrolle
Die Kontrolle des ÖLN wird gemäss Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert.Diese können Organisationen,die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten und akkreditierte Organisationen zum Vollzug beiziehen.Sie müssen die Kontrolltätigkeit stichprobenweise überprüfen.Direktzahlungsberechtigte Bio-Betriebe müssen neben den Auflagen des Biolandbaus die Vorgaben des ÖLN erfüllen und alle Nutztiere nach den RAUS-Anforderungen halten. Sie werden von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle überprüft.Die Kantone überwachen diese Kontrollen.Artikel 66 Absatz 4 der Direktzahlungsverordnung präzisiert, nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben.
Zu kontrollieren sind: –alle Betriebe,welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen; –alle Betriebe,bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden;und –mindestens 30% der übrigen Betriebe,die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind.
Bei Verstössen im ÖLN,wie z.B.falschen Angaben,werden die Betriebe nach einheitlichen Kriterien sanktioniert.Die Konferenz der Landwirtschaftsdirektoren hat ein entsprechendes Sanktionsschema erlassen.
■ Durchgeführte Kontrollen und Sanktionen 2002
Von den Kantonen bzw.den von ihnen beauftragten Kontrollstellen wurden im Jahr 2002 rund 39’881 Betriebe,davon 5’869 Bio-Betriebe,auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert.Im Weiteren wurden von den total 35’562 am RAUS-Programm angemeldeten Betriebe 23’075 (das entspricht 65%),sowie 12’229 der 18’528 im BTS angemeldeten Betriebe (66%),kontrolliert.
Gesamthaft wurden über 8’800 Verstösse festgestellt,was Beitragskürzungen von fast 11 Mio.Fr.zur Folge hatte.Die meisten Verstösse gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften anderer Gesetzgebungen betrafen das Gewässerschutzgesetz.Nur in wenigen Fällen wurden Verstösse gegenüber den übrigen Schutzgesetzgebungen,den Richtlinien des biologischen Landbaus und beim Extensoprogramm festgestellt.
Die Verstösse bei den kontrollierten Sömmerungsbetrieben betrafen primär die Nichteinhaltung von Bewirtschaftungsanforderungen und zu grosse Abweichungen des Tierbestandes gegenüber dem Normalbesatz.
Zusammenstellung der Verstösse und Sanktionen 2002
KategorieVerstösseSanktionenHauptgründe AnzahlFr.
Grunddaten6151 309 047verspätete Anmeldung,falsche Flächenangaben, falsche Angaben zum Betrieb oder Bewirtschafter, falsche Tierbestandesangaben,falsche Angaben zu Sömmerung und Milchkontingent
Gewässerschutz153504 367keine Angaben möglich
Natur- und Heimatschutz1315 470keine Angaben möglich
Umweltschutz3357 890keine Angaben möglich
ÖLN4 9256 506 503nicht rechtzeitige Anmeldung,mangelhafte Aufzeichnungen, tiergerechte Haltung der Nutztiere,ungenügender ökologischer Ausgleich,Pufferstreifen,nicht ausgeglichene Düngerbilanz,fehlende Bodenproben,geregelte Fruchtfolge, geeigneter Bodenschutz,Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmittel
ÖAF 716303 096nicht rechtzeitige Anmeldung,zu frühe oder unzulässige Nutzung,falsche Flächenangaben,Verpflichtungsdauer von 6 Jahren nicht eingehalten,Verunkrautung,unzulässige Düngung und Pflanzenschutz,falsche Angabe der Anzahl Bäume
Extenso 7025 298nicht rechtzeitige Anmeldung,Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung,falsche Flächenangaben,unzulässige Pflanzenschutzmittel
Bio 9477 622falsche Angaben,fehlende Bodenproben,ungenügender ökologischer Ausgleich,Gewässerschutz,Schnittzeitpunkt bei ÖAF,nicht rechtzeitige Anmeldung,im Bio-Landbau nicht zugelassene Dünger und Pflanzenschutzmittel
BTS 579371 509nicht rechtzeitige Anmeldung,Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften,kein MehrflächenHaltungssystem,mangelhafter Liegebereich,mangelhafte Stallbeleuchtung,mangelhafte Einstreu
RAUS
1 0951 179 298zu wenig Auslauftage,mangelhafte Aufzeichnungen,nicht alle Tiere einer Kategorie nach den Vorschriften gehalten, ungenügender Laufhof,nicht rechtzeitige Anmeldung
Sömmerung525569 807nicht rechtzeitige Anmeldung,Unter- oder Überschreitung des Normalbesatzes,unsachgemässe Weideführung, Nutzung nicht beweidbarer Flächen,falsche Angaben zu Fläche/Tierbestand/Daten/Sömmerungsdauer
Total8 81810 919 907
Quelle:Kantonale Berichterstattung über Kontrolltätigkeit und Sanktionen
■ Nichterfüllung des ÖLN wegen höherer Gewalt

In speziellen Fällen,wo die Auflagen des ÖLN aufgrund höherer Gewalt nicht oder nur teilweise erfüllt werden können,kann der Kanton gemäss Artikel 15 Absatz 2 der Direktzahlungsverordnung Ausnahmen gewähren.Für die Aufrechterhaltung der Beitragsberechtigung muss ein bewilligtes Gesuch vorliegen.Im Jahr 2002 wurden von den Kantonen 231 Gesuche bewilligt.Der grösste Anteil der Gesuche wurde aufgrund von Unwetterschäden eingereicht,die vor allem Flächen in den Kantonen Thurgau und St.Gallen betrafen.
■ Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz
In witterungs- und standortbedingten Spezialfällen wird,um die Kultur zu schützen, der Einsatz im ÖLN nicht erlaubter Pflanzenschutzmittel oder Behandlungsarten zugelassen.Deshalb können die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen,gestützt auf Anhang 6.4 der Direktzahlungsverordnung,Sonderbewilligungen ausstellen.Im Jahr 2002 gab es für 5’659 ha LN 2‘521 Sonderbewilligungen.Am meisten bewilligt wurde analog zu den Vorjahren die Behandlung von Verunkrautung in Naturwiesen.Dabei ging es vor allem um die Bekämpfung von Hahnenfuss,Disteln,gemeines Rispengras und Ampfer.Für Kunstwiesen wird dafür seit dem Jahr 2001 keine Sonderbewilligung mehr benötigt.
Erteilte Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz 2002
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Schutz und Pflege der Kulturlandschaft,Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab.Die Flächenbeiträge werden seit dem Jahr 2001 mit einem Zusatzbeitrag für die offene Ackerfläche und die Dauerkulturen ergänzt. Dadurch soll jener Teil der gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Ackerbau abgegolten werden,welcher als Folge der Schwellenpreissenkung und der Liberalisierung der Getreidemarktordnung nicht mehr anders entschädigt werden kann.Für die Erschwernisse in der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen. Ansätze
– 30 bis 60 ha900
– 60 bis 90 ha600

– über 90 ha 0
1Der Zusatzbeitrag für offenes Ackerland und Dauerkulturen beträgt 400 Fr.pro ha und Jahr;auch er unterliegt der Flächenabstufung
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25%.Insgesamt handelt es sich um 5’122 ha,welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden.
Flächenbeiträge 2002 (inkl.Zusatzbeitrag)
Der Zusatzbeitrag wurde für insgesamt 275'374 ha offenes Ackerland und 17'584 ha Dauerkulturen ausgerichtet.
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen 2002
Von der Beitragsdegression betroffen sind 7,8% der LN.Im Durchschnitt wird pro ha ein Flächenbeitrag von 1'286 Fr.ausbezahlt (inkl.Zusatzbeitrag).Die Betriebe mit einer Fläche bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 9,7% der gesamten LN.Eine Betriebsgrösse von mehr als 60 ha weisen lediglich 0,9% aller Betriebe aus;sie bewirtschaften 3,5% der gesamten LN.
Die Massnahme hat zum Ziel,die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig im Grasland Schweiz die flächendeckende Pflege durch Nutzung sicherzustellen.
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere,die während der Winterfütterung (Referenzperiode:1.Januar bis Stichtag des Beitragsjahrs) auf einem Betrieb gehalten werden.Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe,Ziegen,Bisons,Hirsche, Lamas und Alpakas.Die Beiträge werden für Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt.Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE).
Begrenzung der FörderungRGVE/ha
– in der Ackerbauzone,der erweiterten Übergangszone und der Übergangszone2,0
in der Hügelzone 1,6
– in der Bergzone I1,4
– in der Bergzone II 1,1
in der Bergzone III0,9
– in der Bergzone IV0,8
Die Abstufung der Beitragsbegrenzung nach Zonen orientiert sich einerseits am höchstzulässigen Tierbesatz gemäss Gewässerschutzrichtlinien und berücksichtigt andererseits das abnehmende Ertragspotential.Durch diese Staffelung wirken die Beiträge produktionsneutral,tragen aber wesentlich zu einer flächendeckenden Bewirtschaftung bei.
Beitragsberechtigt ist,wer mindestens eine RGVE auf seinem Betrieb hält sowie die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllt.
Der Beitrag pro RGVE für Tiere,welche einen höheren Arbeits- und Gebäudeaufwand verlangen,ist höher angesetzt als für die Tiere mit niedrigem Aufwand.Die RGVE sind demnach in zwei Beitragsgruppen aufgeteilt.Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung,Bisons,Milchziegen und Milchschafe werden 900 Fr.,für die übrigen Ziegen und Schafe,sowie Hirsche,Lamas und Alpakas 400 Fr.je RGVE ausgezahlt.
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2002
Die Beiträge ersetzen die bis 1998 ausbezahlten Beiträge an Kuhhalter,welche keine Milch zur Vermarktung abliefern.Der Beitrag wird nicht nur für Kühe,deren Milch nicht vermarktet wird,sondern auch für andere Raufutter verzehrende Tiere bezahlt.Bei den Milchproduzenten,die in den Genuss dieser Beiträge kommen,handelt es sich um eher extensiv bewirtschaftete Betriebe.Im Vergleich zu den gehaltenen Kühen weisen sie einen relativ hohen Anteil an Aufzucht- oder Masttieren auf und verfügen über eine genügende Grünfläche.Bei den Verkehrsmilchproduzenten wurde im Jahr 2002 pro 4‘400 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE vom beitragsberechtigten Bestand in Abzug gebracht.Der Abzug wurde gegenüber dem Vorjahr um 200 kg angehoben, was zusätzliche Beiträge für milchproduzierende Betriebe in der Grössenordnung von ca.11 Mio.Fr.bewirkte.Die Beitragssumme ist gegenüber dem Vorjahr um ca.15 Mio.Fr. höher ausgefallen,was einerseits auf die Erhöhung des Milchabzuges,aber auch auf Umstellungen von Verkehrsmilch- auf Nichtverkehrsmilchproduktion sowie Beitragsoptimierungen zurückzuführen ist.
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2002
MerkmalEinheitBetriebe mit Betriebe ohne vermarkteter vermarktete MilchMilch
BetriebeAnzahl21 62116 923
Tiere pro BetriebeRGVE23,512,5

Abzug aufgrund Beitragsbegrenzung der GrünflächeRGVE1,31,2 MilchabzugRGVE15,80,0
Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE6,411,3
Beiträge pro BetriebFr.5 6499 518
Quelle:BLW
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar rund 3'900 Fr.weniger RGVE-Beiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch.Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z.B.Zulage für verkäste Milch).
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen.Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere,bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung),werden bei dieser Massnahme auch soziale,strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt.Beitragsberechtigt sind jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,die mindestens 1 ha LN in der Hügel- oder Bergregion bewirtschaften und zugleich mindestens 1 RGVE halten. Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere.
Auf das Beitragsjahr 2002 wurde die Limite der beitragsberechtigten GVE je Betrieb von 15 auf 20 erhöht.Mit der Erhöhung dieser Limite wird einerseits die Einkommenslage der Berglandwirtschaft verbessert und andererseits werden die negativen strukturellen Auswirkungen dieser Beitragsbegrenzung vermindert.Die Beitragsansätze sind nach Zonen differenziert.
für die Tierhaltung unter erschwerenden
1 Betriebe,die einen Teil der Fläche in der Berg- und Hügelregion bewirtschaften
Gegenüber dem Vorjahr haben die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen durch die Erhöhung der Limite von 15 auf 20 GVE um beinahe 40 Mio.Fr.zugenommen.Dementsprechend verzeichnen die zu Beiträgen berechtigenden RGVE eine Zunahme um knapp 78'000 Einheiten.Weiter zurückgegangen ist aber die Betriebszahl,und zwar um 870 Einheiten.
Im Beitragsjahr 2002 standen rund 84% des RGVE-Bestandes in beitragsberechtigten Betrieben,die von der Limite betroffen sind.Mit der Erhöhung der Begrenzung von 15 auf 20 RGVE hat der beitragsberechtigte Tierbestand gegenüber dem Vorjahr um 11% auf insgesamt 72% zugenommen.
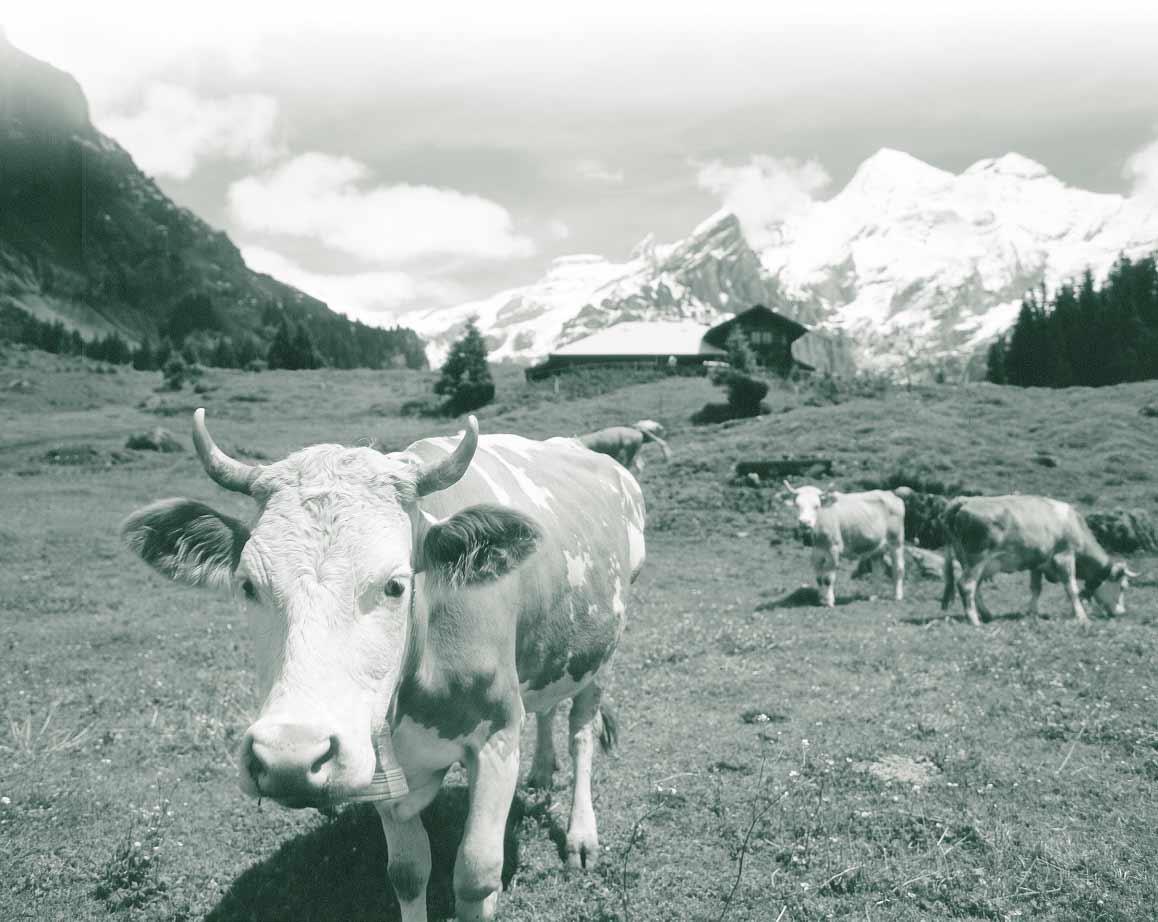
■ Allgemeine Hangbeiträge:Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung in der Hügel- und Bergregion abgegolten.Sie werden nur für Wies-,Streuund Ackerland ausgerichtet.Wiesen und Streuefläche müssen jährlich mindestens ein Mal gemäht werden.Ausgeschlossen sind Hecken und Feldgehölze sowie Weiden und Rebflächen.
Anrecht auf Hangbeiträge haben jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,welche die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllen.Diese sieht präzisierend vor,dass die Gesamtfläche mit Hangneigung mehr als 50 Aren zu umfassen hat,wobei eine Bewirtschaftungsparzelle mindestens 5 Aren messen muss.Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt.

Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert von Jahr zu Jahr.Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab,die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben.
■ Hangbeiträge:Zur Erhaltung der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei,Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten.Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden,wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden.Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden nur für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet.
Als Terrassenlagen gelten Rebflächen,welche mit Stützmauern regelmässig abgestuft sind und die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
die Flächen weisen eine minimale Terrassierung auf,das heisst höchstens 30 m Abstand zwischen den Stützmauern;
– die Terrassenlage misst mindestens eine ha;
– die Stützmauern müssen mindestens 1 m hoch sein,gewöhnliche Betonmauern werden nicht berücksichtigt.
Hangbeiträge für Rebflächen erhalten jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllen und auf deren Betrieb die Fläche mit Hangneigung mehr als 10 Aren und pro Bewirtschaftungsparzelle mehr als 2 Aren misst.Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig.
Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2002
Der Anteil der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 26% und der Anteil Betriebe gemessen an der Gesamtzahl aller Rebbaubetriebe 49%.

Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab,deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen.Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten,bei denen sie freiwillig mitmachen können.Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig;die Beiträge können kumuliert werden.
Total 359,4 Mio. Fr.
34%
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert werden.Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei.Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN angerechnet werden.Daneben gibt es Elemente,die nur für den ökologischen Ausgleich beim ÖLN anrechenbar sind,nicht aber mit Beiträgen abgegolten werden.
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Beim ÖLN anrechenbare Elemente Beim ÖLN anrechenbare Elemente mit Beiträgen ohne Beiträge extensiv genutzte Wiesenextensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte WiesenWaldweiden
Streueflächeneinheimische standortgerechte
Einzelbäume und Alleen
Hecken,Feld- und UfergehölzeWassergräben,Tümpel,Teiche BuntbrachenRuderalflächen,Steinhaufen und -wälle RotationsbrachenTrockenmauern
Ackerschonstreifenunbefestigte natürliche Wege Hochstamm-FeldobstbäumeRebflächen mit hoher Artenvielfalt
weitere,von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN
Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und dürfen während sechs Jahren in Abhängigkeit zur Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt werden.Das späte Mähen soll gewährleisten,dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird.So bleibt auch zahlreichen wirbellosen Tieren,bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion.Das Düngen und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,mit Ausnahme der Einzelstockbehandlung von Problemunkräutern,sind verboten.
Die Beiträge für extensiv genutzte Wiesen,Streueflächen,Hecken,Feld- und Ufergehölze sind einheitlich geregelt und richten sich nach der Zone,in der sich die Fläche befindet.Der Anteil an extensiven Wiesen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Beiträge für extensive Wiesen 2002
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten,welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden. Es gelten grundsätzlich die gleichen Bewirtschaftungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen.Die Flächen dürfen jedoch erst ab dem 1.September gemäht werden.
Beiträge für Streueflächen 2002
Als Hecken,Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-,Hoch- oder Baumhecken,Windschutzstreifen,Baumgruppen,bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze. Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet werden.Sie müssen sachgerecht gepflegt werden. Verboten sind sowohl die Düngung als auch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.Den Gehölzstreifen entlang ist ein ungedüngter Krautsaum von mindestens 3 m Breite anzulegen.
Beiträge für Hecken,Feld- und Ufergehölze 2002
■ Wenig intensiv genutzte Wiesen
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden.Daneben gelten die selben Nutzungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen.
Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen 2002
■ Buntbrachen

Als Buntbrachen gelten mehrjährige,mit einheimischen Wildkräutern angesäte Streifen von mindestens 3 m Breite.Die Düngung dieser Streifen ist verboten.Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden,falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind.Ab dem zweiten Standjahr dürfen sie zwischen dem 1.Oktober und dem 15.März zur Hälfte geschnitten werden.Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter.In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung.Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung.
Für Buntbrachen werden pro ha 3'000 Fr.ausgerichtet.Die Beiträge gelten für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone.
Die Buntbrache ist im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Getreidemarktes eine wirtschaftlich interessante Alternative zu den Ackerkulturen geworden.
Als Rotationsbrachen gelten ein- bis zweijährige,mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen,die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen.In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel,Hasen und Insekten Lebensraum.In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich.Die Düngung dieser Streifen ist verboten.Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden,falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht zu bekämpfen sind.Rotationsbrachen dürfen zwischen dem 1.Oktober und dem 15.März geschnitten werden.
Für die Rotationsbrachen werden pro ha 2'500 Fr.ausgerichtet.Die Beiträge gelten wie für die Buntbrachen für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone.
Beiträge für Rotationsbrachen 2002
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben.Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen wie Getreide,Raps,Sonnenblumen,Eiweisserbsen,Ackerbohnen und Soja,nicht jedoch Mais.Verboten sind der Einsatz von Stickstoffdüngern und Insektiziden sowie die breitflächige chemische oder mechanische Unkrautbekämpfung.Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden,falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind.
Im Jahr 2002 wurden pro ha 1’500 Fr.bezahlt.Beiträge gibt es nur für Flächen in der Tal- und Hügelzone.
Beiträge für Ackerschonstreifen 2002
MerkmalEinheitTal-Hügel-Berg-Total regionregionregion 1
BetriebeAnzahl120331154
Flächeha2960.135
Fläche pro Betriebha0,240,170,100,23
Beitrag pro BetriebFr.367251150341
Beiträge1 000 Fr.448052
Beiträge 20011 000 Fr.598066
1Hier handelt es sich um Betriebe,die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften Quelle:BLW
■ HochstammFeldobstbäume
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume,die nicht in einer Obstanlage stehen,sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven. Die Stammhöhe muss bei Steinobstbäumen mindestens 1,2 m,bei den übrigen Bäumen mindestens 1,6 m betragen.Der Einsatz von Herbiziden zur Freihaltung des Stammes ist ausser bei Bäumen von weniger als fünf Jahren verboten.Die Beitragsberechtigung besteht ab einer Mindestzahl von 20 Bäumen.Die Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume können mit jenen für extensiv oder wenig intensiv genutzte Wiesen sowie den Beiträgen gemäss der Öko-Qualitätsverordnung kumuliert werden. Im Jahr 2002 wurden pro angemeldeten Baum 15 Fr.ausgerichtet.
Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume 2002
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 2002
Total 95 527 ha
Rotationsbrachen 1,4%
Buntbrachen 2,4%
Wenig intensiv genutzte Wiesen 38,7%
Feld- und Ufergehölze 2,4%

1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume
Ackerschonstreifen 0,1%
Extensiv genutzte Wiesen 48,2%
Streueflächen 6,9%
Quelle: BLW
■ Gegenwärtige Situation der ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF)

Seit der Einführung des ökologischen Ausgleichs als eigenes Öko-Programm im Jahr 1993 hat sich der Anteil ökologischer Ausgleichfläche kontinuierlich erhöht.Entscheidend war dabei der geforderte Mindestanteil an diesen Ausgleichsflächen von 7% bzw.3,5% bei Spezialkulturen bei einer Teilnahme am ehemaligen Programm der Integrierten Produktion (IP).Heute umfasst die beitragsberechtigte Fläche des ökologischen Ausgleichs mehr als 95'000 ha oder beinahe 9% der LN.Als wichtiges Element zum ökologischen Ausgleich zählen auch die Hochstamm-Feldobstbäume mit gegenwärtig 2,4 Mio.Stück.Der Bund unterstützt die ökologischen Ausgleichflächen mit rund 122 Mio.Fr.(zur Entwicklung der Flächen vgl.Abschnitt 1.3.1).
Aufteilung der ÖAF nach Elementen und Regionen 2002 1 TalregionHügelregionBergregion in hain %in hain %in hain %
Seit dem 1.Mai 2001 ist die Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (ÖkoQualitätsverordnung, ÖQV,SR 910.14) in Kraft.
Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern,unterstützt der Bund auf der LN ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen mit Finanzhilfen.Die Anforderungen, welche die Flächen für die Beitragsberechtigung gemäss der ÖQV erfüllen müssen, werden durch die Kantone festgelegt.Der Bund überprüft die kantonalen Vorgaben auf Grund von Mindestanforderungen.Entsprechen die kantonalen Anforderungen den Mindestanforderungen des Bundes und ist die regionale Mitfinanzierung gewährleistet,so leistet der Bund Finanzhilfen an die von den Kantonen an die Landwirte ausgerichteten Beiträge.Die Finanzhilfen des Bundes bewegen sich je nach Finanzkraft der Kantone zwischen 70 und 90% der anrechenbaren Beiträge.Die restlichen 10–30% müssen durch Dritte (Kanton,Gemeinde,Private,Trägerschaften) übernommen werden.Beiträge für die biologische Qualität und die Vernetzung sind kumulierbar.Die Verordnung beruht auf Freiwilligkeit,finanziellen Anreizen und der Berücksichtigung regionaler Unterschiede bezüglich der Biodiversität.
Anrechenbare Ansätze
Ansätze 2002Fr.
– für die biologische Qualität500.–/ha
– für die biologische Qualität der Hochstamm-Feldobstbäume20.–/Baum
für die Vernetzung500.–/ha
Eine ökologische Ausgleichsfläche trägt vor allem dann zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt bei,wenn sie bestimmte Zeigerarten und Strukturmerkmale ausweist und/oder an einem ökologisch sinnvollen Standort liegt.Während sich der Bewirtschafter einer ökologischen Ausgleichsfläche für die biologische Qualität direkt anmelden kann,braucht es für die Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen ein Konzept,das mindestens eine landschaftlich und ökologisch begründbare Einheit abdeckt.
Zielsetzung biologische Qualität
Ökologische Ausgleichsfläche
Extensiv genutzte Wiesen (Typ 1)
Wenig intensiv genutzte Wiesen (Typ 4)
Streuefläche (Typ 5) HochstammFeldobstbäume (Typ 8) Hecken,Feld- und Ufergehölze (Typ 10)
Zielsetzung
Artenreiche Wiesen mit einer für die Region charakteristischen Pflanzen- und Tierwelt erhalten und fördern.
Auf Hochstamm-Feldobstbäume angewiesene Insekten und Vögel erhalten und fördern.
Eine für die Region charakteristische und biologisch wertvolle Tier- und Pflanzenvielfalt in Hecken,Feldund Ufergehölzen erhalten und fördern.
Quelle:BLW
Zielsetzung Vernetzung
Zielsetzung
Für die Region charakteristische Tier- und Pflanzenarten mittels einer zielorientierten Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen erhalten und fördern
Ansprüche an die ökologischen Ausgleichsflächen
Die ökologischen Ausgleichsflächen sowie weitere naturnahe Lebensräume sind so zu platzieren,aufzuwerten und zu ergänzen,dass – die charakteristischen und zu fördernden Tierarten genügend und geeigneten Raum finden zur Nahrungssuche,Deckung,Fortpflanzung und Überwinterung sowie die Pflanzenarten zur Etablierung oder Vergrösserung des Bestandes; – die Voraussetzungen für die Verbreitung und den genetischen Austausch der Tier- und Pflanzenarten günstig sind;und
den landschaftlichen Eigenheiten einer Region Rechnung getragen wird.
Welche Typen von ÖAF miteinander vernetzt werden, hängt von den zu fördernden Arten ab.Deren ökologische Ansprüche und Verbreitungsmöglichkeiten bestimmen zudem Lage,Grösse und Abstände zwischen den einzelnen ÖAF sowie die Bewirtschaftung.
Quelle:BLW
Beiträge gemäss Öko-Qualitätsverordnung 2002
1BE,VD:Daten unvollständig,GR,UR,TI:Daten nicht rechtzeitig geliefert 2Hochstamm umgerechnet:1 Baum = 1 Are

Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2002
Wiesen,wenig intensiv genutze Wiesen,Streueflächen
Diese Massnahme hat zum Ziel,den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren,Fungizide,chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide zu fördern.Die Anforderungen sind auf der gesamten Brotgetreide-,Futtergetreide- oder Rapsfläche eines Betriebes einzuhalten.

Der Anteil von Brotgetreide,der nach den Auflagen für die extensive Produktion angebaut wird,beträgt 44% der Gesamtproduktion.Dieser Anteil liegt bei 58% für Futtergetreide (ohne Körnermais) und bei 33% für Raps.
Im Jahr 2002 wurden pro ha 400 Fr.ausgerichtet.
Extensive Produktion von Getreide und Raps 2002
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform.Um Beiträge zu erhalten,müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb mindestens die Anforderungen der im August 2000 revidierten Bio-Verordnung vom 22.September 1997 erfüllen.
Beim biologischen Landbau wird auf chemisch-synthetisch hergestellte Hilfsstoffe,wie Handelsdünger oder Pestizide gänzlich verzichtet.Dies spart Energie und schont Wasser,Luft und Boden.Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig,die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen.Biobauern benötigen zwar mehr Energie für Infrastruktur und Maschinen.Gesamthaft erreicht der Biolandbau aber eine höhere Effizienz in der Nutzung der vorhandenen Ressourcen.Dies ist ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit des Produktionssystems.
Der Verzicht auf Herbizide fördert die Entwicklung zahlreicher Beikrautarten.Wo eine vielfältige Flora vorhanden ist,finden auch mehr Kleinlebewesen Nahrung.Dies wiederum verbessert die Ernährung der räuberisch lebenden Gliedertiere,wie der Laufkäfer,und damit die Voraussetzungen für eine natürliche Bekämpfung von Schädlingen.Zahlreicher vorkommende Pflanzen,Tiere und Mikroorganismen machen das Ökosystem robuster gegen Störungen und Stress.
Durch die organische Düngung,die schonende Bodenbearbeitung und den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel fördert der Biobauer eine grosse Menge und Vielfalt an Bodenorganismen.Die Bodenfruchtbarkeit wird durch die biologische Aktivität gefördert.Es wird Humus angereichert,die Bodenstruktur verbessert und die Bodenerosion vermindert.
Um eine optimale Abstimmung von Pflanzen,Boden,Tier und Mensch im Betrieb zu erreichen,strebt der Biobauer die Schliessung der Nährstoffkreisläufe auf dem Betrieb an.Erreicht wird dies durch die Bindung der Tierhaltung an die betriebseigene Futtergrundlage.Der Anbau von Leguminosen verbessert das Stickstoffangebot im Boden. Hofdünger und organisches Material aus Gründüngungen und Ernterückständen stellen über die Ernährung der Bodenlebewesen eine ausgewogene Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen sicher.
In der Nutztierhaltung müssen die RAUS-Anforderungen erfüllt sein.Sie bilden die Minimalanforderungen für die Tierhaltung im Biolandbau.Als weitere Massnahmen sind elektrisierende Steuerungseinrichtungen (Viehtrainer) und der Einsatz von Medizinalfutter verboten.Die Verwendung von grösstenteils betriebseigenem Futter soll eine angemessene Leistung und eine gute Gesundheit der Tiere sicherstellen.Natürliche Heilmethoden kommen im Bedarfsfall vorrangig zur Anwendung.
Im Jahr 2002 umfasste der biologische Landbau 9,6% der gesamten LN.

■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
Unter diesem Titel werden die beiden im Folgenden beschriebenen Programme BTS und RAUS zusammengefasst (vgl.auch Abschnitt 1.3.2).
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen,welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen.Es gelten die folgenden Grundsätze:
– die Tiere werden frei in Gruppen gehalten;
– den Tieren stehen ihrem natürlichen Verhalten angepasste Ruhe-,Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung;
die Ställe verfügen über genügend natürliches Tageslicht.
für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 2002
■ Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren,auf einer Weide oder in einem Laufhof bzw.in einem Aussenklimabereich,der den Bedürfnissen der Tiere entspricht. Für die verschiedenen Tiere gelten die folgenden Anforderungen:
Raufutter verzehrende Nutztiere
– Weidegang an mindestens 26 Tagen im Monat während der Vegetationsperiode; – Auslauf an mindestens 13 Tagen im Monat während der Winterfütterungsperiode.
Schweine
– Mastschweine,Aufzuchtschweine und Zuchteber:täglicher Auslauf;
Galtsauen:Auslauf an mindestens 3 Tagen in der Woche.
Geflügel
täglicher Auslauf.
Ansätze 2002Fr./GVE
Tiere der Rinder- und Pferdegattung,Bisons,Schafe,Ziegen, Dam- und Rothirsche sowie Kaninchen180 –
Beiträge für den regelmässigen Auslauf im Freien 2002
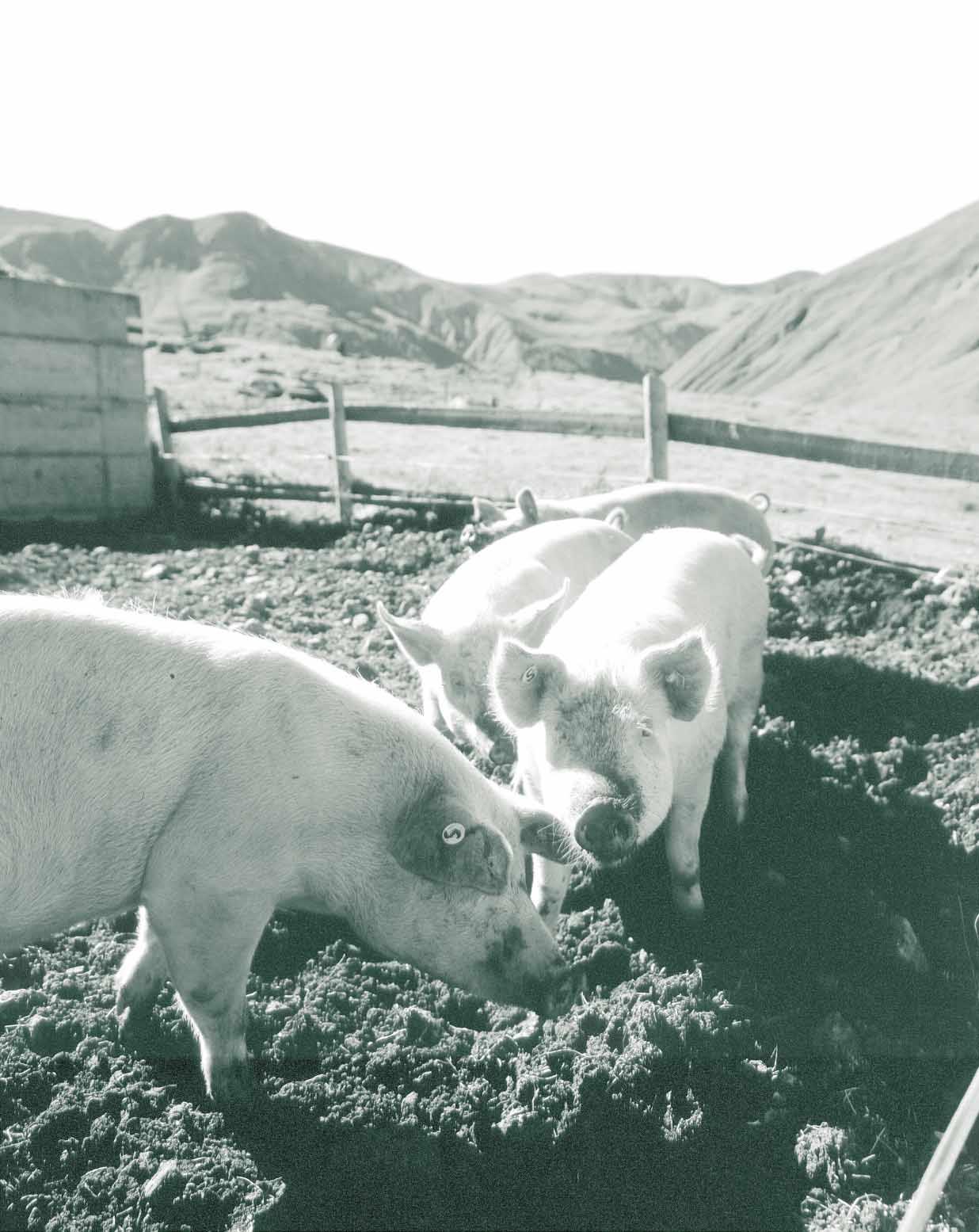
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege unserer ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden.Das Sömmerungsgebiet umfasst rund 600'000 ha,welche mit über 300'000 GVE genutzt und gepflegt werden.Beitragsberechtigt sind Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen,welche Tiere auf einem Sömmerungs-,Hirten- oder Gemeinschaftsweidebetrieb sömmern.
Sömmerungsbeiträge werden unter der Bedingung gewährt,dass die Betriebe sachgerecht und umweltschonend bewirtschaftet und allfällige kantonale,kommunale oder genossenschaftliche Vorschriften eingehalten werden.Sömmerungsbeiträge werden nach Normalstoss (NST) bzw.GVE ausgerichtet.Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen.
Der Beitragsansatz für übrige Raufutter verzehrende Tiere wurde gegenüber dem Vorjahr um 40 Franken pro Normalstoss erhöht.Diese Beitragserhöhung hatte für das Sömmerungsgebiet gegenüber dem Vorjahr eine Einkommensverbesserung von rund 9 Mio.Fr.zur Folge.
dieser Zahl handelt es sich um das Total der beitragsberechtigten Sömmerungsbetriebe (ohne Doppelzählungen)Quelle:BLW
■ Abschwemmungen und Auswaschung verhindern
Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes ermächtigt den Bund,Massnahmen der Landwirte zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in oberund unterirdische Gewässer abzugelten.Das Schwergewicht wird auf die Verminderung der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen gelegt,in denen der ÖLN,der Biolandbau,Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso, ökologischer Ausgleich) nicht genügen.
Gemäss der Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet,für ober- und unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen.Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen für die Betriebe mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und 50% für Bewirtschaftungsmassnahmen.Im Jahr 2002 wurden rund 3,6 Mio.Fr.ausbezahlt.
■ Kommunikationskonzept für das Nitratprogramm
Seit 1999 unterstützt der Bund kantonale Projekte (Nitrat-Programme) zur gezielten Verminderung der Nitratbelastung des Grundwassers.Für die Umsetzung der NitratProgramme ist auf Stufe Bund die Arbeitsgruppe (AG) Nitrat verantwortlich.Der Ausschuss vereinigt Experten des BLW,des BUWAL sowie des BAG.Den Kantonen obliegt sowohl die konzeptionelle als auch die operative Umsetzung der Nitrat-Programme.
Ziel der AG Nitrat ist,die Kommunikation zwischen den diversen Akteuren wie Bundesstellen,Kantone und Gemeinden zu verbessern und die Bevölkerung auf die Nitratproblematik zu sensibilisieren.Der Wissensstand und die Motivation der kantonalen Beratung und Fachstellen sollte erhöht und die Beteiligungszahlen am Nitrat-Programm des Bundes wesentlich gesteigert werden.Durch Kommunikationsaktionen wie umfassende Öffentlichkeitsarbeit,Plattformen für den Informations- und Wissensaustausch,Schaffung von Foren,wurde der Dialog und die Kommunikation gefördert.
Aufgrund der vermehrten Beteiligung am Nitrat-Programm haben sich auch die durch den Bund geleisteten Beiträge gegenüber dem letzten Jahr erhöht.
■ Entwicklung der Nährstoffgehalte im Projektgebiet Wohlenschwil
Überblick über die Projekte 2002
Das Projekt Wohlenschwil im Kanton Aargau wird seit 2001 im Rahmen der 62aBeiträge vom Bund unterstützt.Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden 1996 rund 18 ha Ackerland in extensiv genutzte und ungedüngte Wiesen überführt.Durch diese Massnahme,die ohne Abgeltungen wirtschaftlich nicht tragbar gewesen wäre,konnte eine Verbesserung der Trinkwasserqualität erzielt werden.In dieser Zeitspanne konnte im Projekt durch eine gezielte Anpassung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung im Zuströmbereich und im Nitratperimeter der Grundwasserfassung «Frohberg» eine beachtliche Reduktion der Nährstoffeinträge erreicht werden:Die Nitratbelastung sank von 53 mg/l (1996) auf 25 mg/l (2003).
Das Grundwasser-Einzugsgebiet der Grundwasserfassung «Frohberg» wird mehrheitlich landwirtschaftlich genutzt.Bis 1996 dominierte auf Grund der idealen natürlichen Voraussetzungen vor allem der Ackerbau.Das Einzugsgebiet umfasst eine Gesamtfläche von rund 102 ha.Davon sind 62 ha (61%) LN,39 ha (39%) Wald und eine ha nicht landwirtschaftliche Nutzfläche (vor allem überbaute Fläche).
12 Landwirtschaftsbetriebe aus fünf verschiedenen Gemeinden sind vom Nitratperimeter Wohlenschwil betroffen,allerdings in sehr unterschiedlichem Masse.Einige Betriebe bewirtschaften lediglich Einzelparzellen,bei anderen befinden sich namhafte Teile der LN innerhalb des Perimeters.
Gut ein Viertel der LN ist offenes Ackerland.Der Anteil Kunst- und Naturwiesen beträgt 73%.Auf Grund der Stilllegungen wird ein bedeutender Teil der Wieslandfläche extensiv genutzt.Das offene Ackerland wird zu mehr als der Hälfte mit Hackfrüchten, wie Raps,Zuckerrüben und Mais bebaut.Nitratrelevante Kulturen wie der Gemüseund Kartoffelanbau,die pro Fläche grosse N-Verluste aufweisen,sind im Jahr 2003 nicht vertreten.
Um die erfolgreiche Nitratreduktion auf 25 mg/l sicher halten zu können,ist die Fortführung der Massnahmen notwendig,was für die betroffenen Landwirte weiterhin mit Mehrleistungen verbunden ist.
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion sowie die Erfüllung der multifunktionalen Aufgaben.
Finanzhilfen für die Grundlagenverbesserung
MassnahmeRechnung Rechnung Budget 200120022003
Mio.Fr.
Beiträge Strukturverbesserungen10290102
Investitionskredite987079
Betriebshilfe30935
Beratungswesen und Forschungsbeiträge232424
Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge294
Pflanzen- und Tierzucht212123
Total277223267
Quelle:BLW
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt:
– Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Produktionskosten;
– Förderung des ländlichen Raumes;
– Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen;
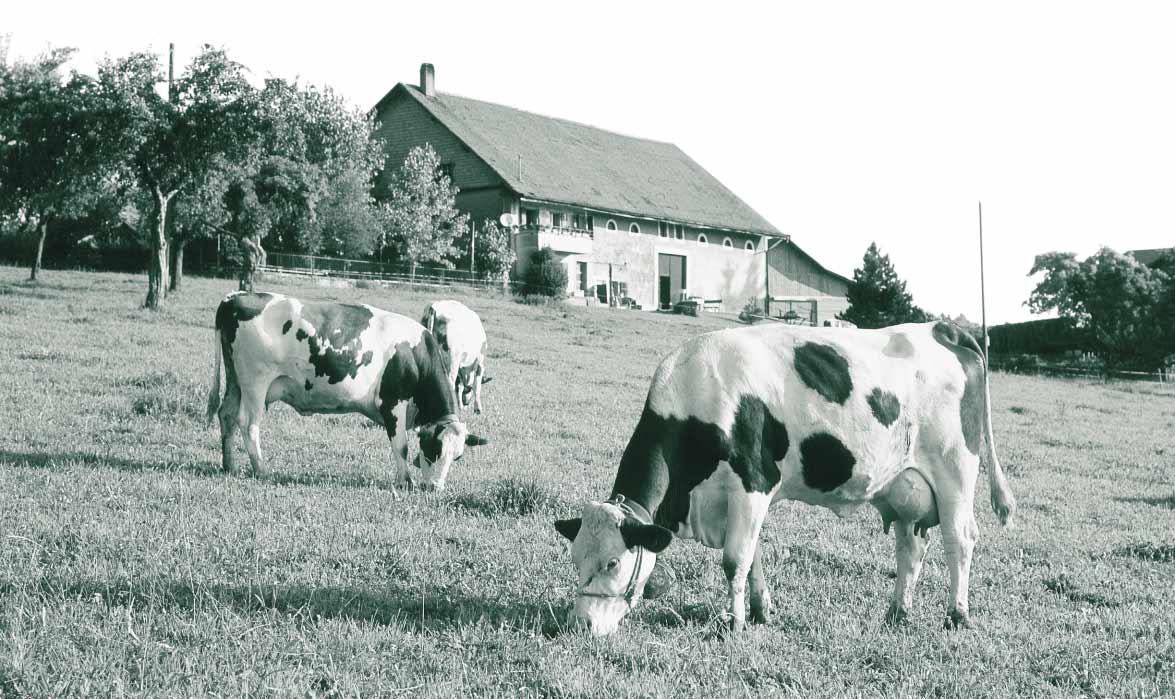
– Effiziente und umweltgerechte Produktion;
– Ertragreiche,möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte;
– Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt;
– Genetische Vielfalt.
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert.Dies betrifft insbesondere das Berggebiet und die Randregionen.
Als Investitionshilfen stehen zwei Instrumente zur Verfügung: – Beiträge (à-fonds-perdu) mit Beteiligung der Kantone; – Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen.
Investitionshilfen unterstützen die Landwirtschaft in der Entwicklung und der Erhaltung wettbewerbsfähiger Strukturen,ohne dass sie sich dafür untragbar verschulden muss.Auch in anderen Ländern,insbesondere in der EU,zählen die Investitionshilfen zu den wichtigsten Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raumes.
Investitionshilfen werden für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.
Im «Internationalen Jahr 2003 des Wassers» ist auch bei den Strukturverbesserungen in der Schweiz die Thematik hoch aktuell.Diese werden beim Wasser im ländlichen Raum vorwiegend in folgenden Bereichen wirksam:
–Unwetterereignisse:
Die Bedeutung der Wiederherstellung von Schäden an Infrastrukturen und Kulturland hat in den letzten Jahren zugenommen.
–Trinkwasser:

Die Bereitstellung von einwandfreiem Trinkwasser in dezentral besiedelten Gebieten ist auch bei uns noch nicht selbstverständlich.
–Ökologie:
Die Erhaltung und Aufwertung von Biotopen und Kleingewässern können im Rahmen von Strukturverbesserungen wirksam gefördert werden.
–Bodenfruchtbarkeit: Bewässerungen und die Erneuerung von Entwässerungen erhalten die Bodenfruchtbarkeit in den besten Böden und leisten einen Beitrag zur Ertragssicherung in extremen Klimajahren.
Für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten standen im Jahr 2002 90 Mio.Fr.zur Verfügung.Das BLW genehmigte neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 77 Mio.Fr.Damit wurde ein Investitionsvolumen von 355 Mio.Fr.ausgelöst.Die Summe der Bundesbeiträge an die genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen»,da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen, und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird. Im Jahr 2002 konnten so beispielsweise die im Vorjahr eingegangenen Verpflichtungen,die wegen den Unwetterschäden 2000 besonders hoch waren,zu einem guten Teil abgebaut werden.
Beiträge des Bundes 2002 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
Wegebauten
Wasserversorgungen
Unwetterschäden und andere Tiefbaumassnahmen
Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere andere Hochbaumassnahmen
Der Bund setzte im Jahr 2002 12% weniger finanzielle Mittel in Form von Beiträgen ein als im Vorjahr.Gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1992/94 liegt die Beitragssumme 11% tiefer.In den ordentlichen Rubriken 2000 und 2001 ist eine Erhöhung der Bundeskredite zur Behebung von Unwetterschäden enthalten.
Im Jahre 2002 bewilligten die Kantone für 2’498 Fälle Investitionskredite von insgesamt 314 Mio.Fr.Von diesem Kreditvolumen entfallen 85% auf einzelbetriebliche und 15% auf gemeinschaftliche Massnahmen.Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite,so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren,gewährt werden.
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden z.B.als Starthilfe,für den Neubau,den Umbau oder die Verbesserung von landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomie- oder Alpgebäuden eingesetzt.Sie werden in durchschnittlich 14 Jahren zurückbezahlt.
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen und bauliche Massnahmen (Alpgebäude,Gemeinschaftsställe,Gebäude und Einrichtungen für die Verarbeitung und die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte) unterstützt.
Im seit 1963 geäufneten Fonds de roulement befinden sich rund 1,9 Mrd.Fr.Den Kantonen werden jährlich neue Bundesmittel zur Verfügung gestellt;im Jahre 2002 waren es 70 Mio.Fr.Diese werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt.

Die Unwetter im Jahr 2002 waren in ganz Europa geprägt durch Überschwemmungen, verbunden mit riesigen Schäden.Die Schweiz war nicht im gleichen Ausmass betroffen wie unsere Nachbarländer,dennoch wurden mehrere Gebiete von ausserordentlichen Unwettern heimgesucht:

– Mitte Juli verursachten Starkniederschläge in den Voralpen der Kantone Bern und Luzern grössere Schäden.
– Ende August ereigneten sich nach einer längeren Niederschlagsperiode massive Erdrutsche und Anlageschäden in der Ostschweiz;davon war neben den Kantonen St.Gallen und Appenzell Innerrhoden vor allem der Kanton Appenzell Ausserrhoden betroffen.

– Mitte November wurde insbesondere der Kanton Graubünden ungewöhnlich stark von Unwetterschäden betroffen.Infolge von lang andauernden Niederschlägen und hohen Temperaturen lösten grossflächige Erdrutsche massive Schäden aus.
Die provisorische Schadensumme im öffentlichen Bereich von 260 Mio.Fr.(Stand Februar 2003) übersteigt das Ausmass durchschnittlicher Jahre beträchtlich.Auch in der Landwirtschaft entstanden neben Ertragsausfällen grosse Schäden an Infrastrukturen und Kulturland.Unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit wird für die Wiederherstellungen von landwirtschaftlichen Wegen,Wasserversorgungen sowie für die Räumung und Wiederherstellung von Kulturland insgesamt mit Kosten von 39 Mio.Fr.gerechnet;der Hauptteil fällt in den Kantonen Graubünden (21,3 Mio.Fr.), Appenzell Ausserrhoden (4,2 Mio.Fr.),Luzern (3,9 Mio.Fr.) und Bern (3,6 Mio.Fr.) an. Gemäss neueren Schätzungen der Kantone dürften die definitiven Schadenssummen über diesen Werten liegen.
Der Bundesanteil an der Schadenbehebung im Bereich Landwirtschaft wird mit 18 Mio.Fr.veranschlagt.Ein Teil der Wiederherstellungsprojekte,insbesondere jene im Zusammenhang mit den Unwetterereignissen Juli–August,wurde bereits im Kreditjahr 2002 behandelt oder durch Umverteilungen im ordentlichen Budget 2003 berücksichtigt.Namentlich zur Bewältigung der Schäden der Grossereignisse im November hat das Parlament ausserdem per 2003 einen Nachtragskredit im Umfang von 7 Mio.Fr. bewilligt.Dabei kommt Artikel 95 des Landwirtschaftsgesetzes für Zusatzbeiträge zur Behebung besonders schwerer Folgen von ausserordentlichen Naturereignissen zur Anwendung.
Die Betriebshilfe wird in Form von zinslosen Darlehen gewährt und ist eine soziale Begleitmassnahme,die dazu dient,eine vorübergehende,unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben.In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen indirekten Entschuldung.
Im Jahr 2002 wurden in 270 Fällen insgesamt 35,2 Mio.Fr.Betriebshilfedarlehen gewährt.Im Vergleich zu 304 Fällen im Vorjahr ist die Anzahl Darlehen leicht zurück gegangen,was auch mit dem allgemein tiefen Zinsniveau erklärt werden kann.Das durchschnittliche Darlehen ist von 113’200 auf 130’237 Fr.gestiegen und wird in 14 Jahren zurückbezahlt.

Betriebshilfedarlehen 2002
Umfinanzierung bestehender Schulden26334,6 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung70,6
Total27035,2
Quelle:BLW
Der seit 1963 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufnete Fonds de roulement beträgt,zusammen mit den Kantonsanteilen,rund 173 Mio.Fr.Im Jahr 2002 wurden den Kantonen 9 Mio.Fr.neu zur Verfügung gestellt.Diese sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden,die je nach Finanzkraft 20–80% des Bundesanteils beträgt.Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt.
Investitionsbedarf für landwirtschaftliche Betriebsgebäude – Untersuchungen zu den Baukosten
Investitionen in landwirtschaftliche Bauten können die Produktionskosten eines Betriebes stark belasten.Sie sollten daher möglichst tief sein;es muss ein Optimum gefunden werden zwischen den Baukosten und den gewünschten Arbeitserleichterungen.In diesem Zusammenhang wird häufig auf Bauten und Lösungen verwiesen,die angeblich mit sehr niedrigen Kosten erstellt wurden.Die Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT) hat im Auftrag des BLW Untersuchungen durchgeführt,die den Investitionsbedarf für landwirtschaftliche Betriebsgebäude feststellen und die Baukosten mit dem benachbarten Ausland vergleichen.Den heutigen Entwicklungen entsprechend wurden Laufställe für die Milchviehhaltung untersucht.
Generell herrscht in der Schweiz die Meinung vor,dass die landwirtschaftlichen Bauten im Ausland weniger kosten.Deshalb wurden zusammen mit den Fachstellen im benachbarten Ausland,namentlich in Frankreich,Deutschland und Österreich,Vergleiche angestellt mit dem Ziel,diese Behauptung zu erhärten oder zu widerlegen.

Die Untersuchung zeigt,dass im benachbarten Ausland billiger gebaut wird.Der Unterschied ist auf tiefere Lohn- und Materialkosten sowie auf kostengünstige Serienund Vorfabrikationen zurückzuführen.Ausserdem sind im Ausland die Winter in der Regel kürzer und somit die mögliche Zeit für das Bauen länger.
Die tieferen Kosten müssen jedoch relativiert werden.So wird im Ausland die Planung und die Bauleitung oft von Amtsstellen zu äusserst günstigen Bedingungen wahrgenommen,was einer indirekten Finanzhilfe gleich kommt.Der Anteil an Eigenleistungen ist in der Regel wesentlich höher als in der Schweiz.Da beim Baukostenvergleich nur belegbare Kosten berücksichtigt wurden,verringert ein höherer Anteil an Eigenleistungen die Differenz ebenfalls.Eigenleistungen haben auch den Nachteil,dass eine Haftung Dritter bei Mängeln,Schäden und Verlusten nicht beansprucht werden kann. Zudem ist der betriebliche Erfolg und das persönliche Umfeld während der angespannten Zeit in der Bauphase zu berücksichtigen.
Untersucht wurde auch der Einfluss von gesetzlichen Vorschriften auf die Baukosten. Hier zeigt sich,dass diese das Bauen in der Schweiz gegenüber dem Ausland kaum teurer machen.Bei den Vorschriften betreffend Gewässerschutz und Tierschutz gibt es wenig Unterschiede.Einzig bei den Auflagen von Natur- und Heimatschutz sind Unterschiede feststellbar,die aber bei den untersuchten Bauten nicht ins Gewicht fallen.
■ Unterschiede auch in der Schweiz
Die Untersuchungen in der Schweiz wurden im Talgebiet und im Berggebiet in drei Gruppen mit Betrieben bis 35 Grossvieheinheiten (GVE),zwischen 35–55 GVE und grösser als 55 GVE durchgeführt,dies für Baulösungen für die silagefreie Milchproduktion bei der Käseherstellung oder für die Produktion von Konsum- und Industriemilch mit Silagefütterung.Insgesamt wurden 71 Objekte ausgewertet.
Die Untersuchungen zeigen,dass es auch innerhalb der Schweiz grosse Unterschiede in den Kosten gibt.Die wichtigsten Faktoren für die Differenzen sind die Gebäudegrösse,die Betriebsausrichtung (Betriebe ohne oder mit Silage) sowie der Standard der Installationen.
Die Gebäudegrösse beeinflusst die spezifischen Baukosten (Fr./GVE) am meisten.Die Kostendegression ist bis zu 50 GVE am stärksten,nachher flacht sie deutlich ab.Tiefere Kosten pro GVE haben Baulösungen ohne Jungviehplätze zur Folge.Der Unterschied ist allerdings teilweise durch unterschiedliche Ansätze erklärbar,da eine Kuh mit 1,0 GVE angerechnet wird,ein grosses Rind bei gleichem Platzbedarf aber nur mit 0,6 GVE.Die Kosten in die Höhe treiben dagegen aufwändige Installationen wie teurer Melkstand, Melkroboter und mechanische Fütterungseinrichtungen.
Kostenvergleich zwischen Betrieben mit und ohne Silage
Betriebe ohne Silage (25) 1 Betriebe mit Silage (17) 1 mit Heubelüftungohne Heubelüftung
Fr.%Fr.%
Stall10 000528 60066
Futterlager5 900312 10016
Hofdünger3 300172 40018
Total19 20010013 100100
ohne Silagemit Silage im Durchschnitt:im Durchschnitt: 41 GVE,davon 31 Kühe72 GVE,davon 59 Kühe

1(Anzahl Betriebe)
Quelle:FAT
Erhebliche Differenzen gibt es bei Betrieben ohne Silage respektive mit Silage.Bei gleicher Betriebsgrösse betragen sie Fr.3'000.– bis 4'000.– pro GVE.Die Silagebetriebe profitieren oft von bestehenden Gebäudeteilen und müssen somit nicht das gesamte Raumprogramm realisieren.Mobile Gerätschaften und der grössere Arbeitsaufwand für das Einlagern und Bereitstellen des Futters (Traktoren,Blockschneider, Futtermischwagen,etc.) bei Betrieben mit Silage sind in den Baukosten allerdings nicht enthalten.
Keinen wesentlichen Einfluss auf die Kosten haben Standort (Tal-,Hügel-,Bergregion) und Aufstallungssystem (Liegeboxen oder Tiefstreue) der Betriebe.Obwohl die Betriebe in der Bergregion eine längere Lagerdauer für Futter und Hofdünger haben und zudem höhere statische Anforderungen erfüllt werden müssen,können auch im Berggebiet grössere Einheiten kostengünstig erstellt werden,sofern nicht erschwerende Terrainverhältnisse und lange Transportwege zu Mehrkosten führen.
Mobile Einrichtungen sind im Vergleich nicht erfasst.Bei grossen Betrieben findet oft eine Verlagerung von Bauinvestitionen in solche Einrichtungen statt,was die Kostendegression etwas relativiert.
Die Investitionen für das Gesamtprogramm mit Stall,Futter- und Hofdüngerlager schwanken je nach Baulösung sehr stark und liegen auch bei grossen Silagebetrieben im Talgebiet (82 GVE) im Durchschnitt bei Fr.13'500.– pro GVE.

■ Auch Minimallösungen haben eine Grenze
Die Auswertung nach Gebäudeflächen ergibt,dass pro GVE
13 bis 20 m2 überdeckte und betonierte Fläche erstellt wurden,um den Anforderungen einer tiergerechten Haltung zu genügen (Liegebereich,Fressbereich mit Futtertenne und Melkbereich);
– 30 m3 Lager für Belüftungsheu bei silofreien Betrieben oder 12 m3 Lager für die Silage notwendig sind;
12 m3 Hofdüngerlager erstellt werden müssen.
Eine Berechnung auf der Basis der minimal notwendigen Flächen zeigt,dass auch bei grossen Betrieben mit einfachen Gesamtlösungen die Kosten Fr.10'400.– bis 15'500.–pro GVE betragen.Zuschläge für Erschwernisse,Umgebung und Erschliessung sind darin noch nicht enthalten.Kostenangaben für Gesamtlösungen unter Fr.10'000.– pro GVE sind deshalb zu hinterfragen.Andererseits sind Kosten über Fr.20'000.– pro GVE ebenfalls kritisch zu prüfen.Es ist im Einzelfall abzuklären,welche Bauteile in den jeweiligen Kosten enthalten sind.
Minimaler Investitionsbedarf
Betrieb ohne SilageBetrieb mit Silage
Anmerkung: Der minimale Investitionsbedarf basiert auf den Ausmassen für den Boden von 15 m2, die Wand von 15 m2, das Dach von 20 m2, die Gülle von 12 m3
■ Gute Bauqualität auch mit tieferen Kosten
Quelle: FAT
Die in der Studie überprüften Betriebsgebäude waren grösstenteils unisolierte oder gar offene Ställe und wiesen eine gute Bauqualität auf,weshalb eine lange Lebensdauer erwartet werden kann.Die Gebäude befriedigen ebenfalls gestalterisch.Es wurden keine gravierenden bautechnischen oder bauphysikalischen Mängel festgestellt.
Die Bundesverfassung und das Landwirtschaftsgesetz verlangen,dass dem Natur- und Heimatschutz Rechnung getragen wird.Die finanziellen Auswirkungen dieser Vorgaben auf die landwirtschaftlichen Bauten sind im Rahmen der Studie nicht speziell untersucht worden;sie dürften allerdings nur in einzelnen Fällen eine Bedeutung haben.
■ Zielsetzungen zu 93% erreicht
Nach Bundesverfassung kann der Bund zur Erfüllung der multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft die landwirtschaftliche Forschung fördern.
Die eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten sind in der Geschäftseinheit Landwirtschaftliche Forschung (GLF) zusammengefasst und dem BLW unterstellt.Ihre Tätigkeiten in der anwendungsorientierten Forschung beanspruchen rund 60%,Vollzugs- und Kontrollaufgaben rund 40% der Mittel.Dank der Verbindung von angewandter Forschung mit Vollzug und Kontrolle wird gewährleistet,dass das aktuellste Know-how und eine hochwertige Infrastruktur optimal genutzt werden.
Die Beurteilung der Forschungsleistungen erfolgt anhand konkreter Indikatoren und Standards.Die Zielvorgaben wurden zu 93% erreicht.Die GLF konnte also das im vergangenen Jahr erreichte,hohe Leistungsniveau halten.Nur einige wenige Projekte liessen sich wegen fehlenden Fachpersonals oder einer im Laufe des Jahres erforderlichen neuen Prioritätensetzung nicht verwirklichen.
■ BSC:Ein modernes Steuerungsinstrument
Die GLF hat mit der «Balanced Scorecard» (BSC) ein umfassendes Managementinstrument eingeführt,das der Leistungssteuerung und der strategischen Unternehmensführung dient.Die BSC (wörtlich:ausgewogene Bewertungskarte) zeigt wie ein Armaturenbrett die wichtigsten Daten zur Führung und Steuerung der GLF an.
Dieses Armaturenbrett umfasst rund 20 Kennzahlen,dank denen die Vision und Aufgabe einer Organisation aus vier miteinander vernetzten Perspektiven betrachtet werden können:
1.Die Finanzperspektive stellt die Entwicklung und Verteilung der Finanzmittel dar.
2.Die Perspektive Leistung und Kunden zeigt den Output auf (z.B.Veröffentlichungen, Vorträge,Vorlesungen).
3.Die Prozessperspektive zeigt auf,welche Kooperationen mit anderen Institutionen bestehen.
4.Die Perspektive Potentiale umfasst die Bereiche Personal und Ausbildung.
Diese vier Gesichtspunkte sind eng verflochten.Die Auswertung des Kennzahlensystems ergibt somit Betriebsdaten,die es erlauben,kontinuierlich auf die bestmögliche Befriedigung der Kundenwünsche hinzuwirken.Die BSC der GLF wird in Abhängigkeit der Erfahrungen modifiziert und ständig an neue Bedürfnisse angepasst.
■ RAP und FAM werden zusammengelegt
Elemente der Balanced Scorecard
Finanzen
«Welches ist der Erreichungsgrad bei den vertraglichen Zielvorgaben?»
➞ Vertragsinformation
Potentiale
«Welches interne Potential ist für die Zielerreichung zu entwickeln?»

➞ Potentialinformation
Ziele / Vision
«Wie sind die Aufgaben zu erfüllen?»
➞ Strategie
Leistung und Kunden
«Wie lässt sich bei der Aufgabenerfüllung die Kundenzufriedenheit optimieren?»
➞ Verhaltenssteuerung
Prozesse
«Welche Prozesse müssen wir meistern, um unsere Kunden zufrieden zu stellen?»
➞ Interne Impulsinformation
Die BSC vernetzt sämtliche Gesichtspunkte,damit Vision und Strategie eines Unternehmens optimal umgesetzt werden können.Sie ist ein internes Führungsinstrument, mit dem die Weiterentwicklung der Institution auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet wird.
Die Forschungsanstalt für Milchwirtschaft (FAM) und die Forschungsanstalt für Nutztiere (RAP) bilden seit 2000 das Kompetenzzentrum «Tierische Produktion und Lebensmittel tierischer Herkunft».Mit Beginn der neuen Leistungsauftragsperiode 2004–2007 werden die beiden Standorte einer gemeinsamen Direktion unterstellt.Die Standorte Posieux und Liebefeld-Bern bleiben bestehen.
■ Internationale Anbindung
Die Agrarforschung richtet sich zunehmend international aus.Die GLF will sich am sechsten EU-Forschungsrahmenprogramm aktiv beteiligen.Sie steht damit im Wettbewerb zu den Forschungseinrichtungen in ganz Europa.Die erste Hürde wurde erfolgreich gemeistert.Die GLF beteiligt sich zusammen mit Forschungspartnern aus EU-Ländern an insgesamt 87 Interessensbekundungen (Expressions of Interest) für Forschungsprojekteingaben.Ein Teil der durch die Interessensbekundungen erarbeiteten Forschungsideen werden in den folgenden Jahren in Forschungsprojekt-Anträge einfliessen.
Das Mitmachen in internationalen Forschungsprojekten verlangt den Aufbau von Netzwerken mit mehreren internationalen Projektpartnern.Zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit gehört immer ein Geben und Nehmen.Es wird zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen eine Win/Win-Situation angestrebt.Dies heisst auch, dass nur hoch qualifizierte Forschungsgruppen gefragte Netzwerkpartner werden können.

Ausser in Netzwerken für EU-Forschungsprojekte arbeitet die GLF am Aufbau von grenzübergreifenden Projekten mit Partnerinstituten im benachbarten Ausland.Diese Anstrengungen zielen auf die Intensivierung der auch vom Bund geförderten InterregProjekte hin.Weitere Zusammenarbeitsmöglichkeiten ergeben sich mit dem europäischen Programm unter dem Kürzel COST (Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung),mit der FAO und mit der OECD.Die Schweizer Agrarforschung ist damit deutlich internationaler geworden.
■ Forschungskonzept
für den Politikbereich Landwirtschaft
Im Rahmen der Botschaft über die Förderung von Bildung,Forschung und Technologie in den Jahren 2004–2007 wurden zu 12 Politikbereichen Forschungskonzepte erarbeitet.Das BLW war federführend für den Politikbereich Landwirtschaft.
Das Forschungskonzept für den Politikbereich Landwirtschaft steht wie die Agrarpolitik unter dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit.Für die Forschung bedeutet dies,dass eine umfassende Systembetrachtung angestrebt wird.Dazu ist der Ausbau interdisziplinärer Forschung unerlässlich.Die Vernetzung der Forschung ist auch notwendig,um künftige Forschungsfragen so früh wie möglich angehen zu können.
Wissen ist eine wettbewerbsentscheidende Ressource und das Management von Wissen wird zum kritischen Erfolgsfaktor.Praktische Ansätze und Methoden zum systematischen Umgang mit Wissen werden notwendig.Dies betrifft sowohl die unternehmensinternen Abläufe als auch den externen Wissensaustausch.
Ausgehend von diesen Grundgedanken sowie aus der Analyse der Entwicklungen der Agrarpolitik und des Umfeldes sind für die Forschung des Bundes für den Politikbereich Landwirtschaft für die Periode 2004–2007 folgende Ziele abgeleitet worden:
Ein ökonomisch leistungsfähiger Agrarsektor:Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel zu marktgerechten Preisen,tiefere Produktionskosten und höhere Wertschöpfung.
– Ein ökologisch verantwortungsvoller Agrarsektor:Erhaltung / nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen wie Boden,Wasser,Luft und Landschaft sowie Biodiversität,Verständnis für ökosystemare Zusammenhänge,Technikfolgenabschätzungen, Ökotoxikologie im Landwirtschaftsbereich,Umweltleistungen des Agrarsektors,artgerechte Tierhaltung. – Eine sozialverträgliche Entwicklung des Agrarsektors:Einkommenssituation der Landwirtschaft im Zusammenhang mit Lebensqualität,Strukturdynamik,Anpassungsmöglichkeiten,Auswirkungen auf den ländlichen Raum.
– Früherkennung:Die landwirtschaftliche Forschung muss die Entwicklung in Bereichen wie Ernährung und Gesundheit,Produkteinnovation,Qualitätsstandards versus Warenflüsse,geschlossene Kreisläufe voraussehen und daran arbeiten.


Transdisziplinäre Forschung:Effektive Problemlösungen benötigen oft multidisziplinäre Ansätze und die aktive Beteiligung der ganzen «filière» (Produktionskette) bis zu den Konsumentinnen und Konsumenten.




– Wissenstransfer:Forschungsergebnisse kundengerecht den Benutzern zur Verfügung stellen.Neue Informationsmöglichkeiten und -technologien nutzen.Die Forschung muss transparent und medienwirksam mit der breiten Öffentlichkeit in Dialog treten.
Ziele der Agrarforschung
Auf der Grundlage des Forschungskonzepts «Landwirtschaft» wurde für die GLF ein neuer Leistungsauftrag 2004–2007 erstellt,der vom Bundesrat den betreffenden parlamentarischen Kommissionen zur Vernehmlassung unterbreitet wurde.Der neue Leistungsauftrag wird am 1.Januar 2004 in Kraft treten.
Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung

Der Bund gewährt den kantonalen landwirtschaftlichen und bäuerlich-hauswirtschaftlichen Beratungsdiensten,den Spezial-Beratungsdiensten landwirtschaftlicher Organisationen,die gesamtschweizerisch aktiv sind und den Beratungszentralen der Schweizerischen Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft Finanzhilfen.
Ausgaben für die Beratung 2002 EmpfängerBetrag Mio.Fr.
Landwirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone8,8 Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone0,8 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen1,0 Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft8,4
Total19,0
Quelle:Staatsrechnung
In den letzten zwei Jahren standen Finanzfragen im Vordergrund.Diese können vom üblichen Betriebsvoranschlag über Abklärungen für Investitionen und Investitionskredite bis hin zu strategischen Abklärungen im Zusammenhang mit Hofübergaben und überbetrieblicher Zusammenarbeit gehen.Häufig hat die Komplexität der Fälle zugenommen und nicht selten wurden Betriebe zu Problemfällen.Zudem gewannen die Optimierung der Milchproduktion und die Ausrichtung auf Qualitäts- und Labelproduktion an Bedeutung.
■ Grundbildung
Der SBV nimmt die berufsständischen Interessen der landwirtschaftlichen Berufsbildung wahr.Nach einer gut einjährigen Übergangsphase wurde der Wechsel vom Schweizerischen Landwirtschaftlichen Verein (SLV) zum SBV im Berichtsjahr definitiv vollzogen.Die Delegierten des SLV haben am 28.Mai 2002 die Fusion mit dem SBV und gleichzeitig die Auflösung des traditionsreichen Vereins rückwirkend auf den 1.Januar 2002 beschlossen.Dem Geschäftsbereich Bildung des SBV sind damit sämtliche Aufgaben im Bereich der Berufsbildung,welche aus der Sicht des Berufsverbandes bearbeitet werden müssen,zugewiesen.Sie gliedern sich in die Bereiche Grundbildung (Sekundarstufe 2),höhere Berufsbildung (Tertiärstufe) und Erwachsenenbildung(Quartärstufe).Die Tätigkeiten beschränken sich auf die Deutschschweiz, soweit es sich um die Zusammenarbeit mit den Bildungsanbietern (Landwirtschaftsschulen,Kantone) handelt.In der Romandie werden die entsprechenden Aufgaben durch die Association des Groupements et Organisations Romands de l’Agriculture (AGORA) betreut.
Auf Stufe Berufslehre wurde das Projekt «Berufsfeld grüne Berufe» weiter geführt. Die Aktivitäten dienen als Vorbereitung im Hinblick auf die Einführung des neuen Berufsbildungsgesetzes.Im Frühjahr 2002 hat sich gezeigt,dass die Vision eines grossen Berufsfeldes,in welchem die Grundbildung der Berufe in der Landwirtschaft (inkl.der landwirtschaftlichen Spezialberufe),im Gartenbau und in der Forstwirtschaft mindestens teilweise gemeinsam angeboten würde,nicht umgesetzt werden kann. Das Lehrstellenbeschluss 2-Projekt des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) wurde deswegen nicht abgeschlossen,sondern in angepasster Form weiter geführt.Die Zusammenarbeit findet auf gesamtschweizerischer Ebene zwischen dem Beruf LandwirtIn und den landwirtschaftlichen Spezialberufen statt,also im Rahmen eines «kleinen» Berufsfeldes.
Einen Schwerpunkt der Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Bildung des SBV bildeten im Berichtsjahr die Arbeiten zur Entwicklung von neuen Ausbildungsmodellen der Grundbildung.Die laufenden Geschäfte wurden von der neuen Berufsbildungskommission des SBV bearbeitet.Die Führung des Gremiums,in welchem die praktische und schulische Bildung paritätisch vertreten sind,wurde von Werner Wyss,Lehrmeister aus dem Kanton Bern, übernommen.
Eine brancheninterne Vernehmlassung führte zur Erkenntnis,dass in der landwirtschaftlichen Grundbildung ein einheitliches,gesamtschweizerisches Ausbildungsmodell eingeführt werden soll.Die schulische Bildung von mindestens 1’600 Lektionen soll über die drei Ausbildungsjahre progressiv verteilt sein.Die Branche bekräftigt ganz klar das Prinzip der dualen Berufslehre.

■ Höhere Berufsbildung
Der modular aufgebaute Baukasten für die höhere Berufsbildung wurde auch im Berichtsjahr rege genutzt.Die Möglichkeit,das «eigene» Weiterbildungsmenu zeitlich selber zu gestalten,wird sehr geschätzt.Auf Stufe Berufsprüfung wurden in der Deutschschweiz 1’679 Module,davon 1’453 mit «erfüllt»,abgeschlossen.287 Absolventinnen und Absolventen erreichten mindestens 10 Modulpunkte und konnten so die Berufsprüfung als «Landwirt/Landwirtin mit eidgenössischem Fachausweis» erfolgreich bestehen.Sie erfüllen damit die Zulassungsbedingungen für die landwirtschaftliche Meisterprüfung 2003.Im Berichtsjahr sind 184 Kandidatinnen und Kandidaten zur Schlussprüfung für Meisterlandwirte angetreten.161 bestanden die anspruchsvollen Prüfungen und konnten am 19.September 2002 an der Expoagricole das Meisterdiplom im Rahmen einer gesamtschweizerischen Feier entgegennehmen.
■ Weiterbildungsangebot des BLW
Rund 2000 Arbeitsstunden sind nötig,um für 80 Teilnehmende aus 40 Ländern eine zweiwöchige Weiterbildungsveranstaltung zu planen und durchzuführen.Seit vielen Jahren ist das BLW im Rahmen der Weiterbildungsinitiative CIEA an Aktivitäten mit landwirtschaftlichen Beratungs- und Bildungsfachleuten aus der ganzen Welt beteiligt.
Es handelt sich dabei um die Führung eines Bildungszentrums,welches 1956 auf Anregung des damaligen Direktors der landwirtschaftlichen Abteilung der FAO in Rom, F.T.Wahlen und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA),gegründet wurde.Ab 1958 konnten regelmässig aktuelle Fragestellungen zu Pädagogik,Methodik,Ausbildungsmodellen,Weiterbildungskonzepten und Beratung in der Landwirtschaft bearbeitet und diskutiert werden.Als Teilnehmende meldeten sich interessierte Fachleute aus Industrie- und Entwicklungsländern,so dass in jedem CIEA-Seminar ein intensiver,breiter Ideen- und Erfahrungsaustausch über viele Landesgrenzen hinweg stattfand.
■ Ein Netzwerk von Beratungs- und Bildungsfachleuten
Aus der anfänglichen Idee,einen Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit zu leisten, ist in den vergangenen Jahren ein Netzwerk von Beratungs- und Bildungsfachleuten entstanden.Ein kurzer Blick auf die Themen der letzten Jahre zeigt,dass die Institution CIEA stark darauf bedacht war und ist,aktuelle und vielseitige Fragestellungen zu bearbeiten.So wurden z.B.Probleme rund um «Schlüsselqualifikationen», «Evaluation», «Interne und externe Kommunikation» sowie «Wissensmanagement» erörtert. Gerade die letztgenannte Thematik erlaubte es an Herausforderungen zu arbeiten,mit welchen auch die ganze Landwirtschaft konfrontiert ist.Der Umgang mit einer riesigen Menge von Wissen und der Bedarf,das eigene Wissen ständig auf möglichst aktuellem Stand zu halten,beschäftigt heute wohl jeden Berufsmann,jede Berufsfrau.
Es gilt deshalb die wichtigen Grundsätze des Wissensmanagements zu kennen.So nennen Davenport und Prusak beispielweise folgende Prinzipien,welche im Rahmen von CIEA-Aktivitäten berücksichtigt werden:
– Wissen entsteht und verbleibt im menschlichen Geist; – gemeinsame Nutzung von Wissen erfordert Vertrauen; – Austausch von Wissen sollte gefördert und entlohnt werden;
– Wissen ist etwas Kreatives;seine Entwicklung in unvermutete Richtungen sollte unterstützt werden.
Konkret ging es im Seminar 2002 darum aufzuzeigen,wie landwirtschaftliche Fachleute zu gutem,umfassendem Wissen kommen,wie sie dieses Wissen effizient verwenden können und wie aufgearbeitetes Wissen in geeigneter Form weitergegeben werden kann.Neben wichtigen Grundlagen zum Wissensmanagement wurden im Verlauf des Seminars vor allem konkrete Anwendungsbeispiele bearbeitet,z.B.die Themen «Mit Wissen in Institutionen umgehen», «Netzwerke – eine neue Art der Zusammenarbeit setzt sich durch» oder «Wissensmanagement mit technischen Hilfsmitteln».Einblicke in die landwirtschaftliche Bildungspraxis und in Bauernbetriebe des Kantons Bern rundeten das Programm ab.
Das CIEA als kleines Kompetenzzentrum zweier Bundesämter (BLW und DEZA) will verschiedenste methodisch-didaktische Prinzipien zu Gunsten der schweizerischen und der internationalen Landwirtschaft und im Interesse der landwirtschaftlichen Beratung und Bildung auch in den kommenden Jahren umsetzen.Der Nutzen für alle Beteiligten kommt auf verschiedenen Ebenen klar zum Ausdruck.
Das CIEA ermöglicht:
– die Auseinandersetzung mit Stand und Entwicklungsperspektiven im landwirtschaftlichen Beratungs- und Bildungswesen;
– Einblicke in neue Arbeitstechniken und Arbeitsmethodologien;

– interdisziplinäres Denken und Arbeiten an den Schnittstellen zwischen Landwirtschaft,Pädagogik und Entwicklung;
–übergreifende nationale und internationale Kontakte zu Fachleuten aus Beratung und Bildung und damit verbunden eine persönliche Standortbestimmung.
Zwischenbeurteilungen und Evaluationen am Ende der verschiedenen Seminare zeigten auf,dass die gesteckten Ziele in hohem Masse erreicht werden konnten.Die hohe Teilnehmerzufriedenheit und die gute Beurteilung konnten neben der inhaltlichen Qualität und der methodischen Vielfalt auch auf die gute Organisation der Anlässe zurückgeführt werden.Am entscheidensten für den Erfolg der Seminare war jeweils die äusserst engagierte Mitarbeit der Teilnehmenden.Die Beteiligten aus aller Welt wuchsen im Verlauf der Seminare zu einer echten Wissensgemeinschaft zusammen.
Detaillierte Informationen über das CIEA sowie über kommende Aktivitäten sind unter www.ciea.ch zu finden.
Der Pferdebestand in der Schweiz hat seit 1996 um mehr als 17% zugenommen.Zwar werden demnach immer mehr Pferde genutzt,aber es fehlt oft das notwendige Wissen über die Haltung und Nutzung dieser Tiere.
Fragen an die Beratungsstelle Pferd im Jahr 2002
Diverses 4%
Fütterung 5%
Pferdekauf / Info zu Rassen 5%
Pferdepflege / Hufpflege 2%
Abstammung / Anpaarung 8%
Ausbildung Pferd und Reiter 2% Herdebuch / Zuchtprüfungen 8% Betriebswirtschaft 18%
Quelle: Eidgenössisches Gestüt
Um Abhilfe zu schaffen haben die Verantwortlichen für das Eigenössische Gestüt in Zusammenarbeit mit den bestehenden Organisationen ein Beratungsbüro für Pferdezucht und Pferdehaltung ins Leben gerufen.Das Beratungsbüro liefert wertvolle Informationen auf zahlreichen Gebieten:Zucht,tiergerechte Haltung,Fütterung, Hygiene und Krankheiten,Verletzungen,Hufpflege,Fruchtbarkeit und Reproduktionsmethoden.Im Berichtsjahr wurde das Angebot bereits rege benutzt.

■ Hoher Qualitätsstandard dank zertifiziertem Saatund Pflanzgut
Durch die Zertifizierung von Saat- und Pflanzgut wird der Landwirtschaft Vermehrungsmaterial mit hoher Qualität,erwünschten Sortenmerkmalen und einwandfreiem phytosanitärem Status zur Verfügung gestellt.Mit der Anwendung eines gezielten Vermehrungsschemas sowie der Verwendung von gesundem Ausgangsmaterial wird der Befall durch qualitätsmindernde und phytopathogene Schadorganismen in der Pflanzenproduktion eingedämmt.Im Vordergrund der Zertifizierung stehen die Pflanzenschutzqualität und Sortenechtheit.
Das Ausgangsmaterial wird in aufwändigen Tests auf die Abwesenheit von Virosen, Mycoplasmen und Bakterien getestet und muss artspezifische Anforderungen,z.B.das Einhalten der Abstammungsregeln,die Sortenechtheit oder den Gesundheitszustand der für die Produktion registrierten Parzellen erfüllen.Mit der exakten Dokumentation des gesamten Vermehrungsprozesses wird ein gesunder Warenfluss angestrebt.
Durch die gezielte Selektion pflanzengenetischer Merkmale bietet die moderne Pflanzenzüchtung eine Erweiterung der Sorteneigenschaften.Somit kann eine verbesserte Resistenz gegenüber Schadorganismen,ein gezielter und reduzierter Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder eine erhöhte Toleranz gegenüber abiotischen Stressfaktoren erreicht werden.
Der Sortencharakter wird durch natürliche Mutationen,Durchwuchs oder spontane Einkreuzungen mit anderen Typen beeinträchtigt.Die Erhaltungszüchtung gewährleistet,dass die Leistungsfähigkeit einer Sorte bestehen bleibt.So wird sortenbildtypisches Saatgut in Vorvermehrungsparzellen angebaut.Diese stellen die erste Vermehrungsgeneration dar (Vorstufensaatgut),aus der sich die verschiedenen Vermehrungsstufen (Basissaatgut,zertifiziertes Saatgut) entwickeln.
Nach den Grundsätzen der Erhaltungszüchtung produziertes Basissaatgut ist anerkennungspflichtig und bildet das Ausgangsmaterial für die Weitervermehrung zu zertifiziertem Saatgut.Es erwächst direkt aus dem Vorstufensaatgut.Die Sortenechtheit muss gewährleistet sein.Die geforderten Bedingungen an Parzellen und phytosanitären Status des Saatgutes sind deutlich höher als bei zertifizierten Saatgut.
Das eigentliche Verbrauchssaatgut,welches für die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln benötigt wird,ist das zertifizierte Saatgut.Es muss aus anerkanntem Basissaatgut gewachsen sein.Vor dem Verkauf wird es offiziell (Feldbesichtigung der Vermehrungsparzellen,Analyse der Reinheit und Keimfähigkeit) kontrolliert.
Für jede Pflanzenart besteht ein spezifisches Kontrollverfahren.Diese Kontrollen werden je nach Produktionskategorie durch den Eidgenössischen Dienst für Saat- und Pflanzgut oder eine zugelassene Person der Vermehrungsorganisation durchgeführt. Als zertifiziertes Saatgut darf ausschliesslich Vermehrungsmaterial in Verkehr gebracht werden,welches die hohen Anforderungen der Gesetzgebung erfüllt und somit die notwendige Qualität aufweist.

■ Weniger Neubewilligungen
Bedingt durch angehobene Zulassungsbedingungen (internationale Anforderungen, vollständige Dossiers) setzt sich der Trend zu weniger Gesuchen und Neubewilligungen von Pflanzenschutzmitteln fort.
Entwicklung von Gesuchen und Neubewilligungen für Pflanzenschutzmittel
JahrNeue
1 inkl.Bewilligungen aus Vorjahresgesuchen
Anmerkung:Nicht mitgezählt sind Gesuche,die aus Anlass von Änderungen der Geschäftstätigkeit (Fusionen,Verkauf von Produkten,Wirkstoffen oder Geschäftszweigen) seitens der Bewilligungsinhaber gestellt wurden.
■ EU-Verbot von Wirkstoffen
Aufmerksam werden die Entwicklungen in der EU verfolgt.Dort dürfen in den kommenden Monaten und Jahren rund 50% der Wirkstoffe,welche noch Mitte 1993 in mindestens einem der Mitgliedstaaten auf dem Markt waren,nicht mehr eingesetzt werden.Das BLW hat ein entsprechendes Programm zur Bewältigung der Auswirkungen dieser EU-Massnahmen in der Schweiz erarbeitet.Die Umsetzung richtet sich auf diejenige in der EU aus.


Die Pflanzennährstoffe Stickstoff (N) und Phosphor (P ausgedrückt als P2O5) werden den Böden durch das Pflanzenwachstum entzogen und müssen wieder ersetzt werden. In der Landwirtschaft werden neben Hofdüngern auch Recycling- und Handelsdünger eingesetzt.Der Düngemittelverbrauch von N und P ist ein Gradmesser der Intensität der landwirtschaftlichen Produktion.Hofdünger (vorwiegend Stallmist und Gülle) sind die Hauptquelle für die N- und P-Zufuhr,vor allem in Gebieten mit hoher Viehdichte. Zusätzlich werden N- und P-haltige Mineraldünger eingesetzt.
Die Hofdünger decken mehr als 60% des Bedarfs unserer Kulturen.Grossvieh und Schweine liefern den grössten Teil davon.Beim Grossvieh haben die Bestände seit 1960 etwas abgenommen.Demgegenüber nahm der Schweinebestand bis 1980 stetig zu,seit 1980 jedoch markant ab.
N- und P2O5-Anteile verschiedener D
Die wichtigsten in der Landwirtschaft verwendeten Recyclingdünger der letzten Jahre waren Klärschlamm und Kompost.Die Menge an ausgebrachten Nährstoffen durch diese beiden lag jedoch unter 11% der gesamten Düngerbilanz.Der Anteil des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlamms nahm in den neunziger Jahren stark ab.Ab 2003 darf Klärschlamm nicht mehr auf Gemüse- und Futterflächen und ab dem Jahre 2006 als Folge zu hoher Risiken in der Landwirtschaft überhaupt nicht mehr verwendet werden.
In den letzten Jahrzehnten hat eine optimale Versorgung der Böden mit den benötigten Nährstoffen und der schonungsvolle Umgang der Landwirte mit den Hofdüngern zu einer starken Abnahme des Mineraldüngerverbrauchs geführt.So sank der Phosphorverbrauch in den Jahren 1996 bis 2000 um mehr als die Hälfte verglichen mit den vorangehenden Jahrzehnten.
Belastungen der Umwelt durch Nährstoffe können durch massvollen Gebrauch von Düngern,aber auch durch nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden, wie geeignete Fruchtfolge und Anbau von Bodendeckern,minimiert werden.Die neue Agrarpolitik hat massgeblich dazu beigetragen,dass die in der Landwirtschaft eingesetzte Düngermenge reduziert wurde.
Die Forschungsanstalt für Nutztiere (RAP) in Posieux führt die amtliche Kontrolle von Ausgangsprodukten,Futtermitteln und deren Produzenten gesamtschweizerisch durch. Sie überprüft Inhaltsstoffe sowie gewisse Eigenschaften von Futtermitteln analytisch und vergleicht die Ergebnisse mit der entsprechenden Kennzeichnung auf der Verpackung sowie den zugelassenen Ausgangsprodukten und Zusatzstoffen.Im Jahr 2002 wurden total 1’414 Proben untersucht,17% mehr als im Vorjahr.
Für kleine Fehler in der Deklaration von Futtermitteletiketten oder für Abweichungen im tolerierten Bereich zwischen dem deklarierten und analysierten Gehalt (z.B.Rohproteingehalt) werden hauptsächlich leichte Beanstandungen ausgesprochen.Mit 41% blieb dieser Anteil praktisch gleich wie im Vorjahr (42%).
Zu kostenpflichtigen Beanstandungen kam es in 13% der Fälle,im Vergleich zu 15% im Vorjahr.Bei diesen werden z.B.die tolerierten Bereiche überschritten oder die Etikettierung ist ungenügend.Solche Beanstandungen müssen innert nützlicher Frist behoben werden.
■ Kontrolle auf Tiermaterialrückstände
Bei schwerwiegenden Mängeln wird eine Strafanzeige eingereicht.Dies ist der Fall, wenn ein negativer Einfluss auf die Qualität der tierischen Lebensmittel Milch,Fleisch, Eier oder auf die Umwelt zu erwarten ist.Wie im Vorjahr wurden in 9 Fällen (0,6%) die Gerichte eingeschaltet.
Seit Anfang 2001 ist der Einsatz von tierischem Material auch in Futtermitteln für Schweine und Geflügel verboten.Im Rahmen des Leistungsauftrages der BSE-Einheit wurden Futtermittel vermehrt auf Tiermaterialrückstände kontrolliert.Von den 1’251 analysierten Proben des Jahres 2002 wiesen 19 entsprechende Verunreinigungen auf. Die Anzahl positiver Proben verringerte sich somit von 14% im Jahre 2000 auf 2,9% im Jahr 2001 und weiter auf 1,5% im Berichtsjahr.Die Futtermühlen konnten als Kontaminationsquellen für BSE weitgehend eliminiert werden.
■ Kontrolle auf GVO
Im Jahr 2002 wurden 254 Futtermittel auf das Vorhandensein gentechnisch veränderter Bestandteile untersucht.Gemäss der Liste der zugelassenen gentechnisch veränderten Ausgangsprodukte und Einzelfuttermittel (SR 916.307.11) gilt eine Kennzeichnungsgrenze von 3% für Einzelfuttermittel und 2% bei Ausgangsprodukten resp.Mischfuttermitteln.Drei Proben wurden beanstandet,ein Fall mehr als im Jahr 2001.In allen drei Fällen fehlte die entsprechende Deklaration.
■ Betriebskontrollen
Bei den Betriebskontrollen werden die Aktivitäten der Betriebe erfasst und es wird überprüft,ob sie den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen nachkommen und diese auch weiterhin erfüllen können.Darunter fallen Anforderungen an Räume, Einrichtungen und Verfahren,Hygiene und Sachkenntnis sowie die Buchführungspflicht und Abgabeberechtigung bei Zusatzstoffen und Vormischungen.Die Mehrheit der Betriebe erfüllt diese Anforderungen oder konnte sie im Verlaufe des Jahres in Ordnung bringen.
In 167 Getreidesammelstellen wurde zusammen mit den Kantonen,die für die Lebensmittelkontrolle zuständig sind,die Möglichkeit einer Kontamination zwischen Brotgetreide,Futtergetreide und Ölsaaten einerseits und Futtermitteln tierischer Herkunft andererseits abgeklärt.Gleichzeitig hat man Getreideproben gezogen und untersucht. In sieben Futtermittelproben aus sechs Betrieben wurden Spuren von tierischem Material festgestellt,worauf die Produkte zurückgerufen und vernichtet wurden.
Die Erhaltung einer eigenständigen Tierzucht in der Schweiz ist das wichtigste Ziel der staatlichen Unterstützung.Die Wertschöpfung der tierzüchterischen Tätigkeit soll im Inland erfolgen.Der Bund und die Kantone unterstützen die Züchterschaft in ihrem Bestreben für eine wirtschaftliche,qualitativ hochstehende und umweltgerechte Produktion mit einem jährlichen Beitrag von rund 39 Mio.Fr.

An erster Stelle stehen die Massnahmen zur Grundlagenverbesserung wie die Herdebuchführung,die Durchführung von Leistungsprüfungen,die Zuchtwertschätzung sowie die Programme zur Erhaltung der einheimischen Rassen.Die Beihilfen werden an die anerkannten Tierzuchtorganisationen ausgerichtet,welche damit ihren Züchtern die für eine erfolgreiche züchterische Tätigkeit notwendigen Dienstleistungen zur Verfügung stellen.
Ausgaben des Bundes für die Tierzucht 2002
■ Einfuhr von Zuchttieren und Rindersperma
Der Bund ist zuständig für die Bewirtschaftung der Zollkontingente sowie für die Einfuhr von Zuchttieren und Samen von Stieren.Die Zollkontingentsanteile für Zuchtpferde,Schweine,Schafe,Ziegen und Stierensamen werden nach dem Windhundverfahren an der Bewilligungsstelle zugeteilt,diejenigen für Zuchtrinder müssen hingegen seit dem 1.Januar 2001 ersteigert werden.Infolge der unsicheren Entwicklung der BSE in Europa wurde im Jahr 2001 und im ersten Halbjahr 2002 auf eine Ausschreibung der Zollkontingente verzichtet.Für das zweite Halbjahr 2002 wurden erstmals Kontingente für 600 Zuchtrinder ausgeschrieben.40 Personen reichten Gebote für insgesamt 1’256 Tiere ein.Der Zuschlagspreis lag im Mittel bei 175 Fr.Der Versteigerungserlös zu Gunsten der Bundeskasse betrug rund 105’000 Fr.Während die Nachfrage nach ausländischen Kleinvieh- und Zuchtpferderassen in den letzten Jahren rückläufig ist,bleibt das Interesse an ausländischem Rindersperma nach wie vor gross, wobei die Genetik aus den USA an erster Stelle steht.
■ Ausfuhr von Zuchtrindern
Seit 1996 konnten aufgrund der BSE-Situation keine Zuchtrinder mehr exportiert werden.BSE-Fälle in Deutschland und Frankreich und das Aufkommen der Maul- und Klauenseuche in verschiedenen EU-Ländern verschärften die Situation zusätzlich. Grosse Anstrengungen waren nötig,um das Vertrauen des Auslandes in unsere Rinderzucht neu aufzubauen.Ende 2001 hat Deutschland als erstes EU-Land die Grenzen für Schweizer Zuchtrinder wieder geöffnet.Anfangs 2002 sind weitere Länder diesem Beispiel gefolgt.Unter Einhaltung strenger Bedingungen konnten im vergangenen Jahr insgesamt 2’038 Tiere nach Deutschland,Frankreich,Irland,Polen und in den Kosovo exportiert werden.Nach wie vor geschlossen bleibt die Grenze nach Italien,das ehemals wichtigste Exportland für Schweizer Zuchtvieh.
■ Tiergenetische Ressourcen
Das seit 1999 von Bund und Kantonen mit Beiträgen unterstützte Konzept zur Erhaltung der Rassenvielfalt bei den landwirtschaftlichen Nutztieren in der Schweiz ist bereits zu einem grossen Teil umgesetzt worden und hat erste Erfolge gezeigt.Im Jahr 2002 hat eine breitgefächerte Arbeitsgruppe im Auftrag des BLW zuhanden der FAO die heutige Situation der tiergenetischen Ressourcen ein weiteres Mal analysiert und bewertet und aufgezeigt,in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht.Neben den bereits laufenden rassenspezifischen Erhaltungsprogrammen sind in Zukunft vermehrt Strategien zu entwickeln,die die Biodiversität unserer Nutztiere auch langfristig sicherstellen.Im Vordergrund stehen Projekte wie die Schaffung einer nationalen Genbank und die bessere Vermarktung von rassenspezifischen Produkten.
■ Rechenschaftsablage im Berichtsjahr
Die Sektion Finanzinspektorat gliedert sich in die Bereiche Finanzinspektorat (Interne Revision) und Feldkontrolle.Das Inspektionsprogramm des Finanzinspektorates wird mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle abgestimmt und koordiniert,damit Überschneidungen und Doppelspurigkeiten vermieden werden können.
Im Berichtsjahr wurden folgende Revisionstätigkeiten vorgenommen:
–Umfangreiche externe Revisionen bei zehn Leistungsempfängern resp.Subventionsempfängern und deren ausführende Beauftragte;
–BLW-interne Revision von einer Sektion;
–Periodische Belegkontrollen im Amt inkl.Forschungsanstalten und Gestüt; –Abschlussrevisionen bei neun Subventionsempfängern.
Die BLW-externen und -internen Prüfungen führten gesamthaft zu guten Resultaten. Generell werden die öffentlichen Mittel zweckmässig und zielgerichtet eingesetzt.Die dafür eingesetzten Führungs- und Steuerungsinstrumente sind in vielen Fällen angemessen und effizient.Bei einem Leistungsempfänger musste die fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Aufzeichnungen bemängelt werden.Soweit notwendig wurden Empfehlungen zur Weiterentwicklung der bestehenden Internen Kontrollsysteme abgegeben und mit den betroffenen Instanzen diskutiert.
Die Ergebnisse der durchgeführten Abschlussrevisionen sind generell gut,die Unterschiede in der Qualität der Aufzeichnungen sind jedoch recht gross und teilweise mussten Mängel beanstandet werden.Die Ordnungs- und Rechtmässigkeit konnte dennoch,mit einer Ausnahme,überall bestätigt werden.Wünschenswert wäre eine nähere Begleitung der Projekte durch das Amt.Damit können die Projektarbeiten und die erbrachten Leistungen angemessen beurteilt und nötigenfalls Änderungen eingeleitet werden.
DerwirtschaftlicheRessourceneinsatzmussauchimFinanzinspektorateinprioritäres Zielsein.DieErarbeitungundAnwendungvonangepasstenArbeitsinstrumenten, welchedieEffizienzundWirksamkeitdieserArbeitoptimierenunddenrevisionstechnischenAnforderungengenügen,istdeshalbangezeigt.DerAufbaueineszweckmässigenHandbuchesstütztsichdabeihauptsächlichaufdiebestehendennationalenund internationalenGrundlagenderRevision.
DieInspektorendesBereichsFeldkontrolleführenKontrollen,Abklärungen,ErmittlungenundUntersuchungeninallenBereichenderlandwirtschaftlichenGesetzgebung vonProduktionundAbsatzbzw.fürdieFachstellendesBLWdurch.ImJahr2002 wurden1003KontrollendurchdieseEquipedurchgeführt.DiesePrüfungenfandenin denfolgendenBereichenstatt:
Milch-undMilchproduktemit778Kontrollen;
– Acker-undFutterbaubereichmit64Kontrollen;
– Gemüse,Obst,SchnittblumenundObstkonzentratmit132Kontrollen;
– FleischundEiermit26Kontrollenund1Abrechnungskontrolle;
– VerarbeitungsprodukteauslandwirtschaftlichenErzeugnissenmit2Kontrollen.
BeidenimBereichMilch-undMilchproduktedurchgeführtenKontrollenwurdenin 24%allerFälleUnregelmässigkeitenfestgestellt.Dabeihandelteessichindenmeisten FällenumkeineschwerwiegendenTatbestände,diezugrösserenErmittlungenund Untersuchungengeführthätten.Meistensmussteeineunvollständigeoderfehlerhafte Buchführungbeanstandetwerden.Eszeigtesichjedoch – geradeinderheutefürviele Betriebeschwierigen,durchknappeRessourcengeprägtenZeit,immerkleinerwerdendenMargenundunsicherenZukunftsperspektiven – wiewichtigdieKontrollenund derenpräventivenCharaktersind.
ImBereichderDomizilkontrollenvonfrischenFrüchtenundGemüsewurdeninetwas mehralsderHälfteallerKontrollenVerfehlungenbeanstandet.Sanktioniertwerden mussten21ImporteurefürFalschangabenbeimLagerbestandundvierImporteurefür FalschmeldungenbeidenInlandleistungen.
Inden übrigenBereichengabendieKontrollenundBeanstandungenzukeinenbesonderenBemerkungenAnlass.
Abklärungen,UntersuchungenundBefragungenimZusammenhangmitWiderhandlungengegendieLandwirtschaftsgesetzgebungwerdeninZusammenarbeitmit eidgenössischen,kantonalenundkommunalenUntersuchungsbehörden,mitprivaten OrganisationenundanderenRechtshilfestellenvorgenommen.ImBerichtsjahrwurden 21WiderhandlungsfälleeröffnetundzurBearbeitungweitergeleitet.Gesamthaft wurden30Fälledefinitiverledigt.DieStatistikpräsentiertsichdabeiwiefolgt:
OffeneFälleper31.12.200112
ImBerichtsjahreröffneteFälle21
ImBerichtsjahrweitergeleiteteodervonderSFIdirekterledigteFälle30
OffeneFälleper31.12.20023
UmdenBereichFeldkontrollefürdiezukünftigenEntwicklungenvorzubereiten,hat dasBLWdieAkkreditierungdesMilchstützungsbereichsalserstesZielvorgegeben.Die entsprechendenVorbereitungsarbeitensindimOktober2002soweitvorangeschritten, dasseinentsprechenderAntragandieSchweizerischeAkkreditierungsstelle(SAS)des BundesamtesfürMetrologieundAkkreditierung(metas)gestelltwerdenkonnte.Es wurdeeineProjektleitungbestimmtdiedasZielhat,diesbisEnde2003abzuschliessen.
Am20.Juni2003hatdasParlamentdieBotschaftzurWeiterentwicklungderAgrarpolitik(Agrarpolitik2007)zuEndeberatenunddamitÄnderungeninsechsBundesgesetzensowiedenBundesbeschlussüberdiefinanziellenMittelfürdieLandwirtschaftindenJahren2004–2007verabschiedet.DieGesetzesänderungenwerdenauf den1.Januar2004inKrafttreten.MitderAgrarpolitik2007wirddermitderAgrarpolitik2002eingeschlageneWegkonsequentweiterverfolgt:TrennungderPreis-und EinkommenspolitikunddieVerwirklichungderökologischenAnliegendurchökonomischeAnreize.ImZentrumderAgrarpolitik2007stehtdieVerbesserungderWettbewerbsfähigkeitderSchweizerLand-undErnährungswirtschaft.Nachfolgendwerden diewichtigstenErgebnissederAgrarpolitik2007kurzdargestellt.
DerAusstiegausderMilchkontingentierungistaufden1.Mai2009terminiert.Biszu diesemZeitpunktbleibtdieöffentlich-rechtlicheMilchmengenregulierunggrundsätzlichbestehen.ErsteFlexibilisierungsschrittesindbereitsvorhermöglich.GemässArtikel 31LwGkönnenz.B.einzelneKäseorganisationendieMilchmengeihrerProduzenten mittelsAntragandenBundesraterhöhen.EinweitererFlexibilisierungsschrittistdie AusstiegsoptiongemässAbsatz2inArtikel36aLwGfürOrganisationenmiteinem eigenenMengenmanagement.Produzentenorganisationenkönnen,zusammenmit einembedeutendenregionalenVerwerterundmiteinerBranchenorganisationabdem 1.Mai2006frühzeitigausderöffentlich-rechtlichenKontingentierungaussteigen.Um dieoffenenFragenderAufhebungMilchkontingentierungrechtzeitigzuklären,wird dasEVDimJahr2005einenMilchberichtveröffentlichen.
Etappen des Ausstiegs aus der Milchkontingentierung
AutonomeFestlegungderMengen (Art. 31 Abs. 2 LwG)
Branchenorganisationen
VollzugBund
Art. 36a Abs. 2 LwG Kontingentierung aufgehoben
Organisationenmiteigenem Mengenmanagement
Branchenorganisationen
-UnterstützungSanktionierung Branchenorganisationen Produzentengemeinschaften regionaleMilchverwerter Art. 36b LwG
-Vertragspflicht -Angebotsbündelung
■ Versteigerung der Fleischimportkontingente
DamitnachdemÜbergangzudenprivatrechtrechtlichenMengenregulierungen weiterhingeordneteMarktverhältnisseherrschen,hatdasParlamentbis2012befristeteLeitplankengemässArtikel36bLwGbeschlossen.DazugehörtdieMindestdauer voneinemJahrfürMilchkaufverträgeunddieMöglichkeit,beimBundesratdie AllgemeinverbindlichkeitvonSanktionenbeiVertragsverletzungenzubeantragen.
MitdergeplantenAufhebungderMilchkontingentierungwirdauchderZielpreisfür Milchaufgehoben.ErhattebishernureinegeringeBedeutung,dasichderBundaus denMärktenschrittweisezurückziehtunddieVerantwortungdenMarktpartnern überlässt.
DieFleischimportkontingentewerdenheuteaufGrundeinerimVorauszuerbringendenInlandleistungverteilt.DasParlamenthatbeschlossen,ab2004diesesSystem schrittweiseabzulösendurcheineVersteigerungderZollkontingentsanteilefür SchlachtviehundFleisch.DamiterhaltenkünftigalleMarktakteureZugangzuImportrechten.
DamitderViehabsatzausdemBerggebietweiterhingewährleistetwerdenkann,gibt esfürViehkäufeaböffentlichenMärktenImportrechte.10%Zollkontingentsanteilefür FleischvonRindviehundSchafenwerdenaufgrundderZahlderabüberwachten ViehmärktenersteigertenTierezugeteilt.DiesesZugeständnisansBerggebiethat wesentlichzurAkzeptanzderVersteigerungbeigetragen.
■ Förderung der Wertschöpfung im ländlichen Raum
ImBerggebietkönnenab2004gemeinschaftlicheBautenmitBeiträgenunterstützt werden,diezurVermarktungvoninderRegionerzeugtenProdukteselbsterstellt werden.PauschaleBeiträgegibtesneuandieperiodischeWiederinstandstellungvon Bodenverbesserungen.
Investitionskreditekönnenab2004auchfürdieDiversifizierungderTätigkeiteninder LandwirtschaftundinlandwirtschaftsnahenBereichenausgerichtetwerden.InvestitionskrediteinFormeinerStarthilfekönnenneuauchfürdenAufbauvonbäuerlichen Selbsthilfeorganisationengewährtwerden,welchesichimBereichdermarktgerechten Produktionengagieren.DasParlamenthatzusätzlichzudenVorschlägendesBundesratesauchdiegesetzlicheBasisgeschaffenfürInvestitionskreditemitdenenProjekte zurregionalenEntwicklungundzurFörderungvoneinheimischenundregionalen Produkten,andenendieLandwirtschaftvorwiegendbeteiligtist,unterstütztwerden können.
■ Soziale Begleitmassnahmen
ZusätzlichzurbisherigenBetriebshilfefürunverschuldetinNotgerateneBewirtschafterwerdendieneueUmschuldungsmöglichkeit,dieUmschulungsbeihilfenfür ausstiegswilligeBäuerinnenundBauernsowieeineAnpassungderLiquidationsgewinnbesteuerungdenVeränderungsprozesssozialflankieren.Letzterewarnicht direktGegenstandderAgrarpolitik2007.GeplantistdiesezusätzlicheErleichterung desAusstiegsausderLandwirtschaftimRahmenderUnternehmenssteuerreform.Die EinführungeinerBetriebsaufgaberentehatdasParlamentabgelehnt.
■ Vorsorgeprinzip gesetzlich verankert

DasRisikomanagementwirdzueinemzentralenElementfürdieAgrarwirtschaft.Wie diejüngstenErfahrungengezeigthaben,istdieNahrungsmittelsicherheitalsProzessüberwachungzuverstehen,diebeimEinsatzderProduktionsmittelaufdemLandwirtschaftsbetriebbeginntundalsNahrungsmittelimLadenendet.
DieNahrungsmittelsicherheitwirddurchdiegesetzlicheVerankerungderProduktesicherheitalsGrundsatzimzweitenundsiebtenTiteldesLwGsowiedurchdie AnpassungenimBereichderProduktionsmittelwieVorsorgemassnahmen,Herstellungs-undVerwendungsvorschriften,durchdieEinsetzungeinerZentralstellefürdie ErmittlungvonZuwiderhandlungenunddurchdasTierseuchengesetzvom1.Juli1966 (TSG),SR916.40(vgl.TeilIVderBotschaft)unterstützt.IndiesemKontextsinddie zuständigenBehördenbestrebt,denVollzugderMassnahmenüberdieverschiedenen BundesgesetzehinwegzuoptimierenunddieKommunikationzuverstärken.
VorsorglicheMassnahmenkönnenbeschlossenwerden,wenneinehoheWahrscheinlichkeitbesteht,dassdieGesundheitvonMensch,TierundPflanzenoderdieUmwelt gefährdetist.Siesindzubefristenunddürfennurangeordnetwerden,wenndie Risikohypothesenwissenschaftlichplausibelsind.
MitderAgrarpolitik2007wirddieMöglichkeit,vorsorglicheMassnahmenzuergreifen, imGesetzklarfestgelegt.AufnationalerundinternationalerEbenegaltbisherdas VorsorgeprinzipvorallemaufdemGebietdesUmweltschutzes.ImZugederBSEProblematikwurdedieBefolgungdiesesGrundsatzesvondenKonsumentenimmer häufigerauchimZusammenhangmitderProduktionvonNahrungs-undProduktionsmittelngefordert.
■ Weitere Anpassungen DasParlamenthateinerFlexibilisierungderButterimportregelungzugestimmt.Der KreisderButterimporteurekanngeöffnetwerden.DieVerteilungderZollkontingentsanteileistnichtmehraufdieButterproduzenten,Schmelzkäsefabrikantenunddie Nahrungsmittelindustriebeschränkt.SolangedieImporteurediemarktregulierende Ventilfunktionwahrnehmen,beabsichtigtderBundesratdasbisherigeVerteilsystem beizubehalten.
Produzenten-undBranchenorganisationenkönnenneuaufnationaleroderregionaler EbeneRichtpreisebestimmen,aufdiesichdieLieferantenundAbnehmergeeinigt haben.EineinzelnesUnternehmendarfjedochnichtzurEinhaltungdieserRichtpreise gezwungenwerden.GegenüberdenBestimmungenimKartellgesetzwirddenlandwirtschaftlichenOrganisationeneinSonderrechtzugestanden,dasindenparlamentarischenBeratungenunbestrittenwarundangesichtsderhäufigasymmetrischen Marktverhältnissegerechtfertigtist.
ZurAnpassungdesAngebotsandieErfordernissedesMarkteswerdenimObst-und WeinbauUmstellungsbeiträgebefristetbis2011ausgerichtet.DieseUnterstützung erhaltenimObstbaunurkollektive,voneinerProduzentengruppierungvereinbarte Massnahmen.GefördertwirddieUmstellungaufinnovativeKulturenoderfrüh-bzw. spätreifeSortenmitgutenMarktchancen.
BeidenDirektzahlungenhatdasParlamentdieAbstufungnachFlächeundTierzahl aufgehoben.DieEinkommens-undVermögensgrenzenbleiben,entgegendenbundesrätlichenVorschlägen,erhalten.FürverheirateteBewirtschafterinnenundBewirtschafterwurdendiebereits2001aufVerordnungsstufeeingeführtenhöherenGrenzen imGesetzverankert.
■ Parlament heisst Finanzrahmen 2004–2007 gut
GleichzeitigmitdenGesetzesänderungenhatdasParlamentdiedreiZahlungsrahmen fürdieLandwirtschaftfürdienächstenvierJahreverabschiedet.Neuerhältder BundesratdieMöglichkeit,infolgevonneuenWTO-Verpflichtungen,Mittelausder MarktstützungindieDirektzahlungenumzulagern.KonkretwurdenochkeineUmverteilungbeschlossen.
Zahlungsrahmen für die Jahre 2004–2007
20042005200620072004–072000–03
Grundlagenverbesserung
undSozialmassnahmen27628028428911291037
ProduktionundAbsatz76974972070829463490
Direktzahlungen2487249225002538100179502
Total35323521350435351409214029
MitderBotschaftvom2.Juli2003zumEntlastungsprogramm2003beantragteder BundesrateineKürzungderZahlungsrahmeninderHöhevon40Mio.Fr.für2004, 110Mio.Fr.für2005und160Mio.Fr.ab2006.DamitwürdederStrukturwandelvon geschätzten2,5%bis3%aufgegen4%proJahransteigen.
■ Massnahmen gegen die Folgen der Trockenheit
DieTrockenheitunddasEntlastungsprogrammzurSanierungderBundesfinanzen warenimJahr2003Themen,welchedieLandwirtschaftstarkbeschäftigten.Im FolgendenwirdkurzaufdieBeschlüssezudenbeidenThemenbereicheneingegangen.
Seit1976istdieTrockenheitniemehrsoausgeprägtgewesenwiediesenSommer–insbesondereindenRegionenJura,Seeland,Aargau,GraubündenundTessin.GesamtschweizerischfielenimAugustgerade20bis50%dernormalenNiederschläge;im Sommerfielinsgesamtnur45bis65%derlangjährigen,durchschnittlichenRegenmenge.DiemittlereTemperaturimSommererreichteindenNiederungen21bis23 GradCelsius,imSüden24,5GradCelsius.JenachOrtlagsiedamitvierbissechsGrad CelsiusüberdemlangjährigenDurchschnitt.
DieanhaltendeTrockenheithatteindenmeistbetroffenenGebietensowohlimAckerbaualsauchbeiderFutterproduktionzumTeilerheblicheErtragsausfällezurFolge.In einigenRegionenwardasFutteraufkommennichtmehrausreichend,umdieTierezu füttern.IndieserSituationmussteFutterzugekauftwerdenodereswurdenTiere geschlachtet.DieTrockenheitdürfteauchdiewirtschaftlichenErgebnissedesJahres 2003negativbeeinflussen.DieSchätzungendesBFSfürdiewirtschaftlichenErgebnissedesGesamtsektorsimJahr2003zeigen,dassdieErlösebeimPflanzenbautiefer ausfallenals2002.AufderKostenseiteistderFutterzukaufhöherundauchdieKosten fürdieBewässerungwerdenzuBucheschlagen.
ZurMilderungderAuswirkungenderTrockenheitwurdenimLaufedesJahres2003 eineGanzeReihevonMassnahmenergriffen.
–Aufden1.August2003wurdedieGrenzabgabefürHeuum6Fr.je100kggesenkt. Aufden1.September2003wurdesieaufNullgesetzt.
–DerGrenzschutzfürFuttergetreideundproteinhaltigeFuttermittelwurdeaufGrund derhöherenImportpreisefürdieseProdukteinzweiSchrittennachuntenangepasst.
–Am21.August2003wurdendieZölleaufGrassiloballenundSilomaisaufgehoben.
–Am26.September2003hatderBundesratentschieden,dassdieReduktionder DirektzahlungenaufGrundtiefererTierbeständealsFolgederTrockenheitinbegründetenFällenimJahr2004teilweiseausgeglichenwird.
–FürdieBergzonenIIIundIVwurdederSchnittzeitpunktfürdieextensivenund wenigintensivenWiesenumzehnTagevorverlegt.
–DieKantonekonntendieBeweidungvonextensivundwenigintensivgenutzten WiesensowievonRotationsbrachenerlauben.AufSömmerungsbetriebenwares möglich,denNormalbesatzinbegründetenFällenzuüber-oder–betreffendDauer –unterschreiten.ZudemdurfteaufdenAlpenauchzugekauftesFutterverwendet werden.
–DerSchnittzeitpunktfürStreueflächenvom1.Septemberwurde,sofernnichtabweichendevertraglicheRegelungenmitdemKantonbestehen,am19.August2003 aufgehoben.
–DieRegelungbezüglichhöhererGewaltgemässArtikel15derDirektzahlungsverordnungkonnteangewendetwerden,wenndieAnforderungendesÖLNwegen derTrockenheitnichterfülltwerdenkonnten.LandwirtemusstendiesdemkantonalenLandwirtschaftsamtmitteilenunddokumentieren.
–IndenbetroffenenRegionenwurdedenBio-Betriebenerlaubt,anstattnur10%bis maximal40%konventionellesRaufutterzuzukaufen.
Investitionskredite und Betriebshilfe
–FürHärtefällewaresmöglich,dasInstrumentderBetriebshilfeeinzusetzen.
–Am26.September2003hatderBundesratentschieden,dasszurÜberbrückung gravierenderLiquiditätsschwierigkeitenBetriebshilfedarlehenmiteinemvereinfachtenVerfahrenausgerichtetwerden.
–DieRückzahlungvonInvestitionskreditenkonntehinausgeschobenwerden.
Verschiedene Massnahmen
–FürdieMilchproduzentenwurdedieMöglichkeitgeschaffen,mehrals5’000kgim nächstenMilchjahrnachzuliefern,wennsieihreKontingenteimlaufendenMilchjahr nichtausschöpfen.
–DasBLWsahbeiderbefristetenÜbertragungvonMilchkontingentenvomBerg-ins TalgebietsowiebeiderErteilungvonZusatzmilchkontingenteninbegründeten FälleneinfacheAusnahmeregelungenvor.Diesewurdenangewandt,wennTiere vorzeitigdieAlpenverlassenodervomBerg-insTalgebietverstelltwerdenmussten. –DieArmeeübernahmdenTransportvonWasseraufAlpen,dievonderTrockenheit betroffenwaren,undsiebeteiligtesichauchbeidenHeutransporten.
–MitfinanziellenMittelndesBundeswurdeKuhfleischeingelagert.Damitkonnten diePreisefürdieSchlachtkühestabilisiertwerden.
ZuBeginndesJahres2003wurdeklar,dassbeimFinanzhaushaltdesBundesohne GegenmassnahmeninkurzerZeiteinegrosseLückezwischenEinnahmenund Ausgabenentstehenwürde.DerBundesrathatam2.Juli2003dieBotschaftzum Entlastungsprogramm2003fürdenBundeshaushaltverabschiedet.Darinschluger Massnahmenvor,umdasAusgabenwachstummarkantzureduzieren.Gemessenam Finanzplanvom30.September2002würdeesimJahr2006Verbesserungenvon knapp3,3Mrd.Fr.bringen.
■ Auswirkungen
DieLandwirtschaftwurdevondenSparmassnahmennichtausgenommen.DieVorschlägedesBundesratesergebengegenüberdemFinanzplan2004–2006vom30.September2002erheblicheDifferenzen.
Entlastungsprogramm 2003:Kürzungen in der Landwirtschaft
Bereich2004200520062007 Mio.Fr.
Struktur-,Sozialmassnahmen28,519,448,548,5 Marktstützung10,038,048,048,0 Direktzahlungen–50,057,057,0 Verwaltung,Forschung1,52,66,56,5 Total40,0110,0160,0160,0
FürdenvierjährigenZeitraumvon2004bis2007ergibtsicheineReduktionvoninsgesamt470Mio.Fr.DamitwürdendievomParlamentam5.Juni2003beschlossenen finanziellenMittelfürdieZahlungsrahmen2004bis2007nicht14,092Mrd.Fr. betragen,sondernauf13,639Mrd.Fr.begrenzt.FürdasJahr2004schlugder BundesratimRahmendesBudgetausserdemeinezusätzlicheKürzungvon28Mio.Fr. vor.InsgesamtwürdesichdamitdieKürzungfürdasJahr2004auf68Mio.Fr. belaufen.
DasParlamenthatdasEntlastungsprogramm2003inderHerbstsessionberaten. ObwohlesnocheineDifferenzzwischenNational-undStänderatgibt,istbereitsklar, dassderSparbeitragderLandwirtschaftgeringerausfallenwirdalsderBundesrat vorgeschlagenhat.DieDifferenzbereinigungfindetinderWintersessionstatt.
DieEntlastungsmassnahmenbeiderGrundlagenverbesserungunddenSozialmassnahmenwerdendiefinanziellenMöglichkeitenderLandwirtereduzieren,dieStrukturenundInfrastrukturenandieneuenErfordernisseanzupassen:DieSparmassnahmenbeeinträchtigendasRationalisierungspotenzialunddieMöglichkeitenzur SenkungderProduktionskostenunddamitdieWettbewerbsfähigkeit.BeiderMarktstützungwerdendieKreditkürzungen2006fürdieLandwirteeinenunmittelbaren Einnahmenverlustvonrund63Mio.Fr.verursachen.EtwadreiVierteldavon,also 48Mio.Fr.,würdedabeiaufdieMilchwirtschaftentfallen.BeidenDirektzahlungensoll bis1.Januar2008aufdieAufhebungderAbstufungenverzichtetwerden.
InsgesamtwerdendieKürzungeneinedirekteVerminderungderEinnahmenfürdie LandwirtschaftsbetriebezurFolgehaben.FürdasJahr2006wirdmit120Mio.Fr. gerechnet.DamitwirdsichderDruckaufdenLandwirtschaftssektorweitererhöhen. UmdieEinbussenauszugleichenunddieEinkommennominalhaltenzukönnen, müsstederStrukturwandeldeutlichhöheralsheutesein.Diesistabereherunwahrscheinlich.ImDurchschnittallerBetriebeistdahervoneinemnominalen Einkommensrückgangauszugehen.

Die Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen betreffen die Landwirtschaft in zunehmendem Masse.Auf globaler Ebene ist die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk der WTO eingeflochten.Angesichts der geographischen Konzentration des Agrarhandels sind die vertraglichen Beziehungen zur EU und die zunehmende Integration in Europa für die Schweizer Landwirtschaft von grösster Bedeutung.
Um ihre Exportmöglichkeiten zu erhalten und verbessern,ist die Schweiz auf einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten angewiesen.Die Schweiz setzt sich zudem auf internationaler Ebene stark dafür ein,dass die multifunktionalen Eigenschaften der Landwirtschaft in den internationalen Abkommen stärker berücksichtigt werden.
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung und behandelt die internationalen Themen im dritten Kapitel.
–Abschnitt 3.1 enthält Informationen über internationale Organisationen,namentlich die WTO,die OECD und die FAO.Im Weiteren wird der aktuelle Stand im Europadossier und bei den Freihandelsabkommen sowie eine Zusammenfassung der Beschlüsse des EU-Agrarministerrats vom 26.Juni 2003 über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorgestellt.
–In Abschnitt 3.2 geht es um internationale Vergleiche.Im vorliegenden Bericht werden die im Jahr 2000 begonnenen internationalen Preisvergleiche fortgeführt.
Die Schweizer Landwirtschaft und insbesondere das Preisniveau für Agrarprodukte in der Schweiz hängen stark mit der Höhe des Grenzschutzes zusammen.Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnet,dass 75% des bäuerlichen Rohertrages in der Schweiz den kombinierten Auswirkungen des Grenzschutzes,der Exportsubventionen,der Marktstützung im Inland und der Direktzahlungen zuzuschreiben sind.Mit dieser Zahl aus dem Jahr 2002 steht die Schweiz erneut an der Spitze aller OECD-Länder in Bezug auf die Unterstützung ihrer Landwirtschaft.
Die Entwicklungen im internationalen Bereich haben im Berichtsjahr keine spürbaren Auswirkungen auf den Handel mit Agrarprodukten und auf die Inlandproduktion gebracht.
–Das Agrarabkommen Schweiz-EU vom 21.Juni 1999 ist zwar zusammen mit den sechs anderen Sektorabkommen am 1.Juni 2002 in Kraft getreten.Dessen Kernstück,der uneingeschränkte Handel mit Käse,wird jedoch seine Auswirkungen erst innerhalb von fünf Jahren entfalten.

–Die WTO-Agrarverhandlungen wurden gemäss dem Ministermandat von Doha (November 2001) weitergeführt,ohne aber wie vorgesehen im März 2003 zu ersten Ergebnissen zu führen.
–Ein Freihandelsabkommen wurde mit Chile vereinbart,nach Mexiko dem zweiten lateinamerikanischen Land.Das Agrarvolet enthält jedoch keine Konzessionen,welche wesentlich über die bisher in solchen Abkommen gemachten hinausgehen.
–Eine erste Zollreduktion als Schritt zu Nullzöllen für die ärmsten Entwicklungsländer hat ebenfalls noch keine Auswirkungen gezeitigt.Dies könnte sich mit der für 2004 vorgesehenen zweiten Etappe ändern,nämlich wenn die genannten 49 Länder dank dieser Zollreduktionen gewisse Produkte preisgünstiger als die heutigen Lieferländer anbieten können.
Mittelfristig muss in allen diesen Dossiers mit einer progressiven Reduktion des heutigen Grenzschutzes gerechnet werden.
Am 1.Juni 2002 traten die sieben bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EG,die «Bilateralen I» in Kraft.Das Agrarabkommen erleichtert den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der Schweiz und der EU durch den Abbau von Zöllen und die Aufhebung nichttarifarischer Handelshemmnisse (z.B.Gleichwertigkeit phytosanitarischer Bestimmungen,Mindestqualitätsnormen,Tierschutznormen).Es bietet der Schweiz einen einfacheren Zugang zu ihrem wichtigsten Exportmarkt in jenen Bereichen,in denen sie traditionell Stärken aufweist,wie Käse und gewisse Früchte und Gemüse.
Nach einem Jahr ist es noch verfrüht,zum Abkommen definitiv Bilanz zu ziehen,vor allem auch weil der Zollabbau beim Käse auf fünf Jahre angelegt ist.Die Export- und Importvolumen erfuhren weder bei Obst und Gemüse noch beim Käse wesentliche Änderungen.Der Handelsüberschuss der Schweiz gegenüber der EU im Schlüsselbereich Käse blieb mit rund 10 Mio.Fr.monatlich auf dem üblichen Niveau.
Die Umsetzung des Agrarabkommens verläuft zurzeit,abgesehen von einigen Startschwierigkeiten,zufriedenstellend.Obwohl verschiedene Fragen noch hängig sind, möchte die EU aufgrund der Entwicklungsklausel bereits eine neue Liberalisierungsetappe des Agrarhandels angehen.Aus schweizerischer Sicht kommt dies solange nicht in Frage,als das Abkommen – inkl.BSE-Bestimmungen – noch nicht vollständig umgesetzt und das neue Abkommen über landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte (Aktualisierung des Protokolls 2 des Freihandelsabkommens von 1972) noch nicht ratifiziert ist.
Die Konzessionen im Fleischhandel werden erst in Kraft treten können,wenn Italien und Österreich ihr im Zusammenhang mit BSE verhängtes Importverbot für Lebendvieh aufheben.Der Viehhandel,der in Folge des Rinderwahnsinns 1997 praktisch zum Erliegen kam,hat seit 2002 wieder etwas angezogen.Dies ist jedoch nicht dem bilateralen Agrarabkommen zuzuschreiben,sondern dem kurz zuvor von Frankreich und Deutschland gefällten Entscheid,das Einfuhrverbot für Lebendvieh aufzuheben.Die Schweiz hofft,dass bis Ende 2003 eine Lösung für die BSE-Frage gefunden wird.
Der Gemischte Veterinärausschuss hat mit der Abschaffung der Milchzertifikate an seiner Sitzung vom 30.April 2003 einen weiteren Schritt zur Beseitigung von Handelshemmnissen getan.Dadurch werden schweizerische Milchprodukte künftig denen der EU gleichgestellt,was für die Käseausfuhr einen beträchtlichen Vorteil bringt.Inwieweit die durch die Öffnung des europäischen Markts gebotenen Chancen wahrgenommen werden können,hängt jedoch von der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Produzenten und der Verarbeitungsindustrie ab.
Es zeigt sich in der Praxis,dass die Schweizer Exporteure die von der EU zugestandenen zollfreien Importquoten nur zaghaft nutzen.Die Nutzungsrate beträgt für Rahm und Joghurt lediglich 65%.Bei den neuen Zollkontingenten gewisser Käsesorten liegt sie sogar bei ungefähr 20%.Die schwache Ausnützung der Exportkontingente lässt sich teilweise durch noch bestehende nichttarifarische Schranken erklären.So gelten z.B. die komplizierten Verfahren der EU zur Erteilung von Exportlizenzen weiterhin.Hauptursache ist indes die durch die Preise in der schweizerischen Landwirtschaft und
■ Arbeiten im Rahmen des Gemischten Agrarausschusses
Verarbeitungsindustrie bedingte mangelnde Wettbewerbsfähigkeit.In dieser Hinsicht hat der starke Zollabbau nur geringe Auswirkungen.Die schweizerische Landwirtschaft sowie die vor- und nachgelagerten Bereiche müssen ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem europäischen Markt verstärken.
Der Gemischte Ausschuss für Landwirtschaft Schweiz – EU evaluiert die Umsetzung und Funktionalität des Agrarabkommens.Er trat unter dem Vorsitz der Schweiz am 11.Juni 2003 zu seiner zweiten Sitzung in Bern zusammen.Dabei wurden insbesondere die Resultate aus den Arbeiten der zehn vom Ausschuss eingesetzten Arbeitsgruppen vorgestellt.Auf Wunsch der Schweiz wurden zwei Kernthemen auf die Tagesordnung gesetzt.Zum Ersten ging es um den Schutz der geografischen Angaben (GUB/GGA). Die Schweiz möchte möglichst schnell Verhandlungen mit der EU im Hinblick auf die Erstellung einer Liste gegenseitig anerkannter GUB/GGA aufnehmen.Dieses Ziel wurde bereits in einer gemeinsamen Erklärung im Anhang des Abkommens festgelegt; nun geht es um seine Verwirklichung.Zum Zweiten hob die Schweiz ihre Anliegen im Bereich der biologischen Produktion hervor.Hier soll dafür gesorgt werden,dass die im Abkommen vorgesehenen Vorteile in der Praxis zum Tragen kommen.Weiter verwies die Schweiz auf die administrativen Probleme,die bei der Zuteilung der Käsekontingente zu ihren Gunsten noch bestehen.
■ Auswirkungen der EU-Erweiterung auf die schweizerische Landwirtschaft
Die Aussenminister der 15 Mitgliedstaaten legten am 18.November 2002 in Brüssel das offizielle Datum für den Beitritt von zehn Ländern Mittel- und Osteuropas auf den 1.Mai 2004 fest.Es handelt sich dabei um die so genannten «MOEL-10»:Estland, Lettland,Litauen,Malta,Polen,die Slowakei,Slowenien,Tschechien,Ungarn und Zypern.
Die Erweiterung birgt für die schweizerische Landwirtschaft neue Chancen (Exporte) und Risiken (Preissenkung).
Die an der Schweizer Grenze erhobenen Zölle für Einfuhren landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse aus den MOEL-10 (vor allem Fleisch,Getreide und Gemüse aus Ungarn) werden nach dem EU-Beitritt dieser Länder zumeist unverändert bleiben oder gar erhöht;ausgenommen sind in gewissen Fällen Produkte,für welche im Agrarabkommen Schweiz-EU reduzierte Zölle vorgesehen sind (Trockenfleisch,Gemüse zu bestimmten Jahreszeiten).Ein potenziell wichtiger Sonderfall ist die gemäss Abkommen für 2007 vorgesehene völlige Aufhebung der Zölle für Käse.Wie es für die jetzigen EU-Mitgliedländer gilt,könnten Käse aus den MOEL-10 (sogar «Swiss Emmental», Tilsiter usw.) direkt (inkl.für die Verarbeitung bestimmte Käse) oder indirekt (z.B.in Deutschland verarbeitete MOEL-Milch) zollfrei in die Schweiz eingeführt werden, während beispielsweise der Zoll für Emmentaler (0406.9099) heute noch 315 Fr.pro 100 kg brutto beträgt.In Tschechien und der Slowakei lag der Produzentenpreis ab Hof 24% (2000) bzw.40% (1999) unter demjenigen in Österreich,der seinerseits im Jahre 2001 (49.95 Fr./100 kg) 37% niedriger war als der schweizerische Preis (79.90 Fr./100 kg).Das Problem wird jedoch erst akut,sobald die MOEL-10 in der Lage sein werden (Strukturen,Know-how,Schwerfälligkeiten aus der Sowjetzeit,wenig wettbewerbsfähige Verarbeitungs- und Vermarktungsindustrie) mehr auszuführen als aus der Schweiz einzuführen.Der Rohstoffpreis ist für die Wettbewerbsfähigkeit nicht allein bestimmend.
Für schweizerische Agrarerzeugnisse werden sich neue Exportmöglichkeiten erschliessen (Käse,Trockenfleisch,Joghurt usw.),indem ein Markt mit einer höheren Wachstumsrate als im Durchschnitt der EU-15 und mit 105 Mio.Konsumentinnen und Konsumenten geöffnet wird.Die Zölle beider Parteien (CH und MOEL-10) für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte (Biscuits,Schokolade) werden unverändert bleiben,weil das Protokoll 2 des Freihandelsabkommens (FHA) mit der EG und das Protokoll «A» des FHA mit dem MOEL-10 gleichwertig sind.Die schweizerische Nahrungsmittelindustrie rechnet jedoch trotzdem mit einem beträchtlichen Anteil an der wachsenden Nachfrage in den neuen EU-Mitgliedländern.
EU-interne Veränderungen (Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik,Senkung der institutionellen Preise),neue Marktsituationen sowie die Entwicklung des Wechselkurses Fr./Euro werden sich wahrscheinlich stärker auf die schweizerische Landwirtschaft auswirken als neue Handelsbedingungen (Zölle,Zollkontingente,nichttarifarische Bedingungen) mit den MOEL-10.Schliesslich ist zu bemerken,dass bei einer allfälligen Ausdehnung des Abkommens Schweiz – EU über den freien Personenverkehr auf die MOEL-10 mehr ausländische Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden.
Mit den Ausfuhrbeiträgen für Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten wird gestützt auf das Protokoll Nr.2 die Differenz zwischen in- und ausländischen Rohstoffpreisen ausgeglichen.Am 25.November 2002 fand in Brüssel die letzte Verhandlungsrunde über das neue Protokoll Nr.2 zum Freihandelsabkommen von 1972 statt.Das Endergebnis der Verhandlungen wurde in einem von EU- und Schweizerseite gemeinsamen Sitzungsprotokoll festgehalten.Die offizielle Unterzeichnung des neuen Protokolls Nr.2 wird zusammen mit den anderen Dossiers der bilateralen Verhandlungen II erfolgen.
Das neue Protokoll Nr.2 umfasst nicht nur eine grössere Palette an Produkten.Alle schweizerischen Exporte werden zollfrei auf den EU-Markt gelangen.Anderseits wird den Einfuhren aus der EU ein besserer,aber für die sensiblen Produkte dennoch nicht zollfreier Marktzutritt gewährt.Zu diesem Zweck wurden die Produkte in zwei Tabellen aufgelistet.Tabelle 1 enthält diejenigen Produkte,für welche die Schweiz einen Preisausgleich bei der Einfuhr vornehmen und Beiträge bei der Ausfuhr bezahlen wird. Dabei handelt es sich um die «klassischen» Verarbeitungsprodukte wie Biskuits, Backwaren,Schokolade usw.Die Tabelle 2 wird Produkte enthalten,die beidseitig zollfreien Marktzutritt erlangen,und für welche die Schweiz auch keine Ausfuhrbeiträge mehr leisten wird.Hier handelt es sich um Produkte wie Kaffee-Extrakte, Röstkaffee,Spirituosen,zuckerfreie Bonbons,Suppen und Saucen usw.,die für die Schweizer Landwirtschaft nicht sensibel sind,das heisst nur geringe Mengen oder gar keine landwirtschaftlichen Grundstoffe enthalten.
■ Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU
Am 26.Juni 2003 beschloss der Agrarministerrat,dem von der Europäischen Kommission unterbreiteten Vorschlag zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) teilweise zu folgen.Dieser sieht eine radikale Änderung des Finanzierungsmodus der Landwirtschaft in der Gemeinschaft vor.Die neue GAP wird mehr auf die Konsumenten und Steuerzahler ausgerichtet sein und dabei den Landwirten die Möglichkeit geben, den Marktbedürfnissen entsprechend zu produzieren.Die Reform,die schrittweise 2004 und 2005 in Kraft treten soll,ist durch fünf Hauptelemente gekennzeichnet:
– Entkoppelung: die Landwirte in der EU werden künftig eine einzelbetriebliche Zahlung erhalten,die unabhängig von der Produktion auf Grund der Zahlungen in den Jahren 2000 bis 2002 gewährt wird.Diese Entkoppelung wird nach Produktionsart wie folgt differenziert:
– Ackerbau: Entkoppelung der Beihilfen mit der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten,bei den Ackerkulturen und beim Hartweizen bis zu 25 bzw.40% der Zahlungen weiterhin an die Produktion zu binden.
– Rindfleisch: Möglichkeit für die Mitgliedstaaten die Produktionsbindung entweder bis zu 100% der Mutterkuhprämie und 40% der Schlachtprämie beizubehalten oder bis zu 100% der Schlachtprämie und 75% der Sonderprämie für männliche Rinder;
– Schaffleisch: Möglichkeit,die Bindung zwischen Beihilfe und Produktion bis zu 50% der Prämie für Schafe und Ziegen beizubehalten,inkl.Ergänzungsprämie in benachteiligten Gebieten;
– Milch: Entkoppelung der Beihilfen erst ab 2008,das heisst am Ende der Umsetzung der in diesem Bereich vorgesehenen Reform.
– Zusätzliche Zahlungen: Möglichkeit für die Mitgliedstaaten,zusätzliche Zahlungen zu leisten,um für den Umweltschutz wichtige Produktionsarten zu fördern und die Vermarktungsqualität der Produkte zu verbessern,wobei jedoch maximal 10% des nationalen Zahlungsrahmens für direkte Beihilfen dazu verwendet werden dürfen.
EU-Kommissar Fischler nimmt an,dass in vier Jahren die effektive Entkoppelung der Beihilfen vom Produktionsvolumen beim Getreide 90% und beim Rindfleisch 70% betragen dürfte.
– Cross compliance: Die einzelbetriebliche Zahlung ist an die Einhaltung von Normen bezüglich Umweltschutz,Lebensmittelsicherheit,Tier- und Pflanzengesundheit und Tierwohl gebunden sowie an die Pflicht,alle Landwirtschaftsflächen in einem guten agronomischen und ökologischen Zustand zu erhalten.
– Modulation: Die Direktzahlungen und die einzelbetriebliche Zahlung werden bei Grossbetrieben (mehr als 5'000 Euro/Jahr) gekürzt (2005:3%;2006:4%; 2007–2013:5%),um die Politik der ländlichen Entwicklung zu stärken,welche Massnahmen zur Förderung der Umwelt,der Qualität und des Tierwohls umfassen wird,und um den Landwirten bei der Einhaltung der von der EU festgelegten Produktionsnormen zu helfen.
– Haushaltsdisziplin: Es wird ein Mechanismus eingeführt,um sicherzustellen,dass der Agrarhaushalt bis 2013 nicht überschritten wird.
■ Auswirkungen auf die schweizerische Landwirtschaft
– Marktstützungspolitik im Rahmen der GAP:Dabei geht es hauptsächlich um die folgenden Änderungen:
a) Milch
– Butter: Senkung des Interventionspreises für Butter um 7% jährlich von 2004 bis 2006 und um 4% im Jahre 2007,das heisst insgesamt um 25%;dies ist 10% mehr als in der Vereinbarung am Berliner Gipfel (März 1999,Agenda 2000) vorgesehen,aber 10% weniger als gemäss Kommissionsvorschlag vom Januar 2003. Ab der Kampagne 2008/09 gilt eine Interventionshöchstgrenze von 30'000 t.
– Magermilchpulver: Senkung des Interventionspreises um 5% jährlich von 2004 bis 2006,das heisst total um 15%.Diese Preissenkungen werden ab 2006 durch eine Hilfe von 35,5 Euro/t kompensiert.
– Milchquoten: Bis zur Kampagne 2014/15 Weiterführung der Milchquotenregelung und Verschiebung um ein Jahr (2006 statt 2005) der in der Agenda 2000 vorgesehenen schrittweisen Erhöhung der Quoten um 1,5% über drei Kampagnen (3 mal 0,5%).Sobald die Reform des Milchsektors vollständig umgesetzt ist,wird die Kommission einen Bericht über die Marktaussichten erstellen, damit über eine allfällige weitere Erhöhung der Quoten in den Jahren 2007 und 2008 beschlossen werden kann.
b) Getreide
–Keine Kürzung um 5% des Interventionspreises für Getreide wie von der Kommission vorgeschlagen,aber Kürzung der monatlichen Zuschläge um die Hälfte; –Roggen:Aufhebung der Intervention mit Kompensation über Strukturmassnahmen; –Trocknungsbeihilfen:Die Ergänzungszahlung für Getreide wird von 19 auf 24 Euro/t erhöht.
c) Eiweisspflanzen
–Umwandlung des Zuschlags von 9.5 Euro/t für Eiweisspflanzen in eine flächengebundene Beihilfe von 55.57 Euro/ha für eine neu auf 1,4 Mio.ha festgelegte Garantiehöchstfläche.
d) Andere Produktionen
–Reformen in den Bereichen Reis,Hartweizen,Schalenfrüchte,Stärkekartoffeln und Trockenfutter.
Unsere Agrarpolitik wird auf internationaler Ebene (WTO) gestärkt,da sich die Politik der Union und diejenige der Schweiz annähern,das heisst in der EU von der Produktion entkoppelte und an ökologische und ethologische Kriterien gebundene Direktzahlungen ähnlich dem seit 1999 in der Schweiz verlangten ökologischen Leistungsnachweis. Auf der Preisebene wird sich die Konkurrenz hingegen verschärfen.Mit der Senkung des Interventionspreises für Butter und Magermilchpulver bzw.mit einer möglichen Abschaffung der Milchquoten ab 2014/15 zeichnet sich ein möglicher Druck auf die Marktpreise sämtlicher Milchprodukte und insbesondere des Käses ab,da für 2007 die vollständige Liberalisierung des Käsehandels zwischen der Schweiz und der EU geplant ist.Die in der Schweiz für 2009 vorgesehene Aufhebung der Milchkontingentierung wird allerdings dazu beitragen,diese komparativen Nachteile zu verringern.
Die EFTA-Staaten haben im März 2003 mit Chile nach Mexiko und Singapur ihr drittes umfassendes Freihandelsabkommen (FHA) abgeschlossen.Dieses Abkommen wird den Freihandel im Industriesektor,Liberalisierung im Dienstleistungssektor,Marktzugang für Investitionen und Liberalisierungen im Öffentlichen Beschaffungswesen verwirklichen und enthält Bestimmungen über den Wettbewerb und den Schutz des Geistigen Eigentums.Wie bisher ist in einem separaten Protokoll die Liberalisierung des Industrieschutzes im Handel mit verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten geregelt. Über den Handel mit Basisagrarprodukten haben die EFTA-Staaten einzeln bilaterale Abkommen mit Chile abgeschlossen.
Die Verhandlungen waren besonders komplex und heikel,handelt es sich doch bei Chile um ein aktives Land der Cairns-Gruppe.Die Landwirtschaft hat für Chile eine überragende Bedeutung.Zwei Drittel aller chilenischen Exporte in die Schweiz sind Landwirtschaftsprodukte,davon macht allein der Tafelwein rund 40% aus! Die Schweiz sah sich ausserstande,Zollkonzessionen für dieses wichtigste landwirtschaftliche Exportprodukt Chiles anzubieten,was letztlich beinahe zu einem Verhandlungsabbruch führte.Nur der Verzicht auf die schweizerische Forderung nach garantiert undiskriminierendem Marktzugang im Finanzsektor brachte den Durchbruch und machte den Abschluss möglich.Die Schweizer Landwirtschaft hat damit für die sensiblen Produkte wie Milchprodukte,Fleisch,Getreide,Futtermittel,Öle,Fette und Wein keine Konzessionen geben müssen.

Die fünfte WTO-Ministerkonferenz,die vom 10.bis 14.September 2003 in Cancun stattfand,ging ohne eine Einigung zu Ende.Obwohl die Verhandlungen über das Agrardossier recht gut vorangekommen waren,kam es auf Grund unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten speziell über die Singapur-Themen (Investitionen,Wettbewerb,Handelserleichterungen,öffentliche Märkte) zum Abbruch der Konferenz. Einige WTO-Delegierte verlangten,dass alle diese Themen in der Doha-Runde behandelt werden,andere Konferenzteilnehmer setzten sich indessen für eine teilweise oder vollständige Vertagung ein.
Die Agrarverhandlungen liessen neue Lager mit mehr oder weniger übereinstimmenden Interessen entstehen,während Gruppierungen wie die Cairns-Gruppe (Australien,Argentinien,Bolivien,Brasilien,Kanada,Chile,Kolumbien,Costa Rica, Guatemala,Indonesien,Malaysia,Neuseeland,Paraguay,Philippinen,Thailand, Südafrika,Uruguay) und die MF6-Gruppe (Korea,Japan,Schweiz,Mauritius,Norwegen und EU) nicht mehr in ihrer altgewohnten Rolle auftraten.Als Hauptgruppierungen sind zu nennen:
–Die Allianz USA-EU,die durch einen gemeinsamen Text am 13.August 2003 besiegelt wurde,hatte beim Agrarteil eindeutig am meisten Einfluss auf den Inhalt des Entwurfs der Ministererklärung,dessen zweite Fassung (nachfolgend als Rev2 bezeichnet) den Mitgliedern durch den Vorsitzenden der Konferenz unterbreitet wurde.Dieser Text geht beim Abbau der Zölle und der Inlandstützung sehr weit.
–Als Gegenpol zu dieser Allianz schloss sich eine Gruppe aus 21 Entwicklungs- und Schwellenländern zusammen (Argentinien,Bolivien,Brasilien,Chile,China, Kolumbien,Costa Rica,Kuba,Ecuador,Ägypten,El Salvador,Guatemala,Indien, Mexiko,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Südafrika,Thailand und Venezuela). Brasilien,China,Indien und Südafrika traten als Wortführer der «G21» in Erscheinung.Diese Gruppe präsentierte am 4.September 2003 einen sehr taktischen Gegenvorschlag,der noch radikaler war als jener der USA-EU-Allianz.
–Die Schweiz bildete zusammen mit Bulgarien,Chinesisch-Taipeh,Island,Israel, Liechtenstein,Japan,Korea,Mauritius,Norwegen die «G-10»-Gruppe,deren Mitglieder vor allem bei den Verhandlungen über den Zollabbau und die Reduktion der Inlandstützung eine moderatere Position vertraten als die beiden vorher genannten Lager.
–Eine heterogene Gruppe von Entwicklungsländern,die aus einer Allianz um Indonesien bestand,machte sich für eine grösstmögliche Sonderbehandlung ihrer «Spezialprodukte» sowie eine Sonderschutzklausel stark.
–Eine Gruppierung mehrerer kleiner Entwicklungsländer,darunter die Afrikanische Union,die AKP-Staaten (Staaten Afrikas,des Karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans) und die CARICOM (Karibische Gemeinschaft),zeigten sich besorgt über die Erosion ihrer Zollpräferenzen auf den Märkten der Industriestaaten.
–Die auf Grund des Vorschlags von vier afrikanischen Ländern erarbeitete «Baumwollinitiative» wurde als unabhängiges Thema in den Entwurf der Ministererklärung aufgenommen.Die Initiative verlangt die Abschaffung von Subventionen für den Export von Baumwolle und betrifft daher in erster Linie die USA und die EU.Weder die USA noch die EU zeigten jedoch besondere Bereitschaft,auf dieses Anliegen einzugehen.
Der vom Vorsitzenden der Konferenz erarbeitete Vorschlag zu den Agrarmodalitäten (Rev2) behandelt hauptsächlich die drei Pfeiler Marktzutritt,Inlandstützung und Exportsubventionen.Nachfolgend werden die einzelnen Vorschläge der Hauptakteure unter Verwendung der Abkürzungen «Rev2»,«EU-USA»,«G21» und «G10» zusammengefasst,wobei kein einziger Vorschlag Zahlen enthält,die über das reale Ausmass der zugestandenen Konzessionen Aufschluss geben.
1.Im Bereich Marktzutritt sieht der Rev2 Abbaumodalitäten in drei «Bändern» vor:
–Das erste Band betrifft einen noch festzulegenden Prozentsatz der Positionen, deren Zolltarife nach der bewährten Formel der Uruguay-Runde zu reduzieren sind.Diese Formel verlangt eine Mindestsenkung pro Zolltariflinie und einen durchschnittlichen Abbau der Tariflinien insgesamt.Bei Zöllen,die als Einfuhrschutz für sensible Produkte dienen,ist eine weniger starke Senkung möglich, sofern als Ausgleich die entsprechenden Zollkontingente erhöht werden.
–Das zweite Band bezieht sich auf einen weiteren Prozentsatz der Zollpositionen, deren Zolltarife nach einer so genannten Harmonisierungsformel zu reduzieren sind,das heisst höhere Zölle müssen stärker abgebaut werden.
–Das dritte Band besteht aus den verbleibenden Zollpositionen,deren Produkte zum Nullzoll eingeführt werden können.
2.Die EU-USA und die G21 vertreten in diesem Bereich ähnliche Positionen wie der Rev2,ausser dass die G21 die sensiblen Produkte im ersten Band nicht berücksichtigt.
3.Während der Rev2 für sämtliche Produkte eine durchschnittliche Mindestsenkung erwägt,verlangt die G21 eine solche Herabsetzung nur für die Tariflinien der beiden erstgenannten Bänder.Der Rev2 will Tarife,die ein vorgegebenes Niveau überschreiten,mindestens auf dieses Niveau reduzieren,andernfalls müssten die entsprechenden Kontingente ausgedehnt werden;davon ausgenommen sind einige Produkte mit besonderer Bedeutung.Die Vorschläge der EU-USA und der G21 enthalten für diese Produkte keine Ausnahmeregelungen.
■
4.Die G10 lehnt jegliche Verpflichtung zur Beschränkung der Tarife («capping») kategorisch ab.Sie schlägt indessen eine eventuelle Erhöhung der Zollkontingente vor mit dem einzigen Ziel,ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen,und ohne Verbindung zur Formel der Uruguay-Runde.
5.Sowohl der Rev2 als auch die G21 befürworten eine Reduktion der Zollprogression (die Zölle für die Verarbeitungserzeugnisse sind oft höher als für deren Grunderzeugnisse),indem die Zölle für Verarbeitungserzeugnisse stärker gesenkt werden.
6.Als letzten Punkt zur Verbesserung der Marktzugangsbedingungen schlägt der Rev2 eine Herabsetzung des Kontingentszollansatzes und eine Ausdehnung der Zollkontingente vor,indem dieser Ansatz auf «0» gesenkt wird und gleichzeitig eine Erhöhung der Kontingente auf ein Mindestniveau je nach Inlandkonsum erfolgt.Die G10 ist damit nicht einverstanden.
1.Sowohl der Rev2 als auch die EU-USA und die G21 befürworten einen Abbau der internen Stützungsmassnahmen,die an die Produktion gebunden sind (Amber-Box). Während der Rev2 eine Höchstgrenze pro Produkt erwähnt («AMS specific capping»),gegen welche die G10 opponiert,soll nach dem Willen der G21 die Differenz zwischen der oberen und unteren Grenze der produktspezifischen Stützung einen gewissen Prozentsatz nicht übersteigen.Ferner fordert die G21 eine schnelle Reduktion und schliesslich ein Auslaufen der internen gekoppelten Stützungen für ausgeführte Erzeugnisse,die einen bestimmten Mindestanteil an den weltweiten Exporten ausmachen.Jeder dieser drei Vorschläge strebt auch eine Senkung des Anteils der De Minimis-Massnahmen an (Anteil der produktgebundenen Stützungen,die bis jetzt keiner Abbaupflicht unterliegen:für die Industrieländer sind dies 5% des nationalen Produktionswertes);die G21 erhebt diese Forderung indessen nur für die entwickelten Länder.
2.Gemäss dem Rev2 und der EU-USA sind die Stützungsformen der Blue-Box (gebunden an einen Viehbestand,an vorgegebene begrenzte Erträge bzw.Flächen) abzubauen und auf 5% des nationalen Produktionswertes zu beschränken, während die G21 diese Zahlungen gänzlich abschaffen will.
3.Der Rev2,die EU-USA und die G21 möchten die Summe der gebundenen Zahlungen,die den Kriterien der Amber-Box,der Blue-Box (mit Ausnahme der G21,die von einer Streichung dieser Box ausgeht) und der De Minimis-Regel entsprechen,um einen durchschnittlichen Prozentsatz kürzen.
4.Was die Green-Box anbelangt,regt der Rev2 eine Überprüfung der Kriterien an,und die G21 setzt sich für neue Disziplinen,die Festlegung von Höchstwerten und den Stützungsabbau in den entwickelten Ländern ein.
■ Exportsubventionen
1.Im Bereich der Exportsubventionen klaffen die Positionen des Rev2,der G21 und G10 in den wesentlichen Punkten nicht auseinander:Alle drei schlagen einen Zeitplan für die Aufhebung der Exportsubventionen für Produkte vor,die von Interesse für die Entwicklungsländer sind.Betreffend die übrigen Produkte will jedoch nur die G21 ein Datum festlegen,an dem diese Subventionen endgültig aufgehoben werden müssen.

2.Das handelsverzerrende Element der Exportkredite soll abgeschafft werden und es sind Disziplinen einzuführen,damit Handelsumlenkungen über staatliche Handelsbetriebe oder Nahrungsmittelhilfe nicht möglich sind.
3.Schliesslich wollen der Rev2 und die G21 Verhandlungen über die Festlegung eines Datums für die definitive Aufhebung sämtlicher Formen von Exportsubventionen einleiten.
■ Besondere und differenzierte Behandlung
Unter «besonderer und differenzierter Behandlung» werden den Entwicklungsländern absolut weniger zwingende Massnahmen bzw.längere Implementierungsperioden zugestanden.Die Forderungen der «Multifunktionalisten» (Non Trade Concerns,NTC) ausserhalb des Agrarabkommens wurden an den Verhandlungen in Cancun nicht direkt behandelt.Sie werden aber Gegenstand von Verhandlungen über die Festlegung der Modalitäten sein.
Obwohl Cancun nicht zu einer Deblockierung der Situation geführt hat,bedeutet dies nicht,dass die Doha-Runde gescheitert ist,auch wenn sie wahrscheinlich nicht wie vorgesehen am 31.Dezember 2004 abgeschlossen werden kann.Die Verhandlungen werden sich unter Umständen um rund zwei Jahre verzögern.Es kann somit davon ausgegangen werden,dass während des Zeitraumes 2004–2007,den die AP 2007 abdeckt,die WTO-Verhandlungen keinen zusätzlichen Einfluss auf die Umsetzung der Agrarreform in der Schweiz haben werden.
Wird der Modalitätenentwurf Rev2 ohne Änderungen angenommen,wären alle entwickelten Länder,darunter die Schweiz,zu erheblichen Konzessionen speziell im Bereich Marktzutritt gezwungen:
–Selbst ohne konkrete Zahlen (der Entwurf Rev2 enthält immer noch keine bezifferten Angaben) steht fest,dass die einheitliche Begrenzung aller Zolltarife für die G10Länder eines der Hauptprobleme darstellt.Die Multifunktionalität und die komparativen Nachteile der schweizerischen Landwirtschaft erfordern einen angemessenen Grenzschutz.Wenn die Preisdifferenz zum Ausland gross ist,muss bisweilen ein hoher Zoll angewandt werden,damit der Inlandsektor keine Marktanteile verliert. Eine Beschränkung auf 100% bzw.200% (Verhältnis zwischen Zolltarif und Importwert) könnte der inländischen Produktion einen schweren Schlag versetzen.Die Schweiz ist dennoch zur Begrenzung der Zölle bereit («capping»),sofern sie eine gewisse Flexibilität erhält (Ausnahmen von den Senkungsverpflichtungen bzw. grössere Reduktion bei gewissen Tariflinien und im Gegenzug Konzessionen z.B.bei der Erhöhung der Zollkontingente).
–Der Entwurf Rev2 hält zudem fest,dass die Kontingentszollansätze ebenfalls zu verringern sind.Dieser Parameter ist neu und würde sich auf gewisse Märkte in der Schweiz wie den Brotgetreide- und Weinmarkt auswirken.
–Im Bereich Inlandstützung wäre die Schweiz direkt betroffen,falls die produktspezifische Stützung auf das gegenwärtige durchschnittliche Niveau begrenzt wird.Die Massnahmen der Amber-Box könnten in gewissen Sektoren (Zucker,Öle) nicht mehr nach oben angepasst werden,um beispielsweise eine zu grosse Zollreduktion abzufedern.
–Strengere Beschränkungskriterien der Green-Box dürften sich für die Schweiz ebenfalls als problematisch erweisen,insbesondere wenn sie gemäss Vorschlag der G21Staaten mit einer Begrenzung der in die Green-Box eingeteilten Direktzahlungen einhergehen.
Man könnte versucht sein zu glauben,dass der Misserfolg der WTO-Verhandlungen in Cancun der Schweizer Landwirtschaft bei ihren Reformanstrengungen eine Atempause gönnt.Dies ist jedoch illusorisch,vor allem wenn der Stillstand der Verhandlungen andauern sollte.Im Falle einer längeren Blockade wäre tatsächlich eine Rückkehr zum Bilateralismus denkbar.Einige Länder wie die USA haben in dieser Hinsicht bereits eindeutige Signale ausgesendet.Für die Schweiz als kleines Nettoimportland sind relativ einschneidende Konsequenzen zu befürchten,wenn ohne multilaterale Rahmenbedingungenmit den USA,Lateinamerika oder auch China bilaterale Verträge ausgehandelt werden müssen:Diese Länder können nämlich auf Grund ihres wirtschaftlichen Gewichts der Schweiz grössere Zugeständnisse im Agrarbereich aufzwingen,als wenn die Konzessionen in einem multilateralen Kontext verhandelt werden.
■ Beurteilung und Konsequenzen für die Schweiz
Die Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht jährlich einen Bericht über die Agrarpolitik ihrer 30 Mitgliedstaaten,in dem die nationalen Massnahmen analysiert und kommentiert werden.Mit Hilfe verschiedener Indikatoren berechnet sie ausserdem die Mittel,die von den Konsumenten und Steuerzahlern für die Stützung der Landwirtschaft aufgewendet werden.Hauptindikator ist der PSE-Wert (Producer Support Estimate),das heisst die Prozentzahl,die dem Anteil der agrarpolitischen Unterstützung an den gesamten Einnahmen der Landwirtschaftsbetriebe entspricht.Teil der staatlichen Stützung ist auch der Grenzschutz.
Die schweizerische Landwirtschaft ist im Berichtsjahr immer noch durch ein hohes Stützungsniveau gekennzeichnet.Der PSE-Wert betrug in diesem Jahr 75% und übertraf damit erneut denjenigen aller anderen Mitgliedländer.Gefolgt wurde die Schweiz von Norwegen (71%),Korea (66%),Island (63%) und Japan (59%).In der EU liegt der PSE-Wert bei 34%.Ebenfalls 2002 wurde eine Bruttoumverteilung von den Konsumenten und Steuerzahlern zur Stützung der Agrarproduzenten von insgesamt 7,8 Mrd.Fr.(Grenzschutz inklusive) verzeichnet.
Zum ersten Mal erwähnt der Evaluationsbericht die Verschiebung der landwirtschaftlichen Stützung auf Instrumente,die keinen Produktionsanreiz schaffen und wenig Marktverzerrungen bewirken.Im Laufe des letzten Jahrzehnts ging die Marktpreisstützung in der Schweiz deutlich zurück,während die an den ökologischen Leistungsnachweis gekoppelten Abgeltungen für produktionsungebundene,spezifische Leistungen stiegen.Trotzdem beurteilt die Schweiz die PSE-Methode und ihre Anwendung skeptisch.Der grösste Vorbehalt betrifft die Unterscheidung zwischen Marktpreisstützung und Direktzahlungen,die von der Lebensmittelproduktion entkoppelt sind und der Förderung produktionsungebundener Leistungen dienen.Mit der heutigen Berechnungsmethode ergibt sich kein genügend klares Bild dieser beiden Massnahmenkategorien.Die neue Darstellungsweise und die diversen Studien gehen zwar in die richtige Richtung,aber die für die Abtrennung der nicht produktgebundenen Leistungen erforderlichen Klassierungskriterien liegen leider noch nicht vor.Auch sind die mit der Methode zusammenhängenden Probleme bezüglich Wechselkurs und Bestimmung der Weltmarktpreise nicht gelöst.Aus diesen Gründen wird die Schweiz im Agrarkomitee der OECD weiterhin dafür eintreten,dass die PSE-Berechnungsmethode die oben erwähnten Probleme besser berücksichtigt und künftig in den Veröffentlichungen der Organisation mehr Gewicht auf die Unterteilung des PSE als auf die Gesamtstützung und ihren Anteil an den Einnahmen gelegt wird.
Die Arbeiten der OECD zur Multifunktionalität stehen im Zeichen der Diskussionen der Mitgliedländer um die neue WTO-Verhandlungsrunde und der agrarpolitischen Reformen,die insbesondere die Entkoppelung von der Produktion und gezielte Massnahmen im Hinblick auf einen Abbau der Inlandstützung,des Grenzschutzes und der Marktverzerrungen beinhalten.Mit der Genehmigung eines analytischen und konzeptionellen Rahmens zur Behandlung der Multifunktionalität wurde 2001 eine erste Phase abgeschlossen.In der zweiten Phase wurden auf der Grundlage empirischer Arbeiten konkrete Situationen untersucht.Im Mai 2003 wurden schliesslich auf Grund der zwei vorhergehenden Phasen Empfehlungen zu den nationalen Politiken und zur Bereitstellung eines entsprechenden Rahmens auf internationaler Ebene abgegeben. Es lassen sich nun Referenzstrategien entwickeln,wobei der Koppelungsgrad,das Bestehen oder die Wahrscheinlichkeit eines Marktversagens,räumliche Parameter und gegebenenfalls die Eigenschaft eines Produkts als öffentliches Gut beachtet werden. Anhand dieser Kriterien erstellte die OECD eine Liste der jeweils von der öffentlichen Hand zu treffenden Massnahmen.Beispiele:
–bei schwacher Koppelung muss die Massnahme auf die nicht warenbezogene Leistung zielen und darf nicht an die Produktion gebunden sein,da definitionsgemäss (schwache Koppelung – keine Verbundvorteile) produktionsungebundene Massnahmen immer wirksamer sind;
–bei starker Koppelung ist unter Berücksichtigung der nicht warenbezogenen Leistungen und der negativen Externalitäten sorgfältig zu prüfen,ob ein Marktversagen besteht.Trifft dies nicht zu,drängt sich kein staatlicher Eingriff auf;
–sind sowohl eine Koppelung als auch ein Marktversagen zu verzeichnen,kann der Eingriff auf die betreffende nicht warenbezogene Leistung oder auf den Ursprung der Koppelung zielen,muss aber in jedem Fall durch die Erbringung der Leistung bedingt sein.Dieser Grundsatz gewährleistet die Erbringung nicht warenbezogener Leistungen und verhindert gleichzeitig mit der Produktion,dem Konsum oder unerwünschten kommerziellen Auswirkungen verbundene Effizienzverluste.Die fixe Koppelung wäre die einzige Ausnahme,was aber bisher nicht bestätigt werden konnte;
–Massnahmen sind immer räumlich oder geografisch gezielt zu ergreifen,sofern es sich nicht um ein stark verbreitetes oder nationales Produkt handelt und somit ein grosser Teil der Produktion oder der landwirtschaftlichen Fläche des Landes betroffen ist;
–bei der Suche nach optimalen Lösungen sind auch die Kosten der Massnahmen zu berücksichtigen.Es müssen alle Kostenpunkte einbezogen werden,auch die mit den verschiedenen Optionen zusammenhängenden Effizienzverluste;
–bei allen Massnahmen und Eingriffen ist regelmässig zu überprüfen,ob die erwünschten Resultate erzielt werden.Alle Inputs (Zahlungen usw.) und Outputs (andere als Basisprodukte) müssen quantifizierbar sein und quantifiziert werden.
■ Zollbegünstigung für die ärmsten Entwicklungsländer
Das BLW ist mit diesen ersten Arbeiten zur Multifunktionalität insgesamt zufrieden und beabsichtigt,sich im Rahmen des Agrarkomitees und seiner Untergruppen aktiv an neuen Forschungsarbeiten zu diesem Thema zu beteiligen.
Im Mai 2001 fand in Brüssel eine UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung statt.Es ging darum,den 49 ärmsten Entwicklungsländern (LDC = least developed countries) bei der Beschleunigung des Integrationsprozesses in die Weltwirtschaft zu helfen.Die Schweiz versprach,im Rahmen ihrer Entwicklungspolitik einen substanziellen Beitrag zu diesem Ziel zu leisten.Dabei sollen den LDC vor allem zusätzliche Zollpräferenzen gewährt werden,um ihnen den Marktzugang in den Industrieländern zu erleichtern.
Bei den Industrieprodukten erhebt die Schweiz für Einfuhren aus diesen Ländern schon seit langem keine Zölle mehr.Bei den landwirtschaftlichen Produkten dagegen wurde die Zollfreiheit nur fallweise gewährt,wie beispielsweise für tropische Früchte.Gemäss dem Zollpräferenzenbeschluss (SR 632.91) beschloss der Bundesrat «mittelfristig» für die LDC den Nulltarif einzuführen.
Ein erster Schritt erfolgte am 1.Januar 2002 als in Anwendung von Anhang 3 der Zollpräferenzenverordnung vom 29.Januar 1997 (SR 631.911) zugunsten der LDC die Zölle auf allen Landwirtschaftserzeugnissen um durchschnittlich 30% gesenkt wurden. Diese Zollreduktion variierte je nach Produkt zwischen 10 und 50%.
In einer zweiten Etappe ist ab dem 1.April 2004 ein Abbau der verbleibenden Zölle um die Hälfte vorgesehen.Ab diesem Datum sollen somit durchschnittlich noch 35% des Normaltarifs erhoben werden.
Das Parlament wird 2006 auf Grund der Erfahrungen bestimmen,wann das Ziel von Nullzöllen ohne Mengenbeschränkungen bei allen Importen aus den LDC erreicht werden kann.
Falls die Auswirkungen der Zollsenkungen auf den Warenverkehr wesentliche Wirtschaftsinteressen der Schweiz tangieren oder treffen könnten,hat der Bundesrat die Möglichkeit,die Präferenzen zu ändern oder aufzuheben solange die Umstände es erfordern.Ohne einen Entscheid des Bundesrats abzuwarten,kann das EVD eine solche Massnahme für höchstens drei Monate anordnen.
■ Die weltweiten Perspektiven von Landwirtschaft und Ernährung bis 2030
Die Anzahl hungernder und unterernährter Menschen in Entwicklungsländern hat sich seit dem Jahre 1992 von 816 Mio.Menschen auf 777 Mio.verringert.Gemäss der FAOStudie «Agriculture mondiale:horizon 2015/2030» wird diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf rund 440 Mio.sinken.Dies bedeutet,dass das Ziel des Welternährungsgipfels von 1996,die Zahl der Hungernden von 815 Mio.im Jahre 1990–92 bis zum Jahr 2015 zu halbieren,selbst bis 2030 nicht erreicht wird.Kritisch ist die Lage in Afrika südlich der Sahara,wo die Anzahl Hungernder vorerst noch auf über 200 Mio.Menschen ansteigen und im Jahr 2030 noch schätzungsweise 183 Mio.Menschen umfassen wird.
Wachstumsraten von Bevölkerung sowie von Produktion und Nachfrage nach Nahrungsmitteln (1969–1999 und Prognose für 1999–2030)
Länder oder Bevölkerungs-Wachstum derWachstum der LändergruppenwachstumNahrungsmittel-Nachfrage produktion
% pro Jahr% pro Jahr% pro Jahr
südlich1969–19992,92,32,8 der Sahara1999–20302,42,72,9
Naher Osten1969–19992,73,13,8 und Nordafrika1999–20301,72,02,2
Lateinamerika1969–19992,12,82,9 1999–20301,11,91,9
Asien Ost1969–19991,64,44,5
1999–20300,71,51,6
Asien Süd1969–19992,23,13,2 1999–20301,32,22,3
Quelle :FAO
Die FAO-Prognosen gehen davon aus,dass die Weltbevölkerung von heute rund 6 Mrd. Menschen auf ungefähr 8,3 Mrd.im Jahre 2030 steigen wird.Das Wachstum wird jährlich ca.1,1% betragen,verglichen mit 1,7% in den vergangenen 30 Jahren.Im Vergleich dazu soll die Erzeugung von Nahrungsmitteln weltweit bis 2030 jährlich um 1,5% zunehmen.Der Anteil der insgesamt gut ernährten Menschen würde damit ansteigen.Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen würde von durchschnittlich 2,2% jährlich in den zurückliegenden 30 Jahren auf 1,5% bis zum Jahr 2030 zurückgehen.In den Entwicklungsländern dürfte der Rückgang noch stärker sein: von 3,7% auf 2% pro Jahr.
■ Produktionssteigerung braucht mehr Ressourcen
Dies gilt allerdings nicht für die ärmsten Entwicklungsländer in denen die Hälfte der Menschen in der Dritten Welt lebt.Auf Grund mangelnder Kaufkraft soll dort die Nachfrage um nur 2,5% pro Jahr wachsen,verglichen mit 2,9% in der Vergangenheit. Der Pro-Kopf-Verbrauch würde damit nur leicht steigen.
Gemäss den Prognosen würde bis zum Jahre 2030 zusätzlich 1 Mrd.t Getreide benötigt.Dies entspricht einer Steigerung von rund 50% gegenüber heute.Die Entwicklungsländer wären zunehmend auf die Einfuhr von Getreide,Fleisch und Milchprodukten angewiesen.Ihre Produktion könnte die Nachfrage nicht decken.Ihre Nettoimporte würden von gegenwärtig 103 Mio.t auf 265 Mio.t steigen.Die FAO erwartet,dass die Fleischimporte der Entwicklungsländer – wenn auch von niedrigerem Niveau aus – sich noch schneller erhöhen werden.
Für die zusätzlich benötigten Nahrungsmittel ist eine höhere Produktivität der Landwirtschaft erforderlich.Die Entwicklungsländer sollen rund 70% der höheren Getreideproduktion aus steigenden Erträgen erzielen,für 20% sollen die Anbauflächen erweitert werden und 10% sollen durch Mehrfachanbau und kürzere Bracheperioden erzielt werden.Die Bewässerung wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.Die Entwicklungsländer dürften ihre Bewässerungsflächen von heute 202 Mio.ha Land auf 242 Mio.ha im Jahre 2030 ausdehnen.
Die Anbauflächen für die Nahrungsmittelerzeugung werden in Zukunft langsamer wachsen als in der Vergangenheit.Die Entwicklungsländer werden in den kommenden 30 Jahren rund 120 Mio.ha mehr Land für den Getreideanbau benötigen.Die Agrarflächen dürften vor allem in Afrika südlich der Sahara und in Lateinamerika zunehmen. Für einen großen Teil dieser zusätzlich benötigten Äcker müssen Wälder gerodet werden.
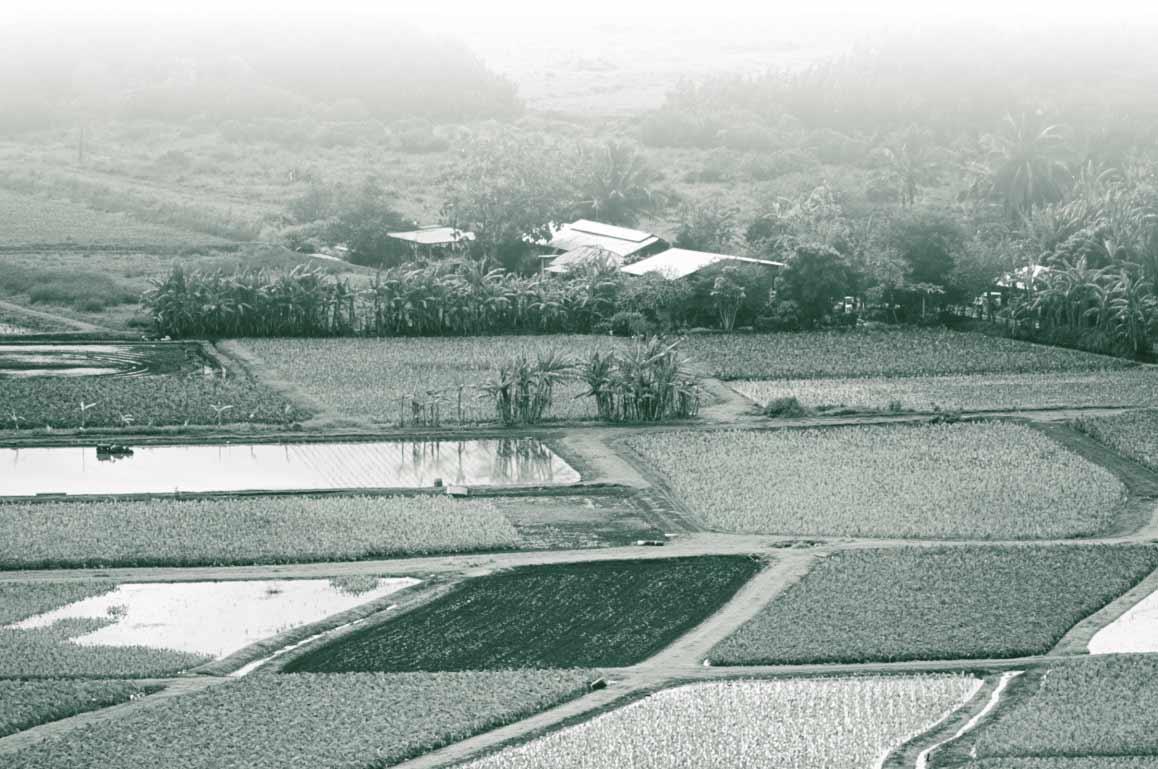
Armut ist Hauptursache für Unterernährung und Hunger.Viele der mehr als 1,1 Mrd. Menschen,die in extremer Armut leben,sind auf das Wachstum in der Landwirtschaft und in nachgelagerten Sektoren angewiesen,um ihre Lebenssituation zu verbessern. In den Entwicklungsländern lebt die Mehrzahl der armen Menschen in ländlichen Gebieten.Die Diskriminierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums in den Entwicklungsländern muss,dort wo dies immer noch der Fall ist,unbedingt gestoppt werden.Es ist deshalb wichtig,dort die Bedingungen für den Zugang der ländlichen Bevölkerung zu Land,Wasser,Krediten,Gesundheitsdiensten und Bildung zu verbessern,sowie die rechtlichen und politischen Grundrechte zu garantieren,um Hunger und Armut zu verringern.
Ausgehend vom Schweizer Markt,erfolgt der internationale Preisvergleich mit identischen,ähnlichen oder wichtigen Märkten des Auslands.Damit sind jedoch gewisse Schwierigkeiten verbunden wie die Auswahl der Produkte,die Verfügbarkeit der Daten, die Relevanz der Messgrössen,die unterschiedlichen Produktions- und Verkaufsformen oder die währungsspezifischen Einflüsse.Bei den für den internationalen Vergleich verwendeten Preisen in diesem Kapitel handelt es sich um:
–Nationale Durchschnittswerte:minimale bzw.maximale Werte werden je nach Region oder Verwertung des Erzeugnisses (Produzentenpreis) verdeckt.

–Grössenordnungen:die Erzeugnisse (Qualitäts-,Labelprodukte),Vermarktungsvoraussetzungen (Menge,Vermarktungsgrad),Absatzkanäle und Berechnungsmethoden des Durchschnittswertes unterscheiden sich von Land zu Land.
–Bruttopreise;das heisst:
–die auf dem Markt beobachteten Preise (im Rahmen der Agrarpolitik jedes einzelnen Landes).Die Produzentenpreise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Diese ist jedoch in den Konsumentenpreisen eingeschlossen,da es sich um eine vom Konsumenten zu leistende Abgabe handelt.
–die Preise sind nicht nach der unterschiedlichen Kaufkraft der einzelnen Länder bereinigt.
Es stehen daher nicht die absoluten Werte im Vordergrund,sondern die Veränderungen im Verlaufe der Zeit und das Verhältnis zu den Schweizer Preisen.
Die aus dem Verkauf eines «Standardwarenkorbes» erzielten Einnahmen der Produzenten dienen als Vergleichsgrundlage.Der Standardwarenkorb setzt sich aus den wichtigsten Produktionsvolumen der Schweiz in den Jahren 1998/2000 zusammen. Die Struktur der schweizerischen Produktion wird also auf die für den Preisvergleich berücksichtigten Länder übertragen.
Die EU-Preise beziehen sich auf die vier Nachbarstaaten (EU-4/6).Die Länder fünf und sechs sind die Niederlande und Belgien.Sie werden für jene Produkte berücksichtigt, bei denen diese Länder hohe Produktionsvolumen ausweisen.Der Durchschnittspreis im EU-Raum berechnet sich aus den Produktionsvolumen der betreffenden Länder. Auf diese vier bzw.sechs Länder entfällt mehr als die Hälfte der von den 15 EU-Mitgliedern produzierten Gesamtmenge.Die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes (schweizerisches Produktionsvolumen 1998/2000) und das Gewicht der Länder der EU-4/6 (Produktionsvolumen 1995/2001) sind als fix über die Zeit angenommen, damit nur die Preisschwankungen aufgezeigt werden.
Auf welchem aktuellen Stand (2000/02) befinden sich die schweizerischen Agrarpreise im Vergleich zur EU und den USA?
–Würden die Landwirte der EU-4/6 oder der USA den schweizerischen Standardwarenkorb produzieren und 2000/02 in ihren Ländern verkaufen,erzielten sie rund die Hälfte (54 bzw.53%) der Einnahmen ihrer Schweizer Kollegen.
–Je nach EU-Land sind jedoch Unterschiede auszumachen:Der Erlös des Standardwarenkorbes entspricht in Italien 61%,in Deutschland 53%,in Frankreich 52% und in Österreich ebenfalls 52% des Schweizer Preises.
–Unterschiedliche Entwicklungen werden auch je nach Produkt beobachtet.Der Preis der Ackerbauprodukte wie Weizen (28% des schweizerischen Preises),Gerste (30%),Raps (42%) und Kartoffeln (43%) bewegt sich 2000/02 in der EU-4/6 auf einem ausgesprochen tiefen Niveau.Eine Ausnahme bilden die in der EU kontingentierten Zuckerrüben (51%).Im Gegensatz zu diesen Erzeugnissen erzielt die Milch, die ebenfalls kontingentiert ist,in der EU-5 einen ziemlich hohen Preis (60%).
–Im Vergleich «Land-Produkt» zeigen sich folglich noch viel grössere Abweichungen: Während 1999/2002 in Frankreich Birnen zu 116% des schweizerischen Preises verkauft wurden,erhielten 2000/02 belgische Bauern für Karotten lediglich 24% des Entgelts der Schweizer Landwirte.
Milch (10 kg) Grossrinder (kg SG) Kalb (kg SG) Schwein (kg SG) Poulet (2 kg LG) Eier (20 St.) Weizen (10 kg) Gerste (10 kg)
CH 1990/92EU 1990/92
K ö rnermais (10 kg) Zuckerr ü ben (100 kg) Kartoffeln (20 kg) Raps (5 kg) Ä pfel (10 kg) Birnen (10 kg) Karotten (10 kg) Zwiebeln (10 kg) Tomaten (5 kg)
CH 2000/02
EU 2000/02
Standardwarenkorb (Mrd. Fr./Jahr)
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste
Kalb Schwein Poulet Eier Weizen Gerste K ö rnermais Zuckerr ü ben Kartoffeln Raps Ä pfel Birnen Karotten Zwiebeln Tomaten Standardwarenkorb
1990/922000/02
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste
Nähern sich die schweizerischen Agrarpreise denjenigen in der EU und den USA an?
– In der Zeitspanne zwischen 1990/92 und 2000/02 gingen die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) für den Standardwarenkorb nicht nur in der Schweiz (–24%), sondern auch im EU-Raum (–19%) zurück.Die niedrigeren Preise im EU-Raum lassen sich einerseits durch die Agenda 2000 und andererseits durch die Schwächung des Euro erklären,der gegenüber dem Schweizer Franken 15% verloren hat.Der relative Abstand zwischen der Schweiz und der EU hat im beobachteten Zeitraum daher nur leicht abgenommen.1990/92 betrug der Preis des Standardwarenkorbes in der EU 51% gegenüber aktuell 54% (2000/02).Deutlicher zeigt sich indessen die Angleichung an die EU-Preise in absoluten Werten:Zwischen den beiden Perioden hat sich die absolute Preisdifferenz zwischen der Schweiz und der EU um mehr als einen Viertel verkleinert (–28%).
1990/92200020012002
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste, U.S. Department of Agriculture
Eine andere Entwicklung war in den USA zu beobachten:Die Produzentenpreise (in Schweizer Franken) setzten ihren Aufwärtstrend (+15%) bis 2001 fort.Seitdem ist ein Rückgang feststellbar.Diese Entwicklung hängt fast ausschliesslich mit dem Verlauf des Dollarkurses gegenüber dem Schweizer Franken während des beobachteten Zeitraums zusammen.Im Vergleich zur Referenzperiode (1990/92) verringerte sich der Preisunterschied zu den USA sowohl in relativen (von 35% in den Jahren 1990/92 auf 53% der Schweizer Preise in der Periode 2000/02) als auch in absoluten Werten (–45%).
– Im EU-Raum sind je nach Land Unterschiede auszumachen.Zwischen den genannten Zeitspannen reduzierte sich die absolute Preisdifferenz für einen Standardwarenkorb am meisten zu Frankreich (–33%),Deutschland (–29%) und Italien (–25%),während das Preisgefälle zu Österreich,das erst am 1.Januar 1995 der EU beitrat,etwas weniger deutlich abnahm (–4%).
■ Konsumentenpreise
– Unterschiedlich verliefen die Entwicklungen auch bei den einzelnen Produkten.Von 1990/92 bis 2000/02 nahm der absolute Preisabstand zwischen der EU und der Schweiz am meisten bei Raps (–73%),Weizen (–40%),Eiern (–39%) und Milch (–37%) ab,während sich die Preisschere bei den Schweinen (–18%) und Grossrindern (–3%) weniger schloss und bei den Karotten (12%) und Zwiebeln (88%) sogar weiter öffnete.

Der Preis ist für die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft zwar ein wichtiger Faktor,aber nicht der einzige:Qualität,Sicherheit und Ruf des Produktes, Werbung,Verteilernetz und die mit den Erzeugnissen verbundenen Dienstleistungen sind ebenfalls für den Erfolg auf einem gegebenen Markt entscheidend.
Das Gefälle bei den Lebensmittelpreisen zwischen der Schweiz und den beobachteten Ländern wurde aus dem Konsumentenpreis eines «Standardwarenkorbes» im Ladenverkauf (von den Privathaushalten bezahlter Preis) inkl.MwSt.berechnet.Dieser Warenkorb besteht aus rund 20 Lebensmitteln im Verhältnis des für den schweizerischen Konsumentenpreisindex im Jahr 1993 verwendeten Gewichtungsschlüssels.
Entwicklung der Konsumentenpreise eines Standardwarenkorbes
1990/922000/02
Quellen: BLW, BFS, ZMP (D), nationale Statistikämter von F, B, A, USA, Statistikamt der Stadt Turin (I)
Zur Gruppe «EU-4» gehören wie bei den Produzentenpreisen die Nachbarländer Deutschland,Frankreich,Italien und Österreich.Für Italien dienten die Preise der Stadt Turin als Bezugsbasis.Beim Gemüse und bei fehlenden Zahlen aus den Nachbarländern wurde zusätzlich Belgien einbezogen.Ferner wurde aus den minimalen und maximalen nationalen Durchschnittspreisen ein oberer und unterer Durchschnittswert der EU-4/5 ermittelt.
Das Gewicht der einzelnen Länder der EU-4/6 (Ausgaben der Privathaushalte im Jahr 1998) und die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes wurden als fix angenommen,damit ausschliesslich die Preisschwankungen über die Jahre ersichtlich sind.
Bei den Konsumentenpreisen (in Prozenten) für den «Standardwarenkorb» sind zwischen der Schweiz und den Vergleichsländern (EU,USA) weniger grosse Abweichungen festzustellen als bei den Produzentenpreisen.Eine Erklärung dafür liefern einerseits die unterschiedliche Zusammensetzung des Warenkorbes auf Produzentenund Konsumentenebene sowie andererseits das Ausmass der Nahrungsmitteleinfuhren und der höhere Mehrwertsteuersatz in der EU (rund 7% gegenüber 2,4% in der Schweiz mit Schwankungen je nach Land und Produkt).
In der Schweiz gingen die Konsumentenpreise zwischen 1990/92 und 2000/02 um 2% zurück.Der in den letzten drei Berichten veröffentlichte Wert für die Vergleichsperioden 1990/92–1997/99,1990/92–1998/2000 und 1990/92–1999/2001lag bei 4%.In der EU dagegen beträgt die Reduktion 7%,gegenüber 9,8% und 7% in den drei Vorjahren.
Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den benachbarten EU-Ländern betrug 28% der schweizerischen Preise 1990/92 und stieg in der Periode 2000/02 auf 33% an.Folglich vertieft sich der Graben zwischen den Konsumentenpreisen in der Schweiz und der EU.Diese Entwicklung ist zumindest teilweise durch den deutlich gestiegenen Anteil der Labelprodukte (Bio,M-7,Coop Natura Plan) insbesondere beim Fleisch bedingt.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bleiben aber beträchtlich.Während in der EU der Zucker und gewisse Milchprodukte in Italien (Turin) mehr kosten als in der Schweiz,sind die Schweinekoteletts im EU-Raum nur halb so teuer.Das Schweinefleisch in der EU-4 stammt denn auch mehrheitlich aus konventionellen Züchtungen, während sich das in den schweizerischen Geschäften im Jahr 2001 angebotene Schweinefleisch zu 60% aus Marken- oder Labelerzeugnissen zusammensetzt.
Im Gegensatz dazu stiegen im Zeitraum 1990/92 bis 2000/02 die Konsumentenpreise in den USA um 34% an.Entsprechend wurde die Preisschere zur Schweiz kleiner. 2000/02 betrug der Abstand nur noch 28% gegenüber 49% in der Periode 1990/92. Hauptgrund dafür ist der Anstieg des Dollarkurses,der im Vergleich zum Schweizer Franken um 17% zulegte.
■ Projektleitung, Werner Harder
Sekretariat
■ Autoren
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Ursula Gautschi,Andreas Berger,Simon Hasler,Katja Hinterberger,Beat Ryser, Hans-Ulrich Tagmann
Wirtschaftliche Lage
Vinzenz Jung
Soziales und Gesellschaft
Esther Muntwyler,Thomas Maier
Ökologie und Ethologie
Brigitte Decrausaz,Peter Baumann,Rhea Beltrami,Heinz Hänni,Esther Muntwyler, Matthias Ritter
Beurteilung der Nachhaltigkeit
Vinzenz Jung
■ Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Ursula Gautschi
Übergreifende Instrumente
Frédéric Brand,Friedrich Brand,Jean-Marc Chappuis,Emanuel Golder,Samuel Heger, Simone Rüfenacht
Milchwirtschaft
Katja Hinterberger,Paolo Degiorgi,Andreas Galler
Viehwirtschaft
Simon Hasler
Pflanzenbau
Frédéric Rothen,Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
■ Übersetzungsdienste
Direktzahlungen
Thomas Maier,Christina Blank,Eliane Jäggi,Victor Kessler,Hugo Roggo,Olivier Roux, Martin Weber
Grundlagenverbesserung
Strukturverbesserungen und Betriebshilfe
René Weber,Peter Klaus,Willi Riedo,Markus Wildisen
Forschung,Beratung,Berufsbildung,CIEA,Gestüt
Anton Stöckli,Fabio Cerutti,Jacques Clément,Urs Gantner,Walter Müller, Jakob Rösch,Roland Stähli
Produktionsmittel
Katja Babuin,Markus Hardegger,Michael Sahli,Albrecht Siegenthaler
Tierzucht
Karin Wohlfender
Sektion Finanzinspektorat
Rolf Enggist,Marco Vanazzi
Ergebnisse der Agrarpolitik 2007
Thomas Meier,Gustav Munz
Trockenheit und Entlastungsprogramm 2003
Félix Mettraux
■ Internationale Aspekte
Internationale Entwicklungen
Nicole Bays,Friedrich Brand,Christoph Eggenschwiler,Jacques Gerber,Jean Girardin, Anton Kohler
Internationale Vergleiche
Jacques Gerber,Jean Girardin
Deutsch:Yvonne Arnold
Französisch:Christiane Bokor,Pierre-Yves Barrelet,Yvan Bourquard, Giovanna Mele,Elisabeth Tschanz,Marie-Thérèse Von Graffenried, Magdalena Zajac
Italienisch:Patrizia Vanini,Gisella Crivelli,Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Technische Unterstützung Hanspeter Leu,Peter Müller
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1999/2002
Quellen:
Milch und -produkte:SBV (1990–98),ab 1999 TSM
Fleisch:Proviande
Eier:GalloSuisse
Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:SBV,alle Mengen 2002 provisorisch
Obst:Schweizerischer Obstverband
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein:BLW,Kantone
1 Brotgetreideverwertung pro Kalenderjahr
2 Durchschnitt der Jahre 1990/93 3 Veränderung 1990/93–1999/2002 4 Veränderung 1990/93–1998/2001 n.v.:nicht verfügbar Quellen: Brotgetreide:BLW Kartoffeln:Eidgenössische Alkoholverwaltung,swisspatat Mostobst:BLW;Spirituosen:Eidgenössische Alkoholverwaltung Verarbeitungsgemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
1 0406.1010,0406.1020,406.1090
2 0406.2010,0406.2090
3 0406.3010,0406.3090
4 0406.4010,0406.4021,0406.4029,0406.4081,0406.4089
5 0406.9011,0406.9019
6 0406.9021,0406.9031,0406.9051,0406.9091
7 0406.9039,0406.9059,0406.9060,0406.9099
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1999/2002
3 Restzahlung nicht berücksichtigt,effektiver Preis 10% bis 15% höher 4geschätzt
Quellen:
Milch:BLW
Schlachtvieh,Geflügel,Eier:SBV
Getreide,Hackfrüchte und Ölsaaten:FAT
Obst:Schweizerischer Obstverband,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse:Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Tabelle 13
(Warenkorb aus Labelfleisch und konventionell produziertem Fleisch):BLW
Tabelle 14
1inkl.Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide,jedoch ohne Ölkuchen;ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2einschliesslich Hartweizen,Speisehafer,Speisegerste und Mais
3Äpfel,Birnen,Kirschen,Zwetschgen und Pflaumen,Aprikosen und Pfirsiche
4Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5einschliesslich Fleisch von Pferden,Ziegen,Kaninchen sowie Wildbret,Fische,Krusten- und Weichtiere
6verdauliche Energie in Joules,alkoholische Getränke eingeschlossen
7ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8Inlandproduktion zu Produzentenpreisen,Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
Tabelle 17
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%;2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%;2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion:Ackerbauzone plus Übergangszonen
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%;2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;1999:3.02%;2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion:Bergzonen II bis IV
Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
Tabelle 21a
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*neue Betriebstypologie FAT99
Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*neue Betriebstypologie FAT99
Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
Tabelle 22
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
Tabelle 23
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Talregion:Ackerbauzone plus Übergangszonen
Tabelle 24
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Hügelregion:Hügelzone und Bergzone I
Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
Tabelle 25
1Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (2000:3.95%;2001:3.36%;2002:3.22%)
2Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4Cashflow zu Investitionen total
5Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10(Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11(kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12(landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
*Bergregion:Bergzonen II bis IV
Quelle:Zentrale Auswertung,FAT
Tabelle 26
Ausgaben für Produktion und Absatz
Tabelle27
Absatzförderung:Verfügte Mittel
Sektoren/Produkt-Markt-BereichRechnung2001Rechnung20022VerfügteMittel2003 Fr.Fr.Fr.
Milchproduktion405592783368202439866830
KäseAusland268794011982565224534790
KäseInland479579237053725481040
Milch8884085101510009851000
Tierproduktion308734329312455069962
Fleisch220234317960003770125
Eier650000626000650000
Fische7000165008250
LebendeTiere228000472745641587 Honig0200000
Pflanzenbau595686967518338396594
Gemüse168474616927472690107
Obst190198423817112703987
Getreide753373885503695000
Kartoffeln7500007050001127500
Ölsaaten224820286872380000
Zierpflanzen641946800000800000
GemeinsameMassnahmen435523751371466981357
ÜbergreifendeMassnahmen(Bio,IP)171253721735423125187
ReserviertfürSchlussabrechnungenund
längerfristigeVerpflichtungen15644954826324
National572357595550211463439930
Regional1274648332963623000000
Total599822425879847666439930
1Budget,rollendePlanung
2nachprovisorischerAbrechnung
Quelle:BLW
Tabelle28
BezeichnungRechnung2001Rechnung20021Budget20032 Fr.Fr.Fr.
Marktstützung(ZulagenundBeihilfen)
ZulageaufverkästerMilch331835957318644295307959000
ZulagefürFütterungohneSilage487138524480818042200000
InlandbeihilfenfürButter1042778469293617689800000
InlandbeihilfenfürMagermilchundMilchpulver591064225923568354400000
InlandbeihilfenfürKäse1075531514047840
AusfuhrbeihilfenfürKäse948335314526464827300000
AusfuhrbeihilfenfürandereMilchprodukte99270773135623131200000
659450000593649997552859000
Marktstützung(Administration)
RekurskommissionenMilchkontingentierung538806605280000
AdministrationMilchverwertungund-kontingentierung664488169335157040000
669876169995677120000
Total666148761600649564559979000
1HinzukommendieausserordentlichenMittelimUmfangvon152,9Mio.Fr.,welchederBundwährenddenTurbulenzenaufdemMilchmarkt fürverschiedeneMassnahmeneingesetzthat.
2Kreditsperreberücksichtigt
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Tabelle29
BezeichnungRechnung2001Rechnung2002Budget20031 Fr.Fr.Fr.
Fleischfonds
EntschädigunganprivateOrganisationenSchlachtviehundFleisch73656567596262
AnkaufRindfleischfürhumanitäreZwecke16612751177802
EinlagerungsbeiträgevonKalbfleisch43558603963567
EinlagerungsbeiträgeRindfleischvonBanktieren(Muni,Rinder,Ochsen)67101401734769
EinlagerungsbeiträgeRindfleischvonVerarbeitungstieren(Kühen)35840820911
VerbilligungsbeiträgeRindsstotzen3212903256173
InformationskampagneSchweizerRindfleisch6496740 392653921374948415764000
PreisausgleichskassefürEierundEiprodukte
UmstellungsbeiträgefürbesonderstierfreundlicheLegehennenhaltung1369312342398
Sammel-undSortierkostenbeiträge3265103378880
Aufschlagsaktionen6675091671524
Verbilligungsaktionen425298627618
PraxisnaheVersuchebeimGeflügel255702319314
InvestitionsbeiträgefürStallbauten0247964
AusfuhrbeihilfenZucht-undNutzvieh321650220000016830000
VerwertungsbeiträgeSchafwolle800000800000594000
Total463699662033718243583000
1Kreditsperreberücksichtigt
Quellen:Staatsrechnung,BLW
Tabelle30
BezeichnungRechnung2001Rechnung2002Budget20032 Fr.Fr.Fr.
Ackerbaubeiträge317821393902251544550000
FlächenbeiträgefürÖlsaaten271560153217619236887400
FlächenbeiträgefürKörnerleguminosen395492263780517177500
FlächenbeiträgefürFaserpflanzen489234468272485100
AnbauprämienfürFuttergetreide18196800
Verarbeitungs-undVerwertungsbeiträge917199669458199696030000
Zuckerrübenverarbeitung450000004500000044550000
Ölsaatenverarbeitung428448085090008415000
Kartoffelverarbeitung189720001897211718810000
Saatgutproduktion381266038675843861000
Obstverwertung190750531821744519131750
VerarbeitungnachwachsenderRohstoffe575773158501262250
FörderungdesWeinbaus55375271229657312160908
Sachausgaben823648302482908
FörderungdesRebbaus10986128692251089000
Verwertungsmassnahmen14356551438781410989000
AlkoholfreieVerwertungvonTrauben069565100
Total129039632145901084152740908
1WeinabsatzförderungimAusland 2Kreditsperreberücksichtigt
Quellen:Staatsrechnung,BLW
AllgemeineDirektzahlungen1778807180365819290941994838
Flächenbeiträge1163094118677013038811316183
BeiträgefürdieHaltungRaufutterverzehrenderNutztiere254624258505268272283221
BeiträgefürdieTierhaltunguntererschwerendenProduktionsbedingungen255882251593250255289572
AllgemeineHangbeiträge95882967149664395811
HangbeiträgefürRebflächeninSteil-undTerrassenlagen9325100761004310051
ÖkologischeDirektzahlungen326520361309412664452448
Ökobeiträge258788278981329886359387
BeiträgefürdenökologischenAusgleich100674108130118417122347
BeiträgenachderÖko-Qalitätsverordnung(ÖQV)---8934
BeiträgefürdieextensiveProduktionvonGetreideundRaps(Extenso-Produktion)35135333983252631938 BeiträgefürextensivgenutzteWiesenaufstillgelegtemAckerland
(ÜbergangsbestimmungbisEnde2000)1765217150-BeiträgefürdenbiologischenLandbau11637121852348825484
BeiträgefürdiebesonderstierfreundlicheHaltunglandwirtschaftlicherNutztiere93690108118155455170684
Sömmerungsbeiträge67571812388052489561
Gewässerschutzbeiträge161109022543500
Kürzungen24366225421676321143
TotalDirektzahlungen2080961214242523249952426143
Anmerkung:EindirekterVergleichmitdenAngabenderStaatsrechnungistnichtmöglich.DieWertebetreffendDirektzahlungenbeziehensichaufdasgesamteBeitragsjahr; dieStaatsrechnungdagegenwiedergibtdiegetätigtenAusgabenwährendeinesKalenderjahrs.BeidenKürzungenhandeltessichumAbzügeaufgrundvongesetzlichen undadministrativenBegrenzungenundSanktionen.
Quelle:BLW
Tabelle32a
FlächenbeiträgeBeiträgefürRaufutterverzehrendeNutztiere
BetriebeFlächeTotalBeiträgeBetriebeRGVETotalBeiträge AnzahlhaFr.AnzahlAnzahlFr. Kanton
ZH3626693079325583019361515213114826 BE1280718771624358283589006141154603604 LU5170771289717996131722188719684629
UR6806731807994963753374541853
SZ1692237452846473514931369911704409 OW7047891947903761939643502355
NW4956028723837940624262089376
Tabelle32b
TierhaltungunterAllgemeineHangbeiträgeHangbeiträgeSteil-und erschwerendenBedingungenTerrassenlagenimRebbau
TotalTotalTotal BetriebeRGVEBeiträgeBetriebeFlächeBeiträgeBetriebeFlächeBeiträge AnzahlAnzahlFr.AnzahlhaFr.AnzahlhaFr.
Kanton
ZH78713101405414478152242145102191170318930
BE911213292473136478847947747200347396496330173
LU316648653214359363327217929093662101427270
UR6748123701276063247672260293111245
SZ151322444129282911478100454296574111122125
OW67410413599943664647242175826112500
NW4627169377527544438181705525000
GL3695770432972837233351510750127950
ZG380633529486673733075125818110930
FR19033558613080279159173942921942171420328
SO60710083384655758549561900035000
BL68911207315982668460192316421403662220
Tabelle33a
ÖkologischerAusgleich1BiologischerLandbau
BetriebeFlächeTotalBeiträgeBetriebeFlächeTotalBeiträge AnzahlhaFr.AnzahlhaFr.
1HochstammobstbäumeumgerechnetinAren
2ZuteilungderFlächenachHauptanteilderLN,dieeinBetriebineinerZonebewirtschaftet
Tabelle33b
ExtensiveProduktionvonBesonderstierfreundlicheHaltung GetreideundRapslandwirtschaftlicherNutztiere BetriebeFlächeTotalBeiträgeBetriebeGVETotalBeiträge AnzahlhaFr.AnzahlAnzahlFr.
Kanton
ZH1605625524956371971627639560051
BE5560172036881253872820550233384814
LU130733531341152377914297521636695
UR0003895598931590
SZ243313088933211403454685
OW241408436100811644481
NW00025467471074467
GL2290428969861166154
ZG8618574084393137692111348
FR13616358254333425179428615000809
SO821427617049981037306664721746
BL68333971339777529193652959287
SH3382487976004258104651489801
AR000593146852488280
AI000417110971954261
SG37882132276626218444313691901
GR2848083230842319542628696588
AG1735726729051931748582968843877
TG840279611182281696639999698259
Tabelle34a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2002
ExtensivgenutzteWiesenWenigintensivgenutzteWiesen
BetriebeFlächeTotalBeiträgeBetriebeFlächeTotalBeiträge AnzahlhaFr.AnzahlhaFr.
Tabelle34b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2002
StreueflächenHecken,Feld-undUfergehölze BetriebeFlächeTotalBeiträgeBetriebeFlächeTotalBeiträge
Tabelle34c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2002
BetriebeFlächeTotalBeiträgeBetriebeFlächeTotalBeiträge
Tabelle34d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2002
AckerschonstreifenHochstamm-Feldobstbäume BetriebeFlächeTotalBeiträgeBetriebeBäumeTotalBeiträge
Tabelle35
Beiträge für biologische Qualität und Vernetzung 2002
NurbiologischeQualität1NurVernetzung1BiologischeQualitätBeiträgeBund undVernetzung1
BetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeFlächeBetriebeTotalBeiträge
Tabelle36
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2002
Tabelle37
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2002
BesonderstierfreundlicheStallhaltungssystemeRegelmässigerAuslaufimFreien
BetriebeGVETotalBeiträgeBetriebeGVETotalBeiträge AnzahlAnzahlFr.AnzahlAnzahlFr.
Kanton
ZH10652286424288961846398577131155
BE3336532156359180847715228727025634
LU248356014681145435968696114825241
UR82894879183864704843672
SZ3034924545687917162172908998
OW175271332017742473671324304
NW12723102924862424437781981
GL66120212595828957841040196
ZG211482851850937689411592839
FR144428951332360023856533511677209
SO568100481082704969206183639042
BL3077013754049512123522205238
SH18655286426502114937847151
AR1682444292487591122412195793
AI140267544038541084221513876
SG104723199275295325576124410938948
1ZuteilungderFlächenachHauptanteilderLN,dieeinBetriebineinerZonebewirtschaftet
Tabelle38
TierkategorieGVEBetriebeGVEBetriebeGVEBetriebe
Zucht und Nutzung:
Milchkühe63754140037121226510219.012.7
Rinder,über1jährig1498883815633517671022.417.6
Stiere,über1jährig525080101240156523.619.5
weiblichesJungvieh,4bis12Monate33228301877539532222.717.6
männlichesJungvieh,4bis12Monate195638851933539.89.1
Aufzuchtkälber,unter4Monate24533264387215632329.423.9
Mutter- und Ammenkühe:
Mutter-undAmmenkühemitKälbern52358500039499283075.456.6
Mast: Rinder,Stiere,Ochsen,über4Monate36940731319230231152.131.6
Kälber,unter4Monate404464141996159149.424.8
Mastkälber11106186444698382042.320.5
Tabelle39
Beteiligung am RAUS-Programm 2002
TierkategorieGVEBetriebeGVEBetriebeGVEBetriebe AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl%%
Zucht und Nutzung:
Milchkühe637541400374176262388065.559.6
Rinder,über1jährig14988838156901342101260.155.1
Stiere,über1jährig525080102233347342.543.4
weiblichesJungvieh,4bis12Monate3322830187170291535551.250.9
männlichesJungvieh,4bis12Monate19563885466104023.826.8
Aufzuchtkälber,unter4Monate24533264385896604824.022.9
Mutter- und Ammenkühe:
Mutter-undAmmenkühemitKälbern52358500047053391889.978.4
Mast:
Rinder,Stiere,Ochsen,über4Monate36940731314186264838.436.2
Kälber,unter4Monate40446414901118622.318.5
Mastkälber111061864494516268.58.7
TotalRindvieh956844463875964692933662.363.2
TierederPferdegattung311191152624544769078.966.7
Schafe36659994327108636073.964.0
Ziegen799461565333279566.745.4
Dam-undRothirsche53815243311180.473.0
Bisons1681016810100.0100.0
Kaninchen337339681201423.63.6
TotalübrigeRaufutterVerzehrer7985223718577061373772.357.9
Zuchtschweine,über6Monate,undFerkel56645540524758164243.730.4
Remonten,bis6Monate,undMastschweine938881033649611354852.834.3
TotalSchweine1505331254374369437649.434.9
Zuchthennenund-hähne9792036732997.514.7
Legehennen16381143959577345958.524.0
Junghennen,-hähneundKüken185552321512211.623.3
Mastpoulets168241022285322417.021.9
Truten2036301193812695.241.9
TotalGeflügel380751607314656383038.523.8
TotalalleTierkategorien1225304527837432003482860.766.0
1BeitragsberechtigteBetriebe(Betriebe,dieDirektzahlungenerhaltenhaben)
Quelle:BLW
Tabelle40a
Sömmerungsbeiträge 2002
KantoneSchafeKühe,MilchschafeÜbrigeRaufutterBetriebeund (ohneMilchschafe)undMilchziegenverzehrendeTiereBeiträgeTotal
Tabelle40b
Gesömmerte Tiere 2002
KantoneKühegemolkenMilchziegenMilchschafeÜbrigeSchafeÜbrigeRaufutter verzehrendeTiere
Tabelle41a
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2002
TalzoneHZ
MerkmalEinheit10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haLNhaLNhaLNhaLNhaLNhaLN
ReferenzbetriebeAnzahl49827910918610627
VertreteneBetriebeAnzahl93335571287735041409636
LandwirtschaftlicheNutzflächeha15.1624.0336.1114.7424.0036.25
Direktzahlungennach
Direktzahlungsverordnung(DZV)
AllgemeineDirektzahlungentotalFr.228613520252491273084465160517
FlächenbeiträgeFr.205613246948007179763080446165
RaufutterverzehrerbeiträgeFr.206924934021309057776856
BeiträgefürTierhaltungunter
erschwerendenProduktionsbedingungenFr.119129254434348464248
HangbeiträgeFr.111110208189932243248
ÖkobeiträgetotalFr.655396041303665411030012826
ÖkologischerAusgleichFr.246832614866183338884047
ExtensiveProduktionFr.67596918425878162082
BiologischerLandbauFr.311440811415378362
BesonderstierfreundlicheNutztierhaltungFr.310049355517370652196336
TotalDirektzahlungennachDZVFr.294134480665526338505495173343
RohertragFr.183263274908338357158966246021317530
AnteilDirektzahlungennachDZVamRohertrag%16.016.319.421.322.323.1
AndereDirektzahlungen2Fr.131715424559109128043872
TotalDirektzahlungenFr.307304634870085349415775577215
AnteilDirektzahlungentotalamRohertrag%16.816.920.722.023.524.3
1DieErgebnissebasierenaufdenDatenderzentralenAuswertungderFAT
2Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,kantonaleundprivateBeiträge
Quelle:FAT
Tabelle41b
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2002
BZIBZII
MerkmalEinheit10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haLNhaLNhaLNhaLNhaLNhaLN
ReferenzbetriebeAnzahl15987281659553
VertreteneBetriebeAnzahl2970125767429681445975
LandwirtschaftlicheNutzflächeha15.4224.0434.7915.1724.3736.31
Direktzahlungennach
Direktzahlungsverordnung(DZV)
AllgemeineDirektzahlungentotalFr.350004834359605400765428169005
FlächenbeiträgeFr.184802930743887177042837840439
RaufutterverzehrerbeiträgeFr.4661612742726521798510548
BeiträgefürTierhaltungunter
erschwerendenProduktionsbedingungenFr.832990567811118331328714087
HangbeiträgeFr.352938533635401846313931
ÖkobeiträgetotalFr.6255912310640476277479332
ÖkologischerAusgleichFr.154323021913135017002167
ExtensiveProduktionFr.194497194232141433
BiologischerLandbauFr.72088539470012901293
BesonderstierfreundlicheNutztierhaltungFr.379954396391268046175439
TotalDirektzahlungennachDZVFr.412555746670244448396202878337
RohertragFr.151321210850259658128205180196211774
AnteilDirektzahlungennachDZVamRohertrag%27.327.327.135.034.437.0
AndereDirektzahlungen2Fr.128715702341195030973436
TotalDirektzahlungenFr.425425903672585467896512681773
AnteilDirektzahlungentotalamRohertrag%28.128.028.036.536.138.6
1DieErgebnissebasierenaufdenDatenderzentralenAuswertungderFAT
2Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,kantonaleundprivateBeiträge
Quelle:FAT
Tabelle41c
Direktzahlungen auf Betriebsebene1:nach Zonen und Grössenklassen 2002
BZIIIBZIV
MerkmalEinheit10–2020–3030–5010–2020–3030–503 haLNhaLNhaLNhaLNhaLNhaLN
ReferenzbetriebeAnzahl885515662816
VertreteneBetriebeAnzahl18149611499578
LandwirtschaftlicheNutzflächeha14.8624.5114.4823.15
Direktzahlungennach
Direktzahlungsverordnung(DZV)
AllgemeineDirektzahlungentotalFr.47356648654698964225
FlächenbeiträgeFr.17436286301704625768
RaufutterverzehrerbeiträgeFr.1020711849885211502
BeiträgefürTierhaltungunter
erschwerendenProduktionsbedingungenFr.14754178211618220571
HangbeiträgeFr.4959656649086384
ÖkobeiträgetotalFr.4152651439186911
ÖkologischerAusgleichFr.1230169612652249
ExtensiveProduktionFr.0000
BiologischerLandbauFr.69314928221989
BesonderstierfreundlicheNutztierhaltungFr.2229332618312673
TotalDirektzahlungennachDZVFr.51508713795090771135
RohertragFr.10740415310294586133267
AnteilDirektzahlungennachDZVamRohertrag%48.046.653.853.4
AndereDirektzahlungen2Fr.2425311319604186
TotalDirektzahlungenFr.53933744935286775321
AnteilDirektzahlungentotalamRohertrag%50.248.755.956.5
1DieErgebnissebasierenaufdenDatenderzentralenAuswertungderFAT
2Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,kantonaleundprivateBeiträge
3AufgrundderzukleinenStichprobewerdenkeineErgebnissedargestellt
Quelle:FAT
Tabelle42
Direktzahlungen auf Betriebsebene1 :nach Regionen 2002
MerkmalEinheitAlleTal-Hügel-BergBetrieberegionregionregion
ReferenzbetriebeAnzahl23791006698675
VertreteneBetriebeAnzahl51421230721394614403
LandwirtschaftlicheNutzflächeha19.3820.6818.0918.55
Direktzahlungennach
Direktzahlungsverordnung(DZV)
AllgemeineDirektzahlungentotalFr.36535305613519447404
FlächenbeiträgeFr.24391276392219921310
RaufutterverzehrerbeiträgeFr.4648260942538297
BeiträgefürTierhaltungunter
erschwerendenProduktionsbedingungenFr.5444125598613439
HangbeiträgeFr.205318927574358
ÖkobeiträgetotalFr.7168824973255287
ÖkologischerAusgleichFr.2361308721321420
ExtensiveProduktionFr.59692959265
BiologischerLandbauFr.577408457964
BesonderstierfreundlicheNutztierhaltungFr.3635382441452837
TotalDirektzahlungennachDZVFr.43704388104251952691
RohertragFr.194365242450179713131524
AnteilDirektzahlungennachDZVamRohertrag%22.516.023.740.1
DirektzahlungenprohaFr./ha2255187723502840
AndereDirektzahlungen2Fr.1927198113992350
TotalDirektzahlungenFr.45630407914391755041
AnteilDirektzahlungentotalamRohertrag%23.516.824.441.8
1DieErgebnissebasierenaufdenDatenderzentralenAuswertungderFAT
2Sömmerungsbeiträge,Anbaubeiträge,kantonaleundprivateBeiträge
Quelle:FAT
Tabelle43a
Auswertung von Vollzug und Kontrolle (ÖLN)
KantonDZ-KontrollierteBeanstandungenTotal berechtigteBetriebeBeanstandungen Betriebe
Nicht rechtzeitige Anmeldung
Düngerbilanz
Tiergerechte Haltung der NutztiereAufzeichnungenAusgeglichene
Angemessener Anteil an ökol.
AusgleichsflächenPufferstreifen / Grasstreifen
Geregelte Fruchtfolge
Geeigneter Bodenschutz
Auswahl und gezielte Anwendung von PflanzenbehandlungsmittelnAndere
CH524183401216411871430408171247152782748144925 n.v.:nichtverfügbar
Anmerkung:DieAngabenbasierenaufdenRückmeldungenderKantonezumVollzugunddenSanktionen.
Quelle:KantonaleBerichterstattungüberKontrolltätigkeitundSanktionen
Tabelle43b
KantonBeanstandungenBeanstandungenBetriebeSanktionenFlächenbeiträgeSanktionenin%
Tabelle44
KantonBodenverbesserungenLandwirtschaftlicheGebäudeTotalBeiträge
Tabelle45
Beiträge an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2002
MassnahmeBeiträgeGesamtkosten
TalregionHügelregionBergregionTotalTotal 1000Fr.
Bodenverbesserungen
Landumlegungen(inkl.Infrastrukturmassnahmen)11575515259602268768297
Wegebauten72310997421924332316
ÜbrigeTransportanlagen4204201652
Massnahmenzum
Boden-Wasserhaushalt12933341308293510387
Wasserversorgungen15733993556623003
Elektrizitätsversorgungen394625012418
WiederherstellungenundSicherungen131415113816845750
Grundlagenbeschaffungen732546144422
Total1379586372074843180144245
LandwirtschaftlicheGebäude
ÖkonomiegebäudefürRaufutterverzehrendeTiere93472206331410193025
Alpgebäude2304230414253
GemeinschaftsgebäudefürVerarbeitungundLagerung1251953203702
Total94722456234034210980
Gesamttotal13795181094531077214355225
Quelle:BLW
Tabelle46
Tabelle47
Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2002 (ohneBaukredite)
KantonStarthilfeKaufdesWohn-Ökonomie-Gemein-VerarbeitungBoden-Total BetriebesgebäudegebäudeschaftlicherundLagerungverbesdurchInventar-landw.serungen PächterkaufProdukte
Tabelle48
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2002 (Bundes-undKantonsanteile)
Tabelle49a
Übersicht über Beiträge
MassnahmeGenehmigteProjektein1000Fr.
200020012002
Beiträge820449569077214
LandumlegungenmitInfrastrukturmassnahmen271242741622687
Wegebauten12157120539243
Wasserversorgungen868559685566
AndereTiefbaumassnahmen8681192855684
ÖkonomiegebäudefürRaufutterverzehrendeTiere236672848331410
andereHochbaumassnahmen173024852624
Quelle:BLW
Tabelle49b
Übersicht über Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen
MassnahmebewilligteKreditein1000Fr.
200020012002
Investitionskredite1241951265105283412
Starthilfe713856998489520
KaufBetriebdurchPächter273751735535
Wohngebäude470824436044866
Ökonomiegebäude113710132921128221
GemeinschaftlicherInventarkauf,Verarbeitungund
LagerunglandwirtschaftlicherProdukte41821152610583
Bodenverbesserungen285511414687
Betriebshilfedarlehen1310623441335164
1vomKantonbewilligtQuelle:BLW
Tabelle50
Finanzhilfen für die Tierzucht 2002
TierartundMassnahmenBetragHerdebuchtiereZuchtorganisationen Fr.Anzahl
Rinder143890005638968
Herdebuchführung2819000
Milch-undFleischleistungsprüfungen10833000
Exterieurbeurteilungen737000
Pferde11225004812122
Schweine1677500163582
Schafe1094000854502
ZiegenundMilchschafe824000302184
Herdebuchführung595000
Milchleistungsprüfungen228000
GefährdeteRassen6280005
Total19735000700734
1identifizierteFohlen
Quellen:Staatsrechnung/Zuchtorganisationen
Tabelle51
Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung,in 1000 Fr.
Ausgabenbereich1990/922000200120021990/92–2000/02 %
AusgabenBLW269944233591613565776368370231.0
ProduktionundAbsatz16849949546969015579786191-43.9
Absatzförderung595215999858798
Milchwirtschaft1127273716156666149753583-36.8
Viehwirtschaft133902261934637020337-76.9
Pflanzenbau423819152826129040145901-66.4
Direktzahlungen772258211447023335752428673196.8
AllgemeineDirektzahlungen758332175898519165801981432148.7
ÖkologischeDirektzahlungen139263554854169954472412819.5
Grundlagenverbesserung20876124550327658822282018.9
Strukturverbesserungen1338798800010205890000-30.3
Investitionskredite271361000009818070000229.4
Betriebshilfe95277533000090001537.0
BeratungswesenundForschungsbeiträge214762201523039237376.8
BekämpfungderPflanzenkrankheitenundSchädlinge1449673521198996310.6
Pflanzen-undTierzucht23869210002119221087-11.6
Verwaltung3342944492540565359051.7
WeitereAusgaben3481633683293964463834979.9
AusfuhrbeiträgefürlandwirtschaftlicheVerarbeitungsprodukte938671118429835511490015.4
FamilienzulageninderLandwirtschaft7799691230914478040012.4
LandwirtschaftlicheForschungsanstalten9643111761912212711829723.8
Gestüt68436514700871960.9
Übriges73026546877750962704-11.0
TotalLandwirtschaftundErnährung304760537274903962222406719928.6
Anmerkung:DieStaatsrechnung1999bildetdieBasisfürdieAufteilungderfinanziellenMittelaufdieeinzelnenAufgabengebiete Sowurdenz.B.dieAufwendungenfürdieKartoffel-undObstverwertungoderdieAusgabenfürdieGetreideverwaltung 1990/92alsAusgabendesBLWeinbezogen.ZudiesemZeitpunktgabesdafürnochseparateRechnungen. DieZahlenfür1990/92sinddeshalbnichtidentischmitdenAngabeninderStaatsrechnung.
DieZunahmederVerwaltungsausgabenistvorallemdaraufzurückzuführen,dassLeistungenwiez.B.fürdiePensionskassen inderStaatsrechnungnichtmehrzentralgeführtsondernaufdieeinzelnenÄmteraufgeteiltwerden.
1DieausserordentlichenAusgabenimMilchsektorsindindiesemBetrageingerechnet.DiesgingzulastenvonanderenBereichen wiez.B.StrukturverbesserungenundViehwirtschaft.
Quellen:Staatsrechnung,BLW
EU-4:NachbarländerDeutschland(D),Frankreich(F),Italien(I)undÖsterreich(A)
EU-5:EU-4plusBelgien(B)oderNiederlande(NL)
EU-6:EU-4plusBelgien(B)undNiederlande(NL)
D:BundesrepublikDeutschland(inkl.ehemaligeDDRab1991)
Anmerkung:DieZahlenin Kursivschrift sindaufgrundvonIndizesberechnet(Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,SchweizerischeNationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.DepartmentofAgriculture
EU-4:NachbarländerDeutschland(D),Frankreich(F),Italien(I)undÖsterreich(A)
EU-5:EU-4plusBelgien(B)oderNiederlande(NL)
EU-6:EU-4plusBelgien(B)undNiederlande(NL)
D:BundesrepublikDeutschland(inkl.ehemaligeDDRab1991)
1DurchschnittderJahre1990/93(wegenAlternanz)undVeränderung1990/93–1998/2001
Anmerkung:DieZahlenin Kursivschrift sindaufgrundvonIndizesberechnet(Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,SchweizerischeNationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.DepartmentofAgriculture
-IMio.Fr./Jahr4411339534793304-23
-AMio.Fr./Jahr4362280829552790-35 USAMio.Fr./Jahr255129013267260315
EU-4:NachbarländerDeutschland(D),Frankreich(F),Italien(I)undÖsterreich(A)
EU-5:EU-4plusBelgien(B)oderNiederlande(NL)
EU-6:EU-4plusBelgien(B)undNiederlande(NL)
EU-4/6:NachbarländerDeutschland(D),Frankreich(F),Italien(I)undÖsterreich(A)sowieBelgien(B)und/oderdieNiederlande(NL)fürgewisseProdukte
D:BundesrepublikDeutschland(inkl.ehemaligeDDRab1991)
1DurchschnittderJahre1990/93(wegenAlternanz)undVeränderung1990/93–1998/2001
2DerStandardwarenkorbsetztsichausdenwichtigstenProduktionsvolumenderSchweizimDurchschnittderJahre1998–2000zusammen
Anmerkung:DieZahlenin Kursivschrift sindaufgrundvonIndizesberechnet(Eurostat)
Quellen:BLW,BFS,SBV,SchweizerischeNationalbank,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.DepartmentofAgriculture
-max(I:90/92,99,00,01)Fr./kg6.175.896.315.90-2
USAFr./kg2.743.994.113.6843
EierCHFr./Sk.0.570.580.600.615
EU-4(mitB,ohneF)Fr./Sk.0.250.250.250.24-1
-min(B:90/92,99,00,01)Fr./Sk.0.220.210.220.22-4
-max(A:90/92,99,00,01)Fr./Sk.0.330.340.350.343
USAFr./Sk.0.100.150.160.1443
EU-4:NachbarländerDeutschland(D),Frankreich(F),Italien(I)undÖsterreich(A)
AnmerkungzuLand:(min)und(max)-->jeweilsineinemJahrausgewiesenertiefster,resp.höchsterPreisdesbetreffendenLandes
Anmerkung:DerAnteilderLabelprodukte(Bio,M-7,CoopNaturaPlan)indenGeschäftenistinsbesonderebeimFleischinderSchweizgrösseralsimAusland.
Quellen:BLW,BFS,ZMP,nationaleStatistikämtervonF,B,A,USA,StatistikamtderStadtTurin(I)
EU-3(EU-4mitB,ohneF+I)Fr./kg1.751.541.491.44-15
-min(B:90/92,99,00,01)Fr./kg1.671.461.411.38-15
-max(A:90/92,99,00,01)Fr./kg1.891.661.661.60-13 USAFr./kg1.221.521.561.4423
PflanzenölCH-SonnenblumenFr./l5.053.963.753.88-24
-min(I:90/92,99,00,01)Fr./l1.942.122.012.026
-max(I:90/92;F:99,00,01)Fr./kg1.751.922.082.2719
USAFr./kg1.29---
TomatenCHFr./kg3.733.503.213.75-7
EU-5(EU-4plusB)Fr./kg3.603.373.143.46-8
-min(F:90/92;D:99,01;A:00)Fr./kg3.332.952.772.93-13
-max(I:90/92,99,00,01)Fr./kg4.413.813.734.45-9
USA(Freiland)Fr./kg3.295.154.924.5448
StandarwarenkorbCHFr./kg-----
EU-4/5Fr./kg-----
UnteresMittelEUFr./kg-----
OberesMittelEUFr./kg-----
USAFr./kg-----
EU-4:NachbarländerDeutschland(D),Frankreich(F),Italien(I)undÖsterreich(A)
1DurchschnittderJahre1990/93(wegenAlternanz)undVeränderung1990/93–1998/2001 AnmerkungzuLand:(min)und(max)-->jeweilsineinemJahrausgewiesenertiefster,resp.höchsterPreisdesbetreffendenLandes
Quellen:BLW,BFS,ZMP,nationaleStatistikämtervonF,B,A,USA,StatistikamtderStadtTurin(I)
Gesetze
–Bundesgesetz vom 29.April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz,LwG,SR 910.1)
–Bundesgesetz vom 20.März 1959 über die Brotgetreideversorgung des Landes (Getreidegesetz,SR 916.111.0)
–Bundesgesetz vom 4.Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB,SR 211.412.11)
–Bundesgesetz vom 4.Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG,SR 221.213.2)
–Bundesgesetz vom 8.Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz,LVG,SR 531)
–Bundesgesetz vom 13.Dezember 1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72)
–Zolltarifgesetz vom 9.Oktober 1986 (ZGT,SR 632.10)
–Bundesgesetz vom 20.März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz,SR 232.16)
–Bundesgesetz vom 20.Juni 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG,SR 836.1)
–Bundesgesetz vom 22.Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz,RPG,SR 700)
–Bundesgesetz vom 9.Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz,LMG,SR 817.0)
–Bundesgesetz vom 24.Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz,GSchG,SR 814.20)
–Tierschutzgesetz vom 9.März 1978 (TSchG,SR 455)
–Bundesgesetz vom 1.Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG,SR 451)
–Bundesgesetz vom 7.Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz,USG,SR 814.01)
Verordnungen
Allgemeines
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung,LBV,SR 910.91)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Erhebung und Bearbeitung von landwirtschaftlichen Daten (Landwirtschaftliche Datenverordnung,SR 919.117.71)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (SR 919.118)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung,SR 912.1)
Produktion und Absatz
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Branchen- und Produzentenorganisationen (SR 919.117.72)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Unterstützung der Absatzförderung von Landwirtschaftsprodukten (Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung,SR 916.010)
–Verordnung vom 28.Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung,SR 910.12)
–Verordnung vom 22.September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die entsprechende Kennzeichnung der pflanzlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung,SR 910.18)
–Verordnung vom 3.November 1999 über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung;LDV,SR 916.51)
–Allgemeine Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung,AEV,SR 916.01)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Kontingentierung der Milchproduktion (Milchkontingentierungsverordnung, MKV,SR 916.350.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über Zielpreis,Zulagen und Beihilfen im Milchbereich (Milchpreisstützungsverordnung, MSV,SR 916.350.2)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über die Höhe der Beihilfen für Milchprodukte sowie über Vorschriften für den Buttersektor und die Einfuhr von Vollmilchpulver (SR 916.350.21)
–Verordnung vom 7.Dezember 1999 für den Übergang zur neuen Milchmarktordnung (Übergangsverordnung Milch,SR 916.350.3)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Milchwirtschaft (Milchqualitätsverordnung,MQV,SR 916.351.0)
–Verordnung vom 13.April 1999 über die Qualitätssicherung bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten,Speiseöl und Speisefetten sowie von Kaseinen und Kaseinaten (Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung,VEMSK,SR 916.355.1)
–Verordnung des BLW vom 30.März 1999 über die Buttereinfuhr (SR 916.357.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung (Pferdeeinfuhrverordnung,PfEV,SR 916.322.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Schlachtvieh- und Fleischmarkt (Schlachtviehverordnung,SV,SR 916.341)
–Geflügelverordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 (SR 916.341.61)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion (Höchstbestandesverordnung,HBV,SR 916.344)
–Verordnung vom 7.Juli 1971 über die Verwertung der inländischen Schafwolle (SR 916.361)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Eiermarkt (Eierverordnung,EiV,SR 916.371)
–Eierverordnung des EVD vom 18.Juni 1996 (SR 916.371.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über Flächen- und Verarbeitungsbeiträge im Ackerbau (Ackerbaubeitragsverordnung,ABBV,SR 910.17)
–Allgemeine Verordnung vom 16.Juni 1986 zum Getreidegesetz (SR 916.111.01)
–Verordnung des EVD vom 16.Juni 1986 über die Brotgetreideversorgung des Landes (Brotgetreideverordnung,SR 916.111.011)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr von Saatgetreide,Futtermitteln,Stroh und Waren,bei deren Verarbeitung Futtermittel anfallen (Einfuhrverordnung Saatgetreide und Futtermittel,SR 916.112.211)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Verwertung sowie die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln (Kartoffelverordnung,SR 916.113.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben (Zuckerverordnung,SR 916.114.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse,Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG,SR 916.121.10)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Marktentlastungsmassnahmen bei Steinobst und die Verwertung von Kernobst (Verordnung über die Massnahmen bei Obst,SR 916.131.11)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung,SR 916.140)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über das Rebsortenverzeichnis und über die Prüfung der Rebsorten (SR 916.143.5)
Direktzahlungen
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverorndung,DZV,SR 910.13)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS-Verordnung,SR 910.132.4)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren im Freien (RAUS-Verordnung,SR 910.132.5)
–Verordnung vom 29.März 2000 über Sömmerungsbeiträge (Sömmerungsbeitragsverordnung,SöBV,SR 910.133)
–Verordnung vom 4.April 2001 über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung,ÖQV,SR 910.14)
Grundlagenverbesserung
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (Strukturverbesserungsverordnung,SVV,SR 913.1)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über die Abstufung der pauschalen Ansätze für Investitionshilfen (PAUV,SR 913.211)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Betriebshilfe als soziale Begleitmassnahme in der Landwirtschaft (Betriebshilfeverordnung,BHV,SR 914.11)
–Verordnung vom 8.November 1995 über die landwirtschaftliche Forschung (VLF,SR 426.10)
–Verordnung vom 13.Dezember 1993 über die landwirtschaftliche Berufsbildung (VLB,SR 915.1)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Tierzucht (SR 916.310)
–Verordnung vom 7.Dezember 1998 über die Produktion und das Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Saatgut-Verordnung,SR 916.151)
–Verordnung des EVD vom 7.Dezember 1998 über Saat- und Pflanzgut von Acker- und Futterpflanzenarten (Saat- und Pflanzgut-Verordnung des EVD,SR 916.151.1)
–Verordnung des EVD vom 11.Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von anerkanntem Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Obst,Beerenobst und Reben (SR 916.151.2)
–Verordnung des BLW vom 7.Dezember 1998 über den Sortenkatalog für Getreide,Kartoffeln,Futterpflanzen und Hanf (Sortenkatalog-Verordnung,SR 916.151.6)
–Verordnung vom 23.Juni 1999 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-Verordnung,SR 916.161)
–Verordnung vom 26.Januar 1994 über das Inverkehrbringen von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen (DüngerVerordnung,SR 916.171)
–Verordnung vom 28.Februar 2001 über Pflanzenschutz (Pflanzenschutzverordnung,PSV,SR 916.20)
–Verordnung des EVD vom 25.Januar 1982 über die Meldung von gemeingefährlichen Schädlingen und Krankheiten (SR 916.201)
–Verordnung vom 28.April 1982 über die Bekämpfung der San-José-Schildlaus,des Feuerbrandes und der gemeingefährlichen Obstvirosen (SR 916.22)
–Verordnung vom 26.Mai 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung,SR 916.307)
–Verordnung des EVD vom 10.Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln,Zusatzstoffen für die Tierernährung,Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung,FMBV,SR 916.307.1)
–Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 16.Juni 1999 über die GVO-Futtermittelliste (SR 916.307.11)
Es bestehen folgende Möglichkeiten,die Gesetzestexte einzusehen oder zu beschaffen:
–Zugriff via Internetwww.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
–Bestellen beim BBL,Vertrieb Publikationen
– via Internetwww.bundespublikationen.ch
– via Fax031 325 50 58
Begriffe
Abiotische Eigenschaften: Chemische oder physikalische Eigenschaften eines Raumes,wie klimatische Faktoren (Licht,Temperatur, usw.),Bodeneigenschaften,hydrologische Verhältnisse,Relief.
Biotische Eigenschaften: Eigenschaften eines Raumes,der durch die darin vorkommenden Pflanzen und Tiere hervorgehen.
Evaluation: Synonym auch für Erfolgskontrolle.Evaluation ist eine Methode zur Ermittlung und Beurteilung der Effektivität (Mass der Zielerreichung),Wirksamkeit (Ursache-Wirkungs-Beziehung) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) von Massnahmen oder Instrumenten.Im Voraus definierte Ziele sind Voraussetzung für eine Evaluation.Evaluationen dienen v.a.für Vergleiche:Kontrollgruppenvergleich, vorher/nachher-Vergleich,Querschnittsvergleich.
Externe Effekte: Externe Effekte oder Externalitäten sind positive oder negative Nebeneffekte auf Dritte oder die Gesellschaft,die durch Konsum- oder Produktionsvorgänge einzelner Akteure entstehen.Sie werden nicht unmittelbar über den Markt bzw.den Marktpreis erfasst und führen deshalb zu Marktverzerrungen und Fehlallokation von Gütern und Produktionsfaktoren.Ziel einer rationalen Wirtschaftspolitik ist es,die externen Effekte zu internalisieren.
Beispiele von Externen Effekten:
NegativexterneEffekte(sozialeKosten)
ProduktionKonsum
Negative Beeinträchtigung von Übermässiger Konsum von Alkohol und Tabak Trink-,Grund- und Oberflächenwasser bringt hohe Kosten im Gesundheitswesen durch unsachgemässe Düngung
PositivexterneEffekte(sozialeNutzen) Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft Breitensport als Freizeitbeschäftigung durch die landwirtschaftliche Produktionsenkt die Kosten des Gesundheitswesens
Landwirtschaftlicher Umweltindikator: Repräsentative Erhebung,die Daten über eine Ursache,einen Zustand,eine Umweltveränderung oder ein Umweltrisiko vereint,welche aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten hervorgehen und für die Entscheidungsträger von Bedeutung sind (z.B.Erosionsgrad der Böden;Definition der OECD).
Marktspanne: Differenz zwischen Konsumenten- und Produzentenpreis (absoluter Wert) bzw.Anteil am Konsumentenfranken,der den Marktstufen Verarbeitung und Handel zukommt (relativer Wert).Der Begriff Marge wird als Synonym verwendet.
Median: Zentralwert (statistische Grösse):Wert,der bei der Abzählung einer Reihe von der Grösse nach geordneten Merkmalswerten (z.B.Messreihe) in der Mitte liegt.
Milchäquivalent: Ein Milchäquivalent entspricht dem durchschnittlichen Fett- und Proteingehalt eines kg Rohmilch (73 g) und dient als Massstab zur Berechnung der in einem Milchprodukt verarbeiteten Milchmenge.
Mittel(wert): Durchschnitt (statistische Grösse):Summe der Zahlen einer Reihe dividiert durch die Anzahl der Zahlen.
Monitoring: Laufendes Beobachten anhand von Indikatoren über einen Zeitraum ohne problemorientiertes Erkennen der kausalen Zusammenhänge.Resultat eines Monitorings sind Entwicklungen aufzuzeigen.Beispiele:Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche,Vogelpopulationen usw.
Multifunktionalität der Landwirtschaft: Das Konzept einer multifunktionalen Landwirtschaft umschreibt die vielfältigen Funktionen, die die Landwirtschaft erfüllt.Es umfasst die Leistungen,die über die eigentliche Agrarproduktion hinausgehen.Hierzu zählen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln,die Pflege der Kulturlandschaft,die Erhaltung der natürlichen Produktionsgrundlagen und Artenvielfalt,sowie der Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes.Eine multifunktionale Landwirtschaft trägt wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.Die multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft sind in der Bundesverfassung (Art.104) festgehalten.
Öffentliche Güter: Öffentliche Güter zeichnen sich durch zwei Merkmale aus:Nichtrivalität und fehlendes Ausschlussprinzip. Nichtrivalität im Konsum heisst,dass aufgrund des Konsums andere Konsumenten und Konsumentinnen nicht beeinträchtigt werden. Fehlendes Ausschlussprinzip heisst,dass es bei öffentlichen Gütern nicht möglich ist,einzelne NutzerInnen vom Konsum auszuschliessen. Öffentliche Güter sind zum Beispiel die Landesverteidigung,die Freizeiterholung im Wald,der Genuss einer naturnahen Landschaft. Für öffentliche Güter existiert kein Markt und damit auch kein Marktpreis.Aus diesem Grund müssen öffentliche Güter durch den Staat selbst oder in dessen Auftrag von Dritten bereitgestellt werden.
Quartil: Viertel (statistische Grösse):Aufteilung einer der Grösse nach geordneten Reihe in vier Teile.
Schoggigesetz: Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72):Umsetzung des Protokolls 2 des Freihandelsabkommens Schweiz – EG von 1972.Ausgleich der Rohstoffpreisdifferenz zwischen Inland- und Weltmarktpreis für landwirtschaftliche Grundstoffe (Ausfuhr:Ausfuhrbeiträge / Einfuhr:bewegliche Teilbeträge).
Streuung: Varianz (statistische Grösse):Verteilung der Beobachtungen oder Messwerte um einen Mittelwert.
Veredlungsverkehr: Veredlungsverkehr bedeutet,dass für Waren,die zur Bearbeitung,Verarbeitung oder Reparatur vorübergehend eingeführt werden,unter bestimmten Voraussetzungen Zollermässigung oder -befreiung gewährt wird.Bei Landwirtschaftsprodukten und landwirtschaftlichen Grundstoffen wird der Veredlungsverkehr gewährt,wenn gleichartige inländische Erzeugnisse nicht in genügender Menge verfügbar sind oder für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachteil für die schweizerische Nahrungsmittelindustrie nicht durch andere geeignete Massnahmen ausgeglichen werden kann.
Zielpreis: Vom Bundesrat festgelegte Orientierungsgrösse je kg vermarktete Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein.Der Zielpreis soll für Milch erreicht werden können,die zu Produkten mit hoher Wertschöpfung verarbeitet und gut vermarktet wird.Die Höhe des Zielpreises hängt insbesondere von der Einschätzung der Marktlage und den verfügbaren Mitteln zur Marktstützung ab.Die Zulage für die Fütterung ohne Silage wird dabei nicht berücksichtigt.
Weitere Begriffe sind zu finden in: –«Betriebswirtschaftliche Begriffe in der Landwirtschaft» (Bezug bei:Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale,Länggasse 79,3052 Zollikofen). –Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (SR 910.91).
Das BLW erhebt die Produzentenpreise monatlich und orientiert über die Ergebnisse in der Publikation «Milchbericht».Unterschieden werden dabei folgende vier Preise:gesamte Milch,Industriemilch,verkäste Milch und Biomilch.Die Milchpreise werden nicht nur gesamtschweizerisch erhoben,sondern auch aufgeteilt in fünf Regionen: Region I: Genf,Waadt,Freiburg,Neuenburg,Jura und Teile des französischsprachigen Gebiets des Kantons Bern (Bezirke La Neuveville,Courtelary und Moutier). Region II: Bern (ausser Bezirke der Region I), Luzern,Unterwalden (Obwalden,Nidwalden),Uri,Zug und ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Schwyz und Küssnacht). Region III: Baselland und Basel-Stadt,Aargau und Solothurn. Region IV: Zürich,Schaffhausen,Thurgau,Appenzell (Innerrhoden und Ausserrhoden), St.Gallen,ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Einsiedeln,March und Höfe),Glarus,Graubünden. Region V: Wallis und Tessin.
Quelle: BLW
An der Milchpreiserhebung,die gemäss Übergangsverordnung Milch bei den Milchverwertern durchzuführen ist,nehmen alle wichtigen industriellen Milchverarbeiter sowie eine repräsentative Auswahl an Käsereien teil.Auf diese Weise können über 60% der produzierten Milch erfasst werden.Als ausbezahlter Milchpreis gilt gemäss Übergangsverordnung der Preis für Milch am Erfassungsort (ab Hof oder Sammelstelle),einschliesslich ortsüblicher Zulagen und Abzüge.Die Zulage für die Fütterung ohne Silage,freiwillige Verbandsbeiträge sowie Abzüge für Molke sind im erhobenen Milchpreis nicht enthalten.
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung bei Milch und Milchprodukten beinhaltet in einem ersten Schritt eine theoretische Wertschöpfungsberechnung in den Segmenten Konsummilch,Käse,Butter,Konsumrahm und Joghurt.Dabei wird die Wertschöpfung für die einzelnen Produkte je kg eingesetzte Rohmilch berechnet.So können die Werte untereinander verglichen werden.Die Wertschöpfung Milch und Milchprodukte stellt also die Differenz zwischen dem erzielten Grundpreis pro kg Rohmilch des Produzenten einerseits und dem Verkaufspreis je kg eingesetzte Rohmilch des des verarbeiteten Endprodukts dar.
Die so berechnete Wertschöpfung wird in einem zweiten Schritt korrigiert um die jeweiligen produktspezifischen Eigenschaften.So fliessen z.B.Beihilfen des Bundes,produktgebundene Ab- bzw.Zuschläge und der Wert der anfallenden Nebenprodukte in die Berechnung der Einzelmargen ein.Die Bruttomarge bei Milch und Milchprodukten ist das Resultat aus der Wertschöpfung und den produktspezifischen Eigenschaften.Bei der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte handelt es sich um einen Zusammenzug aller Bruttomargen der Produktgruppen Konsummilch,Käse,Butter,Konsumrahm und Joghurt.Diese setzen sich ihrerseits aus den Kalkulationen der beobachteten Indikatorprodukten zusammen.
Basis für die Berechnung der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte,sowie der Einzelmargen Konsummilch,Käse,Butter,Rahm und Joghurt bildet die in der Schweiz verwertete jährliche Rohmilchmenge.Entsprechend ihrem Anteil an der Rohmilchmenge wird jede Verwertungsart gewichtet.
Die Margenberechnung beschränkt sich auf die Wertschöpfung der in der Schweiz produzierten und konsumierten Milchprodukte.Die verarbeitete Milchmenge muss daher um den exportierten Anteil korrigiert werden.
Für die Erhebung der Konsumentenpreise wird zwischen den drei Verkaufskanälen Grossverteiler,Discounter und Fachhandel unterschieden.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des Institutes für Marktanalysen,Hergiswil (IHA GfM),nach Marktanteilen gewichtet.
8%Beihilfen, Abgaben Wert der Nebenprodukte,
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung auf Frischfleisch für den Konsum im Ladenverkauf ist ein Realwert (zum Preis von Januar 1999) ohne MwSt.(oMwSt.).Sie wird in Fr.pro kg Schlachtgewicht (SG) ausgedrückt.Die Bruttomarge stellt die Differenz zwischen dem Rohertrag und dem Total der variablen Kosten dar.Dieser Wert besteht auch aus der Differenz zwischen den Nettoeinnahmen und dem Einstandspreis.
Der Rohertrag entspricht dem Umsatz des Verarbeitungs- und Verteilungssektors bzw.den Ausgaben der Konsumentinnen und Konsumenten (Privathaushalte und Grosshandel).Darin eingeschlossen sind der Verkauf von Frischfleisch für den Konsum sowie die Verwertung von Wurstfleisch,Haut und Schlachtnebenprodukten auf Grosshandelsstufe.
Die gesamten variablen Kosten umfassen einerseits den bereinigten Einstandspreis des Viehs.Es handelt sich hierbei um einen gewichteten Durchschnittspreis (konventionell,Label),franko Schlachthof.Eine eventuelle Handelsspanne oder Transportkosten sind also in diesem Preis eingeschlossen,von dem jedoch sämtliche Vorteile aus den Einfuhren innerhalb des Zollkontingents abgezogen wurden. Andererseits sind in den variablen Kosten die Auslagen für die Entsorgung von Schlachtabfällen,Kopf und Füssen;die Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und der Beitrag zum Basismarketing der Proviande enthalten.
8.46 Fr./kg SG
variable
Anmerkung: Die Verhältnisse in dieser Abbildung sind nicht realitätsgetreu. Die angegebenen Preise stellen ein Beispiel für die Berechnung der Bruttomarge auf frischem Rindfleisch im Jahr 2000 dar. Rechnungseinheit sind Fr. pro kg Schlachtgewicht warm (SG) zu Festpreisen (Realwert 01.1999) ohne MwSt. Quelle: BLW
Die detaillierte Definition der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung findet sich in den Sonderausgaben des «Marktberichtes Fleisch» von Januar 2001 und April 2002 (Nummer 140 und 155),der von der Sektion Marktbeobachtung des BLW herausgegeben wird.Diese Nummern sind auf Anfrage erhältlich.
Früchte und Gemüse
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse ist die Differenz zwischen dem Einstandspreis der ersten Handelsstufe eines Produktes,ausgenommen Gebinde- und Verpackungskosten,und dem Endverkaufspreis (inkl.allfällige Gebinde- und Verpackungskosten).Sowohl die Daten des Inlandmarktes als auch diejenigen des Importmarktes fliessen in die Margenberechnungen ein.Beim Import sind die Zollabgaben enthalten.Berücksichtigt werden dabei je sieben bedeutende,umsatzstarke Früchte und Gemüse.Bei den Früchten sind dies Äpfel (Werte von Golden Delicious und den wichtigsten Lagersorten,sowie Granny Smith Import,mengengewichtet), Birnen (Werte Inlandbirnen und importierten Birnen ohne Abate- und Nashibirnen,mengengewichtet),Erdbeeren,Nektarinen,Kirschen, Aprikosen und Orangen.Beim Gemüse sind es Tomaten (Fleischtomaten,runde Tomaten,beide mit mengengewichtetem Anteil), Blumenkohl,gelbe Zwiebeln,Karotten,Brüsseler Witloof,Gurken und Kartoffeln.Die Mengengewichtungen stützen sich auf Zahlen des IHA · GfM,der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG),des Schweizerischen Obstverbandes (SOV),des Bundesamtes für Statistik (BFS) und der Oberzolldirektion (OZD).
Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse
Bruttomarge Gemüse
Der Einstandspreis der einzelnen Produkte setzt sich bei Inlandware aus dem Preis franko Verlader (bei Lagerware werden die Lagerkosten mitberücksichtigt) und bei Importware dem Importwert franko Grenze verzollt,beide mengengewichtet,zusammen.Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA · GfM nach Marktanteilen gewichtet.Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Gemüse zusammengefasst.
Bruttomarge Früchte
Hier ist das periodische Hinzustossen und Wegfallen von nur kurz auftretenden saisonalen Früchten eine Besonderheit bei der Gesamtmarge.Trotzdem kann diese Gesamtbetrachtung gerade im Mehrjahresvergleich wertvolle Anhaltspunkte liefern.
Der Einstandspreis setzt sich bei Inlandware aus dem Produzentenpreis franko Sammelstelle und bei der Importware dem Importwert franko Grenze verzollt,beide mengengewichtet,zusammen.Lager- und Zinskosten sind berücksichtigt.Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet.Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA GfM nach Marktanteilen gewichtet.Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Früchte zusammengefasst.
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung wird durch das BFS mit Unterstützung des Sekretariats des SBV nach dem europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (Eurostat) berechnet.Die neu zur Anwendung gelangende Methode basiert auf der LGR97Nomenklatur von Eurostat (vorher LGR89).Mit der Revision sind die Ergebnisse wieder direkt mit jenen der EU vergleichbar.
Im folgenden werden die methodischen Anpassungen dargestellt.Anhand eines Beispiels wird aufgezeigt,wie sich diese quantitativ auswirken.Bei der Revision handelt sich um eine umfassende Weiterentwicklung.Deshalb können die Ergebnisse nicht mit den Ergebnissen der Vorjahre verglichen werden,wie sie in den Agrarberichten 2000–2002 publiziert worden sind.
Zwei Gruppen von Anpassungen können unterschieden werden.Erstens die methodischen Änderungen im engeren Sinn und zweitens eine Reihe von Anpassungen,die sich auf die erfasste Grundgesamtheit und die berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen beziehen.
Methodische Änderungen im engeren Sinn
Abkehr vom Bundeshofkonzept
Im alten System wurde die Landwirtschaft als «Black Box» betrachtet.In der LGR berücksichtigt wurden somit lediglich die Waren- und Dienstleistungsflüsse zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft.Neu werden auch die innerlandwirtschaftlichen und die innerbetrieblichen Flüsse erfasst,letztere aber nur dann,wenn diese zwei verschiedene Produktionszweige betreffen (z.B.Futtermittelproduktion als Input für die Milch- oder Fleischproduktion).
Neudefinition der Preise
Der «Herstellungspreis» ersetzt den alten «Ab-Hof-Preis».Der Unterschied liegt darin,dass neu auch die Subventionen berücksichtigt werden,welche den Produkten direkt zugeordnet werden können (z.B.Siloverbotsentschädigung,Exportbeiträge für Tiere,Unterstützung der Kartoffelverwertung).Auch die Preise der Beschaffungsgüter («Anschaffungspreise») werden entsprechend korrigiert (z.B.Berücksichtigung der Treibstoffzollrückerstattungen bei Treibstoffen).
LGR89, alte MethodeLGR97, neue Methode
Produzentenpreis
Ab-Hof-Preis
+ Gütersteuer
Produzentenpreis+ Gütersubvention
Herstellungspreis – Gütersteuer
Anpflanzungen
Neupflanzungen sowie deren Zuwachs an Wert bis zu ihrer Reife werden bei der Produktion wie auch bei den Bruttoanlageinvestitionen erfasst.Nach Erreichen der Reife werden auf dem Wert auch Abschreibungen verbucht.Nach alter Methode wurden lediglich die gesamthaften Bestandesveränderungen erfasst (das heisst der Zuwachs oder die Abnahme des Gesamtbestands,ohne Berücksichtigung der Ersatzpflanzungen).
LGR89, alte MethodeLGR97, neue Methode
Rebfläche 2001
Rebfläche 2002
BAI: Bruttoanlageinvestitionen
NAI: Nettoanlageinvestitionen
Produktion = BAI
Rebfläche 2001
Rebfläche 2002
Produktion = BAI
NAI Abschreibungen
Anpassungen der erfassten Grundgesamtheit und der berücksichtigten Produkte und Dienstleistungen
Neu werden folgende Bereiche in die LGR einbezogen:
Ziergartenbau (Pflanzen und Blumen,Baumschulerzeugnisse).
– Dienstleistungen,angeboten von spezialisierten Betrieben (z.B.Lohnarbeiten,künstliche Besamung) oder Landwirten (z.B.Lohnarbeiten).
– Nichtlandwirtschaftliche (aber mit der landwirtschaftlichen Aktivität direkt verbundene) Nebentätigkeiten (nichtlandwirtschaftliche nicht trennbare Tätigkeiten).Dazu gehören einerseits die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Rohstoffen,andererseits aber auch der Einsatz landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren zu weiteren Zwecken (z.B.Schneeräumungen,Tierpensionen).
– Wein:Die Bewertung der Trauben erfolgt neu nach Verwertungszweck (Tafelwein,Qualitätswein,Tafeltrauben,Most) (LGR89: Bewertung der gesamten Traubenernte zu Preisen für Traubenmost).
Aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen werden Kleinproduzenten unter bestimmten Schwellenwerten.Betroffen sind vor allem ein Teil der Weinproduzenten,die Bienen- und Kaninchenzucht.
–Kleinstproduzenten
Landwirtschaftliche Produktion der von der LGR89 abgedeckten Betriebe
+ Ziergartenbau
+ Landwirtschaftliche Dienstleistungen der spezialisierten Betriebe
+ Bewertung des Weins aus eigener Produktion
+ Landwirtschaft. Dienstleistungen (Nebentätigkeit)
+ Nicht landwirtschaftliche, nicht trennbare Tätigkeiten
In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse der alten (LGR89) und der neuen (LGR97) Methode der LGR für den Durchschnitt der Jahre 1999/2001 verglichen.Auf jeder Stufe der LGR werden die Unterschiede den drei Gründen «methodische Anpassungen im engeren Sinn» «Einfluss Gartenbau» und «andere Einflüsse» zugeordnet.Gesamthaft betrachtet führen die Anpassungen dazu,dass auf allen Stufen der LGR die Werte zunehmen.
Auf der Stufe Gesamtproduktionswert und Vorleistungen kommt die Abkehr vom Bundeshofkonzept stark zum Ausdruck (Einbezug gewisser innerbetrieblichen und der zwischenbetrieblichen Flüsse).Der Einbezug des Gartenbaus und der Dienstleistungen wirkt sich ebenfalls auf beiden Stufen aus.Die Berücksichtigung des Gartenbaus wirkt sich zusätzlich besonders stark beim Arbeitnehmerentgelt aus.Die nicht landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten finden Eingang beim Gesamtproduktionswert und beeinflussen auch die Höhe des gesamthaften Arbeitnehmerentgelts,naturgemäss aber kaum die Vorleistungen.
Relativ stark wirkt sich auch der Übergang zu den neuen Herstellungspreisen aus.Die Berücksichtigung der produktgebundenen Subventionen bei den Preisen bedeutet auch,dass diese bei der Rubrik «sonstige Subventionen» nicht mehr aufgeführt werden.
Die Summe aller Anpassungen führt dazu,dass das Unternehmenseinkommen um rund 30% steigt.
Darstellung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs
Zusammensetzung des Gesamtproduktionswertes
Innerbetrieblicher Verbrauch
Verarbeitung durch die Produzenten
Eigenkonsum durch landwirtschaftliche Haushalte
Verkäufe an andere landwirtschaftliche Einheiten
Verkäufe ausserhalb der Landwirtschaft, im Inland und ins Ausland
Gütersubventionen
Selbsterstellte Anlagen
Vorratsveränderung
Sonstige Subventionen
Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen
Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen
Faktoreinkommen
Nettobetriebsüberschuss / Selbständigeneinkommen
Nettounternehmenseinkommen 1
Pachten und Schuldzinsen
Arbeitnehmerentgelt Sonstige Produktionsabgaben
1 Wird in der Literatur und Eurostat-Methodik als Nettounternehmensgewinn bezeichnet.
AbschreibungenVorleistungen
Neue Auswertungsmethodik
Mit den Buchhaltungsabschlüssen des Jahres 1999 erfuhr die Zentrale Auswertung grundlegende methodische Änderungen.In der Vergangenheit wurden für die Ermittlung der Einkommen restriktiv abgegrenzte «Testbetriebe» verwendet (z.B.Beschränkung des Nebenverdienstes,Forderung einer Fachschulbildung).Auf Grund der bewussten positiven Selektion der Testbetriebe konnten konsequenterweise auch nur Aussagen über diese Betriebe selbst gemacht werden.Im neuen System erlauben die sogenannten «Referenzbetriebe» repräsentative Aussagen über die gesamte Landwirtschaft.
Überblick über die methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung
– Als Grundgesamtheit werden diejenigen schweizerischen Betriebe bezeichnet,die grundsätzlich als Referenzbetriebe für die Zentrale Auswertung in Frage kommen.Dazu müssen sie minimale physische Schwellen erreichen.Sobald ein Betrieb z.B.mindestens 10 ha Land bewirtschaftet oder mindestens 6 Kühe hält,gehört er zur Grundgesamtheit.Die Grundgesamtheit umfasst rund 57‘000 Betriebe,was rund 90% der bewirtschafteten Fläche und rund 90% der Produktion entspricht.
– Aus der Grundgesamtheit werden ca.3‘500 Referenzbetriebe ausgewählt.
Da die Strukturen der Referenzbetriebe der Zentralen Auswertung von den Strukturen in der Gesamtlandwirtschaft abweichen, werden die Buchhaltungsergebnisse gewichtet.Dazu wird aus der Betriebsstrukturerhebung die Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrössen,Betriebstypen und Zonen herangezogen.Mit diesem Vorgehen ist gewährleistet,dass z.B.Buchhaltungsergebnisse von kleineren Betrieben,die in der Auswahl der Referenzbetriebe untervertreten sind,in der Auswertung das entsprechende Gewicht erhalten.
– Eine neue Betriebstypologie erlaubt eine bessere Unterscheidung der agrarpolitisch bedeutenden Betriebstypen.Rund zwei Drittel der Betriebe entfallen auf sieben spezialisierte Betriebstypen,die eine Konzentration auf bestimmte Betriebszweige des Pflanzenbaus oder in der Tierhaltung aufweisen.Das restliche Drittel teilt sich auf in vier Typen kombinierter Betriebe (vgl.weiter unten).
Die weiter gefasste Grundgesamtheit und die Gewichtung verbessert die Aussagekraft der Ergebnisse der Zentralen Auswertung für die gesamte Landwirtschaft erheblich.Auch die internationale Vergleichbarkeit der Buchhaltungsdaten wird erleichtert.Die methodischen Änderungen sind insgesamt derart bedeutend,dass eine Vergleichbarkeit mit älteren Berichten der Zentralen Auswertung nicht mehr gegeben ist.Um dennoch Mehrjahresvergleiche anstellen zu können,wurden die Buchhaltungsergebnisse der Vorjahre ebenfalls mit der neuen Methodik berechnet.
Die neue Betriebstypologie FAT99
Im Rahmen der methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung der FAT wurde die alte Betriebstypologie nach Grüner Kommission (1966) durch eine neue Typologie (FAT99) ersetzt.Neben der Verwendung in der Ergebnisdarstellung wird die Betriebstypologie für den Auswahlplan der Betriebe der Zentralen Auswertung und für die Gewichtung der einzelbetrieblichen Ergebnisse eingesetzt.
Die Einteilung der Betriebe nach der neuen Typologie erfolgt ausschliesslich auf der Basis von physischen Kriterien,nämlich Flächen und GVE verschiedener Tierkategorien.Mit insgesamt zehn Kennzahlen bzw.acht Quotienten je Betrieb ist eine differenzierte und eindeutige Einteilung möglich.
BereichBetriebstypGVE/OAF/SKul/RiGVE/VMiK/MAK/PSZ/SG/Andere LNLNLNGVERiGVERiGVEGVEGVEBedingungen
11PflanzenbauAckerbaumax. übermax.
170%10%
12Spezialkulturenmax. über 110%
21TierhaltungVerkehrsmilchmax.max. über über max. 25%10%75%25%25%
22Mutterkühemax.max. über max. über 25%10%75%25%25%
23Anderes Rindviehmax.max. übernicht 21 25%10%75%oder 22 31Pferde/Schafe/max.max. über Ziegen25%10%50%
41Veredlungmax.max. über 25%10%50%
51KombiniertVerkehrsmilch/ über über übermax.nicht Ackerbau40%75%25%25%11– 41
52Mutterkühe übermax. übernicht 75%25%25%11– 41
53Veredlung übernicht 25%11– 41
54Andere nicht 11– 53
Die Kriterien in einer Zeile müssen alle gleichzeitig erfüllt sein.
Abkürzungen:
GVEGrossvieheinheit
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche in ha
GVE/LNViehbesatz je ha LN
OAF/LNAnteil offene Ackerfläche an LN
SKul/LNAnteil Spezialkulturen an LN
RiGVE/GVEAnteil Rindvieh-GVE am Gesamtviehbestand
VMiK/RiGVEAnteil Verkehrsmilchkühe am Rindviehbestand
MAK/RiGVEAnteil Mutter-/Ammenkühe am Rindviehbestand
PSZ/GVEAnteil Pferde-,Schaf- und Ziegen-GVE am Gesamtviehbestand
SG/GVEAnteil Schweine- und Geflügel-GVE am Gesamtviehbestand
Quelle:FAT
Es werden sieben spezialisierte und vier kombinierte Betriebstypen unterschieden.Die spezialisierten Pflanzenbaubetriebe (11 und 12) verfügen über einen Viehbesatz von weniger als einer GVE je ha LN.Bei den Ackerbaubetrieben überschreitet der Anteil offener Ackerfläche 70% der LN,für die Spezialkulturbetriebe liegt der Anteil entsprechender Kulturen über 10%.Die spezialisierten Tierhalter (21 bis 41) haben als gemeinsame Beschränkung maximal 25% offene Ackerfläche und maximal 10% Spezialkulturfläche.Die Verkehrsmilchbetriebe weisen über 25% des Rindviehbestandes als Milchkühe mit vermarkteter Milch (Verkehrsmilch) aus,analog werden die Mutterkuhbetriebe abgegrenzt.In der verbleibenden Gruppe «Anderes Rindvieh» befinden sich vor allem Betriebe mit Milchkühen ohne Kontingent (spezialisierte Kälbermäster oder Aufzuchtbetriebe im Berggebiet).In den Veredlungsbetrieben machen Schweine- und Geflügel-GVE mehr als die Hälfte des Viehbestandes aus.Betriebe,die sich keinem der sieben spezialisierten Betriebstypen zuteilen lassen, gelten als kombinierte Betriebe (51 bis 54).
Aspekte der Darstellung
Artikel 7 der Nachhaltigkeits-Verordnung legt fest,dass die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft auch regionenweise zu beurteilen ist. Dementsprechend werden auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung drei Regionen definiert:
Talregion:Ackerbauzone, Übergangszonen
– Hügelregion:Hügelzone,Bergzone I
– Bergregion:Bergzonen II bis IV
Abgrenzung Tal-, Hügel- und Bergregion (Zuteilung der Gemeinden nach grösstem Zonenanteil)
Talregion Hügelregion Bergregion
Gemeindegrenzen: © BFS GEOSTAT
Quelle: AGIS-Daten 1998
Um eine differenzierte Beurteilung der Streuung von bestimmten Kennzahlen zu erreichen,werden die Betriebe in Quartile eingeteilt. Einteilungskriterium ist der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft (FJAE).In jedem Quartil (0–25% / 25–50% / 50–75% / 75–100%) befinden sich je ein Viertel der Betriebe aus der Grundgesamtheit.
Die Darstellung nach Quartilen erlaubt eine ökonomisch differenzierte Beurteilung.Auf eine ökologische Differenzierung wird verzichtet, weil der Anteil der Referenzbetriebe ohne ÖLN weniger als 3% ausmacht und die Differenz der Arbeitsverdienste minimal ist.
Gemäss Artikel 5 LwG ist die wirtschaftliche Lage «im Durchschnitt mehrerer Jahre» zu beurteilen.Bei Entwicklungen werden deshalb mehrere Jahre dargestellt.Die statischen Betrachtungen stellen auf das aktuellste verfügbare Drei-Jahresmittel (1998/2000) ab.
Für die Gegenüberstellung der Arbeitseinkommen wird auf der Seite der Landwirtschaft der Arbeitsverdienst und auf der Seite der übrigen Bevölkerung ein Jahres-Bruttolohn ermittelt.Die Lohnsituation der übrigen Bevölkerung wird durch die vom BFS alle zwei Jahre durchgeführte Lohnstrukturerhebung erfasst.In den dazwischen liegenden Jahren werden die Werte mit Hilfe der Entwicklung des Lohnindexes aktualisiert.Die Lohnstrukturerhebung gibt einen repräsentativen Überblick über die Lohnsituation der Beschäftigten in der Industrie (Sekundärsektor) und im Dienstleistungsbereich (Tertiärsektor).
Erfasste Lohnkomponenten (gemäss Lohnstrukturerhebung BFS)
Bruttolohn im Monat Oktober (inkl.Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherung,Naturalleistungen,regelmässig ausbezahlte Prämien-,Umsatz- oder Provisionsanteile),Entschädigungen für Schicht-,Nacht- und Sonntagsarbeit, 1⁄12 vom 13.Monatslohn und 1⁄12 von den jährlichen Sonderzahlungen.
Standardisierung: Umrechnung der erhobenen Beiträge (inkl.Sozialabgaben) auf eine einheitliche Arbeitszeit von 4 1⁄3 Wochen à 40 Stunden.
Die Werte der Lohnstrukturerhebung werden auf Jahres-Bruttolöhne umgerechnet.Anschliessend wird für jede Region der Median über alle im 2.und 3.Sektor Beschäftigten gebildet.
Auf Seite der Landwirtschaft wird als Pendent zu den Jahres-Bruttolöhnen der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst pro FJAE berechnet. Die Basis für eine FJAE sind 280 Arbeitstage,wobei eine Person maximal 1,0 FJAE entspricht.
Berechnung des landwirtschaftlichen Arbeitsverdienstes
Landwirtschaftliches Einkommen
Zins für das im Betrieb investierte Eigenkapital (mittlerer Zinssatz für Bundesobligationen)
=Arbeitsverdienst der Betriebsleiterfamilie
:Anzahl Familienarbeitskräfte (FJAE) (Basis:280 Arbeitstage)
=Arbeitsverdienst pro FJAE
Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen (Stand August 2003)
Allgemeine Anforderungen
Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,welche einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben.Keine Direktzahlungen gibt es für Betriebe des Bundes,der Kantone und der Gemeinden sowie für Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen,deren Tierbestände die Grenzen der Höchstbestandesverordnung überschreiten.Ebenfalls ausgeschlossen sind juristische Personen,sofern es sich nicht um Familienbetriebe handelt (Artikel 2 Direktzahlungsverordnung).
Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen,welche Direktzahlungen beantragen,müssen der kantonalen Behörde den Nachweis erbringen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ÖLN oder nach vom Bundesrat anerkannten Regeln bewirtschaften (vgl.hierzu Ausführungen weiter hinten).
Weitere Bedingungen
Die Beitragsberechtigung ist an weitere strukturelle und soziale Kriterien geknüpft.Die Übersicht fasst die Bedingungen für die Ausrichtung der Direktzahlungen stichwortartig zusammen.
Bedingungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen
MindestgrössedesBetriebes
MinimalerArbeitsbedarf
BetriebseigeneArbeitskräfte
1 ha
Spezialkulturen:50 Aren
Reben in Steil- und Terrassenlagen:30 Aren
0,3 Standard-Arbeitskräfte (SAK)
Mindestens 50% der für die Bewirtschaftung erforderlichen Arbeiten mit betriebseigenen Arbeitskräften (Familie und Angestellte) ausführen
AlterdesBewirtschafters bis 65 Jahre
Beitragsbegrenzungen
AbstufungFläche in haTiere in GVEAnsatz in % bis3045100
30–6045–9075
60–9090–13550
über901350
maximaler Betrag pro SAK
55 000 Fr.
– massgebliches Einkommen (steuerbares Einkommen vermindert um Summe der Direktzahlungen wird ab 80 000 Fr.massgebliches Einkommen 30 000 Fr.für verheiratete Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter)reduziert.
– massgebliches Vermögen (steuerbares Vermögen,vermindert umSumme der Direktzahlungen wird ab 800 000 Fr.massgebliches Vermögen 200 000 Fr.pro SAK und um 200 000 Fr.für verheiratetereduziert; übersteigt das massgebliche Vermögen 1 Mio.Fr.werden keine Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter) Direktzahlungen ausbezahlt.
Quelle:Direktzahlungsverordnung
Die Berechnung der SAK wird mit Umrechnungsfaktoren für die LN und die Nutztiere vorgenommen.Für gewisse Nutzungen wie z.B.den arbeitsaufwendigeren biologischen Landbau,gibt es Zuschläge.Die Faktoren sind abgeleitet aus der standardmässigen Erfassung arbeitswirtschaftlicher Abläufe.Sie sind für den Vollzug der Direktzahlungen und der Massnahmen zur Strukturverbesserung vereinfacht worden. Für die Berechnung des effektiven Arbeitsbedarfs sind sie nicht geeignet,weil dieser von den speziellen Eigenschaften des einzelnen Betriebes wie der Oberflächengestaltung,der Arrondierung,den Gebäudeverhältnissen oder dem Mechanisierungsgrad abhängt.
Abstufung der Beiträge nach Artikel 20 Direktzahlungsverordnung
Die prozentuale Abstufung gilt für sämtliche Beitragsarten mit Ausnahme der Sömmerungs- und der Gewässerschutzbeiträge.
Der ÖLN strebt eine gesamtheitliche Betrachtung der Agro-Ökosysteme und der landwirtschaftlichen Betriebe an.Zu diesem Zweck wurden der bei der Integrierten Produktion (IP) entwickelte Ansatz übernommen.So wird der ÖLN aufgrund der Auflagen der IP (Stand 1996) konkretisiert.Zusätzlich hat der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachzuweisen,dass die Vorschriften des Tierschutzgesetzes eingehalten werden.Somit ist die IP,ergänzt mit den Auflagen der Tierschutzbestimmungen,zum Standard der Landwirtschaft in der Schweiz geworden.Direktzahlungen werden nur an Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ausbezahlt,die den ÖLN erbringen. Bewirtschafter von Betrieben auf denen der ÖLN nicht erfüllt ist,erhielten bis zum 31.Dezember 2001 Direktzahlungen;diese aber mit einer Kürzung.Mit der Einführung des ÖLN wurden Auflagen der Integrierten Produktion (IP,Stand 1996) übernommen.Die Einführung von Direktzahlungen hat die Bewirtschaftungsmethoden und dadurch die Ökologie ganz wesentlich beeinflusst.Dies zeigt die starke Zunahme der nach den ÖLN- und Bio-Richtlinien bewirtschafteten Flächen:Zu Beginn der ersten Etappe der Agrarreform im Jahre 1993 betrug dieser Anteil knapp 20% der LN.Heute sind es mehr als 99% der LN.Dank gezielten finanziellen Anreizen konnte diese hohe Beteiligung der Betriebe erreicht werden.Zusätzlich ist noch zu vermerken,dass gewisse Betriebe,wie z.B.Staatsbetriebe oder juristische Personen im Direktzahlungssystem nicht erfasst sind,obwohl sie die ÖLN- oder Bio-Anforderungen erfüllen.
Der ÖLN umfasst die folgenden Punkte:
– Aufzeichnungs- und Nachweispflicht:Wer Direktzahlungen beansprucht,erbringt der kantonalen Behörde den Nachweis,dass er die ökologischen Leistungen auf dem gesamten Betrieb erfüllt.Als Nachweis gilt das Attest einer vom Kanton beigezogenen Kontrollorganisation.Um diese Bestätigung zu erhalten,macht der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin regelmässige Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs.
– Tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere:Die Bestimmungen der Tierschutzverordnung sind einzuhalten.Dabei gilt die Beweislastumkehr,das heisst,der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat zu belegen,dass auf dem Betrieb das Tierschutzgesetz eingehalten wird.
Ausgeglichene Düngerbilanz:Um die Nährstoffverluste in die Umwelt zu verringern und möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe zu erzielen,muss die Stickstoff- und Phosphorzufuhr aufgrund des Bedarfs der Pflanzen und des Produktionspotenzials des Betriebs berechnet werden.Mit der Düngerbilanz werden prioritär die Hofdünger eingesetzt;Mineraldünger und Abfalldünger werden nur wenn nötig eingesetzt.Eine Toleranzgrenze von plus 10% wird gewährt.
Mindestens alle zehn Jahre sind parzellenweise Bodenanalysen durchzuführen,um die Nährstoffreserven im Boden zu ermitteln und die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit notwendige Düngermenge entsprechend anzupassen.
Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF):Mindestens 3,5% der LN bei Spezialkulturen und 7% bei der übrigen LN sind mit ÖAF zu belegen.Entlang von Wegen sind Wiesenstreifen von mindestens 0,5 m und entlang von Oberflächengewässern, Hecken,Feldgehölzen,Ufergehölzen und Waldrändern von mindestens 3 m zu belassen.
– Geregelte Fruchtfolge:Für Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche muss zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit der Pflanzen die Fruchtfolge jedes Jahr mindestens vier Kulturen umfassen.Zudem sind Höchstanteile der Hauptkulturen an der Ackerfläche oder Anbaupausen vorgeschrieben.
Geeigneter Bodenschutz:Für jede Kultur ist ein Bodenschutzindex festgelegt.Damit Bodenerosion,Nährstoffverluste und Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln verringert werden,muss jeder Betrieb mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche einen minimalen mittleren Bodenschutzindex erreichen.Beim Ackerbau beträgt dieser 50 Punkte,beim Gemüsebau 30 Punkte.Die Stichtage sind jeweils der 15.November und der 15.Februar.
Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln:Pflanzenbehandlungsmittel können in die Luft,den Boden und die Gewässer gelangen und nachteilige Auswirkungen auf Organismen haben.Daher sind natürliche Regulationsmechanismen und biologische Verfahren vorzuziehen.Im Acker- und Futterbau sind gewisse Behandlungsverfahren (z.B.Vorauflaufbehandlung mit Herbiziden bei Weizen) verboten.Bei den Spezialkulturen werden mit gewissen Verwendungseinschränkungen zugelassene Produkte in regelmässig aktualisierten Listen aufgeführt.
Wird die Einhaltung landwirtschaftsrelevanter Vorschriften wie diejenigen des Gewässer-,des Umwelt- sowie des Natur- und Heimatschutzgesetzes verletzt,kommt zusätzlich zur Busse eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Direktzahlungen hinzu.
Nachfolgend einige Beispiele von Vorschriften,deren Verletzung Sanktionen zur Folge haben kann:
Einhaltung der Sorgfaltspflicht um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Artikel 3 Gewässerschutzgesetz);
– Verbot,Stoffe die Gewässer verunreinigen können in ein Gewässer einzubringen,oder versickern zu lassen oder so zu lagern oder auszubringen,dass dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (Artikel 6 Gewässerschutzgesetz);
Nichteinhalten der DGVE-Grenzwerte nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz (gemessen an der düngbaren LN); – Nicht vorschriftsgemässe Lagerkapazität für Hofdünger nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz;
– Zerstörung oder Beschädigung eines vom Bund oder Kanton geschützten Biotopes,insbesondere Riedgebiete und Moore,Hecken, Feldgehölze und Trockenstandorte ,sowie eines geschützten Natur- oder Kulturdenkmals,eine geschützte geschichtliche Stätte oder eine geschützte Naturlandschaft (inkl.Moorlandschaft),sofern sie durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung verursacht wird (Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 18 Absatz 1bis Natur- und Heimatschutzgesetz);
– Verstösse gegen das Verbot von Verbrennen von Abfällen (Artikel 26 Luftreinehalteverordnung).
Verstösse gegen die Vorschriften werden je nach Vorgeschichte und Wirkung der Widerhandlung im Einzelfall einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet:
– Erstmalige Verstösse ohne Dauerwirkung.Beispiel:Einmaliges gewässerschutzwidriges Güllen (Kürzung um 5 bis 25%,höchstens 2‘500 Fr.); – Erstmalige Verstösse,deren Wirkung andauert oder deren Handlung oder Unterlassung sich über eine mehrere Tage,Wochen oder Monate umfassende Zeitspanne erstreckt.Beispiel:Unbefestigter Miststock.Mehrmaliges gewässerschutzwidriges Güllen an verschiedenen Tagen (Kürzung um 10 bis 50%,höchstens 10‘000 Fr.);
Wiederholte Verstösse,also Widerhandlungen gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von drei Jahren. Massgebend sind die Vorfälle ab dem Jahr 1999 (Kürzung um 20 bis 100%).
Organisationen/Institutionen
BAGBundesamt für Gesundheit,Bern
BBTBundesamt für Berufsbildung und Technologie,Bern
BLWBundesamt für Landwirtschaft,Bern
BSVBundesamt für Sozialversicherung,Bern
BUWALBundesamt für Umwelt,Wald und Landschaft,Bern
BVETBundesamt für Veterinärwesen,Bern
BWLBundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung,Bern
ETHEidgenössische Technische Hochschule,Zürich
EUEuropäische Union
EVDEidg.Volkswirtschaftsdepartement,Bern
EZVEidg.Zollverwaltung,Bern
FALEidg.Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau,Zürich-Reckenholz
FAMEidg.Forschungsanstalt für Milchwirtschaft,Bern-Liebefeld
FAOFood and Agriculture Organization of the United Nations,Rom
FATEidg.Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik,Tänikon
FAWEidg.Forschungsanstalt für Obst-,Wein- und Gartenbau,Wädenswil
FiBLForschungsinstitut für Biologischen Landbau,Frick
IAWInstitut für Agrarwirtschaft,Zürich
LBLLandwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
OECDOrganisation for Economic Cooperation and Development,Paris
OZDOberzolldirektion,Bern
RACEidg.Forschungsanstalt für Pflanzenbau,Changins
RAPEidg.Forschungsanstalt für Nutztiere,Posieux
SBVSchweizerischer Bauernverband,Brugg
secoStaatssekretariat für Wirtschaft,Bern
SMPSchweizerische Milchproduzenten,Bern
SRVAService romand de vulgarisation agricole,Lausanne
TSMTreuhandstelle Milch,Bern
WTOWorld Trade Organization (Welthandelsorganisation),Genf
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft,Bonn
Masseinheiten
dtDezitonne = 100 kg
Fr.Franken
hStunden
haHektare = 10 000 m2
hlHektoliter
KcalKilokalorien
kgKilogramm kmKilometer
lLiter
mMeter
m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
Mio.Million
Mrd.Milliarde
Rp.Rappen
St.Stück
tTonne
%Prozent
ØDurchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGISAgrarpolitisches Informationssystem
AHVAlters- und Hinterlassenenversicherung
AKArbeitskraft
AKZAAusserkontingentszollansatz
BSEBovine spongiforme Enzephalopathie ("Rinderwahnsinn")
BTSBesonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw.beziehungsweise
BZ I,II,…Bergzone
ca.zirka
CO2 Kohlendioxid
EOErwerbsersatzordnung
FJAEFamilien-Jahresarbeitseinheit
GAPGemeinsame Agrarpolitik der EU
GGAGeschützte Geografische Angaben
GUBGeschützte Ursprungsbezeichnung
GVEGrossvieheinheit
GVOGentechnisch veränderte Organismen
inkl.inklusive
IPIntegrierte Produktion
IVInvalidenversicherung
JAEJahresarbeitseinheit
KZAKontingentszollansatz
LGLebendgewicht
LNLandwirtschaftliche Nutzfläche
LwGLandwirtschaftsgesetz
MwstMehrwertsteuer
NStickstoff
NWRNachwachsende Rohstoffe
ÖAFÖkologische Ausgleichsfläche
ÖLNÖkologischer Leistungsnachweis
PPhosphor
PSMPflanzenschutzmittel
RAUSRegelmässiger Auslauf im Freien
RGVERaufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAKStandardarbeitskraft
SGSchlachtgewicht
u.a.unter anderem
vgl.vergleiche
z.B.zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B.Tabellen)
BundesamtfürEnergie(BFE),1999.
Schweizerische Gesamtenergiestatistik.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2000. Agrarbericht 2000.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2001. Agrarbericht 2001.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2002.
Auswertung der Daten über die Milchkontingentierung;Milchjahr 2001/2002.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2002. Agrarbericht 2002.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2002.
Bericht «Inventar des kulinarischen Erbes der Schweiz» inErfüllungdesPostulatesNr.00.3556vonNationalratZisyadisvom6.Oktober2000.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2002.
Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme. SchlussberichtKategorieMilchkühe,Bern.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2003. Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme. SchlussberichtKategorieMastschweine.
BundesamtfürLandwirtschaft(BLW),2003.
Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente. gemässPunkt2desBerichtesvom19.Februar2003desBundesratesüber zolltarifarischeMassnahmen2002,Separatdruck.
BundesamtfürStatistik(BFS),2001.
Einblicke in die schweizerische Landwirtschaft,Ausgabe 2001, Neuenburg.
BundesamtfürStatistik(BFS),2002.
Umwelt Schweiz,Statistiken und Analysen.
BundesamtfürUmwelt,WaldundLandschaft(BUWAL),2000.
Graue Treibhausgas-Emissionen des Energie- und des Ernährungssektors der Schweiz 1990 und 1998.
UmweltmaterialienNr.128,Bern.
BundesamtfürUmwelt,WaldundLandschaft(BUWAL),2001.
Böden der Schweiz.Schadstoffgehalte und Orientierungswerte (1990–1996).
UmweltmaterialienNr.139,Boden,Bern.
BundesamtfürVeterinärwesen(BVET),2003.
Prävalenz latenter Zoonoseerreger in tierfreundlicher Schweinproduktion.
Demoscope,2003.
Leistungs- und kommunikationsbedingte Vor- und Nachteile von schweizerischen Landwirtschaftsprodukten,3.Welle 2003.
FuhrerJ.,2001.
Klimaschonende Landwirtschaft.
UFA-Revue9/01.
Interface/Evaluanda,2002.
Zwischenevaluation Regio Plus und Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung. Luzern.
LehmannB.,GerwigC.,(InstitutfürAgrarwirtschaftderETHZürich),2002.
Betriebswirtschaftliche Analyse der Umlagerung der Stützung vom Produkt zu Produktionsfaktoren im Milchsektor (Talgebiet).
Folgestudie«UmlagerungderMilchpreisstützung»,Teil1
LeifeldJ.,BassinS.andFuhrerJ.,2003.
Carbon stocks and carbon sequestration potentials in agricultural soils in Switzerland. SchriftenreihederFALNo.44,Zürich-Reckenholz.
LuderW.,2003.
Arbeitsbelastung:was sind Ursachen?
Agil7,Lindau.
MackG.,MannSt.,PfefferliSt.,(Eidg.ForschungsanstaltfürAgrarwirtschaftundLandtechnik,FAT),2003.
Sektorale Auswirkungen der Aufhebung der Milchkontingentierung und Umlagerung der Stützung. Folgestudie«UmlagerungderMilchpreisstützung»,Teil4.
MitgliederderBegleitgruppeausIAW,FAT,BLW,SMPundSBV.
Effekte einer Aufhebung der Milchkontingentierung und einer Umlagerung der Milchpreisstützung. SyntheseausderFolgestudie«UmlagerungderMilchpreisstützung»,Teile1–4.
OcCC,2002.
Das Klima ändert – auch in der Schweiz.
ProClim,2002.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC):Klimaänderung 2001, Zusammenfassung für Politische Entscheidungsträger.
PutaudJ.P.,VanDingenenR.andRaesF.,2002.
Submicron aerosol mass balance at urban and semirural sites in the Milan area (Italy). JournalofGeophysicalResearch,Vol.107,NO.D22,8198,doi:10.1029/2000JD000111.
RossierD.,1999.
Evaluation simplifiée de l’impact environnemental de l’agriculture suisse.
SchickM.,RiegelM.,2003. Arbeitsqualität in der Milchviehhaltung. AGRARForschung10(4),Posieux.
SchweizerischerBauernverband(SBV),verschiedeneJahrgänge. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg.
SRVA/FAL/FAT,2000.
Bilan écologique de l’exploitation agricole.
SwissConfederation,2002.
Swiss Greenhouse Gas Inventory 2000.
UNFrameworkConventiononClimateChange(UNFCCC),2001.
Third National communication of Switzerland 2001,Swiss Confederation,2001. EditedandpublishedbySwissAgencyfortheEnvironment,ForestsandLandscape.