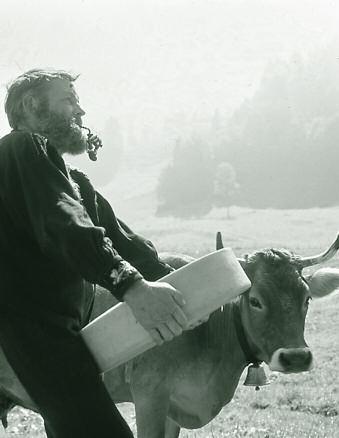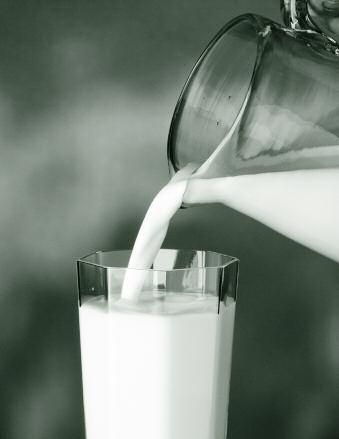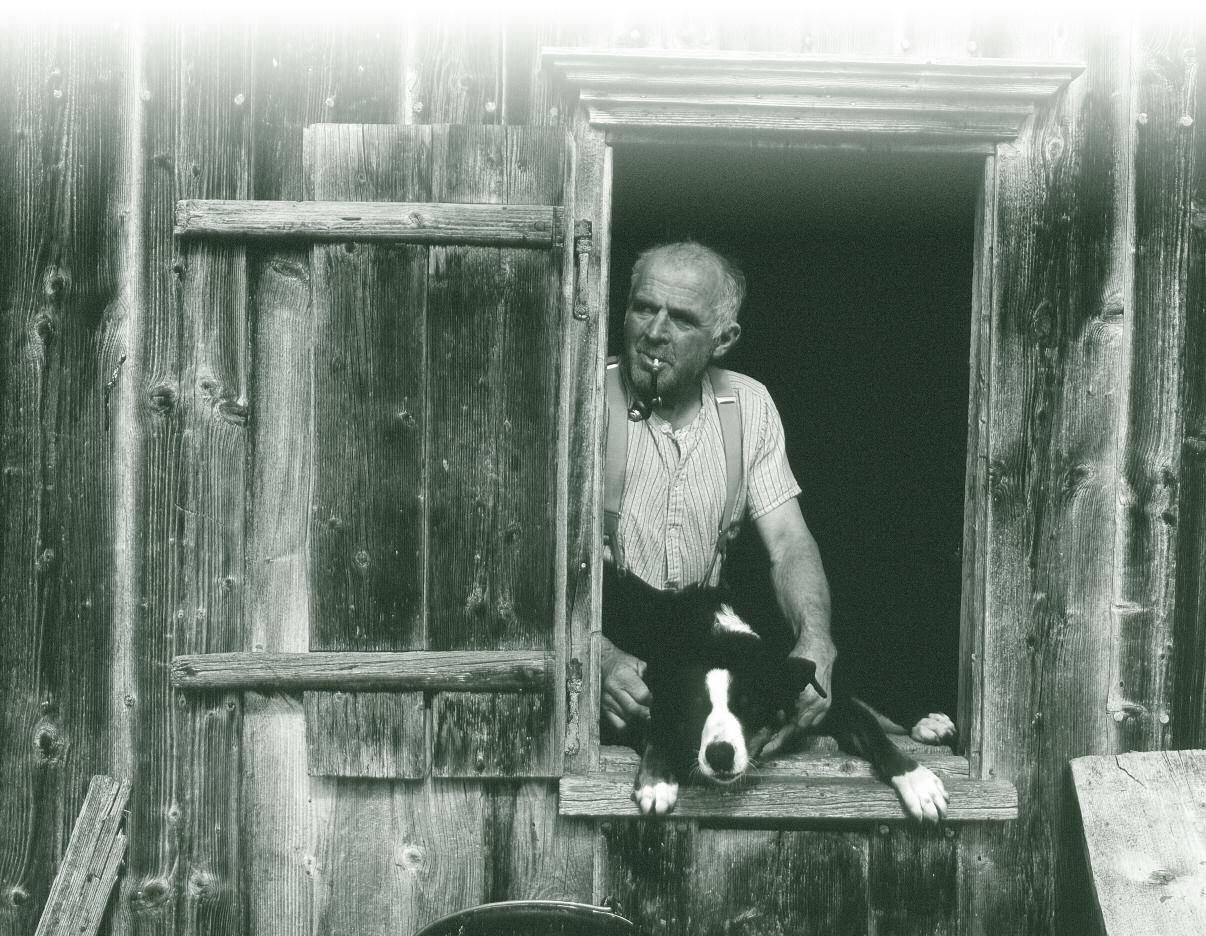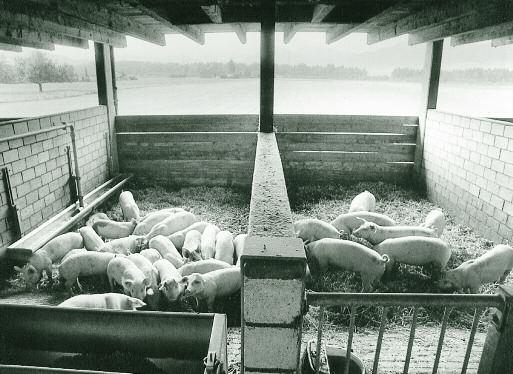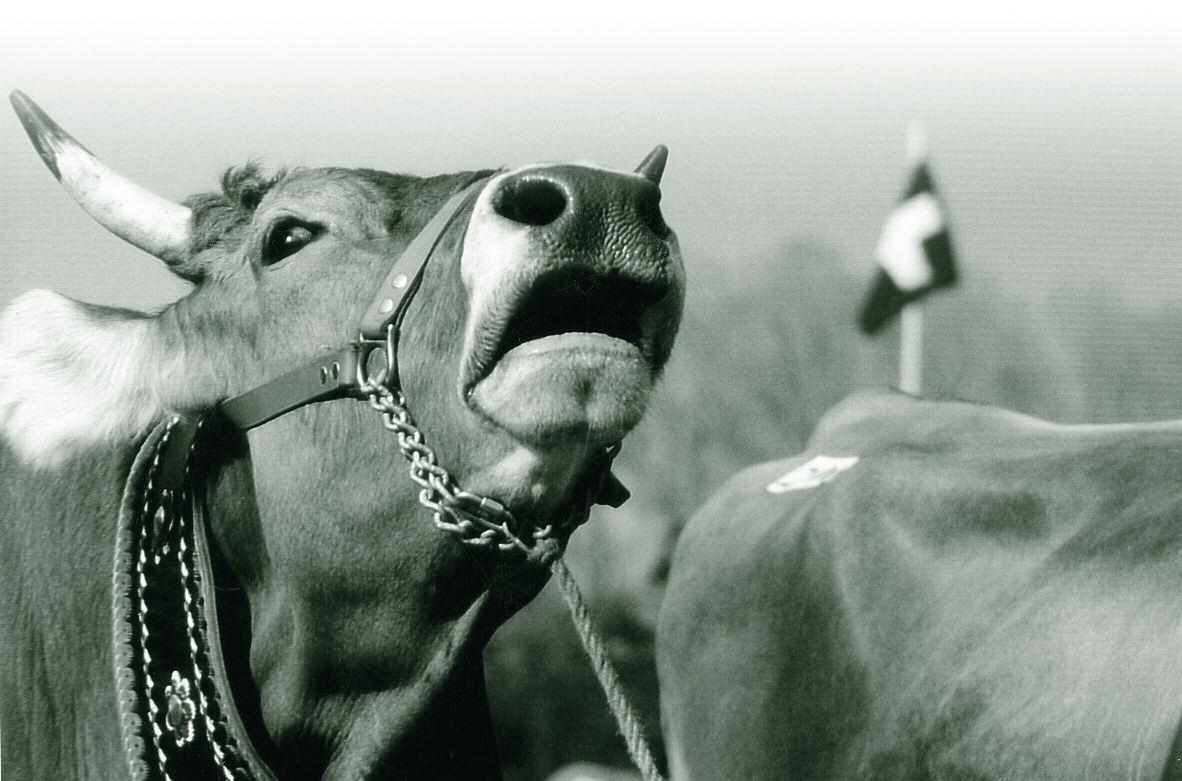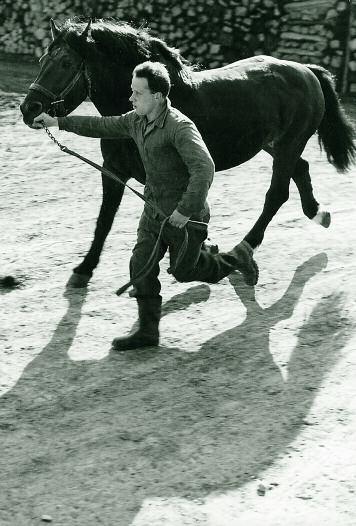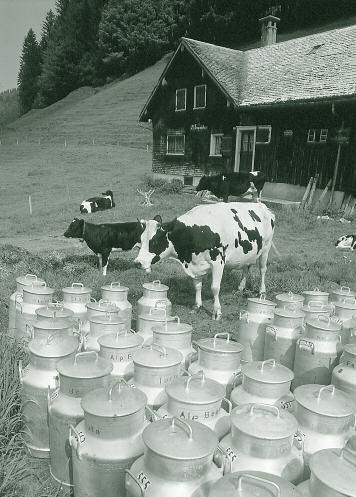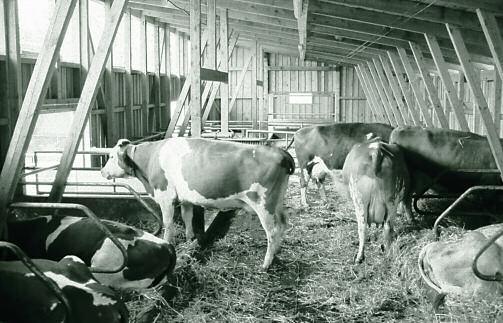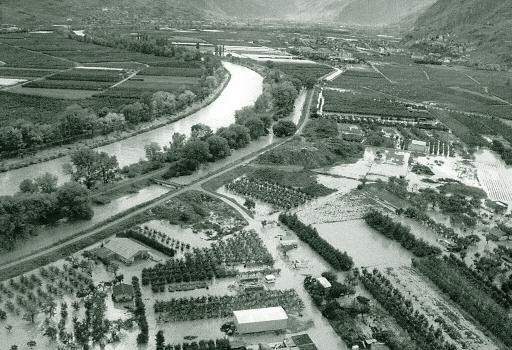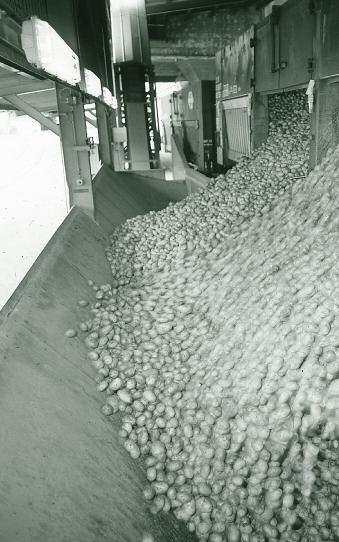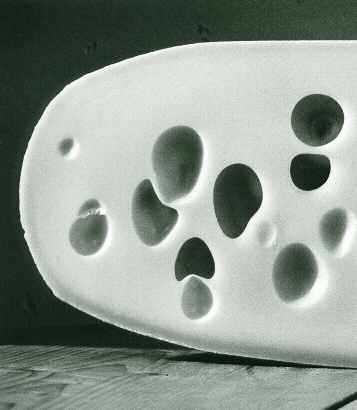Bundesamt für Landwirtschaft
Office fédéral de l’agriculture
Ufficio federale dell’agricoltura
Uffizi federal d’agricultura

AGRARBERICHT
Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
Telefon: 031 322 25 11
Telefax: 031 322 26 34
Internet: www blw admin ch
Copyright: BLW, Bern 2002
Gestaltung
Artwork, Grafik und Design, St Gallen
Druck Bruhin AG, Freienbach
Fotos
Agrofot Bildarchiv
Blue Planet Bild
BLW Bundesamt für Landwirtschaft
– Christof Sonderegger, Fotograf
– FAL Eidgenössische Forschungsanstalt
für Agrarökologie und Landbau
– Keystone Archive
Masterfile Schweiz
Peter Studer, Fotograf
PhotoDisc Inc
Prisma Dia-Agentur
– SBV Schweizerischer Bauernverband
– Schweizer Milchproduzenten SMP
– Schweiz Tourismus
Bezugsquelle
BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern
Bestellnummern: Deutsch:
Französisch:
Italienisch:
Telefax:
Internet: www bundespublikationen ch
–
–
–
–
–
–
–
730 680 02 d 10 2002 2800 82894
730 680 02 f 10 2002 1400 82894
730 680 02 i 10 2002 200 82894
031 325 50 58
2 I M P R E S S U M
■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1. Bedeutung und Lage 1.1 Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1 1 1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1 1 2 Märkte 19 1 1 3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 47 1 1 4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 52 1.2 Soziales und Gesellschaft 65 1 2 1 Soziales 66 1 2 2 Gesellschaft 84 1 3 Ökologie und Ethologie 91 1 3 1 Ökologie 92 1 3 2 Ethologie 117 1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit 123 ■ 2. Agrarpolitische 2.1 Produktion und Absatz 131 Massnahmen 2.1.1 Übergreifende Instrumente 133 2 1 2 Milchwirtschaft 147 2 1 3 Viehwirtschaft 154 2 1 4 Pflanzenbau 160 2 1 5 Überprüfung der Massnahmen 171 2 2 Direktzahlungen 175 2 2 1 Bedeutung der Direktzahlungen 176 2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen 184 2 2 3 Ökologische Direktzahlungen 194 2 3 Grundlagenverbesserung 213 2 3 1 Strukturverbesserungen und Betriebshilfe 214 2 3 2 Forschung, Beratung, Berufsbildung 223 2 3 3 Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz 230 2 3 4 Tierzucht 237 2 4 Finanzinspektorat 239 ■ 3. Internationale 3.1 Internationale Entwicklungen 245 Aspekte 3 2 Internationale Vergleiche 275 ■ Anhang Tabellen A2 Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft A63 Begriffe und Methoden A66 Abkürzungen A82 Literatur A84 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 3
Das Berichtsjahr 2001 war für die Schweizer Landwirtschaft ein mittelmässiges Wirtschaftsjahr Die Endproduktion lag um 4% tiefer als im Durchschnitt der drei Vorjahre Dies ist vor allem auf schlechtere Erträge im Pflanzenbau zurückzuführen Für 2002 sieht die Situation aber wieder deutlich besser aus Die Schätzungen für das laufende Jahr gehen von einem wirtschaftlichen Ergebnis aus, welches mit dem guten Jahr 2000 vergleichbar ist Dies ist erfreulich, insbesondere vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten auf dem Milchmarkt
Die Milchwirtschaft steht vor einer anspruchsvollen Phase der Restrukturierung, nicht nur in der Verarbeitung, sondern auch in der Landwirtschaft Die Ursachen für die aktuelle Situation reichen weit zurück In den siebziger und achtziger Jahren wurden in der Verarbeitungsindustrie Überkapazitäten aufgebaut, die vor und seit dem In-KraftTreten der neuen Milchmarktordnung nur ungenügend abgebaut wurden Die Erhöhungen der Milchpreise in den achtziger Jahren reduzierten auf der anderen Seite den Anpassungsbedarf bei den Landwirtschaftsbetrieben Verarbeitungs- und Landwirtschaftsbetriebe waren in der Folge zu wenig gut vorbereitet Die Marktkräfte, die auf Grund des neuen Verfassungsartikels für die Produktion von Nahrungsmitteln massgebend sind, haben nun die Schwächen der Schweizer Milchwirtschaft aufgedeckt Ich hoffe, dass die Krise eine Erneuerung ermöglicht, welche die Position der Milchwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe stärkt und so insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft steigt Dies ist wichtig, denn die Milchproduktion trägt einen bedeutenden Anteil zur Endproduktion und damit zu einer produktiven Landwirtschaft bei

Der dritte Agrarbericht hat in der Grundausrichtung keine Änderungen erfahren. Der Bericht gibt Auskunft über die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik, über die Entwicklungen bei den agrarpolitischen Massnahmen und über internationale Aspekte. Die Berichterstattung wurde gegenüber dem Vorjahr in einigen Bereichen wiederum weiterentwickelt So werden gesellschaftliche Aspekte wie z B das Konsumverhalten oder Meinungen der Bevölkerung zur Landwirtschaft neu in Abschnitt 1 2 und das Tierwohl separat in Abschnitt 1 3 dargestellt
Die Einkommen in der Landwirtschaft sind im Durchschnitt im Vergleich zur übrigen Bevölkerung tief Dies war schon unter der alten Agrarpolitik der Fall Die Ergebnisse der zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT zeigen ausserdem, dass sich die Situation nicht laufend verschlechtert. Die Einkommen gingen nach dem Rekordjahr 1989 bis 1995 kontinuierlich zurück, zu einem wesentlichen Teil noch vor der ersten Etappe der Agrarreform, die 1993 begann Inzwischen ist wieder eine deutliche Verbesserung eingetreten. So kann eine Mehrzahl der Betriebe genügend Eigenkapital bilden, um die betriebliche Existenz zu sichern Dies gelingt aber nicht allen Betrieben Rund ein Drittel der Betriebe ist finanziell in Bedrängnis Der Anteil dieser Betriebe hat in den neunziger Jahren leicht zugenommen Die stärkere Orientierung des Sektors am Markt bringt dies mit sich Nach wie vor wird in der Schweizer Landwirtschaft gegenüber vergleichbaren Betrieben im Ausland mehr Arbeit für dieselbe Produktionsmenge
V O R W O R T 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Vorwort
eingesetzt. Es besteht also ein Spielraum für Kostensenkungen oder ein Wachstum der Betriebe Die Aufgabe von Betrieben ist in einem Sektor mit einem stagnierenden Marktvolumen und laufenden technischen Fortschritten eine natürliche Entwicklung Diese erlaubt es den übrigen Betrieben, ihre ökonomische Basis zu sichern.
Der Strukturwandel hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt zum grössten Teil im Rahmen des Generationswechsels abgespielt Die Sozialverträglichkeit war im Grundsatz gewährleistet Für einen Teil der Betriebe wird es auch künftig schwierig sein, sich in einem Umfeld mit mehr Konkurrenz behaupten zu können Mit der Weiterentwicklung der Agrarpolitik (AP 2007) wurden deshalb zusätzliche Begleitmassnahmen, z B die Umschulungsbeihilfen vorgeschlagen, damit der Anpassungsprozess weiterhin sozialverträglich verlaufen kann.
Die Sorgen und Ängste der Bäuerinnen und Bauern sind ernst zu nehmen Die Restrukturierung wird von allen Beteiligten viel abverlangen. Ich bin aber überzeugt, dass mit der AP 2007 wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Lösungen erreicht werden können
Manfred Bötsch
Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft

V O R W O R T 5
6

1 7 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1. Bedeutung
Landwirtschaft
und Lage der
In Artikel 104 ist festgehalten, dass «der Bund dafür zu sorgen hat, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
c dezentralen Besiedlung des Landes»
Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich, dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt, die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalität der Landwirtschaft Die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen, die im öffentlichen Interesse liegen, welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen
Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden
Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen. Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind Absatz 2 hält fest, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft.
8 1 . B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
Die Landwirtschaft ist auf eine ausreichende wirtschaftliche Basis angewiesen, damit sie die von ihr verlangten Leistungen erbringen kann Die Darstellung der ökonomischen Auswirkungen der Agrarpolitik bilden deshalb einen wichtigen Bestandteil der Berichterstattung Diese gibt unter anderem Auskunft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Landwirtschaftsbetriebe, über die Strukturentwicklungen, über die Verflechtungen zur übrigen Wirtschaft oder über die Verhältnisse auf den verschiedenen Märkten
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt, die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt sowie ein Projekt «Performance in der Schweizer Landwirtschaft» vorgestellt

9 1 . 1 Ö K O N O M I E ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.1
Ökonomie
1
■ Landwirtschaftsbetriebe
1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Der Rückgang der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ist ein Prozess, der nicht nur in der Schweiz, sondern auch im übrigen Europa zu beobachten ist Im Folgenden wird die Entwicklung aufgezeigt in der Schweiz und in ausgewählten EU-Ländern
Entwicklung der Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz und in ausgewählten EU-Ländern
1 1996
Eurostat, BFS
Die Veränderungen der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe im Jahrzehnt 1990–2000 zeigen sowohl in der Schweiz als auch in ausgewählten EU-Ländern vergleichbare Ausmasse. In fast allen berücksichtigten EU-Ländern ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen Die höchste Abnahmerate wurde in diesem Zeitraum in Dänemark festgestellt, die Tiefste in Grossbritannien
10 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
■■■■■■■■■■■■■■■■
Land Anzahl Betriebe Veränderung 1990–2000 1990 1995 2000 in % Deutschland 653 550 566 910 471 960 -27,8 Frankreich 923 590 734 800 663 810 -28,1 Italien 2 664 550 2 482 100 2 152 210 -19,2 Österreich 278 000 221 750 199 470 -28,2 Niederlande 124 800 113 200 101 550 -18,6 Dänemark 81 270 68 770 57 830 -28,8 Spanien 1 593 640 1 277 600 1 287 420 -19,2 Grossbritannien 243 060 234 500 233 250 -4,0 Schweiz 92 815 79 479 1 70 537 -24,0
Quellen:
Tabelle 1, Seite A2
■ Familieneigene Arbeitskräfte nehmen ab
Bei den Beschäftigten in der Landwirtschaft wird einerseits zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten unterschieden, andererseits aber auch zwischen familieneigenen und -fremden Arbeitskräften Zu den Familieneigenen gehören neben dem Betriebsleiter/der Betriebsleiterin andere Familienangehörige. Bei den Familienfremden wird zwischen Schweizerinnen und Schweizern sowie Ausländerinnen und Ausländern unterschieden

Entwicklung der familieneigenen und -fremden Beschäftigten
19901996
Quelle: BFS
1 . 1 Ö K O N O M I E 11 1
2000 A n z a h l
Familieneigene Betriebsleiterinnen Betriebsleiter Andere familieneigene Frauen Andere familieneigene Männer Familienfremde Familienfremde Schweizerinnen Familienfremde Schweizer Ausländerinnen Ausländer 0 150 000 175 000 200 000 225 000 250 000 125 000 100 000 75 000 25 000 50 000
■ Mehr Kühe ohne Verkehrsmilch
Die Gesamtzahl der familieneigenen Arbeitskräfte hat zwischen 1990 und 2000 um 51'500 oder rund 24% abgenommen Mit 35'755 handelte es sich zu 70% um Personen der Kategorie andere familieneigene Beschäftigte Auch der relative Rückgang war bei dieser Kategorie grösser als bei der Kategorie Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen 70% des Rückgangs hat in der Teilperiode 1990–1996 stattgefunden und 30% in der Teilperiode 1996–2000 In der zweiten Periode ist demnach eine Verlangsamung eingetreten Die Entwicklung ist bei Frauen und Männern unterschiedlich verlaufen Der Anteil Frauen ging in der Teilperiode 1990–1996 um 21'460 oder knapp 27% zurück, in der Teilperiode 1996–2000 hat dagegen wieder eine Zunahme von 3'269 oder 6% stattgefunden Der Anteil Männer war in beiden Teilperioden rückläufig Insgesamt wurden im Jahr 2000 rund 31'000 Männer weniger gezählt als 1990. Das Verhältnis zwischen Männer und Frauen unter den familieneigenen Beschäftigten blieb in diesem Zeitraum konstant
Eine gegenläufige Entwicklung als bei den familieneigenen ist bei den familienfremden Arbeitskräften zu beobachten Diese haben zwischen 1990 und 2000 um 1'732 oder 5% zugenommen In der Teilperiode 1990–1996 stieg ihre Zahl gar um 8'171 oder 23% stark an In der Teilperiode 1996–2000 verringerte sich diese Zahl wieder um 6‘439 oder 14% Bei den familienfremden Beschäftigten hat sich das Verhältnis zwischen Männer und Frauen im Zeitraum 1990–2000 zugunsten der Frauen verschoben
Der Rindviehbestand der Schweiz hat sich zwischen 1990 und 2000 von 1,86 Mio auf 1,59 Mio Tiere reduziert Dies entspricht einem Rückgang von 15% Der Kuhbestand ging in dieser Zeit um 10% zurück Während die Anzahl Kühe, deren Milch in Verkehr gesetzt wird, ebenfalls um 15% abnahm, stieg die Anzahl Kühe ohne Verkehrsmilch um 34'105 Einheiten. Der Anteil der Verkehrsmilchkühe am Kuhbestand ist in diesem Jahrzehnt von 92 auf 86% zurückgegangen
Entwicklung der Anzahl Kühe mit und ohne Verkehrsmilchproduktion

12 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Tabelle 2, Seite A3
19901996 2000 A n z a h l Kühe mit Verkehrsmilch Kühe ohne Verkehrsmilch Quelle: BFS 0 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 726 362 64 542 70 367 98 647 693 676 615 645
■ Entwicklung von Preisindices
Die Kühe ohne Verkehrsmilch setzen sich aus gemolkenen Kühen sowie Mutter- und Ammenkühen zusammen Zwischen 1990 und 2000 erhöhte sich die Zahl der Mutterund Ammenkühe von 13'536 auf 44'882 Tiere Bei den gemolkenen Kühen dagegen war nur ein geringer Anstieg um 2'759 Tieren zu verzeichnen. Die Mutter- und Ammenkühe haben damit ihren Anteil am Bestand der Kühe ohne Verkehrsmilch von 21 auf 45% erhöht Ihr Anteil am gesamten Kuhbestand lag im Jahr 2000 bei rund 6%
Der Produzentenpreisindex ist nach einem leichten Anstieg im 2000 im Berichtsjahr wieder um 5,4 Prozentpunkte gesunken Dafür verantwortlich waren insbesondere die tieferen Preise bei Getreide und bei der Viehwirtschaft
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel
Importpreisindex
für Nahrungsmittel 1
Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke
Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel
Produzentenpreisindex
Landwirtschaft
1 Basis Mai 1993 = 100 Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden Im Importpreisindex enthält die Gruppe «Nahrungsmittel» die Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Diese umfassen ausgewählte Produkte und widerspiegeln nicht den gesamten Bereich der Nahrungsmittelimporte
Quellen: BFS SBV
Im Landesindex der Konsumentenpreise wirken sich die Kosten und Margen der Nahrungsmittelverarbeitung und des Nahrungsmittelhandels, die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Nahrungsmittelrohstoffe (rund 40% des Nahrungsmittelverbrauchs in Kalorien gemessen werden importiert), der Wechselkurs des Schweizer Frankens und etwa zu einem Siebtel die inländischen Produzentenpreise aus Der Index hat im Berichtsjahr gegenüber 2000 um 2 Prozentpunkte zugelegt
Im Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel drücken sich in erster Linie die Preise von Futtermitteln, Saat- und Pflanzgut, Dünge-, Bodenverbesserungsund Pflanzenschutzmitteln sowie von Bau- und Ausrüstungsinvestitionen aus Ausserdem fliesst ein Teil der mit dem Landesindex der Konsumentenpreise gemessenen Preisentwicklungen unmittelbar in den entsprechenden Index ein. Dazu gehören unter anderem Energie (Treibstoffe, Strom), Telefon, Wasser, Unterhalts- und Reparaturkosten Der Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel zeigt in abgeschwächter Form denselben Verlauf wie der Landesindex der Konsumentenpreise. Im Jahr 2001 ist der Index um 0,7 Prozentpunkte auf 99,9 angestiegen
Im Importpreisindex für Nahrungsmittel ist nicht der gesamte Warenkorb der Nahrungsmittelimporte enthalten Seine Aussagekraft ist deshalb nicht derjenigen des Produzenten- oder Konsumentenpreisindexes gleichzustellen. Der Index blieb im 2001 unverändert auf 111,8 Prozentpunkten
13 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )
75 80 85 90 95 100 105 110 115 1990–921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 2001
■
Aussenhandel mit Land-
Im Berichtsjahr nahmen sowohl die gesamten Einfuhren als auch die gesamten Ausfuhren gegenüber 2000 um knapp 2% zu Die Importe stiegen von total 139,4 auf 141,9 Mrd Fr , die Exporte von 136,0 auf 138,5 Mrd Fr Bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen erhöhten sich die Importe von 8,5 auf 8,6 Mrd. Fr., die Exporte von 3,5 auf 3,6 Mrd Fr
Die EU ist im Agrarbereich die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz Im Berichtsjahr stammten 72,1% der Landwirtschaftsimporte (6,2 Mrd Fr ) aus der EU 65,5% der Exporte (2,4 Mrd Fr ) wurden in den EU-Raum getätigt Gegenüber dem Vorjahr hat es sowohl bei den Einfuhren als auch bei den Ausfuhren leichte Zunahmen gegeben Seit 1990 hat bei den Importen der Verkehr mit der EU um 1,4 Mrd Fr und bei den Exporten um 0,7 Mrd. Fr. zugenommen.
Der Agrarhandel der Schweiz mit ausgewählten EU-Ländern ist zwischen 1990 und 2001 wertmässig mit Ausnahme von Italien sowohl auf der Einfuhr- als auch auf der Ausfuhrseite angestiegen Die Exporte nach Italien haben um 91 Mio Fr abgenommen Im Gegenzug hat der Import aus diesem Land im selben Zeitraum mit 449 Mio Fr am meisten aller ausgewählter Länder zugelegt Von Frankreich führt die Schweiz am meisten ein Am wenigsten wird aus Österreich importiert Bei den Ausfuhren hat zwischen 1990 und 2001 der Verkehr mit Deutschland um 369 Mio Fr zugenommen Die Schweiz hat also im letzten Jahrzehnt vor allem das Exportgeschäft mit dem nördlichen Nachbarn ausgebaut. Deutschland führt die Liste der ausgewählten Länder bei den Ausfuhren denn auch mit Abstand an Eine stark negative Bilanz hat die Schweiz mit Spanien und der Niederlande, während sich die Ein- und Ausfuhren nach Österreich auf relativ bescheidenem Niveau die Waage halten.
14 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
wirtschaftsprodukten
Quelle: OZD Deutschland Frankreich Italien Österreich Spanien Niederlande übrige Länder 777 1 021 408 832 387 1 635 248 1 407 281 1 347 372 900 191 211 140 157 64 478 47 383 127 763 92 593 525 717 358 575 Einfuhren Ausfuhren 200015001000 5000 in Mio. Fr 5001000 2001 1990
Entwicklung des landwirtschaftlichen Aussenhandels mit der EU
Entwicklung der Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen nach Produktekategorie
Milchprodukte (4)

Tabak und Diverses (13, 14, 24)
Nahrungsmittel (20, 21)
Tierfutter, Abfälle (23)
Getreide und Zubereitungen (10, 11, 19)
Genussmittel (9, 17, 18)
Ölsaaten, Fette und Öle (12, 15)
Lebende Pflanzen, Blumen (6)
Gemüse (7)
Früchte (8)
Tierische Produkte, Fische (1, 2, 3, 5, 16)
Getränke (22)
Quelle: OZD
Einfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen werden bei allen Produktekategorien in erheblichem Umfang getätigt In den letzten elf Jahren stark zugenommen haben die Importe von Getränken, tierischen Produkten (inkl Fische), von Produkten der Kategorie Nahrungsmittel (z B Gemüse- und Früchtezubereitungen) sowie von Getreide und Zubereitungen Nahmen 1990 noch die tierischen Produkte die Spitzenposition ein, waren es im Jahr 2001 neu die Getränke. Im Gegensatz zu den Einfuhren gibt es bei den Ausfuhren einige Produktekategorien, die wenig Bedeutung haben Zu ihnen zählen z B Früchte, Gemüse und Tierische Produkte Ausgeführt werden vor allem verarbeitete Nahrungsmittel, Käse sowie Genussmittel. Im Zeitraum 1990–2001 am meisten zugelegt haben die verarbeiteten Nahrungsmittel sowie Genussmittel Bei den Milchprodukten ist der Export hingegen zurückgegangen Exportüberschüsse werden bei Milchprodukten, Tabak und Diverses und neu auch bei Nahrungsmitteln erzielt War dieser 1990 mit 248 Mio Fr noch bei den Milchprodukten grösser, lag 2001 Tabak und Diverses mit 271 Mio Fr an der Spitze Der Überschuss bei der Milch verringerte sich hingegen um 122 Mio Fr auf 126 Mio Fr
15 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
541 415 594 346 659 388 469 295 849 812 475 534 154 338 120 276 420 605 160 422 718 742 438 636 3 552 4 433 4 579 30 494 7 898 7 822 48 1 382 106 1 194 165 1 507 89 1 004 25 342 45 288 Einfuhren Ausfuhren 2000150010005000 in Mio Fr ( ): Zolltarif-Nr 5001000 2001 1990
Entwicklung der Ein- und Ausfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen pro Kopf der Bevölkerung in ausgewählten Ländern
Die Einfuhren von landwirtschaftlichen Produkten und Verarbeitungserzeugnissen pro Kopf der Bevölkerung haben sich von Land zu Land unterschiedlich entwickelt Im Zeitraum 1990–2001 haben sie in den meisten betrachteten Ländern zugenommen Ausnahmen waren Italien, Deutschland, die Niederlande und die Schweiz Mit Abstand am meisten zugelegt haben die Importe in Australien mit 297 $ pro Kopf der Bevölkerung gefolgt von Irland mit 218 $ Am deutlichsten abgenommen haben sie hingegen in Deutschland mit 126 $ pro Einwohner Auch auf der Ausfuhrseite wurden mit Ausnahme von Frankreich, Deutschland und der Niederlande Zunahmen beobachtet. Zwischen 1990 und 2001 war Australien mit 370 $ pro Kopf der Bevölkerung das Land mit der stärksten Exportzunahme vor Österreich mit 200 $ Am meisten abgenommen haben in diesem Zeitraum die Exporte der Niederlande mit 143 $ pro Einwohner 1990 lag die Schweiz mit 389 $ pro Kopf der Bevölkerung an erster Stelle der Nettoimporteure vor Japan mit 262 $ Als bedeutendster Nettoexporteur erwies sich damals Irland mit 893 $ pro Kopf der Bevölkerung vor der Niederlande mit 673 $ Elf Jahre später hat Japan mit 366 $ pro Kopf der Bevölkerung die Schweiz an der Spitze der Nettoimporteure abgelöst. Die Niederlande haben mit 927 $ pro Kopf der Bevölkerung Irland vom ersten Rang der Nettoexporteure verdrängt
16 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Quelle: OECD Irland Niederlande Australien Kanada Frankreich Spanien USA Italien Österreich Deutschland Grossbritannien Japan Schweiz 1 671 842 1 517 624 1 701 1 074 1 844 1 171 528 411 158 114 575 400 392 259 561 406 585 402 389 354 215 245 256 353 186 377 380 463 180 338 301 434 307 560 254 443 224 400 281 633 262 651 17 383 14 276 196 174 166 120 Einfuhren Ausfuhren 1 500 1 000 5000 in $ pro Einwohner 500 1 000 1 500 2 000 2001 1990
Die Schweizer Landwirtschaft produziert rund 60% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittel (gemessen in Kalorien) Allerdings sind jährliche Schwankungen festzustellen 2000 lag der Selbstversorgungsgrad bei 62% und war damit um 4 Prozentpunkte über dem Wert von 1999. Den Ausschlag gab das bessere Pflanzenbaujahr.
Bei tierischen Produkten blieb der Inlandanteil 2000 wie 1999 stabil bei 95% Im pflanzlichen Bereich stieg er von 40% im Jahr 1999 auf 46% im 2000 Somit wurde wieder annähernd der Stand von 1998 (47%) erreicht
Der Bund hat im Berichtsjahr gesamthaft 50'215 Mio Fr ausgegeben, ein Ausgabenplus von 6,5% gegenüber 2000 Davon wurden 3'962 Mio Fr für Landwirtschaft und Ernährung aufgewendet. Nach sozialer Wohlfahrt (12'535 Mio. Fr.), Finanzen und Steuern (9'472 Mio Fr ), Verkehr (8'107 Mio Fr ) und Landesverteidigung (4'956 Mio Fr ) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle.
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes blieb im Berichtsjahr wie im Vorjahr auf dem Stand von 7,9%
Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187, Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet, wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio Fr 1998 betrugen die Ausgaben für Produktion und Absatz 1'203 Mio. Fr. 2001 waren es noch 902 Mio. Fr. In dieser Zeitspanne wurden die Mittel um 301 Mio Fr reduziert
1 . 1 Ö K O N O M I E 17 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 Entwicklung der Ausgaben
für Landwirtschaft und Ernährung 1990/921993 1994 1995 1996 1997 1998 199920002001 M i o F r i n % absolut (Mio. Fr.) in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 3 0 4 8 3 4 1 6 3 4 9 6 3 5 4 7 3 9 5 3 3 9 0 8 3 9 2 6 4 1 9 7 3 7 2 7 3 9 6 2
des Bundes
■ Selbstversorgungsgrad bei 62%
■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung
Tabelle 48, Seite A56
Tabelle 13, Seite A13
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung

Anmerkung: Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete So wurden z B die Aufwendungen für die Kartoffel-und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung
Quellen: Staatsrechnung BLW
Die vorsichtige Budgetierung bei den Direktzahlungen für 1999 und 2000 führte zu Minderausgaben von 172 Mio Fr im 2000 Der Bundesrat hat diesem Umstand Rechnung getragen und bei der Beitragsgfestsetzung der Direktzahlungen für 2001 die Ansätze nach oben angepasst Dies bewirkte einen Anstieg der Direktzahlungen um 210 Mio Fr im Jahr 2001 gegenüber 2000
Die Ausgaben für Grundlagenverbesserung erhöhten sich im Berichtsjahr um 31 Mio Fr gegenüber 2000 Diese Erhöhung liegt im Rahmen der geplanten Erweiterung der Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen.
18 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Ausgabenbereich 1990/92 1999 2000 2001 in Mio. Fr. Produktion und Absatz 1 685 1 318 955 902 Direktzahlungen 772 2 286 2 114 2 334 Grundlagenverbesserung 207 148 246 277 Weitere Ausgaben 384 445 412 449 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 048 4 197 3 727 3 962
1.1.2 Märkte
Das Jahr 2001 war insgesamt warm, in den nördlichen Alpen und auf der Alpennordseite nass bis sehr nass und im Tessin sowie im Mittelland sehr sonnig Der Sommer zeichnete sich aus durch vergleichsweise hohe Temperaturen, eine lange Sonnenscheindauer und trotzdem viel Niederschlag
Die Milch- und Käseproduktion hat im Berichtsjahr weiter zugenommen Auch der Produzentenpreis für Milch ist im Durchschnitt leicht gestiegen In der Tierproduktion stand aufgrund der BSE- und Maul-und-Klauenseuche-Diskussionen eine geringe Rindfleischnachfrage einem gleichzeitig erhöhtem Angebot und sinkenden Produzentenpreisen gegenüber Sowohl im Acker- wie auch im Gemüse- und Obstbau mussten gegenüber 2000 grösstenteils tiefere Erträge verzeichnet werden
Die Endproduktion, also der Wert aller in der Landwirtschaft erzeugten Produkte, hat gegenüber dem Vorjahr um 4,7% abgenommen: Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse minus 10,7% (252 Mio Fr ); Tiere und tierische Erzeugnisse minus 1,9% (100 Mio
)
19 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Fr
Zusammensetzung der Endproduktion 2001 Milch 36% Schweine 14% Rindvieh 13% Übrige pflanzliche Erzeugnisse 2% Früchte, Gemüse 10% Weinmost 7% Getreide 7% Quelle: SBV 1 Schätzung, Stand Winter 2001/2002 Total 7 275 Mio. Fr. 1 Geflügel, Eier 5% Übrige tierische Erzeugnisse 2% Kartoffeln, Zuckerrüben 4% Tabelle 14, Seite A14
■ Produktion:
Kontingentserhöhung wurde ausgenützt
Milch und Milchprodukte
Das Berichtsjahr 2001 war nochmals ein gutes Milchjahr Die Kontingentserhöhung wurde ausgenützt und die Produktion von Käse, Frischmilchprodukten, Butter und Milchpulver ist gestiegen Die erfreuliche Marktsituation im Jahr 2001 hat auch zu stabilen Preisen für die Produzenten geführt Weiter konnte eine leicht steigende Tendenz bei den Konsumentenpreisen festgestellt werden
Die Gesamtmilchproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 70‘000 t auf 3,94 Mio t Rund 19% dieser Menge diente der Selbstversorgung oder wurde auf dem Hof verfüttert. Die Milchleistung pro Kuh nahm im Berichtsjahr weiter auf 5'540 kg (+70 kg) zu.
Entwicklung von Kuhbestand und Milchleistung
Im Berichtsjahr haben die Milchproduzenten 3,21 Mio t Milch verkauft Diese Milchmenge stammte von 614'608 Kühen. Erstmals seit 1990/92 konnte im Jahr 2001 wieder eine leichte Zunahme des Kuhbestandes von 3'000 Tieren (+0,4%) verzeichnet werden Diese Entwicklung lässt sich durch die erschwerte Situation im Verkauf von überzähligen Kühen wegen der BSE-Krise und der Maul-und Klauenseuche im Frühjahr und Herbst 2001 erklären
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 20
Tabellen 3–13, Seiten A4–A13
1990/92199920002001 A n z a h l K ü h e k g M i l c h p r o K u h Kuhbestand Milchleistung je Kuh Quelle: SBV 660 000 680 000 5 600 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 4 800 4 700 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 800 000
Milcheinlieferungen nach Monaten 2000 und 2001

Mit Ausnahme von November und Dezember waren die monatlichen Milcheinlieferungen im Jahr 2001 höher als im Vorjahr, vor allem in den Monaten Januar, März, Juni bis August Die Zunahme der Produktion ist auf die generelle Erhöhung der Milchkontingentsmenge um 3% für das Milchjahr 2001/2002 zurückzuführen.
Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,21 Mio. t) wie folgt verwertet (in t Milch): zu Konsummilch und anderen Milchprodukten: 1'066'000 t (+1,0%)
1 . 1 Ö K O N O M I E 21 1
zu Käse:
t
zu Rahm/Butter: 724'000 t (+1,8%)
1'420'000
(+0,7%)
J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r i n 1 0 0 0 t Milcheinlieferungen 2001 Milcheinlieferungen 2000 Quelle: TSM 220 230 250 240 270 260 280 290 300 310 ■ Verwertung
■ Aussenhandel: steigende Joghurtexporte
der Verwertung der vermarkteten Milch 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
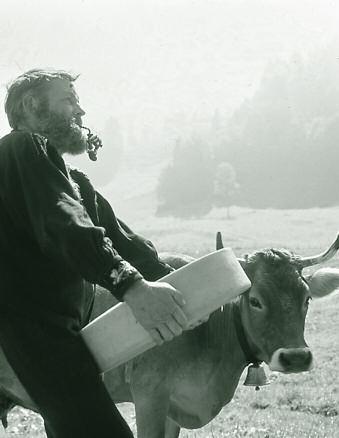
Entwicklung 0
Quellen: TSM, SBV
Die hergestellte Menge Käse nahm gegenüber dem Vorjahr um 2,9% zu Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr betrug beim Weichkäse 5,4% (auf 6'978 t) und beim Halbhartkäse 4,9% (auf 48'164 t) Das Produktionsvolumen von Frischkäse und von Hartkäse weist eine leicht positive Tendenz auf. Im Vergleich zum Vorjahr stieg im Jahr 2001 die Produktion von Spezialprodukten (z B reiner Schaf- oder Ziegenkäse) um 30% von 494 t auf 643 t
Im Berichtsjahr wurde erstmals seit ein paar Jahren wieder mehr Butter produziert Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug 14,5% (von 36'611 t auf 41'904 t) Die Zunahme steht im Zusammenhang mit der höheren Milchproduktion
Die Milchpulverproduktion nahm im Berichtsjahr wiederum zu, insbesondere beim Vollmilchpulver war innert Jahresfrist eine Zunahme um 50,6% festzustellen (von 10'332 t auf 15'559 t) Sie ist mit dem höheren Bedarf in der Schokoladeindustrie zu erklären, die auf entsprechende Importe verzichtete.
Die Produktion von Frischmilchprodukten ist nach wie vor zunehmend Allerdings ist die Konsummilchproduktion gegenüber dem Vorjahr um 0,8% zurückgegangen Dafür wurden insbesondere vermehrt Joghurt und Dessertprodukte hergestellt
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 22
1990/92199920002001 i n 1 0 0 0 t M i l c h Andere Milchprodukte Rahm Butter
Im Milchsektor ist die Aussenhandelsbilanz nach wie vor positiv Die Schweiz exportiert bei Käse, Milchpulver, Joghurt und Rahm mengenmässig mehr als sie einführt. Käse Konsummilch
Entwicklung der Exporte und Importe von Käse
1990/92199920002001
Die wirtschaftlich bedeutungsvolle Käseausfuhr sank im Berichtsjahr um 1,4% auf 53'099 t Der Käseimport stieg leicht auf 31'245 t Die Hartkäseeinfuhr allein nahm um 6,8% auf 7'340 t zu (Parmesan/Grana Padano) Auffallend ist im 2001 die Zunahme der Joghurtexporte um 47,7% auf 3'981 t. Die Joghurteinfuhren sind unbedeutend (151 t) Der Export von Milchpulver bildete sich von 13'992 t auf 4'905 t (–65%) zurück Der Import nahm um 51,2% ab Im Vorjahresvergleich sank der Rahmexport stark (um 832 t bzw. 55%).
Betrachtet man die Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums einzelner Milchprodukte, so sind im Vergleich zum Vorjahr unterschiedliche Tendenzen erkennbar: steigendem Käse- und Joghurtverbrauch stehen stabilem Quark- und leicht abnehmendem Butterkonsum gegenüber
Der Käsekonsum pro Kopf erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 kg auf 18,4 kg. Der grösste Anstieg kann wiederum beim Frischkäseverbrauch verzeichnet werden, dessen Konsum neu 4,5 kg (+36,4%) erreicht Der Joghurtabsatz stieg im Berichtsjahr erstmals seit drei Jahren wieder an.
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 23 1
i n t Käseausfuhr Käseeinfuhr Handelsbilanz Quellen: OZD, BLW 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums
k g p r o K o p f Käse Joghurt Quelle: SBV Butter Quark 0,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,0 16,0 18,0 20,0 ■ Verbrauch: Käse und Joghurt im Trend
1990/92199920002001
■ Produzentenpreise: leicht höher
und Methoden, Seite A68
Der vom Bundesrat festgelegte Zielpreis lag unverändert bei 77 Rp. pro kg Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein Wie schon im vorangehenden Jahr wurde auch im Berichtsjahr der Zielpreis übertroffen
Milchpreise 2001 gesamtschweizerisch und nach Regionen
Die regionalen Differenzen zwischen den Preisen sind relativ gering Werden die Milchpreise 2000 mit denjenigen des Berichtsjahres verglichen, so kann eine leichte Zunahme festgestellt werden Der schweizerische Gesamt-Milchpreis ist um 0 49 Rp pro kg Milch auf 79 90 Rp gestiegen Der Preis für Biomilch nahm um 1,3% zu und erreichte 95 32 Rp pro kg Milch Für Biomilch wird zwischen 15 und 17 Rp pro kg Milch mehr als für die übrige Milch bezahlt
■ Konsumentenpreise: Leicht steigend
1 kg Emmentaler kostete im Jahr 2001 durchschnittlich Fr 20 59 Die Zunahme beträgt gegenüber dem Vorjahr 41 Rp. Für 125 g vollfetten Camembert zahlte der Konsument Fr 2 70 oder 16 Rp mehr als im Jahr 2000
Erstmals seit Jahren haben sich im Berichtsjahr die Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte erhöht Der Index für Butter ist mit 4 Punkten oder 4,3% am stärksten gestiegen Die restlichen Indices stiegen durchschnittlich um einen Punkt
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 24
Rp /kg CH Region I Region II Region III Region IV Region V Gesamt 79 90 80 05 80 40 79 63 79 30 80 41 Industriemilch 78 65 78 84 79 05 78 69 77 72 79 88 verkäste Milch 79 73 80 34 79 46 79 53 79 23 82 45 Biomilch 95 32 95 32 95 79 94 57 94 98 nicht erhoben Quelle:
BLW
Entwicklung der Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte 1990/92199920002001 I n d e x ( M a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte 75 85 80 90 95 100 105
Begriffe
■ Bruttomarge: tendenziell
Im Dezember 2001 notierte die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Milch und Milchprodukte deutlich höher als im November Diese Steigerung ist zum einen mit der im Dezember erfolgten Aktualisierung der Gewichtungsfaktoren der einzelnen Bruttomargen nach den verwerteten Milchmengen, zum anderen mit der starken Zunahme der Bruttomarge Butter im Dezember zu erklären
Entwicklung der Bruttomarge Milch und Milchprodukte 2001

1 . 1 Ö K O N O M I E 25 1
zunehmend
J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r I n d e x ( J a n u a r 1 9 9 7 = 1 0 0 ) Quelle: BLW 105 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 Begriffe und Methoden,
A69
Seite
Tiere und tierische Erzeugnisse
Während des Berichtsjahres beeinflussten Diskussionen rund um die BSE und die Maul- und Klauenseuche (MKS) den Fleischmarkt. Im ersten Halbjahr wurden in Privathaushalten 10% weniger Rindfleisch konsumiert als in der gleichen Vorjahresperiode Die Konsumentenschaft kaufte in dieser Periode jedoch über 5% mehr Geflügel-, Lamm- und Pferdefleisch ein Um die Einschleppung der MKS zu verhindern, verhängten die schweizerischen Behörden insbesondere gegen Grossbritannien, Frankreich und die Niederlande Einfuhrsperren für tierische Produkte Erst im März 2002 hoben die Behörden die letzten Sperren gegen Grossbritannien auf
Mit dem Zweck eine aktive Oberaufsicht auszuüben, beschloss der Bundesrat am 28 Februar 2001, vorerst für eine Zeitdauer von sechs Jahren, eine BSE-Kontrolleinheit einzusetzen Die Kontrolleinheit unter der Leitung von BVET, BAG und BLW soll Lücken beim Vollzug aufdecken und damit einen einheitlichen Vollzug aller BSE-Bestimmungen sichern Ausserdem stellte der Bundesrat weitere 1,1 Mio Fr für Forschungen über Prionenkrankheiten und deren Übertragung zur Verfügung
Für Schweizer Zucht- und Nutzvieh sind die Absatzmärkte Deutschland seit dem 30. November 2001 und Frankreich seit dem 3. Mai 2002 wieder offen. Nach über fünf Jahren wurden die aus wissenschaftlicher Sicht ungerechtfertigten Handelseinschränkungen damit beseitigt
Erstmals seit vielen Jahren stieg der Rindviehbestand um 23'000 Stück (1,4%) an Hauptgrund dürften die ausserordentlich hohen Preise des Jahres 2000 sein, die vor allem einen Anreiz zur Grossviehmast gaben Nochmals gestiegen ist der Mastgeflügelbestand, der im Berichtsjahr beinahe 40% höher liegt als 1990. In dieser Vergleichsperiode hat sich der Legehennenbestand gegenläufig entwickelt (–26%) Die Zahl der Schafe, Ziegen und Pferde blieb in den vergangenen drei Jahren relativ stabil
26 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Entwicklung der Tierbestände Tierart 1990 1999 2000 2001 1990–1999/2001 in 1 000 in 1 000 in 1 000 in 1 000 % Rindvieh 1 858 1 609 1 588 1 611 -13,74 Schweine 1 776 1 453 1 498 1 548 -15,56 Schafe 355 424 421 420 18,78 Ziegen 61 62 62 63 2,19 Pferde 38 49 50 50 30,70 Mastgeflügel 2 878 3 747 3 808 3 993 33,75 Lege- und Zuchthennen 2 795 2 223 2 150 2 069 -23,17 Quelle: BFS
Mastgeflügelbestand Tabellen
■ Produktion: Steigender
3–13, Seiten A4–A13
Die Rind- und Kalbfleischproduktion stieg gegenüber 2000 um je 7,4%. Diese Zunahme ist beim Rindfleisch zu 40% durch höhere durchschnittliche Schlachtgewichte und zu 60% durch den Anstieg der Zahl der Schlachtungen bedingt Beim Kalbfleisch ist das Verhältnis genau umgekehrt. Trotz ausgezeichneter Nachfrage legte die Mastgeflügelproduktion lediglich um 1% zu Dies dürfte auf die zahlreichen Vorschriften für den Bau von neuen Masthallen zurückzuführen sein, die eine schnelle Anpassung der Produktion an die Nachfrage behindern
Die Eierproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 5% und belief sich auf 685 Mio Stück Ungefähr ein Drittel der Produktion wird direkt vermarktet und zwei Drittel vom Grosshandel übernommen

1 . 1 Ö K O N O M I E 27
1 Entwicklung der tierischen Produktion 1990/92199920002001 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quellen: Proviande und GalloSuisse Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 70 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch
■ Aussenhandel: Brasilien, Hauptlieferant von Rindfleisch
Wichtigstes Exportprodukt ist seit Jahren Trockenfleisch. Nach Frankreich und Deutschland fliessen zusammen 97% der Ausfuhren von insgesamt 829 t Auf der anderen Seite wird aus Italien Trockenfleisch in der Grössenordnung von rund 195 t eingeführt.
Die Einfuhren von Fleisch von Tieren der Rindvieh- und Schweinegattung sanken als Folge der grösseren Inlandproduktion von rund 14'800 t auf 8'000 t bzw von 15‘700 t auf 9'300 t Hauptlieferant von Rind- und Kalbfleisch ist Brasilien mit einem Anteil von rund 70%, gefolgt von den USA und Südafrika mit je 10% Aus Deutschland und Österreich stammen beinahe 100% des eingeführten Schweinefleisches Die vergleichbare Fleischqualität, tierfreundliche Haltungssysteme und kurze Transportwege dürften der Grund sein, weshalb diese Nachbarländer bevorzugt werden. Traditionell sind Neuseeland und Australien die wichtigsten Schaf- und Lammfleischexporteure in die Schweiz (86%); das gleiche gilt für die USA und Kanada beim Pferdefleisch (67%)
Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 150 Esel, Maultiere und Maulesel und über 2'900 Pferde und Kleinponys importiert, womit die Einfuhrzahlen 2000 um 11% übertroffen wurden Weiter nahmen die Schaleneierimporte um 8% gegenüber dem Vorjahr zu
■ Verbrauch: Geflügelkonsum steigt
Im Vergleich zum Vorjahr nahm der Fleisch- und Fischverbrauch im Berichtsjahr um 1,1% auf 443'000 t zu. Geflügelfleisch (+7,3%), Pferdefleisch (+8,5%), Wild und Kaninchen (+10,1%) sowie Fische und Krustentiere (+2,4%) liegen im Trend, dagegen sank der Verbrauch von Rindfleisch erneut um 4,8% Der Fleisch- und Fischkonsum pro Kopf stieg erstmals seit 1998 wieder um 0,3% an und erreichte 59,76 kg Das am meisten konsumierte Fleisch ist weiterhin Schweinefleisch (25,27 kg), gefolgt von Rind- (9,73 kg) und Geflügelfleisch (9,62 kg). Geflügel- und Lammfleisch sind die einzigen Fleischarten, von welchen seit 1990/92 signifikant mehr gegessen wird Dies dürfte auf den steigenden Verbrauch in Grosshaushalten (Gastronomie, Kantinen, Spitäler) zurückzuführen sein und auf die Tatsache, dass vor allem Geflügelfleisch ein vergleichsweise billiges Fleisch ist Der grösste Rückgang ist seit 1990/92 beim Rind(–23,2%) und Schweinefleischkonsum (–14,4%) zu beobachten
Quellen: Proviande und GalloSuisse
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 28
Entwicklung
von Fleisch und Eiern 1990/92199920002001 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch
Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier (in St.)
des Pro-Kopf-Konsums
■ Produzentenpreise: Fleischpreise im Tief
Vom konsumierten Rind-, Kalb- und Schweinefleisch wurden jeweils über 95% im Inland produziert Diese Situation trat letztmals 1991 auf Die gestiegene Nachfrage nach Geflügelfleisch wurde fast ausschliesslich mit Importen gedeckt, so dass der Inlandanteil um 2,5 Prozentpunkte auf rund 40% sank. Sehr geringe Inlandanteile unter 15% weisen Pferde- und Kaninchenfleisch sowie Fisch auf
Die Produzenten erzielten im Berichtsjahr für alle Kategorien des Schlachtviehs und für Geflügel tiefere Marktpreise als im Vorjahr Wegen der äusserst schwachen Rindfleischnachfrage und einem gleichzeitig gestiegenen Angebot waren die Preiseinbussen von 20 bis 45% bei den Kühen und beim Bankvieh (Muni, Ochsen und Rinder) am grössten. Für Lämmer, Mastpoulets und Schweine war der Rückgang mit bis zu 2% hingegen gering Saisonale Preisschwankungen treten ausgeprägt bei Tieren der Rindviehgattung auf Da die Kühe grösstenteils in den Wintermonaten abkalben, wirkt sich dies auf den Kälber- (Mastdauer 3–4 Monate) und Bankviehmarkt (Mastdauer 13–16 Monate) aus Die Kalbfleischpreise sanken deshalb auch von Januar bis August 2001 bis auf Fr 10 je kg SG und kletterten anschliessend dank kleinerem Angebot bis Ende Jahr wieder auf über Fr 14 je kg SG Für Banktiere erzielten die Produzenten im Rekordtief von Mai bis August lediglich Fr 6 10 bis Fr 6 40 je kg SG Als Folge der grossen Nachfrage nach Fleisch zum Grillieren stiegen wie jedes Jahr die Schweinepreise im Juni und Juli an und erreichten zeitweise über Fr 5 pro kg SG
Der Preis für verkaufte Eier an Sammelstellen stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1,5 Rp pro Stück Somit wurde der seit 1998 andauernde Abwärtstrend gebrochen Seit 1990 nimmt der Pouletpreis stetig ab Dies dürfte vor allem mit den sinkenden Futtermittelkosten zusammenhängen.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 29 1
Monatliche Schlachtvieh- und Fleischschweinepreise 2001, ab Hof F r p r o k g S G Kühe, Handelsklasse T2/3 Muni, Handelsklasse T3 Kälber, Handelsklasse T3 Fleischschweine, leicht Quelle: SBV 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r
■
Infolge der sinkenden Produzentenpreise für Rindfleisch sanken auch die Konsumentenpreise gegenüber dem Vorjahr um rund Fr 2 pro kg Sowohl beim frischen Rindwie auch beim Schweinefleisch waren die Konsumentenpreise gleich hoch wie 1990/92, obwohl seither die Produzentenpreise um ca. 20% gesunken sind. Seit Jahren stetig steigend sind die Preise für Fleischwaren und frische Inlandpoulets
■
Erstmals wurden im April 2002 die Einfuhren zur Berechnung der Bruttomargen Verarbeitung und Verteilung auf Rind-, Kalb- und Schweinefleisch einbezogen; beim Lammfleisch war dies bereits im Juni 2001 der Fall Die rückwirkend auf Januar 1999 kalkulierten Margen bestätigen den bereits vorher beobachteten Aufwärtstrend: Die nominale Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung beim Schweinefleisch lag im Berichtsjahr durchschnittlich 25% höher als in der Basisperiode Februar bis April 1999 Wesentlich geringer war die Zunahme der Bruttomarge Rind- (12%), Kalb- (11%) und Lammfleisch (5%). Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung aller Frischfleischsorten (Schwein, Rind, Kalb, Lamm), Fleisch- und Wurstwaren stieg um rund 10% gegenüber der Basisperiode Die grössten monatlichen Schwankungen im Berichtsjahr traten beim Schweinefleisch auf, dessen Index sich zwischen 114,1 und 132,0 Punkten bewegte
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 30
Konsumentenpreise: sinkende Rindfleischpreise
Bruttomarge Fleisch Entwicklung der Bruttomargen Fleisch
I n d e x ( F e b r u a r –A p r i l 1 9 9 9 = 1 0 0 ) Schwein Rind Kalb Lamm Frischfleischsorten, Fleisch- und Wurstwaren Quelle: BLW 135 130 125 120 115 110 105 100 95 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r
2001
■ Wettersituation: warm und nass
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte
Die Wintermonate am Übergang vom 2000 ins 2001 zeichneten sich durch aussergewöhnlich hohe Temperaturen und viel Niederschlag aus. Wie schon Januar und März, waren auch die ersten Frühlingstage mild, aber meistenorts regnerisch und nass Markant kühler wurde es um Ostern und in der zweiten Hälfte April Der Mai war sonnig, trocken und extrem warm Anfang Juni hat Pfingsten eine markant kühlere und nasse Periode eingeleitet, mit Frostnächten bis ins Flachland und grossen Niederschlagsmengen Die sehr warmen letzten Junitage vermochten das im Norden entstandene Temperaturdefizit auszugleichen Die warme und sonnige Periode setzte sich auch zu Beginn des Juli fort Der Monat Juli war in der ganzen Schweiz um rund 1° C, der August 2° C wärmer als im langjährigen Mittel. Die Hagelschäden hielten sich in Grenzen und wurden nur lokal festgestellt Sonnenarm und regnerisch präsentierte sich der September Der Oktober war in weiten Teilen des Mittellandes der mildeste seit Messbeginn im Jahre 1864. Eine deutliche Abkühlung brachten die ersten Novembertage Ein massiver Kälteeinbruch kam im Dezember und hielt bis in den ersten beiden Dekaden des Januar 2002 an
■ Produktion: Erträge meist unterdurchschnittlich
Nur beim Getreide haben sich gegenüber dem Vorjahr gewisse Flächenverschiebungen ergeben Die Reduktion der Anbauflächen von Weizen, Roggen, Gerste und Hafer konnte durch die Ausdehnung von Dinkel, Triticale und Körnermais nicht wettgemacht werden. Es resultierte eine Reduktion der Getreidefläche von knapp 1,7%. Eine 13%ige Ausdehnung haben dagegen die Körnerleguminosen, vorab die Eiweisserbsen, erfahren
Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2001
T
otal 29
übrige Kulturen 5% 16 300 ha
Z
Auf einer Fläche von 24‘137 ha oder 2,3% der LN wurden Dauerkulturen angebaut. Davon waren 15‘086 ha Reben, 6‘937 ha Obstanlagen und 257 ha Strauchbeeren
1 . 1 Ö K O N O M I E 31
1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Tabellen 3–13 Seiten A4–A13
Getreide 62% 179 576 ha Silo- und Grünmais 14% 41 252 ha Freilandgemüse 3% 8 390 ha
1
Quelle: SBV
0
88 ha
Raps 5% 13 129 ha
uckerrüben 6% 17 757 ha
Kartoffeln 5% 13 784 ha
Spezialkulturbetriebe
Im Berichtsjahr wurden 12'700 ha mit Gemüse angebaut (Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau) Diese Fläche (inkl Mehrfachanbau pro Jahr) stieg seit einigen Jahren kontinuierlich an Wetterbedingt war sie allerdings ein wenig kleiner als im Vorjahr (–200 ha) Die grösste Flächensteigerung ist beim Saisongemüse zu verzeichnen Seit 1997 nahm die Fläche um 500 ha zu und betrug im Berichtsjahr 7‘000 ha Die bedeutendsten Saisongemüse sind Kopfsalat und Blumenkohl. Die Lagergemüsefläche ist mit 1‘600 ha seit mehreren Jahren konstant Karotten und Zwiebeln sind die am meisten angebauten Lagergemüse Der Anbau in den Gewächshäusern war mit 820 ha gleich gross wie im Vorjahr, jedoch etwas grösser als in den vorhergehenden Jahren. Die wichtigsten Produkte aus dem Gewächshaus sind Tomaten, Nüsslisalat, Kopfsalat und Radieschen Die Fläche der Konservengemüse (Bohnen, Erbsen, Spinat und Karotten) nimmt seit mehreren Jahren kontinuierlich ab und betrug im Berichtsjahr 3‘100 ha
Der Flächenrückgang bei den Kernobstkulturen und die Flächenausdehnung bei den Steinobstanlagen hält an Äpfel wurden auf einer Fläche von 4‘700 ha angebaut, Birnen auf 940 ha Somit sind die Flächen im Vergleich zum Vorjahr um 1 bis 2% zurückgegangen. Hingegen nahm die Steinobstfläche seit der letztjährigen Erhebung um 6% auf 1‘240 ha zu Die gesamte Beerenfläche blieb mit 630 ha ungefähr gleich Während die Erdbeerfläche wie bereits in den letzten vier Jahren zurückging, nahmen die Himbeer-, Heidelbeer- und auch die Johannisbeerflächen weiter um einige ha zu.
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 32
Werte pro Betriebsstandort nach FAT Betriebstypologie (max. 1 GVE/LN; über 10% Spezialkulturen/LN)
Quelle: BLW - GG25 © Swisstopo (BA024503)
Das BFS führte im Jahre 2001 eine Feldobstbaumzählung durch. Dabei wurden 2,6 Mio. Hochstammobstbäume erfasst 240'000 Bäume oder 9% vom Bestand wurden in den letzten zehn Jahren neu gepflanzt Bei der letzten Zählung im Jahre 1991 wurden noch 3,6 Mio. Hochstämme gezählt. Die beiden Erhebungen sind allerdings nicht direkt vergleichbar Im Jahre 2001 wurden im Gegensatz zum Jahre 1991 keine Bäume, welche ausserhalb der Landwirtschaftsbetriebe stehen, erfasst Im Weiteren umfasste die Erhebung 2001 mehr Gemeinden als noch vor zehn Jahren Aufgrund einer Expertenschätzung kann für das Jahr 2001 mit einem Korrekturfaktor von rund 230'000 Bäumen gerechnet werden Somit kann seit 1991 von einem Baumrückgang von rund 20% ausgegangen werden
Die Erträge im Ackerbau sind gegenüber dem Vorjahr tiefer ausgefallen. Insbesondere sind die Durchschnittserträge von Zuckerrüben und Kartoffeln wegen der verspäteten Aussaat bzw Pflanzung gesunken Die Erträge von Getreide und Raps bewegten sich im Bereich des langjährigen Mittels.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 33 1 Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte 1990/92199920002001 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Winterweizen (55,64 dt/ha) Kartoffeln (382,60 dt/ha) Produkte (Erträge 2001) Quelle: SBV Raps (29,69 dt/ha) Gerste (55,88 dt/ha) Zuckerrüben (593,22 dt/ha) 70 140 130 120 110 100 90 80
Die Getreideproduktion erfährt oft witterungsbedingt bedeutende Mengenschwankungen Das Produktionsniveau ist gegenüber dem Durchschnitt von 1990/92 gesunken Insbesondere hat die Produktion von Gerste signifikant abgenommen Die Körnermaisproduktion ist im Vergleich zu Weizen und Gerste ziemlich stabil geblieben Die Haferproduktion ist zurückgegangen, während die Produktion von Triticale zugenommen hat

Obwohl es sich bei den meisten Früchten um Dauerkulturen handelt, passen sich die Obstproduzenten den Bedürfnissen des Marktes an Seit mehreren Jahren werden jährlich zwischen 240 und 620 ha Apfelkulturen gerodet und zwischen 160 und 260 ha neue Anlagen erstellt Somit liegt die Remontierungsrate durchschnittlich bei 4% Mit jährlichen Abnahmen von mehr als 10% der Fläche wurden vor allem die Sorten Gloster, Spartan, Primerouge, Kidds, Glockenapfel, Jonathan und Idared häufig gerodet Hingegen nahmen die gefragten Sorten Gala, Braeburn und Topaz stark zu Die Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr betrugen bei Gala 12%, bei Topaz 29% und bei Braeburn sogar 50%.
Die gesamte Aprikosenfläche betrug 565 ha Die traditionelle Sorte Luizet besetzte mit 370 ha (65%) immer noch den grössten Teil der Aprikosenfläche Bei der übrigen Fläche handelte es sich um neue Sorten Seit 1997 wurden pro Jahr im Durchschnitt 30 ha Neuanlagen erstellt Die Sortenstruktur der gesamten Aprikosenfläche erneuerte sich um bis zu 11% pro Jahr Orangered, Goldrich, Hargrand und Bergeron sind die wichtigsten neuen Sorten Seit 1997 haben sie sich von 5 ha auf 111 ha vervielfacht Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Sorten; im Jahre 2000 wurden 25 Sorten das erste Mal erhoben Ihre Flächen waren allerdings lediglich zwischen 0,01 und 5 ha gross
Das nasskalte Wetter im Frühling liess nicht nur weniger Gemüse und Obst wachsen, es beeinträchtigte auch deren Qualität Nass gewachsene oder geerntete Gemüse waren oft nur kurz haltbar Auch für Pilzkrankheiten war die feuchte Witterung ideal Gerade die Lagergemüse, insbesondere Zwiebeln, Karotten und Sellerie, waren während der ganzen Wachstumszeit einem enormen Krankheitsdruck ausgesetzt. Deutliche Vorteile hatten Produzenten mit Kulturen unter geschütztem Anbau
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 34
Getreideproduktion 1990/92199920002001 i n 1 0 0 0 t Weizen Triticale Quelle: BLW Roggen Hafer Dinkel Körnermais Gerste 0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 547 490 561 456 245 218 274 212 254 194 342 211
■ Verwertung: Weniger Ölsaaten verarbeitet
Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen 480‘000 t bzw 163‘000 t Diese Mengen sind ein wenig kleiner als im Durchschnitt der letzten vier Vorjahre (Gemüse –1%, Obst –4,5%) Die Anteile Schweizer Gemüse und Obst am gesamten Marktvolumen betrugen 55% bzw. 73%. Diese Anteile sind in den letzten Jahren bei Gemüse leicht sinkend und bei Obst recht konstant geblieben
Die Ertragserhebung aus den Kulturen ergab, dass 123'700 t Äpfel und 21'600 t Birnen geerntet wurden Somit sind die Ernten bei den Äpfeln um 17% und bei den Birnen um 5% kleiner ausgefallen als in den vier Vorjahren Wie in den Vorjahren erreicht Idared mit 37 t/ha den grössten Flächenertrag, gefolgt von Golden Delicious mit 34 t/ha. Das Jahr 2001 brachte den Obstbauern eine kleine bis mittlere Steinobst-, dafür aber eine ausgezeichnete Beerenernte Rekordmengen wiesen vor allem die Himbeeren auf
Die Verwertungs- und Verarbeitungsstrukturen für Zuckerrüben haben sich nicht verändert Ein kontinuierlicher Konzentrationsprozess findet weiterhin bei den Getreidemühlen und bei den Trocknungsbetrieben für Kartoffeln zu Futterzwecken statt Eine wesentliche Neuausrichtung hat bei den Ölmühlen und Fettwerken stattgefunden. Durch die Schliessung des einzigen Extraktionswerkes im November 2000 sind zwei Drittel der inländischen Ölsaatenverarbeitungs- und Raffinationskapazität verloren gegangen. Letztere konnte bei den verbleibenden Betrieben teilweise wieder aufgebaut werden In diesem Zusammenhang ist der aktive Veredelungsverkehr mit Sojabohnen stark zurückgegangen Ab 2001 beanspruchen die inländischen Ölsaaten rund 80% der verbleibenden Verarbeitungskapazitäten
Sojaöl zu Speisezwecken 20002001

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 35 1
i n t importiert abgepresst 1 exportiert verbraucht
OZD, SwissOlio 1 Aus inländischen und importierten Sojabohnen gewonnenes Öl 0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Quellen:
Von der geernteten Apfelmenge aus den Kulturen konnten 77% als Tafelobst abgesetzt werden, 20% wurden als Mostäpfel der technischen Verwertung zugeführt und die restlichen 3% wurden in den eigenen Betrieben verbraucht Verglichen mit dem Vorjahr reduzierte sich der Anteil für die technische Verarbeitung zugunsten des Tafelobstabsatzes um 15% Die Birnen wurden in etwa gleich verwendet wie im Vorjahr: 67% ging als Tafelware weg, 31% wurde für die technische Verarbeitung abgeliefert und 2% verblieb in den Betrieben
Die in den Mostereien verarbeitete Menge Mostäpfel betrug 66‘000 t und jene der Mostbirnen 31‘500 t Im Jahr 2001 fielen im Gegensatz zum Erntedurchschnitt der letzten zehn Jahre (1991–2000) nur 51% Mostäpfel und 67% Mostbirnen an Zur Deckung des schweizerischen Jahresbedarfs werden rund 77‘000 t Mostäpfel und rund 15‘500 t Mostbirnen benötigt Die kleine Mostapfelernte 2001 deckte den Jahresbedarf nicht, so dass dieser mit Apfelsaftkonzentrat aus dem Vorjahr, welches für den Export bestimmt war, ergänzt werden konnte. Trotzdem standen per 31. Dezember 2001 noch 9‘400 t Apfelsaftkonzentrat (entspricht 70'000 t Mostäpfel) in den Mostereien zum Export an Lager Obschon die Mostbirnenernte 2001 als klein bezeichnet werden kann, deckte diese den Jahresbedarf um rund das Doppelte, so dass per 31 Dezember 2001 rund 1'200 t Birnensaftkonzentrat (entspricht 9000 t Birnen) für den Export ausgeschieden werden mussten. Der Jahresausstoss an ungegorenen Obstsaftgetränken hat das erste Mal seit Jahren wieder zugenommen Derjenige von gegorenen Obstsaftgetränken hat weiterhin leicht abgenommen
Die Erzeugung von Kernobstbrand durch gewerbliche Betriebe hat in den letzten Jahren massiv abgenommen Gründe dafür sind die zunehmend gehobenen Qualitätsansprüche der Veredlungsbetriebe und Endverbraucher an den Kernobstbrand, die Preisentwicklung sowie die per 1 Juli 1999 in Kraft getretene Steuerharmonisierung auf Spirituosen. Der Handel durch die alcosuisse (Profitcenter der Alkoholverwaltung) mit Kernobstbrand kam praktisch zum Erliegen
Es wurden 870 t schwarze Konservenkirschen abgeliefert und vorwiegend zu Tiefkühlprodukten verarbeitet Im Jahr zuvor betrug die Menge 2‘300 t

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 36
■ Aussenhandel: Importe rückläufig
Die Erntemengen und die Importe von Ackerbauprodukten sind mehrheitlich tiefer als im Vorjahr ausgefallen Beim Weichweizen waren keine erhöhten Ergänzungsimporte notwendig, weil die Liberalisierung der Brotgetreidemarktordnung einen ausserordentlichen Lagerabbau mit einer entsprechenden Angebotserhöhung mit sich brachte. Die Hartweizenimporte sind im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 22% auf 130’657 t gestiegen Diese Schwankung liegt im Bereich der üblichen Beschaffung und Lagerbewirtschaftung Die Importe von Gerste und Körnermais sind um die Hälfte gesunken Zum einen geht der Verbrauch an energiereichen Futtermitteln stetig zurück Zum anderen haben die vorhandenen Lager den Importbedarf 2001 reduziert
Wie die Zuckerrüben- war auch die Kartoffelproduktion im Berichtsjahr geringer als im Vorjahr. Durch die kleinere Inlandernte flossen weniger Kartoffeln in die Frischverfütterung und in die Trocknung zu Futtermitteln Um den inländischen Bedarf an Kartoffeln, insbesondere für die Veredelungsbetriebe, zu decken, hat das EVD das ordentliche Zollkontingent für Kartoffeln wie schon in den Vorjahren vorübergehend erhöht
Inlandproduktion und Import ausgewählter Produkte
Der Aussenhandel von Zucker und Ölsaaten hat strukturelle Veränderungen erfahren
Die Reduktion der Importe von Ölsaaten ist auf die reduzierten Verarbeitungskapazitäten zurückzuführen Ende 2000 hat das grösste Ölwerk mit zwei Dritteln der schweizerischen Kapazität den Betrieb eingestellt Seither sind vermehrt Speiseöle an Stelle von Ölsaaten eingeführt worden.
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 37 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Weichweizen Gerste Körnermais Zucker Ölsaaten Kartoffeln Gemüse Obst (ohne tropische Früchte) i n 1 0 0 0 t Import 2000 Inlandproduktion 2000 Quellen: SBV, Schweizerischer Obstverband, Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau, OZD, Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG Import 2001 Inlandproduktion 2001 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Während der Inlandkonsum von Zucker in den letzten zehn Jahren stabil geblieben ist, hat der aktive Veredelungsverkehr an Bedeutung gewonnen Die Reexporte von Zucker gelangen in Form von Limonaden zum grössten Teil in die benachbarten Länder der EU Die EU hat bei diesen Zollpositionen eine verminderte Zollbelastung gegenüber der Schweiz (Protokoll 2 des Freihandelsabkommens) Die bestehende Regelung ist Gegenstand der bilateralen Verhandlungen mit der EU (siehe Kapitel 3 1 Internationale Entwicklungen). Kommt die so genannte Doppel-Null-Lösung zustande, wird dieser Preisvorteil der schweizerischen Exporteure von Limonaden aufgehoben Die Zuckerimporte sind in den letzten beiden Jahren konstant geblieben Demgegenüber folgte auf die Rekordernte 2000 eine mengenmässig bescheidene Zuckerrübenernte 2001 In der Summe beider Jahre konnte durch die Übertragung der Mehrmenge eine ausgeglichene Versorgung erreicht werden.
215‘000 t Frischgemüse und 46‘000 t Frischobst wurden in die Schweiz importiert, das sind 5,8% mehr Gemüse und 6,0% weniger Obst als im Durchschnitt der vier Vorjahre. In diesen Mengen sind die Gemüse- und Obstarten enthalten, welche in der Schweiz angebaut werden können
Beim Trinkwein betrugen die Einfuhren 142,1 Mio Liter Rotwein und 22,5 Mio Liter Weisswein Dazu kommen noch Importe von 12,2 Mio Liter Schaumweine, 7,8 Mio Liter Verarbeitungsweine und 1,7 Mio Liter Süssweine Gegenüber dem Jahr 2000 ist ein Rückgang um 4,3 Mio Liter bei den Rotweineinfuhren festzustellen, hingegen haben die Einfuhren beim Weisswein um 4,8 Mio. Liter zugenommen. Diese Zunahme ist auf das Zusammenlegen der Rot- und Weissweinkontingente auf den 1 Januar 2001 zurückzuführen (vgl Kapitel 2 1 Produktion und Absatz) Beim Schaumwein haben die Importe wieder zugenommen (+1,4 Mio. Liter) nachdem sie im Jahre 2000 leicht rüchläufig waren Die Exporte an Schweizer Wein haben leicht zugelegt Sie haben mit rund 730‘000 Liter aber immer noch wenig Bedeutung

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 38
Entwicklung der Zuckerbilanz 1990/92199920002001 i n 1 0 0 0 t Import und Lagerveränderung Inlandproduktion Export Nettoverbrauch Quelle: Treuhandstelle der Schweizerischen Lebensmittelimporteure 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50
■ Verbrauch: Weniger Obstund Gemüsekonsum
Der Pro-Kopf-Konsum von Brot- und Backwaren hat sich nach einem Tiefstand Mitte der neunziger Jahre bis 2000 wieder auf das Niveau von 1990 erhöht Im Berichtsjahr ist er wieder gesunken und beträgt etwas weniger als 50 kg pro Kopf Gründe für diese Entwicklung sind in den Konsumgewohnheiten und Modetrends zu suchen. Insbesondere Spezialbrote sind Ende der neunziger Jahre vermehrt konsumiert worden Dieser Trend scheint nun etwas nachzulassen
Bei Gemüse betrug der berechnete Jahreskonsum 67 kg pro Kopf der Wohnbevölkerung und bei Früchten 23 kg (ohne tropische Früchte) Gegenüber dem Vierjahresmittel 1998/2001 wurden 1 kg weniger Gemüse und ebenfalls 1 kg weniger Obst konsumiert
Der Konsum an Rot- und Weisswein (ohne Verarbeitungsweine) betrug im Weinjahr 2000/2001 286 Mio Liter Damit liegt der Verbrauch um zwei Mio Liter tiefer als im Vorjahr. Der Marktanteil an Schweizer Wein beträgt rund 41% und nimmt um 1% ab. Beim Konsum von Schweizer Weisswein ist ein starker Rückgang von 3,1 Mio Liter festzustellen Sein Anteil am Trinkweinmarkt beträgt noch 76% (Rückgang von 5% in fünf Jahren) Beim Schweizer Rotwein blieb der Konsum stabil Der Marktanteil beträgt rund 29%, was eine Zunahme von 3% in fünf Jahren entspricht Der Gesamtverbrauch an Wein, das heisst inkl. die Verarbeitungsweine, beträgt 294 Mio. Liter, wovon 69% Rotweine sind
■ Produzentenpreise: Höhere Erlöse im Gemüse- und Obstbereich Entwicklung
Nach erfolgter Liberalisierung der Getreide- und Ölsaatenmarktordnungen haben sich die Produzentenpreise auf dem meist tieferen Niveau stabilisiert Wegen der tiefen Inlandproduktion 2001 sind die Preise in einzelnen Bereichen wieder angestiegen (Zuckerrüben, Ölsaaten) Die innerhalb der swiss granum ausgehandelten Richtpreise für Getreide der Ernte 2001 konnten mit Ausnahme desjenigen für Top-Weizen und Roggen mehrheitlich realisiert werden
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 39
der Produzentenerlöse für Ackerprodukte 1990/92199920002001 A b w e i c h u n g i n % Produzentenpreise 2001 Weizen Kl. I, 55.65 Fr./dt Zuckerrüben, 13.3 Fr./dt Raps, 79.57 Fr./dt Quelle: FAT Gerste, 45.08 Fr./dt Kartoffeln, 35.15 Fr./dt –40 –50 –60 –70 –30 –20 –10 0
Preisschwankungen auf den internationalen Märkten wirkten sich wegen den fixen Grenzabgaben vor allem beim Brotgetreide, den Zuckerrüben und bei den Ölsaaten auf den Erlös aus dem inländischen Anbau aus Die verbliebenen marktstützenden Massnahmen hatten jedoch eine stabilisierende Wirkung auf die Preisbildung. Preiszusammenbrüche konnten bisher verhindert werden
Für den grössten Teil der Gemüse konnten die Produzenten mehr lösen als in den Vorjahren Der durchschnittliche Kilopreis betrug Fr 2 46 Dieser Wert ist 13% höher als im Vorjahr und sogar 20% höher als im Durchschnitt der drei Vorjahre
Grüner Kopfsalat: Preis und Angebot 2000 und 2001
Preis 2000Preis 2001
Das abgebildete Beispiel von grünem Kopfsalat zeigt eindrücklich wie sich Angebotsänderungen auf den Preis und somit auf den Erlös auswirken Ein Angebotsrückgang von rund 10% (12‘108 t) hatte eine Preissteigerung von 27% (3 39 Fr /kg) zur Folge Der Erlös stieg dadurch um 14% und zwar von 36 auf 41 Mio. Fr. Das Preisniveau war allerdings in ganz Europa hoch Trotz diesem für die Produktion positiven Beispiel anhand von Durchschnittswerten gab es viele Betriebe, die unter den widrigen Wetterbedingungen wirtschaftlich leiden mussten
Die Preise von Tafelobst waren im Allgemeinen besser als im Vorjahr Für Brennkirschen erhielten die Produzenten 89 Rp /kg bei 18 Brix-Grad (Zuckergehalt) Der Preis war 4 Rp tiefer als im Vorjahr, obwohl nur halb so viel produziert und importiert wurde
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 40
1 3 5 7 9 1113 15 17 19 21 23 25 27 29 31 3335 37 39 41 43 45 47 49 51 Angebot 2000 Woche Quelle: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau Angebot 2001 0 1 000 800 600 200 400 i n t F r / k g 0 6 5 4 3 2 1
■ Konsumentenpreise: Entwicklung des Warenkorbes Früchte und Gemüse
Entwicklung des Warenkorbes Früchte und Gemüse im Jahr 2001 verglichen zum Mittelwert der vier Vorjahre 1
n (250 g), Champignons (250 g), Fenchel (500 g),
Karotten (1 kg), Blumenkohl (1 kg), Chinakohl (350 g), Weisskabis (500 g), Krautstiel (250 g),

Lauch grün (250 g), Peperoni (200 g), Knollensellerie (600 g), Tomaten rund (2 kg), Zucchetti (600 g), Speisezwiebeln (500 g), Brüsseler Witloof (500 g), Gurken (1 kg), Kopfsalat (1 Stück),
Radieschen (2 Bund), Kartoffeln (2,5 kg), Äpfel (1 kg),Orangen (1 kg),
Bananen (1 kg), Kiwi (4 Stück), Trauben (1 kg)
Die Preisdifferenz zum Vorjahr betrug zum Teil mehr als 14% Das Jahr 2001 hat mit deutlich tieferen Konsumentenpreisen begonnen als im Vorjahr Der Regen zog im März/April (Wochen 10–18) grössere Ertragsausfälle nach sich. Ab Mitte April zogen die Preise bis zur zweiten Hälfte Juni an Die Mindererträge führten europaweit zu Teuerungsschüben und damit zur Erhöhung der Preise für Importware In den Monaten Juli und August (Wochen 27–34) sank die Nachfrage ferienbedingt deutlich ab Innert zehn Wochen sank der Preis um Fr 14 50 oder 20% Im September (Wochen 36–39) kam das Wachstum der Kulturen aufgrund der feuchten und kühlen Witterung ins Stocken Der Oktober indes (Wochen 40–44) wartete mit besonders warmen Tagen auf, die die Produktion wieder in Gang setzten Im November (Wochen 45–48) meldeten sich schon früh die ersten Fröste und die Freilandkulturen mussten früher als im Vorjahr geräumt werden Die strengen Dezembertemperaturen liessen die Preise sowohl für Inland- als auch Importware ansteigen
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 41
4 7 1013 16 19 2225 28 31 34 37 40 43 46 49 52 1 Woche T o t a l F r Warenkorb 2001 Warenkorb 1997–2000 Quelle: BLW 1 Addierte Konsumentenpreise von Aubergine
48 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 Bruttomarge Gemüse 19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2000 F r / k g Bruttomarge x Menge Einstand in Fr./kg Verkauf in Fr./kg Bruttomarge in Fr./kg Quelle: BLW 0 3 00 2 50 2.00 1 50 1 00 0 50 i n M i o F r 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280
Bruttomarge Früchte
Bei der Betrachtung der Bruttomarge für Verarbeitung und Verteilung (Differenz des Einstands- und Konsumentenpreises) ausgewählter Produkte im Früchte- und Gemüsebereich lässt sich für das Jahr 2001 Folgendes feststellen:
Bei den Früchten (Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Erdbeeren, Nektarinen und Orangen) lag der Einstandspreis um 3,8% und bei Gemüse (Blumenkohl, Karotten, Gurken, Zwiebeln, Brüsseler Witloof, Tomaten und Kartoffeln) sogar um 9,6% höher als im Vorjahr Bei den Konsumentenpreisen wurde ebenfalls ein deutlicher Teuerungsschub festgestellt Der Endverkaufspreis hat um 6,8% bei Früchten und 6,3% bei Gemüse zugelegt Die Bruttomarge Früchte stieg um 9,2% und diejenige von Gemüse um 3,9% im Vergleich zum Vorjahr Mengenmässig wurde jedoch deutlich weniger umgesetzt, was zu einem Rückgang des mengengewichteten Wertes der Bruttomarge um 6,3% bei Früchten und 0,3% bei Gemüse führte Das heisst: der Handel hat bei den genannten Produkten nicht mehr lösen können als im Vorjahr und deshalb bei steigenden Kosten für Personal und Verteilung schlechter abgeschnitten. Fazit: Ein Jahr, das sowohl für die Produktion als auch für den Handel nicht zu den besten zählte und an der Konsumfront Preise auf Rekordniveau bescherte

42 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2000 F r / k g Bruttomarge x Menge Einstand in Fr./kg Verkauf in Fr./kg Bruttomarge in Fr./kg Quelle: BLW 0 4 50 4 00 3 00 2 50 3 50 2 00 1 50 1 00 0 50 i n M i o . F r . 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
■ Methodisches Vorgehen
Analyse der Deckungsbeiträge verschiedener Betriebszweige
Nach Artikel 7 LwG setzt der Bund die agrarpolitischen Rahmenbedingungen unter anderem so fest, dass die Landwirtschaft aus der Produktion einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann Dieser macht heute drei Viertel der gesamten Einnahmen des Sektors aus, während die Direktzahlungen einen Viertel dazu beitragen Nach Abzug der Bundesausgaben für die Marktstützung verbleiben rund zwei Drittel der Einnahmen als Markterlöse Optimierungen im Marktbereich können ein Potenzial zur Verbesserung der Einkommen enthalten
Der Beitrag eines Betriebszweiges zur Einkommensbildung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Verkaufspreis des entsprechenden Produkts und den Kosten für die Vorleistungen. Im volkswirtschaftlichen Sinne wird diese Grösse als Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen bezeichnet In der Betriebswirtschaft entspricht diese Grösse den vergleichbaren Deckungsbeiträgen (VDB) Darunter versteht man die Differenz zwischen Bruttoerlös und Sachaufwendungen, die eindeutig einem Betriebszweig zugeordnet werden können Bei dieser Betrachtung werden die Strukturkosten ausser Acht gelassen, da die Zuordnung zu einzelnen Betriebszweigen mit erheblichen methodischen Problemen verbunden ist
Um der tatsächlich auf dem Markt erzielten Wertschöpfung näherzukommen, werden die VDB jeweils mit und ohne Berücksichtigung von finanziellen Mitteln des Bundes errechnet Zu den einbezogenen finanziellen Mitteln zählen die Gelder für die Marktstützung, die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, die Beiträge für offenes Ackerland und Dauerkulturen sowie die spezifischen Beiträge bei den Eiweisserbsen und Ölsaaten. Die aufgezählten finanziellen Mittel des Bundes werden in der Folge als «Beiträge» bezeichnet
Die VDB werden auf Grund der Ordner «Deckungsbeiträge 2000 und 2001» von LBL/SRVA/FIBL berechnet Die Schätzungen für das Jahr 2007 stützten sich ab auf die Preise und Beiträge, die in dem von der FAT im Auftrag des BLW erarbeiteten Prognosemodell SILAS verwendet wurden Es handelt sich dabei um ein Modell zur Optimierung der Produktion und des landwirtschaftlichen Einkommens, das die Produktionsfähigkeit sowie die Rahmenbedingungen der Agrarpolitik und ihren Bezug zu den Preisen erfasst Nicht einkalkuliert werden bei der Berechnung der VDB für das Jahr 2007 die möglichen Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Erträge und die erforderliche Arbeitszeit. Die für einige Produktionszweige mit den Preisen des Jahres 2000 in Bayern (Deutschland) ausgeführten Vergleiche beruhen auf den vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten veröffentlichten Zahlen
Die nachfolgenden Ergebnisse für die Jahre 2000 und 2007 werden einerseits je ha, anderseits je Arbeitsstunde präsentiert
43 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
■ Ergebnisse in der Viehwirtschaft
In der Viehwirtschaft werden bei der Milch Resultate für die drei Produkte Milchdrink, Butter und Emmentaler, der in die EU exportiert wird, dargestellt
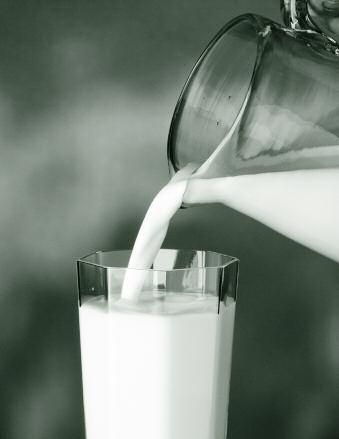
VDB
Milchdrink Die Butter, Grosspackung Emmentaler, Export EU Rinder, Intensivmast Mutter- und A
In der Milchwirtschaft ist der VDB/ha für Milch, die ohne Einsatz von Silage in der Fütterung zu Emmentaler verarbeitet wird etwas höher als für Konsummilch (Milchdrink), die mit Einsatz von Silofutter produziert wird Werden die Beiträge abgezogen sieht das Bild anders aus. Mit dem Milchdrink ist ein höherer VDB/ha zu erzielen als mit Emmentaler, der in die EU exportiert wird Bei dieser Betrachtung gilt es allerdings zu beachten, dass der Milchdrink nur in der Schweiz abgesetzt werden muss und es für den Rohstoff Milch einen beträchtlichen Grenzschutz gibt
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 44
pro ha 2000 und 2007
F r / h a
Beitr
Beiträ
Quellen: BLW LBL SRVA FiBL 0 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
mmenkühe (Natura-beef)
VDB ohne Beiträge pro ha 2000
V
DB ohne Beiträge pro ha 2007
ä
ge pro ha 2000
ge pro ha 2007
VDB pro Arbeitsstunde 2000 und 2007
F r / h
Beitr
Beiträ
Quellen: BLW LBL SRVA FiBL 0 35 30 25 20 15 10 5
Milchdrink Die Butter, Grosspackung Emmentaler, Export EU Rinder, Intensivmast Mutter- und Ammenkühe (Natura-beef)
VDB ohne Beiträge pro h 2000
V
DB ohne Beiträge pro h 2007
äge pro h 2000
ge pro h 2007
Die VDB/ha sind in der Fleischproduktion weniger hoch als in der Milchproduktion. Die Betrachtung je Arbeitsstunde zeigt, dass die VDB ziemlich ähnlich sind Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Milchproduktion arbeitsintensiver ist Bei der Mutter- und Ammenkuhhaltung sind allerdings wie bei der Butter und bei Emmentaler für den Export in die EU beträchtliche finanzielle Mittel des Staates im Spiel Bei den Ergebnissen für das Jahr 2007 ist ausserdem zu beachten, dass bei der Intensivmast im Jahr 2000 vergleichsweise hohe Preise erzielt werden konnten Aus diesem Grund ist die Differenz zwischen dem Jahr 2000 und den Schätzungen für das Jahr 2007 ziemlich hoch ausgefallen
Beim Pflanzenbau werden Mähdruschfrüchte (Wintergerste, Winterweizen, Eiweisserbsen, Raps), Hackfrüchte (Kartoffeln, Zuckerrüben) und Spezialkulturen (Tafeläpfel aus den Kulturen) miteinander verglichen
VDB ohne Beiträge pro ha 2000 VDB ohne Beiträge pro ha 2007
äge pro ha 2000
pro
VDB pro Arbeitsstunde 2000 und 2007 Wintergerste Winterweizen Eiweisserbsen Raps Zuckerrüben Speisekartoffeln Tafeläpfel, Obstkulturen
VDB ohne Beiträge pro h 2000 VDB ohne Beiträge pro h 2007
äge pro h 2000
äge pro h 2007 Quellen: BLW, LBL, SRVA, FiBL
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 45 VDB pro ha 2000 und 2007 Wintergerste Winterweizen Eiweisserbsen Raps Zuckerrüben Speisekartoffeln Tafeläpfel, Obstkulturen F r / h a
Beitr
0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
F r / h
Beitr
äge
ha 2007 Quellen: BLW, LBL, SRVA, FiBL
0 120 100 80 60 40 20
Ergebnisse im Pflanzenbau
Beitr
Beitr
■
Beim Pflanzenbau kommt der unterschiedliche Arbeitseinsatz für die verschiedenen Produkte klar zum Ausdruck Die Mähdruschfrüchte erfordern weniger Arbeit pro ha als die Hackfrüchte und bedeutend weniger als eine Obstkultur Die VDB von Kartoffeln und Tafeläpfeln sind zwar je ha am höchsten, je Arbeitsstunde hingegen am tiefsten. Bei den Zuckerrüben hat die Mechanisierung in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht Entsprechend hoch ist der VDB je ha Bei den Mähdruschfrüchten zeigt sich die Wirkung des unterschiedlichen Grenzschutzes Ohne die spezifischen Beiträge für Eiweisserbsen und Ölsaaten wären diese Kulturen gegenüber der Wintergerste und dem Winterweizen nicht konkurrenzfähig
Im Vergleich zum Jahr 2000 deuten die Schätzungen für 2007 in allen untersuchten Produktionszweigen auf einen Rückgang der VDB hin. Da die Auswirkungen des technischen Fortschritts für die Berechnung der VDB 2007 nicht berücksichtigt wurden, kann man davon ausgehen, dass die Ergebnisse pro Arbeitsstunde besser sein werden, falls der Rationalisierungseffekt im Jahre 2007 zu einer Senkung des Arbeitseinsatzes führt
Der Vergleich Schweiz – Bayern bezieht sich auf das Jahr 2000 Die staatlichen Beiträge sind nicht mit in die Analyse einbezogen worden.
Die VDB je ha waren bei allen untersuchten Produktionszweigen in der Schweiz höher als in Bayern. Die Unterschiede bewegten sich zwischen 4 und 73%. Besonders gross war die Differenz bei Produkten wie Winterweizen und Getreide, die in der Schweiz einen guten Grenzschutz geniessen Bei der Milch mit einem Unterschied von 8% und bei den Zuckerrüben mit 4% war die Differenz am geringsten.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 46
■ Vergleich Schweiz –Bayern für 2000
Wintergerste Winterweizen Raps Zuckerrüben Speisekartoffeln Milch F r / h a CH Bayern Quellen: BLW LBL SRVA, FiBL, Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 0 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
VDB-Vergleich Schweiz – Bayern pro ha 2000
1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme Eine sektorale Beurteilung basiert auf der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, welche vom Sekretariat des SBV im Auftrag und unter der Aufsicht des BLW sowie des BFS erstellt wird (vgl. Abschnitt 1.1.3). Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der FAT (vgl Abschnitt 1 1 4)
Das sektorale Nettoeinkommen der Familienarbeitskräfte hat im Jahr 2001 im Vergleich zu den Jahren 1998/2000 von rund 2,7 Mrd Fr auf rund 2,4 Mrd Fr abgenommen (–8%) Die Abnahme ist vorwiegend das Resultat einer tieferen Endproduktion (–4%), vor allem bedingt durch tiefere Erlöse bei Getreide, Ölsaaten und Obst. Auf der anderen Seite haben die Kosten zugenommen Während die Vorleistungen (+1%), die Abschreibungen (+3%) sowie die Pachten und Zinsen (+6%) zugenommen haben, waren die Entschädigung der fremden Arbeit (–2%) und die Produktionssteuern (–52%) tiefer Höher sind auch die öffentlichen Transfers an die Landwirtschaft (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen) (+7%)
Beim Sektoreinkommen zeigen sich ausgeprägt die Schwankungen der landwirtschaftlichen Einkommen in den letzten Jahren. Einem starken Rückgang 1999 gegenüber 1998 folgte ein Anstieg im Jahr 2000 Im Jahr 2001 fielen die Einkommen fast wieder auf den Stand von 1999 zurück Die Schätzungen für das Jahr 2002 deuten auf ein Sektoreinkommen hin, welches wiederum den Wert des guten Landwirtschaftsjahres 2000 erreichen dürfte
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz Angaben zu laufenden Preisen, in Mio Fr
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 47 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1990/92 1998 1999 2000 1 2001 2 2002 3 Endproduktion 9 902 7 894 7 240 7 627 7 275 7 344 + Beiträge der öffentlichen Hand (Subventionen) 1 317 2 439 2 427 2 458 2 604 2 700 – Vorleistungen 4 173 3 855 3 780 3 911 3 900 3 868 – Produktionssteuern, Kompensation Mwst 123 273 219 170 167 137 Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 6 923 6 204 5 668 6 005 5 812 6 039 – Abschreibungen 2 031 1 853 1 837 1 858 1 899 1 883 – Pachten und Zinsen 845 700 696 738 753 736 – Entlöhnung der familienfremden Arbeitskräfte 827 764 728 716 720 740 Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte 3 221 2 888 2 408 2 692 2 440 2 680 1 provisorisch Stand Winter 2001/2002 2 Schätzung, Stand Winter 2001/2002 3 Schätzung Stand Sommer 2002 Quelle: SBV
Beurteilung
Sektor-Einkommen
Begriffe und Methoden Seite A72 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ Zwei Indikatorensysteme für die
der wirtschaftlichen Lage ■
2001
Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung

Beiträge der öffentlichen Hand (Subventionen)
Endproduktion
Ausgaben (Vorleistungen, Produktionssteuern, Unterkompensation
Mwst, Abschreibungen, Pacht-, Zins- und Angestelltenkosten)
Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte
48 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
199920001 20012 20023
1990/921998
A n g a b e n z u l a u f e n d e n P r e i s e n i n M i o . F r .
Quelle: SBV 1 p
isoris
2 Schätzung, Stand Winter 2001/2002 3 Schätzung, Stand Sommer 2002 0 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
rov
ch, Stand Winter 2001/2002
Tabellen 14–15, Seiten A14–A15
■ Schätzung des Sektor-
Die Schätzung 2002 (Stand August) stützt sich auf das zurzeit noch provisorische Berechnungsjahr 2000 und nicht auf die Schätzung 2001 Auf diese Weise werden allfällige Ungenauigkeiten der Schätzung 2001 nicht auf das laufende Jahr übertragen
Die Endproduktion 2002 liegt gemäss der Schätzung mit 7,34 Mia Fr um 0,5% tiefer als das Dreijahresmittel 1999/2001 Im Vergleich zur Schätzung 2001 entspricht dies einer Zunahme von 0,9% Diese Zunahme ist durch die besseren Erträge im Pflanzenbau bedingt Die Endproduktion im tierischen Bereich dürfte dagegen im Jahr 2002 leicht tiefer ausfallen als im Vorjahr
Die pflanzliche Endproduktion wird gegenüber dem Mittel der drei Vorjahre um 1,2% tiefer, im Vergleich zum Vorjahr aber um 4,3% höher geschätzt. Bei allen Kulturen kann von besseren Erträgen als letztes Jahr ausgegangen werden
Die Einnahmen aus dem Verkauf von Getreide dürften nur knapp höher sein als 2001. Die abgelieferten Mengen werden zwar erheblich über dem Vorjahr liegen Aufgrund der schlechten Witterung Anfang August ist aber sowohl bei Weizen als auch bei Roggen mit viel Auswuchs zu rechnen
Bei den Kartoffeln wird die Situation gleich eingeschätzt wie im Vorjahr. Sowohl die Erntemenge als auch die Preise bewegen sich auf dem Niveau von 2001 Beim Gemüse wird mit einem guten Jahr gerechnet Die Preise blieben Anfang dieses Jahres lange hoch. Dies war vor allem auf die Angebotsknappheit in Frankreich, Spanien und Italien zurückzuführen Davon konnte auch das Schweizer Gemüse profitieren Beim Obst wird eine gute Ernte erwartet Der Produktionswert dürfte um 12% höher sein als 2001
Die ersten Rübenuntersuchungen lassen eine mengenmässig und auch in Bezug auf den Zuckergehalt gute Ernte erwarten. Der Produktionswert wird sich in der Grössenordnung von 2000 bewegen und deutlich höher sein als im Vorjahr Der Wert der Ölsaaten wird dank einer Ausdehnung der Flächen bei Raps, Soja und Sonnenblumen deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt (+41%). Wie letztes Jahr wird mit einer qualitativ guten Tabakernte gerechnet
Die Wetterbedingungen waren für den Rebbau bis Ende August recht gut, so dass eine ähnliche Traubenernte wie im Vorjahr erwartet werden kann Aufgrund der Probleme am Markt werden jedoch tiefere Preise als im Vorjahr geschätzt Wie in den letzten zwei Jahren kann auch von einer quantitativ und qualitativ guten Raufutterernte ausgegangen werden
Die Endproduktion im tierischen Bereich weist im Mehrjahresvergleich eine Abnahme von 0,2% und im Vergleich zum Vorjahr von 0,4% aus Die Endproduktion des Betriebszweiges Rindvieh (ohne Milch) wird um 1% höher als im Vorjahr und 4% tiefer als das Dreijahresmittel geschätzt Die Munipreise erholten sich im Vergleich zum Vorjahr etwas Die Preise der Schlachtkühe bleiben aber weiterhin unter Druck Aufgrund der zur Zeit stark angespannten Lage am Milchmarkt wird noch ein Anstieg der Schlachtungen bei den Kühen erwartet
49 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
Tabellen 14–15, Seiten A14–A15
Einkommens 2002
Bei den Schweinen wird mit einer um 2% tieferen Endproduktion als 2001 gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr vermögen die höheren Schlachtungen die tieferen Preise nicht aufzufangen
Bei der Milch dürfte sich die angespannte Lage noch wenig auswirken auf das Ergebnis 2002 Die Endproduktion wird leicht tiefer geschätzt als 2001 Sie wird damit praktisch auf dem Niveau des Durchschnitts der drei Vorjahre sein
Beim Geflügel wird erwartet, dass die höhere Produktion die tieferen Preise mehr als auszugleichen vermag (Endproduktion +2,1% gegenüber 2001) Im Mehrjahresmittel wird gar mit einer Zunahme von 4,9% gerechnet Bei den Eiern wird von höheren Preisen und einer höheren Produktion als in den Vorjahren ausgegangen. Die Endproduktion dürfte deshalb bedeutend höher sein als im Vorjahr (+11,4%) Die Honigernte wird weniger hoch als im Vorjahr geschätzt
Die Ausgaben für Vorleistungen werden auf 3,87 Mia Fr veranschlagt Im Mehrjahresvergleich bedeutet dies eine leichte Zunahme von 0,1%, gegenüber dem Vorjahr hingegen eine Reduktion von 0,8% Gegenüber dem Vorjahr werden vor allem die Ausgaben für Saat- und Pflanzgut, für Futtermittel sowie für Material und den Unterhalt von Maschinen abnehmen. Eine Erhöhung erfahren dagegen insbesondere die Ausgaben für Dünger und Dienstleistungen
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen wird für das Jahr 2002 um 3% höher geschätzt als 2001 Gegenüber dem Dreijahresmittel ist sie hingegen um 1,2% tiefer
Die öffentlichen Transfers für den Bereich Landwirtschaft dürften im Jahr 2002 um 3,7% höher als im Vorjahr und 8,2% höher als im Dreijahresmittel ausfallen Die Produktionssteuern dürften dagegen stark zurückgehen (–57,7% gegenüber 1999/2001) Diese starke Abnahme ist auf den ganz wegfallenden Verwertungskostenbeitrag bei Getreide im Jahr 2002 zurückzuführen 2002 ist mit einer kleineren Unterkompensation der Mehrwertsteuer im Vergleich zu 2001 zu rechnen. Dies hängt mit dem Anstieg des Produktionswertes zusammen
Die Abschreibungen, die in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zu Wiederbeschaffungspreisen bewertet werden, liegen über den Werten der Vorjahre, aber leicht tiefer als im Vorjahr (–0,8%) Diese Abnahme lässt sich vor allem durch die sinkenden Baukosten erklären
Die Abnahme der Ausgaben für Pachten und Zinsen im Vergleich zu 2001 (–2,3%) ist durch die Senkung der Zinssätze bedingt Gegenüber dem Dreijahresmittel sind die Werte für 2002 um 1% höher
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 50
Die Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit (= Angestelltenkosten) werden 2002 um 2,8% höher geschätzt als 2001 und um 2,6% höher als im Dreijahresmittel 1999/2001 Die leichte Zunahme ist auf die gestiegenen Löhne für Angestellte zurückzuführen.
Als Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte verbleiben 2,68 Mia Fr Dies ist eine Erhöhung um 9,8% gegenüber 2001 und 6,6% gegenüber dem Mittel der drei vorangegangenen Jahre

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 51
■ Einkommen 2001 tiefer als 1998/2000
1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der FAT Deren methodische Grundlagen wurden 1999 vollständig überarbeitet Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren wie z B zur finanziellen Stabilität oder zur Rentabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe Im Anhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen Zudem wird eine Arbeit des Instituts für Agrarwirtschaft der ETH Zürich zum Thema Performance der Schweizer Landwirtschaft präsentiert
Entwicklung
Das Jahr 2001 war im mehrjährigen Vergleich ein mittelmässiges Wirtschaftsjahr Gegenüber 1998/2000 hat der Rohertrag leicht zugenommen (+2,5%) Im Pflanzenbau sind tiefere Werte zu verzeichnen Vom Rückgang betroffen sind insbesondere Getreide, Zuckerrüben, Raps, Rebbau, Obst sowie die Erträge aus dem Wald, die nach den sturmbedingten ausserordentlichen Holzverkäufen im Jahr 2000 markant tiefer ausfielen Der Rohertrag der Tierhaltung liegt hingegen leicht über dem Niveau der Vorjahre. Dazu beigetragen haben höhere Erträge bei der Rindviehhaltung, der Schweinemast und den Eiern Die höheren Erträge bei der Rindviehhaltung sind das Resultat einer Ausdehnung der Milchmenge je Betrieb Sie vermochten die tieferen Preise für Nutz- und Schlachtvieh mehr als aufzufangen. Die Direktzahlungen waren gegenüber dem Durchschnitt der drei Vorjahre um 12% höher Die Zunahme ergibt sich vor allem aus der Einführung eines neuen Flächenbeitrags für die offene Ackerfläche und Dauerkulturen, höheren Beiträgen für den Bio-Landbau sowie einer Zunahme der Direktzahlungen für die Programme BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltung) und RAUS (freie Auslaufhaltung). Die Fremdkosten stiegen gegenüber dem gleichen Zeitraum um 7% Zurückzuführen ist die Zunahme vor allem auf steigende Kosten in der Tierhaltung und gestiegene Gebäudekosten Bei der Tierhaltung fallen insbesondere die Mengenausdehnung in der Milchproduktion und die damit verbundenen
52 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Begriffe und Methoden, Seite A73
Tabellen 16–25, Seiten A16–A26
1990/921998 199920002001 F r p r o B e t r i e b Nebeneinkommen Landwirtschaftliches Einkommen Quelle: Zentrale Auswertung, FAT 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 18 254 18 638 62 822 53 079 53 789 1,39 FJAE Familien-Jahresarbeitseinheiten 1,311,29 19 208 64 675 1,30 18 633 52 434 1,29
der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe: Mittel
alle Regionen
höheren Futterkosten und Kosten für gemietetes oder gekauftes Milchkontingent ins Gewicht Leicht abgenommen haben die Personalkosten (–3%)
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten Im Jahr 2001 lag es auf dem Niveau der Jahre 1998 und 1999 Im Vergleich zu 1998/2000 hat es um 8% abgenommen Das Nebeneinkommen ist hingegen konstant geblieben Insgesamt resultierte eine Abnahme des Gesamteinkommens um 6%
Die Abnahme des landwirtschaftlichen Einkommens gegenüber 1998/2000 lag in der Talregion bei 8% und in der Hügelregion bei 9% Die geringere Abnahme in der Bergregion (–7%) kann mit der kleineren Bedeutung des Pflanzenbaus in dieser Region erklärt werden.
In der Talregion hat auch das Nebeneinkommen abgenommen (–3%), währenddem es in der Hügel- und Bergregion leicht zugenommen hat (um 1 respektive 3%). Das Gesamteinkommen lag damit in der Talregion um 7%, in der Hügelregion um 6% und in der Bergregion um 4% unter dem Durchschnitt der Jahre 1998/2000
53 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
Tabellen 16–19 Seiten A16–A19
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Regionen Einkommen nach Region Einheit 1990/92 1998 1999 2000 2001 1998/2000–2001 % Talregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16,66 18,90 19,33 19,41 19,93 3,7 Familienarbeitskräfte FJAE 1,36 1,27 1,26 1,26 1,26 0 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 73 794 64 885 61 968 77 738 62 453 -8,4 Nebeneinkommen Fr 16 429 17 507 17 580 17 805 17 043 -3,3 Gesamteinkommen Fr 90 223 82 392 79 548 95 543 79 496 -7,4 Hügelregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15,30 17,07 17,19 17,83 17,95 3,4 Familienarbeitskräfte FJAE 1,40 1,29 1,28 1,29 1,26 -2,3 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 59 838 47 420 49 885 58 725 47 496 -8,7 Nebeneinkommen Fr 14 544 19 283 19 849 21 814 20 557 1,2 Gesamteinkommen Fr 74 382 66 703 69 734 80 539 68 053 -5,9 Bergregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15,76 17,67 18,06 18,63 18,85 4,0 Familienarbeitskräfte FJAE 1,42 1,38 1,37 1,39 1,38 0 Landwirtschaftliches Einkommen Fr. 45 541 38 101 43 392 47 721 40 135 -6,8 Nebeneinkommen Fr 17 853 18 505 19 250 19 011 19 414 2,6 Gesamteinkommen Fr 63 394 56 606 62 642 66 732 59 549 -3,9 Quelle: Zentrale Auswertung FAT
Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2001 16% in der Talregion, 23% in der Hügelregion und 38% in der Bergregion Damit liegt der Anteil in allen drei Regionen etwas höher als 1998/2000, was vor allem auf die gestiegene Direktzahlungssumme im Jahr 2001 zurückzuführen ist.
Die Einkommenssituation in den 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) zeigt erhebliche Differenzen auf
Im Durchschnitt der Jahre 1999/2001 erzielten die Ackerbau-, Spezialkultur- und bestimmte kombinierte Betriebe (Verkehrsmilch/Ackerbau, Kombiniert Veredlung) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen Zusammen mit den kombinierten Mutterkuhbetrieben erwirtschafteten diese auch die höchsten Gesamteinkommen Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen «Pferde, Schafe, Ziegen» sowie «anderes Rindvieh»
54 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 1999/2001 Betriebstyp Landw Familien- Landw Neben- GesamtNutzfläche arbeits- Einkommen einkommen einkommen kräfte ha FJAE Fr Fr Fr Mittel alle Betriebe 18,76 1,29 56 966 18 826 75 792 Ackerbau 23,03 1,06 63 747 23 260 87 007 Spezialkulturen 12,68 1,36 73 678 16 360 90 038 Verkehrsmilch 18,29 1,35 50 818 18 092 68 910 Mutterkühe 17,36 1,09 42 664 32 510 75 174 Anderes Rindvieh 15,47 1,28 35 375 21 567 56 942 Pferde/Schafe/Ziegen 13,72 1,21 25 437 26 154 51 591 Veredlung 11,27 1,13 60 816 17 665 78 481 Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau 24,52 1,33 70 131 14 112 84 243 Kombiniert Mutterkühe 22,73 1,20 61 943 22 493 84 436 Kombiniert Veredlung 19,00 1,29 72 064 16 601 88 665 Kombiniert Andere 19,84 1,28 57 769 20 062 77 831 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Tabellen 20a–20b, Seiten A20–A21
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte Gegenüber dem Dreijahresmittel 1998/2000 hat sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) im Jahr 2001 um 13% verschlechtert

Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich Im Durchschnitt liegt er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion Auch die Quartile liegen weit auseinander So erreichte 1999/2001 der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 23% und derjenige im vierten Quartil 196% des Mittelwertes aller Betriebe der Region In den anderen Regionen sind die Streuungsbandbreiten ähnlich.
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 1999/2001: nach Regionen und Quartilen
Arbeitsverdienst 1 in Fr pro FJAE 2
1 Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen: 1999: 3,02%; 2000: 3,95%; 2001: 3,36%
2 Familien-Jahresarbeitseinheiten: Basis 280 Arbeitstage Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
55 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Median Mittelwerte Region 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Talregion 38 449 9 664 31 239 46 667 81 585 Hügelregion 29 739 6 090 23 572 36 215 61 490 Bergregion 21 442 4 135 17 318 26 465 46 745
Tabellen 21–24 Seiten A22–A25
■ Arbeitsverdienst hat abgenommen
In der Tal- und Hügelregion übertraf bzw. erreichte 1999/2001 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung In der Bergregion lag der mittlere Arbeitsverdienst im vierten Quartil rund 7'000 Fr unter dem Vergleichswert. Im Vergleich zur Periode 1998/2000 hat sich der Abstand in der Talregion etwas vergrössert, während er in der Hügel- und Bergregion konstant geblieben ist
Vergleichslohn 1999/2001, nach Regionen

1 Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten
Quellen: BFS, FAT
Zieht man das Nebeneinkommen mit in die Beurteilung ein, sieht die Situation der landwirtschaftlichen Haushalte deutlich besser aus, als der alleinige Vergleich von Arbeitsverdienst mit Vergleichslohn erscheinen lässt Die durchschnittlichen Nebeneinkommen lagen 1999/2001 bei rund 19'000 Fr
56 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Region Vergleichslohn 1 Fr pro Jahr Talregion 64 132 Hügelregion 58 373 Bergregion 54 000
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens Kombiniert man diese Kennzahl mit der Grösse der Eigenkapitalbildung, lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen. Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält –finanziell nicht existenzfähig
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit ... Fremdkapitalquote
Tief (<50%) Hoch (>50%)
Positiv guter beschränkter finanEigenkapitalbildung finanzieller Situation zieller Selbständigkeit
Negativ ungenügendem bedenklicher
Einkommen finanzieller Situation
Quelle: De Rosa
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild. Knapp die Hälfte der Betriebe befindet sich in einer finanziell guten Situation und rund 30% sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung) Im Vergleich zu 1998/2000 hat sich die Situation in keiner der drei Regionen wesentlich verändert
Beurteilung der finanziellen Stabilität 1999/2001: nach Regionen
bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle Situation
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
57 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
A n t e i l B e t r i e b e i n %
Talregion Hügelregion Bergregion
0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 15 19 19 47 15 13 26 46 14 18 21 47
■ Finanzielle Stabilität
■ Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
Die Investitionen der FAT-Referenzbetriebe haben im Jahr 2001 im Vergleich zu 1998/2000 zugenommen (+4%) Da im Gegenzug der Cashflow abgenommen hat (–8%), liegt das Cashflow-Investitionsverhältnis um 13% tiefer Die Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen
Privatverbrauch) ist wesentlich tiefer als in der Referenzperiode (–50%) Die Fremdkapitalquote hat sich hingegen nicht verändert
Entwicklung von Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremkapitalquote
1 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2 Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT

58 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
–
Merkmal 1990/92 1998 1999 2000 2001 1998/2000–2001 % Eigenkapitalbildung Fr 19 513 9 330 13 207 21 233 7 288 -50 Investitionen 1 Fr 46 914 49 585 41 856 44 965 47 469 4 Cashflow-Investitionsverhältnis 2 % 95 81 101 102 83 -13 Fremdkapitalquote % 43 41 41 41 41 0
■ Methodik
Performance von Schweizer Landwirtschaftsbetrieben
Das Institut für Agrarwirtschaft (IAW) der ETH Zürich hat im Auftrag des BLW ein «Monitoring Tool Performance Schweizer Landwirtschaftsbetriebe (MPSL)» entwickelt. Es handelt sich um ein Instrument, mit dem die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe hinsichtlich ihrer Performance unter gegebenen Rahmenbedingungen und hinsichtlich des Wettbewerbsdrucks unter EU-Rahmenbedingungen klassifiziert werden können
Für das MPSL wurden zwei Indikatoren entwickelt Der eine misst die betriebswirtschaftliche Performance der Betriebe unter gegebenen Rahmenbedingungen und der andere den Wettbewerbsdruck, der in einem EU-Preisszenario auf die Betriebe zukommen würde Unter EU-Preisszenario wird das Szenario der Schweiz als Mitglied einer Freihandelszone mit der EU verstanden Zur Klassifizierung werden die Betriebe in neunzehn Betriebsgruppen eingeteilt und in einer Vierfelder-Portfoliomatrix hinsichtlich der beiden Indikatoren positioniert Die Abgrenzung der vier Felder in der Portfoliomatrix erfolgt über die Durchschnittswerte von Performance und Wettbewerbsdruck aller untersuchten Betriebe So sind beispielsweise in einem Feld (oben rechts) diejenigen Betriebe mit überdurchschnittlicher Performance vorzufinden, die unter einem EU-Preisszenario einem unterdurchschnittlichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt wären Es handelt sich somit um eine relative Klassifizierung
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 59
Portfoliodarstellung W e t t b e w e r b s d r u c k i m E UP r e i s s z e n a r i o u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h überdurchschnittlich unterdurchschnittlich -1,7 0,7 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 -1,7 0,7 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 -3,7 -2,7 -1,7 -0,7 0,3 1,3 2,33,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 -3,7 -2,7 -1,7 -0,7 0,3 1,3 2,33,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 Performance ohne EU-Preisszenario (%)
Der Performance-Indikator basiert auf der Cashflow-Gesamtkapitalrendite. Er gibt unabhängig von der Finanzierungsart (Eigen- oder Fremdkapital) darüber Auskunft, wieviel flüssige Mittel mit dem auf dem Betrieb eingesetzten Gesamtkapital nach Entschädigung der Fremdarbeit und nach einer theoretischen Entschädigung der Familienarbeit erwirtschaftet werden (in Prozent ausgedrückt) Je nach Situation kann der Betrieb den Mittelfluss für Ersatz- und Neuinvestitionen, zur Schuldentilgung, zur Schuldzinszahlung verwenden oder als Entschädigung des Eigenkapitals betrachten
Für die theoretische Entschädigung der Familienarbeit wird der Vergleichslohn eingesetzt, der bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Einzelbetriebe verwendet wird (vgl Begriffe und Methoden im Anhang)
Für das Jahr 2000 hatten folgende Vergleichslöhne Gültigkeit:
– Talregion: 63'679 Fr. / Familienarbeitskraft
– Hügelregion: 57'485 Fr / Familienarbeitskraft
– Bergregion: 53'779 Fr / Familienarbeitskraft
Die Lage der Betriebe hinsichtlich des Wettbewerbsdrucks im EU-Umfeld wird mit Hilfe des Indikators «Wettbewerbsdruck» erhoben. Dieser Indikator leitet sich vom Performance-Indikator ab Er sagt aus, wie stark die Performance unter einem EU-Preisszenario zurückgehen würde Zur Bestimmung dieses Performancerückgangs wird ein Preisvergleich für landwirtschaftliche Vorleistungen und Erzeugnisse zwischen der Schweiz und der EU durchgeführt Es handelt sich dabei um eine komparativ statische Betrachtung Deshalb werden weder Faktorsubstitutionen noch Substitutionen in der Produktion und auch keine Strukturveränderungen berücksichtigt Das heisst, dass ein Betrieb im EU-Preisszenario mit derselben Quantität an Produktionsfaktoren dieselbe Quantität an landwirtschaftlichen Erzeugnissen produzieren würde wie unter gegebenen Rahmenbedingungen Zudem wird angenommen, dass in der Schweiz im EU-Preisszenario das Lohn- und Zinsniveau und die Höhe und Zusammensetzung der Direktzahlungen gleich bleiben würden.
Datengrundlage für das MPSL sind die Buchhaltungsdaten von 1'820 FAT-Referenzbetrieben Zur Bestimmung der Performance im EU-Preisszenario werden die Preise der Schweiz und der EU für Vorleistungen (z B Saatgut, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Mischfutter etc ) und für landwirtschaftliche Erzeugnisse (z B Milch, Getreide, Fleisch) miteinander verglichen Die Preise für die EU wurden mit Hilfe des SBV in BadenWürttemberg erhoben
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 60
Begriffe und Methoden, Seite A76
■ Grundlagen für das Monitoring
Für das Jahr 2000 wurden die Buchhaltungsdaten von 1'820 Betrieben (Untersuchungseinheit) hinsichtlich Performance und Wettbewerbsdruck ausgewertet Mit der Untersuchungseinheit werden 7,3% der Betriebe der Grundgesamtheit abgebildet Untersuchungseinheit und Grundgesamtheit 2000
Der grösste Preisunterschied besteht beim Brotgetreide Hier liegt der Preis der Schweiz bei 66 6 Fr /dt und in der EU bei 19 Fr /dt Bei der Milch ist die Preisdifferenz deutlich geringer Der EU-Preis beträgt 64% des Schweizer Preises Bei den Vorleistungen sind die Preisunterschiede vor allem beim Kraftfutter markant
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 61
Betriebsgruppe Grund- Untersuchungs- UE/GG gesamtheit (GG) einheit (UE) Anzahl Anzahl in % Mutterkühe alle Regionen, 10-50 ha 1 107 58 5,2 Rindviehmast alle Regionen, 10-50 ha 369 32 8,7 Schweine alle Regionen, 10-50 ha 356 30 8,4 Geflügel alle Regionen, 10-50 ha 129 14 10,9 Verkehrsmilch Tal, 10-20 ha 2 075 153 7,4 Verkehrsmilch Tal, 20-30 ha 769 58 7,5 Verkehrsmilch Tal; 30-50 ha 235 15 6,4 Verkehrsmilch Hügel, 10-20 ha 3 756 291 7,7 Verkehrsmilch Hügel, 20-30 ha 1 443 134 9,3 Verkehrsmilch Hügel, 30-50 ha 561 36 6,4 Verkehrsmilch Berg, 10-20 ha 3 575 263 7,4 Verkehrsmilch Berg, 20-30 ha 1 808 167 9,2 Verkehrsmilch Berg, 30-50 ha 1 005 83 8,3 Ackerbau Tal, 10-20 ha 1 418 41 2,9 Ackerbau Tal, 20-30 ha 816 44 5,4 Ackerbau Tal, 30-50 ha 560 24 4,3 komb Verkehrsmilch Ackerbau Tal, 10-20 ha 2 085 169 8,1 komb Verkehrsmilch Ackerbau Tal, 20-30 ha 1 768 157 8,9 komb Verkehrsmilch Ackerbau Tal; 30-50 ha 998 51 5,1 24 554 1 820 7,3 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Preisvergleich Schweiz – EU 2000
Bezüglich der Performance schneiden im Jahr 2000 die Rindviehmast-, Schweine- und Geflügelbetriebe, die Verkehrsmilchbetriebe der Talregion mit 30–50 ha, die Ackerbaubetriebe mit 20–50 ha sowie die Betriebe der Gruppe kombiniert/Verkehrsmilch Ackerbau mit 30–50 ha am besten ab Durchschnittlich haben diese Betriebe eine Performance im Bereich von 6–8%. Am schlechtesten schneiden die Verkehrsmilchbetriebe der Hügelregion mit 10–20 ha und die Verkehrsmilchbetriebe der Bergregion mit 10–20 ha ab Durchschnittlich liegt die Performance dieser Betriebe zwischen –2% und +1% Beim EU-Preisszenario weisen nur noch gerade sechs Betriebsgruppen eine positive Performance auf Am besten schneiden die Schweinebetriebe und die Verkehrsmilchbetriebe mit 30–50 ha ab. Die Performance dieser Betriebe liegt zwischen 1 und 2%

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 62
Roherträge Referenzeinheit Referenzpreise BW-Preis –CH BW 1 CH-Preis Fr Fr % Brotgetreide dt 66 60 19 04 29 Futtergetreide dt 44 49 20 10 45 Körnermais dt 48 70 17 87 37 Kartoffeln dt 43 00 16 70 39 Zuckerrüben dt 10 60 6 97 66 Raps dt 62 80 28 94 46 Soja dt 51 81 30 66 59 Sonnenblumen dt 66 40 29 68 45 Eiweisserbsen dt 51 81 19 43 38 Ackerbohnen dt 45.94 18.26 40 Milch, Milchprodukte dt 76 50 49 00 64 Grosses Mastvieh Stück 2 058 00 1 061 36 52 Mastkälber dt SG 1 261 00 702 00 56 Magerkälber % 100 00 95 00 95 Verkauf Nutzvieh % 100 00 65 00 65 Kauf Nutzvieh % 100 00 65 00 65 Schweinemast dt SG 465 30 196 70 42 Schweinezucht % 100.00 47.50 48 Eier 100 St 29 10 10 40 36 Geflügelhaltung (ohne Eier) dt LG 269 30 112 00 42 Fremdkosten Dünger dt 120 80 72 88 60 Saat- und Pflanzgut % 100 00 60 00 60 Pflanzenschutz % 100 00 65 00 65 Kraftfutter Rindvieh dt 98 30 30 90 31 Kraftfutter Schweine dt 88.40 33.40 38 Kraftfutter verschiedene Tiere dt 96 60 32 80 34 Übriges Futter dt 31 04 9 60 31 Stroh und Streue (zugekauft) dt 13 50 7 50 56
1 Baden-Württemberg
■ Ergebnisse 2000
Vergleich der Performance mit und ohne EU-Preisszenario 2000
Mutterkühe; alle Regionen; 10-50 ha
Rindviehmast; alle Regionen; 10-50 ha
Schweine; alle Regionen; 10-50 ha
Geflügel; alle Regionen; 10-50 ha
Verkehrsmilch; Tal; 10-20 ha
Verkehrsmilch; Tal; 20-30 ha
Verkehrsmilch; Tal; 30-50 ha
Verkehrsmilch; Hügel; 10-20 ha
Verkehrsmilch; Hügel; 20-30 ha
Verkehrsmilch; Hügel; 30-50 ha
Verkehrsmilch; Berg; 10-20 ha
Verkehrsmilch; Berg; 20-30 ha
Verkehrsmilch; Berg; 30-50 ha
Ackerbau; Tal; 10-20 ha Ackerbau; Tal; 20-30 ha Ackerbau; Tal; 30-50 ha
komb. Verkehrsmilch Ackerbau; Tal; 10-20 ha
komb. Verkehrsmilch Ackerbau; Tal; 20-30 ha
komb. Verkehrsmilch Ackerbau; Tal; 30-50 ha
Bei der Klassifizierung der Betriebe im Portfolio sind in der «besten» Klasse (überdurchschnittliche Performance und unterdurchschnittlicher Wettbewerbsdruck) die Betriebsgruppen «Verkehrsmilch Hügel, 30–50 ha», «Verkehrsmilch Berg, 30–50 ha», «Mutterkühe alle Regionen, 10–50 ha», «Verkehrsmilch Hügel, 20–30 ha» und «Verkehrsmilch Tal, 10–20 ha» In der «schlechtesten» Klasse (unterdurchschnittliche Performance und überdurchschnittlicher Wettbewerbsdruck) ist einzig die Betriebsgruppe «kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau, 10–20 ha, Tal» vertreten.
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 63
Performance Performance im EU-Preisszenario -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 in %
Klassifizierung der Betriebe im Portfolio 2000
Betriebsgruppe
Mutterkühe; alle Regionen; 10-50 ha
Rindviehmast; alle Regionen; 10-50 ha
Schweine; alle Regionen; 10-50 ha
Geflügel; alle Regionen; 10-50 ha
Verkehrsmilch; Tal; 10-20 ha
Verkehrsmilch; Tal; 20-30 ha
Verkehrsmilch; Tal; 30-50 ha
Verkehrsmilch; Hügel; 10-20 ha
Verkehrsmilch; Hügel; 20-30 ha
Verkehrsmilch; Hügel; 30-50 ha
Verkehrsmilch; Berg; 10-20 ha
Verkehrsmilch; Berg; 20-30 ha
Verkehrsmilch; Berg; 30-50 ha
Ackerbau; Tal; 10-20 ha
Ackerbau; Tal; 20-30 ha
Ackerbau; Tal; 30-50 ha
komb Verkehrsmilch Ackerbau; Tal; 10-20 ha
komb Verkehrsmilch Ackerbau; Tal; 20-30 ha
komb Verkehrsmilch Ackerbau; Tal; 30-50 ha
f
ä
repräsentiert die Anzahl der Betriebe dieser Betriebsgruppe in der Schweiz Betriebsgruppe mit positiver Performance im EU-Preisszenario Betriebsgruppe mit negativer Performance im EU-Preisszenario
■ Schlussfolgerungen
Bezüglich der Performance gibt es Anhaltspunkte dafür, dass grosse Betriebe (bezüglich LN) und Betriebe mit tiefer Arbeitsintensität (Arbeitskräfte/pro ha LN) bessere Resultate erzielen als kleine Betriebe und Betriebe mit hoher Arbeitsintensität So ist die Arbeitsintensität bei den Verkehrsmilchbetrieben der Flächenklasse 10–20 ha fast doppelt so hoch wie bei denjenigen mit 30–50 ha. Betriebe mit einer hohen Performance unter bestehenden Rahmenbedingungen sind im EU-Preisszenario meist einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt (z B «Ackerbau Tal, 30–50 ha») Der Preisunterschied zwischen der Schweiz und der EU für landwirtschaftliche Erzeugnisse (z B Preisunterschied bei Brotgetreide) ist bei diesen Betrieben z T bis mehr als doppelt so hoch als bei den anderen Betrieben (z B Preisunterschied bei Verkehrsmilch) Deshalb sind diese Betriebe im EU-Preisszenario einem um so höheren Anpassungsdruck ausgesetzt Dazu kommt, dass diese Betriebe bezogen auf ihre LN vergleichsweise mit tiefen Direktzahlungen (Total DZ/LN) auskommen müssen. Betriebe mit hohen Direktzahlungen könnten hingegen die Auswirkungen des EUPreisszenarios besser «abfedern» und wären deshalb einem tieferen Wettbewerbsdruck ausgesetzt (z.B. «Mutterkühe alle Regionen, 10–50 ha»).
Grundsätzlich gibt es zwei Strategien bzw eine Kombination der beiden zur Verbesserung der Lage eines Betriebes Die eine ist eine Steigerung des Umsatzes bei gleich bleibender Ausrüstung (Gesamtkapital) Die andere ist eine Erhöhung der Wertschöpfung.
Die Resultate des Jahres 2000 sind eine Momentaufnahme Mit dem MPSL können die Berechnungen periodisch aktualisiert werden und Entwicklungen aufgezeigt werden.
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 64
W e t t b e w e r b s d r u c k i m E UP r e i s s z e n a r i o u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h Ø ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h überdurchschnittlich unterdurchschnittlich Ø Ø -1,7 0,7 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 -1,7 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0,7 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 -3,7 -2,7 -1,7 -0,7 0,3 1,3 2,33,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 -3,7 -2,7 -1,7 -0,7 0,3 1,3 2,33,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 Performance ohne EU-Preisszenario (%) 11 12 1 8 13 9 5 6 10 7 3 14 17 18 19 15 16 4 2 Durchschnitt
Kreis
aller untersuchten Betriebe
l
che
1.2 Soziales und Gesellschaft
Das Soziale ist eine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. In der Berichterstattung über die agrarpolitischen Auswirkungen nehmen die sozialen Aspekte deshalb einen eigenen Platz ein Die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft gliedert sich gemäss dem Konzept, das im Agrarbericht 2001 präsentiert wurde in die drei Bereiche: Einkommen und Verbrauch; periodische Bestandesaufnahme bei fünf zentralen sozialen Themen; Fallstudien zu sozialen Themen Für die Landwirtschaft wichtig sind auch gesellschaftliche Aspekte So ist es für die Sicherung der Direktzahlungen wichtig, wie die übrige Bevölkerung die Leistungen der Landwirtschaft einschätzt Das Konsumverhalten auf der anderen Seite spielt eine wesentliche Rolle, wenn es um das Halten der Marktanteile geht
Im Agrarbericht 2002 werden im sozialen Bereich die Einkommen und der Verbrauch in der Landwirtschaft auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT, die Bestandesaufnahme im Bereich Arbeit und Ausbildung sowie eine Studie zum Thema «Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft» dargestellt Im Bereich Gesellschaft werden Ergebnisse von Befragungen über die Meinungen der Bevölkerung zur Landwirtschaft und zum Konsumverhalten präsentiert.
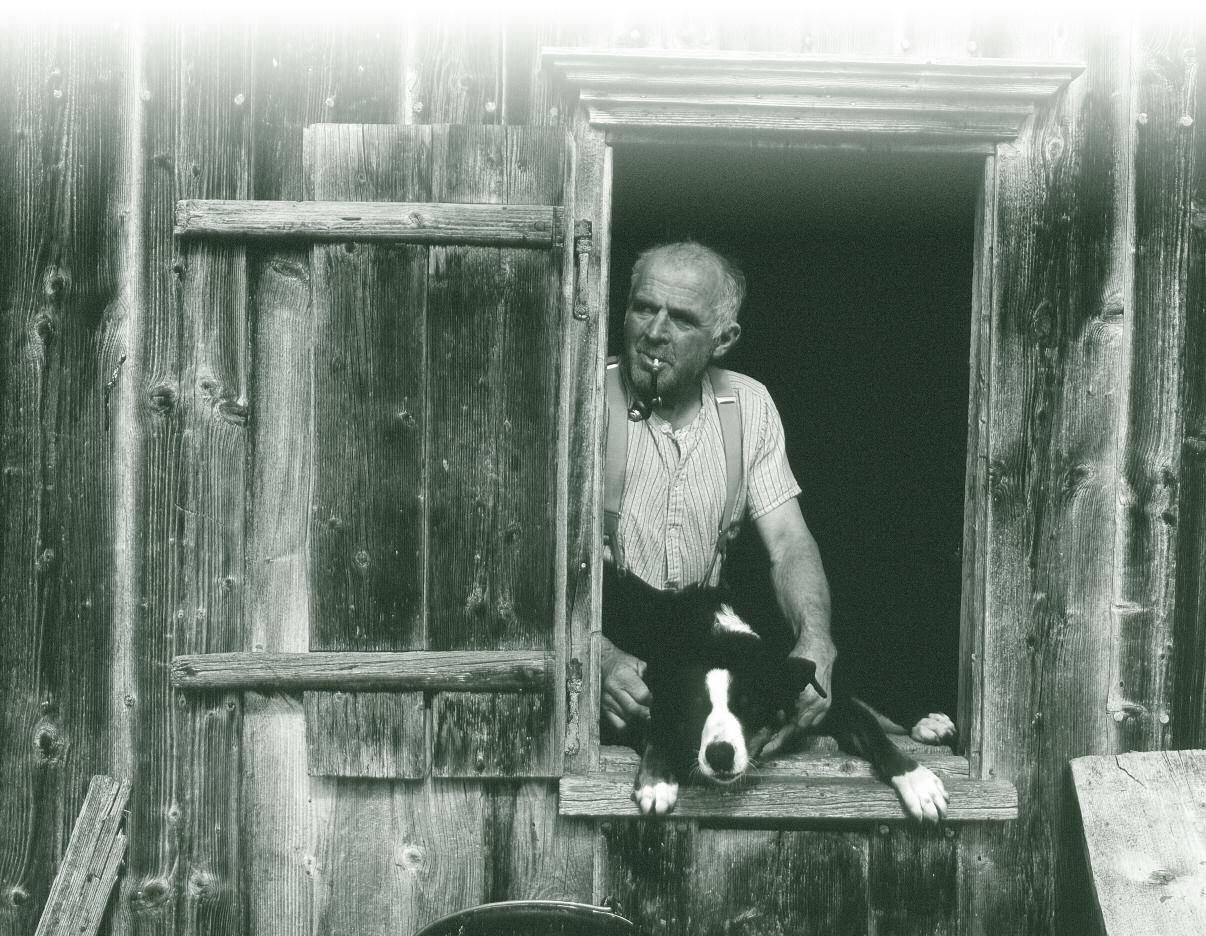
■■■■■■■■■■■■■■■■
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 65
■ Gesamteinkommen
1.2.1 Soziales
Einkommen und Verbrauch
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Landwirtschaft sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe Bei der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit steht die Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte im Vordergrund Damit wird das Nebeneinkommen der Haushalte ebenfalls mit in die Analyse einbezogen Neben dem Gesamteinkommen wird auch die Entwicklung des Privatverbrauchs verfolgt. Ein besonderes Augenmerk wird bei der Analyse von Einkommen und Verbrauch auf die Haushalte gelegt, die sich gemäss ihrem Arbeitsverdienst in der unteren Hälfte befinden.
Das Gesamteinkommen, das sich aus dem landwirtschaftlichen Einkommen und dem Nebeneinkommen zusammensetzt, lag im Durchschnitt der Jahre 1999/2001 je nach Region zwischen knapp 63'000 und 85'400 Fr. pro Betrieb: Die Betriebe der Bergregion erreichten somit rund 75% des Gesamteinkommens von Betrieben der Talregion Mit Nebeneinkommen von 17'500 bis 20'700 Fr hatten die Betriebe dabei eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle: Diese machte bei den Betrieben der Talregion 21% des Gesamteinkommens aus, bei jenen der Hügelregion 28% und bei denjenigen der Bergregion 30% Die Betriebe der Hügelregion wiesen mit 20'700 Fr absolut die höchsten Nebeneinkommen aus
Gesamteinkommen und Privatverbrauch pro Betrieb 1999/2001
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 66 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Hügelregion Bergregion i n F r Landwirtschaftliches Einkommen Nebeneinkommen Privatverbrauch Quelle: Zentrale Auswertung, FAT 0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Talregion
Der Privatverbrauch pro Betrieb ist entsprechend der Höhe des Gesamteinkommens bei den Betrieben der Talregion am höchsten und bei den Betrieben der Bergregion am tiefsten Der Privatverbrauch macht bei allen Betrieben rund 88% des Gesamteinkommens aus. Er liegt jeweils über der Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens.
Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Betrieb lag 2001 mit rund 71’000 Fr deutlich unter jenem aus dem Durchschnitt der Jahre 1998/2000 mit 76’000 Fr Der Privatverbrauch pro Betrieb hat hingegen im Jahr 2001 im Vergleich zu 1998/2000 um etwa 2’500 Fr zugenommen und lag bei 63’800 Fr
Gesamteinkommen und Privatverbrauch nach Quartilen 1 1999/2001
1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil Alle Betriebe
1 Quartile nach Arbeitsverdienst je Familien-Jahresarbeitseinheit
2 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr
Quelle: Zentrale Auswertung FAT
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit konnte 1999/2001 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken Sie mussten einen Teil ihrer für Ersatz- und Neuinvestitionen bzw für ihre Altersvorsorge vorgesehenen Mittel für den Privatverbrauch einsetzen Bei den Betrieben in den übrigen Quartilen waren die Privatausgaben geringer als das Gesamteinkommen Die Betriebe des ersten Quartils erreichten 43% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Betrieben des vierten Quartils
Beim Privatverbrauch ist die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer als beim Gesamteinkommen Er lag bei den Betrieben des ersten Quartils bei 71% des Verbrauchs der Betriebe des vierten Quartils
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit war 2001 in allen Quartilen tiefer im Vergleich zu den drei Vorjahren 1998/2000 Am geringsten ist die Differenz im ersten Quartil, am höchsten im vierten Quartil Beim Privatverbrauch fällt auf, dass dieser im Jahr 2001 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1998/2000 im ersten Quartil am stärksten zugenommen hat. Er lag im Jahr 2001 bei 16’200 Fr.
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 67 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Gesamteinkommen pro VE 2 (Fr ) 14 068 17 969 22 841 32 381 21 816 Privatverbrauch pro VE (Fr ) 15 325 16 086 18 413 21 457 17 816
Arbeit und Ausbildung
Der Bereich Arbeit und Ausbildung ist eines der zentralen sozialen Themen, bei denen alle fünf Jahre eine Bestandesaufnahme aufgrund repräsentativ durchgeführter Erhebungen gemacht wird
Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), eine jährliche Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS), erlaubt Aussagen zur Situation von Erwerbstätigen, Erwerbslosen und nicht erwerbstätigen Personen Erhoben werden unter anderem Daten bezüglich Arbeitsbedingungen sowie betreffend Haushalt- und Wohnsituation Eine Person wird stellvertretend für einen Haushalt kontaktiert: Jedes Jahr werden so rund 16'000 (ab 2002 ca 40'000) zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählte Personen telefonisch befragt; die Grundgesamtheit der SAKE ist die ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Die Ergebnisse der Stichprobe werden jeweils auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet
Die für die Landwirtschaft wichtigen Ergebnisse sind in den Abschnitten Haushalt- und Wohnsituation sowie Ausbildung und Arbeitssituation aufgeführt Die Zahlen stammen von der SAKE 2001, mit Ausnahme der Daten über Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit, welche im Jahr 2000 erhoben wurden Verglichen wird die Situation folgender fünf Berufskategorien von Erwerbstätigen:
– selbständige Landwirte,
– selbständige Gewerbetreibende des zweiten Sektors,
übrige Selbständige,
– landwirtschaftliche Arbeitnehmer sowie
– übrige Arbeitnehmer.
Als erwerbstätig gilt, wer in der Woche vor der Befragung mindestens eine Stunde gegen Entlöhnung gearbeitet oder wer als mitarbeitendes Familienmitglied unentgeltlich auf dem Familienbetrieb mitgearbeitet hat Bei der Gruppe selbständige Landwirte können also auch mitarbeitende Familienmitglieder inbegriffen sein, mehrheitlich Frauen Da die Stichproben bei den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern sehr klein sind, sind die hochgerechneten prozentualen Angaben für diese Kategorie statistisch nur bedingt zuverlässig
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 68
–
■ Schweizerische Arbeitskräfteerhebung als Grundlage
■ Haushalt- und Wohnsituation
In diesem Abschnitt werden die Kenngrössen «Alter der erwerbstätigen Personen», «Anzahl Personen und Anzahl Zimmer pro Haushalt» sowie «Besitzverhältnisse» aufgezeigt
Alter der erwerbstätigen Personen
Selbständige Landwirte
Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1

Ü
Arbeitnehmer
Es zeigt sich, dass bei den Landwirten doppelt so viele über 65-Jährige arbeitstätig sind – über 15% – als bei den beiden anderen Kategorien der selbständig Erwerbstätigen Der Anteil der unter 55-Jährigen ist mit rund zwei Dritteln bei den Landwirten am geringsten Knapp 10% der über 65-jährigen landwirtschaftlichen Arbeitnehmer sind noch arbeitstätig, bei den übrigen Arbeitnehmern sind es nur 1%
Selbständige Landwirte
Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1
Übrige Arbeitnehmer
Knapp ein Drittel der Landwirte wohnen in Haushalten mit fünf und mehr Personen; bei den anderen beiden Kategorien der selbständig Erwerbenden sind es rund 15% Weniger als 5% der Landwirte wohnen in einem Ein-Personen-Haushalt, bei den übrigen Arbeitnehmern sind es beinahe 20% Rund 45% der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer leben in Haushalten mit mindestens 4 Personen.
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
69
brige
in % Quelle: BFS 1 statistisch nur bedingt zuverlässig 0 20 40 60 80 100 15–24 Jahre 40–54 Jahre ≥ 65 Jahre 25–39 Jahre 55–64 Jahre
Personen im Haushalt
Anzahl
in % Quelle: BFS 1 statistisch nur bedingt zuverlässig 0 20 40 60 80 100 1 Person 3 Personen 5 und mehr Personen 2 Personen 4 Personen
Anzahl Zimmer pro Haushalt 1
Der Grösse des Haushalts entsprechend wohnen die Landwirte in Haushalten mit vielen Zimmern: 70% der Landwirte leben in Häusern bzw Wohnungen mit fünf und mehr Zimmern. Rund die Hälfte der selbständigen Gewerbetreibenden, der übrigen Selbständigen sowie der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer wohnen ebenfalls in diesen grossen Haushalten, bei den übrigen Arbeitnehmern sind es etwa ein Drittel
Besitzverhältnisse
Selbständige Landwirte Selbständige Gewerbetreibende

Übrige Selbständige Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1
Übrige Arbeitnehmer
Bei den Besitzverhältnissen zeigt sich, dass etwa 80% der Landwirte Eigentümer bzw Miteigentümer sind und nur rund 5% Mieter Gut 60% der selbständigen Gewerbetreibenden und der übrigen Selbständigen sind Eigentümer. Rund die Hälfte der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer sind Eigentümer bzw Miteigentümer, über 10% wohnen in so genannten Dienstwohnungen Bei den übrigen Arbeitnehmern sind knapp 40% Eigentümer, rund 60% Mieter
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1
brige Arbeitnehmer in % Quelle:
1
2
0 20 40 60 80 100 5
3
1
4 Z
2 Z
70
Selbständige Landwirte Selbständige Gewerbetreibende Übrige Selbständige Landwirtschaftliche Arbeitnehmer 2 Ü
BFS
ohne Küche und Bad
statistisch nur bedingt zuverlässig
und mehr Zimmer
Zimmer
Zimmer
immer
immer
in
%
0 20 40 60 80 100
Quelle: BFS
1 statistisch nur bedingt zuverlässig
(Mit-) Eigentümer Mieter Genoss.-wohnung Übrige
Mieter Wohnung, Haus Dienstwohnung
■ Ausbildung und Arbeitssituation
In diesem Abschnitt werden die Kenngrössen «Berufliche Ausbildung und ausgeübte Tätigkeit», «Besuch von Weiterbildungskursen», «Arbeitszeit pro Woche», «Arbeit am Wochenende, am Abend und in der Nacht», «Zeitaufwand für Haushalt- und Familienarbeit», «Anzahl Ferientage» sowie «Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen» dargelegt

Berufliche Ausbildung und ausgeübte Tätigkeit
Selbständige Landwirte Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1
Übrige Arbeitnehmer
Die Landwirte haben zusammen mit den selbständigen Gewerbetreibenden den höchsten Anteil an Personen, die ihren ersten erlernten Beruf ausüben Bedeutend höher ist dagegen bei den Landwirten mit 16% der Anteil derjenigen, die ihre Tätigkeit ohne berufliche Ausbildung ausüben Nur die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer weisen mit über 20% einen noch höheren Anteil auf Bei den übrigen Selbständigen, den landwirtschaftlichen und den übrigen Arbeitnehmern sind um die Hälfte der erwerbstätigen Personen nicht mehr in ihrem ersten erlernten Berufsgebiet tätig
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 71
in
%
1
0 20 40 60 80 100
Quelle: BFS
statistisch nur bedingt zuverlässig
Ausgeübter = erster erlernter Beruf Ausgeübter ≠ erster erlernter Beruf keinen Beruf erlernt
Besuch von Weiterbildungskursen
Selbständige Landwirte
Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1

Übrige Arbeitnehmer
Unter Weiterbildungskurse werden Freizeitkurse, betriebsinterne Kurse oder andere Formen der beruflichen Weiterbildung zusammengefasst Rund 75% der Landwirte haben in den letzten 12 Monaten vor der Befragung keine Weiterbildungskurse besucht, bei den selbständigen Gewerbetreibenden sind es 65%, bei den übrigen Selbständigen 55% Rund zwei Drittel der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer besuchten keine Weiterbildungskurse, bei den übrigen Arbeitnehmern waren es 55%
Arbeitszeit pro Woche 1
Selbständige Landwirte
Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landwirtschaftliche Arbeitnehmer 2
Übrige Arbeitnehmer
Die wöchentliche Arbeitszeit ist bei den Landwirten und den selbständigen Gewerbetreibenden hoch: Fast die Hälfte arbeitet 50 und mehr Stunden; bei den übrigen Selbständigen sowie den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern sind es rund ein Viertel, bei den übrigen Arbeitnehmern nur knapp 2%
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 72
in % Quelle: BFS 1 statistisch nur bedingt zuverlässig 0 20 40 60 80 100 keinen einen zwei und mehr
in %
1
2
0 20 40 60 80 100 50 und mehr 30–39 10–19 40–49 20–29 1–9
Quelle: BFS
in Stunden pro Woche normalerweise geleistete Arbeitszeit
statistisch nur bedingt zuverlässig
Arbeit am Wochenende Selbständige Landwirte
Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1
Übrige Arbeitnehmer
Normalerweise am Samstag und Sonntag
Normalerweise am Sonntag
Normalerweise am Samstag
Manchmal am Samstag oder Sonntag
Nie
Knapp 70% der Landwirte geben an, dass sie normalerweise am Wochenende arbeiten; bei den beiden anderen selbständig Erwerbenden gehen nur rund 10% auch am Wochenende regelmässig ihrer Tätigkeit nach Etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer arbeiten normalerweise am Wochenende, bei den übrigen Arbeitnehmern sind es weniger als 10%.
Abend- und Nachtarbeit
Selbständige Landwirte
Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1
Übrige Arbeitnehmer
Nie
Manchmal am Abend oder in der Nacht
Normalerweise am Abend
Normalerweise in der Nacht
Normalerweise am Abend und in der Nacht
Was die Abend- und Nachtarbeit betrifft, so lässt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Selbständigen und den Arbeitnehmern erkennen: Nur rund ein Drittel der selbständig Erwerbenden arbeiten nie abends oder nachts; bei den beiden Kategorien der Arbeitnehmer sind es knapp zwei Drittel
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 73
in % Quelle: BFS 1 statistisch nur bedingt zuverlässig 0 20 40 60 80 100
in %
BFS 1 statistisch nur bedingt zuverlässig 0 20 40 60 80 100
Quelle:
Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit 1
Selbständige Landwirte Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige
Landwirtschaftliche Arbeitnehmer 2
Übrige Arbeitnehmer
Der Zeitaufwand für Haus- und Familienarbeit (inkl Kinderbetreuung sowie Pflege von Erwachsenen im Haushalt) ist bei den Frauen erwartungsgemäss weit höher als bei den Männern, am höchsten ist er bei den Landwirtinnen mit 43 Stunden pro Woche: Diese haben durchschnittlich auch den grössten Haushalt zu betreuen. Die befragten Männer – selbständig erwerbend und angestellt – wenden zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche für Haus- und Familienarbeit auf
Anzahl Ferientage
Selbständige Landwirte
Selbständige Gewerbetreibende
Landwirte machen mit jährlich im Durchschnitt rund 6 Tagen klar am wenigsten Ferien Die selbständigen Gewerbetreibenden kommen auf 17, die übrigen Selbständigen auf 19 Tage. Die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer haben über 18 und die übrigen Arbeitnehmer durchschnittlich 23 Tage Ferien pro Jahr Für die Landwirte – insbesondere für die Nutzviehhalter – ist es im Gegensatz zu den anderen selbständig Erwerbenden nicht möglich, den Betrieb vorübergehend zu schliessen
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 74
Stunden pro Woche Quelle:
010 20 30 40 50 M
BFS 1 Daten aus der SAKE 2000
2
statistisch nur bedingt zuverlässig
änner Frauen
brige Arbeitnehmer in % Quelle:
1
0 20 40 60 80 100 keine Ferien 11–15 26–30 1–5 16–20 30 und mehr 6–10 21–25
Übrige Selbständige Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1 Ü
BFS
statistisch nur bedingt zuverlässig
Zufriedenheit mit Arbeitsbedingungen
Selbständige Landwirte Selbständige Gewerbetreibende
Übrige Selbständige Landwirtschaftliche Arbeitnehmer1
Übrige Arbeitnehmer
entspricht den Wünschen/Vorstellungen entspricht nicht den Wünschen/Vorstellungen
Die grosse Mehrheit (rund 85%) der befragten Erwerbstätigen ist mit den momentanen Arbeitsbedingungen zufrieden
Im Bereich von Arbeit und Ausbildung sind sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen den Landwirten und den übrigen Kategorien von Erwerbstätigen festzustellen.

Der grösste Unterschied zu allen anderen Kategorien besteht bei den Ferien Die Landwirte gehen im Durchschnitt nur 6 Tage in die Ferien, bei den übrigen Kategorien sind es 17 und mehr Tage Auffallend ist auch der hohe Anteil von Wohneigentum bei den Landwirten. Über 80% sind Eigentümer, bei den selbständigen Gewerbetreibenden sind es nur 60%, bei den übrigen Arbeitnehmern gar nur 40% Bedeutend häufiger leisten die Landwirte auch Wochenendarbeiten; zusammen mit den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern ist der Anteil von Erwerbstätigen, welche keine berufliche Ausbildung haben, am höchsten
Gemeinsam mit den selbständigen Gewerbetreibenden und den übrigen Selbständigen gibt es eine bedeutende Zahl von Landwirten, deren Arbeitszeit im Durchschnitt über 50 Stunden pro Woche beträgt Die übrigen Arbeitnehmer dagegen arbeiten fast ausschliesslich weniger als 50 Stunden in der Woche Interessant ist, dass die Männer aller Kategorien etwa gleich viel für den Haushalt und die Familienarbeit aufwenden Allen Kategorien gemeinsam ist schliesslich die hohe Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 75
in %
1
0 20 40 60 80 100
Quelle: BFS
statistisch nur bedingt zuverlässig
■ Fazit
■ Viele Bäuerinnen kommen aus dem Bauernstand
Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft
Im Hinblick auf die Tagung der FAO-Arbeitsgruppe «Frau und Familie in der Entwicklung des ländlichen Raums» – die im Oktober 2002 in Freiburg stattfand

entschied das BLW, sich in einem Forschungsprojekt vertieft mit der Rolle der Frauen in der schweizerischen Landwirtschaft auseinander zu setzen Das Projekt bestand aus einer durch die Gesellschaft für praktische Sozialforschung (GfS) ausgeführten schriftlichen Befragung, aus Gruppengesprächen mit Bäuerinnen und aus Interviews mit Expertinnen aus dem landwirtschaftlichen und bäuerlich-hauswirtschaftlichen Bereich Es wurde durch eine Arbeitsgruppe von Fachpersonen begleitet Die Projektleitung lag bei der Sozialwissenschafterin Dr Brigitte Stucki
Die schriftliche Befragung diente primär der Erhebung von Basisdaten Vertieften Einblick in den gegenwärtigen Alltag von Bäuerinnen in der Schweiz vermittelten vier Gruppengespräche mit jeweils rund zehn Bäuerinnen. Je ein Treffen fand im Tessin und in der Romandie statt, während in der Deutschschweiz ein Gespräch mit Bäuerinnen aus der Talregion und eines mit Bäuerinnen aus der Bergregion durchgeführt wurde
Rund 60% der Frauen in der Landwirtschaft sind selber auf einem Hof aufgewachsen. Zwar geht die Zahl in der jüngeren Generation leicht zurück, doch der Prozentsatz bleibt ausserordentlich hoch, wenn man berücksichtigt, dass die landwirtschaftliche Bevölkerung heute nur noch rund vier Prozent ausmacht. Mehrheitlich finden die Bäuerinnen ihren Partner in der Region, aus der sie selbst stammen Nur ein verschwindender Teil der Bäuerinnen in der Schweiz kommt aus dem Ausland
■ Oft leben drei Generationen auf dem gleichen Hof
Ein bäuerlicher Haushalt besteht heute in der Regel aus einer Kernfamilie, also aus Eltern und Kindern In jedem zwanzigsten Haushalt leben über den engsten Kreis hinaus noch Lehrlinge oder Angestellte und gelegentlich auch Menschen, die in der Familie betreut werden. Dass Eltern, Schwiegereltern oder andere Verwandte im gleichen Haushalt wohnen, kommt selten vor Besonders in der Deutschschweiz ist es hingegen verbreitet, dass die Schwiegereltern auf dem selben Hof, aber in einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus(teil) leben In der Romandie ist dies etwas, im Tessin deutlich seltener anzutreffen
Das generationenübergreifende Zusammenleben erweist sich in vielen Familien als konflikthaft Die ältere Generation muss sich von ihrem Lebenswerk ablösen, wenn die junge Familie die Verantwortung übernimmt. Nicht selten kommt sich das Bauernpaar im Ruhestand nutzlos vor Unterschiedliche Auffassungen, wieviel Haushaltarbeit, wieviel Gartenbau, wieviel Näh- und Flickarbeit eine Bäuerin zu erledigen habe und wie sie die einzelnen Dinge ausführen müsse, prallen aufeinander. Ebenso gehen die Meinungen oft auseinander, ob und wieviel eine Bäuerin ausserhalb des Betriebs arbeiten solle, wie Haus und Hof geschmückt sein müssten und wie die richtige Kinderund Jugendlichenerziehung zu erfolgen habe
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 76
–
■ Bäuerin ist ein Zweitberuf
Das generationenübergreifende Zusammenleben kann aber für beide Seiten auch ein Gewinn sein Für die junge Familie bedeutet die Anwesenheit der älteren Generation oft eine Arbeitsentlastung, sei dies durch das Kinderhüten oder durch die Mithilfe in Stall und Feld. Von Bedeutung kann auch die Weitergabe von Wissen von der älteren an die jüngere Bäuerin sein, etwa über Garten und Haushalt In Zukunft an Bedeutung gewinnen wird mit dem stetigen Anstieg der Lebenserwartung das Zusammenleben von vier Generationen und insbesondere das Thema der häuslichen Alterspflege
Die heutigen Bäuerinnen haben zumeist einen ausserlandwirtschaftlichen Erstberuf erlernt Jede sechste Frau verfügt über einen kaufmännischen Lehrabschluss, häufig sind ferner Berufe im Sozialwesen sowie im Verkauf. Mit ihrer nicht landwirtschaftlichen Qualifikation unterscheiden sich die Bäuerinnen deutlich von den Männern, die mehrheitlich Landwirt als ersten und einzigen Beruf erlernt haben
Traditionell führte die Ausbildung zur Bäuerin über eine bäuerlich-hauswirtschaftliche Berufslehre, an welche eine Zusatzausbildung zur diplomierten Bäuerin anschloss Heute handelt es sich in der Regel um eine Zweitausbildung, die zum Abschluss «Bäuerin mit Fachausweis» führt In der Deutschschweiz besitzt knapp jede dritte Bäuerin ein Bäuerinnendiplom, in der Romandie sind es leicht über 10%, während es im Tessin nur wenige diplomierte Bäuerinnen gibt Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass in der italienischsprachigen Schweiz keine Ausbildungsstätte für Bäuerinnen existiert Sehr selten kommt es vor, dass eine Frau den Beruf «Landwirtin» erlernt, indem sie zusammen mit den Männern eine landwirtschaftliche Lehre absolviert.
Bäuerinnen sind an Weiterbildung interessiert, sie nutzen solche Angebote aber eher gelegentlich als regelmässig, vor allem deshalb, weil es ihnen an Zeit fehlt Die gefragtesten Weiterbildungsbereiche sind hauswirtschaftliche, dies am deutlichsten in der Westschweiz. Gefragt sind auch Computerkurse. Ein gutes Drittel der besuchten Kurse betrifft ferner den Bereich Garten, bäuerliche Selbstversorgung und Ernährung Jede vierte Bäuerin bildet sich in Buchhaltung weiter Gelegentlich werden auch Kurse zum Thema Persönlichkeitsbildung und Kommunikation belegt.
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 77
Erlernte Berufe pädagogisch hauswirtschaftlich gewerblich Verkauf sozial kein Abschluss kaufmännisch landwirtschaftlich Quelle: GfS 2002 0 5 6 8 9 12 14 15 16 25 10 15 in % 2025 30
Bäuerinnen arbeiten vermehrt auswärts
Wichtigstes Tätigkeitsfeld der Bäuerinnen ist der Bereich Haushalt, Familie und Garten. Darauf folgt die Mithilfe auf bzw für den Betrieb An erster Stelle stehen dabei Büroarbeiten wie Buchhaltung, Korrespondenz und andere administrative Angelegenheiten. Die Frauen helfen aber auch im Stall und auf dem Feld mit. Im Stall ist ihre wichtigste Arbeit das Füttern und Tränken der Tiere Bei den Aussenarbeiten steht die Mithilfe beim Heuen im Vordergrund Bäuerinnen in mittleren Jahren arbeiten mehr Stunden im Betrieb als jüngere Frauen, die stärker von der Kinderbetreuung beansprucht sind Praktisch alles, was mit dem Ackerbau zu tun hat, fällt gänzlich in den Verantwortungsbereich des Ehemannes respektive Partners
Neben den obigen Tätigkeitsfeldern hat fast die Hälfte der Bäuerinnen irgend ein spezielles Arbeitsgebiet auf dem Betrieb. Auf rund vier von zehn Höfen gibt es in grösserem oder kleinerem Umfang Direktvermarktung als Aufgabenbereich der Bäuerin Darauf folgen die selbständige Betreuung von Spezialkulturen und/oder die Zuständigkeit für Geflügel und Kleintiere. So grosse Bedeutung ihnen auf einem einzelnen Hof zukommen kann, so wenig Relevanz haben die verschiedenen Formen von Agrotourismus für die Landwirtschaft als Ganzes
Jede vierte Bäuerin hat in den letzten zehn Jahren neu eine Arbeit aufgenommen. Teilzeitarbeit ist die Regel Jede dritte ausserhalb der Landwirtschaft arbeitende Bäuerin absolviert ein Pensum von mehr als 16 Wochenstunden In der Romandie arbeiten Bäuerinnen häufiger auswärts, und ihre Arbeitszeit ist umfangreicher als in der übrigen Schweiz Mehrheitlich kehrt die Bäuerin in ihren erlernten Erstberuf zurück, oder sie hat diesen gar nie ganz aufgegeben Eher selten verrichtet sie eine Tätigkeit zu Hause, indem sie zum Beispiel als Coiffeuse oder Schneiderin arbeitet oder für Drittpersonen Büroarbeiten erledigt

Geld zu verdienen ist für die Frauen nur ein Motiv unter anderen für die auswärtige Arbeit Zwar sagen sie, sie seien auf das Zusatzeinkommen angewiesen, doch erwähnen sie eine Reihe weiterer positiver Aspekte: Sie treffen andere Menschen, erhalten neue Impulse, die Abwechslung bringt Freude, sie verdienen eigenes Geld und erfahren Wertschätzung Dafür nehmen auswärts arbeitende Bäuerinnen in Kauf, dass sie mehr zu organisieren haben, dass Arbeit im Haushalt liegen bleibt und dass sie den Garten verkleinern oder aufgeben müssen Neben den Bäuerinnen, die ihre Erwerbstätigkeit positiv sehen, gibt es aber auch Frauen, welche diese wieder aufgegeben haben, weil die Doppelbelastung sie überforderte
40% der erwerbstätigen Frauen tragen bis zu einem Zehntel zum gesamten Einkommen der Familie bei Im Unterschied dazu arbeiten die Männer wesentlich häufiger als die Bäuerinnen ausserhalb der Landwirtschaft, ebenso sind ihre durchschnittlichen Pensen umfangreicher. Anders als die Bäuerinnen haben die Männer seltener die Möglichkeit, in einen qualifizierten Erstberuf zurück zu kehren, da sie in der Regel Landwirt als ersten und einzigen Beruf erlernt haben Nur im Tessin ist das nicht so deutlich der Fall Arbeitet der Mann auswärts, hilft die Bäuerin verstärkt auf dem Betrieb mit, häufig auf Kosten des Haushalts Doch wie bei ihrer eigenen auswärtigen Arbeit schätzt sie auch bei der Erwerbstätigkeit des Mannes, dass neue Impulse auf den Hof kommen
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 78
■
■ Haushalt, Familie und Garten stehen im Zentrum
■ Manche Bäuerin hat lange Arbeitszeiten
70 Arbeitsstunden – für Haushalt, Familie, Garten, Betrieb und allfällige ausserlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit
gaben Bäuerinnen in der schriftlichen Befragung als durchschnittliche Wochenarbeitszeit an, unabhängig von der Sprachregion Diese Zahl ist jedoch aufgrund der Gruppengespräche zu relativieren, da es stark darauf ankommt, welche Inhalte eine Bäuerin zur Arbeit zählt Sowohl im Bereich Kinderbetreuung wie auch im Bereich Haushalt existieren viele Grauzonen, die sich als Arbeit einstufen lassen oder eben nicht Die Vermutung liegt nahe, dass die Arbeitszeit im Jahresdurchschnitt und bei Einbezug aller Arbeiten höher liegt Dass sie zumindest saisonal auf vielen Betrieben wesentlich umfangreicher ist, wurde durch die Gruppengespräche bestätigt

1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 79
–
der wöchentlichen Arbeitszeit ≥ 56 Jahre 36–55 Jahre bis 35 Jahre Total Quelle: GfS 2002 020 10 30 40 Stunden 60 50 70 80 Haushalt inkl Garten, Familie spezielle Tätigkeiten Betrieb allgemeine Betriebsarbeiten ausserlandwirtschaftliche Erwerbsarbeit 38,1 39,3 46,1 40,5 18,8 4,0 4,5 20,3 4,3 6,8 17,3 2,65,5 19,6 3,9 6,3
Zusammensetzung
■ Bäuerinnen haben ein traditionelles Rollenverständnis
Die zeitliche Beanspruchung hat auf den meisten Betrieben in den letzten Jahren spürbar zugenommen Die Arbeitsbelastung kann zum Problem werden Eine deutliche Mehrheit der Frauen hat das Gefühl, für sich selbst, für freund- und nachbarschaftliche Kontakte und für Hobbies zu wenig Zeit zu finden. Etwas besser sieht es aus, was die Partnerschaft und das Familienleben angeht Unabhängig von der Sprachregion, in der sie lebt, sagt jede dritte Bäuerin, sie habe hierfür ausreichend Zeit
Nur jede zweite Bäuerin in allen Landesteilen macht pro Jahr eine Woche oder mehr Ferien Auch hierfür kommt Zeitmangel, neben der Begründung, keinen Ersatz auf dem Betrieb zu finden, als Hauptargument ins Spiel Mangelnde Freizeit und Ferien bedeuten für viele Bäuerinnen, die eine andere Arbeitswelt kennengelernt haben, eine grosse Umstellung, die nicht von allen gleich gut bewältigt wird.
Als Kompensation zur oft stark empfundenen Arbeitsbeanspruchung schätzen viele Bäuerinnen die besonderen Qualitäten ihrer Lebenswelt hoch ein: die Wohnlage, die abwechslungsreiche Arbeit, die Eigenverantwortung, das Gefühl, keinen Chef zu haben Dass die Kinder ihren Vater in seinem Arbeitsalltag erleben und sich die ganze Familie für etwas Gemeinsames einsetzt, erachten viele Frauen in der Landwirtschaft als Privileg Doch gibt es auch Bäuerinnen, die hierzu eine kritische Haltung einnehmen und eher finden, dass räumliche Distanz im Alltag auch Vorteile bringe. Im übrigen kann sich die Einstellung zu den Vor- und Nachteilen einer bäuerlichen Lebensweise im Laufe des Lebens auch stark verändern
Bäuerinnen verstehen ihre Rolle mehrheitlich als Teil einer Lebensform, die alle Aspekte des Alltags umfasst und weniger als Berufsrolle im modernen Sinn Viele Frauen sehen sich primär als Hausfrau und Mutter, wohlwissend, dass ihre Lebenssituation eine andere ist als die von Hausfrauen und Müttern in nicht bäuerlichen Verhältnissen. Die Frauen in der Landwirtschaft sind in der Regel auch Produzentinnen Immerhin haben neun von zehn Bäuerinnen einen Garten, und knapp ein Drittel der Befragten ist verantwortlich für Spezialkulturen oder Kleintiere. Als verantwortliche Leiterin eines Betriebszweiges versteht sich jedoch nur ein bescheidener Teil Selten kommt es vor, dass sich eine Frau ausdrücklich vom Begriff Bäuerin abgrenzt, indem sie das Selbstbild einer andern Berufsfrau pflegt In der Romandie ist dies häufiger anzutreffen als in den andern Schweizer Regionen
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 80
■ Die Rechtsstellung der Bäuerin ist schwach
Die Rolle, welche die Bäuerinnen auf dem Hof einnehmen, kann entweder abgesprochen sein, oder dann sind sie einfach in diese hineingewachsen In beiden Fällen drücken die Frauen ein hohes Mass an Zufriedenheit aus Die traditionelle Rollenauffassung ist aber auch innerhalb der Bäuerinnenschaft nicht mehr unbestritten. Besonders aus der Romandie erklingen kritische Töne gegenüber diesem Selbstverständnis

Als in der Regel verheiratete Frauen sind Bäuerinnen juristisch gesehen Hausfrauen Dies, obwohl sie im Durchschnitt ein Arbeitspensum von rund 24 Stunden pro Woche auf oder für den Betrieb leisten Ist eine Bäuerin auswärtig tätig, fliesst das verdiente Geld in der Regel auf ein gemeinsames Familienkonto. Die heutigen Bäuerinnen haben juristisch keinerlei Einfluss auf die Betriebsentscheidungen, und sie sind nicht unterschriftsberechtigt Besonders im Falle einer Scheidung oder eines Todes kommen die rechtlichen Defizite zum Tragen. Um den Frauen in der Landwirtschaft einen ihrer Arbeitsleistung entsprechenden Status zu verschaffen, werden heute mehrere Möglichkeiten diskutiert
■ Die Haltung gegenüber der Gesellschaft ist ambivalent
Bäuerinnen sind sich ihrer Stellung als Minderheit in der Gesellschaft ausgeprägt bewusst Sie fühlen sich im positiven wie im negativen Sinne als etwas Besonderes wahrgenommen Auf der positiven Seite steht das Selbstbild, dass die Bauern gute, verlässliche Arbeitskräfte seien und dass die bäuerliche Familie eine Vorbildfunktion habe Als negative Wahrnehmung steht dem gegenüber, dass die Gesellschaft die Bauern aufgrund ihrer staatlichen Unterstützung und ihrer Wirtschaftsform kritisiert Dies führt bei vielen Frauen zu einem Rechtfertigungsdruck.
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 81
Hausfrau und Mutter Bäuerin andere Berufsfrau Landwirtin Leiterin eines Betriebszweigs etwas anderes Angestellte des Betriebs Quelle: GfS 2002 1 Mehrfachantworten möglich 0 83 55 13 9 8 6 1 20 40 in % 60 80 100
Rollenverständnis 1
■ Persönlicher Optimismus mit schwarzer Allgemeinbeurteilung
Rund die Hälfte der Frauen stuft sich als zuversichtlich bis sehr zuversichtlich bezüglich ihrer persönlichen Zukunft ein Diese rosige Sicht wird im Hinblick auf die Betriebszukunft bereits deutlich relativiert, während die Mehrheit der Bäuerinnen der Landwirtschaft als Ganzes kaum mehr positive Perspektiven abgewinnt.
■ Bäuerinnen spielen eine Rolle in der nachhaltigen Landwirtschaft
Diese negative Sicht ist unter den älteren Bäuerinnen am ausgeprägtesten Diese Frauengruppe hat die Jahre mit einem gut ausgebauten Subventionssystem in der Landwirtschaft erlebt und bekundet Mühe, den Abbau dieser Stützungen und das neue Direktzahlungssystem zu akzeptieren Jüngere Bäuerinnen setzen dem traditionellen bäuerlichen Kontinuitätsdenken, der Erhaltung des Hofs für die künftigen Generationen, pragmatisch entgegen, dass sie nicht über die eigene Generation hinaus planen können
Die letzten fünfzehn Jahre bedeuteten eine verunsichernde Umbruchzeit in der Landwirtschaft, welche die Werthaltungen der Bauernschaft nachhaltig erschütterte. Wer nicht in einem traditionellen Verständnis, was Landwirtschaft zu sein hat, verhaftet ist, kann sich leichter auf die politischen Neuausrichtungen einlassen Dies betrifft die Einstellung gegenüber dem 1993 eingeführten System der Direktzahlungen ebenso wie jene gegenüber den Ökologisierungsbestrebungen der Landwirtschaft Der traditionelle Landwirt versteht sich zuerst und vor allem als Produzent, der für seine landwirtschaftlichen Güter entschädigt werden will und der sich daher mit dem Prinzip der Direktzahlungen schwer tut Ebenso halten sich die in der herkömmlichen Landwirtschaft verwurzelten Menschen sozusagen von Natur aus für Fachleute, was Fragen der Naturerhaltung angeht Sie betrachten es als unzulässigen Übergriff der Gesellschaft, wenn ihre Wirtschaftsweise angeprangert oder gar beeinflusst wird, wie das mit dem ökologischen Leistungsnachweis geschieht. In dieser Beziehung ist ein frischer, unbefangener Blick von aussen hilfreich Zwar stammen auch unter den jüngeren Bäuerinnen statistisch gesehen noch erstaunlich viele aus bäuerlichem Umfeld, doch ihre Zahl ist abnehmend und wird in Zukunft zweifellos noch zurückgehen Frauen, die aus nicht landwirtschaftlichen Kreisen kommen, bringen einen anderen Erfahrungshintergrund mit sich und damit neue Impulse in die Landwirtschaft.
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 82
Zuversicht in die Zukunft ≥ 56 Jahre 36–55 Jahre bis 35 Jahre Total Quelle: GfS 2002 0 1 2 3 4 5 bezüglich meiner persönlichen Zukunft bezüglich unseres Betriebs bezüglich Zukunft der Landwirtschaft 3,4 3,8 3,8 3,1 3,1 2,4 2,4 4,0 3,3 2,6 2,7 2,1
■ Die typische Bäuerin gibt es nicht
Viele Bäuerinnen haben aber auch einen direkten Einfluss auf die Art und Weise, wie der Betrieb geführt wird, indem sie als Produzentinnen spezielle Angebote auf dem Betrieb pflegen und/oder für die Direktvermarktung von Produkten zuständig sind Hingegen wäre es eine Überforderung der Frauen in der Landwirtschaft, wenn man von ihnen Kompetenz in allen betrieblichen Belangen – speziell was Fragen der Ökologisierung angeht – verlangt In den letzten Jahren wurde oft auf die Frauen in der Landwirtschaft eine besondere Naturnähe und Tierliebe projiziert und ihr somit eine übermässige Verantwortung aufgebürdet Dabei versteht es sich von selbst, dass eine Bäuerin in der Regel nicht über entsprechendes Fachwissen verfügen kann Diese Kompetenz lässt sich nur durch den Besuch einer landwirtschaftlichen Schule und durch stetige Weiterbildung erwerben
Je nach Sprachregion scheinen verschiedene Themen, die unter den Bäuerinnen diskutiert werden, im Vordergrund zu stehen. Im Tessin – wie auch in der Romandie – ist der Minderheitenstatus als Grundtenor stark gegenwärtig Gerade in der italienischsprachigen Schweiz ist die Bauernschaft eine Minorität mit schwacher Vertretung in der kantonalen Regierung und noch schwächer im nationalen Parlament Es gibt im Tessin weder eine bäuerlich-hauswirtschaftliche Schule noch ein Beratungszentrum für Bäuerinnen. Erst im Jahr 2001 wurde hier eine Bäuerinnenorganisation gegründet und damit überhaupt ein Kommunikationsforum geschaffen
In der Romandie ist die Stellung als Minderheit innerhalb der Bauernschaft ebenfalls ein wichtiges Thema, obwohl die Landwirtschaft in den Westschweizer Kantonen über mehr politischen Einfluss verfügt Im Unterschied zum Tessin gibt es hier gut ausgebaute landwirtschaftliche Institutionen, insbesondere auch für Bäuerinnen Die Romandie vereinigt in sich verschiedenste Landwirtschaftsweisen und unterschiedliche bäuerliche Kulturen. Die landwirtschaftliche Situation in einem Fribourger oder jurassischen Milchwirtschaftsbetrieb lässt sich kaum mit einem Acker- und Rebbaubetrieb im Kanton Waadt vergleichen Mehr als in andern Regionen scheinen in einzelnen Gegenden der Romandie die Bäuerinnen ihre Rolle zu hinterfragen.
Doch die Auffassung, dass Bäuerin zu sein nach wie vor eine Lebensform mit ihren ganz spezifischen Qualitäten ist, ist noch sehr stark lebendig Dies wurde in den Gruppengesprächen in der Deutschschweiz klar, ohne dass die Bäuerinnen in der Talund in der Bergregion sich hierin unterschieden hätten
Es zeigt sich also, Bäuerin sein ist eine Lebensweise mit vielen Facetten Die typische Bäuerin gibt es nicht, vielmehr bestehen traditionelle und moderne Rollenbilder nebeneinander Bei allen Unterschieden bleibt: Bäuerin zu sein ist etwas ganz Besonderes

1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 83
■ Kosten der Agrarpolitik
1.2.2 Gesellschaft
Meinungen der Bevölkerung zur Landwirtschaft
Die Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung (GfS) führt in Zusammenarbeit mit anderen spezialisierten Instituten seit 1986 Langzeitbeobachtungen der Gesellschaft durch Die Analysen basieren auf Befragungen zu verschiedenen Themenbereichen und werden nach der bei UNIVOX üblichen Befragungsanlage realisiert Die Landwirtschaft ist Gegenstand dieser Untersuchungen
Die GfS hat 2002 wieder eine Befragung im Bereich Landwirtschaft durchgeführt. Der Schwerpunkt wurde dieses Jahr auf die Meinungen der Bevölkerung zur Agrarpolitik und zur Landwirtschaft sowie auf die Beziehungen der Befragten zur Landwirtschaft gelegt. Grundlage für die Analyse waren im Februar 2002 durchgeführte Interviews. Die Stichprobe umfasste 718 Befragte, 72% davon kamen aus der Deutschschweiz und 28% aus der Westschweiz Im Folgenden werden die Hauptergebnisse der Befragung wiedergegeben
Die Bevölkerung wird seit Beginn der neunziger Jahre befragt, ob die Schweizer Agrarpolitik zu hohe Kosten verursacht oder nicht Ihre Einschätzung diesbezüglich hat sich im vergangenen Jahrzehnt verändert. Noch nie waren so wenig der Befragten (40%) der Ansicht, dass die Agrarpolitik zu hohe Kosten verursacht Im Gegenzug hat sich aber in dieser Zeitspanne auch der Anteil der Unschlüssigen von 14 auf 28% verdoppelt
Die Schweizer Agrarpolitik verursacht zu hohe Kosten
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 84 ■■■■■■■■■■■■■■■■
angemessen
i n % einverstanden weiss nicht/keine Antwort Quelle: GfS 2002 1992 1994 20002002 1998 1996 0 100 80 40 60 20 nicht einverstanden 17 17 24 23 14 28 62 64 56 57 57 40 2119 2020 29 32
Die Meinung der Bevölkerung in Bezug auf den Einfluss der Agrarpolitik auf die Landwirtschaft hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich geändert Über zwei Drittel der Befragten sind heute der Meinung, dass die Agrarpolitik eine umweltgerechte Produktion fördert. Zehn Jahre zuvor waren noch weniger als 50% der Befragten dieser Ansicht Der Anteil der Unschlüssigen ist in dieser Zeitspanne ziemlich konstant auf tiefem Niveau geblieben Aufgrund der Ergebnisse kann von einem positiven Trend gesprochen werden In den Augen der Bevölkerung wird die landwirtschaftliche Produktion immer umweltgerechter
Aus der Sicht der Befragten hat sich im vergangenen Jahrzehnt die Haltung der Landwirtinnen und Landwirte gegenüber der Ökologie positiv entwickelt Nur noch ein Sechstel der Befragten sind der Ansicht, dass die meisten Landwirte ökologische Produktionsformen ablehnen würden Vor zehn Jahren waren es noch 41% Etwas weniger eindeutig scheinen die Ergebnisse bei der Aussage, dass die Landwirte umweltgerecht produzieren würden, wenn ihre Kosten gedeckt wären. Der Trend ist leicht sinkend Gestiegen ist der Anteil der Befragten, die finden, dass den meisten Landwirten die Landschaftspflege wichtig ist 81% waren 2002 dieser Meinung
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 85
Agrarpolitik fördert umweltgerechte Landwirtschaft
Positive Haltung gegenüber Ökologie
umweltgerechte Produktion i n % einverstanden weiss nicht/keine Antwort Quelle: GfS 2002 1992 1994 20002002 1998 1996 0 100 80 40 60 20 nicht einverstanden 18 16 2020 12 17 34 33 29 23 25 13 48 51 51 57 63 70 Sie lehnen ökologische Produktionsformen ab Sie würden umweltgerecht produzieren, wenn ihre Kosten gedeckt wären Die Landschaftspflege ist ihnen wichtig i n % grosse Mehrheit+Mehrheit Quelle: GfS 2002 199220002002 199220002002 199220002002 0 100 80 40 60 20 Minderheit+ kleine Minderheit weiss nicht / keine Antwort 7 52 41 7 62 31 19 65 16 4 12 84 6 12 83 10 10 80 3 28 69 6 26 68 9 10 81
■
■
Die
Schweizer Agrarpolitik fördert
eine
■ Abgeltung der Mehrkosten für tier- und umweltgerechte Bewirtschaftung
Die Bevölkerung ist weniger bereit, den umwelt- und tiergerecht wirtschaftenden Bauern die entstehenden Mehrkosten durch Steuergelder abzugelten Während 1995 noch zwei Drittel der Befragten dafür waren, lag ihr Anteil 2002 unter der 50%-Marke
Der Anteil der Unschlüssigen ist im Beobachtungszeitraum etwa gleich geblieben. Dieses Ergebnis steht in einem gewissen Widerspruch zum Resultat über die Kosten der Agrarpolitik, welche von nur noch 40% der Befragten als zu hoch eingestuft werden
Der Staat sollte Bauern, die tier- und umweltgerecht wirtschaften, die entstehenden Mehrkosten durch Steuergelder abgelten
■ Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft
80% der Befragten bescheinigen der Mehrheit der Landwirtinnen und Landwirte, entsprechend den Konsumentenwünschen produzieren zu wollen Diese Einschätzung ist im Laufe der Zeit annähernd stabil geblieben Nur noch 23% der Befragten glauben, dass die grosse Mehrheit und die Mehrheit der Landwirte auf Kosten der übrigen Bevölkerung auch unrentable Betriebe erhalten wolle
Sie sind bestrebt, das zu produzieren, was der Konsument wünscht
Sie wollen auf Kosten der übrigen Bevölkerung auch unrentable Betriebe erhalten
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 86
i n % einverstanden weiss nicht/keine Antwort Quelle: GfS 2002 1995 2002 2000 0 100 80 40 60 20 nicht einverstanden 11 26 63 13 31 56 13 41 46
i
grosse Mehrheit+Mehrheit weiss nicht/keine Antwort Quelle: GfS 2002 19922000 199220002002 2002 0 100 80 40 60 20 Minderheit+kleine Minderheit 2 4 9 9 20 1916 10 79 80 81 32 9 59 57 52 39 23
n %
■ Akzeptanz des Strukturwandels
Bei der Frage nach dem Strukturwandel zeigt sich eine Auf-und-Ab-Bewegung. Bis Mitte der neunziger Jahre war in der Bevölkerung eine abnehmende Akzeptanz zu verzeichnen Danach wurde wieder ein Anstieg festgestellt, welcher 2000 einen Höchststand erreichte. 36% der Befragten waren damals der Meinung, dass ein Teil der Betriebe aufgegeben werden sollte, damit die verbleibenden Betriebe konkurrenzfähiger werden können 2002 ist dieser Anteil wieder gesunken Fast verdoppelt hat sich hingegen der Anteil der Unschlüssigen Diese Konstellation erschwert eine Interpretation der Ergebnisse
Ein Teil der landwirtschaftlichen Betriebe sollte aufgegeben werden, damit die verbleibenden Betriebe konkurrenzfähiger werden können
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 87
i n % einverstanden weiss nicht/keine Antwort Quelle: GfS 2002 1992 1994 20002002 1998 1996 0 100 80 40 60 20 nicht einverstanden 10 10 10 14 11 21 60 63 68 58 53 52 3027 2228 36 27
■ Relevanz für die Beurteilung der Sicherheit der Nahrungsmittel
Konsumverhalten
Das Marktforschungsinstitut IHA · GfM AG hat im Auftrag der BIOSUISSE, dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Basel und dem BLW eine repräsentative Befragung bei 500 Personen zum Thema Konsumenten/Konsumentinnen und Landwirtschaft durchgeführt Ziel der Befragung war es, mehr über das Verhalten von Konsumenten und Konsumentinnen bei der Auswahl und beim Kauf von Nahrungsmitteln zu erfahren
Bei der Befragung wurde das Thema Lebensmittelsicherheit angeschnitten Die befragten Personen erhielten eine Liste von Kriterien, welche einen Einfluss haben könnten auf die Sicherheit von Lebensmitteln Dabei bewerteten sie, wie relevant die Kriterien für die Beurteilung der Nahrungsmittelsicherheit für sie sind, ohne dabei aber eine positive oder negative Wertung anzufügen. Mehr als jede zweite Person erachtet den Einfluss des Einsatzes von Antibiotika (63%) und von genetisch veränderten Mikroorganismen (56%) als hoch Etwas über 30% glaubt, dass die schweizerische Herkunft von Lebensmitteln relevant sei für die Sicherheit von Lebensmitteln
Einfluss verschiedener Faktoren auf die Unbedenklichkeit bzw. Sicherheit von Nahrungsmitteln
Einsatz von Antibiotika
Einsatz von genetisch veränderten Mikroorganismen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
BSE-Kontrollen
Produkt stammt direkt vom Hof Keimfreiheit (frei von Bakterien und Mikroorganismen)
Produkt stammt aus der Schweiz
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 88
in % der Antworten «Einfluss hoch» 0 10 20 30 40 50 60 70 Quelle: BLW/ BIOSUISSE /ISPM
■ Einkaufen von tiergerecht produzierten Lebensmitteln
Gemäss der Umfrage achten 38% der Befragten beim Kauf von Fleisch immer bzw. meistens auf tiergerechte Haltung und Fütterung Jede fünfte Person achtet hingegen nie darauf
Beachtung der tiergerechten Haltung und Fütterung beim Einkaufen
■ Einkauf von sozial verträglich hergestellten Produkten
Quelle: BLW/BIOSUISSE/ISPM
20% der Befragten geben an, immer bzw. meistens sozial verträglich hergestellte Produkte einzukaufen 31% achten nie darauf
Beachtung der sozial verträglichen Produktionsarten beim Einkaufen
Quelle: BLW/BIOSUISSE/ISPM
1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 89
nie 20% manchmal 23% meistens / immer 38% selten 19%
nie 31% manchmal 25% meistens / immer 20% selten 24%
■ Einkauf von regionalen Produkten
Drei Viertel der Befragten geben an, immer, meistens oder manchmal Produkte zu kaufen, die in der Region hergestellt worden sind Dabei spielt die Kennzeichnung eine entscheidende Rolle (57%) Je knapp 30% kaufen ihre regionalen Produkte auf dem Bauernhof und auf dem regionalen Markt.
Beachtung der Herkunft (eigene Region) beim Einkaufen

1 . 2 S O Z I A L E S U N D G E S E L L S C H A F T 1 90
Quelle: BLW/BIOSUISSE/ISPM nie 8% manchmal 46% meistens / immer 29% selten 17%
1.3 Ökologie und Ethologie
Die Landwirtschaft und die Umwelt sind eng miteinander verbunden. Die Beziehungen sind vielschichtig und komplex Da die Landwirtschaft einen bedeutenden Teil des schweizerischen Territoriums nutzt, spielt der Agrarsektor im Ökosystem des ländlichen Raums eine zentrale Rolle Die Aufgaben und Verantwortung der Landwirtschaft bestehen nicht nur in der Herstellung von Lebensmitteln, sondern auch in der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Pflege der Kulturlandschaft
In den beiden ersten Agrarberichten wurde mit Hilfe von Indikatoren über die ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik informiert. Darin eingeschlossen waren auch die Indikatoren, welche über das Verhalten gegenüber Nutztieren und über das Tierwohl Auskunft gaben Neu werden Ökologie und Ethologie (Verhaltensforschung) separat behandelt. Der Abschnitt 1.3.1 vermittelt Informationen zu den ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik, Abschnitt 1 3 2 befasst sich mit der Entwicklung der Programme für die besonders artgerechte Tierhaltung und mit dem Tierwohl

■■■■■■■■■■■■■■■■
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 91
1.3.1 Ökologie
Die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit in den verschiedenen Umweltbereichen lassen sich mittels agrarökologischer Indikatoren beobachten Diese beruhen einerseits auf Modellen, welche die künftige Entwicklung von Umweltparametern aufzeigen, anderseits auf Beobachtungen und Messungen, mit denen die Auswirkungen landwirtschaftlicher Tätigkeiten in der Umwelt ermittelt werden
In den beiden ersten Agrarberichten gab es Informationen über alle Bereiche des Landwirtschaft-Mensch-Umwelt-Systems Neu sollen nur noch die Entwicklungen beim Einsatz von Produktionsmitteln wie z.B. Dünger, Pflanzenschutzmittel und bei der Bodennutzung wie z B Anteil der Ökoausgleichsflächen an der LN jährlich aufgezeigt werden Im Mittelpunkt der Berichterstattung werden neu Themenbereiche stehen, die im Rhythmus von vier Jahren behandelt werden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
– Phosphor und Boden (2002)
Energie und Klima (2003)
– Stickstoff und Wasser (2004)

– Biodiversität und Landschaft (2005)
Mit diesem Vorgehen kann vertieft auf die einzelnen Themenbereiche eingegangen werden. Dabei werden einerseits agrarökologische Indikatoren als Informationsbasis dienen, anderseits aber auch Ergebnisse von Studien Im vorliegenden Bericht geht es um die Themen Phosphor und Boden
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 92 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
Weiterentwicklung der agrarökologischen Indikatoren
Die agrarökologischen Indikatoren sind die Basis für die Beurteilung der ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik. Dabei werden drei Arten von Indikatoren unterschieden:
Die Indikatoren zur landwirtschaftlichen Praxis werden direkt von den Landwirtinnen und Landwirten beeinflusst Sie bilden die Triebkraft des Systems und umfassen die Produktionsmittel (Dünger, Pflanzenschutzmittel, usw ), Tierarzneimittel sowie die Bodennutzung (Kulturen und Produktionsmethoden) – Mit den Indikatoren zu den landwirtschaftlichen Prozessen werden die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Praxis auf die Umwelt anhand von Modellen analysiert Es handelt sich dabei um den Einfluss, der durch die Bewirtschaftung auf die Umwelt ausgeübt wird und dort unerwünschte oder günstige Veränderungen zeitigt. Diese Indikatoren ermöglichen eine Einschätzung der potenziellen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt und somit eine Beurteilung der Agrarpolitik im Ganzen
– Die Indikatoren zum Zustand der von der Landwirtschaft beeinflussten Umwelt ergeben sich aus konkreten Beobachtungen und Messungen Hier geht es also nicht um einen potenziellen, sondern um einen effektiven Zustand, der aus vergangenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten resultiert.
Die agrarökologischen Indikatoren lassen sich auch nach Themenbereichen ordnen Diese Aufteilung ist allerdings nicht starr, da einzelne Indikatoren mehrere Bereiche betreffen können Sie gibt aber eine bessere Gesamtübersicht Die Begleitgruppe «Umweltaspekte der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft» hat mehr als dreissig Indikatoren ausgewählt Prioritär werden dabei die in der Übersicht dargestellten Indikatoren behandelt Dazu zählen die sechs von der Begleitgruppe als Schlüsselindikatoren zur Beurteilung der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit ausgewählten Indikatoren Diese sollen in die Beurteilung der Nachhaltigkeit in Abschnitt 1 4 einfliessen Mit Hilfe dieser Indikatoren lässt sich verfolgen, wie die Landwirtschaft die Umweltqualität beeinflusst und wie sich der Umweltzustand verändert Sie erlauben auch, Problembereiche frühzeitig zu identifizieren und können als Basis bei der Wahl neuer Instrumente dienen
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 93
–
Übersicht über agrarökologische Indikatoren
Themenbereiche
Stickstoff
Landwirtschaftliche
Praxis
N-Bilanz der Landwirtschaft
Umweltauswirkungen
N-Verlustpotenzial (Nitrat-, Ammoniak- und Lachgasemissionen)
Ammoniakemissionen
Umweltzustand
Nitratbelastung des Grundwassers aus der Landwirtschaft
Phosphor
Energie/Klima
P-Bilanz der Landwirtschaft
P-Gehalt der Böden
P-Belastung der Seen aus der Landwirtschaft
Wasser
Energieverbrauch in der Landwirtschaft Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln
Verbrauch von Tierarzneimitteln
Energieeffizienz
Treibhausgasemissionen (CO2, Methan, Lachgas)
Nicht realisierbar
Boden
Biodiversität/ Landschaft
Noch offen
Ökologische Ausgleichsflächen (inkl Qualität) 1
Risiko von aquatischer Ökotoxizität Erosionsrisiko
Potenzielle Auswirkungen landwirtschaftlicher Aktivitäten auf die Biodiversität 1
■■ Schlüsselindikatoren zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft
Belastung des Grundwassers durch Pflanzenschutz
Noch offen
Noch offen
Vielfalt der Wildarten
Vielfalt der Lebensräume und Landschaften: noch offen
1 Der Schlüsselindikator für die Biodiversität («ökologische Ausgleichsflächen» oder «Potenzielle Auswirkungen landwirtschaftlicher Aktivitäten auf die Biodiversität») wird erst endgültig bestimmt, wenn Letzterer besser umschrieben ist
Mit der Wahl und der Definition der Indikatoren ist die Arbeit noch nicht zu Ende Bei einigen Indikatoren sind noch Methoden zu entwickeln, damit die Indikatoren in Kennziffern ausgedrückt werden können; bei anderen fehlen die statistischen Grundlagen. Diese Arbeiten werden in nächster Zeit weiter vorangetrieben
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 94
Bodennutzung und Produktionsmittel
Bodennutzung und Produktionsmittel sind Grunddaten, die für die Berechnung zahlreicher Indikatoren gebraucht werden. Sie ermöglichen grobe, aber leicht kommunizierbare Angaben über das Entwicklungspotenzial der landwirtschaftlichen Umwelt-

1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 95 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
einwirkungen Entwicklung des Anteils der Fläche mit umweltschonender Bewirtschaftung i n % d e r L N i n % ( 1 9 9 3 = 1 0 0 % ) umweltschonende Bewirtschaftung1 davon Bio Quelle: BLW 1 1993 bis 1998: IP+Bio, ab 1999: ÖLN 19931994 1995 1999 2000 2001 1997 1998 1996 0 100 600 400 200 0 80 60 40 20 umweltschonende Bewirtschaftung1 (Index 1993 = 100) davon Bio (Index 1993 = 100) +411% +385% Entwicklung der ökologischen Ausgleichflächen 1 i n 1 0 0 0 h a i n % ( 1 9 9 2 = 1 0 0 % ) Quelle: BLW 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume 1992 1993 1994 1995 19992000 2001 1997 1998 1996 0 100 350 300 250 200 150 100 50 0 80 60 40 20 +221%
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 96 Entwicklung des Tierbestandes i n 1 0 0 0 G V E 1 i n % ( 1 9 9 0 = 1 0 0 % ) Rindvieh übrige Quelle: BFS 1 GVE: Grossvieheinheit 19901996 1999 2000 2001 1998 1997 0 1 600 1 200 800 400 100 80 60 40 20 0 Schweine Total GVE (Index) -8% Entwicklung der Kraftfutterimporte i n 1 0 0 0 t i n % ( 1 9 9 0 = 1 0 0 % ) Quelle: SBV 199019911992 1993 1997 1998 1999 2000 1995 1996 1994 0 400 500 200 150 100 50 0 300 200 100 2001 +89% Entwicklung des Mineraldüngerverbrauchs i n 1 0 0 0 t i n % ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 % ) N (Fracht) P205 (Fracht) Quelle: SBV 1990/92 1994 2000 1998 1996 0 80 70 100 80 60 40 20 0 60 50 30 40 20 10 N (Index) P205 (Index) -71% -23%
Mit Ausnahme der Kraftfutterimporte, deren Zunahme wohl auf das Verbot des Tiermehls in der Fütterung zurückzuführen ist, sinken die Inputs seit 1990 deutlich. Umweltfreundliche Produktionssysteme und der ökologische Ausgleich hingegen haben in den neunziger Jahren stark zugenommen In den letzten Jahren haben sich die Zuwachs- resp Abnahmeraten zusehends abgeschwächt

1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 97
i n t i n % ( 1 9 9 0 = 1 0 0 % ) Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie 19901992 1994 2000 2001 1996 1998 0 2 500120 80 100 60 40 20 0 1 000 1 500 2 000 500 -32%
Entwicklung des Pflanzenschutzmittelverkaufs
■ P wichtig für Pflanzenwachstum
Phosphor
Phosphor (P) kommt in Spuren überall in der Natur vor In höheren Konzentrationen findet man P aber nur in natürlichen Lagerstätten. Etwa drei Fünftel der abgebauten P-Vorkommen sind Meeresablagerungen, mehr als ein Fünftel ist vulkanischen Ursprungs und ein kleiner Rest ist Guano, also Vogelexkremente Der grösste Teil des P-Verbrauchs entfällt auf Dünge- und Futtermittel und ein Teil auf Waschmittel (P wurde in den letzten 20 Jahren weitgehend durch andere Stoffe ersetzt) Nach Angaben des U S Geological Survey wird der jährliche Abbau von Phosphaterz auf 140 Mio t geschätzt, die Reserven auf 12 Mrd t Erz Daraus lässt sich eine Lebensdauer der Reserven von rund 85 Jahren ableiten P ist die Achillesferse der weltweiten Versorgung mit Pflanzennährstoffen.
P ist ein Hauptnährstoff der Pflanzen P-Verbindungen spielen bei den wichtigsten biologischen Vorgängen, nämlich beim Aufbau der Erbsubstanz, bei der Zellteilung und den enzymatischen Stoffwechselvorgängen (z B bei der Energieübertragung) eine entscheidende Rolle
Eine gute P-Versorgung der Böden ist wichtig, um gute Erträge von einwandfreier Qualität zu erbringen P-Mangel wirkt sich in der Landwirtschaft, z B durch gehemmtes Pflanzenwachstum, schwache Wurzelbildung und verzögerte Blüte und Reife aus. Während Jahrhunderten war die P-Versorgung der Böden in der europäischen Landwirtschaft äusserst mangelhaft In einer Arbeit von 1916 (Tätigkeitsbericht, agrikulturchemische Anstalt Bern) wird berichtet, dass 90% der untersuchten Kulturböden P-bedürftig seien Während den grossen Kriegen im letzten Jahrhundert machte sich der Mangel an P-Düngern in der schweizerischen Landwirtschaft deutlich bemerkbar. Heute herrscht in den Tropen immer noch ein akuter P-Mangel. In vielen Teilen der industrialisierten Welt hingegen sind viele Böden dank jahrzehntelanger intensiver Zufuhr von mineralischen P-Düngern sehr gut mit P versorgt und es werden Wege gesucht, um das Übermass an P in Böden und Gewässern abzubauen. Ein P-Überschuss im Boden kann sich – wenn überhaupt – nur im Extremfall negativ auf Pflanzen auswirken
■ P in Gewässern problematisch
Auch im Wasser bestimmt das Nährstoffangebot das Pflanzen- (hier vor allem das Algen-) wachstum In den schweizerischen Seen ist P der Minimumfaktor, also derjenige Nährstoff, der das Algenwachstum begrenzt Während in der Landwirtschaft ein hoher Ertrag mehr Nahrung für Tier und Mensch bedeutet, der geerntet und abgeführt wird, wirkt sich das zunehmende Algenwachstum im Wasser negativ aus Diese Algenmasse wird nur sehr begrenzt aus dem Kreislauf entfernt (Abflüsse, Fischertrag) Überschüssiges, abgestorbenes Pflanzenmaterial sinkt auf den Seegrund ab und wird durch Bakterien und Pilze unter Verbrauch von Sauerstoff abgebaut In einem nährstoffreichen See kann dies in der Tiefe zu einem vollständigen Sauerstoffverbrauch führen Auf diese Weise wird der Lebensraum für alles höhere Leben eingeschränkt Der aus den zersetzten Algen stammende P wird durch die alljährliche herbstliche Seewasserumwälzung wieder gleichmässig im See verteilt.
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 98
■ P-Einträge in die Gewässer

Wie gelangt P in die Seen? Es gibt grundsätzlich zwei Eintragswege: Der Eintrag aus Punktquellen (Kläranlagen, Haushalte und Industrie), welcher an einem Punkt erfasst werden kann, und der Eintrag aus diffusen Quellen (z B Landwirtschaft, Wald, Atmosphäre), welcher nicht an einem Punkt erfassbar ist. In der Mitte des letzten Jahrhunderts waren es vor allem die ungeklärten Abwässer aus den Siedlungen, die zu einer Anreicherung der Oberflächengewässer mit P und organischer Substanz und damit zu dramatischen Auswirkungen auf die Qualität der Gewässer führten Seit über 95% der Abwässer von Haushalten, Industrie und Gewerbe in Kläranlagen behandelt und insbesondere der darin enthaltene P zu einem sehr hohen Grad daraus entfernt wird, ist die Belastung durch diese Quellen deutlich zurückgegangen Bezogen auf die Gesamteinträge an P in die Oberflächengewässer ist die Fracht aus Abwässern hingegen immer noch fast dreimal so hoch wie diejenige aus diffusen Quellen.
70% der P-Einträge aus diffusen Quellen stammen gemäss einer Untersuchung der FAL aus Oberflächenabfluss durch Abschwemmung auf Grasland (zwei Drittel der Fracht) sowie aus Abschwemmung und Bodenerosion auf Ackerland (ein Drittel der Fracht) Allein die zwischen 1990 und 2000 in die Landwirtschaft eingebrachten PÜberschüsse haben zu einer P-Anreicherung in landwirtschaftlichen Böden von über 140‘000 t P geführt Diese P-Vorräte stellen eine latente Gewässergefährdung dar Einerseits wird bei Oberflächenabfluss auf Grasland P gelöst und abgeschwemmt, anderseits kann mit Bodenerosion P-reicher Oberboden in die Gewässer gelangen Dieser Erosionsprozess kann durch bodenschonende Bewirtschaftung und eine dauernde Bodenbedeckung vermindert werden. Die restlichen 30% der P-Einträge stammen aus verschiedenen diffusen Quellen Dazu gehören: Die Deposition aus der Atmosphäre direkt auf Oberflächengewässer, die Auswaschung aus dem Bodenprofil, der Direkteintrag durch Abschwemmung von Hofflächen, Weidetrieb auf Strassen sowie Düngeraustrag entlang von Oberflächengewässern und Strassen
■ Ökologische Bedeutung der P-Einträge
In den Fliessgewässern entstehen durch die gemessenen und seit 20 Jahren stark rückläufigen P-Konzentrationen heute keine bedeutende ökologischen Probleme. Indirekt jedoch haben auch sie eine unerwünschte Umweltwirkung, nämlich in den Meeren, wohin diese P-Frachten transportiert werden Dort können sie ähnlich wie in Seen u a zu übermässigem Algenwuchs beitragen 1990 haben die Minister der Nordseeanrainerstaaten sowie der Schweiz u a das Ziel festgelegt, den Eintrag von P in die Nordsee – gemessen am Eintrag 1985 – bis 2000 um 50% zu senken Alle Staaten, ausser Schweden, haben dieses Ziel erreicht oder übertroffen (Schweiz: – 61%)
Nicht überall gelöst ist aber das Problem der Belastung der Seen durch P in der Schweiz Nachdem in den meisten Seen in den siebziger Jahren maximale P-Konzentrationen im Seewasser auftraten, sind in der Zwischenzeit durch baulichen Gewässerschutz (Abwasserreinigungsanlagen), das Phosphatverbot für Textilwaschmittel (1986) und die Ökologisierung der Landwirtschaft grosse Fortschritte erzielt worden Die PGehalte im Wasser der meisten Seen haben massiv abgenommen Heute sind es (ohne die Berücksichtigung kleiner Gewässer) in erster Linie die mittelgrossen Mittellandseen Baldeggersee, Hallwilersee, Sempachersee, Zugersee und Greifensee, welche noch ökologische Störungen durch zu hohe P-Gehalte im Seewasser und immer noch zu hohe P-Einträge aufweisen Das Problem verschiebt sich also auf die regionale Ebene
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 99 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Zur Lösung des Problems gibt es zwei Möglichkeiten: See-interne und -externe Massnahmen See-interne Massnahmen (Tiefenwasserableitung, Einleiten von wenig belastetem Wasser, künstliche Hilfe bei der Zirkulation des Seewassers und Sauerstoffeintrag ins Tiefenwasser) wurden bisher mit Erfolg eingesetzt. Ohne vorgängige Sanierung des Einzugsgebiets haben sie aber keinen dauerhaften Erfolg und zehren ständig an den finanziellen Ressourcen Ein dauerhafter Erfolg setzt See-externe Massnahmen voraus Dabei müssen die aus dem Einzugsgebiet des Sees stammenden Belastungen minimiert werden Dazu gehören u a das möglichst weitgehende Fernhalten von ungeklärtem Abwasser und die Reduktion des P-Eintrags aus landwirtschaftlich genutzten Böden Nachdem die Massnahmen ausserhalb der Landwirtschaft weitgehend vollzogen wurden, konzentriert sich die Problemlösung zunehmend auf die Landwirtschaft in tierintensiven Regionen.

Entwicklung der P-Einträge in Gewässer aus verschiedenen Quellen
Nachfolgend werden verschiedene Aspekte, die im Zusammenhang mit P stehen, vertieft behandelt. Dabei werden zunächst Informationen über den Einsatz von P in der landwirtschaftlichen Praxis, anschliessend über die Wirkung auf die Umwelt und schliesslich über den Umweltzustand vermittelt
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 100
i n t / J a h r 19851999/2000 Quelle:
kommunale Abwasserreinigungsanlagen (ARA) Diffuse Quellen (v a Landwirtschaft) Industrie und nicht an ARA angeschlossene Haushalte 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Fifth Int Conf. Protection North Sea
■ Internationaler Vergleich
Aus der Entwicklung des P-Mineraldüngerverbrauchs im internationalen Vergleich lassen sich zwei Hauptaussagen ableiten: In Europa (ausser Irland) nimmt die eingesetzte Menge P-haltiger Mineraldünger pro ha deutlich ab Unter den ausgewählten Ländern weist die Schweiz einen der geringsten Inputs pro ha und eine der stärksten Abnahmen auf In den USA und in Australien ist die Entwicklung gegenläufig; der PMineraldüngerverbrauch steigt Allerdings ist der Düngeraustrag (Mineral-, Hof- und Abfalldünger) pro ha in diesen Ländern viel geringer als in Europa
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 101 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1 Quellen: FAO, OECD 1 Mineraldünger Klärschlamm und Kompost 1985 1990 1995 1999 Dänemark Deutschland Schweiz Österreich Frankreich EU Niederlande Irland USA Australien 15,0 24,4 15,3 15,6 32,3 24,9 30,1 22,9 9,4 2,1 - 61% - 60% -43% -39% -34% -32% -27% -4% +5% +44% kg P2O5 / ha LN (1999) 0 2550 75 100 125 in % (1985 = 100%) 150
Enwicklung des Verbrauchs an Phosphatdüngern
Eine wichtige Grösse zur Beurteilung des P-Einsatzes in der Landwirtschaft ist die Entwicklung des Tierbestandes Die Schweiz weist im internationalen Vergleich eine relativ hohe Viehdichte auf, welche dazu führt, dass rund drei Viertel des gesamten PDüngereinsatzes in der Landwirtschaft aus Hofdüngern stammen. Dazu kommt, dass die Tierhaltung in den beiden Regionen Zentralschweiz (Luzern, Nid- und Obwalden, Zug) und Ostschweiz (beide Appenzell, St Gallen, Thurgau) besonders stark verbreitet ist

Entwicklung der GVE nach Landwirtschaftszonen
Die Tierbestände, ausgedrückt in GVE, haben von 1990 bis 2001 gesamthaft abgenommen Diese Entwicklung betrifft alle Zonen ausser die Bergzone IV In einigen Zonen, insbesondere in der Talregion, sind die Tierzahlen zwischen 1996 und 2001 nicht mehr zurückgegangen Insgesamt war der Rückgang der Tierbestände in der ersten Hälfte der neunziger Jahre etwas stärker als in der zweiten Hälfte
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 102
i n G V E 19901996 2001 Quelle: BFS In Klammern: Durchschnitt der Zonen 2000 (GVE /ha) 0 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 A c k e r b a u z o n e ( 0 , 9 ) E r w e i t e r t e Ü b e r g a n g s z o n e ( 1 , 2 ) Ü b e r g a n g s z o n e ( 1 , 7 ) H ü g e l z o n e ( 1 , 4 ) B e r g z o n e I ( 1 , 4 ) B e r g z o n e I I ( 1 , 2 ) B e r g z o n e I I I ( 1 , 0 ) B e r g z o n e I V ( 0 , 9 )
■ Tiere liefern drei Viertel des P-Düngers
Entwicklung der GVE nach Kantonen
Total 1990
Schweine/Geflügel 1996 Schweine/Geflügel 2001
in GVE
Rindvieh/Schafe/Ziegen 1996

Rindvieh/Schafe/Ziegen 2001
Quelle: BFS in Klammern: Kantonsdurchschnitt 2000 (GVE/ha)
Zwischen den Kantonen lassen sich Unterschiede bei der Entwicklung der Tierzahlen feststellen Gegenüber 1990 hat die Anzahl GVE fast überall abgenommen Die Kantone mit den grössten Abnahmen seit 1990 sind: UR (–14%), ZH und OW (je –13%) Die Kantone mit einer Tierdichte von über 1,5 GVE/ha im Jahr 2000 haben die Tierzahlen gegenüber 1990 um 6% (LU) bis 13% (OW) reduziert
Seit 1996 hat in den meisten Kantonen der Gesamttierbestand ebenfalls abgenommen, wobei die Anzahl Schweine in fast allen Kantonen in derselben Zeit zugenommen hat. Im Kanton Luzern, dem tierintensivsten Kanton, hat der Schweinebestand seit 1996 um 10’000 GVE zugenommen
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 103 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
LU (1,8) AI (1,8) NW (1,8) OW (1,8) SG (1,6) TG (1,6) ZG (1,5) AR (1,5) SZ (1,4) UR (1,3) FR (1,3) BE (1,2) GL (1,1) AG (1,1) SO (1,0) GR (1,0) ZH (0,9) BS/BL (0,9) JU (0,9) TI (0,8) NE (0,8) VD (0,7) VS (0,7) SH (0,7) GE (0,2)
040
000120 000160 000200 000240 000280 000
00080
Viehdichte
Die Orientierungswerte entsprechen, nach dem heutigen Stand des Wissens, einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz Sie sind fixiert im Bericht «Harmonisierung des Vollzugs im Gewässerschutz» zuhanden der Landwirtschaftsdirektoren. In den meisten Kantonen liegen die effektiven Werte in allen Zonen unter diesen Orientierungswerten In einigen Kantonen sind sie in gewissen Zonen darüber Dies zeigt, dass die kantonalen Durchschnittszahlen oft Unterschiede innerhalb der Kantone verdecken.
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 104
Orientierungswerte 1 2,5 2,5 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 1,1 ZH 0,7 0,9 1,2 1,3 1,3 1,0 0,7 BE 1,2 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 LU 1,6 2,1 1,9 1,8 1,5 1,0 0,8 UR 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 SZ 2,0 1,7 1,6 1,2 1,0 0,9 OW 2,4 2,5 1,8 1,6 1,2 1,2 NW 3,4 2,0 2,0 1,4 1,0 0,9 GL 1,7 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 ZG 1,8 1,8 1,3 1,2 FR 1,0 1,2 1,4 1,6 1,5 1,3 1,3 SO 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 BS 0,5 1,1 BL 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 SH 0,7 0,9 0,6 0,7 AR 1,4 1,6 1,5 AI 1,8 1,9 SG 1,9 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 GR 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 0,9 AG 0,9 1,2 1,5 1,1 1,2 TG 1,1 1,7 1,9 2,1 1,4 1,3 TI 0,8 0,7 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 VD 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 VS 0,6 0,4 0,4 1,0 0,6 0,7 0,9 0,8 NE 0,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 GE 0,3 JU 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,7
nach Kantonen und Zonen 2000
Acker- Erweiterte Übergangs- Hügelzone Bergzone Bergzone Bergzone Bergzone bauzone Übergangs- zone I II III IV zone
1 vgl Bericht «Harmonisierung des Vollzugs im Gewässerschutz, 1995» Quelle: BFS
Tierbesatz nach Betriebsgrösse 2001

Vor allem in kleinen Betrieben mit einer LN von weniger als 3 ha findet sich ein relativ hoher Anteil an Betrieben mit einem Tierbesatz von über 2,5 GVE/ha Je grösser die Betriebe sind, um so seltener weisen sie einen Tierbesatz über diesem Wert auf
Um den Austrag von Gülle zu ungünstigen Zeiten zu vermeiden, wurden in den Kantonen Mio von Kubikmetern Güllegrubenvolumen erstellt
GVE-Anteil am gesamten Tierbestand der Schweiz Deckung des Bedarfs an Güllegrubenvolumen
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 105 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
A n z a h l B e t r i e b e < 0,5 GVE/ ha 1,51–2,5 GVE/ ha 0,51–1,5 GVE/ ha > 2,5 GVE/ ha Quelle: BLW 0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Betriebsgrösse in ha < 33–9,9 10–19,9 20–29,9 ≥ 30
Lagerkapazität für Gülle Deckung des Bedarfs an Güllegrubenvolumen B e d a r f s d e c k u n g i n % G V EA n t e i l i n %
■
Quelle: BUWAL 1 Keine Daten verfügbar BE LU SG 1 FR VD ZH TGAGGR SZ SO JU 0 200 150 100 50 20 15 10 5 0 19 11 10 8 7 6 6 6 4 333
Bei den Kantonen mit einem Anteil von 3% oder mehr am gesamten Tierbestand der Schweiz sind Unterschiede festzustellen bei der Deckung des Bedarfs an Güllegrubenvolumen So haben die Kantone Thurgau und Bern deutlich mehr als die erwünschten 100% abgedeckt, andere Kantone rund 100%. In einigen Kantonen deckt das vorhandene Volumen den Bedarf noch nicht Der Bedarf wird durch die Kantone selbst festgelegt, basierend auf der vom Kanton festgelegten Mindestlagerdauer nach Höhenlage des Betriebes Im Mittel aller Kantone, die auf eine entsprechende Umfrage des BUWAL geantwortet haben, besteht in der Schweiz genügend Güllegrubenvolumen Insgesamt fehlen aber für rund 20% des Tierbestandes in der Schweiz solche Angaben Es ist aufgrund dieser Angaben nicht möglich, die Anzahl Betriebe zu nennen, die nicht genügend Güllegrubenvolumen besitzen
Mit einer angepassten Fütterung ist es möglich, einen Beitrag zur Reduktion der PEinträge in die Böden zu leisten. So setzen die Schweinehalter heute bei der Fütterung vermehrt N- und P-reduzierte Futtermittel ein

10 8 6 4 2
■ 7,77,1 7,9 7,9 5,65,9 4,14,4 1990 1993 2000 ohne Phytase 2000 mit Phytase
g P / k g F u t t e r Mastschweinealleinfutter Zuchtschweinealleinfutter Quelle: RAP
0
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 106
Praxiserhebungen der RAP zeigen, dass der P-Gehalt in Futtermitteln, welche die Schweinehalter verwenden, in den neunziger Jahren deutlich abgenommen hat, nachdem er in den achtziger Jahren mit gewissen Schwankungen gleich geblieben ist Beim Mastschweinealleinfutter liegt der Mittelwert heute nur noch leicht über dem empfohlenen Angebot von 4,8 g P/kg Futter ohne bzw 4,0 g P/kg mit Phytase (Enzym, das den im Futtermittel enthaltenen P leichter verfügbar macht) Die Extremwerte der gefundenen Gehalte lagen zwischen 8,5 g P/kg Futter im Maximum und 3,3 g P/kg bei Futtermitteln mit Phytase im Minimum Dies zeigt, dass es noch einen gewissen – aber kleinen – Spielraum für weitere Absenkungen des P-Gehalts in Mastschweinealleinfutter gibt. Beim Zuchtschweinealleinfutter sind die P-Gehalte in einem vergleichbaren Ausmass zurückgegangen Die tiefsten gemessenen Werte von 3,6 g P/kg Futter mit Phytase zeigen, dass man vereinzelt in einem Bereich liegt, in welchem eine korrekte Deckung des P-Bedarfs nicht mehr garantiert ist Auch hier gibt es aber Extremwerte von bis zu 8,0 g P/kg Futter ohne Phytasezusatz, was zeigt, dass auch hier noch ein gewisser Spielraum für Verbesserungen besteht. Fütterung Entwicklung des P-Gehalts im Schweinealleinfutter 19841988
■ P-Bilanz und P-Effizienz
Nicht bekannt ist die Gesamtmenge an P, die an Schweine verfüttert wird. Aus diesem Grund kann nicht endgültig beurteilt werden, ob der Eintrag von P in den Boden in diesem Bereich rückläufig ist Eine Abnahme ist insbesondere in Gebieten mit einer hohen Schweinedichte entscheidend, damit das Risiko des P-Eintrags in die Oberflächengewässer reduziert werden kann
Die P-Bilanz errechnet sich aus der Differenz der Zufuhr in die Landwirtschaft minus der Wegfuhr von P aus der Landwirtschaft Diese wird wie ein Betrieb betrachtet Die Zufuhr umfasst importierte Futtermittel, Mineral- und Abfalldünger, das importierte Saatgut und die Depositionen aus der Luft Die Wegfuhr setzt sich aus den pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln und anderen Produkten zusammen, welche die Landwirtschaft verlassen
Entwicklung des P-Überschusses und der P-Effizienz in der schweizerischen Landwirtschaft
Die Berechnung des P-Überschusses zeigt eine starke Abnahme zwischen 1980 und 2000, welche vor allem auf den gesunkenen Mineraldüngerverbrauch zurückzuführen ist Der markante Sprung von 1995–1996 ist durch einen Anstieg der Betriebe zu erklären, die die Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises (damals Programm Integrierte Produktion) erfüllen Nachdem das Ziel einer 50%-igen Reduktion gegenüber den Referenzjahren 1990/92 bereits 1996 erreicht worden war, lag der Überschuss im Jahr 2000 mit 7'200 t schon beträchtlich unter der Zielgrösse von 9'500 t. Trotzdem war die P-Bilanz immer noch positiv, was eine weitere Anreicherung von P im Boden bedeutet Ein höherer P-Gehalt im Oberboden ist bei gleich bleibender Bewirtschaftung mit dem Risiko höherer P-Verluste über Abschwemmung, Erosion und Auswaschung verbunden. Deshalb ist eine weitere Verringerung des P-Überschusses anzustreben
Die Effizienz des P-Einsatzes wird aus dem Verhältnis von P-Wegfuhr zu P-Zufuhr gemäss der P-Bilanz berechnet Dabei wird die Wegfuhr in Prozent der Zufuhr ausgedrückt. Ein Verhältnis von 1 würde eine 100%-ige Effizienz bedeuten. Es zeigt sich, dass die schweizerische Landwirtschaft sich diesem theoretischen Idealzustand stetig nähert, mit markanten Fortschritten in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre, ohne ihn jedoch erreicht zu haben.
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 107 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
19801982 1984 1986 198819901992 1994 1996 1998 2000 20022004 Bilanz Quelle: FAL Effizienz Ziel P-Bilanz 2005 0 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 i n t / J a h r O u t p u t / I n p u t 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
Entwicklung des Deckungsgrads des P-Bedarfs der landwirtschaftlichen Kulturen durch Düngung und Deposition
Der Deckungsgrad berechnet sich als Verhältnis von P-Einsatz (Hof-, Mineral-, Abfallund übrige Dünger) zum Bedarf der landwirtschaftlichen Kulturen Er zeigt, dass die Überdüngung in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist Während im Jahr 1980 fast doppelt soviel P eingesetzt wurde, wie für den produzierten Pflanzenertrag benötigt, betrug im Jahr 2000 der P-Überschuss noch rund 20% Somit nimmt auch der Gehalt der P-überdüngten Böden an Gesamtphosphor weniger stark zu bzw. dürfte in gewissen Fällen sogar abnehmen
Die relative Bedeutung des bodenbürtigen P (durch Erosion und Abschwemmung, in geringem Mass auch durch Auswaschung) beim Eintrag in die Oberflächengewässer hat gegenüber dem abwasserbürtigen P in gewissen Regionen stark zugenommen
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 108
198019811982 1983 1984 1985 1986 1987 19881989199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 19981999 2000 Quelle: FAL 0 200 250 150 100 50 i n % Entwicklung der jährlichen P-Zufuhr in den Sempachersee i n t i n % aus Abwasser bodenbürtig (vor allem Landwirtschaft) aus Niederschlag Quelle: Amt für Umweltschutz, Kanton Luzern 19541967 1976/77 1984/86 1986/88 1989/911992/97 0 18 16 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 14 12 10 6 8 4 2 aus Abwasser (%) bodenbürtig (%) aus Niederschlag (%) Ziel ■ P-Zufuhr in die Seen
Beim P-Eintrag in den Sempachersee ist seit Mitte der fünfziger Jahre eine deutliche Gewichtsverschiebung von P aus dem Abwasser zu bodenbürtigem P feststellbar Dies ist auf umfangreiche Abwassersanierungen in den Siedlungsgebieten zurückzuführen bei gleichzeitig starker Zunahme des bodenbürtigen P. Die P-Zufuhr nahm insgesamt von knapp 4,4 t Gesamtphosphor im Jahre 1954 auf knapp 19 t 1986/88 zu Seither ist sie auf knapp 15,3 t im Zeitraum 1993/97 zurückgegangen Beim bodenbürtigen P (überwiegend aus der Landwirtschaft stammend) ist eine Spitze im Jahr 1986/88 mit 16,1 t und bis 1992/97 ein Rückgang auf 10,3 t feststellbar Die Massnahmen für die weitere Sanierung des See-Einzugsgebiets stützen sich auf Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes Diese Programme wurden 1999 gestartet Das für den Sempachersee spezifische Ziel ist eine Begrenzung der bodenbürtigen P-Fracht auf maximal 8,6 t Eine ähnliche Entwicklung bei den P-Einträgen sowie beim P-Gehalt kann beim Baldeggersee beobachtet werden
Zur Beurteilung des Düngebedarfes wird in der Schweiz seit Anfang der dreissiger Jahre des letzten Jahrhunderts der Nährstoffgehalt (P, K) in landwirtschaftlichen Böden gemessen Bis Anfang der neunziger Jahre war das Gebiet der Schweiz für die Bestimmung des Düngebedarfes in drei Regionen aufgeteilt Die Ergebnisse dieser Regionen wurden von den zuständigen Forschungsanstalten ausgewertet. Aus den damaligen Untersuchungsresultaten ging eine deutliche Tendenz zur Überversorgung der Böden mit P hervor Eine weitergehende Analyse zeigte, dass der Anteil überversorgter Böden mit zunehmendem Tierbesatz stark ansteigt.
P-Versorgung der Böden im Gebiet Baldeggersee 1994–1998
Neuere Daten liegen aus dem Einzugsgebiet des Baldeggersees vor Es handelt sich um 1878 Bodenproben der Jahre 1994 bis 1998 (CO2-Wasserextrakt) Diese zeigen, dass in diesem tierintensiven Gebiet über 40% der Böden mit P überversorgt sind, auf Naturwiesen sind es gar über 60%
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 109 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ P im Boden
Fruchtfolgeflächen Naturwiesen A n z a h l B o d e n p r o b e n arm Vorrat mässig angereichert genügend Quelle: Fachstelle Ökologie, Sursee 0 600 500 400 300 200 100
Die P-Konzentrationen haben in praktisch allen Seen der Schweiz von 1980 bis 2000 deutlich abgenommen Die Abnahmen waren in den hochbelasteten Seen besonders ausgeprägt, lassen sich aber auch in den nur schwach belasteten Vierwaldstätter- und Neuenburgersee aufzeigen.
Die Landwirtschaft hat grosse Anstrengungen zur Reduktion der P-Belastung der Gewässer unternommen Der Erfolg ist aber in gewissen Regionen noch nicht ausreichend.

1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 110
■ P-Konzentrationen in Seen Entwicklung der P-Konzentrationen in Schweizer Seen 198019811982 1983 1984 1985 1986 1987 19881989199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 19981999 2000 2001 m g P / m 3 W a s s e r Sempachersee Neuenburgersee Quellen: BUWAL / Amt für Umweltschutz Kanton Luzern Vierwaldstättersee Baldeggersee 0 50 100 150 200 250 300 350 Greifensee Zugersee
Boden
Boden ist die Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanze und die Existenzbasis von Land- und Forstwirtschaft. Diese bewirtschaften zusammen zwei Drittel der Gesamtfläche der Schweiz, 26% sind landwirtschaftliche Nutzfläche (LN), 11% Alpweiden Die Sicherung und wo möglich Verbesserung der Ertrags- und Nutzungsfähigkeit des Bodens ist ein zentrales Anliegen der Agrarpolitik Dabei gibt es einerseits den quantitativen Aspekt, die landwirtschaftlich nutzbare Fläche in ihrer flächenhaften Ausdehnung zu erhalten Andererseits muss die Qualität des Bodens erhalten bleiben Agronomisch gesehen geht es vor allem um die Möglichkeit, regelmässig quantitativ und qualitativ gute Pflanzenerträge zu erbringen Da die Nahrungsmittelerzeugung der modernen Landwirtschaft in vielen westlichen Industrieländern den Bedarf der einheimischen Bevölkerung übertrifft, ist die Annahme weit verbreitet, Boden sei für die Landwirtschaft qualitativ und quantitativ zur Genüge vorhanden Dem ist aber nicht so:

– Die landwirtschaftlich genutzte Fläche pro Kopf der Erdbevölkerung hat abgenommen und wird weiter abnehmen
– Die Fruchtbarkeit des anbaufähigen Landes nimmt ab Von der Landfläche der Erde von rund 13'000 Mio. ha werden heute 4'600 Mio. ha (36%) als Acker- und Weideland genutzt Davon wurden laut GLASOD-Weltatlas 1990 1'200 Mio ha (27%) als (mindestens teilweise) degradiert klassifiziert
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den noch vorhandenen Boden in Umfang und Qualität zu erhalten und die Nahrungsmittelproduktion auf der pro Kopf sinkenden Fläche zu steigern
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 111 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1960197019801990 2000 2010 2020 i n h a Welt Schweiz Schätzungen Quelle: FAO 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Entwicklung der LN pro Einwohner
■ Verlust landwirtschaftlich nutzbarer Flächen
Der Verlust an landwirtschaftlichen Nutzflächen (inkl. Alpweiden) schreitet fort.
Jährlicher Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen 1979/85–1992/97 nach biogeografischen Regionen
Innert rund 12 Jahren haben die landwirtschaftlichen Nutzflächen gesamthaft um 482 km2 oder 3,1% abgenommen, das entspricht 76 m2 pro Minute Im Mittelland und im Jura geht der Verlust zu beinahe 100% auf den Bedarf an Siedlungsflächen zurück, in Graubünden und im Tessin erobert der Wald sein früher verlorenes Terrain zurück, während die Siedlungen nur relativ wenig Fläche beanspruchen Im Wallis und in den Voralpen sind die beiden Ursachen etwa gleichwertig
Wie lange reicht der Vorrat landwirtschaftlicher Nutzflächen bei gleich bleibendem Kulturlandverlust
Würde der jährliche Kulturlandverlust im gleichen Ausmass weitergehen, wären die landwirtschaftlichen Nutzflächen innert weniger Jahrhunderte vollständig aufgebraucht Während der Vorrat im Tessin nur noch für gut 100 Jahre reichen würde, würde der letzte m2 im Mittelland in knapp 400 Jahren verschwinden, im Jura in 600 Jahren
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 112
Quelle: BFS
Zunahme der Siedlungsflächen Zunahme der Waldflächen 3,14 km2 14,65 km2 8,22 km2 4,33 km2 4,71 km2 5,10 km2
Quelle: BFS
Schweiz: 380 Jahre 604 Jahre 388 Jahre 533 Jahre 423 Jahre 108 Jahre 188 Jahre
Vor diesem Hintergrund verstärkt das BLW sein Engagement im Bereich Boden. Mit dem Bodenkonzept wurde in den letzten zwei Jahren ein Instrument geschaffen, um die Wirkungen der Agrarpolitik und der landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf den Boden zu untersuchen und geeignete Massnahmen veranlassen zu können. Die Partner des BLW zur Erarbeitung dieses Instruments waren insbesondere die Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Zürich-Reckenholz (FAL) und die Forschungsanstalt für Pflanzenbau, Changins-Nyon (RAC)
Ein Boden ist fruchtbar, wenn er seine Funktionen den Standortverhältnissen entsprechend auch langfristig erfüllt
Im Bodenkonzept des BLW werden in einem ersten Schritt die Funktionen von Böden definiert Zu nennen sind z B die Funktion, als Speicher für Nährstoffe, für Wasser oder von Wärme zu dienen, Pflanzenmasse zu produzieren oder organische Substanz abzubauen. Dann werden messbare Bodeneigenschaften ausgewählt, welche für diese Bodenfunktionen von zentraler Bedeutung sind Um den Zusammenhang zwischen Bodenfunktionen und Bodeneigenschaften sichtbar zu machen, lassen sich die Bodenfunktionen und -eigenschaften in einer Matrix gegenüberstellen Darauf aufbauend wurde in einem ersten Bewertungsschritt beurteilt, wie stark sich mögliche Beeinträchtigungen der Bodeneigenschaften (z.B. Erosion, Bodenverdichtung, Versauerung oder Schadstoffeintrag) auf die Bodenfunktionen auswirken können Es zeigte sich, dass Gründigkeit, Gefügeaufbau und Gehalt an organischem Kohlenstoff diejenigen Bodeneigenschaften sind, die den potenziell umfassendsten Einfluss auf die Gesamtheit der Bodenfunktionen ausüben können
In einem zweiten Bewertungsschritt wurden die Auswirkungen landwirtschaftlicher Tätigkeiten auf die Bodenqualität beurteilt Bewertet wurden mögliche Auswirkungen einseitiger Bewirtschaftung auf der Basis von Betrieben, welche die geltenden ökologischen Auflagen und Bedingungen erfüllen, nicht jedoch extreme Fälle von Bewirtschaftungsfehlern Dies unter der Annahme, dass eine ungünstige Bewirtschaftung während 30 Jahren aufrecht erhalten bleibt. Zugleich wurde bewertet, wie stark eine daran anschliessende ebenfalls 30 Jahre andauernde möglichst bodenschonende Bewirtschaftung zur Regeneration von Bodenschädigungen beitragen könnte

Aufgrund der vorgenommenen Bewertung kann davon ausgegangen werden, dass – beim heutigen Stand der Technik bei allen Bodeneigenschaften erhebliche Beeinträchtigungen auftreten können;
– durch eine angepasste Bewirtschaftung aber auch grosse Regenerationsmöglichkeiten gegeben sind. Bodenschädigungen können vermieden werden, wenn dank der Fähigkeit des Betriebsleiters bzw der Betriebsleiterin die Bewirtschaftungsmassnahmen den jeweils gegebenen Bodenverhältnissen angepasst werden;
insbesondere der Bodenabtrag durch Erosion, die Verdichtung des Unterbodens sowie der Schadstoffeintrag auch bei bester landwirtschaftlicher Praxis mittelfristig nicht reversibel sind
–
■
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 113
Bodenkonzept
Bewertung der Bedeutung landwirtschaftlicher Bewirtschaftung für die Beeinträchtigung und Regeneration von Bodeneigenschaften
Bodeneigenschaften Schädigungs- Regenerations- Langfristiges potenzial 1 möglichkeit 1 Schädigungspotenzial 1
Gründigkeit - - - 0 !!! Erosion
Gefügeaufbau Oberboden - - - + + + 0
Gefügeaufbau Unterboden - - - + !! Verdichtung
Gefügestabilität - - + + 0
Menge und Diversität des Bodenlebens - - + + 0
Aktivität des Bodenlebens - - + + 0
Gehalt und Qualität des organisch gebundenen
Kohlenstoffs - - (-) + + (!)

Bodenreaktion - - - + + + 0
Speicherkapazität für Stoffe (KUK) 2 - - (-) + + (!)
Nährstoffgehalt - - - + + + 0
Salzgehalt - +0
Schadstoffgehalt
(z B Schwermetalle, - - - (+) !!(!) SchadstoffPAH 3 , PCB 4) eintrag
1 Die Benotung reicht für das Schädigungs- und Regenerationspotenzial auf einer Skala von 0 (= keine messbaren Auswirkungen) bis - - - (= starkes Schädigungsausmass), bzw + + + (= grosses Regenerationspotenzial); das langfristige Schädigungspotenzial wird durch 0 (= keine Gefährdung) bis !!! (= grosse Gefährdung) bewertet () bedeutet: entsprechender Wert ist zu halbieren
2 Kationenumtauschkapazität
3 Policyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
4 Polichlorierte Biphenyle
Quelle: BLW
Der bodenkundliche Teil des Konzepts wurde auch angewendet, um abzuklären, in welchem Ausmass es in der Schweiz durch den Menschen verursachte Bodenbelastungen gibt Dabei wurde zwischen Beeinträchtigungen auf einzelnen Standorten (wenige Aren) und grossflächigen Bodenbelastungen (auf mehr als 1000 ha) unterschieden Es zeigte sich, dass
– bei allen Bodeneigenschaften an einzelnen Standorten erhebliche Bodenschädigungen bekannt sind;
– es zu grossflächigen Bodenbelastungen hingegen nur wenige gesicherte Angaben gibt. Es wird geschätzt, dass auf rund 300'000 ha die Richtwerte für den Schwermetallgehalt in Böden gemäss Verordnung über Belastungen des Bodens überschritten werden Dies sind 9% der Gesamtfläche der natürlich entwickelten Böden Vermutlich sind auch die Schadensursachen Erosion und Verdichtung von Bedeutung, aber zuverlässige Angaben fehlen Bei allen übrigen Bodeneigenschaften sind ebenfalls nur bruchstückhafte Erkenntnisse verfügbar
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 114
■ Schwermetalle
Der Bund betreibt ein nationales Referenznetz zur Bodenbeobachtung (NABO), mit dem er gegenwärtig an 105 Messstellen die «normale» Bodenbelastung durch Schadstoffe erfasst Die Kantone andererseits sind verpflichtet, vor allem diejenigen Böden zu untersuchen, die aufgrund ihrer Vorgeschichte oder der Emissionslage sicher oder vermutlich stärker belastet sind
Richtwertüberschreitung 1 bei ausgewählten Schwermetallen, 1990–1996
Im Rahmen des NABO sind die Schwermetallgehalte von insgesamt rund 11'000 Bodenproben von 31 Datenlieferanten der gesamten Schweiz ausgewertet worden In beinahe 20% der untersuchten Proben wurden die Richtwerte von Kupfer und Blei überschritten Bei Cadmium und Zink sind es 10% Richtwertüberschreitungen gibt es vor allem auf Siedlungsfreiflächen (z B Sportplätze, Böschungen), bezüglich Kupfer auch bei Intensivkulturen (Rebbau). Richtwerte sind gesetzlich festgelegte, ökotoxikologisch hergeleitete Vorsorgewerte Werden sie überschritten, gilt die Bodenfruchtbarkeit langfristig als nicht mehr gewährleistet Die Unterscheidung der untersuchten Bodenproben nach Nutzungstypen zeigt deutlich, dass der mit Abstand höchste Anteil an Richtwertüberschreitungen auf die Siedlungsfreiflächen fällt Rund die Hälfte aller untersuchten Böden ist hier mit Blei und Kupfer übermässig belastet Bei den beprobten Intensivkulturen sind rund 60% aller Böden über den Richtwert hinaus mit Kupfer belastet Es ist allerdings zu beachten, dass die Bodenproben zum überwiegenden Teil aus Untersuchungen von Verdachtsflächen stammen Die durchschnittliche Belastung dürfte deutlich tiefer liegen
Die Schwermetallbelastungen der Böden haben verschiedene Ursachen. Ein bestimmter Grundgehalt ist in jedem Boden vom bodenbildenden Muttergestein gegeben Gebietsweise kann dieser sogar zu Richtwertüberschreitungen führen Die Haupteintragspfade für Schwermetalle in Böden sind die Luft (z.B. Abgase und Stäube aus Industrie und Verkehr), sowie die Düngung (Hof-, Mineral- und Abfalldünger) und die Verwendung anorganischer Pflanzenschutzmittel (durch die Landwirtschaft und die Bewirtschafter von Siedlungsfreiflächen)
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 115 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
i n %
Nutzun
0 10 20 30 40 50 60 70
Quelle: BUWAL
1 11 000 Bodenproben wurden untersucht Cu Pb Cd Zn AlleAckerland Dauergrünland
gstypen Intensivkulturen Wald, Schutzzonen Siedlungsfreifläche
■ Erosionsrisiko
Eine weitere besonders folgenreiche und kaum regenerierbare Bodenschädigung ist der Abtrag von fruchtbarem Boden durch Erosion
Flächen mit erhöhter Gefahr für Bodenerosion 1998

Anteil der Flächen mit erhöhter Gefahr für Bodenerosion am
Total der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in %
nach Bezirken
CH = 282 964 ha
Anteil 26,2%
Quelle: BFS
Wie gross die Bodenschädigungen durch Erosion in der Schweiz sind, ist nur für wenige Regionen abgeschätzt worden Gesamthaft sind diesbezüglich keine Aussagen möglich. Die obige Karte zeigt aber das Risiko, das in der Schweiz für Bodenerosion besteht Auffällig ist, dass Alpen und Voralpen einen relativ geringen Anteil LN mit erhöhter Erosionsgefahr aufweisen Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Flächen fast durchwegs mit einer dichten Grasnarbe bewachsen sind, welche den Boden auch in Hanglagen und bei erhöhten Niederschlägen sehr effizient vor Erosion schützt
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 116
≥ 50,0 35,0
49,9 20,0 – 34,9 5,0 – 19,9 < 5,0
–
Beteiligung bei Tierhaltungsprogrammen RAUS und BTS
Mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) und «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) fördert der Bund die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere Näheres zu den Anforderungen und weitere Informationen über RAUS und BTS sind im Kapitel 2 2 Direktzahlungen zu finden
Seit der Einführung von RAUS (1993) und BTS (1996) nahm die Beteiligung an beiden Programmen stetig zu: So hat sich die Beteiligung bei RAUS von 1993 bis 2001 mehr als versiebenfacht (von rund 4'500 auf 33‘000 Betriebe) und diejenige bei BTS mehr als verdreifacht (von knapp 4'500 auf rund 15‘300 Betriebe).
Gemessen am gesamten massgebenden schweizerischen Nutztierbestand betrug der Anteil der GVE, die an RAUS oder BTS teilnahmen, 1996 19% bzw 9% Im Jahr 2001 beteiligten sich 56% an RAUS und 27% an BTS; die Werte sind jeweils Durchschnittszahlen der vier Tiergruppen
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 117 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3.2 Ethologie
G V EA n t e i l i n % RAUS BTS Quelle: BLW 19961997 1998 1999 0 60 50 40 30 20 10 2000 2001
Tabellen 36–37 Seiten A42–A43 Entwicklung der
Beteiligung bei RAUS und BTS
Die Beteiligung bei RAUS im Jahr 2001 zeigt, dass bei Betrieben mit Rindvieh prozentual praktisch gleich viele Tiere wie Betriebe mitmachen Dies ist insbesondere beim Geflügel anders: Der Anteil Tiere war hier etwa doppelt so hoch wie der Anteil Betriebe Auch bei den übrigen Raufutter Verzehrern sowie den Schweinen übertraf der Anteil Tiere den Anteil Betriebe, allerdings weniger deutlich als beim Geflügel.

1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 118
Beteiligung
RAUS
i n % Anteil Tiere (in GVE)Anteil Betriebe Quelle: BLW Rindvieh übrige Raufutter Verzehrer SchweineGeflügel 0 70 80 60 50 40 30 20 10
bei
2001
Beteiligung bei
Bei BTS ist beim Geflügel der Unterschied zwischen Anteil Tiere und Anteil Betriebe noch grösser als bei RAUS: 14% der Betriebe hielten im Jahr 2001 rund 74% der Tiere nach den BTS-Vorschriften Bei den Schweinen zeigt sich in etwa dasselbe Verhältnis wie beim RAUS-Programm Beim Rindvieh war der Anteil Betriebe gar leicht höher als der Anteil Tiere.
übrige Raufutter
Quelle: BLW
Bei RAUS nahm die Beteiligung zwischen 1996 und 2001 bei allen Tiergruppen deutlich zu Im Jahr 2001 nahmen rund 58% der Bestände von Rindvieh und etwa 67% der übrigen Raufutter Verzehrer am Programm teil. Bei den Schweinen und beim Geflügel lag der Anteil bei ca 43%; bei den Letztgenannten ist der Anteil im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Mastpoulets mit weniger als 56 Masttagen aus dem RAUS-Programm ausgeschlossen wurden
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 119 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
i n % Anteil Tiere (in GVE)Anteil Betriebe Quelle: BLW Rindvieh übrige Raufutter Verzehrer SchweineGeflügel 0 80 70 60 50 40 30 20 10
BTS 2001
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS G V EA n t e i l i n %
rzehrer SchweineGeflügel 19961997 1998 1999 2001 2000 0 70 80 50 60 40 30 20 10
Rindvieh
Ve
Entwicklung der Beteiligung bei BTS
Beim BTS-Programm sticht die hohe Beteiligung des Geflügels heraus Im Jahr 2001 wurde beinahe 74% des Geflügels in tierfreundlichen Ställen gehalten Der Hauptgrund dafür ist, dass bei vielen Labels die BTS-Anforderungen eine Grundvoraussetzung sind Das BTS-Programm für Schweine wurde erst 1997 eingeführt Die Entwicklung war auch dort erfreulich. Die Beteiligung lag mit gut 47% zwar hinter dem Geflügel zurück; gegenüber dem Einführungsjahr wurden aber fünfmal mehr Schweine in BTS-Ställen gehalten
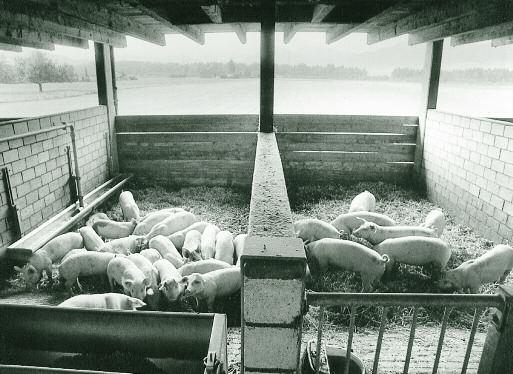
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 120
G V EA n t e i l i n % Quelle: BLW Rindvieh übrige Raufutter Verzehrer SchweineGeflügel 19961997 1998 1999 2001 2002 2000 0 80 50 60 70 40 30 20 10
Tierwohl in RAUS- und BTS-Programmen
Die Wirkungsanalyse der Tierhaltungsprogramme hat zum Ziel, deren Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlergehen der Nutztiere unter Praxisbedingungen aufzuzeigen. Die Untersuchungen werden bei Milchkühen und Mastschweinen durchgeführt Bei den Milchkühen sind sie abgeschlossen; bei den Mastschweinen dauern sie noch an Erste Ergebnisse zu den Milchkühen wurden bereits im Agrarbericht 2001 aufgezeigt Nachfolgend werden weitere Erkenntnisse aus den Untersuchungen präsentiert
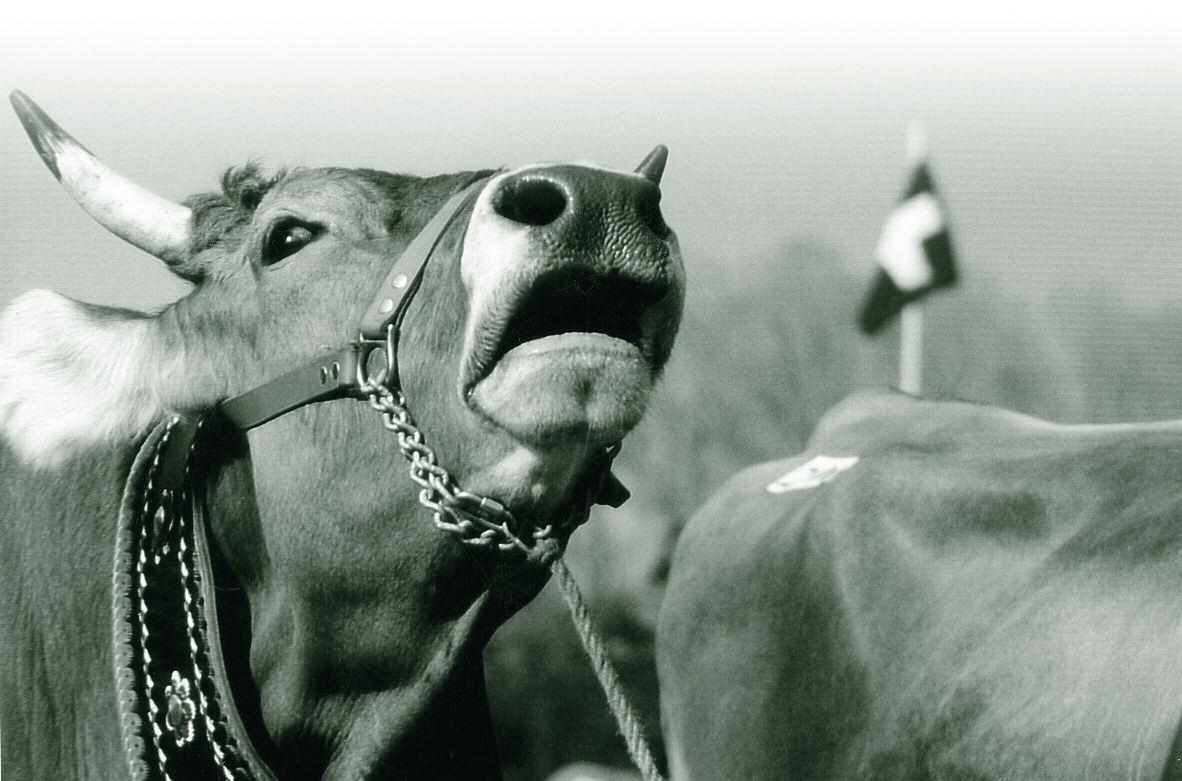
Bei den Milchkühen wurden für die Beurteilung von Gesundheit und Wohlergehen folgende Indikatoren verwendet: Lahmheit, Veränderung an den Sprunggelenken, Liegeschwielen an den Karpalgelenken, Haut- und Zitzenverletzungen, Sauberkeit, Körperkondition, das Verhalten beim Aufstehen und Einschränkungen beim Liegen sowie die Anzahl Behandlungen durch den Tierarzt oder Landwirt Im Laufe von zwei Jahren (1999, 2000) wurden 45 Betriebe ohne Tierprogramm, 45 RAUS-Betriebe und 45 Betriebe, die sich an BTS und RAUS beteiligen, dreimal besucht
Tierwohl bei Milchkühen mit und ohne Beteiligung an RAUS und BTS
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 121
Rötung, Schwellung, offene Wunde, Abszess unsauberer Gang oder Lahmheit Quelle: BLW 0 5 10 Anteil Tiere in % 15 20 BTS+RAUS RAUS ohne Programm
Die Untersuchungen zeigen, dass Betriebe mit BTS+RAUS bei den meisten Indikatoren deutlich besser abschneiden als Betriebe ohne Programm Auch das Programm RAUS alleine bewirkt Verbesserungen, die jedoch nur bei Lahmheit und Zitzenverletzungen signifikant waren.
Ein unsauberer Gang oder gar Lahmheit wurde bei Kühen in Betrieben mit RAUS und in Betrieben mit RAUS+BTS signifikant weniger beobachtet Zusätzlich zum positiven Einfluss der Haltungsprogramme BTS+RAUS vermindert auch jeder zusätzliche wöchentliche Auslauftag im Winter das Risiko von Lahmheit Erwartungsgemäss genossen Tiere auf BTS+RAUS-Betrieben im Durchschnitt am meisten Auslauf im Winter (6 Tage pro Woche), vor den Tieren auf RAUS-Betrieben (3,6 Tage pro Woche) Tiere auf Betrieben ohne Teilnahme an einem Programm kamen auf 0,8 Tage pro Woche
Rötungen, Schwellungen oder schwerwiegendere Veränderungen an den Sprunggelenken waren signifikant seltener in Betrieben mit BTS+RAUS als in Betrieben ohne Haltungsprogramm Dasselbe gilt für die Liegeschwielen an den Karpalgelenken Auch für Veränderungen an den Sprunggelenken war neben dem Programm BTS+RAUS die Häufigkeit des Auslaufs im Winter entscheidend Ein positiver Einfluss konnte auch hier für jeden zusätzlichen Auslauftag pro Woche gefunden werden.
Zitzenverletzungen wurden nur wenige beobachtet In Betrieben mit einem Haltungsprogramm war das Auftreten jedoch deutlich seltener als in Betrieben ohne Programm. Dabei schnitten die Betriebe mit BTS+RAUS gegenüber den Betrieben mit nur RAUS besser ab
Betriebe, die bei BTS+RAUS mitmachen, zeichneten im Durchschnitt zwei Behandlungen pro zehn Kühe und Jahr weniger auf als Betriebe mit Anbindeställen, die bei RAUS oder keinem Programm mitmachten Im Durchschnitt war eine dieser eingesparten Behandlungen eine Behandlung mit Antibiotika Dies ist u a auf eine geringere Häufigkeit von Behandlungen gegen Mastitis in den Betrieben mit RAUS+BTS zurückzuführen Dafür verwendeten die BTS+RAUS-Betriebe etwas häufiger antibiotische Trockenstellpräparate als die Betriebe mit Anbindeställen
Die Sauberkeit der Tiere wurde durch die Haltung in Laufställen mit BTS+RAUS nicht generell beeinträchtigt Die Sauberkeit der Euter war bei allen Programmen vergleichbar
Kein signifikanter Einfluss der Haltungsprogramme konnte auf die Häufigkeit von Verletzungen der Haut am Rumpf, von Veränderungen des Verhaltens beim Aufstehen sowie für die Fruchtbarkeit gefunden werden
Die untersuchten Indikatoren sind in der Praxis nicht nur abhängig von der Teilnahme an Haltungsprogrammen, sondern auch davon, wie die Anforderungen der Programme umgesetzt werden Die Untersuchungen zeigen, dass die Resultate von Betrieben, welche die Programme optimal umsetzen, überdurchschnittlich gut waren
1 . 3 Ö K O L O G I E U N D E T H O L O G I E 1 122
■
1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit
Die Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sieht vor, dass das BLW im Agrarbericht die Resultate der Untersuchungen einer Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unterzieht Das heisst, dass die ökonomische, soziale und ökologische Lage der Landwirtschaft und die Auswirkungen der Agrarpolitik aufgezeigt und beurteilt werden sollen Nachfolgend wird die Beurteilung wie in den beiden letzten Berichten in Form von qualitativen Aussagen vorgenommen Ausserdem wird über den Stand der Arbeiten zur Entwicklung von quantitativen Indikatoren orientiert, welche künftig zur Beurteilung der Nachhaltigkeit mit einbezogen werden sollen.
Aktuelle Beurteilung der Nachhaltigkeit
Das Jahr 2001 war für die Landwirtschaft ein mittelmässiges Wirtschaftsjahr Die Endproduktion lag um 4% tiefer als im Durchschnitt der drei Vorjahre Dies ist vor allem auf schlechtere Ergebnisse im Pflanzenbau zurückzuführen Das Sektoreinkommen fiel damit fast auf den Stand von 1999 zurück und war rund 8% tiefer als im Durchschnitt 1998/2000 Die Schätzungen für das Jahr 2002 zeigen einen erheblichen Anstieg Mit 2,68 Mrd Fr soll es wieder den Wert des guten Wirtschaftsjahres 2000 erreichen Die ersten Jahre nach Einführung des neuen Landwirtschaftsgesetzes sind geprägt durch deutliche Einkommensschwankungen
Ein Vergleich von Dreijahresschnitten der Ergebnisse von Betrieben der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten zeigt, dass die Werte der Jahre 1999/2001 für das landwirtschaftliche Einkommen je Betrieb um 9% tiefer sind als 1990/92. Auf der anderen Seite sind sie aber auch 14% höher als Mitte der neunziger Jahre (1994/96) Die Einkommen befinden sich also nicht in einer unaufhaltsamen Spirale nach unten, sondern konnten sich nach dem Tiefpunkt Mitte der neunziger Jahre wieder erholen.
Die Reduktion der landwirtschaftlichen Einkommen in den neunziger Jahren konnte teilweise kompensiert werden durch höhere Nebeneinkommen Die Gesamteinkommen der Jahre 1999/2001 liegen nur 4% unter dem Niveau der Jahre 1990/92 Investitionen und Privatverbrauch sind denn auch ungefähr auf dem gleichen Niveau wie zu Beginn der neunziger Jahre geblieben Der Privatverbrauch hat von 59'500 Fr im Durchschnitt der Jahre 1990/92 auf 62'000 Fr im Durchschnitt der Jahre 1999/2001 zugenommen, die Investitionen für denselben Zeitraum von 47'000 Fr. auf 45'000 Fr leicht abgenommen Ausserdem ist die Verschuldung stabil geblieben Der Fremdfinanzierungsgrad ist zwischen 1990/92 und 1999/2001 von 43 auf 41% leicht zurückgegangen. Die wirtschaftliche Lage ist im Durchschnitt der Betriebe in den letzten zehn Jahren stabil geblieben
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 123 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ökonomie
Wie zu Beginn der neunziger Jahre gibt es aber Betriebe, deren langfristige Existenz gefährdet ist Im Durchschnitt der Jahre 1999/2001 war die finanzielle Situation bei rund 30% der Betriebe ungenügend für die langfristige Sicherung der betrieblichen Existenz. Nach wie vor wird in der Schweizer Landwirtschaft gegenüber vergleichbaren Betrieben im Ausland mehr Arbeit für dieselbe Produktionsmenge eingesetzt Es besteht also ein Spielraum für Kostensenkungen oder für ein Wachstum der Betriebe Die Aufgabe von Betrieben erlaubt es den übrigen Betrieben, ihre ökonomische Basis zu verbessern Für die Landwirtschaft als Gesamtes wird dadurch eine ökonomisch nachhaltige Entwicklung ermöglicht
Das für die landwirtschaftlichen Haushalte massgebende Gesamteinkommen lag im Jahr 2001 um 7% unter dem Wert des Dreijahresmittels 1998/2000 Trotzdem stieg der Privatverbrauch um 4% oder 2'500 Fr je Haushalt an Besonders stark war der Anstieg bei den Betrieben im ersten Quartil, das heisst jenen mit den tiefsten Gesamteinkommen Insgesamt hat die Einkommensspanne zwischen den Betrieben im ersten und denjenigen im vierten Quartil im Zeitraum 1990/92 bis 1999/2001 leicht zugenommen Waren die Gesamteinkommen des vierten Quartils zu Beginn der neunziger Jahre noch 2,1 mal höher als diejenigen im ersten Quartil, lag diese Spanne 1999/2001 bei 2,3. Beim Privatverbrauch liegen erstes und viertes Quartil näher beieinander. Auch hier ist die Spanne etwas grösser geworden Sie ist von 1,3 auf 1,4 gestiegen
Der Vergleich der Situation in den Bereichen Arbeit und Ausbildung zwischen den Landwirten, anderen Selbständigen und der übrigen Bevölkerung zeigt Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auf Der grösste Unterschied zu allen anderen Kategorien besteht bei den Ferien: Die Landwirte gehen im Durchschnitt nur sechs Tage in die Ferien, bei den übrigen Kategorien sind es 17 und mehr Tage Auffallend ist der hohe Anteil von Wohneigentum bei den Landwirten. Bedeutend häufiger leisten die Landwirte auch Wochenendarbeiten Auffallend ist im Vergleich zu den übrigen Kategorien der hohe Anteil von Landwirten, die keine berufliche Ausbildung haben Gemeinsam mit den übrigen Selbständigen ist die hohe Arbeitszeit pro Woche. Schliesslich ist allen Kategorien gemeinsam die hohe Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen
Die Resultate der Studie «Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft» zeigen in einem Bereich eine hohe Übereinstimmung mit den Ergebnissen der im Jahre 2001 durchgeführten Befindlichkeitsstudie sowie der Auswertung über Arbeit und Ausbildung: Die Frauen sind mehrheitlich mit ihrer Situation zufrieden Für die Frauen ist die Rolle als Hausfrau und Mutter am wichtigsten. Trotzdem ist ihre Mitarbeit auf dem Hof bedeutend, sei es bei den allgemeinen Betriebsarbeiten oder in einem bestimmten Betriebszweig, z B bei der Direktvermarktung Für die Arbeit auf dem Betrieb setzen sie rund 24 Stunden pro Woche ein. Die zeitliche Beanspruchung auf dem Betrieb hat bei rund der Hälfte der Frauen in den letzten zehn Jahren zugenommen Jede vierte Frau hat in diesem Zeitraum zudem neu eine ausserlandwirtschaftliche Arbeit aufgenommen
Die Arbeitsbelastung kann zum Problem werden Als Kompensation schätzen viele Bäuerinnen die besonderen Qualitäten ihrer Lebenswelt
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 124
■ Soziales
■ Ökologie
In den letzten zehn Jahren ist der finanzielle Spielraum vor allem für die Betriebe mit den tiefsten Einkommen enger geworden Wie bei den übrigen Selbständigen ist die Arbeitszeit pro Woche hoch und die meisten Bäuerinnen und Bauern machen wenig Ferien. Trotzdem ist die Zufriedenheit mit dem Beruf gross. Für die Zukunft gilt es, die soziale Situation weiter genau zu verfolgen
Die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft haben im 2001 im Vergleich zum Vorjahr wieder zugenommen Gegenüber 2000 nahmen die Anzahl der beitragsberechtigten Biobetriebe um 11%, die GVE beim Tierhaltungsprogramm RAUS um 12% und bei BTS um 17% zu Die ökologischen Ausgleichsflächen legten dagegen ganz wenig zu.
Die Biobetriebe bewirtschafteten im Jahr 2001 total 8,7% der LN Im Talgebiet (Ackerbauzonen und Hügelzone) gab es im Jahr 2001 47'300 ha beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen 56% der GVE wurden nach den Regeln des RAUS-Programms gehalten, 27% nach denjenigen des BTS-Programms
Die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft gingen seit Beginn der neunziger Jahre bis 1998 stark zurück. Danach ist beim Phosphor und bei den Pflanzenschutzmitteln eine Stagnation eingetreten, der Stickstoffeinsatz hat sogar leicht zugenommen Beim Stickstoff dürfte es daher schwierig sein, das für 2005 fixierte Ziel zu erreichen. Das Verlustpotential müsste auf rund 74'000 t N reduziert werden. 1998 lag es bei 89'000 t Die P-Überschüsse gingen zwischen 1990/92 und 2001 von 20'000 auf 9'000 t zurück Das Ziel, diese bis 2005 um 50% zu reduzieren, wurde damit bereits erreicht Beim Phosphor gilt es vor allem die Situation bei einigen Mittellandseen zu verbessern Dort sind es zur Hauptsache die Emissionen der Landwirtschaft, welche die noch zu hohen P-Belastungen verursachen.
Insgesamt ist die Entwicklung im ökologischen Bereich der Nachhaltigkeit als erfreulich zu bezeichnen. Weitere Anstrengungen sind vor allem auf regionaler oder lokaler Ebene notwendig
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 125 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Stand der Arbeiten zu den quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren
Im Agrarbericht 2001 wurde ein Konzept dargestellt, welches die Grundlage für die Entwicklung von konkreten Nachhaltigkeitsindikatoren bildet
Das Konzept umfasst folgende Schwerpunkte:
– Ressourcen: Nutzung der natürlichen Ressourcen unter Bewahrung von Mindestbeständen Substitution von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen durch erneuerbare natürliche Ressourcen Kontinuierliche Erneuerung aller erneuerbaren natürlichen Ressourcen, der Humanressourcen (Wissen) und der reproduzierten Ressourcen

– Effizienz: Effizienz im Transformationsprozess zwischen Inputs und Outputs auf allen Stufen des Leistungserbringungsprozesses
– Gerechtigkeit: Generationsinterne und generationsübergreifende gerechte Verteilung von Wohlfahrt
Nachhaltigkeitsindikatoren für die Landwirtschaft sollen zeigen, inwieweit die Landwirtschaft – unter Berücksichtigung des Umgangs mit den natürlichen Ressourcen durch die in der Landwirtschaft Tätigen, des Nachfrageverhaltens der Konsumentinnen und Konsumenten sowie der staatlichen Rahmenbedingungen – einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Schweiz leistet Die Indikatoren müssen die Kernbereiche Ressourcen, Effizienz und Gerechtigkeit aufgreifen und für die drei Dimensionen entwickelt werden Je nach Dimension haben die Kernbereiche ein unterschiedliches Gewicht In allen spielt die Ressourcenfrage eine zentrale Rolle Bei der Ökologie und der Ökonomie ist zudem die Frage der Effizienz wichtig, während beim Sozialen die Gerechtigkeit im Vordergrund steht
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 126
■ Stand der Arbeiten
Für die Dimension «Ökonomie» müssen Indikatoren in den Bereichen Ressourcen und Effizienz entwickelt werden Bezüglich Ressourcen sollen die Indikatoren zeigen, wie sich das investierte Geldkapital in der Landwirtschaft (Gebäude, Maschinen usw ) im Zeitablauf entwickelt und wie es erneuert wird. Als Datenquellen stehen die landwirtschaftliche Gesamtrechnung und die Zahlen aus der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten zur Verfügung Zurzeit wird evaluiert, welche Datengrundlage sich besser eignet Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Methodik der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung im Moment überarbeitet wird Voraussetzung für die Erneuerung des investierten Geldkapitals ist die Ertragskraft respektive die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe Aus diesem Grund wird die Entwicklung eines entsprechenden Indikators in Ergänzung zum Ressourcenindikator als sinnvoll erachtet Bezüglich Effizienz scheint es naheliegend, auf die bewährten Indikatoren der FAT abzustützen und diese so weiter zu entwickeln, dass Vergleiche über die Zeit möglich werden
Für die Dimension «Soziales» stehen Indikatoren in den Bereichen Ressourcen und Gerechtigkeit im Vordergrund Bei den Ressourcen handelt es sich hier um das Humankapital Die Indikatoren sollen zeigen, wie sich die Altersstruktur der landwirtschaftlichen Betriebsleiter und -leiterinnen verändert, wie sich deren Ausbildungsstand wandelt und wie sich die gesellschaftliche Akzeptanz der Landwirtschaft entwickelt Im Bereich Gerechtigkeit, das heisst gerechte Verteilung des Wohlstandes, sollen die Indikatoren aufzeigen, wie sich die Einkommensunterschiede zwischen der landwirtschaftlichen und der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung entwickeln, wie es um die Lebensqualität der bäuerlichen Bevölkerung im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung steht – Veränderungen innerhalb der Gesellschaft werden auf diese Weise mitberücksichtigt – und ob der Strukturwandel sozialverträglich abläuft Zurzeit werden aus diesen verschiedenen – und eventuell noch weiteren – Themenbereichen entsprechende, geeignete Nachhaltigkeitsindikatoren erarbeitet Als Datenquellen dienen Zahlen der FAT, des BFS, des SBV sowie eigene Erhebungen.
Für die Dimension «Ökologie» werden wie bei der Ökonomie Indikatoren in den Bereichen Ressourcen und Effizienz entwickelt. Dabei wird unterschieden zwischen Indikatoren zur landwirtschaftlichen Praxis, Indikatoren zu den landwirtschaftlichen Prozessen und Indikatoren zum Zustand der von der Landwirtschaft beeinflussten Umwelt
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 127
Die Begleitgruppe «Umweltaspekte der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft» hat aus rund 30 Indikatoren die folgenden sechs Schlüsselindikatoren ausgewählt:
Potenzielle N-Verluste (Nitrat-, Ammoniak- und Lachgasemissionen);
– P-Zufuhr in die Böden;
– Energieeffizienz;
Risiko von aquatischer Ökotoxizität;
– Erosionsrisiko;
– Ökologische Ausgleichsflächen oder potenzielle Auswirkungen landwirtschaftlicher Aktivitäten auf die Biodiversität
Mit Hilfe dieser Indikatoren lässt sich verfolgen, wie die Landwirtschaft die Umweltqualität beeinflusst und wie sich der Umweltzustand verändert Sie erlauben auch, Problembereiche frühzeitig zu identifizieren und können als Basis bei der Wahl neuer Instrumente dienen. Bei einigen Indikatoren sind noch Methoden zu entwickeln, damit die Indikatoren in Kennziffern ausgedrückt werden können, bei anderen fehlen die statistischen Grundlagen Diese Arbeiten werden in nächster Zeit weiter vorangetrieben
128 1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1
–
–

2 129
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. Agrarpolitische Massnahmen
Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln Das Gesetz gibt vor, dass die Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten gegenüber den Ausgaben 1998 um einen Drittel abgebaut werden müssen Im Jahr 2003 können für diese Massnahmen noch rund 800 Mio Fr eingesetzt werden
Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab. Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht, weil dafür kein Markt besteht Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher, dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden.
– Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte, sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion Im einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung, im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz
Der Bundesrat hat am 29. Mai 2002 die Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2007) verabschiedet Kernpunkte der Vorlage sind die Aufhebung der Milchkontingentierung, die Versteigerung der Fleischimportkontingente und die neuen Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft in den Jahren 2004 bis 2007
Mit der Agrarpolitik 2007 verfolgt der Bundesrat den in den neunziger Jahren eingeschlagenen Reformweg weiter Die agrarpolitischen Massnahmen sollen auf die neuen Herausforderungen hin optimiert werden Mit den vorgeschlagenen Anpassungen sollen die Rahmenbedingungen für die Erhaltung eines produktiven Agrarsektors, einer qualitativ hochwertigen und sicheren Ernährung sowie einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung geschaffen werden
130 2 . A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2
–
2.1 Produktion und Absatz
Nach LwG Artikel 7 setzt der Bund die Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse so fest, dass die Landwirtschaft nachhaltig und kostengünstig produzieren sowie aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann Dafür stehen ihm die Massnahmen in den Bereichen Qualität, Absatzförderung und Kennzeichnung, Ein- und Ausfuhr, Milchwirtschaft, Viehwirtschaft, Pflanzenbau und Weinwirtschaft zur Verfügung

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 131 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■ Finanzielle Mittel 2001
Tabellen 26–29, Seiten A27–A30

Im Jahr 2001 sind zur Förderung von Produktion und Absatz rund 902 Mio. Fr. aufgewendet worden Gegenüber dem Vorjahr sind dies rund 53 Mio Fr oder 6% weniger Ausgaben Dies entspricht einem weiteren Abbauschritt der finanziellen Mittel für Produktion und Absatz wie in Artikel 187 Absatz 12 LwG festgelegt. Der Abbauschritt ist auf Grund eines parlamentarischen Budgetbeschlusses gemildert worden, indem gegenüber dem Finanzplan 30 Mio Fr mehr für den Bereich Produktion und Absatz zur Verfügung gestellt wurden
Ausgaben für Produktion und Absatz
Rechnung 2001 Budget 2002
■ Ausblick
Für das letzte Jahr des laufenden Zahlungsrahmens der Jahre 2000 bis 2003 ist ein weiterer Abbauschritt von rund 47 Mio. Fr. vorgesehen.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 132
Ausgabenbereich Betrag Anteil Betrag Anteil Mio Fr % Mio Fr % Absatzförderung 60 6,7 60 7,0 Milchwirtschaft 666 73,9 601 70,2 Viehwirtschaft 46 5,1 46 5,4 Pflanzenbau (inkl Weinbau) 129 14,3 148 17,3 Total 902 100,0 855 100,0 Quellen: Staatsrechnung,
Budget
2.1.1 Übergreifende Instrumente
Branchen- und Produzentenorganisationen
Die Branchen- und Produzentenorganisationen spielen bei der Liberalisierung der Agrarmärkte eine grosse Rolle Sie dienen als Diskussions- und Verhandlungsplattformen für die Partner einer Branche oder für die Produzenten eines Produkts bzw einer Produktegruppe Indem sie, insbesondere bezüglich Produktequalität, Spielregeln festlegen, tragen sie zum guten Funktionieren der Märkte bei Ausserdem treffen sie gemeinsam Massnahmen zur Konsum- und Absatzförderung Schliesslich bieten sie ihren Mitgliedern zahlreiche Dienstleistungen an: technische und rechtliche Beratung, Erarbeitung von Modellverträgen, Information über die Marktentwicklung, Vertretung und Verteidigung der Interessen auf nationaler und internationaler Ebene, Finanzierung von Forschungsprogrammen.
In Artikel 8 und 9 LwG wird der Bundesrat ermächtigt, Selbsthilfemassnahmen von Branchen- und Produzentenorganisationen zu unterstützen Konkret kann er im Interesse eines Produkts oder einer Branche Unternehmen, die keiner Branchen- oder Produzentenorganisation angeschlossen sind, zur Teilnahme an Selbsthilfemassnahmen solcher Organisationen verpflichten Es handelt sich dabei um eine subsidiäre Unterstützung, denn die Partner entscheiden gemäss Gesetzgebung selber über die notwendigen Massnahmen, bevor sie den Bundesrat gegebenenfalls um Unterstützung bitten. Dieser kann in drei klar bezeichneten Bereichen intervenieren: Qualitätsverbesserung, Absatzförderung sowie Anpassung der Produktion und des Angebots an die Marktbedürfnisse
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 133 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■ Spielregeln sind festzulegen
Produzentengemeinschaften Markt Interessenvertretung Verhandlungsbereich Produzenten Verarbeiter Handel Quelle: BLW Produzenten-Organisation Branchen-Organisation
Struktur von Branchen- und Produzentenorganisationen
Die Intervention des Bundesrats erlaubt es, gegen Trittbrettfahrer anzugehen, die von kollektiven Massnahmen profitieren ohne sich daran zu beteiligen oder die Kosten mitzutragen Wenn beispielsweise eine Branchenorganisation beschliesst, für die allgemeine Förderung des Produkts 40 Rp. pro kg Käse zu erheben, ermöglichen die von ihren Mitgliedern freiwillig bezahlten Beiträge die Finanzierung einer Werbung, die allen Herstellern des Produkts, das heisst Mitgliedern und Nichtmitgliedern, zugute kommt Die Unternehmen, die bereit sind, sich finanziell an einer kollektiven Massnahme zu beteiligen, werden rasch entmutigt, wenn sie merken, dass Nichtmitglieder, die keinen Beitrag zahlen, ebenfalls davon profitieren Da die Unternehmen, die keinen Beitrag zahlen, nicht von den günstigen Auswirkungen der gemeinsamen Aktion ausgeschlossen werden können, ist eine Unterstützung durch den Staat gerechtfertigt Die subsidiäre Intervention des Bundesrates stärkt somit die kollektive Dynamik auf den liberalisierten Agrarmärkten Es ist äusserst wichtig, dass die Anstrengungen der Mehrheit der Betriebe einer Branche oder eines Sektors für eine bessere Positionierung und Absatzförderung ihres Produktes nicht durch eine Minderheit von Betrieben in Frage gestellt werden, die als Trittbrettfahrer Vorteil daraus ziehen möchten
Im LwG werden für die Unterstützung von Selbsthilfemassnahmen durch den Bundesrat gewisse Bedingungen gesetzt. Erstens muss die von der Branchen- oder Produzentenorganisation beschlossene Massnahme ohne die Unterstützung gefährdet sein Die Gesuchstellerin muss demnach ihren Antrag dreifach begründen: Notwendigkeit der Massnahme, Gefährdung und allgemeines Interesse, das die Unterstützung durch den Bundesrat rechtfertigt Zweitens muss die Organisation drei Kriterien entsprechen: (a) sie muss repräsentativ sein, (b) sie darf weder in der Produktion noch in der Verarbeitung oder im Verkauf tätig sein und (c) die Selbsthilfemassnahmen müssen mit grossem Mehr beschlossen worden sein
a) Eine Branchenorganisation gilt als repräsentativ, wenn ihre Mitglieder mindestens die Hälfte der in den Handel gelangenden Menge des Produkts oder der Produktegruppe herstellen, verarbeiten oder gegebenenfalls vermarkten, wenn die Produktions- bzw Verarbeitungsregionen in der Organisation angemessen vertreten sind und wenn ihr auf Produktionsstufe mindestens 60% der Bewirtschafter angeschlossen sind
b) Eine Branchen- oder Produzentenorganisation darf weder in der Produktion, noch in der Verarbeitung oder im Handel tätig sein, denn es entstünde dadurch ein Konflikt mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder und erst recht mit derjenigen von Nichtmitgliedern Ausserdem kommt es für den Bundesrat nicht in Frage, die Handelstätigkeit eines Unternehmens zu Lasten eines anderen zu unterstützen Die Massnahme, für welche seine Unterstützung beantragt wird, muss allen Stufen bzw der gesamten Branche zugute kommen.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 134
■ Zu erfüllende Bedingungen
c) Die Beschlüsse einer Branchen- oder Produzentenorganisation müssen von den Mitgliedern grossmehrheitlich genehmigt sein Bei einer Branchenorganisation ist dies eine Mehrheit auf Produzenten-, Verarbeitungs- und gegebenenfalls Handelsstufe Wenn eine Branche beschliesst, für ein Produkt eine Partnerschaft einzugehen, darf keine Berufsgruppe von den anderen Stufen zu einer Massnahme gezwungen werden, mit der sie nicht einverstanden ist Die zu unterstützende Massnahme muss einem breiten Konsens entsprechen
Zudem misst der Bundesrat der Repräsentativität und den demokratischen Strukturen der gesuchstellenden Branchen- und Produzentenorganisationen grosse Bedeutung bei Die Legitimität einer Organisation ist für die Ausdehnung einer Massnahme auf Nichtmitglieder wesentlich. Die Beschlüsse müssen also von demokratisch gewählten Vertretern möglichst nahe an der Basis gefasst werden

Die Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen enthält die Durchführungsbestimmungen zu den Artikeln 8 und 9 LwG Die Gesuche um Unterstützung sind dem BLW vorzulegen, das die Legitimität der Gesuchstellerin und die Konformität der Massnahme prüft Das BLW unterbreitet das Unterstützungsgesuch mit einer eigenen Stellungnahme dem Bundesrat Dieser entscheidet definitiv, ob die Massnahme verbindlich zu erklären ist.
Am 1 Januar 2002 beschloss der Bundesrat, die von drei Produzentenorganisationen (Schweizerischer Bauernverband, Schweizer Milchproduzenten, GalloSuisse) und drei Branchenorganisationen (Emmentaler Switzerland, Interprofession du Gruyère, Interprofession du Vacherin fribourgeois) vereinbarten Massnahmen zur Absatzförderung und Qualitätsverbesserung zu unterstützen Diese Unterstützung wurde auf dem Verordnungsweg für zwei Jahre gewährt Die betreffenden Branchen- und Produzentenorganisationen müssen dem EVD jährlich über die Realisierung der Massnahmen und ihre Auswirkungen Bericht erstatten
Die ersten Erfahrungen in der Behandlung des Dossiers durch das BLW haben gezeigt, dass die rechtlichen Anforderungen Spielraum für Interpretation und offene Fragen lassen bezüglich der Organisationsstruktur, ihrer Repräsentativität und des Entscheidverfahrens Es ist deshalb vorgesehen, im Laufe des Jahres 2002 die Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen zu revidieren, indem im Gesuch zur Unterstützung durch den Bundesrat der demokratische Prozess in den Organisationen, die Legitimität und Transparenz der Entscheide stärker betont werden Die Nichtmitglieder dieser Organisationen müssen von einer besseren Information profitieren können
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 135 2
■ Ausblick
■ Ausblick
Absatzförderung
Die Mittel zur Finanzhilfe an die Absatzförderung sollen so auf Produkte oder Produktegruppen verteilt werden, dass mit dem Einsatz der Absatzförderungsinstrumente der grösste Nutzen für die Landwirtschaft erreicht werden kann
Dazu werden Produkt-Markt-Bereiche (PMB) gebildet und mit einer Portfolio-Analyse bewertet PMB sind gegenseitig möglichst unabhängige Produktbereiche wie beispielsweise Käse, Gemüse, Fleisch etc Dieses Vorgehen erlaubt, die Investitionsattraktivität nach Marktattraktivität und Wettbewerbsstärke der einzelnen PMB zu bewerten
Die pro PMB bereitgestellten Mittel sind beim BLW mit einem Gesuch zu beantragen Das BLW stellt dazu Formulare zur Verfügung Mit dem Gesuch sind eine Projektbeschreibung, ein Budget und ein Finanzierungsplan einzureichen. Die Gesuche werden auf Grund von festgelegten Prüfkriterien beurteilt und die Finanzhilfen bei Erfüllen der Anforderungen, in der Regel bis Ende September für das folgende Kalenderjahr verfügt
Das Vorgehen erlaubt eine zweckmässige Verteilung der finanziellen Mittel sowohl bezüglich der Investitionsattraktivität der Produkte wie auch nach dem Bedarf der aktiven Organisationen im Bereich der Absatzförderung Der Mindestanteil der Gesuchsteller an Eigenmitteln von 50% bietet Gewähr, dass die Projekte effizient realisiert werden.
Bei den Mittelempfängern handelt es sich vor allem um Branchenorganisationen, in wenigen Fällen um Marketingorganisationen, welche im Interesse mehrerer unabhängiger Teilnehmer handeln Als Marketingorganisation ist beispielsweise die Switzerland Cheese Marketing AG zu erwähnen. Dieses Unternehmen bewirbt im Ausland den grössten Teil der exportierten Käsesorten
Erste Ergebnisse zeigen, dass sich die Portfolio-Analyse zur strategischen Vorsteuerung eignet Die Überprüfung auf Grund der gemachten Erfahrungen dürfte jedoch zu Anpassungen der Mittelverteilung führen
Nach Artikel 12 Absatz 2 LwG sind die Verantwortlichen der Absatzförderung aufgefordert, die Massnahmen zu koordinieren und dazu gemeinsame Leitlinien auszuarbeiten In den Leitlinien vom Januar 2002 verpflichtet sich die Agro Marketing Suisse (AMS), inskünftig bestimmte Themenbereiche als Grundlage zur Formulierung der Botschaften zur «Herkunft Schweiz» festzulegen Das BLW wird bei den zukünftigen Projekteingaben, welche die Kampagnen ab 2004 betreffen, auf die Umsetzung der Leitlinien im Sinne einer Bündelung der Botschaften besonderes Gewicht legen.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 136
Tabelle 26, Seite A27
■ Wie werden die Mittel verteilt?
Qualitätsförderung
Um auch der biologischen Bienenhaltung einen rechtlichen Rahmen zu verleihen, der die Produzenten vor unlauterem Wettbewerb schützt und den Konsumentenschutz verbessert, wurden im Berichtsjahr als Ergänzung der Bio-Verordnung Bestimmungen über die Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse ausgearbeitet Der Bundesrat setzte diese auf den 1 Januar 2002 in Kraft

In der Schweiz wird eine sehr vielseitige Bienenhaltung betrieben Mit durchschnittlich sieben Völkern pro Quadratkilometer gehören wir weltweit zu den Ländern mit der höchsten Bienendichte Die Bienenhaltung ist eine ökologisch wichtige Tätigkeit, indem eine flächendeckende geografische Verteilung der Bienenstöcke die Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen gewährleistet
Die Qualität der Imkereierzeugnisse, namentlich des Honigs, hängt stark von der Behandlung der Bienenstöcke und der Qualität der Umwelt ab Auch die Bedingungen, unter denen Honig gewonnen, verarbeitet und gelagert wird, bestimmen diese Qualität Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die meisten Beeinträchtigungen der Honigqualität, wie z B Pestizidrückstände, nicht etwa auf die Lage der Bienenweiden, sondern primär auf die Arbeit des Imkers oder der Imkerin am Bienenstock zurückzuführen sind Die Bio-Verordnung schränkt daher insbesondere den Einsatz von Hilfsstoffen im Bienenstock ein Bei der Krankheitsvorsorge sind vorbeugende und alternative Heilmittel zu bevorzugen. Behandlungen mit chemo-therapeutischen Mitteln dürfen nur angewendet werden, wenn sie unabdingbar sind und durch einen Tierarzt verschrieben werden Hinsichtlich des Schadstoffeintrages sind unbedenkliche Standorte zu wählen
Leistungsvereinbarungen
Das LwG bildet die rechtliche Grundlage für Leistungsvereinbarungen im Bereich Landwirtschaft In verschiedenen Produktbereichen ist es zweckmässiger, gewisse Vollzugsaufgaben auszulagern Dies kann einerseits die Delegation von routinemässigen Administrationsaufgaben oder der Vollzug von Massnahmen in Marktnähe sein Die nachfolgende Tabelle, welche u a als Antwort auf die Interpellation Sommaruga (01 3593) erstellt wurde, gibt Auskunft darüber, mit welchen Organisationen und Firmen im Berichtsjahr schriftliche Leistungsvereinbarungen bestanden haben Je nach Marktorganisation sind sie unterschiedlich ausgestaltet Für die Überwachung und Kontrolle der Umsetzung ist das BLW zuständig. Die eidgenössische Finanzkontrolle prüft zudem beim Fleisch die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Proviande
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 137 2
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Vorschriften für die Bio-Imkerei
Leistungsvereinbarungen 2001
Bereich
Milch
Organisation, Firma
Treuhandstelle Milch GmbH, Bern
13 Administrationsstellen Milchkontingentierung (13 regionale Milchverbände)
Auftrag und Vertragsdauer
Rechtsgrundlagen
Administration der Zulagen und Beihilfen im Bereich Milch;
1 5 1999 bis 30 4 2004
Administration der Milchkontingentierung;
1 5 1999 bis 30 4 2004
Art 17 der Milchpreisstützungsverordnung vom 7 12 1998
Art 2 der Milchkontingentierungsverordnung vom 7 12 1998
Fleisch
Proviande, Bern
Erfassung und Kontrolle der Gesuche um Zollkontingentsanteile; 1 1 2000 bis 31 12 2003
Neutrale Qualitätseinstufung von lebenden und geschlachteten Tieren; 1 1 2000 bis 31 12 2003
Überwachung von öffentlichen Schlachtvieh- und Schafmärkten, Durchführung von Marktentlastungsmassnahmen; 1 1 2000 bis 31 12 2003
Art 34-36 der Schlachtviehverordnung vom 7 12 1998
Art 34-36 der Schlachtviehverordnung vom 7 12 1998
Art 34-36 der Schlachtviehverordnung vom 7 12 1998
Zucker Ölsaaten Speisekartoffeln
Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG, Aarberg
swiss granum, Bern swisspatat, Bern
Verarbeitungsauftrag, Produktion von mindestens 120 000 t und maximal 185 000 t Zucker pro Jahr; 1 10 1999 bis 30 9 2003
Leistungsvereinbarung für die Verteilung der Verarbeitungsbeiträge für Ölsaaten; 1 1 2002 bis 31 12 2003, Verlängerung jeweils um ein weiteres Jahr
Leistungsvereinbarung über die Verteilung der Beiträge für die Frischverfütterung, Kartoffeltrocknung zu Futterzwecken und Lagerhaltung von Speisekartoffeln (Verwertungsauftrag); 1 7 1999 bis 30 6 2001, Verlängerung jeweils um ein weiteres Jahr
Art 1, 2 und 4 der Zuckerverordnung vom 7 12 1998, befristet bis 30 9 2003
Art 9, 10 und 12a der Ackerbaubeitragsverordnung vom 7 12 1998, befristet bis 31 12 2003
Art 5 der Kartoffelverordnung vom 7 12 1998, befristet bis 30.6.2003
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 138
Entschädigung Leistungsvereinbarung 2,8 Mio Fr 3,76 Mio Fr 0,35 Mio Fr 4,25 Mio Fr 2,99 Mio Fr 0 0 0 Verwaltete Mittel 2001 629,45 Mio Fr 1 0 0 0 8,4 Mio Fr und Nachtragskredite von 23,5 Mio Fr 1 45 Mio Fr 2 8,5 Mio Fr 2 (ab 2002) 18 Mio Fr 2
1 Durch Bund verwaltete finanzielle Mittel
2 Durch Auftragnehmerin verwaltete finanzielle Mittel Quelle: BLW
Bereich
Saatkartoffeln
Organisation, Firma
Schweiz Saatgutproduzentenverband, Delley
Auftrag und Vertragsdauer
Rechtsgrundlagen
Saatmais Saatgut Futterpflanzen
Spezialkulturen
Schweiz Zentralstelle für Gemüsebau, Koppigen
Leistungsvereinbarung über die Verteilung der Beiträge für Frischverfütterung, Trocknung zu Futterzwecken und Ausfuhr (Verwertungsauftrag); 1 7 1999 bis 30.6.2001, Verlängerung jeweils um ein weiteres Jahr
Produktionsauftrag für mindestens 240 ha Saatmais; 1.1.1999 bis 31 12 1999, Verlängerung jeweils um ein weiteres Jahr
Produktionsauftrag für 250 ha Futterpflanzensaatgut; 1 3 2001 bis 31 12 2003, Verlängerung jeweils um ein weiteres Jahr
Erhebung, Auswertung und Bereitstellung von Daten für die Importregelung und zur Überwachung internationaler Verpflichtungen; 1 1 1999 bis 31 12 2002
Art 5 der Kartoffelverordnung vom 7 12 1998, befristet bis 30 6 2003 Art 18 der Saatgutverordnung vom 7.12.1998
Art. 18 der Saatgutverordnung vom 7 12 1998
Art 22 der Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen vom 7 12 1998, Art 28 der Agrareinfuhrverordnung vom 7.12.1998
SWISSLEGUMES, Bern; Fachzentrum für die Ein- und Ausfuhr von Früchten c/o swisscofel, Bern; Interprofession Schnittblumen Schweiz, Hindelbank
Qualiservice GmbH, Bern
Aufgaben im Bereich der Importregelung und der Erfassung der Inlandleistung bei Gemüse, Obst und Schnittblumen, 1 1 2001 bis 31 12 2002 (SWISSLEGUMES und Interprofession Schnittblumen), 1.1.2000 bis 31.12.2001 (Fachzentrum)
Art 22 der Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen vom 7 12 1998; Art 28 der Agrareinfuhrverordnung vom 7 12 1998
Kontrolle der Konformität der Qualität beim Export von Gemüse und Obst nach den ECE/UNONormen; 1 2 2001 bis 31 12 2001
Kontrolle der Konformität der Qualität bei Marktentlastungsmassnahmen für Steinobst nach den Qualitätsvorschriften des Bundesamtes; 1 2 2001 bis 31 12 2001
Art 20 der Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen vom 7 12 1998
Art 1 und 12 der Verordnung über die Massnahmen bei Obst vom 7 12 1998
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 139 2
Entschädigung Leistungsvereinbarung 0 0 0 175 000 Fr 190 000 Fr 30 000 Fr 0 3 Verwaltete Mittel 2001 2,6 Mio Fr 2 1 Mio Fr 2 0,3 Mio. Fr. 2 0 0 0 0
2 Durch Auftragnehmerin verwaltete finanzielle Mittel 3 Massnahme wurde nicht durchgeführt Quelle: BLW
Die Spalte «Entschädigung Leistungsvereinbarung» zeigt den Betrag, den die Vertragspartner für die administrativen Vollzugsdienstleistungen gestützt auf die Verträge erhalten In der Spalte «Verwaltete Mittel 2001» werden die finanziellen Mittel aufgeführt, welche für die Marktstützung 2001 ausgegeben wurden. Es lassen sich grundsätzlich zwei Gruppen von Leistungsvereinbarungen unterscheiden:
In den Bereichen Milch, Fleisch und Spezialkulturen werden den Vertragspartnern administrative Dienstleistungen im Rahmen des Vollzugs, wie beispielsweise die Erstellung von Abrechnungsbelegen, die Erfassung und Kontrolle von Inlandleistungen oder die Durchführung und Kontrolle der Einlagerung von Fleisch, vergütet Die Vertragspartner verwalten keine finanziellen Mittel
Die Vertragspartner in den Bereichen Zucker, Ölsaaten, Speise- und Saatkartoffeln, Saatmais und Futterpflanzen-Saatgut verwalten die Bundesmittel, welche sie für den Verarbeitungs-, Verteilungs- oder Produktionsauftrag verwenden. Ihre eigenen Administrationskosten dürfen damit jedoch nicht gedeckt werden Diese sind beispielsweise über Mitgliederbeiträge zu finanzieren Allfällige Gebühren zur Deckung der administrativen Kosten müssen vom EVD genehmigt werden
Die Leistungsvereinbarung Ölsaaten ist auf Ende 2003 befristet. Der erste Verarbeitungsauftrag Zucker und die Verwertungsaufträge für Kartoffeln und Saatkartoffeln gelten dagegen nur bis und mit der Ernte 2002 Diese Leistungsvereinbarungen sind deshalb auf ihre Wirkung und Effizienz hin bereits im Jahr 2002 zu überprüfen. Die Erkenntnisse daraus werden in die zukünftige Ausgestaltung einfliessen Die beiden Produktionsaufträge für Mais- und für Futterpflanzensaatgut sind nicht befristet und können ohne Verordnungsänderung jährlich erneuert werden

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 140
■ Einfuhrregelungen im Wandel
Instrumente des Aussenhandels
Zur Unterstützung einer produktiven Landwirtschaft werden Importe von Agrarprodukten mit Einfuhrregelungen gesteuert. Obschon derartige Instrumente bereits lange Anwendung finden, werden sie laufend neuen Gegebenheiten angepasst Einfluss auf die Einfuhrregelungen haben sowohl internationale als auch inländische Entwicklungen im Agrarbereich
Die folgenden Abschnitte geben einerseits einen Überblick, wie in den letzten Jahren Einfuhrregelungen einzelner Produkte oder Produktegruppen weiterentwickelt wurden, und anderseits, wie sich der Vollzug der Einfuhrregelungen verändert
■ Veränderungen bei den Zuteilungskriterien von Zollkontingenten
Sowohl für den Importeur als auch die Verwaltung ist der so genannte Windhund an der Grenze (Reihenfolge der Verzollungen nach dem Prinzip «first come, first served») das einfachste Verfahren für die Zuteilung eines Zollkontingents Das Zollkontingent muss nicht zum Voraus zugeteilt werden und der Importeur kann sich laufend über den Stand der Ausnützung auf der Homepage der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) (www zoll admin ch) informieren In den letzten Jahren sind die folgenden Zollkontingente auf Windhund an der Grenze umgestellt worden:
– Wein (seit 1 Januar 2001, vorher getrennte Marktordnungen: Versteigerung des Weissweinkontingents und Windhund bei Rotwein);
– Konsum- und Verarbeitungseier (seit 1 Januar 2002, vorher Zuteilung nach Massgabe der Inlandleistung, bzw Windhund bei der Bewilligungsstelle);
Esel, Maultiere und Maulesel (seit 1 Januar 2002, vorher Versteigerung)
Auch die Konzessionen der Schweiz im Rahmen der bilateralen Verträge mit der EU, die mengenmässig begrenzte zollfreie Einfuhren zulassen, werden teilweise auf diese Art verteilt Bestimmte Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein, damit dieses Verfahren angewendet werden kann: das Zollkontingent muss genügend gross sein in Bezug auf die inländische Nachfrage nach Importprodukten und die Einfuhren erfolgen, bedingt durch gewisse Eigenschaften der Produkte, ziemlich gestaffelt, so dass nicht einzelne Importeure mit raschen, übergrossen Importen eine marktbeherrschende Stellung erlangen können Deshalb werden andere Zuteilungskriterien weiterhin von Bedeutung sein
Die Versteigerung erlaubt eine wettbewerbsgerechtere Verteilung von Zollkontingenten. Sie bietet den Vorteil, dass alle Marktteilnehmer die gleichen Chancen für das Erlangen von Kontingentsanteilen haben Deshalb wurde dieses Kriterium in den letzten Jahren neu eingeführt bei
– Tieren der Rindergattung (vorher Windhund bei der Bewilligungsstelle);
– Käse (vorher Zuteilung auf Grund der Importe im Vorjahr);
Brotgetreide (vorher Inlandleistung) und
– Nutz- und Sportpferde (vorher Inlandleistung)
In der vom Bundesrat am 29 Mai 2002 verabschiedeten Botschaft AP 2007 wird die Versteigerung auch für die Kontingente im Fleischbereich vorgeschlagen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 141 2
–
–
■ Sind die Importrechte einseitig verteilt?
Einseitig verteilte Importrechte könnten zu Marktverzerrungen führen. Mit geeigneten Mitteln soll deshalb erreicht werden, dass der Zugang zu Importrechten möglichst allen Interessierten offen steht Um dieser Anforderung gerecht zu werden, werden Instrumente bevorzugt, die tendenziell zu einer breiten Verteilung der Zollkontingentsanteile führen Zugleich ist zu verhindern, dass Akteure Importrechte zugeteilt erhalten, die diese nur zu spekulativen Zwecken erlangen möchten, oder die effektiv gar nicht importieren wollen In einem zunehmend spezialisierten Handel konzentrieren sich die Importfirmen immer mehr auf einzelne Produkte und Produktegruppen Dies sind Argumente, die für eine gezielte, eher schmale Verteilung sprechen

Voraussetzung für die Berechtigung an einem Zollkontingentsanteil ist eine Generaleinfuhrbewilligung (GEB) für ein bestimmtes Produkt oder eine Produktegruppe. Damit eine solche erteilt wird, hat die natürliche oder juristische Person oder Personengemeinschaft verschiedene Auflagen zu erfüllen Für das Erlangen bestimmter Zollkontingentsanteile wird vorausgesetzt, dass die Person im entsprechenden Bereich nachweislich gewerbsmässig Handel treibt, z B im Bereich von Frischgemüse und -obst Somit ist die Berechtigung für das Erlangen von Zollkontingentsanteilen eingeschränkt
Andere Massnahmen dienen dazu, dass die Anteile nicht nur einzelnen Importeuren zugeteilt werden Beim Verfahren «Windhund bei der Bewilligungsstelle» (Reihenfolge des Eingangs der Gesuche) ist sicherzustellen, dass die zugeteilten Anteile auch importiert werden. Dies wird erreicht, indem die Ausnützung an eine Frist geknüpft und die nicht gebrauchte Menge neu zugeteilt wird Zusätzlich ist der maximale Zollkontingentsanteil pro Gesuch oder pro Importeur beschränkt
Wird ein Zollkontingent versteigert, bleibt das Verhindern von Preisabsprachen wichtig Werden solche vermutet, bringt das BLW diese dem Sekretariat der Wettbewerbskommission zur Anzeige, damit dieses die notwendigen Schritte für einen allfälligen Ausschluss der an der Absprache beteiligten Bieterinnen und Bieter vom Zuteilungsverfahren veranlassen kann.
Bei Zuteilungskriterien, die auf Inlandleistung, auf den Importen des Vorjahres oder einer Kombination der beiden Kriterien beruhen, ist eine breite Verteilung der Importrechte in der Regel gewährleistet Unterstützt wird diese durch Zuteilung von Minimalmengen (z B bei Schnittblumen), durch Zollkontingentsanteile für Neueinsteiger auf Gesuch (z B bei Tiefkühlgemüse), oder mit Phasen mit unbeschränkter Importmöglichkeit (freie Phase bei allen Früchten und Gemüsen) Zudem lösen Importe ausserhalb des Zollkontingents ebenfalls Importrechte für die Folgeperiode aus. Ist die Inlandleistung teilweise oder ausschliesslich Grundlage für eine Zuteilung, widerspiegelt sich die Marktstärke im Inland bei den Importrechten Dies kann zu einer gewissen Konzentration der Anteile führen.
Einen Überblick über die Zuteilung der Zollkontingentsanteile und deren Ausnützung bietet der jährlich erscheinende Separatdruck zum Bericht des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen Bereits der Umfang der Publikation zeigt, dass die meisten Zollkontingente breit verteilt sind. Bei jenen Kontingenten, die nur von einer geringen Anzahl Importfirmen ausgenützt werden, handelt es sich zum Teil um eine Konzentration, die auf die Übertragung der Ausnützungsrechte nach Artikel 14 der Agrareinfuhrverordnung zurückzuführen ist.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 142
■ Nachforderung von geschuldeten Einfuhrabgaben
Bei den verschiedenen Einfuhrregelungen treten nicht selten Unstimmigkeiten auf. Kontingentsanteile werden überschritten oder Einfuhren werden ohne Berechtigung zum tiefen Kontingentszollansatz (KZA) getätigt Das BLW unterbreitet den Importeuren seit 1998 eine Kontingentskontrolle zur Stellungnahme, wenn es solche Unstimmigkeiten feststellt Konnten diese auf Grund der Stellungnahme seitens der Importeure nicht bereinigt werden, erstellte das BLW ein Dossier zu Handen der EZV, welche für die Weiterbehandlung der Fälle nach Artikel 175 Absatz 2 des LwG verantwortlich zeichnet Für Verzollungen ab 1 Januar 2002 hat der Bundesrat neu dem BLW die Kompetenz übertragen, im Auftrag der EZV die geschuldeten Einfuhrabgaben in Rechnung zu stellen Bezahlt der Importeur die Abgaben fristgerecht, ist die Unstimmigkeit bereinigt Wenn der Importeur auf die Zahlung verzichtet, die Widerhandlungen wiederholt auftreten, oder der begründete Verdacht auf vorsätzliches Handeln besteht, werden die Fälle weiterhin von der EZV behandelt Vorbehalten bleiben auch Verwaltungsmassnahmen nach LwG
Mit der Kompetenzdelegation von der EZV zum BLW werden die Verwaltungsabläufe gestrafft und die Importeure besser über Fehler informiert Zugleich erhalten die Importeure die Möglichkeit, Fehler ohne weiteren Verzug zu bereinigen Vom neuen Instrument darf überdies erwartet werden, dass in Zukunft weniger Unstimmigkeiten auftreten. Die Betroffenen dürften ihre Sorgfaltspflicht besser wahrnehmen, wenn sie sich anhand der Rechnungen der grossen Differenzen zwischen den Zollansätzen innerhalb und ausserhalb des Kontingents bewusst werden
■ Ein- und Ausfuhr von Verarbeitungsprodukten (Schoggigesetz)
In der ersten Hälfte des Berichtsjahres bewirkten die hohen Auslandpreise gegenüber den stabilen Inlandpreisen eine Reduktion der Rohstoffpreisdifferenzen Die Ausfuhrbeiträge beispielsweise für Milchprodukte konnten im Vergleich zum Jahresbeginn zwischen 6 und 8% gesenkt werden. In der zweiten Hälfte setzte bei den Auslandpreisen eine Talfahrt ein, die im letzten Quartal enorme Ausmasse annahm (EUMilchpulver bis 27% Preisnachlass innert drei Monaten) Diese Preissenkungen werden sich allerdings erst im Jahr 2002 auf die Ausfuhrbeiträge auswirken. Von der im Bundesbugdet für das Jahr 2001 für Ausfuhrbeiträge enthaltenen Summe von 114,9 Mio Fr – entspricht dem WTO-Plafonds – wurden lediglich 98,6 Mio Fr ausgeschöpft, dies obwohl für die Monate November und Dezember 2001 die Butter wahlweise im Veredlungsverkehr ein- und ausgeführt oder mit Ausfuhrbeiträgen ausgeführt werden konnte
Die Entwicklung des Milchmarktes lässt vermuten, dass 2002 keine Ergänzungseinfuhren von Butter mehr notwendig sind. Den Begehren der Milchproduzenten wurde deshalb Rechnung getragen, indem die Butter ab April 2002 bis auf weiteres wahlweise im Veredlungsverkehr oder mit Ausfuhrbeiträgen ausgeführt werden kann Damit dürfte mehr inländische Butter in Verarbeitungsprodukten exportiert und die zur Verfügung stehende Summe für Ausfuhrbeiträge besser ausgeschöpft werden
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 143 2
Neu sind in den dargestellten Ausfuhrmengen Butter, Hartweizengriess, pflanzliche Fette und Zucker, welche im Veredlungsverkehr ein- und ausgeführt wurden, ebenfalls enthalten

144 2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
Ausfuhrmengen i n t Quellen: EZV, BLW 0 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 92 000 204 000 212 000 238 000 1991/92 1999 2000 2001 Ausfuhrbeiträge M i o F r Quellen: EZV, BLW 0 200 150 100 50 180 130 112 98 1991/92 1999 2000 2001
■ Ausblick Die Einfuhrregelungen werden auch künftig den laufenden Entwicklungen angepasst. Im Rahmen von internationalen Verhandlungen werden der Marktzutritt und die Höhe der Zölle weiterhin ein Thema bleiben Auf nationaler Ebene dürften mit der vorgesehenen Erweiterung des elektronischen Verzollungssystems der EZV die aufwändigen Verfahren der nachträglichen Nacherhebung von Einfuhrabgaben weitgehend entfallen Das Projekt sieht vor, dass die Zollkontingentsanteile der einzelnen Importeure ins elektronische System eingegeben werden Ist eine zu verzollende Warenpartie grösser als der entsprechende Anteil, wird eine Verzollung innerhalb des Kontingents nur bis zu dessen Ausschöpfung möglich sein In Zukunft sollten so Kontingentsüberschreitungen oder ein Import zum Kontingentszollansatz ohne entsprechenden Anteil bereits bei der elektronischen Verzollung verhindert werden können
Kontrollen und Untersuchungen
Die Neuorientierung der Agrarpolitik mit der vermehrten Trennung von Preis- und Einkommenspolitik hat ebenfalls Auswirkungen auf den Kontrollbereich des BLW Mit der Aufnahme der Tätigkeiten des Finanzinspektorates (Interne Revisionsstelle des Amtes) wurde die bestehende Sektion Inspektorat neu organisiert, umbenannt und unter einer neuen Leitung zur Sektion Finanzinspektorat zusammengefasst. Im Kapitel 2 4 Finanzinspektorat wird dieser Organisationsprozess näher erläutert und beschrieben
Die Inspektoren des Bereichs Feldkontrolle führen Kontrollen, Abklärungen, Ermittlungen und Untersuchungen in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Gesetzgebung von Produktion und Absatz bzw für die Fachstellen des Amtes durch Abklärungen, Untersuchungen und Befragungen im Zusammenhang mit Widerhandlungen gegen die Landwirtschaftsgesetzgebung werden in Zusammenarbeit mit eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Untersuchungsbehörden, mit privaten Organisationen und anderen Rechtshilfestellen vorgenommen
Der Bereich Feldkontrolle führte im Berichtsjahr 1'241 Kontrollen und 17 Finanzrevisionen durch Diese Prüfungen fanden in den folgenden Bereichen statt:
– Milch- und Milchprodukte mit 568 Kontrollen und 2 Finanzrevisionen;
Getreide mit 316 Kontrollen und 1 Finanzrevision;
– Kartoffeln mit 202 Kontrollen und 2 Finanzrevisionen;
Gemüse, Obst und Schnittblumen mit 111 Kontrollen und 1 Finanzrevision;
– Fleisch und Eier mit 43 Kontrollen und 2 Finanzrevisionen;
– Landwirtschaftliche Forschung mit 6 Finanzrevisionen;
Pflanzenschutz mit 1 Kontrolle sowie Ökologie, Zucker und Absatzförderung mit je 1 Finanzrevision
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 145
–
–
–
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Kontrolltätigkeit im Berichtsjahr
■ Widerhandlungen
Die Kontrollen und gegebenenfalls die Untersuchungen werden von den Inspektoren gemäss Auftrag der jeweiligen Fachsektionen durchgeführt Je nach Resultat werden die Unterlagen zur weiteren Bearbeitung verteilt:
– An die auftraggebende Fachsektion zur Ergreifung von Verwaltungsmassnahmen und/oder
Über die Juristin der Sektion Finanzinspektorat an die Sektion Recht- und Verfahren zur Beurteilung von eindeutigen Straftatbeständen
Im Berichtsjahr wurden 29 Widerhandlungsfälle eröffnet und zur Bearbeitung weitergeleitet Davon konnten bis Mitte 2002 gesamthaft 27 Fälle erledigt werden
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 146
–
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1.2 Milchwirtschaft
Insgesamt hat sich die neue Milchmarktordnung im Berichtsjahr weiter konsolidiert. Im Jahr 2001 sind bezüglich Menge und Preisstützung Änderungen vorgenommen worden Dank günstiger Absatzlage erhöhte der Bundesrat die Kontingente zu Beginn des Milchjahres 2001/2002 um 3% Der vom Zahlungsrahmen her gegebene Stützungsabbau wurde vollumfänglich auf die Beihilfen überwälzt Einzelne Ansätze wurden dabei auf Null gesenkt (Käseexport)
Massnahmen 2001/2002
1 nur noch für Weichkäse mind 45% FiT und Feta aus Kuhmilch mind 45% FiT
2 nur für bestimmte Verwendungszwecke
3 nur bei Importverzicht
4 nach Käsesorte und Destination (EU – andere Länder) differenziert
5 nicht für Konsummilch Quelle: BLW
Das Produzentenpreisniveau blieb gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert trotz beschlossener Mengenausdehnung im Milchjahr 2001/2002 und trotz der Reduktion der Stützung. Die Stützungsmassnahmen sind mit der Zulage für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage schwerpunktmässig weiterhin auf den Käse ausgerichtet

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
Produkt Käse Butter Magermilch Milchpulver Konsummilch Rahm Frischmilchprodukte Massnahme Grenzschutz ■■■■■ Zulagen ■ Inlandbeihilfen ■ 1 ■ 2 ■ 2 ■ 3 Ausfuhrbeihilfen ■ 4 ■■ 5
147
■ Finanzielle Mittel 2001
Tabelle 27, Seite A28
Im Jahr 2001 sind die Ausgaben des Bundes zu Gunsten der Milchwirtschaft weiter abgebaut worden Im Vergleich zum Vorjahr standen im Berichtsjahr rund 50 Mio Fr oder 7% weniger zur Verfügung
Für die Preisstützung wurden im Milchbereich insgesamt 666,1 Mio Fr ausgegeben Davon beanspruchte der Bereich Käse 486,1 Mio Fr (73%) 104,3 Mio Fr (16%) wurden im Butterbereich und 69,0 Mio Fr (10%) im Pulverbereich eingesetzt Wie im Vorjahr wurden für die Administration 6,7 Mio Fr (1%) benötigt
Mittelverteilung 2001

Total 666,1 Mio. Fr.
16%
26%
Administration 1%
Zulagen 57%
Quelle: BLW
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 148
Inlandbeihilfen
Ausfuhrbeihilfen
■ Handel mit Milchkontingenten bleibt eine beliebte Massnahme
Milchkontingentierung
Die Statistik «Auswertung der Daten über die Milchkontingentierung; Milchjahr 2000/2001» gibt einen Überblick über die strukturellen Veränderungen in der Milchproduktion: Die Anzahl Milchproduzenten ist von 50'334 im Milchjahr 1990/1991 auf 38‘082 im Milchjahr 2000/2001 (–24,3%) zurückgegangen In der gleichen Periode nahm das durchschnittliche Kontingent pro Betrieb von 58'861 kg auf 79'181 kg (+36,5%) zu Während die Anzahl Milchproduzenten in diesem Zeitraum um knapp einen Viertel abnahm, erhöhte sich das durchschnittliche Kontingent um gut einen Drittel
Die Milchproduzenten konnten auf Gesuch hin die gesamten Überlieferungen des Milchjahres 2000/2001 auf die Folgeperiode übertragen, anstatt dafür die Abgabe zu bezahlen Diese auf das Milchjahr 2000/2001 beschränkte Möglichkeit wurde gewährt, um den Markteinbruch als Folge von BSE sowie Maul- und Klauenseuche zu mildern Die Belastung der Produzenten mit Überlieferungsabgaben wurde dadurch erheblich reduziert Die Summe der Abgaben betrug knapp 180‘000 Fr gegenüber 700‘000 Fr im Vorjahr
Dementsprechend zahlreich waren Kontingentsüberschreitungen: 22'839 Produzenten überlieferten im Durchschnitt 3'400 kg In der Vorjahresperiode übertrugen 15‘688 Produzenten durchschnittlich 1'782 kg auf das Folgejahr
Im Milchjahr 2000/2001 haben 3'763 Produzenten rund 73'523 t Kontingente gekauft und 10'118 Produzenten rund 155'844 t gemietet Die übertragene Menge erreichte 229'000 t oder 7,6% der total verteilten Kontingentsmenge
Kontingentshandel
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 149 2
Einheit 2000/2001 1 2001/2002 2 Verkauf Beteiligte Produzenten Anzahl 2 820 2 455 Milch total Mio kg 73,5 72,4 je Übertragung Kg 26 072 29 495 Vermietung Beteiligte Produzenten Anzahl 7 813 7 316 Milch total Mio kg 155,8 140,8 je Übertragung Kg 19 947 19 245 1 definitive Daten 2 provisorische Daten Quelle: BLW
■ Milchkontingente um weitere 1,5% erhöht
Der Strukturanpassungsprozess der landwirtschaftlichen Betriebe ist mit erheblichen Kosten verbunden Die flächenunabhängigen Kontingentsübertragungen verschaffen den Produzenten im Milchbereich den nötigen Spielraum für Strukturanpassungen Die Beschaffung der Produktionsrechte fallen für die aktiven Milchproduzenten relativ stark ins Gewicht Im Milchjahr 2000/2001 mussten schätzungsweise für den Kauf 110 Mio Fr und für die Miete 19 Mio Fr aufgewendet werden In den beiden Milchjahren 1999/2000 und 2000/2001 dürften es insgesamt 233 Mio Fr gewesen sein
Kosten zu Lasten aktiver Milchproduzenten 1999/2000 und 2000/2001
Den Milchproduzenten, die ihren Betrieb zu spezialisierten Milchviehbetrieben entwickeln wollen, vermindert dieser Mittelabfluss die erzielbare Rentabilitätsverbesserung beträchtlich. Dadurch wird die angestrebte Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt
Auf Grund der guten Verfassung der Milchproduktemärkte wurde den Produzentinnen und Produzenten zu Beginn des Milchjahres 2001/2002 eine Kontingentsmenge von 3% oder rund 90'000 t gewährt Die Regelung wurde so gewählt, dass diese zusätzliche Menge grundsätzlich auch für die folgenden Milchjahre gilt Zu Beginn des Jahres 2002 wurde die Produktions- und Absatzlage erneut analysiert und festgestellt, dass eine weitere Erhöhung der Gesamtmenge um 1,5% oder rund 45'000 t auf das Milchjahr 2002/2003 hin vertretbar war Insgesamt beträgt die zusätzliche Menge damit 4,5%.
■ Ausblick
Auf den 1 Mai 2001 wurde der Zukauf von «kontingentsberechtigten» Tieren aus dem Berggebiet auf das ganze Jahr ausgedehnt und die Zusatzkontingente von 1'500 auf 2'000 kg erhöht Damit wurde die Arbeitsteilung zwischen Berg- und Talgebiet weiter flexibilisiert Die neue Regelung erforderte gleichzeitig auch eine Anpassung der Gesuchsfrist: Ab 1 Januar 2002 müssen die Gesuche innert 60 Tagen nach dem Zukauf des Tieres eingereicht werden.

Auf den 1 Januar 2002 wurde die Funktion des Zuchtbuchführers teilweise geändert Die Kontrolle der Haltedauer im Berggebiet musste entsprechend angepasst werden. Bis eine vollständige Kontrolle mittels Angaben aus der Tierverkehrsdatenbank (TVD) möglich ist, gibt es eine Übergangsregelung in den Bereichen Gesuchsstellung und Kontrolle Damit ist sichergestellt, dass die zuständigen kantonalen Amtsstellen die Anforderungen an die zugekauften Tiere weiterhin kontrollieren und das Ergebnis den Administrationsstellen «Milchkontingentierung» melden können.
Parallel dazu trifft das BLW die nötigen Vorbereitungen, damit die Kontrolle der Anforderungen ab 1. Januar 2003 direkt über die TVD abgewickelt werden kann.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 150
Menge Preis 1 Betrag Mio kg Fr /kg Mio Fr Kontingentskauf 133,4 1 40 187 Kontingentsmiete 458,1 0 10 46 Total 591,5 - 233
Quelle: BLW
1 vorsichtige Annahme
Marktstützung mit Zulagen und Beihilfen
Das Instrumentarium zur Marktstützung hat sich im Berichtsjahr nicht geändert Durch die Überwälzung des Stützungsabbaus von 50 Mio. Fr. sind allerdings die Beihilfen erheblich reduziert worden Davon betroffen ist auch der Milchpulvermarkt, dessen Bedeutung in der Milchwirtschaft oft unterschätzt wird; er soll deshalb nachstehend näher vorgestellt werden
Die Nachfrage nach Frischmilchprodukten und auch nach Käse ist relativ konstant Bei der Milchproduktion hingegen sind saisonale Schwankungen zu beobachten In Perioden mit hoher Produktion fliesst deshalb ein Teil der Milch in die Herstellung von haltbaren Produkten wie Butter und Milchpulver Die Milchpulverproduktion schwankt dementsprechend erheblich Da Milchpulver lagerfähig ist, wird in den milchstarken Frühjahrsmonaten mehr davon produziert. Die Milchindustrie greift in den produktionsschwachen Milchmonaten darauf zurück
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 151 2
Produktion Milchpulver 2001 i n t Quelle: TSM 0 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 15 559 Vollmilchpulver 178 Buttermilchpulver 18 736 Magermilchpulver 5 354 Milchkondensat 1 841 Molkepulver
■ Der Milchpulvermarkt
Magermilchpulver (MMP)
Die Produktionsmengen von MMP sind abhängig von der produzierten Milchmenge und der Art ihrer Verwertung Die wirtschaftlich bedingte Tendenz zur Schliessung von Zentrifugierstellen vermindert den Absatz von Magermilch zur Flüssigverfütterung und erhöht im Prinzip die Produktion von MMP
In der einheimischen Nahrungsmittelindustrie findet MMP als Eiweissträger vielfältige Anwendung In verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkten für den Export ist MMP als Agrargrundstoff beitragsberechtigt Im Berichtsjahr wurden ca 3'300 t MMP in Verarbeitungsprodukten exportiert
Der Absatz von MMP im Inland ist auch im Fütterungsbereich bedeutungsvoll. Im Berichtsjahr wurden 7'921 t MMP zu Milchersatzfuttermitteln verarbeitet Für die Verarbeitung von MMP in Milchersatzfuttermitteln werden Beihilfen ausgerichtet Voraussetzung für die aktuelle Beihilfe von Fr. 1.– je kg MMP ist, dass der Anteil MMP mindestens 30% des Endproduktes beträgt
Über die beiden erwähnten Absatzkanäle kann nicht die gesamte Menge an MMP vermarktet werden Die verbleibenden Mengen werden deshalb mit Beihilfen exportiert. Die Branchenorganisation Schweizer Milchpulver (BSM) koordiniert diese Exporte. Im Berichtsjahr umfassten sie 2'435 t Die Exportbeihilfe beträgt seit dem 1 Mai 2002
Fr 1,507 je kg MMP oder 31 Rp je Gehaltsäquivalent Um die Konkurrenzfähigkeit weiter zu verbessern, setzen die Milchproduzenten und die Milchpulverhersteller zusätzlich Eigenmittel dafür ein
Nachdem sich die Weltmarktpreise für Milchpulver während den vergangenen Jahren auf einem erfreulich hohen Niveau halten konnten, setzte gegen Ende 2001 eine Talfahrt ein, deren Ende noch nicht in Sicht ist. Etwas weniger betroffen sind die Pulverspezialitäten Mit der Herstellung und dem überwiegenden Export von Milchpulvern mit einem Milchproteinanteil von deutlich über 80% wird in der Schweiz eine zukunftsgerichtete Technologie eingesetzt. Diese Produkte wie auch die aufgeschlossenen Milcheiweisse weisen eine Vielzahl von spezifischen Eigenschaften wie beispielsweise die Verbesserung des Wasserbindungsvermögens oder der Schlageigenschaften auf Um im hochpreisigen Schweizer Umfeld bestehen zu können, sind vermehrte Anstrengungen bei der Vermarktung von Spezialmilchpulvern notwendig
Vollmilchpulver (VMP)
VMP wird u a als Geschmacksträger mit guten Eigenschaften nicht nur in Schokolade, sondern auch in vielen anderen Produkten wie Kindernährmitteln, Biskuits, Suppen oder Fertigdesserts verwendet Ein wichtiger Abnehmer sind nebst der Nahrungsmittelindustrie auch die Hilfswerke Sauberes Wasser vorausgesetzt, bildet aufgelöstes Vollmilchpulver in Krisengebieten eine wichtige Ergänzungsnahrung. VMP ist weniger lange lagerfähig als MMP
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 152
■
Mit der Einführung der neuen Milchmarktordnung wurde die Konkurrenzfähigkeit des einheimischen VMP beitragsmässig verbessert Die Nahrungsmittelindustrie hat in der Folge überwiegend auf den Import von VMP zu Gunsten der einheimischen Produktion verzichtet. Dies ist auch Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe auf VMP.
Im Berichtsjahr verarbeitete die Nahrungsmittelindustrie 22'680 t VMP Die Kondensmilch, welche als Vorstufe zur VMP-Herstellung bezeichnet wird, ist in diesen Zahlen berücksichtigt
Für die schweizerische Milchwirtschaft ist es wichtig, dass die Lebensmittelindustrie auch in Zukunft inländisches VMP verarbeitet
Wie beim MMP sinken derzeit die Weltmarktpreise auch für VMP stark Sollte dieser Trend anhalten, würden die Lebensmittelfabrikanten, sofern nicht Gegenmasssnahmen ergriffen werden, aus Kostengründen vermehrt auf den Import von VMP umstellen (z.B. Mischrechnung: ein Teil Import und vier Teile Inland)
Molkenpulver
Die künftige Herausforderung für die Molkenpulver-Hersteller in der Schweiz ist, neue Produkte zu entwickeln, um der Nachfrage des Marktes nach innovativen Produktelösungen gerecht zu werden Molke kann nicht nur in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, sondern auch in der Kosmetik Unternehmen, die Molke verarbeiten, werden zukünftig nicht nur Rohstoff anbieten, sondern auch hochwertige Substanzen aus Molke herstellen
Auf den 1 Mai 2002 wurden verschiedene Beihilfen reduziert Der durchschnittliche Abbau beträgt rund 23%. Tiefer sind die Ansätze der Inland- und Ausfuhrbeihilfen, die Zulage für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage bleiben hingegen unverändert Von der Reduktion sind in erster Linie die Butter- und Magermilch-Verbilligungen sowie die Exportbeiträge für Emmentaler, Sbrinz, Weichkäse und andere Milchprodukte betroffen Die Stützungen im Bereich Pulverexport, MMP in Milchersatzfuttermitteln, Verfütterung von flüssiger Magermilch und verarbeitetes Vollmilchpulver wurden ebenfalls gesenkt Die Anpassungen im Eiweisssektor sind so konzipiert, dass bei der Verfütterung von Magermilch nass oder getrocknet, in etwa die gleichen Beihilfen ausbezahlt werden Am 1 Juni 2002 trat ausserdem das Käseabkommen mit der EG in Kraft
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 D I E A G R A R P O L I T I S C H E N M A S S N A H M E N 153 2
Vorgaben für 2002
2.1.3 Viehwirtschaft
Der Grenzschutz ist das wichtigste Instrument zur Unterstützung der inländischen Fleischproduktion; für die Eierproduktion sind es die Inlandbeihilfen
Im Berichtsjahr machte die Proviande keinen Gebrauch von ihrer Kompetenz, Marktabräumung in Schlachtbetrieben für Tiere der Rindvieh-, Pferde- und Schweinegattung durchzuführen Auch wurde kein Schweinefleisch mit Beiträgen verbilligt oder eingelagert Die Kaninchen-, Straussen-, und Wildfleischproduktion wird vom Bund nicht spezifisch mit Beihilfen gestützt Dieses Fleisch kann ohne Mengenbegrenzung zu einem fixen Zoll eingeführt werden

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 154 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Massnahmen 2001 Tier/Produkt Rinder Kälber Schweine Pferde Schafe Ziegen Geflügel Eier Massnahme Grenzschutz ■■■■■■■■ Marktabräumung ab öffentlichen Märkten ■■■ Marktabräumung in Schlachtbetrieben ■■■■■ Einlagerungsaktionen ■■■ Verbilligungsaktionen ■■■ Praxisnahe Versuche ■ Umstellungsbeiträge ■ Sammel- und Sortierkostenbeiträge ■ Aufschlagsaktionen und Vermarktungsmassnahmen ■ Verwertungsbeiträge Schafwolle ■ Ausfuhrbeiträge 1 ■■■■ Höchstbestände ■■■■ 1 beschränkt auf Zucht- und Nutzvieh Quelle: BLW
■ Finanzielle Mittel 2001
Tabelle
Im Jahr 2001 budgetierte der Bund 47,4 Mio. Fr. für Massnahmen der Viehwirtschaft. Rund zwei Drittel dieser Mittel stammen aus zweckgebundenen Zollanteilen, die auf Einfuhren von Fleisch, Eiern und Eiprodukten erhoben werden und in den Fleischfonds und die Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte fliessen. Die Ausgaben beliefen sich auf 46,4 Mio Fr , wobei es zahlreiche Mittelverschiebungen zwischen den Budgetrubriken gab
Mittelverteilung 2001
Total 46,4 Mio. Fr Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 13%
Leistungsvereinbarung Proviande 16%
Verwertungsbeiträge Schafwolle 2%
Ankauf Rindfleisch für humanitäre Zwecke 35%
Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh 1% Einlagerungs- und Verbilligungsbeiträge für Rind- und Kalbfleisch 33%
Quellen: Staatsrechnung, BLW
Die ausserordentlich schlechte Lage auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt veranlasste den Bundesrat mit drei Nachtragskrediten zusätzlich 23,5 Mio. Fr. bereit zu stellen Die Mittel wurden in den Rubriken Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh (7,0 Mio Fr ), Beihilfen Inlandeier (5,5 Mio Fr ), Ackerbaubeiträge (4,5 Mio Fr ) und Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge (6,5 Mio Fr ) vollständig kompensiert Für Massnahmen auf dem Schlachtvieh- und Fleischmarkt und die Entschädigung an die Proviande wurden annähernd 40 Mio. Fr. ausgegeben. Infolge der guten Situation auf dem Eiermarkt beanspruchte die saisonale Marktentlastung deutlich weniger Mittel Unerwartet deutlich gingen auch die ausgerichteten Sammel- und Sortierkostenbeiträge sowie die Umstellungsbeiträge zurück. Wegen der weiterhin zahlreichen BSE-bedingten Restriktionen umliegender Länder wurden lediglich 2% der budgetierten Beihilfen für den Zucht- und Nutzviehexport ausgenutzt Im Jahr 2002 dürften wieder vermehrte Absatzmöglichkeiten bestehen, weil Deutschland und Frankreich die BSE-bedingten Einfuhrrestriktionen für lebende Rinder per 30 November 2001 bzw 3 Mai 2002 aufgehoben haben Nach Frankreich können jedoch ausschliesslich Rinder ausgeführt werden, die nach dem 1 Januar 2001 geboren sind
Mit der Aufhebung der befristeten Sammel- und Sortierkostenbeiträge sowie der teilweisen Aufhebung der Umstellungsbeiträge per Ende 2001 reduzierte der Bund die Unterstützung der inländischen Eierproduktion um mehr als 4,5 Mio Fr
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 155 2
Seite A29
28,
■ Schlachtvieh und Fleisch: Leistungsvereinbarungen
Mit den Mitteln aus dem Fleischfonds werden alle Massnahmen im Schlachtvieh- und Fleischmarkt finanziert Seit dem 1 Januar 2000 erbringt die Proviande im Auftrag des BLW Dienstleistungen:
1 Neutrale Qualitätseinstufung auf überwachten öffentlichen Märkten und in Schlachtbetrieben
Im Jahr 2001 stufte die Proviande die Qualität der geschlachteten Tiere in den 42 grössten Schlachtbetrieben ein Massgebend für die Qualität ist bei Tieren der Rindvieh-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung die Handelsklasse, eine Kombination von Fleischigkeits- und Fettgewebeklasse; bei Tieren der Schweinegattung ist der Magerfleischanteil das Qualitätsmerkmal. Der Klassifizierungsdienst der Proviande mit mehrheitlich Teilzeitangestellten leistete in den Schlachtbetrieben über 45'000 Arbeitsstunden Insgesamt wurde im Berichtsjahr die Qualität von 80 bis 90% aller geschlachteten Tiere neutral bestimmt. Auf den überwachten öffentlichen Märkten stufte der Klassifizierungsdienst die Handelsklasse von allen aufgeführten Tieren der Rindviehund Schafgattung ein Die Proviande hat zudem in Zusammenarbeit mit einer privaten Unternehmung für ihren Klassifizierungsdienst ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut Das Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung hat diesen Dienst auditiert und am 21. November 2001 akkreditiert.
2. Überwachung von öffentlichen Märkten und des Marktgeschehens in Schlachtbetrieben sowie Durchführung von Marktentlastungsmassnahmen
Die Proviande organisierte im Jahr 2001 in Zusammenarbeit mit bäuerlichen Organisationen und/oder kantonalen Stellen 936 Grossvieh-, 485 Kälber- und 307 Schafmärkte. Die nicht verkauften Tiere teilte sie den Zollkontingentanteilsinhabern zu marktüblichen Preisen zu (Marktabräumung) Trotz der schwierigen Lage auf dem Schlachtviehmarkt nahmen die Zuteilungen beim Grossvieh gegenüber dem Vorjahr lediglich um 103 auf 3'020 Stück (St.) zu. Mit 60 zugeteilten Kälbern wurden sogar 108 St weniger als im Vorjahr zugeteilt Hingegen teilte die Proviande im Berichtsjahr mit 2‘397 Schafen (+2'105 St ) deutlich mehr Tiere als im Vorjahr zu

Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten 2001
Merkmal Einheit Kälber Grossvieh Tiere der Schafgattung
Überwachte öffentliche Märkte Anzahl 485 936 307
Aufgeführte Tiere St. 52 654 73 014 64 736
Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen % 17 19 24
Zugeteilte Tiere
(Marktabräumung) St 60 3 020 2 397
Quelle: Proviande
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 156
■ Importrente für Fleisch
Wegen der schwierigen Lage auf dem Rindfleischmarkt unterstützte der Bund mehrere Entlastungsmassnahmen Die Unternehmen der Fleischwirtschaft lagerten im Berichtsjahr insgesamt 1‘062 t Kalbfleisch und 3'100 t Rindfleisch ein und verkauften rund 35'000 Rindsstotzen verbilligt an Trockenfleischfabrikanten weiter. Im Weiteren wurden annähernd 2'000 t Rindfleisch für die internationale Nahrungsmittelhilfe angekauft Die Proviande organisierte und kontrollierte die Einlagerungen und Verbilligungen und führte den Rindfleischankauf im Auftrage des Bundes aus Das BLW zahlte die Beiträge den Verwertern von Schlachtvieh und Fleisch aus
3 Erfassung und Kontrolle der Gesuche um Zollkontingentsanteile
Die Zahl der eingereichten Gesuche lag mit 937 rund 6% tiefer als im Vorjahr. Die geltend gemachten Inlandleistungen wurden auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft, und bei Unklarheiten verlangte die Proviande zusätzliche Nachweise Alle Betriebe, welche eingesalzene Rindsbinden geltend machten, wurden zudem vor Ort überprüft Nach der Erfassung und Kontrolle leitete die Proviande die elektronisch erfassten Daten ans BLW weiter Die Zollkontingentsanteile wurden vom BLW am 23 November 2001 mittels Verfügung zugeteilt
Das BLW hat im Auftrag der Subkommission 7 der Finanzkommission des Nationalrates einen Bericht über Importrenten beim Fleisch erstellt Unter dem heutigen System mit Inlandleistung kann die Rente maximal die Grössenordnung von 300 Mio. Fr. pro Jahr erreichen Dieses Maximum ergibt sich als Differenz zwischen Verkaufs- und Einstandspreis des Importeurs oder Grossisten für das importierte Fleisch multipliziert mit der Fleischmenge Bei vollständigem Wettbewerb wird die Importrente an die Konsumentenschaft und/oder an die Produzenten weiter gegeben Wie weit der Wettbewerb spielt und wer am Schluss vom Unterschied zwischen Verkaufs- und Einstandspreis des importierten Fleisches profitiert, kann nicht festgestellt werden Die maximale Importrente resultiert aus Fleischimporten von Geflügel (41%), Rind (36%), Lamm (11%), Schwein (5%) und anderen wie Pferde- und Ziegenfleisch (7%). Die versteigerten Wurstwaren und Fleischspezialitäten, die Importe im Rahmen des Veredlungsverkehrs und die Importe zum AKZA wurden nicht in die Berechnungen einbezogen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 157 2
■ Eier: Unterstützung der inländischen Produktion
Die Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte, die aus zweckgebundenen Zollanteilen geäufnet wird, steht für die Unterstützung der Inlandeierproduktion auf bäuerlichen Betrieben und zur Finanzierung von Verwertungsmassnahmen zu Gunsten der Schweizer Eier zur Verfügung. Für zwei befristete Übergangsmassnahmen wurden bis zum 31 Dezember 2001 Mittel aus dieser Kasse ausgerichtet:
1 Das BLW zahlte Sammel- und Sortierkostenbeiträge für die Übernahme von Konsumeiern bei ehemals geschützten Eierproduzentinnen und -produzenten Diese Beiträge in der Höhe von 3,27 Mio Fr für insgesamt 109 Mio Eier dienten im Berichtsjahr auch zur Preis- und Absatzstützung
2. Zur Förderung der tierfreundlichen Legehennenhaltung (RAUS und/oder BTS) richtete das BLW zusätzlich zu den RAUS- und BTS-Beiträgen Umstellungsbeiträge aus 135 Betriebe mit insgesamt 181'375 Legehennen erhielten im Jahr 2001 Beiträge in der Höhe von 1,37 Mio. Fr. Die Reduktion um 2,02 Mio. Fr. gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass zahlreiche Betriebe den auf drei Jahre beschränkten Umstellungsbeitrag bereits erhalten haben und damit im Berichtsjahr nicht mehr beitragsberechtigt waren

Im Weiteren können Aufschlagsaktionen und Vermarktungsmassnahmen bei saisonalem Überangebot an Schweizer Hühnereiern mit Mitteln der Preisausgleichskasse mitfinanziert werden Das BLW stellte nach Anhörung der interessierten Kreise maximal 2,5 Mio. Fr. für beide Massnahmen bereit; sie begannen nach Ostern und dauerten bis Ende Oktober 2001 Insgesamt schlugen die Eiprodukteunternehmen
7,9 Mio überschüssige Inlandeier auf, welche zu Eiprodukten verarbeitet wurden Zu Gunsten der Konsumentinnen und Konsumenten verbilligten die Anbieter 8,5 Mio Eier Weil die Lage auf dem Eiermarkt besser als erwartet war, wurden lediglich 1,09 Mio Fr zur Preisstabilisierung in der nachfrageschwachen Zeit nach Ostern benötigt.
Weiter unterstützt das BLW praxisnahe Versuche beim Geflügel sowie die Verbreitung der entsprechenden Ergebnisse bei der Bildung und Beratung. Nutzniesser sind die Geflügelzuchtschule in Zollikofen und das FiBL In folgenden Bereichen wurden Praxisversuche mit 255'700 Fr aus der Preisausgleichskasse unterstützt: Legeleistungsprüfung für Legehennen, Optimierung der Legehennenhaltung mit Grünauslauf, Wirkungen von bestimmten Fütterungsmethoden sowie des Coupierens und Touchierens der Schnäbel von Eintagesküken
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 158
■ Nutz- und Sportpferde: Versteigerung von Zollkontingentsanteilen
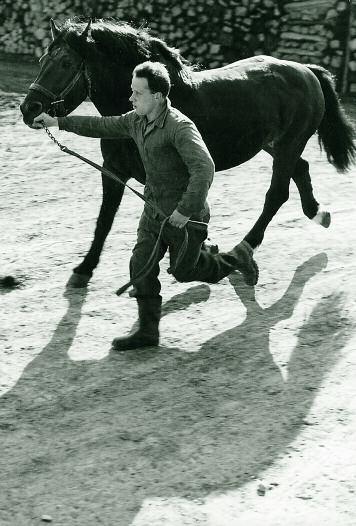
Am 21. September 2001 hat der Bundesrat beschlossen, die Direktzahlungen für RAUS und BTS für Geflügel zur Eierproduktion um je 100 Fr pro GVE zu erhöhen Die Umstellungsbeiträge werden bis Ende 2003 weiter ausgerichtet, allerdings lediglich für Legehennenhalterinnen und -halter, die zwischen 1997 und 2001 den Beitrag bereits ein- oder zweimal erhalten haben Dafür wird neu der Um- und Neubau von tierfreundlichen Haltungssystemen bis Ende 2006 mit einem einmaligen Investitionsbeitrag von 600 Fr pro GVE unterstützt Alle Änderungen traten am 1 Januar 2002 in Kraft und werden mit Geldern aus der Preisausgleichskasse finanziert Ebenfalls seit Anfang 2002 werden die Zollkontingentsanteile Konsum- und Verarbeitungseier erstmalig nach dem Windhund-Verfahren an der Grenze zugeteilt Gleichzeitig erhöhte der Bundesrat das Teilzollkontingent Verarbeitungseier um 2'500 t; diese Erhöhung geht zu Lasten des Teilzollkontingentes Konsumeier. Die Aufhebung der Inlandleistung als Verteilkriterium der Konsumeier führte bisher zu keinen Komplikationen oder signifikanten Importzunahmen
Das BLW hat das Zollkontingent «Tiere der Pferdegattung (ohne Zuchttiere)» erneut in zwei Hälften von je 1'461 St ausgeschrieben und versteigert Ungefähr 200 Personen und Personengemeinschaften reichten pro Ausschreibung Gebote ein Im Mittel lag der Zuschlagspreis bei annähernd 400 Fr. pro Nutz- und Sportpferd. Der Versteigerungserlös zu Gunsten der Bundeskasse belief sich auf 1 Mio Fr Vor allem wegen den zahlreichen telefonischen Auskünften und den häufigen Übertragungen der Ausnützung von Zollkontingentsanteilen ist der administrative Aufwand relativ gross. Der Grund liegt darin, dass eine sehr grosse Zahl von Privatpersonen ohne Erfahrung in der Verzollung lediglich ein oder wenige Pferde einführen wollen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 159 2
Massnahmen 2001
2.1.4 Pflanzenbau
Mit der Ernte 2001 konnte die Liberalisierung der Marktordnungen im Ackerbau gemäss AP2002 abgeschlossen werden Als letzter und wichtigster Schritt ist die Preisund Übernahmegarantie des Bundes für Brotgetreide aufgehoben worden Bei allen Kulturen bildet sich seither der Produzentenpreis auf Grund von Angebot und Nachfrage auf dem inländischen Markt Die staatliche Stützung beschränkt sich im Wesentlichen auf den Grenzschutz und auf die allgemeinen Direktzahlungen Insbesondere für den Anbau, den Handel und die Verarbeitung von Getreide, das knapp zwei Drittel der offenen Ackerfläche beansprucht, sind alle Preis- und Mengenregelungen sowie die Anbaubeiträge (spezifische Flächenbeiträge) aufgehoben worden.
Für Obst, Gemüse sowie für Schnittblumen ist der Grenzschutz das wichtigste wirtschaftliche Element der Marktordnungen. Bei Obst sind ausserdem die finanzielle Beteiligung an der Verwertung von Mostobst und die Marktentlastungsmassnahmen für Steinobst von Bedeutung

1 Je nach Verwendungszweck bzw Zollposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung
2 Betrifft nicht die gesamte Erntemenge (Ausbeuteausgleich für Presswerke zur Speiseölgewinnung, Beiträge an Pilot- und Demonstrationsanlagen für NWR, Frischverfütterung und Trocknung von Kartoffeln Marktreserve für Kernobstkonzentrat) 3 Nur für Kartoffeln Quelle:
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 160
■■■■■■■■■■■■■■■■
Grenzschutz 1 ■■■■■■■■ Verarbeitungsbeiträge ■ 2 ■ 2 ■■■ 2 Anbaubeiträge ■■■ Ausfuhrbeiträge ■■ 3 ■
Massnahme
K u l t u r G e t r e i d e K ö r n e r l e g u m i n o s e n Ö l s a a t e n K a r t o f f e l n Z u c k e r r ü b e n S a a t g u t G e m ü s e, S c h n i t t b l u m e n , W e i n b a u O b s t
BLW
■ Finanzielle Mittel 2001
Tabelle 29, Seite A30
Im Berichtsjahr hat der Bund gegenüber dem Vorjahr 23 Mio. Fr. weniger für die direkte Marktstützung im Pflanzenbau eingesetzt Von den 129 Mio Fr wurde mehr als die Hälfte in Form von Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträgen ausbezahlt Der Anteil der Anbaubeiträge reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von einem Drittel auf einen Viertel
Mittelverteilung 2001
Total 129 Mio. Fr.
Exportbeiträge 15%
Diverses 1%
Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 59%
Anbaubeiträge 25%
Quelle: Staatsrechnung
Bei der Betrachtung der eingesetzten Mittel pro Kultur oder Kulturengruppe fällt die Reduktion beim Getreide auf Im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Brotgetreidemarktes wurde die Anbauprämie für Futtergetreide in zwei Schritten von Fr 770 –/ha auf null reduziert Die im Rechnungsjahr 2001 noch ausgewiesenen Mittel sind Restzahlungen für den Anbau 2000
uckerrüben Kartoffeln Getreide Körnerleguminosen Ölsaaten Nachwachsende Rohstoffe
1999 20002001
produktion
Quelle: Staatsrechnung
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 161 2
Kulturen M i o F r
Mittelverteilung nach
Saatgut
O
0 45 50 40 35 30 25 20 15 10 5
Z
bst Weinbau
Der Systemwechsel bei den Ölsaaten von der begrenzten Preis- und Übernahmegarantie zum Flächenbeitrag fand im Jahr 2000 statt und hat eine Reduktion der Ausgaben um 20% bewirkt Die Raps- und die Sojafläche verharrten in den ersten beiden Jahren nach der Liberalisierung auf tiefem Niveau, weil die Ölsaaten vorübergehend an betriebswirtschaftlicher Attraktivität eingebüsst hatten Im Berichtsjahr erfolgte die Liberalisierung des Brotgetreideanbaus und die Aufhebung der Anbauprämien für Futtergetreide Deshalb haben sich die neuen Preisverhältnisse der Mähdruschfrüchte erstmals auf die Anbauentscheide im Herbst 2001 voll ausgewirkt
Die 2001 gestiegenen Ausgaben für Ölsaaten sind darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr alle inländischen Ölsaaten in reinen Presswerken ohne Extraktion verarbeitet wurden. Demzufolge wurde nicht mehr nur für einen Drittel, sondern für die gesamte Verarbeitungsmenge der Ausbeuteausgleichsbeitrag ausbezahlt
Ausgaben für Obst im Jahre 2001
Export Kirschen 1,8%

Verwertung von Äpfel und Birnen im Inland 10,5%
Anderes 2,1% davon Marktentlastung (Kirschen und Zwetschgen) 1,3%
Export von Apfelsaftkonzentrat 44,6%
Export von Birnensaftkonzentrat 37,5%
Export andere Kernobstprodukte 4,1%
Quelle: BLW
Der Bund beteiligt sich finanziell an der Verwertung von Mostobst und den Marktentlastungsmassnahmen für Steinobst.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 162
Total 19,1 Mio. Fr.
■ Mähdruschfrüchte: Stärkere Abhängigkeit vom Weltmarktpreis
Ackerkulturen
Zu den Mähdruschfrüchten zählen das Getreide, die Ölsaaten und die Körnerleguminosen. Mit dem Wegfall der Preisgarantien des Bundes wird die Preisbildung beim Brotgetreide stärker vom Grenzschutz und den internationalen Preisen beeinflusst Für Brot- und Futtergetreide gelten weiterhin unterschiedliche Importregime Beim Getreide zur menschlichen Ernährung werden fixe Zölle erhoben Zusätzlich hat die Schweiz im Rahmen der WTO-Verpflichtung einen minimalen Marktzutritt für Brotgetreide (Weizen, Roggen, Dinkel) zu gewährleisten Das entsprechende Zollkontingent beträgt jährlich 70‘000 t und wird seit dem 1 Juli 2001 halbjährlich versteigert Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Müller verpflichtet, 85% ihrer Verarbeitungsmengen aus dem Inland zu beziehen. Die Grenzabgaben für Futtermittel werden in Abhängigkeit der Weltmarktpreise auf den entsprechenden Schwellenpreis bzw Importrichtwert ausgerichtet Der inländische Futtergetreidemarkt ist durch die Futtermittelbewirtschaftung weitgehend von den Fluktuationen der internationalen Preise abgeschirmt Die Zollansätze werden in der Regel quartalsweise, bei starken Preisschwankungen monatlich, angepasst
Die Körnerleguminosen sind vollständig, die Ölsaaten bezüglich ihrer Nebenprodukte (Kuchenmehl aus der Ölgewinnung) dem Schwellenpreissystem bzw. der Futtermittelbewirtschaftung unterstellt Bei den importierten pflanzlichen Ölen und Fetten zur menschlichen Ernährung wird ein fixer Zoll erhoben Durch den hohen Importanteil bei den pflanzlichen Ölen und Fetten werden die Schwankungen der internationalen Preise direkt auf die inländischen Ölsaatenpreise übertragen Hinzu kommt, dass die Grenzabgaben je nach Verwendungszweck der Waren starke Unterschiede aufweisen Verarbeitungsbeihilfen sorgen hier für Ausgleich Die Beiträge für den Ausbeuteausgleich und die Rohstoffverbilligungsbeiträge für Nachwachsende Rohstoffe (NWR) wurden ab 2002 zu einem Verarbeitungsbeitrag von 8,5 Mio. Fr. für Ölsaaten zusammengefasst. Die Branchenorganisation swiss granum wurde mit der Verteilung auf die verschiedenen Ölsaaten und deren Einsatzbereiche beauftragt

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 163 2
■ Versorgung mit Eiweissfuttermitteln: Produktionsanreize verstärkt

Die eiweissreichen Körnerleguminosen und Ölsaaten sind eine sinnvolle Ergänzung der Fruchtfolge, sie stehen jedoch betriebswirtschaftlich in Konkurrenz zum Getreide Um sie im angestrebten Umfang zu erhalten, sind sie auf eine zusätzliche Stützung angewiesen. Die natürlichen Produktionsbedingungen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind in der Schweiz für den Anbau von Getreide günstiger als für Eiweisspflanzen Deshalb ist der Selbstversorgungsgrad beim Getreide wesentlich höher als bei den eiweissreichen Futtermitteln
Die Raufutter verzehrenden Nutztiere decken ihren Proteinbedarf zur Hauptsache durch die Aufnahme von Raufutter, das auf zwei Dritteln der LN (total ca 1 Mio ha) angebaut wird Diese Flächen bilden zusammen mit Silo- und Grünmais die primäre Futterbasis für unsere Raufutter verzehrenden Nutztiere (Rind, Schafe, Pferde und Ziegen) Auf der übrigen Fläche werden Ackerkulturen, vor allem Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben und Ölsaaten angebaut Die Produkte dieser Kulturen dienen hauptsächlich der menschlichen Ernährung. Bei deren Verarbeitung fallen bedeutende Mengen an energie- und eiweissreichen Futtermitteln an Das Futtermittelangebot wird ergänzt durch Gerste, Körnermais, Triticale und Hafer (85'000 ha)
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 164
19971998 1999 20002001 1 i n T e r a j o u l e s Kraftfutter Import Kraftfutter Inland Raufutter Quelle: SBV 1 provisorisch 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 10 000 20 000
Entwicklung des Verbrauchs von Energie Umsetzbare Energie
Die inländischen Futtermittel decken rund 80% des Protein- und 90% des Energiebedarfs unserer Nutztiere Der hohe Selbstversorgungsgrad entsteht durch den hohen Anteil an Raufutter verzehrenden Nutztieren in der Tierproduktion, welche das Energieund Proteinangebot im Wiesenfutter optimal nutzen können Insgesamt müssen im Durchschnitt der Jahre 20% der Futterproteine importiert werden Bilanziert man nur die im Kraft- bzw. Ergänzungsfutter enthaltenen Proteine, so sind etwas mehr als die Hälfte inländischer Herkunft (Kraftfutter inkl Nebenprodukte aus der Nahrungsmittelverarbeitung)
Die Futtermittel mit einem hohen Eiweissgehalt werden vor allem in der Geflügel- und Schweinehaltung eingesetzt. Im Berichtsjahr sind 14,8% des Verbrauchs in der Schweiz angebaut worden Je 6,3% sind Nebenprodukte aus der Ölsaatenverarbeitung (Raps-, Sonnenblumen- und Sojakuchenmehl) und Trockengras, die restlichen 2,2% sind Körnerleguminosen (Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Lupinen). Diese eigentlichen Proteinpflanzen werden auf einer Fläche von gut 3'000 ha angebaut
Seit dem 1 Januar 2001 gilt das Fütterungsverbot für tierische Eiweissfuttermittel wie Fleisch- und Knochenmehl bei allen Nutztieren In den vorangehenden Jahren wurde deren Einsatz auf freiwilliger Basis bereits stark reduziert Dies führte dazu, dass sich der Bedarf an pflanzlichen Eiweissfuttermitteln erhöht hat, allerdings nur um 2%
Schon seit 1986 hat der Bund den Anbau von Eiweisserbsen und Ackerbohnen speziell gefördert Deren Flächenbeitrag war stets höher als derjenige für Futtergetreide Die Umsetzung der AP 2002 hat die Konkurrenzfähigkeit der Körnerleguminosen weiter verbessert. Die Brotgetreidepreise bilden sich seit Mitte 2001 durch Angebot und Nachfrage und die Anbaubeiträge für Futtergetreide sind nach einem schrittweisen Abbau ganz aufgehoben worden Währenddessen sind die Beiträge für Körnerleguminosen auf Lupinen ausgedehnt und von Fr 1'260
je ha auf das Niveau der Ölsaatenprämie von Fr 1'500 – je ha angehoben worden Zur Deckung der gestiegenen Nachfrage ist eine gewisse Erhöhung der inländischen Produktion in den nächsten Jahren zu erwarten
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 165 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N Entwicklung
19971998 1999 20002001 1 i n 1 0 0 0 t
des Verbrauchs von Eiweiss Verdauliches Rohprotein
1 provisorisch Kraftfutter Import Kraftfutter Inland Raufutter 0 1 000 900 800 700 600 500 400 300 100 200
Quelle: SBV
–
■ Kartoffeln: Erhöhung des Zollkontingentes

Im Ackerbau ist weiterhin mit einer kontinuierlichen Ertragssteigerung zu rechnen. Der Produktivitätsfortschritt wird auch die Proteinproduktion erhöhen Die Produktionsanreize sollen jedoch nicht dazu führen, dass in grossen Mengen Eiweissfuttermittel an Stelle von Nahrungsmitteln produziert werden. Letztere ermöglichen meist eine höhere Wertschöpfung und belasten die Bundeskasse weniger Würde der Flächenbeitrag für Körnerleguminosen noch mehr angehoben, besteht die Gefahr, dass Kulturen mit einem höheren Markterlös verdrängt werden Wird eine ha Getreide durch Körnerleguminosen ersetzt, steigen die Bundesausgaben um den Anbaubeitrag Das Einkommen der Produzenten erhöht sich dadurch jedoch nicht
Der inländische Produzentenpreis für pflanzliche Eiweissfuttermittel steht im Spannungsfeld zwischen dem betriebswirtschaftlich notwendigen Produkteerlös im Ackerbau und den Futterkosten in der Tierproduktion Durch die grosse wirtschaftliche Bedeutung der Milch- und Fleischproduktion für die Landwirtschaft sind den Futtermittelpreisen gegen oben enge Grenzen gesetzt. Bei der Festlegung der Schwellenpreise für Futtermittel und bei der Schaffung von Produktionsanreizen ist dieser Umstand zu berücksichtigen
Bei den Eiweissfuttermitteln hat die Auslandabhängigkeit bisher zu keinen Versorgungsengpässen geführt. Mit einer situationsgerechten Grenzabgabenpolitik wird die Schweiz auch in Zukunft die notwendigen Mengen beschaffen können Eine weitgehende Selbstversorgung der Schweiz mit pflanzlichen Proteinen lässt sich kurz- und mittelfristig nicht realisieren. Durch den hohen Importanteil ist die Schweiz von den weltweiten Entwicklungen abhängig und kann sich nicht davon abkoppeln
Bei normalen Ertragsverhältnissen deckt die Kartoffelproduktion rund 95% des Bedarfs. Zur Preisstützung der Saat-, Speise- und Veredlungskartoffeln wird die Frischverfütterung, die Lagerhaltung und die Trocknung zu Futtermitteln vom Bund im Falle von überdurchschnittlichen Erträgen finanziell unterstützt Die Branchenorganisation swisspatat und der Schweizerische Saatgutproduzenten-Verband sind mit der Administration dieser Beiträge beauftragt (vgl Übersicht Leistungsvereinbarungen Seiten 138 und 139) Zusätzlich gewährt das BLW Exportbeiträge für Kartoffelprodukte In der WTO hat die Schweiz vereinbart, für den Export von Kartoffeln und Kartoffelprodukten nicht mehr als 2,3 Mio Fr auszugeben und diese Mittel auf maximal 8‘400 t Kartoffeläquivalente zu beschränken Das WTO-Abkommen verpflichtet die Schweiz zudem, einen minimalen Marktzutritt von 22‘250 t Kartoffeln zu gewährleisten Das ordentliche Zollkontingent in diesem Umfang wird für die Kartoffelprodukte im Voraus versteigert und für die Kartoffeln nach Inlandleistung an die Importeure verteilt. Oft entsteht ein zusätzlicher Importbedarf, hauptsächlich aus drei Gründen:
Tiefe Erträge erfordern mehr Saatgutimporte zur Deckung des inländischen Bedarfs.
Eine verspätete oder kleine Frühkartoffelernte ergibt eine Mangelsituation, bevor die neue Ernte auf den Markt kommt
Die Zollkontingentsanteile für Veredelungskartoffeln werden meist bei den ausländischen Lieferanten vor dem Anbau bestellt und als fixer Anteil in die Rohstoffbeschaffung der Importeure integriert. Verknappt sich das inländische Angebot von einzelnen Sorten, bestehen keine Importmöglichkeiten mehr zum Zollkontingentsansatz (Fr 6 –/dt)
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 166
–
–
–
■ Ausblick: Überprüfung der Leistungsvereinbarungen Zucker
Seit 1998 hat das EVD jedes Jahr auf Antrag der Branche das Zollkontingent Nr. 14 für Kartoffeln vorübergehend erhöht Da Importe ausserhalb des Zollkontingentes mit einem Zollansatz von mindestens Fr 64 –/dt belastet werden, sind sie wirtschaftlich uninteressant.
Da die Interprofession Zucker bereits im Jahr 2002 Entscheide über die zukünftige Ausgestaltung des Verarbeitungsauftrages Zucker anstrebt, wird er im Folgenden näher beleuchtet
Die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld erhielten 1998 vom Bund einen vierjährigen Verarbeitungsauftrag. Sie sind verpflichtet, jährlich mindestens 120'000 und maximal 185'000 t Zucker aus inländischen Zuckerrüben zu produzieren Die entsprechende Abgeltung erfolgte im laufenden Zahlungsrahmen 2000 bis 2003 Die Ernte 2003 wird im Rechnungsjahr 2004 finanziert. Damit fällt der Bundesbeitrag zu Gunsten der Zuckerproduktion aus der Ernte 2003 bereits in den nächsten Zahlungsrahmen 2004 bis 2007 Damit die Zuckerfabriken vor der Aussaat der Rüben die Branchenvereinbarung mit den Zuckerrübenpflanzern abschliessen können, sind die Rahmenbedingungen für den zweiten Verarbeitungsauftrag rechtzeitig festzulegen
Die bisherigen Rahmenbedingungen führten zu guten betriebswirtschaftlichen Ergebnissen in der inländischen Zuckerproduktion, sowohl auf der Stufe Produktion als auch auf der Stufe Verarbeitung. Der abnehmende Arbeitsaufwand für den Anbau, die bessere Auslastung der Zuckerfabriken und die Preisreduktionen im übrigen Ackerbau haben die Attraktivität der Zuckerproduktion erhöht
Zur Herstellung der Erlösparität zwischen den Kulturen soll der vorgegebene Abbau der Marktstützung im Ackerbau schwergewichtig im Zuckersektor vorgenommen werden. Um den Anbau konkurrenzfähiger zu gestalten und eine noch bessere Auslastung der Zuckerfabriken zu ermöglichen, ist eine Erhöhung oder die Aufhebung der Obergrenze der Produktion ab 2004 zu prüfen.
Da die Zuckerpflichtlager durch eine Importabgabe (Garantiefondsbeiträge) auf Zucker entschädigt werden, hätte eine allfällige Ausdehnung der Inlandproduktion eine Reduktion der verfügbaren Mittel im Garantiefonds zur Folge Deshalb ist vorgesehen, die Zuckerpflichtlager zum gegebenen Zeitpunkt nach den Bestimmungen des Landesversorgungsgesetzes auf eine neue Finanzierungsbasis zu stellen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 167 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Weinwirtschaft: Zusammenlegung der Weiss- und Rotweinkontingente
Spezialkulturen
Durch die Zusammenlegung der Importkontingente mit einer Gesamtmenge von 170 Mio. Liter Wein ab dem 1. Januar 2001 änderte sich die Marktsituation grundlegend Die Importeure können nunmehr frei zwischen Rot- und Weisswein und zwischen Fass- und Flaschenwein auswählen Die Zusammenlegung folgte einer schrittweisen Öffnung der Grenzen schon seit 1995 1996 wurden die Weissweinkontingente auf 15 Mio Liter verdoppelt und danach jährlich um 1 Mio bis auf 19 Mio Liter im Jahr 2000 erhöht Ab 1997 wurden sie versteigert Um die Erhöhung der Weissweinkontingente auszugleichen und die Gesamtmenge von 170 Mio Litern nicht zu überschreiten, wurden diejenigen für Rotwein entsprechend gesenkt
Im Jahr 2000 betrugen die Einfuhren insgesamt 159,8 Mio Liter, wovon 17,6 Mio Liter Weisswein und 142,2 Mio Liter Rotwein Dabei ist zu bemerken, dass trotz der Erhöhung des Weissweinkontingents um 1 Mio. Liter die entsprechenden Importe nur leicht über denjenigen des Vorjahres lagen (+300'000 Liter)

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 168
J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r 20002001 Quellen: EZV, BLW 0 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 i n L i t e r
Kumulierte Weissweinimporte 2000–2001
Schon zum Jahresbeginn 2001 stiegen jedoch die Weissweinimporte stark an und erreichten schliesslich 22,4 Mio Liter, das heisst 4,8 Mio mehr als im Jahr zuvor Die Zunahme der Einfuhren verteilte sich ziemlich regelmässig über das ganze Jahr Von den verschiedenen Gründen für den Anstieg sind besonders zwei zu erwähnen. Einerseits ermöglichte die Zusammenlegung der Kontingente und die Aufhebung des Versteigerungsverfahrens zum ersten Mal den mehr oder weniger freien Import von Weisswein ohne vorherige Zuteilung Andererseits verschlechterte sich die Lage auf dem internationalen Weinmarkt nach der Ernte 2000 deutlich, weil in gewissen Regionen die Marktbedürfnisse weit übertroffen wurden Dies führte vor allem bei den Weissweinen zu einem Preissturz Die durchschnittlichen Preise vor Verzollung für importierten weissen Fasswein mit weniger als 13 Volumenprozent fielen innerhalb eines Jahres um rund 23% auf 1.05 Fr./l, diejenigen für weissen Flaschenwein um ungefähr 6% auf 8 45 Fr /l bzw auf 6 33 Fr pro Flasche Dieser Trend wirkte sich stark auf den Schweizer Weissweinmarkt aus, indem der berechnete Konsum zwischen 1. Juli 2000 und dem 30. Juni 2001 gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Mio. Liter tiefer lag, was in etwa den Mehrimporten in den ersten sechs Monaten 2001 entspricht
Beim Rotwein ist das Importvolumen praktisch gleich geblieben Es betrug 141,9 Mio Liter, das heisst 300’000 Liter weniger als im Vorjahr Auch hier sanken die Preise Für einen Liter Fasswein unter 13 Volumenprozent betrug er durchschnittlich 1.81 Fr./l, also 7% weniger als im vorhergehenden Jahr, für eine Flasche Rotwein rund Fr 8 – (–6%) Die Lage auf dem Rotweinmarkt in der Schweiz ist demnach günstiger als auf dem Weissweinmarkt, weil auch beim Konsum keine Schwankungen auftraten.
Der Rückgang des Konsums von Schweizer Weisswein begann schon anfangs der neunziger Jahre und war besonders bis Mitte der neunziger Jahre markant.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 169 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
Entwicklung von Produktion, Konsum und Einfuhr von Weisswein 1 9 9 1 / 9 2 1 9 9 2 / 9 3 1 9 9 3 / 9 4 1 9 9 4 / 9 5 1 9 9 5 / 9 6 1 9 9 6 / 9 7 1 9 9 7 / 9 8 1 9 9 8 / 9 9 1 9 9 9 / 2 0 0 0 2 0 0 0 / 2 0 0 1 Produktion Einfuhr Quelle: BLW Konsum total Konsum Inland Konsum ausländische Weine 0 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 i n h l
■ Ausblick
Im ersten Semester 2002 stiegen die Weissweinimporte um 2 Mio. Liter an. Auf dem internationalen Markt sind immer noch Überschüsse und ein allgemeiner Preisrückgang zu beobachten Der Preisdruck auf die Schweizer Weissweine wird also anhalten Daraus ist ersichtlich, wie wichtig eine rasche Umstellung des schweizerischen Weinbaus auf Sorten und Weine ist, die von den Konsumenten bevorzugt werden In der gleichen Periode gingen jedoch die Rotweinimporte um rund 4 Mio Liter zurück

170 2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
2.1.5 Überprüfung der Massnahmen
Studien zur Marktstützung
Im Rahmen des Forschungsauftrages des BLW «Marktanalysen AP 2002» (MAAP 2002) ist im Februar 2002 der zweite Teil «Auswirkungen staatlicher Massnahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Milchwirtschaft» veröffentlicht worden Die theoretischen Grundlagen und die Präsentation der Ergebnisse der Analyse des Fleisch- und Eiermarktes wurden im Agrarbericht 2001 vorgestellt Nachfolgend wird nun auf die Ergebnisse der Analyse des Milchmarktes eingegangen
Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Erzielung eines mit der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung vergleichbaren Einkommens stellen die zwei zentralen ökonomischen Ziele der Schweizer Agrarpolitik dar Für die Milchmarktpolitik können aus den gesetzlichen Grundlagen fünf Unterziele abgeleitet werden, zu deren Erreichung verschiedene Massnahmen wie Grenzschutz, Angebotskontingentierung, Zulagen und Beihilfen, Direktzahlungen ergriffen werden
Das Ziel der Studie bestand darin, diese Massnahmen im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft zu evaluieren Das grösste Gewicht wurde der Wirkungsanalyse beigemessen.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft wurde in der Vergangenheit stark von den staatlichen Regulierungen beeinflusst Die Faktorproduktivitäten konnten in der Milchproduktion im Verlaufe der letzten 20 Jahre nicht gesteigert werden. Durch die Einführung der neuen Milchmarktordnung und die Zulassung der flächenunabhängigen Kontingentsübertragung haben sich die Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähigere Schweizer Milchwirtschaft etwas verbessert
Die einzelbetriebliche Verteilung der Milchkontingente und deren Bindung an die Fläche bis zum 1 Mai 1999 haben trotz höheren Milchpreisen kaum zu besseren Einkommen der Milchproduzenten geführt, weil die Entwicklung effizienter Strukturen verhindert wurde Die Einführung der flächenunabhängigen Kontingentsübertragung wurde von den Produzenten benützt und hat zu einer höheren durchschnittlichen Kontingentsmenge pro Betrieb geführt Durch die Handelbarkeit der Kontingente werden Einkommen umverteilt Die Kontingentsrenten bleiben bei den Kontingentseigentümern, die nicht mehr mit der Gruppe der Produzenten identisch sein muss.
Im Fall eines kleinen Importlandes wird durch den Grenzschutz ein Teil der Konsumentenrente den Produzenten zugeteilt. Es werden auch Wohlfahrtsverluste in Kauf genommen Rohmilch zur Verarbeitung wird nicht importiert, da ein hoher Zollansatz besteht Dieser wirksame Grenzschutz bei Rohmilch ist die Voraussetzung für das Funktionieren der aktuellen Milchmarktordnung
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z ■■■■■■■■■■■■■■■■
2 171 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ MAAP 2002: Milchmarkt
Berechnungen mit einem quadratischen Optimierungsmodell haben gezeigt, dass bei einer Weiterführung der produktespezifischen Zulagen und Beihilfen hauptsächlich die Kontingentsmenge, die Butternachfrage und der Aussenhandel beim Käse die Höhe des Milchpreises beeinflussen. Beim Szenario mit konstanter Kontingentsmenge bis 2007 und Zulagen und Beihilfen im Umfang von 500 Mio Fr zeigt die Studie, dass ein Produzentenpreis von 72 bis 74 Rp je kg möglich sein könnte Wird zusätzlich ein positiver Konsumtrend bei den Frischmilchprodukten und beim Käse im Inland und in der EU im Umfang von 10% unterstellt, kann ein leicht höherer Milchpreis erzielt werden Bei einem Szenario mit Ausdehnung der Kontingentsmenge um 15% würde der Milchpreis im Jahr 2007 zwischen 56 und 60 Rp je kg zu liegen kommen
Eine Umlagerung der Stützungsmittel von den Zulagen und Beihilfen zu RGVEBeiträgen für Verkehrsmilchproduzenten (Fr 900 –/RGVE) würde zu einem zusätzlichen Direktzahlungsbedarf von 558 Mio Fr führen Die Berechnungen haben ergeben, dass eine Aufhebung der Milchkontingentierung grosse Spezialisierungsgewinne in der Milchproduktion zur Folge hätte und wohlfahrtsökonomisch besser als deren Beibehaltung wäre
Als Schlussfolgerungen und gestützt auf die Evaluationsergebnisse wurden vier Empfehlungen hergeleitet:
– Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Milchwirtschaft muss in der Schweiz das zentrale Ziel darstellen. Die staatlichen Interventionsmassnahmen sind in Zukunft so auszugestalten, dass die notwendigen Strukturanpassungen bei Produktion und Verarbeitung nicht behindert werden
– Beim Grenzschutz für Käse besteht zurzeit auf Grund des bilateralen Käseabkommens kein Handlungsbedarf. Die Importregelung bei der Butter ist aus wettbewerbspolitischer Sicht nicht optimal und allenfalls neu zu gestalten
Die Aufhebung der Milchkontingentierung ist möglichst bald einzuleiten. Die heutigen Massnahmen sind schrittweise auf einen Milchmarkt ohne Angebotskontingentierung auszurichten, damit sich die Milchproduzenten und -verarbeiter an die neuen Rahmenbedingungen anpassen können
– Die produktspezifischen Zulagen und Beihilfen sind in RGVE-Beiträge für Verkehrsmilchproduzenten umzuwandeln, um die Strukturanpassungen in der Milchproduktion und -verarbeitung nicht zu behindern und deren Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu verbessern.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 172
–
■ Befragung im Berggebiet über Zukunft der Milchproduktion
Studie «Umlagerung der Milchpreisstützung»
Im Anschluss an die Vor- und Hauptstudie zur Evaluation der Milchkontingentierung (Agrarbericht 2000 und 2001) hat das BLW das Institut für Agrarwirtschaft (IAW) der ETH Zürich und die FAT beauftragt, die mit einer Aufhebung der Milchkontingentierung verbundenen strukturellen Auswirkungen auf die Betriebe und die Betriebsstrukturen zu analysieren Aus der vierteiligen Folgestudie «Umlagerung der Milchpreisstützung» liegen erste Ergebnisse zu den Auswirkungen im Berggebiet vor
Ziel der Studie war es, die mittelfristige Veränderung der Produktionsrichtung von Milchwirtschaftsbetrieben abzuschätzen. Zu diesem Zweck wurden die Landwirtschaftsbetriebe aller Bergzonen der Schweiz mittels Clusteranalyse in Betriebstypen eingeteilt Die Fragestellung wurde mit Interviews abgeklärt Von 79 interviewten Milchwirtschaftsbetrieben wurden 71 mündlich und 8 (Auslaufbetriebe) telefonisch befragt Die Interviews gliederten sich in 4 Teile: Bisherige Entwicklung des Betriebes, persönliche Zukunftsvorstellung, Szenario mit Milchkontingentierung und Szenario ohne Milchkontingentierung Im Interview wurden Informationen zu Milch, Aufzucht, Schlachtvieh, Betriebszweige, Gebäude, Fläche, Alpwirtschaft, Nebenerwerb und Zusammenarbeit erhoben.
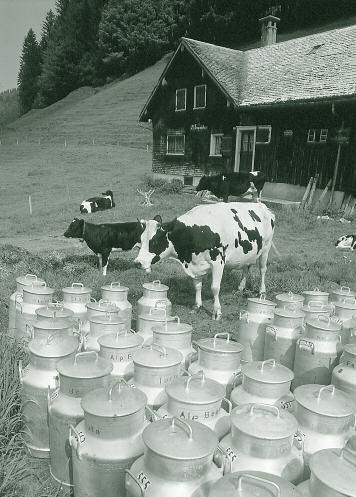
Die Befragung ergab, dass der grösste Teil der Betriebe in der Milchproduktion bleiben will. Dabei waren die Unterschiede zwischen einem Szenario mit Beibehaltung der Milchkontingentierung bei einem Milchpreis von 65 Rp /kg und einem Szenario ohne Milchkontingentierung bei einem Milchpreis von 60 Rp /kg nicht sehr gross Nur wenige Betriebe würden die Milchproduktion bei einer Aufhebung der Milchkontingentierung aufgeben Auf der anderen Seite würden auch nur einige Betriebsleiter die Milchproduktion ausdehnen und gleichzeitig andere Betriebszweige abbauen. Nur wenige können sich vorstellen, vermehrt in Richtung Aufzucht und Mutterkuhhaltung zu gehen Insgesamt stellt die Befragung der ETH fest, dass die Landwirte auch bei einer Aufhebung der Milchkontingentierung keinen besseren Erlös für sich als in der Milchproduktion sehen Sie wollen deshalb zum grössten Teil an den jetzigen Betriebsausrichtungen festhalten
■ Modellrechnungen über strukturelle Auswirkungen bei der Milch im Berggebiet
Ziel der Studie war es, die strukturellen Auswirkungen einer Aufhebung der Milchkontingentierung auf das schweizerische Berggebiet mittels Modellberechnungen abzuschätzen Diese Berechnungen wurden mit Hilfe eines komparativen-statischen linearen Sektorenmodells auf der Basis von typischen Betrieben durchgeführt.
Die Modellrechnungen zeigen eine ganz andere Entwicklung als die Befragung der Landwirte. In der Berglandwirtschaft bestehen zwischen wie auch innerhalb der Regionen sowie zwischen den verschiedenen Produktionsrichtungen grosse strukturelle Unterschiede Im Modell wird die kosten- und arbeitsintensive Haltung von Milchkühen stark durch die arbeitsextensive Fleischproduktion konkurrenziert So würden bei einem Milchpreis von 75 Rp /kg (Grundpreis 79 Rp /kg) nur noch 65% der Kontingente ausgeschöpft.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 173
■ Schlussfolgerung
Gemäss den Modellrechnungen würden strukturelle Anpassungen in der Berglandwirtschaft auch ohne Aufhebung der Milchkontingentierung stattfinden Anstelle der Milchproduktion würden die Betriebe vor allem in die Mutterkuhhaltung einsteigen Die strukturellen Anpassungen im Berggebiet werden weitgehend durch die Relation zwischen den Milch- und den Fleischpreisen bestimmt
Damit die Betriebe ein ausreichendes Einkommen erzielen können, müssten sie bei einem Milchpreis von 60 Rp /kg, welcher nach Umsetzung der bilateralen Verträge mit der Liberalisierung des Käsehandels zu erwarten ist, deutlich wachsen Ein Strukturwandel im Generationenwechsel würde dazu nicht ausreichen
Modellmässig wurden auch die Auswirkungen einer Umlagerung der produktionsbezogenen Stützung von heute auf Direktzahlungen berechnet Einerseits wurden die finanziellen Mittel umgelagert auf Beiträge für Milchkühe und anderseits auf das Grünland. Beide Beitragsarten vermögen den Verlust bei den Einnahmen aus dem Verkauf der Milch nicht ganz zu kompensieren Die Milchproduktion verliert dadurch leicht an Konkurrenzkraft gegenüber der Fleischproduktion Der Vorteil eines Grünlandbeitrages wäre, dass damit die Konkurrenzkraft der Milch aus Raufutter gegenüber der Produktion mit Kraftfutter grösser wäre
Aus der Befragung und der Modellrechnung resultieren unterschiedliche Auswirkungen einer Aufhebung der Milchkontingentierung im Berggebiet. Die Gründe dafür können wie folgt erklärt werden
Zur Vorhersage der strukturellen Auswirkungen einer Kontingentsaufhebung wird ein komparativ statisches lineares und sektorales Optimierungsmodell verwendet Modelle bilden sofortige und rein ökonomisch begründete Reaktionen der Betriebe auf eine Veränderung der Rahmenbedingungen in einem bestimmten Zeitpunkt ab Bei der Befragung der Milchproduzenten wird hingegen ein Trend wiedergegeben, bei welchem auch die hemmenden Faktoren sowie ausserhalb ökonomischer Überlegungen liegende Motivationen der Betriebsleiter zum Ausdruck kommen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 174
2.2 Direktzahlungen
Die Direktzahlungen sind eines der zentralsten Elemente der Agrarpolitik. Sie ermöglichen eine Trennung der Preis- und Einkommenspolitik und gelten die von der Gesellschaft geforderten Leistungen ab Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen
Ausgaben für die Direktzahlungen
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich Die Werte in Abschnitt 2 2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen
Quelle: BLW

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ausgabenbereich 1999 2000 2001 Mio Fr Mio Fr Mio Fr Allgemeine Direktzahlungen 1 779 1 804 1 929 Ökologische Direktzahlungen 326 361 413 Kürzungen 24 23 17 Total 2 081 2 142 2 325
175
■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere Diese Beiträge haben das Ziel, eine flächendeckende Nutzung und Pflege sicherzustellen In der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).

■ Abgeltung besonderer ökologischer Leistungen
Die ökologischen Direktzahlungen geben einen Anreiz für besondere ökologische Leistungen, die über den ÖLN hinausgehen Zu ihnen gehören die Öko-, Sömmerungsund Gewässerschutzbeiträge Diese Beiträge bezwecken, die Artenvielfalt in den Landwirtschaftsgebieten zu erhalten und zu erhöhen, die Nitrat- und Phosphorbelastung der Gewässer sowie die Verwendung von Hilfsstoffen zu vermindern, landwirtschaftliche Nutztiere besonders tierfreundlich zu halten und das Sömmerungsgebiet nachhaltig zu nutzen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 176 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2001
Die Direktzahlungen machten 2001 rund 65% der Ausgaben des BLW aus. Von den Direktzahlungen kamen 62% der Berg- und Hügelregion zugute
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich Die Werte in Abschnitt 2 2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen
Quelle: BLW
Die Hügel- und Bergregion sind bei den Produktionsbedingungen benachteiligt Die wichtigsten Nachteile sind:
– Die kürzere Vegetationsperiode, welche geringere Erträge und höhere Aufwendungen für die Futterkonservierung sowie hohe Arbeitsspitzen zur Folge hat.
– Die Bewirtschaftung von Hanglagen ist aufwändiger, die Mechanisierung teurer und weniger leistungsfähig
Die im Durchschnitt ungünstigere Verkehrslage bedingt einen höheren Zeitaufwand und Mehrkosten für Transporte, Schulwege, Märkte, Produkteabnehmer, Einkäufe usw.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 177
Direktzahlungen 2001 Beitragsart Total Talregion Hügelregion Bergregion 1 000 Fr Allgemeine Direktzahlungen 1 929 094 720 299 497 931 700 820 Flächenbeiträge 1 303 881 643 489 325 919 334 473 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 268 272 71 286 67 240 129 746 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 250 255 3 245 69 981 177 029 Allgemeine Hangbeiträge 96 643 2 279 34 791 59 573 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 10 043 Ökologische Direktzahlungen 412 664 Ökobeiträge 329 886 168 353 91 577 69 956 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 118 417 67 837 30 522 20 058 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 32 526 21 737 9 743 1 046 Beiträge für den biologischen Landbau 23 488 7 331 4 946 11 211 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 155 455 71 448 46 366 37 641 Sömmerungsbeiträge 80 524 Gewässerschutzbeiträge 2 254 Kürzungen 16 763 Total Direktzahlungen 2 324 995
–
■ Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von Referenzbetrieben nach Regionen 2001
Die erschwerende Bewirtschaftung in diesen Regionen wird mit den Beiträgen für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen, den Hangbeiträgen und den Sömmerungsbeiträgen abgegolten Folgerichtig nimmt die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis zu Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern zahlreiche Anforderungen zu erfüllen Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen wie Rechtsform, zivilrechtlicher Wohnsitz usw , anderseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend wie beispielsweise die Mindestgrösse des Betriebes, der Arbeitsbedarf von mindestens 0,3 Standardarbeitskräften (SAK), das Alter der Bewirtschafter, das Einkommen und Vermögen Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen, die unter den Begriff «Ökologischer Leistungsnachweis» (ÖLN) fallen. Die Anforderungen des ÖLN umfassen: eine ausgeglichene Düngerbilanz, ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen, eine geregelte Fruchtfolge, ein geeigneter Bodenschutz, eine gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere Eine Verletzung oder ein Verstoss gegen die massgebenden Vorschriften haben Sanktionen in Form einer Kürzung oder Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 178
Merkmal Einheit Total Tal- Hügel- Bergregion region region Betriebe Anzahl 3 067 1 376 907 784 LN im Ø ha 19,10 19,93 17,95 18,85 Allgemeine Direktzahlungen Fr 34 784 29 335 33 574 45 479 Ökobeiträge Fr 6 791 7 749 6 989 4 925 Total Direktzahlungen Fr 41 575 37 084 40 563 50 404 Rohertrag Fr 192 972 233 144 178 588 138 099 Anteil Direktzahlungen am Rohertrag % 21,5 15,9 22,7 36,5 Quelle: FAT
Tabellen 39a–40, Seiten A46–A49
Begriffe und Methoden, Seite A77
■ Agrarpolitisches Informationssystem
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem) Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen, welche die Kantone zusammentragen und übermitteln, und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart (Massnahme) gespiesen Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge Eine weitere Funktion des Systems besteht in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen Dank der Informationsfülle und der leistungsfähigen EDV-Hilfsmittel können zahlreiche agrarpolitische Fragen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden
Von 68‘131 im AGIS erfassten Betrieben im Jahr 2001 beziehen deren 59’797 Direktzahlungen Die meisten der restlichen 8’334 Betriebe sind zu klein, um Anspruch auf Beiträge zu haben, das heisst, sie weisen zu wenig Fläche oder zu wenig SAK auf.
■ Auswirkungen der Begrenzungen und Abstufungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro SAK, bei den Abstufungen um die Degressionen bei Fläche und Tieren
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2001
Begrenzung Betroffene Gesamtbetrag Anteil am Anteil an der Betriebe Kürzungen Beitragstotal Direktzahlungsder Beriebe summe
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge, insbesondere für jene 239 Betriebe, deren Vermögen zu hoch ist Von den Einkommensgrenzen waren im Jahr 2001 rund 900 Betriebe betroffen. Die Kürzung der Direktzahlungen betrug bei diesen Betrieben im Durchschnitt 13,6% Insgesamt wurden aufgrund der Begrenzungen 10,2 Mio Fr an Direktzahlungen gekürzt; dies entspricht 0,43% des Gesamtbetrages.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 179
Anzahl Fr %% pro SAK (55 000 Fr.) 1 382 1 684 651 2,98 0,07 auf Grund des Einkommens 902 4 932 511 13,55 0,21 auf Grund des Vermögens 239 3 597 530 70,70 0,15 Quelle:
BLW
Wirkung der Abstufung der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl 2001
Insgesamt sind 7‘511 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenen Massnahmen Die Reduktionen betragen total 29,1 Mio Fr Sie wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus, wo die Abstufungen bei über 6‘600 Betrieben (11% aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 148 Betriebe von dieser Reduktion betroffen, da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite und der Milchabzug bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken Von der Beitragsreduktion betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen So werden z B die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei rund 2'800 Betrieben zwischen 7,3 und 9,4% reduziert. Rund 550 Bio-Betriebe erhalten um 7% herabgesetzte Direktzahlungen Gemessen an den gesamten Direktzahlungen beträgt der Anteil sämtlicher Reduktionen aufgrund der Beitragsdegression 1,43%
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 180
Massnahme Betroffene Fläche oder Reduktion Anteil am Anteil am Betriebe Tierbestand Beitrag der Total der pro Betrieb Betriebe Direktzahlungsart Anzahl ha oder GVE Fr %% Flächenbeiträge 6 615 41,4 26 064 512 7,1 1,96 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 148 58,6 412 591 5,7 0,15 Allgemeine Hangbeiträge 68 34,3 31 218 3,2 0,03 Beiträge für Rebflächen in Steilund Terrassenlagen 0 0,0 0 0,0 0,00 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 4 41,6 19 119 10,8 0,02 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 30 36,1 17 956 4,2 0,06 Beiträge für den biologischen Landbau 553 39,3 403 633 7,1 1,69 Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 1 117 65,7 842 773 9,4 2,42 Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien 1 715 61,8 1 340 316 7,3 1,09 Total 7 511 1 29 132 118 7,2 1,43
1 ohne Doppelzählungen Quelle: BLW
■ Vollzug und Kontrolle
Die Kontrolle des ÖLN wird gemäss Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert Diese können Organisationen, die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten und akkreditierte Organisationen zum Vollzug beiziehen. Sie müssen die Kontrolltätigkeit stichprobenweise überprüfen. Direktzahlungsberechtigte Bio-Betriebe müssen neben den Auflagen des Biolandbaus die Vorgaben des ÖLN erfüllen und alle Nutztiere nach den RAUS-Anforderungen halten Sie werden von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle überprüft Die Kantone überwachen diese Kontrollen Artikel 66 Absatz 4 der Direktzahlungsverordnung präzisiert, nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben
Zu kontrollieren sind: – alle Betriebe, welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen; – alle Betriebe, bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden; und
mindestens 30% der übrigen Betriebe, die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind
Bei Verstössen im ÖLN, wie z B falschen Angaben, werden die Betriebe nach einheitlichen Kriterien sanktioniert Die Konferenz der Landwirtschaftsdirektoren hat mit Beschluss vom 20. September 2001 das revidierte Sanktionsschema in Kraft gesetzt.
■ Durchgeführte Kontrollen und Sanktionen 2001
Von den Kantonen bzw. den von ihnen beauftragten Kontrollstellen wurden im Jahr 2001 rund 38‘700 Betriebe, davon 5‘441 Bio-Betriebe, auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert Im Weiteren wurden von den total 32’987 am RAUS-Programm angemeldeten Betriebe 17‘604 (das entspricht 53%), sowie 12'385 der 15’321 im BTS angemeldeten Betriebe (81%), kontrolliert Neu kam im Jahr 2001 die Kontrolle der Auflagen zur Sömmerung bei 1'079 Betrieben hinzu.
Gesamthaft wurden über 8‘800 Verstösse festgestellt, was Beitragskürzungen von etwa 8 Mio. Fr. zur Folge hatte. In diesem Betrag nicht enthalten sind Rückbehalte bei nicht beitragsberechtigten Bewirtschaftern sowie nicht ausbezahlte Beiträge, die auf Grund von falschen Angaben bei der Anmeldung verweigert wurden In der Gewässerschutzgesetzgebung wurden weniger Verstösse als im Vorjahr gezählt, dafür hatten die registrierten Fälle insgesamt höhere Sanktionen zur Folge Nur in wenigen Fällen wurden Verstösse gegenüber dem Umweltschutzgesetz, den Richtlinien des biologischen Landbaus und beim Extensoprogramm festgestellt
Die Verstösse bei den kontrollierten Sömmerungsbetrieben betrafen primär die unsachgemässe Weideführung bei Schafalpen, wo die Auflagen nicht eingehalten wurden
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 181
–
nicht rechtzeitige Anmeldung, Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung
falsche Angaben, fehlende Bodenproben, ungenügender ökologischer Ausgleich, Gewässerschutz, Schnittzeitpunkt bei ÖAF, nicht rechtzeitige Anmeldung
nicht rechtzeitige Anmeldung, Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften, kein MehrflächenHaltungssystem, mangelhafter Liegebereich, mangelhafte Stallbeleuchtung, mangelhafte Einstreu RAUS
1 344 1 159 000 zu wenig Auslauftage, mangelhafte Aufzeichnungen, nicht alle Tiere einer Kategorie nach den Vorschriften gehalten, ungenügender Laufhof, nicht rechtzeitige Anmeldung
Sömmerung 343 606 300 Unter-/Überschreitung des Normalbesatzes, Unsachgemässe Weideführung, Nutzung nicht beweidbarer Flächen, falsche Angaben zu Fläche/Tierbestand/Daten
1 In diesen Kategorien sind die Kantone Zürich und Graubünden nicht enthalten, sie wiesen die jeweiligen Verstösse und Sanktionen im gesamten ÖLN aus
■ Nichterfüllung des ÖLN wegen höherer Gewalt
Quelle: BLW
In speziellen Fällen, wo die Auflagen des ÖLN aufgrund höherer Gewalt nicht oder nur teilweise erfüllt werden können, kann der Kanton gemäss Artikel 15 Absatz 2 der Direktzahlungsverordnung Ausnahmen gewähren. Für die Aufrechterhaltung der Beitragsberechtigung muss ein bewilligtes Gesuch vorliegen Im Jahr 2001 wurden von den Kantonen 2'103 Gesuche bewilligt Der grösste Anteil der Gesuche wurde aufgrund von Unwetterschäden eingereicht, die vor allem Flächen im Kanton Aargau, Thurgau und St Gallen betrafen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 182
Kategorie Verstösse Sanktionen Hauptgründe Anzahl Fr. Grunddaten 640 882 900 verspätete Anmeldung, falsche Flächenangaben, falsche Angaben zum Betrieb oder Bewirtschafter Gewässerschutz 199 293 700 keine Angaben möglich Natur- und Heimatschutz 00 keine Angaben Umweltschutz 18 23 400 keine Angaben möglich ÖLN 4 046 3 888 500 mangelhafte Aufzeichnungen, tiergerechte Haltung
Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmittel ÖAF 1 1 659 382 800 zu frühe oder unzulässige Nutzung, falsche Flächenangaben, Mindestdauer von 6 Jahren nicht eingehalten, Verunkrautung Extenso 1 68
Bio 1 82
BTS 1 426 786
1
Zusammenstellung der Verstösse und Sanktionen 2001
der Nutztiere, fehlende Bodenproben, ungenügender ökologischer Ausgleich, nicht ausgeglichene Düngerbilanz, Pufferstreifen,
31 300
61 100
600
Total 8 825 8 115
600
■ Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz
In witterungs- und standortbedingten Spezialfällen wird, um die Kultur zu schützen, der Einsatz im ÖLN nicht erlaubter Pflanzenschutzmittel oder Behandlungsarten zugelassen Deshalb können die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen, gestützt auf Anhang 6.4 der Direktzahlungsverordnung, Sonderbewilligungen ausstellen. Im Jahr 2001 gab es für 4‘924 ha LN 2‘454 Sonderbewilligungen Am meisten bewilligt wurde analog zu den Vorjahren die Behandlung von Verunkrautung in Naturwiesen Dabei ging es vor allem um die Bekämpfung von Hahnenfuss, Disteln, gemeines Rispengras und Ampfer Für Kunstwiesen wird seit dem Jahr 2001 keine Sonderbewilligung mehr benötigt, was den massiven Rückgang der Bewilligungen bei den Wiesenherbiziden seit dem Jahr 2000 erklärt In diesem Zusammenhang ist die proportionale Flächenzunahme der Vorauflaufherbizide gegen Unkräuter in Getreide relativ zu bewerten Durch den vermehrten Einsatz von gebeiztem Saatgut war die Nachfrage nach Mais- und Rübengranulaten rückläufig

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 183
Erteilte Sonderbewilligungen
Pflanzenschutz 2001 Bekämpfungsmittel Bewilligungen Fläche Anzahl % ha % Vorlauf-Herbizide 326 13,3 553,3 11,2 Insektizide 232 9,5 582,2 11,8 Mais-Granulate 101 4,1 324,4 6,6 Rüben-Granulate 252 10,3 715,9 14,5 Wiesen-Herbizide 1 461 59,5 2 564,3 52,1 Andere 82 3,3 184,3 3,8 Total 2 454 100 4 924,4 100 Quelle: BLW
im Bereich
■ Flächendeckende Bewirtschaftung als Ziel
2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen
Flächenbeiträge
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Schutz und Pflege der Kulturlandschaft, Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab Die Beiträge wurden 2001 mit einem Zusatzbeitrag für das offene Ackerland und die Dauerkulturen ergänzt Dadurch soll jener Teil der gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Ackerbau abgegolten werden, welcher als Folge der Schwellenpreissenkung und der Liberalisierung der Getreidemarktordnung nicht mehr anders entschädigt werden kann. Für die Erschwernisse in der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
1 Der Zusatzbeitrag für offenes Ackerland und Dauerkulturen beträgt 400 Fr pro ha und Jahr; auch er unterliegt der Flächenabstufung
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25% Insgesamt handelt es sich um 5’059 ha, welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden.
Flächenbeiträge 2001 (inkl Zusatzbeitrag)
Der Zusatzbeitrag wurde für insgesamt 273'189 ha offenes Ackerland und 16'840 ha Dauerkulturen ausgerichtet Die Flächenbeiträge erhöhten sich dadurch um insgesamt rund 112 Mio Fr
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 184 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ansätze 2001 Fr /ha 1 – bis 30 ha 1 200 – 30 bis 60 ha 900 – 60 bis 90 ha 600 – über 90 ha 0
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Fläche ha 478 019 263 779 287 079 1 028 877 Betriebe Anzahl 25 147 16 153 18 288 59 588 Fläche pro Betrieb ha 19,0 16,3 15,7 17,3 Beitrag pro Betrieb Fr 25 589 20 177 18 289 21 882 Total Beiträge 1 000 Fr 643 489 325 919 334 473 1 303 881 Total Beiträge 2000 1 000 Fr 552 878 305 495 328 397 1 186 770 Quelle: BLW
Tabellen 31a–31b, Seiten A32–A33
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen

Von der Beitragsdegression betroffen sind 8% der LN Im Durchschnitt wird pro ha ein Flächenbeitrag von 1'267 Fr ausbezahlt (inkl Zusatzbeitrag) Die Betriebe mit einer Fläche bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 10,3% der gesamten LN Eine Betriebsgrösse von mehr als 60 ha weisen lediglich 0,9% aller Betriebe aus; sie bewirtschaften
3,9% der gesamten LN
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 185
über 90 Betriebe in % LN in % 60 – 90 30 –60 20 – 30 15 – 20 10 –15 5 –10 bis 5 Quelle: BLW G r ö s s e n k l a s s e n i n h a LN < 30 60 < LN < 90 30 < LN < 60 LN > 90 30 20 10 0 10 20 30 0,2 0,2 1,4 0,5 19,0 27,3 18,2 15,6 8,5 11,0 0,8 0,1 19,5 18,1 21,7 19,4 9,5 51,8 5,5
■ Flächennutzung mit Grünland
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere
Die Massnahme hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig im Grasland Schweiz die flächendeckende Pflege durch Nutzung sicherzustellen
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere, die während der Winterfütterung (Referenzperiode: 1 Januar bis Stichtag des Beitragsjahrs) auf einem Betrieb gehalten werden Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe, Ziegen, Bisons, Hirsche, Lamas und Alpakas. Die Beiträge werden für Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE)
Die Abstufung der Beitragsbegrenzung nach Zonen orientiert sich einerseits am höchstzulässigen Tierbesatz gemäss Gewässerschutzrichtlinien und berücksichtigt andererseits das abnehmende Ertragspotential Durch die Staffelung wirken die Beiträge produktionsneutral, tragen aber wesentlich zu einer flächendeckenden Bewirtschaftung bei.
Beitragsberechtigt ist, wer mindestens eine RGVE auf seinem Betrieb hält sowie die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllt
Die RGVE sind in zwei Beitragsgruppen aufgeteilt Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung, Bisons, Milchziegen und Milchschafe werden 900 Fr , für die übrigen Ziegen und Schafe, sowie Hirsche, Lamas und Alpakas 400 Fr. je RGVE ausgezahlt. Der Beitrag pro RGVE für Tiere, welche einen höheren Arbeits- und Gebäudeaufwand verlangen, ist höher angesetzt als für die Tiere mit niedrigem Aufwand
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 186
Begrenzung der Förderung RGVE/ha – in der Ackerbauzone, der
Übergangszone und der Übergangszone 2,0 – in der Hügelzone 1,6 – in der Bergzone I 1,4 – in der Bergzone II 1,1 – in der Bergzone III 0,9 – in der Bergzone IV 0,8
erweiterten
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2001

Die Beiträge ersetzen die bis 1998 ausbezahlten Beiträge an Kuhhalter, welche keine Milch zur Vermarktung abliefern Der Beitrag wird nicht nur für Kühe, deren Milch nicht vermarktet wird, sondern auch für andere Raufutter verzehrende Tiere bezahlt Bei den Milchproduzenten, die in den Genuss dieser Beiträge kommen, handelt es sich um eher extensiv bewirtschaftete Betriebe Im Vergleich zu den gehaltenen Kühen weisen sie einen relativ hohen Anteil an Aufzucht- oder Masttieren auf und verfügen über eine genügende Grünfläche. Bei den Milchproduzenten wurde im Jahr 2001 pro 4‘200 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE vom beitragsberechtigen Bestand in Abzug gebracht
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2001
Betriebe ohne vermarkteter vermarktete
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar rund 3'900 Franken weniger RGVEBeiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch. Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z B Zulage für verkäste Milch)
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 187
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Zu Beiträgen berechtigende RGVE Anzahl 82 213 77 506 151 564 311 283 Betriebe Anzahl 10 704 11 212 16 305 38 221 Zu Beiträgen berechtigende RGVE pro Betrieb Anzahl 7,7 6,9 9,3 8,1 Beiträge pro Betrieb Fr 6 660 5 997 7 957 7 019 Total Beiträge 1 000 Fr 71 286 67 240 129 746 268 272 Total Beiträge 2000 1 000 Fr 67 444 64 265 126 795 258 505 Quelle: BLW
Merkmal Einheit
Milch Milch Betriebe Anzahl 21 556 16 665 Tiere pro Betriebe RGVE 22,9 12,2 Abzug aufgrund Beitragsbegrenzung der Grünfläche RGVE 1,2 1,2 Milchabzug RGVE 15,7 0,0 Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE 6,0 10,9 Beiträge pro Betrieb Fr 5 317 9 221
BLW
Betriebe mit
Quelle:
■ Abgeltung der Produktionserschwernisse
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung), werden bei dieser Massnahme auch soziale, strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt Beitragsberechtigt sind jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, die mindestens 1 ha LN in der Hügel- oder Bergregion bewirtschaften und zugleich mindestens 1 RGVE halten Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere. Die Massnahme begünstigt kleinere Betriebe, indem die Beiträge nur für höchstens 15 RGVE je Betrieb ausgerichtet werden Die Beitragsansätze sind nach Zonen differenziert
für die Tierhaltung unter erschwerenden
Gegenüber den Vorjahren haben die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen wenig abgenommen Weiter zurückgegangen ist aber die Betriebszahl; und zwar um 130 Einheiten. Demgegenüber verzeichnen die zu Beiträgen berechtigenden RGVE eine leichte Zunahme um knapp 2'000 Einheiten
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 188
Ansätze pro RGVE 2001 Fr /GVE – in der Hügelzone 260 – in der Bergzone I 440 – in der Bergzone II 690 – in der Bergzone III 930 – in der Bergzone IV 1 190 Beiträge
Produktionsbedingungen 2001 Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region 1 region region Zu Beiträgen berechtigende RGVE Anzahl 36 771 202 173 213 148 452 093 Betriebe Anzahl 2 581 15 362 17 634 35 577 RGVE pro Betrieb Anzahl 14,2 13,2 12,01 12,7 Beiträge pro Betrieb Fr 1 257 4 555 10 039 7 034 Total Beiträge 1 000 Fr 3 245 69 981 177 029 250 255 Total Beiträge 2000 1 000 Fr 2 989 70 423 178 181 251 593
1 Betriebe die einen Teil der Fläche in der Berg- und Hügelregion bewirtschaften
Quelle: BLW
Der Anteil der RGVE ohne Beiträge entsprach 39% des Tierbestandes der beitragsberechtigten Betriebe Rund 83% des RGVE-Bestandes wurden auf Betrieben gehalten, die von der Beitragsbegrenzung auf 15 RGVE betroffenen sind Bei diesen Betrieben betrug der Anteil der RGVE ohne Beitrag 46,7%

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 189 Verteilung der Raufutter verzehrenden Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen nach Grössenklassen 2001 Quelle: BLW G r ö s s e n k l a s s e n i n R G V E RGVE mit Beitrag RGVE ohne Beitrag 100 5000 50150 100 200 250 45–90 30–45 20–30 15–20 10–15 5–10 bis 5 34 77 101 125 93 17 70 41 9 84 50 20 63 57 56 24 80 81 Betriebe in 100 Tiere in RGVE in 1 000
■ Allgemeine Hangbeiträge: Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Hangbeiträge
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung in der Hügel- oder Bergregion abgegolten. Sie werden nur für Wies-, Streuund Ackerland ausgerichtet Wiesen und Streuefläche müssen jährlich mindestens ein Mal gemäht werden Ausgeschlossen sind Hecken und Feldgehölze sowie Weiden und Rebflächen
Anrecht auf Hangbeiträge haben jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllen Diese sieht präzisierend vor, dass die Gesamtfläche mit Hangneigung mehr als 50 Aren zu umfassen hat, wobei eine Bewirtschaftungsparzelle mindestens 5 Aren messen muss Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt
Beiträge für Hangflächen 2001

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 190
Ansätze 2001 Fr /ha – Neigung 18 bis 35% 370 – Neigung über 35% 510
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region 1 region region Zu Beiträgen berechtigende Flächen: – Neigung 18–35% ha 4 383 67 716 74 242 146 341 – über 35 Neigung ha 1 288 19 097 62 989 83 374 Total ha 5 671 86 813 137 231 229 715 Betriebe Anzahl 2 113 14 392 17 020 33 525 Beitrag pro Betrieb Fr 1 078 2 417 3 500 2 883 Total Beiträge 1 000 Fr 2 279 34 791 59 573 96 643 Total Beiträge 2000 1 000 Fr 2 287 34 843 59 584 96 714
1 Betriebe mit Flächen in der Berg- und Hügelregion
Quelle: BLW
■ Hangbeiträge: Zur Erhaltung der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen
Betriebe mit Hangbeiträgen 2001
Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert von Jahr zu Jahr. Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab, die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei, Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden, wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden. Diese Eigenschaften sind einerseits bedeutend für das Landschaftsbild und erschweren anderseits die Bewirtschaftung Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden nur für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet
Als Terrassenlagen gelten Rebflächen, welche mit Stützmauern regelmässig abgestuft sind und die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
– die Flächen weisen eine minimale Terrassierung auf, das heisst höchstens 30 m Abstand zwischen den Stützmauern;
– die Terrassenlage misst mindestens eine ha;
– die Stützmauern müssen mindestens 1 m hoch sein, gewöhnliche Betonmauern werden nicht berücksichtigt
Hangbeiträge für Rebflächen erhalten jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllen und auf deren Betrieb die Fläche mit Hangneigung mehr als 10 Aren und pro Bewirtschaftungsparzelle mehr als 2 Aren misst Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 191
unter
Neigung 59% 18–35% Neigung 26% 35% und mehr Neigung 15%
Quelle: BLW
18%
Total 557 835 ha
Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2001
Der Anteil der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 33% und der Anteil Betriebe gemessen an der Gesamtzahl aller Rebbaubetriebe 60%

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 192 Ansätze 2001 Fr /ha – für Flächen mit 30 bis 50% Neigung 1 500 – für Flächen mit über 50% Neigung 3 000 – für Flächen in Terrassenlagen 5 000
Einheit Zu Beiträgen berechtigende Flächen total ha 3 305 Steillagen 30 bis 50% Neigung ha 1 667 Steillagen über 50% Neigung ha 323 Terrassenanlagen ha 1 314 Anzahl Betriebe Anzahl 2 888 Fläche pro Betrieb ha 1,1 Beitrag pro Betrieb Fr 3 477 Total Beiträge 1 000 Fr 10 043 Total Beiträge 2000 1 000 Fr 10 076 Quelle: BLW
Neuerungen 2002
Im Bereich der Allgemeinen Direktzahlungen hat der Bundesrat mit Beschluss vom 24. April 2002 folgende Änderungen vorgenommen:
Erhöhung der Limite beim Beitrag für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen von 15 auf 20 GVE
Mit der Erhöhung der Limite können einerseits die Einkommenslage der Berglandwirtschaft verbessert und andererseits die negativen strukturellen Auswirkungen der heutigen Beitragsbegrenzung vermindert werden Ab 2002 werden für rund 80'000 RGVE zusätzlich Beiträge in der Höhe von 43 Mio Fr ausgerichtet Damit erhalten insbesondere die Haupterwerbsbetriebe im Hügel- und im Berggebiet höhere Beiträge.
Anhebung des Abzuges für vermarktete Milch beim Beitrag für Raufutter verzehrende Nutztiere um 200 kg auf 4‘400 kg Diese Massnahme bewirkt zusätzliche Beiträge an milchproduzierende Betriebe in der Höhe von rund 11 Mio Fr Dadurch dürfte der Rückgang der RGVE-Beiträge in Folge der Erhöhung der Milchkontingente kompensiert werden
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 193
2.2.3 Ökologische Direktzahlungen
Ökobeiträge

Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab, deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten, bei denen sie freiwillig mitmachen können Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig; die Beiträge können kumuliert werden
die verschiedenen Programme 2001
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 194 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ökoausgleich 36% Extenso 10% RAUS 37% BTS 10% Biologischer Landbau 7% Quelle: BLW Total 329,9 Mio. Fr.
Tabellen 32a–32b, Seiten A34–A35 Verteilung der Ökobeiträge auf
■ Extensiv genutzte Wiesen
Ökologischer Ausgleich
Mit dem ökologischen Ausgleich soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten und nach Möglichkeit wieder vergrössert werden Der ökologische Ausgleich trägt zudem zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN angerechnet werden Daneben gibt es Elemente, die nur für den ökologischen Ausgleich beim ÖLN anrechenbar sind
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Beim ÖLN anrechenbare Elemente Beim ÖLN anrechenbare Elemente mit Beiträgen ohne Beiträge
extensiv genutzte Wiesen extensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte Wiesen Waldweiden
Streueflächen
einheimische standortgerechte
Einzelbäume und Alleen
Hecken, Feld- und Ufergehölze Wassergräben, Tümpel, Teiche
Buntbrachen Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle Rotationsbrachen Trockenmauern
Ackerschonstreifen
Hochstamm-Feldobstbäume
unbefestigte natürliche Wege
Rebflächen mit hoher Artenvielfalt
weitere, von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen auf der LN
Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und dürfen während sechs Jahren in Abhängigkeit zur Zone jeweils frühestens Mitte Juni bis Mitte Juli genutzt werden. Das späte Mähen soll gewährleisten, dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird So bleibt auch zahlreichen wirbellosen Tieren, bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion Das Düngen und der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln, mit Ausnahme der Einzelstockbehandlung von Problemunkräutern, sind verboten
Die Beiträge für extensiv genutzte Wiesen, Streueflächen, Hecken, Feld- und Ufergehölze sind einheitlich geregelt und richten sich nach der Zone, in der sich die Fläche befindet Der Anteil an extensiven Wiesen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 195
Ansätze 2001 Fr /ha – Ackerbau- und Übergangszonen 1 500 – Hügelzone 1 200 – Bergzonen I und II 700 – Bergzonen III und IV 450
Tabellen 33a–33d, Seiten A36–A39
Beiträge für extensive Wiesen 2001
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten, welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden Es gelten grundsätzlich die gleichen Bewirtschaftungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen Die Flächen dürfen jedoch erst ab dem 1 September gemäht werden
für Streueflächen 2001
Als Hecken, Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-, Hoch- oder Baumhecken, Windschutzstreifen, Baumgruppen, bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze. Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet werden Sie müssen sachgerecht gepflegt werden Verboten sind sowohl die Düngung als auch die Verwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln Den Gehölzstreifen entlang ist ein ungedüngter Krautsaum von mindestens 3 m Breite anzulegen
Beiträge für Hecken, Feld- und Ufergehölze 2001
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 196
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 18 036 8 785 9 346 36 167 Fläche ha 21 550 8 712 13 663 43 926 Fläche pro Betrieb ha 1,19 0,99 1,46 1,21 Beitrag pro Betrieb Fr 1 755 1 005 769 1 318 Beiträge 1 000 Fr 31 653 8 825 7 191 47 669 Beiträge 2000 1 000 Fr 24 567 7 986 7 256 39 809 Quelle: BLW
Beiträge
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 1 459 1 453 2 362 5 274 Fläche ha 1 429 1 093 2 267 4 788 Fläche pro Betrieb ha 0,98 0,75 0,96 0,91 Beitrag pro Betrieb Fr 1 447 735 596 870 Beiträge 1 000 Fr 2 112 1 067 1 407 4 586 Beiträge 2000 1 000 Fr 1 930 826 911 3 668 Quelle: BLW
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 5 217 2 518 1 076 8 811 Fläche ha 1 283 683 308 2 274 Fläche pro Betrieb ha 0,25 0,27 0,29 0,26 Beitrag pro Betrieb Fr 364 277 186 317 Beiträge 1 000 Fr 1 899 698 201 2 797 Beiträge 2000 1 000 Fr 1 865 698 214 2 777 Quelle: BLW
Streueflächen
Hecken,
Ufergehölze
■
■
Feld- und
■ Wenig intensiv genutzte Wiesen
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden Daneben gelten die selben Nutzungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen
Beiträge für wenig intensiv genutzte Wiesen 2001
Als Buntbrachen gelten mehrjährige, mit einheimischen Wildkräutern angesäte Streifen von mindestens 3 m Breite Die Düngung dieser Streifen ist verboten Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind Ab dem zweiten Standjahr dürfen sie zwischen dem 1. Oktober und dem 15. März zur Hälfte geschnitten werden Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung.
Für Buntbrachen werden pro ha 3'000 Fr ausgerichtet Die Beiträge gelten für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone
Beiträge für Buntbrachen 2001

1 Hier handelt es sich um Betriebe die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften
Quelle: BLW
Die Buntbrache ist im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Getreidemarktes eine wirtschaftlich interessante Alternative zu den Ackerkulturen geworden.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 197
Ansätze 2001 Fr /ha – Ackerbau- bis Hügelzone 650 – Bergzonen I und II 450 – Bergzonen III und IV 300
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 9 992 9 306 10 862 30 160 Fläche ha 8 735 8 453 21 432 38 619 Fläche pro Betrieb ha 0,87 0,91 1,97 1,28 Beitrag pro Betrieb Fr 561 502 673 583 Beiträge 1 000 Fr 5 607 4 674 7 307 17 588 Beiträge 2000 1 000 Fr 5 884 4 797 7 589 18 269 Quelle: BLW
Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 1 932 361 7 2 300 Fläche ha 1 670 289 2 1 961 Fläche pro Betrieb ha 0,86 0,80 0,27 0,85 Beitrag pro Betrieb Fr 2 593 2 402 810 2 558 Beiträge 1 000 Fr 5 010 867 6 5 883 Beiträge 2000 1 000 Fr 3 380 563 4 3 946
Merkmal Einheit Tal-
Buntbrachen
■
■ Rotationsbrachen
Als Rotationsbrachen gelten ein- bis zweijährige, mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen, die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel, Hasen und Insekten Lebensraum In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich. Die Düngung dieser Streifen ist verboten Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht zu bekämpfen sind Rotationsbrachen dürfen zwischen dem 1 Oktober und dem 15 März geschnitten werden
Für die Rotationsbrachen werden pro ha 2'500 Fr ausgerichtet Die Beiträge gelten wie für die Buntbrachen für Flächen in der Ackerbauzone bis und mit Hügelzone
■ Ackerschonstreifen
mit Standort in der Hügel- oder Bergregion, die jedoch Teile ihrer Flächen in der Talregion bewirtschaften
Quelle: BLW
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen wie Getreide, Raps, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Soja, nicht jedoch Mais. Verboten sind der Einsatz von Stickstoffdüngern und Insektiziden sowie die breitflächige chemische oder mechanische Unkrautbekämpfung Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind
Im Jahr 2001 wurden pro ha 1’500 Fr bezahlt Beiträge gibt es nur für Flächen in der Tal- und Hügelzone
Beiträge für Ackerschonstreifen 2001
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 198
Beiträge für Rotationsbrachen 2001 Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region 1 region 1 Betriebe Anzahl 846 131 2 979 Fläche ha 1 115 165 1 1 281 Fläche pro Betrieb ha 1,32 1,26 0,65 1,31 Beitrag pro Betrieb Fr 3 295 3 141 1 625 3 271 Beiträge 1 000 Fr 2 788 412 3 3 203 Beiträge 2000 1 000 Fr 2 218 330 0 2 548 1 Hier handelt es sich
um Betriebe
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 149 41 0 190 Fläche ha 39 50 44 Fläche pro Betrieb ha 0,26 0,13 0 0,23 Beitrag pro Betrieb Fr 394 186 0 349 Beiträge 1 000 Fr 59 80 66 Beiträge 2000 1 000 Fr 43 50 48 Quelle:
BLW
Die Beiträge wurden für das Jahr 2001 um 500 Franken erhöht, um die Attraktivität dieses Elements im ökologischen Ausgleich im Vergleich zu den Bunt- und Rotationsbrachen zu steigern
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume, die nicht in einer Obstanlage stehen, sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven
Die Stammhöhe muss bei Steinobstbäumen mindestens 1,2 m, bei den übrigen Bäumen mindestens 1,6 m betragen Der Einsatz von Herbiziden zur Freihaltung des Stammes ist ausser bei Bäumen von weniger als fünf Jahren verboten Die Beitragsberechtigung besteht ab einer Mindestzahl von 20 Bäumen Die Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume können mit jenen für extensiv oder wenig intensiv genutzte Wiesen sowie den Beiträgen gemäss der Öko-Qualitätsverordnung kumuliert werden Im Jahr 2001 wurden pro angemeldeten Baum 15 Fr ausgerichtet
Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume 2001
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 2001

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 199
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 17 740 13 261 5 464 36 465 Bäume Anzahl 1 246 754 931 289 262 856 2 440 899 Bäume pro Betrieb Anzahl 70,28 70,23 48,11 66,94 Beitrag pro Betrieb Fr. 1 054 1 053 722 1 004 Beiträge 1 000 Fr 18 701 13 969 3 943 36 613 Beiträge 2000 1 000 Fr 18 991 14 172 3 893 37 057 Quelle: BLW
■ HochstammFeldobstbäume
Extensiv genutzte Wiesen
Streuefläche
Rotationsbrachen 1,4% Wenig intensiv genutzte Wiesen 41,6% Feld- und Ufergehölze 2,4% Quelle: BLW 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume Total 92 892 ha Ackerschonstreifen 0,1% Buntbrachen 2,1%
47,3%
5,1%
■ Postulat Fässler: Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen
Entwicklung der ökologischen Ausgleichsflächen
Mit Beschluss vom 9 Januar 2002 hat der Bundesrat das Postulat Fässler (01 3501) angenommen. In seiner Stellungnahme hält er fest, dass er keinen separaten Bericht vorsieht, sondern dem Postulat im Agrarbericht 2002 Rechnung tragen wird Die nachfolgenden Ausführungen orientieren über die gegenwärtige Situation sowie über die aktuellen und avisierten Massnahmen zur Vernetzung der ökologischen Ausgleichsflächen
Postulat Fässler vom 3. Oktober 2001: Wortlaut
Der Bundesrat wird um einen Bericht gebeten über die ökologischen Ausgleichsflächen in der Schweiz
Im Bericht soll die gegenwärtige Situation dargestellt werden (Anzahl Flächen, Grösse dieser Flächen, geografische Lage, usw )
Der Bericht soll zeigen, welche Massnahmen zur Vernetzung der Ausgleichsflächen im Moment laufen
Der Bericht soll aufzeigen, mit welchen weiteren Massnahmen die Vernetzung ökologischer Ausgleichsflächen voran getrieben werden kann
■ Gegenwärtige Situation der ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF)
Seit der Einführung des ökologischen Ausgleichs als eigenes Öko-Programm im Jahr 1993 hat sich die ökologische Ausgleichfläche an der gesamten LN kontinuierlich erhöht Entscheidend war dabei der geforderte Mindestanteil an diesen Ausgleichsflächen von 7% bzw 3,5% bei Spezialkulturen bei einer Teilnahme am ehemaligen Programm der Integrierten Produktion (IP). Heute umfasst die beitragsberechtigte Fläche des ökologischen Ausgleichs knapp 93'000 ha oder beinahe 9% der LN Als wichtiges Element zum ökologischen Ausgleich zählen auch die Hochstamm-Feldobstbäume mit gegenwärtig 2,4 Mio. Stück. Der Bund unterstützt die ökologischen Ausgleichflächen mit rund 118 Mio Fr (zur Entwicklung der Flächen vgl Abschnitt 1 3 1)
Verteilung der ÖAF nach Regionen 2001
1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume
Quellen: BLW, BFS
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 200
–
–
–
Beitragsberechtigte ÖAF 1 LN Anteil ha ha % Talregion 35 821 507 371 7,1 Hügelregion 19 401 277 160 7,0 Bergregion 37 670 286 599 13,1 Total 92 892 1 071 130 8,7
Von Naturschutzkreisen wurde kritisiert, dass die ÖAF aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen an Standorten mit geringen ökologischen Potenzial wie Nordhängen oder Waldrändern angelegt werden oder eine Vegetation ohne floristisches Verbesserungspotential aufweisen Diese Mängel wurden durch verschiedene Evaluationen bestätigt. Die Ergebnisse zeigten, dass rund ein Drittel der untersuchten Wiesen eine gute Qualität aufwies, ein Drittel hatte Verbesserungspotential und etwa ein Drittel war von ungenügender Qualität
Gemeinsam mit dem BLW, dem nationalen Forum für den ökologischen Ausgleich und dem BUWAL wurde eine Änderung im Konzept des Ökoausgleichs erarbeitet, um eine Verbesserung innerhalb und zwischen den ökologischen Ausgleichsflächen zu erreichen Das Konzept bildet die Grundlage für die Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV, SR 910 14) Am 4 April 2001 hat der Bundesrat diese verabschiedet und sie auf den 1 Mai 2001 in Kraft gesetzt
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 201
Anteil
ökologische
Ausgleichsflächen 1 in % der LN nach Gemeinden 2001
1 Ökologischer Ausgleich ohne Hochstamm-Feldobstbäume 2001 2 Pro Gemeinde, ha beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen dividiert durch ha LN in % der LN 2 0 <10 10–19,9 20–29,9 ≥30 Sömmerungsgebiet
Quelle: BLW, Kartendaten GG25 © Swisstopo (BA024503)
■ Öko-Qualitätsverordnung als Basis aktueller und künftiger Massnahmen
Basierend auf den Erlassen des LWG und des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz unterstützt der Bund ÖAF von besonderer Qualität sowie die Vernetzung von ÖAF mit Finanzhilfen Bedingung ist eine finanzielle Beteiligung durch die Kantone oder Dritte. Massgebend hierfür ist die Finanzkraft der Kantone.
Die Beiträge für die biologische Qualität können mit den Beiträgen für die Vernetzung kumuliert werden
Anrechenbare Ansätze
Ansätze 2001 Fr
– für die biologische Qualität 500 –/ha
für Hochstamm-Feldobstbaum
– für die Vernetzung
20 –/Baum
500 –/ha
Damit ÖAF ihre Funktion als Lebensraum von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten erfüllen können, müssen sie bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen Eine ÖAF hat eine gute biologische Qualität, wenn sie eine standortgemässe botanische Artenvielfalt aufweist. Diese ist wiederum die Basis für eine vielfältige Fauna (Schmetterlinge, Käfer, Spinnen, Vögel usw ) Ebenso wichtig wie die biologische Qualität ist die sinnvolle Vernetzung der ÖAF Vernetzung bedeutet, eine ÖAF gezielt so anzulegen, damit sie den Tier- und Pflanzenarten als Trittsteine oder Korridore zwischen bereits bestehenden aber isolierten Lebensräumen dienen Solche Trittsteine ermöglichen Wanderbewegungen und den Austausch von Erbmaterial Eine gute Vernetzung ist somit eine weitere Dimension der Qualität von ÖAF

Für den Bezug von Beiträgen haben die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von ÖAF die spezifischen Anforderungen der Kantone zu erfüllen Bei der Vernetzung sind zudem die Vorgaben eines vom Kanton genehmigten regionalen Vernetzungsprojektes zu berücksichtigen. Die kantonalen Anforderungen ihrerseits haben gewisse Kriterien als Mindestanforderungen sowohl für die biologische Qualität als auch die Vernetzung zu erfüllen
Die Öko-Qualitätsverordnung basiert auf ergebnisorientierten Anreizen, wodurch sich der ökologische Ausgleich von einem mehrheitlich mit Bewirtschaftungsauflagen belegten Bereich zu einem zielorientierten Produktionszweig der Landwirtschaft wandelt Die Teilnahme an den Programmen der Öko-Qualitätsverordnung ist freiwillig
Die Öko-Qualitätsverordnung beruht auf dem Grundsatz, dass eine gezielte Förderung der natürlichen Artenvielfalt angesichts der Vielfalt unseres Landes nur regional umzusetzen ist. Sie enthält klar definierte, wissenschaftlich abgestützte und auf einem breiten Konsens beruhende Qualitäts- und Vernetzungskriterien, die von den Kantonen spezifiziert werden können
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 202
–
■ Stand der Umsetzung
September 2002
Die kantonalen Anforderungen für den Vollzug werden nach Anhörung von Experten vom BLW geprüft und genehmigt Seit In-Kraft-Treten der Öko-Qualitätsverordnung wurden folgende Bewilligungen erteilt:
Kantone mit Bewilligungen für den Vollzug der Öko-Qualitätsverordnung
Biologische Qualität Regionale Vernetzung
BL, BS, FR, GR, LU, SG, BE, BL, BS, GR, LU, SG, SH, TG, VD, ZG, ZH, SZ, JU SH, TG, VD, ZG, ZH
Nur für Teilbereiche:
AG, BE, GL, SO
■ Weiterführende Massnahmen
Die Öko-Qualitätsverordnung dürfte künftig der Motor zur Umsetzung bestehender Gesetze, Leitbilder und Konzepte in den Kantonen sein, wie z B Artikel 18b Absatz 2 des Natur- und Heimatschutzgesetzes, Landschaftskonzept Schweiz, Nationales Ökologisches Netzwerk REN, Wildtierkorridore, Inventar der Trockenwiesen und -weiden der Schweiz sowie kantonale Richtpläne Seit dem Inkrafttreten der Öko-Qualitätsverordnung sind diverse Praxishilfen für die Umsetzung erschienen.
Damit sind alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um die Ziele des ökologischen Ausgleichs zu erreichen. Momentan werden keine zusätzlichen Massnahmen als notwendig erachtet, um die Vernetzung von ÖAF voranzutreiben Der Prozess wird laufend evaluiert Entscheidend ist, dass die ausgelöste Dynamik erhalten bleibt Hier sind alle Akteure gefordert: Landwirtschaft, Beratung, Kantone und Bund Wesentlich ist auch, dass die durch die Öko-Qualitätsverordnung verstärkte Zusammenarbeit von BUWAL und BLW vertieft werden kann und die auf Bundes- und Kantonsebene entstandenen guten Kontakte zwischen Landwirtschaft und Natur- und Landschaftsschutz weiter gepflegt werden
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 203
Bezugsquelle für die Praxishilfen siehe Anhang Literatur A84
Extensive Produktion von Getreide und Raps
Diese Massnahme hat zum Ziel, den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren, Fungizide, chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektizide zu fördern Die Anforderungen sind auf der gesamten Brotgetreide-, Futtergetreide- oder Rapsfläche eines Betriebes einzuhalten
Der Anteil von Brotgetreide, der nach den Auflagen für die extensive Produktion angebaut wird, beträgt 43% der Gesamtproduktion Dieser Anteil liegt bei 61% für Futtergetreide (ohne Körnermais) und bei 34% für Raps
Im Jahr 2001 wurden pro ha 400 Fr. ausgerichtet.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 204
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 11 161 6 939 1 117 19 217 Fläche ha 54 576 24 385 2 616 81 576 Fläche pro Betrieb ha 4,89 3,51 2,34 4,25 Beitrag pro Betrieb Fr 1 948 1 404 937 1 693 Beiträge 1 000 Fr 21 737 9 743 1 046 32 526 Beiträge 2000 1 000 Fr. 22 103 10 128 1 168 33 398 Quelle: BLW Aufteilung der Extensofläche 2001 Brotgetreide 50% Raps 5% Futtergetreide 45% Quelle: BLW Total 81 576 ha Tabelle
Extensive Produktion von Getreide und Raps 2001
34, Seite A40
Biologischer Landbau

Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform. Um Beiträge zu erhalten, müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb mindestens die Anforderungen der im August 2000 revidierten Bio-Verordnung vom 22 September 1997 erfüllen Teilumstellungen sind nur bei Betrieben mit Wein-, Obst-, Gemüseproduktion oder Zierpflanzenanbau möglich Gefordert werden unter anderem der Verzicht auf chemisch-synthetisch hergestellte Hilfsstoffe, wie Handelsdünger oder Pestizide Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig, die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen
Im Jahr 2001 umfasste der biologische Landbau 9% der gesamten LN Im Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl der Biobetriebe um über 10% zugenommen Die nach der Bioverordnung bewirtschaftete Fläche vergrösserte sich um 11,5%.
Es ist davon auszugehen, dass die Erhöhung der Beitragsansätze als zusätzlicher Anreiz für die Umstellung wirkte
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 205
Ansätze 2001 Fr /ha – Spezialkulturen 1 200 – Offene Ackerfläche ohne Spezialkulturen 800 – Grün- und Streueflächen 200
Beiträge für den Biologischen Landbau 2001
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche nach Region 2001

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 206
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 1 068 1 247 3 126 5 441 Fläche ha 18 309 19 927 55 328 93 565 Fläche pro Betrieb ha 17,14 15,98 17,70 17,20 Beitrag pro Betrieb Fr 6 864 3 967 3 586 4 317 Beiträge 1 000 Fr 7 331 4 946 11 211 23 488 Beiträge 2000 1 000 Fr 4 585 2 520 5 080 12 185 Quelle: BLW
Talregion 20% Bergregion
Quelle: BLW Total 93 565 ha Hügelregion 21%
59%
Tabelle 32a, Seite A34
■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
Besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere
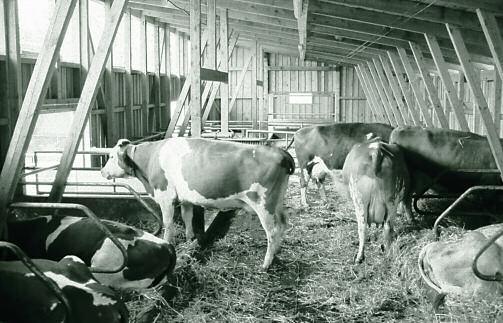
Unter diesem Titel werden die beiden im Folgenden beschriebenen Programme BTS und RAUS zusammengefasst (vgl Abschnitt 1 3 2)
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen, welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen Es gelten die folgenden Grundsätze:
die Tiere werden frei in Gruppen gehalten; – den Tieren stehen ihrem natürlichen Verhalten angepasste Ruhe-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung;
die Ställe verfügen über genügend natürliches Tageslicht.
Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 2001
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 207
–
–
Ansätze 2001 Fr /GVE – Tiere der Rindergattung, Ziegen, Kaninchen 90 – Schweine 155 – Geflügel 180
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 7 607 4 852 2 862 15 321 GVE Anzahl 181 300 88 079 40 760 310 139 GVE pro Betrieb Anzahl 23,83 18,15 14,24 20,24 Beitrag pro Betrieb Fr. 2 630 2 027 1 465 2 221 Beiträge 1 000 Fr 20 006 9 834 4 194 34 034 Beiträge 2000 1 000 Fr 14 877 7 049 2 822 24 749 Quelle: BLW
Tabelle 35, Seite A41
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren, auf einer Weide oder in einem Laufhof bzw in einem Aussenklimabereich, der den Bedürfnissen der Tiere entspricht Für die verschiedenen Tiere gelten die folgenden Anforderungen:
Raufutter verzehrende Nutztiere

– Weidegang an mindestens 26 Tagen im Monat während der Vegetationsperiode;
Auslauf an mindestens 13 Tagen im Monat während der Winterfütterungsperiode
Schweine
Mastschweine, Aufzuchtschweine und Zuchteber: täglicher Auslauf;
– Galtsauen: Auslauf an mindestens 3 Tagen in der Woche
Geflügel – täglicher Auslauf
für den regelmässigen Auslauf im Freien 2001
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 208
–
–
Ansätze 2001 Fr /GVE – Tiere der Rinder- und Pferdegattung, Bisons, Schafe, Ziegen, Dam- und Rothirsche sowie Kaninchen 180 – Schweine 155 – Geflügel 180 Beiträge
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 12 183 9 749 11 055 32 987 GVE Anzahl 296 399 207 250 187 290 690 939 GVE pro Betrieb Anzahl 24,33 21,26 16,94 20,95 Beitrag pro Betrieb Fr. 4 222 3 747 3 026 3 681 Beiträge 1 000 Fr 51 443 36 532 33 447 121 422 Beiträge 2000 1 000 Fr 36 048 24 806 22 516 83 370 Quelle: BLW
Tabelle 35, Seite A41
■ Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)
■ Nachhaltige Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete
Sömmerungsbeiträge
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege unserer ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden Das Sömmerungsgebiet umfasst rund 600'000 ha, welche mit über 300'000 GVE genutzt und gepflegt werden Beitragsberechtigt sind Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, welche Tiere auf einem Sömmerungs-, Hirten- oder Gemeinschaftsweidebetrieb sömmern

Sömmerungsbeiträge werden unter der Bedingung gewährt, dass die Betriebe sachgerecht und umweltschonend bewirtschaftet und allfällige kantonale, kommunale oder genossenschaftliche Vorschriften eingehalten werden. Sömmerungsbeiträge werden nach Normalstoss (NST) bzw GVE ausgerichtet Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen
1 Bei dieser Zahl handelt es sich um das Total der beitragsberechtigten Sömmerungsbetriebe (ohne Doppelzählungen) Quelle: BLW
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 209
Ansätze 2001 – Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe pro GVE (56–115 Tage Sömmerung) 300 – Für Schafe ohne Milchschafe pro NST 120 – Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 260 Sömmerungsbeiträge 2001 Merkmal Beiträge Betriebe GVE oder NST 1 000 Fr Anzahl Anzahl Kühe, Milchziegen und Milchschafe 22 527 3 220 75 090 Schafe ohne Milchschafe 2 923 1 008 24 359 Übrige Raufutter verzehrende Tiere 55 074 6 926 208 969 Total 80 524 7 607 1 Total 2000 81 238 7 968 1
Tabelle 38a–38b, Seite A44–A45
Beiträge für den Gewässerschutz
Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes ermächtigt den Bund, Massnahmen der Landwirte zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in oberund unterirdische Gewässer abzugelten Das Schwergewicht wird auf die Verminderung der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen gelegt, in denen der ÖLN, der Biolandbau, Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso, ökologischer Ausgleich) nicht genügen
Gemäss der Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet, für ober- und unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen für die Betriebe mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und 50% für Bewirtschaftungsmassnahmen Im Jahr 2001 wurden rund 2,3 Mio Fr ausbezahlt
Überblick über die Projekte 2001

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 210
Kanton Region, Voraus- Projektgebiet Projektierte Beiträge Gemeinde sichtliche (2001) Gesamt- 2001 Projektdauer kosten Jahr ha Fr Fr LU Sempachersee 1999–2004 1 4 905 8 811 166 1 023 300 LU Baldeggersee 2000–2005 1 4 325 9 559 694 567 800 LU/AG Hallwilersee 2001–2006 1 3 786 5 029906 363 200 AG Wohlenschwil 2001–2009 62 Noch keine Beiträge ausbezahlt VD Thierrens 1999–2008 17 121 236 17 600 VD Morand 2000–2008 14 760 183 9 900 ZH Baltenswil 2000–2008 70 428 353 30 900 BE Walliswil 2000–2005 125 381 108 40 800 SH Klettgau 2001–2006 450 1 136 221 87 500 FR Avry-sur-Matran 2000–2005 37 158 232 27 500 FR Middes 2000–2006 45 159 996 23 500 SO Gäu 2000–2005 650 965 640 62 500 Total 2 254 500 1 Verlängerung notwendig Quelle: BLW
■ Abschwemmungen und Auswaschung verhindern
■ Entwicklung der Nährstoffgehalte in zwei Projektgebieten
Die Projekte Thierrens (VD) und Sempachersee (LU) werden seit 1999 im Rahmen der 62a-Beiträge vom Bund unterstützt In dieser Zeitspanne konnte in den Projekten durch die ergriffenen Massnahmen eine Reduktion der Nährstoffeinträge erreicht werden:
Im Projekt Thierrens sind hauptsächlich gemischte Betriebe und Mastbetriebe mit einem relativ geringen Tierbesatz von 0,2 bis 1,4 GVE/ha LN beteiligt. Primär gehören die Anlage von extensiven und wenig intensiven Wiesen, eine gezielte Fruchtfolge und weitere Abmachungen im Rahmen der Direktzahlungsverordnung zu den vertraglich geregelten Massnahmen
Seit Projektbeginn sind die gemessenen Nitratwerte von 52mg/l auf 45mg/l zurückgegangen Die abnehmende Tendenz setzt sich fort Das Ziel besteht darin, die Einträge für die Wasserfassungen auf einer Konzentration von unter 30 mg Nitrat je Liter für Trinkwasser zu halten.
Beim Projekt Sempachersee (LU) geht es um eine Reduktion der P-Einträge Diese wurden bereits im Rahmen des ÖLN durch die Reduktion der Tierzahlen und den Export von Hofdüngern verringert Im Jahr 1999 lagen sie aber immer noch mit 7% über dem Bedarf Damit die Wasserqualität des Sempachersees weiter verbessert werden konnte, waren zusätzliche Anstrengungen notwendig (vgl Abschnitt 1 3 1)
Das Phosphorprojekt nach Artikel 62a Gewässerschutzgesetz sieht weitere Massnahmen vor Dazu gehören die Schaffung von extensiven Pufferstreifen, eine Reduktion der Düngung auf 80% des Pflanzenbedarfs, bauliche Massnahmen, der Abbau des Tierbestandes, Hofdüngerverträge, Ökofutter- und Separatoreinsatz. Obwohl sich bis jetzt nur rund ein Drittel der Betriebe am Projekt beteiligten, konnte der P-Eintrag in den See um 8 Prozentpunkte gesenkt werden
Das Projekt zeigt in der kurzen Zeit eine positive Zwischenbilanz Für eine nachhaltige Verbesserung der Wasserqualität des Sees sind jedoch grossräumigere Massnahmen nötig, und es müssen sich noch mehr Betriebe am Projekt beteiligen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 211
Entwicklung
beim Projekt Thierrens (VD) M ä r z 9 9 M a i 9 9 J u l i 9 9 S e p t e m b e r 9 9 N o v e m b e r 9 9 J a n u a r 0 0 M ä r z 0 0 M a i 0 0 J u l i 0 0 S e p t e m b e r 0 0 N o v e m b e r 0 0 J a n u a r 0 1 M ä r z 0 1 M a i 0 1 J u l i 0 1 S e p t e m b e r 0 1 N o v e m b e r 0 1 N i t r a t g e h a l t ( m g / l ) Quelle: Inspection des eaux de l'Etat de Vaud 0 60 50 40 30 20 10
des Nitratgehaltes
Neuerungen 2002
Mit Beschluss vom 21 September 2001 hat der Bundesrat Änderungen der Ökobeiträge im Bereich der besonders tierfreundlichen Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere vorgenommen
Geflügelhaltung
Die Beiträge für Geflügel zur Eierproduktion wurden für die beiden Programme BTS und RAUS um je 100 Fr /GVE erhöht
Sömmerungsbeiträge
Mit Beschluss vom 24 April 2002 hat der Bundesrat die Beiträge für die übrigen Raufutter verzehrenden Tiere von bisher 260 auf 300 Fr. pro Normalstoss erhöht und eine Differenzierung der Beiträge für Schafe nach Weidesystem ab 2003 beschlossen
Damit erfolgt eine Angleichung der Beiträge für die übrigen Raufutter verzehrenden Tiere an jene für gemolkene Tiere Mit der Differenzierung für Schafe nach Weidesystem soll in Analogie zu den Ökobeiträgen ein Anreiz für eine nachhaltigere Schafalpung geschaffen werden Insbesondere geht es darum, die aus ökologischen Gründen erwünschte Umtriebsweide bzw Behirtung mit höheren Beiträgen zu fördern und zu honorieren. Für diese Massnahme ist mit Ausgaben von rund 1,5 Mio. Fr. zu rechnen. Das Inkrafttreten der Differenzierung nach Weidesystem ist für 2003 vorgesehen, um den Vollzugsbehörden zu ermöglichen, die erforderlichen Abklärungen gleichzeitig mit der allgemeinen Überprüfung der Schafalpen vorzunehmen Die Erhöhung der Sömmerungsbeiträge führt insgesamt zu zusätzlichen Einnahmen für die Alpwirtschaft von 9 Mio. Fr.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 212
BTS Ansätze 2002 Fr /GVE – Geflügel zur Eierproduktion 280 RAUS Ansätze 2002 Fr /GVE – Geflügel zur Eierproduktion 280
Ansätze in Fr 2001 2002 2003 Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe pro GVE 300 300 300 Für Schafe ohne Milchschafe pro NST: – bei ständiger Behirtung 120 120 300 – bei Umtriebsweide 120 120 220 – bei übrigen Weiden 120 120 120 Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 260 300 300
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion
Finanzhilfen für die Grundlagenverbesserung
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt: – Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen;

– Effiziente und umweltgerechte Produktion;
– Ertragreiche, möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte;
Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt;
– Genetische Vielfalt
213 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
2.3 Grundlagenverbesserung
Massnahme Rechnung Rechnung Budget 2000 2001 2002 Mio Fr Beiträge Strukturverbesserungen 88 102 90 Investitionskredite 100 98 90 Betriebshilfe 8 30 40 Beratungswesen und Forschungsbeiträge 22 23 24 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge 724 Pflanzen- und Tierzucht 21 21 23 Total 246 277 271 Quelle: BLW
–
2.3.1 Strukturverbesserungen und Betriebshilfe
Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert Dies betrifft insbesondere das Berggebiet und die Randregionen
Als Investitionshilfen stehen zwei Instrumente zur Verfügung:

– Beiträge (à-fonds-perdu) mit Beteiligung der Kantone;
Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen.
Investitionshilfen unterstützen die Landwirtschaft in der Entwicklung und der Erhaltung wettbewerbsfähiger Strukturen, ohne dass sie sich dafür untragbar verschulden muss Auch in anderen Ländern, insbesondere in der EU, zählen die Investitionshilfen zu den wichtigsten Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raumes
Die Investitionshilfen werden für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.
Für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten standen im Jahr 2001 102 Mio Fr zur Verfügung, davon 12 Mio Fr als Nachtragskredit für die Behebung der Unwetterschäden im Jahr 2000 Das BLW genehmigte neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 96 Mio Fr Damit wurde ein Investitionsvolumen von 393 Mio Fr ausgelöst Die Summe der ausgerichteten Bundesbeiträge der genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen», da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird.
214 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
■ Finanzielle Mittel für Beiträge
Beiträge des Bundes 2001 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen
Wegebauten
Wasserversorgungen
Unwetterschäden und andere Tiefbaumassnahmen
Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere
Der Bund setzte im Jahr 2001 dank einem Nachtragskredit für die Behebung der Unwetterschäden 15% mehr finanzielle Mittel in Form von Beiträgen ein als im Vorjahr Gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1991/93 ist die Summe aber 7% tiefer Die Erhöhung der Bundeskredite zur Behebung von Unwetterschäden ist in den ordentlichen Rubriken 1994, 2000 und 2001 enthalten
Beiträge des Bundes an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten 1991/93–2001
215 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
2
Tabellen 41–42, Seiten A50–A51
andere Hochbaumassnahmen Mio Fr Talregion Hügelregion Bergregion 27,4 0 5 10 15 20 25 30 12,1 6,0 19,3 28,5 2,5 Quelle: BLW 68% 15% 18%
1991/931994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001 M i o F r ordentliche Rubrik Sonderrubrik zur Förderung der Beschäftigung im landw. Hochbau Quelle: BLW 1 In den Jahren 1993 und 1994 wurden Sonderkredite für den landwirtschaftlichen Hochbau zur Förderung der Beschäftigung gesprochen 0 20 40 60 80 100 120 10991 85 85 15 1 82 75 75 87 102
■ Finanzielle Mittel für Investitionskredite
Im Jahre 2001 bewilligten die Kantone für 2'514 Fälle Investitionskredite von insgesamt 283 Mio Fr Von diesem Kreditvolumen entfallen 87% auf einzelbetriebliche und 13% auf gemeinschaftliche Massnahmen Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite, so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren, gewährt werden
Investitionskredite 2001
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden z B als Starthilfe, für den Neubau, den Umbau oder die Verbesserung von landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomie- oder Alpgebäuden eingesetzt Sie werden durchschnittlich in 13 Jahren zurückbezahlt.

Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen und bauliche Massnahmen (Alpgebäude, Gemeinschaftsställe, Gebäude und Einrichtungen für die Verarbeitung und die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte) unterstützt
Im seit 1963 geäufneten Fonds de roulement befinden sich rund 1,8 Mrd Fr Den Kantonen werden jährlich neue Bundesmittel zur Verfügung gestellt; im Jahre 2001 waren es 98,2 Mio Fr Sie werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt
216
Bestimmung Fälle Betrag Anteil Anzahl Mio Fr % Einzelbetriebliche Massnahmen 2301 245,9 87 Gemeinschaftliche Massnahmen, ohne Baukredite 151 19,2 7 Baukredite 62 17,7 6 Total 2514 282,8 100 Quelle: BLW
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Tabellen 43–44 Seiten A52–A53
■ Unwetterschäden
Oktober 2000
Investitionskredite 2001 nach Massnahmenkategorie, ohne Baukredite
Gemeinschaftlicher Inventarkauf, Verarbeitung und Lagerung landw. Produkte Kauf Betrieb durch Pächter
Bodenverbesserungen
Nach einer ausserordentlichen Niederschlagsperiode im Oktober 2000 sind im Wallis und auf der Alpensüdseite grosse Schäden entstanden Diese waren gesamthaft kleiner als 1987, 1993 und 1999. Der Kanton Wallis jedoch war wesentlich stärker betroffen als bei den vorangegangenen Katastrophenereignissen Die Schäden waren grossflächiger, zahlreicher und von grösserem Ausmass Neben den tragischen Murgängen von Gondo, Baltschieder, Vispertal und Fully sind in höher gelegenen Regionen ganze Hangpartien grossflächig abgerutscht Die umfangreichen Ueberschwemmungen im Talgebiet zerstörten hauptsächlich Intensivkulturen Viele Schäden im Bereich der Sömmerungsgebiete sind infolge des früh einsetzenden Winters erst im Frühsommer 2001 erfasst worden
Auf Grund der Grosszahl der Schäden mussten bei der Wiederinstandstellung strenge Prioritäten gesetzt werden Im Vordergrund stand im landwirtschaftlichen Bereich die Wiederherstellung der Hauptwege und Bewässerungseinrichtungen. Bei grossflächigen Schutt- und Schlammablagerungen sind selbst im Talgebiet Verzichtslösungen oder Umnutzungen in Kauf genommen worden Da die zahlreich abgerutschten Hangpartien im Berggebiet nicht stabilisiert werden konnten, ist dort in Zukunft vermehrt mit Folgeschäden zu rechnen
217 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2
Ökonomiegebäude
Starthilfe Wohngebäude
Mio Fr Talregion Hügelregion Bergregion 132,9 0 20 40 60 80 100 120 140 70,0 44,4 11,5 5,2 1,1 Quelle: BLW 26,1% 48,5% 25,3%
Die Summe der direkten Schäden wird gesamthaft auf über 400 Mio. Fr. geschätzt. Im Bereich «Landwirtschaft» sind in den Kantonen Wallis und Graubünden (Puschlav) kostenwirksame Schäden von 25 Mio Fr an Kulturland und kulturtechnischen Bauten gemeldet worden. Zur Behebung dieser Schäden wurden im Jahre 2001 Bundesbeiträge im Umfang von 15,4 Mio Fr zugesichert Dabei kam Artikel 95 des Landwirtschaftsgesetzes für Zusatzbeiträge zur Behebung besonders schwerer Folgen von ausserordentlichen Naturereignissen zur Anwendung Für 12 Mio Fr wurden vom Parlament Nachtragskredite gesprochen Die restlichen Beiträge wurden im Rahmen des normalen Budgets durch Umverteilungen abgedeckt
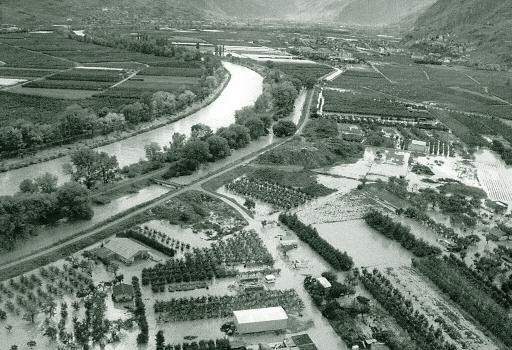
Ertragsausfälle sind vom «Schweizerischen Elementarschädenfonds» entschädigt worden, welcher sich auch an den Kosten der Feinräumung des Kulturlandes von Privaten beteiligt hat

218 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Wertewandel
Öffentlicher und privater Nutzen moderner Meliorationen – Entwicklung eines Bewertungssystems
Moderne Meliorationen bezwecken die Erhaltung, Gestaltung und Förderung des ländlichen Raumes Sie weisen zahlreiche Verknüpfungspunkte mit anderen Bereichen auf und sind Bestandteil der Landschaftsentwicklung Bei der Umsetzung werden die verschiedenen Bedürfnisse der direkt und indirekt Betroffenen einbezogen
Bis Ende der siebziger Jahre waren die Ziele von Meliorationen vorwiegend auf die Landwirtschaft ausgerichtet Das Instrumentarium wurde zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen entwickelt und mit Erfolg eingesetzt. Der Wertewandel in der Gesellschaft und die damit geänderten Bedürfnisse bedingten eine Überprüfung der Meliorationsziele Daraus entstand 1993 das Leitbild «Moderne Meliorationen», welches als neue Zielrichtung die «Gestaltung und Förderung des ländlichen Raumes» hat Mit Hilfe von modernen Meliorationen sollen optimale Strukturen und ein günstiges Umfeld für die multifunktionale Landwirtschaft, für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt sowie für die Raumnutzung und Raumplanung geschaffen werden
Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt «Öffentlicher und privater Nutzen moderner Meliorationen» in die Wege geleitet Der Schwerpunkt wurde auf die Entwicklung eines Bewertungssystems von öffentlichem und privatem Nutzen gelegt.
■ Methode
Das Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich (IAW) hat im Auftrag von 11 Kantonen und der Konferenz der Amtsstellen für das Meliorationswesen ein Forschungsprojekt zur «nicht monetären Quantifizierung des öffentlichen und privaten Nutzens moderner Meliorationen» durchgeführt
Als methodischer Ansatz wurde die Nutzwertanalyse gewählt. Diese bewertet eine komplexe Handlung (Projekt) und wird oft zur Entscheidungsfindung verwendet Mittels eindeutiger Formulierung von Zielen sowie deren Gewichtung und Bewertung mit Indikatoren wird der Nutzwert der Projektvarianten ermittelt Die Nutzwertanalyse kann die Planer jedoch nicht von einer genauen Analyse der einzelnen Projektschritte entbinden, sondern nur eine Tendenz zur besten Alternative aufzeigen
Für die Entwicklung des Zielsystems als Grundlage einer Nutzwertanalyse sind Experten befragt worden. Anhand der zwei Fallbeispiele «Güterzusammenlegung Ermensee LU» und «Güterzusammenlegung Otelfingen-Boppelsen ZH» wurden die Bewertungsgrundlagen (Indikatoren) bestimmt und das Zielsystem verfeinert Die Gewichtung der Ziele erfolgte durch Vertreter von Interessengruppen.
■ Resultate
Das Forschungsprojekt schuf mit der Formulierung der Projektziele und deren Bewertung mit messbaren Indikatoren eine solide Basis für Anwendungen in der Praxis Das vorliegende System kann nun bei anderen Meliorationen angewendet werden.
219 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Zielsystem moderner Meliorationen
Oberziel:
Erhalten und Fördern des ländlichen Raumes im Hinblick auf die Nutzungs-, Schutz- und Bewahrungsbedürfnisse der Gesellschaft
Hauptziele
Erhalten der Bodenproduktivität
Unterziele Teilziele Erhalten und Fördern einer nachhaltigen Landwirtschaft (ökonomisch, ökologisch, sozial)
Landwirtschaftliche Nutzung der geeigneten Böden erhalten (insbesondere Fruchtfolgeflächen)
Durchführung notwendiger Entwässerungsmassnahmen prioritärer Landwirtschaftsflächen
Durchführung notwendiger Bewässerungsmassnahmen prioritärer Landwirtschaftsflächen
Fördern einer flexiblen und lebensfähigen Betriebsstruktur (Reduktion der Produktionskosten)
Vermindern von unerwünschten
Umwelteinflüssen
Verbessern der Erschliessung für die Bewirtschaftung
Möglichst gute Arrondierung des Eigen- und Pachtlandes Grundlagen schaffen zum Erstellen von zweckmässigen
Bauten und Anlagen
Bewirtschaftungsstrukturen schaffen, damit zukünftige Bodenschädigungen vermieden werden können
Durchführung von notwendigen Massnahmen gegen die vorhandene Bodenverdichtung (Lockerung, Stabilisierung)
Durchführung von notwendigen Massnahmen gegen die vorhandene Bodenerosion
Erhalten, Pflegen und Aufwerten der Kultur- und Naturlandschaft und Aufwerten des Landschaftsbildes
Rahmenbedingungen schaffen zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt (Schutzbereiche)
Erhalten der Eigenart der Landschaft
Umsetzen der Anliegen des Gewässerschutzes
Erhalten von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere
Erstellen von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere
Sicherstellen einer ausreichenden Vernetzung der Lebensräume für Pflanzen und Tiere
Erhalten und Fördern der Erholungsfunktion
Erhalten von besonderen, lokalen Bewirtschaftungsformen Erhalten von besonderen, lokalen Landschaftselementen
Renaturierung von Oberflächengewässern
Revitalisierung von Oberflächengewässern
Sicherstellen des Quell- und Grundwasserschutzes
Unterstützen der Realisierung von öffentlichen und privatrechtlichen Anliegen
Grundlagen schaffen zur Sicherstellung einer angepassten, zukunftsfähigen Gemeindeinfrastruktur
Umsetzung der Vorgaben der Richt- und Nutzungsplanung
Erleichterung und Erhöhung der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
Ermöglichen der Landbereitstellung für öffentliche Zwecke (Erschliessung, grosse Bauvorhaben etc )
Erhalten der dezentralen Siedlungsstruktur in Randregionen
Koordination mit Meliorationsmassnahmen im Wald
Schutz vor Naturgefahren
Ermöglichen der Spezialnutzung (z B Kiesabbau)
Eliminierung bzw Reduzierung von Nutzungskonflikten
Vereinfachung der Pfandtitel
Vereinfachung und Sicherung der Grundeigentumsverhältnisse
Vereinfachung und Sicherung der Nutzungsrechtsverhältnisse
220 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Folgerungen


Das Oberziel formuliert ein umfassendes Ziel von modernen Meliorationen. Das Zielsystem mit Hauptzielen, Unterzielen und Teilzielen unterteilt das Oberziel in konkrete und messbare Einzelziele
Für die Erarbeitung des Zielsystems diente das Leitbild «Moderne Meliorationen» als Grundlage Ein erstes Zielsystem wurde innerhalb eines iterativen Prozesses mit Meliorationsexperten entwickelt Durch die Anwendung an den zwei Fallbeispielen sowie mit Rückfragen bei weiteren Fachleuten entstand ein konsolidiertes Zielsystem Damit konnten mehrere Anforderungen erfüllt werden:
– die Zusammenhänge der verschiedenen Zielebenen kommen klar zum Ausdruck; – eine formale Konsistenz ist erreicht;
– trotz der komplexen Aufgabenstellung konnte eine übersichtliche und knappe Formulierung der Ziele erreicht werden
Das vorliegende Zielsystem erlaubt es, die Anwendung des Instrumentariums der modernen Meliorationen zur Umsetzung von öffentlichen und privaten Bedürfnissen in einem bestimmten Raum generell zu überprüfen Mit einer Sensitivitätsanalyse können die Auswirkungen der unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Interessenvertreter nachvollziehbar und transparent dargestellt werden. Das Bewertungssystem bildet auch die Basis für eine strukturierte Erfolgskontrolle
Das Zielsystem ist nicht abschliessend, da sich die Werthaltung der Gesellschaft und die spezifischen Bedürfnisse so verändern, dass die Ziele und die dazu gehörenden Bewertungen und Gewichtungen immer wieder überprüft werden müssen Wesentlich ist, dass die konsistente Struktur des Zielsystems grundsätzlich beibehalten wird Während unterschiedliche Werthaltungen oft durch die verschiedene Gewichtung der Interessengruppen berücksichtigt werden, müssen zur Behandlung von neuen Ansprüchen Teilziele um- oder neu formuliert werden In nächster Zeit werden weitere Anforderungen zu berücksichtigen sein, z.B. die Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung und der Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK) oder der Raumbedarf für Fliessgewässer bei Wasserbauprojekten
Bei der Bearbeitung der Fallbeispiele ist aufgefallen, dass die notwendigen Daten ungenügend und uneinheitlich erfasst worden sind Eine Normierung der Datenerfassung ist deshalb unerlässlich
Da Meliorationen regional verschieden und oft gemeindeweise durchgeführt werden, kann und darf keine allgemeine Aussage über das Ausmass des privaten oder öffentlichen Nutzens von Meliorationen gemacht werden Erst eine Analyse bei verschiedenen Projekten würde Klarheit über mögliche gemeinsame Tendenzen ergeben. Im Einzelfall kann die Bewertung Hinweise geben für die Überprüfung des Finanzierungsschlüssels
In einer nächsten Phase wird ein Leitfaden für die praktische Anwendung erstellt Anschliessend sollen mehrere moderne Meliorationen bewertet werden.
221 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Verteilung der Mittel
Betriebshilfe
Die Betriebshilfe wird in Form von zinslosen Darlehen gewährt und ist eine soziale Begleitmassnahme, die dazu dient, eine vorübergehende, unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen indirekten Entschuldung
Im Jahr 2001 wurden in 304 Fällen insgesamt 34,4 Mio Fr Betriebshilfedarlehen gewährt Im Vergleich zu 316 Fällen im Vorjahr ist die Anzahl Darlehen etwa gleich geblieben Das Kreditvolumen ist um 3,4 Mio Fr höher als im Jahre 2000 Das durchschnittliche Darlehen ist von 98'300 auf 113'200 Fr. gestiegen und wird in 14 Jahren zurückbezahlt
Betriebshilfedarlehen 2001
Der seit 1963 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufnete Fonds de roulement beträgt, zusammen mit den Kantonsanteilen, rund 162 Mio Fr Im Jahr 2001 wurden den Kantonen 30 Mio Fr neu zur Verfügung gestellt Diese sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden, die je nach Finanzkraft 20–80% des Bundesanteils beträgt. Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt

222 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Bestimmung Fälle Betrag Anzahl Mio Fr Umfinanzierung bestehender Schulden 259 30,6 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung 45 3,8 Total 304 34,4 Quelle: BLW
Tabelle 45, Seite A54
■ Dynamische Agrarforschung
2.3.2 Forschung, Beratung, Berufsbildung
Landwirtschaftliche Forschung
Die Geschäftseinheit Landwirtschaftliche Forschung (GLF), in der die sechs landwirtschaftlichen Forschungsanstalten des BLW zusammengeschlossen sind, hat nun zwei Jahre FLAG (Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget) hinter sich FLAG ist gleichbedeutend mit mehr Autonomie, Transparenz und Flexibilität Dies geht einher mit einer grösseren Verantwortung der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalten
Zu Beginn gab es Kinderkrankheiten: Die neue unternehmerische Sichtweise musste eingeübt werden Die Kosten-Leistungsrechnung und der vermehrte Einsatz von Führungsinstrumenten wie die Definition von Zielen mit Indikatoren und Standards führen zu Zusatzarbeit, aber auch zu zusätzlichem Nutzen. Die Forschungsanstalten wurden autonomer und flexibler und verbesserten ihre Unternehmenskultur
Die GLF verfügte noch nie über so viele nützliche und objektive Daten zur landwirtschaftlichen Forschung, die den Bedürfnissen ihrer Gesprächspartner entsprechen Die Gesamtbilanz über die FLAG-Einführung ist positiv, sowohl für die Forschungsanstalten als auch für das BLW
Im Berichtsjahr hat die «Peer Review» zur Forschung im Biolandbau durch internationale Experten den Involvierten – dem Landwirtschaftlichen Forschungsrat, den Forschungsanstalten, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau und dem BLW – wertvolle Hinweise geliefert, die in Empfehlungen des Landwirtschaftlichen Forschungsrates zuhanden des BLW mündeten
Einige Tage waren dem «Foresight» gewidmet, das heisst dem Nachdenken über eine langfristige Strategie für unsere Agrarforschung Überlegt wurde unter anderem, welche Forschungsfragen mit dem Zeithorizont 2020 relevant werden dürften.
■ Ziele zu 93% erreicht
Die Beurteilung der Forschungsleistungen erfolgt anhand konkreter Indikatoren und Standards Die Zielvorgaben wurden zu 93% erreicht Diese Verbesserung um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2000 ist das Ergebnis einer erfolgreichen Anpassung an FLAG Lediglich bei einigen Projekten konnten die Ziele wegen Restrukturierungsmassnahmen und Mangel an qualifiziertem und spezialisiertem Personal nicht verwirklicht werden.
223 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Die GLF in der Champions League
Eine Studie des Zentrum für Wissenschafts- und Technologiestudien (CEST) zeigt auf, dass die Forschungsanstalten des BLW zur weltweiten «Champions League der Forschungsinstitutionen» gehören Weltweit gehören 1'000 Institutionen zu den Champions. Die GLF befindet sich auf Rang 211.
Die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten gehören in der Schweiz zu den wichtigeren Forschungsinstitutionen Mitarbeitende der GLF haben in der Zeitspanne 1994–1999 337 wissenschaftliche Arbeiten in «peer reviewed journals» veröffentlicht Die GLF findet sich in der Spitzengruppe der 25 wichtigsten Institutionen Spitzenreiter sind die Universität Zürich und die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Weitere Universitäten aber auch private Institutionen wie Nestlé und Novartis gehören zur Spitzengruppe.
■ Biolandbau –Peer Review, ein Novum in der landwirtschaftlichen Forschung
Eine Gruppe von internationalen Experten für Biolandbau hat im Auftrag des BLW die Leistungen der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) zu Gunsten des biologischen Landbaus überprüft Aus dem Expertenbericht geht hervor, dass die landwirtschaftliche Forschung in der Schweiz die Einführung der Integrierten Produktion optimal unterstützt hat und wertvolle Grundlagen für den Biolandbau erarbeitet. Insgesamt haben diese Forschungsarbeiten der Schweiz zu einer führenden Stellung im Biolandbau verholfen
Der Landwirtschaftliche Forschungsrat empfiehlt, dass sich die Forschungsinstitute auf Forschungsfelder mit Wettbewerbsvorteilen konzentrieren Eine derartige Schwerpunktbildung erlaubt es, die minimale «kritische Masse» zu erreichen, um in der Bioforschung an der Spitze zu bleiben Zugleich sollen die Forschungsinstitute vermehrt problemorientiert kooperieren; vor allem soll die Zusammenarbeit zwischen dem FiBL und den Forschungsanstalten vertieft werden. Chancen sieht der Forschungsrat auch in der verstärkten internationalen Ausrichtung, was zum ständigen internationalen Quervergleich und damit zur Exzellenz in der Forschung führt Die Forschungsinstitute sollen zudem ihre Ergebnisse medienwirksamer präsentieren. Der Forschungsrat regt schliesslich an, vermehrt umfassende Fragestellungen anzugehen, die oft ein multioder transdisziplinäres Vorgehen erfordern Dabei sollen das Erfahrungswissen der Kunden und die Ergebnisse des «on farm research» soweit sinnvoll und notwendig einbezogen werden
■ Neuer Vertrag mit dem FiBL
Das BLW hat mit Beteiligung des BVET eine neue Leistungsvereinbarung mit dem FiBL für die Jahre 2002 und 2003 abgeschlossen. Angestrebt wird eine Vertiefung der Zusammenarbeit und eine Förderung der Synergien zwischen den Forschungsanstalten und dem FiBL Ab 2004 können die Arbeitsprogramme der Forschungsanstalten und des FiBL aufeinander abgestimmt werden, was eine verbesserte Effizienz der Forschung zur Folge haben wird
224 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Das BLW hat in den letzten Jahren seine Agrarforschung neu strukturiert und besser in das nationale Forschungsnetz eingebunden Ohne die weiteren Reformen im Inland zu vernachlässigen, werden seit dem Jahre 2000 die Koordinationsanstrengungen mit dem Ausland verstärkt.
Die GLF will sich zur Qualitätssicherung ihrer Leistungen stärker mit ähnlich gelagerten Forschungsorganisationen in vergleichbaren Ländern messen Dabei soll vor allem beim Einreichen von Forschungsanträgen im sechsten Forschungsrahmenprogramm der EU und der neuen COST-Aktionen (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) eine aktivere Haltung eingenommen werden Im weiteren werden bestehende Kontakte zu Forschungsorganisationen und -gruppen primär in europäischen Ländern intensiviert. Auch Entwicklungen in aussereuropäischen Räumen werden mitverfolgt
Die GLF startete im Jahre 2000 einen Foresight-Prozess Bei Foresight-Prozessen wird systematisch ein Blick in die längerfristige Zukunft geworfen Dieser dient als Entscheidungshilfe, wie die Mittel thematisch und organisatorisch langfristig am geeignesten eingesetzt werden sollen Ziel dieses Prozesses ist es, Grundlagen für die strategische Planung und für eine zukunftsrobuste Strategie zu liefern.
In der Forschung ist es wichtig, sich frühzeitig mit möglichen Forschungsthemen zu befassen, deren eigentlichen Denkhorizonte die nächsten Jahrzehnte betreffen. Eine erfolgreiche Strategie kann nur entwickelt werden, wenn sie bewusst mit der Mehrdeutigkeit der Zukunft und mit der Unsicherheit umgeht Für den Foresight-Prozess wurde deshalb die Szenariotechnik ausgewählt Anhand der Szenarien, die mögliche Zukunftsbilder darstellen, konnten konkrete Massnahmen ausgearbeitet werden Zusätzlich wurde eine Umfrage unter Experten durchgeführt.
Die Resultate zeigen, dass es einen Trend hin zu den Forschungsfeldern Lebensmittelsicherheit und Gesundheit gibt. Die landwirtschaftliche Forschung soll die Lebensmittelqualität, die Lebensmittelsicherheit sowie die gesundheitsfördernden Aspekte der Nahrungsmittel unterstützen und damit das Vertrauen der Konsumenten festigen Demographische und soziale Entwicklungen werden diese Aspekte noch verstärken Auch wichtiger als heute werden Themen wie der ländliche Raum und das Risikomanagement Die reine Forschungsleistung wird durch eine ganzheitlichere Betreuung der Kunden zu ergänzen sein Ohne die bisherigen Kunden der landwirtschaftlichen Produktionskette zu vernachlässigen, wird sich langfristig die landwirtschaftliche Forschung vermehrt mit den Anliegen der Konsumentinnen und Konsumenten beschäftigen
Für die Landwirtschaftliche Forschung ist es wichtig nicht nur die zukünftigen Risiken, sondern auch die Chancen zu erkennen und zu nutzen Der Foresight-Prozess hilft, für die Forschungsplanung Zeit zu gewinnen

225 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Blick ins Ausland –Internationale Agrarforschung
■ Blick in die Zukunft –Foresight
Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung
Der Bund gewährt den kantonalen landwirtschaftlichen und bäuerlich-hauswirtschaftlichen Beratungsdiensten, den Spezial-Beratungsdiensten landwirtschaftlicher Organisationen, die gesamtschweizerisch aktiv sind und den Beratungszentralen der Schweizerischen Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft Finanzhilfen
Ausgaben für die Beratung 2001
Seit Beginn 2000 erfassen und melden die Kantone ihre Beratungsleistungen, für die sie ein Anrecht auf Finanzhilfe des Bundes haben, nach den neuen Richtlinien des BLW Obwohl im ersten Jahr noch nicht alle Kantone vollständig rapportierten, verfügt das BLW bereits jetzt über weiter reichende Angaben über die kantonale Beratungsarbeit als je zuvor
Die Grundidee hinter dem neuen Erfassungssystem ist, die Finanzhilfe an die Kantone nicht mehr nach dem Aufwand, das heisst dem für die Beratung in den kantonalen Dienststellen eingesetzten Personal zu berechnen, sondern nach Leistung Zu den drei wichtigsten Leistungskategorien zählen: Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen, Einzelberatung, Projekt- und Prozessbegleitung. In der Einzelberatung werden die Tätigkeitsbereiche zudem nach ihrem unterschiedlichen öffentlichen Interesse bewertet Die Leistungen werden in Tarifpunkte umgerechnet Die Anzahl Tarifpunkte bestimmt dann die Höhe der Finanzhilfe Das neue Erfassungssysem befindet sich in der Probephase
Erste Analysen der Meldungen der Jahre 2000 und 2001 lassen erkennen, dass das System funktioniert, aber in Einzelheiten noch verfeinert werden muss Damit sollen nicht mehr Details geregelt werden, sondern der Interpretationsspielraum der Richtlinien genauer erklärt werden So haben nicht alle Kantone ihre Leistungen mit der gleichen Genauigkeit erfasst Zu klären gilt es insbesondere, ob alle gemeldeten Leistungen Anrecht auf Finanzhilfe haben, das heisst, ob es sich tatsächlich um Beratungsleistungen handelt und bei den Einzelberatungen, in welche Kategorie des öffentlichen Interesses sie gehören So fällt eine Hofübergabe unter normalen Umständen in den Tätigkeitsbereich Betriebswirtschaft mit einem tiefen öffentlichen Interesse Wenn aber eine grundsätzliche strategische Neuausrichtung des Betriebes oder Fragen der überbetrieblichen Organisation vorliegen, kann die Betriebsübergabe viel mit Begleitung des Strukturwandels zu tun haben In diesem Fall ist das öffentliche Interesse höher
226 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Empfänger Betrag Mio Fr Landwirtschaftliche Beratungsdienste der
9,7 Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone 0,9 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen 0,9 Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft 8,4 Total 19,8 Quelle: Staatsrechnung
Kantone
■ Erste Auswertungen der kantonalen Beratungsarbeit
■ Direktvermarktung und überbetriebliche Zusammenarbeit
Nicht in allen Tätigkeitsbereichen lassen sich gesamtschweizerische Schwerpunkte ausmachen So ist es z B in der Produktionstechnik offensichtlich, dass die Themen je nach Region und Zone variieren Der Direktabsatz hingegen steht in beinahe allen Kantonen weit oben auf der Prioritätenliste. Hier stehen weniger Einzelberatungen, als vielmehr Projektarbeit und Weiterbildungsveranstaltungen im Vordergrund
Bei der Betriebswirtschaft liegt der Schwerpunkt eindeutig bei der überbetrieblichen Zusammenarbeit Ziel der Massnahmen sind vor allem Kosteneinsparungen oder Vereinfachungen der Arbeitsabläufe
Vielfältig sind die Beratungsleistungen im Bereich Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Hier geht es beispielsweise um ökologische Vernetzung, um Erhaltung naturnaher Ökosysteme, um Landschaftsentwicklungskonzepte oder um Reduktion der Nitratbelastung Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung werden Unternehmerschulung, Zeitmanagement und Kommunikation gross geschrieben, wobei sich viele Veranstaltungen vor allem an Frauen wenden
Jeder Betrieb setzt durchschnittlich gut zwei Tage für Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen der Beratungsdienste ein

227 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Projekt «Berufsfeld»
Landwirtschaftliche Berufsbildung
Der Entwurf des neuen Berufsbildungsgesetzes prägt die zwei Projekte «Berufsfeld» und «Bildungsplattform», die 2001 in Angriff genommen wurden. Das Gesetz soll neu auch die Berufsbildung des Landwirts/der Landwirtin sowie diejenige der landwirtschaftlichen Spezialberufe regeln Die Herausforderungen und Bedürfnisse, welche sich aus der Botschaft zum neuen Gesetz ableiten lassen, sind Leitlinien für die beiden Projekte
Der SBV arbeitete im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses 2 das Projekt «Berufsfeld grüne Berufe» aus. Zu diesem Zweck wurde eine Projektgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der interessierten Berufe, den Kantonen und Berufsverbänden gebildet In einem ersten Schritt wurde ein Konzeptbericht verfasst Dieser enthält die Definition des Berufsfeldes, ein mögliches Ausbildungsmodell sowie einen Vorschlag für die berufspraktische Bildung Ende September 2001 wurde dieser Zwischenbericht interessierten Kreisen inoffiziell zu einer Vernehmlassung unterbreitet 80 Stellungnahmen trafen dazu ein Zahlreiche Rückmeldungen enthielten wertvolle Ergänzungen, welche die Bestandesaufnahme in vielseitiger Hinsicht vervollständigten Der daraus resultierende Bericht – er wurde intern und in der Öffentlichkeit kommuniziert – dient der Projektgruppe als solide Grundlage für die Weiterarbeit im Jahre 2002
Aus dieser Vernehmlassung sind zwei Erkenntnisse besonders hervorzuheben. Die landwirtschaftliche Grundbildung, die nicht direkt Gegenstand des Berufsfeldprojekts ist, wird ebenfalls reformiert Diese Reform geht von einer anderen Ausgangslage aus und beschränkt sich auf den Beruf Landwirt Die Projektgruppe «Berufsfeld» hat die entsprechenden Verbindungen aufgebaut, damit diese Reformbestrebungen möglichst gut in das Projekt «Berufsfeld» einbezogen werden können.
Die Umfrage brachte deutlich zum Ausdruck, dass die Ansichten über die Weiterentwicklung der Berufsbildung auf Stufe Grundbildung (bis und mit Fähigkeitszeugnis) weit auseinander gehen Es gibt in der Landwirtschaft keinen Konsens bezüglich der Ziele der Berufsbildung (Facharbeiter oder Unternehmer), den zu erteilenden Unterrichtslektionen (1’200, 1’600 oder 1’900 Lektionen) und ebenso wenig bei Bildungsangeboten für schulisch schwache, bzw begabte Schüler (Niveauklassen) Diese Uneinigkeit darf nicht bestehen bleiben Um wirklich Verbesserungen erreichen zu können, wird eine gemeinsame, einheitliche Basis benötigt, auf welcher ein zukunftsgerichteter Aufbau möglich ist

■ Projekt «Bildungsforum»
Mit dem Projekt «Bildungsforum» wird eine engere Zusammenarbeit der Berufsverbände angestrebt. Damit sollen die Vorsaussetzungen geschaffen werden, um für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben gerüstet zu sein Der Entwurf zum neuen Berufsbildungsgesetz (Inkraftsetzung vorgesehen auf den 1 Januar 2004) sieht eine vermehrte Delegation von Kompetenzen und Verantwortung an die Bildungsgremien der Berufsorganisationen vor Die Berufsverbände aus dem Bereich der grünen Berufe haben zu den Strukturen, den Aufgaben und zur Finanzierung Stellung genommen Eine allfällige Einsetzung des Bildungsforums wird frühestens auf anfangs 2003 erfolgen können
228 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Attraktive Berufliche Weiterbildung
Im Jahr 2001 konnte das neue, modulare System der beruflichen Weiterbildung konsolidiert und ergänzt werden Die jungen Berufsleute reagieren positiv darauf Sie schätzen die Wahlmöglichkeiten, welche die Stufe Berufsprüfung eröffnet Das individuelle Weiterbildungsmenu berücksichtigt optimal die Bedürfnisse der Kandidatinnen und Kandidaten Die Weiterbildungsangebote der Landwirtschaftsschulen und diejenigen anderer Modulanbieter lassen sich in ein System einfügen, welches es erlaubt, rasch und gezielt auf die wechselnden Bedingungen der Berufswelt zu reagieren
Die Verbindung des Modulbaukastens mit demjenigen der Bäuerinnen stellt eine erfreuliche Entwicklung dar Junge Bäuerinnen und Bauern besuchen teilweise gleiche Module und absolvieren gemeinsam die Prüfungen
■ Die Berufsbildung wechselt vom SLV zum SBV
Die Berufsorganisationen sind ebenfalls einer Strukturanpassung unterworfen Der Schweizerische Landwirtschaftliche Verein SLV trat die Berufsbildung auf den 1. Januar 2002 dem SBV ab Im Jahre 2001 wurden die entsprechenden Vorbereitungen getroffen Dazu zählte unter anderem die Verlegung der Geschäftsstelle von Lindau nach Brugg und das Überführen der Rechnungsführung in das System des SBV Im Mai 2002 stimmte die SLV-Delegiertenversammlung der Fusion mit dem SBV rückwirkend zu
■ Bäuerinnenausbildung der Zukunft
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, die veränderten Werte und Aufgaben der heutigen Bäuerinnen und das neue Berufsbildungsgesetz haben den Schweizerischen Landfrauenverband, den Schweizerischen Verband Katholischer Bäuerinnen und die Schulleiterinnenkonferenz veranlasst, die Neugestaltung der Bäuerinnenausbildung in Angriff zu nehmen
Viele Bäuerinnen haben zuerst einen nicht-bäuerlichen Beruf erlernt und werden erst durch Heirat Bäuerin Sie brauchen in ihrem Beruf Kompetenzen in zwei Bereichen: hauswirtschaftliche Kenntnisse für ihre Tätigkeit als Hauswirtschafterin auf einem bäuerlichen Familienbetrieb und betriebswirtschaftliche Kenntnisse für ihre Tätigkeit als Partnerin eines Landwirts oder als Betriebsleiterin Die Bäuerinnenausbildung vereint beides miteinander In der Folge gilt der Fachausweis der Bäuerin als gleichwertiges Zertifikat wie der Lehrabschluss des Landwirts für den Erhalt von Investitionskrediten und Starthilfen Die Bedeutung ihrer Stellung als Frau in der Landwirtschaft wird dadurch verstärkt
Damit die neue Ausbildung frauenfreundlich, familiengerecht und betriebsspezifisch ist, gibt es zwei Angebotsformen. Semesterfachkurse dauern 20 Wochen. Andererseits besteht die Möglichkeit, die Ausbildung berufsbegleitend über Module zu absolvieren Jedes Modul wird mit einem Kompetenznachweis abgeschlossen Nach bestandener Schlussprüfung erhalten die Absolventinnen den Titel Bäuerin mit Fachausweis bzw. nach der nächsten Stufe diplomierte Bäuerin mit Höherer Fachprüfung Durch die Möglichkeit, Module auch einzeln zu besuchen, kann die Forderung nach lebenslangem Lernen umgesetzt werden
229 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
2.3.3 Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz

Saatgut
Seit der Inkraftsetzung der Änderungen der Saatgut-Verordnung am 1 Juli 2000 müssen Importeure und Inverkehrbringer von Saatgut und Sämereien geeignete Massnahmen ergreifen, um Verunreinigungen mit gentechnisch veränderten Organismen zu verhindern Sie müssen dazu über ein geeignetes Qualitätssicherungssystem verfügen Bisher wurde in der Schweiz für den Anbau kein gentechnisch verändertes Saatgut zugelassen Wegen der starken Abhängigkeit der Schweiz von Saatgutimporten werden aber gewisse gentechnische Verunreinigungen bis zu einer Menge von 0 5% toleriert Zurzeit werden nur jene gentechnisch veränderten Organismen toleriert, die für die Lebens- und Futtermittelproduktion in der Schweiz zugelassen sind
Die Importeure von Saatgut von Tomaten, Zuckerrüben, Chicorée, Soja, Mais und Raps benötigen eine Generaleinfuhrbewilligung des BLW Mit dem Erteilen einer entsprechenden Generaleinfuhrbewilligung sind die Importeure bekannt und die Kontrolle der Bestimmungen kann gewährleistet werden Die Importeure können überdies auf spezifische Anforderungen aufmerksam gemacht werden. So sind sie verpflichtet, alle eingeführten Saatgutposten der oben genannten Arten beim BLW zu melden Das Amt entscheidet dann aufgrund dieser Meldungen, von welchen Saatgutposten Proben genommen und auf gentechnische Verunreinigungen analysiert werden. Während der Anbausaison 2000/2001 wurden in einer von total 31 untersuchten Proben gentechnisch veränderte Organismen gefunden Darauf wurde der entsprechende Saatgutposten vom Markt zurückgezogen Je nach Saatgutart wurden von 1 bis 10% der gemeldeten Saatgutposten Proben gezogen und analysiert Im Weiteren begutachtete das BLW das Qualitätssicherungssystem von einigen Saatgutimporteuren.
230 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Pflanzenschutzmittel
Die Pflanzenschutzmittel-Verordnung vom 23 Juni 1999 bildet die rechtliche Grundlage zur Harmonisierung der Zulassungsanforderungen mit den EU- und OECDLändern sowie für die Regelung der freien Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln Die Anhebung der Zulassungsanforderungen auf das internationale Niveau verlangt von den Gesuchstellern vollständige Angaben der Zusammensetzung und ein lückenloses Datenpaket zu allen Sicherheitsaspekten von Gesundheit und Umwelt Die Behörden ihrerseits verpflichten sich, Beurteilung und Bewilligungserteilung auf die Basis internationaler Kriterien zu stellen Die Konsequenzen sind für beide Seiten beträchtlich, indem das Erbringen von vollständigen Dossiers nicht für alle Gesuchsteller problemlos ist und für die Behörden die Arbeitsbelastung ebenfalls merklich erhöht wird. Seit der Einführung der neuen Pflanzenschutzmittel-Verordnung sind nun zwei Bewilligungsrunden vollzogen worden
Entwicklung von Gesuchen und Neubewilligungen für Pflanzenschutzmittel
1 inkl Bewilligungen aus Vorjahresgesuchen
Anmerkung: Nicht mitgezählt sind Gesuche, die aus Anlass von Änderungen der Geschäftstätigkeit (Fusionen, Verkauf von Produkten oder Geschäftszweigen) seitens der Bewilligungsinhaber gestellt wurden
Während bei der forschenden Industrie das Erfüllen internationaler Anforderungen bereits zum Standard gehört, stossen die erhöhten Anforderungen bei den KMU auf Schwierigkeiten Die konsequente Durchsetzung der internationalen Standards im Bewilligungswesen ist jedoch in Anbetracht der Weiterentwicklung der Agrarpolitik (AP 2007) und der gesetzlichen Rahmenbedingungen des Chemikaliengesetzes unverzichtbar Im Hinblick auf die internationale Kooperation zur Arbeitsteilung im Registrierverfahren muss sich auch in der Schweiz so schnell als möglich ein internationaler Qualitätsstandard festigen Die strukturellen und prozeduralen Änderungen bei Bewilligungsbehörden und anderen beteiligten Stellen waren wichtige unterstützende Massnahmen für die Neuausrichtung des Bewilligungswesens Noch immer sind die Bearbeitungszeiten in der Schweiz deutlich kürzer als in der EU (1–2 Jahre im Vergleich zu 5 Jahren). Allerdings muss erwartet werden, dass die Festigung des Qualitätsstandards zu unvermeidlichen Verlängerungen der Bearbeitungszeiten führt
231 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Jahr Neue Gesuche Neu bewilligte Produkte Anzahl Anzahl 1998 126 110 1999 121 42 2000 100 91 2001 70 751
■ Erfahrungen mit der neuen Bewilligungspraxis
Die Regelung zur freien Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln ermöglicht es den KMU und den Produzenten, die in einer von BAG und BLW gemeinsam erarbeiteten Liste die bezeichneten Pflanzenschutzmittel ohne Bewilligung einzuführen Die Liste umfasst zurzeit rund 250 Produkte, die zusätzlich zu den im schweizerischen Zulassungsverfahren bewilligten Produkten zur Verfügung stehen Bedingungen an die Listenprodukte sind, dass in der Schweiz entsprechende durch das reguläre Bewilligungsverfahren bewilligte Referenzprodukte auf dem Markt sind und dass der Erstanmelderschutz abgelaufen ist
Aufgrund dieser gesetzlichen «Auswahlkriterien» können nur ältere, bewährte Produkte auf die Importliste gesetzt und frei eingeführt werden Dies hatte bisher zur Folge, dass der Import weder mengen- noch kostenmässig eine bedeutende Rolle spielte
Dünger
Während in den achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre die Landwirtschaft eine konstante Menge von Klärschlamm verwertete – rund 84'000 t Trockensubstanz, die einer Klärschlammmenge von etwa 2 Mio. m3 entsprechen – sank die Nachfrage in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre deutlich Mitverantwortlich für diese Entwicklung waren insbesondere Befürchtungen, Prionen, welche die Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE, «Rinderwahnsinn») auslösen, könnten über Abwässer aus Schlachthöfen in die Nahrungsmittelkette gelangen
Als wertbestimmende Stoffe enthält Klärschlamm vor allem Phosphor (P ausgedrückt als P2O5), Stickstoff (N), organische Substanz (OS) und geringe Mengen Kalium (K ausgedrückt als K2O), Calcium (Ca) und Magnesium (Mg). Der Nährstoffwert des in der Landwirtschaft in einem Jahr verwerteten Klärschlamms wurde 1999 auf 7 Mio Fr geschätzt
232 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Klärschlamm: Einsatz in der Landwirtschaft geht zurück
N P2O5 K2O i n 1 0 0 0 t Mineraldünger Klärschlamm und Kompost Hofdünger Quelle: SBV 0 250 200 100 150 50
Anteil von Düngerarten am Gesamtverbrauch 2000
Der Klärschlamm hat in der Düngung bei den Hauptnährstoffen nur eine geringe Bedeutung Beim Phosphor sind es 5,3%, beim Stickstoff 4% und bei Kalium noch weniger Grosse Unterschiede zeigen sich bei der Klärschlamm-Verwertung in den einzelnen Kantonen. So wird der Klärschlamm z.B. im Kanton Jura vollumfänglich in der Landwirtschaft ausgebracht, in den Kantonen Luzern und Basel-Stadt wird er dagegen gänzlich der thermischen Verwertung zugeführt
Klärschlammverwertung in den Kantonen 2000

233 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
JU FR GL SH TG AI UR BE AG TI VD SO ZH BL NE SZ SGGR VS AR ZG OW NW BS GE LU Deponie Thermische Verwertung Landwirtschaftliche Verwertung Quellen: AG neue Brennstoffe, Cemsuisse 0 20 40 60 80 100 i n %
Die Themen Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit haben bei der Bevölkerung stark an Bedeutung gewonnen Verunsicherungen im Zusammenhang mit der Verwertung von Klärschlamm und anderen Abfalldüngern nahmen zu Deshalb gab das BLW bei der Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau Zürich-Reckenholz (FAL) eine entsprechende Risikoanalyse in Auftrag Diese kommt zum Schluss, dass im Klärschlamm nicht nur wertvolle Nährstoffe für die Pflanzen, sondern vermehrt auch Schadstoffe enthalten sind, welche ein Gesundheitsrisiko nicht in allen Bereichen ausschliessen lassen (Internet: http://www blw admin ch, Link Dünger)
Im Biolandbau ist die Verwendung von Klärschlamm nach der am 1 Januar 1998 in Kraft gesetzten Verordnung über die biologische Landwirtschaft nicht mehr zulässig
Im Juni 2001 empfahlen der SBV, die SMP und andere Organisationen den Verzicht auf die Klärschlamm-Verwendung in der Landwirtschaft Seit Ende Oktober 2001 gilt für alle M7-Betriebe der MIGROS ein Verbot von Klärschlamm. COOP und verschiedene Labels wie +Natura-Beef+, SwissPrim-Gourmet, AgriNatura, IP-Suisse haben in ihre Richtlinien Bestimmungen aufgenommen, die den Einsatz von Klärschlamm auf den 1 Januar 2002 untersagen
Im September 2001 haben sich die Verantwortlichen der Bundesämter für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), für Landwirtschaft (BLW), für Gesundheit (BAG) und für Veterinärwesen (BVET) dahingehend geeinigt, dass Klärschlamm als Dünger in der Landwirtschaft künftig nicht mehr verwendet werden soll. Zeithorizont für ein generelles Verbot ist das Jahr 2005
Die Zementindustrie (Cemsuisse) erklärt sich in ihrem Bericht vom Mai 2001 «grundsätzlich bereit, im Rahmen der vorhandenen Verwertungskapazitäten mit den Kantonen langfristige Abnahmeverträge für die technische Klärschlamm-Verwertung abzuschliessen» und Klärschlamm zu verbrennen Allerdings fehlen in vielen Kläranlagen die technischen Voraussetzungen (Trocknung u a ) zurzeit noch Dies trifft insbesondere für die kleineren Anlagen zu.
234 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Von der landwirtschaftlichen Verwertung zur Verbrennung
■ Pflanzenpass

Pflanzenschutz
Der Bundesrat hat am 28 Februar 2001 eine neue Verordnung über den Pflanzenschutz verabschiedet und diese auf den 1. Juli 2001 in Kraft gesetzt. Die Verordnung enthält Regelungen, die den Schutz von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, Waldbäumen und -sträuchern, Zierpflanzen sowie gefährdeten wildlebenden Pflanzen vor besonders gefährlichen Schadorganismen gewährleisten soll Ein solcher Erreger (z B Feuerbrand) kann innert kürzester Zeit grosse Flächen befallen Für die betroffenen Produzenten kann dies bedeutende wirtschaftliche Einbussen mit sich bringen
Die neue Verordnung sieht verschiedene Vorbeugemassnahmen und Bekämpfungsstrategien vor. Eine aktive Bekämpfung ist beispielsweise die Rodung befallener Bestände und Wirtspflanzen Besonders wichtig sind vorbeugende Massnahmen Dazu zählt z B die Meldepflicht an die zuständigen kantonalen Dienste über das Auftreten eines Quarantäneorganismus an Kulturen oder Wirtspflanzen.
Mit der Verordnung neu eingeführt wurde der Pflanzenpass für in der Schweiz in Verkehr zu bringende Waren Pflanzenmaterialien sind der Passpflicht unterstellt, wenn sie als potenzielle Träger von besonders gefährlichen Schadorganismen eingestuft werden Man spricht in diesem Zusammenhang auch von so genannten Quarantäneorganismen Die Betriebe, die eine Zulassung für die Produktion und das Inverkehrbringen von passpflichtigem Pflanzenmaterial erhalten, werden registriert Zu Beginn des Jahres 2002 waren 229 Produktionsbetriebe registriert Der Pflanzenpass leistet Gewähr für eine einwandfreie, phytosanitäre Qualität der Ware und erbringt den Nachweis, dass die produzierten Pflanzen:
– auf einem registrierten Betrieb erzeugt wurden und – frei von Quarantäneorganismen sind.
235 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Registrierte Produktionsbetriebe nach Produktionszweigen Obstgehölze 11% Ziergehölze 8% kombinierte Betriebe 50% Fragaria/Rubus 2% Forstpflanzen 1% Vitis 28% Quelle: BLW Total: 229 Betriebe, Stand Februar 2002
■ Gesunder Warenfluss
Eine besondere Herausforderung stellt auch die Sicherstellung des Warenflusses dar, ohne dass besonders gefährliche Schadorganismen eingeschleppt und/oder im Inland verbreitet werden In diesen Warenfluss miteinbezogen sind die Speditionsfirmen, die Wiederverkäufer und die Produzenten. Firmen, die in diesen Bereichen tätig sind, müssen eine Zulassung des Eidgenössischen Pflanzenschutzdienstes haben Dieser ist beim BLW angesiedelt Zu Beginn des Jahres 2002 waren 345 Betriebe zugelassen, rund ein Drittel davon Spediteure und Wiederverkäufer
Beim Import unterziehen speziell ausgebildete Pflanzenschutzkontrolleure Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse an der Grenze einer phytosanitären Kontrolle Einzuführendes Pflanzenmaterial muss ausserdem von einem Pflanzenschutzzeugnis begleitet sein, welches den phytosanitären Status garantiert. Erfüllen die Pflanzen oder die Pflanzenmaterialien die Anforderungen an das Inverkehrbringen, stellen die Pflanzenschutzkontrolleure für diese Ware einen Pflanzenpass aus Dieser begleitet die Ware in der Folge bis hin zum Empfänger.
Die registrierten Betriebe unterstehen einer Buchführungspflicht Sie müssen Buch führen über den Zukauf, die Produktion und den Weiterverkauf passpflichtiger Waren Damit wird der Aufenthalt von Pflanzen und deren Erzeugnisse im Inland aufgezeichnet. Die Rückverfolgbarkeit kann so beim Auftreten eines Quarantäneorganismus gewähtleistet werden Die von den Produktionsbetrieben gemeldeten Produktionsparzellen werden jährlich einer Inspektion unterzogen
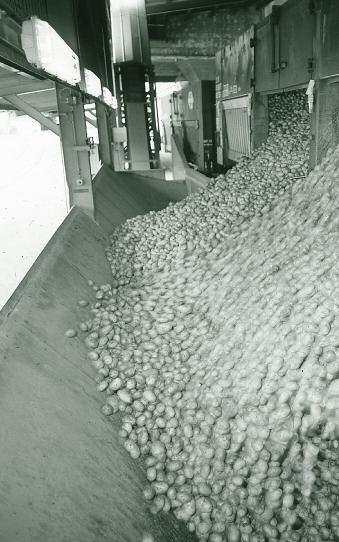
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 236
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.3.4 Tierzucht
■
Die Erhaltung einer eigenständigen Tierzucht in der Schweiz ist das wichtigste Ziel der staatlichen Unterstützung Die Wertschöpfung der tierzüchterischen Tätigkeit soll im Inland erfolgen Der Bund und die Kantone unterstützen die Züchterschaft in ihrem Bestreben für eine wirtschaftliche, qualitativ hochstehende und umweltgerechte Produktion mit einem jährlichen Beitrag von rund 40 Mio Fr

An erster Stelle stehen die Massnahmen zur Grundlagenverbesserung wie die Herdebuchführung, die Durchführung von Leistungsprüfungen, die Zuchtwertschätzung sowie die Programme zur Erhaltung der einheimischen Rassen. Die Beihilfen werden an die anerkannten Tierzuchtorganisationen ausgerichtet, welche damit ihren Züchtern die für eine erfolgreiche züchterische Tätigkeit notwendigen Dienstleistungen zur Verfügung stellen.
des Bundes für die Tierzucht 2001
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 237
Tierart Betrag Mio Fr Rinder 14,60 Pferde 1,07 Schweine 1,65 Schafe 1,10 Ziegen 0,80 Einheimische Schweizer Rassen (Erhaltung) 0,76 Quelle: Staatsrechnung
Ausgaben
Eigenständige schweizerische Tierzucht
Tabelle 47, Seite A55
■ Einfuhr von Zuchttieren und Rindersperma
Der Bund ist zuständig für die Bewirtschaftung der Zollkontingente sowie für die Einfuhr von Zuchttieren und Samen von Stieren Die Zollkontingentsanteile für Zuchtpferde, Schweine, Schafe, Ziegen und Stierensamen werden nach dem Windhundverfahren an der Bewilligungsstelle zugeteilt, diejenigen für Zuchtrinder müssen hingegen seit dem 1 Januar 2001 ersteigert werden
Aufgrund der unsicheren Lage bei der Maul- und Klauenseuche und der BSE-Problematik wurde jedoch bisher keine Versteigerung ausgeschrieben Während die Nachfrage nach ausländischen Kleinvieh- und Zuchtpferderassen in den letzten Jahren rückläufig ist, besteht in der Rindviehzucht nach wie vor ein grosses Interesse nach Stieren ausländischer Herkunft, wobei die Genetik aus den USA an erster Stelle steht
Einfuhren innerhalb des Zollkontingentes 2001
■ Tiergenetische Ressourcen
Quelle:
Die traditionellen Rassen bei den landwirtschaftlichen Nutztieren sind nicht nur von genetischem Interesse, sondern stellen auch ein wertvolles und erhaltenswertes Kulturgut dar Mit der Unterstützung von Projekten zur Erhaltung und Förderung gefährdeter einheimischer Nutztierrassen leisten Bund und Kantone einen wichtigen Beitrag zu Gunsten der landwirtschaftlichen Biodiversität Gegenwärtig werden für sämtliche Schweizerrassen der Gattungen Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde, die gemäss internationalen Kriterien als gefährdet gelten, Erhaltungsprogramme durchgeführt und mit öffentlichen Beiträgen unterstützt Es handelt sich dabei um das Evolèner Rind, das Engadinerschaf, das Bündner Oberländerschaf, das Spiegelschaf, das Walliser Landschaf, die Stiefelgeiss, die Appenzellerziege, die Bündner Strahlenziege und die Pfauenziege Weiter sind Präventivmassnahmen für das Freiberger Pferd, das Original Braunvieh, die Schweizer Landrasse (Schwein) und die Walliser Schwarzhalsziege erarbeitet und bewilligt worden
Die Projekte werden von den anerkannten Tierzuchtorganisationen durchgeführt und stehen unter der Oberaufsicht des Bundes Die meisten Rassen werden über Aktivitäten zur in situ-Erhaltung (lebend vor Ort) unterstützt, hingegen soll die Erhaltung des Evolèner Rindes, des Freiberger Pferdes und sämtlicher Schweizer Ziegenrassen zusätzlich über eine Samenbank (ex situ-Methode) sicher gestellt werden
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 238
Marktordnung Einfuhr Zollkontingent Anzahl Anzahl Zuchtpferde Tiere 69 200 Rinder Tiere 0 1 200 Schweine Tiere 0 100 Schafe/Ziegen Tiere 150 600 Rindersperma Dosen 613 209 800 000
Zolltarifarischer Bericht des Bundesrates
2.4 Finanzinspektorat
Mit der Neuorientierung der Agrarpolitik wurde u.a. ein Organisationsprozess eingeleitet, der auch zum Ziel hatte, für das BLW eine interne Revisionsstelle einzurichten Dazu wurde im Jahr 2001 die bestehende Sektion Inspektorat neu organisiert, erweitert und unter einer neuen Leitung zur Sektion Finanzinspektorat zusammengefasst Sie gliedert sich heute in die Bereiche Finanzinspektorat, Feldkontrolle, juristischer Support und Sekretariat Der Bereich Finanzinspektorat ist momentan mit 180 Stellenprozenten dotiert Ein weiterer Ausbau ist geplant Des Weiteren soll, wie schon für den Bereich Feldkontrollen im Jahre 2003 geplant, mittelfristig eine Akkreditierung ins Auge gefasst werden.
Der Bereich Finanzinspektorat ist direkt dem BLW-Direktor unterstellt, der Bereich Feldkontrollen dem Leiter der Abteilung Besondere Dienste. Der Bereich Feldkontrollen prüft innerhalb der Marktordnungen die Einhaltung der Verordnungen Im Abschnitt 2 1 1 wird über deren Kontrolltätigkeit berichtet
Im Folgenden werden die Ziele, Aufgaben, Methoden und die Stellung für den Bereich Finanzinspektorat dargestellt
■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 4 F I N A N Z I N S P E K T O R A T 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 239 Sekretariat Jur Support Finanzinspektorat Feldkontrollen Sektionschef Stellvertreter
■ Ein Führungsinstrument des Direktors
Das Finanzinspektorat unterstützt den Direktor des BLW in seiner Führungs- und Oberaufsichtsfunktion Es prüft und bewertet die Aktivitäten innerhalb des BLW als unabhängige Einheit Ausserdem werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BLW bei der effektiven Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. Zu diesem Zweck liefert das Finanzinspektorat Analysen, Bewertungen, Empfehlungen, Beratung und Informationen über die geprüften Aktivitäten
Mit der Schaffung eines Finanzinspektorates wird auch einem parlamentarischen Anliegen, in den Bundesämtern verstärkt unabhängige Kontrollen einzubauen, Rechnung getragen Durch die direkte Unterstellung unter den Amtsdirektor wird erreicht, dass das Finanzinspektorat nicht in den operativen Arbeitsablauf eingebunden ist und seine Prüfungen unabhängig und ohne mögliche Interessenkonflikte durchführen kann.
■ Aufgaben des Finanzinspektorates
Grundlage für die Tätigkeiten des Finanzinspektorates bilden das Finanzkontrollgesetz und das von den Direktoren der Eidgenössischen Finanzkontrolle und des BLW unterzeichnete Reglement über das Finanzinspektorat BLW Alle Geschäftsbereiche des BLW sind als Ganzes zu betrachten und alle Stufen der Tätigkeiten wie Führung, Management und Überwachung der Geschäfts- und Organisationsrisiken sind in die Prüfung miteinzubeziehen. Dabei wird zwischen folgenden Prüfungsarten unterschieden:
– Ergebnisprüfung: Alle Rubriken der Finanzrechnung und alle Konten der Bilanz des BLW werden bezüglich Ordnungsmässigkeit und Rechtmässigkeit überprüft. Diese Prüfung ist vergangenheitsorientiert, zeigt aber, wie Entscheidungen und Handlungen aus den Vorjahren ihren finanziellen Niederschlag gefunden haben
– Verfahrens- und Systemprüfung: Sie umfasst die gesamte Aufbau- und Ablauforganisation einer Einheit. Diese kann innerhalb oder ausserhalb des BLW angesiedelt sein Hauptziel ist die Überprüfung der internen Kontrolle (Internes Kontrollsystem
IKS) Das Augenmerk richtet sich dabei nicht nur auf eine Soll-Ist-Abweichung (Symptom), sondern auch auf deren Ursachen. Auf Grund der Analyse der aktuellen Verhältnisse werden Schlussfolgerungen für die Zukunft gezogen
Führungsprüfung: Die Leistung von Führungskräften wird systematisch beurteilt im Hinblick auf die Umsetzung und Erreichung der Amtsziele Die Führungsprüfung umfasst verfahrensorientierte Prüfungen sämtlicher Führungselemente und -prozesse und ergebnisorientierte Prüfungen von gefällten Entscheiden, Aktivitäten und Aktionen im ganzen BLW Sie beurteilt, wie Führungskräfte ihren Handlungsspielraum nutzen und wie sie zu ihrer Entscheidungsfindung Führungs- und Informationsinstrumente gestalten und einsetzen
Projektprüfung: Prüfungsgegenstand bilden Aktivitäten, die einen bestimmten Auftrag beinhalten und einem zeitlichen und organisatorischen Ablaufplan folgen Die Prüfungen können nach Abschluss (ex post) oder während des gesamten Verlaufes eines Projektes (ex ante) vorgenommen werden Das Finanzinspektorat überprüft dabei die Abwicklung laufender oder abgeschlossener Projekte, vergleicht Resultate mit Vorgaben und untersucht allfällige Abweichungen auf deren Ursachen.
2 . 4 F I N A N Z I N S P E K T O R A T 2 240
–
–
–
Nebst den beschriebenen Prüfungsarten kann das Finanzinspektorat auch für Sonderaufgaben eingesetzt werden Meistens handelt es sich dabei um zeitlich begrenzte und klar definierte Sonderprüfungen Die Erfüllung der ordentlichen Aufgaben und die Unabhängigkeit dürfen dabei nicht eingeschränkt oder beeinträchtigt werden.
Es lassen sich grob vier Stufen auseinanderhalten: Planung – Durchführung – Berichterstattung und Folgeprozess Auf allen Stufen gelten zwei wichtige Grundsätze: Transparenz und Qualität Transparenz hilft mit, dass alle Betroffenen in allen Phasen des Revisionsprozesses den Sinn und Zweck des Finanzinspektorates verstehen Die Qualität der Arbeit des Finanzinspektorates bestimmt in ausserordentlichem Masse die Beziehungen zu den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzinspektorates müssen hohen menschlichen und fachlichen Standards genügen, um gute, auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruhende Kontakte pflegen und ihre Revisionen professionell durchführen zu können. Die Verhaltensregeln des Finanzinspektorates richten sich dabei nach den internationalen und nationalen Berufsstandards der Revision
Den Arbeiten des Finanzinspektorates liegt ein Jahresprogramm zugrunde, das die Prüfungsobjekte umfasst und mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle abgesprochen ist Für jeden Auftrag wird ein Pflichtenheft erstellt Es umfasst das Objekt, Art und Umfang der Prüfung, die Zielsetzungen und den Umfang In dieser Phase findet ein intensiver Dialog mit den Betroffenen statt, damit auch ihre Anliegen in die weitere Planung einfliessen und berücksichtigt werden können
Aufgrund des Pflichtenheftes wird ein Arbeitsprogramm erstellt, das im einzelnen die Prüfungshandlungen aufzeigt Dieses wird wiederum der zu prüfenden Einheit abgegeben. Damit kann auch das Prinzip der Wesentlichkeit erfüllt werden, indem sich das Finanzinspektorat – schon wegen der knappen Ressourcen – vor Ort auf die relevanten Punkte konzentrieren kann
Das Finanzinspektorat erstellt einen Bericht, der das Wesentliche ihrer Prüfungen umfasst Adressaten sind die Geschäftsleitung und die betroffenen Einheiten Die Eidgenössische Finanzkontrolle erhält eine Kopie Der Bericht gibt Aufschluss über Auftrag, Bemerkungen, Feststellungen und Schlussfolgerungen des Finanzinspektorates sowie Bemerkungen und Massnahmen der geprüften Stelle Auch in der Phase der Erstellung des Berichtes werden die Betroffenen miteinbezogen Dies ist vor allem dort wichtig, wo Empfehlungen für die Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen abgegeben werden.
Nach Abschluss der Revision erfolgt die Umsetzung der abgegebenen Empfehlungen durch die betroffenen Einheiten. Um sicherzustellen, dass die Empfehlungen effektiv umgesetzt und Geschäftsprozesse weiterentwickelt werden, ist es wichtig, von Zeit zu Zeit den Stand dieser Geschäfte in Erfahrung zu bringen und den Amtsdirektor darüber zu informieren Damit schliesst sich der Regelkreis der Revision und einer der Hauptzwecke wird damit erfüllt: die Unterstützung des Direktors in der Wahrnehmung seiner Führungs- und Oberaufsichtsfunktion.
2 . 4 F I N A N Z I N S P E K T O R A T 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 241
■ Die vier Stufen der Prüfung
■ Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Das Finanzinspektorat des BLW ist ein Element eines grösseren Systems. Es ist auf eine gute interne Zusammenarbeit angewiesen Es braucht eine Fülle von Informationen über die Geschäftsabläufe innerhalb des BLW Es pflegt daher einen regen Gedankenaustausch mit allen Hierarchiestufen.
Aber auch die Kontakte zu externen Stellen sind wichtig Primär gehört dazu die Eidgenössische Finanzkontrolle Die Zusammenarbeit ist im Finanzkontrollgesetz geregelt und erstreckt sich von der Koordination und Information über Aus- und Weiterbildung und periodischer Überprüfung der Wirksamkeit der Kontrollen des Finanzinspektorates
Die Zusammenarbeit erfolgt aber auch via Erfahrungsaustausch mit anderen Revisionsstellen, sei es in oder ausserhalb der öffentlichen Verwaltung
242 2 . 4 F I N A N Z I N S P E K T O R A T 2
■■■■■■■■■■■■■■■■ 3. Internationale Aspekte

3 243
Die Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen betreffen die Landwirtschaft in zunehmendem Masse Auf globaler Ebene ist die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk der WTO eingeflochten Angesichts der geographischen Konzentration des Agrarhandels sind die vertraglichen Beziehungen zur EU und die zunehmende Integration in Europa für die Schweizer Landwirtschaft von grösster Bedeutung
Um ihre Exportmöglichkeiten zu erhalten und verbessern, ist die Schweiz auf einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten angewiesen Die Schweiz setzt sich zudem auf internationaler Ebene stark dafür ein, dass die multifunktionalen Eigenschaften der Landwirtschaft in den internationalen Abkommen stärker berücksichtigt werden
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung und behandelt die internationalen Themen im dritten Kapitel
– Abschnitt 3 1 enthält Informationen über internationale Organisationen, namentlich die WTO, die OECD und die FAO So wurde an der fünften WTO-Ministerkonferenz in Doha im November 2001 die Fortsetzung der Agrarverhandlung beschlossen Im Rahmen der FAO fand in Rom im Juni 2002 ein Gipfel zur Lage der Welternährung statt. An der 31. FAO-Konferenz wurden die Arbeiten zum Übereinkommen über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft abgeschlossen Im Weiteren wird der aktuelle Stand im Europadossier und bei den Freihandelsabkommen sowie eine Zusammenfassung der Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU durch die EU-Kommission vorgestellt Schliesslich wird über die Ergebnisse der internationalen Konferenz über nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in Bergregionen, welche im Juni 2002 in Adelboden abgehalten wurde, berichtet
In Abschnitt 3 2 geht es um internationale Vergleiche Je mehr sich die Schweizer Landwirtschaft mit der ausländischen Konkurrenz messen muss, desto wichtiger sind Informationen über die Verhältnisse im Ausland. Im vorliegenden Bericht werden die im Jahr 2000 begonnenen internationalen Preisvergleiche fortgeführt
3 . I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 244
–
3.1 Internationale Entwicklungen
Das Agrarabkommen CH – EU
Das Abkommen zwischen der EU und der Schweiz über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrarabkommen) vom 21 Juni 1999 ist am 1 Juni 2002 in Kraft getreten Der gegenseitige Marktzutritt wird zunehmend verbessert durch Zollreduktionen und Zollabbau auf ausgewählten Produkten einerseits und andererseits durch Vereinfachungen im Handel Diese Änderungen betreffen die Sektoren Pflanzenschutz, Futtermittel, Saatgut, biologische Produkte, Weinbauprodukte, Spirituosen sowie Obst und Gemüse.
Das Agrarabkommen setzt sich zusammen aus dem Rahmenvertrag (Regelung von Ursprungsregeln, Evolutiv- und Schutzklausel, Streitbeilegung, Einsetzung des Gemischten Ausschusses), aus Zollkonzessionen, Vereinbarungen zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse sowie Erklärungen zu diversen Handelsfragen und Produkten (z B Ursprungsbezeichnungen)

Die ausgehandelte gegenseitige Marktöffnung konzentriert sich primär auf Produkte, bei denen die schweizerische Landwirtschaft vergleichsweise wettbewerbsfähig ist wie Käse, Obst und Gemüse sowie einzelne andere Spezialitäten Durch das Abkommen wird insbesondere die Bedeutung des einheimischen Käses als strategische Erfolgsposition der schweizerischen Land- und Milchwirtschaft gestärkt, wovon die Schweiz als bedeutender Nettoexporteur von Käse in die EU profitieren kann Das Agrarabkommen birgt für die Schweiz in zentraler Lage Europas die Chance eines wesentlich verbesserten Zugangs zu einem kaufkräftigen Markt mit über 370 Mio Konsumenten und Konsumentinnen.
In Ergänzung zur Verbesserung des Marktzugangs leistet das Agrarabkommen einen Beitrag zur Kostensenkung. Die Beseitigung technischer Handelshemmnisse führt bei den Exportbetrieben zu einer Reduktion von Administrations- und Investitionskosten Zudem erleichtert das Abkommen den Zugang zu gewissen Hilfsstoffen (z B Futtermittel, Pflanz- und Saatgut), was sich ebenfalls positiv auf die Produktionskosten auswirken wird
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 245 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Zollkonzessionen
Die Schweiz gewährt der EU Konzessionen bei Käse, Fleisch- und Weinspezialitäten, Früchten und Gemüse ausserhalb der inländischen Saison sowie bei Produkten, die in der Schweiz nicht oder in unbedeutenden Mengen hergestellt werden (z B Zitrusfrüchte, Olivenöl). Die Zollkonzessionen der EU gegenüber der Schweiz betreffen Käse, Joghurt und Rahm, zahlreiche Früchte und Gemüse sowie Kartoffeln, Trockenfleisch, Schnittblumen und Gartenbauprodukte Frischfleisch, Getreide und Milch sind hingegen vom Zollabbau nicht betroffen Die gegenseitigen Konzessionen beim Fleisch treten ein Jahr nach dem Agrarabkommen in Kraft, vorausgesetzt die BSE-bedingten Einfuhrverbote gegen schweizerische Produkte sind bis dahin aufgehoben
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 246
Übersicht über die Zollkonzessionen Konzessionen Schweiz Produkte Konzessionen EU
Freier Zugang bis 2007 keine 1 000 t 200 t 10 000 t keine keine 4 000 t keine keine Freier Zugang keine keine keine keine 2 000 t keine 10 000 t keine Freier Zugang keine Zollreduktion um 50% 1 000 hl 1 000 t Freier Zugang Freier Zugang bis 2007 2 000 t keine 1 200 t 1 000 t 5 000 t 5 500 t 4 000 t 5 000 t 1 000 t Freier Zugang 4 000 t 3 000 t 3 000 t 3 000 t 500 t 1 500 t keine 1 000 t keine Freier Zugang keine keine Freier Zugang Freier Zugang Milch Käse Joghurt / Rahm Fleisch Getrockneter Schinken (Schwein) Trockenfleisch (Rind) Gemüse Tomaten Zwiebeln / Lauch Kohl Salat Karotten Salatgurken Pilze Pflanzkartoffeln Kartoffelerzeugnisse Obst Äpfel Birnen Aprikosen Kirschen Erdbeeren Pflaumen Zitrusfrüchte / Melonen Frucht- und Gemüsepulver Anderes Olivenöl Porto Schnittblumen Zierpflanzen
■ Das Käseabkommen Die Vereinbarungen im Käsebereich sind ein zentraler Teil des Agrarabkommens. Mit Ausnahme des Nullzollkontingentes für Joghurt und Rahm (2’000 t) beschränkt sich das Abkommen im Milchsektor auf den Käse Aufgrund eines Exportüberschusses von Milch in Form von Käse von rund 10% und einem Exportanteil von über 25% (vor allem auf dem europäischen Markt) liegt ein vereinfachter Marktzutritt im Interesse der Schweiz Die Zulage auf verkäster Milch erleichtert dabei die Marktöffnung trotz dem herrschenden hohen schweizerischen Kostenniveau
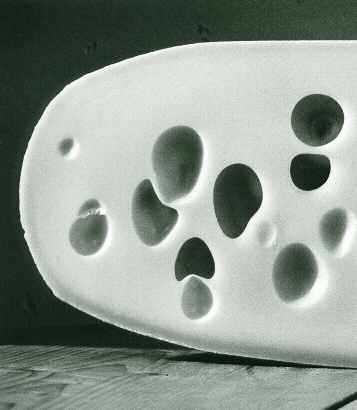
Nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren wird der Käsehandel gegenseitig vollständig liberalisiert, das heisst alle Käsesorten werden ohne jegliche mengenmässigen Beschränkungen oder Zölle zwischen der Schweiz und der EU gehandelt Der schrittweise Abbau bis zur vollständigen Liberalisierung im Jahre 2007 beruht im Wesentlichen auf den folgenden drei Elementen:
Abbau der Zollansätze: Ab In-Kraft-Treten des Abkommens reduzieren die Schweiz und die EU die noch bestehenden Zölle um jährlich 20% Ab 1 Juni 2007 werden somit für den Käsehandel zwischen der Schweiz und der EU keine Zölle mehr bestehen
– Gewährung von zollfreien Kontingenten: Die gewährten Nullzoll-Kontingente werden jährlich seitens der Schweiz um 2'500 t und seitens der EU um 1‘250 t erhöht und fallen ab dem sechsten Jahr weg Zudem sind bereits bei In-Kraft-Treten des Abkommens gewisse Käse (z.B. Tilsiter, Bündner Käse, Schmelzkäse) in unbegrenzten Mengen zollbefreit
Abbau der Exportsubventionen: Die Schweiz reduziert die maximal möglichen Exportbeiträge um 30% nach dem ersten, um 55% nach dem zweiten, um 80% nach dem dritten, um 90% nach dem vierten und um 100% nach dem fünften Jahr ab In-Kraft-Treten Die EU ihrerseits verzichtet bereits von Beginn weg auf sämtliche Exportsubventionen
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 247
–
–
In Kraft-Treten +1+2 +3 +4 +5 +6 +7 Jahre Nullzoll-Kontingente CH/EU Zölle CH/EU Export-
1 EU
In-Kraft-Treten
Liberalisierungsprozess im Käsehandel CH-EU
beiträge CH 1
hebt diese mit
des Abkommens auf
■ Beseitigung technischer Handelshemmnisse
Ziel der Beseitigung von technischen Handelshemmnissen ist die Erleichterung des Aussenhandels Dies erfolgt mittels Vereinbarungen, die auf der gegenseitigen Anerkennung der Gleichwertigkeit der Gesetzgebung beruhen (Äquivalenzprinzip) Die gegenseitige Anerkennung wie auch die Weiterentwicklung der Handelsbeziehungen im Rahmen der Evolutivklausel ist allen Sektoren gemein Die Evolutivklausel ermöglicht die spätere Erweiterung der Anwendungsbereiche des Abkommens und des Abbaus nichttarifärer Handelshemmnisse einvernehmlich durch den Gemischten Ausschuss
Abbau technischer Handelshemmnisse
Sektor
Pflanzenschutz
Technische Vereinbarungen
– Gegenseitige Anerkennung von Schutzmassnahmen gegen die Einschleppung und Verbreitung von Schadorganismen durch Pflanzen oder Pflanzenprodukte
Evolutivklausel: Einführung Pflanzenschutzpass, Anpassung der schweizerischen Vorschriften für Importe aus Drittländern
Futtermittel
– Gegenseitige Anerkennung der Anforderungen an Futtermittel (sobald schweizerische Gesetzgebung angepasst ist)
Evolutivklausel: Ergänzung der anerkannten Futtermittellisten
– Aufhebung Grenzkontrolle für anerkannte Futtermittel
– Schutzklausel bei Gefahren für Tier und Mensch
Saatgut
Anerkennung der Sortenkataloge für Kartoffeln und Getreide
– Evolutivklausel: Ausweitung der Sortenkataloge auf Zuckerrüben, Ölsaaten, Futterpflanzen, Faserpflanzen, Obst, Gemüse, Reben, Zierpflanzen
– Zugang zu allen Sorten (ausser GVO-Sorten)
Vereinfachung der Formalitäten
Weinbauprodukte
– gegenseitiger Schutz der geographischen und traditionellen Bezeichnungen (ausser für Schweizer «Champagne»)
gegenseitige Rechtshilfe der Kontrollorgane
Verschnittverbot (Weisswein sofort, Rotwein in vier Jahren)
– Exportvereinfachungen
Spirituosen
Gegenseitiger Schutz der Bezeichnungen («Grappa» nur noch für Spirituosen aus Italien und aus der italienisch sprachigen Schweiz)
– Schweiz passt Gesetzgebung betreffend Definitionen und Sachbezeichnungen an die der EU an
Bio-Produkte
Vereinbarungen vorläufig auf pflanzliche Produkte und Lebensmittel beschränkt
– Evolutivklausel: Einbezug von tierischen Produkten
– Beseitigung von autonomen Drittlandregimen
– Einbezug ins Notifikationsverfahren der EU
Vereinfachung von Information und Vollzug
Obst und Gemüse
– Anerkennung der Qualitätskontrollen für Schweizer Obst und Gemüse beim Export und somit Wegfall der Qualitätskontrollen an der EU-Grenze
Zertifizierung von Schweizer Exporten (frische Früchte, Frischgemüse) gemäss Vertriebsvorschriften der EU in der Schweiz
Veterinärbereich
– Gegenseitige Anerkennung der Tierseuchen- und Milchhygienebestimmungen
– Suche gemeinsamer Lösungen zur BSE-Problematik
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 248
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
■ Der Gemischte Agrarausschuss
Artikel 6 des Agrarabkommens sieht die Einsetzung eines Gemischten Agrarausschusses vor Der Gemischte Ausschuss ist ein gemeinsames Organ der Vertragsparteien, welches aus Vertretern von diesen zusammengesetzt ist und einvernehmlich beschliesst. Er verwaltet das Agrarabkommen und zeichnet verantwortlich für die korrekte Umsetzung bzw das ordnungsgemässe Funktionieren des Abkommens Der Ausschuss trifft daher alle notwendigen Massnahmen, um die Erfüllung der Vertragsverpflichtungen sicherzustellen Federführend beim Agrarabkommen ist das BLW in Zusammenarbeit mit anderen interessierten Verwaltungsstellen Zur Verwaltung des Anhanges 11 wird zusätzlich ein Gemischter Veterinärausschuss eingesetzt, bei dem das BVET die Leitung übernimmt
Der Gemischte Ausschuss sorgt für den Meinungs- und Informationsaustausch zwischen den Vertragsparteien und kann Empfehlungen abgeben Er verfügt in den im Abkommen vorgesehenen Fällen über Entscheidungsgewalt Zu den Befugnissen des Gemischten Ausschusses gehört namentlich die einvernehmliche Änderung der Anhänge sowie die Entscheidung über die Übernahme von neuem Recht der Vertragsparteien in das Abkommen Änderungen des bilateralen Agrarabkommens, die neue Verpflichtungen beinhalten, bleiben in der Zuständigkeit der Vertragsparteien Sie müssen somit in der Schweiz durch den Bundesrat oder das Parlament genehmigt werden und unterstehen im letzteren Fall dem fakultativen Staatsvertragsreferendum.
Der Gemischte Ausschuss überprüft regelmässig die Möglichkeit weiterer Liberalisierungsschritte im Rahmen der Evolutivklausel und setzt die im Abkommen vorgesehenen Arbeitsgruppen ein, die für die Verwaltung der Anhänge verantwortlich sind Zudem legt er die Zusammensetzung und Arbeitsweise dieser Arbeitsgruppen fest Arbeitsgruppen werden gebildet in den Bereichen Pflanzenschutz (Anhang 4), Futtermittel (Anhang 5), Saatgut (Anhang 6), Weinbauerzeugnisse (Anhang 7), Spirituosen (Anhang 8), ökologische Erzeugnisse (Anhang 9) sowie Obst und Gemüse (Anhang 10) Ihre Aufgabe umfasst im Wesentlichen die regelmässige Überprüfung der Entwicklung der unter die jeweiligen Anhänge fallenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Parteien. Insbesondere unterbreiten sie dem Ausschuss Vorschläge zur Anpassung und Aktualisierung der Anlagen dieser Anhänge Zudem prüfen sie alle Fragen, die sich aus den entsprechenden Anhängen und ihrer Durchführung ergeben
Auf Grund ihrer besonderen Bedeutung für die Schweiz ist hier die gemeinsame Erklärung zu erwähnen, mit der die Parteien vereinbart haben, zu einem späteren Zeitpunkt Bestimmungen über den gegenseitigen Schutz von geschützten Ursprungsbezeichnungen (AOC) und geschützten geographischen Angaben (GGA) in das Landwirtschaftsabkommen aufzunehmen. Die Einsetzung einer entsprechenden Expertengruppe soll dem Gemischten Ausschuss vorgeschlagen werden
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 249
Verhandlungen mit der EU über verarbeitete Landwirtschaftsprodukte
Das Protokoll 2 zum Freihandelsabkommen von 1972 regelt die zolltarifarische Behandlung der verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte (z B Schokolade, Biskuits, Suppen, Saucen, Teigwaren, Instant-Kaffee, Konfitüren usw ) Es ist nicht mehr zeitgemäss und verursacht bei seiner Anwendung Probleme Das Protokoll 2 konnte in den ersten bilateralen Verhandlungen nicht aktualisiert werden; es wurde aber in der gemeinsamen Erklärung festgehalten, dass die EU und die Schweiz beabsichtigen, «Verhandlungen aufzunehmen im Hinblick auf den Abschluss von Abkommen im Bereich von gemeinsamen Interessen wie die Aktualisierung des Protokolls 2 zum Freihandelsabkommen von 1972»

Am 18 Juli 2001 fand die erste und bis zum Ende des Berichtsjahres fanden noch zwei weitere bilaterale Verhandlungsrunden mit der EU-Kommission statt. Ziele dieser Verhandlungen sind in erster Linie die Verbesserung des Preisausgleichsmechanismus sowie die Ausdehnung des Deckungsbereichs des Protokolls 2 Der Preisausgleichsmechanismus bedeutet, dass die Differenz zwischen den in- und ausländischen Rohstoffpreisen in Verarbeitungsprodukten ausgeglichen werden kann Bei der Einfuhr geschieht dies über Zölle (bewegliche Teilbeträge) und beim Export über Ausfuhrbeiträge Die Verbesserung des Mechanismus liegt darin, dass die Differenz nur noch auf den reinen Rohstoffkosten berechnet wird, das heisst, dass alle Verzerrungen wie Überkompensationen oder Industrieschutz eliminiert werden.
Der Deckungsbereich des aktualisierten Protokolls 2 konnte weitgehend bereinigt werden Voraussichtlich werden dem neuen Protokoll 2 zwei Listen beigefügt Neben einer Liste von vollständig zollfreien Produkten wird es eine zweite Liste mit Verarbeitungsprodukten geben, bei denen die Preisunterschiede zwischen der EU und der Schweiz für die in diesen Produkten enthaltenen Agrarrohstoffe (Mehl, Butter, Milchpulver etc ) bei der Einfuhr durch Zölle bzw bei der Ausfuhr durch Exportbeiträge ausgeglichen werden können.
Zucker als einziger Rohstoff, dessen Preisniveau in der Schweiz und in der EU etwa gleich hoch ist, nimmt in den Verhandlungen eine spezielle Position ein Das gleich hohe Preisniveau ermöglicht es der Schweiz, der EU eine so genannte Doppel-NullLösung vorzuschlagen Die Schweiz und die EU verzichten beide sowohl auf Exportbeiträge als auch auf Zollbelastungen für Zucker in Verarbeitungsprodukten Gleichzeitig wird auch auf den Veredlungsverkehr für Zucker zur Herstellung von Verarbeitungsprodukten verzichtet. Damit erhalten die Hersteller, zumindest was den Zucker betrifft, beidseits der Grenze gleich lange Spiesse
Ziel ist es, die Verhandlungen bis Ende 2002 abzuschliessen.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 250
Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU
Bei der Verabschiedung der Agenda 2000 (neue GAP-Reform) im Europäischen Rat (Gipfeltreffen der Staats- bzw Regierungschefs) von Berlin 1999 wurde beschlossen, im Jahr 2002 einige grosse Sektoren wie Milch, Rindfleisch und Getreide einer Überprüfung zu unterziehen Auf diese Weise sollte festgestellt werden, ob die geschaffenen Mechanismen hinreichend funktionieren Beim EU-Gipfel von Göteborg (2001) wurde die Europäische Kommission zusätzlich beauftragt zu prüfen, auf welche Weise mit der GAP eine nachhaltigere Landwirtschaft EU-weit eingeführt werden kann Damit verbunden sind auch Fragen der Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel sowie soziale Aspekte.
Die Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU, welche die Europäische Kommission dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament am 10. Juli 2002 vorgelegt hat, setzt somit die in Berlin und Göteborg getroffenen Beschlüsse um
Die Halbzeitbewertung ist auch eine Antwort auf die folgenden Herausforderungen, denen sich grösstenteils ebenfalls die schweizerische Landwirtschaft zu stellen hat:
– Vorbereitung für die Verpflichtungen und internationalen Verhandlungen (WTO);
– Erhaltung und/oder Ausdehnung der Marktanteile im In- und Ausland;
– Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger sowie Konsumentinnen und Konsumenten für die Agrarpolitik und die damit zusammenhängenden Ausgaben sowie Vertrauen in die Sicherheit und Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse;
Budgetvorgaben im Zusammenhang mit der ab 2004 geplanten EU-Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten
Die Leitlinien des Entwurfs zur Halbzeitbewertung, zu denen sich der Agrarministerrat nicht vor Dezember 2002 (EU-Gipfel in Kopenhagen) äussern dürfte, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Künftig soll nicht mehr die Überschussproduktion belohnt werden, sondern die von der Bevölkerung gewünschten Leistungen: sichere Lebensmittel, Qualitätsproduktion, Tierwohl und gesunde Umwelt Nach Ansicht der Kommission müssen die öffentlichen Ausgaben für den Agrarsektor besser gerechtfertigt werden Ihre Vorschläge halten den in der Agenda 2000 für die Periode 2000–2006 festgelegten Finanzrahmen vollumfänglich ein Die Revision soll die Landwirte von der Bürokratie entlasten und sie dazu animieren, die Produktion nach den Marktbedürfnissen und hohen Standards, anstatt nach den Subventionen auszurichten
Zur Umsetzung dieser Leitlinien schlägt die Kommission vor:
Trennung von Produktion und Direktzahlungen (Entkoppelung). Festlegung einer einzigen, betriebsbezogenen Einkommenszahlung auf der Grundlage historischer Referenzbeträge Die Mitgliedstaaten können die Höhe der Beihilfen innerhalb gewisser Grenzen anpassen;
– Knüpfung dieser Hilfen an die Einhaltung von verbindlichen Standards in den Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Sicherheit am Arbeitsplatz (Cross compliance);
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 251
–
–
Substantielle Umverteilung der Beihilfen zwischen Produzenten und Regionen über eine Modulation der Direktzahlungen Dabei sollen die Ausgleichszahlungen in jährlichen Tranchen von 3% mit dem Endziel einer Reduktion um 20% gekürzt werden, wobei die Kleinbauern von der Reduktion ausgeschlossen sind. Pro Betrieb ist ein Freibetrag von 5’000 Euro (7’500 Fr ) vorgesehen Die Mitgliedstaaten können Betrieben mit mehr als zwei Arbeitseinheiten für jede weitere Arbeitseinheit einen zusätzlichen Freibetrag von 3’000 Euro (4’500 Fr ) gewähren Die Höchstgrenze pro Betrieb liegt bei 300’000 Euro (450’000 Fr ); die erzielten Einsparungen stehen dem betreffenden Mitgliedstaat zur Verfügung, sollen aber für die ländliche Entwicklung verwendet werden (siehe Kasten);
Einführung neuer Massnahmen der ländlichen Entwicklung, um die Qualität der Produktion, die Sicherheit der Nahrungsmittel und das Tierwohl zu fördern Es geht insbesondere um die Aufnahme eines neuen Kapitels über die Nahrungsmittelqualität als neue Begleitmassnahme, welche den Landwirten Anreiz sein soll, sich an Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsprogrammen zu beteiligen
«Ländliche Entwicklung»
Die Entwicklung des ländlichen Raumes ist der zweite Hauptpfeiler der GAP Sie umfasst heute die folgenden Massnahmen:
– Investitionsbeihilfen an landwirtschaftliche Betriebe;
– Beihilfen zugunsten der Humanressourcen: Junglandwirte, Vorruhestandsregelung, Ausbildung;
– Förderung benachteiligter Gebiete und von Gebieten mit umweltspezifischen Auflagen; – Investitionshilfen an forstwirtschaftliche Massnahmen;
– Förderung von Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse; – Beihilfen Agrarumweltmassnahmen;
– Verschiedene Massnahmen zur Entwicklung der ländlichen Gebiete: Bodenmeliorationen, Landumlegung, Bewirtschaftungsbeihilfen, Bewirtschaftung der Wasserressourcen usw ;
– Leader+-Initiative: Es werden zwei Ziele verfolgt: Unterstützung innovativer Pilotprojekte lokaler Aktionsgruppen und Förderung des Erfahrungsaustausches sowie der transnationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
Die Ausgaben für die ländliche Entwicklung belaufen sich für den Zeitraum 2000–2006 (ohne Anteil der nationalen Mitfinanzierung) auf 10% der gesamten Aufwendungen für die GAP
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 252 –
–
Im Bereich der Marktpolitik – der erste Pfeiler der GAP – schlägt die Kommission Folgendes vor:
– Abschluss des Reformprozesses für Getreide. Dabei geht es um eine zusätzliche Reduktion des Interventionspreises für alle Getreide (ausser Roggen und Reis) um 5% auf 95 35 Euro/t (143 Fr ), um die Aufhebung des Interventionspreises für Roggen und um eine 50%ige Senkung dieses Preises für Reis
– Anpassung der Regelungen für Trockenfutter und Eiweisskulturen
– Gleichzeitig mit den Reformvorschlägen unterbreitete die Europäische Kommission dem Agrarministerrat ein Arbeitspapier über die Zukunft der gemeinsamen Marktordnung für Milchprodukte Die Kommission analysierte darin die vier folgenden Optionen:
1. Status quo oder Beibehaltung der in der Agenda 2000 vorgesehenen Massnahmen bis 2015: schrittweise Senkung der Interventionspreise um 15% ab 2005/2006; Erhöhung der Kuhprämie um 5 75 Euro/t auf 17 24 Euro/t ab 2005/2006 sowie generelle Erhöhung der Quoten um 2,39%
2 Agenda 2000 und zusätzliche Herabsetzung der Interventionspreise (–15% für Butter und –5% für Magermilchpulver) sowie weitere Aufstockung der Quoten (+3%);
3 Einführung einer zweistufigen Quotenregelung Senkung der Quote im Binnenmarkt um 5% («A»-Quote). Die Quote für die Ausfuhren («C»-Quote) ist unbegrenzt Die Ausfuhrerstattungen und Absatzbeihilfen fallen weg
4 Abschaffung der Quoten ab 2008 und zusätzlich Senkung des Interventionspreises, der als Sicherheitsnetz dient, um weitere 25%
Die Vorschläge zur Halbzeitbewertung der GAP werden im Falle ihrer Annahme auch Auswirkungen auf die schweizerische Landwirtschaft haben Die Angleichung der EU bei den Direktzahlungen und den ökologischen und ethologischen Auflagen dürfte unsere Landwirtschaftspolitik auf internationaler Ebene (WTO) stärken. Hingegen wäre mit einem grösseren Preiswettbewerb zu rechnen Die Senkung des Interventionspreises für Getreide in der EU könnte unseren Wettbewerbsrückstand auf diesem Sektor und folglich auch beim weissen Fleisch vergrössern Mit der Senkung des Interventionspreises für Butter und Magermilchpulver bzw mit der Abschaffung der Milchquoten im Jahr 2008 (Option 4) ergäbe sich z B ein Druck auf die Marktpreise sämtlicher Milchprodukte und insbesondere des Käses, da für 2007 die vollständige Liberalisierung des Käsehandels zwischen der Schweiz und der EU festgelegt worden ist.
Weitere Informationen über die Halbzeitbewertung der GAP finden sich im Internet unter http://europa.eu.int/comm/agriculture/mtr/index de.htm
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 253
Freihandelsabkommen
Die Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), Island, Norwegen, Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, haben seit Beginn der neunziger Jahre ein Netz von vertraglichen Beziehungen zu Drittstaaten aufgebaut, welche nicht Mitglieder der EU sind Wichtigstes Instrument sind dabei die Freihandelsabkommen, mit denen Diskriminierungen der EFTA-Staaten auf Drittmärkten begegnet werden kann
Die Aktivitäten der EFTA konzentrierten sich bis unlängst auf Mittel- und Osteuropa sowie den Mittelmeerraum Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren weltweit zunehmenden Tendenz zu Präferenzabkommen in regionalem (z B NAFTA, Mercosur, ASEAN) und regionenübergreifendem Rahmen (z.B. EU-Mexiko, EU-Chile, EU-Südafrika, USA-Singapur, Japan-Singapur) und den sich daraus ergebenden aktuellen oder potentiellen Diskriminierungen für Schweizer Güterlieferungen und Dienstleistungen hat die EFTA bzw. die Schweiz ihre Freihandelspolitik geografisch auf Überseepartner ausgeweitet Ebenso wurde entschieden, neben dem Warenhandel und dem geistigen Eigentum auch Bereiche wie Dienstleistungen, Investitionen und öffentliche Beschaffungen in diese Abkommen einzubeziehen
Die EFTA-Staaten verfügen über keine gemeinsame Agrarpolitik. Dies hat zur Folge, dass die EFTA-Staaten jeweils über einen gemeinsamen Agrarabkommenstext verhandeln, das Abkommen selber aber bilateral mit länderspezifischen Konzessionslisten abschliessen. In-Kraft-Treten und Gültigkeitsdauer dieser bilateralen Abkommen hängen aber direkt von den jeweiligen Hauptabkommen ab Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Agrarabkommen gelten auch für das Fürstentum Liechtenstein, solange der Vertrag vom 29 März 1923 über die Zollunion der Schweiz mit dem Fürstentum Liechtenstein in Kraft ist
1998 sind die EFTA-Staaten erstmals mit einem transatlantischen Partner, Kanada, in Verhandlung getreten Im November 2000 konnte das erste Freihandelsabkommen ausserhalb Europas und des Mittelmeerraumes unterzeichnet werden. Es handelt sich um das Abkommen mit Mexiko, das am 1 Juli 2001 in Kraft getreten ist Es ist zugleich das erste Abkommen der EFTA, welches zusätzlich zum Warenverkehr und zum geistigen Eigentum auch Dienstleistungen, Investitionen und öffentliches Beschaffungswesen substantiell, das heisst über das Niveau der entsprechenden WTOVerpflichtungen hinaus, abdeckt

3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 254
Freihandelsabkommen mit Auswirkungen auf die Landwirtschaft
Die EFTA-Staaten haben bisher Freihandelsabkommen mit insgesamt 19 DrittlandPartnern abgeschlossen: Türkei, Israel, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Marokko, PLO (palästinensische Behörden), Mazedonien, Mexiko, Kroatien, Jordanien und Singapur Letzteres wurde am 26 Juni 2002 unterzeichnet Das bilateral mit Singapur ausgehandelte Landwirtschaftsabkommen ist das erste, welches der Schweiz einen zollfreien Marktzutritt für alle landwirtschaftlichen Produkte vertraglich zusichert, ohne dass die Schweiz dafür signifikante Gegenkonzessionen gewähren musste.
Zwischen der EFTA und weiteren acht Staaten bzw Staatengruppen bestehen zudem Zusammenarbeitserklärungen, welche eine Vorstufe zu allfälligen späteren Verhandlungen von Freihandelsabkommen darstellen: Albanien, Ukraine, Ägypten, Tunesien, Jugoslawien, Libanon, Golf-Kooperationsrat und Mercosur
Die EFTA-Staaten planen, ihr vertragliches Beziehungsnetz mit Drittländern auf dynamische Art und Weise zu erweitern:
durch den Abschluss von laufenden Freihandelsverhandlungen (Ägypten, Chile, Kanada, Tunesien);
durch die Aufnahme solcher Verhandlungen mit Südafrika im Herbst 2002, sowie zu gegebener Zeit mit weiteren Partnern;
– durch die Unterzeichnung von Zusammenarbeitserklärungen
Darüber hinaus verfolgen die EFTA-Staaten aktiv die Entwicklung der Handelspolitik gewisser Staaten im asiatisch-pazifischen Raum (insbesondere Südkorea und Japan) sowie der USA
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 255
Mexiko
PLO Abkommen in Kraft: Litauen Estland Lettland Polen Tschechien Slowakei Ungarn Slowenien Rumänien Mazedonien Kroatien Bulgarien Türkei Jordanien Israel CH EFTA EU Singapur (Abschluss 2002) WTO WTO WTO WTO Mercosur Laufende Verhandlungen: Kanada Chile Tunesien Ägypten Zypern Verhandlungen geplant: Japan Korea GolfkooperationsStaaten Südafrika USA
Marokko
–
–
Die Aussenhandelsstärken der Schweiz liegen in den industriellen und Dienstleistungsbereichen Genau umgekehrt verhält es sich in den meisten Partnerstaaten, mit denen Freihandelsabkommen abgeschlossen wurden oder noch werden Sehr stark landwirtschaftsorientiert sind die Staaten des Mittelmeerraumes, Mittel- und Südamerikas, wogegen Singapur über keine eigentliche Landwirtschaft verfügt Daraus folgt, dass dem Landwirtschaftssektor in den Verhandlungen über den Warenverkehr mit Staaten wie Mexiko, Chile und auch Kanada eine spezielle Rolle zukommt Die schweizerischen Zölle im Industriebereich sind bereits so tief, dass keine wesentlichen Konzessionen mehr offeriert werden können, wogegen im Landwirtschaftsbereich noch ein Grenzschutz besteht Bisher konnten die gewährten Konzessionen soweit in Grenzen gehalten werden, dass sie für die schweizerische Landwirtschaft noch tragbar waren Die zukünftigen Verhandlungen mit Ländern wie Tunesien, Ägypten und vor allem Südafrika sind aus der beschriebenen Optik heraus sehr schwierig einzustufen
WTO – Fortsetzung und Beschleunigung des Verhandlungsprozesses
Das Jahr 2001 stand bei der WTO im Zeichen von zwei Hauptereignissen: Die Ministerkonferenz in Doha und der Beitritt von China. Parallel dazu wurden auch die neuen Agrarverhandlungen fortgesetzt Die erste Phase dieser Runde ging im März 2001 und die zweite Phase im März 2002 zu Ende
In der ersten Phase konnten die WTO-Mitglieder ihre allgemeinen Verhandlungsvorschläge unterbreiten, während die zweite Phase dazu diente, die in diesen Eingaben geäusserten Positionen näher zu umreissen Im Rahmen dieser zweiten Phase legte die Schweiz sieben Verhandlungsdokumente zu den folgenden Themenbereichen vor: Bewirtschaftung der Zollkontingente (Versteigerung), Exportsubventionen, Sonderschutzklausel, geografische Angaben, Etikettierung und Konsumenteninformation, Entwicklungsbox und Tierwohl
Die Wiederaufnahme der Agrarverhandlungen im Rahmen der WTO richtet sich nach Artikel 20 des Agrarabkommens Dieser Artikel schreibt vor, dass bei der Weiterführung der schrittweisen wesentlichen Senkung der Stützungs- und Schutzmassnahmen sowohl nicht handelsbezogene Anliegen als auch die besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer Berücksichtigung finden müssen In diese Stossrichtung gehen die vier letztgenannten Verhandlungspapiere der Schweiz
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 256
Die Ministerkonferenz von Doha fand vom 9. bis 13. November 2001 in der Hauptstadt von Katar statt Die Arbeiten der Konferenz mündeten in einer Ministererklärung, die den Rahmen und das Arbeitsprogramm für die WTO-Verhandlungen in den nächsten Jahren festsetzt.
Ministererklärung: Wichtigste Punkte zu den Agrarverhandlungen
Artikel 13:
Auf die bisherigen Arbeiten aufbauend und ohne Vorwegnahme des Verhandlungsergebnisses, verpflichten wir uns, umfassende Verhandlungen mit folgenden Zielen zu führen:
– substanzielle Verbesserung des Marktzutritts;
Abbau aller Formen der Exportsubventionierung im Hinblick auf deren schrittweise Abschaffung;
– substanzieller Abbau der handelsverzerrenden Inlandstützung
Wir vereinbaren, dass die besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer ... Bestandteil der Verhandlungen sein soll ..., sodass sie ... den Entwicklungsländern ermöglicht, ihren Entwicklungsbedarf einschliesslich ihrer Bedürfnisse bezüglich Ernährungssicherung und Entwicklung des ländlichen Raumes effektiv zu berücksichtigen. Wir nehmen nicht-handelsbezogene Anliegen, die in den Verhandlungsvorschlägen der Mitglieder enthalten sind, zur Kenntnis und bestätigen, dass diese in den Verhandlungen Beachtung finden, wie dies das Agrarabkommen vorsieht
Artikel14:
Die Modalitäten für die weiteren Verpflichtungen, einschliesslich der Bestimmungen zur differenzierten Sonderbehandlung, werden spätestens am 31 März 2003 festgelegt. Die Mitglieder unterbreiten ihre umfassenden Entwürfe der Verpflichtungslisten entsprechend diesen Modalitäten spätestens bis zur fünften Ministerkonferenz Die Verhandlungen einschliesslich in Bezug auf die Regeln und Disziplinen sowie die damit zusammenhängenden Rechtstexte, sind im Rahmen und zum Zeitpunkt der Beendigung des gesamten Verhandlungsprogrammes abzuschliessen
Die dritte Phase der Agrarverhandlungen begann im März 2002 und dauert bis März 2003 Diese Frist wurde den Verhandlungsteilnehmern erteilt, um gemäss oben stehendem Artikel 14 die Modalitäten für die weiteren Verpflichtungen festzulegen (ausführliche Vorschriften zu allen Verhandlungsgegenständen, Zollreduktionssätze und Stützungsgrad sowie eventuelle Änderungen des Wortlautes des Agrarabkommens) Nachdem diese Modalitäten bestimmt sind, müssen die Mitglieder ihre konkreten Verhandlungsofferten bis zur sechsten Ministerkonferenz einreichen, die vom 10 bis 14 September 2003 in Cancun (Mexiko) stattfinden wird
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 257
–
■ Doha – Reformwille bestätigt
■ Die Hauptpositionen
– Die Länder der Cairns-Gruppe (die meisten Nettoexporteure, insbesondere Kanada, Australien, Neuseeland, verschiedene südamerikanische und südostasiatische Staaten sowie Südafrika) und in geringerem Masse die Vereinigten Staaten treten für die Liberalisierung des Agrarhandels ein. Sie verlangen strengere Regeln und Begrenzungen betreffend die Stützungs- und Schutzinstrumente, um den Handelsverzerrungen entgegenzuwirken, die ihrer Meinung nach auf den Agrarmärkten herrschen
– Die Gruppe der «Multifunktionalisten» (EU, Japan, Korea, Norwegen, Mauritius und die Schweiz) fordert eine angemessene Behandlung nicht handelsbezogener Anliegen, damit eventuelle negative Auswirkungen einer schnellen Liberalisierung der Agrarmärkte abgefedert werden können. Unterstützung erhalten sie von den Transitionsländern und bis zu einem bestimmten Masse auch von China
Die restlichen Entwicklungsländer bilden keine einheitliche Front. Ihre unterschiedlichen Interessen werden in mehreren Untergruppen vertreten (konkurrenzfähige Exporteure, am wenigsten entwickelte Länder, kleine Inseln, Länder mit anfälliger Wirtschaft, Länder ohne Meerzugang, verschuldete Staaten, Nettoimporteure von Nahrungsmitteln und Länder, die nur ein Produkt produzieren/exportieren) Seit der Uruguay-Runde haben diese Länder deutlich an Einfluss gewonnen; ohne eine Berücksichtigung ihrer Anliegen ist kein Verhandlungsabschluss mehr denkbar
Dank ihrer aktiven Rolle im Landwirtschaftskomitee bleibt die Schweiz trotz ihres beschränkten Einflusses nicht unbemerkt und kann ihre Position gegenüber den grossen Akteuren behaupten Darüber hinaus ermöglicht ihr diese Mitarbeit, die Synergien zwischen den externen Aspekten und den internen Anliegen der schweizerischen Agrarreform zu nutzen Diese Synergien garantieren den Einbau und die Umsetzung des Multifunktionalitäskonzeptes bei jeder einzelnen Reformetappe.
Die Schweiz setzt mit ihrer auf dem Konzept der Multifunktionalität aufbauenden Agrarpolitik ein Zeichen für eine Landwirtschaft, die sowohl die Produktion von Marktgütern als auch von nicht marktbezogenen Leistungen erbringen kann und damit gleichzeitig mehreren Anforderungen der Gesellschaft genügt

3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 258
–
Die USA sind einer der Hauptakteure der WTO-Agrarverhandlungen. Ihre Verhandlungsposition wird fraglos von der Entwicklung ihrer nationalen Agrarpolitik beeinflusst sein Das neue Landwirtschaftsgesetz der USA, das der amerikanische Präsident am 13. Mai 2002 verabschiedet hat, enthält folgende Kernpunkte:
– Im Vergleich zum letzten «FAIR Act» von 1996 eine massive Erhöhung der staatlichen Subventionen (um 80% bzw 182,8 Mrd $ für die nächsten zehn Jahre) in Form von Direktzahlungen und Krediten Gegenüber den Jahren 1998–2001, in denen die amerikanische Regierung zusätzliche Direktzahlungen sprach (u a «desaster relief payments»), bleibt die staatliche Hilfe jedoch konstant
Wiedereinführung eines «antizyklischen» Preisstützungssystems (ähnlich den 1996 abgeschafften «deficiency payments») Dieses System richtet sich nach dem effektiven Preisniveau und einem vorgegebenen Zielpreis Die Marktsignale werden dadurch neutralisiert, sodass die Produzenten auch in Perioden mit Überschuss weiter produzieren
Besondere Massnahmen im Bereich Milch, Zucker, Erdnüsse, Obst und weiteren Sektoren
– Erhaltungs- und Umweltprogramme sowie verstärkte interne Nahrungsmittelhilfe (Food Aid)
Es wird sich weisen, ob die US-Regierung mit der neuen Farm Bill den Rahmen ihrer WTO-Verpflichtungen bezüglich Inlandstützung übersteigen wird Dies hängt nicht nur von der Entwicklung der Weltmarktpreise ab, sondern auch von der endgültigen Einordnung bestimmter Unterstützungsformen wie das neue System der Einkommensversicherung. In seiner aktuellen Form dürfte dieses System nur schwierig in die GreenBox (Stützung ohne Abbaupflicht) Eingang finden
Die Auswirkungen auf die Agrarverhandlungen werden nicht nur den Bereich der Inlandstützung betreffen, sondern auch die anderen beiden Eckpfeiler, nämlich den Marktzutritt und die Exportsubventionen Denn bevor Zollreduktionen für sensible Produkte durchgesetzt werden können, bedarf es der engen Zusammenarbeit mit dem Kongress, der jedoch der Abschaffung der Exportkredite und dem Druck von aussen im Zusammenhang mit der internationalen Nahrungsmittelhilfe ablehnend gegenübersteht
–
–
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 259
■ Die neue Farm Bill der USA
OECD
Die Organisation für ökonomische Kooperation und Entwicklung (OECD) veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht zu den Agrarpolitiken der 30 Mitgliedsländer. In diesem Bericht wird die Agrarpolitik der einzelnen OECD-Mitgliedsländer anhand der verschiedenen Massnahmen analysiert und kommentiert Mit Hilfe von verschiedenen Indikatoren werden ausserdem diejenigen Mittel berechnet, welche von den Konsumenten und Steuerzahlern für die Stützung der Landwirtschaft aufgewendet werden Am meisten Bedeutung kommt in der Regel dem PSE-Wert zu, der Prozentzahl, welche den Anteil der agrarpolitischen Stützung an den gesamten Einnahmen der landwirtschaftlichen Betriebe widerspiegelt Teil der Stützung ist auch der Grenzschutz
Im Jahr 2001 betrug der PSE-Wert für die Schweiz 69% Das ist zwar noch einmal leicht weniger als in den Vorjahren (2000: 70%), stellt aber wieder den höchsten Wert aller OECD-Länder dar. Der Wert der Gesamtstützung betrug 7,1 Mrd. Fr. (inkl. Grenzschutz) Im Gegensatz zu andern Ländern mit hohen PSE-Werten wie Südkorea, Japan oder Norwegen, wird die Schweiz von der OECD verhältnismässig positiv beurteilt, da die Schweiz ihre Agrarstützung auf Instrumente verlagert hat, welche nicht produktionsstimulierend wirken und den Markt nur wenig verzerren (insbesondere Direktzahlungen).
Das BLW anerkennt zwar die Richtigkeit der Zahlen, weist aber darauf hin, dass die Agrarpolitik der Schweiz mit dem von der OECD ausgewiesenen Wert für die Gesamtstützung oder für den Stützungsanteil an den Betriebseinnahmen nicht ausreichend beurteilt werden kann Wichtig ist vielmehr auch der ebenfalls von der OECD angegebene Anteil der Marktpreisstützung einerseits und der von der Nahrungsmittelproduktion entkoppelten Direktzahlungen zur Erreichung von Umwelt- und anderen Zielen andererseits. Diese Unterteilung des PSE zeigt für die Schweiz in den letzten Jahren in der Tat grosse Veränderungen: Die Marktpreisstützung ging deutlich zurück, während die an den ökologischen Leistungsnachweis gekoppelten Abgeltungen für produktionsungebundene, spezifische Leistungen stiegen. Das BLW wird sich auch in Zukunft im Agrarkomitee der OECD dafür einsetzen, dass die PSE-Berechnungsmethode den Schweizer Reformen besser Rechnung trägt
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 260
Tabelle 53, Seite A62
Welternährung und FAO
Im Jahr 1996 fand in Rom der Welternährungsgipfel statt Dabei wurden Verpflichtungen angenommen und ein Aktionsplan verabschiedet, der zum Ziel hatte, die Zahl der Hungernden bis zum Jahr 2015 auf die Hälfte, das heisst, auf maximal 400 Mio Menschen zu reduzieren Fünf Jahre nach diesem Gipfel fand am Hauptsitz der FAO in Rom vom 10 bis 13 Juni 2002 ein Folgegipfel statt Die Schweizer Delegation wurde von Bundesrat Pascal Couchepin geleitet
Die Lageanalyse nach fünf Jahren ergab, dass die Zahl der Hungernden sich jährlich nur um 9 Mio. Menschen verringert. Dies ist viel zu wenig, um das Ziel des Aktionsplanes aus dem Jahr 1996 zu erreichen Dabei würden die im Durchschnitt weltweit zur Verfügung stehenden 2‘800 Kcal pro Kopf genügen, um alle Menschen ausreichend zu ernähren. Die Ärmsten haben aber oft zu wenig Kaufkraft, um sich Nahrungsmittel zu beschaffen oder es fehlt ihnen am Zugang zu landwirtschaftlichen Ressourcen für den Anbau Da die Mehrheit der Armen in oft wenig erschlossenen Zonen lebt, müssten Armut und Hunger mit vermehrten Investitionen in diesen ländlichen Regionen bekämpft werden Solche Investitionen werden dann am wirksamsten, wenn die Frauen als Hauptträgerinnen besseren Zugang zu Weiterbildung, Krediten, Beratung, landwirtschaftlichen Kenntnissen und zu den Märkten haben
Anzahl hungernder Menschen in Entwicklungsländern versus Ziel des Welternährungs-Gipfels 1996

3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 261
■ Fortschritte sind ungenügend
19701975 19801985 19901995 2000 2005 2010 2015 M i o u n t e r e r n ä h r t e r M e n s c h e n 300 1 000 900 800 700 600 500 400 Tendenz Resultate bei gleichbleibenden Tendenzen Weg zum Ziel des WelternährungsGipfels Basisperiode Welternährungs-Gipfel 1990–1992
■ Keine zusätzlichen finanziellen Mittel
In den letzten Jahren sind immer weniger nationale und internationale Mittel in die Landwirtschaft der Entwicklungsländer geflossen Vernachlässigt wurden insbesondere jene Gebiete, wo mit wenig und einfachen Mitteln ein Beitrag geleistet werden könnte zu einer erhöhten landwirtschaftlichen Produktion, zu mehr Arbeit und zu mehr Einkommen Damit könnte der Hunger wirksam bekämpft werden Es fehlte aber am politischen Willen, um diese Mittel in ausreichendem Masse zur Verfügung zu stellen
Am Folgegipfel in Rom stand die Schaffung eines zusätzlichen Fonds (so genannter Trust Fund) zur Diskussion Mit diesen Mitteln will die FAO Programme zur Hungerbekämpfung unterstützen Die Entwicklungsländer hoffen, dadurch mehr finanzielle Mittel für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums zu erhalten. Die Industrieländer zeigten an einem derartigen Instrument aber wenig Interesse Aus ihrer Sicht ist für die Bekämpfung des Hungers vor allem eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Hauptakteuren auf multilateraler und bilateraler Ebene sowie ein höherer Stellenwert der Menschenrechte im Rahmen einer guten Regierungsführung auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene notwendig Ausserdem bevorzugen sie die gezielte Unterstützung von Projekten im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit In diesem Bereich sollte auch die Schweiz in Zukunft wieder vermehrt Projekte unterstützen, welche in ländlichen Gebieten eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
■ Recht auf Nahrung
Das Recht auf Nahrung war beim Folgegipfel ein zentraler Verhandlungspunkt Bereits in der Deklaration zum Welternährungsgipfel 1996 wurde dieses Recht verankert Mit Ausnahme der USA stimmten alle Länder diesem Passus zu Beim Folgegipfel im Juni 2002 ging es nun darum, die Inhalte des Rechts auf Nahrung weiter zu konkretisieren Die Schweiz setzte sich zusammen mit Norwegen und den G77-Staaten für einen Verhaltenskodex für das Recht auf Nahrung ein Dieses Anliegen konnte sich jedoch nicht gänzlich durchsetzen Am Gipfel wurde beschlossen, in den nächsten zwei Jahren freiwillige Leitlinien für das Recht auf Nahrung auszuarbeiten. Aus der Sicht der Schweiz können auch mit diesem Vorgehen Akzente gesetzt werden, um dem Recht auf Nahrung auf internationaler Ebene schrittweise zum Durchbruch zu verhelfen
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit liess als Grundlage für die Vorbereitung dieses Verhandlungspunktes ein Gutachten erstellen Dieses wurde vom Institut für öffentliches Recht der Universität Bern ausgearbeitet Das Recht auf Nahrung gehört zu den so genannten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten. Diese Kategorie der Menschenrechte hat seit dem Ende des Kalten Krieges einen höheren Stellenwert erhalten So wird auch das Recht auf Nahrung in den letzten Jahren viel stärker diskutiert Die bisherigen Bemühungen lassen erkennen, dass das Recht auf Nahrung juristisch noch auf einem wenig gefestigten Rechtsbereich beruht Man steht erst am Beginn einer Entwicklung
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 262
Inhalt des internationalen Rechts auf Nahrung
Folgende zwei Elemente machen den Inhalt des Rechts auf Nahrung aus:
– Die Verfügbarkeit von Nahrung, welche quantitativ und qualitativ genügt, um die Ernährungsbedürfnisse von Individuen frei von nachteiligen Substanzen und kulturell akzeptabel befriedigen zu können
– Der ungehinderte Zugang zu solcher Nahrung
Wo beide Voraussetzungen umfassend und auf Dauer erfüllt sind, ist das Recht auf Nahrung voll realisiert Damit ist allerdings nicht gemeint, dass der Staat den Privaten unbeschränkt Nahrung zur Verfügung stellen muss oder dass das Recht verletzt wird, wenn dieser Idealzustand nicht erreicht wird Das Recht auf Nahrung kann in verschiedene Teilaspekte unterteilt werden
In den Bereich der individuellen Ansprüche fallen folgende Teile:
Bezüglich des Zugangs zu vorhandener Nahrung haben Private folgende Ansprüche:
– Unterlassungspflicht: Der Staat darf Private nicht durch Verbote und andere Eingriffe am Zugang zu an sich vorhandener Nahrung hindern;
– Schutzpflicht: Der Staat schützt Private gegenüber Dritten, welche sie am Zugang zu an sich vorhandener Nahrung hindern;
– Leistungspflicht: Der Staat fördert den Zugang zu an sich vorhandener Nahrung mit konkreten Massnahmen, wo die Betroffenen nicht selber in der Lage sind, sich solchen Zugang zu verschaffen;
– Diskriminierungsverbot: Der Staat darf Private nicht wegen ihrer Rasse, Religion, ethnischer Herkunft usw. diskriminieren.
Bezüglich Verfügbarkeit von Nahrung muss der Staat:
den Abbau bestehender Leistungen unterlassen, soweit dieser nicht durch andere Massnahmen kompensiert oder sachlich unvermeidlich ist;
– direkt Nahrungsmittel zur Verfügung stellen bzw auf dem Wege der internationalen Zusammenarbeit zur Verfügung stellen lassen, wo es um die unmittelbare Lebenssicherung hungernder Menschen geht oder er über eine Person (z B Gefangene) umfassende Kontrolle hat
in beiden Fällen auf jegliche Diskriminierung verzichten
In den Bereich der programmatischen Verpflichtung des Staates zur fortschreitenden Verwirklichung des Rechts auf Nahrung gehören:
– die Sicherung der Nachhaltigkeit des Zugangs zu Nahrung;
die Sicherung der Verfügbarkeit von Nahrung z.B. durch Massnahmen der Landwirtschafts-, Sozial- oder Umwelt- und Gesundheitspolitik

3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 263
–
–
–
aus: DEZA, Das Recht auf Nahrung, Zusammenfassung eines Gutachtens zuhanden der DEZA, Arbeitsdokument der DEZA 7/99, Bern 1999
In der Schweiz schliesst das in Artikel 12 der Bundesverfassung verankerte Recht auf Hilfe in Notlagen den Anspruch auf überlebensnotwendige Nahrung mit ein Das Recht auf Nahrung ist damit in der Schweiz als einklagbares Sozialrecht verfassungsmässig anerkannt. Dies gilt in der Regel auch für die für das Recht auf Nahrung relevanten Erlasse des Verwaltungsrechtes Auf der Ebene der UNO ist seit 1999 konzeptionell anerkannt, dass Private in Teilbereichen des Rechts auf Nahrung direkt berechtigt sind und es deshalb für die richterliche Durchsetzbarkeit grundsätzlich geeignet ist Diese Auffassung ist in der Observation général 12 des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gemäss dem internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgehalten
Übereinkommen über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
Anlässlich der 31 FAO-Konferenz konnten die über sieben Jahre dauernden Revisionsarbeiten des International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IU) mit der Annahme des Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Übereinkommen über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft; Übereinkommen) abgeschlossen werden. Die Verabschiedung des Übereinkommens ist ein politischer Erfolg für eine nachhaltige Landwirtschaft mit ihren vielfältigen Aufgaben Die schweizerische Agrar- und Entwicklungspolitik erhält damit auch auf internationaler Ebene in einem eigenständigen Abkommen einen internationalen Rechtsrahmen Das Übereinkommen wird als entscheidender Schritt betrachtet, zukünftig die Verfügbarkeit der Vielfalt von pflanzengenetischen Ressourcen sicherzustellen, von der Landwirte und Pflanzenzüchter abhängig sind
Das Übereinkommen enthält Bestimmungen über den Erhalt und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, anerkennt die traditionellen Leistungen der Bauern bei der Erhaltung und Weiterentwicklung pflanzengenetischer Ressourcen (so genannte Farmers‘ Rights) und stellt Bestimmungen für die weitere internationale Zusammenarbeit auf Zentrales Element des Übereinkommens ist das multilaterale System für den erleichterten Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen und für die Aufteilung der Vorteile, die aus der Benutzung solchen Materials entstehen (Access/Benefit Sharing) Dieses System, das einen erleichterten Zugang im Austausch mit einer Vorteilsaufteilung vorsieht, soll eine genügend breite Basis für die Weiterentwicklung verbesserter Pflanzensorten sicherstellen Insgesamt wird das Übereinkommen einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit und nachhaltigen Landwirtschaft leisten. Es harmonisiert das FAO-Recht mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 264
Die Schweiz nahm in den Verhandlungen eine zentrale Rolle ein. So organisierte sie nicht nur zwei Sitzungen des relevanten Verhandlungsausschusses der FAO in der Schweiz, sondern war auch Mitglied des engeren Verhandlungsgremiums Dieses Engagement ist ein Ausdruck der Bedeutung, welche die Schweiz dem FAO International Treaty beimisst Das BLW als federführende Stelle hat die notwendigen Schritte für eine Unterzeichnung und anschliessende Ratifikation des Übereinkommens eingeleitet Ziel ist es, als vollberechtigte Vertragspartei an der ersten Sitzung des Lenkungsausschusses des Übereinkommens teilnehmen zu können
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 265
Internationale Konferenz über nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in Bergregionen
Vom 16 bis 20 Juni 2002 fand in Adelboden die internationale Konferenz über nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (SARD-Mountains) statt Rund 200 Teilnehmer aus 57 Ländern waren in Adelboden anwesend Vertreten waren Repräsentanten von Regierungen und Verwaltungen, von Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Nichtregierungsorganisationen sowie von zehn internationalen Organisationen Die Konferenz wurde durch Bundesrat Pascal Couchepin eröffnet
Die Konferenz stand im Zeichen des «Internationalen Jahres der Berge 2002» und der Vorbereitungen zum bevorstehenden «Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung / Johannesburg 2002».
Das «Internationale Jahr der Berge 2002» war eine ideale Gelegenheit, die Anliegen von «Kapitel 14» der «Agenda 21» («Nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung») gemeinsam mit denjenigen von «Kapitel 13» («nachhaltige Bergentwicklung») anzugehen. Mit dieser doppelten Herausforderung sieht sich die Landwirtschaft sowohl in weiten Teilen Europas und in vielen Entwicklungs- und Transitionsländern konfrontiert
Die Konferenz stand auch in engem Bezug zur Förderung einer multifunktionalen Landwirtschaft, ein Anliegen das zwar in Kapitel 14 wie auch in der Deklaration des Welternährungsgipfels von 1996 in Rom verankert ist, das aber noch immer zu wenig verstanden wird Wenn es uns gelingt, diesen Ansatz breiteren Kreisen bewusster zu machen und die begonnen Prozesse erfolgreich und zielgerichtet weitergeführt werden, kommen wir auf diesem Weg einen entscheidenden Schritt weiter
Vom 26. August bis 4. September 2002 fand der «Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung» in Johannesburg statt Hauptthemen waren zum einen ein umfassender Rückblick auf die Umsetzung der Beschlüsse von Rio Zum anderen wurden Massnahmen für die Zukunft verabschiedet Die Berggebiete sowie nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung waren dabei zentrale Themen
In diesem globalen Zusammenhang war es ein Anliegen der Schweiz, im Jahr der Berge einen Beitrag zu leisten und sich zum Thema nachhaltige Berggebietsentwicklung international verstärkt einzubringen. Dies waren die Beweggründe für die Organisation der Konferenz über nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in Adelboden Verantwortlich dafür zeichnete das EVD/BLW Die Konferenz wurde in Zusammenarbeit mit der FAO, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, dem Bundesamt für Raumentwicklung und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) vorbereitet und durchgeführt
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 266
■ UNO-Jahr der Berge als Anstoss
Die Berggebiete beanspruchen weltweit zirka ein Fünftel der Erdoberfläche. Sie sind Wohn- und Lebensräume für etwa ein Zehntel der Weltbevölkerung und versorgen etwa drei Mrd Menschen mit Wasser Sie sind Produktionsort von Nahrungsmitteln, Orte reicher Biodiversität, ausgeprägte Erholungs- und Tourismusräume sowie Zentren des kulturellen Erbes Kurzum: Berggebiete haben vielfältige ökonomische, ökologische und soziale Funktionen sowohl für die ansässige Bevölkerung als auch für die umliegenden Regionen und Länder zu erfüllen Der fragile Lebensraum Berggebiet ist durch verschiedene Faktoren wie Verkehr, Klimaänderungen, Landwirtschaft oder intensive Freizeitnutzung bedroht
Die Schweiz hat einen Berganteil von rund zwei Dritteln der Landesfläche International wird die Schweiz als Bergland wahrgenommen. Die nachhaltige Entwicklung der Berggebiete ist in der Schweiz ein wichtiges Anliegen Zahlreiche Instrumente und Förderungsmittel, welche die öffentliche Hand zugunsten der Berggebiete einsetzt, sind ein klares Bekenntnis, dass sie den Bergregionen einen besonderen Stellenwert beimisst

Die Internationale Konferenz über nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in Bergregionen war eine der Hauptveranstaltungen des Internationalen Jahrs der Berge (siehe unter www mountains2002 org): Folgende Ziele wurden damit angestrebt:
Förderung des gegenseitigen Verständnisses, der Solidarität und des Informationsaustausches über die Herausforderungen und die Möglichkeiten, in Berggebieten eine nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (SARD) zu fördern;
Forum für diverse Stakeholder, in dem Anliegen, Ideen und Empfehlungen zur Zukunft von SARD-Mountains eingebracht werden können; – Förderung von Netzwerken und Partnerschaften und Schaffung strategischer Allianzen zwischen Stakeholdern
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 267
–
–
■ Berggebiete als Lebensspender
■ Internationaler Erfahrungsaustausch
■ Referate als Einstieg
Am ersten Tag der Konferenz gab es Referate, welche die Thematik von verschiedenen Blickwinkeln her beleuchteten
Botschafter Walter Fust, Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, erklärte, dass die Schweiz am Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung in Johannesburg der Thematik «Entwicklung in Bergregionen» eine hohe Bedeutung zumessen werde Für ihn sind dabei Bereiche wie Wasser, nachhaltige Nutzung erneuerbarer Ressourcen, Klimawandel, Biodiversität, Marktzugang für abgelegene Regionen und die Integration des privaten Sektors und der Zivilgesellschaft mit eingeschlossen Die Landwirtschaft sieht er nicht isoliert, sondern als Teil eines Ganzen, damit eine nachhaltige Entwicklung in Bergregionen erreicht werden kann
Andrea Negri, Vizepäsident von Euromontana, gab einen Überblick über die Entwicklungen in der EU Er hob hervor, dass diese Entwicklungen sowohl Risiken als auch Chancen bieten würden. Als Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation nannte er unter anderem die Konzentration auf Produkte, die nicht als Massenware produziert werden können, überregionale Zusammenarbeit oder die Nutzung von Synergien zwischen der Erhaltung natürlicher Ressourcen und wirtschaftlichen Tätigkeiten
Claude Martin, Direktor von WWF International, führte in seinem Referat aus, dass die Klimaerwärmung in den Bergregionen für die nächsten Jahrzehnte eine der grössten Herausforderungen sein dürfte Er plädierte für einen Planungsansatz, der ökologische, ökonomische und soziale Anliegen gleichwertig berücksichtigt. Er rief auch dazu auf, die Umweltanliegen besser bekannt zu machen und dafür auch entsprechende Abgeltungsmöglichkeiten zu schaffen
Professor Bernard Lehmann, Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich, hob in seiner Analyse die ungünstigen Bedingungen der Berglandwirtschaft hervor. Im Einzelnen sind dies eine relativ tiefe Produktivität, eine insgesamt geringe Wettbewerbsfähigkeit, Nachteile auf den Beschaffungs- und Angebotsmärkten aufgrund der grossen Distanzen. Als Folge davon sind die Einkommen und der Lebensstandard der Bergbauern tief Für Bernard Lehmann hat das Konzept der Multifunktionalität in der Landwirtschaft Modellcharakter für eine nachhaltige Entwicklung der Berggebiete Das Konzept ermöglicht es, die nicht marktfähigen Produkte der Landwirtschaft sichtbar zu machen und kann somit eine Basis sein für die Abgeltung entsprechender Leistungen durch die Allgemeinheit Auch Bernard Lehmann vertrat die Ansicht, dass die Landwirtschaft nicht allein eine nachhaltige Entwicklung in den Bergregionen tragen kann
Peter Moser, Historiker, Universität Bern, präsentierte einen historischen Abriss (1848 bis 1992) des Verhältnisses zwischen der Bergbevölkerung und der übrigen Bevölkerung in der Schweiz Er stellte einen Wandel fest in der Wahrnehmung der übrigen Bevölkerung gegenüber den Bergregionen. Konstant waren in dieser Zeitperiode dagegen die ökonomischen Unterschiede
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 268
■ Vertiefung der Thematik in Arbeitsgruppen
Am zweiten Tag der Konferenz wurde die Thematik in acht Arbeitsgruppen vertieft. Als Inputs in diese Arbeiten wurden lokale Initiativen und Programme vorgestellt In den Arbeitsgruppen wurden Prioritäten für einen Aktionsplan und konkrete Empfehlungen formuliert. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppensitzungen flossen auch ein in die Deklaration von Adelboden
Rahmen für die Diskussionen in den Arbeitsgruppen
Oberziel von SARD: Lebensqualität ländlicher Gemeinschaften verbessern
Schlüsselement für Politiken und Programme: nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung
Natürliche Ressourcen Human Ressourcen
Hauptausrichtung der Diskussion
Wirtschaftliche Ressourcen
Hauptstrategie für Aktionen (Umsetzung): Bessere Nutzung der Ressourcen
■ Landwirtschaft allein in den Bergregionen genügt nicht
Die Referate und die Diskussionen in den Arbeitsgruppen haben eines klar gezeigt: Die Landwirtschaft kann allein eine nachhaltige Entwicklung in den Bergregionen nicht gewährleisten Durch den Wandel der Volkswirtschaft von der Primärproduktion in Richtung Tertiärsektor ist es auch in den Bergregionen und in den abgelegenen Gebieten von zentraler Bedeutung, eine angemessene Durchmischung der Sektoren zu haben. Dadurch stellt sich die Frage des Zusammenspiels der verschiedenen Politikbereiche, insbesondere von Agrar- und Regionalpolitik Die Bergregionen müssen ihre strategischen Erfolgspositionen aber auch mit eigener Initiative suchen und ausbauen Dies gilt auch für die Landwirtschaft. Mit ihren multifunktionalen Leistungen kann sie zusätzlich indirekt einen Nutzen stiften für andere Wirtschaftsbereiche, z B für den Tourismus mit einer gepflegten Landschaft
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 269
■ Deklaration von Adelboden
In Adelboden wurde aber auch klar, dass die Bergregionen einerseits weit über ihre Grenzen hinaus Dienstleistungen erbringen und andererseits globale Prozesse, z B Klimaveränderungen oder die Globalisierung der Wirtschaft, sich besonders negativ auf diese Gebiete auswirken. In diesem Zusammenhang wurde in Adelboden angeregt, dass neue Allianzen mit Tiefland-Bevölkerungen und Kompensationsprogramme für die positiven äusseren Gegebenheiten geschaffen werden sollen
Am letzten Tag der Konferenz verabschiedeten die Teilnehmer einstimmig die Deklaration von Adelboden über die nachhaltige Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung Die Erarbeitung der Deklaration stand unter der Leitung von G Viatte, dem ehemaligen Direktor für Landwirtschaft bei der OECD. Mit einbezogen waren die acht «Speakers» der Arbeitsgruppen Der «Geist von Adelboden» hat viel zu diesem positiven Abschluss beigetragen Er stimmt zuversichtlich, dass damit ein Prozess eingeleitet werden kann, welcher mithilft, die Situation der Bevölkerung in den Bergregionen dieser Welt zu verbessern
Deklaration von Adelboden zu SARD Mountains
Unter Hinweis auf die «Agenda 21», angenommen an der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (Rio de Janeiro, Brasilien, Juli 1992) und die Empfehlungen der Kommission für nachhaltige Entwicklung mit Bezug auf «Nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung» (Sustainable Agriculture and Rural Development, SARD),
Unter Hinweis auf die Entscheide der UN Generalversammlung, das Jahr 2002 zum «Internationalen Jahr der Berge» zu erklären und den kommenden «Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung» in Johannesburg (26 August – 4 September 2002) abzuhalten, sowie der Kirgisischen Republik, die Funktion als Gastgeberland für die Internationale Berggebietstagung «Bishkek Global Mountain Summit» (28. Oktober – 1. November 2002) zu übernehmen,
In Anbetracht der besonderen Bedeutung von Kapitel 14 (SARD) und Kapitel 13 (Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme: nachhaltige Bewirtschaftung von Berggebieten) der «Agenda 21» für den Lebensunterhalt der Bergbevölkerung,
In Anbetracht des FAO «World Food Summit – five years later» (Rom, Juni 2002), dessen Deklaration eine Internationale Allianz gegen Hunger fordert und an welchem ein Anlass über nachhaltige Entwicklung der Berggebiete durchgeführt wurde,
Die Vertreter der Bergbevölkerung, die Hauptgruppen der Zivilgesellschaft, Regierungen und internationale Organisationen, die an der Konferenz SARD in Bergregionen 2002 in Adelboden, Schweiz, 16 – 20 Juni 2002 teilnahmen, erklären im Konsens folgendes:
SARD als ein Gesamtansatz für Bergregionen
In Anbetracht der Erfahrung seit Rio, dass die Implementierung von Kapitel 14 (SARD) und 13 (Mountains [Berge]) in engem Bezug steht zu vielen anderen Kapiteln der «Agenda 21», die Themen abdecken wie Armut, Konsum, Gesundheit,
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 270
Boden, Land, Wälder, Wüstenbildung, biologische Vielfalt, Süsswasser, eingeborene Bevölkerungsgruppen, Kommunen, Zugang zu Ressourcen, Rolle der Privatwirtschaft, Rolle der Bauern,
In Anbetracht der Tatsache, dass daher SARD, um erfolgreich zu sein, in einem ganzheitlichen, standortspezifischen, integrierten und flexiblen Ansatz verfolgt werden muss mit Sicherstellung des Miteinbezugs der aktiven Beteiligung der Bergleute mit allen anderen Interessengruppen,
In Anbetracht der Tatsache, dass Landwirtschaft für die Bergleute auf der ganzen Welt eine Schlüsselrolle spielt, dass aber nachhaltige Lebensunterhaltsysteme und integrierte ländliche Entwicklung eine Diversifizierung in andere wirtschaftliche Aktivitäten erfordern,
In Anbetracht der Tatsache, dass alle Bergregionen und andere empfindliche Ökosysteme in den drei Hauptpfeilern der Nachhaltigkeit mit bedeutenden Herausforderungen konfrontiert sind: wirtschaftlich, umweltbezogen und sozial, unter Berücksichtigung auch der politischen und kulturellen Dimensionen.
Nachteile und Potentiale in Berggebieten und deren Populationen
In Anbetracht insbesondere der Tatsache, dass
– Bergregionen und ihre Bevölkerungen Problemen wie Armut, Hunger, sozialer und politischer Marginalisierung und Konflikten stärker ausgesetzt sind und daher im Allgemeinen einen Entwicklungsrückstand aufweisen,
– Berglandwirtschaft Besonderheiten und einige spezifische Nachteile aufweist aufgrund von geographischer Isolation, schwierigen klimatischen Bedingungen und empfindlichen Ökosystemen, was Produktion, Marketing und Entwicklung schwieriger gestaltet, – Globalisierung für Berggebiete oft negative Auswirkungen gehabt hat und dass es wichtig ist, Marktverzerrungen zu vermindern Jedoch herrschen selbst im Falle einer Ausräumung dieser Verzerrungen in Bergregionen vergleichsweise Nachteile vor, die entsprechend besondere Aufmerksamkeit erfordern,
In Anbetracht der Tatsache, dass Berggebiete andererseits auch gewisse vergleichsweise Vorteile und bedeutende Potentiale aufweisen und eine breite Palette an Gütern und Dienstleistungen für den Rest der Gesellschaft anbieten, z B in Bezug auf biologische Vielfalt, Landschaft, Wasser, Vorbeugung von Risiken, spezifische Produkte und Kultur,
In Anbetracht daher des Netzes gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen Berggebieten und Tiefland, z B durch Migration und Süsswasserverbindungen,
Die Konferenz in Adelboden hat die Herausforderungen von SARD in Bergregionen und die unter den folgenden vier Themenkreisen spezifischer vorzusehenden Aktionen genauer untersucht: Rollen und Aufgaben der Landwirtschaft, Gute Praktiken für SARD in Bergregionen, Zugang zu Ressourcen sowie faire Arbeitsbedingungen
und ruft Regierungen, regierungsübergreifende Organisationen und andere internationale Organisationen sowie grössere Gruppierungen bürgerlicher Gesellschaften und andere Interessengruppen auf zur

3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 271
Entwicklung und Verbesserung von Strategien und Aktionen
Um auf die vielen Herausforderungen von SARD in Bergregionen zu reagieren, müssen adäquate und kohärente Strategien, Instrumente und Programme entwickelt und eingesetzt werden, und zwar in einer die Beteiligung fördernden Weise in allen Bereichen, insbesondere den folgenden: – politische, rechtliche und institutionelle Umgebung: grössere Aufmerksamkeit und Verantwortlichkeit für bergspezifische Fragen und spezielle Belange – insbesondere durch Entschärfung der Armut – im Kontext bestehender nationaler und internationaler Rahmenbedingungen; Anerkennung der Rechte von lokalen Gemeinschaften und Einzelpersonen auf ihr Wissen, ihre natürlichen Ressourcen und Technologien und eine Beteiligung am Nutzen bzw Ertrag; Kompetenz und Ermächtigung (Empowerment) für Gemeinschaften; Eigentumsund Nachfolgerechte einschliesslich entsprechenden Landbesitztums und Katasterregelungen; Rechtsgrundsatz, Sicherheit, politische Rechte und Demokratie, Dezentralisation sowie laufende lokale Beteiligung und gute Steuerung; Rolle, Rechtsstatus und Rechte für Eingeborene und Stammangehörige, Frauen, Kinder und schwächere Gruppen; ordentliche Arbeitsnormen, – soziale und kulturelle Umgebung: Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser und grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung der Bevölkerung, Gesundheit, Hygiene, Wohnen, Energie; faire Arbeitsbedingungen, Risikomanagement und Reduktion der Anfälligkeit; Erhaltung der Kultur; Fähigkeit, sich zu organisieren und zusammenzuschliessen; Reduktion des sozialen Ausschlusses; Förderung sozialer Sicherheitsnetze und Schutz der Schwächsten (Kinder, Alte, Kranke, Behinderte und HIV/Aids-Infizierte, speziell in Entwicklungsländern); Erwägung von Hilfestellung und Unterstützung zur Entwicklung von Alternativen für illegalen Anbau, – natürliche Umgebung: Bekämpfung von Entwaldung, Erosion, Landentwertung, Verlust an biologischer Vielfalt, alle Arten von Wasserwegunterbrüchen und Rückgang von Gletschern; Bereitschaft für nachteilige Auswirkungen von Klimaveränderungen und Naturkatastrophen, Einsatz und Verstärkung von Frühwarnsystemen; nachhaltiges Bewirtschaften von Talschaften und Wäldern (Watershed Developement); Wiederherstellung und Förderung von Boden und Ökosystemen,
wirtschaftliche Umgebung: ländliche Infrastruktur, «wesentliche Verbesserung des Zugangs zu Märkten; Reduktion aller Formen von Exportsubventionen im Hinblick auf deren schrittweise Abschaffung; und wesentliche Reduktion der wirtschaftsverzerrenden inländischen Unterstützung sowie spezielle und differentiale Behandlung für Entwicklungsländer»; Marktinformation und -entwicklung; Zugang zu Kredit und Finanzdienstleistungen, öffentliche und private Investitionen; wirtschaftliche Aufwertung und faire Kompensation für umweltbasierte und andere Güter und Dienstleistungen aus Bergregionen; Förderung und Stärkung von Kooperativen und konkurrenzfähigen Organisationen; alle Formen von nachhaltigen Landwirtschaftspraktiken; Diversifizierung innerhalb und ausserhalb der Landwirtschaft, Nischenmärkte, Ausrichtung auf Mehrwert auf Primärebene mit damit verbundenem Beitrag zu höheren Einkommen, Konsumenteninformation, Produktionsnormen und -indikatoren, Bescheinigungen, Herkunfts- und Qualitäts-Labels,

3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 272
–
Kapazitätsaufbau/Wissen: Forschung, Ausbildung, Technologietransfer und -ausdehnung; Landbau- und Ökosystem-Bewirtschaftung; Bewirtschaftung lokaler Organisationen, insbesondere Bauernorganisationen, und finanzielle sowie technische Unterstützung zu diesen Zwecken; regionale Nord-Süd und Süd-Süd Allianzen und Informationsaustausch sowie beste Praktiken; Erzeugung von Einkommen; Kapazität zur Ausarbeitung und Implementierung von Strategien
Dazu sind Initiativen, Aktionen und politische Entscheide auf lokaler, nationaler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene nötig («Prinzip der Subsidiarität») Sie erfordern informierte Beteiligung und Engagement, einschliesslich eigener Ressourcen auf allen Ebenen auf der Grundlage der Prinzipien von gemeinschaftsinitiierten Ansätzen und Gleichheit/Gerechtigkeit bei der Beteiligung vieler verschiedener Interessengruppen
Konkrete Lösungen für Konflikte, von denen so viele Menschen in Berggebieten betroffen sind, müssen dringend implementiert werden
Eine während der Diskussionen der Konferenz erarbeitete Liste von Themen im Hinblick auf zukünftige Aktivitäten, die es weiter auszuarbeiten gilt, liegt im Anhang bei.
SARD – Mountains: Kombination von SARD und nachhaltiger Bergentwicklung – Verstärkung des internationalen Fortschritts
Aufgrund der Erkenntnis, dass die Herausforderungen und der Fortschritt von SARD in Bergregionen abhängig sind von dringlichen Aktionen sowohl auf der allgemeinen Ebene von SARD als auch der nachhaltigen Entwicklung von Bergregionen, rufen wir die betroffenen Länder und andere Partner auf, folgende Initiativen zu ergreifen:
– die SARD Initiative und die internationale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung in Bergregionen – gefördert von der FAO – zu unterstützen und ihre Ausrichtung auf SARD in Bergregionen zu verstärken;
eine Adelboden Gruppe für SARD in Bergregionen zu bilden als Plattform für Diskussionen über Strategien und strategische Instrumente, Erfahrungsaustausch, Vorbereitung von Initiativen. Diese Gruppe wird involvierte Regierungen, die FAO und andere wichtige internationale Organisationen, Interessengruppen und NGOs mit einschliessen;
– FAO, Regierungen und andere wichtige Organisationen um institutionelle Vorschläge zur Weiterbearbeitung gemäss den Empfehlungen dieser Deklaration zu bitten;
– die an der Konferenz in Adelboden teilnehmenden Länder und Interessengruppen zu bitten, die Ergebnisse dieser Konferenz und ihre Deklaration am «World Summit on Sustainable Development» (WSSD) in Johannesburg, am «Bishkek Global Mountain Summit» und anderen internationalen Anlässen sowie im lokalen, regionalen und nationalen Rahmen bekannt zu machen und zu integrieren
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 273 –
–
Angenommen in Adelboden, Schweiz am 20 Juni 2002
Die Konferenz von Adelboden über nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung war ein erster Schritt in einem Prozess, der eine nachhaltige Verbesserung der Situation in den Bergregionen zum Ziel hat Die Deklaration bildet sowohl eine Basis für die Akteure, die konkret an Programmen arbeiten, als auch für künftige Aktivitäten, die den eingeleiteten Prozess weiter vertiefen Die Konferenz hat gezeigt, wie wertvoll ein Erfahrungsaustausch aller Betroffenen der verschiedenen Bergregionen der Welt ist Der Erfolg der Konferenz von Adelboden wird sich daran messen, inwieweit es gelingt, in den nächsten Jahren Partnerschaften zwischen den verantwortlichen Regierungsstellen und der zivilen Gesellschaft aufzubauen Bei Redaktionsschluss für den Agrarbericht 2002 war nicht bekannt, ob und wie die Ergebnisse der Konferenz von Adelboden Eingang gefunden haben in den Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung in Johannisburg und in den Weltgipfel über die Berge in Bishkek (Kirgistan). Das Thema nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in Bergregionen wird jedoch unabhängig des Ausgangs dieser Konferenzen weiter bearbeitet So wurde in Adelboden beschlossen, im Jahr 2004 in Peru eine Folgekonferenz abzuhalten. Ausserdem ist die FAO zusammen mit der Schweiz und anderen Ländern daran, konkrete Massnahmen zur Umsetzung des Folgeprozesses in Gang zu setzen Weitere Informationen zur Konferenz in Adelboden und zum Folgeprozess finden Sie unter www sard-m2002 ch
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 274
■ Wie geht es weiter
3.2 Internationale Vergleiche
Internationaler Preisvergleich
Der internationale Preisvergleich wird, ausgehend vom Schweizermarkt, mit identischen, ähnlichen oder wichtigen Märkten des Auslandes angestellt Damit sind jedoch gewisse Schwierigkeiten verbunden wie die Auswahl der Produkte, die Verfügbarkeit der Daten, die Relevanz der Messgrössen, die unterschiedlichen Produktions- und Verkaufsformen oder die währungsspezifischen Einflüsse Bei den für den internationalen Vergleich verwendeten Preisen in diesem Kapitel handelt es sich um:
– Durchschnittswerte auf nationaler Ebene das bedeutet, minimale bzw maximale Werte je nach Region oder Verwertung des Erzeugnisses (Produzentenpreis) werden verdeckt.
– Grössenordnungen: die Erzeugnisse (Qualitäts-, Labelprodukte), Vermarktungsvoraussetzungen (Menge, Vermarktungsgrad), Absatzkanäle und Berechnungsmethoden des Durchschnittswertes unterscheiden sich von Land zu Land

– Bruttopreise; das heisst:
– die auf dem Markt beobachteten Preise (im Rahmen der Agrarpolitik jedes einzelnen Landes) Die Produzentenpreise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer Diese ist jedoch in den Konsumentenpreisen eingeschlossen, da es sich um eine vom Konsumenten zu leistende Abgabe handelt.
– Die Preise sind nicht nach der unterschiedlichen Kaufkraft der einzelnen Länder bereinigt
Es stehen daher nicht die absoluten Werte im Vordergrund, sondern die Veränderungen im Verlaufe der Zeit.
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 ■■■■■■■■■■■■■■■■
275
Die aus dem Verkauf eines «Standardwarenkorbes» erzielten Einnahmen der Produzenten dienen als Vergleichsgrundlage Der Standardwarenkorb setzt sich aus den wichtigsten Produktionsvolumen der Schweiz in den Jahren 1998/2000 zusammen
Die Struktur der schweizerischen Produktion wird also auf die für den Preisvergleich berücksichtigten Länder übertragen
Die EU-Preise beziehen sich auf die vier Nachbarstaaten (EU-4/6) Die Länder fünf und sechs sind die Niederlande und Belgien Diese werden für jene Produkte berücksichtigt, bei denen diese Länder hohe Produktionsvolumen ausweisen Der Durchschnittspreis für die EU berechnet sich aus dem Produktionsvolumen der betreffenden Länder Diese vier bzw sechs Länder produzieren mehr als die Hälfte der von den 15 EUMitgliedern produzierten Gesamtmenge. Die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes (schweizerisches Produktionsvolumen 1998/2000) und das Gewicht der Länder der EU-4/6 (Produktionsvolumen 1995/2001) sind als fix über die Zeit angenommen, damit nur die Preisschwankungen aufgezeigt werden.
Auf welchem aktuellen Stand (1999/2001) befinden sich die schweizerischen Agrarpreise im Vergleich zur EU und den USA?
– Würden die Landwirte der EU-4/6 oder der USA den schweizerischen Standardwarenkorb produzieren und 1999/2001 in ihren Ländern verkaufen, erzielten sie etwa die Hälfte (54 bzw 53%) der Einnahmen ihrer Schweizer Kollegen
– Zwischen den einzelnen EU-Ländern gibt es jedoch Unterschiede: Der Erlös des Standardwarenkorbes entspricht in Italien 62%, in Deutschland 55%, in Frankreich 53% und in Österreich 51% des Schweizer Preises
– Unterschiede sind auch je nach Produkt auszumachen: Der Preis der Ackerbauprodukte wie Weizen (28% des schweizerischen Preises), Gerste (35%), Raps (35%) und Kartoffeln (45%) bewegt sich 1999/2001 in der EU-4/6 auf einem ausgesprochen tiefen Niveau. Eine Ausnahme bilden die in der EU kontingentierten Zuckerrüben (54%) Im Gegensatz zu diesen Erzeugnissen erreicht die Milch, die ebenfalls kontingentiert ist, in der EU-5 einen ziemlich hohen Preis (62%)
– Im Vergleich «Land-Produkt» zeigen sich folglich noch viel grössere Abweichungen: Während 1998/2001 in Frankreich Birnen zu 102% des schweizerischen Preises verkauft wurden, erhielten 1999/2001 belgische Bauern für Karotten lediglich 17% des Entgelts der Schweizer Landwirte
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 276
Tabellen 49–50b, Seiten A57–A59
■ Produzentenpreise
Entwicklung der Produzentenpreise in der EU und der CH
w i e b e l n ( 1 0 k g ) T o m a t e n ( 5 k g ) S t a n d a r d w a r e n k o r b ( M r d F r / J a h r )
Produzentenpreise der Schweiz im Verhältnis zur EU
i l c h G r o s s r i n d e r K a l b S c h w e i n P o u l e t E i e r W e i z e n G e r s t e
1990/921999/2001
K ö r n e r m a i s Z u c k e r r ü b e n K a r t o f f e l n R a p s Ä p f e l B i r n e n K a r o t t e n Z w i e b e l n T o m a t e n S t a n d a r d w a r e n k o r b
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 277
CH 1990/92 EU 1990/92 Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste CH 1999/2001 EU 1999/2001 0 16 14 12 10 8 6 4 2 M i l c h ( 1 0 k g ) G r o s s r i n d e r ( k g S G ) K a l b ( k g S G ) S c h w e i n ( k g S G ) P o u l e t ( 2 k g V G ) E i e r ( 2 0 S t ) W e i z e n ( 1 0 k g ) G e r s t e ( 1 0 k g ) K ö r n e r m a i s ( 1 0 k g ) Z u c k e r r ü b e n ( 1 0 0 k g ) K a r t o f f e l n ( 2 0 k g ) R a p s ( 5 k g ) Ä p f e l ( 1 0 k g ) B i r n e n ( 1 0 k g ) K a r o t t e n ( 1 0 k g ) Z
i n F r
0 100 90 80 70 60 40 50 30 20 10
M
I n d e x ( C H = 1 0 0 )
Nähern sich die schweizerischen Agrarpreise denjenigen in der EU und den USA an?
– In der Zeitspanne zwischen 1990/92 und 1999/2001 gingen die Produzentenpreise (in Schweizer Franken ausgedrückt) für den Standardwarenkorb nicht nur in der Schweiz (–23%), sondern auch im EU-Raum (–18%) zurück Die niedrigeren Preise im EU-Raum sind einerseits auf die Agenda 2000 und andererseits auf die Schwächung des Euro zurückzuführen, der gegenüber dem Schweizer Franken 13% verloren hat Der relative Abstand zwischen der Schweiz und der EU hat im beobachteten Zeitraum deshalb nur leicht abgenommen 1990/92 betrug der Preis des Standardwarenkorbes in der EU 51% gegenüber 54% (1999/2001) In absoluten Werten ist die Angleichung an die EU-Preise indessen erheblich Die absolute Preisdifferenz zwischen der Schweiz und der EU hat sich zwischen den beiden Perioden um mehr als einen Viertel verkleinert (–28%)
In den USA wiesen die Produzentenpreise (in Schweizer Franken ausgedrückt) eine steigende Tendenz auf (+15%) Grund dafür war in erster Linie der gegenüber dem Schweizer Franken gestiegene Dollarkurs (15%) Im Vergleich zur Referenzperiode (1990/92) verringerte sich der Preisunterschied zu den USA sowohl in relativen (von 35% in den Jahren 1990/92 auf 53% der Schweizer Preise in der Periode 1999/2001) als auch in absoluten Werten (–44%)
– Je nach EU-Land sind Unterschiede auszumachen Zwischen den genannten Zeitspannen reduzierte sich die absolute Preisdifferenz für einen Standardwarenkorb am meisten zu Frankreich (–32%), Deutschland (–28%) und Italien (–23%), während das Preisgefälle zu Österreich, das erst am 1 Januar 1995 der EU beitrat etwas weniger deutlich abnahm (–4%).
– Unterschiedlich verliefen die Entwicklungen auch bei den einzelnen Produkten Zwischen 1990/92 und 1999/2001 nahm der absolute Abstand zwischen der EU und der Schweiz am meisten bei Raps (–57%), Eiern (–39%), Milch (–37%) und Weizen (–32%) ab, während sich die Preisschere beim Schwein (–17%) als auch bei den Grossrindern (–3%) weniger schloss und Zwiebeln (63%) sogar weiter öffnete
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 278
–
1990/92199920002001 I n d e x ( C H 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) CH UE-4/6
Entwicklung der Produzentenpreise des Standardwarenkorbes
USA 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 100
Quellen: BLW, BFS, Schweizerische Nationalbank, SBV, Eurostat, ZMP, Agreste U S. Department of agriculture
Der Preis ist zwar ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft, aber nicht der einzige: Qualität, Sicherheit und Ruf des Produktes, Werbung, Verteilernetz und die mit den Erzeugnissen verbundenen Dienstleistungen sind ebenfalls für den Erfolg auf einem bestimmten Markt entscheidend.
Das Preisgefälle bei den Lebensmitteln zwischen der Schweiz und den beobachteten Ländern wurde aus dem Konsumentenpreis eines «Standardwarenkorbes» im Ladenverkauf, inkl MwSt , berechnet Dieser Warenkorb besteht aus rund zwanzig Lebensmitteln im Verhältnis des für den schweizerischen Konsumentenpreisindex im Jahr 1993 verwendeten Gewichtungsschlüssels
Zur Gruppe «EU-4» gehören wie bei den Produzentenpreisen die Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich Für Italien dienten die Preise der Stadt Turin als Bezugsbasis. Beim Gemüse und bei fehlenden Zahlen aus den Nachbarländern wurde Belgien zusätzlich einbezogen Zudem wurde aus den minimalen und maximalen nationalen Durchschnittspreisen ein oberer und unterer Durchschnittswert der EU-4/5 ermittelt

Das Gewicht der einzelnen Länder der EU-4/6 (Ausgaben der Privathaushalte im Jahr 1998) und die Zusammensetzung des Standardwarenkorbes wurden als fix angenommen, damit ausschliesslich die Preisschwankungen über die Jahre ersichtlich sind
Bei den Konsumentenpreisen für den «Standardwarenkorb» sind zwischen der Schweiz und den Vergleichsländern (EU, USA) weniger grosse Abweichungen festzustellen als bei den Produzentenpreisen. Eine Erklärung dafür liefern die unterschiedliche Zusammensetzung des Standardwarenkorbes auf Konsumenten- und Produzentenebene, das Ausmass der Nahrungsmittelimporte und auch der höhere Mehrwertsteuersatz in der EU (7% im Vergleich zu 2,4% in der Schweiz mit Schwankungen zwischen den einzelnen Ländern und Produkten)
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 279
■
CH
I n d e x ( C H 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 1990/921999/2001 Quellen: BLW, BFS, ZMP, nationale Statistikämter von F, B, A, USA, Statistikamt der Stadt Turin 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Tabellen
51–52, Seiten A60–A61
Konsumentenpreise Entwicklung der Konsumentenpreise eines Standardwarenkorbes
EU-4/5 unteres Mittel EU oberes Mittel EU USA
Die schweizerischen Konsumentenpreise gingen zwischen 1990/92 und 1999/2001 um 4% zurück Dieser Wert entspricht dem Preis, der in den letzten beiden Berichten für die Vergleichsperioden 1990/92–1997/99 und 1990/92–1998/2000 veröffentlicht wurde. In der EU betrug der Preisrückgang 9% gegenüber 8 und 7% in den beiden Vorjahren
Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den benachbarten EU-Ländern betrug 28% der schweizerischen Preise 1990/92 und stieg für den Zeitraum 1999/2001 auf 32% an Folglich vertieft sich der Graben zwischen den Konsumentenpreisen in der Schweiz und der EU Diese Entwicklung lässt sich zumindest teilweise durch den deutlich gestiegenen Anteil der Labelprodukte (Bio, M-7, Coop, Natura Plan) insbesondere beim Fleisch erklären.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bleiben aber beträchtlich Während in der EU der Zucker und ein Teil der italienischen Milchprodukte (Turin) mehr kosten als in der Schweiz, sind die Schweinekoteletts in der EU nur halb so teuer, denn das in der EU-4 angebotene Schweinefleisch stammt mehrheitlich aus konventionellen Züchtungen Das in den schweizerischen Geschäften im Jahr 2001 angebotene Schweinefleisch setzte sich hingegen zu 60% aus Marken- oder Labelerzeugnissen zusammen
Im Gegensatz dazu stiegen im Zeitraum 1990/92–1999/2001 die Konsumentenpreise in den USA um 30% an Dementsprechend wurde die Preisschere zur Schweiz kleiner 1999/2001 betrug der Abstand nur noch 29% gegenüber 49% in der Periode 1990/92 Hauptgrund dafür ist der Anstieg des Dollarkurses, der gegenüber dem Schweizer Franken um 15% zulegte
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 280
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 281
Mitarbeit am Agrarbericht 2002
■ Projektleitung, Werner Harder
Sekretariat
■ Autoren
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Ursula Gautschi, Michel Yawo Afangbedji, Andreas Berger, Simon Hasler, Katja Hinterberger, Thomas Meier, Beat Ryser
Wirtschaftliche Lage
Vinzenz Jung
Soziales und Gesellschaft
Michel Fischler, Esther Muntwyler, Alessandro Rossi
Ökologie und Ethologie
Brigitte Decrausaz, Rhea Beltrami, Anton Candinas, Olivier Felix, Michel Fischler, Heinz Hänni, Esther Muntwyler
Beurteilung der Nachhaltigkeit
Vinzenz Jung
■ Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Ursula Gautschi
Übergreifende Instrumente
Friedrich Brand, Jean-Marc Chappuis, Emanuel Golder, Simon Hasler, Samuel Heger, Franziska Ruchti Bandli, Marco Vanazzi
Milchwirtschaft
Katja Hinterberger
Viehwirtschaft
Simon Hasler
Pflanzenbau
Thomas Meier, Frédéric Rothen
282
Überprüfung der Massnahmen
Paolo Degiorgi, Katja Hinterberger
Direktzahlungen
Thomas Maier, Hanspeter Berger, Viktor Kessler, Daniel Meyer, Hugo Roggo, Olivier Roux, Beat Tschumi, Peter Zbinden, Carole Zeindler
Grundlagenverbesserung
Strukturverbesserungen und Betriebshilfe
René Weber, Jörg Amsler, Willi Riedo, Andreas Schild
Forschung, Beratung, Berufsbildung
Anton Stöckli, Jacques Clément, Urs Gantner, Jakob Rösch
Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz
Katja Babuin, Elisabeth Bosshard, Olivier Félix, Markus Hardegger, Albrecht Siegenthaler
Tierzucht
Karin Wohlfender
Finanzinspektorat
Niklaus Olibet
■ Internationale Aspekte
Internationale Entwicklungen
Nicole Bays, Friedrich Brand, Christoph Eggenschwiler, Anders Gautschi, Jean Girardin, Anton Kohler, Hans-Jörg Lehmann
Internationale Vergleiche
Jean Girardin
■ Übersetzungsdienste Deutsch: Yvonne Arnold
Französisch: Christiane Bokor, Pierre-Yves Barrelet, Yvan Bourquard, Giovanna Mele, Elisabeth Tschanz, Paule Valiquer, Magdalena Zajac
Italienisch: Patrizia Vanini, Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Technische Unterstützung
Hanspeter Leu, Peter Müller
283
284
A N H A N G A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Anhang Tabellen Strukturen A2 Tabellen Märkte A4 Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse A14 Tabellen Ausgaben des Bundes A27 Tabellen Internationale Aspekte A57 Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft A63 Begriffe und Methoden A66 Abkürzungen A82 Literatur A84
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Strukturen
A2 A N H A N G Tabelle 1 Landwirtschaftsbetriebe, Landwirtschaftliche Nutzfläche und Grossvieheinheiten Grössenklassen in ha Betriebe Landwirtschaftliche Nutzfläche Grossvieheinheiten landwirtschaftlicher Nutzfläche 1990 1996 2000 1990 1996 2000 1990 1996 2000 Anzahl Anzahl Anzahl ha ha ha Anzahl Anzahl Anzahl 0-1 6 629 5 054 3 609 2 895 2 123 1 336 82 550 54 588 61 016 1-3 13 190 7 113 4 762 23 828 12 614 8 861 34 466 22 522 14 753 3-5 8 259 6 926 5 393 32 243 27 004 21 348 42 473 34 355 27 714 5-10 18 833 15 148 13 149 141 403 113 654 99 056 209 784 156 778 127 361 10-15 18 920 15 907 13 812 233 888 197 421 171 817 341 563 273 225 230 628 15-20 12 710 11 970 11 172 218 771 207 194 193 856 290 523 268 163 247 517 20-25 6 677 7 248 7 244 147 772 161 294 161 311 173 896 187 984 191 057 25-30 3 364 4 143 4 430 91 271 112 886 121 005 97 680 120 265 130 901 30-40 2 674 3 669 4 168 90 726 124 930 142 266 87 709 119 097 142 628 0 40-50 875 1 351 1 591 38 672 59 904 70 501 32 214 50 956 61 914 50-70 507 728 921 28 849 41 226 52 672 23 172 32 761 42 707 70-100 127 166 209 10 371 13 287 17 021 7 414 9 490 13 290 > 100 50 56 77 7 802 9 339 11 444 6 315 6 005 8 025 Total 92 815 79 479 70 537 1 068 490 1 082 876 1 072 492 1 429 759 1 336 189 1 299 511 Quelle: BFS
Tabelle 2
Entwicklung der Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft
A N H A N G A3
Kategorie Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte Total 1990 1996 2000 1990 1996 2000 1990 1996 2000 Betriebsleiter Männer 62 720 59 560 49 339 26 169 20 831 25 385 88 889 80 391 74 724 Frauen 1 456 1 505 524 2 470 1 375 1 822 3 926 2 880 2 346 Andere Familieneigene Männer 21 796 13 828 8 749 22 729 25 118 18 212 44 525 38 946 26 961 Frauen 14 367 22 043 14 281 65 770 36 634 47 665 80 137 58 677 61 946 Familieneigene total 100 339 96 936 72 893 117 138 83 958 93 084 217 477 180 894 165 977 Familienfremde Schweizer/innen Männer 12 453 11 435 10 836 2 949 6 188 5 125 15 402 17 623 15 961 Frauen 3 200 2 851 2 592 3 304 4 976 4 194 6 504 7 827 6 786 Ausländer/innen Männer 10 910 8 726 8 061 1 758 4 949 3 454 12 668 13 675 11 515 Frauen 663 1 528 1 613 847 3 602 1 941 1 510 5 130 3 554 Familienfremde total 27 226 24 540 23 102 8 858 19 715 14 714 36 084 44 255 37 816 Beschäftigte total 127 565 121 476 95 995 125 996 103 673 107 798 253 561 225 149 203 793 Quelle: BFS
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Märkte
A4 A N H A N G
Tabelle 3
Nutzfläche
Nutzungsarten Produkt 1990/92 1999 2000 2001 1 1990/92–1999/2001 ha ha ha ha % Getreide 207 292 182 257 182 671 179 576 -12 4 Brotgetreide 102 840 97 542 99 260 95 018 -5 4 Weizen 96 173 92 861 94 109 89 682 -4 1 Dinkel 2 160 1 221 1 467 2 019 -27 3 Roggen 4 432 3 433 3 643 3 284 -22 1 Mischel von Brotgetreide 75 27 41 33 -55 1 Futtergetreide 104 453 84 715 83 411 84 558 -19 4 Gerste 59 695 48 942 45 741 43 845 -22 6 Hafer 10 434 5 866 5 067 3 923 -52 5 Mischel von Futtergetreide 238 211 291 244 4 5 Körnermais 25 739 21 647 22 006 24 329 -12 0 Triticale 8 347 8 049 10 306 12 217 22 1 Hülsenfrüchte 2 258 2 950 2 892 3 270 34 5 Futtererbsen (Eiweisserbsen) 2 112 2 680 2 581 2 919 29 1 Ackerbohnen 146 270 275 300 92 5 Lupinen 36 51Hackfrüchte 36 385 34 429 34 775 34 073 -5 4 Kartoffeln (inkl Saatgut) 18 333 13 740 14 153 13 785 -24 2 Zuckerrüben 14 308 17 450 17 725 17 757 23 3 Futterrüben (Runkeln, Halbzuckerrüben) 3 744 3 239 2 897 2 531 -22 8 Ölsaaten 18 203 18 914 17 618 17 022 -1 9 Raps 16 730 14 865 13 112 12 014 -20 3 Sonnenblumen - 1 776 3 554 4 541 Soja 1 474 2 273 952 467 -16 5 Nachwachsende Rohstoffe - 1 728 1 413 1 280 Raps - 1 576 1 231 1 115 Andere (Kenaf, Hanf, usw ) - 152 182 165 Freilandgemüse 8 250 8 189 8 459 8 390 1 2 Silo- und Grünmais 38 204 40 475 40 486 41 252 6 6 Grün- und Buntbrache 319 3 424 2 510 3 514 888 3 Übrige offene Ackerfläche 830 1 581 1 726 1 743 104 1 Offenes Ackerland 311 741 293 947 292 550 290 188 -6 3 Kunstwiesen 94 436 115 933 115 490 118 544 23.5 Übrige Ackerfläche 3 977 3 009 2 918 2 788 -27 0 Ackerland Total 410 154 412 889 410 958 411 520 0 4 Obstbaumkulturen 7 162 7 172 6 984 6 937 -1 8 Reben 14 987 15 042 15 043 15 086 0 5 Chinaschilf 3 260 267 255 8588 9 Naturwiesen, Weiden 638 900 626 799 629 416 627 338 -1 7 Andere Nutzung sowie Streue- und Torfland 7 394 9 737 9 824 9 994 33 2 Landwirtschaftliche Nutzfläche 1 078 600 1 071 899 1 072 492 1 071 130 -0 6 1 provisorisch Quellen: SBV, BFS
Landwirtschaftliche
nach
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1998/2001
Quellen:
Milch und -produkte: SBV (1990–98) ab 1999 TSM
Fleisch: Proviande
Eier: GalloSuisse
Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV, alle Mengen 2001 provisorisch
Obst: Schweizerischer Obstverband Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein: BLW Kantone
A N H A N G A5 Tabelle 4 Produktion Produkt Einheit 1990/1992 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Milch und -produkte Konsummilch t 549 810 438 000 508 918 505 048 -12 0 Rahm t 68 133 70 400 67 770 67 997 0 9 Butter t 38 766 37 238 36 611 41 904 -0 5 Milchpulver t 35 844 35 534 42 361 44 527 13 8 Käse t 134 400 134 306 167 382 172 218 17 5 Fleisch und Eier Rindfleisch t SG 130 710 110 435 95 700 102 824 -21 2 Kalbfleisch t SG 36 656 36 419 32 619 35 036 -5 4 Schweinefleisch t SG 266 360 225 657 224 901 234 298 -14 3 Schaffleisch t SG 5 065 6 316 5 528 5 904 16 8 Ziegenfleisch t SG 541 494 550 572 -0 4 Pferdefleisch t SG 1 212 1 196 1 265 1 138 -1 0 Geflügel t Verkaufsgewicht 20 733 26 367 28 406 28 703 34 2 Schaleneier Mio St 638 680 685 680 6 8 Getreide Weichweizen t 546 733 489 813 561 164 496 400 -5 7 Roggen t 22 978 18 538 22 404 18 700 -13 5 Gerste t 341 774 254 093 274 107 245 200 -24 6 Hafer t 52 807 27 996 26 295 19 800 -53 2 Körnermais t 211 047 194 321 212 391 217 600 -1 4 Triticale t 43 940 43 779 64 080 71 300 35 9 Andere t 11 469 6 678 9 023 10 600 -23 6 Hackfrüchte Kartoffeln t 833 333 484 000 600 636 527 000 -35 5 Zuckerrüben t 925 867 1 187 334 1 409 959 1 050 000 31 3 Ölsaaten Raps t 46 114 38 376 39 060 39 440 -15 5 Andere t 3 658 12 552 15 267 13 030 272 2 Obst (Tafel) Äpfel t 91 503 1 90 161 103 693 94 963 5 2 2 Birnen t- 14 808 16 081 14 397Aprikosen t 3 407 1 2 341 2 845 400 -45 3 2 Kirschen t 1 818 1 942 2 205 1 287 -18 7 2 Zwetschgen t 2 837 1 2 397 2 369 1 859 -22 2 2 Erdbeeren t 4 263 5 065 5 111 5 101 19 5 Gemüse (frisch) Karotten t 49 162 57 746 51 389 50 090 8 0 Zwiebeln t 23 505 27 529 27 368 24 201 12 2 Knollensellerie t 8 506 8 686 10 093 10 651 15 3 Tomaten t 21 830 27 384 30 932 30 606 35 8 Kopfsalat t 18 821 15 877 17 086 15 399 -14 3 Blumenkohl t 8 331 6 666 6 701 6 147 -21 9 Gurken t 8 608 8 881 8 371 8 839 1 0 Wein Rotwein hl 550 276 591 410 605 975 570 164 7 1 Weisswein hl 764 525 718 203 669 699 603 725 -13 2
Getreide,
A6 A N H A N G Tabelle 5 Produktion Milchprodukte Produkt 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 tttt% Total Käse 134 400 134 306 167 382 172 218 17 5 Frischkäse 4 387 13 093 35 101 35 909 539 0 Mozzarella - 9 634 11 582 12 136Übrige Frischkäse - 3 459 23 519 23 773Weichkäse 4 812 5 851 6 618 6 978 34 7 Tommes 1 249 1 054 737 1 038 -24 5 Weissschimmelkäse, halb- bis vollfett 1 573 1 909 2 141 2 377 36 2 Übrige Weichkäse 1 990 2 888 3 740 3 563 70 7 Halbhartkäse 40 556 44 293 45 928 48 164 13 7 Appenzeller 8 725 8 878 8 813 8 790 1 2 Tilsiter 7 736 6 103 6 260 6 167 -20 2 Raclettekäse 9 898 11 123 12 993 14 265 29 3 Übrige Halbhartkäse 14 197 18 189 17 862 18 942 29 1 Hartkäse 84 629 70 824 79 240 80 524 -9 2 Emmentaler 56 588 41 637 45 325 45 657 -21 9 Gruyère 22 464 24 566 26 209 27 041 15 5 Sbrinz 4 659 3 090 3 303 3 041 -32 5 Übrige Hartkäse 918 1 531 4 403 4 785 289 2 Spezialprodukte 1 15 245 494 643 2971 1 Total Frischmilchprodukte 680 822 612 900 697 769 708 851 -1 1 Konsummilch 549 810 438 000 508 918 505 048 -12 0 Übrige 131 012 174 900 188 851 203 802 44 4 Total Butter 38 766 37 238 36 611 41 904 -0.5 Vorzugsbutter 27 200 33 222 7 142 7 516 -41 3 Übrige 11 566 4 016 29 469 34 388 95 6 Total Rahm 68 133 70 400 67 770 67 997 0 9 Total Milchpulver 35 844 35 534 42 361 44 527 13 8 1 reiner Schafkäse und reiner Ziegenkäse Quellen: SBV (1990–98), ab 1999 TSM Tabelle 6 Verwertung der vermarkteten Milch Produkt 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 1 000 t Milch 1 000 t Milch 1 000 t Milch 1 000 t Milch % Konsummilch 549 438 462 461 -17 4 Verarbeitete Milch 2 490 2 633 2 714 2 749 8 4 zu Käse 1 531 1 503 1 410 1 420 -5 7 zu Butter 356 337 459 465 18 1 zu Rahm 430 460 252 259 -24 7 andere Milchprodukte 173 333 593 605 195 0 Total 3 039 3 071 3 176 3 209 3.7 Quellen: SBV (1990–98) ab 1999 TSM
1 Brotgetreideverwertung pro Kalenderjahr
2 Durchschnitt der Jahre 1990/93
3 Veränderung 1990/93–1998/2001
4 Daten sind erst im Jahr 2003 verfügbar
5 Veränderung 1990/93–1997/2000 n v : nicht verfügbar
Quellen: Brotgetreide: BLW
Kartoffeln: Eidgenössische Alkoholverwaltung, swisspatat
Mostobst: BLW; Spirituosen: Eidgenössische Alkoholverwaltung
Verarbeitungsgemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
A N H A N G A7
Verwertung der Ernte im Pflanzenbau Produkt 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 tttt% Brotgetreide 1 Übernahme Bund 569 000 460 894 547 100 n v -40 9 Lagerveränderung - 26 333 - 11 800 0 n v -85 1 Menschliche Ernährung 399 000 389 700 391 900 n v -34 7 Verfütterung 196 333 171 400 155 200 n v -44 6 Kartoffeln Speisekartoffeln 285 300 170 700 167 600 167 400 -40 9 Veredlungskartoffeln 114 700 121 900 120 900 120 900 5 7 Saatgut 35 933 27 000 31 200 25 000 -22 8 Frischverfütterung 225 967 8 181 600 145 000 -51 8 Verarbeitung zu Futtermitteln 146 900 23 400 76 000 62 000 -63 4 Schweizer Mostäpfel und -birnen (Verarbeitung in gewerblichen Mostereien) 183 006 2 103 609 256 352 97 556 5 6 3 Mostobst-Menge für Rohsaft 182 424 2 103 173 256 143 97 252 5 8 3 Frisch ab Presse 10 477 2 7 620 8 621 7 939 -22 2 3 Obstwein zur Herstellung von Obstbrand 3 297 2 548 806 64 -62 4 3 Konzentratsaft 165 263 2 92 398 246 482 87 553 9 3 3 Andere Säfte (inkl Essig) 3 387 2 2 606 235 1 696 -8 7 3 Obst eingemaischt 582 2 436 209 304 -49 4 3 Spirituosenerzeugung aus Schweizer Äpfel und Birnen 40 255 2 23 458 26 259 4 -27 6 5 aus Schweizer Kirschen und Zwetschgen 23 474 2 11 938 13 808 4 -33 9 5 Schweizer Frischgemüse für Nährmittelherstellung Tiefkühlgemüse 26 061 26 855 26 209 24 105 -1 3 Konservengemüse (Bohnen, Erbsen, Pariserkarotten) 19 776 15 258 15 770 15 111 -22 2 Sauerkraut (Einschneidekabis) 8 091 5 894 6 885 5 812 -23 4 Sauerrüben (Rübe) 1 535 1 182 1 117 1 059 -27 1
Tabelle 7
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1998/2001
Milch und -produkte, Eier, Getreide, Hackfrüchte, Ölsaaten, Obst, Gemüse und Wein: OZD
Fleisch: Proviande
Zucker: Treuhandstelle Schweizerischer Lebensmittelimporteure
A8 A N H A N G Tabelle 8 Aussenhandel Produkt 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 tttt% Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Milch und -produkte Milch 19 23 007 30 22 795 24 23 017 6 22 902 3 6 -0 4 Joghurt 1 195 17 1 156 110 2 694 101 3 981 151 118 4 609 8 Rahm 909 25 1 559 6 1 509 166 677 224 37 3 421 7 Butter 0 4 154 17 4 987 31 7 370 5 5 529 - 43 5 Milchpulver 8 158 3 266 17 768 2 584 13 992 1 606 4 905 784 49 8 -49 2 Käse 62 483 27 328 63 359 31 208 53 880 30 829 53 099 31 245 -9 1 13 8 Fleisch und Eier Rindfleisch 1 994 9 668 3 644 10 024 2 645 12 824 4 384 7 502 78 4 4 6 Kalbfleisch 0 916 0 1 345 0 2 007 0 540 - 41 7 Schweinefleisch 1 055 4 185 754 14 999 780 15 653 1 289 9 274 -10 8 218 0 Schaffleisch 5 6 093 0 5 611 0 7 616 0 6 332 -100 0 7 0 Ziegenfleisch 0 403 0 413 0 453 0 268 - -6 3 Pferdefleisch 0 4 609 0 3 884 0 3 922 0 4 378 - -11 9 Geflügel 8 35 238 448 37 562 324 38 348 139 42 724 3860 9 12 2 Eier 0 31 401 0 23 281 0 23 579 0 25 411 - -23 3 Getreide Weizen 6 232 134 86 249 619 25 298 922 72 259 413 856 5 16 0 Roggen 0 3 057 0 10 233 3 10 435 0 2 794 - 155 9 Gerste 436 44 504 1 11 491 0 74 732 3 32 750 -99 7 -10 9 Hafer 131 60 885 0 23 411 0 45 863 3 52 032 -99 2 -33 6 Körnermais 194 60 512 78 29 428 68 24 981 24 14 687 -70 7 -61 9 Hackfrüchte Kartoffeln 9 695 8 722 1 702 42 361 818 39 142 1 546 22 995 -86 0 299 4 Zucker 41 300 124 065 119 084 137 404 140 971 178 106 150 648 177 225 231 5 32 4 Ölsaaten Ölsaaten 453 135 456 830 135 408 923 136 229 595 109 651 72 6 -6 2 Pflanzliche Öle und Fette 18 680 57 765 15 426 84 021 18 127 86 735 1 942 97 022 -36 7 54 5 Obst (frisch) Äpfel 683 1 12 169 1 3 125 6 295 367 9 164 2 227 7 515 116 1 2 -33 5 2 Birnen 491 1 11 803 1 369 8 529 141 7 857 167 9 057 -56 5 2 -23 5 2 Aprikosen 226 1 10 578 1 3 12 199 62 9 322 5 9 661 -86 1 2 -5 4 2 Kirschen 256 1 1 062 1 7 1 567 22 1 134 0 1 162 -70 9 2 12 7 2 Zwetschgen und Pflaumen 12 1 3 290 1 0 4 678 0 4 370 1 5 927 12 5 2 38 4 2 Erdbeeren 150 11 023 11 11 823 23 11 576 25 10 543 -86 9 2 6 Trauben 23 33 691 0 36 969 10 39 888 16 41 162 -62 9 16 8 Zitrusfrüchte 161 135 780 49 122 668 11 124 099 37 126 508 -79 9 -8 4 Bananen 85 77 896 0 74 554 0 72 334 0 73 429 -100 0 -5 7 Gemüse (frisch) Karotten 71 1 710 185 5 867 21 6 089 0 7 590 -3 3 280 9 Zwiebeln 862 3 444 3 5 644 0 4 756 1 6 668 -99 8 65 2 Knollensellerie 0 206 0 831 0 119 0 22 0 0 57 0 Tomaten 402 35 700 56 42 138 41 42 392 7 43 442 -91 4 19 5 Kopfsalat 37 3 954 1 3 244 0 2 453 10 2 889 -90 0 -27 6 Blumenkohl 11 9 985 0 9 503 3 9 261 0 8 845 -91 2 -7 8 Gurken 65 17 479 0 17 996 2 17 225 37 16 728 -79 9 -0 9 Wein (Trinkwein) Rotwein (in hl) 3 499 1 494 294 8 814 1 474 733 7 470 1 424 552 7 359 1 421 051 125 3 -2 7 Weisswein (in hl) 7 590 76 835 4 681 175 844 5 174 177 643 6 095 225 214 -30 0 151 1
Quellen:
A N H A N G A9 Tabelle 9 Aussenhandel Käse Produkt 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 tttt% Einfuhr Frischkäse 1 4 175 8 485 8 491 8 616 104 3 Reibkäse 2 233 333 312 342 41 4 Schmelzkäse 3 2 221 2 550 2 527 2 415 12 4 Schimmelkäse 4 2 276 2 414 2 346 2 374 4 5 Weichkäse 5 6 628 5 618 5 664 5 808 -14 1 Halbhartkäse 6 11 795 5 234 4 617 4 350 Hartkäse 7 6 574 6 872 7 340 -1 2 Total Käse und Quark 27 328 31 208 30 829 31 245 13 8 Ausfuhr Frischkäse 1 2 10 29 43 1260 0 Reibkäse 2 104 156 130 73 14 8 Schmelzkäse 3 8 245 6 733 6 020 5 147 -27 6 Schimmelkäse 4 09 16 7Weichkäse 5 30 50 64 109 146 5 Halbhartkäse 6 54 102 6 944 7 033 7 753 Hartkäse 7 49 457 40 588 39 967 -5 2 Total Käse und Quark 62 483 63 359 53 880 53 099 -9 1 1 0406 1010 0406 1020 406 1090 2 0406 2010, 0406 2090 3 0406 3010 0406 3090 4 0406 4010, 0406 4021, 0406 4029, 0406 4081, 0406 4089 5 0406 9011 0406 9019 6 0406 9021, 0406 9031, 0406 9051, 0406 9091 7 0406 9039 0406 9059 0406 9060 0406 9099 Quelle: OZD
und -produkte, Eier, Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV, 2001 teilweise provisorisch
Proviande
BWL
A10 A N H A N G Tabelle 10 Pro-Kopf-Konsum Produkt 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 kg kg kg kg % Milch und -produkte Konsummilch 104 37 86 60 88 80 87 80 -15 9 Rahm 6 43 6 70 6 20 6 60 1 0 Butter 6 20 5 90 5 90 5 40 -7 5 Käse 14 73 15 60 16 60 18 40 14 5 Frischkäse 1 50 2 90 3 30 4 50 137 8 Weichkäse 1 83 1 80 1 90 1 90 1 8 Halbhartkäse 6 17 5 60 5 50 5 80 -8 6 Hartkäse 5 20 5 30 5 90 6 20 11 5 Fleisch und Eier Rindfleisch 13 71 11 53 10 30 9 73 -23 3 Kalbfleisch 4 25 4 08 3 73 3 76 -9 3 Schweinefleisch 29 73 25 63 25 43 25 27 -14 4 Schaffleisch 1 42 1 43 1 54 1 53 5 6 Ziegenfleisch 0 12 0 11 0 12 0 10 -8 3 Pferdefleisch 0 75 0 62 0 62 0 67 -15 1 Geflügel 8 05 8 71 9 04 9 62 13 3 Schaleneier (in St ) 199 195 185 188 -4 9 Getreide Brot- und Backwaren 50 70 52 70 51 70 48 50 0 5 Hackfrüchte Kartoffeln und Kartoffelprodukte 44 17 53 80 58 00 58 00 28 1 Zucker (inkl Zucker in Verarbeitungsprodukten) 42 37 41 70 47 10 43 50 4 1 Ölsaaten Pflanzliche Öle und Fette 12 80 14 3 16 20 16 00 21 1 Obst (Tafel) Äpfel 15 26 1 12 96 15 62 13 92 -5 0 2 Birnen - 3 16 3 31 3 23Aprikosen 2 04 1 2 02 1 68 1 40 -16 9 2 Kirschen 0 39 1 0 35 0 46 0 34 -1 3 2 Zwetschgen und Pflaumen 0 91 1 0 98 0 94 1 08 5 5 2 Erdbeeren 2 24 2 34 2 31 2 17 1 5 Zitrusfrüchte 20 09 17 03 17 23 17 57 -14 0 Bananen 11 53 10 35 10 05 10 20 -11 5 Gemüse (frisch) Karotten 7 53 8 81 7 98 8 01 9 8 Zwiebeln 3 86 4 61 4 46 4 29 15 2 Knollensellerie 1 29 1 32 1 42 1 48 9 0 Tomaten 8 46 9 65 10 18 10 28 18 6 Kopfsalat 3 37 2 66 2 71 2 54 -21 7 Blumenkohl 2 71 2 25 2 22 2 08 -19 5 Gurken 2 97 2 78 2 75 2 79 -6 6 Wein Rotwein (in l) 31 97 28 70 28 80 28 60 -10 2 Weisswein (in l) 14 47 12 80 12 70 12 40 -12 7 Wein total (in l) 46 43 41 50 41 50 41 00 -11 0 1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 2 Veränderung 1990/93–1998/2001 Quellen: Milch
Fleisch:
Getreide:
Obst, Gemüse und Wein:
BLW
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1998/2001
3 Restzahlung nicht berücksichtigt, effektiver Preis 10% bis 15% höher
Quellen:
Milch: BLW
Schlachtvieh, Geflügel, Eier: SBV
Getreide, Hackfrüchte und Ölsaaten: FAT
Obst: Schweizerischer Obstverband, Interprofession des fruits et légumes du Valais
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
A N H A N G A11 Tabelle 11 Produzentenpreise Produkt Einheit 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Milch CH gesamt Rp /kg 104 97 80 93 79 41 79 90 -23 7 Verkäste Milch (erst ab 1999) Rp /kg - 79 96 79 14 79 73Biomilch (erst ab 1999) Rp /kg - 91 55 94 05 95 32Schlachtvieh Kühe T3 Fr / kg SG 7 82 4 39 6 54 4 53 -34 1 Kühe X3 Fr / kg SG 7 53 3 03 5 02 2 86 -51 7 Jungkühe T3 Fr / kg SG 8 13 5 52 7 73 5 62 -22 6 Muni T3 Fr / kg SG 9 28 7 67 8 85 6 85 -16 1 Ochsen T3 Fr / kg SG 9 83 7 34 8 79 6 50 -23 2 Rinder T3 Fr / kg SG 8 66 7 11 8 67 6 61 -13 8 Kälber T3 Fr / kg SG 14 39 10 84 13 13 12 03 -16 6 Fleischschweine Fr / kg SG 5 83 4 37 4 69 4 54 -22 2 Lämmer bis 40 kg, T3 Fr / kg SG 15 40 11 74 12 60 12 38 -20 5 Geflügel und Eier Poulets Kl I, ab Hof Fr / kg LG 3 72 2 84 2 81 2 76 -24 6 Eier aus Bodenhaltung an Läden Fr /100 St 41 02 42 86 42 21 40 98 2 4 Eier aus Freilandhaltung an Läden Fr /100 St 46 21 49 01 52 34 47 05 7 0 Eier, verkauft an Sammelstelle >53 g Fr /100 St 33 29 22 21 21 46 23 12 -33 1 Getreide Weizen Fr /100 kg 99 34 75 41 66 35 55 65 -33 8 Roggen Fr /100 kg 102 36 62 77 51 82 50 91 -46 1 Gerste Fr /100 kg 70 24 48 83 48 52 45 08 -32 4 Hafer Fr /100 kg 71 40 48 83 48 23 45 22 -33 6 Triticale Fr /100 kg 70 69 49 44 48 61 46 33 -31 9 Körnermais Fr /100 kg 73 54 51 91 47 65 43 33 -35 2 Hackfrüchte Kartoffeln Fr /100 kg 38 55 37 76 36 12 35 50 -5 4 Zuckerrüben Fr /100 kg 14 84 11 85 11 58 13 42 -17 2 Ölsaaten Raps Fr /100 kg 203 67 146 11 61 26 3 70 00 -54 6 Sonnenblumen Fr /100 kg - 159 44 69 11 3 81 64Obst Äpfel: Golden Delicious I Fr / kg 1 12 1 1 06 0 86 1 04 -20 5 2 Äpfel: Idared I Fr / kg 0 98 1 0 82 0 55 0 70 -35 7 2 Birnen: Conférence Fr / kg 1 33 1 1 09 0 88 1 17 -26 3 2 Aprikosen Fr / kg 2 09 1 2 66 2 17 3 69 29 2 2 Kirschen Fr / kg 3 20 1 3 05 3 30 3 50 2 7 2 Zwetschgen: Fellenberg Fr / kg 1 40 1 1 40 1 50 1 85 9 8 2 Erdbeeren Fr / kg 4 77 4 80 4 80 5 50 5 6 Gemüse Karotten (Lager) Fr / kg 1 09 1 05 1 15 1 20 4 0 Zwiebeln (Lager) Fr / kg 0 89 0 96 1 02 1 19 18 7 Knollensellerie (Lager) Fr / kg 1 62 1 84 1 63 1 72 6 6 Tomaten rund Fr / kg 2 42 1 92 2 15 1 90 -17 8 Kopfsalat Fr / kg 2 37 2 89 2 72 3 47 27 7 Blumenkohl Fr / kg 1 85 1 88 1 88 2 08 5 4 Salatgurken Fr / kg 1 66 1 73 1 97 2 02 15 1
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1998/2001
Milch, Fleisch: BLW
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte: BLW, BFS
A12 A N H A N G Tabelle 12 Konsumentenpreise Produkt Einheit 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Milch und -produkte Vollmilch, pasteurisiert,verpackt Fr /l 1 85 1 58 1 55 1 55 -15 7 Milchdrink, pasteurisiert, verpackt Fr /l 1 85 1 58 1 54 1 55 -15 9 Magermilch UHT Fr /l - 1 48 1 42 1 45Emmentaler Fr /kg 20 15 20 66 20 18 20 59 1 6 Greyerzer Fr /kg 20 40 20 67 20 17 20 37 0 0 Tilsiter Fr /kg - 17 49 17 47 17 72Camembert 45% (FiT) 125 g - 2 54 2 54 2 70Weichkäse Schimmelreifung 150 g - 3 34 3 36 3 51Mozzarella 45% (FiT) 150 g - 2 32 2 30 2 34Vorzugsbutter 200 g 3 46 2 89 2 97 3 13 -13 4 Die Butter (Kochbutter) 250 g 3 44 2 92 2 94 3 03 -13 9 Vollrahm, verpackt 1⁄2 l- 5 19 4 83 4 92Kaffeerahm, verpackt 1⁄2 l- 2 62 2 49 2 52Jogurt, aromatisiert oder mit Früchten 180 g 0 89 0 71 0 69 0 69 -21 7 Rindfleisch Entrecôte, geschnitten Fr /kg 48 36 45 68 50 14 48 10 -0 8 Plätzli, Eckstück Fr /kg 37 59 34 76 39 24 37 42 -1 2 Braten, Schulter Fr /kg 26 34 24 09 27 73 25 96 -1 6 Hackfleisch Fr /kg 15 00 13 42 15 29 15 49 -1 8 Kalbfleisch Koteletten, geschnitten Fr /kg 35 32 35 84 40 77 40 40 10 4 Braten, Schulter Fr /kg 32 56 30 80 34 96 33 86 2 0 Voressen Fr /kg 21 67 24 67 28 68 28 30 25 6 Schweinefleisch Koteletten, geschnitten Fr /kg 19 88 18 26 19 80 20 74 -1 4 Plätzli, Eckstück Fr /kg 24 48 22 38 24 58 26 22 -0 3 Braten, Schulter Fr /kg 18 43 16 75 18 60 19 31 -1 1 Voressen, Schulter Fr /kg 16 69 15 75 17 39 18 34 2 8 Lammfleisch Inland frisch Gigot ohne Schlossbein Fr /kg 26 34 27 10 27 15 27 71 3 7 Koteletten, geschnitten Fr /kg 30 32 31 57 32 66 34 23 8 2 Fleischwaren Hinterschinken, Model geschnitten Fr /kg 25 56 26 18 27 13 28 49 6 7 Salami Inland I, geschnitten Fr /100 g 3 09 3 42 3 75 3 81 18 5 Poulets Inland, frisch Fr /kg 8 41 8 43 8 49 9 13 3 2 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte Weissmehl Fr /kg 2 05 1 80 1 75 1 67 -15 1 Ruchbrot Fr /500 g 2 08 1 98 1 82 1 76 -10 9 Halbweissbrot Fr /500 g 2 09 2 02 1 83 1 75 -10 7 Weggli Fr / St 0 62 0 75 0 70 0 69 15 1 Gipfeli Fr / St 0 71 0 89 0 84 0 83 20 2 Spaghetti Fr /500 g 1 66 1 43 1 54 1 65 -7 2 Kartoffeln Fr / kg 1 43 1 77 1 87 2 03 32 2 Kristallzucker Fr / kg 1 65 1 50 1 41 1 42 -12 5 Sonnenblumenöl Fr /l 5 05 4 46 3 96 3 75 -19 7 Obst (Herkunft In- und Ausland) Äpfel: Golden Delicious Fr / kg 3 15 1 2 98 3 40 3 41 2 3 2 Birnen Fr / kg 3 25 1 3 26 3 36 3 46 3 1 2 Aprikosen Fr / kg 3 93 1 4 24 4 69 5 54 22 1 2 Kirschen Fr / kg 7 35 1 8 13 8 89 10 46 21 5 2 Zwetschgen Fr / kg 3 42 1 3 22 3 46 4 04 3 7 2 Erdbeeren Fr / kg 8 69 9 44 9 59 9 98 11 3 Gemüse (Frischkonsum; Herkunft In- und Ausland) Karotten (Lager) Fr / kg 1 91 1 78 1 78 2 11 -1 0 Zwiebeln (Lager) Fr / kg 1 86 2 03 1 94 2 29 12 2 Knollensellerie (Lager) Fr / kg 3 14 3 67 3 36 3 47 11 5 Tomaten rund Fr / kg 3 73 3 18 3 50 3 21 -11 6 Kopfsalat Fr / kg 4 46 5 15 5 25 5 83 21 3 Blumenkohl Fr / kg 3 58 3 59 3 58 4 15 -0 8 Salatgurken Fr / kg 2 80 2 86 3 14 3 10 8 3
Quellen:
1 inkl Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide, jedoch ohne Ölkuchen; ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 einschliesslich Hartweizen, Speisehafer, Speisegerste und Mais
3 Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche
4 Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5 einschliesslich Fleisch von Pferden, Ziegen, Kaninchen sowie Wildbret, Fische, Krusten- und Weichtiere
6 verdauliche Energie in Joules, alkoholische Getränke eingeschlossen
7 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen, Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
Quelle: SBV
A N H A N G A13 Tabelle 13 Selbstversorgungsgrad Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Mengenmässiger Anteil: %%%% Brotgetreide 118 120 99 89 -15 Futtergetreide 1 61 73 70 76 12 Getreide total 2 64 69 62 62 0 Speisekartoffeln 101 100 82 99 -7 Zucker 46 60 58 63 14 Pflanzliche Fette, Öle 22 21 18 18 -3 Obst 3 72 82 68 80 5 Gemüse 55 54 52 51 -3 Konsummilch 97 97 97 97 0 Butter 89 92 88 85 -1 Käse 137 126 123 116 -15 Milch und Milchprodukte total 110 110 111 110 0 Kalbfleisch 4 97 98 95 92 -2 Rindfleisch 4 93 92 88 85 -5 Schweinefleisch 4 99 93 92 92 -7 Schaffleisch 4 39 43 46 35 2 Geflügel 4 37 39 42 43 4 Fleisch aller Arten 45 76 71 70 68 -6 Eier und Eikonserven 44 49 47 48 4 Energiemässiger Anteil 6: Pflanzliche Nahrungsmittel 43 47 40 46 1 Tierische Nahrungsmittel brutto 97 95 95 95 -2 Nahrungsmittel im ganzen brutto 60 64 58 62 1 Nahrungsmittel im ganzen netto 7 58 56 54 57 -2 Wertmässiger Anteil Nahrungsmittel im ganzen 8 72 65 63 63 -8
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse
A14 A N H A N G
Tabelle 14 Endproduktion der Landwirtschaft zu laufenden Preisen, in 1000 Fr Produkt 1990/92 1999 2000 1 2001 2 1990/92 – 2002 3 1999/2001–1999/2001 2002 %% Getreide 807 539 515 434 540 884 471 000 -37 0 475 000 -6 7 Hülsenfrüchte 1 318 976 980 800 -30 3 3 000 226 6 Kartoffeln 231 342 165 299 169 745 164 000 -28 1 164 000 -1 4 Zuckerrüben 141 784 139 138 159 720 138 800 2 9 158 000 8 3 Ölsaaten (Raps, Soja, Sonnenblumen) 102 033 78 658 36 504 39 000 -49 6 55 000 7 0 Tabak 16 945 16 554 17 984 20 000 7 3 20 000 10 0 Gemüse 379 455 404 782 444 456 435 000 12 8 450 000 5 1 Obst und Beeren 371 296 293 403 359 973 298 000 -14 6 335 000 5 6 Futterpflanzen (Heu, Silomais, Grünfutter, ) 14 077 - 8 445 33 954 - 3 000 -46 7 10 000 Nebenprodukte der pflanz Produktion 14 044 12 395 17 839 14 000 5 0 16 000 8 5 Weinmost 586 831 561 136 550 618 505 000 -8 2 485 000 -10 0 Übriger Pflanzenbau 14 144 10 575 11 544 10 000 -24 3 11 000 2 7 Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse 2 680 807 2 189 905 2 344 201 2 092 600 -17 6 2 182 000 -1 2 Rindvieh 1 580 377 944 200 1 126 055 960 000 -36 1 970 000 -4 0 Schweine 1 556 531 973 763 1 040 716 1 046 000 -34 5 1 025 000 0 5 Einhufer (Pferde, Esel, Maultiere) 20 475 15 519 3 890 5 900 -58 8 7 000 -17 0 Schafe 71 810 59 367 57 376 61 000 -17 5 58 000 -2 1 Ziegen 4 906 4 074 4 409 3 700 -17 2 3 900 -4 0 Geflügel (Poulets, Truten, Enten, Gänse) 186 808 177 038 184 176 188 000 -2 0 192 000 4 9 Übrige Tiere (Kaninchen, Bienenvölker) 26 010 17 066 17 920 17 000 -33 4 16 000 -7 7 Milch 3 461 227 2 572 583 2 566 908 2 598 000 -25 5 2 580 000 0 0 Eier 207 617 154 644 146 313 153 500 -27 0 171 000 12 9 Wolle 507 000 -100 0 0 Honig 47 917 37 667 41 030 55 000 -7 0 45 000 1 0 Übrige tierische Erzeugnisse 5 042 3 971 3 954 4 400 -18 5 4 000 -2 6 Tiere und tierische Erzeugnisse 7 169 228 4 959 892 5 192 747 5 092 500 -29 1 5 071 900 -0 2 Lohnarbeiten auf der landw Erzeugerstufe 52 400 90 420 90 420 90 000 72 3 90 000 -0 3 Endproduktion total 9 902 435 7 240 217 7 627 368 7 275 100 -25.5 7 343 900 -0.5 1 provisorisch Stand Winter 2001/2002 2 Schätzung, Stand Winter 2001/2002 3 Schätzung Stand Sommer 2002 Quelle: SBV
1 Wenn die Mwst auf den Verkäufen landwirtschaftlicher Produkte nicht gleich hoch ist wie die auf den Ankäufen von Vorleistungen und Investitionsgütern bezahlten Steuern, wird sie in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgeglichen Wurde auf der Produktionsseite mehr als auf der Kostenseite verrechnet, wird diese Überkompensation als zusätzliche Einnahmequelle betrachtet Bis jetzt war in der Schweiz immer eine Unterkompensation zu verzeichnen
2 inkl stationäre Einrichtungen
3 provisorisch, Stand Winter 2001/2002
4 Schätzung, Stand Winter 2001/2002
5 Schätzung, Stand Sommer 2002
A N H A N G A15 Tabelle 15 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung zu laufenden Preisen, in 1000 Fr Merkmal 1990/92 1999 2000 3 2001 4 1990/92– 2002 5 1999/2001–1999/2001 2002 %% Endproduktion 9 902 435 7 240 217 7 627 368 7 275 100 -25 5 7 343 900 -0 5 Vorleistungen total 4 172 848 3 780 209 3 910 575 3 900 000 -7 4 3 868 000 0 1 Saat- und Pflanzgut 235 204 219 664 197 426 204 000 -12 0 195 000 -5 8 Vieh 7 535 10 862 16 134 11 000 68 1 7 000 -44 7 Energie 397 171 437 145 490 404 480 000 18 1 475 000 1 2 Düngemittel 243 903 147 004 142 553 153 000 -39 5 160 000 8 5 Pflanzenschutzmittel 138 587 123 364 125 572 126 000 -9 8 125 000 0 0 Futtermittel 1 721 238 1 434 248 1 502 117 1 496 000 -14 2 1 478 000 0 0 Material und Unterhalt Maschinen 682 312 732 244 727 773 740 000 7 5 726 000 -1 0 Unterhalt Wirtschaftsgebäude 182 658 132 770 135 709 140 000 -25 5 139 000 2 1 Dienstleistungen 564 240 542 908 572 887 550 000 -1 6 563 000 1 4 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 5 729 587 3 460 008 3 716 793 3 375 100 -38 6 3 475 900 -1 2 Beiträge der öffentlichen Hand (Subventionen) 1 317 038 2 427 383 2 457 903 2 604 000 89 5 2 700 000 8 2 Überkompensation der Mwst 1 Produktionssteuern 123 433 120 824 72 298 62 000 -31 1 36 000 -57 7 Unterkompensation der Mwst 1 - 98 297 97 844 105 000 101 000 0 6 Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 6 923 192 5 668 270 6 004 554 5 812 100 -15 8 6 038 900 3 6 Abschreibungen Total 2 030 896 1 836 788 1 858 380 1 899 000 -8 2 1 883 000 1 0 Abschreibungen für Gebäude 2 1 057 197 768 363 785 586 809 000 -25 5 809 000 2 7 Abschreibungen für Maschinen 973 699 1 068 425 1 072 794 1 090 000 10 6 1 074 000 -0 3 Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 4 892 296 3 831 482 4 146 174 3 913 100 -19 0 4 155 900 4 9 Pachten und Zinsen 844 689 695 639 737 834 753 000 -13 7 736 000 1 0 Pachten 227 754 225 427 225 404 225 000 -1 1 225 000 -0 1 Zinsen 616 936 470 212 512 430 528 000 -18 4 511 000 1 5 Nettoeinkommen aus landw Tätigkeit 4 047 607 3 135 843 3 408 340 3 160 100 -20 1 3 419 900 5 7 aller in der Landwirtschaft Beschäftigten Entlöhnung der familienfremden Arbeitskräfte 827 058 728 091 716 053 720 000 -12 8 740 000 2 6 Nettoeinkommen aus landw Tätigkeit 3 220 549 2 407 752 2 692 287 2 440 100 -22 0 2 679 900 6 6 der Familienarbeitskräfte
Quelle:
SBV
Tabelle 16
Betriebsergebnisse: Alle Regionen
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A16 A N H A N G
Merkmal Einheit 1990/92 1998 1999 2000 2001 1998/2000–2001 % Referenzbetriebe Anzahl 4 302 3 861 3 494 3 419 3 067 -14 6 Vertretene Betriebe Anzahl 62 921 56 579 54 906 53 896 52 470 -4 8 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16 06 18 08 18 41 18 78 19 10 3 7 Offene Ackerfläche ha 4 90 5 11 5 08 5 17 5 17 1 0 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 88 1 73 1 70 1 70 1 68 -1 8 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 39 1 31 1 29 1 30 1 29 -0 8 Kühe total Anzahl 12 9 13 3 13 4 13 5 14 0 4 5 Tierbestand total GVE 23 2 23 6 23 5 23 8 24 7 4 5 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 606 321 680 090 689 619 716 645 732 058 5 3 davon: Umlaufvermögen total Fr 116 932 130 317 135 278 144 196 140 469 2 8 davon: Tiervermögen total Fr 60 662 40 396 41 172 44 706 45 448 8 0 davon: Anlagevermögen total Fr 428 727 509 377 513 169 527 743 546 141 5 7 davon: Aktiven Betrieb Fr 558 933 627 590 636 990 662 417 680 487 5 9 Fremdkapitalquote % 43 41 41 41 41 0 0 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 19 808 10 146 11 089 15 193 13 319 9 7 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 184 762 183 882 181 702 199 145 192 972 2 5 davon: Direktzahlungen Fr 13 594 37 667 38 872 39 307 43 162 11 8 Sachkosten Fr 91 735 104 464 102 844 108 460 114 173 8 5 Betriebseinkommen Fr 93 027 79 418 78 858 90 685 78 799 -5 0 Personalkosten Fr 13 775 12 983 12 128 12 369 12 097 -3 2 Schuldzinsen Fr 11 361 7 931 7 405 8 001 8 492 9 2 Pachtzinsen Fr 5 069 5 425 5 536 5 640 5 776 4 4 Fremdkosten Fr 121 941 130 802 127 912 134 470 140 539 7 2 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 62 822 53 079 53 789 64 675 52 434 -8 3 Nebeneinkommen Fr 16 264 18 254 18 638 19 208 18 633 -0 4 Gesamteinkommen Fr 79 086 71 333 72 427 83 883 71 067 -6 3 Privatverbrauch Fr 59 573 62 003 59 220 62 650 63 779 4 1 Eigenkapitalbildung Fr 19 513 9 330 13 207 21 233 7 288 -50 0 Investitionen und Finanzierung IInvestitionen total 2 Fr 46 914 49 585 41 856 44 964 47 469 4 4 Cashflow 3 Fr 44 456 40 398 42 238 46 043 39 389 -8 2 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 81 101 102 83 -12 3 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 66 60 66 67 60 -6 7 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 52 44 47 52 42 -11 9 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 26 21 21 25 17 -23 9 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 10 20 17 12 22 34 7 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 15 15 11 19 39 0 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 49 473 45 846 46 376 53 426 47 027 -3 1 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 5 796 4 393 4 282 4 829 4 125 -8 4 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 16 7 12 7 12 4 13 7 11 6 -10 3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % 0 8 -2 4 -2 3 -0 6 -2 7 52 8 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -2 2 -6 3 -5 9 -3 2 -6 8 32 5 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 31 025 32 854 33 050 38 099 30 356 -12 4 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 29 465 30 125 29 770 34 410 27 417 -12 8 (Median)
Tabelle 17
Betriebsergebnisse: Talregion*
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion: Ackerbauzone plus Übergangszonen
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A17
Merkmal Einheit 1990/92 1998 1999 2000 2001 1998/2000–2001 % Referenzbetriebe Anzahl 2 356 1 789 1 565 1 517 1 376 -15 3 Vertretene Betriebe Anzahl 29 677 26 275 25 499 25 094 24 183 -5 6 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16 66 18 90 19 33 19 41 19 93 3 7 Offene Ackerfläche ha 8 34 9 07 9 05 9 13 9 26 1 9 Arbeitskräfte Betrieb JAE 2 05 1 86 1 83 1 80 1 77 -3 3 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 36 1 27 1 26 1 26 1 26 -0 3 Kühe total Anzahl 12 8 13 3 13 4 13 3 13 8 3 5 Tierbestand total GVE 22 9 23 4 23 4 23 5 24 7 5 4 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 706 406 774 628 778 173 814 917 832 078 5 4 davon: Umlaufvermögen total Fr 149 871 159 909 165 188 179 657 172 076 2 3 davon: Tiervermögen total Fr 61 461 40 588 41 791 44 637 45 969 8 6 davon: Anlagevermögen total Fr 495 074 574 131 571 194 590 623 614 033 6 1 davon: Aktiven Betrieb Fr 642 757 710 317 712 424 746 171 773 158 6 9 Fremdkapitalquote % 41 40 40 39 40 0 8 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 23 633 11 839 12 686 17 549 15 362 9 5 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 225 249 224 055 218 369 242 054 233 144 2 2 davon: Direktzahlungen Fr 7 248 33 541 32 359 32 944 38 399 16 5 Sachkosten Fr 110 193 123 500 122 085 129 262 135 711 8 6 Betriebseinkommen Fr 115 056 100 555 96 284 112 792 97 433 -5 6 Personalkosten Fr 20 784 19 172 18 194 18 330 17 349 -6 6 Schuldzinsen Fr 13 463 9 073 8 424 9 051 9 835 11 1 Pachtzinsen Fr 7 015 7 425 7 698 7 673 7 796 2 6 Fremdkosten Fr 151 456 159 170 156 400 164 316 170 690 6 7 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 73 794 64 885 61 968 77 738 62 453 -8 4 Nebeneinkommen Fr 16 429 17 507 17 580 17 805 17 043 -3 3 Gesamteinkommen Fr 90 223 82 392 79 548 95 543 79 496 -7 4 Privatverbrauch Fr 67 985 70 676 66 577 69 756 70 993 2 9 Eigenkapitalbildung Fr 22 238 11 716 12 971 25 787 8 503 -49 5 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 56 951 55 734 46 615 52 271 52 828 2 5 Cashflow 3 Fr 52 079 47 108 45 807 53 548 45 267 -7 3 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 92 85 98 102 86 -9 5 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 61 64 69 61 -5 7 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 52 45 47 54 42 -13 7 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 24 20 17 23 17 -15 0 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 12 22 20 13 23 25 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 13 16 10 18 38 5 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 56 050 54 204 52 755 62 635 55 134 -2 5 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 6 908 5 321 4 981 5 810 4 889 -9 0 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 17 9 14 2 13 5 15 1 12 6 -11 7 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % 2 1 -0 7 -1 2 0 9 -1 3 290 0 Eigenkapitalsrentabilität 11 % 0 0 -3 3 -4 1 -0 5 -4 4 67 1 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 36 924 41 723 39 210 47 891 37 523 -12 6 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 36 186 39 191 36 114 44 561 34 671 -13 2 (Median)
Tabelle 18
Betriebsergebnisse: Hügelregion*
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A18 A N H A N G
Merkmal Einheit 1990/92 1998 1999 2000 2001 1998/2000–2001 % Referenzbetriebe Anzahl 1 125 1 119 1 029 1 017 907 -14 0 Vertretene Betriebe Anzahl 17 397 15 420 14 967 14 588 14 343 -4 3 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 30 17 07 17 19 17 83 17 95 3 4 Offene Ackerfläche ha 3 08 2 98 2 99 3 15 3 04 0 0 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 81 1 65 1 62 1 62 1 60 -1 8 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 40 1 29 1 28 1 29 1 26 -2 1 Kühe total Anzahl 14 4 14 8 14 7 15 3 15 8 5 8 Tierbestand total GVE 26 0 26 6 26 0 27 0 27 8 4 8 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 553 876 648 445 655 042 677 784 686 002 3 9 davon: Umlaufvermögen total Fr 95 672 114 116 116 937 122 136 122 814 4 3 davon: Tiervermögen total Fr 66 366 44 218 44 452 49 901 49 611 7 4 davon: Anlagevermögen total Fr 391 838 490 111 493 653 505 747 513 577 3 4 davon: Aktiven Betrieb Fr 516 933 595 810 602 991 626 182 628 230 3 3 Fremdkapitalquote % 46 45 45 45 44 -2 2 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 17 271 8 959 9 825 13 318 11 653 8 9 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 170 201 169 697 167 340 183 249 178 588 3 0 davon: Direktzahlungen Fr 15 415 37 258 37 996 39 135 41 649 9 2 Sachkosten Fr 85 602 99 789 96 378 102 222 108 086 8 7 Betriebseinkommen Fr 84 599 69 908 70 962 81 027 70 502 -4 7 Personalkosten Fr 9 943 9 839 9 037 9 183 9 655 3 2 Schuldzinsen Fr 10 915 8 136 7 618 8 330 8 265 3 0 Pachtzinsen Fr 3 903 4 513 4 422 4 789 5 086 11 2 Fremdkosten Fr 110 363 122 277 117 455 124 525 131 092 8 0 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 59 838 47 420 49 885 58 725 47 496 -8 7 Nebeneinkommen Fr 14 544 19 283 19 849 21 814 20 557 1 2 Gesamteinkommen Fr 74 382 66 703 69 734 80 539 68 053 -5 9 Privatverbrauch Fr 55 272 57 769 55 890 59 963 61 333 6 0 Eigenkapitalbildung Fr 19 110 8 934 13 844 20 576 6 720 -53 5 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 41 428 47 691 39 227 39 674 47 007 11 4 Cashflow 3 Fr 41 445 39 269 40 759 43 650 37 263 -9 6 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 100 82 104 110 79 -19 9 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 68 61 67 68 58 -11 2 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 50 43 46 50 43 -7 2 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 30 25 26 31 19 -30 5 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 8 15 13 8 18 50 0 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 17 15 11 20 39 5 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 46 654 42 381 43 842 50 119 44 191 -2 8 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 5 533 4 096 4 128 4 545 3 927 -7 7 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 16 4 11 7 11 8 12 9 11 2 -7 7 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % 0 4 -3 1 -2 5 -1 1 -3 3 47 8 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -3 3 -8 3 -7 0 -4 5 -8 4 27 3 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 30 335 29 714 31 292 35 336 28 458 -11 4 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 29 520 28 701 29 459 33 156 26 604 -12 6 (Median)
Tabelle 19
Betriebsergebnisse: Bergregion*
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion: Bergzonen II bis IV
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A19
Merkmal Einheit 1990/92 1998 1999 2000 2001 1998/2000–2001 % Referenzbetriebe Anzahl 821 953 900 885 784 -14 1 Vertretene Betriebe Anzahl 15 847 14 884 14 440 14 214 13 944 -3 9 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 76 17 67 18 06 18 63 18 85 4 0 Offene Ackerfläche ha 0 44 0 32 0 25 0 28 0 26 -8 2 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 63 1 60 1 57 1 60 1 60 0 6 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 42 1 38 1 37 1 39 1 38 0 0 Kühe total Anzahl 11 4 11 8 11 9 11 8 12 4 4 8 Tierbestand total GVE 20 5 20 7 21 1 21 0 21 5 2 7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 476 486 545 982 569 082 583 036 605 967 7 1 davon: Umlaufvermögen total Fr 78 573 94 862 101 469 104 230 103 814 3 6 davon: Tiervermögen total Fr 52 902 36 097 36 681 39 497 40 263 7 6 davon: Anlagevermögen total Fr 345 011 415 023 430 932 439 309 461 890 7 8 davon: Aktiven Betrieb Fr 448 089 514 474 539 022 551 742 573 520 7 2 Fremdkapitalquote % 45 41 40 40 40 -0 8 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 15 432 8 388 9 580 12 957 11 491 11 5 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 124 931 127 656 131 838 139 707 138 099 3 8 davon: Direktzahlungen Fr 23 476 45 373 51 279 50 719 52 979 7 8 Sachkosten Fr 63 905 75 698 75 569 78 140 83 081 8 6 Betriebseinkommen Fr 61 026 51 958 56 269 61 567 55 018 -2 8 Personalkosten Fr 4 860 5 316 4 619 5 116 5 500 9 6 Schuldzinsen Fr 7 918 5 704 5 386 5 808 6 397 13 6 Pachtzinsen Fr 2 707 2 837 2 872 2 922 2 986 3 8 Fremdkosten Fr 79 390 89 556 88 445 91 986 97 964 8 9 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 45 541 38 101 43 392 47 721 40 135 -6 8 Nebeneinkommen Fr 17 853 18 505 19 250 19 011 19 414 2 6 Gesamteinkommen Fr 63 394 56 606 62 642 66 732 59 549 -3 9 Privatverbrauch Fr 48 548 51 077 49 678 52 865 53 783 5 0 Eigenkapitalbildung Fr 14 846 5 529 12 964 13 867 5 766 -46 5 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 34 138 40 694 36 177 37 494 38 648 1 4 Cashflow 3 Fr 33 482 29 723 37 469 35 247 31 384 -8 1 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 98 73 104 94 81 -10 3 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 70 59 70 65 60 -7 2 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 54 44 50 51 41 -15 2 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 26 19 23 23 16 -26 2 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 8 20 15 14 25 53 1 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 17 12 12 18 31 7 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 37 418 32 445 35 950 38 532 34 399 -3 5 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 3 874 2 940 3 115 3 304 2 919 -6 4 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 13 6 10 1 10 4 11 2 9 6 -9 1 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2 3 -5 6 -4 4 -3 8 -5 1 10 9 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -7 4 -11 6 -9 2 -8 2 -10 5 8 6 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 21 201 21 498 24 747 25 064 20 809 -12 5 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 20 707 20 629 22 991 22 851 18 484 -16 6 (Median)
Tabelle 20a
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 1999/2001
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99 (vgl Anhang: Begriffe und Methoden)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A20 A N H A N G
Pflanzenbau Tierhaltung Merkmal Einheit Mittel alle Spezial- Verkehrs- Mutter- Anderes Betriebe Ackerbau kulturen milch kühe Rindvieh Referenzbetriebe Anzahl 3 327 129 79 1 340 67 154 Vertretene Betriebe Anzahl 53 757 3 337 3 361 19 535 1 528 3 755 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 76 23 03 12 68 18 29 17 36 15 47 Offene Ackerfläche ha 5 14 18 83 5 82 0 99 0 86 0 20 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 69 1 38 2 39 1 63 1 26 1 41 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 29 1 06 1 36 1 35 1 09 1 28 Kühe total Anzahl 13 6 3 4 1 8 16 1 15 7 9 4 Tierbestand total GVE 24 0 8 0 3 1 24 8 20 7 16 5 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 712 774 732 575 793 405 646 782 668 715 526 866 davon: Umlaufvermögen total Fr 139 981 162 559 238 498 116 380 121 446 96 864 davon: Tiervermögen total Fr 43 776 15 659 8 697 44 721 42 612 34 137 davon: Anlagevermögen total Fr 529 017 554 357 546 210 485 681 504 657 395 865 davon: Aktiven Betrieb Fr 659 964 687 299 729 743 602 277 635 869 495 122 Fremdkapitalquote % 41 36 32 42 40 42 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 13 200 14 915 16 702 11 795 13 068 9 813 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 191 273 206 655 245 283 157 747 128 964 114 403 davon: Direktzahlungen Fr 40 447 38 968 22 110 40 993 58 300 53 358 Sachkosten Fr 108 492 115 370 116 187 87 510 71 719 68 518 Betriebseinkommen Fr 82 781 91 285 129 096 70 237 57 245 45 885 Personalkosten Fr 12 198 10 861 40 668 7 533 5 022 3 112 Schuldzinsen Fr 7 966 7 723 7 735 7 252 6 957 5 440 Pachtzinsen Fr 5 651 8 954 7 015 4 634 2 602 1 958 Fremdkosten Fr 134 307 142 908 171 605 106 928 86 300 79 029 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 56 966 63 747 73 678 50 818 42 664 35 375 Nebeneinkommen Fr 18 826 23 260 16 360 18 092 32 510 21 567 Gesamteinkommen Fr 75 792 87 007 90 038 68 910 75 174 56 942 Privatverbrauch Fr 61 883 75 531 75 182 56 138 58 769 48 802 Eigenkapitalbildung Fr 13 909 11 476 14 856 12 772 16 405 8 140 Investitionen und Finanzierung IInvestitionen total 2 Fr 44 763 46 904 33 293 40 805 41 825 33 636 Cashflow 3 Fr 42 557 44 417 43 396 38 025 41 638 29 585 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 95 135 93 99 88 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 60 68 66 69 63 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 47 44 46 47 61 42 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 21 16 18 23 18 23 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 17 24 22 17 13 20 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 15 16 14 13 8 15 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 48 943 66 392 53 842 42 981 45 445 32 607 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 4 412 3 966 10 171 3 840 3 296 2 970 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 12 5 13 3 17 6 11 7 9 0 9 3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -1 9 0 5 -0 7 -3 2 -1 9 -6 0 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -5 3 -1 0 -2 6 -7 8 -5 0 -12 3 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 33 835 46 011 41 833 28 957 27 214 19 886 (Mittelwert)
Tabelle 20b
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 1999/2001
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99 (vgl Anhang: Begriffe und Methoden)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A21
Tierhaltung Kombiniert Pferde/ VerkehrsMerkmal Einheit Mittel alle Schafe/ milch/ MutterBetriebe Ziegen Veredlung Ackerbau kühe Veredlung Andere Referenzbetriebe Anzahl 3 327 27 51 442 23 611 404 Vertretene Betriebe Anzahl 53 757 1 145 1 180 5 860 413 6 110 7 533 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 76 13 72 11 27 24 52 22 73 19 00 19 84 Offene Ackerfläche ha 5 14 0 41 1 09 13 13 9 90 6 67 6 50 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 69 1 34 1 48 1 93 1 63 1 81 1 71 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 29 1 21 1 13 1 33 1 20 1 29 1 28 Kühe total Anzahl 13 6 2 0 11 2 18 8 19 4 15 5 14 7 Tierbestand total GVE 24 0 12 2 42 7 29 0 26 4 38 0 26 2 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 712 774 452 689 780 752 816 922 755 476 865 151 763 161 davon: Umlaufvermögen total Fr 139 981 69 317 111 800 170 657 164 925 158 920 147 047 davon: Tiervermögen total Fr 43 776 21 898 60 698 53 337 55 512 61 783 52 614 davon: Anlagevermögen total Fr 529 017 361 474 608 254 592 928 535 039 644 448 563 500 davon: Aktiven Betrieb Fr 659 964 434 635 746 702 756 890 681 046 798 668 685 400 Fremdkapitalquote % 41 41 47 41 44 42 43 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 13 200 8 689 13 594 15 145 12 889 15 795 13 279 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 191 273 93 933 265 147 242 301 210 581 268 705 198 246 davon: Direktzahlungen Fr 40 447 43 515 26 562 41 685 65 886 37 440 39 788 Sachkosten Fr 108 492 58 556 179 823 135 708 113 959 164 872 113 129 Betriebseinkommen Fr 82 781 35 377 85 324 106 593 96 622 103 833 85 117 Personalkosten Fr 12 198 2 837 10 518 17 728 14 962 15 689 12 586 Schuldzinsen Fr 7 966 5 767 11 047 9 166 8 212 10 022 8 715 Pachtzinsen Fr 5 651 1 336 2 943 9 568 11 505 6 058 6 047 Fremdkosten Fr 134 307 68 496 204 331 172 170 148 638 196 641 140 477 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 56 966 25 437 60 816 70 131 61 943 72 064 57 769 Nebeneinkommen Fr 18 826 26 154 17 665 14 112 22 493 16 601 20 062 Gesamteinkommen Fr 75 792 51 591 78 481 84 243 84 436 88 665 77 831 Privatverbrauch Fr 61 883 48 178 60 875 67 395 68 800 68 228 64 387 Eigenkapitalbildung Fr 13 909 3 413 17 606 16 848 15 636 20 437 13 444 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 44 763 31 487 29 483 57 082 46 629 58 169 49 360 Cashflow 3 Fr 42 557 26 319 51 322 50 780 45 670 55 543 43 925 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 92 211 90 103 97 89 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 58 76 62 63 67 62 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 47 44 44 47 43 50 45 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 21 18 23 20 20 21 21 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 17 15 13 17 14 15 17 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 15 23 20 16 23 14 17 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 48 943 26 434 57 603 55 300 59 369 57 504 49 764 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 4 412 2 579 7 578 4 348 4 253 5 463 4 294 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 12 5 8 1 11 5 14 1 14 2 13 0 12 4 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -1 9 -8 5 0 5 -0 7 -0 9 0 3 -1 8 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -5 3 -16 9 -1 8 -3 2 -3 8 -1 6 -5 4 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 33 835 13 906 41 908 41 315 40 765 43 432 34 628 (Mittelwert)
Tabelle 21
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Alle Regionen 1999/2001
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A22 A N H A N G
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 3 327 692 840 892 903 Vertretene Betriebe Anzahl 53 757 13 451 13 437 13 432 13 437 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 76 14 12 16 96 19 84 24 14 Offene Ackerfläche ha 5 14 2 78 3 21 5 46 9 11 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 69 1 58 1 67 1 71 1 81 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 29 1 26 1 38 1 33 1 20 Kühe total Anzahl 13 6 10 5 13 2 14 7 15 8 Tierbestand total GVE 24 0 18 6 22 4 25 3 29 7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 712 774 651 722 630 635 730 634 838 189 davon: Umlaufvermögen total Fr 139 981 105 620 117 768 150 544 186 028 davon: Tiervermögen total Fr 43 776 34 260 41 014 45 950 53 890 davon: Anlagevermögen total Fr 529 017 511 842 471 853 534 140 598 271 davon: Aktiven Betrieb Fr 659 964 609 758 588 160 671 378 770 633 Fremdkapitalquote % 41 41 42 40 41 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 13 200 12 174 11 586 13 710 15 332 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 191 273 131 001 159 258 200 165 274 736 davon: Direktzahlungen Fr 40 447 34 782 39 268 41 217 46 527 Sachkosten Fr 108 492 90 584 94 395 110 056 138 955 Betriebseinkommen Fr 82 781 40 417 64 863 90 109 135 781 Personalkosten Fr 12 198 9 547 8 547 11 468 19 233 Schuldzinsen Fr 7 966 7 738 7 165 7 805 9 156 Pachtzinsen Fr 5 651 2 955 4 359 6 175 9 117 Fremdkosten Fr 134 307 110 824 114 466 135 504 176 460 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 56 966 20 177 44 792 64 661 98 275 Nebeneinkommen Fr 18 826 27 912 18 077 15 498 13 808 Gesamteinkommen Fr 75 792 48 089 62 869 80 159 112 083 Privatverbrauch Fr 61 883 52 348 56 295 64 573 74 326 Eigenkapitalbildung Fr 13 909 -4 259 6 574 15 586 37 757 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 44 763 37 657 38 570 44 716 58 118 Cashflow 3 Fr 42 557 25 051 33 085 43 957 68 154 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 67 86 99 118 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 54 64 68 72 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 47 30 45 55 59 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 21 13 21 21 30 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 17 32 18 13 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 15 25 16 11 6 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 48 943 25 586 38 883 52 763 75 024 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 4 412 2 867 3 825 4 546 5 621 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 12 5 6 7 11 0 13 4 17 6 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -1 9 -7 5 -4 9 -1 2 4 3 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -5 3 -15 1 -10 7 -4 0 5 4 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 33 835 6 307 24 102 38 234 69 109 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 30 532 (Median)
Tabelle 22
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Talregion* 1999/2001
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion: Ackerbauzone plus Übergangszonen
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A23
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 1 486 325 384 388 388 Vertretene Betriebe Anzahl 24 925 6 244 6 210 6 248 6 223 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 19 56 15 68 17 54 20 29 24 73 Offene Ackerfläche ha 9 14 6 83 7 63 9 04 13 08 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 80 1 70 1 79 1 78 1 92 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 26 1 23 1 36 1 28 1 16 Kühe total Anzahl 13 5 10 9 13 5 14 8 14 7 Tierbestand total GVE 23 8 19 4 23 0 24 3 28 7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 808 389 776 661 748 137 806 660 902 206 davon: Umlaufvermögen total Fr 172 307 141 098 159 905 171 963 216 396 davon: Tiervermögen total Fr 44 132 36 507 42 281 45 579 52 178 davon: Anlagevermögen total Fr 591 950 599 056 545 951 589 118 633 632 davon: Aktiven Betrieb Fr 743 918 722 636 682 247 743 997 826 755 Fremdkapitalquote % 40 39 40 39 41 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 15 199 14 861 13 737 15 457 16 739 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 231 189 171 952 204 164 232 484 316 270 davon: Direktzahlungen Fr 34 567 27 939 30 954 36 260 43 123 Sachkosten Fr 129 019 114 555 118 847 125 118 157 588 Betriebseinkommen Fr 102 170 57 397 85 317 107 366 158 682 Personalkosten Fr 17 958 16 419 14 310 15 454 25 647 Schuldzinsen Fr 9 103 9 482 8 408 8 524 9 997 Pachtzinsen Fr 7 722 4 785 6 476 8 254 11 376 Fremdkosten Fr 163 802 145 242 148 041 157 349 204 608 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 67 387 26 711 56 123 75 134 111 662 Nebeneinkommen Fr 17 475 26 019 16 187 14 676 13 006 Gesamteinkommen Fr 84 862 52 730 72 310 89 810 124 668 Privatverbrauch Fr 69 109 60 160 64 650 70 154 81 498 Eigenkapitalbildung Fr 15 753 -7 430 7 660 19 656 43 170 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 50 571 45 070 43 738 55 134 58 341 Cashflow 3 Fr 48 207 27 412 38 360 50 657 76 440 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 63 88 92 131 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 65 52 64 67 75 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 47 28 44 57 59 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 19 10 17 21 28 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 19 36 21 12 7 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 15 26 18 10 6 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 56 841 33 817 47 751 60 352 82 456 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 5 227 3 662 4 879 5 289 6 418 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 13 7 8 0 12 5 14 5 19 2 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -0 5 -5 9 -3 3 0 2 5 7 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -3 0 -12 1 -7 8 -1 5 7 6 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 41 541 9 664 31 239 46 667 81 585 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 38 449 (Median)
Tabelle 23
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Hügelregion* 1999/2001
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A24 A N H A N G
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 984 192 242 263 288 Vertretene Betriebe Anzahl 14 633 3 671 3 650 3 641 3 670 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 17 66 12 67 15 62 18 65 23 69 Offene Ackerfläche ha 3 06 1 84 2 32 3 32 4 75 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 61 1 52 1 61 1 59 1 72 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 27 1 22 1 35 1 30 1 22 Kühe total Anzahl 15 3 12 2 14 7 16 0 18 2 Tierbestand total GVE 26 9 20 3 24 6 27 7 35 1 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 672 943 619 194 633 825 668 287 770 270 davon: Umlaufvermögen total Fr 120 629 97 109 109 409 118 821 157 104 davon: Tiervermögen total Fr 47 988 36 567 44 281 49 330 61 767 davon: Anlagevermögen total Fr 504 326 485 518 480 135 500 136 551 399 davon: Aktiven Betrieb Fr 619 134 568 376 586 776 612 490 708 800 Fremdkapitalquote % 45 47 44 44 45 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 11 599 10 333 11 107 11 703 13 251 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 176 392 124 183 154 625 180 179 246 538 davon: Direktzahlungen Fr 39 593 31 010 35 114 41 150 51 084 Sachkosten Fr 102 228 87 616 93 290 100 090 127 888 Betriebseinkommen Fr 74 164 36 567 61 335 80 089 118 650 Personalkosten Fr 9 292 8 094 7 055 7 992 14 006 Schuldzinsen Fr 8 071 8 003 7 531 7 749 8 995 Pachtzinsen Fr 4 766 2 654 3 738 5 436 7 231 Fremdkosten Fr 124 357 106 367 111 614 121 267 158 120 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 52 035 17 816 43 011 58 912 88 418 Nebeneinkommen Fr 20 740 33 104 19 934 14 860 15 017 Gesamteinkommen Fr 72 775 50 920 62 945 73 772 103 435 Privatverbrauch Fr 59 062 51 707 55 675 60 543 68 331 Eigenkapitalbildung Fr 13 713 - 787 7 270 13 229 35 104 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 41 969 37 323 38 000 42 222 50 340 Cashflow 3 Fr 40 557 27 203 33 136 38 921 62 928 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 98 73 88 93 128 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 56 65 64 72 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 46 33 43 51 55 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 26 16 24 27 35 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 13 24 18 9 3 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 15 27 15 13 7 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 46 050 24 086 37 952 50 369 69 054 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 4 200 2 905 3 927 4 293 5 003 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 12 0 6 5 10 5 13 1 16 7 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -2 3 -8 0 -4 8 -1 5 3 6 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -6 6 -17 9 -11 2 -5 0 4 4 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 31 696 6 090 23 572 36 215 61 490 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 29 739 (Median)
Tabelle 24
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Bergregion* 1999/2001
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1999: 3 02%; 2000: 3 95%; 2001: 3 36%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
11 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
12 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion: Bergzonen II bis IV Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A25
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 856 180 199 229 248 Vertretene Betriebe Anzahl 14 199 3 564 3 537 3 548 3 551 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 52 13 70 15 76 18 87 25 73 Offene Ackerfläche ha 0 26 0 12 0 14 0 33 0 45 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 59 1 54 1 61 1 60 1 61 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 38 1 32 1 46 1 41 1 32 Kühe total Anzahl 12 0 9 3 11 0 12 2 15 6 Tierbestand total GVE 21 2 16 6 19 1 21 7 27 3 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 586 028 559 838 527 171 571 044 685 992 davon: Umlaufvermögen total Fr 103 171 76 050 93 679 106 399 136 649 davon: Tiervermögen total Fr 38 814 30 333 35 200 39 886 49 850 davon: Anlagevermögen total Fr 444 043 453 455 398 292 424 759 499 493 davon: Aktiven Betrieb Fr 554 761 536 820 500 896 541 090 640 152 Fremdkapitalquote % 40 41 39 39 40 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 11 342 10 939 10 349 11 078 13 004 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 136 548 102 044 118 356 140 105 185 737 davon: Direktzahlungen Fr 51 659 41 691 47 563 52 407 64 997 Sachkosten Fr 78 930 72 319 71 994 78 233 93 157 Betriebseinkommen Fr 57 618 29 725 46 362 61 872 92 580 Personalkosten Fr 5 078 5 150 3 272 4 813 7 071 Schuldzinsen Fr 5 864 6 101 5 235 5 558 6 556 Pachtzinsen Fr 2 927 2 038 2 298 3 260 4 115 Fremdkosten Fr 92 799 85 608 82 798 91 863 110 900 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 43 749 16 436 35 557 48 241 74 838 Nebeneinkommen Fr 19 225 26 013 18 235 16 625 15 996 Gesamteinkommen Fr 62 974 42 449 53 792 64 866 90 834 Privatverbrauch Fr 52 109 45 032 49 684 53 034 60 709 Eigenkapitalbildung Fr 10 865 -2 583 4 108 11 832 30 125 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 37 440 31 252 32 066 38 909 47 535 Cashflow 3 Fr 34 700 22 339 26 914 34 468 55 086 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 93 72 84 89 117 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 65 57 62 68 73 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 47 28 43 55 63 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 21 14 16 24 27 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 18 33 25 10 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 14 25 16 11 5 Verhältnis Betriebseinkommen/Faktoreinsatz Betriebseinkommen je Arbeitskraft Fr /JAE 36 294 19 279 28 866 38 730 57 677 Betriebseinkommen je ha landw Nutzfläche Fr /ha 3 113 2 171 2 944 3 280 3 597 Verhältnis Betriebseinkommen/Aktiven Betrieb % 10 4 5 6 9 3 11 4 14 5 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 10 % -4 4 -9 1 -7 6 -4 1 1 6 Eigenkapitalsrentabilität 11 % -9 3 -17 4 -14 4 -8 6 0 9 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 23 540 4 135 17 318 26 465 46 745 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 12 Fr /FJAE 21 442 (Median)
Tabelle 25
Betriebsergebnisse nach Regionen, Betriebstypen und Quartilen: 1990/92–1999/2001
A26 A N H A N G
Einheit Alle Betriebe Talregion Hügelregion Bergregion Einkommen nach Regionen 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16 06 18 76 16 66 19 56 15 30 17 66 15 76 18 52 Familienarbeitskräfte FJAE 1 39 1 29 1 36 1 26 1 40 1 27 1 42 1 38 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 62 822 56 966 73 794 67 387 59 838 52 035 45 541 43 749 Nebeneinkommen Fr 16 264 18 826 16 429 17 475 14 544 20 740 17 853 19 225 Gesamteinkommen Fr 79 086 75 792 90 223 84 862 74 382 72 775 63 394 62 974 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 31 025 33 835 36 924 41 541 30 335 31 696 21 201 23 540 Einheit Ackerbau Spezialkulturen Verkehrsmilch Mutterkühe Einkommen nach Betriebstypen 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 21 23 23 03 8 92 12 68 15 30 18 29 15 32 17 36 Familienarbeitskräfte FJAE 1 08 1 06 1 29 1 36 1 42 1 35 1 20 1 09 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 60 284 63 747 67 184 73 678 53 923 50 818 36 627 42 664 Nebeneinkommen Fr 26 928 23 260 21 555 16 360 16 044 18 092 33 558 32 510 Gesamteinkommen Fr 87 212 87 007 88 739 90 038 69 967 68 910 70 185 75 174 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 34 375 46 011 30 334 41 833 26 471 28 957 17 348 27 214 Einheit Anderes Pferde/Schafe/ Veredlung Rindvieh Ziegen Einkommen nach Betriebstypen 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14 20 15 47 Nur sieben 13 72 9 34 11 27 Familienarbeitskräfte FJAE 1 37 1 28 Betriebe 1 21 1 35 1 13 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 38 407 35 375 vorhanden 25 437 86 288 60 816 Nebeneinkommen Fr 20 570 21 567 26 154 14 614 17 665 Gesamteinkommen Fr 58 977 56 942 51 591 100 902 78 481 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 16 793 19 886 13 906 48 182 41 908 Einheit Kombiniert Kombiniert Kombiniert Kombiniert Verkehrsmilch/ Mutterkühe Veredlung Andere Ackerbau Einkommen nach Betriebstypen 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20 37 24 52 17 93 22 73 15 59 19 00 17 24 19 84 Familienarbeitskräfte FJAE 1 45 1 33 1 24 1 20 1 40 1 29 1 43 1 28 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 75 368 70 131 51 161 61 943 84 363 72 064 66 705 57 769 Nebeneinkommen Fr 11 802 14 112 20 475 22 493 12 032 16 601 15 000 20 062 Gesamteinkommen Fr 87 170 84 243 71 636 84 436 96 395 88 665 81 705 77 831 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 36 420 41 315 27 456 40 765 42 927 43 432 32 732 34 628 Einheit 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Einkommen nach Quartilen (Arbeitsverdienst) 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 1990/92 1999/2001 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14 68 14 12 15 30 16 96 15 78 19 84 18 47 24 14 Familienarbeitskräfte FJAE 1 36 1 26 1 49 1 38 1 42 1 33 1 27 1 20 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 26 883 20 177 52 294 44 792 69 198 64 661 102 975 98 275 Nebeneinkommen Fr 27 789 27 912 14 629 18 077 12 064 15 498 10 557 13 808 Gesamteinkommen Fr 54 672 48 089 66 923 62 869 81 262 80 159 113 532 112 083 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 4 367 6 307 23 592 24 102 36 016 38 234 62 665 69 109 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Ausgaben des Bundes
Ausgaben für
A N H A N G A27
Tabelle 26 Absatzförderung: Verfügte Mittel Sektoren / Produkt-Markt-Bereich Rechnung 2000 Rechnung 2001 Verfügte Mittel 2002 Fr Fr Fr Milchproduktion 35 788 653 40 559 278 38 279 000 Käse Ausland 26 975 377 26 879 401 28 000 000 Käse Inland 2 462 776 4 795 792 3 928 000 Milch 6 350 500 8 884 085 6 351 000 Tierproduktion 2 575 391 3 087 343 2 975 250 Fleisch 1 523 571 2 202 343 1 800 000 Eier 720 000 650 000 650 000 Fische 8 250 7 000 0 Lebende Tiere 313 550 228 000 505 250 Honig 10 020 0 20 000 Pflanzenbau 5 704 595 5 956 869 6 861 000 Gemüse 1 465 631 1 684 746 2 100 000 Obst 1 613 305 1 901 984 2 056 000 Getreide 1 048 627 753 373 865 000 Kartoffeln 1 125 000 750 000 705 000 Ölsaaten 452 032 224 820 335 000 Zierpflanzen 0 641 946 800 000 Gemeinsame Massnahmen 4 170 782 4 355 237 5 114 978 Übergreifende Massnahmen (Bio, IP) 1 539 906 1 712 537 2 234 640 Reserviert für Schlussabrechnungen und längerfristige Verpflichtungen 7 868 615 1 564 495 3 620 902 National 57 647 942 57 235 759 56 110 520 Regional 1 1 873 084 2 746 483 3 500 000 Total 59 521 026 59 982 242 59 610 520 1 rollende Planung Quelle: BLW
Produktion und Absatz
Tabelle 27
Ausgaben Milchwirtschaft
A28 A N H A N G
Bezeichnung Rechnung 2000 Rechnung 2001 Budget 2002 Fr Fr Fr Marktstützung (Zulagen und Beihilfen) Zulage auf verkäster Milch 280 058 833 331 835 957 350 000 000 Zulage für Fütterung ohne Silage 50 693 222 48 713 852 40 000 000 Inlandbeihilfen für Butter 108 493 186 104 277 846 88 350 000 Inlandbeihilfen für Magermilch und Milchpulver 57 780 162 59 106 422 52 500 000 Inlandbeihilfen für Käse 27 139 882 10 755 315 1 400 000 Ausfuhrbeihilfen für Käse 159 647 903 94 833 531 45 300 000 Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte 24 886 812 9 927 077 16 600 000 708 700 000 659 450 000 594 150 000 Marktstützung (Administration) Rekurskommissionen Milchkontingentierung 83 770 53 880 100 000 Administration Milchverwertung und -kontingentierung 7 372 665 6 644 881 6 400 000 7 456 435 6 698 761 6 500 000 Total 716 156 435 666 148 761 600 650 000 Quellen: Staatsrechnung, BLW
Tabelle 28
Ausgaben Viehwirtschaft
A N H A N G A29
Bezeichnung Rechnung 2000 Rechnung 2001 Budget 2002 Fr Fr Fr Fleischfonds Entschädigung an private Organisationen Schlachtvieh und Fleisch 7 373 585 7 365 656 Ankauf Rindfleisch für humanitäre Zwecke 0 16 612 751 Einlagerungsbeiträge von Kalbfleisch 1 466 554 4 355 860 Einlagerungsbeiträge Rindfleisch von Banktieren (Muni, Rinder, Ochsen) 2 035 345 6 710 140 Einlagerungsbeiträge Rindfleisch von Verarbeitungstieren (Kühen) 1 988 930 358 408 Verbilligungsbeiträge Rindsstotzen 199 041 3 212 903 Informationskampagne Schweizer Rindfleisch 0 649 674 13 063 455 39 265 392 16 000 000 Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte Umstellungsbeiträge für besonders tierfreundliche Legehennenhaltung 3 388 478 1 369 312 Sammel- und Sortierkostenbeiträge 3 898 951 3 265 103 Aufschlagsaktionen 1 202 531 667 509 Verbilligungsaktionen 729 217 425 298 Praxisnahe Versuche beim Geflügel 121 629 255 702 9 340 806 5 982 924 12 500 000 Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh Exportbeiträge für Zucht- und Nutzvieh aus dem Berggebiet 2 768 200 321 650 Ausstellungen 20 803 0 2 789 003 321 650 17 000 000 Verwertungsbeiträge Schafwolle 1 000 000 800 000 800 000 Total 26 193 264 46 369 966 46 300 000 Quellen: Staatsrechnung BLW
Tabelle 29
Ausgaben Pflanzenbau
A30 A N H A N G
Bezeichnung Rechnung 2000 Rechnung 2001 Budget 2002 Fr Fr Fr Ackerbaubeiträge 56 391 275 31 782 139 42 000 000 Flächenbeiträge für Ölsaaten 27 175 149 27 156 015 36 000 000 Flächenbeiträge für Körnerleguminosen 3 671 201 3 954 922 5 200 000 Flächenbeiträge für Faserpflanzen 525 190 489 234 800 000 Anbauprämien für Futtergetreide 25 019 735 181 968 Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 90 687 642 91 719 966 99 000 000 Zuckerrübenverarbeitung 46 829 775 45 000 000 45 000 000 Ölsaatenverarbeitung 1 481 824 4 284 480 7 075 000 Kartoffelverarbeitung 18 909 564 18 972 000 19 200 000 Saatgutproduktion 3 465 960 3 812 660 3 900 000 Obstverwertung 19 283 193 19 075 053 21 325 000 Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe 717 326 575 773 2 500 000 Förderung des Weinbaus 5 746 598 5 537 527 7 120 700 Sachausgaben 81 263 82 364 83 500 Förderung des Rebbaus 1 061 542 1 098 612 1 100 000 Verwertungsmassnahmen 1 4 603 793 4 356 551 5 937 200 Total 152 825 515 129 039 632 148 120 700 1 Weinabsatzförderung im Ausland Quellen: Staatsrechnung, BLW
Ausgaben für Direktzahlungen
Tabelle 30
Entwicklung der Direktzahlungen
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich Die Werte betreffend Direktzahlungen beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs Bei den Kürzungen handelt es sich um Abzüge aufgrund von gesetzlichen und administrativen Begrenzungen und Sanktionen Quelle: BLW
A N H A N G A31
1999 2000 2001 Beitragsart 1 000 Fr 1 000 Fr 1 000 Fr Allgemeine Direktzahlungen 1 778 807 1 803 658 1 929 094 Flächenbeiträge 1 163 094 1 186 770 1 303 881 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 254 624 258 505 268 272 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 255 882 251 593 250 255 Allgemeine Hangbeiträge 95 882 96 714 96 643 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 9 325 10 076 10 043 Ökologische Direktzahlungen 326 520 361 309 412 664 Ökobeiträge 258 788 278 981 329 886 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 100 674 108 130 118 417 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 35 135 33 398 32 526 Beiträge für extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland (Übergangsbestimmung bis Ende 2000) 17 652 17 150 0 Beiträge für den biologischen Landbau 11 637 12 185 23 488 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 93 690 108 118 155 455 Sömmerungsbeiträge 67 571 81 238 80 524 Gewässerschutzbeiträge 161 1 090 2 254 Kürzungen 24 366 22 542 16 763 Total Direktzahlungen 2 080 961 2 142 425 2 324 995
Tabelle 31a
Allgemeine Direktzahlungen 2001
A32 A N H A N G
Flächenbeiträge Beiträge
Raufutter
Nutztiere Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe RGVE Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 3 838 70 528 92 751 289 1 934 14 299 12 307 752 BE 13 046 188 745 243 185 654 8 630 56 684 50 767 193 LU 5 231 77 092 96 766 885 2 988 19 360 17 653 049 UR 689 6 736 7 913 502 637 5 317 4 555 492 SZ 1 760 24 075 27 637 945 1 515 13 226 11 356 320 OW 729 8 038 9 400 499 614 3 764 3 345 108 NW 519 6 119 7 140 294 389 2 241 1 930 952 GL 426 7 175 8 589 450 408 3 502 3 062 255 ZG 601 10 460 12 689 254 410 2 650 2 347 829 FR 3 386 75 462 98 238 249 2 183 16 543 14 734 290 SO 1 460 31 356 40 563 006 978 8 595 7 466 258 BL 984 21 336 26 991 102 700 5 863 5 101 455 SH 590 14 006 19 198 440 245 2 348 2 067 411 AR 791 12 111 14 279 067 614 4 402 3 978 257 AI 592 7 283 8 682 467 362 2 178 2 126 740 SG 4 572 72 480 86 223 224 3 367 26 127 22 422 027 GR 2 867 51 498 60 530 779 2 742 35 390 29 042 315 AG 3 212 57 666 76 636 224 1 645 12 920 11 224 434 TG 2 798 49 455 65 158 032 869 5 716 4 733 141 TI 935 12 699 15 150 193 737 7 209 5 552 906 VD 4 114 105 159 142 020 889 2 015 20 125 17 643 220 VS 4 019 36 870 44 155 615 2 456 18 866 13 618 481 NE 993 33 156 39 152 474 751 7 599 6 874 657 GE 315 10 471 13 367 063 101 1 290 1 058 558 JU 1 121 38 902 47 459 253 931 15 069 13 301 607 Schweiz 59 588 1 028 877 1 303 880 849 38 221 311 283 268 271 707 Zone 1 Tal 25 147 478 019 643 488 866 10 704 82 213 71 286 301 Hügel 8 395 143 278 180 731 228 5 299 37 789 32 665 757 BZ I 7 758 120 501 145 187 617 5 913 39 718 34 574 407 BZ II 9 421 155 669 181 299 523 7 664 65 527 58 222 492 BZ III 5 833 85 689 100 075 011 5 667 56 898 47 987 984 BZ IV 3 034 45 720 53 098 604 2 974 29 140 23 534 766
Zuteilung der Fläche
Hauptanteil
LN,
Quelle: BLW
für
verzehrende
1
nach
der
die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
Tabelle 31b
Allgemeine Direktzahlungen 2001
A N H A N G A33
Tierhaltung unter Allgemeine Hangbeiträge Hangbeiträge Steil- und erschwerenden Bedingungen Terrassenlagen im Rebbau Total Total Total Betriebe RGVE Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Anzahl Anzahl Fr Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 836 11 160 3 496 212 808 5 264 2 162 445 210 182 338 955 BE 9 267 115 975 64 173 356 8 627 48 088 20 173 315 67 101 320 274 LU 3 190 41 282 18 382 789 3 355 21 855 9 120 523 9 14 24 075 UR 680 7 530 6 576 163 639 4 790 2 270 846 11 1 245 SZ 1 562 19 856 11 519 617 1 526 10 177 4 352 454 10 10 21 495 OW 698 9 118 5 333 949 666 4 773 2 196 891 10 750 NW 484 6 368 3 366 278 464 3 865 1 727 311 000 GL 378 4 951 3 725 667 378 3 355 1 522 868 12 7 950 ZG 391 5 321 2 490 223 379 3 084 1 261 977 10 930 FR 1 934 28 445 10 514 604 1 627 7 399 2 924 287 19 14 21 238 SO 614 8 166 3 118 643 593 4 986 1 911 192 0 BL 704 9 182 2 581 373 693 6 058 2 331 466 39 36 62 460 SH 119 1 511 256 185 145 826 309 534 123 95 157 410 AR 783 10 497 6 027 437 781 6 656 2 801 728 4 10 29 050 AI 582 7 675 5 091 641 568 3 391 1 413 745 0 SG 3 128 41 671 19 345 165 3 051 25 477 10 619 077 71 95 275 960 GR 2 749 34 183 32 999 695 2 674 31 550 13 782 341 31 21 46 845 AG 1 191 15 276 3 056 480 1 233 7 906 3 036 985 124 162 281 115 TG 165 2 309 810 637 152 1 199 530 274 81 102 154 530 TI 701 7 270 5 915 209 594 3 158 1 393 289 179 141 283 825 VD 1 346 18 570 8 078 043 1 024 5 871 2 329 191 371 561 2 049 645 VS 2 444 21 598 19 820 922 2 347 12 789 5 727 524 1 448 1 628 5 739 055 NE 835 12 407 7 436 706 599 3 579 1 346 645 53 70 135 260 GE 000000 43 57 89 025 JU 796 11 771 6 138 242 602 3 622 1 396 790 22 2 385 Schweiz 35 577 452 093 250 255 236 33 525 229 715 96 642 698 2 888 3 305 10 043 477 Zone 1 Tal 2 581 36 771 3 244 663 2 113 567 073 2 278 605 1 806 2 232 6 721 542 Hügel 7 865 104 361 26 767 065 7 306 3 858 961 15 094 722 188 251 641 671 BZ I 7 497 97 812 43 214 009 7 086 4 822 341 19 696 713 185 204 582 210 BZ II 8 861 113 314 77 444 944 8 328 6 183 166 26 109 740 543 558 1 883 780 BZ III 5 764 66 497 61 523 852 5 697 4 832 083 21 245 813 126 50 181 724 BZ IV 3 009 33 338 38 060 703 2 995 2 707 878 12 217 105 40 9 32 550 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Ökobeiträge 2001
1 Hochstammobstbäume umgerechnet in Aren
2 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
3 SG, OW, AR, SZ: Ohne NHG-Flächen und entsprechende Sockelbeiträge
A34 A N H A N G
Tabelle 32a
Ökologischer Ausgleich 1 Biologischer Landbau Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 3 821 8 810 12 336 632 328 6 249 1 987 695 BE 12 707 18 556 17 489 406 1 330 18 857 4 577 595 LU 5 192 8 007 9 055 525 269 4 054 1 028 481 UR 686 1 233 629 103 39 460 92 446 SZ 3 1 718 3 173 2 787 015 126 1 878 383 864 OW 3 726 1 066 888 305 144 1 816 367 426 NW 516 926 728 698 53 720 147 199 GL 422 1 084 665 012 88 1 514 301 812 ZG 603 1 549 1 663 234 78 1 391 306 326 FR 3 311 6 533 6 942 083 73 1 266 502 839 SO 1 455 4 118 4 981 664 109 2 761 722 877 BL 978 3 386 4 429 854 125 2 796 762 106 SH 571 1 545 2 259 262 14 295 134 009 AR 3 730 861 688 197 138 2 261 453 487 AI 456 496 356 767 27 366 72 890 SG 3 4 187 5 919 6 694 961 459 7 705 1 663 440 GR 2 808 14 633 5 845 575 1 151 23 330 4 843 647 AG 3 208 7 238 9 599 779 193 3 368 1 220 259 TG 2 759 5 146 7 145 786 210 3 523 1 304 904 TI 859 1 586 1 135 093 92 1 343 336 091 VD 3 899 9 561 12 094 878 97 1 884 681 449 VS 2 331 5 665 3 381 079 199 2 856 847 213 NE 771 2 029 1 687 694 39 1 049 269 694 GE 305 1 077 1 773 271 4 56 54 340 JU 1 086 3 103 3 158 163 56 1 767 425 605 Schweiz 56 105 117 302 118 417 036 5 441 93 565 23 487 694 Zone 2 Tal 24 018 48 287 67 837 000 1 068 18 309 7 330 801 Hügel 8 285 17 239 20 331 375 524 8 868 2 461 931 BZ I 7 441 11 474 10 190 272 723 11 059 2 484 479 BZ II 8 159 13 876 9 612 767 1 162 19 040 3 870 030 BZ III 5 343 14 096 5 968 888 1 168 20 877 4 264 585 BZ IV 2 859 12 330 4 476 734 796 15 412 3 075 868
Quelle: BLW
Tabelle 32b
Ökobeiträge 2001
1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A N H A N G A35
Extensive Produktion von Besonders tierfreundliche Haltung Getreide und Raps landwirtschaftlicher Nutztiere Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe GVE Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 1 573 6 068 2 423 316 1 786 56 764 8 537 323 BE 5 910 18 222 7 288 465 8 679 200 995 32 321 081 LU 1 407 3 564 1 425 648 3 636 129 379 19 460 904 UR 000 340 4 947 823 754 SZ 22 32 12 724 821 18 400 2 985 800 OW 23 1 060 405 9 140 1 476 500 NW 000 244 6 399 997 435 GL 34 1 444 281 6 443 1 082 614 ZG 83 155 62 164 367 12 271 1 887 896 FR 1 456 6 669 2 667 641 2 405 85 230 13 443 732 SO 862 4 419 1 760 952 1 010 28 769 4 424 630 BL 717 3 576 1 412 892 488 17 667 2 628 421 SH 338 2 490 980 639 231 9 367 1 315 096 AR 23 830 559 13 605 2 288 742 AI 000 387 9 697 1 626 357 SG 393 837 327 370 2 471 76 798 12 251 678 GR 323 845 337 813 2 180 49 690 8 028 217 AG 1 866 7 694 3 075 800 1 637 52 157 7 801 569 TG 834 2 733 1 093 012 1 638 59 677 8 911 294 TI 64 246 98 448 702 13 421 2 118 901 VD 1 950 13 567 5 420 090 1 778 64 592 9 575 686 VS 132 338 134 055 960 12 015 2 014 676 NE 462 3 079 1 230 531 587 21 667 3 335 611 GE 217 2 964 1 147 956 59 1 939 279 124 JU 601 4 070 1 623 311 877 40 097 5 838 138 Schweiz 19 217 81 576 32 526 161 34 528 1 001 126 155 455 179 Zone 1 Tal 11 161 54 576 21 737 066 13 140 477 733 71 448 343 Hügel 4 561 16 639 6 645 357 5 283 164 744 25 507 634 BZ I 2 378 7 745 3 097 637 4 880 130 597 20 857 910 BZ II 897 2 360 943 959 5 702 132 880 21 777 739 BZ III 182 228 91 102 3 661 64 736 10 778 140 BZ IV 38 28 11 040 1 862 30 435 5 085 413
Quelle: BLW
Tabelle 33a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2001
nach
der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
Ohne NHG-Flächen und entsprechende Sockelbeiträge
A36 A N H A N G
Extensiv genutzte Wiesen Wenig intensiv genutzte Wiesen Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 3 141 4 167 5 905 362 1 209 1 094 696 031 BE 7 020 6 111 6 023 967 8 053 6 870 3 338 293 LU 3 799 3 181 3 401 584 2 429 1 623 876 715 UR 388 465 236 567 495 620 195 864 SZ 2 840 681 489 129 674 591 249 997 OW 2 582 624 395 975 219 130 55 528 NW 373 450 281 502 228 190 80 951 GL 380 752 450 786 176 223 84 318 ZG 327 267 311 312 288 215 118 436 FR 1 930 2 271 2 957 214 2 210 2 897 1 687 865 SO 1 165 1 965 2 454 574 669 877 505 711 BL 736 1 103 1 319 633 477 588 358 063 SH 521 887 1 242 339 195 199 129 691 AR 2 356 179 130 344 435 286 129 942 AI 266 179 124 950 146 100 45 125 SG 2 2 090 1 485 1 696 825 2 293 1 677 912 632 GR 2 086 5 016 2 444 820 2 472 9 231 2 845 398 AG 2 518 3 380 4 567 173 1 410 1 204 775 040 TG 1 705 1 442 2 113 248 1 293 868 560 516 TI 514 612 508 689 443 764 269 345 VD 3 050 4 695 6 432 066 1 497 2 567 1 347 264 VS 899 1 323 829 016 1 692 3 521 1 186 849 NE 459 744 784 587 469 1 065 497 047 GE 297 811 1 217 220 14 23 15 161 JU 725 1 136 1 350 000 674 1 197 625 968 Schweiz 36 167 43 926 47 668 879 30 160 38 619 17 587 750 Zone 1 Tal 18 036 21 550 31 652 800 9 992 8 735 5 607 103 Hügel 5 064 5 502 6 474 919 4 881 4 640 2 915 419 BZ I 3 721 3 211 2 350 557 4 425 3 813 1 758 442 BZ II 4 201 4 283 2 894 183 4 807 5 932 2 608 982 BZ III 3 230 5 457 2 516 447 3 646 7 441 2 270 583 BZ IV 1 915 3 924 1 779 973 2 409 8 059 2 427 222 1 Zuteilung der Fläche
2 SG, OW, AR, SZ:
Quelle: BLW
Hauptanteil
Tabelle 33b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2001
der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet 2
A N H A N G A37
Streueflächen Hecken, Feld- und Ufergehölze Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 1 155 1 273 1 730 692 930 187 269 533 BE 752 550 345 951 1 975 422 441 842 LU 344 196 199 643 354 71 95 029 UR 43 34 26 486 10 84 SZ 2 901 1 159 934 575 20 159 OW 2 103 49 43 106 11 1 1 148 NW 119 97 82 454 15 2 1 279 GL 54 42 31 059 11 2 1 146 ZG 293 504 388 565 191 47 48 582 FR 78 39 39 518 764 236 314 623 SO 000 307 89 110 017 BL 000 250 73 90 139 SH 96 9 405 222 63 87 357 AR 2 284 203 145 016 47 9 6 521 AI 188 163 114 415 59 11 7 462 SG 2 420 157 140 999 185 34 41 463 GR 63 32 15 511 105 23 19 441 AG 97 60 87 354 996 288 375 966 TG 166 91 131 440 476 95 141 154 TI 28 26 36 441 14 4 4 475 VD 99 71 53 545 1 076 349 474 239 VS 49 16 11 258 252 63 44 953 NE 33 2 058 121 41 39 384 GE 35 8 235 113 35 53 040 JU 23 11 8 521 334 128 128 444 Schweiz 5 274 4 788 4 586 242 8 811 2 274 2 797 478 Zone 1 Tal 1 459 1 429 2 111 571 5 217 1 283 1 899 328 Hügel 615 476 568 081 1 613 426 511 154 BZ I 838 617 499 235 905 257 186 363 BZ II 1 436 1 499 1 050 195 744 235 165 812 BZ III 669 539 253 289 266 60 28 939 BZ IV 257 228 103 872 66 13 5 884
Hauptanteil
SG, OW, AR, SZ:
Quelle: BLW
1 Zuteilung der Fläche nach
Ohne NHG-Flächen und entsprechende Sockelbeiträge
Tabelle 33c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2001
A38 A N H A N G
Buntbrachen Rotationsbrachen Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 389 277 830 580 159 185 462 050 BE 278 191 573 072 117 142 355 837 LU 60 41 121 860 13 16 39 625 UR 000000 SZ 000000 OW 000000 NW 000000 GL 000000 ZG 12 13 37 800 33 8 075 FR 136 141 422 715 62 92 229 768 SO 48 53 159 900 42 50 125 175 BL 128 92 276 660 60 91 227 175 SH 145 97 290 580 37 63 157 600 AR 000000 AI 000000 SG 44 27 81 660 13 13 33 075 GR 14 10 29 610 7 10 23 750 AG 351 144 432 120 120 117 291 875 TG 138 100 300 810 56 74 185 950 TI 7 13 38 700 3 26 64 075 VD 326 488 1 462 860 174 238 594 700 VS 78 108 324 450 20 34 85 925 NE 41 50 150 930 12 25 61 425 GE 57 75 226 170 55 65 161 825 JU 48 41 122 640 26 38 94 750 Schweiz 2 300 1 961 5 883 117 979 1 281 3 202 655 Zone 1 Tal 1 932 1 670 5 010 482 846 1 115 2 787 870 Hügel 349 271 813 396 129 162 404 385 BZ I 12 18 53 569 23 7 150 BZ II 62 5 280 21 3 250 BZ III 10 390 000 BZ IV 000000 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 33d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2001
A N H A N G A39
Ackerschonstreifen Hochstamm-Feldobstbäume Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Bäume Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 18 6 8 760 2 676 162 231 2 433 445 BE 50 12 18 651 8 639 425 626 6 384 390 LU 10 1 1 860 4 386 287 944 4 319 160 UR 000 246 11 335 170 025 SZ 000 1 078 74 205 1 113 075 OW 000 493 26 168 392 520 NW 000 361 18 833 282 495 GL 000 147 6 511 97 665 ZG 000 536 50 031 750 466 FR 62 2 475 2 016 85 587 1 283 805 SO 15 2 3 510 1 200 108 185 1 622 775 BL 92 2 310 936 143 725 2 155 877 SH 20 350 388 22 796 341 940 AR 000 324 18 425 276 375 AI 000 77 4 321 64 815 SG 51 1 860 3 196 252 429 3 786 435 GR 000 583 31 164 467 460 AG 71 1 905 2 700 204 537 3 068 055 TG 14 3 4 695 2 330 247 247 3 707 974 TI 000 221 14 219 213 315 VD 37 11 16 215 2 173 114 279 1 714 185 VS 000 781 59 895 898 425 NE 10 225 183 10 136 152 040 GE 82 2 430 121 5 946 89 190 JU 81 1 080 674 55 124 826 859 Schweiz 190 44 66 326 36 465 2 440 899 36 612 766 Zone 1 Tal 149 39 58 685 17 740 1 246 754 18 700 560 Hügel 36 4 6 339 7 267 575 774 8 636 612 BZ I 51 1 302 5 994 355 515 5 332 724 BZ II 000 4 008 192 303 2 884 545 BZ III 000 1 231 59 917 898 755 BZ IV 000 225 10 636 159 570
Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die
Betrieb
Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
1
ein
in einer
Tabelle 34
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2001
Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A40 A N H A N G
Brotgetreide Futtergetreide Raps Total Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Fr Kanton ZH 1 159 3 820 1 105 1 894 231 354 2 423 316 BE 3 485 8 165 5 181 9 633 297 424 7 288 465 LU 808 1 460 1 149 1 962 87 142 1 425 648 UR 0000000 SZ 33 21 28 11 12 724 OW 22110 1 060 NW 0000000 GL 003400 1 444 ZG 32 50 68 102 34 62 164 FR 866 3 250 1 260 3 135 110 284 2 667 641 SO 618 2 202 767 2 063 87 154 1 760 952 BL 529 1 758 645 1 691 57 126 1 412 892 SH 320 1 911 182 469 65 110 980 639 AR 111200 830 AI 0000000 SG 143 263 316 537 19 37 327 370 GR 142 364 286 464 11 17 337 813 AG 1 540 4 407 1 526 3 016 187 271 3 075 800 TG 679 1 834 531 793 75 106 1 093 012 TI 17 67 58 179 0 98 448 VD 1 097 6 593 1 602 5 534 612 1 440 5 420 090 VS 91 218 73 114 16 134 055 NE 177 923 442 1 985 64 171 1 230 531 GE 171 1 824 191 934 47 205 1 147 956 JU 320 1 683 530 2 201 63 186 1 623 311 Schweiz 12 200 40 797 15 938 36 741 2 017 4 039 32 526 161 Zone 1 Tal 8 182 31 541 8 533 19 735 1 617 3 300 21 737 066 Hügel 2 913 7 038 4 098 8 987 341 614 6 645 357 BZ I 916 1 950 2 258 5 673 58 123 3 097 637 BZ II 139 228 847 2 131 12 943 959 BZ III 39 36 168 192 00 91 102 BZ IV 11 5 34 23 00 11 040 1
Quelle: BLW
Tabelle 35
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2001
A N H A N G A41
Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme Regelmässiger Auslauf im Freien Betriebe GVE Total Beiträge Betriebe GVE Total Beiträge Anzahl Anzahl Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 933 19 989 2 036 193 1 691 36 754 6 501 130 BE 3 348 52 875 6 170 318 8 325 148 120 26 150 763 LU 2 299 49 302 5 840 959 3 445 80 077 13 619 945 UR 69 779 76 810 337 4 169 746 944 SZ 236 4 148 445 517 803 14 252 2 540 283 OW 156 2 331 260 042 394 6 809 1 216 458 NW 118 2 152 254 248 235 4 247 743 187 GL 54 932 95 409 281 5 511 987 205 ZG 183 3 883 411 189 354 8 388 1 476 707 FR 1 314 25 670 2 921 005 2 239 59 560 10 522 727 SO 553 9 269 988 045 933 19 499 3 436 585 BL 273 6 393 654 102 471 11 274 1 974 319 SH 173 5 021 572 482 186 4 346 742 614 AR 141 2 108 242 042 555 11 497 2 046 700 AI 113 2 232 313 513 378 7 465 1 312 844 SG 931 19 970 2 242 148 2 408 56 828 10 009 530 GR 545 10 252 962 839 2 180 39 438 7 065 378 AG 916 20 290 2 205 505 1 494 31 842 5 596 064 TG 840 21 992 2 327 677 1 532 37 685 6 583 617 TI 210 3 142 289 766 697 10 278 1 829 135 VD 1 028 24 079 2 464 340 1 629 40 512 7 111 346 VS 128 1 630 157 429 947 10 385 1 857 247 NE 246 6 335 620 650 570 15 333 2 714 961 GE 26 772 76 061 56 1 167 203 063 JU 488 14 595 1 405 292 847 25 502 4 432 846 Schweiz 15 321 310 139 34 033 581 32 987 690 939 121 421 598 Zone 1 Tal 7 607 181 300 20 005 674 12 183 296 399 51 442 669 Hügel 2 825 54 568 6 173 842 4 999 110 165 19 333 792 BZ I 2 027 33 511 3 659 874 4 750 97 085 17 198 036 BZ II 1 724 26 438 2 850 943 5 595 106 440 18 926 796 BZ III 808 9 922 939 398 3 615 54 815 9 838 742 BZ IV 330 4 400 403 850 1 845 26 035 4 681 563 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 36
Beteiligung am BTS-Programm 2001
A42 A N H A N G
Basis 1 BTS-Beteiligung Tierkategorie GVE Betriebe GVE Betriebe GVE Betriebe Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl %% Zucht und Nutzung: Milchkühe 649 228 42 017 110 027 4 910 16 9 11 7 Rinder, über 1jährig 152 221 39 587 30 783 6 299 20 2 15 9 Stiere, über 1jährig 5 485 8 169 1 044 1 294 19 0 15 8 weibliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate 33 595 31 055 6 788 5 036 20 2 16 2 männliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate 2 241 4 265 208 337 9 3 7 9 Aufzuchtkälber, unter 4 Monate 25 815 27 344 6 428 5 420 24 9 19 8 Mutter- und Ammenkühe: Mutter- und Ammenkühe mit Kälbern 45 505 4 449 32 978 2 434 72 5 54 7 Mast: Rinder, Stiere, Ochsen, über 4 Monate 38 842 7 895 17 872 2 132 46 0 27 0 Kälber, unter 4 Monate 4 166 6 808 1 820 1 466 43 7 21 5 Mastkälber 11 213 19 196 4 089 3 215 36 5 16 7 Total Rindvieh 968 310 47 814 212 035 12 497 21 9 26 1 Ziegen 7 785 6 285 1 575 483 20 2 7 7 Kaninchen 2 653 4 280 66 83 2 5 1 9 Total übrige Raufutter Verzehrer 10 439 9 601 1 641 548 15 7 5 7 Zuchtschweine, über 6 Monate, und Ferkel 55 310 5 819 20 777 1 380 37 6 23 7 Remonten, bis 6 Monate, und Mastschweine 90 008 10 628 47 629 3 273 52 9 30 8 Total Schweine 145 317 13 079 68 406 3 914 47 1 29 9 Zuchthennen und -hähne 844 2 068 134 61 15 8 2 9 Legehennen 16 847 14 997 11 761 1 647 69 8 11 0 Junghennen, -hähne und Küken 1 680 515 885 82 52 7 15 9 Mastpoulets 16 130 1 028 13 033 675 80 8 65 7 Truten 2 371 289 2 096 92 88 4 31 8 Total Geflügel 37 871 16 692 27 908 2 397 73 7 14 4 Total alle Tierkategorien 1 161 937 51 105 309 991 15 311 26 7 30 0 1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe, die Direktzahlungen erhalten haben) Quelle: BLW
Tabelle 37
Beteiligung am RAUS-Programm 2001
1 Beitragsberechtigte Betriebe (Betriebe, die Direktzahlungen erhalten haben)
A N H A N G A43
Basis 1 RAUS-Beteiligung Tierkategorie GVE Betriebe GVE Betriebe GVE Betriebe Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl %% Zucht und Nutzung: Milchkühe 649 228 42 017 395 579 23 077 60 9 54 9 Rinder, über 1jährig 152 221 39 587 83 735 19 841 55 0 50 1 Stiere, über 1jährig 5 485 8 169 1 964 3 065 35 8 37 5 weibliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate 33 595 31 055 15 715 14 618 46 8 47 1 männliches Jungvieh, 4 bis 12 Monate 2 241 4 265 464 1 043 20 7 24 5 Aufzuchtkälber, unter 4 Monate 25 815 27 344 6 020 5 960 23 3 21 8 Mutter- und Ammenkühe: Mutter- und Ammenkühe mit Kälbern 45 505 4 449 40 412 3 442 88 8 77 4 Mast: Rinder, Stiere, Ochsen, über 4 Monate 38 842 7 895 12 470 2 338 32 1 29 6 Kälber, unter 4 Monate 4 166 6 808 824 1 072 19 8 15 7 Mastkälber 11 213 19 196 841 1 431 7 5 7 5 Total Rindvieh 968 310 47 814 558 023 27 874 57 6 58 3 Tiere der Pferdegattung 30 478 11 589 22 294 7 174 73 2 61 9 Schafe 36 249 10 104 24 550 5 863 67 7 58 0 Ziegen 7 785 6 285 4 864 2 587 62 5 41 2 Dam- und Rothirsche 527 154 393 105 74 6 68 2 Bisons 152 9 152 9 100 0 100 0 Kaninchen 2 653 4 280 106 171 4 0 4 0 Total übrige Raufutter Verzehrer 77 844 24 176 52 361 12 856 67 3 53 2 Zuchtschweine, über 6 Monate, und Ferkel 55 310 5 819 20 617 1 515 37 3 26 0 Remonten, bis 6 Monate, und Mastschweine 90 008 10 628 43 754 3 263 48 6 30 7 Total Schweine 145 317 13 079 64 371 4 031 44 3 30 8 Zuchthennen und -hähne 844 2 068 60 122 7 1 5 9 Legehennen 16 847 14 997 9 616 3 496 57 1 23 3 Junghennen, -hähne und Küken 1 680 515 179 71 10 7 13 8 Mastpoulets 16 130 1 028 4 341 298 26 9 29 0 Truten 2 371 289 2 020 115 85 2 39 8 Total Geflügel 37 871 16 692 16 215 3 881 42 8 23 3 Total alle Tierkategorien 1 229 343 54 298 690 969 32 982 56 2 60 7
Quelle: BLW
Tabelle 38a
Sömmerungsbeiträge 2001
A44 A N H A N G
Kantone Schafe Kühe, Milchschafe Übrige Raufutter Betriebe und (ohne Milchschafe) und Milchziegen verzehrende Tiere Beiträge Total Betriebe Normalstösse Betriebe GVE Betriebe Normalstösse Betriebe Beiträge Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Fr ZH 0013 10 483 10 126 360 BE 183 2 136 875 19 306 1 708 42 318 1 807 17 030 453 LU 47 394 69 316 249 5 613 255 1 727 556 UR 81 1 512 238 3 807 247 2 886 357 2 170 529 SZ 33 219 272 2 200 433 9 367 458 3 320 029 OW 24 287 105 1 701 260 7 165 279 2 424 136 NW 10 96 47 368 122 3 476 136 1 112 762 GL 19 603 81 1 998 113 4 615 120 1 880 086 ZG 00195 107 5 35 624 FR 58 733 172 2 639 604 20 970 642 6 293 826 SO 00 14 17 63 2 457 63 678 634 BL 0000 10 410 10 106 590 SH 00001 100 1 25 904 AR 00 57 536 119 2 079 121 743 996 AI 10 148 107 1 524 139 1 825 144 949 422 SG 41 1 441 288 7 318 435 13 682 453 5 845 439 GR 217 8 547 479 17 027 887 30 213 1 053 14 010 179 AG 2 21 008 343 6 91 779 TG 00002 85 2 20 714 TI 82 2 066 116 4 806 202 3 986 252 2 536 627 VD 15 285 72 1 747 647 30 213 668 8 452 493 VS 183 5 783 197 9 249 432 12 593 526 6 741 739 NE 00 28 519 152 3 479 158 1 155 906 GE 1 85 00001 10 169 JU 2410 78 10 505 80 3 033 361 Total 1 008 24 359 3 220 75 090 6 926 208 969 7 607 80 524 313 Quelle: BLW
Tabelle 38b
Sömmerungsbeiträge 2001
A N H A N G A45
Kantone Kühe gemolken Milchziegen Milchschafe Übrige Schafe Übrige Raufutter verzehrende Tiere ZH 0 10 00 740 BE 28 718 3 722 86 24 861 70 301 LU 1 214 148 0 2 595 9 012 UR 4 152 564 1 15 222 6 968 SZ 3 733 756 0 8 129 18 107 OW 4 555 187 0 2 722 7 642 NW 1 589 170 0 2 102 4 380 GL 3 599 106 0 4 207 5 855 ZG 25 000 180 FR 8 026 644 0 5 226 27 347 SO 93 10 51 4 164 BL 0000 850 SH 0000 140 AR 1 347 208 00 2 789 AI 1 705 375 0 908 3 110 SG 9 353 729 6 13 923 27 545 GR 22 494 4 157 286 58 577 85 015 AG 000 190 310 TG 000 150 147 TI 5 281 5 523 14 15 840 7 222 VD 12 334 604 104 8 425 32 565 VS 12 890 208 11 54 169 16 626 NE 911 10 810 6 412 GE 000 720 0 JU 3 042 00 249 9 268 Total 125 061 18 113 508 219 076 346 695 Quelle: BLW
Tabelle 39a
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2001
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der FAT
2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, kantonale und private Ökobeiträge
A46 A N H A N G
Talzone HZ Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 667 413 140 243 142 32 Vertretene Betriebe Anzahl 9834 5601 2832 3378 1628 654 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 20 24 01 36 86 14 82 23 93 36 97 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 22 706 35 553 52 670 26 517 42 274 61 956 Flächenbeiträge Fr 20 653 32 991 48 708 18 906 31 047 47 217 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 1 898 2 331 3 711 2 090 4 494 6 998 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 77 95 117 3 644 3 605 4 433 Hangbeiträge Fr 78 136 134 1 877 3 128 3 308 Ökobeiträge total Fr 6 433 9 043 13 873 6 566 9 898 13 679 Ökologischer Ausgleich Fr 2 335 3 016 4 767 2 031 3 552 4 799 Extensive Produktion Fr 743 1 001 1 812 699 1 150 2 371 Biologischer Landbau Fr 426 434 1 072 472 633 1 019 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 2 929 4 592 6 222 3 364 4 563 5 490 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 29 139 44 596 66 543 33 083 52 172 75 635 Rohertrag Fr 184 095 267 214 352 848 166 299 230 475 297 090 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 15 8 16 7 18 9 19 9 22 6 25 5 Andere Direktzahlungen 2 Fr 784 1 334 3 343 795 2 309 3 621 Total Direktzahlungen Fr 29 923 45 930 69 886 33 878 54 481 79 256 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 16 3 17 2 19 8 20 4 23 6 26 7
Quelle: FAT
Tabelle 39b
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2001
A N H A N G A47
BZ I BZ II Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 221 100 33 200 122 50 Vertretene Betriebe Anzahl 3 132 1 138 679 3 121 1 547 961 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14 95 24 10 35 19 15 13 24 03 36 42 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 31 840 44 901 62 136 37 795 50 115 65 634 Flächenbeiträge Fr 18 123 29 290 43 405 17 712 27 528 40 367 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 3 743 4 982 7 654 5 765 7 204 9 824 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 6 545 6 769 6 354 10 105 10 548 11 350 Hangbeiträge Fr 3 429 3 860 4 723 4 213 4 835 4 093 Ökobeiträge total Fr 5 628 7 735 11 752 4 278 7 360 9 188 Ökologischer Ausgleich Fr 1 385 1 776 2 295 1 150 1 525 1 751 Extensive Produktion Fr 218 530 1 909 30 121 458 Biologischer Landbau Fr 659 645 780 556 1 283 1 485 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 3 366 4 784 6 768 2 542 4 431 5 494 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 37 468 52 636 73 888 42 073 57 475 74 822 Rohertrag Fr 152 424 205 420 268 003 130 881 180 310 221 444 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 24 6 25 6 27 6 32 1 31 9 33 8 Andere Direktzahlungen 2 Fr 639 992 1 563 1 990 2 806 3 298 Total Direktzahlungen Fr 38 107 53 628 75 451 44 063 60 281 78 120 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 25 0 26 1 28 2 33 7 33 4 35 3 1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der FAT 2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, kantonale und private Ökobeiträge Quelle: FAT
Tabelle 39c
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2001
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der FAT
2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, kantonale und private Ökobeiträge
3 Aufgrund der zu kleinen Stichprobe werden keine Ergebnisse dargestellt
A48 A N H A N G
BZ III BZ IV Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 3 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 117 56 18 63 36 Vertretene Betriebe Anzahl 1 967 872 319 1 262 526 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 00 24 76 35 75 14 79 24 49 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 44 696 59 752 75 588 48 022 60 767 Flächenbeiträge Fr 17 083 28 144 38 935 17 292 27 100 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 9 787 11 575 13 473 9 586 10 696 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 12 878 13 937 16 252 16 037 17 163 Hangbeiträge Fr 4 948 6 096 6 928 5 107 5 808 Ökobeiträge total Fr 3 780 6 098 7 103 3 685 7 701 Ökologischer Ausgleich Fr 1 158 1 521 1 466 1 144 2 018 Extensive Produktion Fr 04707 Biologischer Landbau Fr 563 1 440 1 681 809 2 293 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 2 059 3 133 3 949 1 732 3 383 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 48 476 65 850 82 691 51 707 68 468 Rohertrag Fr 110 125 159 972 200 442 98 487 141 001 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 44 0 41 2 41 3 52 5 48 6 Andere Direktzahlungen 2 Fr 2 801 2 989 5 281 2 508 5 211 Total Direktzahlungen Fr 51 277 68 839 87 972 54 215 73 679 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 46 6 43 0 43 9 55 0 52 3
Quelle: FAT
Tabelle 40
Direktzahlungen auf Betriebsebene1 : nach Regionen 2001
A N H A N G A49
Merkmal Einheit Alle Tal- Hügel- BergBetriebe region region region Referenzbetriebe Anzahl 3 067 1 376 907 784 Vertretene Betriebe Anzahl 52 470 24 183 14 343 13 944 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 19 10 19 93 17 95 18 85 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 34 784 29 335 33 574 45 479 Flächenbeiträge Fr 24 069 26 825 22 169 21 243 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 4 189 2 268 3 709 8 016 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 4 516 80 4 945 11 767 Hangbeiträge Fr 2 010 162 2 751 4 453 Ökobeiträge total Fr 6 791 7 749 6 989 4 925 Ökologischer Ausgleich Fr 2 156 2 782 2 028 1 202 Extensive Produktion Fr 630 933 667 67 Biologischer Landbau Fr 637 549 546 883 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 3 368 3 485 3 748 2 773 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 41 575 37 084 40 563 50 404 Rohertrag Fr 192 972 233 144 178 588 138 099 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 21 5 15 9 22 7 36 5 Direktzahlungen pro ha Fr /ha 2 177 1 861 2 260 2 674 Andere Direktzahlungen 2 Fr 1 587 1 315 1 086 2 575 Total Direktzahlungen Fr 43 162 38 399 41 649 52 979 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 22 4 16 5 23 3 38 4 1
FAT 2 Sömmerungsbeiträge,
Quelle: FAT
Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der
Anbaubeiträge, kantonale und private Ökobeiträge
Ausgaben für Grundlagenverbesserung
Tabelle 41
An die Kantone ausbezahlte Beiträge 2001
A50 A N H A N G
Kanton Bodenverbesserungen Landwirtschaftliche Gebäude Total Beiträge Fr Fr Fr ZH 1 948 925 361 200 2 310 125 BE 9 395 780 4 630 000 14 025 780 LU 2 634 630 1 283 900 3 918 530 UR 804 958 1 204 300 2 009 258 SZ 1 685 617 1 533 000 3 218 617 OW 533 000 774 800 1 307 800 NW 198 593 226 334 424 927 GL 176 400 340 700 517 100 ZG 110 000 110 000 FR 3 237 753 3 705 300 6 943 053 SO 1 811 239 174 800 1 986 039 BL 81 812 789 900 871 712 SH 29 144 64 800 93 944 AR 153 050 801 800 954 850 AI 336 096 427 600 763 696 SG 3 720 908 3 031 500 6 752 408 GR 13 807 717 2 252 200 16 059 917 AG 770 956 713 700 1 484 656 TG 854 739 272 800 1 127 539 TI 1 473 903 1 425 840 2 899 743 VD 7 220 176 1 013 400 8 233 576 VS 16 851 376 2 830 800 19 682 176 NE 1 164 778 1 235 800 2 400 578 GE 69 377 69 377 JU 2 829 545 952 616 3 782 161 Diverse 52 487 Total 71 790 472 30 157 090 102 000 049 Quelle: BLW
Tabelle 42
Beiträge an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2001
A N H A N G A51
Massnahme Beiträge Gesamtkosten Talregion Hügelregion Bergregion Total Total 1 000 Fr Bodenverbesserungen Landumlegungen (inkl Infrastrukturmassnahmen) 12 612 3 573 11 231 27 416 92 189 Wegebauten 274 1 840 9 939 12 053 40 389 Übrige Transportanlagen 534 534 2021 Massnahmen zum Boden-Wasserhaushalt 187 253 1 044 1 484 4 520 Wasserversorgungen 13 1 341 4 614 5 968 24 360 Elektrizitätsversorgungen 53 423 476 2 171 Wiederherstellungen und Sicherungen 835 269 15 683 16 787 30 756 Grundlagenbeschaffungen 44 40 Total 13 925 7 329 43 468 64 722 196 446 Landwirtschaftliche Gebäude Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere 9 802 18 681 28 483 176 936 Alpgebäude 2 064 2 064 13 599 Gemeinschaftsgebäude für Verarbeitung und Lagerung 421 421 6 129 Total 9 802 21 166 30 968 196 664 Gesamttotal 13 925 17 131 64 634 95 690 393 110 Quelle: BLW
Tabelle 43
Von den Kantonen bewilligte Investitionskredite 2001
A52 A N H A N G
Kanton Gemeinschaftliche Einzelbetriebliche Total Massnahmen Massnahmen Baukredite Investitionskredite Investitionskredite Anzahl 1 000 Fr Anzahl 1 000 Fr Anzahl 1 000 Fr Anzahl 1 000 Fr ZH 2 60 147 16 391 149 16 451 BE 25 7 711 11 2 449 441 45 110 477 55 270 LU 4 1 527 11 1 015 273 27 853 288 30 395 UR 1 30 27 2 236 28 2 266 SZ 15 2 083 51 5 792 66 7 875 OW 2 244 37 3 924 39 4 168 NW 1 16 13 1 300 14 1 316 GL 1 65 11 964 12 1 029 ZG 27 2 897 27 2 897 FR 10 864 205 25 339 215 26 203 SO 1 164 45 4 869 46 5 033 BL 45 4 183 45 4 183 SH 30 3 820 30 3 820 AR 1 100 37 3 316 38 3 416 AI 26 2 177 26 2 177 SG 4 516 14 1 135 223 22 559 241 24 210 GR 4 3 630 14 1 025 115 12 490 133 17 145 AG 1 44 107 11 466 108 11 510 TG 1 850 101 11 964 102 12 814 TI 1 507 9 832 9 1 353 19 2 692 VD 2 500 44 5 006 156 18 266 202 23 772 VS 6 1 089 15 2 091 55 4 822 76 8 002 NE 7 2 118 36 3 645 43 5 763 GE 184 300 5 308 JU 5 1 160 80 8 894 85 10 054 Total 62 17 663 151 19 176 2 301 245 929 2 514 282 767 Quelle: BLW
A N H A N G A53
Tabelle 44
Kanton Starthilfe Kauf des Wohn- Ökonomie- Boden- Verarbeitung Gemein- Total Betriebes gebäude gebäude verbes- und Lagerung schaftlicher durch serungen landw InventarPächter Produkte kauf 1 000 Fr ZH 5 218 173 2 265 8 765 30 16 451 BE 12 245 1 226 9 579 23 091 128 1 290 47 559 LU 9 941 80 6 701 11 131 250 665 100 28 868 UR 515 684 1 037 30 2 266 SZ 1 330 166 1 696 2 600 5 792 OW 760 220 1 211 1 777 200 4 168 NW 310 360 646 1 316 GL 90 220 719 1 029 ZG 1 090 138 1 669 2 897 FR 5 630 125 3 331 16 333 714 70 26 203 SO 1 810 411 643 2 005 164 5 033 BL 1 580 620 1 983 4 183 SH 1 355 312 2 154 3 820 AR 1 110 370 537 1 299 3 316 AI 400 158 425 1 194 2 177 SG 5 880 763 4 023 12 464 194 370 23 694 GR 2 710 2 917 7 385 408 95 13 515 AG 4 600 120 1 360 5 386 44 11 510 TG 2 590 220 1 880 7 274 850 12 814 TI 90 454 1 641 2 185 VD 6 650 776 2 207 10 607 2 183 849 23 272 VS 510 50 1 342 4 144 375 63 429 6 913 NE 740 315 581 2 009 1 220 898 5 763 GE 220 80 8 308 JU 2 610 795 5 609 1 015 25 10 054 Total 69 984 5 173 44 360 132 921 1 141 9 022 2 504 265 105 Quelle: BLW
Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2001 (ohne Baukredite)
Tabelle 45
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2001 (Bundes- und Kantonsanteile)
A54 A N H A N G
Kanton Anzahl Summe pro Fall Tilgungsdauer 1 000 Fr 1 000 Fr Jahre ZH 8 950 119 15 BE 51 6 130 120 15 LU 39 4 772 122 18 UR SZ 7 569 81 9 OW 3 300 100 11 NW 2 170 85 14 GL ZG FR 11 1 405 128 10 SO 9 1 015 113 15 BL 5 291 58 3 SH 7 515 74 9 AR 4 288 72 11 AI 1 90 90 10 SG 45 4 705 105 14 GR 8 585 73 15 AG 8 1 160 145 14 TG 5 568 114 14 TI 6 390 65 19 VD 32 4 909 153 13 VS 26 3 328 128 13 NE 6 593 99 12 GE JU 21 1 680 80 9 Total 304 34 413 Ø: 113 Ø: 14 Quelle: BLW
A N H A N G A55 Tabelle 46a Übersicht über Beiträge Massnahme Genehmigte Projekte in 1 000 Fr 1999 2000 2001 Beiträge 75 654 82 044 95 690 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen 30 814 27 124 27 416 Wegebauten 10 600 12 157 12 053 Wasserversorgungen 5 807 8 685 5 968 Andere Tiefbaumassnahmen 3 310 8 681 19 285 Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere 22 055 23 667 28 483 andere Hochbaumassnahmen 3 068 1 730 2 485 Quelle: BLW Tabelle 46b Übersicht über Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen Massnahme bewilligte Kredite in 1 000 Fr 1999 2000 2001 Investitionskredite 1 204 719 241 951 265 105 Starthilfe 57 525 71 385 69 984 Kauf Betrieb durch Pächter 2 949 2 737 5 173 Wohngebäude 33 679 47 082 44 360 Ökonomiegebäude 102 547 113 710 132 921 Gemeinschaftlicher Inventarkauf, Verarbeitung und Lagerung landwirtschaftlicher Produkte 5 264 4182 11 526 Bodenverbesserungen 2 755 2 855 1 141 Betriebshilfedarlehen 1 18 057 31 062 34 413 1 vom Kanton bewilligt Quelle: BLW Tabelle 47 Finanzhilfen für die Tierzucht 2001 Tierart und Massnahmen Betrag Herdebuchtiere Zuchtorganisationen Fr Anzahl Rinder 14 595 000 567 940 8 Herdebuchführung 2 831 000 Milch- und Fleischleistungsprüfungen 11 100 000 Exterieurbeurteilungen 664 000 Pferde 1 069 000 4 836 1 21 Schweine 1 650 000 236 2 Herdebuchzucht Mastleistungsprüfungs-Anstalt Sempach Schafe 1 101 000 87 421 2 Ziegen und Milchschafe 797 000 29 018 4 Herdebuchzucht Milchleistungsprüfungen Gefährdete Rassen 757 000 1 Total 19 969 000 689 451 38 1 identifizierte Fohlen Quellen: Staatsrechnung/Zuchtorganisationen
Anmerkung: Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete
So wurden z B die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung
1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen
Die Zahlen für 1990/92 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung
Die Zunahme der Verwaltungsausgaben ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Leistungen wie z B für die Pensionskassen in der Staatsrechnung nicht mehr zentral geführt sondern auf die einzelnen Ämter aufgeteilt werden
Quellen: Staatsrechnung BLW
A56 A N H A N G Tabelle 48 Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung, in 1 000 Fr Ausgabenbereich 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Ausgaben BLW 2 699 442 3 794 868 3 359 161 3 565 776 32 4 Produktion und Absatz 1 684 994 1 317 539 954 696 901 557 -37 2 Absatzförderung 49 546 59 521 59 998 Milchwirtschaft 1 127 273 1 052 228 716 156 666 149 -28 0 Viehwirtschaft 133 902 32 585 26 193 46 370 -73 8 Pflanzenbau 423 819 183 180 152 826 129 040 -63 4 Direktzahlungen 772 258 2 285 600 2 114 470 2 333 575 190 6 Allgemeine Direktzahlungen 758 332 1 846 188 1 758 985 1 916 580 142 7 Ökologische Direktzahlungen 13 926 439 412 355 485 416 995 2800 8 Grundlagenverbesserung 208 761 148 467 245 503 276 588 7 1 Strukturverbesserungen 133 879 76 400 88 000 102 058 -33 7 Investitionskredite 27 136 20 000 100 000 98 180 168 0 Betriebshilfe 952 4 987 7 753 30 000 1396 5 Beratungswesen und Forschungsbeiträge 21 476 23 226 22 015 23 039 6 0 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge 1 449 3 354 6 735 2 119 180 8 Pflanzen- und Tierzucht 23 869 20 500 21 000 21 192 -12 4 Verwaltung 33 429 43 262 44 492 54 056 41 4 Weitere Ausgaben 348 163 402 132 368 329 396 446 11 7 Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 93 867 129 466 111 842 98 355 20 6 Familienzulagen in der Landwirtschaft 77 996 90 420 91 230 91 447 16 7 Landwirtschaftliche Forschungsanstalten 96 431 99 472 117 619 122 127 17 3 Gestüt 6 843 5 525 6 514 7 008 -7 2 Übriges 73 026 77 249 54 687 77 509 -4 4 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 047 605 4 197 000 3 727 490 3 962 222 30 0
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Internationale Aspekte
Produzentenpreise tierische Erzeugnisse
EU-4: Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
EU-5: EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6: EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
D: Bundesrepublik Deutschland (inkl ehemalige DDR ab 1991)
Anmerkung: Die Zahlen in Kursivschrift sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen: BLW, BFS, SBV, Schweizerische Nationalbank, Eurostat, ZMP, Agreste, U S Department of Agriculture
A N H A N G A57
Tabelle 49
Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Rohmilch CH Rp /kg 104 97 80 93 79 41 79 90 -24 EU-5 Rp /kg 56 55 48 33 49 02 50 71 -13 - D Rp /kg 57 28 48 12 49 20 52 17 -13 - F Rp /kg 48 67 47 06 47 17 47 53 -3 - I Rp /kg 68 76 54 62 53 22 53 10 -22 - A Rp /kg 66 64 46 41 45 18 49 95 -29 - NL Rp /kg 57 93 46 08 49 51 51 88 -15 USA Rp /kg 40 57 47 60 45 79 55 81 23 Muni CH Fr /kg SG 9 28 7 67 8 85 6 85 -16 EU-4 Fr /kg SG 5 59 4 62 4 50 3 54 -25 - D Fr /kg SG 5 22 4 27 4 18 3 20 -26 - F Fr /kg SG 5 56 4 48 4 40 3 48 -26 - I Fr /kg SG 5 83 5 07 4 88 3 87 -21 - A Fr /kg SG 6 49 4 42 4 40 3 70 -36 USA Fr /kg SG 4 35 4 03 4 89 5 11 7 Kälber CH Fr /kg SG 14 39 10 84 13 13 12 03 -17 EU-5 Fr /kg SG 8 65 8 24 8 06 7 38 -9 - D Fr /kg SG 8 98 9 45 9 38 8 19 0 - F Fr /kg SG 8 94 8 86 8 85 8 42 -3 - I Fr /kg SG 8 81 7 35 7 05 6 78 -20 - A (ab 92) Fr /kg SG 9 60 7 57 7 36 6 38 -26 - NL Fr /kg SG 7 83 7 71 7 35 6 13 -10 USA Fr /kg SG 5 05 5 12 6 79 6 83 24 Schweine CH Fr /kg SG 5 83 4 37 4 69 4 54 -22 EU-6 Fr /kg SG 2 93 1 76 2 16 2 47 -27 - D Fr /kg SG 2 88 1 80 2 20 2 52 -24 - F Fr /kg SG 2 84 1 82 2 17 2 49 -24 - I Fr /kg SG 3 48 2 15 2 52 2 99 -27 - A Fr /kg SG 3 18 1 53 1 87 2 15 -42 - NL Fr /kg SG 2 64 1 47 1 91 2 00 -32 - B Fr /kg SG 3 01 1 65 2 17 2 55 -30 USA Fr /kg SG 1 88 1 35 2 02 2 08 -3 Poulets CH Fr /kg LG 3 72 2 84 2 81 2 76 -25 EU-5 Fr /kg LG 1 49 1 10 1 13 1 17 -24 - D Fr /kg LG 1 43 1 08 1 08 1 17 -23 - F Fr /kg LG 1 30 1 01 1 02 1 07 -20 - I Fr /kg LG 1 89 1 36 1 50 1 42 -25 - A Fr /kg LG 2 29 1 26 1 22 1 23 -46 - NL Fr /kg LG 1 36 0 93 0 94 1 09 -28 USA Fr /kg LG 0 98 1 21 1 34 1 47 36 Eier CH Fr /100 St 33 29 22 21 21 46 23 12 -33 EU-5 Fr /100 St 10 67 7 58 9 32 8 68 -20 - D Fr /100 St 13 12 8 83 10 66 9 71 -26 - F Fr /100 St 8 60 5 87 7 07 6 75 -24 - I Fr /100 St 12 86 11 09 12 66 11 54 -9 - A Fr /100 St 12 67 6 63 13 47 13 50 -12 - NL Fr /100 St 7 94 4 91 6 84 6 52 -23 USA Fr /100 St 7 55 7 53 9 10 8 66 12
EU-4: Nachbarländer Deutschland (D) Frankreich (F) Italien (I) und Österreich (A)
EU-5: EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6: EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
D: Bundesrepublik Deutschland (inkl ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–1998/2001
Anmerkung: Die Zahlen in Kursivschrift sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen: BLW, BFS, SBV, Schweizerische Nationalbank, Eurostat, ZMP, Agreste, U S Department of Agriculture
A58 A N H A N G
50a Produzentenpreise pflanzliche Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Weizen CH Fr /100 kg 99 34 75 41 66 35 55 65 -34 EU-4 Fr /100 kg 28 59 18 31 18 11 17 49 -37 - D Fr /100 kg 26 81 17 99 18 05 16 85 -34 - F Fr /100 kg 28 37 18 10 17 67 17 34 -38 - I Fr /100 kg 35 92 22 88 23 42 23 42 -35 - A Fr /100 kg 43 30 16 96 17 21 15 90 -61 USA Fr /100 kg 15 32 14 25 15 88 17 55 4 Gerste CH Fr /100 kg 70 24 48 83 48 52 45 08 -32 EU-4 Fr /100 kg 25 97 17 25 16 94 15 73 -36 - D Fr /100 kg 24 47 16 47 15 97 14 89 -36 - F Fr /100 kg 25 67 17 73 17 62 16 16 -33 - I Fr /100 kg 34 52 22 76 22 94 21 86 -35 - A Fr /100 kg 36 05 15 75 15 19 14 42 -58 USA Fr /100 kg 12 30 10 85 13 15 13 64 2 Körnermais CH Fr /100 kg 73 54 51 91 47 65 43 33 -35 EU-4 Fr /100 kg 33 72 21 19 20 21 19 03 -40 - D Fr /100 kg 30 44 19 01 18 57 17 55 -40 - F Fr /100 kg 29 63 19 67 19 29 18 27 -36 - I Fr /100 kg 40 80 24 96 22 68 21 26 -44 - A Fr /100 kg 36 37 17 00 17 20 15 42 -55 USA Fr /100 kg 12 76 11 16 12 23 12 53 -6 Kartoffeln CH Fr /100 kg 38 55 37 76 36 12 35 15 -6 EU-6 Fr /100 kg 16 99 23 86 10 77 14 34 -4 - D Fr /100 kg 13 69 20 61 9 56 9 85 -3 - F Fr /100 kg 15 50 24 00 10 52 13 35 3 - I Fr /100 kg 43 79 43 99 40 76 49 28 2 - A Fr /100 kg 30 36 16 87 17 34 13 80 -47 - NL Fr /100 kg 16 31 26 29 5 41 13 29 -8 - B Fr /100 kg 12 49 17 08 6 42 12 26 -5 USA Fr /100 kg 18 08 19 47 21 31 22 52 17 Zuckerrüben CH Fr /100 kg 14 84 11 85 11 58 13 30 -17 EU-4 Fr /100 kg 7 37 6 40 6 46 6 97 -10 - D Fr /100 kg 7 89 6 88 6 43 7 64 -11 - F Fr /100 kg 5 84 5 27 5 68 5 94 -4 - I Fr /100 kg 9 59 7 92 8 27 8 10 -16 - A (ab 92) Fr /100 kg 9 21 7 48 7 28 7 06 -21 USA Fr /100 kg Raps CH Fr /100 kg 203 67 146 11 61 26 79 57 -53 EU-4 Fr /100 kg 48 71 25 45 28 47 33 70 -40 - D Fr /100 kg 55 45 24 23 27 96 32 94 -49 - F Fr /100 kg 41 77 26 97 29 35 34 86 -27 - I Fr /100 kg 52 53 20 92 22 48 23 23 -58 - A (ab 92) Fr /100 kg 53 69 20 53 22 70 28 98 -55 USA Fr /100 kg Äpfel: Golden Delicious 1 CH Fr /kg 1 12 1 06 0 86 1 04 -21 EU-5 Fr /kg 0 79 0 52 0 46 0 50 -37 - D Fr /kg 1 07 0 56 0 49 0 55 -50 - F Fr /kg 0 68 0 57 0 46 0 40 -28 - I Fr /kg 0 75 0 47 0 47 0 58 -32 - A (diverse) Fr /kg 1 02 0 45 0 40 0 49 -57 - B Fr /kg 0 80 0 52 0 44 0 44 -37 USA (diverse) Fr /kg 0 66 0 59 0 73 0 66 -3
Tabelle
EU-4: Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
EU-5: EU-4 plus Belgien (B) oder Niederlande (NL)
EU-6: EU-4 plus Belgien (B) und Niederlande (NL)
EU-4/6: Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A) sowie Belgien (B) und/oder die Niederlande (NL) für gewisse Produkte
D: Bundesrepublik Deutschland (inkl ehemalige DDR ab 1991)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–1998/2001
2 Der Standardwarenkorb setzt sich aus den wichtigsten Produktionsvolumen der Schweiz im Durchschnitt der Jahre 1998–2000 zusammen
Anmerkung: Die Zahlen in Kursivschrift sind aufgrund von Indizes berechnet (Eurostat)
Quellen: BLW, BFS, SBV, Schweizerische Nationalbank, Eurostat, ZMP, Agreste, U S Department of Agriculture
A N H A N G A59 Tabelle 50b Produzentenpreise pflanzliche Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Birnen I 1 CH Fr /kg 1 33 1 09 0 88 1 17 -26 EU-5 Fr /kg 0 96 0 75 0 70 0 77 -22 - D Fr /kg 1 10 0 76 0 56 0 74 -37 - F Fr /kg 1 09 0 95 0 95 0 98 -8 - I Fr /kg 0 90 0 67 0 62 0 69 -27 - A (ab 92) Fr /kg 1 20 0 81 0 60 0 68 -41 - B Fr /kg 0 95 0 78 0 78 0 88 -11 USA Fr /kg 0 57 0 64 0 58 0 71 7 Karotten CH Fr /kg 1 09 1 05 1 15 1 20 4 EU-6 Fr /kg 0 52 0 54 0 52 0 64 8 - D Fr /kg 0 48 0 49 0 31 0 48 -10 - F Fr /kg 0 44 0 58 0 47 0 68 31 - I Fr /kg 0 83 0 72 0 88 1 02 5 - A Fr /kg 0 42 0 33 0 28 0 32 -26 - NL Fr /kg 0 39 0 47 0 51 0 40 19 - B Fr /kg 0 36 0 14 0 15 0 29 -46 USA Fr /kg 0 41 0 55 0 51 0 66 40 Zwiebeln CH Fr /kg 0 89 0 96 1 02 1 19 19 EU-5 Fr /kg 0 54 0 47 0 40 0 57 -11 - D Fr /kg 0 30 0 20 0 16 0 28 -29 - F Fr /kg 0 60 0 71 0 66 1 06 35 - I Fr /kg 0 70 0 52 0 38 0 41 -38 - A Fr /kg 0 25 0 16 0 16 0 22 -28 - B Fr /kg 0 21 0 25 0 19 0 29 14 USA Fr /kg 0 40 0 45 0 45 0 52 20 Tomaten CH Fr /kg 2 42 1 92 2 15 1 90 -18 EU-6 Fr /kg 0 98 0 82 0 86 0 73 -18 - D Fr /kg 0 89 1 04 1 10 0 97 16 - F Fr /kg 1 31 1 13 1 38 1 11 -8 - I Fr /kg 0 90 0 74 0 74 0 65 -21 - A (ab 92) Fr /kg 0 39 0 80 0 92 0 83 115 - NL Fr /kg 1 25 1 15 1 17 0 91 -14 - B Fr /kg 1 22 1 08 1 39 1 12 -2 USA Fr /kg 1 00 0 93 1 17 1 16 8 Standardwarenkorb 2 CH Mio Fr /Jahr 7200 5565 5635 5458 -23 EU-4/6 Mio Fr /Jahr 3683 2950 3004 3075 -18 - D Mio Fr /Jahr 3716 2974 3045 3135 -18 - F Mio Fr /Jahr 3376 2944 2965 2996 -12 - I Mio Fr /Jahr 4411 3368 3395 3479 -23 - A Mio Fr /Jahr 4362 2747 2808 2955 -35 USA Mio Fr /Jahr 2551 2646 2901 3267 15
EU-4: Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
Anmerkung zu Land: (min) und (max) --> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster, resp höchster Preis des betreffenden Landes
Anmerkung: Der Anteil der Labelprodukte (Bio, M-7, Coop Natura Plan) in den Geschäften ist insbesondere beim Fleisch in der Schweiz grösser als im Ausland
Quellen: BLW, BFS, ZMP, nationale Statistikämter von F, B, A, USA, Statistikamt der Stadt Turin (I)
A60 A N H A N G
Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Frischmilch CH Fr /l 1 85 1 58 1 55 1 55 -16 EU-4 Fr /l 1 30 1 13 1 09 1 13 -14 - min (D: 90/92, 99, 00, 01) Fr /l 1 07 0 93 0 86 0 91 -16 - max (I: 90/92, 99, 00, 01) Fr /l 1 82 1 75 1 77 1 82 -2 USA Fr /l 1 04 1 13 1 24 1 29 17 Käse CH-Emmentaler Fr /kg 20 15 20 66 20 18 20 59 2 EU-4 (mit B, ohne F) Fr /kg 15 98 13 55 12 65 12 54 -19 - min (D: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 13 52 11 30 10 09 10 06 -22 - max (I: 90/92, B: 99, 00, 01) Fr /kg 20 68 17 51 17 13 17 13 -17 USA (Cheddar) Fr /kg 11 14 12 49 14 26 14 99 25 Butter CH Fr /kg 13 76 11 68 11 76 12 12 -14 EU-4 Fr /kg 9 04 8 17 8 01 8 07 -11 - min (D: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 6 81 5 92 5 70 5 92 -14 - max (I: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 12 90 12 25 12 01 11 66 -7 USA Fr /kg 5 96 8 79 9 38 12 28 70 Rahm CH Fr / 1⁄2 l 3 58 2 95 2 79 2 79 -21 EU-3 (EU-4 mit B, ohne F+I) Fr / 1⁄2 l 1 25 1 01 0 95 0 98 -22 - min (D: 90/92, 99, 00, 01) Fr / 1⁄2 l 1 13 0 93 0 87 0 91 -20 - max (A: 90/92, B: 99, 00, 01) Fr / 1⁄2 l 2 53 1 67 1 64 1 62 -35 USA Fr / 1⁄2 l----Braten Rind CH Fr /kg 26 34 24 09 27 73 25 96 -2 EU-4 Fr /kg 16 00 15 14 14 92 14 84 -6 - min (F: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 11 85 11 92 11 76 11 78 0 - max (A: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 24 32 24 21 23 93 23 10 -2 USA Fr /kg 9 26 9 15 10 95 11 95 15 Braten Schwein CH Fr /kg 18 43 16 75 18 60 19 31 -1 EU-4 Fr /kg 11 80 10 90 10 99 12 02 -4 - min (A: 90/92, 99, 01; D: 00) Fr /kg 10 00 9 43 9 66 10 43 -2 - max (I: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 13 67 12 57 12 43 13 70 -6 USA Fr /kg Koteletten Schwein CH Fr /kg 19 88 18 26 19 80 20 74 -1 EU-4 Fr /kg 10 62 9 07 9 24 10 18 -11 - min (D: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 9 71 8 30 8 39 9 53 -10 - max (I: 90/92, 01; A: 99, 00) Fr /kg 12 43 10 42 10 36 11 06 -15 USA Fr /kg 10 02 10 51 12 54 13 11 20 Schinken CH Fr /kg 25 56 26 18 27 13 28 49 7 EU-4 Fr /kg 22 13 19 95 19 70 20 99 -9 - min (D: 90/92, 00, 01; F: 99) Fr /kg 20 38 18 07 18 63 19 80 -8 - max (I: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 27 15 24 59 23 17 23 49 -13 USA Fr /kg 8 85 9 49 10 39 10 20 13 Poulets frisch CH Fr /kg 8 41 8 43 8 49 9 13 3 EU-4 Fr /kg 5 72 4 93 4 93 5 39 -11 - min (F: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 4 84 3 82 3 86 4 13 -19 - max (I: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 6 17 5 71 5 89 6 31 -3 USA Fr /kg 2 74 3 50 3 99 4 11 41 Eier CH Fr /Sk 0 57 0 57 0 58 0 60 3 EU-4 (mit B, ohne F) Fr /Sk 0 25 0 25 0 25 0 25 0 - min (B: 90/92, 99, 00, 01) Fr /Sk 0 22 0 20 0 21 0 22 -7 - max (A: 90/92, 99, 00, 01) Fr /Sk 0 33 0 35 0 34 0 35 4 USA Fr /Sk 0 10 0 13 0 15 0 16 41
Tabelle 51 Konsumentenpreise tierische Erzeugnisse
EU-4: Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 (wegen Alternanz) und Veränderung 1990/93–1998/2001 Anmerkung zu Land: (min) und (max) --> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster, resp höchster Preis des betreffenden Landes
Quellen: BLW, BFS, ZMP, nationale Statistikämter von F, B, A, USA, Statistikamt der Stadt Turin (I)
A N H A N G A61 Tabelle 52 Konsumentenpreise pflanzliche Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1999 2000 2001 1990/92–1999/2001 % Weissmehl CH Fr /kg 2 05 1 80 1 75 1 67 -15 EU-4 (mit B, ohne F) Fr /kg 1 10 0 94 0 91 0 93 -15 - min (D: 90/92; B: 99, 00, 01) Fr /kg 0 79 0 82 0 79 0 78 1 - max (A: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 1 67 1 02 1 00 1 10 -38 USA Fr /kg 0 75 0 97 1 08 1 13 41 Weissbrot CH Fr / 1⁄2 kg 2 09 2 02 1 83 1 75 -11 EU-4 Fr / 1⁄2 kg 1 49 1 53 1 50 1 48 1 - min (D: 90/92, 99, 00, 01) Fr / 1⁄2 kg 1 16 1 06 0 99 0 97 -13 - max (A: 90/92, 99, 00, 01) Fr / 1⁄2 kg 2 98 2 85 2 98 2 96 -2 USA Fr / 1⁄2 kg 1 12 1 47 1 73 1 86 51 Kartoffeln CH Fr /kg 1 43 1 77 1 87 2 03 32 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 0 92 1 09 1 00 1 10 15 - min (B: 90/92, 99; D: 00, 01) Fr /kg 0 56 0 84 0 72 0 79 41 - max (A: 90/92; A: 99, 00, 01) Fr /kg 1 27 1 57 1 50 1 62 23 USA Fr /kg 1 04 1 31 1 41 1 45 34 Zucker CH Fr /kg 1 65 1 50 1 41 1 42 -13 EU-3 (EU-4 mit B, ohne F+I) Fr /kg 1 75 1 57 1 54 1 49 -12 - min (B: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 1 67 1 50 1 46 1 41 -13 - max (A: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 1 89 1 71 1 66 1 66 -11 USA Fr /kg 1 22 1 38 1 52 1 56 21 Pflanzenöl CH - Sonnenblumen Fr /l 5 05 4 46 3 96 3 75 -20 EU-4 (mit B, ohne D) Fr /l 2 81 2 48 2 34 2 26 -16 - min (I: 90/92, 99, 00, 01) Fr /l 1 94 2 26 2 12 2 01 10 - max (F: 90/92; F: 99, 00, 01) Fr /l 3 56 2 64 2 51 2 45 -29 USA - Salatöl (kg) Fr /l 2 26 2 88 3 25 3 29 39 Äpfel: Golden Delicious 1 CH Fr /kg 3 15 2 98 3 40 3 41 2 EU-4 (F/A: div Sorten) Fr /kg 3 16 2 49 2 37 2 50 -22 - min (A: 90/92; I: 99, 00, 01) Fr /kg 2 94 2 27 1 97 2 12 -27 - max (D: 90/92; F: 99, 00, 01) Fr /kg 3 25 2 70 2 72 2 79 -16 USA Fr /kg 2 58 2 97 3 42 3 23 22 Birnen 1 CH Fr /kg 3 25 3 26 3 36 3 46 3 EU-4 Fr /kg 3 43 2 66 2 75 2 75 -20 - min (D: 90/92; I: 99, 00, 01) Fr /kg 3 32 2 39 2 40 2 48 -26 - max (F: 90/92, 00, 01; A: 99) Fr /kg 3 62 2 95 3 17 3 07 -14 USA Fr /kg 2 52 3 15 3 59 3 60 32 Bananen CH Fr /kg 2 52 2 82 2 83 2 86 13 EU-4 Fr /kg 2 61 2 30 2 17 2 33 -13 - min (D: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 1 89 2 14 1 99 2 16 11 - max (I: 90/92; A: 99, 00, 01) Fr /kg 3 56 2 69 2 46 2 58 -27 USA Fr /kg 1 45 1 63 1 87 1 89 23 Karotten CH Fr /kg 1 91 1 78 1 78 2 11 -1 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 1 71 1 53 1 32 1 52 -15 - min (B: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 1 06 1 23 0 94 1 16 5 - max (I: 90/92, 00, 01; A: 99) Fr /kg 2 32 1 97 1 55 1 67 -25 USA Fr /kg 1 35 1 86 2 07 2 07 49 Zwiebeln CH Fr /kg 1 86 2 03 1 94 2 29 12 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 1 54 1 55 1 48 1 67 2 - min (B: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 0 92 1 05 0 92 0 99 7 - max (I: 90/92; F: 99, 00, 01) Fr /kg 1 75 2 07 1 92 2 08 15 USA Fr /kg 1 29 Tomaten CH Fr /kg 3 73 3 18 3 50 3 21 -12 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 3 60 2 96 3 37 3 14 -12 - min (F: 90/92; D: 99, 01; A: 00) Fr /kg 3 33 2 58 2 95 2 77 -17 - max (I: 90/92, 99, 00, 01) Fr /kg 4 41 3 37 3 81 3 73 -18 USA (Freiland) Fr /kg 3 29 4 54 5 15 4 92 48 Standarwarenkorb CH Fr /kg -4 EU-4/5 Fr /kg -9 Unteres Mittel EU Fr /kg -9 Oberes Mittel EU Fr /kg -8 USA Fr /kg 30
Stützung der landwirtschaftlichen Betriebe im Jahre 2001
A62 A N H A N G
Tabelle 53
Zusammensetzung Producer Support Estimate PSE Schweiz EU USA (Schätzwert der Produzentenstützung) 1986–88 1999 2000 2001p 2001p 2001p Mio Fr Mio Fr Mio Fr Mio Fr Mio Fr Mio Fr PSE in absoluten Werten 7 944 7 317 7 352 7 109 156 976 82 743 Marktpreisstützung 6 485 4 413 4 299 3 849 91 554 33 446 Zahlungen gebunden an die Produktion 102 261 331 381 6 197 12 131 Zahlungen gebunden an Anbauflächen / Anzahl Tiere 494 821 861 902 42 219 3 450 Zahlungen basierend auf Referenzperiode (Produktionsungebunden) 0 1 163 1 187 1 278 939 14 848 Zahlungen gebunden an den Verbrauch von Produktionsmitteln 647 303 317 348 9 610 12 411 Zahlungen mit Auflagen betreffend Produktionsmittelverbrauch 0 147 158 152 5 938 3 288 Zahlungen gebunden an das einzelbetriebliche Gesamteinkommen 00000 3 170 Diverse Zahlungen 216 208 200 200 518 0 PSE in Prozenten der Bruttoeinnahmen auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb 73 72 70 69 35 21 SNB-Devisenkurse 2001: Fr /US-$ 1 6886/ Fr /EURO 1 5103 Quelle: OECD
■■■■■■■■■■■■■■■■ Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft
Gesetze
– Bundesgesetz vom 29 April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910 1)
– Bundesgesetz vom 20 März 1959 über die Brotgetreideversorgung des Landes (Getreidegesetz, SR 916 111 0)
Bundesgesetz vom 4 Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB, SR 211 412 11)
– Bundesgesetz vom 4 Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG, SR 221 213 2)
– Bundesgesetz vom 8 Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG, SR 531)
Bundesgesetz vom 13 Dezember 1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632 111 72)
– Zolltarifgesetz vom 9 Oktober 1986 (ZGT, SR 632 10)
Bundesgesetz vom 20 März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz, SR 232 16)
– Bundesgesetz vom 20 Juni 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG, SR 836 1)
– Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700)
Bundesgesetz vom 9 Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817 0)
– Bundesgesetz vom 24 Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG, SR 814 20)
– Tierschutzgesetz vom 9 März 1978 (TSchG, SR 455)
Bundesgesetz vom 1 Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451)
– Bundesgesetz vom 7 Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG, SR 814 01)
Verordnungen
Allgemeines
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV, SR 910 91)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Erhebung und Bearbeitung von landwirtschaftlichen Daten (Landwirtschaftliche Datenverordnung, SR 919 117 71)
– Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (SR 919.118)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung, SR 912 1)
Produktion und Absatz
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Branchen- und Produzentenorganisationen (SR 919 117 72)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Unterstützung der Absatzförderung von Landwirtschaftsprodukten (Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung, SR 916 010)
– Verordnung vom 28 Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung, SR 910 12)
– Verordnung vom 22 September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die entsprechende Kennzeichnung der pflanzlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung, SR 910.18)
Verordnung vom 3 November 1999 über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV, SR 916 51)
– Allgemeine Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV, SR 916 01)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Kontingentierung der Milchproduktion (Milchkontingentierungsverordnung, MKV, SR 916 350 1)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über Zielpreis, Zulagen und Beihilfen im Milchbereich (Milchpreisstützungsverordnung, MSV, SR 916.350.2)
A N H A N G A63
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über die Höhe der Beihilfen für Milchprodukte sowie über Vorschriften für den Buttersektor und die Einfuhr von Vollmilchpulver (SR 916 350 21)
Verordnung vom 7 Dezember 1999 für den Übergang zur neuen Milchmarktordnung (Übergangsverordnung Milch, SR 916 350 3)
Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Milchwirtschaft (Milchqualitätsverordnung, MQV, SR 916 351 0)
Verordnung vom 13 April 1999 über die Qualitätssicherung bei der Milchproduktion (SR 916 351 021 1)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten, Speiseöl und Speisefetten sowie von Kaseinen und Kaseinaten (Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung, VEMSK, SR 916 355 1)
Verordnung des BLW vom 30 März 1999 über die Buttereinfuhr (SR 916 357 1)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung (Pferdeeinfuhrverordnung, PfEV, SR 916 322 1)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Schlachtvieh- und Fleischmarkt (Schlachtviehverordnung, SV, SR 916 341)
Geflügelverordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 (SR 916 341 61)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion (Höchstbestandesverordnung, HBV, SR 916 344)
– Verordnung vom 7. Juli 1971 über die Verwertung der inländischen Schafwolle (SR 916.361)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Eiermarkt (Eierverordnung, EiV, SR 916 371)
Eierverordnung des EVD vom 18 Juni 1996 (SR 916 371 1)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über Flächen- und Verarbeitungsbeiträge im Ackerbau (Ackerbaubeitragsverordnung, ABBV, SR 910 17)
– Allgemeine Verordnung vom 16 Juni 1986 zum Getreidegesetz (SR 916 111 01)
Verordnung des EVD vom 16 Juni 1986 über die Brotgetreideversorgung des Landes (Brotgetreideverordnung, SR 916 111 011)
Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr von Saatgetreide, Futtermitteln, Stroh und Waren, bei deren Verarbeitung Futtermittel anfallen (Einfuhrverordnung Saatgetreide und Futtermittel, SR 916 112 211)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Verwertung sowie die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln (Kartoffelverordnung, SR 916 113 11)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben (Zuckerverordnung, SR 916 114 11)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG, SR 916 121 10)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Marktentlastungsmassnahmen bei Steinobst und die Verwertung von Kernobst (Verordnung über die Massnahmen bei Obst, SR 916.131.11)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung, SR 916 140) – Verordnung des BLW vom 7 Dezember 1998 über das Rebsortenverzeichnis und über die Prüfung der Rebsorten (SR 916 143 5)
Direktzahlungen
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverorndung, DZV, SR 910 13)
Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS-Verordnung, SR 910 132 4)
Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren im Freien (RAUS-Verordnung, SR 910 132 5)
Verordnung vom 29 März 2000 über Sömmerungsbeiträge (Sömmerungsbeitragsverordnung, SöBV, SR 910 133)
– Verordnung vom 4 April 2001 über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV, SR 910.14)
Grundlagenverbesserung
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (Strukturverbesserungsverordnung, SVV, SR 913 1)
– Verordnung des BLW vom 7 Dezember 1998 über die Abstufung der pauschalen Ansätze für Investitionshilfen (PAUV, SR 913 211)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Betriebshilfe als soziale Begleitmassnahme in der Landwirtschaft (Betriebshilfeverordnung, BHV, SR 914 11)
– Verordnung vom 8. November 1995 über die landwirtschaftliche Forschung (VLF, SR 426.10)
A64 A N H A N G –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Verordnung vom 13 Dezember 1993 über die landwirtschaftliche Berufsbildung (VLB, SR 915 1)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Tierzucht (SR 916 310)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Produktion und das Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Saatgut-Verordnung, SR 916.151)
Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über Saat- und Pflanzgut von Acker- und Futterpflanzenarten (Saat- und Pflanzgut-Verordnung des EVD, SR 916 151 1)
– Verordnung des EVD vom 11 Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von anerkanntem Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Obst, Beerenobst und Reben (SR 916 151 2)
– Verordnung des BLW vom 7 Dezember 1998 über den Sortenkatalog für Getreide, Kartoffeln, Futterpflanzen und Hanf (Sortenkatalog-Verordnung, SR 916 151 6)
Verordnung vom 23 Juni 1999 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-Verordnung, SR 916 161)
– Verordnung vom 26 Januar 1994 über das Inverkehrbringen von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen (DüngerVerordnung, SR 916 171)
– Verordnung vom 28 Februar 2001 über Pflanzenschutz (Pflanzenschutzverordnung, PSV, SR 916 20)
– Verordnung des EVD vom 25. Januar 1982 über die Meldung von gemeingefährlichen Schädlingen und Krankheiten (SR 916 201)
– Verordnung vom 28 April 1982 über die Bekämpfung der San-José-Schildlaus, des Feuerbrandes und der gemeingefährlichen Obstvirosen (SR 916 22)
– Verordnung vom 26 Mai 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung, SR 916 307)
Verordnung des EVD vom 10 Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung, Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung, FMBV, SR 916 307 1)
– Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 16. Juni 1999 über die GVO-Futtermittelliste (SR 916.307.11)
Es bestehen folgende Möglichkeiten, die Gesetzestexte einzusehen oder zu beschaffen:
Zugriff via Internet www admin ch/ch/d/sr/sr html
– Bestellen beim BBL, Vertrieb Publikationen
via Internet www bundespublikationen ch
via Fax 031 325 50 58
A N H A N G A65
–
–
–
–
–
–
–
■■■■■■■■■■■■■■■■ Begriffe und Methoden
Begriffe
Abiotische Eigenschaften: Chemische oder physikalische Eigenschaften eines Raumes, wie klimatische Faktoren (Licht, Temperatur, usw ), Bodeneigenschaften, hydrologische Verhältnisse, Relief
Biotische Eigenschaften: Eigenschaften eines Raumes, der durch die darin vorkommenden Pflanzen und Tiere hervorgehen
Evaluation: Synonym auch für Erfolgskontrolle Evaluation ist eine Methode zur Ermittlung und Beurteilung der Effektivität (Mass der Zielerreichung), Wirksamkeit (Ursache-Wirkungs-Beziehung) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) von Massnahmen oder Instrumenten Im Voraus definierte Ziele sind Voraussetzung für eine Evaluation Evaluationen dienen v a für Vergleiche: Kontrollgruppenvergleich, vorher/nachher-Vergleich, Querschnittsvergleich
Externe Effekte: Externe Effekte oder Externalitäten sind positive oder negative Nebeneffekte auf Dritte oder die Gesellschaft, die durch Konsum- oder Produktionsvorgänge einzelner Akteure entstehen Sie werden nicht unmittelbar über den Markt bzw den Marktpreis erfasst und führen deshalb zu Marktverzerrungen und Fehlallokation von Gütern und Produktionsfaktoren Ziel einer rationalen Wirtschaftspolitik ist es, die externen Effekte zu internalisieren
Beispiele von Externen Effekten:
Produktion
Konsum
Negativ externe Effekte (soziale Kosten) Negative Beeinträchtigung von Übermässiger Konsum von Alkohol und Tabak Trink-, Grund- und Oberflächenwasser bringt hohe Kosten im Gesundheitswesen durch unsachgemässe Düngung
Positiv externe Effekte (soziale Nutzen) Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft Breitensport als Freizeitbeschäftigung durch die landwirtschaftliche Produktion senkt die Kosten des Gesundheitswesens
Landwirtschaftlicher Umweltindikator: Repräsentative Erhebung, die Daten über eine Ursache, einen Zustand, eine Umweltveränderung oder ein Umweltrisiko vereint, welche aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten hervorgehen und für die Entscheidungsträger von Bedeutung sind (z.B. Erosionsgrad der Böden; Definition der OECD).
Marktspanne: Differenz zwischen Konsumenten- und Produzentenpreis (absoluter Wert) bzw Anteil am Konsumentenfranken, der den Marktstufen Verarbeitung und Handel zukommt (relativer Wert) Der Begriff Marge wird als Synonym verwendet
Median: Zentralwert (statistische Grösse): Wert, der bei der Abzählung einer Reihe von der Grösse nach geordneten Merkmalswerten (z B Messreihe) in der Mitte liegt
Milchäquivalent: Ein Milchäquivalent entspricht dem durchschnittlichen Fett- und Proteingehalt eines kg Rohmilch (73 g) und dient als Massstab zur Berechnung der in einem Milchprodukt verarbeiteten Milchmenge
Mittel(wert): Durchschnitt (statistische Grösse): Summe der Zahlen einer Reihe dividiert durch die Anzahl der Zahlen.
Monitoring: Laufendes Beobachten anhand von Indikatoren über einen Zeitraum ohne problemorientiertes Erkennen der kausalen Zusammenhänge Resultat eines Monitorings sind Entwicklungen aufzuzeigen Beispiele: Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, Vogelpopulationen usw
A66 A N H A N G
Multifunktionalität der Landwirtschaft: Das Konzept einer multifunktionalen Landwirtschaft umschreibt die vielfältigen Funktionen, die die Landwirtschaft erfüllt Es umfasst die Leistungen, die über die eigentliche Agrarproduktion hinausgehen Hierzu zählen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, die Pflege der Kulturlandschaft, die Erhaltung der natürlichen Produktionsgrundlagen und Artenvielfalt, sowie der Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes. Eine multifunktionale Landwirtschaft trägt wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung bei Die multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft sind in der Bundesverfassung (Art 104) festgehalten
Öffentliche Güter: Öffentliche Güter zeichnen sich durch zwei Merkmale aus: Nichtrivalität und fehlendes Ausschlussprinzip Nichtrivalität im Konsum heisst, dass aufgrund des Konsums andere Konsumenten und Konsumentinnen nicht beeinträchtigt werden Fehlendes Ausschlussprinzip heisst, dass es bei öffentlichen Gütern nicht möglich ist, einzelne NutzerInnen vom Konsum auszuschliessen Öffentliche Güter sind zum Beispiel die Landesverteidigung, die Freizeiterholung im Wald, der Genuss einer naturnahen Landschaft Für öffentliche Güter existiert kein Markt und damit auch kein Marktpreis Aus diesem Grund müssen öffentliche Güter durch den Staat selbst oder in dessen Auftrag von Dritten bereitgestellt werden
Quartil: Viertel (statistische Grösse): Aufteilung einer der Grösse nach geordneten Reihe in vier Teile.
Schoggigesetz: Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632 111 72): Umsetzung des Protokolls 2 des Freihandelsabkommens Schweiz – EG von 1972 Ausgleich der Rohstoffpreisdifferenz zwischen Inland- und Weltmarktpreis für landwirtschaftliche Grundstoffe (Ausfuhr: Ausfuhrbeiträge / Einfuhr: bewegliche Teilbeträge)
Streuung: Varianz (statistische Grösse): Verteilung der Beobachtungen oder Messwerte um einen Mittelwert
Veredlungsverkehr: Veredlungsverkehr bedeutet, dass für Waren, die zur Bearbeitung, Verarbeitung oder Reparatur vorübergehend eingeführt werden, unter bestimmten Voraussetzungen Zollermässigung oder -befreiung gewährt wird Bei Landwirtschaftsprodukten und landwirtschaftlichen Grundstoffen wird der Veredlungsverkehr gewährt, wenn gleichartige inländische Erzeugnisse nicht in genügender Menge verfügbar sind oder für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachteil für die schweizerische Nahrungsmittelindustrie nicht durch andere geeignete Massnahmen ausgeglichen werden kann
Zielpreis: Vom Bundesrat festgelegte Orientierungsgrösse je kg vermarktete Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein Der Zielpreis soll für Milch erreicht werden können, die zu Produkten mit hoher Wertschöpfung verarbeitet und gut vermarktet wird Die Höhe des Zielpreises hängt insbesondere von der Einschätzung der Marktlage und den verfügbaren Mitteln zur Marktstützung ab. Die Zulage für die Fütterung ohne Silage wird dabei nicht berücksichtigt
Weitere Begriffe sind zu finden in:
– «Betriebswirtschaftliche Begriffe in der Landwirtschaft»
(Bezug bei: Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Länggasse 79, 3052 Zollikofen)
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (SR 910 91)
A N H A N G A67
–
Methoden
Milchpreiserhebung
Das BLW erhebt die Produzentenpreise monatlich und orientiert über die Ergebnisse in der Publikation «Milchbericht» Unterschieden werden dabei folgende vier Preise: gesamte Milch, Industriemilch, verkäste Milch und Biomilch Die Milchpreise werden nicht nur gesamtschweizerisch erhoben, sondern auch aufgeteilt in fünf Regionen: Region I: Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Jura und Teile des französischsprachigen Gebiets des Kantons Bern (Bezirke La Neuveville, Courtelary und Moutier) Region II: Bern (ausser Bezirke der Region I), Luzern, Unterwalden (Obwalden, Nidwalden), Uri, Zug und ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Schwyz und Küssnacht) Region III: Baselland und Basel-Stadt, Aargau und Solothurn Region IV: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, Appenzell (Innerrhoden und Ausserrhoden), St Gallen, ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Einsiedeln, March und Höfe), Glarus, Graubünden Region V: Wallis und Tessin
Die fünf Regionen der Preiserhebung
Quelle: BLW
An der Milchpreiserhebung, die gemäss Übergangsverordnung Milch bei den Milchverwertern durchzuführen ist, nehmen alle wichtigen industriellen Milchverarbeiter sowie eine repräsentative Auswahl an Käsereien teil. Auf diese Weise können über 60% der produzierten Milch erfasst werden Als ausbezahlter Milchpreis gilt gemäss Übergangsverordnung der Preis für Milch am Erfassungsort (ab Hof oder Sammelstelle), einschliesslich ortsüblicher Zulagen und Abzüge Die Zulage für die Fütterung ohne Silage, freiwillige Verbandsbeiträge sowie Abzüge für Molke sind im erhobenen Milchpreis nicht enthalten
A68 A N H A N G
I II III IV V
Berechnung der Bruttomargen
Milch und Milchprodukte
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung bei Milch und Milchprodukten beinhaltet in einem ersten Schritt eine theoretische Wertschöpfungsberechnung in den Segmenten Konsummilch, Käse, Butter, Konsumrahm und Joghurt Dabei wird die Wertschöpfung für die einzelnen Produkte je kg eingesetzte Rohmilch berechnet So können die Werte untereinander verglichen werden Die Wertschöpfung Milch und Milchprodukte stellt also die Differenz zwischen dem erzielten Grundpreis pro kg Rohmilch des Produzenten einerseits und dem Verkaufspreis je kg eingesetzte Rohmilch des des verarbeiteten Endprodukts dar
Die so berechnete Wertschöpfung wird in einem zweiten Schritt korrigiert um die jeweiligen produktspezifischen Eigenschaften So fliessen z B Beihilfen des Bundes, produktgebundene Ab- bzw Zuschläge und der Wert der anfallenden Nebenprodukte in die Berechnung der Einzelmargen ein Die Bruttomarge bei Milch und Milchprodukten ist das Resultat aus der Wertschöpfung und den produktspezifischen Eigenschaften Bei der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte handelt es sich um einen Zusammenzug aller Bruttomargen der Produktgruppen Konsummilch, Käse, Butter, Konsumrahm und Joghurt Diese setzen sich ihrerseits aus den Kalkulationen der beobachteten Indikatorprodukten zusammen.
Basis für die Berechnung der Gesamtsmarge Milch und Milchprodukte, sowie der Einzelmargen Konsummilch, Käse, Butter, Rahm und Joghurt bildet die in der Schweiz verwertete jährliche Rohmilchmenge Entsprechend ihrem Anteil an der Rohmilchmenge wird jede Verwertungsart gewichtet
Die Margenberechnung beschränkt sich auf die Wertschöpfung der in der Schweiz produzierten und konsumierten Milchprodukte Die verarbeitete Milchmenge muss daher um den exportierten Anteil korrigiert werden
Für die Erhebung der Konsumentenpreise wird zwischen den drei Verkaufskanälen Grossverteiler, Discounter und Fachhandel unterschieden Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des Institutes für Marktanalysen, Hergiswil (IHA GfM), nach Marktanteilen gewichtet
Bruttomarge Emmentaler (Oktober 2000)
A N H A N G A69
VP1/kg Emmentaler VP1/kg Rohmilch Milchgrundpreis Bruttomarge Emmentaler Ausbeute: 8% Beihilfen, Abgaben Wert der Nebenprodukte, etc F r / k g 1 VP = Verkaufspreis Quelle: BLW 0 20 44 1 64 0 81
Fleisch
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung auf Frischfleisch für den Konsum im Ladenverkauf ist ein Realwert (zum Preis von Januar 1999) ohne MwSt (oMwSt ) Sie wird in Fr pro kg Schlachtgewicht (SG) ausgedrückt Die Bruttomarge stellt die Differenz zwischen dem Rohertrag und dem Total der variablen Kosten dar. Dieser Wert besteht auch aus der Differenz zwischen den Nettoeinnahmen und dem Einstandspreis
Der Rohertrag entspricht dem Umsatz des Verarbeitungs- und Verteilungssektors bzw den Ausgaben der Konsumentinnen und Konsumenten (Privathaushalte und Grosshandel) Darin eingeschlossen sind der Verkauf von Frischfleisch für den Konsum sowie die Verwertung von Wurstfleisch, Haut und Schlachtnebenprodukten auf Grosshandelsstufe
Die gesamten variablen Kosten umfassen einerseits den bereinigten Einstandspreis des Viehs Es handelt sich hierbei um einen gewichteten Durchschnittspreis (konventionell, Label), franko Schlachthof Eine eventuelle Handelsspanne oder Transportkosten sind also in diesem Preis eingeschlossen, von dem jedoch sämtliche Vorteile aus den Einfuhren innerhalb des Zollkontingents abgezogen wurden Andererseits sind in den variablen Kosten die Auslagen für die Entsorgung von Schlachtabfällen, Kopf und Füssen; die Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und der Beitrag zum Basismarketing der Proviande enthalten.
Bruttomarge (BM2)
Frisches Bankfleisch
(Einzelhandelspreis)
15.54 Fr./kg SG
Nettoeinnahmen
16.62 Fr./kg SG
Einstandspreis beobach.
(EPb)
9.11 Fr./kg SG
8 28 Fr./kg SG
Wurstfleisch
(Grosshandelspreis)
0 56 Fr./kg SG
Schlachtabfälle für Verkauf (Grosshandelspreis)
0.64 Fr./kg SG
Schlachtabfälle und Knochen für Verbrennung
LSVA, Marketing,
0.12 Fr./kg SG
Imp (TIV)
0.77 Fr./kg SG
Einstandspreis bereinigt
(EPk)
8 34 Fr./kg SG
Anmerkung: Die Verhältnisse in dieser Abbildung sind nicht realitätsgetreu Die angegebenen Preise stellen ein Beispiel für die Berechnung der Bruttomarge auf frischem Rindfleisch im Jahr 2000 dar. Rechnungseinheit sind Fr. pro kg Schlachtgewicht warm (SG) zu Festpreisen (Realwert 01.1999) ohne MwSt. Quelle: BLW
Die detaillierte Definition der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung findet sich in den Sonderausgaben des «Marktberichtes Fleisch» von Januar 2001 und April 2002 (Nummer 140 und 155), der von der Sektion Marktbeobachtung des BLW herausgegeben wird Diese Nummern sind auf Anfrage erhältlich
A70 A N H A N G
R o h e r t r a g ( = K o n s u m e n t e n f r a n k e n ) : 1 6 . 7 4 F r . / k g S G T o t a l v a r i a b l e K o s t e n : 8 4 6 F r / k g S G
Früchte und Gemüse
Die Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse ist die Differenz zwischen dem Einstandspreis der ersten Handelsstufe eines Produktes, ausgenommen Gebinde- und Verpackungskosten, und dem Endverkaufspreis (inkl allfällige Gebinde- und Verpackungskosten). Sowohl die Daten des Inlandmarktes als auch diejenigen des Importmarktes fliessen in die Margenberechnungen ein. Beim Import sind die Zollabgaben enthalten Berücksichtigt werden dabei je sieben bedeutende, umsatzstarke Früchte und Gemüse Bei den Früchten sind dies Äpfel (Werte von Golden Delicious und den wichtigsten Lagersorten, sowie Granny Smith Import, mengengewichtet), Birnen (Werte Inlandbirnen und importierten Birnen ohne Abate- und Nashibirnen, mengengewichtet), Erdbeeren, Nektarinen, Kirschen, Aprikosen und Orangen Beim Gemüse sind es Tomaten (Fleischtomaten, runde Tomaten, beide mit mengengewichtetem Anteil), Blumenkohl, gelbe Zwiebeln, Karotten, Brüsseler Witloof, Gurken und Kartoffeln Die Mengengewichtungen stützen sich auf Zahlen des IHA · GfM, der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG), des Schweizerischen Obstverbandes (SOV), des Bundesamtes für Statistik (BFS) und der Oberzolldirektion (OZD)
Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung Früchte und Gemüse
Bruttomarge Gemüse
Der Einstandspreis der einzelnen Produkte setzt sich bei Inlandware aus dem Preis franko Verlader (bei Lagerware werden die Lagerkosten mitberücksichtigt) und bei Importware dem Importwert franko Grenze verzollt, beide mengengewichtet, zusammen Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA · GfM nach Marktanteilen gewichtet Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Gemüse zusammengefasst
Bruttomarge Früchte
Hier ist das periodische Hinzustossen und Wegfallen von nur kurz auftretenden saisonalen Früchten eine Besonderheit bei der Gesamtmarge Trotzdem kann diese Gesamtbetrachtung gerade im Mehrjahresvergleich wertvolle Anhaltspunkte liefern
Der Einstandspreis setzt sich bei Inlandware aus dem Produzentenpreis franko Sammelstelle und bei der Importware dem Importwert franko Grenze verzollt, beide mengengewichtet, zusammen. Lager- und Zinskosten sind berücksichtigt. Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA GfM nach Marktanteilen gewichtet Die Einzelmargen jedes Produktes werden in der Bruttomarge Früchte zusammengefasst
A N H A N G A71
P Import P Einstand P Inland P Endverkauf Bruttomarge Quelle: BLW
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung wird durch das Sekretariat des SBV im Auftrag und unter der Aufsicht des BLW sowie des BFS nach dem europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (Eurostat) berechnet. Die international anerkannte Methode erlaubt einen Vergleich mit anderen Ländern Die Ergebnisse werden an verschiedene internationale Organisationen (OECD, UNO) weitergeleitet
Darstellung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Endproduktion
Bestandesveränderung 1 Selbsterstellte Anlagen Verkäufe im Inland und Exporte Eigenverbrauch der Produzenten Rohprodukte verarbeitet durch Produzenten
Produktionswert
Zusammensetzung der Endproduktion
Beiträge der öffentlichen Hand
Endproduktion
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten Nettowertschöpfung zu Faktorkosten
Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte
Entlöhnung der familienfremden Arbeitskräfte
Pachten und Zinsen Abschreibungen
Unterkompensation der Mwst 2 Produktionssteuern Vorleistungen
1 In diesem Schema wird der Endbestand höher angenommen als der Anfangsbestand so dass eine positive Bestandesveränderung resultiert
Einnahmen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit
Wertschöpfung
Verwendung der Einnahmen
2 Wenn die Mwst auf den Verkäufen landwirtschaftlicher Produkte nicht gleich hoch ist wie die auf den Ankäufen von Vorleistungen und Investitionsgütern bezahlten Steuern wird sie in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgeglichen Wurde auf der Produktionsseite mehr als auf der Kostenseite verrechnet wird diese Überkompensation als zusätzliche Einnahmequelle betrachtet Bis jetzt war in der Schweiz immer eine Unterkompensation zu verzeichnen
Quelle: SBV
Der Produktionswert der Landwirtschaft (Endproduktion) entspricht dem Geldwert sämtlicher Agrarerzeugnisse der Schweiz und bildet zusammen mit den Beiträgen der öffentlichen Hand (Subventionen) die Einnahmen aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit Auf Seite der Ausgaben sind die Vorleistungen (Kosten für Energie, Unterhalt sowie andere Güter und Dienstleistungen) die gewichtigste Position Aus der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben resultiert das Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte Dieses sektorale Einkommen dient als Entschädigung der Arbeit der Familienarbeitskräfte und des investierten Eigenkapitals Es ist auf einzelbetrieblicher Ebene (Buchhaltungsdaten) in etwa mit dem landwirtschaftlichen Einkommen vergleichbar
A72 A N H A N G
Zentrale Auswertung der FAT
Neue Auswertungsmethodik
Mit den Buchhaltungsabschlüssen des Jahres 1999 erfuhr die Zentrale Auswertung grundlegende methodische Änderungen. In der Vergangenheit wurden für die Ermittlung der Einkommen restriktiv abgegrenzte «Testbetriebe» verwendet (z B Beschränkung des Nebenverdienstes, Forderung einer Fachschulbildung) Auf Grund der bewussten positiven Selektion der Testbetriebe konnten konsequenterweise auch nur Aussagen über diese Betriebe selbst gemacht werden Im neuen System erlauben die sogenannten «Referenzbetriebe» repräsentative Aussagen über die gesamte Landwirtschaft
Überblick über die methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung
– Als Grundgesamtheit werden diejenigen schweizerischen Betriebe bezeichnet, die grundsätzlich als Referenzbetriebe für die Zentrale Auswertung in Frage kommen Dazu müssen sie minimale physische Schwellen erreichen Sobald ein Betrieb z B mindestens 10 ha Land bewirtschaftet oder mindestens 6 Kühe hält, gehört er zur Grundgesamtheit Die Grundgesamtheit umfasst rund 57‘000 Betriebe, was rund 90% der bewirtschafteten Fläche und rund 90% der Produktion entspricht.
– Aus der Grundgesamtheit werden ca 3‘500 Referenzbetriebe ausgewählt
Da die Strukturen der Referenzbetriebe der Zentralen Auswertung von den Strukturen in der Gesamtlandwirtschaft abweichen, werden die Buchhaltungsergebnisse gewichtet Dazu wird aus der Betriebsstrukturerhebung die Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrössen, Betriebstypen und Zonen herangezogen Mit diesem Vorgehen ist gewährleistet, dass z B Buchhaltungsergebnisse von kleineren Betrieben, die in der Auswahl der Referenzbetriebe untervertreten sind, in der Auswertung das entsprechende Gewicht erhalten.
– Eine neue Betriebstypologie erlaubt eine bessere Unterscheidung der agrarpolitisch bedeutenden Betriebstypen Rund zwei Drittel der Betriebe entfallen auf sieben spezialisierte Betriebstypen, die eine Konzentration auf bestimmte Betriebszweige des Pflanzenbaus oder in der Tierhaltung aufweisen Das restliche Drittel teilt sich auf in vier Typen kombinierter Betriebe (vgl weiter unten)
Die weiter gefasste Grundgesamtheit und die Gewichtung verbessert die Aussagekraft der Ergebnisse der Zentralen Auswertung für die gesamte Landwirtschaft erheblich. Auch die internationale Vergleichbarkeit der Buchhaltungsdaten wird erleichtert. Die methodischen Änderungen sind insgesamt derart bedeutend, dass eine Vergleichbarkeit mit älteren Berichten der Zentralen Auswertung nicht mehr gegeben ist Um dennoch Mehrjahresvergleiche anstellen zu können, wurden die Buchhaltungsergebnisse der Vorjahre ebenfalls mit der neuen Methodik berechnet
Die neue Betriebstypologie FAT99
Im Rahmen der methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung der FAT wurde die alte Betriebstypologie nach Grüner Kommission (1966) durch eine neue Typologie (FAT99) ersetzt Neben der Verwendung in der Ergebnisdarstellung wird die Betriebstypologie für den Auswahlplan der Betriebe der Zentralen Auswertung und für die Gewichtung der einzelbetrieblichen Ergebnisse eingesetzt
Die Einteilung der Betriebe nach der neuen Typologie erfolgt ausschliesslich auf der Basis von physischen Kriterien, nämlich Flächen und GVE verschiedener Tierkategorien. Mit insgesamt zehn Kennzahlen bzw. acht Quotienten je Betrieb ist eine differenzierte und eindeutige Einteilung möglich
A N H A N G A73
–
Definition der neuen Betriebstypologie FAT99
Die Kriterien in einer Zeile müssen alle gleichzeitig erfüllt sein
Abkürzungen:
GVE Grossvieheinheit
LN Landwirtschaftliche Nutzfläche in ha
GVE/LN Viehbesatz je ha LN
OAF/LN Anteil offene Ackerfläche an LN
SKul/LN Anteil Spezialkulturen an LN
RiGVE/GVE Anteil Rindvieh-GVE am Gesamtviehbestand
VMiK/RiGVE Anteil Verkehrsmilchkühe am Rindviehbestand
MAK/RiGVE Anteil Mutter-/Ammenkühe am Rindviehbestand
PSZ/GVE Anteil Pferde- Schaf- und Ziegen-GVE am Gesamtviehbestand
SG/GVE Anteil Schweine- und Geflügel-GVE am Gesamtviehbestand
Quelle: FAT
Es werden sieben spezialisierte und vier kombinierte Betriebstypen unterschieden Die spezialisierten Pflanzenbaubetriebe (11 und 12) verfügen über einen Viehbesatz von weniger als einer GVE je ha LN. Bei den Ackerbaubetrieben überschreitet der Anteil offener Ackerfläche 70% der LN, für die Spezialkulturbetriebe liegt der Anteil entsprechender Kulturen über 10% Die spezialisierten Tierhalter (21 bis 41) haben als gemeinsame Beschränkung maximal 25% offene Ackerfläche und maximal 10% Spezialkulturfläche Die Verkehrsmilchbetriebe weisen über 25% des Rindviehbestandes als Milchkühe mit vermarkteter Milch (Verkehrsmilch) aus, analog werden die Mutterkuhbetriebe abgegrenzt In der verbleibenden Gruppe «Anderes Rindvieh» befinden sich vor allem Betriebe mit Milchkühen ohne Kontingent (spezialisierte Kälbermäster oder Aufzuchtbetriebe im Berggebiet) In den Veredlungsbetrieben machen Schweine- und Geflügel-GVE mehr als die Hälfte des Viehbestandes aus Betriebe, die sich keinem der sieben spezialisierten Betriebstypen zuteilen lassen, gelten als kombinierte Betriebe (51 bis 54)
A74 A N H A N G
Bereich Betriebstyp GVE/ OAF/ SKul/ RiGVE/ VMiK/ MAK/ PSZ/ SG/ Andere LN LN LN GVE RiGVE RiGVE GVE GVE Bedingungen 11 Pflanzenbau Ackerbau max über max 1 70% 10% 12 Spezialkulturen max über 1 10% 21 Tierhaltung Verkehrsmilch max max über über max 25% 10% 75% 25% 25% 22 Mutterkühe max max über max über 25% 10% 75% 25% 25% 23 Anderes Rindvieh max max über nicht 21 25% 10% 75% oder 22 31 Pferde/Schafe/ max max über Ziegen 25% 10% 50% 41 Veredlung max max über 25% 10% 50% 51 Kombiniert Verkehrsmilch/ über über über max nicht Ackerbau 40% 75% 25% 25% 11– 41 52 Mutterkühe über max über nicht 75% 25% 25% 11– 41 53 Veredlung über nicht 25% 11– 41 54 Andere nicht 11– 53
Aspekte der Darstellung
Artikel 7 der Nachhaltigkeits-Verordnung legt fest, dass die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft auch regionenweise zu beurteilen ist Dementsprechend werden auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung drei Regionen definiert:
Talregion: Ackerbauzone, Übergangszonen
– Hügelregion: Hügelzone, Bergzone I
– Bergregion: Bergzonen II bis IV
Abgrenzung Tal-, Hügel- und Bergregion (Zuteilung der Gemeinden nach grösstem Zonenanteil)
Talregion
Um eine differenzierte Beurteilung der Streuung von bestimmten Kennzahlen zu erreichen, werden die Betriebe in Quartile eingeteilt Einteilungskriterium ist der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft (FJAE) In jedem Quartil (0–25% / 25–50% / 50–75% / 75–100%) befinden sich je ein Viertel der Betriebe aus der Grundgesamtheit
Die Darstellung nach Quartilen erlaubt eine ökonomisch differenzierte Beurteilung Auf eine ökologische Differenzierung wird verzichtet, weil der Anteil der Referenzbetriebe ohne ÖLN weniger als 3% ausmacht und die Differenz der Arbeitsverdienste minimal ist
A N H A N G A75
–
Gemäss Artikel 5 LwG ist die wirtschaftliche Lage «im Durchschnitt mehrerer Jahre» zu beurteilen Bei Entwicklungen werden deshalb mehrere Jahre dargestellt Die statischen Betrachtungen stellen auf das aktuellste verfügbare Drei-Jahresmittel (1998/2000) ab Hügelregion Bergregion Quelle: AGIS-Daten 1998 BLW Gemeindegrenzen: © BFS GEOSTAT
Einkommensvergleich
Für die Gegenüberstellung der Arbeitseinkommen wird auf der Seite der Landwirtschaft der Arbeitsverdienst und auf der Seite der übrigen Bevölkerung ein Jahres-Bruttolohn ermittelt Die Lohnsituation der übrigen Bevölkerung wird durch die vom BFS alle zwei Jahre durchgeführte Lohnstrukturerhebung erfasst. In den dazwischen liegenden Jahren werden die Werte mit Hilfe der Entwicklung des Lohnindexes aktualisiert Die Lohnstrukturerhebung gibt einen repräsentativen Überblick über die Lohnsituation der Beschäftigten in der Industrie (Sekundärsektor) und im Dienstleistungsbereich (Tertiärsektor)
Erfasste Lohnkomponenten (gemäss Lohnstrukturerhebung BFS)
Bruttolohn im Monat Oktober (inkl Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherung, Naturalleistungen, regelmässig ausbezahlte Prämien-, Umsatz- oder Provisionsanteile), Entschädigungen für Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit, 1⁄12 vom 13 Monatslohn und 1⁄12 von den jährlichen Sonderzahlungen
Standardisierung: Umrechnung der erhobenen Beiträge (inkl Sozialabgaben) auf eine einheitliche Arbeitszeit von 4 1⁄3 Wochen à 40 Stunden
Die Werte der Lohnstrukturerhebung werden auf Jahres-Bruttolöhne umgerechnet Anschliessend wird für jede Region der Median über alle im 2 und 3 Sektor Beschäftigten gebildet
Auf Seite der Landwirtschaft wird als Pendent zu den Jahres-Bruttolöhnen der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst pro FJAE berechnet Die Basis für eine FJAE sind 280 Arbeitstage, wobei eine Person maximal 1,0 FJAE entspricht
Berechnung des landwirtschaftlichen Arbeitsverdienstes
Landwirtschaftliches Einkommen
Zins für das im Betrieb investierte Eigenkapital
(mittlerer Zinssatz für Bundesobligationen)
= Arbeitsverdienst der Betriebsleiterfamilie
: Anzahl Familienarbeitskräfte (FJAE)
(Basis: 280 Arbeitstage)
= Arbeitsverdienst pro FJAE
A76 A N H A N G
–
Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen (Stand August 2002)
Allgemeine Anforderungen
Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben Keine Direktzahlungen gibt es für Betriebe des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sowie für Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, deren Tierbestände die Grenzen der Höchstbestandesverordnung überschreiten Ebenfalls ausgeschlossen sind juristische Personen, sofern es sich nicht um Familienbetriebe handelt (Artikel 2 Direktzahlungsverordnung)
Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, welche Direktzahlungen beantragen, müssen der kantonalen Behörde den Nachweis erbringen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ÖLN oder nach vom Bundesrat anerkannten Regeln bewirtschaften (vgl hierzu Ausführungen weiter hinten)
Weitere Bedingungen
Die Beitragsberechtigung ist an weitere strukturelle und soziale Kriterien geknüpft Die Übersicht fasst die Bedingungen für die Ausrichtung der Direktzahlungen stichwortartig zusammen
Bedingungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen
Mindestgrösse des Betriebes
Minimaler Arbeitsbedarf
Betriebseigene Arbeitskräfte
1 ha
Spezialkulturen: 50 Aren
Reben in Steil- und Terrassenlagen: 30 Aren
0,3 Standard-Arbeitskräfte (SAK)
Mindestens 50% der für die Bewirtschaftung erforderlichen Arbeiten mit betriebseigenen Arbeitskräften (Familie und Angestellte) ausführen
Alter des Bewirtschafters bis 65 Jahre Beitragsbegrenzungen
Fläche in ha Tiere in GVE Ansatz
maximaler Betrag pro SAK
55 000 Fr
– steuerbares Einkommen (vermindert um 30 000 Fr für verheiratete Summe der Direktzahlungen wird ab 80 000 Fr steuerbares Einkommen Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter) reduziert
– massgebliches Vermögen (steuerbares Vermögen, vermindert um Summe der Direktzahlungen wird ab 800 000 Fr massgebliches Vermögen 200 000 Fr pro SAK und um 200 000 Fr für verheiratete reduziert; übersteigt das massgebliche Vermögen 1 Mio Fr werden keine Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter) Direktzahlungen ausbezahlt
Quelle: Direktzahlungsverordnung
A N H A N G A77
–
Abstufung
in %
30 45 100 30–60 45–90 75 60–90 90–135 50 über 90 135 0 –
bis
plus 20%
Quelle: Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
Die Berechnung der SAK wird mit Umrechnungsfaktoren für die LN und die Nutztiere vorgenommen Für gewisse Nutzungen wie z B den arbeitsaufwendigeren biologischen Landbau, gibt es Zuschläge. Die Faktoren sind abgeleitet aus der standardmässigen Erfassung arbeitswirtschaftlicher Abläufe Sie sind für den Vollzug der Direktzahlungen und der Massnahmen zur Strukturverbesserung vereinfacht worden Für die Berechnung des effektiven Arbeitsbedarfs sind sie nicht geeignet, weil dieser von den speziellen Eigenschaften des einzelnen Betriebes wie der Oberflächengestaltung, der Arrondierung, den Gebäudeverhältnissen und dem Mechanisierungsgrad abhängt
Artikel 20 Direktzahlungsverordnung
Die prozentuale Abstufung gilt für sämtliche Beitragsarten mit Ausnahme der Sömmerungs- und der Gewässerschutzbeiträge
A78 A N H A N G Landwirtschaftliche Nutzfläche SAK/ha LN ohne Spezialkulturen 0,035 Spezialkulturen 0,400 Rebflächen in Steil- und Terrassenlage 1,000 Nutztiere SAK/GVE Milchkühe, Milchschafe, Milchziegen 0,05 Mastschweine 0,01 Zuchtschweine 0,02 andere Nutztiere 0,04 Zuschläge für Hanglagen im Berggebiet/Hügelzone 0,02
Hochstamm-Feldobstbäume
SAK pro ha für biologischen Landbau wie bei LN
für
0,01 SAK/10 Bäume
Abstufung der Beiträge nach
Flächen 1–30 ha >30–60 ha >60–90 ha >90 ha % d e s B e i t r a g s s a t z e s Tierbestand / Nutztiere 1–45 RGVE >45–90 RGVE >90–135 RGVE >135 RGVE % d e s B e i t r a g s s a t z e s 0 100 75 50 0 100 75 50
Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN)
Der ÖLN strebt eine gesamtheitliche Betrachtung der Agro-Ökosysteme und der landwirtschaftlichen Betriebe an Zu diesem Zweck wurden der bei der Integrierten Produktion (IP) entwickelte Ansatz übernommen. So wird der ÖLN aufgrund der Auflagen der IP (Stand 1996) konkretisiert Zusätzlich hat der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachzuweisen, dass die Vorschriften des Tierschutzgesetzes eingehalten werden Somit ist die IP, ergänzt mit den Auflagen der Tierschutzbestimmungen, zum Standard der Landwirtschaft in der Schweiz geworden Direktzahlungen werden nur an Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ausbezahlt, die den ÖLN erbringen Für Betriebe auf denen der ÖLN nicht erfüllt ist, erhielten bis zum 31 Dezember 2001 Direktzahlungen; diese aber mit einer Kürzung Mit der Einführung des ÖLN wurden Auflagen der Integrierten Produktion (IP, Stand 1996) übernommen Die Einführung von Direktzahlungen hat die Bewirtschaftungsmethoden und dadurch die Ökologie ganz wesentlich beeinflusst Dies zeigt die starke Zunahme der nach den ÖLN- und Bio-Richtlinien bewirtschafteten Flächen: Zu Beginn der ersten Etappe der Agrarreform im Jahre 1993 betrug dieser Anteil knapp 20% der LN Heute sind es etwa 96% der LN Dank gezielten finanziellen Anreizen konnte diese hohe Beteiligung der Betriebe erreicht werden Zusätzlich ist noch zu vermerken, dass gewisse Betriebe, wie z B Staatsbetriebe oder juristische Personen im Direktzahlungssystem nicht erfasst sind, obwohl sie die ÖLN- oder Bio-Anforderungen erfüllen
Der ÖLN umfasst die folgenden Punkte:
– Aufzeichnungs- und Nachweispflicht: Wer Direktzahlungen beansprucht, erbringt der kantonalen Behörde den Nachweis, dass er die ökologischen Leistungen auf dem gesamten Betrieb erfüllt Als Nachweis gilt das Attest einer vom Kanton beigezogenen Kontrollorganisation Um diese Bestätigung zu erhalten, macht der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin regelmässige Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs
– Tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere: Die Bestimmungen der Tierschutzverordnung sind einzuhalten. Dabei gilt die Beweislastumkehr, das heisst, der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat zu belegen, dass auf dem Betrieb das Tierschutzgesetz eingehalten wird
Ausgeglichene Düngerbilanz: Um die Nährstoffverluste in die Umwelt zu verringern und möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe zu erzielen, muss die Stickstoff- und Phosphorzufuhr aufgrund des Bedarfs der Pflanzen und des Produktionspotenzials des Betriebs berechnet werden Mit der Düngerbilanz werden prioritär die Hofdünger eingesetzt; Mineraldünger und Abfalldünger werden nur wenn nötig eingesetzt Eine Toleranzgrenze von plus 10% wird gewährt
Mindestens alle zehn Jahre sind parzellenweise Bodenanalysen durchzuführen, um die Nährstoffreserven im Boden zu ermitteln und die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit notwendige Düngermenge entsprechend anzupassen
Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF): Mindestens 3,5% der LN bei Spezialkulturen und 7% bei der übrigen LN sind mit ÖAF zu belegen Entlang von Wegen sind Wiesenstreifen von mindestens 0,5 m und entlang von Oberflächengewässern, Hecken, Feldgehölzen, Ufergehölzen und Waldrändern von mindestens 3 m zu belassen
– Geregelte Fruchtfolge: Für Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche muss zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit der Pflanzen die Fruchtfolge jedes Jahr mindestens vier Kulturen umfassen Zudem sind Höchstanteile der Hauptkulturen an der Ackerfläche oder Anbaupausen vorgeschrieben
A N H A N G A79
–
–
–
Geeigneter Bodenschutz: Für jede Kultur ist ein Bodenschutzindex festgelegt Damit Bodenerosion, Nährstoffverluste und Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln verringert werden, muss jeder Betrieb mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche einen minimalen mittleren Bodenschutzindex erreichen Beim Ackerbau beträgt dieser 50 Punkte, beim Gemüsebau 30 Punkte Die Stichtage sind jeweils der 15 November und der 15 Februar
Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln: Pflanzenbehandlungsmittel können in die Luft, den Boden und die Gewässer gelangen und nachteilige Auswirkungen auf Organismen haben Daher sind natürliche Regulationsmechanismen und biologische Verfahren vorzuziehen. Im Acker- und Futterbau sind gewisse Behandlungsverfahren (z.B. Vorauflaufbehandlung mit Herbiziden bei Weizen) verboten Bei den Spezialkulturen werden mit gewissen Verwendungseinschränkungen zugelassene Produkte in regelmässig aktualisierten Listen aufgeführt
A80 A N H A N G Beispiele von Höchstanteilen in
Ackerfläche – Getreide (ohne Mais und Hafer) 66 – Weizen und Korn 50 – Mais 40 – Hafer 25 – Rüben 25 – Kartoffeln 25 –
% der
Beispiele
Bodenschutzindex
Ackerbau Punkte Raps 80 Wintergerste, Triticale, Roggen, Winterhafer 50 Winterweizen, Korn 40 Kunstwiese bis 15 November 80 Kunstwiese bis 15 Februar 100 –
für den
im
Einhaltung von Gesetzen
Wird die Einhaltung landwirtschaftsrelevanter Vorschriften wie diejenigen des Gewässer-, des Umwelt- sowie des Natur- und Heimatschutzgesetzes verletzt, kommt zusätzlich zur Busse eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Direktzahlungen hinzu.
Nachfolgend einige Beispiele von Vorschriften, deren Verletzung Sanktionen zur Folge haben kann:
Einhaltung der Sorgfaltspflicht um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Artikel 3 Gewässerschutzgesetz);
– Verbot, Stoffe die Gewässer verunreinigen können in ein Gewässer einzubringen, oder versickern zu lassen oder so zu lagern oder auszubringen, dass dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (Artikel 6 Gewässerschutzgesetz);
Nichteinhalten der DGVE-Grenzwerte nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz (gemessen an der düngbaren LN);
– Nicht vorschriftsgemässe Lagerkapazität für Hofdünger nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz;
– Zerstörung oder Beschädigung eines vom Bund oder Kanton geschützten Biotopes, insbesondere Riedgebiete und Moore, Hecken, Feldgehölze und Trockenstandorte , sowie eines geschützten Natur- oder Kulturdenkmals, eine geschützte geschichtliche Stätte oder eine geschützte Naturlandschaft (inkl Moorlandschaft), sofern sie durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung verursacht wird (Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 18 Absatz 1bis Natur- und Heimatschutzgesetz);
– Verstösse gegen das Verbot von Verbrennen von Abfällen (Artikel 26 Luftreinehalteverordnung)
Verstösse gegen die Vorschriften werden je nach Vorgeschichte und Wirkung der Widerhandlung im Einzelfall einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet:
– Erstmalige Verstösse ohne Dauerwirkung Beispiel: Einmaliges gewässerschutzwidriges Güllen (Kürzung um 5 bis 25%, höchstens 2‘500 Fr );
– Erstmalige Verstösse, deren Wirkung andauert oder deren Handlung oder Unterlassung sich über eine mehrere Tage, Wochen oder Monate umfassende Zeitspanne erstreckt Beispiel: Unbefestigter Miststock Mehrmaliges gewässerschutzwidriges Güllen an verschiedenen Tagen (Kürzung um 10 bis 50%, höchstens 10‘000 Fr );
Wiederholte Verstösse, also Widerhandlungen gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von drei Jahren Massgebend sind die Vorfälle ab dem Jahr 1999 (Kürzung um 20 bis 100%)
A N H A N G A81
–
–
–
Abkürzungen
Organisationen/Institutionen
BAG Bundesamt für Gesundheit, Bern
BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Bern
BLW Bundesamt für Landwirtschaft, Bern
BSV Bundesamt für Sozialversicherung, Bern
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern
BVET Bundesamt für Veterinärwesen, Bern
BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, Bern
ETH Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich
EU Europäische Union
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Bern
FAL Eidg Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Zürich-Reckenholz
FAM Eidg Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, Bern-Liebefeld
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rom
FAT Eidg Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik, Tänikon
FAW Eidg Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil
FiBL Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, Frick
IAW Institut für Agrarwirtschaft, Zürich
LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris
OZD Oberzolldirektion, Bern
RAC Eidg Forschungsanstalt für Pflanzenbau, Changins
RAP Eidg Forschungsanstalt für Nutztiere, Posieux
SBV Schweizerischer Bauernverband, Brugg
seco Staatssekretariat für Wirtschaft, Bern
SMP Schweizerische Milchproduzenten, Bern
SRVA Service romand de vulgarisation agricole, Lausanne
TSM Treuhandstelle Milch, Bern
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation), Genf
ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, Bonn Masseinheiten
Dezitonne = 100 kg
A82 A N H A N G ■■■■■■■■■■■■■■■■
Fr
h
ha
hl Hektoliter Kcal Kilokalorien kg Kilogramm km Kilometer l Liter m Meter m2 Quadratmeter m3 Kubikmeter Mio. Million
dt
Franken
Stunden
Hektare = 10 000 m2
Mrd Milliarde
Rp Rappen
St Stück
t Tonne
% Prozent
Ø Durchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGIS Agrarpolitisches Informationssystem
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
AK Arbeitskraft
AKZA Ausserkontingentszollansatz
BSE Bovine spongiforme Enzephalopathie ("Rinderwahnsinn")
BTS Besonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw beziehungsweise
BZ I, II, Bergzone
ca zirka
CO2 Kohlendioxid
EO Erwerbsersatzordnung
FJAE Familien-Jahresarbeitseinheit
GAP Gemeinsame Agrarpolitik der EU
GGA Geschützte Geografische Angaben
GUB Geschützte Ursprungsbezeichnung
GVE Grossvieheinheit
GVO Gentechnisch veränderte Organismen
inkl inklusive
IP Integrierte Produktion
IV Invalidenversicherung
JAE Jahresarbeitseinheit
KZA Kontingentszollansatz
LG Lebendgewicht
LN Landwirtschaftliche Nutzfläche
LwG Landwirtschaftsgesetz
Mwst Mehrwertsteuer
N Stickstoff
NWR Nachwachsende Rohstoffe
ÖAF Ökologische Ausgleichsfläche
ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis
P Phosphor
PSM Pflanzenschutzmittel
RAUS Regelmässiger Auslauf im Freien
RGVE Raufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAK Standardarbeitskraft
SG Schlachtgewicht
u a unter anderem
vgl vergleiche
z B zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B. Tabellen)
A N H A N G A83
Bolliger P., Charollais M., Condrau V., 2002.
Werkzeugkasten LEK – Arbeitshilfe zum Erarbeiten von Landschaftsentwicklungskonzepten
HSR Hochschule und SRVA, Rapperswil und Lausanne
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2001
Auswertung der Daten über die Milchkontingentierung; Milchjahr 2000/2001
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2002
Analyse der Deckungsbeiträge verschiedener Betriebszweige.
Interner Bericht, Bern
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2002.
Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme
Schlussbericht Kategorie Milchkühe, Bern
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2002
Maximale Importrente für Fleisch.
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2002
Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente.
Gemäss Punkt 2 des Berichtes vom 21 Februar 2002 des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen 2001, Separatdruck
Bundesamt für Statistik (BFS), 2001
Arealstatistik
Bodennutzung im Wandel, Neuenburg
Bundesamt für Statistik (BFS), verschiedene Jahrgänge
Einblicke in die schweizerische Landwirtschaft, Neuenburg.
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2001
Böden der Schweiz Schadstoffgehalte und Orientierungswerte (1990–1996)
Umweltmaterialien Nr 139, Boden, Bern
Chassot G , Altorfer Borer M , 2001
Mise en application de la loi sur la protection des eaux Volume de stockage des réservoirs à lisier
Rapport d’évaluation 2001.
Schriftliche Ergänzungen durch die Umweltschutzämter der Kantone SG und SZ
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), 1999.
Das Recht auf Nahrung
Zusammenfassung eines Gutachtens zuhanden der DEZA, Arbeitsdokument der DEZA, Bern
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), 1992
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen im Acker- und Futterbau von 1986–90.
Schweizerische Landwirtschaftliche Forschung 33 (2), Siegenthaler A , Stauffer B , Lischer P und Häni H , Zürich
A84 A N H A N G ■■■■■■■■■■■■■■■■
Literatur
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), 1999
Abschätzung der P- und N-Verluste aus diffusen Quellen in die Gewässer im Rheineinzugsgebiet der Schweiz unterhalb der Seen
Eidgenössische Forschungsanstalt für Nutztiere (RAP), 2001
Phosphor im Alleinfutter.
Suisseporcs-Information 6/2001, Kessler J , Posieux
Flury C , Rieder P , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2002
Strukturelle Auswirkungen auf das Berggebiet
Folgestudie «Umlagerung der Milchpreisstützung», Teil 3
GfS-Forschungsinstitut und Institut für Agrarwirtschaft (IAW), 2002
Univox Teil III A Landwirtschaft 2002.
Koch B , Rieder P , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2002 Milchmarktanalyse.
Forschungsauftrag des BLW, Zürich
Institut für Marktanalysen (IHA GfM AG), 2001
Befragung über Lebensmittel, Landwirtschaft und Umwelt
Auftrag des Institutes für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel (ISPM), der Bio Suisse und des BLW, Hergiswil
Institut für Umweltschutz und Landwirtschaft (IUL), 1999
Abschätzung der Phosphor- und Stickstoffverluste aus diffusen Quellen in die Gewässer im Rheineinzugsgebiet der Schweiz unterhalb der Seen (Stand 1996)
Interner Bericht FAL, Prasuhn V , Hurni P , Liebefeld-Bern
Jenny M et al , 2002
Vernetzungsprojekte – leicht gemacht, Ein Leitfaden für die Umsetzung der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV).
Schweizerische Vogelwarte Sempach, Schweizerischer Vogelschutz SVS, Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, Service romand de vulgarisation agricole
Landw Jahrbuch der Schweiz, 1918
Bericht über die Tätigkeit der schweizerischen agrikulturchemischen Anstalt Bern für das Jahr 1916
Martinovits A , Abele M , (GfS-Forschungsinstitut), 2002
Ergebnisse einer repräsentativen schriftlichen Befragung von Frauen in Landwirtschaftshaushalten Forschungsauftrag des BLW, Zürich
Oldeman L R , 1994
World Map of the Status of Human-induced Soil degradation. GLASOD, Wageningen, Netherlands
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2002
Politique agricole dans les pays de l’OCDE Monitoring et évaluation 2002, Paris
Progress Report, 2002
Fifth International Conference on the Protection of the North Sea, March 2002. The North Sea Secretariat, Oslo
A N H A N G A85
Schnyder A , Weber M , Dumondel M , Lehmann B , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2002
MPSL: Monitoring Tool Performance Schweizer Landwirtschaft
Forschungsauftrag des BLW, Zürich.
Schweizericher Bauernverband (SBV), verschiedene Jahrgänge
Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg
Stucki B , (bs texte), 2002
Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft
Forschungsauftrag des BLW, Steg
U S Geological Survey, 2001
Phosphate Rock.
Mineral Commodity Summaries.
Werder D , Albisser G , Berthold N , Weber M , Lehmann B , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2002
Strategien für Bergbetriebe im Hinblick auf künftige Rahmenbedingungen für den Milchsektor
Folgestudie «Umlagerung der Milchpreisstützung», Teil 2
A86 A N H A N G
A N H A N G A87
A88 A N H A N G