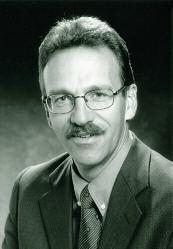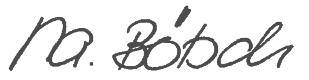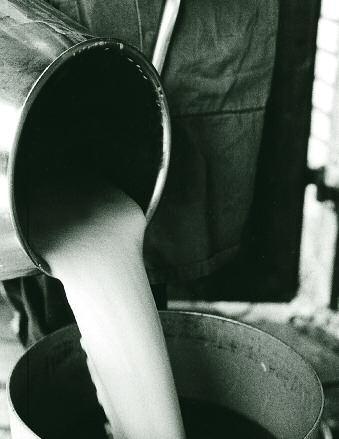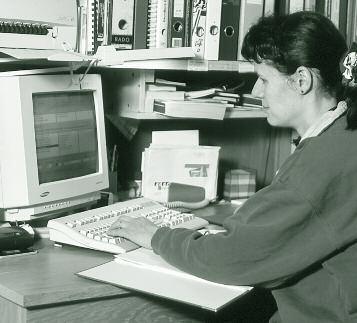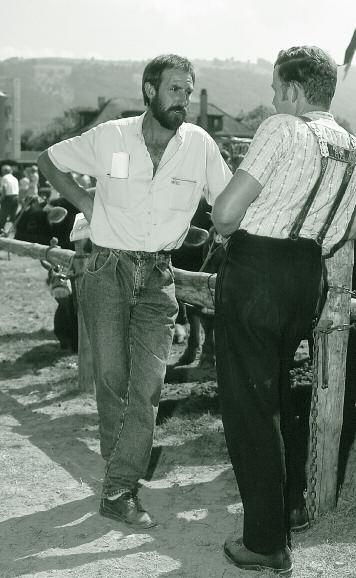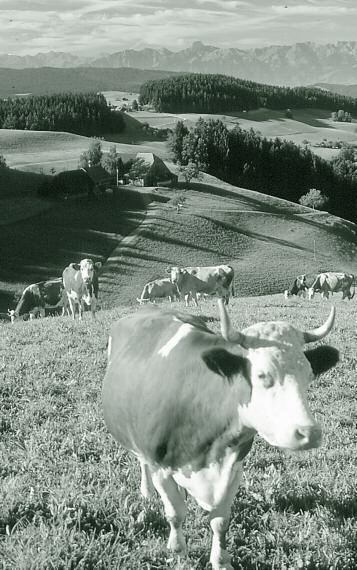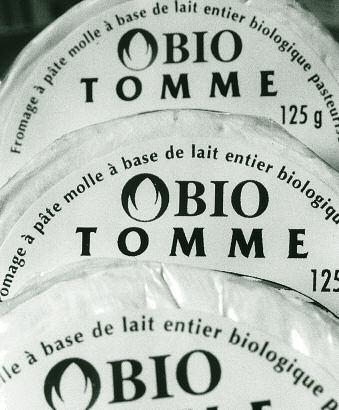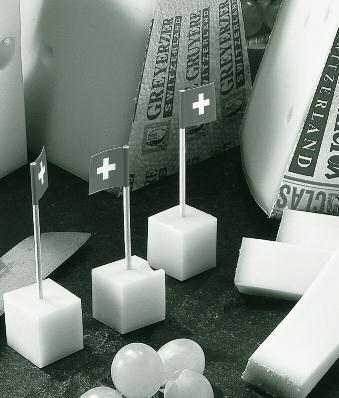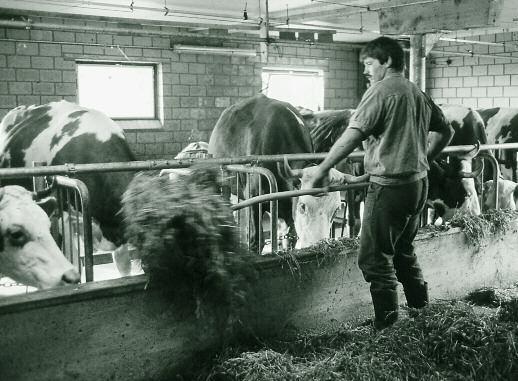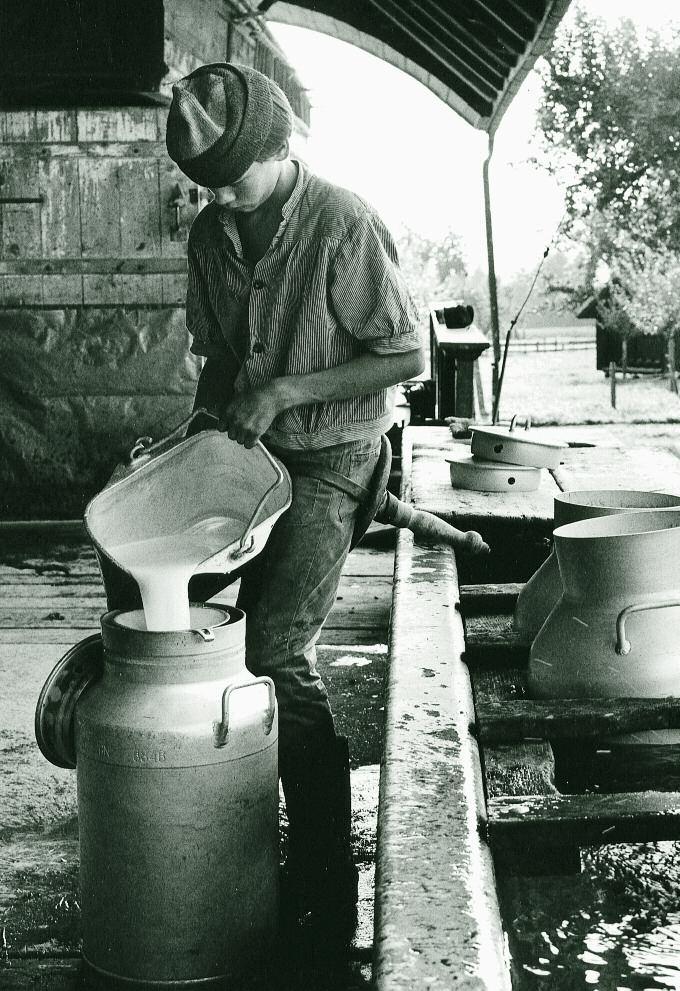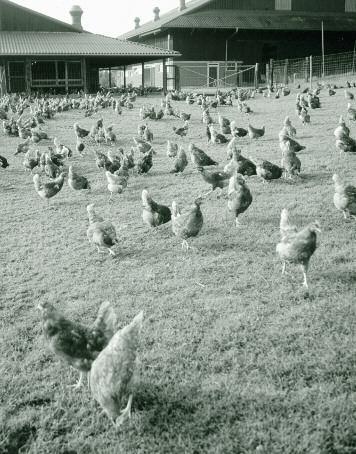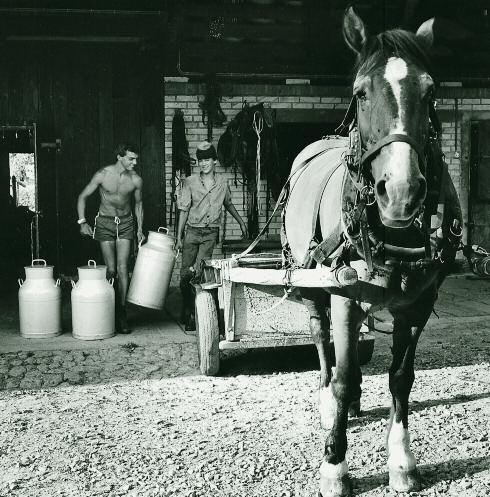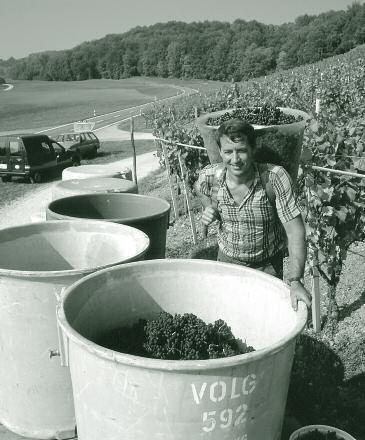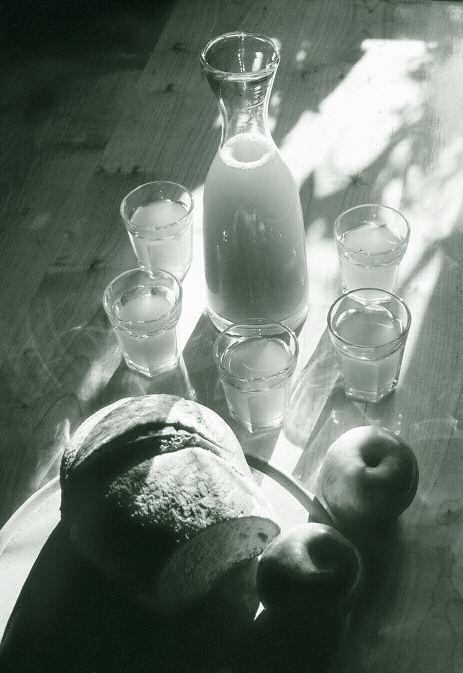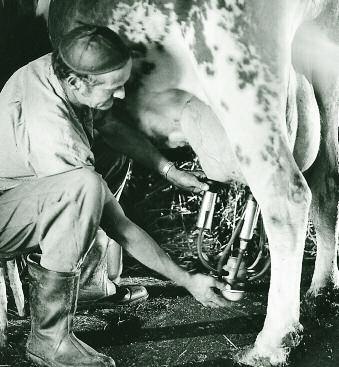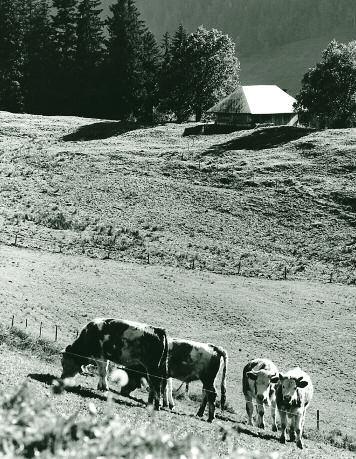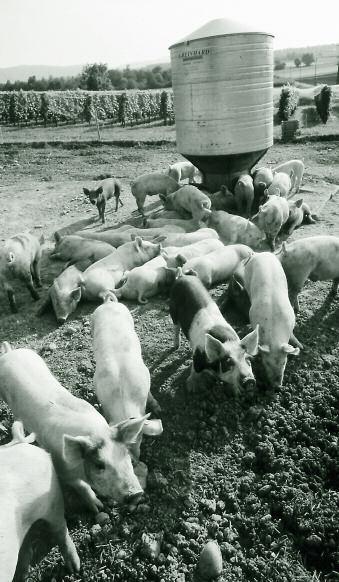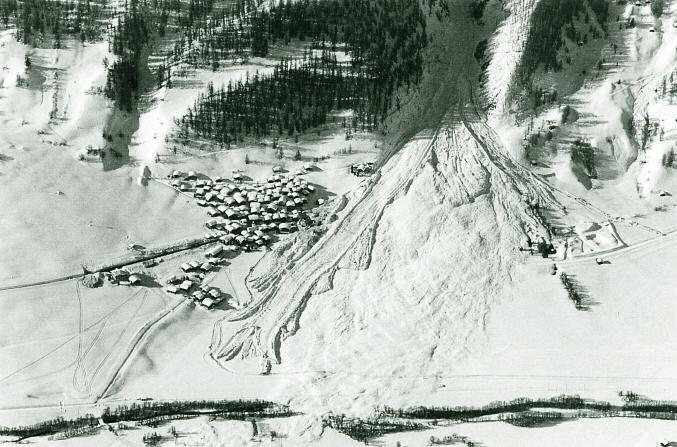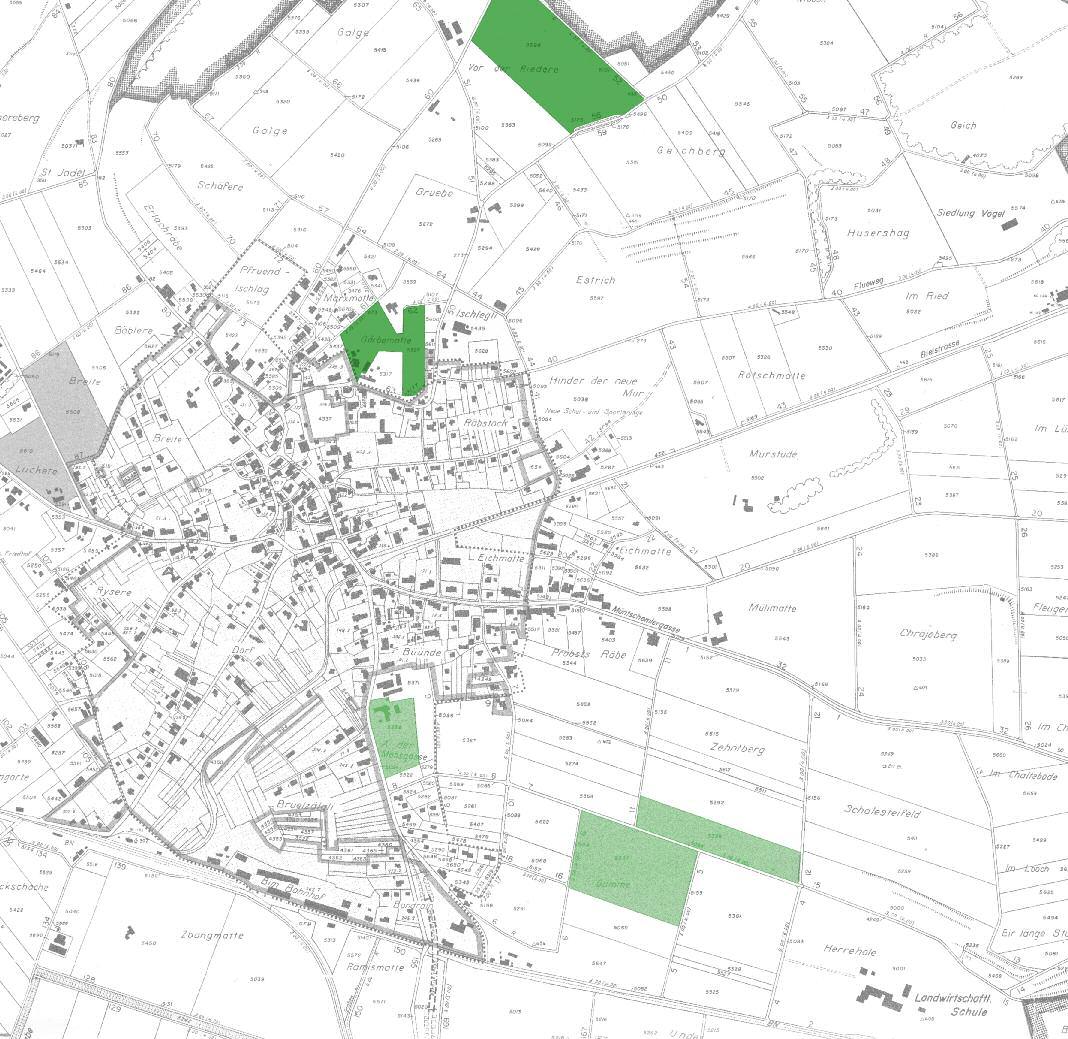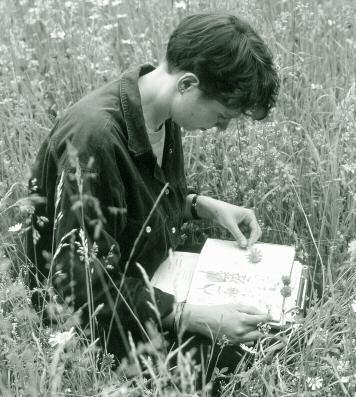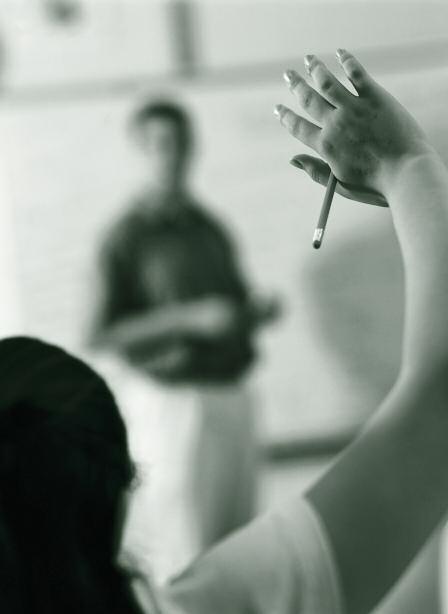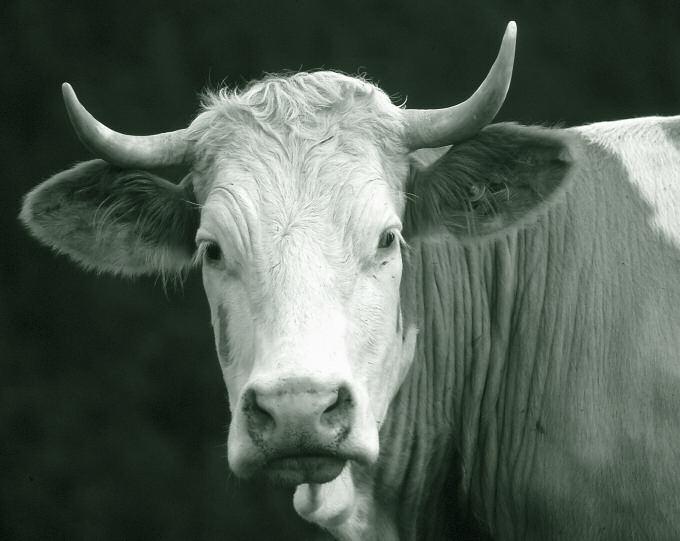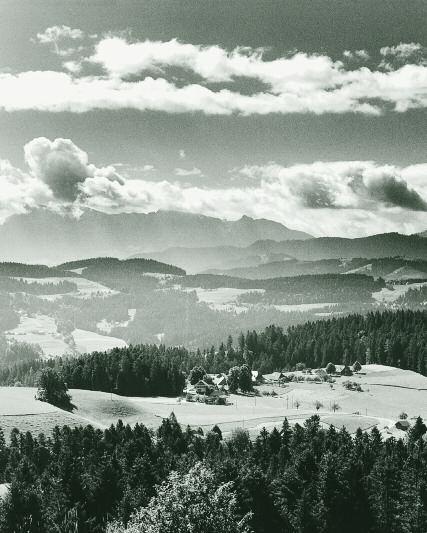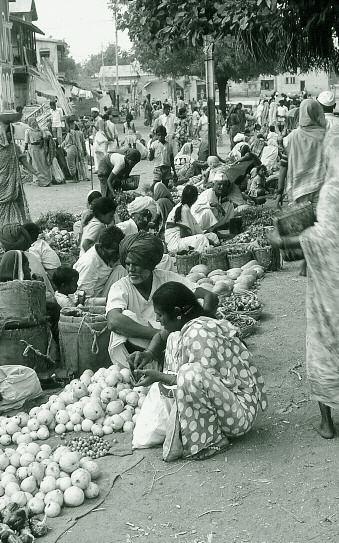Bundesamt für Landwirtschaft
Officefédéral de l’agriculture
Ufficio federale dell’agricoltura
Uffizi federal d’agricultura

AGRARBERICHT
Herausgeber
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
3003 Bern
Telefon: 031 322 25 11
Telefax: 031 322 26 34
Internet: www blw admin ch
Copyright: BLW, Bern 2001
Gestaltung
Artwork, Grafik und Design, St Gallen
Druck Bruhin AG, Freienbach
Fotos
Aebi & Co AG, Maschinenfabrik
Agrofot Bildarchiv
Bavaria Bildagentur
– Blue Planet Bild
– BLW Bundesamt für Landwirtschaft
– FAL Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau
FAW Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau
Hans Kern, Fotograf
Incolor AG
– Keystone Archive
– Markus Jenny
– Peer Schilperoord
– Peter Mosimann, Fotograf
Peter Studer, Fotograf
PhotoDisc Inc
Prisma Dia-Agentur
Roger Corbaz
– Ruedi Bosshart
– SMP Schweizer Milchproduzenten
– Switzerland Cheese Marketing AG
Bezugsquelle
BBL/EDMZ, 3003 Bern
Bestellnummern:
Deutsch: 730 680 01 d
10 2001 3000 62454
Französisch: 730 680 01 f
10 2001 1600 62454
Italienisch: 730 680 01 i
10 2001 300 62454
Telefax: 031 325 50 58
Internet: www admin ch/edmz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 I M P R E S S U M
■■■■■■■■■■■■■■■■ Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 ■ 1. Bedeutung und Lage 1.1 Ökonomie 9 der Landwirtschaft 1 1 1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft 10 1 1 2 Märkte 25 1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors 52 1 1 4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe 55 1.2 Soziales 65 1.2.1 Konzept Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft 66 1 2 2 Einkommen und Verbrauch 69 1 2 3 Erhebung über die Lebensqualität 72 1 2 4 Kinder- und Jugendhilfe in Eggiwil 79 1.3 Ökologie 83 1.3.1 Agrarökologische Indikatoren 84 1 3 2 Spezifische Themen 110 1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit 117 1.4.1 Aktuelle Beurteilung der Nachhaltigkeit 118 1 4 2 Konzept für eine umfassende Beurteilung der Nachhaltigkeit 120 ■ 2 Agrarpolitische 2 1 Produktion und Absatz 129 Massnahmen 2 1 1 Globale Instrumente 131 2.1.2 Milchwirtschaft 146 2 1 3 Viehwirtschaft 152 2 1 4 Pflanzenbau 158 2 1 5 Überprüfung der Massnahmen 167 2.2 Direktzahlungen 185 2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen 186 2 2 2 Allgemeine Direktzahlungen 199 2 2 3 Ökologische Direktzahlungen 208 2.3 Grundlagenverbesserung 227 2 3 1 Strukturverbesserungen und Betriebshilfe 228 2 3 2 Forschung, Beratung, Berufsbildung, Gestüt 238 2 3 3 Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz 245 2 3 4 Tierzucht 255 2.4 Weiterentwicklung der Agrarpolitik 257 ■ 3. Internationale 3.1 Internationale Entwicklungen 265 Aspekte 3 2 Internationale Vergleiche 287 ■ Anhang Tabellen A2 Karten A60 Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft A72 Begriffe und Methoden A75 Abkürzungen A93 Literatur A95 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 3
Das Berichtsjahr 2000 war für die Schweizer Landwirtschaft allgemein ein gutes Jahr. Sowohl beim Pflanzenbau als auch in der Tierhaltung stiegen die Erlöse gegenüber 1999 an Insgesamt fiel die Endproduktion um 344 Mio Fr oder rund 5% höher aus Für 2001 sieht die Situation aber wieder deutlich ungünstiger aus Die Schätzungen für das laufende Wirtschaftsjahr gehen von einem mit 1999 vergleichbaren wirtschaftlichen Ergebnis aus Das macht deutlich, dass die mit der neuen Agrarpolitik erwarteten grösseren Schwankungen im Marktbereich Realität sind
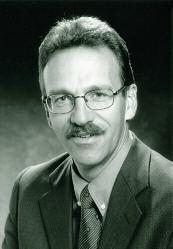
Im Juli des Berichtsjahres hat das BLW mit dem Strategiepapier «Horizont 2010» die Weiterentwicklung der Agrarpolitik lanciert Am 21 September 2001 ermächtigte der Bundesrat das EVD, eine breite Vernehmlassung über die Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2007) zu eröffnen. Dazwischen gab es eine intensiv und breit geführte Diskussion über die weiteren Reformschritte Ergebnis davon ist eine Vorlage, bei der die Optimierung der bestehenden Massnahmen im Vordergrund steht Die Verfassungsgrundlage sowie die Grundzüge und Ziele der Agrarpolitik 2002 werden nicht in Frage gestellt Im Zentrum der Anpassungen stehen Änderungen bei der Milchkontingentierung mit dem Ziel, diese mittelfristig aufzuheben. An dieser Stelle danke ich allen Beteiligten für die konstruktive Mitarbeit
Der zweite Agrarbericht hat in der Grundausrichtung keine Änderungen erfahren. Der Bericht gibt Auskunft über die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik, über die Entwicklungen bei den agrarpolitischen Massnahmen und über internationale Aspekte Die Berichterstattung wurde gegenüber dem Vorjahr in einigen Bereichen weiterentwickelt In Abschnitt 1 2 wird ein umfassendes Konzept für die Darstellung der sozialen Situation der Bäuerinnen und Bauern vorgestellt, in Abschnitt 1 4 eines für die Beurteilung der Nachhaltigkeit mit Hilfe von Indikatoren In Abschnitt 2 1 5 finden Sie Zusammenfassungen über die Ergebnisse von Wirkungsanalysen zu Massnahmen im Marktbereich. Die laufende Weiterentwicklung der Monitoringinstrumente sowie Wirkungsanalysen einzelner Massnahmen erlauben verfeinerte Analysen Damit stehen bessere Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung
Die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft ist im Durchschnitt aller Betriebe als stabil zu bezeichnen Die Ergebnisse der zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT zeigen, dass sich die Situation bis Mitte der neunziger Jahre verschlechtert hat, inzwischen aber wieder eine deutliche Verbesserung eingetreten ist Eine Mehrzahl der Betriebe kann genügend Eigenkapital bilden, um die betriebliche Existenz zu sichern. Durchschnittszahlen sagen aber nicht alles aus Eine feinere Analyse zeigt, dass die Zahl der Betriebe in finanzieller Bedrängnis in den letzten zehn Jahren leicht zugenommen hat. Ausserdem hat sich die wirtschaftliche Basis der 25% Betriebe mit den tiefsten Ergebnissen verschlechtert Die soziale Situation der Betriebe gilt es aufmerksam zu verfolgen Der Abstand zwischen den Betrieben mit den besten und schlechtesten Ergebnissen öffnet sich Dies wurde erwartet, da die unternehmerischen Fähigkeiten mit der neuen Agrarpolitik noch stärker zum Tragen kommen
V O R W O R T 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Vorwort
Die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft sind auch im Berichtsjahr gegenüber 1999 wie in den Vorjahren angestiegen, das heisst dass z B für die Erhaltung der Biodiversität mehr Flächen ausgeschieden wurden, mehr Tiere zusätzlichen Auslauf hatten und mehr Tiere in tierfreundlichen Laufställen gehalten wurden. Auf der anderen Seite ist 1999 und 2000 eine Stagnation beim Mineraldünger- und Pflanzenschutzmittelverbrauch eingetreten Positiv ausgewirkt haben sich die getroffenen Massnahmen zur Reduktion des Einsatzes von Antibiotika in der Landwirtschaft Dieser ist seit 1995 um 50% zurückgegangen
Der Agrarbericht 2000 ist insgesamt auf ein gutes Echo gestossen Für die konstruktiven Rückmeldungen danke ich bestens Diese sind weiterhin erwünscht Die gute Aufnahme der ersten Ausgabe war für uns eine besondere Motivation, Ihnen auch dieses Jahr einen interessanten und umfassenden Bericht präsentieren zu können Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre
Manfred Bötsch
Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft
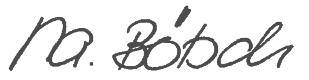
V O R W O R T 5
6

1 7 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1. Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
In Artikel 104 ist festgehalten, dass «der Bund dafür zu sorgen hat, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft;
c dezentralen Besiedlung des Landes»
Die in der Verfassung verankerten Ziele machen deutlich, dass die Landwirtschaft Aufgaben erfüllt, die über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen Man spricht in diesem Zusammenhang von der Multifunktionalitiät der Landwirtschaft Die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die dezentrale Besiedlung sind Leistungen, die im öffentlichen Interesse liegen, welche sich über den Markt aber nur teilweise abgelten lassen
Der Begriff «nachhaltig» wurde 1996 zum ersten Mal in der Verfassung verankert. Er ist seit der Konferenz über Umwelt und nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine wichtige Leitlinie für politisches Handeln geworden
Der Bundesrat will die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik verfolgen Er hat in der Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen Die Verordnung sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass die Agrarpolitik und die Leistungen der Landwirtschaft unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu untersuchen sind. Absatz 2 hält fest, dass die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu beurteilen sind Das BLW wird beauftragt, jährlich über die Ergebnisse der Untersuchungen Bericht zu erstatten Mit dem Agrarbericht kommt das BLW diesem Auftrag nach
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Grundstruktur zu den Informationen von Kapitel 1 des Agrarberichts Dieses gibt Auskunft über die Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
8 1 . B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
Die ökonomischen Aspekte der Landwirtschaft bildeten in der Vergangenheit einen Schwerpunkt der Berichterstattung über die Landwirtschaft So gaben z B Buchhaltungsdaten von ausgewählten Betrieben Auskunft über die Einkommenssituation der Einzelbetriebe, und die landwirtschaftliche Gesamtrechnung vermittelte ein Bild über die Lage des Gesamtsektors Die in der Regel alle fünf Jahre durchgeführten Betriebszählungen lieferten Informationen über die Strukturentwicklung in der Landwirtschaft Ausserdem wurden viele Daten über die Produktion und die Preise erfasst Im ökonomischen Bereich waren die umfassendsten Grundlagen für die Berichterstattung vorhanden.
Im Folgenden werden die ökonomische Stellung der Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft dargestellt, Informationen über Produktion, Verbrauch, Aussenhandel, Produzenten- und Konsumentenpreise auf den einzelnen Märkten vermittelt sowie die wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors und der Einzelbetriebe aufgezeigt

9 1 . 1 Ö K O N O M I E ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.1
Ökonomie
1
1.1.1 Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen
Die im Jahr 2000 durchgeführte Landwirtschaftszählung bietet die Gelegenheit, eine vertiefte Analyse der Betriebsstrukturen für den Zeitraum 1990 bis 2000 vorzunehmen Für die Darstellung der Entwicklung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe wurde auch die Periode 1985 bis 1990 miteinbezogen
Der Erhebungsbereich der Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe richtet sich seit 1995 nach internationalen Normen. Er stützt sich auf die Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA), welche auf der Wirtschaftszweigsystematik der EU (NACE) aufgebaut ist Entsprechend dieser Wirtschaftsnomenklatur werden vom Bundesamt für Statistik (BFS) alle Betriebe erfasst, welche die Normen der Agrarstrukturerhebung der EU
umgerechnet auf schweizerische Verhältnisse – erfüllen Um als Landwirtschaftsbetrieb gezählt zu werden, muss demnach mindestens eines der folgenden sechs Kriterien erfüllt werden:
– 1 ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LN);

– 30 Aren Spezialkulturen;
– 10 Aren in geschütztem Anbau;
– 8 Mutterschweine;
– 80 Mastschweine; oder
– 300 Stück Geflügel
10 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
■ Strukturwandel trifft insbesondere Kleinbetriebe
Die Strukturveränderungen der letzten Jahrzehnte haben alle Sektoren der Volkswirtschaft erfasst Davon war auch die Landwirtschaft betroffen
Entwicklung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe
1 in Analogie zu den späteren Jahren ohne Kleinstproduzenten Quelle: BFS
Insgesamt wurden im Jahr 2000 rund 28'200 Betriebe weniger gezählt als 1985 Die Hälfte davon waren Kleinbetriebe mit einer Fläche zwischen 0 und 3 ha Ihre Zahl schrumpfte in dieser Zeitspanne praktisch auf einen Drittel.
Im Zeitraum von 1985 bis 1990 nahmen die Betriebe mit einer Fläche bis 3 ha um 3'354 ab Das ergibt eine jährliche Abnahmerate von 3,1% 1990 wurden 2'590 Betriebe über 3 ha weniger gezählt als 1985, was einer jährlichen Abnahmerate von 0,7% entspricht.
Zwischen 1990 und 1996 beschleunigte sich der Strukturwandel bei den Betrieben mit einer Fläche bis 3 ha. Sie nahmen jährlich um 7,8% ab. Die Anzahl der Betriebe mit einer Fläche von mehr als 3 ha reduzierte sich im Vergleich nur um 1,3%
Zwischen 1996 und 2000 ging die Zahl der Betriebe der Grössenklasse bis 3 ha erneut um 3'796 Einheiten zurück Das entspricht einer Abnahmerate von 8,9% pro Jahr Bei den Betrieben über 3 ha war ein Rückgang von jährlich 2,0% zu verzeichnen.
In der Periode von 1990 bis 2000 war die Anzahl der Betriebe mit einer LN zwischen 3 und 10 ha stark rückläufig. Die Landwirtschaftszählungen können die Vermutung, dass die Direktzahlungen viele kleinere Betriebe zur Weiterführung veranlassen, nicht bestätigen
■ Betriebe über 20 ha nehmen zu
Die Betriebsentwicklung nach Grössenklassen im vergangenen Jahrzehnt zeigt, dass eine Verschiebung in Richtung grössere Betriebe stattgefunden hat Betriebe in den Grössenklassen bis 20 ha nahmen ab, diejenigen darüber zu Die Zahl der Betriebe mit einer LN unter 20 ha ist in diesem Zeitraum um 26'644 zurückgegangen, diejenige der Betriebe mit einer LN über 20 ha um 4'366 gestiegen Bei den grösserflächigen Betrieben haben diejenigen der Grössenklasse 30 bis 50 ha absolut gesehen am meisten zugelegt. Die Anzahl hat sich von 3'549 im Jahr 1990 auf 5'759 im Berichtsjahr erhöht. Die Betriebe mit einer Fläche von 20 bis 30 ha haben in dieser Zeit von 10'041 auf 11'674 zugenommen und diejenigen über 50 ha von 684 auf 1'207
1 . 1 Ö K O N O M I E 11
Grössenklasse Anzahl Betriebe In ha 1985 1 1990 1996 2000 0–3 23 173 19 819 12 167 8 371 > 3 75 586 72 996 67 312 62 166 Total 98 759 92 815 79 479 70 537
1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1
Tabelle 1, Seite A2
Ein Vergleich der beiden Teilperioden 1990 bis 1996 und 1996 bis 2000 zeigt, dass sich das Wachstum der Grössenklasse 20 bis 30 ha von jährlich über 2% auf unter 1% und dasjenige der Grössenklasse von 30 bis 50 ha von jährlich gegen 6% auf unter 4% verringert hat Nur bei den Betrieben über 50 ha war ein stabiles, sogar leicht erhöhtes Wachstum von rund 6% pro Jahr zu verzeichnen.
Die LN der Schweiz hat sich im Zeitraum 1990 bis 2000 geringfügig verändert Eine Verschiebung erfuhr die gesamte, von den verschiedenen Grössenklassen bewirtschaftete Fläche Die Betriebe der Grössenklasse 0 bis10 ha hatten 1990 gesamthaft 19% der LN inne Im Berichtsjahr betrug ihr Anteil noch 12% Betriebe mit einer LN unter 3 ha bewirtschafteten im Jahr 1990 26'723 ha oder 3% der gesamten LN Im Jahr 2000 waren es nur noch 10'197 ha oder 1% Ebenfalls gesunken ist die bewirtschaftete Fläche der Betriebe der Grössenklasse 10 bis 20 ha, nämlich von 42 auf 34%. Von diesen Abnahmen profitierten die Betriebe der Grössenklassen über 20 ha Ihr Anteil an der Flächennutzung stieg von 39% im Jahr 1990 auf 54% im Berichtsjahr
Grössenklassen
12
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 Entwicklung
19901996 2000 i n h a 0–10 ha Quelle: BFS 10–20 ha >20 ha 0 1 200 000 1050 000 900 000 750 000 600 000 450 000 300 000 150 000 415 463 452 659 200 369 522 866 404 615 155 395 576 220 356 673 130 601
19901996 2000 A n z a h l 0–3 ha Quelle: BFS 10–20 ha >20 ha 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 14 274 31 630 27 092 19 819 17 361 27 877 22 074 12 167 18 640 24 984 18 542 8 371 3–10 ha
der LN nach
Entwicklung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe nach Grössenklassen
Tabelle 1, Seite A2
Die Anzahl Grossvieheinheiten (GVE) nahm zwischen 1990 und 2000 gesamthaft um 130'000 Einheiten ab Bei den Betrieben der Grössenklassen bis 20 ha wurde eine Abnahme von rund 292'000 GVE registriert, bei den Betrieben über 20 ha eine Zunahme von 162'122 GVE. Trotz dieser negativen Bilanz ist der durchschnittliche Bestand je Betrieb praktisch gleich geblieben Die Betriebe der Grössenklassen 0 bis 10 ha und 10 bis 20 ha wiesen 1990 im Mittel einen Tierbestand von 7,9 bzw 20 GVE auf Zehn Jahre später waren es 8,6 bzw 19,1 GVE Bei den Betriebsgrössenklassen über 20 ha standen 1990 im Mittel 30 GVE im Stall, im Berichtsjahr 31,7 Diese Zahlen deuten darauf hin, dass weder eine Intensivierung bei kleineren Betrieben noch eine Extensivierung bei grösseren Betrieben stattgefunden hat

13 1 . 1 Ö K O N O M I E
1
19901996 2000 A n z a h l 0–10 ha Quelle: BFS 10–20 ha >20 ha 0 1 500 000 1 350 000 1 200 000 1050 000 750 000 900 000 600 000 450 000 300 000 150 000 428 400 632 086 369 273 526 558 541 388 268 243 590 522 478 145 230 844
Entwicklung der Anzahl GVE nach Grössenklassen
■ Tierbestände pro Betrieb verändern sich nur minim
Tabelle 1, Seite A2
Im vergangenen Jahrzehnt lag das Verhältnis zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben konstant bei 70% Haupterwerbsbetrieben zu 30% Nebenerwerbsbetrieben Die Haupterwerbsbetriebe befanden sich sowohl 1990 als auch im Berichtsjahr zu rund der Hälfte in der Talregion und zu je einem Viertel in der Hügel- und Bergregion.
Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe
Unterschiedlich verlief die Entwicklung der Anzahl Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe über die Teilperioden 1990 bis 1996 und 1996 bis 2000 in den einzelnen Regionen
Bei den Haupterwerbsbetrieben war die Abnahme in der Talregion zwischen 1990 und 1996 bedeutend höher als zwischen 1996 und 2000. Gerade entgegengesetzt verlief die Entwicklung in der Bergregion
Die Nebenerwerbsbetriebe waren in der Talregion zwischen 1996 und 2000 viel stärker rückläufig als in der Teilperiode vorher In der Bergregion auf der anderen Seite wurde nach einem starken Rückgang zwischen 1990 und 1996 gar eine Zunahme um über 5% festgestellt In abgeschwächter Form ist diese Entwicklung bei den Nebenerwerbsbetrieben auch in der Hügelregion zu beobachten
14 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Betriebe 1990 1996 2000 Veränderung in % 1990–1996 1996–2000 Haupterwerb 64 242 55 951 49 239 -12,9 -12,0 Talregion 1 30 139 25 475 23 536 -15,5 -7,6 Hügelregion 2 17 452 15 636 13 793 -10,4 -11,8 Bergregion 3 16 651 14 840 11 910 -10,9 -19,7 Nebenerwerb 28 573 23 528 21 298 -17,7 -9,5 Talregion 1 11 451 10 302 8 076 -10,0 -21,6 Hügelregion 2 7 089 5 594 5 164 -21,1 -7,7 Bergregion 3 10 033 7 632 8 058 -23,9 5,6 Total 92 815 79 479 70 537 -14,4 -11,3
1 Ackerbauzone, Übergangszonen
2 Hügelzone, Bergzone I
3 Bergzonen II-IV
Quelle: BFS
■ Unverändertes Verhältnis Haupt-/Nebenerwerbsbetriebe
Veränderung der Haupterwerbsbetriebe 1990/2000

Veränderung der Nebenerwerbsbetriebe 1990/2000
Die Zahl der Haupterwerbsbetriebe ist im letzten Jahrzehnt in sämtlichen Kantonen zurückgegangen Bei den Nebenerwerbsbetrieben wurden neben rückläufigen Zahlen in einzelnen Kantonen auch Zunahmen festgestellt, dies in den Zentralschweizer Kantonen NW, OW, SZ, UR, LU sowie in AI
15 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1 VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW >25% 20–25% 0–20% Abnahme in % Quelle: BFS
VS GE VD NE FR JU SO BL BS AG LU BE TI GR UR NW SZ ZH TG SH SG AI AR GL ZG OW >25% 20–25% 0–20% Zunahme Abnahme in % Quelle: BFS
Bei den Beschäftigten in der Landwirtschaft handelt es sich gemäss BFS um Arbeitsstellen auf dem Betrieb, die durch Personen mit einem Alter von 15 Jahren und mehr besetzt sind Unterschieden wird zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten Die Vollzeitbeschäftigten arbeiten 75% und mehr von ihrer Arbeitszeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, die Teilzeitbeschäftigten weniger als 75%
Die Beschäftigung in der Landwirtschaft ist zwischen 1990 und 2000 stark zurückgegangen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten sank in dieser Zeit von 253'561 auf 203'793, was einer jährlichen Abnahmerate von 2,2% entspricht Diese Entwicklung geht einher mit der Abnahme der Betriebe in derselben Zeitspanne Die Voll- und Teilzeitbeschäftigten entwickelten sich in den Teilperioden 1990 bis 1996 und 1996 bis 2000 unterschiedlich Während die Vollzeitbeschäftigten in der ersten Teilperiode nur leicht und in der zweiten stark abnahmen, stellte sich bei den Teilzeitbeschäftigten ein starker Rückgang in der ersten Teilperiode und sogar eine leichte Zunahme in der zweiten ein Das Auf und Ab der Konjunktur in den neunziger Jahren dürfte diesen Verlauf massgebend geprägt haben.
Die Zahl der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen reduzierte sich von 64'242 im Jahr 1990 auf 49'239 im Jahr 2000 Dies entspricht einer Abnahme von rund 23%

16 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
■ Verlagerung von Voll- zu Teilzeitbeschäftigung
19901996 2000 A n z a h l Vollzeitbeschäftigte Quelle: BFS 0 300 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Teilzeitbeschäftigte
Entwicklung der Anzahl Voll- und Teilzeitbeschäftigte
Tabelle 2, Seite A3
Entwicklung des Anteils der hauptberuflichen Betriebsleiter und -leiterinnen nach Altersklassen
Die Gegenüberstellung der Altersstruktur der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen von 1990 mit derjenigen von 2000 veranschaulicht insbesondere zwei Entwicklungen Einerseits ist die Zahl der Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen mit einem Alter über 65 von 4'926 auf 1'102, also auf weniger als einen Viertel, geschrumpft Dies dürfte vor allem auf die 1999 eingeführte Altersgrenze für den Bezug von Direktzahlungen zurückzuführen sein. Andererseits nahm auch der Anteil der Betriebsleiter unter 35 Jahren deutlich ab Als Folge dieser beiden Entwicklungen hat in dieser Zeitspanne der Anteil der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen im Alter zwischen 35 und 49 Jahren um 8,1% zugenommen.
Entwicklung des Anteils der nebenberuflichen Betriebsleiter und -leiterinnen nach
Die Zahl der nebenberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen erfuhr ebenfalls eine Reduktion und veränderte sich von 28'573 im Jahr 1990 auf 21'298 im Jahr 2000 Die Entwicklung in den verschiedenen Alterskategorien folgt in etwas weniger ausgeprägter Form derjenigen der hauptberuflichen Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen.
1 . 1 Ö K O N O M I E 17 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1
ohne Angabe > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Quelle: BFS 40 200 in % 20 40 60 5 0 5 8 2 2 7 7 33 9 35 7 16 8 35 0 43 8 14 0
ohne Angabe > 65 1990 2000 50–65 35–49 < 35 Quelle: BFS 40 20 3010010 30 20 40 3 9 12 1 15 1 20 4 30 0 27 0 10 5 37 4 33 3 10 3 in %
Altersklassen
Eng verbunden mit der Landwirtschaft sind die Beschäftigungen in vorgelagerten Branchen wie der Landmaschinenindustrie, der Dünger-, Pflanzenschutz- oder Futtermittelproduktion und in nachgelagerten Branchen wie der Nahrungsmittelverarbeitung.
Die jüngsten Zahlen zu den Beschäftigten in den der Land- und Forstwirtschaft vorund nachgelagerten Branchen sind für 1995 und 1998 verfügbar Gesamthaft gesehen hat sich in diesen drei Jahren praktisch nichts verändert Die nachgelagerten Branchen beschäftigten rund 220'000 Personen Dies entspricht einem Anteil von 5,8% aller in der Schweiz Beschäftigten Im Bereich der Verarbeitung sind Schlachten, Fleisch- und Milchverarbeitung sowie Herstellung von Brot-, Back- und Dauerbackwaren mit je über 10'000 Beschäftigten die grössten Branchen. Diese werden jedoch deutlich übertroffen vom Gross-, Detail- und Fachdetailhandel im Nahrungsmittelbereich mit insgesamt rund 160'000 Beschäftigten Der Anteil in den vorgelagerten Stufen fällt mit 1,5% geringer aus (rund 58'000 Personen). Insgesamt finden über 12% der Beschäftigten direkt in der Landwirtschaft oder in Branchen, die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben, ihr Auskommen

18 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
■ Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft
Produktion, Preise und Aussenhandel
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ist ein Massstab für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. In der Landwirtschaft ergibt sie sich als Differenz von Bruttoproduktionswert und Vorleistungen
Bruttowertschöpfung der drei Wirtschaftssektoren 1998/99
■ Entwicklung von Preisindices
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen der gesamten Wirtschaft erreichte 1999 einen Wert von 381'887 Mio. Fr. Im Vergleich zum Vorjahr nahm sie leicht zu. Der Anteil des Primärsektors war mit 1,3% gering Davon machte die Landwirtschaft mit 70% den grössten Anteil aus
Die Leistungen der Landwirtschaft gehen jedoch über diesen Produktionswert hinaus In der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nicht enthalten sind die mit Direktzahlungen abgegoltenen gemeinwirtschaftlichen und ökologischen Leistungen der Landwirtschaft
Mit der Einführung der neuen Agrarpolitik sind alle Preis- und Absatzgarantien weggefallen. Dadurch wirken sich die Marktkräfte unmittelbarer auf die Preise aus und die Markterlöse schwanken mehr als früher Nach einem kontinuierlichen Rückgang des Produzentenpreisindexes von 1990 bis 1999 um mehr als 20 Prozentpunkte, stieg dieser im Jahr 2000 um 3,5 Prozentpunkte an Dies war vor allem eine Folge der guten Fleischpreise (besonders für Rind- und Kalbfleisch) Die Produzentenpreise gingen jedoch bereits gegen Ende des Jahres wieder deutlich zurück
19 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Sektor 1998 1999 1 Anteil Veränderung 1999 1998/99 Mio Fr % Primärsektor 5 484 4 906 1,3 -10,5 davon Landwirtschaft 4 038 3 443 1,0 -14,7 Sekundärsektor 99 422 100 503 26,3 1,1 Tertiärsektor 271 117 276 478 72,4 2,0 Total 376 022 381 887 100,0 1,5 1 provisorisch Quellen: BFS, SBV
1
Entwicklung des Produzenten-, Konsumenten- und Importpreisindexes für Nahrungsmittel sowie des Indexes der Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel
Importpreisindex für Nahrungsmittel 1
Landesindex der Konsumentenpreise, Untergruppe Nahrungsmittel und Getränke
Index der Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel Produzentenpreisindex
1 Basis Mai 1993 = 100 Ältere Zeitreihen sind für diesen Index nicht vorhanden Importpreisindex enthält die Gruppe «Nahrungsmittel» der Untergruppen «Fleisch», «Andere Nahrungsmittel» und «Getränke». Diese umfassen ausgewählte Produkte und widerspiegeln nicht den gesamten Bereich der Nahrungsmittelimporte
Landwirtschaft Quellen: BFS, SBV
Der Landesindex der Konsumentenpreise für Nahrungsmittel und Getränke stieg zwischen 1990/92 und 2000 um 5,6 Prozentpunkte, davon allein zwischen 1999 und 2000 um 1,6 Prozentpunkte Dieser Index wird nur zu rund einem Siebtel von den inländischen Produzentenpreisen beeinflusst Daneben wirken sich die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Nahrungsmittelrohstoffe (rund 40% des Nahrungsmittelverbrauchs in Kalorien gemessen werden importiert), der Wechselkurs des Schweizer Frankens und insbesondere die Kosten und Margen der Nahrungsmittelverarbeitung und des Nahrungsmittelhandels aus.
Im Einkaufspreisindex landwirtschaftlicher Produktionsmittel drücken sich in erster Linie die Preise von Futtermitteln, Saat- und Pflanzgut, Dünge-, Bodenverbesserungsund Pflanzenschutzmitteln sowie von Bau- und Ausrüstungsinvestitionen aus Ausserdem fliesst ein Teil der mit dem Landesindex der Konsumentenpreise gemessenen Preisentwicklungen unmittelbar in den entsprechenden Index ein Dazu gehören unter anderem Energie (Treibstoffe, Strom), Telefon, Wasser, Unterhalts- und Reparaturkosten
Der Einkaufspreisindex landwirtschaftlicher Produktionsmittel ist nach einer anfänglichen Zunahme um 4 Prozentpunkte zwischen 1990/92 und 1993 und einer anschliessenden Abnahme bis 1999, im Jahr 2000 um 1,2 Prozentpunkte wieder leicht angestiegen
Im Importpreisindex für Nahrungsmittel ist nicht der gesamte Warenkorb der Nahrungsmittelimporte enthalten Seine Aussagekraft ist deshalb nicht derjenigen des Produzenten- oder Konsumentenpreisindexes gleichzustellen. Der Index nahm zwischen 1994 und 1995 um 2,6 Prozentpunkte ab In der Folge stieg er bis 1999 um 13,6 Prozentpunkte an Im Jahr 2000 wurde wieder ein leichter Rückgang um 0,5 Prozentpunkte verzeichnet.
20
1 . 1 Ö K O N O M I E 1
I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )
75 1990-921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 115 110 105 100 95 90 85 80
■ Aussenhandel mit Landwirtschaftsprodukten
Der Wert des schweizerischen Aussenhandels ist im Berichtsjahr ausserordentlich stark angewachsen Die Einfuhren legten gegenüber 1999 um 16%, die Ausfuhren um 13% zu Auch bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen waren Zuwachsraten zu verzeichnen. Die Importe erhöhten sich um 4,2%., die Exporte um 7,1%.
Anteil der landwirtschaftlichen Produkte an den gesamten Ein- und Ausfuhren
Die EU bleibt im Agrarbereich nach wie vor die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz Im Berichtsjahr stammten 70,6% der Landwirtschaftsimporte (6,0 Mrd Fr ) aus der EU 65,2% der Exporte (2,3 Mrd Fr ) wurden in den EU-Raum getätigt
Die Schweizer Landwirtschaft produziert rund 60% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittel (gemessen in Kalorien) Allerdings sind jährliche Schwankungen festzustellen 1999 lag der Selbstversorgungsgrad bei 58% und war damit um 6 Prozentpunkte unter dem Wert von 1998. Dies war ausschliesslich auf eine tiefere Selbstversorgung bei pflanzlichen Produkten zurückzuführen Für das Jahr 2000 liegen die entsprechenden Berechnungen noch nicht vor Das gute Pflanzenbaujahr 2000 dürfte aber dazu führen, dass der Selbstversorgungsgrad wieder das Niveau von 1998 erreicht Bei tierischen Produkten blieb der Inlandanteil 1999 wie 1998 bei 95% Im Jahr 2000 dürfte er leicht auf 96% ansteigen Bei den pflanzlichen Produkten dürfte für das Berichtsjahr wieder mit einem Selbstversorgungsgrad im Bereich von 1998 (47%) zu rechnen sein

21 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1
i n M r d F r Landwirtschaft
Quelle: OZD 0 20 40 60 80 100 120 160 140 6,9 94,7 8,5 139,4 2,7 89,5 3,6 136,0
1990/9220001990/922000
Gesamtwirtschaft
Einfuhren
A
usfuhren
■ Pflanzenbau bewirkt Schwankungen im Selbstversorgungsgrad
Tabelle 13, Seite A13
■ Vorleistungen der Landwirtschaft
Ausgaben
Die Vorleistungen der Landwirtschaft enthalten die Aufwendungen für Saat- und Pflanzgut, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Futtermittelzukäufe, Energie, den Unterhalt von Maschinen und Wirtschaftsgebäuden sowie für Dienstleistungen
Entwicklung der produktionsbedingten Ausgaben der Landwirtschaft
1990/922000
Der Wert der Vorleistungen hat zwischen 1990/92 und 2000 insgesamt um 250 Mio. Fr. abgenommen Deutlich geringer sind die Ausgaben für Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Vieh sowie für Dünger und Pflanzenschutzmittel Demgegenüber erhöhten sich die Aufwendungen für Dienstleistungen und Energie
Das Investitionsvolumen der Landwirtschaft ist von 1'525 Mio Fr im Jahr 1990 auf 1'420 Mio Fr im Jahr 1999 gesunken Diese Reduktion ist ausschliesslich auf tiefere Bauinvestitionen, die in dieser Zeit um 7% abgenommen haben, zurückzuführen. Die Ausrüstungsinvestitionen sind um 3% angestiegen
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 22
i n M i o F r Saat- und Pflanzgut, Vieh Energie Dienstleistungen Düngemittel, Pflanzenschutzmittel Material sowie Unterhalt Maschinen und Wirtschaftsgebäude Futtermittel Quelle: SBV 0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Entwicklung
i n M i o F r Bauinvestitionen Ausrüstungsinvestitionen Quelle: SBV 0 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 ■ Investitionen der Landwirtschaft
der Investitionsausgaben der Landwirtschaft 1990/921999
Der Bund hat im Berichtsjahr gesamthaft 47'131 Mio. Fr. ausgegeben, ein Ausgabenplus von 3,2% gegenüber 1999 Davon wurden 3'727 Mio Fr für Landwirtschaft und Ernährung aufgewendet Nach sozialer Wohlfahrt (12'281 Mio Fr ), Finanzen und Steuern (9'413 Mio. Fr.), Verkehr (6'630 Mio. Fr.) und Landesverteidigung (5'004 Mio. Fr ) liegen die Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung nach wie vor an fünfter Stelle
Der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtausgaben des Bundes betrug im Berichtsjahr 7,9% und erreichte den tiefsten Wert der letzten Jahrzehnte
Die Entwicklung der Ausgaben für Produktion und Absatz ist auf die Erfüllung der in Artikel 187, Absatz 12 der Übergangsbestimmungen zum neuen LwG festgehaltenen Verpflichtung ausgerichtet, wonach in den fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes die Mittel im Bereich der Marktstützung um einen Drittel gegenüber den Ausgaben im Jahr 1998 abzubauen sind Diese Verpflichtung entspricht in diesem Zeitraum einem Abbau von rund 400 Mio. Fr. Bisher wurden die Mittel um 248 Mio. Fr. reduziert

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 23
■ Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung
Ernährung 1990/921993 3 416 3 496 3 547 3 9533 908 3 926 4 197 3 727 3 048 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 M i o F r i n % in % der Gesamtausgaben Quelle: Staatsrechnung 0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 7,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5
46
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und
Tabelle
Seite A54
Entwicklung der Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung
Anmerkung: Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete So wurden z B die Aufwendungen für die Kartoffel-und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung 1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen Die Zahlen für 1990/92 und 1998 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung Quellen: Staatsrechnung BLW
Die neue Direktzahlungsverordnung ist am 1. Januar 1999 in Kraft getreten. Die mit der Einführung verbundenen Unsicherheiten bei der Schätzung des effektiven Finanzbedarfes führten zu einer vorsichtigen Festlegung der Beitragssätze für die Jahre 1999 und 2000 Zudem kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Zahlungsüberhängen vor allem als Folge starker Beteiligungszunahmen bei den ÖkoProgrammen. Aufgrund der genannten Unsicherheiten sowie zum Abbau und zur Verhinderung weiterer Zahlungsüberhänge wurde insbesondere der Flächenbeitrag etwas tiefer angesetzt als nach den Schätzungen möglich gewesen wäre Die Folge dieser vorsichtigen Vorgehensweise war, dass im Berichtsjahr gegenüber 1999 172 Mio. Fr. weniger ausgegeben wurden Die Beschlüsse des Bundesrates vom 10 Januar 2001 für das Jahr 2001 haben diesem Umstand Rechnung getragen So wurden verschiedene Beitragssätze bei den Direktzahlungen nach oben angepasst Insgesamt dürften die Ausgaben für die Direktzahlungen im Jahr 2001 um über 200 Mio Fr höher ausfallen als im Jahr 2000.
Die Ausgaben für Grundlagenverbesserung sind 1998 und 1999 praktisch konstant geblieben. Der um rund 100 Mio. Fr. höhere Betrag im Berichtsjahr ist vor allem mit dem Ausbau der Investitionskredite (Starthilfe) und der Erhöhung der Betriebshilfe in Verbindung zu setzen

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 24
Ausgabenbereich 1990/92 1998 1999 2000 in Mio. Fr. Produktion und Absatz 1 685 1 203 1 318 955 Direktzahlungen 772 2 126 2 286 2 114 Grundlagenverbesserung 207 147 148 246 Weitere Ausgaben 384 450 445 412 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 048 3 926 4 197 3 727
1.1.2 Märkte
Im Jahr 2000 wechselten sich gute und schlechte Wetterperioden ab. Nach kalten und schneereichen Wintermonaten brachte ein warmer Frühling die Vegetation rund 14 Tage in Vorsprung gegenüber dem Normaljahr Der trockene und heisse Frühsommer erlaubte qualitativ gute Heu- und Futtergetreideernten Dagegen bot der nasse Juli schlechte Voraussetzungen für die Brotgetreideernte; es gab einen unverhältnismässig grossen Anteil an Auswuchsgetreide Hingegen übertrafen hohe Zuckerrüben- und gute Kirschenernten die tiefen Erträge des Vorjahres bei weitem
Die Milchproduktion hat im Berichtsjahr zugenommen. Auch die Käseproduktion ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen Bis im Herbst war der Schlachtviehmarkt gesund und die Preise erreichten wieder das Niveau vor der ersten BSE-Krise von 1996 Im November des Berichtsjahres nahmen als Folge von Fällen in Frankreich und Deutschland die Diskussionen über BSE wieder zu, was auf dem Schlachtviehmarkt zu Preiseinbrüchen um die 30% führte
In der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung wird der Wert der im Bereich Landwirtschaft erzeugten Produkte als Endproduktion dargestellt Die Endproduktion hat im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 4,8% zugenommen: Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse plus 3,9% (86 Mio. Fr.); Tiere und tierische Erzeugnisse plus 5,2% (259 Mio Fr )
1 . 1 Ö K O N O M I E 25 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 Zusammensetzung der Endproduktion 2000 Milch 33% Schweine 14% Rindvieh 15% Übrige pflanzliche Erzeugnisse 3% Früchte, Gemüse 10% Weinmost 7% Getreide 7% Quelle: SBV 1 Schätzung, Stand Winter 2000/2001 Total 7 583 Mio. Fr. 1 Geflügel, Eier 5% Übrige tierische Erzeugnisse 2% Kartoffeln, Zuckerrüben 4% Tabelle 14 Seite A14
■
Milch und Milchprodukte
Die Molkereien und Käsereien verarbeiteten im Jahr 2000 rund 3,2 Mio t Milch Stark gestiegen ist die Produktion in den Bereichen Käse, Frischmilchprodukte und Milchpulver Da die Situation auf den internationalen Milchmärkten stabil war, konnte diese Menge problemlos abgesetzt werden
■
Die Gesamtproduktion einschliesslich der auf dem Hof verwerteten Milch hat im Berichtsjahr um 28‘000 t zugenommen und betrug rund 3,88 Mio t Die Milchleistung pro Kuh stieg ebenfalls weiter, und zwar im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 90 kg auf 5'470 kg.
Im Berichtsjahr haben die Milchproduzenten 3,17 Mio t Milch verkauft Diese Milchmenge stammte von 708'000 Kühen. Der Kuhbestand hat gegenüber dem Vorjahr um 1% (7'000 Tiere) abgenommen
Mit Ausnahme des Januars waren die monatlichen Milcheinlieferungen im Berichtsjahr höher als 1999 Deutlich mehr Milch wurde in den Monaten April und September bis Dezember eingeliefert Die Zunahme ist auf die gute Futterqualität und auf die steigende Nachfrage nach dem Rohstoff Milch der Käsereien und der Milchverwerter zurückzuführen Die schwierige Situation auf den Schlachtviehmärkten in den letzten Monaten des Berichtsjahres hat ausserdem dazu beigetragen, dass mehr Kühe auf den Betrieben gehalten wurden, was die Milcheinlieferungen entsprechend beeinflusste
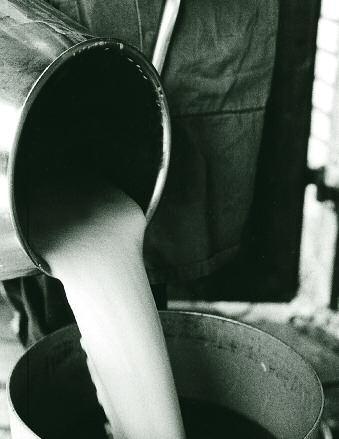
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 26
Milchjahr
Ein gutes
Produktion:
Milcheinlieferungen Milcheinlieferungen nach Monaten 1999 und 2000 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r i n 1 0 0 0 t Milcheinlieferungen 2000 Milcheinlieferungen 1999 Quellen: TSM, SBV 200 220 240 280 260 300 Tabellen
steigende
3–13, Seiten A4–A13
Im Berichtsjahr wurde die insgesamt vermarktete Milch (3,17 Mio. t) wie folgt verwertet (in t Milch):
zu Konsummilch und anderen Milchprodukten: 1'055'000 t
zu Käse: 1'410'000 t
zu Rahm/Butter: 711'000 t
Die hergestellte Käsemenge nahm gegenüber dem Vorjahr um 24,6% zu Diese hohe Steigerung ist nur zum Teil durch eine höhere Produktion begründet Unter anderem ist sie auch durch eine neue statistische Erhebung bedingt Vor dem 1 Mai 1999 wurde das Produktionsvolumen der meisten Käsesorten aufgrund der eingesetzten Milchmenge bestimmt. Dies hatte zur Folge, dass Magerkäse (Käse ohne Fett) statistisch gar nie in Erscheinung trat Mit der neuen Methode wird nun der effektiv hergestellte Käse erfasst Zudem sind in der Käseproduktion von 2000 neu auch Quark, Rohziger, Frischkäsegallerte sowie Alpkäse enthalten (Anteil an der Gesamtproduktion Käse: ca 13%)
Im Berichtsjahr wurde erstmals seit Jahren wieder mehr Hartkäse produziert Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr betrug 12% Das Produktionsvolumen von Frischkäse wie Mozzarella, von Weich- und Halbhartkäse weist nach wie vor eine steigende Tendenz auf Im Vergleich zum Vorjahr stieg im Jahr 2000 die Produktion von Mozzarella um 20% von 9'634 t auf 11'582 t

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 27
1
■ Verwertung: steigende Käseproduktion
1990/921998 19992000 i n 1 0 0 0 t M i l c h Andere Milchprodukte Rahm Butter Quellen: TSM SBV Käse Konsummilch 0 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Entwicklung der Verwertung der vermarkteten Milch
Die sinkende Tendenz der Butterproduktion hielt im Jahr 2000 an, war jedoch nicht mehr so ausgeprägt wie 1999 Der Produktionsrückgang im Berichtsjahr betrug 1,7% Für das Jahr 2000 wurde eine Vorzugsbutter-Produktion von 7'142 t ausgewiesen, im Vorjahr hingegen 33‘222 t. Diese grosse Differenz ist auf die geänderte statistische Erfassung der Butterherstellung zurückzuführen Rund 3/4 der schweizerischen Butterproduktion erfüllt die Kriterien für Vorzugsbutter Davon können jedoch nur rund 20% als Vorzugsbutter verkauft werden Die restlichen 80% gelangen als Rohstoff in die Weiterverarbeitung und werden zu «Die Butter», zu Butterspezialitäten oder zu entwässerter Butter verarbeitet Im Jahr 2000 wurde nur diejenige Menge als Vorzugsbutter ausgewiesen, die auch als Vorzugsbutter in den Verkauf gelangte In den vorangehenden Jahren hingegen wurde auch jene Menge Butter als Vorzugsbutter ausgewiesen, die in eine weitere Verarbeitung gelangte.

Im Berichtsjahr wurde 19% mehr Milchpulver hergestellt Diese Zunahme erklärt sich durch die steigende Nachfrage der Schokoladenindustrie nach inländischem Vollmilchpulver und der Milchersatzfutterhersteller nach inländischem Magermilchpulver
Im Milchsektor ist die Aussenhandelsbilanz positiv Frischmilch und Butter ausgenommen, exportiert die Schweiz bei allen Milchprodukten mengenmässig mehr als sie einführt
Entwicklung der Exporte und Importe von Käse
Im Jahr 2000 nahmen die Joghurtexporte um 133% auf 2'694 t zu. Die Möglichkeit der Erschliessung neuer Absatzmärkte wurde wahrgenommen Die Joghurteinfuhr hingegen ist im Vergleich zum Vorjahr etwa konstant geblieben Der Export von Milchpulver sank um 21,3% auf 13'992 t. Der Import in diesem Bereich hat ebenfalls abgenommen Die Buttereinfuhr ist um 47,7% gestiegen und erreichte im Berichtsjahr
7'370 t Im Vorjahresvergleich hat die Käseausfuhr stark abgenommen Im Jahr 2000 wurden 9'479 t (–15%) weniger Käse exportiert Dies lässt sich vor allem durch die im Vorjahr im Rahmen der Ablösung der alten Milchmarktordnung getätigten Sondergeschäfte im Export durch die Käseunion erklären. Die Hartkäseausfuhr sank um 18% auf 40'588 t
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 28
Abnehmende Käseexporte
■ Aussenhandel:
i n t Käseausfuhr Käseeinfuhr Handelsbilanz Quellen: OZD, BLW 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
1990/921998 19992000
■ Verbrauch: steigender Frischkäseverbrauch
Betrachtet man den Pro-Kopf-Konsum einzelner Milchprodukte, so sind unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich Der Verbrauch von Konsummilch hat 2000 gegenüber 1999 um 2,2 kg auf 88,8 kg zugenommen In den Jahren zuvor ging der Verbrauch kontinuierlich zurück.
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Milchprodukten
■ Produzentenpreise: Zielpreis weiterhin übertroffen
Der Käsekonsum pro Kopf stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,4% auf 16,6 kg, der Frischkäseverbrauch allein von 2,9 kg auf 3,3 kg. Im gleichen Zeitraum konnte ebenfalls eine steigende Tendenz im Verbrauch von Hartkäse festgestellt werden Nach einer positiven Entwicklung während den letzten Jahren wurde 2000 ein leichter Absatzrückgang beim Rahm verzeichnet
Seit gut einem Jahr bestimmen der Grenzschutz, die Mittel zur Marktstützung sowie die Marktkräfte den Produzentenpreis Der vom Bundesrat festgelegte Zielpreis von 77 Rp. pro kg Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein hat nur noch eine Bedeutung als Orientierungsgrösse
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 29
1
19992000 k g p r o K o p f Käse Joghurt Quelle: SBV Quark Butter 0 12 10 8 6 4 2 14 16 18 20 Milchpreise 1999 und 2000 Gesamt Industriemilch verkäste Milch Biomilch R p p r o k g M i l c h 1999 Quelle: BLW 2000 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
1990/921998
■ Konsumentenpreise
Im Jahr 2000 wurde der Zielpreis wiederum übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der schweizerische Gesamt-Milchpreis um 1 52 Rp pro kg Milch auf 79 41 Rp gesunken Ebenfalls eine leicht sinkende Tendenz wiesen im Berichtsjahr die Milchpreise für Industriemilch und verkäste Milch auf. Hingegen hat der Preis für Biomilch weiter zugenommen Er stieg im Berichtsjahr um 2,7% und erreichte 94 05 Rp pro kg Milch
Milchpreise 2000 gesamtschweizerisch und nach Regionen
Gesamtschweizerisch sind die Differenzen zwischen den Preisen relativ gering Dagegen wurde für 1 kg Biomilch bis zu 16 Rp mehr bezahlt als für Industriemilch oder verkäste Milch
Für 200 g Vorzugsbutter zahlte der Konsument im Jahr 2000 durchschnittlich Fr 2 97 Das sind knapp 10 Rp. mehr als im Vorjahr.
Entwicklung der Konsumentenpreisindices für
Die Konsumentenpreisindices für Milch und Milchprodukte entwickelten sich in der Tendenz seit 1998 ähnlich. Der Index für die Milch ist um 5,7 Punkte gefallen, jener für Rahm um 7,9 und jener für Käse um 2,3 Punkte Dagegen ist der Index für Butter leicht gestiegen
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 30
Rp /kg CH Region I Region II Region III Region IV Region V Gesamt 79,41 79,25 79,98 79,48 78,93 78,43 Industriemilch 78,29 78,40 78,49 78,61 77,73 77,91 vekäste Milch 79,14 79,78 79,22 79,66 78,14 79,01 Biomilch 94,05 93,88 94,63 93,26 94,02 nicht erhoben Quelle: BLW
Begriffe und Methoden, Seite A77
Milch
Milchprodukte 1990/921998 19992000 I n d e x ( M a i 1 9 9 3 = 1 0 0 ) Milch Käse Butter Quelle: BFS Rahm Andere Milchprodukte 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0
und
Im Bereich Milch und Milchprodukte wird die Marktspanne seit dem 1. Januar 1997 anhand der Preisniveaus auf Produzenten- und Konsumentenebene berechnet Im Vergleich zu anderen Agrarmärkten, wie für Fleisch oder Früchte und Gemüse, ist der Milchmarkt eher statisch. Die wichtigsten Gründe dafür sind:
– Produzentenpreis. Der Produzentenpreis war bis zum Übergang zur neuen Milchmarktordnung (MMO) staatlich fixiert Die Abnahmeverträge zwischen Produzent und Verarbeiter werden seither jährlich neu ausgehandelt Das Preisniveau auf Produzentenebene ist also, abgesehen von im Voraus abschätzbaren, saisonalen Schwankungen, auf ein Jahr hinaus relativ stabil
– Staatliche Beihilfen. Die Absatzpreise werden nach wie vor massgeblich von der Höhe der staatlichen Beihilfen beeinflusst. Änderungen oder Anpassungen werden in der Regel auf das neue Milchjahr hin vorgenommen, so dass die Beihilfen mindestens für die Dauer eines Jahres festgelegt sind
Milchkontingentierung. Das Angebot der verfügbaren Milchmenge ist aufgrund der Kontingentierung grundsätzlich gegeben
Entsprechend dieser Vorgaben haben sich die nominalen Marktspannen der Segmente Konsummilch, Käse, Konsumrahm und Butter in den letzten Jahren auf relativ konstantem Niveau entwickelt. Kurzfristige Schwankungen sind fast ausschliesslich auf Verkaufsaktionen zurückzuführen Seit der Einführung der neuen MMO wirkte sich ausserdem der saisonal schwankende Milchpreis – tiefe Preise im Frühjahr, hohe Preise im Herbst – auf die Spannenentwicklung der einzelnen Produktsegmente aus.
Entwicklung der Marktspannen der Periode Januar 1997 bis Dezember 2000 je kg verarbeitete Rohmilch
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 31
–
1 Begriffe und Methoden, Seite A78 ■ Marktspanne
F r / k g Milch Käse Butter Rahm Total Quelle: BLW F e b 9 7 A p r 9 7 J u n 9 7 A u g 9 7 O k t 9 7 D e z 9 7 F e b 9 8 A p r 9 8 J u n 9 8 A u g 9 8 O k t 9 8 D e z 9 8 F e b 9 9 A p r 9 9 J u n 9 9 A u g 9 9 O k t 9 9 D e z 9 9 F e b 0 0 A p r 0 0 J u n 0 0 A u g 0 0 O k t 0 0 D e z 0 0 0 00 1 60 1 40 1 20 1 00 0 80 0 60 0.40 0 20
Im Segment der Konsummilch erfolgten die Schwankungen der Marktspanne hauptsächlich aufgrund von Verkaufsaktionen Der Übergang zur neuen MMO mit tieferen Produzentenpreisen wurde mit Preisabschlägen auf der Konsumentenebene ausgeglichen. Der kurzfristige Anstieg im Mai 1999 ist darauf zurückzuführen, dass noch Produkte zu alten Preisen auf den Markt gelangten Da die Abgaben für entrahmte Milch per 1 Mai 1999 aufgehoben wurden, bewegte sich die Spanne seither auf leicht höherem Niveau
Beim Käse war die Entwicklung der Marktspanne am uneinheitlichsten Hier ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund des Einbezugs der Lagerdauer Schwankungen der Milchpreise oder Änderungen der Beihilfenstruktur verzögert zum Ausdruck kommen Insgesamt weist die Marktspanne beim Käse eine leicht steigende Tendenz auf. Sie ist insbesondere im September 2000 angestiegen Zu diesem Zeitpunkt wurde die Erhöhung der Zulage auf verkäster Milch ab dem 1 Mai 2000 von 12 auf 20 Rp spannenwirksam. Die Rohstoffverbilligung auf der verkästen Milch wurde also nicht in vollem Umfang an die Konsumentinnen und Konsumenten weiter gegeben
Die Spanne Konsumrahm bewegte sich bis im Mai 1999 – abgesehen von den kurzfristigen Schwankungen – auf konstantem Niveau Der Anstieg im Mai 1999 ist – wie bei der Konsummilch – auf Produkte mit alten Preisen zurückzuführen. Von Juni 1999 an bewegte sich die Spanne wieder auf konstantem, leicht tieferem Niveau

Die Marktspanne Butter bewegte sich ebenfalls bis zum Übergang zur neuen MMO auf stabilem Niveau Mit deren Einführung wurden verschiedene Beihilfen im Bereich Butter gekürzt oder gar aufgehoben, so dass sich die Marktspanne Butter ab Mai 1999 auf tieferer Stufe bewegte Die tiefere Marktspanne bei der Butter ist allein auf die Reduktion der staatlichen Beihilfen zurückzuführen
In der Periode von Januar 1997 bis Dezember 2000 ist die Gesamtspanne Milch und Milchprodukte um 4 52 Rp von 78 86 auf 83 38 Rp je kg verarbeitete Rohmilch gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2001 sind zudem vermehrt erhöhte Konsumentenpreise festgestellt worden Aufgrund gleichbleibender oder gar steigender Milchpreise und dem ab 1 Mai 2001 vollzogenen Stützungsabbau ist im Milchjahr 2001/02 mit weiteren Preiserhöhungen auf Absatzstufe zu rechnen
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 32
■ Schätzungen 2001
Der Milchmarkt befindet sich im Jahr 2001 in guter Verfassung. Die Verkäufe von Milchprodukten im In- und Ausland, vor allem im Bereich Käse, entwickeln sich erfreulich

Die Käseproduktion dürfte sich im Jahr 2001 weiter positiv entwickeln Auf Grund der schon vorliegenden Daten setzt sich 2001 auch im Frischmilchproduktebereich die positive Tendenz fort Die Produktion von Spezialitäten wie Joghurt, Dessertprodukte und Milchgetränke dürfte das Vorjahresergebnis übertreffen Bei der Butter ist zu erwarten, dass die Produktion leicht zunehmen wird
Die insgesamt erfreuliche Marktsituation dürfte wiederum stabile Preise für die Milchproduzenten ermöglichen. Auf Grund der im ersten Halbjahr 2001 vorliegenden Zahlen wird sich der Milchpreis im Durchschnitt des Jahres voraussichtlich wiederum über dem Zielpreis von Rp 77 pro kg Milch bewegen Bei den Konsumentenpreisen für Milchprodukte ist in den letzten Monaten eine steigende Tendenz festzustellen. Auf Grund unveränderter oder gar gestiegener Milchpreise und dem ab 1 Mai 2001 vollzogenen Stützungsabbau ist im Prinzip mit weiteren Preiserhöhungen speziell für Butter und Käse zu rechnen
Gemäss den Schätzungen 2001 für die landwirtschaftliche Gesamtrechnung (vgl. Abschnitt 1 1 3) dürfte im 2001 die Endproduktion Milch um rund 40 Mio Fr (+1,5%) zunehmen im Vergleich zum Vorjahr Dieses erfreuliche Ergebnis ist auf die stabilen Milchpreise und auf den Entscheid des Bundesrates zurückzuführen, die gesamte Kontingentsmenge ab 1 Mai 2001 um 3% zu erhöhen
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 33
1
Tabelle 14, Seite A14
■ Produktion: sinkende Rind-, Kalb- und Schweineproduktion
Tiere und tierische Erzeugnisse
Die Fleischwirtschaft wurde gegen Ende des Berichtsjahres von den neuerlichen Diskussionen rund um die BSE negativ beeinflusst. Vor allem das erstmalige Feststellen von BSE in Deutschland, das bis anhin als seuchenfrei galt, und die vielen kritischen Medienberichte in ganz Europa verunsicherten die Konsumentinnen und Konsumenten In der Folge brach der Konsum von Rindfleisch in der Schweiz um bis zu 20% ein, und die Produzentenpreise sanken um rund 30% In der Westschweiz war die Reaktion wegen der Nähe zu Frankreich besonders heftig Vermehrt wurde jedoch in dieser Periode Geflügel- und Lammfleisch gegessen
Bereits im Januar des Berichtsjahres führte der Ausbruch der klassischen Geflügelpest in neun oberitalienischen Provinzen zu grossen Verunsicherungen Zwischenzeitlich hat die Schweiz die Einfuhr von lebendem Geflügel, Geflügelfleisch und weiteren Erzeugnissen aus Italien verboten.
Der Bundesrat beschloss am 20 Dezember 2000 mit einer Änderung der Tierseuchenverordnung ein generelles Tiermehlfütterungsverbot Anlass dazu waren BSE-Fälle bei Kühen, welche nach den im Mai 1996 verschärften Massnahmen im Bereich Futtermittel geboren wurden sowie wissenschaftliche Hinweise. Verboten wurde auch die Verfütterung so genannter Extraktionsfette, die bei der Produktion von Tiermehlen anfallen Das Verbot trat am 1 Januar 2001 in Kraft An den anfallenden Mehrkosten, die bei der Entsorgung durch Verbrennung entstehen, beteiligt sich der Bund mit 75% (ca 28 Mio Fr )
Gegenüber dem Vorjahr sank der Rindviehbestand um 1,3% und der Legehennenbestand um 3,3% Der langfristige Trend hat sich damit fortgesetzt Beim Mastgeflügel steigt hingegen der Bestand seit 1990 kontinuierlich an und liegt im Berichtsjahr 32,3% über demjenigen von 1990 Grund dafür ist die stark gestiegene Nachfrage nach inländischem Geflügelfleisch Die Zahl der gehaltenen Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde blieb zwischen 1998 und 2000 relativ stabil.
Entwicklung der Tierbestände
34 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Tierart 1990 1998 1999 2000 1990–1998/00 in 1 000 in 1 000 in 1 000 in 1 000 % Rindvieh 1 858 1 641 1 609 1 588 -13,17 Schweine 1 776 1 487 1 453 1 498 -16,84 Schafe 355 422 424 421 18,78 Ziegen 61 60 62 62 0,55 Pferde 38 46 49 50 26,32 Mastgeflügel 2 878 3 502 3 747 3 808 28,01 Lege- und Zuchthennen 2 795 2 270 2 223 2 150 -20,78 Quelle: BFS
Tabellen 3–13, Seiten A4–A13
■ Aussenhandel: Fleischimporte nehmen zu
Die Produktion von Rindfleisch nahm gegenüber 1999 um 13,3% ab, jene von Kalbfleisch um 10,4% Vor allem wegen den attraktiven Bankviehpreisen wurden wieder vermehrt Kälber in die Grossviehmast geleitet Auch das Angebot an Schaffleisch war 12,5% tiefer als im Vorjahr. Die lebhafte Nachfrage nach inländischem Geflügelfleisch führte zu einem Wachstum der Produktion von 7,7%

Die Eierproduktion sank gegenüber dem Vorjahr um 4,1% und belief sich auf 652 Mio St
Im Berichtsjahr wurden 2'007 t Kalbfleisch eingeführt; dies sind 662 t mehr als im Vorjahr Ausnahmsweise war das Angebot an inländischem Kalbfleisch im ersten Halbjahr gering, so dass bereits in dieser Periode mehr als 600 t importiert wurden. Hauptlieferländer sind die Niederlande, Italien und Frankreich Bei den Rindfleischeinfuhren von rund 13'000 t handelte es sich insbesondere um Spezialstücke (Nierstücke, High-Quality-Beef und Rindsbinden für die Trockenfleischfabrikation).
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 96 Esel, Maultiere und Maulesel und 2'646 Pferde und Kleinponys importiert, womit die Einfuhrzahlen von 1999 nicht erreicht wurden Weiter wurden 23'597 t Schaleneier eingeführt Davon flossen 55% als Konsumeier in den Detailhandel und den Gastrokanal und 45% wurden für die Eiprodukteherstellung aufgeschlagen Umgerechnet mit einem durchschnittlichen Eigewicht von 60,289 g wurden insgesamt 391 Mio Schaleneier eingeführt Nicht zuletzt wegen der Präferenz zu Schweizer Konsumeiern gingen die Importe seit 1990/92 um 25% zurück. Genau umgekehrt ist die Situation bei den Eiprodukten, deren Importe im gleichen Zeitraum um 26% gestiegen sind
1 . 1 Ö K O N O M I E 35 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1
1990/921998 19992000 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schaffleisch Geflügelfleisch Quelle: Proviande Kalbfleisch Ziegenfleisch Schaleneier 70 140 130 120 110 100 90 80 Schweinefleisch Pferdefleisch
Entwicklung der tierischen Produktion
■ Verbrauch: Fleisch- und Fischverbrauch nimmt
In allen Fleischkategorien und bei den Eiern nehmen die Ausfuhren gemessen an der Inlandproduktion entweder nur einen geringen Anteil ein oder es werden überhaupt keine Erzeugnisse ausgeführt Am bedeutendsten waren mit 969 t die Exporte von Trockenfleisch von Tieren der Rindergattung (Bündnerfleisch), vor allem in die Nachbarländer Frankreich und Deutschland
Wie 1999 konnten keine Rinder in die EU-Länder exportiert werden BSE-Fälle in Deutschland und Frankreich und das Aufkommen der Maul- und Klauenseuche verschärften die Situation zusätzlich Im Rahmen des Hilfsprojektes der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) konnten 1'296 Rinder und Kühe in den Kosovo ausgeführt werden Fachleute überwachten und begleiteten diese Aktion, welche sowohl im In- wie auch im Ausland auf positives Echo gestossen ist. Insgesamt wurden 2'604 lebende Rinder zur Zucht eingeführt, wobei die Rassen Holstein (676 St ) und Jersey (896 St ) zusammen den Hauptanteil einnehmen Mehr als 90% der eingeführten Tiere stammen aus Deutschland, Dänemark und Frankreich.
Die Inlandanteile von Kalb- und Schweinefleisch am Verbrauch lagen im Berichtsjahr bei rund 92% Tiefe Inlandanteile unter 15% weisen Pferde- und Kaninchenfleisch sowie Fisch auf. Weiter steigend ist der Inlandanteil von Geflügelfleisch, der im Jahr 2000 rund 43% betrug Vom Gesamtverbrauch an Fleisch und Fisch in der Höhe von 438'425 t wurden lediglich 68% (1999: 70%) im Inland produziert
Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums von Fleisch und Eiern
Der Fleisch- und Fischkonsum pro Kopf sank gegenüber dem Vorjahr um 1,6% auf 59,65 kg. Der rückläufige Trend hält nun seit 1988 an, wobei sich der Pro-KopfKonsum der einzelnen Fleischkategorien unterschiedlich entwickelt hat: Bei Schweineund Rindfleisch nahm er um mehr als 20% ab, bei Geflügelfleisch hingegen stieg er um 16% Den grössten Anteil nimmt weiterhin Schweinefleisch ein, von dem pro Kopf und Jahr mehr als 25 kg gegessen werden Nach wie vor gering und relativ stabil ist der Konsum von Schaf-, Pferde-, Ziegen- und Kaninchenfleisch.
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 36
weiter ab
1990/921998 19992000 I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Rindfleisch Schweinefleisch Ziegenfleisch Quelle: Proviande Geflügelfleisch Kalbfleisch Schaffleisch 70 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Pferdefleisch Schaleneier (in St.)
■ Produzentenpreise:
im Hoch
Von Januar bis Oktober 2000 realisierten die Rind- und Kalbfleischproduzenten so hohe Preise wie letztmals 1995 Das knappe Angebot an Kalbfleisch führte sogar zu einem atypischen Verlauf des Preises, indem er während der ersten Jahreshälfte stabil auf rund Fr. 13.– je kg SG verharrte. Normalerweise gerät der Preis in dieser Periode wegen dem saisonal grossen Angebot unter Druck Auch für Schweinefleisch wurde mit Fr 4 69 je kg SG im Durchschnitt 7% mehr bezahlt als 1999; das gleiche gilt für Lammfleisch mit einer Preissteigerung von 10% auf Fr 12 60 je kg SG Die positive Entwicklung in den ersten zehn Monaten des Berichtsjahres wurde schlagartig durch die wieder ausgebrochenen Diskussionen rund um die Tierseuche BSE gestoppt Gegen Ende des Jahres fielen die Preise für Muni mittlerer Qualität (Handelsklasse T3) um 30% auf Fr 6 90 je kg SG
Auf dem Eiermarkt rutschten die Preise für verkaufte Eier an Sammelstellen weiter ab Gegenüber 1999 sanken sie um 6% auf 21 Rp pro St Dank den gezielten Marktentlastungsmassnahmen nach Ostern konnte der saisontypische Preisrückgang im Sommer gedämpft werden
■
Die gestiegenen Produzentenpreise für Rind- und Kalbfleisch zogen im Berichtsjahr auch die Konsumentenpreise um 2 bis 5 Fr pro kg nach oben Es wurde ein Niveau erreicht, das sogar höher liegt als dasjenige der Referenzperiode 1990/92 Ebenfalls mehr mussten die Konsumentinnen und Konsumenten für Schweine- und Lammfleisch ausgeben. Seit Jahren stabil bleiben die Preise für frische Inlandpoulets.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 37
1
Fleischpreise
steigende Rind- und Kalbfleischpreise
Schlachtvieh-
ab Hof F r p r o k g S G Kühe, Handelsklasse T2/3 Muni, Handelsklasse T3 Kälber, Handelsklasse T3 Fleischschweine, leicht Quelle: SBV 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 J a n u a r F e b r u a r M ä r z A p r i l M a i J u n i J u l i A u g u s t S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r D e z e m b e r
Konsumentenpreise:
Monatliche
und Fleischschweinepreise 2000,
■ Bruttomarge Fleisch
Die Methode zur Berechnung der Verarbeitungs-Verteilungsspanne für Frischfleisch wurde überarbeitet und rückwirkend auf den Januar 1990 umgesetzt Das BLW berechnet neu die «Bruttomarge Verarbeitung-Verteilung» in Fr /kg SG (ohne Mwst) beim Frischfleisch. Die Marge ist definiert als Differenz zwischen dem Rohertrag oder Umsatz und den variablen Kosten des Verarbeitungs- und Verteilsektors Die Jahreswerte werden aus dem Durchschnitt der Monatswerte, die anhand des Konsums gewichtet wurden, berechnet Bei der Entwicklung der nominalen Bruttomarge ist zu berücksichtigen, dass zwischen 1990 und 2000 eine Inflation von 15% festgestellt wurde
Entwicklung der Bruttomarge Verarbeitung-Verteilung von Frischfleisch (nominale Preise)
■ Schätzungen 2001
Nach dem für Produzentinnen und Produzenten guten Jahr 2000 zeigen die Schätzungen für das Folgejahr starke Veränderungen: Das inländische Angebot an Rind- und Kalbfleisch dürfte um 5 bzw 15% steigen; es wird jedoch absolut weniger gross sein als 1999 Die durchschnittlichen Preise für Muni und Rinder mittlerer Qualität dürften auf rund Fr. 7.–/kg SG (-20%) sinken. Bei den Kälbern wird der Jahresdurchschnittspreis ebenfalls zurückgehen, und zwar auf rund Fr 12 –/kg SG (-10%) Beim Schweinefleisch bleibt das Angebot konstant Es dürfte ein durchschnittlicher Preis von Fr 4 40/kg SG realisiert werden
Infolge der angespannten Lage auf dem Schlachtviehmarkt werden die Importe von Rind-, Kalb- und Schweinefleisch signifikant sinken
Der langfristige Trend der Rindvieh- und Geflügelbestände dürfte sich fortsetzen. Somit werden wohl bald 4 Mio St Mastgeflügel gehalten und der sinkende Rindviehbestand nähert sich der Zahl von 1,5 Mio St
Die Endproduktion der Tiere und tierischen Erzeugnisse ohne Milch dürfte über 8% tiefer liegen als im Berichtsjahr Dieser Rückgang wird fast ausschliesslich von der Rindviehhaltung verursacht, deren Wert auf etwa 930 Mio Fr sinkt (-18,4%) Dadurch dürfte die Schweinehaltung wieder mit einem gegenüber 2000 stabilen Wert von 1 Mrd. Fr. den grössten Anteil bei Tieren und tierischen Erzeugnissen erreichen. In den übrigen tierischen Betriebszweigen werden keine bedeutenden Veränderungen geschätzt
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 38
I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) Total Rind Kalb Schwein Quelle: BLW 70 90 90 100 110 120 130 140 150 1990199119921993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tabelle 14, Seite A14
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte
Auf ein insgesamt überdurchschnittlich sonniges und warmes erstes Halbjahr 2000 folgte ein nasser und kühler Juli mit zahlreichen Hagelgewittern, die punktuell grosse Schäden an den Kulturen anrichteten Erst ab Mitte August gab es wieder verbreitet warmes, trockenes Sommerwetter Im Oktober führten ergiebige Niederschläge auf den durchnässten Böden vor allem im Wallis und anderen Gebieten zu Murgängen und lokal zu grossflächigen Überschwemmungen Dem bereits aussergewöhnlich warmen Jahr 2000 folgte ein milder Winter mit Temperaturen über 0º C oft bis über 1000 m über Meer
Auf die Spezialkulturen wirkten sich das warme Wetter und die im Jahresdurchschnitt normalen Niederschlagsmengen positiv aus: frühe, grosse und qualitativ gute Ernten waren zu verzeichnen Insbesondere setzte die Kirschenernte so früh ein wie noch nie und dank guter Witterung zu Beginn der Ernte war die Qualität hervorragend. Auch beim Wein hatte das warme Wetter einen sehr positiven Einfluss und der Jahrgang 2000 gilt als einer der besten der letzten Jahre
Die Flächenanteile der verschiedenen Kulturen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert Die offene Ackerfläche ging gesamthaft um 1'339 ha zurück Nach wie vor spielt die Getreidefläche im Ackerbau mit einem Anteil von fast zwei Dritteln eine zentrale Rolle. Die Ölsaatenfläche hat sich nur wenig verringert, wobei mehr Sonnenblumen und weniger Raps und Soja als im Vorjahr ausgesät wurden Die mehr als 50%ige Reduktion der Produzentenpreise machten die Ölsaaten trotz Einführung eines spezifischen Flächenbeitrags betriebswirtschaftlich weniger attraktiv Hinzu kam, dass im Berichtsjahr noch die beschränkte Preis- und Übernahmegarantie für Brotgetreide galt. Dadurch kamen die Produzentenpreise für Ölsaaten und Brotgetreide in der gleichen Höhe zwischen Fr 60 –/dt und Fr 70 –/dt zu liegen Die Kartoffelfläche und die Zuckerrübenfläche sind dagegen geringfügig angestiegen

1 . 1 Ö K O N O M I E 39
1
■ Produktion: gutes Pflanzenbaujahr
Tabellen 3–13, Seiten A4–A13
Zusammensetzung der offenen Ackerfläche 2000
Silo- und Grünmais 14%
40 486 ha
Freilandgemüse 3%
Raps 5%
14 343 ha
Zuckerrüben 6% 17 725 ha
üb
Kartoffeln 5% 14 153 ha
Q
uell
Im Ackerbau sind die Erträge je nach Kultur recht unterschiedlich, jedoch durchwegs höher als im Vorjahr ausgefallen Die guten Ergebnisse von 1998 konnten aber nicht erreicht werden Der Brotgetreideanbau erzielte befriedigende Erträge, die Qualität liess jedoch zu wünschen übrig Infolge des verregneten Julis ist ein sehr grosser Teil des Brotgetreides ausgewachsen. Beim Raps waren die Erträge mässig. Die Zuckerrübenernte erreichte mit 1,4 Mio t ein Rekordergebnis Die Kartoffelernte lag leicht unter dem mehrjährigen Mittel
Entwicklung der Flächenerträge ausgewählter Ackerprodukte
70 140 130 120 110 100 90 80
19992000 n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 )
1990/921998
Produkte (Erträge 2000)
Winterweizen (60 dt/ha)

Kartoffeln (424 dt/ha)
Raps (27 dt/ha)
Gerste (60 dt/ha)
Zuckerrüben (795 dt/ha)
Quelle: SBV
24‘229 ha oder 2,3% der LN sind mit Dauerkulturen bepflanzt Davon sind 6‘984 ha Obstkulturen, 250 ha Strauchbeeren und 15'058 ha Reben Die Rebfläche ist stabil geblieben, wobei sich das Verhältnis von roten (7'958 ha) zu weissen (7'100 ha) Traubensorten weiter zugunsten der roten Sorten (+44 ha) verschoben hat
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 40
Getreide 62% 182 669 ha rige Kulturen 5% 14 713 ha
8 459 ha
e: SBV
Total 292 548 ha
I
Die Abdeckung der Gemüsekulturen mit Vlies oder Plastikfolien zur Verfrühung und zur Verlängerung des Anbaues hat sich in den letzten zehn Jahren beinahe auf rund 2'000 ha verdoppelt Die Gewächshaus- und Tunnelfläche hat sich hingegen im gleichen Zeitraum nur um wenige ha vergrössert (2000: 820 ha).
1990/921998 19992000
Die Fläche der Apfelanlagen betrug 4'812 ha und ist 203 ha kleiner als im Vorjahr Die Obstbauern haben ihre Apfelkulturfläche wegen den schlechten Produzentenpreisen in der Saison 1998/99 verkleinert Die Anbaufläche wurde im Rahmen der Rodeaktion des Schweizerischen Obstverbandes (SOV), welche mit produzenteneigenen Mitteln über den Selbsthilfefonds finanziert wurde, im Jahre 2000 zusätzlich um 90 ha reduziert Die Hauptapfelsorten Golden Delicious, Idared, Jonagold, Maigold und Gala machten wie schon in den Jahren 1990/92 mehr als die Hälfte der Apfelfläche aus. Innerhalb der letzten zehn Jahre fand eine gewisse Sortenkonzentration statt Der Anteil dieser Sorten an der Gesamtfläche stieg von 53 auf 62% Dies vor allem dank der Sorte Gala, deren Fläche sich in diesem Zeitraum vervierfachte. Gala ist zur zweitwichtigsten Sorte nach Golden Delicious geworden Eine starke kontinuierliche Flächenzunahme erfuhren ebenfalls die Apfelsorten Rubinette, Braeburn und Topaz
Die Marktvolumen der Gemüse- und Obstarten, die in der Schweiz angebaut werden können, betrugen im Durchschnitt der letzten drei Jahre 485'800 t Gemüse und 173'900 t Obst Das Schweizer Gemüse hatte einen Anteil am Marktvolumen von 58% Beachtliche Schweizer Anteile von teilweise wesentlich mehr als 85% wiesen die Lagergemüse Karotten, Knollensellerie, Randen, Rot- und Weisskabis, Wirz, Zwiebeln sowie die Blattsalate Lollo, Nüssli- und Eichenlaubsalat auf Bei Obst betrug der Schweizer Marktanteil im Durchschnitt der letzten vier Jahre 73% Äpfel hatten mit 92% einen besonders hohen und Aprikosen mit 19% einen besonders kleinen Anteil.

1 . 1 Ö K O N O M I E 41
1 Flächenentwicklung
von Apfelsorten
i n h a Golden Delicious Idared Gala Quelle: BLW Glockenapfel Maigold Gloster 0 1 500 1 000 500 J
pp
J
Gruppe 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
onagold-Gru
e
onathan-
■ Verwertung: viel Auswuchsgetreide

Es wurden 6'600 t Schweizer Champignons auf dem Frischmarkt abgesetzt. Diese Menge entsprach dem Durchschnitt der drei Vorjahre und einem Marktanteil von 80% Hingegen wurden lediglich 350 t Champignons für die Konservenverarbeitung geerntet. Es handelt sich dabei um Restmengen des Frischmarktes. Wie schon im Vorjahr nahm der Marktanteil von Schweizer Champignons für Konserven ab, er betrug 5%
Die Weinernte 2000 betrug 127,6 Mio Liter oder 3,4 Mio Liter weniger als im Vorjahr Davon stammten 60,6 Mio Liter von roten und 67 Mio Liter von weissen Traubensorten
Durch die feuchten Witterungsverhältnisse im Juli musste die Getreideernte unter schwierigen Verhältnissen eingebracht werden Ein Viertel des vom Bund übernommenen Brotgetreides war ausgewachsen und musste im Futtersektor verwertet werden. Die Qualität des mahlfähigen Brotgetreides war durchschnittlich und das Angebot konnte die Nachfrage nach inländischem Brotgetreide knapp decken Ein Blick auf die Entwicklung der Getreideverwertung in den letzten zehn Jahren zeigt, dass die erntebedingten Schwankungen des inländischen Getreideangebots durch den Futtersektor aufgefangen wurden Das Brotgetreide konnte dank der Übernahme durch den Bund stets in gleichbleibender Menge verkauft werden.
Entwicklung der Verwertung der Getreideernte
Garantiemenge Brotgetreide Auswuchsgetreide (deklassiert) übriges deklassiertes Brotgetreide Futtergetreide inkl. nicht abgeliefertes Brotgetreide
Die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld haben 218'511 t Zucker produziert. Weil im Verarbeitungsauftrag an die Zuckerfabriken die Zuckermenge auf 185'000 t begrenzt ist, mussten 33'511 t so genannter C-Zucker entweder auf die nächste Kampagne übertragen oder zu Weltmarktpreisen abgesetzt werden. Wegen den hohen Weltmarktpreisen für Zucker haben viele Rübenproduzenten vorgezogen, die über das Kontingent gelieferten Rüben (C-Rüben) abzurechnen, um im nächsten Jahr wieder die volle Kontingentsmenge (A- und B-Rüben) produzieren zu können
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 42
199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 i n 1 0 0 0 t
Quelle: BLW V
0 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
om Bund übernommenes Brotgetreide
■ Aussenhandel: importierte Sojabohnen
Die Schweizer Tafelbirnen stammen wie die Tafeläpfel fast ausschliesslich aus Obstanlagen Während sich die jährlichen Tafelapfelmengen in einem engen Band bewegen, bestehen bei den Tafelbirnen recht ausgeprägte Schwankungen von Jahr zu Jahr. Die Schweizer Birnenmenge für den Frischkonsum schwankt seit 1993 zwischen 11'000 t und 16'000 t Die in den Anlagen geernteten Birnen gelangen mit Ausnahme der Sorte Williams auf den Frischmarkt Die technische Verwertung dient im Gegensatz zu den Äpfeln nicht als Puffer für den Tafelmarkt. Die Williamsbirnen werden zu einem grossen Teil als Brennbirnen verwertet Die aus dem Feldobstbau stammenden Äpfel und Birnen, die naturbedingt starken Ertragsschwankungen (Alternanz) unterliegen, werden ausschliesslich vermostet
Der über Jahre stetig rückläufige Ausstoss an ungegorenen und gegorenen Obstsaftgetränken im Inland scheint gebrochen So wurde im Jahr 2000 gleich viel gegorener Obstsaft verkauft wie im Vorjahr, bei den ungegorenen war sogar eine leichte Steigerung zu verzeichnen.
Das Saisongetränk «Obstsaft frisch ab Presse» konnte seinen Marktanteil ebenfalls leicht ausbauen, obwohl weitgehend auf Aktionen verzichtet wurde
In der Schweiz wurden im Berichtsjahr etwas weniger als 200'000 t Ölsaaten verarbeitet Davon waren 109'000 t hauptsächlich importierte Sojabohnen 14'825 t Sojaöl sind im Rahmen des Veredlungsverkehrs wieder exportiert worden. Hinzu kamen Exporte von 3'000 t inländischem Rapsöl für humanitäre Zwecke Wegen der kleinen Ernte sind 1'700 t Rapsöl zu Speisezwecken und knapp 2'000 t Rapssaaten zur Auslastung der bestehenden Bio-Dieselproduktion importiert worden. Die Verarbeitung von importierten Ölsaaten zu Speiseöl wird in den nächsten Jahren merklich zurückgehen, da mit der Schliessung des Ölwerkes in Horn (TG) rund zwei Drittel der inländischen Verarbeitungskapazität per Ende 2000 stillgelegt wurden
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 43
1
Entwicklung
1993/961997 1998 1999 2000 i n 1 0 0 0 t Feldobstbau Obstanlagen Mostbirnen Brennbirnen Tafelbirnen Quelle: BLW 0 120 100 80 60 40 20
der Verwertung der Birnenernte
Inlandproduktion und Import ausgewählter Produkte 2000

Im Berichtsjahr musste erstmals der in der WTO notifizierte minimale Marktzutritt von 5% innerhalb des Zollkontingents für Kartoffeln gewährt werden Dies entspricht 22'250 t Kartoffeln und Kartoffelprodukten Wegen der kleinen Ernte 1999 wurde das Zollkontingent erhöht, um den Anschluss an die Kartoffelernte 2000 zu gewährleisten Insbesondere der Bedarf an Veredelungsrohstoff zur Produktion von Chips, Frites, etc. konnte nicht genügend durch inländische Kartoffeln gedeckt werden
Seit Anfang der neunziger Jahre ist die Inlandversorgung mit Zucker stetig angestiegen und liegt bei gut 80% des Nettoverbrauchs Parallel dazu haben die Importe und Exporte im Rahmen des Veredelungsverkehrs in den EU-Raum zugenommen Der Grossteil dieser Zuckerexporte in Verarbeitungsprodukten besteht aus Limonaden, weil die EU bei diesen Zollpositionen eine verminderte Zollbelastung gegenüber der Schweiz hat (Protokoll 2 des Freihandelsabkommens von 1972).
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 44
Brotgetreide Futtergetreide Zucker Ölsaaten Kartoffeln Gemüse Obst (ohne trop. Früchte) i n 1 0 0 0 t Import Inlandproduktion Quellen: SBV, Schweizerischer Obstverband, Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau, OZD, Zuckerfarbriken Aarberg und Frauenfeld AG 0 100 200 300 400 500 600 700 Entwicklung der Zuckerbilanz 1990/921998 19992000 i n 1 0 0 0 t Import Inlandproduktion Export Nettoverbrauch Quelle: Treuhandstelle der Schweizerischen Lebensmittelimporteure 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50
Die Versorgung der Schweiz mit Eiweissfuttermitteln ist weiterhin von einem grossen Importanteil geprägt Über drei Viertel des inländischen Bedarfes muss durch Importe gedeckt werden Mit 170'000 t hatte Soja im Berichtsjahr den grössten Anteil an diesen Importen.
Seit Beginn des Jahres 2001 gilt das Verfütterungsverbot von tierischen Proteinen (Fleischmehl, Fleischknochenmehl, Griebenmehl, Griebenkuchen, Futterknochenschrot, Blutmehl, Gelatine aus Schlachtabfällen von Wiederkäuern, Geflügelmehl und Federmehl) an alle Nutztiere Diese Massnahme hat jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Importe, weil im Berichtsjahr nur noch knapp 2% der gesamten Eiweissfuttermittel tierischer Herkunft waren und künftig durch pflanzliche ersetzt werden müssen. Seit 1990 ist der Einsatz von Tiermehl in der Nutztierfütterung kontinuierlich zurückgegangen
Die Einfuhren von Gemüse und Obst, die in der Schweiz angebaut werden können, sind mit 206'300 t und 48‘200 t um rund 2% tiefer als im Vorjahr Zu den wichtigsten Importgemüsen und Importfrüchten gehören die oft unter Folien oder Glas angebauten Tomaten, Peperoni, Salatgurken und Erdbeeren Diese Frischprodukte machen zusammen einen Drittel der Importe aus Mehr als zwei Drittel der Gemüse- und Obstimporte stammen aus Italien, Spanien und Frankreich Weitere wichtige Lieferländer sind Holland für Gemüse, Marokko für Tomaten und Südafrika für Birnen Der grösste Teil der Gemüseimporte, nämlich 68%, erfolgt im Winterhalbjahr Die Obstimporte (67%) werden hingegen vorwiegend im Sommerhalbjahr getätigt. Seit 1998 sind besonders starke Importzunahmen bei Brennkirschen und Brennzwetschgen (inkl Maische) zu verzeichnen
Die Einfuhren an Trinkwein betrugen 142,5 Mio Liter Rotwein und 17,8 Mio Liter Weisswein Dazu kamen noch rund 10,7 Mio Liter Schaumwein, 8,4 Mio Liter Verarbeitungswein und 1,5 Mio Liter Süssweine Die Exporte schlagen wie im Vorjahr mit rund 700'000 Liter zu Buche Gegenüber 1999 wird ein Rückgang der Einfuhren an Rotweinen um 5 Mio. Liter und der Schaumweine um 2,3 Mio. Liter festgestellt. Die Importe von weissen Weinen und von Süssweinen blieben stabil
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 45 1
1990/921998 19992000 i n 1 0 0 0 t Pflanzliche, Import Tierische, Import Quellen: BLW, OZD Pflanzliche, Inland Tierische, Inland 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50
Entwicklung der Versorgung mit Eiweissfuttermitteln
■ Verbrauch: mehr Speisekürbisse
Der Konsum von frischem, in der Schweiz anbaubarem Gemüse und Obst betrug 68 kg Gemüse pro Person im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 und 24 kg Obst im Durchschnitt der Jahre 1997/2000 Dies entspricht einer Konsumsteigerung von 7 kg Gemüse im Vergleich zu den Jahren 1990/92. Bei Obst war dagegen ein Konsumrückgang von 1 kg pro Person im Vergleich zu den vier Vergleichsjahren 1990/93 zu verzeichnen
Konsumänderungen: Bei Schweizer Speisekürbissen stieg der Verbrauch im Jahr 2000 sehr stark an Er hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und betrug 4‘432 t Ebenfalls sehr grosse Verbrauchssteigerungen von rund 50% gegenüber dem Vorjahr gab es bei Schweizer Tomaten am Zweig (Rispen mit runden Tomaten oder mit Cherrytomaten) und bei Schweizer Eichenlaubsalat. Seit mehreren Jahren nimmt zudem der Konsum bei den Eisbergsalaten, Broccoli, Zuckerhut und Bundzwiebeln/ Cipolotte kontinuierlich zu
Es werden zunehmend neue, grossfrüchtige Steinobstsorten konsumiert Bei Zwetschgen handelt es sich beispielsweise um die 33-mm-Sorten Cacaks Schöne, Hanita und Elena, bei den Kirschen um Kordia, Star und Regina sowie bei Aprikosen um Jumbo Cot und Goldrich In den letzten zwei bis drei Jahren sind bei diesen Sorten Flächenzunahmen zu verzeichnen. Das Angebot aus Schweizer Produktion dürfte deshalb in den nächsten Jahren weiter zunehmen
Rot- und Weissweinkonsum im Weinjahr 1999/2000
Ausländischer Weisswein 8%Weisswein: 30%
Rotwein: 70% 295,8 Mio. Liter = 100%

Schweizer Weisswein 22%
Schweizer Rotwein 20%
Ausländischer Rotwein 50%
Quellen: OZD, BLW, Kantone
Der Weinkonsum in der Schweiz nahm im Weinjahr 1999/2000 nochmals um 1,2 Mio Liter zu und erreichte 295,8 Mio Liter Der Anteil an Schweizer Wein stieg um 1%, was 42,1% des Verbrauches entspricht. Der Verbrauch an Schweizer Wein stieg um 2,6 Mio. Liter, er lag bei 125 Mio Liter Im Gesamtverbrauch, das heisst inkl den Verarbeitungswein, stieg der Rotweinanteil auf 205,6 Mio Liter (+2,1 Mio Liter) Der Verbrauch an Weisswein hingegen war leicht rückläufig und betrug 90,2 Mio. Liter oder 0,7 Mio. Liter weniger als im Vorjahr
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 46
■ Produzentenpreise: Abnahme im Ackerbau
Der Rückgang der Produzentenpreise im Ackerbau setzte sich bei den meisten Kulturen fort Die Preise für Ölsaaten sind um 50 bis 70% gesunken Ein Teil dieser Erlöseinbussen konnte durch den neu eingeführten spezifischen Flächenbeitrag von Fr. 1'500.–/ha für Ölsaaten kompensiert werden. Im Hinblick auf die Liberalisierung sind auch die Brotgetreidepreise gesenkt worden Da gleichzeitig auch die Anbauprämien für Futtergetreide reduziert wurden, konnte die Erlösparität innerhalb des Getreides weitgehend beibehalten werden Mit ausgeglichenen Preisverhältnissen ist in Zukunft zu rechnen, weil seit dem 1 Juli 2001 alle Preis- und Übernahmegarantien aufgehoben sind

Entwicklung der Produzentenerlöse für Ackerprodukte
1990/921998
Produzentenpreise 2000
Weizen, 66.40 Fr./dt
Zuckerrüben, 11.60 Fr./dt
Raps, 61.30 Fr./dt
19992000
Gerste, 48 50 Fr./dt
Kartoffeln, 36.10 Fr./dt
Quelle: FAT
1 . 1 Ö K O N O M I E 47
1
A b w e i c h u n g i n %
-40 -50 -60 -70 -30 -20 -10 0
Für den grössten Teil der Gemüse konnten die Produzenten mehr lösen als in den Vorjahren Der durchschnittliche Kilopreis war rund 10% höher als im Durchschnitt der drei Vorjahre Aufgrund der höheren Preise und der durchschnittlichen Erntemengen hatten die Produzenten verglichen mit den Jahren 1997/99 einen Mehrerlös von rund 7% Die höheren Preise und die Mehrerlöse müssen allerdings im Hinblick auf die Kostenentwicklungen relativiert werden Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik in Tänikon (FAT) hat im Auftrag des Verbandes schweizerischer Gemüseproduzenten ein Gutachten zur Kostenentwicklung 1999 bis 2001 bei fünf spezialisierten, professionell geführten, mittleren und grossen Gemüsebaubetrieben erstellt Zwischen 1999 und 2000 wurde ein Anstieg der Produktionskosten von 8,5%, zwischen 2000 und 2001 ein solcher von 5,8% ermittelt Zu diesem markanten Anstieg tragen in erster Linie die folgenden Kostenpositionen bei: Personalaufwand, Transport- (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) und Energiekosten sowie die Umstellung auf neue Gebinde
Der Kirschenpreis der grossfruchtigen Extraklasse wurde zum ersten Mal unabhängig von der Klasse 1 gestaltet Für die Kirschen der Klasse Extra, welche meist aus gedeckten Anlagen stammen, konnte pro kg bis zu Fr 1 70 mehr gelöst werden als für die Klasse 1
Die Branche einigte sich auf einen Brennkirschenrichtpreis von Rp 93 je kg bei 18 BrixGrad (Zuckergehalt) Trotz der grossen Einfuhrmenge an frischen Brennkirschen konnte dieser Preis realisiert werden. Die hohen Importe werden auf den Märkten in den folgenden Jahren noch ihre Wirkung zeigen
Die im Jahre 1998 generell um 10 Fr je t gesenkten Mostobstpreise wurden auch im Jahre 2000 auf gleichem Niveau belassen Das durch die Branche angestrebte Ziel, dass jeder Mostobstproduzent, unabhängig seines Produktionsstandortes, sein Mostobst zu gleichen Preisen der nächstgelegenen Mosterei abliefern kann, bleibt bestehen Die überdurchschnittlich grosse Ernte im Jahr 2000 hatte für die Produzenten Rückbehaltsbeiträge von Fr. 70.– bis Fr. 80.– je t Mostobst zur Folge. Trotz der erhobenen grossen Rückbehalte fehlen für die Verwertung der Übermengen zur gänzlichen Liquidierung der Konzentratvorräte rund 8 Mio Fr Hohe Rückbehalte werden deshalb auch in den kommenden Jahren notwendig sein

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 48
■ Konsumentenpreise: steigende Spanne bei Tomaten
Je früher ein Produkt auf den Markt kommt, desto besser können die Preise sein. Höhere Primeurspreise als im Vorjahr wurden bei Himbeeren, Kirschen, Pfirsichen gelb, Kopfsalat und Rhabarber festgestellt
Entwicklung der Konsumentenpreise für Primeurs am Beispiel der Kirsche
Gewöhnliche Tomaten (runde Tomaten) und Fleischtomaten hatten im Jahr 2000 markante Preisspitzen zu verzeichnen Zum einen war die verteuerte Beschaffung mit ein Grund Vorübergehend stieg auch die Spanne
Konsumentenpreise für gewöhnliche Tomaten und Fleischtomaten
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 49 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 F r / k g Kirschen Quelle: BLW 0 00 16 00 14 00 12.00 10.00 8 00 6 00 4 00 2.00
F r / k g Fleischtomaten gewöhnliche Tomaten Quelle: BLW 2 00 6 00 5 50 5 00 4 50 4 00 3 50 3 00 2 50
19981999 2000
Im Jahre 1993 betrug die nominale Preisspanne von Tomaten Fr. 1.61 je kg. Sie ist seither kontinuierlich angestiegen und beträgt nun Fr 1 95 je kg Der Anteil der Preisspanne am Konsumentenpreis vergrösserte sich stetig von 48% im Jahre 1993 auf 55% im Jahre 2000. Bei vielen Gemüse- und Obstarten haben sich die absoluten Preisspannen in den letzten Jahren leicht erhöht Hingegen haben die prozentualen Anteile der Spannen am Konsumentenpreis oft nicht zugenommen
Im Getränkehandel wurden im Jahre 2000 die Preise für Apfel- und Obstsaft geringfügig angehoben
Das zu nasse und zu kalte Frühlingswetter hatte auf die meisten Ackerkulturen negative Auswirkungen Dank der schönen und warmen Witterung in der zweiten Juniund Julihälfte konnte die Getreideernte unter guten bis sehr guten Bedingungen eingebracht werden. Die erfreuliche Getreidequalität und die gegenüber dem Vorjahr etwas tiefere Erntemenge trugen dazu bei, dass die Getreiderichtpreise meist erreicht werden konnten Die erstmals versteigerten Zollkontingentsanteile Brotgetreide von gesamthaft 35'000 t für das zweite Halbjahr 2001 werden voraussichtlich ausgenützt Vor allem beim Biogetreide und Biscuitweizen sind Ergänzungsimporte notwendig, um die Nachfrage zu decken
Währenddem die Frühkartoffelernte mengenmässig auf ein Rekordtief gesunken ist, konnten die mittleren und späten Sorten unter wesentlich günstigeren Bedingungen heranwachsen Es kann deshalb mit einer durchschnittlichen Ernte gerechnet werden Das Zollkontingent für Kartoffeln ist erhöht worden, um den Nachfrageüberhang bei den Kartoffeln für den Frischkonsum und für die Veredlungsindustrie decken zu können.
1 . 1 Ö K O N O M I E 1 50
Fleischtomaten 19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 F r / k g Einstand Verkauf Spanne Quelle: BLW 0 4 00 3 50 3 00 2 50 2 00 1 50 1 00 0 50
Entwicklung der Preise von gewöhnlichen Tomaten und
■ Schätzungen 2001
Die Zuckerrüben sind in den meisten Fällen mit rund einem Monat Verspätung ausgesät worden Wegen der kürzeren Vegetationszeit wird die Rübenernte 2001 nicht ausreichen, um die maximale Menge von 185'000 t Zucker zu produzieren
Die Rapsfelder erholten sich vielerorts von den regenreichen Frühlingsmonaten überraschend gut Deshalb waren häufig hohe Erträge um 40 dt/ha zu verzeichnen Die von der Branchenorganisation swiss granum angestrebte Gesamtproduktion von 42'000 t konnte mit rund 38'300 t wegen der zu geringen Anbaufläche jedoch nicht erreicht werden Da die Importpreise für Ölsaaten sowie für pflanzliche Öle und Fette gleichzeitig in die Höhe geklettert sind, sind auch die inländischen Produzentenpreise merklich gestiegen Der Nachfrageüberhang führte dazu, dass im ersten Halbjahr über 3'000 t Rapsöl importiert wurden. Weltweit ist mit einer gegenüber dem Vorjahr um 1,4% geringeren Rapsernte zu rechnen
Die aussergewöhnlichen Niederschlagsmengen im Frühjahr verhinderten die Saat und das Pflanzen von Gemüse Bei Obst behinderte die nasskalte Witterung die Befruchtung und sorgte für einen Vegetationsrückstand
Im ersten Halbjahr wurden im Vergleich zum Vorjahr 12'600 t oder 22% weniger Schweizer Gemüse angeboten. Besonders betroffen vom wetterbedingten Angebotsrückgang waren die Blattgemüse Die inländischen Defizite wurden mit erhöhten Importmengen kompensiert Die Importe waren in den ersten sechs Monaten 9‘200 t oder 7% grösser als im Vorjahr. Die Mindererträge auf Schweizer Gemüseflächen konnten mit höheren Preisen beinahe wettgemacht werden Der Halbjahreserlös war mit 159 Mio Fr nur gerade um eine Mio Fr geringer als im Jahre 2000
Für Obst konnten im Vergleich zu den Vorjahren mittlere Ernten geschätzt werden Die geschätzten Erntemengen blieben im Allgemeinen deutlich unter dem guten Vorjahr Die Schätzungen für Äpfel und Birnen aus Obstanlagen liegen bei 130'400 t bzw 23'300 t Diese Mengen sind 12% bzw 3% kleiner als im Durchschnitt der vier Vorjahre.
Beim Wein kann aufgrund der in den Kantonen Wallis, Waadt und Genf beschlossenen zusätzlichen Mengenbegrenzung mit einer Ernte von 120 Mio Liter Traubenmost guter Qualität gerechnet werden
Gemäss den Schätzungen 2001 für die Gesamtrechnung (vgl Abschnitt 1 1 3) dürfte der Gesamterlös im Pflanzenbau um 200 Mio Fr (-9,1%) geringer ausfallen als im Jahr 2000.

1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 51
Tabelle 14, Seite A14
■ Zwei Indikatorensysteme für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
Begriffe und Methoden Seite A81
■ Sektor-Einkommen 2000
1.1.3 Wirtschaftliche Lage des Gesamtsektors
Gemäss Artikel 5 LwG wird mit den agrarpolitischen Massnahmen angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind
Die Beurteilung ist in der Nachhaltigkeits-Verordnung (Artikel 3 bis 7) geregelt und erfolgt mit Hilfe zweier Indikatorensysteme Eine sektorale Beurteilung basiert auf der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, welche vom Sekretariat des SBV im Auftrag und unter der Aufsicht des BLW sowie des BFS erstellt wird (vgl. Abschnitt 1.1.3). Eine einzelbetriebliche Betrachtung stützt sich auf die Buchhaltungsergebnisse der Zentralen Auswertung der FAT (vgl Abschnitt 1 1 4)
Das sektorale Nettoeinkommen der Familienarbeitskräfte hat im Jahr 2000 im Vergleich zum Vorjahr von rund 2,4 Mrd Fr auf rund 2,6 Mrd Fr zugenommen (+9%) Die Zunahme ist vor allem das Resultat einer wesentlich höheren Endproduktion (+5%) infolge eines guten Pflanzenbaujahrs und besseren Erlösen beim Rindvieh und bei den Schweinen Die Kosten blieben auf dem selben Niveau Während die Vorleistungen (+3%), die Abschreibungen (+1%) und die Zinsen (+8%) zugenommen haben, waren insbesondere die Entschädigung der fremden Arbeit (-3%) und die Produktionssteuern (-37%) tiefer Die öffentlichen Transfers an die Landwirtschaft (zum grössten Teil produktunabhängige Direktzahlungen) sind praktisch konstant geblieben
der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz
zu laufenden Preisen, in Mio Fr
52 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ergebnisse
Angaben
1990/92 1997 1998 1999 1 2000 2 2001 3 Endproduktion 9 902 7 931 7 894 7 239 7 583 7 200 + Beiträge der öffentlichen Hand (Subventionen) 1 317 2 547 2 439 2 424 2 417 2 679 - Vorleistungen 4 173 3 865 3 855 3 796 3 923 3 954 - Produktionssteuern, Kompensation Mwst 123 300 273 218 174 167 Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 6 923 6 313 6 204 5 648 5 904 5 758 - Abschreibungen 2 031 1 857 1 853 1 837 1 859 1 899 - Pachten und Zinsen 845 729 700 691 729 759 - Entlöhnung der familienfremden Arbeitskräfte 827 798 764 738 715 715 Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte 3 221 2 930 2 888 2 383 2 600 2 385 1 provisorisch, Stand Winter 2000/2001 2 Schätzung Stand Winter 2000/2001 3 Schätzung, Stand Sommer 2001 Quelle: SBV 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
■ Schätzung des SektorEinkommens 2001
Das sektorale Einkommen der Familienarbeitskräfte sank zwischen 1990/92 und 1998/2000 um rund 18% In dieser Zeitperiode ging auch die Zahl der familieneigenen Beschäftigten stark zurück Bei der Landwirtschaftszählung 2000 wurden fast 24% weniger familieneigene Beschäftigte gezählt als 1990.
träge der öffentlichen Hand (Subventionen)
Die Schätzung 2001 (Stand August) stützt sich auf das zurzeit noch provisorische Berechnungsjahr 1999 und nicht auf die Schätzung 2000. Auf diese Weise werden allfällige Ungenauigkeiten der Schätzung 2000 nicht auf das laufende Jahr übertragen Die Werte von 2001 werden im Folgenden insbesondere mit dem Dreijahresmittel 1998/2000 verglichen.
Gemäss der Schätzung liegt die Endproduktion 2001 mit 7,2 Mrd Fr um ca 5% tiefer als das Dreijahresmittel Auch im Vergleich zur Schätzung 2000 muss mit einer Abnahme von rund 5% gerechnet werden Diese Abnahme wird grösstenteils durch die tieferen Getreidepreise infolge der Liberalisierung des Getreidemarktes und die tiefen Rindviehpreise verursacht Im Abschnitt 1 1 2 findet sich unter dem Stichwort «Schätzungen 2001» eine Einschätzung der aktuellen Lage der verschiedenen Produktionssektoren.
53 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Entwicklung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 1990/921997 1998 1999 1 2000 2 20013 A n g a b e n z u l a u f e n d e n P r e i s e n i n M i o . F r . Bei
End
Ausgaben (V
Nettoeinkommen
land
Tät
keit
Familienarbeitskräfte Quelle: SBV 1 Provisorisch, Stand Winter 2000/2001 2 Schätzung, Stand Winter 2000/2001 3 Schätzung Stand Sommer 2001 0 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Tabellen 14–15, Seiten A14–A15 Tabellen 14–15, Seiten A14–A15
produktion
orleistungen, Produktionssteuern, Abschreibungen, Pacht- , Zins- und Angestelltenkosten)
aus
wirtschaftlicher
ig
der
Gegenüber den Vorjahren wird die pflanzliche Endproduktion um 10% und im Vergleich zum Vorjahr um 9% tiefer geschätzt Bei allen Kulturen wird mit vergleichbaren oder schlechteren Erträgen als letztes Jahr gerechnet Die Liberalisierung des Getreidemarktes hat eine starke Senkung der Preise zur Folge. Die Schätzung des Wertes der Getreideproduktion liegt deshalb um 26% unter dem Dreijahresmittel Die tiefen Erträge im Gemüsebau infolge der hohen Niederschläge in den Monaten April und Mai konnten durch die guten Preise im April, Mai und Juni aufgefangen werden, so dass der Wert der Gemüseproduktion sogar leicht höher liegt als in den Vorjahren (+3%) Die diesjährige Obsternte liegt unter derjenigen von 2000 Gegenüber dem Dreijahresmittel ergibt sich eine Reduktion des Produktionswertes um rund 13%
Die Endproduktion im tierischen Bereich weist sowohl im Mehrjahresvergleich als auch im Vergleich zu 2000 eine Abnahme des Produktionswertes von rund 3% aus Als Folge der neuen BSE-Fälle in Europa sanken die Rindviehpreise Ende 2000 stark Diese Tendenz setzte sich auch 2001 fort. Der Produktionswert des Rindviehsektors (ohne Milch) wird voraussichtlich um 9% unter dem Dreijahresmittel und um 18% unter dem Wert des Vorjahres liegen
Die Ausgaben für Vorleistungen werden auf 3,95 Mrd Fr veranschlagt Im Mehrjahresvergleich bedeutet dies eine Zunahme von knapp 3%. Zu dieser Zunahme tragen fast alle Positionen bei Nur das Saat- und Pflanzgut, die Viehimporte sowie die Dienstleistungen sind zurückgegangen
Das Bundesbudget 2001 weist im Vergleich zum Dreijahresmittel eine Zunahme der öffentlichen Transfers für den Bereich Landwirtschaft um rund 10% aus Die Produktionssteuern dürften um rund 52% tiefer ausfallen
Die Abschreibungen, die in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zu Wiederbeschaffungspreisen bewertet werden, liegen rund 3% über dem Wert der Jahre 1998/2000

Die Zunahme der Ausgaben für Pachten und Zinsen wird durch die Erhöhung der Zinssätze ausgelöst Die Zunahme der Zinsen wird gegenüber dem Dreijahresmittel auf rund 11% geschätzt
Dieses Jahr nimmt die Anzahl familienfremder Angestellter (vor allem Saisonarbeiter) bei steigenden Lohnkosten ab Diese gegenläufige Entwicklung wirkt sich auf die Angestelltenkosten neutral aus So bleibt diese Position auf dem Vorjahresniveau, liegt aber um rund 3% tiefer als das Dreijahresmittel.
Das Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte wird auf 2,39 Mrd. Fr. geschätzt. Dies bedeutet gegenüber dem Dreijahresmittel einen Rückgang um 9%
54 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
1.1.4 Wirtschaftliche Lage der Einzelbetriebe
Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe beruht auf den Ergebnissen der Zentralen Auswertung der FAT Deren methodische Grundlagen wurden 1999 vollständig überarbeitet Neben den verschiedenen Einkommensgrössen liefern Indikatoren zur finanziellen Stabilität, Produktivität und Rentabilität wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe Im Anhang sind die Indikatoren detailliert aufgeführt Im Folgenden wird auf ausgewählte Indikatoren näher eingegangen Zudem werden zwei Sonderauswertungen der FAT vorgestellt Diese beziehen sich einerseits auf die zeitliche Stabilität der Einteilung der Betriebe in Quartile nach Arbeitsverdienst und andererseits auf den Zusammenhang zwischen Betriebsgrösse und wirtschaftlichem Erfolg
Das Jahr 2000 war im mehrjährigen Vergleich ein gutes Wirtschaftsjahr Gegenüber 1997/99 stieg der Rohertrag um 8% Dies ist sowohl auf gute Ergebnisse im Pflanzenbau (gutes Kartoffeljahr, Ausdehnung des Körnermaisanbaus, höhere Erträge im Obstbau, gute Raufutterernte) wie auch in der Tierhaltung zurückzuführen In der Tierhaltung konnten Einbussen bei der Milch durch gute Ergebnisse in der Rindviehund Schweinehaltung wettgemacht werden Die Preiseinbrüche in der Rindviehhaltung ab November beeinflussten das Jahresergebnis 2000 vergleichsweise wenig Die Direktzahlungen waren gegenüber dem Durchschnitt der drei Vorjahre geringfügig um 2% höher, was weitgehend durch das betriebliche Wachstum erklärt werden kann Die Fremdkosten stiegen gegenüber dem gleichen Zeitraum um 4% Auffallend sind die höheren Sachkosten im Pflanzenbau (+6%) und in der Tierhaltung (+9%) Entsprechend dem Trend zu vermehrtem überbetrieblichen Maschineneinsatz sind die Kosten für Lohnarbeiten und Maschinenmiete um über 18% gestiegen. Der langjährige Aufwärtstrend bei den Gebäudeabschreibungen mit einer Zunahme um 8% gegenüber 1997/99 blieb ungebrochen Die Personalkosten lagen um 4% tiefer als 1997/99, wobei gegenüber 1999 bereits wieder ein leichter Anstieg zu beobachten ist.
Entwicklung der Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe:
55 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■■■■■■■■■■■■■■■■
1
■ Gutes Landwirtschaftsjahr 2000
Tabellen 16–25, Seiten A16–A26
Mittel alle Regionen 1990/921997 1998 19992000 F r p r o B e t r i e b Nebeneinkommen Landwirtschaftliches Einkommen Quelle: Zentrale Auswertung, FAT 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 18 627 18 254 18 638 62 822 57 974 53 079 53 789 1,39 FJAE Familien-Jahresarbeitseinheiten 1,321,311,29 19 208 64 675 1,30 Begriffe
und Methoden, Seite A82
Das landwirtschaftliche Einkommen ist die Differenz zwischen Rohertrag und Fremdkosten Im Vergleich zu 1997/99 hat es um 18% zugenommen Im Durchschnitt vermochten die Betriebe auch ihr Nebeneinkommen leicht zu steigern (+4%) Gesamthaft resultierte eine Steigerung des Gesamteinkommens um 14%.
Das landwirtschaftliche Einkommen der Jahre 1998/2000 ist um rund 5'600 Fr tiefer als 1990/92 (-9%) Demgegenüber erhöhte sich das Nebeneinkommen in der gleichen Zeitspanne um rund 2'400 Fr (+15%) Für das Gesamteinkommen resultiert daraus ein Rückgang um 3'200 Fr (-4%)
Die Zunahme des landwirtschaftlichen Einkommens gegenüber 1997/99 ist in der Talregion mit 19% etwas ausgeprägter als in der Hügelregion (+17%) und der Bergregion (+15%), was mit dem abnehmenden Einfluss des Pflanzenbaus in höheren Lagen erklärt werden kann
Während in der Talregion das Nebeneinkommen in der gleichen Zeitperiode stagnierte (-0,7%) und in der Bergregion nur leicht zunahm (+2%), hat es in der Hügelregion kräftig zugelegt (+13%) Dadurch hat sich auch das Gesamteinkommen mit einer Zunahme um 16% in dieser Region am stärksten verbessert, während es im Talgebiet um 15% und im Berggebiet um 11% zulegte.
56 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Regionen Einkommen nach Region Einheit 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/99–2000 % Talregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16,66 18,91 18,90 19,33 19,41 1,9 Familienarbeitskräfte FJAE 1,36 1,30 1,27 1,26 1,26 -1,6 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 73 794 69 270 64 885 61 968 77 738 18,9 Nebeneinkommen Fr. 16 429 18 703 17 507 17 580 17 805 -0,7 Gesamteinkommen Fr 90 223 87 973 82 392 79 548 95 543 14,7 Hügelregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15,30 16,92 17,07 17,19 17,83 4,5 Familienarbeitskräfte FJAE 1,40 1,30 1,29 1,28 1,29 0,0 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 59 838 53 740 47 420 49 885 58 725 16,6 Nebeneinkommen Fr 14 544 18 973 19 283 19 849 21 814 12,6 Gesamteinkommen Fr 74 382 72 713 66 703 69 734 80 539 15,5 Bergregion Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15,76 17,28 17,67 18,06 18,63 5,4 Familienarbeitskräfte FJAE 1,42 1,39 1,38 1,37 1,39 0,7 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 45 541 43 137 38 101 43 392 47 721 14,9 Nebeneinkommen Fr 17 853 18 139 18 505 19 250 19 011 2,0 Gesamteinkommen Fr 63 394 61 276 56 606 62 642 66 732 10,9 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT Tabellen 16–19, Seiten A16–A19
Der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag betrug im Jahr 2000 14% in der Talregion, 21% in der Hügelregion und 36% in der Bergregion Damit liegt der Anteil in allen drei Regionen etwas tiefer als 1999, was auf den höheren durchschnittlichen Rohertrag im Jahr 2000 zurückzuführen ist.
Die Einkommenssituation in den 11 Betriebstypen (Produktionsrichtungen) zeigt erhebliche Differenzen auf
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 1998/2000
Im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 erzielten die Ackerbau-, Spezialkultur- und bestimmte kombinierte Betriebe (Verkehrsmilch/Ackerbau, Kombiniert Veredlung) die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen Zusammen mit den kombinierten Mutterkuhbetrieben erwirtschafteten diese auch die höchsten Gesamteinkommen Die tiefsten landwirtschaftlichen Einkommen und Gesamteinkommen erreichten die Betriebstypen «Pferde, Schafe, Ziegen» (mit vergleichsweise tiefem eigenem Arbeitseinsatz) sowie «anderes Rindvieh».
Gegenüber 1990/92 konnten die Betriebstypen «Ackerbau», «Spezialkulturen», «Verkehrsmilch», «anderes Rindvieh» sowie «kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau», und «kombiniert Andere» ihr Gesamteinkommen knapp halten oder leicht verbessern Eine Verbesserung ihrer Einkommen haben die Mutterkuh- und vor allem die kombinierten Mutterkuhbetriebe erzielt, während die Veredlungsbetriebe und die kombinierten Veredlungsbetriebe Einbussen (allerdings ausgehend von einem hohen Niveau) verzeichnen mussten.
57 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Betriebstyp Landw Familien- Landw Neben- GesamtNutzfläche arbeits- Einkommen einkommen einkommen kräfte ha FJAE Fr Fr Fr Mittel alle Betriebe 18,42 1,30 57 181 18 700 75 881 Ackerbau 22,34 1,04 65 853 23 652 89 505 Spezialkulturen 12,80 1,33 72 405 19 334 91 739 Verkehrsmilch 17,86 1,35 50 295 17 946 68 241 Mutterkühe 17,07 1,11 44 406 32 486 76 892 Anderes Rindvieh 14,89 1,29 34 299 20 915 55 214 Pferde/Schafe/Ziegen 13,33 1,14 22 784 30 162 52 946 Veredlung 11,05 1,12 57 572 16 151 73 723 Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau 23,98 1,35 71 330 13 507 84 837 Kombiniert Mutterkühe 23,87 1,22 62 804 23 281 86 085 Kombiniert Veredlung 18,53 1,31 72 357 16 154 88 511 Kombiniert Andere 19,58 1,29 58 563 19 814 78 377 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
1
Tabellen 20a–20b, Seiten A20–A21
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst (landwirtschaftliches Einkommen abzüglich Zinsanspruch für im Betrieb investiertes Eigenkapital) entschädigt die Arbeit der nichtentlöhnten Familienarbeitskräfte Gegenüber dem Dreijahresmittel 1997/99 hat sich der Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft (Median) im Jahr 2000 um 12,6% verbessert Das Dreijahresmittel 1998/2000 ist gegenüber 1990/92 um 6,7% höher
Der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft ist in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich Im Durchschnitt liegt er in der Talregion wesentlich höher als in der Bergregion Auch die Quartile liegen weit auseinander So erreichte der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft in der Talregion im ersten Quartil 27% und derjenige im vierten Quartil 194% des Mittelwertes aller Betriebe der Region. In den anderen Regionen sind die Streuungsbandbreiten ähnlich
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 1998/2000: nach Regionen und Quartilen
Arbeitsverdienst 1 in Fr pro FJAE 2
1 Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen: 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%
2 Familien-Jahresarbeitseinheiten: Basis 280 Arbeitstage
Quelle: Zentrale Auswertung FAT
In der Tal- und Hügelregion übertraf bzw erreichte 1998/2000 das vierte Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung. In der Bergregion liegt der mittlere Arbeitsverdienst im vierten Quartil rund 7'000 Fr unter dem Vergleichswert Im Vergleich zur Periode 1997/99 hat sich die Situation in allen drei Regionen leicht verbessert, relativ am stärksten in der Hügelregion
Vergleichslohn 1998/2000, nach Regionen
1 Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten
Quellen: BFS, FAT
Median Mittelwerte Region 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Talregion 39 955 11 620 32 505 48 391 83 341 Hügelregion 30 439 7 607 24 504 36 833 60 296 Bergregion 22 157 5 156 17 987 26 956 46 094
Region Vergleichslohn
Fr pro Jahr Talregion 62 866 Hügelregion 57 080 Bergregion 53 163
1
58 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Tabellen 21–24, Seiten A22–A25
■ Besserer Arbeitsverdienst
■
Zeitliche Stabilität der Quartilseinteilung der Buchhaltungsbetriebe
Zieht man das Nebeneinkommen mit in die Beurteilung ein, sieht die Situation der landwirtschaftlichen Haushalte deutlich besser aus, als der alleinige Vergleich von Arbeitsverdienst mit Vergleichslohn erscheinen lässt Die durchschnittlichen Nebeneinkommen liegen bei rund 19'000 Fr.
Die FAT hat untersucht, wie stabil die Einteilung der Betriebe in die einzelnen Quartile ist Sie hat Daten der Jahre 1997 bis 1999 ausgewertet und sich dabei auf das erste und das vierte Quartil konzentriert Sie kommt zum Schluss, dass ein Betrieb im ersten oder vierten Quartil mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% im Folgejahr in ein anderes Quartil wechselt Weniger als die Hälfte der Betriebe im ersten oder vierten Quartil bleibt über drei Jahre im gleichen Quartil.
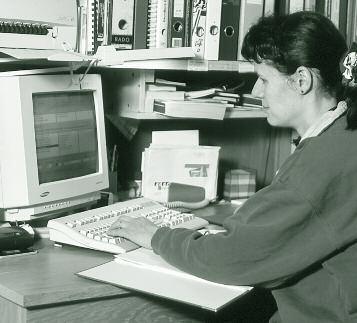
Betriebe, die 1997 im ersten Quartil waren, sind zu 58% zwei Jahre später immer noch oder wieder im ersten Quartil. Die übrigen Betriebe sind aufgestiegen. Die meisten davon befinden sich neu im zweiten Quartil und weniger häufig bzw selten im dritten oder vierten Quartil
Die FAT hat auch analysiert, wie sich der Arbeitsverdienst von Betrieben entwickelt, die 1997 im ersten respektive im vierten Quartil eingeteilt waren. Die Auswertung bezieht sich auf die Betriebe des Talgebiets Betriebe, die 1997 im ersten Quartil waren (oberste Kurve in der Abbildung), haben 1998 und 1999 im Mittel einen höheren Arbeitsverdienst als der Durchschnitt aller Betriebe des untersten Quartils in diesen Jahren. Diese Betriebe konnten ihre Situation also deutlich verbessern Demgegenüber lag der Arbeitsverdienst derjenigen Betriebe, welche jedes Jahr im ersten Quartil waren (unterste Kurve), etwas unter dem Durchschnitt aller Betriebe
Referenzbetriebe in der Talregion: Analyse 1. Quartil
59 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1
19971998 1999 A r b e i t s v e r d i e n s t j e F a m i l i e n a r b e i t s k r a f t i n F r . 1997 im 1 Quartil 1 Quartil, jedes Jahr neu berechnet 1997 bis 1999 im 1 Quartil Quelle: Zentrale Auswertung FAT 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Referenzbetriebe in der Talregion: Analyse 4. Quartil
Die umgekehrte Situation ergibt sich bei der Analyse des vierten Quartils Die Betriebe, die in allen drei Jahren im vierten Quartil waren (oberste Kurve), erzielten einen höheren Arbeitsverdienst als die Betriebe des vierten Quartils in den einzelnen Jahren Die Referenzbetriebe, die 1997 im obersten Quartil anzutreffen waren (unterste Kurve), wiesen 1997 einen Arbeitsverdienst von knapp 85'000 Fr. aus. In den beiden Folgejahren lag ihr durchschnittlicher Arbeitsverdienst hingegen bei weniger als 70'000 Fr , das heisst deutlich tiefer als die Betriebe, welche 1998 und 1999 im vierten Quartil waren (rund 80'000 Fr , mittlere Kurve) Dies ist damit zu erklären, dass von den Betrieben, die 1997 im vierten Quartil waren, rund 40% in tiefere Quartile abgestiegen sind.

60 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
19971998 1999 A r b e i t s v e r d i e n s t j e F a m i l i e n a r b e i t s k r a f t i n F r 1997 bis 1999 im 4 Quartil 4 Quartil, jedes Jahr neu berechnet 1997 im 4 Quartil Quelle: Zentrale Auswertung FAT 0 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
■ Finanzielle Stabilität leicht verbessert
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (Fremdkapitalquote) gibt Auskunft über die Fremdfinanzierung des Unternehmens Kombiniert man diese Kennzahl mit der Grösse der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen. Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält –finanziell nicht existenzfähig
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit ...
Fremdkapitalquote
Tief (<50%) Hoch (>50%)
Positiv guter beschränkter finanEigenkapitalbildung finanzieller Situation zieller Selbständigkeit
Negativ ungenügendem bedenklicher
Einkommen finanzieller Situation
Quelle: De Rosa
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild. Knapp die Hälfte der Betriebe befindet sich in einer finanziell guten Situation und rund 30% sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung) Im Vergleich zu 1997/99 hat sich die Situation im Tal- und Hügelgebiet leicht verbessert, während sie im Berggebiet stabil geblieben ist
Beurteilung der finanziellen Stabilität 1998/2000: nach Regionen
Talregion Hügelregion Bergregion
bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen
beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle Situation
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
61 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1
A n t e i l B e t r i e b e i n %
0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 13 18 20 49 14 12 27 47 14 16 22 48
■ Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremdkapitalquote
Die Investitionen und die Fremdkapitalquote der FAT-Referenzbetriebe haben sich im Jahr 2000 im Vergleich zu 1997/99 nur unwesentlich verändert Auch im Vergleich zu 1990/92 sind die beiden Grössen beinahe konstant Bei der Eigenkapitalbildung (Gesamteinkommen – Privatverbrauch) ist im Jahr 2000 gegenüber 1997/99 eine wesentliche Verbesserung festzustellen Auch das Niveau von 1990/92 wird übertroffen Der Cashflow vermag im Jahr 2000 die Investitionen voll zu decken Sowohl gegenüber 1997/99 (+6,6%) wie auch 1990/92 (+7,4%) liegt das Cashflow-Investitionsverhältnis höher

Entwicklung von Eigenkapitalbildung, Investitionen und Fremkapitalquote
1 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
2 Cashflow (Eigenkapitalbildung plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen) zu Investitionen
Quelle: Zentrale Auswertung FAT
62 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Merkmal 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/99–2000 % Eigenkapitalbildung Fr. 19 513 15 833 9 330 13 207 21 233 66,0 Investitionen 1 Fr 46 914 40 922 49 585 41 856 44 964 1,9 Cashflow-Investitionsverhältnis 2 % 95 105 81 101 102 6,6 Fremdkapitalquote % 43 42 41 41 41 -0,8
Anhand der Buchhaltungsergebnisse von 1999 hat die FAT in einer Spezialauswertung den Zusammenhang zwischen Betriebsgrösse und wirtschaftlichem Erfolg untersucht Für die Betriebsgrösse hat sie die LN als Grössenmass verwendet Spezialkultur- und Veredelungsbetriebe sind nicht berücksichtigt worden, weil für diese Betriebstypen die LN ein schlechtes Mass für die Betriebsgrösse ist Die Ergebnisse sind für das Talgebiet dargestellt, die Aussagen treffen jedoch grundsätzlich auch für die Betriebe der Hügelund Bergregion zu Aufgrund der zu kleinen Gruppengrösse werden die Betriebe über 50 ha nicht berücksichtigt
Für die Darstellung der Ergebnisse werden jeweils die Betriebe mit einer Fläche zwischen 10 und 20 ha als 100% angenommen In dieser Gruppe befinden sich am meisten Betriebe und die Mittelwerte (Struktur und wirtschaftliche Kennzahlen) entsprechen meist ziemlich genau dem schweizerischen Mittel
Betriebe mit 30 bis 50 ha setzen im Vergleich zu Betrieben mit 10 bis 20 ha ungefähr gleich viel eigene Arbeit (FJAE) und gesamthaft 45% mehr Arbeit (JAE) ein Sie halten gleichzeitig knapp 80% mehr Tiere (GVE) und bewirtschaften mehr als das Doppelte an Fläche (LN)
Das Betriebseinkommen (BE) der Betriebsgruppe mit 30 bis 50 ha ist doppelt so hoch wie das der Vergleichsgruppe Da bei den grossen Betrieben vom Betriebseinkommen ein relativ höherer Anteil für Pacht, Zinsen und Angestellte ausgegeben wird, ist der Unterschied beim landwirtschaftlichen Einkommen (LE) kleiner. Es erreicht 165% der Vergleichsgruppe Die Flächenproduktivität (BE/LN) nimmt zwar mit steigender Betriebsgrösse etwas ab Die Arbeitsproduktivität aller im Betrieb Beschäftigten (BE/JAE) steigt jedoch stark an.
Die höhere Arbeitsproduktivität äussert sich letztendlich auch im höheren Arbeitsverdienst der Familienarbeitskräfte (AV/FJAE) Mit einer kalkulierten Entschädigung von 54'000 Fr je Familienarbeitskraft liegt der Arbeitsverdienst 60% höher als in der Vergleichsgruppe.
63 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1 ■ Betriebsgrösse und wirtschaftlicher Erfolg Betriebsstrukturen nach Grössenklassen 1999 1 <1010 –20 Grössenklassen in ha 20 –30 30 –50 231 177 145 106 i n % LN (10 –20 = 100%) GVE (10 –20 = 100%) Quelle: Zentrale Auswertung, FAT 1 Auswertung für die Talregion JAE (10 –20 = 100%) FJAE (10 –20 = 100%) 0 250 200 150 100 50
Die Analyse belegt die Bedeutung der Betriebsgrösse für den wirtschaftlichen Erfolg Allerdings handelt es sich um eine Momentaufnahme und die Schlussfolgerungen beruhen auf Mittelwerten. Selbstverständlich gibt es auch kleinere Betriebe, die aufgrund günstiger Voraussetzungen, angepasster Betriebskonzepte und überdurchschnittlich guter Betriebsführung hervorragende Ergebnisse erzielen Aus der Analyse darf deshalb nicht abgeleitet werden, dass für kleinere Betriebe Wachstum die einzige sinnvolle Strategie ist
64 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 Wirtschaftliche Kennzahlen nach Grössenklassen 1 <1010 –20 Grössenklassen in ha 20 –30 30 –50 200 165 160 138 86 i n % BE (10 –20 = 100%) LE (10 –20 = 100%) AV/FJAE (10 –20 = 100%) Quelle: Zentrale Auswertung, FAT 1 Auswertung für die Talregion BE/JAE (10 –20 = 100%) BE/LN (10 –20 = 100%) 40 220 200 180 160 140 120 100 80 60
Im Agrarbericht 2000 wurde darauf hingewiesen, dass bei der Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft Neuland betreten wird Entsprechend wurde im ersten Bericht noch kein in sich geschlossenes Konzept für die Berichterstattung präsentiert
Die Arbeiten sind inzwischen weiter voran getrieben worden Im Agrarbericht 2001 wird das Grundkonzept für eine Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft vorgestellt Damit sind die Arbeiten aber nicht abgeschlossen Bei den Themenbereichen sind in einem nächsten Schritt konkrete Indikatoren zu entwickeln
Im Agrarbericht 2001 werden neben dem Konzept der Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft die Bereiche Einkommen und Verbrauch in der Landwirtschaft auf der Basis der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT, eine Befragung des GfS-Forschungsinstituts über die Befindlichkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung sowie Projekte im Bereich Kinder- und Jugendhilfe der emmentalischen Gemeinde Eggiwil dargestellt

1 . 2 S O Z I A L E S ■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 Soziales
1 65
1.2.1 Konzept Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft
Das Umschreiben und Abgrenzen des Sozialen ist nicht ganz einfach: Die Grenze zwischen der Ökonomie, die sich auf den Betrieb bezieht, und dem Sozialen, wo der Mensch mit seiner Umwelt sowie der Haushalt im Zentrum stehen, ist fliessend Das Einkommen etwa ist primär eine ökonomische Grösse, aber auch zur Einschätzung der sozialen Lage wichtig Der Einkommensfrage wird, unter einem anderen Blickwinkel, deshalb auch im Teil Soziales nachgegangen
Die Sozialberichterstattung in der Landwirtschaft wird sich insgesamt aus den folgenden drei Bereichen zusammensetzen:
Einkommen und Verbrauch: In einem ersten Bereich wird die soziale Lage der Landwirtschaft jährlich aufgrund der wirtschaftlichen Kenngrössen Einkommen und Verbrauch – auf der Basis der Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT – beurteilt

Bestandesaufnahme soziale Situation: Ein zweiter Bereich umfasst eine periodische Bestandesaufnahme bei fünf für das Erfassen der sozialen Situation zentralen Themenbereichen Diese Bestandesaufnahmen werden alle fünf Jahre mittels Erhebungen gemacht In der jährlichen Berichterstattung wird jeweils nur ein Bereich behandelt. Der Rhythmus von fünf Jahren wurde gewählt, da Veränderungen und Entwicklungen kurzfristiger kaum sichtbar wären und gewisse, bereits institutionalisierte Erhebungen nur alle fünf Jahre durchgeführt werden
Fallstudien: In einem dritten Bereich werden jedes Jahr Fallstudien vorgestellt, die einem bestimmten Thema bzw. Projekt im Bereich Soziales vertieft nachgehen.
Einkommen und Verbrauch sind für die Beurteilung der sozialen Lage der Landwirtschaft zwei wichtige Indikatoren Da bei dieser Beurteilung der landwirtschaftliche Haushalt und nicht der Betrieb im Vordergrund steht, ist hier neben dem Einkommen aus der Landwirtschaft auch das Nebeneinkommen einzubeziehen In diesem Bereich sollen unter anderem die Einkommenslage (Gesamteinkommen, Arbeitsverdienst) der ganzen Landwirtschaft in der Tal-, Hügel- und Bergregion dem Vergleichslohn (Erwerbseinkommen) der übrigen Wirtschaft gegenübergestellt werden Besonders berücksichtigt wird zudem die Entwicklung von Einkommen und Verbrauch der unteren Hälfte der nach Arbeitsverdienst gegliederten Betriebe.
1 . 2 S O Z I A L E S 1 66 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Einkommen und Verbrauch
■ Bestandesaufnahme soziale Situation
Die periodischen Bestandesaufnahmen werden sich zum grossen Teil auf bereits bestehende, institutionalisierte Erhebungen abstützen Für die Darstellung der sozialen Lage im Agrarbericht werden entsprechende Indikatoren entwickelt Diese repräsentativen Untersuchungen – zum Teil in Form von Befragungen – lassen jeweils einen Vergleich mit der übrigen Bevölkerung zu (Kontrollgruppe) Die Bestandesaufnahmen umfassen folgende fünf wesentliche Aspekte des Sozialen:
– Lebensqualität: Diese Bestandesaufnahme stützt sich ab auf das Konzept der ETH Zürich, welches im Rahmen der Grundlagenstudie für eine künftige Sozialberichterstattung der Schweizer Landwirtschaft entwickelt wurde Die entsprechende Erhebung soll jeweils im Auftrag des BLW von einem Meinungsforschungsinstitut durchgeführt werden. Mit dem Konzept der Lebensqualität kann die Zufriedenheit in wichtigen Lebensbereichen wie Lebensstandard oder Familie aufgezeigt werden

Arbeit und Ausbildung: Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS), erlaubt Aussagen zur Situation von Erwerbstätigen, Erwerbslosen und nicht erwerbstätigen Personen aufgrund sozioökonomischer Kriterien: Sie erhebt unter anderem Daten bezüglich Arbeitsbedingungen, Beschäftigungsgrad sowie Angaben betreffend Erstausbildung, Bildungsniveau, Familiensituation, Kindererziehung, Wohnsituation oder Einkommen.
– Gesundheit: Die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) des BFS liefert u a Informationen über den Gesundheitszustand und dessen Bestimmungsfaktoren, über die Folgen von Krankheit oder die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens Gesundheitsbefragungen sind geeignete Erhebungsinstrumente, um das gesundheitliche Befinden im ganzheitlichen Lebenszusammenhang zu erforschen
– Einkommen und Verbrauch: Die Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE) des BFS gibt einen detaillierten Einblick in die Einnahmen der privaten Haushalte und analysiert den Konsum in Abhängigkeit verschiedener sozialer und demografischer Merkmale.
– Inanspruchnahme sozialer Leistungen: Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) liefert Angaben über die Höhe der AHV- oder IV-Rente, den Anteil Rentenbezüger und anderes mehr Diese Angaben zeigen die Inanspruchnahme der Sozialversicherungen der bäuerlichen Bevölkerung wiederum im Vergleich zur übrigen Bevölkerung auf
1 . 2 S O Z I A L E S 1 67 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
–
Jedes Jahr wird aufgrund von Fallstudien einem Aspekt des Sozialen bzw. einem innovativen Projekt mit sozialem Charakter nachgegangen Folgende Themen sollen in den nächsten Jahren vertieft werden:
– Da 2002 die «working party on woman and family in rural development» (WPW) der FAO in der Schweiz stattfindet, ist geplant, dass sich eine Fallstudie vertieft mit dem Thema Rolle der Frauen in der Landwirtschaft auseinandersetzt: Welches ist die Situation der Frauen? Welche Aufgaben nehmen sie wahr?
Weitere mögliche Themen sind:
Armut und Landwirtschaft: Armut in Bauernfamilien ist nicht neu. Vielfach ist sie verdeckt; die Bauernfamilien leben in äusserst bescheidenen Verhältnissen, zehren von der Substanz des Betriebes Bauern werden noch kaum durch die Sozialhilfe unterstützt: Zu den wichtigsten Elementen des bäuerlichen Selbstverständnisses gehört der Wille, selbständig und unabhängig zu sein Wie wird Armut empfunden? Wie wird mit ihr umgegangen?
– Lage der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer: Eine Untersuchung der Gewerkschaft GBI von 1999 zeigte, dass Saisonniers in der Landwirtschaft hart arbeiten müssen und oft schlecht bezahlt sind Was hat sich inzwischen getan?
Alter und Altersvorsorge: Wo und wie verbringt die ältere bäuerliche Bevölkerung ihren Lebensabend? Aber auch: Sind Landwirte und Landwirtinnen angemessen versichert?
– Strukturwandel: Inwiefern haben sich Betriebsstrukturen verändert? Wann ist der Strukturwandel «sozialverträglich»? Welches sind die Auswirkungen des Strukturwandels auf die dezentrale Besiedelung? Welche Strukturen eignen sich, damit die Aufgabenerfüllung auch in Zukunft sichergestellt werden kann?
1 . 2 S O Z I A L E S 1 68
–
–
■ Fallstudien
■ Einbezug des Gesamteinkommens für die Beurteilung der sozialen Situation
1.2.2 Einkommen und Verbrauch
Für die Einschätzung der sozialen Lage der Landwirtschaft sind Einkommen und Verbrauch bedeutende Kenngrössen Bei der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit interessiert das Einkommen vor allem im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe So sollen nach Artikel 5 LwG ökonomisch leistungsfähige Betriebe ein mit der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbares Einkommen erzielen können Bei der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit steht die Einkommenssituation der gesamten Landwirtschaft im Vordergrund Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Entwicklung der Einkommen der Betriebe, die sich gemäss ihrem Arbeitsverdienst in der unteren Hälfte befinden, gelegt. Ausserdem beschränken sich die Beobachtungen nicht allein auf die aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit erzielten Einkommen Das Nebeneinkommen der Haushalte wird ebenfalls mit einbezogen, ebenso der Verbrauch der Familie.
Das Gegenüberstellen von Buchhaltungsergebnissen der Zentralen Auswertung der FAT und Vergleichslöhnen sowie Privatverbrauch der übrigen Bevölkerung lassen nur beschränkte Aussagen zu über die effektive Situation bei Einkommen und Verbrauch der landwirtschaftlichen im Vergleich zur nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung. Die Buchhaltungsergebnisse dienen nämlich insbesondere dazu, die Entwicklungen der verschiedenen Einkommenskomponenten und des Verbrauchs der Landwirtschaftsbetriebe verfolgen zu können. Vertieftere Informationen der übrigen Bevölkerung und bessere Vergleichsdaten liefert die Einkommens- und Verbrauchserhebung des BFS, die im Agrarbericht als eines der fünf zentralen Themen der periodischen Bestandesaufnahmen – voraussichtlich im Jahr 2004 – vertiefter dargestellt wird
Der Arbeitsverdienst – Medianwert – pro Familienarbeitskraft in der Landwirtschaft betrug im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 in der Talregion 64%, in der Hügelregion 53% und in der Bergregion 42% des entsprechenden Vergleichslohns; damit ist der Abstand zum Vergleichslohn in allen Regionen sehr deutlich Das war im Wesentlichen bereits im Durchschnitt der Jahre 1990/92 so Der Vergleichslohn wurde in der Talregion damals zu 63%, in der Hügelregion zu 57% und in der Bergregion zu 37% erreicht Der Abstand hat sich also nur in der Hügelregion vergrössert Insgesamt kann gesagt werden, dass der Arbeitsverdienst sich in den neunziger Jahren gleich entwickelt hat wie die Löhne in der übrigen Bevölkerung
Gesamteinkommen, Arbeitsverdienst und Privatverbrauch der Familie 1998/2000

Region Gesamt- Privat- Familien- Arbeits- Vergleichseinkommen verbrauch arbeitskräfte verdienst lohn
1 Familien-Jahresarbeitseinheiten
1 . 2 S O Z I A L E S 1 69 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■■■■■■■■■■■■■■■■
(Median) (Median) Fr Fr FJAE 1 Fr pro FJAE 1 Fr pro FJAE 1 Tal 85 828 69 004 1 26 39 955 62 866 Hügel 72 325 57 873 1 29 30 439 57 080 Berg 61 994 51 207 1 38 22 157 53 163
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Der Arbeitsverdienst allein – als Entschädigung für die in der Landwirtschaft getätigte Arbeit
ist jedoch zu wenig aussagekräftig für die Beurteilung der Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Haushalte Einerseits hängt er vom Zinsniveau ab, anderseits werden dabei nicht alle Einnahmen eines landwirtschaftlichen Haushalts berücksichtigt Da bei der Beurteilung der sozialen Lage aber der landwirtschaftliche Haushalt und nicht der Betrieb im Vordergrund steht, ist für diese Einschätzung daher das gesamte Einkommen zu berücksichtigen
Die Landwirtschaftsbetriebe hatten im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 mit rund 19'000 Fr Nebeneinkommen eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle Die Betriebe im ersten Quartil mit den tiefsten Arbeitsverdiensten wiesen mit rund 27'000 Fr deutlich höhere Nebeneinkommen aus als die Betriebe in den übrigen Quartilen. Die Nebeneinkommen betrugen in diesen Quartilen im Durchschnitt knapp 16'000 Fr Die Differenz zwischen den Gesamteinkommen von Betrieben des ersten und des vierten Quartils ist denn auch deutlich geringer als der Abstand beim Arbeitsverdienst.
Das Gesamteinkommen pro Verbrauchereinheit ist bei allen Betrieben 1998/2000 im Vergleich zu den Jahren 1990/92 zurückgegangen, am stärksten bei den Betrieben des ersten Quartils von rund 16'000 Fr pro Verbrauchereinheit auf knapp 14'000 Fr Der Privatverbrauch hingegen war 1998/2000 nur im ersten Quartil tiefer als 1990/92.
1 Verbrauchereinheit = ganzjährig am Familienverbrauch beteiligtes Familienmitglied im Alter von 16 Jahren und mehr
Zentrale Auswertung, FAT
Das Gesamteinkommen konnte 1998/2000 den Verbrauch der Familien von Betrieben im ersten Quartil nicht decken. Diese Betriebe mussten zur Deckung ihres Verbrauchs neben dem gesamthaft erzielten Einkommen Mittel aus dem Betrieb und / oder aus dem so genannten privaten Ausgleich einsetzen Ihre Möglichkeit für die Finanzierung von Ersatz- und Neuinvestitionen bzw. ihrer Altersvorsorge wird damit eingeschränkt. 1990/92 lag das Gesamteinkommen bei diesen Betrieben noch knapp über dem Privatverbrauch Bei den Betrieben in den übrigen Quartilen waren die Privatausgaben 1998/2000 geringer als das Gesamteinkommen 1990/92 erreichten die Betriebe des ersten Quartils 48% des Gesamteinkommens pro Verbrauchereinheit von Betrieben des vierten Quartils, 1998/2000 waren es nur noch 43%.

1 . 2 S O Z I A L E S 1 70
–
Entwicklung von Gesamteinkommen und Privatverbrauch 1990/92 1998/2000 Fr Fr 1 Quartil Gesamteinkommen pro VE 1 15 974 13 952 Privatverbrauch pro VE 15 894 14 897 2 Quartil Gesamteinkommen pro VE 19 013 18 092 Privatverbrauch pro VE 15 479 16 001 3 Quartil Gesamteinkommen pro VE 23 063 22 855 Privatverbrauch pro VE 16 947 18 075 4 Quartil Gesamteinkommen pro VE 33 328 32 694 Privatverbrauch pro VE 20 442 21 731
Quelle:
Beim Privatverbrauch ist die Differenz zwischen dem ersten und dem vierten Quartil deutlich geringer als beim Gesamteinkommen Dieser war bei den Betrieben des ersten Quartils 1998/2000 bei 70% der Betriebe des vierten Quartils 1990/92 lag dieses Verhältnis noch bei 78%. Der Privatverbrauch bei den Betrieben des ersten Quartils ist 1998/2000 im Vergleich zu 1990/92 um 1'000 Fr auf rund 15'000 Fr pro Verbrauchereinheit zurückgegangen Bei den übrigen 75% der Betriebe stiegen die Ausgaben pro Verbrauchereinheit in dieser Zeitspanne zwischen 500 und 1‘300 Fr
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Lage der Betriebe aus dem ersten Quartil mit den tiefsten Arbeitsverdiensten zwischen 1990/92 und 1998/2000 verschlechtert hat, bei den übrigen Betrieben ist die Situation ziemlich stabil geblieben

1 . 2 S O Z I A L E S 1 71
■ ETH Zürich erarbeitet Konzept der Lebensqualität
1.2.3 Erhebung über die Lebensqualität
Der Bereich Lebensqualität ist eines der fünf zentralen Themen, bei denen alle fünf Jahre eine Bestandesaufnahme mittels repräsentativ durchgeführten Erhebungen gemacht wird
Das BLW hatte 1999 das Institut für Agrarwirtschaft (IAW) der ETH Zürich beauftragt, Grundlagen für die Berichterstattung zur sozialen Lage der Schweizer Landwirtschaft zu entwickeln Im Vordergrund der ETH-Arbeit stand das Konzept der Lebensqualität, das eine Kombination von objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden darstellt Dabei resultiert immer dann eine hohe Lebensqualität, wenn objektiv messbare Lebensbedingungen von Personen aufgrund ihres Zielsystems und dem aktuellen Zielerreichungsgrad subjektiv positiv bewertet werden. Im Rahmen der ETH-Studie wurde im Frühjahr 2000 eine Befragung bei rund 500 Landwirtinnen und Landwirten im Kanton Bern – ohne Einbezug der übrigen Bevölkerung – durchgeführt und ausgewertet Resultate dieser Erhebung wurden im Agrarbericht 2000 dargestellt
■ GfS – Befragung im Frühjahr 2001
Die Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung (GfS) wurde vom BLW damit beauftragt, eine Befragung über das subjektive Wohlbefinden der landwirtschaftlichen im Vergleich zur übrigen Bevölkerung durchzuführen. Das Konzept der oben erwähnten ETH-Arbeit wurde dabei weitgehend übernommen Die GfS hat die Befindlichkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung von Mitte Februar bis Mitte März 2001 erhoben Die Fragen bezogen sich auf die Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen, die positiven und negativen Seiten des Bauernberufs sowie die Ängste.
Angestrebt wurde, die Lebenssituation – Lebensqualität – der Bauern und Bäuerinnen mit derjenigen der übrigen Bevölkerung (Referenz) zu vergleichen, die entweder in Agglomerationen oder in Landgemeinden wohnhaft ist Für die landwirtschaftliche Bevölkerung wurde eine repräsentative Stichprobe aus der Liste der direktzahlungsberechtigten Betriebe gezogen Bei der Referenzbevölkerung wurden – ausgehend von einer Zufallsstichprobe aus dem elektronischen Telefonverzeichnis – ebenfalls repräsentativ nach Landesregion, Geschlecht, Erwerbstätigkeit sowie Altersklasse Quoten angewandt
Die Befragung fand in einem Zeitraum statt, in dem sowohl die landwirtschaftliche Bevölkerung wie auch die Konsumentinnen und Konsumenten im Banne aktueller Ereignisse wie BSE und Maul- und Klauenseuche standen Es ist denkbar, dass die Ergebnisse dadurch beeinflusst wurden.
Die vorgefundenen Befragungsergebnisse rund um die Befindlichkeit der landwirtschaftlichen im Vergleich zur übrigen Bevölkerung sind vielschichtig Die wichtigsten Ergebnisse sind in die Bereiche Zufriedenheit, positive und negative Seiten des Bauernberufs sowie Ängste gegliedert.
1 . 2 S O Z I A L E S 1 72 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Zufriedenheit ist vergleichbar hoch
Bei der Frage nach der Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen zeigt sich, dass der Anteil der Landwirte und Landwirtinnen, die mit ihrem allgemeinen Lebensstandard zufrieden sind, gleich hoch ist wie bei der übrigen Bevölkerung (90%) Die landwirtschaftliche Bevölkerung weist bei verschiedenen Lebensbereichen eine leicht höhere Zufriedenheit aus Es handelt sich um die Bereiche Erwerbsarbeit, Aus- und Weiterbildung, Gesundheit und Familie Deutlich weniger zufrieden sind die befragten Landwirtinnen und Landwirte bezüglich Stabilität der Rahmenbedingungen (30% zu 57%), Einkommen (42% zu 68%) und Freizeit (61% zu 79%)

Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen
Erwerbsarbeit Landwirte Referenz
1 . 2 S O Z I A L E S 1 73 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Lebensstandard Landwirte Referenz
Landwirte Referenz Soziales Umfeld Landwirte Referenz Stabile Rahmenbeding Landwirte Referenz
Landwirte
Landwirte Referenz
Zeit Landwirte Referenz Kulturelles Angebot Landwirte Referenz in % Quelle: Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 sehr zufrieden unbestimmt sehr unzufrieden zufrieden unzufrieden weiss nicht/keine Antwort
Ausbildung Landwirte Referenz Weiterbildung Landwirte Referenz Einkommen Landwirte Referenz Allg
Familie
Freizeit
Referenz Gesundheit
Genügend
Möglichkeit, in den nächsten drei Jahren sparen zu können eher weniger etwa gleichviel eher mehr weiss nicht/
Hinsichtlich der Möglichkeit, in den nächsten drei Jahren sparen zu können, äussern sich die Landwirte und Landwirtinnen deutlich weniger positiv als die übrige Bevölkerung: Etwa ein Drittel der befragten bäuerlichen Bevölkerung glaubt, eher weniger sparen zu können; bei der Referenzbevölkerung sind nur 12% dieser Meinung.
Entwicklung der finanziellen Lage in den kommenden 12 Monaten verbessern gleich bleiben verschlechtern weiss nicht/
Was die künftige Veränderung der finanziellen Lage der Haushalte betrifft, äussern die Landwirte und Landwirtinnen eine klar weniger positive Einschätzung als die übrige Bevölkerung Rund ein Viertel der befragten Landwirte und Landwirtinnen geht davon aus, dass sich ihre finanzielle Lage in den kommenden 12 Monaten verschlechtern wird. Nur ein knappes Zehntel der landwirtschaftlichen Bevölkerung glaubt an eine finanzielle Verbesserung in dieser Zeitspanne, während es bei der übrigen Bevölkerung fast ein Viertel ist
1 . 2 S O Z I A L E S 1 74
in % Quelle: Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung 0 10 32 12 38 56 9 18 21 14 20 30 40 50 60 Landwirte Referenz
keine Antwort
keine
in % Quelle: Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung 0 10 9 23 48 61 26 9 17 7 20 30 40 50 60 70 Landwirte Referenz
Antwort
■ Einschätzung des Bauernberufs
In diesem Themenbereich wurde sowohl die landwirtschaftliche als auch die übrige Bevölkerung nach den positiven und negativen Seiten des Bauernberufs befragt Die Fragen waren offen formuliert, das heisst den Befragten wurden keine Antwortmuster vorgegeben. Die Antworten zeigen, dass bei der Einschätzung der positiven Seiten des Bauernberufs deutliche Unterschiede zwischen Fremd- und Eigenbild bestehen
Einschätzung positiver Seiten des Bauernberufs
Selbständigkeit, freie Einteilung
Arbeiten in Natur, Naturverbundenheit

Arbeit/Kontakt mit Tieren Mit Familie/Kindern zusammen sein Familienbetrieb
Andere Argumente bezüglich Arbeitsinhalte/-weise Eigenprodukte/ Selbstversorger
So werden von den Bauern selbst als positive Seiten die Selbständigkeit mit freier Zeiteinteilung (63%) sowie die Naturverbundenheit (60%) gesehen Von der Referenzbevölkerung wird die Selbständigkeit der Bauern zwar ebenfalls am häufigsten genannt (42%). Die Naturverbundenheit als positives Charakteristikum des Bauernberufs wurde von der übrigen Bevölkerung aber nie erwähnt
1 . 2 S O Z I A L E S 1 75
in % Quelle: Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung 0 10 63 42 60 0 18 16 12 7 11 4 5 12 6 11 20 30 40 50 60 70 Landwirte Referenz
■ Weniger Ängste in der Landwirtschaft
Einschätzung negativer Seiten des Bauernberufs
Lange Arbeitszeit/ Präsenzzeit
Viele Vorschriften, ändernde Rahmenbedingungen
Geringer Verdienst/ Einkommen Preiszerfall, Marktdruck
Wenig Freizeit/Ferien
Andere Argumente bezüglich Arbeitsinhalte/-weise
Als wichtigste negative Seite werden von der bäuerlichen Bevölkerung die lange Arbeitszeit genannt, gefolgt von vielen Vorschriften, geringem Einkommen und Preiszerfall Von der übrigen Bevölkerung wird die lange Arbeitszeit zusammen mit der geringen Freizeit / Ferien am häufigsten als negative Seite eingeschätzt Interessant ist, dass die Landwirte und Landwirtinnen die lange Präsenzzeit deutlich negativer einschätzen als die vielen Vorschriften und das tiefe Einkommen
Bei der Befragung nach Ängsten zeigt sich gesamthaft betrachtet ein generell leicht tieferes Bedrohungsgefühl der landwirtschaftlichen Bevölkerung (4,0 Punkte gegenüber 4,2 bei der übrigen Bevölkerung)
1 . 2 S O Z I A L E S 1 76
Andere in % Quelle: Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung 0 5 36 28 25 10 21 21 20 7 18 28 7 14 6 7 10 15 20 25 35 30 40 Landwirte Referenz
Angstindikatoren
Luft- und Wasserverunreinigung/ Klimaveränderungen
Risiken durch die Gentechnologie
Die steigende weltweite Abhängigkeit der Wirtschaft (Firmen-Fusionen)
Unheilbare Krankheiten (z.B. Krebs, AIDS)
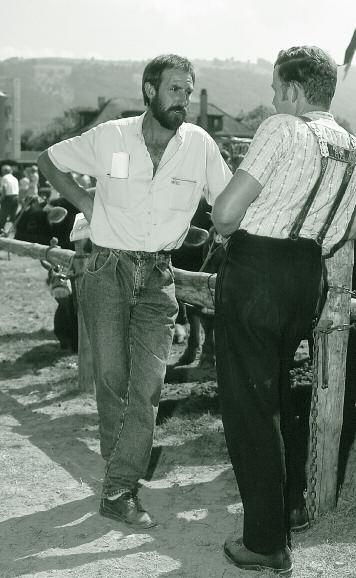
Überfremdung durch Ausländer und Flüchtlinge
Inflation/Preissteigerung
Der Egoismus der Menschen
Atom-Verseuchung
Zu wenig Geld haben zum Leben
Politische Veränderungen/ radikale Bewegungen
Energieverknappung
Schwere Unfälle/Invalidität
Technische Veränderungen und Umwälzungen auf allen Gebieten
Wirtschaftliche Notlage im Alter
Allgemeiner Sittenzerfall, weil die Moral dauernd sinkt
Das Gefühl, nur noch ein unbedeutendes Rädchen zu sein Strassenbauten, Häuserblocks, Zersiedelung der Landschaft
Krieg
Immer geringere Bedeutung der Religion
Kriminalität/Überfälle
Das Gefühl, in der Schweiz nicht mehr zu Hause zu sein Angst, die Stelle/Arbeit zu verlieren oder keine Arbeitsstelle zu finden
Persönliche Probleme (Generationenkonflikt)
Persönliche Probleme (Kinder)
Angst, allein zu sein/ keine Freunde zu haben
Persönliche Probleme (Ehe, Partnerschaft)
Angst, die Wohnung zu verlieren
1 . 2 S O Z I A L E S 1 77 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Q
01,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 5,7 6,1 5,6 5,4 5,3 5,4 5,0 6,0 4,9 4,9 4,8 4,6 4,7 4,7 4,7 5,0 5,6 5,3 4,5 4,4 4,4 5,0 4,6 4,4 4,2 4,4 4,5 4,2 4,0 4,0 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,2 1,9 1,9 2,5 2,6 2,7 3,4 2,7 3,1 3,5 4,1 7,0 Landwirte Referenz
Skala: 1= keine Bedrohung/ 10= grosse Bedrohung
uelle: Schweizerische Gesellschaft für praktische Sozialforschung
Die bäuerliche Bevölkerung hat weniger Angst vor Kriminalität und Krieg. Deutlich weniger bedroht fühlt sie sich auch im Bereich der physischen Unversehrtheit (Angst vor unheilbaren Krankheiten und schweren Unfällen) Bei den sozio-ökonomischen Ängsten ist die Angst, zu wenig Geld zum Leben zu haben, bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung grösser als bei der übrigen Bevölkerung Gleichzeitig hat sie aber wesentlich weniger Angst vor Erwerbslosigkeit als die Referenzbevölkerung Die Angst vor einer wirtschaftlichen Notlage im Alter ist bei beiden Gruppen gleich gross Trotz der Unterschiede teilen aber die landwirtschaftliche und die übrige Bevölkerung ihre Einschätzung bezüglich der Hauptbedrohung Diese liegt im ökologischen Bereich mit der Angst vor Klimaveränderung sowie Luft- und Wasserverunreinigung
Die bäuerliche Bevölkerung ist mit verschiedenen Lebensbereichen leicht zufriedener als die übrige Bevölkerung (Familie, Gesundheit, Aus- und Weiterbildung sowie Erwerbsarbeit). Deutlich unzufriedener ist die bäuerliche Bevölkerung beim Einkommen, bei der Stabilität der Rahmenbedingungen und der Freizeit Sie ist pessimistischer, was die künftige Einkommensentwicklung anbelangt Insgesamt sind die Unterschiede zwischen der bäuerlichen und der übrigen Bevölkerung aber nicht sehr gross So wird die Zufriedenheit mit dem allgemeinen Lebensstandard von der landwirtschaftlichen und der übrigen Bevölkerung gleich hoch eingestuft.
Im Zusammenhang mit dem Bauernberuf werden als positive Seiten von den Bauern selbst die Selbständigkeit sowie die Naturverbundenheit gesehen. Von der Referenzbevölkerung wird ebenfalls die Selbständigkeit der Bauern am häufigsten genannt Als wichtigste negative Seite wird von den Landwirten und Landwirtinnen die lange Arbeitszeit genannt; von der übrigen Bevölkerung werden an erster Stelle die geringe Freizeit und die lange Arbeitszeit als negativ angesehen
Bei den Ängsten zeigt sich generell ein leicht tieferes Bedrohungsgefühl der landwirtschaftlichen Bevölkerung Im Bereiche der Arbeitsmarktindikatoren ist insbesondere die Angst vor Erwerbslosigkeit bei Bauern deutlich geringer als bei der übrigen Bevölkerung Trotz den Unterschieden teilen aber die landwirtschaftliche und die übrige Bevölkerung ihre Einschätzung bezüglich der Hauptbedrohung: Angst vor den Folgen einer Klimaveränderung sowie einer Luft- und Wasserverunreinigung

1 . 2 S O Z I A L E S 1 78
■ Unterschiede in der Befindlichkeit
■ Pionierrolle von Eggiwil
1.2.4 Kinder- und Jugendhilfe in Eggiwil
Die Emmentaler Gemeinde Eggiwil nimmt eine Pionierrolle auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung ein: Eggiwil leistet Besonderes im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, aber auch bei der Förderung der Stadt-Land-Kooperation und des Emmentals als Naherholungsgebiet, als Lieferantin von Energie aus Holz und von sauberem Trinkwasser Um für die weitere Umsetzung dieser Visionen geeignete Wege auszumachen, wird das «Eggiwiler Symposium» durchgeführt – im Jahr 2001 bereits zum vierten Mal Zudem wurde das «Eggiwiler Institut für systemische Gemeinde- und Regionalentwicklung», das die nachhaltige Entwicklung im Rahmen der lokalen Agenda 21 von Rio in den drei Bereichen Bildung, Forschung und Entwicklung vorantreiben will, gegründet
Gemeindespiegel von Eggiwil
Seit 1990 beschäftigt sich das «Atelier für systemische Gemeinde- und Regionalentwicklung, Projekt- und Organisationsentwicklung» (ASPOS in Regensdorf) mit der Entwicklung von Institutionen und Projekten im Sozial- und Gesundheitsbereich. Im Juni 1996 suchte ASPOS per Inserat eine Partnergemeinde Schon im Dezember 1996 konnte mit dem Gemeinderat von Eggiwil ein Kooperationsvertrag abgeschlossen werden Im Zeitraum 1996 bis 1998 entwickelte ASPOS in Zusammenarbeit mit Eggiwil ein Projekt, welches innovative Formen zur nachhaltigen Entwicklung von Gemeinden und Regionen im Sinne der lokalen Agenda 21 erproben und neue Wege der Partnerschaft zwischen Stadt und Land aufzeigen sollte

1 . 2 S O Z I A L E S 1 79 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■■■■■■■■■■■■■■■■
Lage Amtsbezirk Signau / Region Oberes Emmental Einwohner 2‘614 Fläche 60 km2 LN 33,4 km2 Landwirtschaftliche Betriebe 240 Beschäftigte im I Sektor 60% Beschäftigte im II. Sektor 24% Beschäftigte im III Sektor 16% Schulhäuser 9, davon 3 Gesamtschulen Schüler 410
■ Projekt «Integration»
Aus dieser Zusammenarbeit ist das Projekt «Integration» entstanden, das von einem gemeinnützigen Verein in Eggiwil getragen wird Es wurde als Netzwerk der Jugendhilfe konzipiert und bietet psychosozial gefährdeten Kindern und Jugendlichen aus den Agglomerationen Zürich, Basel, Bern, Luzern und Schaffhausen naturnahe Lebens- und Entwicklungsräume mit systemtherapeutischer und sozialpädagogischer Unterstützung
Gefährdete Kinder und Jugendliche finden seit 1998 im Rahmen dieses Projektes bei Eggiwiler Bauernfamilien ein neues Zuhause Die Gründe für die Platzierungen reichen von der Überforderung der Eltern bis zur Kindsmisshandlung In einer speziell qualifizierten Emmentaler Familie, mitten in einer naturnahen Umgebung, sollen diese Kinder wieder sicheren Boden unter den Füssen bekommen Die Partnerfamilien werden sorgfältig ausgewählt. Wichtige Voraussetzungen für die Qualifikation als Partnerfamilie sind: eine nach den Kriterien der World Health Organization (WHO) gesunde Familie mit Kindern im Vor- oder Schulalter, genügend Wohnraum, Haus- und /oder Nutztiere, die artgerecht gehalten werden sowie existenzsichernde wirtschaftliche Verhältnisse Es gibt regelmässig Standortgespräche und Supervisionen Bei Problemen sind die Projektleiter von ASPOS rund um die Uhr erreichbar Zudem werden die Kinder von einem Arzt und einem Psychiater begleitet Die Kinder und Jugendlichen besuchen in der Regel die öffentliche Gemeindeschule in einem der neun Schulhäuser der Gemeinde Eggiwil. Gemeinsam mit den Lehrkräften werden individuelle Lernziele vereinbart und diese periodisch überprüft Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Partnerfamilie wird von ASPOS und weiteren Fachleuten begleitet und unterstützt
Wirtschaftlich betrachtet bedeutet die Aufnahme eines «Integrations-Kindes» für eine Bauernfamilie einen Nebenverdienst im Umfang von rund einer halben Stelle Nur Familien, deren Hof in seiner Existenz nicht gefährdet ist, dürfen ein Pflegekind aufnehmen; sonst wäre die finanzielle Abhängigkeit zu gross Maximal 12 Bauernfamilien können sich bei «Integration» beteiligen. Der Gemeinderat hat diese Grenze gesetzt, weil er der Meinung war, dass die bestehenden Strukturen nicht mehr als 12 Kinder vertragen Für Jugendliche, welche bei Partnerfamilien in Eggiwil dauerhaft platziert werden, wird später eine geeignete Praktikumsstelle oder eine Lehrstelle vermittelt Im Emmental besteht ein vielfältiges Angebot an Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben

1 . 2 S O Z I A L E S 1 80
■ Projekt «Milieutherapie»
Seit Februar 2000 ist das Angebot im Bereich Kinder- und Jugendhilfe um das Projekt «Milieutherapie» erweitert worden Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem «Juvenat» der Franziskaner aus Flüeli-Ranft, welches durch die Mithilfe von ASPOS von einem Internat in ein systemisches Schul- und Therapieheim umgewandelt worden war. Schon vor dem Aufbau des Projekts bestanden Kontakte zwischen Flüeli-Ranft und Eggiwil: Jugendliche des «Juvenats» haben die Möglichkeit, Wochenenden oder Ferien bei Partnerfamilien des Vereins «Integration» in Eggiwil zu verbringen
Das neue Projekt hat zum Ziel, noch nicht gruppenfähigen Jugendlichen zu ermöglichen, sich in einem kleinen und überschaubaren Rahmen zu stabilisieren und zu sozialisieren Eine zentrale Rolle spielt dabei neben den Partnerfamilien auch die eigene Kleingruppenschule. Diese ist nicht mit den öffentlichen Schulen verbunden. Vier Lehrkräfte beteiligen sich am Einzel- und Kleingruppenunterricht Neben Familien für Wochenend- und Ferienaufenthalter des «Juvenats» werden im Rahmen des Projekts auch Familien für die ständige Betreuung von Jugendlichen mit massiven Verhaltensproblemen benötigt Für Partnerfamilien, welche Jugendliche aus dem «Juvenat» betreuen, werden vom «Juvenat» zusätzliche Weiterbildungstage durchgeführt Die Gruppe der «Juvenats-Partnerfamilien» wuchs im Jahr 2000 auf sieben an; vier Jugendliche sind dauerhaft platziert worden
■ Finanzierung der Projekte
Verglichen mit gleichwertigen herkömmlichen Angeboten der stationären Jugendhilfe fällt der Aufwand bei «Integration» bescheiden aus. Die gesamten Kosten sind für gleiche Leistungen und gleiche Qualität durchschnittlich 30% tiefer Diese Kosten werden von den zuweisenden Instanzen bezahlt
Die «Milieutherapie» wird ebenfalls über die zuweisenden Instanzen sowie über die Stiftung Juvenat der Franziskaner finanziert. Diese Stiftung ist als JugendhilfeNetzwerk vom Kanton Obwalden anerkannt und wird auf der Grundlage der Interkantonalen Heimvereinbarung unterstützt
■ Positive Bilanz
Die «Milieutherapie» – neben dem Projekt «Integration» – wie auch der steigende Bedarf an Wochenend- und Ferienplätzen bei Familien hat im Jahr 2000 zu einer nochmaligen Zunahme der neu geschaffenen Arbeitsplätze geführt:

1 . 2 S O Z I A L E S 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 81
Anzahl Arbeitskräfte Ende 2000 Sozialpädagogische Mitarbeitende (Bauernfamilien) 16 Systemtherapeuten 2 Sozialpädagogen / Sozialarbeiterinnen 2 Sekretärin 1 Lehrkräfte 4
Die Projekte «Integration» und «Milieutherapie» werden von der Gemeinde Eggiwil als eine wichtige gemeinschaftliche Aufgabe betrachtet Denn sie sollen nicht nur gefährdeten Kindern und Jugendlichen helfen, sondern einen Entwicklungsprozess in Gang setzen. In einer vom wirtschaftlichen Strukturwandel stark herausgeforderten und von Abwanderung gefährdeten Region lässt sich damit einerseits ein Teil der Infrastruktur erhalten und erneuern Anderseits werden in der vom landwirtschaftlichen Strukturwandel bedrohten Gemeinde neue Arbeitsplätze geschaffen Es braucht aber Anstrengung und Engagement von allen Beteiligten Die Bilanz für die ersten Jahre fällt für die Kinder und Jugendlichen, die Gemeinde Eggiwil sowie die Bauernfamilien positiv und ermutigend aus

1 . 2 S O Z I A L E S 1
82
Die Landwirtschaft und die Umwelt sind eng miteinander verbunden. Die Beziehungen sind vielschichtig und komplex Da die Landwirtschaft einen bedeutenden Teil des schweizerischen Territoriums nutzt, spielt der Agrarsektor im Ökosystem des ländlichen Raums eine zentrale Rolle Die Aufgaben und Verantwortung der Landwirtschaft bestehen nicht nur in der Herstellung von Lebensmitteln, sondern auch in der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Pflege der Kulturlandschaft
Die Einflüsse auf die Landwirtschaft sind vielfältig Der Markt, die Anforderungen der Direktzahlungen, verschiedene Gesetzesbestimmungen oder das Kaufverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten wirken sich auf die Entscheide der Bäuerinnen und Bauern bezüglich der Nutzung der natürlichen Ressourcen aus Im Abschnitt Ökologie geht es darum, die ökologischen Auswirkungen der Agrarpolitik zu erfassen und zu dokumentieren Diese werden einerseits mit geeigneten agrarökologischen Indikatoren dargestellt, anderseits werden einzelne Problem- oder Massnahmenbereiche gezielt untersucht und analysiert

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3 Ökologie
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 83
1.3.1 Agrarökologische Indikatoren
Im ersten Agrarbericht wurden agrarökologische Indikatoren vorgestellt, die zur Berichterstattung im Bereich Ökologie dienen Diese liefern den mit der Ausarbeitung und Umsetzung der Agrarpolitik beteiligten Kreise wertvolle Informationen Im Einzelnen bezwecken sie:
– das Erkennen der wichtigsten agrarökologischen Fragen;
die Förderung des Verständnisses der Beobachtung und Beurteilung der Zusammenhänge zwischen landwirtschaftlicher Praxis und ihren positiven und negativen Auswirkungen auf die Umwelt;
– die Beurteilung, inwieweit die Agrarpolitik eine Ressourcen schonende Landwirtschaft fördert;
die Information politischer Entscheidungsträger und der Öffentlichkeit;
– die Beobachtung und Bewertung des Umweltbeitrages der nachhaltigen Landwirtschaft auf lokaler Ebene;
den Vergleich der Situation mit anderen Ländern
Um eine Analyse der Auswirkungen des Agrarsektors auf die Umwelt zu ermöglichen, werden die ökologischen Anforderungen in einem System Landwirtschaft-MenschUmwelt betrachtet Die Landwirtschaft steht dabei im Zentrum Die Indikatoren zeigen demnach nicht die allgemeine Entwicklung der Umweltqualität im landwirtschaftlich genutzten Gebiet auf, sondern diejenige bezogen auf landwirtschaftliche
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 84 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
–
–
Tätigkeiten Landwirtschaft-Mensch-Umwelt-System Klima, Luft Boden Relief Wasser Flora, Fauna Belebte und unbelebte Natur Ernährung, Gesundheit Wirtschaft, Arbeit Erholung, Freizeit Verkehr, Mobilität Siedlung, Wohnen Mensch Dünger Pflanzenschutzmittel Futtermittel Maschinen 1 Klima, Luft, Wasser, Bodenfruchtbarkeit 3 Landwirtschaftliche Biodiversität Lebensraum für wildlebende Arten Landschaft Verhalten gegenüber der Umwelt 4 Verhalten gegenüber den Tieren Tierwohl 5 Stickstoff Energie Phosphor 2 Landwirtschaft Art der Landnutzung
Es gibt fünf Gruppen von Indikatoren. Bei vier davon handelt es sich um eigentliche agrarökologische Indikatoren, in der fünften Gruppe befinden sich Indikatoren über das Verhalten gegenüber Nutztieren und über das Tierwohl Bei den vier Gruppen der agrarökologischen Indikatoren geht es um:
– den Verbrauch von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, die eine potenzielle Auswirkung auf die Umwelt haben, wie Dünger, Pflanzenschutzmittel, Futtermittel, Tierarzneimittel;
– landwirtschaftliche Prozesse im Agrarsystem, wie beispielsweise Stickstoff-, Phosphor-, Energie- und Ökobilanz Sie dienen der Beurteilung der ökologischen Entwicklung und Verträglichkeit der Landwirtschaft;
– Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf die Umwelt wie Emissionen aus der Landwirtschaft in die Luft, das Wasser und den Boden sowie Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft und deren Auswirkungen auf die Biodiversität und die Landschaft;
– den Einfluss des gesellschaftlichen Verhaltens, der Einkaufsgewohnheiten von Konsumentinnen und Konsumenten und die Haltung der Landwirtinnen und Landwirte auf eine umweltschonende Flächenbewirtschaftung

Die Indikatoren weisen gegenwärtig einen unterschiedlichen Entwicklungsgrad auf: Die ersten beiden Indikatorengruppen (Produktionsmittel und landwirtschaftliche Prozesse) sind verhältnismässig gut ausgebaut Die Methoden sind meist bekannt, und die Daten sind in der Regel vorhanden Eine Interpretation der erhobenen Daten ist ebenfalls möglich
Bei der dritten Gruppe sind für die Festlegung des methodischen Vorgehens oft noch Arbeiten erforderlich Zudem ist die Datenlage lückenhaft
Die Indikatoren der vierten Gruppe bedürfen mit Ausnahme derjenigen über die Gewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten einer vertieften Untersuchung
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 85
■ Der Tierbestand hat abgenommen
Produktionsmittel
Der grösste Anteil des Nährstoffbedarfs wird in der schweizerischen Landwirtschaft über die Hofdünger gedeckt Demzufolge ist die Entwicklung des Tierbestandes ein wichtiger Faktor.
Entsprechend der Tierart und dem Tiergewicht wird ein Normwert für den Hofdüngeranfall gebildet, die Düngergrossvieheinheit (DGVE) Eine DGVE entspricht dem Nährstoffanfall von 15 kg Phosphor (P) und 105 kg Stickstoff (N), die pro Kuh und Jahr im Durchschnitt ausgeschieden werden.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 86
Belebte und unbelebte Natur Mensch Dünger Pflanzenschutzmittel Futtermittel Maschinen 1 3 4 5 2 Landwirtschaft Entwicklung des Tierbestandes 19901996 1997 1998 1999 2000 i n 1 0 0 0 D G V E 1 Total DGVE übrige Quelle: BFS 1 DGVE: Düngergrossvieheinheit Schweine Rindvieh 0 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200
Landwirtschaft-Mensch-Umwelt-System
Der Nutztierbestand, gemessen in GVE, hat in der Schweiz zwischen 1990 und 2000 stetig abgenommen Von 1990 bis 1996 war der Rückgang ziemlich deutlich, danach sank er nur noch wenig Besonders stark war die Abnahme beim Rindvieh Im Jahr 2000 wurden rund 250'000 Stück weniger gezählt als 1990. Bezogen auf die gesamte Zeitspanne war auch der Schweinebestand rückläufig Eine genauere Analyse zeigt, dass der Bestand bis 1996 deutlich abnahm, sich danach aber wieder leicht erhöhte In den letzten zehn Jahren konstant war der Schafbestand 75% der GVE stammen von der Rindviehhaltung Bezüglich des Hofdüngeranfalls nimmt diese eine dominierende Stellung ein
Der Tierbestand ist im Jahr 2000 in 23 Kantonen tiefer als 10 Jahre zuvor.
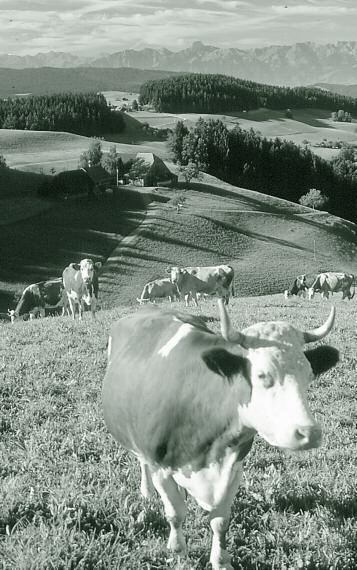
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 87
1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T Entwicklung der GVE nach Kantonen ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS/BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU Quelle: BFS 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 1990 2000
■ Mineraldüngerverbrauch stabilisiert sich
Der Gesamtverbrauch an Mineraldüngern hat seit Anfang der neunziger Jahre bis 1998 stetig und deutlich abgenommen Der Einsatz an P-Mineraldüngern in der schweizerischen Landwirtschaft ist in dieser Zeit um über 75% zurückgegangen Bei den NMineraldüngern ist der Rückgang mit rund 25% weniger ausgeprägt. Nach 1998 ist der Verbrauch nicht mehr zurückgegangen Er hat sich sowohl 1999 als auch 2000 gegenüber 1998 leicht erhöht
■ Landwirtschaft verwendet 400'000 t Abfalldünger
Umgerechnet auf Trockensubstanz (TS) verwendet die Landwirtschaft rund 400'000 t Abfalldünger.
der Verwendung von Abfalldüngern
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 88
Entwicklung des Mineraldüngerverbrauchs 1946/501956/601966/701976/801986/901990/92 1993 1994 2000 1 1999 1998 1997 1996 1995 N Quelle: SBV, Treuhandstelle der schweizerischen Düngerpflichtlagerhalter 1 provisorisch P 0 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 i n t Entwicklung
in der Landwirtschaft Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie (z.B. aus der Zuckerrübenverarbeitung) Abfälle zur Kompostierung Klärschlamm Restholz, Rinden Aschen, weitere Abfälle i n 1 0 0 0 t T S Quelle: FAL 1988/90 1998/99 0 20 40 60 80 100 120 140 160
■ Pflanzenschutzmittel: 30% weniger verkauft als 1990
Beim Einsatz von Abfalldüngern haben sich in den letzten zehn Jahren erhebliche Verschiebungen ergeben Während die Klärschlammmenge von 116'000 t auf 84'000 t TS zurückging, hat sich die Menge von Kompost aus Grünabfällen von rund 65'000 t auf rund 150'000 t TS mehr als verdoppelt. In der Landwirtschaft werden rund 75% der in Kompostieranlagen produzierten Kompostmenge verwendet Zu den übrigen Abfallkategorien können keine zuverlässigen Angaben für die früheren Jahre gemacht werden
Der Verkauf der totalen Menge an Pflanzenschutzmitteln (PSM), gemessen in t aktiver Substanz, ist zwischen 1990 und 2000 um über 30% gesunken Die beiden am häufigsten eingesetzten Stoffgruppen, Fungizide und Herbizide, weisen seit 1990 eine Abnahme von 27% respektive 21% auf Die grösste Abnahme (-76%) ist bei den Wachstumsregulatoren zu verzeichnen Die rückläufige Verkaufsmenge darf allerdings nicht mit einer Abnahme des Umweltrisikos gleichgesetzt werden. Die absolute Abnahme der PSM wurde auch durch den Einsatz wirksamerer Stoffe erreicht Detaillierte Umweltdaten über das Vorkommen dieser Substanzen in den verschiedenen Umweltsphären liegen gegenwärtig auf nationaler Ebene noch nicht vor
■ Verbrauch von Antibiotika
Die Verwendung von Antibiotika in der Landwirtschaft nahm im Zeitraum von 1995 bis 2000 gesamthaft um 50% ab, nämlich von 80 auf 39 t Das zeigt eine im Auftrag des Bundes erstellte Statistik über die im Veterinärbereich verwendeten Antibiotika. Die freiwillige Einschränkung beim Gebrauch von Antibiotika als Leistungsförderer in der Tierproduktion und das definitive Verbot 1999 hatten den markantesten Rückgang zur Folge Allein auf Grund dieser Massnahmen wurden in der Landwirtschaft 34 t weniger Antibiotika verwendet
Antibiotika dürfen heute in der Landwirtschaft nur unter tierärztlicher Kontrolle eingesetzt werden Es werden zwei Anwendungsformen unterschieden: Bei der vorbeugenden oder therapeutischen Behandlung von Tierherden (Medizinalfutter) ist in den Jahren 1995 bis 2000 ein Rückgang von 44% (von 31 t auf 17 t) zu verzeichnen Die zweite Anwendungsform – die fallweise Behandlungen pflegebedürftiger Tiere – verzeichnete dagegen während desselben Zeitraumes eine Zunahme von 7 t (Einsatz im 2000: 22 t) Diese Zahlen lassen den Schluss zu, dass Antibiotika in der Nutztierhaltung heute gezielter eingesetzt werden als früher
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 89
1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ Stabilisierung des Energieverbrauchs
Die Analyse des Energieverbrauches in der Landwirtschaft zeigt, dass der Verbrauch von Elektrizität sowie von Diesel und Benzin heute über 50% der eingesetzten Energieformen ausmachen Die graue Energie, welche in Maschinen und Gebäuden steckt, stellt mit rund 40% einen weiteren bedeutenden Posten dar. Rund 6% der Energie wird für die Bereitstellung von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln wie Dünger und PSM sowie eingeführten Futtermitteln und Samen verbraucht

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 90
Entwicklung des Energieverbrauchs 197019771984 19911998 M J / h a Pestizide Eingeführte Futtermittel Eingeführte Samen Dünger Fossile Energie Elektrizität Maschinen Gebäude Quelle: FAL 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000
Landwirtschaftliche Prozesse
Landwirtschaft-Mensch-Umwelt-System
N spielt in der belebten Umwelt eine wichtige Rolle Er kommt in verschiedensten Formen vor und ist ein lebenswichtiger Nährstoff Er kann aber auch als Schadstoff in der Umwelt auftreten. Durch den notwendigen Einsatz des N ist die Landwirtschaft eine wichtige Quelle für bestimmte umweltrelevante N-Verbindungen N ist damit ein zentraler Indikator im landwirtschaftlichen System
Zur qualitativen Beurteilung dieses Systems wird die N-Bilanz beigezogen Sie wird nach der OECD-Methode «N-Bilanz an der Bodenoberfläche» berechnet. Dabei wird die Differenz gemessen zwischen der gesamten, während eines Jahres zugeführten N-Menge (Hofdünger, Abfalldünger, Mineraldünger, biologische N-Fixierung und Einträge aus der Luft) und der dem Boden entzogenen N-Menge durch Acker- und Futterbauprodukte
Die verwendete Methode allein ermöglicht keine abschliessende Aussage über die effektiven N-Verluste aus der Landwirtschaft So hängen die N-Verluste sehr stark von der Art und Weise der Flächennutzung, der Tierhaltung sowie von der Produktionstechnik ab (u a Aufstallungssysteme, Lager- und Ausbringtechnik der Hofdünger) Die N-Verluste bei der Lagerung und beim Ausbringen der Hofdünger werden bei der OECD-Methode nicht berücksichtigt.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 91
1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■
N-Bilanzüberschüsse nehmen ab
Belebte und unbelebte Natur Mensch 1 3 4 5 Stickstoff Energie Phosphor 2 Landwirtschaft
Der N-Input hat gesamthaft abgenommen: Die Verwendung von Mineraldüngern ist zwischen dem Durchschnitt der Jahre 1989/91 und 1998/99 um über 15'000 t N zurückgegangen. Als Folge des sinkenden Viehbestandes im gleichen Zeitraum enthält auch der Hofdünger über 13'000 t weniger N Hingegen haben die Einträge aus der biologischen N-Fixierung wegen des vermehrten Anbaus von Leguminosen um rund 2'500 t N zugenommen.
Die N-Bilanz hat sich mit einer Abnahme von über 8'000 t N nicht im gleichen Ausmass verändert wie der Input Dies ist auf die Extensivierung im Pflanzenbau, insbesondere die Anlage von ökologischen Ausgleichsflächen, zurückzuführen So sind die N-Entzüge im Futterbau um mehr als 16'000 t und im Ackerbau um knapp 1'500 t zurückgegangen
Die Bilanzüberschüsse sollen möglichst gering sein. Im landwirtschaftlichen System treten jedoch Verluste auf, die unvermeidbar sind
Eine wichtige Grösse zur Beurteilung der N-Verluste aus der Landwirtschaft für die Umwelt sind die so genannten umweltrelevanten N-Frachten Darunter fallen alle N-Verbindungen, die Luft, Klima und Gewässer belasten (Ammoniak, Lachgas, Stickoxid, Nitrat, Ammonium) Zur Bestimmung der umweltrelevanten N-Frachten wird das N-Verlustpotenzial den verschiedenen Stickstoffformen zugeteilt. Das N-Verlustpotenzial umfasst die Stall- und Lagerverluste von Hofdüngern, die Verluste beim Ausbringen von Düngern und den N, der in den Boden gelangt, aber von den Pflanzen nicht aufgenommen wird. Am Institut für Agrarwirtschaft der ETH-Zürich (IAW) wurden die umweltrelevanten N-Frachten aus der Landwirtschaft für 1994 und 1998 berechnet

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 92
Entwicklung der N-Bilanz i n 1 0 0 0 t N -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 Ernteentzug Ackerkulturen
Bilanz Biologische N-Fixierung Atmosphärische Deposition Hofdünger Mineraldünger 1998/99 1989/91 1998/99 1989/91 1998/99 1989/91 Input Output Bilanz Quelle: BFS
Ernteentzug Futterbau
■ Nitrat nimmt stärker ab als Ammoniak
Anteil der verschiedenen N-Fraktionen an den umweltrelevanten N-Frachten
■ N-Verluste nehmen mit höherem Tierbesatz zu
Die wichtigsten umweltrelevanten N-Fraktionen sind Ammoniak (NH3), Nitrat (NO3) und Lachgas (N2O) Die zeitliche Entwicklung dieser Frachten zeigt, dass die Ammoniakverflüchtigung mit einem Rückgang von knapp 4% gesamtschweizerisch sowie in allen Zonen deutlich weniger abgenommen hat als die Verluste von Nitrat und Lachgas (beide über –11%). Bis 1998 betrug die gesamtschweizerische Reduktion 7'000 t N Die Zielvorgabe für 2002 (–22'000 t N) wird schwierig zu erreichen sein
Die über den Bedarf der Pflanze hinausgehende Düngung wird als Normabweichung bezeichnet Diese wie auch die Menge an eingesetztem N-Dünger und das N-Verlustpotenzial steigen mit zunehmendem Tierbesatz (GVE/ha)
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 93 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1998 i n 1 0 0 0 t N 1994 0 20 40 60 80 100 8,1 51 36,8 7,2 49,1 32,6 Quelle: IAW-ETH NO3 NH3 N2O N-Verluste bei zunehmendem Tierbesatz k g N / h a N-Düngung N-Verlustpotenzial Normabweichung Quelle: IAW-ETH 0 50 100 150 200 250 >3,0 2,01–3,0 1,51–2 Viehbesatz (GVE/ha) 1,01–1,5 0–1
Zur Berechnung der P-Bilanz wird die gesamte schweizerische Landwirtschaft als ein Betrieb angesehen Die P-Zufuhr umfasst die P-Mengen in den importierten Futtermitteln, den Mineral- und Abfalldüngern, dem importierten Saatgut und den Depositionen aus der Luft. Die Wegfuhr setzt sich zusammen aus den pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln und anderen Produkten, welche die Landwirtschaft verlassen Alle landwirtschaftsinternen Kreisläufe, wie die Produktion von Futtermitteln oder der Anfall von Hofdüngern, müssen bei dieser Methode nicht berechnet werden
Der P-Input hat von 1990/92 bis 1997/99 um knapp 10'000 t abgenommen Dies ist vor allem auf den starken Rückgang beim Einsatz von P-Mineraldüngern zurückzuführen. Der P-Output hat in der gleichen Zeitperiode um über 800 t P zugenommen. Der Hauptgrund dafür ist, dass die P-reichen Fleisch- und Knochenmehle wegen der BSE-Problematik nicht mehr in der Landwirtschaft verwertet werden Die P-Bilanz hat damit insgesamt um über 10'000 t P abgenommen, bleibt aber weiterhin positiv. Dies bedeutet, dass die P-Vorräte in gewissen Regionen im Boden immer noch zunehmen Die Zunahme der P-Vorräte hat sich allerdings stark verlangsamt
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 94
Entwicklung der P-Bilanz i n t P 1997/99 1990/92 1997/99 1990/92 1997/99 1990/92 Input Output Quelle: FAL Bilanz -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Deposition (Niederschläge) Kompost, andere Dünger und Saatgut Klärschlamm Mineraldünger Importierte Futtermittel Tierische Produkte Pflanzliche Produkte Bilanz
■
Grosse Fortschritte bei der P-Bilanz
Einfluss der Landwirtschaft auf die Umwelt

Der Schutz des Klimas gehört zu den vorrangigen Zielen der globalen Umweltpolitik Die Begrenzung und langfristige Reduktion der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen wird als wichtige Aufgabe anerkannt. Die Landwirtschaft leistet einen bedeutenden Beitrag zur Emissionsreduktion
Die mengenmässig wichtigsten Treibhausgase sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) Um die verschiedenen Treibhausgase miteinander vergleichen zu können, werden die einzelnen Gase in CO2-Äquivalente umgerechnet 84% der in der Schweiz emittierten Treibhausgase stammen aus der Verbrennung fossiler Energieträger Nur knapp 1,5% dieser Emissionen werden durch den Sektor Landwirtschaft verursacht. Von den restlichen 16% der Treibhausgase machen Methan und Lachgas den Hauptanteil aus
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 95 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ Treibhausgasemissionen Landwirtschaft-Mensch-Umwelt-System Belebte und unbelebte Natur Mensch 1 Klima, Luft, Wasser, Bodenfruchtbarkeit 3 Landwirtschaftliche Biodiversität Lebensraum für wildlebende Arten Landschaft 4 5 2 Landwirtschaft Entwicklung der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft 19901998 i n 1 0 0 0 t 1 N2O CH4 CO2 Quelle: BUWAL 1 CO2-Äquivalente 0 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
und
Methan- und Lachgasemissionen verdienen eine genauere Betrachtung. Dies insbesondere auch deshalb, weil ihr Erwärmungspotenzial auf 100 Jahre betrachtet 21-mal (Methan) respektive 310-mal (Lachgas) treibhauswirksamer ist als jenes von Kohlendioxid (CO2). Methan und Lachgas stammen in der Schweiz zu rund 75% (Methan) und 62% (Lachgas) aus dem landwirtschaftlichen Produktionsprozess
Die Methan- und Lachgasemissionen der Landwirtschaft sind in den letzten zehn Jahren um über 11% gesunken. Die Reduktionserfolge der Landwirtschaft sind vor allem auf die Abnahme der Tierzahlen, die Reduktion des Verbrauchs mineralischer Dünger sowie auf den Einsatz angepasster Lager- und Ausbringtechniken von Hofdüngern zurückzuführen Wird davon ausgegangen, dass jeder Emittent von Treibhausgasen in der Schweiz an die Reduktionsverpflichtung gemäss Kyoto-Protokoll der Klimakonvention einen Beitrag leisten muss (–8%), hat die Schweizer Landwirtschaft das gesteckte Ziel bereits heute erreicht

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 96
Entwicklung
19901995 2000 i n % ( 1 9 9 0 = 1 0 0 ) Lachgasemissionen Methanemissionen Quelle: FAL 50 60 70 80 90 100 110
■ Methan-
Lachgasemissionen je um 11% reduziert
der Lachgas- und Methanemissionen
■ Ökologische Ausgleichsflächen (ÖAF)
Als beitragsberechtigter Öko-Ausgleich gelten extensiv und wenig intensiv genutzte Wiesen, extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland, Streueflächen, Hecken, Feld- und Ufergehölze, Bunt- und Rotationsbrachen, Ackerschonstreifen und Hochstamm-Feldobstbäume. Ziel ist es, bis 2005 im Talgebiet 65'000 ha ÖAF zu erreichen, was ca 10% der LN entspricht
Die beitragsberechtigten ökologischen Ausgleichsflächen haben im Jahr 2000 gegenüber 1999 um 4'300 ha (5%) zugenommen Mit 3'300 ha war der grösste Zuwachs im Talgebiet (Ackerbauzonen bis und mit Hügelzone) zu verzeichnen. Insgesamt waren im Talgebiet im Jahr 2000 47'000

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 97 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
als
ökologische Ausgleichsflächen angelegt Entwicklung des Anteils der ÖAF ABZ – HZ 1 BZ I – BZ II BZ III – BZ IV i n % d e r L N Quelle: BLW 1 Ackerbauzonen bis Hügelzone 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 0 25 20 15 10 5 Entwicklung der ÖAF 1 19921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 i n 1 0 0 0 h a 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume Quelle: BLW 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
ha
beitragsberechtigte
Ökologischer Ausgleich1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume 2000
in % der LN 1 0 <10 10–19,9 20–29,9
≥30
Sömmerungsgebiet
1 Pro Gemeinde, ha beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen dividiert durch ha LN
Ökologischer Ausgleich1 inklusive Hochstamm-Feldobstbäume 2000
in % der LN 1 0 <10 10–19,9 20–29,9 ≥30
Sömmerungsgebiet
1 Pro Gemeinde, ha beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen dividiert durch ha LN
Die Hochstamm-Feldobstbäume sind ein wichtiges Landschaftselement Sie spielen auch für den ökologischen Ausgleich eine bedeutende Rolle Einen wesentlichen Beitrag für den ökologischen Ausgleich leisten sie in der Bodenseeregion, in der Nordwestschweiz (insbesondere Kanton Baselland) sowie in gewissen Gebieten der Kantone Bern, Luzern, Waadt und Zürich
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 98
Quelle: BLW, Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
Quelle: BLW, Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
■ Umweltschonende Bewirtschaftung
Verhalten gegenüber der Umwelt
Seit 1999 ist das Erfüllen des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen Die frühere integrierte Produktion (IP) und der BioLandbau erfüllen dessen Kriterien.

Entwicklung des Anteils der Fläche mit umweltschonender
Die Anzahl der Betriebe mit umweltschonender Bewirtschaftung, nahmen von 1993 bis 2000 von 11'000 auf 57‘000 zu Die Anzahl der Biobetriebe, die vom Bund mit Direktzahlungen besonders gefördert werden, erhöhte sich in der gleichen Zeitperiode von 1'200 auf 5'000 Einheiten Der Anteil der LN, die 2000 nach den ÖLN-Anforderungen bewirtschaftet wurde, ist praktisch gleich hoch wie 1999 Die vom Bund mit Direktzahlungen geförderte Fläche des Biolandbaus betrug 2000 rund 8%
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 99 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Landwirtschaft-Mensch-Umwelt-System Belebte und unbelebte Natur Mensch 1 3 Verhalten gegenüber der Umwelt 4 5 2 Landwirtschaft
flächendeckend
fast
i n % d e r L N umweltschonende
davon Bio Quelle: BLW 1 1993 bis 1998: IP+Bio, ab 1999: ÖLN 1993 1994 1995 1999 2000 1997 1998 1996 0 100 80 60 40 20
Bewirtschaftung
Bewirtschaftung1
■ Regionale Unterschiede beim Biolandbau
Betriebe, die biologischen Landbau betreiben, sind vor allem im Berggebiet gut vertreten Eine Spitzenposition nimmt dabei der Kanton Graubünden ein Auffallend ist der geringe Anteil an biologisch bewirtschafteten Flächen im Mittelland und besonders in der Westschweiz.
Biologisch bewirtschaftete Fläche 2000
■ Landwirtschaftlich genutzte Flächen unter Druck
Die aktuelle Bodennutzung und ihre Entwicklung werden vom Bundesamt für Statistik (BFS) mittels der Arealstatistik verfolgt Für die letzten beiden Erhebungen (1979 bis 1985 und 1992 bis 1997) wurden Luftaufnahmen verwendet. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen setzen sich zusammen aus den Nutzflächen für Obst-, Reb- und Gartenbau, dem Wies- und Ackerland sowie den Heimweiden und den alpwirtschaftlich genutzten Flächen Die Definition in der Arealstatistik unterscheidet sich wesentlich von derjenigen in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung Dort zählen insbesondere die alpwirtschaftlich genutzten Flächen nicht zur LN Diese bilden als Sömmerungsweiden eine eigene Kategorie
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 100
1 P
Fläch
in % der LN 1 0 <10 10–19,9 20–29,9 ≥30 Sömmerungsgebiet
Quelle: BLW, Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
ro Gemeinde, ha biologisch bewirtschaftete
e dividiert durch ha LN
Entwicklung der landwirtschaftlich genutzten Fläche
Mit einem Anteil von 36,9% des schweizerischen Territoriums sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen die dominierende Bodennutzung, wenn auch ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen ist: Gemäss Arealstatistik sanken die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Zeitraum von 1979/85 bis 1992/97 um 3,1% In der Periode 1979/85 betrug diese Fläche 1,57 Mio ha bzw 2‘500 m2 pro Kopf der Wohnbevölkerung. 1992/97 waren es noch 1,52 Mio. ha bzw. 2‘200 m2 pro Einwohner.
Übergang netto landwirtschaftlich genutzter Flächen in andere Nutzungen 1979/85 bis 1992/97 (ohne Alpwirtschaftsflächen)

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 101 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
BFS –1,9 % –2,2 % –6,0 % –10,0 % –2,8 % –3,0 %
Quelle:
i n h a
areal In
e
al Besondere S
edlungsflächen Erholungs- und Grünanlagen Verkehrsflächen Alpwirtschaftsflächen Gehölze Wald Unproduktive Flächen Quelle: BFS 0 2 0001 5 9 1 23 2 3 03 1 3 04 3 5 1 1 1 4 31 3 4 61 0 0 35 5 51 9 3 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 -12 000 -14 000 -16 000 -18 000
Gebäude
dustri
are
i
Übergang von Alpwirtschaftsflächen in andere Nutzungen
1979/85 bis 1992/97
Während in den bevorzugten Lagen ein Wettstreit um den Boden besteht, sind weite Teile der Alpwirtschaftsflächen sowohl nördlich als auch südlich der Alpen von einem regional unterschiedlich starken Rückgang der landwirtschaftlichen Bodennutzung betroffen Insgesamt belief sich der Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Betrachtungszeitraum auf rund 50'000 ha. Bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen ohne die Alpwirtschaftsflächen waren es 31'500 ha Diese wurden zu 94% für Siedlungszwecke umgenutzt Der Rückgang bei den Alpwirtschaftsflächen ist dagegen in erster Linie auf die Verbuschung des Kulturlandes zurückzuführen.
Die Konsumentinnen und Konsumenten haben mit ihren Kaufentscheiden einen Einfluss auf das Angebot Sie können damit auch auf die Produktionsweise einwirken Die Beobachtung der Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten liefert wichtige Hinweise zum Konsumverhalten
Als Grundlagen für Aussagen in diesem Bereich werden herangezogen:
– die repräsentative Umfrage des Institutes für Sozialversicherung und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Basel, die alle drei Jahre im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheitswesen (BAG) durchgeführt wird;
– die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Univox, die jährlich über das Konsumverhalten gemacht wird;
eine repräsentative Befragung der BIO SUISSE bei 500 Konsumentinnen und Konsumenten

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 102
–
i n h a Verkehrsfläc
Übrige Siedlun
Landwirtschaftsflächen (Talgebiet) Gehölze Wald Gebüsch, Strauchvegetation Unproduktive Vegetation Vegetationslose Flächen, Gewässer Quelle: BFS 0 2 000 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 0006 9 55 5 81 1 4 32 1 9 63 6 5 58 5 6 71 4 0 1 3 5 5 ■ Konsumverhalten
hen
gsflächen
Konsumenteneinfluss auf die Landwirtschaft
Quelle: ISPM / IHA · GfM
Gemäss der Umfrage des ISPM glauben 55% der Befragten, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die Art und Weise der landwirtschaftlichen Produktion sehr stark bzw ziemlich stark beeinflussen können Nur knapp 7% glauben nicht daran
Beachtung der Produktionsweise beim Einkauf
Trotz des Bewusstseins, dass die Gestaltung der schweizerischen Landwirtschaft vom Konsumverhalten abhängt, achten beim Einkauf nur knapp ein Viertel immer bzw meistens darauf, wie die Lebensmittel produziert wurden
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 103 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
gar nicht 7% sehr stark / ziemlich stark 55% kaum 22% weiss nicht 16%
GfM immer / meistens 24% selten 21% nie 26% manchmal 29%
Quelle: ISPM / IHA ·
Die im Auftrag der BIO SUISSE durchgeführte Befragung ergab, dass der Anteil derjenigen Konsumentinnen und Konsumenten, die immer bzw meistens auf die Herkunft der Lebensmittel achten, bei 34% liegt Daraus kann geschlossen werden, dass die Herkunft der Lebensmittel beim Einkaufsverhalten eine etwas höhere Bedeutung hat als die Produktionsweise Insgesamt scheinen Produktionsweise und Herkunft beim Kaufentscheid aber nur bei 30% der Konsumentinnen und Konsumenten eine wesentliche Rolle zu spielen
Eine wichtige Voraussetzung, dass gezielt und bewusst eingekauft werden kann, ist die Information bzw das Wissen der Konsumentinnen und Konsumenten über die Kennzeichnung der Agrarprodukte
bei Bio-Kennzeichnungen
Bei der Umfrage der BIO SUISSE nannten 35% die Migros-Bio-Produktion, 33% Coop Naturaplan und 18% die BIO SUISSE Knospe als ihnen bekannte Bio-Lebensmittellabel 10% der Befragten gaben
keine Bio-Label zu kennen
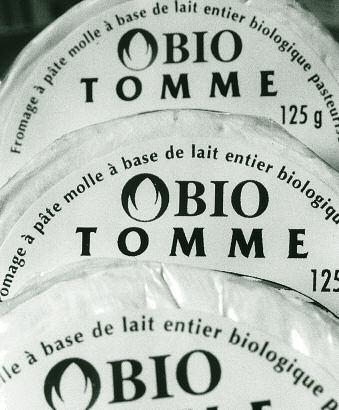
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 104
an,
Beachtung der Herkunft beim Einkauf
immer / meistens 34% selten 18% nie 19% manchmal 29% Kenntnisstand
M i g r o sB i oP r o d u k t i o n C o o p N a t u r a p l a n M i g r o sS a n oP r o d u k t i o n B I O S U I S S E K n o s p e N a t u r a L i n e C o o p N a t u r a B e e f A g r i N a t u r a K A G F r e i l a n d F i d e l i oB i o f r e i l a n d Quelle: BIO SUISSE / IHA GfM 0 40 35 30 25 20 15 10 5 i n %
Bio-Label zu wenig bekannt
Quelle: BIO SUISSE / IHA · GfM
■
■ Produktion und Konsumentenwünsche stimmen gut überein
Die Univox-Umfrage zeigt, dass rund 80% der Befragten der Ansicht sind, die Mehrheit bzw die grosse Mehrheit der Landwirte und Landwirtinnen seien bestrebt, das zu produzieren, was die Konsumentin und der Konsument wünschen

Übereinstimmung der landwirtschaftlichen Produktion mit den Konsumentenwünschen
Minderheit/ kleine Minderheit
17%
weiss nicht/keine Antwort 3%
Mehrheit/ grosse Mehrheit 80%
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 105
Quelle: Univox
■
Verhalten gegenüber den Tieren, Tierwohl
Tierhaltungsprogramme RAUS
Mit den beiden Tierhaltungsprogrammen «Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme» (BTS) und «Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien» (RAUS) soll die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere gefördert werden. Im BTS-Programm werden vor allem qualitative Anforderungen an den Liegebereich gestellt Das RAUS-Programm enthält hauptsächlich Bestimmungen zum Auslauf auf der Weide bzw im Laufhof oder im Aussenklimabereich beim Geflügel Die Teilnahme an einem solchen Programm ist freiwillig
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 106
Seit der Einführung von RAUS (1993) und BTS (1996) nahm die Beteiligung an beiden Programmen stetig zu: So hat sich die Beteiligung an RAUS von 1993 bis 2000 mehr als versechsfacht (von rund 4'500 auf 30‘000 Betriebe) und diejenige am BTS in den fünf ersten Jahren fast verdreifacht (von knapp 4'500 auf rund 13'000 Betriebe). und BTS
Belebte und unbelebte Natur Mensch 1 3 4 Verhalten gegenüber den Tieren Tierwohl 5 2 Landwirtschaft Entwicklung der Beteiligung bei RAUS und BTS G V EA n t e i l i n % RAUS BTS Quelle: BLW; Basis bis 1998 BFS, ab 1999 AGIS 1993 1994 1995 1999 2000 1997 1998 1996 0 50 60 30 40 20 10
Landwirtschaft-Mensch-Umwelt-System
Gemessen am gesamten schweizerischen Nutztierbestand betrug der Anteil der GVE, die an RAUS oder BTS teilnahmen, bei der Einführung je 7% Im Jahr 2000 beteiligten sich bereits 51% an RAUS und 23% an BTS Da die Beteiligung der Nutztiere stärker ansteigt als die Betriebsbeteiligung, scheinen vermehrt grössere Betriebe an den beiden Programmen teilzunehmen
Entwicklung der Beteiligung bei RAUS nach Nutztierkategorie
Bei RAUS nahm die Beteiligung bei allen Nutztierkategorien deutlich zu Im Jahr 2000 nahmen über 51% der Bestände von Rindvieh und übrigen Raufutter-Verzehrern am Programm teil Beim Geflügel lag der Anteil bei 43% Bei den Schweinen war er mit 28% am tiefsten Dies ist vor allem zurückzuführen auf die oft sehr hohen Investitionen einerseits und den relativ geringen Druck vom Markt her anderseits

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 107
G V EA n t e i l i n %
Rindvieh
Verzehrer Gefl
el Schweine 1993 1994 1995 1996 1997 19981999 2000 0 10 20 30 40 50 60 70 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Quelle: BLW; Basis bis 1998 BFS, ab 1999 AGIS
übrige Raufutter
üg
Entwicklung der Beteiligung bei BTS nach Nutztierkategorie
Beim BTS-Programm sticht die hohe Beteiligung des Geflügels heraus Im Jahr 2000 wurde beinahe zwei Drittel des Geflügels in nutztierfreundlichen Ställen gehalten Der Hauptgrund dafür ist, dass der Druck vom Markt für diese Haltungsform gross ist Bei vielen Labels werden die BTS-Anforderungen der Direktzahlungsverordnung als Grundvoraussetzung vorgeschrieben. Die Tierkategorien Rindvieh, übrige RaufutterVerzehrer und Schweine waren mit kleineren Anteilen vertreten Das BTS-Programm für Schweine wurde erst 1997 eingeführt Die Entwicklung ist auch dort erfreulich Die Beteiligung liegt mit fast einem Drittel zwar deutlich hinter dem Geflügel zurück, gegenüber dem Einführungsjahr werden aber drei Mal mehr Schweine in BTS-Ställen gehalten
Ein Ziel von wissenschaftlichen Untersuchungen der Tierhaltungsprogramme ist es, deren Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlergehen der Nutztiere unter Praxisbedingungen aufzuzeigen Die Untersuchungen fanden vorerst bei Milchkühen statt, da diese zu den wirtschaftlich bedeutendsten Tierarten zählen.

Für jede Tierkategorie wurden Indikatoren für Gesundheit und Wohlergehen zu Hilfe genommen, die sich unter Feldbedingungen in einem vernünftigen Zeitaufwand messen lassen und die bei wiederholter Messung vergleichbare Ergebnisse liefern
Bei den Milchkühen wurden als Indikatoren die Beurteilung von Lahmheit in der Bewegung, die Einzeltieruntersuchung auf Veränderungen an den Sprunggelenken, Hautverletzungen, Zitzenverletzungen, Liegeschwielen, Sauberkeit und Körperkondition, das Verhalten beim Aufstehen und Einschränkungen beim Liegen sowie die Anzahl Behandlungen durch den Tierarzt oder Landwirt verwendet Es wurden 45 Betriebe ohne Tierprogramm, 45 RAUS-Betriebe und 45 Betriebe, die sich an den beiden Programmen BTS und RAUS beteiligen, im Laufe von zwei Jahren (1999, 2000) dreimal besucht
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 108
G V EA n t e i l i n %
Rindvieh
Ge
1996 1997 19981999 2000 0 70 50 60 40 30 20 10
Quelle: BLW; Basis bis 1998 BFS, ab 1999 AGIS
übrige Raufutter Verzehrer
flügel Schweine
■ Erhöhtes Tierwohl in RAUS- und BTSProgrammen
Die Untersuchungen zeigen, dass nicht bei allen Indikatoren signifikante Unterschiede zwischen den drei Varianten festgestellt werden konnten Signifikant sind die Unterschiede bezüglich der Indikatoren Lahmheit, Veränderung der Sprunggelenke, Liegeschwielen und Anzahl Behandlungen. Die Tierprogramme erhöhen hier das Tierwohl deutlich Besonders günstig wirkt sich dabei die Kombination RAUS und BTS aus Letztere schneidet auch bezüglich der Anzahl von Behandlungen der Tiere resp dem Antibiotikaeinsatz am besten ab. Zwei Behandlungen pro zehn Kühe und Jahr, davon eine mit Antibiotika, bei Betrieben mit BTS und RAUS stehen sechs Behandlungen pro zehn Kühne und Jahr, davon fünf mit Antibiotika, bei Betrieben ohne Tierhaltungsprogramme gegenüber
RAUS-Betriebe unterscheiden sich von Betrieben ohne Programm vor allem durch vermehrten Auslauf im Winter Dies hat laut Untersuchungsergebnissen einen positiven Einfluss Die Milchkühe gehen weniger lahm

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 109
i n % Quelle:
Lahmheit V
Liegeschwielen Ohne Programm RAUS BTS+RAUS 1999 2000 1999 2000 1999 2000 0 70 50 60 40 30 20 10
Tierwohl bei Milchkühen mit
und ohne
Beteiligung an RAUS und BTS
BLW
eränderung Sprunggelenke
1.3.2 Spezifische
Energieverbrauch für die Milchproduktion
Das BLW hat die Umweltwirkungen der Landwirtschaft bei der Erzeugung verschiedener Produkte mit Hilfe einer vereinfachten Ökobilanz untersuchen lassen Die Untersuchungen erstreckten sich über 52 Betriebe unterschiedlicher Produktionsrichtung und Zonen An der Studie waren die Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), die Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT), der Service romand de vulgarisation agricole (SRVA), die landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL) und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) beteiligt.
Der Verbrauch an nicht erneuerbarer Energie für die Milchproduktion variiert von Betrieb zu Betrieb sehr stark Die Betriebe mit dem tiefsten Verbrauch von Energie je kg Milch setzen diese rund drei Mal effizienter ein als jene mit dem höchsten Verbrauch Um 100 Liter Milch zu produzieren wird im Durchschnitt Energie eingesetzt, die 16 Liter Dieselöl entspricht Gegen 50% des Energieverbrauchs gehen auf das Konto der «grauen» Energie (Gebäude, Maschinen). Die Analyse der untersuchten Betriebe zeigt, dass für das Ergebnis weder die Grösse der Herde noch die Zone, in der Milch produziert wird, entscheidend ist Wichtiger ist, wie die Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen ihre Produktionsmittel einsetzen. Hier kann die Beratung ansetzen und aufzeigen, wie z B mit einem optimierten Einkauf von Maschinen und deren effizienten Einsatz (z B gemeinsame Nutzung mit anderen Betrieben) nicht nur Energie, sondern auch Geld gespart werden kann

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 110 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Themen
Energieverbrauch je kg Milch 1998 M JÄ q u i v a l e n t / k g M i l c h k g M i l c h / K u h Quelle: FAL Betriebsnummer Gebäude Saatgut Maschinen zugekaufte Futtermittel Energieträger weitere Impulse Dünger Milchproduktion pro Kuh 3 1 1 7 3 2 1 0 3 0 2 4 3 5 2 3 2 2 2 7 2 8 9 2 9 1 4 3 1 6 1 9 2 6 1 1 8 1 3 3 4 1 2 2 1 5 5 4 7 6 1 8 1 2 0 2 5 2 1 3 3 D u r c hs c h n i t t 0 14 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 10 12 6 8 4 2 Pestizide
■ Grosse Unterschiede beim Energieaufwand
Schwermetallbelastung von Klärschlamm noch nie so gering
Beurteilung der Verwendung von Abfalldüngern
Im landwirtschaftlichen Pflanzenbau werden Abfälle als Dünger (insbesondere Klärschlamm, Kompost sowie Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie) eingesetzt. Die Rückführung von biogenen Abfällen in den Stoffkreislauf schont den Abbau beschränkter Ressourcen, wie beispielsweise die weltweiten Reserven an Phosphat Die Verwendung von Abfalldüngern ist jedoch mit einer Belastung der Umwelt mit Schadstoffen und einem Marktrisiko verbunden Ein von der Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau Zürich-Reckenholz (FAL) durchgeführtes Projekt hatte zum Ziel, die Umweltverträglichkeit und den pflanzenbaulichen Nutzen von Abfalldüngern zu beurteilen Eingebettet in dieses Projekt wurde das Risiko der Abfalldünger analysiert
Bei den Risiken sind vor allem der Eintrag von Schwermetallen und organischen Schadstoffen in den Boden und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die terrestrischen Ökosysteme zu nennen Zusätzlich ist der Eintrag von Pathogenen in die Umwelt zu beurteilen Von Bedeutung ist auch das Marktrisiko Es besteht darin, dass die Konsumenten und Konsumentinnen mit ihrem Kaufverhalten indirekt einen Einfluss auf die Verwendung von Abfalldüngern ausüben können
Die Schwermetallbelastung von Klärschlamm hat sich seit den achtziger Jahren laufend deutlich verringert Inzwischen liegt der Gehalt der meisten Schwermetalle mehr als die Hälfte unter dem gesetzlichen Grenzwert Wesentlich zu dieser Verbesserung beigetragen haben die Sanierung von Punktquellen (Industrie) wie auch die Einschränkungen z B bezüglich der Verwendung von Cadmium und die Einführung des bleifreien Benzins
Die Schwermetallbelastung von Kompost und jene von Tiermehl und Nahrungsabfällen liegt im Mittel ebenfalls mehr als 50% unter dem Grenzwert, während die Inhaltsstoffe der Holzasche die Grenzwerte für Nickel und Cadmium teils überschreiten
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 111 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Entwicklung der Schwermetallgehalte im Klärschlamm i n % 1 CdCu Pb Zn Quelle: FAL 1 in % der Grenzwerte aus der Soffverordnung Hg 0 50 100 150 200 1975 1980 1984 1989 1994 1999
■
Bezüglich der Belastung der Abfalldünger durch organische Schadstoffe bestehen erhebliche Wissenslücken Dies ist bedingt durch die enorme Vielfalt dieser Stoffgruppe Die am besten bekannten, schwer abbaubaren Schadstoffe sind die toxischen und teils kanzerogenen Gruppen der polychlorierten Biphenyle (PCB), der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) und der Dioxine Deren Gehalt im Klärschlamm wird nicht routinemässig gemessen, ist aber aufgrund von Studien bekannt Der Eintrag dieser Stoffe aus Klärschlamm in den Boden führt gemäss Studien nicht zu einer Gesundheitsgefährdung für den Menschen, da die Aufnahme durch Pflanzen sehr gering ist Die Belastung des Menschen mit Dioxin hat aber nach Angaben des BAG bereits einen maximal tolerierbaren Grenzwert erreicht Zusatzbelastungen müssen somit verhindert werden Lückenhaft ist auch die ökotoxikologische Beurteilung von organischen Schadstoffen.
Ein Risiko durch Viren und Bakterien besteht praktisch nur, wenn die geltenden Hygienisierungsvorschriften nicht eingehalten werden.
Das Marktrisiko ist durch die zunehmende Risiko-Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten gestiegen Dieses Risiko wird alleine durch die Landwirtschaft getragen, das heisst durch die einzelnen Verwender von Abfalldüngern Schwierig abzuschätzen ist das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten. Ihre Reaktionen gegenüber vergleichbaren objektiven Risiken sind sehr unterschiedlich
Phosphor in Gewässern durch Abschwemmungen aus Grasland
Die wichtigsten landwirtschaftlichen P-Eintragspfade in die Gewässer sind Abschwemmungen aus dem Grasland und die Bodenerosion von Ackerland. Im Einzugsgebiet des Lippenrütibaches (LU) wurde die Wirkung der Ökomassnahmen auf die P-Belastung der Gewässer flächendeckend untersucht Dabei wurden auf 270 Schlägen Daten zum Standort, zur Bewirtschaftung und zum Düngeraustrag erhoben und in einen kausalen Zusammenhang zu den Messungen im Bach gestellt Die Federführung für dieses Projekt liegt bei der Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau ZürichReckenholz (FAL)

Auswertungen des Jahres 1998 ergaben eine Verminderung der P-Belastungen im Bach um 55% gegenüber derjenigen zu Beginn der neunziger Jahre Aufgrund der Niederschlagsverhältnisse 1998 ist jedoch auf der Basis von Modellrechnungen davon auszugehen, dass nur rund 20% dieses Rückgangs auf Veränderungen bei Bewirtschaftung und Düngung zurückzuführen sein dürften Die P-Belastung wäre damit 1998 13% tiefer als in der Referenzperiode 1988/92 vor der Einführung der Ökomassnahmen.
Die ersten Ergebnisse dieses Projektes zeigen auf, dass Stärke und Zeitpunkt der Niederschläge einen entscheidenden Einfluss auf die Abschwemmungen ausüben Gesichertere Aussagen können daher erst dann vorgenommen werden, wenn für die Analyse und Interpretation längere Zeitreihen zur Verfügung stehen.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 112
Phosphor in Gewässern durch Bodenerosion
In der Region Frienisberg (BE) werden Zusammenhänge zwischen den Ökomassnahmen und der P-Belastung der Gewässer durch Bodenerosion untersucht. Dieses Projekt wird ebenfalls von der FAL betreut
Die im Feld gemessenen Bodenabträge haben in der Periode 1998/99 gegenüber 1987/89 um rund 22% und die P-Einträge in die Gewässer um 27% zugenommen. Hierfür sind allerdings die ausserordentlich starken Regenfälle in der Periode 1998/99 verantwortlich
Gemäss Modellberechnungen haben sich zwischen 1987/89 und 1998/99 die langjährige Erosionsgefährdung um 27% und die P-Belastung der Gewässer durch Bodenerosion um 22% vermindert; dies ist in erster Linie auf Veränderungen der Fruchtfolgen und Bewirtschaftungsverfahren zurückzuführen So hat sich der Anbau von Zwischenfrüchten von 11 auf 25% mehr als verdoppelt, und der Anteil konservierender Bodenbearbeitungsverfahren (Direkt-, Streifenfräs- oder Mulchsaat) hat von 0 auf 14% zugenommen Konservierende Bodenbearbeitungsverfahren haben deutlich geringere Bodenerosion zur Folge
Auch bei diesem Projekt zeigt sich der starke Zusammenhang zwischen P-Einträgen in die Gewässer und der Stärke und dem Zeitpunkt der Niederschläge Die Kartierungen und Modellberechnungen werden bis zum Jahr 2005 fortgesetzt, um zu gesicherten Ergebnissen zu gelangen und die weitere Entwicklung aufzeigen zu können.

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 113 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Sreifenfrässaat Mulchsaat
Verfahren Pflug t / h a u n d J a h r flächenhaft linear Quelle: FAL 1 Messungen im Gebiet Frienisberg 1998/99 0,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
Bodenerosion bei unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren1
Direktsaat/
Restliche pfluglose
Biodiversität: «Rebhuhn» Projekt
Die Schweizerische Vogelwarte Sempach startete 1991 mit einem 10-jährigen Projekt, welches zum Ziel hatte, Erfahrungen mit der Umsetzung des ökologischen Ausgleichs zu sammeln und bedrohte Vogelarten der offenen Feldflur, insbesondere das Rebhuhn, sowie den Feldhasen zu fördern

Die Wahl der Untersuchungsregionen Champagne genevoise (GE) und Klettgau (SH) für das Teilprojekt «Rebhuhn» war begründet durch das dortige Vorkommen der letzten Rebhühner der Schweiz
Für das Rebhuhn als wichtigste Zielart kam die Lebensraumaufwertung im Klettgau zu spät Kurz nach Projektbeginn verschwanden die letzten Individuen In der Champagne genevoise liess sich zwar der rasante Rückgang bremsen, doch nahm der isolierte Bestand bis auf wenige Individuen ab.
Seit 1998 laufen im Klettgau (im Gebiet Widen) auf einer Fläche von 4,3 km2 wissenschaftlich begleitete Aussetzungsversuche Die ersten Resultate zeigen, dass Rebhühner die neu geschaffenen Brachen intensiv nutzen und von der Aufwertung der Ackerlandschaft profitieren. Analoge Auswirkungen lassen sich für einige typische Brutvogelarten der offenen Feldflur nachweisen
Bestandesentwicklung ausgewählter Brutvögel im Klettgau (SH)
Quelle: Schweizerische Vogelwarte
In der Champagne genevoise mit ihrem milden, trockenen Klima reagierten einige Brutvogelarten im stark aufgewerteten und vernetzten Gebiet um Laconnex (6,1 km2) mit einer starken Bestandeszunahme Das Schwarzkehlchen nahm von 11 Paaren 1991 auf 49 Paare 1999 zu Die Dorngrasmücke besetzte 1991 sechs Reviere, 1999 waren es 62 Der Grauammerbestand erhöhte sich von zwei auf maximal 36 Reviere. Für die Wachtel konnten im Wachteljahr 1997 mit zehn schlagenden Hähnen pro km2 sehr hohe Dichten ermittelt werden Ihre Bestandesentwicklung ist allerdings wegen des invasionsartigen Auftretens der Art in Mitteleuropa schwierig zu interpretieren. Vor allem seit 1995 siedelten sich Orpheusspötter vermehrt in den Brachstreifen an (1995 13, 1999 38 Reviere)
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 114
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Rebhuhn 42000003 1 4 1 Wachtel 2 10 11 17 16 8 34 26 13 Kiebitz 321400000 Feldlerche –2 –2 –2 –2 150 130 167 198 182 Grauammer 3577987 10 8 1 ausgesetzte Vögel 2 nicht aufgenommen
In den stark aufgewerteten Flächen Laconnex (GE) und Widen (SH) entwickelten sich die Bestände von Grauammer und Wachtel im Zeitraum von 1991 bis 1999 sehr ähnlich, wobei in der Champagne genevoise höhere Dichten erreicht wurden als im Klettgau. Aus den gesamtschweizerischen Daten der Schweizerischen Vogelwarte Sempach lassen sich für die erwähnten Arten hingegen keine analogen Bestandesentwicklungen feststellen Im Gegensatz zur Champagne genevoise kam es im Klettgau nur in sehr geringem Mass zur Ansiedlung von Schwarzkehlchen und Dorngrasmücken Unterschiede in der Entwicklung der Bestände in den beiden Untersuchungsregionen lassen sich mit der Verschiedenartigkeit der Habitatstruktur der Gebiete und mit unterschiedlichen Verbreitungsschwerpunkten der Arten erklären Positiv auf die Aufwertung und Vernetzung des Kulturlandes mit linearen Saumbiotopen reagierten auch die in Staudensäumen und Hecken brütenden Arten Sumpfrohrsänger und Neuntöter
Zu Beginn der achtziger Jahre war das Rebhuhn im gesamten Kanton Genf noch relativ weit verbreitet 1996 besiedelte es nur noch die im Rahmen des Rebhuhnprojekts stark ökologisch aufgewertete Fläche bei Laconnex.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 115
A n z a h l A n t e i l B u n t b r a c h e p r o L N i n % Quelle: Schweizerische Vogelwarte Schwarzkehlchen Orpheusspötter Dorngrasmücke Grauammer 199019911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 0 70 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 50 60 30 40 20 10 Anteil Buntbrache je ha LN
Bestandesentwicklung ausgewählter Brutvögel im Laconnex (GE)
Das Projekt der Vogelwarte Sempach zeigt, dass einige bedrohte Brutvogelarten der offenen und halboffenen Feldflur mit Massnahmen des ökologischen Ausgleichs entscheidend gefördert werden können, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
– die Ausgleichsflächen sind botanisch arten- und strukturreich (z.B. eingesäte und spontan begrünte Buntbrachen);
– mindestens 5% der LN sind ökologisch wertvoll;
– die Aufwertungsflächen bilden zusammen mit bestehenden Strukturen ein zusammenhängendes Netz wertvoller Lebensräume
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 116
1989 1993 1996 1977– 82
Entwicklung der Verbreitung des Rebhuhns im Kanton Genf
1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit
An der UNO-Konferenz von Rio über Umwelt und Entwicklung von 1992 wurden Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet Der Bundesrat hat 1997 eine erste Nachhaltigkeitsstrategie für die Schweiz genehmigt Mit der Zustimmung von Volk und Ständen zur neuen Bundesverfassung, die sich ausdrücklich und im umfassenden Sinn zur nachhaltigen Entwicklung bekennt, wurde 1999 eine wichtige Basis für den Einbezug von Nachhaltigkeitsüberlegungen in allen Politikbereichen geschaffen Bereits seit 1996 ist das Prinzip der Nachhaltigkeit im Verfassungsartikel über die Landwirtschaft verankert
Die Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sieht vor, dass das BLW im Agrarbericht die Resultate der Untersuchungen einer Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unterzieht. Das heisst, dass die ökonomische, soziale und ökologische Lage der Landwirtschaft und die Auswirkungen der Agrarpolitik aufgezeigt und beurteilt werden sollen Im ersten Agrarbericht wurde diese Beurteilung in Form von qualitativen Aussagen vorgenommen
In diesem Bericht wird die Beurteilung wiederum vorwiegend mit qualitativen Aussagen gemacht (Abschnitt 1 4 1) Zusätzlich wird ein Konzept präsentiert, wie die Entwicklung künftig mit ausgewählten quantitativen Indikatoren beurteilt werden soll (Abschnitt 1.4.2).
Die konzeptuelle Grundidee ist ähnlich derjenigen, die dem Bericht «Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven» zugrundeliegt Dieser Bericht wurde im Auftrag des Interdepartementalen Ausschusses Rio (IDARio) als Grundlage für die Überarbeitung der Bundesratsstrategie aus dem Jahr 1997 verfasst Die Arbeiten im Rahmen des Projektes «Monet» (ein Projekt BFS/BUWAL, mit dem ein Monitoring der nachhaltigen Entwicklung aufgebaut werden soll), gehen ebenfalls von ähnlichen Definitionen aus. Dieselbe Konzeption findet sich auch in einem Arbeitspapier der EU-Kommission über nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft, welches im Februar 2001 veröffentlicht wurde
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 117 ■■■■■■■■■■■■■■■■
1.4.1 Aktuelle Beurteilung der Nachhaltigkeit
Im vorliegenden Agrarbericht wird das Konzept beschrieben, nach dem in Zukunft die Lage der Landwirtschaft aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit auf der Basis von quantitativen Indikatoren periodisch beurteilt werden soll (vgl Abschnitt 1 4 2) Für das Jahr 2000 wird nachfolgend die Nachhaltigkeit auf der Basis von Daten aus den Teilbereichen Ökonomie, Soziales und Ökologie dargestellt
Das Jahr 2000 war im Marktbereich dank ausgewogenem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage besser als das Vorjahr Sowohl der Pflanzenbau wie auch die Tierhaltung trugen zu einer um 5% höheren Endproduktion bei. Der Preiszerfall auf dem Schlachtviehmarkt von Ende Jahr als Folge des Auftretens von BSE-Fällen in Frankreich und Deutschland beeinflusste das gesamthaft gute Ergebnis nicht mehr entscheidend.
Die Zentrale Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT zeigt, dass die 25% der Betriebe mit den besten wirtschaftlichen Ergebnissen im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 einen Arbeitsverdienst erzielten, welcher mit der übrigen Bevölkerung vergleichbar ist. In der Tal- und Hügelregion lagen die entsprechenden Werte über dem Vergleichslohn, in der Bergregion darunter
Im Mittel der Jahre 1998/2000 wiesen 30% der Betriebe eine negative Eigenkapitalbildung aus Eine Analyse der FAT über die Stabilität der Quartilseinteilung kommt zum Schluss, dass es sich nicht Jahr für Jahr um dieselben Betriebe handelt Im untersten Quartil z B verharrten über die Jahre 1997 bis 1999 weniger als die Hälfte der Betriebe Die Anzahl der Betriebe, die längerfristig eine negative Eigenkapitalbildung aufweisen, dürfte deshalb um einiges unter 30% sein. Trotzdem ist aufgrund der Eigenkapitalbildung der Betriebe im ersten und zweiten Quartil davon auszugehen, dass rund bei einem Drittel der Betriebe die Basis für die längerfristige Sicherung der betrieblichen Existenz nicht gegeben oder ungenügend ist.
Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe hat zwischen 1990 und 2000 um rund 22'000 Einheiten (-24%) abgenommen Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Betriebe mit einer LN bis 10 ha (89%) resp um Kleinbetriebe bis 3 ha (50%) Dieser Sachverhalt weist darauf hin, dass der Umbau der Agrarstützung in Richtung einer vermehrten Leistungsabgeltung mit Direktzahlungen den Strukturwandel bei kleinen Betrieben nicht entscheidend gehemmt hat
Die wirtschaftliche Lage der Schweizer Landwirtschaft ist im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 nicht wesentlich schlechter als in den Jahren 1990/92 Die Gesamteinkommen sind zwar um 4% tiefer, die Mehrzahl der Betriebe kann aber nach wie vor genügend Eigenkapital bilden, um die betriebliche Existenz zu sichern Das Verhältnis von Cashflow zu Investitionen war mit 95% (1990/92) resp 94% (1998/2000) praktisch unverändert Der Verschuldungsgrad war in den Jahren 1998/2000 gegenüber 1990/92 gar leicht rückläufig
Gesamteinkommen und Privatverbrauch von landwirtschaftlichen Haushalten sind wichtige Grössen für die Beurteilung der sozialen Lage der Landwirtschaft Im Durchschnitt der Jahre 1998/2000 erwirtschaftete das unterste Quartil der Betriebe ein
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 118
■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Ökonomie
■ Soziales
Gesamteinkommen, das die Ausgaben für den Privatverbrauch nicht ganz zu decken vermochte Dies deutet auf eine schwierige wirtschaftliche und soziale Lage hin Auch hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Zusammensetzung des untersten Quartils von Jahr zu Jahr ändert und nur die Hälfte der Betriebe über drei Jahre diesem Quartil zugehört Bei den übrigen drei Quartilen lag das Gesamteinkommen zum Teil deutlich über den Ausgaben für den Privatverbrauch Der Privatverbrauch der Betriebe des untersten Quartils war 1998/2000 tiefer als im Durchschnitt der Jahre 1990/92 Zu jenem Zeitpunkt erzielten diese Betriebe noch ein Gesamteinkommen, das den Privatverbrauch zu decken vermochte Die wirtschaftliche Basis der Betriebe im untersten Quartil zur Befriedigung der Bedürfnisse der Familien hat sich damit verschlechtert Diese Betriebe leben über längere Zeit von der Substanz
Eine im Frühjahr 2001 durchgeführte repräsentative Befragung zur Befindlichkeit der landwirtschaftlichen im Vergleich zur übrigen Bevölkerung zeigt, dass bezüglich der Einschätzung des allgemeinen Lebensstandards die Zufriedenheit in der Landwirtschaft vergleichbar hoch wie in der übrigen Bevölkerung ist Die bäuerliche Bevölkerung ist leicht zufriedener mit der Erwerbsarbeit, der Familie, der Gesundheit und der Ausund Weiterbildung Weniger zufrieden ist sie mit ihrer Einkommenssituation, mit der Stabilität der Rahmenbedingungen und mit der Freizeit

Die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft haben im Vergleich zum Vorjahr weiter zugenommen Gegenüber 1999 nahmen die Anzahl der beitragsberechtigten Biobetriebe um 3%, die ökologischen Ausgleichsflächen um 4%, die GVE beim Tierhaltungsprogramm RAUS um 14% und bei BTS um 17% zu
Die Biobetriebe bewirtschafteten im Jahr 2000 total 8% der LN Im Talgebiet (Ackerbauzonen und Hügelzone) gab es im Jahr 2000 rund 47'000 ha beitragsberechtigte ökologische Ausgleichsflächen. 51% der GVE wurden nach den Regeln des RAUSProgramms gehalten, 23% nach denjenigen des BTS-Programms Das Ziel, dass bis 2005 50% der GVE in einem Tierhaltungsprogramm mitmachen, wurde damit im Berichtsjahr erreicht.
Die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft gingen seit Beginn der neunziger Jahre bis 1998 stark zurück 1999 und 2000 ist eine Stagnation eingetreten Der Mineraldüngerverbrauch ging bis 1998 deutlich zurück Danach hat er sich sowohl 1999 als auch 2000 gegenüber 1998 wieder leicht erhöht Dieselbe Feststellung gilt ebenfalls für den Verkauf von Pflanzenschutzmitteln, gemessen in t aktiver Substanz Zwischen 1990 und 1998 ging der Verkauf um 30% zurück Seither hat er sich auf diesem Niveau stabilisiert. Die N-Überschüsse haben zwischen 1994 und 1998 um 7‘000 t abgenommen Das Ziel, diese bis 2002 um 22'000 t zu reduzieren, wird schwierig zu erreichen sein Die P-Überschüsse gingen zwischen 1990/92 und 1998 von 20'000 auf 9'000 t zurück. Das Ziel, diese bis 2005 um 50% zu reduzieren, wurde damit übertroffen Wie sich die geringeren Belastungen und die gesteigerten Leistungen auf die Boden- oder Wasserqualität, auf das Tierwohl oder die Artenvielfalt auswirken werden, ist Gegenstand laufender Wirkungsanalysen Zwischenergebnisse dieser Projekte zeigen, dass neben der untersuchten Massnahme viele andere Faktoren das Resultat zum Teil wesentlich beeinflussen. Untersuchungen beim P z.B. weisen darauf hin, dass Stärke und Zeitpunkt der Niederschläge einen entscheidenden Einfluss auf die Abschwemmungen ausüben
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 119 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Ökologie
■
1.4.2 Konzept für eine umfassende Beurteilung der Nachhaltigkeit
Konzept der Nachhaltigkeit
Ein Konzept der Nachhaltigkeit muss zukunfts- und ressourcenorientiert sein und umfasst die drei Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie Das Ziel ist, dass künftige Generationen ein Wohlfahrtsniveau erreichen können, das zumindest mit dem heutigen vergleichbar ist Unter Wohlfahrt ist das Wohlbefinden zu verstehen, welches auf der Befriedigung materieller und immaterieller menschlicher Bedürfnisse beruht Damit dies möglich ist, muss den zukünftigen Generationen ein bestimmter Bestand an Ressourcen in einer bestimmten Qualität zur Verfügung stehen Als Ressourcen gelten natürliche Ressourcen, Humanressourcen (Wissen) und reproduzierte Ressourcen (in Anlagevermögen investiertes Geldkapital).
Da die quantitativen und qualitativen Bedürfnisse der zukünftigen Generationen nicht bekannt sind und nicht abgeschätzt werden kann, wie der technische Fortschritt die Ressourcenproduktivität und den Substitutionsgrad zwischen verschiedenen Ressourcen beeinflussen wird, kann heute nicht gesagt werden, wieviele Ressourcen welcher Art zukünftigen Generationen weitergegeben werden müssen Unsicherheiten bestehen insbesondere bezüglich der natürlichen Ressourcen In diesem Bereich ist es angebracht, dem Vorsorgeprinzip einen hohen Stellenwert einzuräumen. Entsprechend sorgsam ist mit den natürlichen Ressourcen umzugehen und gleichzeitig für nicht erneuerbare natürliche Ressourcen aktiv eine Substitution durch erneuerbare natürliche Ressourcen anzustreben Erneuerbare natürliche Ressourcen müssen zudem so genutzt werden, dass sie sich regenerieren können und Humanressourcen (Wissen) sowie reproduzierte Ressourcen müssen aktiv und kontinuierlich erneuert werden. Die Knappheit aller Ressourcen gebietet schliesslich einen effizienten Einsatz
Dies sind notwendige, jedoch noch nicht hinreichende Kriterien für Nachhaltigkeit. Deren Beachtung kann zwar zu einem maximalen Wohlfahrtsniveau führen, sie verhindert jedoch nicht, dass Ungleichgewichte bei der Verteilung eintreten können Ein zentrales Element des Konzepts der Nachhaltigkeit ist deshalb auch eine gerechte Verteilung von Wohlfahrt, nicht nur zwischen der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, sondern auch innerhalb der gegenwärtigen Generation Die gerechte Verteilung innerhalb der gegenwärtigen Generation bezieht sich sowohl auf die Verteilung innerhalb der Schweiz wie auch auf die Verteilung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Ein enger Zusammenhang besteht zwischen der generationsübergreifenden Gerechtigkeit und der Weitergabe einer Kombination von Ressourcen, wobei die erstere ein Ziel und die letztere ein Mittel zum Erreichen dieses Ziels darstellt.

1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
120
■ Ressourcen
Mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung werden folgende Schwerpunkte gesetzt:
Nutzung der natürlichen Ressourcen unter Bewahrung von Mindestbeständen. Substitution von nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen durch erneuerbare natürliche Ressourcen Kontinuierliche Erneuerung aller erneuerbaren natürlichen Ressourcen, der Humanressourcen (Wissen) und der reproduzierten Ressourcen – Effizienz im Transformationsprozess zwischen Inputs und Outputs auf allen Stufen des Leistungserbringungsprozesses – Generationsinterne und generationsübergreifende gerechte Verteilung von Wohlfahrt
Nachhaltige Landwirtschaft
Nachhaltige Entwicklung betrifft uns alle Jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten, gefordert sind aber auch Wirtschaft und Politik Die Landwirtschaft als Sektor kann einen möglichst grossen Beitrag leisten, wenn die Rahmenbedingungen so ausgestaltet sind, dass nachhaltige Entwicklungen möglich sind. Für die Kernthemen Ressourcen, Effizienz und Gerechtigkeit sind dazu folgende Bedingungen notwendig:
Die Rolle der Landwirtschaft kommt im Verfassungsauftrag für die Landwirtschaft (BV Art 104, Abs 1) zum Ausdruck, der von der Landwirtschaft einen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Pflege der Kulturlandschaft und zur dezentralen Besiedlung verlangt Mit diesen Leistungen trägt die Landwirtschaft zur Wohlfahrt der Gesellschaft bei.
Damit die Landwirtschaft diesem Auftrag gerecht werden kann, sind drei Gruppen von Akteuren gefordert:
Landwirtinnen und Landwirte
Die Landwirtinnen und Landwirte müssen sorgfältig mit den natürlichen Ressourcen umgehen, die sie zur Leistungserbringung beanspruchen – die Regenerationsfähigkeit der Umweltressourcen muss erhalten bleiben (Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität) Sie sollen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten ihre reproduzierten Ressourcen in Form von Maschinen und Gebäuden regelmässig erneuern Schliesslich ist es ihre Aufgabe, das notwendige Wissen für eine nachhaltige Bewirtschaftung zu erwerben und es laufend auf den neusten Stand zu bringen
Konsumentinnen und Konsumenten
Das Nachfrageverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten beeinflusst entscheidend die Höhe des Beitrags der Landwirtschaft zur nachhaltigen Entwicklung Das Ernährungsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten muss eine Nachfrage für die Erzeugnisse aus einer nachhaltigen Landwirtschaft schaffen Die Konsumentinnen und Konsumenten müssen eine Präferenz für solche Produkte entwickeln und auch bereit sein, einen entsprechenden Preis zu bezahlen
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
–
121
Staat
Dem Staat kommt eine zweifache Aufgabe zu Einerseits muss er sich international für nachhaltige Entwicklungspfade einsetzen, andererseits muss er national Rahmenbedingungen schaffen respektive erhalten, die es der Landwirtschaft ermöglichen, einen maximalen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten
International koordiniertes staatliches Handeln muss anstreben, dass die externen Kosten in die Endpreise der Produkte und Dienstleistungen aller Wirtschaftszweige einbezogen werden Eine derartige Internalisierung ist für die Landwirtschaft doppelt wichtig: Erstens würde sie eine Abnahme des Drucks der anderen Wirtschaftszweige auf die von der Landwirtschaft mitverwendeten natürlichen Ressourcen bedeuten (Luft, Wasser, Boden, Biodiversität). Zweitens würde sie bewirken, dass auch die Preise importierter Konkurrenzprodukte ihre wahren Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebskosten enthalten Damit würde sich die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft verbessern und der Druck auf die natürlichen Ressourcen abnehmen.
Auf nationaler Ebene hat der Staat dafür zu sorgen, dass die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft, die nicht vom Markt entschädigt werden, abgegolten werden Ein Beispiel dafür ist die Kulturlandschaftspflege, die einen direkten Nutzen bei der heutigen Generation stiftet, gleichzeitig aber auch ein Erbe für zukünftige Generationen darstellt Zusatzkosten, die durch Produktionsweisen entstehen, die die natürlichen Ressourcen schonen, müssen vom Staat entschädigt werden, solange die Internalisierung der externen Kosten nicht voll verwirklicht ist. Dazu kann auch der Grenzschutz einen Beitrag leisten Der Grenzschutz erlaubt es, dass in der Schweiz über dem Niveau des Weltmarktes liegende Produzentenpreise erzielt werden können Die Entschädigungen über direkte Zahlungen und Preise müssen sicherstellen, dass die Landwirtschaft bei effizientem Einsatz der Produktionsfaktoren eine dem Schweizer Durchschnitt angemessene Entschädigung des Produktionsfaktors Arbeit erzielen kann.
Zusätzlich muss der Staat mit Bildungs- und Beratungsmassnahmen nachhaltige Produktionsweisen und Ernährungsverhalten fördern.
Das Konzept der Nachhaltigkeit verlangt, dass die Landwirtschaft – wie die übrige Wirtschaft – mit den zur Leistungserbringung notwendigen knappen Ressourcen effizient umgeht Dies ist auch erforderlich, um auf den Märkten so konkurrenzfähig als möglich zu sein Nur eine effiziente und konkurrenzfähige Landwirtschaft kann den von der Bundesverfassung verlangten Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung, zur dezentralen Besiedlung und damit auch zur Lebensfähigkeit des ländlichen Raums leisten
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1
122 ■
Effizienz
■ Gerechtigkeit
Die Landwirtschaft trägt zur generationsübergreifenden Gerechtigkeit bei, indem sie ihr Produktionspotenzial aufrechterhält Dazu zählt der sorgfältige Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die regelmässige Erneuerung von Maschinen, Gebäuden und die gezielte Weiterbildung.
Die Landwirtschaft kann zur generationsinternen Gerechtigkeit beitragen, indem sie durch eigene Anstrengungen und mit Hilfe der geeigneten Rahmenbedingungen einen Beitrag zu Beschäftigung, Einkommen, Infrastruktur und Lebensqualität im ländlichen Raum leistet Damit kann auch unterschiedlichen Wohlfahrtsniveaus zwischen der Stadt- und Landbevölkerung entgegengewirkt werden
Indikatoren für eine nachhaltige Landwirtschaft
■ Anforderungen an Indikatoren
Das Nachhaltigkeitskonzept ist komplex, insbesondere auch durch die Tatsache, dass es in die Zukunft reicht Einen Endzustand «Nachhaltigkeit» gibt es nicht Nachhaltigkeitsindikatoren können deshalb realistischerweise nur eine Einschätzung darüber ermöglichen, ob eine bestimmte Entwicklung in die richtige Richtung geht Es ist gut denkbar, dass einzelne Indikatoren in verschiedene Richtungen zeigen Dies soll auch nicht durch die Aggregation von Einzelindikatoren zu einem globalen, synthetischen Nachhaltigkeitsindikator verdeckt werden Tatsächlich ist es der eigentliche Zweck von Nachhaltigkeitsindikatoren, Trade-offs zwischen einzelnen Indikatoren und insbesondere zwischen den drei Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie aufzuzeigen und eine Grundlage für entsprechende Politikentscheide zu schaffen
Indikatoren zur Beurteilung der Nachhaltigkeit müssen einer Reihe von Kriterien genügen Sie müssen:
– politisch relevant (der Indikator muss sich auf politisch prioritäre Untersuchungsgegenstände beziehen); – analytisch solide (der Indikator muss den gewünschten Untersuchungsgegenstand korrekt abbilden);
– handlungsrelevant (der Indikator muss Rückschlüsse auf notwendige Massnahmen ermöglichen);
– auf einem angemessenen Aggregationsniveau definiert;
– auf statistisch zuverlässigen Daten basieren sowie
kommunizierbar sein und
– ein angemessenes Kosten-Nutzen Verhältnis aufweisen
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
–
123
Nachhaltigkeitsindikatoren für die Landwirtschaft zeigen, inwieweit die Landwirtschaft bei gegebenem Ernährungsverhalten und staatlichen Rahmenbedingungen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Schweiz leistet Die Indikatoren müssen die Kernthemen (Ressourcen, Effizienz, Gerechtigkeit) aufgreifen und für die verschiedenen Dimensionen einer nachhaltigen Landwirtschaft – Ökonomie, Soziales, Ökologie –entwickelt werden Naturgemäss haben je nach Dimension die Kernthemen ein unterschiedliches Gewicht In allen drei Dimensionen spielt die Ressourcenfrage eine zentrale Rolle (natürliches Kapital, Humankapital und reproduziertes Kapital) Bei der Ökologie und der Ökonomie ist zudem die Frage der Effizienz wichtig, während beim Sozialen die Gerechtigkeit im Vordergrund steht
Indikatorenfelder

Indikatoren zu Ressourcen
Ökonomie Soziales Ökologie
Da die Weitergabe von bestimmten Ressourcenbeständen an künftige Generationen das Grundprinzip des Konzeptes der Nachhaltigkeit ist, müssen Indikatoren, die sich auf Kapitalbestände beziehen, den Kern eines Sets von Nachhaltigkeitsindikatoren bilden Bei den natürlichen Ressourcen muss zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen unterschieden werden Bei den erneuerbaren natürlichen Ressourcen müssen die Indikatoren zeigen, ob die Nutzung nicht den Grad der Regenerationsfähigkeit übersteigt. Bei den Humanressourcen (Wissen) und den reproduzierten Ressourcen müssen Indikatoren zeigen, inwiefern und in welchem Tempo diese erneuert werden und welche Qualität sie aufweisen
Indikatoren zur Effizienz
Die Kombination der verschiedenen Kapitaltypen führt zu Markt- und NichtmarktOutputs Effizienzindikatoren im Bereich Ökonomie stellen das Bindeglied zwischen Kapitalinput und Output dar Im Bereich Ökologie beziehen sich Effizienzindikatoren auf die Umweltauswirkungen pro Einheit produzierter Nahrungsenergie
Im Bereich Ökonomie müssen Effizienzindikatoren mit Indikatoren der Wettbewerbsund Lebensfähigkeit ergänzt werden. Nur wenn der Landwirtschaftssektor wettbewerbsfähig ist und die Produktionsfaktoren ausreichend vergütet werden, kann das Produktionspotenzial des Sektors langfristig erhalten bleiben
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1
Ressourcen ■■■ Effizienz ■■ Gerechtigkeit ■
124
■ Indikatorenfelder Landwirtschaft
■ Nachhaltigkeitsziele
Indikatoren zur Gerechtigkeit Indikatoren in diesem Bereich müssen aufzeigen, wie die soziale Situation der landwirtschaftlichen im Vergleich zur nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung aussieht Diese Art von Gerechtigkeit lässt sich z.B. messen anhand eines Vergleichs bezüglich Zugang zu Wissen (Ausbildung, Weiterbildung), Arbeitsbelastung und -bedingungen oder Einkommen
Der Vergleich zwischen Indikatorwerten und einem Zielwert ist eine Voraussetzung für die Beurteilung der Agrarpolitik aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit Da die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen und der technische Fortschritt nicht vorausgesagt werden können, gibt es keinen Endzustand «Nachhaltigkeit». Zielwerte können deshalb nicht als feste Grösse betrachtet werden Sie sind periodisch dem aktuellen Wissensstand anzupassen In gewissen Bereichen dürfte es ausserdem schwierig sein, Zielgrössen festzulegen. Hier kann es sinnvoll sein, eine Zielrichtung anzugeben.
Da die Ziele keine unveränderlichen Grössen sind, soll im Zusammenhang mit der Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft von Zwischenzielen gesprochen werden
Die Formulierung von Zielen, die mit der Agrarpolitik respektive mit agrarpolitischen Massnahmen erreicht werden sollen, ist nicht neu Diese gibt es sowohl im ökonomischen als auch im ökologischen Bereich. Mit der Formulierung von Zwischenzielen für die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft wird die Zielformulierung künftig einerseits ausgedehnt auf den sozialen Bereich und anderseits ausgerichtet auf die Entwicklung aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit
■ Darstellung zur raschen Beurteilung
Eine visuelle Darstellung soll einen raschen Überblick ermöglichen, ob sich die Landwirtschaft aus heutiger Perspektive in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt Zu diesem Zweck sollen in einer Tabelle für jeden Indikator Zielwerte (Zwischenziel) und effektive Werte abgebildet werden Mit unterschiedlichen Farbtönen wird der Grad der Abweichung festgehalten So können sich Leserinnen und Leser rasch ein Bild machen über den Stand der nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
125
■ Weiteres Vorgehen
Beurteilung der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft
Indikatoren Zwischenziel Stand (Wert) Beurteilung (Zielrichtung) (mit Farben)* n+x (Jahre) n n+x n+x Ökonomie
* hellgrau = im Zielbereich (ZB) mittelgrau = ausserhalb ZB/positive Entwicklung dunkelgrau = ausserhalb ZB/negative Entwicklung
Basierend auf dem vorliegenden Konzept werden in einer nächsten Etappe die konkreten Indikatoren in den drei Bereichen Ökonomie, Soziales und Ökologie definiert Anschliessend sollen für die ausgewählten Indikatoren Zwischenziele festgelegt werden Die Beurteilung soll periodisch im Rhythmus der landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen erfolgen und im Agrarbericht dargestellt werden.
126 1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
Soziales
Ökologie

■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. Agrarpolitische Massnahmen 2 127
Das Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998 enthält die Regelungen zur Umsetzung von Artikel 104 der Bundesverfassung aus dem Jahr 1996 Mit dem neuen Gesetz und den entsprechenden Verordnungen wurde die Reform der Agrarpolitik, bekannt unter dem Begriff «Agrarpolitik 2002», am 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt. Die staatliche Regelungsdichte ist mit der «Agrarpolitik 2002» deutlich zurückgegangen Im Marktbereich sind viele Detailregelungen weggefallen, so insbesondere die direkten staatlichen Markteingriffe mit Preis- und Absatzgarantien
Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln Das Gesetz gibt vor, dass die Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten gegenüber den Ausgaben 1998 um einen Drittel abgebaut werden müssen. Im Jahr 2003 können für diese Massnahmen noch rund 800 Mio Fr eingesetzt werden
Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab. Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht, weil dafür kein Markt besteht Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher, dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden.
– Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte, sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion Im einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung, im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz
Das EVD hat am 21. September 2001 die Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik eröffnet Die Vorlage unter dem Titel «Agrarpolitik 2007» hat zum Ziel, die Rahmenbedingungen für die Schweizer Landwirtschaft weiter zu optimieren Die Zielsetzungen der Verfassung und die Grundzüge der «Agrarpolitik 2002» erfahren dabei keine Änderungen Einen Überblick über die Vernehmlassungsunterlage gibt es am Schluss dieses Kapitels
128 2 . A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2
–
2.1 Produktion und Absatz
Der Bund setzt die Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse so fest, dass die Landwirtschaft nachhaltig und kostengünstig produzieren sowie aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann
Eine nachhaltige Produktion wird in erster Linie durch die Auflagen für die Direktzahlungen erreicht Innerhalb der Rahmenbedingungen für Produktion und Absatz kann sie durch Qualitätsbestimmungen und durch Vorschriften über die Kennzeichnung gefördert werden. Diese dienen jedoch in erster Linie der Erzielung einer hohen Wertschöpfung aus der Produktion

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 129 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■ Finanzielle Mittel 2000
Im Jahr 2000 wurden zur Förderung von Produktion und Absatz rund 955 Mio. Fr. aufgewendet Gegenüber dem Vorjahr sind dies rund ein Viertel weniger Ausgaben Diese Summe liegt im Rahmen des vorgesehenen Abbaus der finanziellen Mittel für Produktion und Absatz gemäss Artikel 187 Absatz 12 LwG. Der grosse Abbauschritt zwischen 1999 und 2000 ist vor allem auf die ausserordentlichen Ausgaben für die Liquidation der halbstaatlichen Organisationen Schweizerische Käseunion AG und Butyra im Jahr 1999 zurückzuführen
Ausgaben für Produktion und Absatz
Rechnung 2000 Budget 2001
Aufgrund eines parlamentarischen Budgetbeschlusses stehen im Jahre 2001 für den Bereich Produktion und Absatz gegenüber dem Finanzplan 30 Mio Fr mehr zur Verfügung. Damit kann der Mittelabbau in der Milchwirtschaft gemildert werden.
■ Ausblick
Die Auswirkungen der agrarpolitischen Massnahmen im Bereich Produktion und Absatz werden durch verschiedene Forschungsaufträge evaluiert Der aktuelle Stand der Arbeiten wird in Abschnitt 2.1.5 «Überprüfung der Massnahmen» dargestellt.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 130
Ausgabenbereich Betrag Anteil Betrag Anteil Mio Fr % Mio Fr % Absatzförderung 60 6,2 60 6,6 Milchwirtschaft 716 75,0 666 72,7 Viehwirtschaft 26 2,7 47 5 13 Pflanzenbau (inkl Weinbau) 153 16,0 143 15,6 Total 955 100,0 916 100,0 Quelle: Staatsrechnung
2.1.1 Globale Instrumente
Produzenten- und Branchenorganisationen
Die im Rahmen der Anpassung unserer Gesetzgebung an die sektoriellen Abkommen mit der EU (bilaterale Verträge) erfolgte Änderung von Artikel 9 LwG trat am 1 Januar 2001 in Kraft Sie räumt dem Bund neu die Möglichkeit ein, Beschlüsse der Branchenund Produzentenorganisationen zur Finanzierung von Selbsthilfemassnahmen allgemein verbindlich zu erklären Falls eine Organisation von ihren Mitgliedern Beiträge für die Finanzierung von Selbsthilfemassnahmen im Sinne des Gesetzes erhebt, kann der Bundesrat die Beitragspflicht auf die Gesamtheit der von einem Produkt oder einer Produktegruppe betroffenen Produzenten, Verarbeiter und gegebenenfalls Händler ausdehnen
Die neue Agrarpolitik verlangt von der Landwirtschaft, dass sie eine hohe Wertschöpfung und aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst grossen Markterlös erzielt (Artikel 7 LwG) Es ist daher äusserst wichtig, dass die Anstrengungen der Mehrheit der Betriebe einer Branche oder eines Sektors für eine bessere Positionierung und Absatzförderung ihres Produktes nicht von einer Minderheit von Betrieben in Frage gestellt werden, die ohne Kostenbeteiligung von den gemeinschaftlichen Massnahmen profitiert
Infolge der Änderung von Artikel 9 LwG sind beim BLW im Verlaufe des Frühjahrs 2001 zehn Unterstützungsgesuche eingegangen Das Bundesamt überprüfte die Gesetzmässigkeit dieser Eingaben und kommt in der Hälfte der Fälle zu einer positiven Beurteilung Die fünf berücksichtigten Begehren haben die Finanzierung des Basismarketings der schweizerischen Landwirtschaft, die Schaffung eines Unterstützungsfonds für Milchprodukte, die Absatzförderung von Schweizer Eiern, die Marketingfinanzierung für den Emmentaler und Qualitätsmassnahmen in der Gruyère-Branche zum Gegenstand.
Wie die Erfahrungen aus der Behandlung der verschiedenen Dossiers gezeigt haben, muss das BLW seine Kommunikations- und Beratungsanstrengungen auf Ebene der Branchen- und Produzentenorganisationen verstärken Gemäss der geltenden Gesetzgebung kann der Bundesrat nämlich nur eine begrenzte Anzahl Massnahmen zur Förderung der Qualität und des Absatzes sowie zur Anpassung des Angebotes an die Markterfordernisse unterstützen Einige Massnahmen, für die eine Unterstützung verlangt wurde, fielen nicht in diesen Bereich. Andere Gesuche wurden von Organisationen eingereicht, deren Struktur und Aktivitäten nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen Eine Branchenorganisation muss rund um unabhängige Berufsgattungen auf allen Stufen organisiert sein. Nur so kann sie die verschiedenen Interessen effizient vertreten Aus diesem Grund verlangt das LwG, dass eine Branchen- oder Produzentenorganisation nicht selber im Produktions-, Verarbeitungsund Verkaufssektor tätig ist, damit keine Konflikte zwischen den privaten Interessen der Betriebe entstehen
Die Bildung von glaubwürdigen und leistungsfähigen Branchen- und Produzentenorganisationen ist für die schweizerische Landwirtschaft von zentraler Bedeutung
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 131 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■ Gesuche um Unterstützung
■ Marketingkommunikation in der Landwirtschaft
Absatzförderung
Der Absatz von Produkten wird vom gesamten unternehmerischen Handeln mitbestimmt. Das trifft auch in der Landwirtschaft zu. Ein positives Erscheinungsbild und das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in die Produktion oder in die Herkunft ihrer Lebensmittel, wie auch beispielsweise eine optimale Produkt- und Marktgestaltung, zeigt sich in Absatz- oder Umsatzzahlen Ausschlaggebend für den Erfolg ist somit ein vollständiger Marketing-Mix Produkt-, Sortiments- und Qualitätsmanagement, Preisgestaltung und Distribution sowie die Kommunikation sind aufeinander abgestimmt einzusetzen
Mit der Absatzförderung nach Artikel 12 LwG werden aus dem gesamten Spektrum aber nur die Kommunikationsaufgaben und teilweise die Marktforschung unterstützt
■ Marketingkommunikation als agrarpolitische Massnahme
Der Erfolg eines Unternehmens hängt entscheidend von der erfolgreichen Vermarktung seiner Erzeugnisse ab Massgebend ist, ob sich die Abnehmer für oder gegen das Produkt entscheiden Es geht in der Schweizer Landwirtschaft folglich darum, eine möglichst hohe Präferenz für den hier hergestellten Käse, für das Schweizer Fleisch, oder auch für Schweizer Äpfel, Karotten, usw. zu erreichen. Übergeordnet besteht das Ziel, eine höhere Wertschöpfung für die Landwirtschaft zu erzielen Um das zu erreichen, müssen die Schweizer Produkte im Zielmarkt bekannt sein Ihnen gegenüber muss eine positive Einstellung bestehen, die Konsumentinnen und Konsumenten sind motiviert, sie zu kaufen Zudem muss ein gutes Image der Schweizer Landwirtschaft bestehen Zusammengefasst: Die Endverbraucher wissen, warum sie die Erzeugnisse aus der Schweizer Landwirtschaft vorziehen Erreicht wird das mit den Instrumenten der Marketingkommunikation wie Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, usw.
Der Bund unterstützt die Marketingkommunikation subsidiär Im Berichtsjahr 2000 konnten 61 Absatzförderungsprojekte auf überregionaler, nationaler oder internationaler Ebene von der Bundeshilfe profitieren 36 Gesuchsteller teilten sich die dafür bereitgestellten 54 Mio Fr Weitere rund 2,5 Mio Fr gingen an regionale Projekte zur Förderung regionaler Spezialitäten und 4,6 Mio Fr aus dem Rebbaufonds wurden für die Absatzförderung von Wein im Ausland aufgewendet
Die Initiative ist Sache der Akteure In diesem dezentralen System werden die Ziele sehr individuell festgelegt Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Vorhaben auf die aktuellen, produktespezifischen Erfordernisse des Marktes oder als gemeinsame Massnahme zur Verbesserung des Erscheinungsbilds der Landwirtschaft ausgerichtet werden können Beurteilt werden die unterstützten Projekte auf der Basis der Hauptzielsetzung dieser agrarpolitischen Massnahme, das heisst der Präferenz für Schweizer Landwirtschaftsprodukte
Zur Präferenz für Schweizer Landwirtschaftsprodukte werden die Konsumentinnen und Konsumenten im Auftrag des BLW repräsentativ befragt Alle zwei Jahre können haushaltführende Personen über ihr Verhalten zu ausgewählten Produkten und über die Einstellung zur Landwirtschaft Auskunft geben Durch die regelmässigen Erhebungen mit den gleichen Grundfragen wird die Entwicklung festgestellt
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 132
Tabellen 26/29, Seiten A27/ A30
■ Beachtung und Bedeutung der Herkunft ist nach Produkten verschieden
Über die Lebensmittelproduktion wird in jüngster Zeit vermehrt gesprochen. Dabei sind es hauptsächlich Erzeugnisse aus der Tierproduktion, die für Schlagzeilen sorgen Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass die Herkunft solcher Produkte mehr beachtet wird als jene von Erzeugnissen aus dem Pflanzenbau. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind hier auf die Herkunft weniger sensibilisiert Die Befragungen zeigen, dass sich die Reihenfolge der Produkte, bei welchen auf die Herkunft geachtet wird, in den letzten zwei Jahren nicht verändert hat Spitzenreiter sind nach wie vor die Schweizer Eier gefolgt von Milch und Frischmilchprodukten Eine Aussage darüber, ob beim Einkauf heute mehr oder weniger auf die Herkunft geachtet wird, kann noch nicht mit Sicherheit gemacht werden Die Resultate der beiden Umfragen liegen innerhalb der möglichen Fehlergrenze

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 133
2
Veränderung der Präferenz für Schweizer Produkte Eier 2000 1998 Milch und Frischmilchprod 2000 1998 Fleisch (ohne Wurstwaren) 2000 1998 Kartoffeln 2000 1998 Honig 2000 1998 Käse 2000 1998 Gemüse 2000 1998 Wurstwaren 2000 1998 Obst und Beeren 2000 1998 Getreideprodukte 2000 1998 Kartoffelprodukte 2000 1998 Speiseöl 2000 1998 Zucker 2000 1998 Wein 2000 1998 Wolle 2000 1998 in % Quelle: DemoScope 1998/2000 020 40 60 80 100 immer meistens ab und zu selten nie keine Antwort
■ Werden Schweizer Produkte bevorzugt?
Massgebend für den Erfolg ist die Entwicklung der Präferenz für Schweizer Produkte. Die Unterschiede der Befragungen 1998 und 2000 sind noch zu klein, um einen klaren Trend zu erkennen Auffallend ist die Zunahme der Präferenz beim Käse Hier wählen neu rund 75% der Befragten meistens Schweizer Käse. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass dies für die Westschweizer, die auch französische Käse schätzen, nicht im gleichen Mass zutrifft
■ Das Bild der haushaltführenden Personen von der Schweizer Landwirtschaft
Im Rahmen der periodischen Konsumentenbefragungen wird auch erhoben, wie sich das Bild der Landwirtschaft in der Bevölkerung entwickelt Fast 90% erachtet heute die Schweizer Landwirtschaft als vertrauenswürdig Auch bei der Frage zur Professionalität und zur Konsumentennähe werden gute Noten gegeben. Über 80% beantworten die Kriterien «zeitgemäss» und «umweltgerecht» mit ja oder eher ja Niedriger wird hingegen die Konkurrenzfähigkeit eingestuft Nur gut die Hälfte der Befragten erachten die schweizerische Landwirtschaft als konkurrenzfähig.
Bild der Landwirtschaft bei den haushaltführenden Personen in
■ Ausblick
Die zunehmende Öffnung der Grenzen erhöht den Wettbewerbsdruck auf den Inlandmarkt Im Gegenzug ermöglicht das bilaterale Agrarabkommen mit der EU in absehbarer Zeit für einige Produkte aus der Schweiz den freieren Zutritt zum EU-Markt Eine klare Positionierung der Schweizer Landwirtschaft und deren Erzeugnisse ist unter diesen Voraussetzungen nötig Die Ereignisse rund um die BSE-Krise in den umliegenden Ländern macht zudem klar, dass sich Markteinbrüche, auch in nicht direkt betroffenen Ländern, nur mit einer kontinuierlichen Kommunikation mit den Konsumentinnen und Konsumenten eindämmen lassen Dazu wird die Marketingkommunikation der Landwirtschaft eine klare Ausrichtung auf einige Kernbotschaften benötigen. Hierzu muss sich die Landwirtschaft ihrer Stärken (Nähe, Frische, Qualität, usw ) bewusst werden Der Auftritt wird einheitlicher und unter höherer Konzentration der Kräfte und der Mittel realisiert werden müssen Der Bund wird sich zunehmend bemühen, im Bereich der Absatzförderung diesem Ziel und den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 134
vertrauenswürdig professionell konsumentennah zeitgemäss umweltgerecht konkurrenzfähig i n % Quelle: DemoScope 2000 ja eher ja eher nein nein weiss nicht 10 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20
der Schweiz
■ Bioproduktion –Einbezug Tierhaltung
Qualitätsförderung
Der Einbezug der Tierhaltung in die Verordnung über die biologische Landwirtschaft schützt die Konsumentinnen und Konsumenten vor Täuschung, schützt die Produzentinnen und Produzenten und führt somit zu mehr Sicherheit im Biomarkt Für den Handel ist bedeutend, dass die Änderungen EU-kompatibel sind

Betroffen von der Revision sind sowohl die Bundesratsverordnung, welche die grundsätzlichen materiellen Eckpunkte der biologischen Landwirtschaft regelt, wie auch die darauf basierende Verordnung des EVD, welche gestützt auf die bundesrätlichen Kompetenzdelegationen gewisse technische Einzelheiten enthält
Damit die Regelungsdichte für die Produzentinnen und Produzenten nicht noch grösser wird und ein klar strukturierter Aufbau sichtbar wird, wurden bestehende Verordnungen integriert und soweit wie möglich übernommen. Die Anforderungen betreffend Tierschutz, RAUS, BTS und Bio wurden im Baukastensystem aufeinander abgestimmt Die wichtigsten Anforderungen an die Bio-Tierhaltung sind der regelmässige Auslauf der Tiere ins Freie, eine artgerechte Fütterung, welche auf Bio-Futtermitteln basiert, sowie klare Einschränkungen bei der Verabreichung von Medikamenten Grundsätzlich müssen sowohl Tiere wie Futter aus biologischer Produktion stammen. Da dies aber noch nicht vollumfänglich möglich ist, sind Ausnahmen oder Übergangsbestimmungen vorgesehen
Die nun streng geregelte Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln aus der Nutztierhaltung, also von Fleisch, Milch und Eiern sowie allen daraus hergestellten Lebensmitteln, ermöglicht eine klare Positionierung mit dem Ziel, die Akzeptanz bei den Konsumentinnen und Konsumenten zu erhöhen und den Markt zu vergrössern
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 135
2
■ Lebensmittelverordnung: Deklaration des Produktionslandes
Angaben über Lebensmittel
Das Lebensmittelgesetz (LMG) bezweckt einerseits den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit gefährden können, und anderseits den Schutz vor Täuschung im Zusammenhang mit Lebensmitteln (vgl Artikel 1 LMG) Bezüglich der Kennzeichnung von Lebensmitteln räumt Artikel 21 Absatz 1 LMG dem Bundesrat die Kompetenz ein, nicht nur Angaben zu verlangen, die dem Schutz der Gesundheit oder dem Schutz vor Täuschung dienen, sondern auch solche, die darauf ausgerichtet sind, berechtigte Informationsbedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten zu decken Da derartige Vorschriften die in Artikel 27 der Bundesverfassung (BV) verankerte Wirtschaftsfreiheit einschränken, bedürfen diese jedoch nicht nur einer gesetzlichen Grundlage, sondern sie müssen durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt und insbesondere auch verhältnismässig sein (Artikel 36 BV)
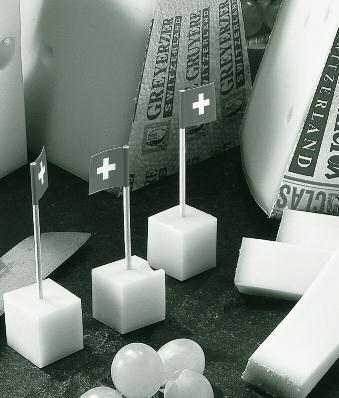
Die schweizerischen Bestimmungen über die Angabe des Produktionslandes von Lebensmitteln gehen bereits recht weit Bei vorverpackten Lebensmitteln ist die Angabe des Produktionslandes grundsätzlich obligatorisch und muss schriftlich erfolgen; bei offen angebotenen Lebensmitteln ist das Produktionsland zwingend schriftlich anzugeben, sofern das Eidgenössische Department des Innern (EDI) dies in einer Verordnung vorsieht Für Fleisch und Fleischerzeugnisse muss das Produktionsland, z.B. auf vorverpackten Lebensmitteln, im Offenverkauf und auch in Einrichtungen wie Gaststätten, Krankenhäusern oder Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben schriftlich angegeben werden
■ Rohstoffdeklarationsverordnung: Deklaration des Hauptrohstoffes
Die Regelung, wonach eine genügende Be- oder Verarbeitung ausreicht, um ein Produkt mit dem Hinweis «Produktionsland Schweiz» zu versehen, entspricht dem international harmonisierten Ursprungsregime Allerdings kann dies Konsumentinnen und Konsumenten verwirren, weil auch Assoziationen mit der landwirtschaftlichen Produktion, bzw der Produktion des Rohstoffes hervorgerufen werden Die am 1 April 2000 in Kraft getretene Rohstoffdeklarationsverordnung bezweckt nun das Verhindern derartiger Täuschungen Im Rahmen der Anhörung der interessierten Kreise hat sich gezeigt, dass es schwierig ist, eine Regelung zu erlassen, die dem Informationsbedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten dient, den Schutz vor Täuschung gewährleistet, dem internationalen Recht sowie demjenigen der wichtigsten Handelspartner Rechnung trägt und darüber hinaus auch noch vollziehbar und verhältnismässig ist. Die geltende Regelung verlangt daher nicht die Angabe des Produktionslandes sämtlicher Rohstoffe, sondern nur des Hauptrohstoffes Damit können zumindest krasse Fälle von Täuschung verhindert werden Aufgrund der Übergangsfrist dürfen Lebensmittel bis zum 31. Dezember 2000 nach bisherigem Recht gekennzeichnet und danach noch bis zum 31 Dezember 2002 an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden Somit muss beispielsweise auf Zuger Kirsch, der seit dem 1 Januar 2001 zu mehr als 50 Massenprozent aus ungarischen Kirschen hergestellt worden ist, auf die ungarische Herkunft der Kirschen hingewiesen werden Dasselbe gilt für Bündnerfleisch, Schüfeli, Rollschinkli, Rohschinken und Ähnliches, das mit dem Hinweis «Produktionsland Schweiz» versehen ist, sofern der Rohstoff nicht aus der Schweiz stammt
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 136
■ Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung: Deklaration in der Schweiz verbotener Produktionsmethoden
In der Schweiz ist es in der Tierfütterung verboten, Hormone, Antibiotika oder andere antimikrobielle Leistungsförderer für Tiere einzusetzen; ebenfalls verboten ist die Käfighaltung von Legehennen Um die Deklaration des eingeführten Frischfleisches und der Konsumeier aus diesen verbotenen Produktionsmethoden zu regeln, hat der Bundesrat die landwirtschaftliche Deklarationsverordnung (LDV) auf den 1 Januar 2000 in Kraft gesetzt Als Vollzugshilfe ist ein Merkblatt zur LDV sowie eine Liste mit Ländern, die gleichwertige Verbote erlassen haben, im Internet publiziert (http://www blw admin ch/themen/aw/deklarat/d/index htm)
Die Deklaration entfällt nur, wenn entweder das Lieferland ein gleichwertiges gesetzliches Verbot festgelegt hat oder wenn die Endverkäuferin oder der Endverkäufer glaubwürdig nachweisen kann, dass das Erzeugnis nicht aus einer verbotenen Produktionsmethode stammt Das BLW hat von den wichtigsten Lieferländern die gesetzlichen Erlasse beschafft und die Gleichwertigkeit mit schweizerischen Bestimmungen überprüft. Auf der erwähnten Länderliste sind die Ergebnisse zusammengefasst. Für den Nachweis gibt es ein Musterdokument im Anhang des genannten Merkblattes
Die amtliche Lebensmittelkontrolle hat nach dem Bereinigen von einigen Unklarheiten im Vollzug die Kontrolltätigkeit verstärkt Auch standen die Bestimmungen nach der erneuten BSE-Diskussion in einem starken öffentlichen Interesse. Die grössten Schwierigkeiten bestehen bei den Nachweisdokumenten für eingeführtes Fleisch: Die Einhaltung von maximal zulässigen Rückstandswerten von leistungsfördernden Stoffen im Fleisch (Monitoringprogramm im Schlachtbetrieb) oder von minimalen Absetzfristen von leistungsfördernden Stoffen vor der Schlachtung des Tieres, entbinden nicht von der Deklaration Der glaubwürdige Nachweis muss sich ausschliesslich auf den Produktionsprozess von der Geburt bis zur Schlachtung der Tiere beziehen Für diesen Prozess müssen Produktionsrichtlinien vorhanden sein, die den Einsatz von Leistungsförderern explizit verbieten und deren Einhaltung von unabhängiger Seite (Behörde oder akkreditierte Organisation) überprüft wird Die Nachweisdokumente können zentral bei den Importeuren hinterlegt werden, jedoch muss die Rückverfolgbarkeit von den Endverkäufern gewährleistet sein.
Weil es in der Schweiz weitere verbotene Produktionsmethoden gibt, ist die Erweiterung des Geltungsbereiches der LDV zu prüfen: Schweine- und Geflügelfleisch, das von Tieren stammt, denen Tiermehl verfüttert worden ist oder Milch, Milchprodukte und Eier, die von Tieren stammen, denen antimikrobielle Leistungsförderer verabreicht wurden Auch in Bezug auf Tierschutzauflagen sind die schweizerischen Normen teilweise deutlich höher als im Ausland, so dass die Deklaration grundsätzlich zu prüfen ist.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 137
2
■ Deklarationsbeispiele: Produktionsland und verbotene Produktionsmethode
Schweinefleisch aus Frankreich im Offenverkauf in der Metzgerei: Das Produktionsland «Frankreich» muss schriftlich in der Verkaufsvitrine angegeben werden Weiter ist der Hinweis «kann mit Antibiotika und /oder anderen antimikrobiellen Leistungsförderern erzeugt worden sein» anzubringen. Dieser Hinweis kann weggelassen werden, sofern glaubwürdig nachgewiesen wird, dass die Stoffe nicht eingesetzt wurden
US-Beef (Rindfleisch) im Restaurant: Das Produktionsland «USA» ist schriftlich in geeigneter Form (Speisekarte oder Plakat) bekannt zu machen Zusätzlich sind die Hinweise «kann mit Hormonen als Leistungsförderer erzeugt worden sein» und/oder «kann mit Antibiotika und /oder anderen antimikrobiellen Leistungsförderern erzeugt worden sein» anzubringen Diese Hinweise können weggelassen werden, sofern glaubwürdig nachgewiesen wird, dass die Stoffe nicht eingesetzt wurden.
Vorverpacktes Rollschinkli im Detailhandel, hergestellt in der Schweiz aus österreichischem Schweinefleisch: Auf der Verpackung muss das Produktionsland «Schweiz» erwähnt werden und zusätzlich zwingend auf die österreichische Herkunft des Rohstoffes verwiesen werden
Konsumeier aus Deutschland werden im Detailhandel verkauft: Das Produktionsland «Deutschland» muss sowohl auf den Verkaufspackungen wie auch auf jedem einzelnen Ei angegeben werden Das Land kann auch in verständlicher Form abgekürzt (D) werden Sofern die Eier aus Käfighaltung stammen, ist zudem auf der Verkaufspackung auf die Haltungsmethode hinzuweisen «aus in der Schweiz nicht zugelassener Käfighaltung»

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 138
Instrumente des Aussenhandels
Zur Steuerung der Einfuhren sind gemäss Bestimmungen des GATT/WTO nur tarifarische Massnahmen, das heisst Zölle auf den Importprodukten erlaubt. Möglich ist es, die Einfuhrmengen aufzuteilen in einen Teil mit höheren Zollansätzen und einen Teil mit tieferen Ansätzen innerhalb der so genannten Zollkontingente Dieses Vorgehen erlaubt Einfuhren zu Preisen, die teilweise nur sehr wenig vom ausländischen Preisniveau abweichen Entsprechend begehrt sind Anteile an diesen Importmengen Wichtige Zollkontingente bestehen bei Fleisch, Milchprodukten, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Brotgetreide und Wein
Die Verteilung der Kontingentsmengen erfolgt mittels Versteigerung, aufgrund der Zukäufe inländischer Erzeugnisse, nach Massgabe der bisherigen Importtätigkeiten oder nach der Reihenfolge des Eingangs der Zuteilungsgesuche bei der Bewilligungsstelle. Die freigegebenen Mengen und die effektiv erfolgten Einfuhren zum Kontingentszollansatz (KZA) sind aus dem jährlich erscheinenden Bericht des Bundesrates über die zolltarifarischen Massnahmen ersichtlich Die Ausnützung der Zollkontingentsanteile ist je nach Erzeugnis unterschiedlich
Bei einigen Produkten, wie z.B. bei den Futtermitteln, wird die Einfuhr ausschliesslich über die Höhe der Zölle gesteuert Bei der Festsetzung der Zölle werden die Versorgungslage im Inland und die Absatzmöglichkeiten für gleichartige Produkte berücksichtigt sowie den gesamtlandwirtschaftlichen Interessen Rechnung getragen. Bei den Futtermitteln werden die Zollansätze mit dem System der Schwellenpreise periodisch an die Entwicklung der Preise franko Schweizergrenze angepasst
Der Grenzschutz beinhaltet neben einem quantitativen auch einen qualitativen Aspekt, indem er zu gewährleisten hat, dass die Einfuhren gesundheitlich unbedenklich sind (Sicherheit der Nahrungsmittel)
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 139
2
Einfuhrregelungen unterstützen produktive Landwirtschaft Entwicklung des Schwellenpreises für Gerste Jan 96 Apr 96 Jul 96 Okt 96 Jan 97 Apr 97 Jul 97 Okt 97 Jan 98 Apr 98 Jul 98 Okt 98 Jan 99 Apr 99 Jul 99 Okt 99 Jan 00 Apr 00 Jul 00 Okt 00 F r / d t Quelle: BLW 0 80 70 60 50 40 30 20 10 G
Bandbreite Schwellenpreis Importpreis verzollt Preis franko Schweizergrenze
■
renzabgaben
■ Ausnützung von Zollkontingenten
Ob ein zugeteiltes Zollkontingent effektiv ausgenützt wird, hängt u.a. mit dem angewendeten Zuteilungskriterium zusammen So werden versteigerte Kontingente, unter der Voraussetzung, dass für die entsprechenden Produkte eine genügende Inlandnachfrage besteht, in der Regel gut ausgenützt. Bei Zuteilungskriterien mit einer historischen Komponente (z B Zuteilung aufgrund der bisherigen Importtätigkeit), oder bei Zuteilungen aufgrund eines entsprechenden Gesuches kommt es vor, dass Zollkontingentsanteile nur zu einem (kleinen) Teil eingeführt werden Die Ausnützung wird u a auch durch die Verfügbarkeit und das Preisniveau der Erzeugnisse im Ausland und von der Inlandnachfrage beeinflusst

Auch die Dauer der Importberechtigung (Kontingentslaufzeit) hat einen Einfluss auf die Ausnützung von Kontingenten. Bei Früchten und Gemüsen werden bei einzelnen Produkten weniger als 50% der freigegebenen Mengen importiert Verstärkt wird dieses Phänomen durch die grosse Zahl von Importeuren und die damit verbundene Stückelung der Einfuhrrechte. Die Branchen beantragen teilweise hohe Freigaben, um einzelnen Importeuren zu ermöglichen, ihren Bedarf über die ihnen zustehenden Einfuhrrechte abzudecken
Die tiefste Ausnützung ist mit 25% diejenige der Schnittblumen-Zusatzkontingente, die aufgrund der gemeldeten Inlandleistungen zugeteilt werden Relativiert wird diese tiefe Zahl durch die hohe Ausnützung des Basiskontingents, das nach den Einfuhren im Vorjahr zugeteilt wird
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 140
Ausnützung ausgewählter Zollkontingentsfreigaben
Produkt Zuteilungsart zugeteilte importierte Menge Menge in t brutto in t brutto Wurstwaren, total Versteigerung 3 136 2 913 Wurstwaren, Deutschland Versteigerung 1 103 110 Wurstwaren, Frankreich Versteigerung 125 94 Wurstwaren, Ungarn Versteigerung 52 24 Wurstwaren, Italien Versteigerung 2 856 2 685 Eisbergsalat Einfuhren im Vorjahr 1 121 725 Blumenkohl Einfuhren im Vorjahr 917 413 Tomaten Marktanteil im Vorjahr 4 118 2 971 Tafeläpfel Marktanteil im Vorjahr 4 768 3 871 Erdbeeren Einfuhren im Vorjahr 2 365 815 Schnittblumen, total gemischt 16 156 7 409 Schnittblumen Einfuhren im Vorjahr 2 4 707 4 590 Schnittblumen Inlandleistung 11 449 2 819
2000
1 Mehreinfuhren werden als Kontingentsüberschreitung behandelt
2 inkl Zuteilungen für Neueinsteiger Quelle: BLW
■ Übertragung von Zollkontingentsanteilen wird rege benützt
Ausnützung von Zollkontingentsteilmengen mit verschiedenen Zuteilungskriterien 2000
Wurstwaren, total, VS Wurstwaren, Italien, VS Wurstwaren, Ungarn, VS Eisbergsalat, EV Blumenkohl, EV Tomaten, rund, MA Tafeläpfel, MA Erdbeeren, EV Schnittblumen total Schnittblumen, IL Schnittblumen, EV
Seit dem Inkrafttreten der neuen Agrareinfuhrverordnung am 1 Januar 1999 besteht die Möglichkeit, Zollkontingentsanteile zu übertragen Gemäss Artikel 14 der Verordnung können Inhaber von Zollkontingentsanteilen mit anderen Zollkontingentsanteilsberechtigten vereinbaren, dass deren Einfuhren dem Zollkontingentsanteil des Anteilsinhabers angerechnet werden Diese Möglichkeit erlaubt einerseits eine bedarfsgerechtere Verteilung der Importrechte, anderseits ermöglicht sie Importeuren, die über keine Zollkontingentsanteile verfügen (z.B. Neueinsteiger), Einfuhren zum KZA zu tätigen Vom neuen Instrument wird rege Gebrauch gemacht, insbesondere bei Einfuhrregelungen mit häufigen Freigaben von Zollkontingentsteilmengen und vielen Zollkontingentsanteilinhaber wie bei Früchten, Gemüsen oder Schnittblumen Die Wareneinfuhr kann bei diesen Produkten durch eine Zusammenlegung der oft kleinen Anteile logistisch (Sammeltransporte) und administrativ vereinfacht werden Weniger häufig sind Übertragungen, wenn die Zollkontingentsanteile versteigert oder auf Gesuch hin freigegeben werden, wie z B bei Gemüsen für die Verarbeitung
Bei Früchten und Gemüsen bestehen zwei Arten von Vereinbarungen:
– ein Inhaber von Zollkontingentsanteilen tritt die ganzen oder Teile seiner für ein Jahr gültigen prozentualen Anteile ab, bevor die entsprechenden Zollkontingentsteilmengen freigegeben werden (vor allem angewendet bei Produkten, deren Anteile aufgrund des Marktanteils zugeteilt werden);
ein Inhaber von Zollkontingentsanteilen macht bei einer Freigabe einer Zollkontingentsteilmenge eine mengenmässige Abtretung
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 141
–
2
in % Quelle: BLW Art der Zuteilung: VS: Versteigerung; EV: Einfuhren im Vorjahr; MA: Marktanteil; IL: Inlandleistung 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ausn
ützung Zuteilung
■ Zollbegünstigung für die ärmsten Entwicklungsländer
Übertragung von Zollkontingentsanteilen 2000

Im Mai 2001 hat in Brüssel eine UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung stattgefunden Es ging darum, den 49 ärmsten Entwicklungsländern (PMA = pays les moins avancées) zu helfen, den Integrationsprozess in die Weltwirtschaft zu beschleunigen. Die Schweiz hat sich bereit erklärt, substanzielle Hilfen zu leisten Neben anderen Massnahmen soll den PMA-Ländern der Marktzugang zu den Industrieländern durch zusätzliche Zollpräferenzen erleichtert werden.
Bei den Industrieprodukten hat die Schweiz für Einfuhren aus diesen Ländern schon seit langem keine Zölle mehr erhoben Bei den landwirtschaftlichen Produkten dagegen wurde die Zollfreiheit nur fallweise gewährt, wie beispielsweise für die tropischen Früchte. Neu sollen weitere substanzielle Begünstigungen eingeräumt werden. In einer ersten Abbaustufe, die gemäss Beschluss des Bundesrates vom 27 Juni 2001 am 1 Januar 2002 in Kraft treten soll, werden den PMA-Ländern bei den landwirtschaftlichen Produkten Zollbegünstigungen von durchschnittlich 30% gegenüber dem heute geltenden Normaltarif gewährt
Zusätzliche Konzessionen an die ärmsten Entwicklungsländer im Agrarbereich
Produktegruppe Reduktion (gemäss Kapiteln 1–24 des Zolltarifs) Normaltarif in %
Tiere, Fleisch (inkl Zubereitungen), Eier, Futtermittel, Getreide, Ölsaaten, pflanzliche Öle und Fette -10 Milch- und Milchprodukte -30 Pflanzen, Schnittblumen, Gemüse, Früchte, tierische Öle, Zucker, Verarbeitungsprodukte
142 2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
-50 Quelle: BLW
Schnittblumen Wurstwaren Eisbergsalat Blumenkohl Tomaten Tafeläpfel Erdbeeren i n t b r u t t o A n z a h l Jahresanteile umgerechnet in t Mengenmässige Abtretungen Anzahl Vereinbarungen Quelle: BLW 0 2 500 450 421 37 52 26 174 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2 000 1 500 1 000 500 45 150
Zollkonzessionen für Entwicklungsländer existieren bereits. Sind diese höher als die mit Präferenzabkommen für PMA-Länder vorgesehenen, gelten diese weiterhin So beträgt beispielsweise die heutige Zollbegünstigung beim Zucker für alle Entwicklungsländer Fr. 22.– je 100 kg. Die 50%ige Zollkonzession vom momentan geltenden Normaltarif würde hingegen nur Fr 20 – je 100 kg betragen
Für das Jahr 2004 ist gemäss dem vom Bundesrat verabschiedeten Fahrplan eine weitere Zollsenkung für die PMA-Länder vorgesehen Spätestens auf den 1 März 2007 soll dem Parlament ein Antrag zur Verlängerung des Zollpräferenzbeschlusses vorgelegt werden Die bis 2005 gesammelten Erfahrungen sollen als Grundlage für einen Entscheid dienen, wann das Ziel der Nullzollpräferenz für alle Importe aus den PMALändern erreicht werden kann.
Es ist wichtig, dass diese Zollkonzessionen effektiv den ärmsten Entwicklungsländern zugute kommen. Es gilt, Trittbrettfahrer auszuschalten und Umgehungsgeschäfte effizient zu bekämpfen Es ist deshalb vorgesehen, die Mengenflüsse aus den begünstigten Ländern im Hinblick auf ihr bisheriges Produktionspotenzial zu kontrollieren Hat beispielsweise ein Land bisher noch nie Rosen exportiert, gilt die Vermutung, dass es sich um ein Umgehungsgeschäft handelt Ergibt eine Nachprüfung, dass die Rosen zu Unrecht mit dem Präferenzzoll importiert worden sind, wird der Normaltarif erhoben Zusätzlich kann die Zollpräferenz ausgesetzt werden, wenn die begünstigten Länder eine ungenügende Amtshilfe im Bereich der Ursprungszeugnisse leisten
Es gilt aber auch, die schweizerische Landwirtschaft vor Mengenzuflüssen, welche die Aufnahmekapazität des einheimischen Marktes überfordern und diesen dadurch nachhaltig stören, zu schützen In solchen Fällen hat der Chef des EVD die Möglichkeit, die Zollbegünstigung für die PMA-Länder für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen
Mit 112,1 Mio Fr Ausfuhrbeiträgen wurde der WTO-Plafonds von 114,9 Mio Fr leicht unterschritten. Erreicht wurde dies in erster Linie dadurch, dass Butter und Hartweizen, welche für die Herstellung von Exportprodukten verwendet wurden, im Veredlungsverkehr ein- und ausgeführt wurden und damit rund 21 Mio Fr (rund 15 Mio Fr für Butter und rund 6 Mio Fr für Hartweizen) weniger an Ausfuhrbeiträgen auszuzahlen waren Hartweizen wird in der Schweiz aus klimatischen Gründen nicht angebaut und bei der Butter waren Ergänzungseinfuhren notwendig, um die Inlandnachfrage zu decken Insgesamt konnte die Menge an ausgeführten Rohstoffen in Verarbeitungsprodukten von 83'500 t im Jahr 1999 auf 88'800 t um rund 6% gesteigert werden
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 143
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Ein- und Ausfuhr von Verarbeitungsprodukten (Schoggigesetz)
Bei den meisten Einfuhrregelungen sind in naher Zukunft keine grundlegenden Änderungen zu erwarten In der von der Beratenden Kommission Landwirtschaft eingesetzten «Arbeitsgruppe Märkte» sind bei einzelnen Marktordnungen die Kriterien über die Verteilung der Zollkontingente überprüft worden. Einzelne Anpassungen können voraussichtlich per 1 Januar 2002 umgesetzt werden
Bei der Einfuhrregelung Weisswein wurde per 1 Januar 2001 die Umstellung vom System der Versteigerung zum Kriterium «Reihenfolge der Verzollung» (Windhund an der Grenze) vollzogen Die ersten Erfahrungen mit dieser für das Kontingent Rot- und Weisswein angewendeten Bewirtschaftungsmethode entsprechen den Erwartungen Der Preiszerfall im Ausland verfälscht jedoch das Bild Eine detaillierte Wertung wird im Rahmen des nächsten Agrarberichtes vorgenommen. Beim Zollkontingent Brotgetreide wurde das bisherige Leistungssystem ab Mitte des Jahres 2001 durch die Versteigerung ersetzt
Die im Rahmen des bilateralen Agrarabkommens mit der EU eingegangenen Marktzutrittsverpflichtungen in Form von Zollkontingenten werden, mit Ausnahme bei Käse, Fleisch und Obstgehölzen, voraussichtlich nach dem Kriterium «Reihenfolge der Verzollung» zugeteilt Die Zollkontingente Käse und Fleisch sollen mittels Versteigerung und dasjenige für Obstgehölze nach dem Kriterium «Reihenfolge des Eingangs der Bewilligungsgesuche» (Windhund bei der Bewilligungsstelle) zugeteilt werden

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 144
■ Ausblick Ausfuhrmengen 1991/921998 19992000 i n t Quelle: BLW 94 000 92 000 90 000 88 000 86 000 84 000 82 000 80 000 92 000 85 000 84 000 89 000 Ausfuhrbeiträge 1991/921998 19992000 M i o . F r . Quelle: BLW 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 180 137 130 112
■ Kontrolltätigkeit im Berichtsjahr
Kontrollen, Revisionen und Untersuchungen
Die Kontrolltätigkeit der Sektion Inspektorat, als unabhängige Einheit des BLW, umfasste im Jahr 2000 neben den produktebezogenen Massnahmen die Bereiche Futterund Pflanzenschutzmittel sowie Tierzucht Die Kontrollen werden üblicherweise ohne Voranmeldung durchgeführt Eine kurzfristige Vorankündigung gibt es, wenn zusätzlich zu den Produkten auch der finanzielle Bereich einer Revision unterzogen wird Das ist nötig, weil die zu revidierenden Unterlagen sich meistens bei einer Treuhandgesellschaft befinden Ausschliessliche Finanzrevisionen werden immer vorangemeldet Solche können, je nach Umfang des Betriebes und der vom Bund gewährten Finanzmittel, mehrere Tage dauern Bei umfangreichen Revisionen sind grundsätzlich immer zwei Inspektoren dabei.
Das Inspektorat führte im Berichtsjahr 1’767 Kontrollen und Revisionen durch. Davon waren 12 reine Finanzrevisionen Die Kontrollen und Revisionen fanden schwerpunktmässig in den folgenden Bereichen statt:
– im Getreidebereich mit 226 Kontrollen und 5 Finanzrevisionen;
– im Zuckerbereich mit 1 Finanzrevision;
– im Kartoffelbereich mit 246 Kontrollen und 2 Finanzrevisionen;
– im Gemüse-, Obst- und Schnittblumenbereich mit 97 Kontrollen und 1 Finanzrevision;
– im Milch- und Milchproduktebereich mit 1'147 Kontrollen bzw. Finanzrevisionen;
– im Fleisch- und Eierbereich mit 39 Kontrollen und 2 Finanzrevisionen;
– im Bereich von nachwachsenden Rohstoffen mit 1 Kontrolle
■ Widerhandlungen
Die Kontrollen, Finanzrevisionen und Untersuchungen werden vom Inspektorat gemäss Auftrag der Fachsektionen durchgeführt Je nach Resultat werden die Unterlagen zur weiteren Bearbeitung verteilt:
– an die auftraggebenden Fachsektionen zur Ergreifung von Verwaltungsmassnahmen; und/oder
– an die Sektion Recht und Verfahren zur Beurteilung von eindeutigen Straftatbeständen
Im Berichtsjahr wurden – gestützt auf das Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht – 30 Milchkontingentsfälle direkt vom Inspektorat an Ort und Stelle im abgekürzten Verfahren erledigt. Die Inspektoren sind befugt, bestimmte Fälle bis zu einer maximalen Busse von 500 Fr mit einem so genannten «Strafbescheid im abgekürzten Verfahren» selber abzuschliessen, wobei hier – nach Unterschrift des Strafbescheides –jegliche Rekursmöglichkeit entfällt. Die übrigen Straffälle werden von der Sektion Inspektorat zur weiteren Bearbeitung an die Sektion Recht und Verfahren überwiesen Die Vorbereitung und Durchführung der Untersuchung, die Befragung der an einem Fall beteiligten Personen und die Zusammenstellung der Dossiers können einen oder mehrere Inspektoren Tage bis mehrere Wochen in Anspruch nehmen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 145
2
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.1.2 Milchwirtschaft
Die mit der neuen Milchmarktordnung gesetzten Rahmenbedingungen, welche zum Ziel haben, auf den in- und ausländischen Märkten eine möglichst grosse Menge Milch und Milchprodukte absetzen zu können, haben sich im Berichtsjahr 2000 nicht geändert Die Massnahmen zur Marktstützung sind so ausgestaltet, dass die Marktkräfte in Produktion, Verarbeitung und Handel möglichst gut zur Geltung kommen
Massnahmen 2000/2001

1 nur für einzelne Käse
2 nur für bestimmte Verwendungszwecke
3 nur bei Inlandverarbeitung
4 nach Käsesorte und Destination (EU - andere Länder) differenziert
5 nicht für Konsummilch
Nach wie vor trägt die Milchkontingentierung zu berechenbaren Verhältnissen auf dem Milchmarkt bei Die Stützungsmassnahmen sind schwerpunktmässig weiterhin auf den Käse ausgerichtet
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 146
Produkt Käse Butter Magermilch Milchpulver Konsummilch Rahm Frischmilchprodukte Massnahme Grenzschutz ■■■■■ Zulagen ■ Inlandbeihilfen ■ 1 ■ 2 ■ 2 ■ 3 Ausfuhrbeihilfen ■ 4 ■■ 5
Quelle:
BLW
■ Finanzielle Mittel 2000
In der Staatsrechnung für das Jahr 2000 sind die Ausgaben entsprechend der neuen Milchmarktordnung zusammengefasst Vergleiche mit dem Vorjahr (alte Ordnung) sind nur bedingt möglich Trotzdem ist nachvollziehbar, dass die Ausgaben des Bundes zugunsten der Milchwirtschaft im Jahr 2000 gegenüber dem Vorjahr abgenommen haben Im Berichtsjahr mussten insbesonders keine befristeten Übergangsmassnahmen und keine Liquidationskosten mehr finanziert werden
Die Ausgaben des Bundes betrugen im Milchbereich insgesamt 716,1 Mio Fr Knapp die Hälfte der finanziellen Mittel wurde in Form von Zulagen ausgegeben. Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte zeigt, dass der Bereich Käse 517,5 Mio Fr (72%) beanspruchte 108,5 Mio Fr (15%) wurden im Butterbereich und 82,7 Mio Fr (12%) im Pulverbereich eingesetzt 1% (7,4 Mio Fr ) wurde für die Administration benötigt Die Ausgaben für die Zulagen haben zugenommen, da der Ansatz der Zulage für die verkäste Milch auf den 1. Mai 2000 von 12 auf 20 Rp. je kg erhöht wurde.
Gemäss Zahlungsrahmen 2000 bis 2003 war im Jahr 2001 ursprünglich ein Abbau der finanziellen Mittel um 80 Mio. Fr. vorgesehen. Durch eine Budgetverschiebung im Zahlungsrahmen Produktion und Absatz im Ausmass von 30 Mio Fr werden nun die Kürzungen bei den Massnahmen zur Milchpreisstützung kleiner ausfallen
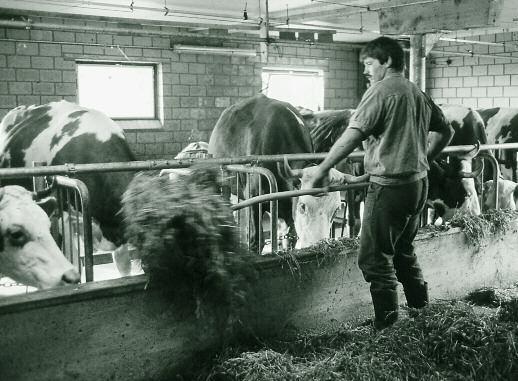
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 147
2
Mittelverteilung 2000 Total 716,1 Mio. Fr Inlandbeihilfen 27% Quelle: BLW Ausfuhrbeihilfen 26% Zulagen 46% Administration 1%
Tabelle 27, Seite A28
■ Handel mit Milchkontingenten ist attraktiv
Milchkontingentierung
Die Daten über die Milchkontingentierung des Milchjahres 1999/2000 geben auch einen Überblick über die strukturellen Verhältnisse in der Milchproduktion: Die Anzahl Milchproduzenten ist von 50'334 im Milchjahr 1990/1991 auf 39'890 im Milchjahr 1999/2000 zurückgegangen In der gleichen Periode nahm das durchschnittliche Kontingent pro Betrieb von 58'861 kg auf 75'689 kg zu, was einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von 2,8% entspricht
Kontingentshandel
1 definitive Daten
2 provisorische Daten Quelle: BLW
Das Verbot, Kontingente vom Berg- ins Talgebiet zu übertragen, hat seine Wirkung nicht verfehlt Die Produzenten des Berggebietes kauften rund 3'560 t mehr als sie verkauften und mieteten rund 2'240 t mehr als sie vermieteten Demgegenüber wurden 4'100 t ins Talgebiet verschoben im Austausch gegen eine Übernahme der Aufzucht Netto hat das Berggebiet somit rund 1'700 t Kontingente dazu gewonnen Hingegen gab es Verschiebungen innerhalb der Berggebiete Davon betroffen sind vor allem die Verbandsgebiete Tessin und Wallis.
Das neue Kontingentsabrechnungssystem hat die Feuerprobe bestanden Die Möglichkeit, Kontingentsüberschreitungen bis zu 5'000 kg auf das nächste Jahr zu übertragen, hat die Belastung der Produzentinnen und Produzenten mit Überlieferungsabgaben erheblich reduziert Für das Milchjahr 1999/2000 beträgt die Summe der Abgaben noch knapp 700'000 – Fr , für das Milchjahr 2000/2001 rund 243'835 Fr
Die Produzentinnen und Produzenten mit Kontingentsüberschreitungen mussten im Milchjahr 1999/2000 durchschnittlich rund 1'800 kg im laufenden Milchjahr 2000/2001 kompensieren Demgegenüber hatten die Produzentinnen und Produzenten mit nicht ausgeschöpften Kontingenten im Milchjahr 1999/2000 in der Folgeperiode die Möglichkeit durchschnittlich rund 2'700 kg nachzuliefern

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 148
Einheit 1999/2000 1 2000/2001 2 Verkauf Verfügungen Anzahl 2 207 2 689 Milch total Mio. kg 62,9 70,5 je Übertragung kg 28 508 26 217 Vermietung Verfügungen Anzahl 9 768 7 886 Milch total Mio kg 302,3 155,8 je Übertragung kg 30 950 19 761
■ Milchkontingente um drei Prozent erhöht
Eine zusätzliche Menge von rund 90'000 t kann im laufenden Milchjahr 2001/2002 produziert werden Die Milchverwerter und Milchproduzenten erachteten aufgrund der anhaltend guten Verfassung der Milchproduktemärkte eine Anpassung der Gesamtmenge als vertretbar und stellten im Mai 2001 den Antrag auf Erhöhung der Milchmenge Mit der Änderung der Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion wurde den Produzentinnen und Produzenten eine zusätzliche Menge im Umfang von 3% des zu Beginn des Milchjahres 2001/2002 zugeteilten Kontingentes gewährt
■ Änderung bei den Zusatzkontingenten
Die mit der Milchkontingentierung eingeführte Massnahme, für zugekaufte Tiere aus dem Berggebiet ein Zusatzkontingent von 1'500 kg pro Tier zu gewähren, fördert auch im neuen agrarpolitischen Umfeld die Arbeitsteilung zwischen Berg- und Talgebiet So wurden in den vergangenen Jahren stets rund 17'000 Tiere über diesen Kanal ins Talgebiet abgesetzt.
Da im Rahmen der Arbeitsteilung Berg/Tal vermehrt Aufzuchtverträge zwischen Bergund Talproduzenten abgeschlossen werden, ist die Zukaufsperiode ab 1 Mai 2001 auf das ganze Jahr geöffnet worden
Nach dem alten Recht mussten die Produzentinnen und Produzenten, die ein Zusatzkontingent erhielten, die Tiere aus dem Berggebiet mindestens bis zum 15 April des dem Zukauf folgenden Jahres auf ihrem Betrieb halten. Mit der Öffnung der Zukaufsperiode auf das ganze Jahr musste deshalb auch die Haltedauer angepasst werden: Neu gilt eine «rollende» Frist von sechs Monaten nach dem Zukauf Diese Änderungen sind am 1 Mai 2001 in Kraft getreten
Zusammen mit der Anpassung der Gesamtmenge wurden im Mai 2001 auch die Zusatzkontingente erhöht Wer in diesem Jahr ein Tier aus dem Berggebiet zugekauft hat, erhält im folgenden Milchjahr 2001/2002 neu 2'000 kg anstatt wie bisher 1'500 kg
■ Ausblick
Für das Milchjahr 2000/2001 wurde ermöglicht, Überlieferungen von mehr als 5'000 kg ohne Abgabe auf das nächste Milchjahr zu übertragen Damit ist der Druck auf die Milchproduzenten zum Verkauf von Kühen reduziert und der besonderen Situation wegen BSE somit Rechnung getragen worden
Die übertragenen Mengen müssen im Milchjahr 2001/2002 kompensiert werden Dank der gewährten zusätzlichen Kontingentsmengen können die Produzenten allgemein auf gleichem Niveau wie im vorangehenden Milchjahr 2000/2001 weiter produzieren
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 D I E A G R A R P O L I T I S C H E N M A S S N A H M E N 149
2
■ www.milchstatistik.ch
Marktstützung mit Zulagen und Beihilfen
Auch zwei Jahre nach der Einführung der neuen Rahmenbedingungen kann festgestellt werden, dass sich die Milchmarktordnung bewährt. Der Zielpreis von 77 Rp. je kg Milch wurde im Durchschnitt übertroffen Der Vollzug funktioniert gut; die Abrechnungen der Zulagen und Beihilfen können termingerecht erstellt und ausbezahlt werden Das System der Gesuchstellung findet bei den Milchverwertern und Produzenten hohe Akzeptanz
Im Rahmen des Informatikprojektes Milchbeihilfen wurde auch ein MilchInfo-System erarbeitet, welches über Internet abrufbar ist. Dieses MilchInfo-System enthält Daten über die Milchverarbeitung und über die ausbezahlten Zulagen und Beihilfen
Im Zusammenhang mit der neuen Milchmarktordnung wurden auch neue Rechtsgrundlagen für die Administration und Auszahlung der Zulagen und Beihilfen für Milchprodukte geschaffen Um in den Genuss von Zulagen oder Beihilfen zu kommen, muss bei der Treuhandstelle Milch (TSM) ein Gesuch eingereicht werden Die Angaben für das MilchInfo-System werden über die Gesuche der Milchverwerter und der Empfänger von Zulagen und Beihilfen – unter Aufsicht des BLW – von der TSM erhoben und unter Einhaltung des Datenschutzes monatlich aufbereitet
Die Daten der Gesuche werden seit dem 1. Mai 1999 elektronisch erfasst. Somit sind in der Datenbank ab diesem Zeitpunkt Informationen vorhanden und für das MilchInfo-System verfügbar Ein Teil der Informationen betrifft statistisch aufbereitete Daten zur Milchverarbeitung, welche öffentlich – unter www milchstatistik ch – zugänglich sind Diese Auswertungen wurden in Zusammenarbeit mit der Branche erarbeitet. Die monatlichen Statistiken werden mit nur 45 Tage Verzögerung publiziert. Es besteht die Möglichkeit, weitere statistische Auswertungen zu veröffentlichen
Folgende Informationen sind unter www.milchstatistik.ch zu finden:
– Vermarktete Milch nach Monaten und nach Herkunft;
– Produktion der verschiedenen Milchprodukte wie Käse, Butter, Milchpulver und -kondensate, Konsummilch und Milchspezialitäten;
– Milchverwertung in Milchäquivalenten;
– Zulagen und Beihilfen nach Massnahmen (jährlich)
■ Änderungen 2000
Per 1. Mai 2000 wurde die Zulage für verkäste Milch von 12 auf 20 Rp. je kg angehoben Diese Erhöhung bewirkt eine Verbilligung des Rohstoffes für die Käseherstellung Unter Berücksichtigung der Budgetvorgabe 2000 mussten die Ansätze der Beihilfen gesenkt werden. Die Reduktion der Beihilfen für Käse wurde durch die höhere Zulage für verkäste Milch kompensiert Die Ansätze für Buttermischungen wurden um Fr 2 – je kg auf Fr 0 71 für Kleinpackungen und Fr 2 25 für Grosspackungen reduziert
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 150
■ Vorgaben 2001
Unter Berücksichtigung der finanzpolitischen Beschlüsse des Parlamentes zum Budget 2001 und angesichts der günstigen Marktsituation hat der Bundesrat zu Beginn 2001 beschlossen, den Zielpreis unverändert bei 77 Rp je kg Milch zu belassen Der effektive Produzentenpreis resultiert allerdings aus den Verhandlungen zwischen den Marktpartnern Zudem wurde die Zulage für verkäste Milch ausgedehnt Ab 1 Mai 2001 ist die Schaf- und Ziegenmilch, die zu Käse verarbeitet wird, ebenfalls zulageberechtigt Aufgrund der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wurden die Ansätze der Inland- und der Ausfuhrbeihilfen reduziert
■ Ausblick
Im Jahr 2002 werden gemäss Zahlungsrahmen 2000 bis 2003 560,5 Mio Fr oder 99 Mio. Fr. weniger finanzielle Mittel für die Milchpreisstützung zur Verfügung stehen. Dies wird zur Folge haben, dass auch im Jahr 2002 Beihilfen und allenfalls Zulagen reduziert werden müssen
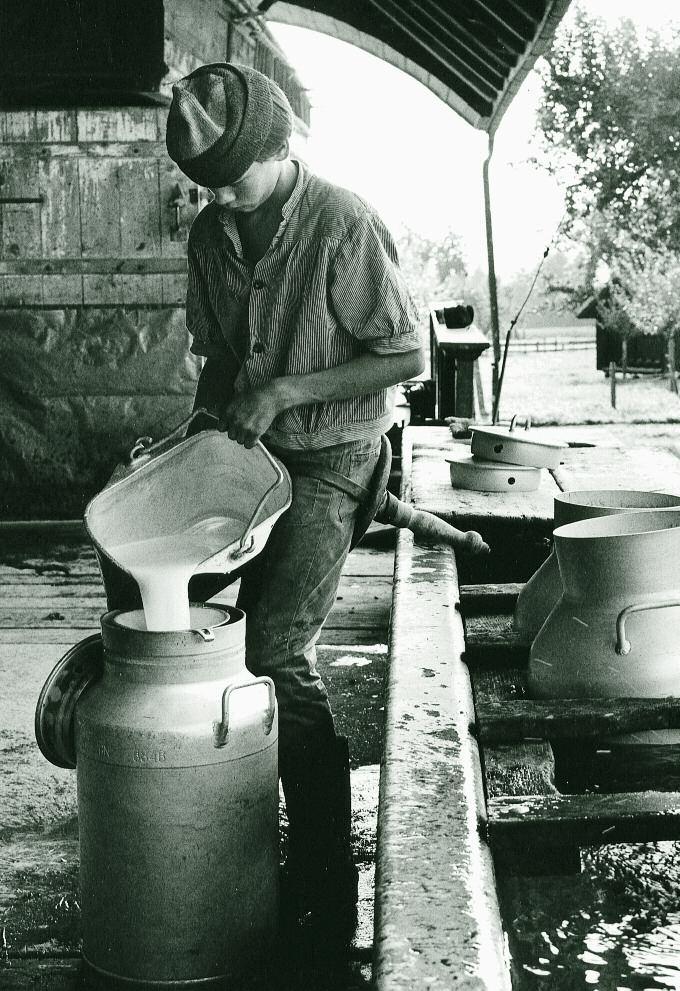
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 151
2
Das wichtigste Instrument zur Unterstützung der Fleischproduktion sind die Massnahmen an der Grenze; für die Eierproduktion sind es die Inlandbeihilfen Lediglich 2,9% der Marktstützungsmittel (Milch- und Viehwirtschaft sowie Pflanzenbau, ohne Absatzförderung) fliessen in die Viehwirtschaft
Im Berichtsjahr gab es keine Marktabräumung in Schlachtbetrieben Zudem wurde kein Schweinefleisch verbilligt abgegeben oder mit Beiträgen eingelagert

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 152 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1.3 Viehwirtschaft
Massnahmen 2000 Tier/Produkt Rinder Kälber Schweine Pferde Schafe Ziegen Geflügel Eier Massnahme Grenzschutz ■■■■■■■■ Marktabräumung ab öffentlichen Märkten ■■■ Marktabräumung in Schlachtbetrieben ■■■■■ Einlagerungsaktionen ■■■ Verbilligungsaktionen ■■■ Praxisnahe Versuche ■ Umstellungsbeiträge ■ Sammel- und Sortierkostenbeiträge ■ Aufschlagsaktionen und Vermarktungsmassnahmen ■ Verwertungsbeiträge Schafwolle ■ Ausfuhrbeiträge 1 ■■■■ Höchstbestände ■■■■ 1 beschränkt auf Zucht- und Nutzvieh Quelle: BLW
■ Finanzielle Mittel 2000
Im Jahr 2000 budgetierte der Bund 49,1 Mio. Fr. für Massnahmen der Viehwirtschaft. Rund 60% dieser Mittel stammen aus zweckgebundenen Zollanteilen, die auf Einfuhren von Fleisch, Eiern und Eiprodukten erhoben werden und in den Fleischfonds und die Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte fliessen. Die effektiven Ausgaben beliefen sich auf 26,2 Mio Fr Vom Budget wurden somit 22,9 Mio Fr nicht beansprucht, insbesondere weil weiterhin Exportrestriktionen für Zucht- und Nutzvieh bestanden Im Weiteren wurden für die Umstellung auf tiergerechte Legehennenhaltung weniger finanzielle Mittel beansprucht, da viele Legehennenhalter bereits während dreier Jahre, 1997 bis 1999, Umstellungsbeiträge bezogen hatten
Mittelverteilung 2000
Total 26,2 Mio. Fr
Verwertungsbeiträge
Schafwolle 4%
Ausfuhrbeihilfen
Zucht- und Nutzvieh 11%
Beiträge zur Unterstützung der inländischen
Eierproduktion 35%
■ Schlachtvieh und Fleisch: Leistungsaufträge
Leistungsauftrag
Proviande 28%
Einlagerungs- und Verbilligungsbeiträge für Rind- und Kalbfleisch 22%
Quellen: Staatsrechnung, BLW
Alle Massnahmen im Schlachtvieh- und Fleischsektor werden mit Mitteln des Fleischfonds finanziert Seit dem 1 Januar 2000 erfüllt die Proviande im Auftrag des BLW Dienstleistungen:
1. Neutrale Qualitätseinstufung auf überwachten öffentlichen Märkten und in Schlachtbetrieben
Die Proviande stufte in 43 Schlachtbetrieben mit jährlich mehr als 1‘200 Schlachteinheiten (z B 1'200 Kühe oder 6'000 Schweine) die Qualität der geschlachteten Tiere ein Das Qualitätsmerkmal bei Tieren der Rindvieh-, Pferde- und Schafgattung sowie bei Gitzi ist die Handelsklasse, eine Kombination von Fleischigkeits- und Fettgewebeklasse Sie wird visuell bestimmt Massgebend für die Qualität bei Tieren der Schweinegattung ist der Magerfleischanteil Dieser wird mit einem technischen Gerät gemessen Das BLW hat das Fat-O-Meater, das CSB-Ultra-Meater, das AUTOFOM und die Schieblehre als Geräte zugelassen Auf überwachten öffentlichen Märkten bestimmte die Proviande die Handelsklasse für Tiere der Rindvieh- und Schafgattung Insgesamt arbeiteten über 100 Personen im Klassifizierungsdienst der Proviande, wobei die allermeisten teilzeitlich angestellt waren Um die anspruchsvolle Einstufung kompetent zu erledigen, setzte die Proviande die Aus- und Weiterbildung in den Mittelpunkt des Berichtsjahres Mit der neutralen Qualitätseinstufung werden 80 bis 90% aller geschlachteten Tiere sowie alle Tiere auf überwachten öffentlichen Märkten erfasst
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 153
2
Tabelle 28, Seite A29
■ BSE-Massnahmen
2. Überwachung von öffentlichen Märkten und des Marktgeschehens in Schlachtbetrieben sowie Durchführung von Marktentlastungsmassnahmen
Die Proviande organisierte in Zusammenarbeit mit bäuerlichen Organisationen und/oder kantonalen Stellen 992 Grossvieh-, 492 Kälber- und 296 Schafmärkte Sie teilte den Zollkontingentanteilsinhabern die nicht verkauften Tiere auf den Märkten zu marktüblichen Preisen zu (Marktabräumung) Wegen des geringeren Angebotes sind die Zuteilungen gegenüber dem Vorjahr beim Grossvieh auf 2'917 Stück (–925 Stück) und bei den Kälbern auf 168 Stück (–1'624 Stück) gesunken Hingegen wurden 292 Schafe und Weidelämmer zugeteilt; im Vorjahr gab es keine Zuteilungen
Mit 4,02 Mio Fr wurden im November und Dezember 1'061 t Fleisch von Bank- und Verarbeitungstieren eingelagert 1,47 Mio Fr benötigte die Einlagerung von 328 t Kalbfleisch im Mai. Die Proviande organisierte und kontrollierte die Einlagerungen.
3. Erfassung und Kontrolle der Gesuche um Zollkontingentsanteile
Per Ende Oktober übermittelte die Proviande rund 1'000 elektronisch erfasste und kontrollierte Gesuche um Zollkontingentsanteile für das Jahr 2001 ans BLW Das BLW berechnete anschliessend die Zollkontingentsanteile an den Fleisch- und Fleischwarenkategorien mit einer neuen EDV-Applikation und teilte sie am 28 November 2000 mittels Verfügung zu Die Berechnung basierte erstmals auf den neuen Kriterien zur Bemessung der Inlandleistung Der grösste Wechsel betraf das Ziegen- und Schaf- bzw Lammfleischimportregime, wo neu eine vorgängige Inlandleistung zu erbringen war
Der Bundesrat hat am 20 Dezember 2000 mit einer Änderung der Tierseuchenverordnung ein generelles Tiermehlverbot beschlossen. Verboten wurde auch die Verfütterung sogenannter Extraktionsfette, die bei der Produktion von Tiermehlen anfallen Das Verbot trat am 1 Januar 2001 in Kraft An den anfallenden Mehrkosten, die bei der Entsorgung durch Verbrennung entstehen, beteiligt sich der Bund mit bis zu 75%

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 154
Zahlen zu den überwachten öffentlichen Märkten
Merkmal Einheit Kälber Grossvieh Tiere der Schafgattung Überwachte öffentliche Märkte Anzahl 492 992 296 Aufgeführte Tiere Anzahl 52 261 79 108 65 935 Anteil aufgeführte Tiere an allen Schlachtungen % 18 22 26 Zugeteilte Tiere (Marktabräumung) Anzahl 168 2 917 292 Quelle: Proviande
2000
■ Eier: Massnahmen zur Unterstützung der inländischen Produktion
Am 14. Februar 2001 hat der Bundesrat beschlossen, 7 Mio. Fr. für den Ankauf von Schweizer Rindfleisch aus frischen Schlachtungen für die Ausfuhr im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe bereit zu stellen Maximal 2 Mio Fr standen für eine Informationskampagne Schweizer Rindfleisch zur Verfügung. Bis Ende März 2001 kaufte die Proviande rund 713 t Rindfleisch auf dem Markt auf Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit war anschliessend für den Transport und die Verteilung des Rindfleisches in Nordkorea zuständig
Weiter hat der Bundesrat am 28 Februar 2001 beschlossen, eine BSE-Kontrolleinheit vorerst für eine Zeitdauer von 6 Jahren (2001–2006) zu schaffen, welche die Kantone beim Vollzug unterstützt Zudem wurden 1,1 Mio Fr für weitere Forschungen über Prionenkrankheiten und deren Übertragung eingesetzt.
Mit Bundesratsbeschluss vom 2 Mai 2001 standen 8,5 Mio Fr für den zweiten Ankauf von mindestens 700 t Schweizer Rindfleisch für die Ausfuhr im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe bereit Die restlichen Mittel konnten für die Einlagerung von Kalbfleisch verwendet werden
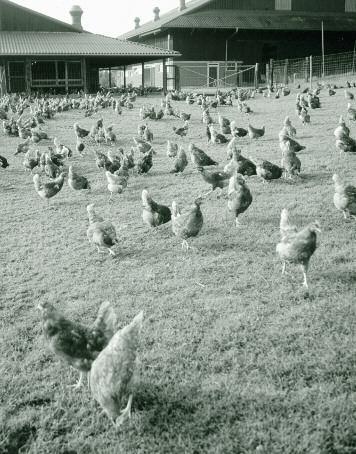
Am 27 Juni 2001 hat der Bundesrat 8 Mio Fr für weitere Marktentlastungsmassnahmen gesprochen. Die Hälfte davon konnte für den dritten Ankauf von 400 t Rindfleisch genutzt werden 2 Mio Fr dienten für Verbilligungs- und Einlagerungsaktionen nach Schlachtviehverordnung Das EVD erhielt ausserdem die Kompetenz, die verbleibenden 2 Mio. Fr. für Massnahmen einzusetzen, welche die grösstmögliche Effizienz gewährleisten
Sämtliche Massnahmen im Eiersektor werden mit Mitteln aus der Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte, die aus zweckgebundenen Zollanteilen geäufnet wird, finanziert Diese Kasse steht für die Unterstützung der Inlandeierproduktion auf bäuerlichen Betrieben und zur Finanzierung von Verwertungsmassnahmen zugunsten der Schweizer Eier zur Verfügung.
Der Bundesrat hatte bereits per 1 September 1996 zwei Übergangsmassnahmen verabschiedet, welche bis Ende 2001 befristet sind:
1 Das BLW zahlt Sammel- und Sortierkostenbeiträge für die Übernahme von Konsumeiern bei ehemals geschützten Eierproduzentinnen und -produzenten Diese Beiträge in der Höhe von 3,9 Mio Fr für insgesamt 124,14 Mio Eier dienten im Berichtsjahr auch zur Preis- und Absatzstützung.
2 Weiter wird die Umstellung auf tierfreundliche Legehennenhaltung (RAUS und/ oder BTS) gefördert. Eierproduzentinnen und -produzenten erhalten zusätzlich zu den RAUS- und BTS-Beiträgen Umstellungsbeiträge 340 Betriebe mit insgesamt 451'800 Legehennen erhielten im Jahr 2000 Umstellungsbeiträge in der Höhe von 3,39 Mio Fr Die Reduktion um 2,45 Mio Fr gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass viele Betriebe den auf drei Jahre beschränkten Umstellungsbeitrag bereits erhalten haben und damit im Berichtsjahr nicht mehr beitragsberechtigt waren
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 155
2
■ Nutz- und Sportpferde: Versteigerung von Zollkontingentsanteilen
Zusätzlich zu den Übergangsmassnahmen können die Mittel der Preisausgleichskasse für Aufschlagsaktionen und Vermarktungsmassnahmen bei saisonalem Überangebot an Schweizer Hühnereiern verwendet werden Ziel ist, die Preise zu stabilisieren Das BLW stellte im Jahr 2000 nach Anhörung der interessierten Kreise maximal 2,5 Mio. Fr. für diese Massnahmen zur Verfügung; sie begannen nach Ostern und dauerten bis Ende Oktober Nach Ostern sinkt die Nachfrage nach Konsumeiern sehr schnell, wohingegen das Angebot kurzfristig nicht im selben Ausmass reduziert werden kann Insgesamt wurden 16,0 Mio überschüssige Inlandeier aufgeschlagen und zu Eiprodukten verarbeitet und 14,6 Mio Inlandeier verbilligt an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben Die für diesen Zweck eingesetzten 1,93 Mio Fr trugen mindestens teilweise zur Preisstabilisierung bei
Weitere Mittel dienen der Mitfinanzierung von praxisnahen Versuchen beim Geflügel sowie der Verbreitung der entsprechenden Ergebnisse bei der Bildung und Beratung Im Jahre 2000 unterzeichnete das BLW sowohl mit dem FIBL wie auch mit der Geflügelzuchtschule in Zollikofen Verträge zur Durchführung von Versuchen, die teilweise bis ins Jahr 2001 laufen Die Ergebnisse werden laufend an Informationsveranstaltungen präsentiert, in den einschlägigen Fachzeitschriften publiziert und fördern dadurch die Verbesserung der Geflügelhaltung Insgesamt wurden für diese Forschungsprojekte im Berichtsjahr 122'000.– Fr. aus der Preisausgleichskasse ausgegeben
Das BLW hat das Zollkontingent «Tiere der Pferdegattung (ohne Zuchttiere)» für das Jahr 2000 in zwei Hälften von je 1'561 Stück im September 1999 und im April 2000 ausgeschrieben und versteigert Natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften mit Wohnsitz oder Sitz im schweizerischen Zollgebiet reichten eine Gebotsmenge von 8'236 Stück ein. Insgesamt teilte das BLW 346 Personen Zollkontingentsanteile für die Kontingentsperiode 2000 zu Der Versteigerungserlös zugunsten der Bundeskasse belief sich auf 1,3 Mio Fr
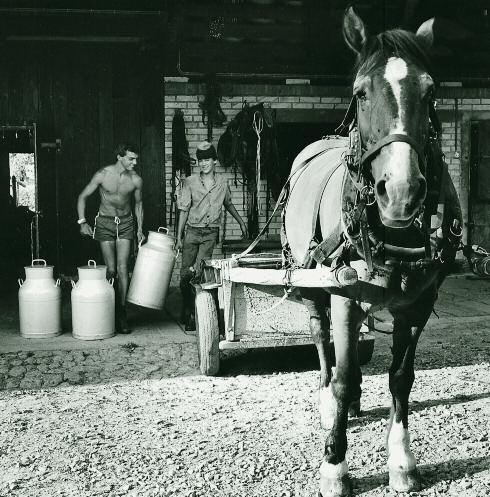
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 156
■ Ausblick
Der Bundesrat hat am 21. September 2001 Änderungen auf dem Geflügel- und Pferdemarkt beschlossen Nach dem Bundesratsbeschluss werden für Geflügel zur Eierproduktion einerseits die Direktzahlungen für RAUS und BTS um je 100 Fr pro GVE erhöht, andererseits wird der Um- und Neubau von tierfreundlichen Haltungssystemen bis Ende 2006 mit einem Investitionsbeitrag von 600 Fr pro GVE unterstützt Bei Mastpoulets und Truten steigen die Direktzahlungen für RAUS um 100 Fr pro GVE Neu werden die Teilzollkontingente Konsum- und Verarbeitungseier sowie «Esel, Maultiere und Maulesel» nach dem Windhund-Verfahren zugeteilt Die beiden Teilzollkontingente Kleinponys sowie Sport-, Nutz- und Freizeitpferde werden zu einem einzigen zusammen gelegt Der Bundesrat hat zudem das Teilzollkontingent Verarbeitungseier um 2'500 t erhöht Die Erhöhung geht zulasten des Teilzollkontingentes Konsumeier Alle Änderungen treten auf den 1. Januar 2002 in Kraft.
Die Senkung der Zollbelastung für Futtermittel hilft mit, die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Fleisch- und Eierproduktion gegenüber der ausländischen Konkurrenz zu verbessern

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 157
2
Massnahmen 2000
2.1.4 Pflanzenbau
Die Umsetzung der Agrarpolitik 2002 im Pflanzenbau ist im Berichtsjahr weiter vorangeschritten Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr betrafen vor allem den Ackerbau Die Einführung des Flächenbeitrags für Ölsaaten an Stelle der bisherigen begrenzten Preis- und Übernahmegarantie war die wichtigste Umstellung Der Wechsel vom Verarbeitungsbeitrag zum Leistungsauftrag Zucker hatte bereits mit der Ernte 1999 begonnen Die erste Abrechnung der neuen Marktordnung fiel jedoch ins Rechnungsjahr 2000 Bei den Spezialkulturen waren nur kleine Anpassungen zu verzeichnen
1 Je nach Verwendungszweck bzw Zollposition kommen teilweise keine oder nur reduzierte Grenzabgaben zur Anwendung
2 Administration und Auszahlung der Beiträge im Rahmen eines Leistungsauftrages an private Organisationen
3 Betrifft nicht die gesamte Erntemenge (Ausbeuteausgleich für Presswerke zur Speiseölgewinnung, Beiträge an Pilot- und Demonstrationsanlagen für NWR, Frischverfütterung und Trocknung von Kartoffeln Marktreserve für Kernobstsaftkonzentrat)
4 Nur für Kartoffeln

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 158
■■■■■■■■■■■■■■■■
Massnahme Grenzschutz 1 ■■■■■■■■ Begrenzte Preis- und Übernahmegarantie ■ Verarbeitungsbeiträge ■ 3 ■ 2,3 ■ 2 ■ 2 ■ 3 Spezifische Flächenbeiträge ■■■ 2 Ausfuhrbeiträge ■■ 2 4 ■
Quelle: BLW K u l t u r B r o t g e t r e i d e F u t t e r g e t r e i d e, K ö r n e r l e g u m i n o s e n , F a s e r p f l a n z e n Ö l s a a t e n K a r t o f f e l n Z u c k e r r ü b e n S a a t g u t O b s t G e m ü s e, S c h n i t t b l u m e n
■ Finanzielle Mittel 2000
Die Hälfte der direkten Marktstützung im Pflanzenbau wurde zu Gunsten der Verarbeitung, Verwertung und Lagerhaltung ausbezahlt Mehr als ein Drittel der Marktstützung gelangte in Form von Flächenbeiträgen direkt zu den Produzenten Die restlichen Mittel wurden als Exportbeiträge eingesetzt. Mit der Agrarpolitik 2002 werden vermehrt private Organisationen mit Vollzugsaufgaben betraut Im Berichtsjahr wurden bereits 45% der Bundesmittel im Rahmen von Leistungsaufträgen administriert und ausbezahlt Die beiden wichtigsten Aufträge waren der Verarbeitungsauftrag an die Zuckerfabriken und der Verwertungsauftrag Kartoffeln an die swisspatat
Mittelverteilung 2000
Exportbeiträge 13%
Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 46%
Diverses 4%
Flächenbeiträge 37%
Quelle: Staatsrechnung
Gegenüber dem Vorjahr wurden die Ausgaben im Pflanzenbau gesamthaft um 30 Mio Fr reduziert Je 20 Mio Fr sind erntebedingt bei der Obstverwertung und durch die Reduktion der Flächenbeiträge für Futtergetreide eingespart worden Dagegen sind die Aufwendungen für Zuckerrüben im Berichtsjahr um 14 Mio Fr gestiegen, weil die Zolleinnahmen auf Importzucker erstmals vollumfänglich in die allgemeine Bundeskasse flossen und die Zweckbindung aufgehoben wurde Im Rechnungsjahr 2000 wurde die Ernte 1999 abgerechnet Die Abgeltung für den Verarbeitungsauftrag Zucker beläuft sich bis 2003 auf jährlich 45 Mio. Fr. Wegen den ausserordentlich tiefen Weltmarktpreisen für Zucker erhielten die Fabriken eine zusätzliche Abgeltung von 1,8 Mio Fr Ab der Ernte 2001 erhalten die Zuckerfabriken die Möglichkeit, Bio-Zucker innerhalb des Verarbeitungsauftrages zu produzieren Die Menge ist auf 2'000 t beschränkt Die maximale inländische Zuckermenge wird mit dieser Änderung um ein Prozent erhöht
In der Rechnung 1999 wurde erst die Hälfte der Abgeltung des Verwertungsauftrages Kartoffeln ausbezahlt. Die andere Hälfte ist in den Ausgaben 2000 enthalten. Jährlich beträgt die Abgeltung 18 Mio Fr Die übrigen Aufwendungen zu Gunsten der Kartoffelverwertung entfallen auf den Verwertungsauftrag Saatkartoffeln und die Exportbeiträge für Kartoffelprodukte.
Die geringeren Ausgaben für Getreide sind auf die Reduktion der Anbauprämien für Futtergetreide zurückzuführen Bei den Körnerleguminosen erhielten erstmals auch Lupinen Anrecht auf den Flächenbeitrag Dieser Beitrag wurde im Berichtsjahr für 36 ha ausbezahlt.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 159
2
Total 152,8 Mio. Fr
Tabelle 29, Seite A30
Sowohl die Anbauflächen wie die Erträge von Raps und Soja waren im Jahr 2000 unterdurchschnittlich Dies wirkte sich direkt auf die Bundesausgaben aus 27,1 Mio Fr flossen als Flächenbeiträge zu den Ölsaatenproduzenten, 1,4 Mio Fr wurden für den Ausbeuteausgleich an die Presswerke benötigt
Für die nachwachsenden Rohstoffe (NWR) wurden im Berichtsjahr Beiträge in der Höhe von 1,2 Mio Fr ausbezahlt Die Stützung beinhaltete den Flächenbeitrag für Faserpflanzen von Fr 2000 –/ha sowie die Verarbeitungsbeiträge an Pilot- und Demonstrationsanlagen für Ölsaaten und die Gewinnung von Ethanol aus Biomasse. Für die Ethanolgewinnung wurden erst kleine Beiträge ausbezahlt Die Reduktion der Bundesausgaben für NWR war möglich, weil insbesondere Raps neu in den Genuss des Ölsaatenflächenbeitrags kam und nur noch die ergänzenden Verarbeitungsbeiträge der NWR-Stützung zugeordnet wurden
Ausgaben für die Obstverwertung 2000
Export Kirschen 5,6%
Verwertung von Kernobst im Inland 6,9%
Anderes 2,1% davon Marktentlastung (Kirschen und Zwetschgen) 1,3%
Export von Birnensaftkonzentrat 11,3%
Export von Apfelsaftkonzentrat 70,1%
Quelle: BLW
Mittelverteilung nach Kulturen M i o F r 1999 2000 Quelle: Staatsrechnung Zuckerrüben Kartoffeln Getreide Körnerleguminosen Ölsaaten NWR Saatgutproduktion Obst Weinbau 0 45 50 40 35 30 25 20 15 10 5 2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 160
Export andere Kernobstprodukte 4,0% Total 19,3 Mio. Fr.
■ Letzte Vorbereitungen für die neue Getreidemarktordnung
Der Bund beteiligt sich finanziell an der Verwertung von Mostobst und an Marktentlastungsmassnahmen für Steinobst
Zu Beginn des Jahres 2000 stammten die 5'400 t Apfel- und Birnensaftkonzentrat, die noch auszuführen waren, aus den Ernten 1998 und 1999 Für den Abbau dieser Lagerbestände sowie der bereits im Jahre 1999 exportierten 3'700 t Apfelsaftkonzentrat, die mit Budget 2000 bezahlt wurden, setzte der Bund 15,7 Mio Fr ein 1,8 Mio Fr steuerte die Branche zusätzlich als Selbsthilfe bei Die Verwertung der 256'000 t Mostobst der Ernte 2000 lieferte allerdings wiederum 18'500 t Kernobstsaftkonzentrat für den Export Da die internationalen Märkte wegen der reichen Ernte 2000 gesättigt waren, konnten die neuen Lager in den letzten Monaten des Berichtsjahrs nicht abgebaut werden.

Die Marktentlastungsmassnahmen für Kirschen und Zwetschgen, inkl bei den ersteren die Exportbeiträge, kamen auf 1,3 Mio. Fr. zu stehen.
Ackerkulturen
Im Ackerbau wurden die Massnahmen der Agrarpolitik 2002 für Zuckerrüben und Kartoffeln weiter konsolidiert, für Ölsaaten und NWR neu eingeführt und für Getreide vorbereitet
Die begrenzte Preis- und Übernahmegarantie für Brotgetreide galt letztmals für die Ernte 2000 Die Garantiemenge von 382'200 t verkaufte der Bund zum Selbstkostenpreis an die Müller Das übrige Brotgetreide wurde deklassiert und als Futtermittel versteigert. Die Produzenten deckten die Kosten der Deklassierung mit einem Verwertungsbeitrag von Fr 6 85/dt
Im Hinblick auf die Liberalisierung wurden die Produzentenpreise gegenüber dem Vorjahr um Fr 7 –/dt gesenkt und betrugen für den Weizen der Klasse 1 noch Fr 75 –/dt Auf den gleichen Zeitpunkt wurde die Anbauprämie für Futtergetreide von Fr 770 –auf Fr 400 – je ha abgebaut Sie ist seit dem Erntejahr 2001 ganz aufgehoben Damit blieb die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit des Brotgetreideanbaus gegenüber dem Futtergetreideanbau während der Übergangsphase weitgehend erhalten Die Flächenbeiträge für Körnerleguminosen wurden unverändert weitergeführt Die betriebswirtschaftliche Attraktivität von Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Lupinen gegenüber Getreide hat sich dadurch erhöht.
Damit die Schweizer Fleisch- und Eierproduzenten ihre Marktanteile unter härteren Konkurrenzverhältnissen halten können, wurde per 1. Juli 2001 der Schwellenpreis für Gerste (Futtergetreide) um Fr 5 – auf Fr 46 – je 100 kg gesenkt Analog dazu wurde der Schwellenpreis für Eiweissfuttermittel reduziert Zur Abgeltung jenes Teils der gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Ackerbau, der als Folge der Schwellenpreissenkung und der Liberalisierung der Getreidemarktordnung nicht mehr über den Preis entschädigt werden kann, wurde ein Zusatzbeitrag von Fr. 400.– je ha für die Offene Ackerfläche und für Dauerkulturen eingeführt
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 161
2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
Erstmals konnte der Flächenbeitrag für Raps, Soja, Sonnenblumen und Hanf von Fr 1500 – pro ha geltend gemacht werden Der inländische Marktpreis hat die garantierten Ölsaatenpreise abgelöst Um eine günstige Ausgangslage für den Start der neuen Marktordnung zu schaffen, hat der Bund 2‘600 t Rapsöl in der Nahrungsmittelhilfe eingesetzt Die Liquidation der alten Marktordnung konnte Mitte 2001 mit der Schlussrevision der Rapsrechnungen abgeschlossen werden
Der neu eingeführte Ausbeuteausgleich für Presswerke ist ein Verarbeitungsbeitrag und stützt den Preis für inländische Ölsaaten zur Speiseölgewinnung, die in den beiden Presswerken Florin AG, Muttenz und Oleificio SABO, Manno (TI) verarbeitet werden Der Ausbeuteausgleich hat zum Ziel, die Minderausbeute von reinen Presswerken gegenüber derjenigen von Extraktionswerken finanziell auszugleichen. Dies ermöglicht eine Gleichstellung der importierten und inländischen Ölsaaten, weil auch beim Import je nach Verarbeitungszweck unterschiedliche Grenzabgaben erhoben werden Die Ansätze des Ausbeuteausgleichs schwankten zwischen Fr. 5.90/dt (Tiefststand bei Soja) und Fr 9 15/dt (Höchststand bei Sonnenblumen) Der Ansatz ist abhängig vom Zollansatz für Futtermittel, welcher wegen des Schwellenpreissystems regelmässig den Weltmarktpreisen angepasst wird Das Extraktionswerk der Firma Lipton-Sais, das zwei Drittel der inländischen Verarbeitungskapazität besass, wurde per November 2000 geschlossen. Mit dem praktisch vollständigen Wegfall des Extraktionsverfahrens in der Schweiz hat die ursprüngliche Funktion des Ausbeuteausgleichs mittlerweile an Bedeutung verloren
Die Marktpartner haben innerhalb der Branchenorganisation swiss granum die Koordination des Ölsaatenmarktes übernommen Seither wird jährlich eine neue Branchenvereinbarung zwischen den Produzenten und Ölwerken ausgehandelt
Pilot- und Demonstrationsanlagen, die Ölsaaten zu technischen Zwecken verarbeiten, erhielten erstmals einen Verarbeitungsbeitrag von Fr 30 –/dt Diese Anlagen stellen aus Rapsöl vor allem Bio-Diesel und leicht abbaubare Schmierstoffe zur Verlustschmierung her. Ab der Ernte 2001 beträgt der Beitrag Fr. 20.–/dt.
Ab der Ernte 2001 erhalten die Produzenten für Ölkürbisse den gleichen Flächenbeitrag wie für Ölsaaten Dadurch wird die Produktion von Kürbiskernen gefördert Gemüse- und Zierkürbisse sind dagegen nicht beitragsberechtigt
Im Weiteren hat der Bundesrat beschlossen, mit dem so genannten Ernteausgleich für Raps die kontinuierliche Versorgung des Marktes mit inländischem Rapsöl zu unterstützen. Für den Fall von kleinen Ernten kann Raps, der für die Verwendung als NWR vorgesehen war, der Speiseölgewinnung zugeführt werden Pilot- und Demonstrationsanlagen, die zu diesem Abtausch bereit sind, können den Verarbeitungsbeitrag für die entsprechende Menge importierte Rapssaaten, jedoch höchstens für 3'000 t pro Anlage und Ernte, geltend machen

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 162
■ Erste Erfahrungen mit der neuen Ölsaatenmarktordnung
Das Parlament hat in der Frühlingssession 2000 das Bundesgesetz vom 24. März 2000 über die Aufhebung des Getreidegesetzes gutgeheissen Die Aufhebung trat auf den 1 Juli 2001 in Kraft Mit der Ernte 2001 hat sich der Bund aus dem Marktgeschehen beim Brotgetreide zurückgezogen. Ablieferungs- und Übernahmepflichten entfielen, ebenso die garantierten Grundpreise Brot- und Futtergetreide bilden nun einen Markt Es ist im Wesentlichen eine Frage der Qualität, in welchen Bereich und zu welchem Preis das Getreide verkauft wird Mit der Einführung des einheitlichen Getreidemarktes ist die Ausgleichsfunktion der Anbauprämien für Futtergetreide nicht mehr notwendig Der Grenzschutz hat damit für die Getreideproduktion an Bedeutung gewonnen Solange die Getreideernte nicht höher als der inländische Bedarf ausfällt, bestimmen die Weltmarktpreise plus die Grenzabgaben das Preisniveau Die Importregelung für Getreide wurde per 1. Juli 2001 angepasst.
Das BLW verteilt das Zollkontingent Brotgetreide (70'000 t) durch Versteigerung Zum Zollkontingentsansatz darf das Brotgetreide nur noch mit der Zuteilung eines entsprechenden Zollkontingentsanteils eingeführt werden Gleichzeitig wurde die bisherige Übernahmepflicht für 85% Inlandgetreide aufgehoben
Auf die Bewirtschaftung des Zollkontingents Hartweizen von 110'000 t wird weiterhin verzichtet. Die Übernahmepflicht von inländischem Brotgetreide bei Verwendung von importiertem Hartweizenmehl im Brotsektor entfällt Die Verarbeitung und die Verwendung des Hartweizens werden durch das Zollgesetz geregelt Hartweizen darf zollbegünstigt nur importiert bzw. übernommen werden, wenn sich der Käufer gegenüber der Zollverwaltung verpflichtet hat, die vorgeschriebenen Mindestausbeuten und Verwendungszwecke einzuhalten Vom eingeführten Hartweizen sind mindestens 64% Mahlprodukte herzustellen und diese sind als Kochgriess zur menschlichen Ernährung oder als Dunst zur Teigwarenherstellung zu verwenden Aus dem Dunst müssen mindestens 96% Teigwaren hergestellt werden. Sofern die Ausbeuten nicht erreicht werden, ist auf der Differenz zur Mindestausbeute der im Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld gültig gewesene Ausserkontingentszollansatz (AKZA) nachzuzahlen (aktuell Fr. 74.– /dt). Werden die Ausbeuten aus qualitativen Gründen nicht erreicht, so ist der Zoll für Futtermehl (aktuell Fr 27 –/dt) geschuldet Die Kontrolle und das Inkasso obliegen der Zollverwaltung Mahlprodukte, welche die Mindestausbeute von 64% übersteigen, können ohne zusätzliche Bedingungen anderweitig im Brot- oder Futtersektor verwendet werden
Die Verwaltung der Pflichtlager von Hart- und Weichweizen gingen vom BLW an das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) über In Anlehnung an die Veränderungen im Getreidemarkt hat die Pflichtlagerhaltung Getreide im Sinne des Pflichtlagerberichts 1999 gewisse Änderungen erfahren Insbesondere konnte eine Reduktion der Anzahl Lagerhalter errreicht werden

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 163
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Die neue Getreidemarktordnung
Mit der Liberalisierung der Ölsaatenmarktordnung hat sich gezeigt, dass die inländischen Marktpreise für Ölsaaten starke Unterschiede aufweisen Verursacht werden diese Preisunterschiede durch den differenzierten Grenzschutz je nach Verwendungszweck und wegen den unterschiedlichen Ölausbeuten. Diese Preisdifferenzen wirken sich auf die Anbauattraktivität dieser Kulturen aus Insbesondere ist der Sojaanbau zur Speiseölgewinnung wegen dem tiefen Marktpreis und zusätzlich wegen dem angeschlagenen Image durch die GVO-Problematik stark zurückgegangen
Auf Grund dieser Marktverhältnisse gilt es, bei der Festlegung der Stützungsbeiträge versorgungs- und einkommenspolitische Ziele gegeneinander abzuwägen Es stellt sich die Frage, inwieweit die Marktstützung bei den Ölsaaten nach Kultur und Verwendungszweck differenziert werden soll
Am 21. September 2001 hat der Bundesrat entschieden, die Verantwortung für die Verteilung der Verarbeitungsbeiträge für Ölsaaten ab 2002 mittels Leistungsvereinbarung der Branchenorganisation swiss granum zu übertragen Dadurch kann innerhalb der Branchenorganisation ein tragfähiger Konsens über den Einsatz dieser Bundesmittel gefunden werden Die bisherigen Ölsaatenbeiträge an die Ölwerke (Ausbeuteausgleich) und an Pilot- und Demonstrationsanlagen werden in diesen Leistungsauftrag integriert Die Grundstützung der Ölsaaten wird weiterhin über einen einheitlichen Flächenbeitrag erfolgen
Gleichzeitig wird der Flächenbeitrag für die Körnerleguminosen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Lupinen von 1’260 auf 1’500 Fr pro ha erhöht Er beträgt neu gleich viel wie derjenige für Ölsaaten. Mit der Flächenbeitragserhöhung für Körnerleguminosen und der Leistungsvereinbarung Ölsaaten werden die Rahmenbedingungen für die Produktion von inländischen Eiweissfuttermitteln verbessert

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 164
■ Ausblick: Leistungsauftrag Ölsaaten
Sp
ja
ja F r / d t Quellen: OZD, BLW Preis franko Grenze Importpreise 0 100 80 60 40 20
Importpreise für Ölsaaten 2000 (unverarbeitet)
eiseölraps NWRRaps SpeiseölSonnenblumen SpeiseölSoja FutterölSo
FutterSo
■ Obst und Gemüse: Grenzschutz als Kernelement der Marktordnung
Spezialkulturen
Geprägt durch den letzten der sechs Zollabbauschritte gemäss den GATT/WTOVerpflichtungen bezüglich Marktzutritt, brachte das Berichtsjahr keinerlei Überraschungen Der Grenzschutz bleibt die wichtigste wirtschaftliche Massnahme zu Gunsten des Absatzes einheimischer Früchte und Gemüse Während des Zeitraums, in dem üblicherweise kein oder nur ein geringes Angebot an Schweizer Produkten besteht, kann weiterhin zum tiefen Ansatz (Kontingentszollansatz, KZA) importiert werden Ausserhalb dieses Zeitraums werden die Einfuhren innerhalb des Zollkontingents aufgrund des Angebots gleichartiger, einheimischer Produkte abgestuft Auf diese Weise führen die Importe zu einer marktkonformen Ergänzung der schweizerischen Produktion. Ist der Bedarf im Inland durch die Letztere gedeckt, wird keine Zollkontingentsteilmenge freigegeben In dieser Selbstversorgungsperiode erfolgen die Importe gegebenenfalls zu einem zwischen dem AKZA und dem KZA liegenden Ansatz
Die Einführung des einheitlichen Steuersatzes für schweizerische und ausländische Spirituosen am 1 Juli 1999 (Fr 29 – /Liter reinen Alkohol) setzte das Angebot an inländischem Brennobst einem grösseren Wettbewerb aus Schätzungsweise 15'000 t Obstäquivalent wurden neu in Form von Brennobst, Maische und Spirituosen eingeführt, wobei auf den beiden Letzteren das ganze Jahr über geringfügige Einfuhrzölle erhoben werden Gleichzeitig gingen die Produzentenpreise für Brennobst zurück
■ Weinwirtschaft: Weniger Mittel für die Absatzförderung
Die Massnahmen der Weinwirtschaft dienen der Absatzförderung im Ausland, der Erhaltung von Rebflächen an Steil- und Terrassenlagen, der Qualitätsverbesserung durch Mengenbegrenzung und Mindestanforderungen sowie die entsprechenden Kontrollmassnahmen
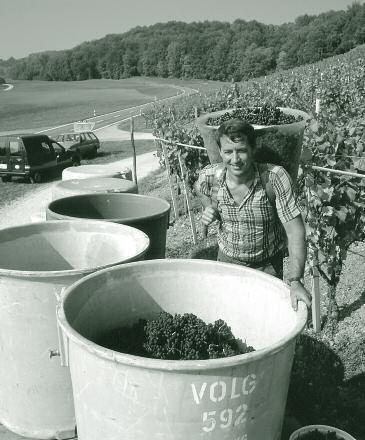
Das Importkontingent für Weisswein wurde im Jahre 2000 zu 92,5% ausgeschöpft Wie schon im Vorjahr nahm der Anteil an Flaschenweinen zu, er beträgt nun 51,5% Vermutlich hatte die geplante Zusammenlegung der Rot- und Weissweinkontingente auf den 1 Januar 2001 sowie die vorgesehene neue Zuteilung nach dem Windhundsystem zur Folge, dass im abgeschlossenen Jahr nur die effektiv benötigten Volumen eingeführt wurden
Das Rotweinkontingent wurde zu 94% ausgeschöpft Die Einfuhren gingen gegenüber dem Vorjahr um rund 50‘000 hl zurück Der Anteil der Flaschenweine nahm auch hier zu und erreicht neu 34,4% Zu den Einfuhren von roten und weissen Trinkweinen kommen noch Einfuhren von Schaum-, Süss- und Verarbeitungsweinen hinzu.
Die Beiträge zugunsten der Weinwirtschaft betrugen rund 5,7 Mio Fr Davon wurden knapp über eine Mio. Fr. für die Weinlesekontrolle und 4,6 Mio. Fr. für die Absatzförderung (Werbe- und PR-Massnahmen) im Ausland eingesetzt Dies waren, insbesondere aufgrund der Kürzung der Beiträge für die Absatzförderung – nur noch 60% der anrechenbaren Ausgaben – rund 1,5 Mio Fr weniger als im Vorjahr
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 165
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Ausblick
Beim Mostobst übersteigen die für den Absatz der Überschüsse aus der Ernte 2000 nötigen Exportbeiträge die budgetierten Mittel für 2001, die der jährlichen Obergrenze gemäss den GATT/WTO-Verpflichtungen entsprechen, um mehr als das Doppelte Die Selbsthilfemassnahmen für die Verwertung der Ernte 2000 reichen nicht aus, um die Finanzierungslücke zu schliessen Daher wird die Übertragung eines Teils der Ausfuhren auf das Jahr 2002 unausweichlich sein Auch wenn die Ernteschätzung 2001 für Mostobst rund zwei Drittel des Durchschnittes der letzten vier Jahre erwarten lässt, sind die Massnahmen zugunsten dieses Sektors dringend zu überprüfen
Die Zusammenlegung der Einfuhrkontingente für Rot- und Weisswein auf den 1 Januar 2001 sowie die neue Zuteilung nach dem Windhundsystem werden voraussichtlich zu einer Zunahme der Weissweineinfuhren führen. Die Zahlen der ersten sechs Monate des Jahres 2001 bestätigen dies, sie sind jedoch mit der nötigen Vorsicht zu interpretieren Die Rotweineinfuhren sind leicht rückgängig Das Gesamtimportvolumen dieser Periode liegt leicht über demjenigen des Vorjahres.
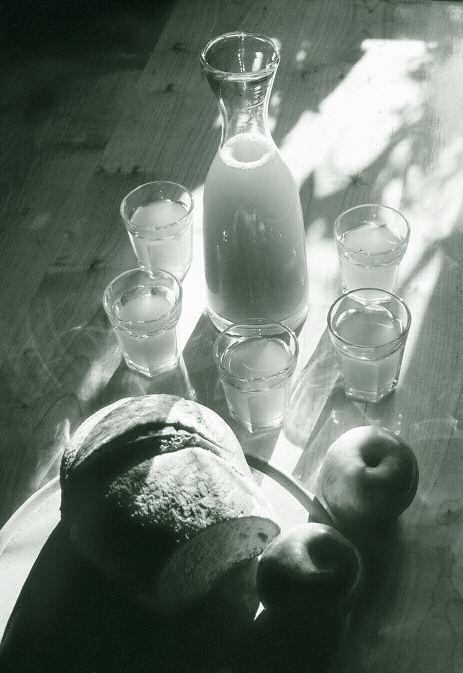
166 2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
■ Beurteilung der Definition der PMB
2.1.5 Überprüfung der Massnahmen
Das LwG verlangt gemäss Artikel 187 Absatz 13 die Überprüfung wichtiger Massnahmen im Bereich von Produktion und Absatz. Das BLW hat verschiedene Studien in Auftrag gegeben, welche die Wirksamkeit einzelner Massnahmen oder Instrumente untersuchen Nachfolgend werden Ergebnisse von Studien kurz präsentiert, die bereits abgeschlossen sind Es geht um Studien zur Absatzförderung, zur Milchkontingentierung, zur Marktstützung und zum Marktzutritt
Studien zur Absatzförderung
Die Absatzförderung ist ein wichtiges Element der neuen Agrarpolitik Zur Unterstützung entsprechender Massnahmen stehen jährlich 60 Mio Fr zur Verfügung Nach Artikel 12 Absatz 4 des LwG legt der Bundesrat die Kriterien zur Verteilung der Mittel fest Zu diesem Zweck wurde eine Vorgehensweise entwickelt, die in der landwirtschaftlichen Absatzförderungsverordnung beschrieben ist Dabei werden die Landwirtschaftsprodukte in möglichst gegenseitig unabhängige Bereiche, so genannte ProduktMarkt-Bereiche (PMB) eingeteilt Mit der Portfolio-Analyse wird deren Investitionsattraktivität ermittelt und dargestellt. Diese Ergebnisse dienen danach als Faktoren bei der Berechnung der maximalen Finanzhilfe je PMB
Das BLW gab Ende 2000 zwei Studien in Auftrag (Bösch, Kuster sowie König, Senti), die unabhängig voneinander die Methode der Mittelverteilung zu prüfen hatten Dabei wurden folgende Fragestellungen untersucht: – Wurden die PBM nach zweckmässigen Kriterien gebildet?
– Ist die angewendete Portfolio-Analyse eine zweckmässige Methode zur Bestimmung der Investitionsattraktivität?
Ist die Ableitung der quantitativen Mittelzuteilung auf die einzelnen PMB aufgrund der Wirkungsschwelle zweckmässig?
Die Bildung von gegenseitig unabhängigen PMB ist Bestandteil der Methode, die zur Verteilung der finanziellen Mittel im Bereich der Absatzförderung angewandt wird Erst damit können die Mittel nach Erfolgspotenzialen verteilt werden Die bestehenden PMB sind, mit Ausnahme von Käse, auf der Gattungsebene wie Milch, Fleisch, Getreide, usw , festgelegt worden Beide Studien erachten die Bildung von PMB grundsätzlich als sinnvoll
Die Studie König, Senti empfiehlt bei der Bildung der PMB eine feinere Aufgliederung So sollte beispielsweise der PMB Fleisch aus den Gruppen Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch und Geflügelfleisch bestehen. Aus ihrer Sicht kann eine zu weite Definition der PMB dazu führen, dass Produkte mit sehr unterschiedlichen Marktpositionierungen zusammengefasst werden Die finanziellen Mittel könnten dadurch zu wenig effizient eingesetzt werden
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
2 167 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
Die Studie von Bösch, Kuster sieht bei der Bildung von PMB Verbesserungsmöglichkeiten, indem der aktuelle unternehmensbezogene Ansatz ersetzt würde durch eine Methode, welche die Branche in den Vordergrund stellt Der Branchenansatz betrachtet das Branchenumfeld, in dem sich ein Unternehmen entwickelt. Der heute angewandte Ansatz basiert auf der Optik des einzelnen Unternehmens innerhalb der Branche, das eine Geschäfts- oder Marketingpolitik entwickelt Diese wird dann auf die Orientierung eines ganzen PMB übertragen Begründet wird der Vorschlag von Bösch, Kuster unter anderem, dass damit die nationalen Wettbewerbsvorteile besser berücksichtigt werden könnten
Beide Studien bewerten den methodischen Ansatz der Portfolio-Analyse als zweckmässig Mit der Portfolio-Analyse wird einerseits die Attraktivität der verschiedenen Teilmärkte für Landwirtschaftsprodukte und andererseits die Wettbewerbsposition der Schweizer Landwirtschaftsprodukte auf diesen Teilmärkten mit Hilfe von Indikatoren beurteilt Aus der Kombination der beiden Resultate lässt sich ableiten, für welche Produkte die Absatzförderungsgelder schwerpunktmässig eingesetzt werden sollen

Massgebend für die Qualität der Portfolio-Analyse sind, wie die Studien bestätigen, neben der Datengrundlage die so genannten Indikatoren. Das heisst, die Art der Daten und die Wahl der Bereiche, aus welchen die Daten stammen Bedeutenden Einfluss hat auch deren Übertragung auf eine zweckmässige Skala
Werden Daten zusammengefügt, erfordert dies neue Kategorien Dadurch geht zwangsläufig Information verloren Zudem werden die Daten nivelliert Beispielsweise werden die Werte von Marktvolumen und Marktwachstum zur Kategorie «Bedeutung des PMB» zusammengefügt Es ist ein neuer in der Skalierung veränderter Wert entstanden. Dieser Nachteil der so genannten Multi-Indikatoren-Portfolios ist bekannt. Die Studie Senti, König merkt dazu an, dass die Ergebnisse der Analyse die Rangfolge der PMB noch richtig zeigen, die Grössenordnungen der Unterschiede aber verzerrt abgebildet werden. Empfohlen wird deshalb, auf die Kategorienbildung zu verzichten und die gesamte Information bis zum Schluss der Berechnungen zu erhalten
Die Werte der gewählten Indikatoren kommen durch Auswertungen von Statistiken, durch Expertenmeinung und in einem Fall durch Befragung zu Stande Als Schwachstelle wird die Expertenmeinung bezeichnet Diese Aussagen sind wenig differenziert und haben bei der Teildimension Marktwachstum ein zu starkes Gewicht In der Studie König, Senti wird empfohlen, bei der Wahl der Indikatoren die Importkonkurrenz und die Exportmöglichkeit besser zu berücksichtigen. Die Studie von Bösch, Kuster schlägt vor, mit einer klaren inhaltlichen Unterscheidung der beiden Achsen die Aussagekraft der Analyse zu erhöhen
Die Portfolio-Analyse dient im Unternehmen auch dazu, nicht attraktive PMB auszuschliessen und neue zu planen Im Portfolio des BLW trifft das nicht zu Statt dessen werden zwei Portfoliobereiche (Förderklassen) gebildet In den Studien wird festgehalten, dass die Unterscheidung der Attraktivität damit vermindert werde Nicht zuletzt deshalb, weil die Zuordnung von Mitteln je Portfoliobereich politisch gefällt wird. Es wird darum empfohlen, auf die Förderklassen zu verzichten und die Mittel nach effektiver Bewertung zu verteilen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 168
■ Beurteilung der Portfolio-Analyse
■ Beurteilung der Zweckmässigkeit der unteren Wirkungsschwelle
Die Wirkung der Instrumente in der Marketingkommunikation ist dann erreicht, wenn die Botschaft von der Zielgruppe wahrgenommen und die gezielte Handlung ausgelöst wird Dies geschieht ab einer gewissen Intensität des Instrumenteneinsatzes Das Erreichen der Wirkungsschwelle ist massgeblich von den eingesetzten Instrumenten wie auch von den zur Verfügung stehenden Mitteln abhängig Mit der heutigen Methode werden den PMB in einem ersten Schritt 50% der Mittel zugeteilt, die zur Erreichung der Wirkungsschwelle notwendig sind
Beide Studien bezeichnen die Verwendung der unteren Wirkungsschwelle zur Verteilung von Finanzhilfen auf PMB als unzweckmässig Insbesondere wird auch hervorgehoben, dass die Berücksichtigung der unteren Wirkungsschwelle in der Mittelverteilung eine zu dominante Rolle einnimmt. Ausserdem sei die untere Wirkungsschwelle von vielen Komponenten abhängig Eine Beurteilung auf der Stufe der bestehenden PMB sei methodisch unsicher und problematisch Das Instrument werde in der Marketingpraxis auf der Stufe Marketing-Mix (Einsatzplanung der Instrumente wie Werbung, Verkaufsförderung usw ) und nicht auf der strategischen Ebene eingesetzt
Im bestehenden Rechnungsmodell wird rund die Hälfte der Mittel entsprechend der unteren Wirkungsschwelle verteilt Die mit der Portfolio-Analyse ermittelte Investitionsattraktivität würde damit relativiert. Die Mittelverteilung aufgrund der Investitionsattraktivität wird folglich in Frage gestellt und als Kriterium zur Effizienz des Mitteleinsatzes bezweifelt
■ Konsequenzen
Die Studien zeigen, dass sich die gewählte Methode zur strategischen Planung der Absatzförderung grundsätzlich eignet Hauptsächliche Schwachstellen zeigen sich da, wo von der Methode abgewichen wird, insbesondere bei der zusätzlichen Anwendung einer unteren Wirkungsschwelle. Zur Weiterentwicklung der Portfolio-Analyse sind deshalb weitere Arbeiten erforderlich Die vorliegende Bestandesaufnahme dient dazu als Basis
Es ist vorgesehen, die Portfolio-Analyse in regelmässigen Abständen zu überarbeiten Die Investitionsattraktivität soll mindestens alle vier Jahre auf der Basis dieser Analyse ermittelt werden Werden die PMB als Folge neu gebildet oder auch nur neu bewertet, ist mit einer Neuverteilung der Mittel an die Absatzförderung zu rechnen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 169
■
Studie zur Milchkontingentierung
Mit der Umsetzung der AP 2002 wurden in der Schweiz die Marktordnungen und Stützungen grundsätzlich umgebaut. Die bevorstehende Umsetzung der bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU wird weitere Veränderungen im Agrarbereich zur Folge haben Betroffen ist insbesondere auch die schweizerische Milchwirtschaft, weil fünf Jahre nach In-Kraft-Treten der Verträge ein freier Käsehandel zwischen der Schweiz und der EU bestehen wird Vor diesem Hintergrund stellt sich unter anderem die Frage nach der künftigen Ausgestaltung des Milchmengenmanagements in der Schweiz Zur Diskussion steht dabei insbesondere die im Jahre 1977 eingeführte Milchkontingentierung Akzentuiert wird diese Diskussion durch die Beschlüsse der EU, die eigene Milchkontingentierung im Jahr 2003 zu überprüfen und nach dem Jahr 2006 allenfalls auslaufen zu lassen
Das BLW beauftragte im Jahr 1999 das Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich (Prof B Lehmann), Fragen rund um die Milchkontintierung zu untersuchen Ergebnisse einer Vorstudie wurden bereits im ersten Agrarbericht dargestellt Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die wichtigsten Resultate der Hauptstudie auf
In der Hauptstudie wurde untersucht, welche Folgen eine allfällige Aufhebung der Milchkontingentierung in der Schweiz sowie absehbare Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Schweizer Landwirtschaft aus heutiger Sicht auf den Zielerreichungsgrad der Landwirtschaftspolitik (Effektivitätsanalyse) und die Effizienz des Milchmengenmanagements haben werden Ausserdem werden Vorschläge für eine Regelung des Milchmengenmanagements nach einer allfälligen Aufhebung der heute bestehenden Milchkontingentierung (inkl Übergangsregelungen) unterbreitet
Die Analyse und Operationalisierung der Zielsetzungen der schweizerischen Landwirtschaftspolitik, die einen Zusammenhang mit der Milchkontingentierung haben, ist für die Durchführung einer Effektivitätsanalyse unumgänglich Die Zielanalyse hat folgende vier relevante Zielbündel ergeben: Zielbündel der Wettbewerbsfähigkeit, sozial-individuelles Zielbündel, sozial-räumliches Zielbündel, ökologisch-ethisches Zielbündel. Um die Veränderung der Zielerreichung bei einer allfälligen Aufhebung der Milchkontingentierung messen zu können, wurden die einzelnen Zielbündel in Teilziele untergliedert und mittels Indikatoren operationalisiert Die Teilziele sowie die Indikatoren werden in der Studie detailliert dargestellt
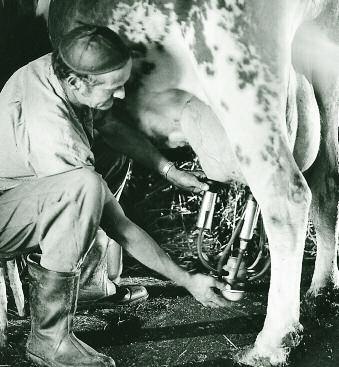
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 170
Zielanalyse
■ Veränderung der Nachfrage nach dem Rohstoff Milch
Die erwartete Veränderung der Nachfrage nach dem Rohstoff Milch ist insofern von Bedeutung, als zum Zeitpunkt einer allfälligen Aufhebung der Milchkontingentierung in der Schweiz neue Rahmenbedingungen für die inländische Milchverarbeitung gelten. Diese veränderte Marktsituation ist für die Bestimmung von Effektivität und Effizienz zu berücksichtigen Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrageveränderungen vorwiegend durch die Umsetzung der bilateralen Verträge mit der EU sowie durch die Reduktion der Milchpreisstützung in der Schweiz verursacht werden Diese neuen Rahmenbedingungen sind zum Zeitpunkt einer Aufhebung der Milchkontingentierung bereits voll wirksam (erwarteter Zeithorizont: fünf Jahre nach Inkraftsetzung der bilateralen Verträge) Im Rahmen von 18 Einzelinterviews bei relevanten Firmen der Milchverarbeitung wurde ermittelt, welche Menge des Rohstoffes Milch zu welchen Beschaffungspreisen (Stufe Produzent) unter den neuen Rahmenbedingungen abgesetzt werden kann Zusätzlich wurden 12 Experten aus dem Detailhandel und aus Branchen- und Sortenorganisationen befragt
Die befragten Firmen gehen davon aus, dass sich der Rohstoffpreis unter den neuen Rahmenbedingungen künftig in einem Preisband von 62 bis 65 Rp pro kg Rohmilch bewegen wird Gemäss ihrer Meinung beträgt die entsprechende Mehrnachfrage rund 448'000 t Rohmilch (+14% im Vergleich zur verarbeiteten Milch im Jahr 2000; davon 29% in der Schweiz und 71% im Export).
■ Analyse mit drei Varianten
Ausgangssituation mit Milchkontingentierung «mMK2000»: Es handelt sich dabei um eine durch Modellrechnungen von zehn repräsentativen Betriebstypen abgebildete Ausgangslage Die Hochrechnung der Modellresultate ergibt eine Milchmenge von 2,9 Mio t bei einem Milchpreis von 80 Rp pro kg (bei gegebenen Betriebsstrukturen).
Plausible Referenzvariante «mMKR»: Bei dieser Variante wird die Milchkontingentierung aufrecht erhalten. Der Milchpreis sinkt auf 65 Rp. pro kg. Es handelt sich dabei um einen geschätzten erwarteten Zustand von Preis, wirtschaftlichen und produktionstechnischen Kenngrössen bei Aufrechterhaltung der Milchkontingentierung, aber unter der Voraussetzung des bevorstehenden Stützungsabbaus und der Öffnung des Käsemarktes zur EU
Variante ohne Milchkontingentierung «oMK»: Im Rahmen dieser Variante wird eine Milchmenge von 3,8 Mio t produziert Diese Menge wird mit Milchpreisen von 60 bis 63 Rp. pro kg Milch hergestellt (bei langfristig optimierten Betriebsstrukturen) Die Preisdifferenzierung erfolgt auf Grund der unterschiedlichen Sammel- und Transportkosten (60 Rp im Berggebiet, 61 Rp in der Hügelzone und 63 Rp. im Talgebiet). Diese Variante befindet sich in einem sehr preiselastischen Bereich, in welchem das Marktgleichgewicht (Preise und Mengen) zu erwarten ist
Werden die Veränderungen mit dem Modell regionenweise berechnet, so steigert das Talgebiet die Produktion um ca. 0,8 Mio. t oder 74%, die Hügelzone um ca. 0,3 Mio. t oder 30%; das Berggebiet senkt die Produktion um 0,2 Mio t oder 18%
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 171
■ Zielerreichungsanalyse
In der Zielerreichungsanalyse werden die oben dargestellten Varianten bewertet in Bezug auf Abweichungen von Indikatorwerten, die zur Operationalisierung der Zielbündel aus der Zielanalyse herangezogen werden Damit kann festgestellt werden, ob die Umsetzung einer Handlungsalternative zu einer Verbesserung oder einer Verschlechterung der Zielerreichung führt
Der Vergleich der Variante «oMK» mit der Ausgangssituation «mMK2000» zeigt die Veränderungen auf, welche bei einer Aufhebung im Vergleich zur aktuellen Situation eintreten Dabei kann folgendes festgestellt werden:
– Für die Variante «oMK» verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft leicht gegenüber der Ausgangssituation «mMK2000». Dabei steigt die produzierte Milchmenge an Dies gilt auch für die Vielfalt an Milchprodukten und die Milchqualität Auf der anderen Seite sinken der Deckungsbeitrag und das Betriebseinkommen minim.

– Für die Situation im sozial-individuellen Bereich führt die Variante «oMK» zu einer geringen Verschlechterung gegenüber der Ausgangssituation Dabei nimmt das landwirtschaftliche Einkommen minimal ab, da mit einer Aufhebung der Milchkontingentierung grössere Anpassungskosten für die landwirtschaftlichen Betriebe anfallen
Die Zielerreichung im sozial-räumlichen Zielbündel verschlechtert sich ebenfalls minimal gegenüber der Ausgangssituation Der vermehrten Zusammenarbeit innerhalb der Landwirtschaft steht ein gewisser Verlust an landwirtschaftlichen Traditionen und ländlicher Kultur gegenüber
– Eine Aufhebung der Kontingentierung wirkt sich im Vergleich zur Ausgangssituation positiv auf die Zielerreichung im ökologisch-ethischen Bereich aus Der Anteil der extensiven Flächen nimmt zwar ab und die Tierdichte zu Dem steht jedoch ein Abbau der offenen Ackerfläche und eine Erhöhung des Anteils besonders tierfreundlicher Stallhaltungssysteme (BTS) gegenüber
Wird die Variante «oMK» der plausiblen Referenzvariante «mMKR» gegenübergestellt, zeigt sich folgendes Bild:
In Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit ist die Zielerreichung ohne Kontingentierung durchwegs besser als mit Kontingentierung
– Im sozial-individuellen Bereich zeichnet sich die Variante ohne Kontingentierung gegenüber der Variante «mMKR» durch eine höhere Zielerreichung aus Bei der plausiblen Referenzvariante ist es nicht möglich, den von 80 auf 65 Rp. sinkenden Milchpreis durch eine genügend grosse betriebliche Mengenausdehnung zu kompensieren Deshalb ist bei einer Aufhebung der Kontingentierung das Einkommen vergleichsweise besser als bei der Referenzvariante Nur die Anpassungskosten sind bei einer Aufhebung der Kontingentierung höher als bei der Variante «mMKR» Längerfristig ist jedoch auch bei Beibehaltung der Milchkontingentierung mit grösseren strukturellen Anpassungskosten zu rechnen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 172
–
–
■ Effizienzanalyse
– Für den sozial-räumlichen Bereich zeigt die Situation ohne Kontingentierung ein ähnliches Bild wie die Variante «mMKR» Die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit nimmt bei einer Aufhebung stärker zu als bei der Beibehaltung der Kontingentierung. Im Gegenzug ist jedoch der Verlust an landwirtschaftlicher Tradition und Kultur bei einer Aufhebung grösser
Die Zielerreichung im ökologisch-ethischen Zielbündel ist für beide Varianten ähnlich Dabei ist bei Aufhebung der Kontingentierung die Abnahme der extensiven Wiesen stärker als bei einer Situation mit Kontingentierung Dem gegenüber steht bei Aufhebung der Kontingentierung eine stärkere Abnahme der offenen Ackerfläche Die Tierdichte nimmt bei der Variante «oMK» mehr zu Die Zunahme der BTS ist ohne Kontingentierung grösser als mit Kontingentierung.
Die Effizienz des Milchmengenmanagements wird durch einen Vergleich der Produzentenrente, der Abnehmerrente sowie der Staatsausgaben vor und nach Aufhebung der Milchkontingentierung bestimmt Die Berechnung erfolgt für den Milchsektor als Ganzes Die Summe der drei einbezogenen Komponenten ergibt die Veränderung der Netto-Wohlfahrt
Bei einer Aufhebung der Milchkontingentierung ergibt sich eine Verschlechterung der Produzentenrente Die grössere Milchmenge vermag die tieferen Milchpreise nicht zu kompensieren. Auf der anderen Seite erhöht sich die Abnehmerrente. Die Staatsausgaben für den Milchsektor schliesslich nehmen ab Gesamthaft gesehen steht so der Verlust der Produzentenrente einer Erhöhung der Abnehmerrente und einer Verbesserung bei den Staatsfinanzen gegenüber
■ Zusammenfassende Beurteilung
Die Ergebnisse der Studie ermöglichen folgendes Fazit:
– Aufgrund der Erkenntnisse der durchgeführten Analysen schliesst eine Lösung ohne Milchkontingentierung in Zukunft bezüglich agrarpolitischer Zielerreichung und volkswirtschaftlicher Effizienz besser ab als eine Lösung mit der Milchkontingentierung
Eine Aufhebung der Milchkontingentierung
sorgfältig eingeleitet mit einer Übergangsregelung – führt in einem kompetitiven Umfeld (offener Käsemarkt gegenüber der EU und weniger produktgebundene Stützung) schneller zu wettbewerbsfähigen und rentablen betrieblichen Milchproduktionsstrukturen
Das Berggebiet könnte unter einem Regime ohne Kontingentierung dank strukturellen Anpassungen und der Wahrnehmung von Absatzchancen weiterhin eine sehr wichtige Rolle in der Milchproduktion einnehmen
– Die heute zu beobachtende Zunahme des Absatzpotenzials ist eine gute Voraussetzung für die Aufhebung der Milchkontingentierung in den nächsten Jahren.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 173
–
–
–
–
■ Regelungen nach Aufhebung der Milchkontingentierung
In der Studie werden auch Vorschläge präsentiert für Regelungen im Sinne von flankierenden Massnahmen nach einer Aufhebung der Milchkontingentierung Ganz grundsätzlich ist ein System des Milchmengenmanagements anzustreben, das den beteiligten Marktpartnern möglichst viel Freiheit bei der Ausgestaltung ihrer Lieferbeziehungen lässt Gleichzeitig ist aber darauf zu achten, dass das System die besonderen Eigenschaften der Agrarmärkte in angemessener Weise berücksichtigt Vor diesem Hintergrund wird für den Zeitraum nach der Aufhebung der Mengenbeschränkung ein Liefer- und Abnahmevertragssystem mit mehrjährigen Verträgen vorgeschlagen Ergänzend soll es auch feste Terminverträge sowie Optionsverträge für kürzere Fristen geben Die Termin- und Optionsverträge sollen handelbar sein Das Ziel des Vertragssystems besteht im Anstreben von Stabilität und im Abbau von Unsicherheit. Gleichzeitig soll eine Informationsstelle für Transparenz über die bestehenden Vertragsverhältnisse sorgen Zudem ist zu prüfen, inwieweit die Differenzierung der staatlichen Beihilfen zwischen Berg- und Talgebiet sowie die Unterstützung der Arbeitsteilung Berg-Tal aufrechterhalten werden soll (ergänzender Ansatzpunkt: Regionalpolitik) Zusätzlich könnte der Bund die Akteure im Milchmarkt bei Bedarf mit einem einmaligen Pauschalbeitrag pro Betrieb bzw pro Genossenschaft für eine problembezogene Beratung unterstützen Die Organisationen im milchwirtschaftlichen Bereich könnten in diesem neuen Kontext zahlreiche Funktionen übernehmen (z.B. Empfehlungen für die Ausarbeitung von Verträgen, Statistik und Information, Beratung)
■ Übergangsregelungen
bzw. frühzeitiger Ausstieg
In der Studie werden auch Übergangsregelungen vorgeschlagen Diese haben das Ziel, dass am Ende der Übergangsfrist die Mengenbeschränkung in der Milchproduktion aufgehoben werden kann, ohne dass es im Milchmarkt zu kurzfristigen, unerwünschten Marktreaktionen mit starken Preis- und Mengenveränderungen kommt Massgebend für die Ausgestaltung dieser Übergangsregelungen ist die begründete Annahme, dass die Preise für den Rohstoff Milch in der Schweiz in den nächsten Jahren auch ohne Aufhebung der Milchkontingentierung rückläufig sein werden (Gründe: Umsetzung der bilateralen Verträge, weiterer Abbau der staatlichen Beihilfen für die Milchproduktion) Die Aufhebung der Mengenbeschränkung schafft deshalb die notwendige Flexibilität für eine kostengünstigere Milchproduktion auf Ebene Landwirtschaftsbetrieb
Aus heutiger Sicht wird eine wirtschaftliche Milchproduktion im Talgebiet künftig mit einer Menge ab 150'000 bis 300'000 kg Milch pro Betrieb erreicht werden können Um die Durchschnittskontingente in den Betrieben entsprechend aufzustocken, soll der Kontingentshandel während der Übergangsfrist weitergeführt werden. Bei jedem Kontingentstransfer gibt der Bund dem Käufer die Möglichkeit, eine Zusatzmenge im Ausmass von 40% der gekauften Menge zu beantragen (evtl Versteigerung; Kaskadenverkäufe von Kontingenten werden ausgeschlossen). Die 40% ergeben sich aus dem Verhältnis zwischen erwünschter Transfermenge und Ausbau des Absatzes in den nächsten Jahren Im Berggebiet kann der Bund zudem den Produzenten die Kontingente für die lokale Verarbeitung nach Massgabe des möglichen Mehrabsatzes erhöhen Ein solcher Ansatz könnte bei erfolgreichem Absatz auch für gezielte Absatzkategorien beim Käse angewendet werden (z.B. für AOC-Käse in Form von kontingentsübersteigenden Ablieferungsverträgen mit den Verarbeitern) Eine Informationsstelle sorgt für Transparenz und die problembezogene Beratung wird unterstützt.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 174
■ Theoretische Grundlagen
Mit diesem Übergangsregime würde die transferierte Kontingentsmenge voraussichtlich markant erhöht und die Produktionsrechte fliessen in die zukunftsträchtigen Milchproduktionsbetriebe Zudem haben die Betriebe, die künftig nicht auf die Milchproduktion setzen, einen Anreiz, ihre Kontingente abzugeben.
Es ist wichtig, dass die vorgeschlagenen Übergangsmassnahmen nur vor dem Hintergrund eines definitiven Ausstiegsentscheides aus der Milchkontingentierung beschlossen werden Andernfalls ist mit kontraproduktiven Effekten zu rechnen Als nächste Schritte zur Vorbereitung eines allfälligen Ausstiegs sind die rechtlichen Anforderungen zu klären sowie detaillierte Aktionspläne zu erarbeiten
Studien zur Marktstützung
Die Massnahmen zur Marktstützung wurden im Rahmen der Agrarpolitik 2002 intensiv diskutiert Das Parlament beschloss 1998, dass die finanziellen Mittel zugunsten dieser Massnahmen innerhalb von fünf Jahren nach In-Kraft-Treten des neuen LwG um einen Drittel abzubauen sind und die Massnahmen überprüft werden müssen
Das BLW beauftragte 1999 das Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich (Prof. P. Rieder), die Massnahmen zur Marktstützung zu untersuchen Die entsprechenden Arbeiten laufen unter dem Titel «Marktanalysen AP 2002» (MAAP 2002) Folgende Märkte werden im Hinblick auf die Frage der Marktstützung detailliert untersucht: Milch, Fleisch und Eier Nachfolgend werden dazu kurz theoretische Grundlagen vorgestellt und anschliessend die Ergebnisse der bereits fertig erstellten Analysen für den Fleisch- und Eiermarkt präsentiert
Die MAAP 2002 haben zum Ziel, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen der Landwirtschaftspolitik auf die Agrarmärkte zu analysieren Für die einzelnen Märkte werden spezifische Zielsetzungen formuliert und daraus ergeben sich die Forschungsschwerpunkte Ausgangspunkt aller Analysen ist der Markt, im Sinne der Wohlfahrtsmaximierung bildet er das Referenzsystem Davon sollte theoretisch nur bei Marktversagen abgewichen werden Ein Marktversagen tritt wegen unerwünschten externen Effekten, öffentlichen Gütern, unvollständigem Wettbewerb, Anpassungsmängeln und Strukturkrisen, Informationsmängeln und nichtrationalem Verhalten der Akteure auf Staatseingriffe sind für die Behebung der Mängel (z B wenn Verteilungsund nicht Effizienzaspekte im Vordergrund stehen) notwendig, dürfen aber nicht zu einem Staatsversagen führen.

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 175
Bei einer umfassenden Analyse der Agrarmärkte müssen die auftretenden Unsicherheiten entsprechend ihrer Bedeutung berücksichtigt werden Wegen den vorhandenen Risikopräferenzen, der Existenz von Anpassungskosten und den möglichen Kosten falscher Politikentscheidungen ist bei der Evaluation von agrarmarktpolitischen Instrumenten ein Methodenset anzuwenden, welches auf solche Unsicherheiten Rücksicht nimmt Im Zentrum stehen die Aussagen über Legitimation, Effektivität und Effizienz der Instrumente Die Politikevaluation mit der Zielerreichungs-, der Wirkungs- und der Vollzugsanalyse stellt für MAAP 2002 das geeignete Evaluationskonzept dar Für die konkrete Beantwortung einzelner Forschungsfragen werden deskriptive und/oder empirische Methoden angewandt (qualitative, theoriebasierte Beurteilung, Statistik, Ökonometrie usw ) Die Auswahl der Methoden erfolgt im Hinblick auf eine gezielte Beantwortung der einzelnen Forschungsfragen.
Teilziel 1 Teilziel 2
Teilziel 4
Teilziel
rie
Methode im weiteren Sinn
Politikevaluation
– Zielerreichungsanalyse
–
Methoden im engeren Sinn
Vollzugsanalyse – Qualitative, theoriebasierte Beurteilung
– Statistische Datenanalyse (ex post)
Verschiedene Modellansätze (ex ante)
–
Analyse und Interpretation der Ergebnisse
deskriptiv empirisch
–
(Eignung der Theorie) – (Methodenwahl)
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 176
2002 Quelle: Koch, Rieder Methodenauswahl und -anwendung Definition der Zielsetzung von MAAP 2002 Ableitung von Forschungsfragen Theorieauswahl: Wohlfahrtstheo
MAAP Hauptziel
3
– Wirkungsanalyse
– Ökonometrische Modelle (ex post)
Schlussfolgerungen – Forschungsfragen
■ Fleischmarkt: Staatliche Förderung der Lagerhaltung
Da es sich bei den Schweizer Agrarmärkten um relativ komplexe Systeme handelt, kommt der Auswahl der Systemelemente, der Systemstrukturen, der Abgrenzung der Systeme und den daraus resultierenden externen Relationen eine grosse Bedeutung zu. Bei MAAP 2002 werden vorwiegend partielle, ökonomisch-mathematische Modelle verwendet Zum einen werden Modelle angewandt, mit denen eine gegebene Situation und deren Entwicklung erklärt werden sollen (ex post-Analyse) Zum anderen kommen Gleichgewichts- oder Optimierungsmodelle zum Einsatz, wenn Aussagen zu alternativen Politikmassnahmen vorgenommen werden Weil bei der ex ante-Modellierung der Agrarmärkte verschiedene Unsicherheiten zu berücksichtigen sind, werden mit Gleichgewichts- und Optimierungsmodellen verschiedene Simulationen durchgeführt
Beim Fleischmarkt steht die ökonomische Wirkungsweise der mit Beiträgen unterstützten Ein- und Auslagerungen im Vordergrund. Der Gesetzgeber hat mit den Artikeln 13 und 50 LwG die Grundlage geschaffen, um bei saisonalen und vorübergehenden Preiseinbrüchen Massnahmen zur Preisstabilisierung ergreifen zu können
Eine erfolgreiche Preisstabilisierung durch die staatliche Förderung der Lagerhaltung setzt voraus, dass die beschliessenden Organe die künftige Marktentwicklung möglichst zutreffend vorausschätzen können Zudem muss beim Auf- und Abbau der Lagerbestände eine hohe Flexibilität gewährleistet sein, um schnell auf Änderungen der Marktlage reagieren zu können. Ein Problem bei staatlich unterstützter Lagerhaltung besteht oft darin, dass die Anreize für private Lagerhaltungsaktivitäten verzerrt werden Zudem können anfängliche Stabilisierungsmassnahmen im Laufe der Zeit unter dem Druck politischer Interessen zu einer fortlaufenden Preisstützungspolitik führen, was nicht dem Ziel einer staatlichen Preisstabilisierungspolitik entspricht Der Einfluss von staatlich unterstützter Lagerhaltung wurde anhand von Daten der letzten Jahre mit Hilfe von Regressionsmodellen analysiert
Bei den Schlachtkälbern wurde der Einfluss der produzierten, konsumierten, eingelagerten und importierten Mengen auf den monatlichen Produzentenpreis untersucht Den grössten Einfluss auf den Produzentenpreis konnte für die erwartete Produktionsmenge im Folgemonat (-0,49) und die Produktionsmenge im gleichen Monat (-0,26) nachgewiesen werden Wird demnach eine um 10% höhere Produktionsmenge im Folgemonat erwartet, bewirkt dies, dass der Produzentenpreis im aktuellen Monat um 4,9% sinkt (und umgekehrt) Dieses Resultat ist nicht erstaunlich, weil die Marktteilnehmer die saisonalen Angebotsentwicklungen beim Kalbfleisch aus Erfahrung kennen. Die Konsum- und die Importmenge beeinflussen hingegen den Schlachtkälberpreis nur in geringem Ausmass Interessanterweise lösen höhere Einlagerungsmengen tiefere Produzentenpreise aus Der Einfluss ist allerdings minim 10% höhere Einlagerungen haben nur eine Preisreduktion von 0,06% zur Folge.
Dieser Effekt ergab sich auch bei der Analyse bei den Munis Auch hier haben höhere Einlagerungsmengen tiefere Produzentenpreise zur Folge Bei den Kühen konnte dagegen kein signifikanter Einfluss der Einlagerungsmenge auf den Preis festgestellt werden.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 177
■ Eiermarkt: Aufschlagsaktionen
Die staatlich unterstützten Einlagerungen von Kalbfleisch haben zum Ziel, den Produzentenpreis für Schlachtkälber zu stützen Mit den gewählten Regressionsmodellen konnten keine positiven Wirkungen auf die Veränderung des Schlachtkälberpreises nachgewiesen werden. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass der Kalbfleischmarkt aus den zwei Teilmärkten «Bankfleisch» und «Wurstfleisch» besteht und die Einlagerungsaktionen vor allem das Wurstfleisch betreffen Das verwertbare Fleisch von Schlachtkälbern besteht zu rund 80% aus Bank- und lediglich zu 20% aus Wurstfleisch Darum ist es fraglich, ob durch die staatlich geförderte Entlastung des Teilmarktes «Wurstfleisch» eine signifikant positive Wirkung auf den Produzentenpreis für Schlachtkälber erzielt werden kann Diese Interpretation lässt sich auch für die Einlagerungen von Fleisch von Muni, Rindern und Ochsen heranziehen Die Studie zeigt auf, dass staatlich unterstützte Einlagerungen nicht geeignet sind, die Produzentenpreise signifikant zu stützen
Das Ziel der Eiermarktanalyse besteht in der Untersuchung der ökonomischen Wirkungsweise der auf dem Eiermarkt angewandten staatlichen Massnahmen Weiter wird die verbreitete vertikale Integration zwischen Eierproduzenten und dem Grosshandel in die Analyse einbezogen
Bei der Aufschlagsaktion wird für die Abnehmer bei einem saisonalen Überangebot der Anreiz geschaffen, einen Teil der im Inland produzierten Konsumeier als Verarbeitungseier zu verwerten. Dabei handelt es sich um eine klassische Marktspaltung: Für einen Teil der produzierten Konsumeier kann trotz Nachfragerückgang der Preis auf dem Ausgangsniveau gehalten werden Der zweite Teil muss verbilligt und einer minderwertigen Verwertung zugeführt werden Dadurch entstehen Kosten, die bei der bestehenden Eiermarktordnung der Staat übernimmt Wohlfahrtsökonomisch führt die Aufschlagsaktion zu einer Erhöhung der Produzentenrente bei einer gleichzeitigen Abnahme der Abnehmerrente Dabei hängen die absoluten Beträge der Renten vom preisbezogenen Verhalten der Anbieter und Abnehmer, also von den jeweiligen Angebots- und Nachfrageelastizitäten, ab. Durch eine Aufschlagsaktion kann unter Annahme eines vollständigen Wettbewerbs vor allem eine Rentenumverteilung von den Abnehmern (bzw Konsumenten) zu den Produzenten bewirkt werden Die Studie kommt zum Schluss, dass diese Aktionen eine relativ kostengünstige Massnahme zur vorübergehenden Stützung der Produzentenpreise darstellen
■ Eiermarkt: Verbilligungsaktionen
Durch Verbilligungsaktionen kann der Staat den Eierabsatz in nachfrageschwachen Perioden fördern. Wenn das Interesse besteht, trotz Nachfragerückgang den Preis auf einem bestimmten Niveau zu halten, kann als Alternative zur Marktspaltung eine Angebotsverbilligung durchgeführt werden Diese hat einen Transfer von Bundesmitteln zu den Produzenten und zu den Abnehmern bzw. im Endeffekt bei vollständigem Wettbewerb zu den Konsumenten zur Folge Entscheidend für die Verteilung der Bundesmittel an die Produzenten und die Konsumenten sind die Angebots- und Nachfrageelastizitäten Verbilligungsaktionen zur Stützung der Produzentenpreise sind auf inelastischen Märkten, wie dies für den Schweizer Eiermarkt zutrifft, vergleichsweise teure Massnahmen.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 178
■ Eiermarkt: Sammel- und Sortierkostenbeiträge
Bis Ende 2001 erhalten Unternehmen, die Eier bei ehemals geschützten Eierproduzenten übernehmen, für die höheren Sammel- und Sortierkosten Beiträge Diese sind nach der Anzahl genutzter Tierplätze, von 500 bis zu 12'000, abgestuft (6 bis 1 Rp /Ei) Die Studie erachtet diese Beiträge als problematisch, da in den letzten Jahren Strukturen erhalten wurden, welche aufgrund der hohen Produktions- und Sammelkosten nicht rentabel sind und auch in Zukunft nicht wettbewerbsfähig sein werden Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die Beiträge nicht für alle Eier, sondern nur für solche von ehemals geschützten Eierproduzenten ausgerichtet werden Eine Weiterführung der Massnahme in der bisherigen Form wird daher nicht empfohlen

■ Eiermarkt: Umstellungsbeiträge
Die Umstellungsbeiträge werden bis Ende 2001 für Betriebe ab 500 Legehennen, aber maximal für 2'400 Tiere ausbezahlt Diese Obergrenze wird von der Studie als problematisch beurteilt, da sie eine strukturlenkende Wirkung hat So wurden in den letzten Jahren vor allem auch kleinere Betriebe dazu motiviert, auf BTS und RAUS umzustellen, da die Entschädigung von Fr 7 50 je Legehenne und Jahr ein relativ hoher Anreiz war Es ist aber fraglich, ob diese Betriebe, die aufgrund des staatlichen Anreizes in tierfreundliche Haltungssysteme investiert haben, im Wettbewerb werden bestehen können
■ Eiermarkt: Vertikale Vertragsproduktion
Unter der vertikalen Vertragsproduktion versteht man die vertraglich gesicherte Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaftsbetrieben und Unternehmen der vor- und nachgelagerten Wirtschaftsstufen Diese hat im Eiermarkt in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen
Für die Produzenten und die Abnehmer ergeben sich durch den Abschluss von Abnahmeverträgen einige Vorteile: Die Produktion wird bestmöglich auf den Markt ausgerichtet, verschiedene Produktions- und Marktrisiken können reduziert werden und es fallen tiefere Transaktionskosten (Suchkosten, Vereinbarungskosten usw ) an Beim Eiermarkt ist der Handel aufgrund der grossen saisonalen Nachfrageschwankungen und verschiedener Produktionsrisiken (z B Salmonellengefahr) an strengen Richtlinien in der Schweizer Eierproduktion interessiert Bei der Analyse der Vertragsverhältnisse ist die Verteilung des Preisrisikos zwischen Produzent und Abnehmer jeweils von besonderem Interesse Die Studie kommt zum Schluss, dass die Verträge, welche in der Schweizer Eierwirtschaft abgeschlossen werden, das Preisrisiko in vielen Fällen fast vollständig den Produzenten zuteilen In der Regel sind diese dadurch benachteiligt
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 179
■ Änderungen von Tarifen und Zollkontingentsmengen
Studien zum Marktzutritt
Die Studien zum Marktzutritt wurden durch das BLW 1999 vor dem Hintergrund der neuen WTO-Agrarhandelsrunde in Auftrag gegeben. Damit beauftragt wurde das Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich (Dr R Jörin) Das Projekt umfasst drei Fragestellungen:
– Wie wirken sich Änderungen bei den Zolltarifen und den Zollkontingentsmengen auf dem Inlandmarkt aus?
Welche Auswirkungen haben Änderungen am Verteilmodus der Zollkontingente auf den Marktzutritt?
Welche Alternativen bestehen zu den bisherigen Regelungen des Marktzutritts?
Bei den Untersuchungen wurden einerseits die verschiedenen Instrumente, die den Marktzutritt regeln, generell analysiert. Anderseits wurden die spezifischen Belange der einzelnen Märkte nocht vertiefter untersucht Nachfolgend werden zunächst wichtige Ergebnisse dargestellt, die generell für alle Märkte gelten Anschliessend werden die bis jetzt vorliegenden Resultate für die Märkte Getreide und Wein dargestellt
Das WTO-Abkommen von 1994 enthält im Bereich Marktzutritt neben den Zöllen auch das Instrument der Zollkontingente. Mit beiden Instrumenten kann ein bestimmter Agrarschutz erreicht werden Die wohlfahrtsökonomische Analyse der ETH-Studie zeigt folgendes: Wird ein bestimmter Agrarschutz durch Einheitszölle gewährt, ist dies mit geringeren volkswirtschaftlichen Kosten verbunden, als wenn dies durch Zollkontingente geschieht Dies gilt besonders für Zollkontingente, die relativ hohe AKZA haben Hohe Schranken haben zur Folge, dass auch die nachgelagerten Stufen der Landwirtschaft geschützt werden und dadurch dort weniger Konkurrenz herrscht Wenn der Wettbewerb somit nicht mehr auf allen Stufen des Agrarmarktes spielt, entstehen zusätzliche Margen, die zu Lasten der Konsumenten und Produzenten gehen. Fehlender Wettbewerb führt zu Ineffizienz und verursacht volkswirtschaftliche Kosten (Effizienzproblem) Aus diesem Grund sollten Zollkontingente grundsätzlich in reine Zollsysteme umgewandelt werden
■ Schwellenpreissysteme zur Regelung des Marktzutritts
Variable Zölle ermöglichen fixe Schwellenpreise und damit stabile Produzentenpreise Die Erfahrung zeigt, dass stabile Preise bzw geringe Preisrisiken Anreize zur zusätzlichen Angebotssteigerung bieten. So wandelte sich die EU unter anderem wegen ihres Abschöpfungssystems und ihrer Exportsubventionen in den siebziger Jahren vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur Diese negativen Auswirkungen auf den Welthandel sind der Grund dafür, dass Systeme mit variablen Zöllen den Zielsetzungen der WTO widersprechen Trotzdem werden auch nach der Uruguay-Runde Zollsysteme angewandt, die stabile Produzentenpreise im Inland bewirken Aus diesem Grund wurden bei den Einzelmarktstudien auch Schwellenpreissysteme als mögliche Alternativen zu den bisherigen Regelungen genauer untersucht
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
–
–
180
■ Administrative Zuteilungsverfahren versus Versteigerung von Zollkontingenten
Versteigerungen haben gegenüber administrativen Verfahren aus ökonomischer Sicht folgende Vorteile:
Der Zugang zu den Importrechten ist für alle interessierten Firmen offen. Diese Eigenschaft von Versteigerungen ist aus der Sicht des Wettbewerbs, der unter mengenmässigen Importregelungen erfahrungsgemäss gefährdet ist, von besonderer Bedeutung Je weniger der Wettbewerb spielt, desto ineffizienter ist die Zuteilung der Importkontingente (Effizienzproblem) Der Staat kann mit der Versteigerung die Kontingentsrenten abschöpfen, die bei administrativen Zuteilungsverfahren den Importeuren zufliessen Steht diesen Renten keine entsprechende Leistung gegenüber, sind sie verteilungspolitisch problematisch (Verteilungsproblem) Die Versteigerung sollte vor allem bei Zollkontingenten Anwendung finden, bei denen eine hohe Nachfrage besteht
■ Sonderfall «Inlandleistung»
Bei der Zuteilung nach Inlandleistung erhalten nur diejenigen ein Importrecht, die auch inländische Produkte kaufen Wenn der Wettbewerb spielt, entsteht dadurch auch ein Wettbewerb um Importrechte Damit unterscheidet sich das Inlandleistungssystem von anderen administrativen Verfahren Die Grundsatzfrage ist jedoch, ob der Wettbewerb spielt. Die hohe Konzentration auf den nachgelagerten Stufen der Landwirtschaft sowie der begrenzte Zugang zu den Importrechten (Kriterien für die Inlandleistung) sind Gründe dafür, dass der Wettbewerb unvollkommen ist Spielt der Wettbewerb nur unvollständig, entstehen nicht nur Kontingentsrenten, sondern zusätzliche Margen, die zu Lasten der Konsumenten und Produzenten gehen

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 181
Das Ziel der Einzelmarktstudie Getreide bestand darin, die Auswirkungen der neuen Getreidemarktordnung unter Berücksichtigung möglicher Zollsysteme abzuschätzen Das Schwergewicht der Studie liegt bei einer Prognose für die Brot- und Futtergetreidepreise in den Jahren 2001 und 2005 unter:
– Beibehaltung des Zollkontingents für Brotgetreide und des Schwellenpreissystems für Futtergetreide;

– Anwendung eines Schwellenpreissystems für Brot- und Futtergetreide und
– Einführung eines Einzollsystems für Brot- und Futtergetreide
Auf der Basis theoretischer Überlegungen kommt die Studie zum Schluss, dass die Abkoppelung eines Agrarmarktes vom Weltmarkt nicht automatisch zu einer stabilen inländischen Marktsituation führt In einem kleinen Land mit Angebots- und/oder Nachfrageschwankungen, einem hohen Selbstversorgungsgrad und fehlenden Exportmöglichkeiten kann eine Isolation zu hausgemachten Marktinstabilitäten führen.
Signifikante Einflüsse auf die durchschnittliche Ertragsentwicklung konnten lediglich für den biologisch-technischen Fortschritt und das Wetter nachgewiesen werden Die Einführung des Extenso-Programmes des Bundes hatte keinen nachweisbaren Einfluss Die Vermutung, dass sich der Getreideanbau aufgrund von Preissenkungen in den letzten Jahren auf ertragsmässig bessere Regionen konzentrierte, konnte mit dem gewählten Ansatz nicht bestätigt werden
Die Modellrechnungen zeigen, dass das Zollsystem im Jahre 2005 sowohl für die Brotgetreide- als auch für die Futtergetreidepreise von grosser Bedeutung sein wird Neben dem Zollsystem haben auch die Höhe der gewählten Zölle bzw die Zollkontingentsmenge einen Einfluss auf die erwarteten Preise und deren Schwankungsbereiche. Die grössten Schwankungen sind bei den inländischen Brotgetreidepreisen zu erwarten, wenn das Zollkontingent beibehalten wird
Die Liberalisierung des Schweizer Getreidemarktes wirkt sich auf den Getreidehandel, die Verarbeitung und die Tierhaltung aus Aufgrund der unterschiedlichen Produktionsauflagen und der Bezeichnung mit je einem Label für Bio- und IP-Suisse-Getreide kann praktisch von einer Spaltung des Brotgetreidemarktes in drei Teilmärkte (Bio, IP-Suisse und konventionell) gesprochen werden
Wegen den vorhandenen Überkapazitäten ist in der Brotgetreidemüllerei und in der Mischfutterbranche in den nächsten Jahren von einem etwas stärkeren Strukturwandel auszugehen als in den letzten Jahrzehnten. Der intensive Wettbewerb unter den Verarbeitern in beiden Branchen wird diesen Prozess unterstützen Durch die tieferen Mischfutterkosten werden die Produktionskosten in der konventionellen Tierhaltung bis zum Jahre 2005 maximal um 6% sinken.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 182
■ Getreidemarkt
Aufgrund der Gesetzgebung (Artikel 55 LwG) sowie absoluter und komparativer Kostennachteile wird der Schweizer Getreideanbau mit einem angemessenen Importschutz und Direktzahlungen unterstützt Die Studie empfiehlt, für einen kurzfristigen Zeithorizont die mit der AP 2002 begonnene Zusammenlegung des Brot- und des Futtergetreidemarktes konsequent zu vollziehen und beim Brot- und beim Futtergetreide das gleiche Zollsystem anzuwenden Die Unsicherheiten auf dem Schweizer Getreidemarkt, welche von den Weltmarktpreis- und den Wechselkursschwankungen ausgehen, können beim Brotgetreide mit einem Wechsel vom Zollkontingent zu einem Schwellenpreissystem beseitigt werden Mittel- bis langfristig sollte allerdingszu einem Einzollsystem übergegangen werden, weil mit der Integration der nationalen Märkte in den Weltmarkt mit stabileren globalen Getreidepreisen zu rechnen ist
Bei der Einzelmarktstudie Wein ging es um folgende zwei Fragestellungen:
– Welche Auswirkungen hätte die Erhöhung bzw eine Aufhebung des Zollkontingentes auf den Inlandmarkt?
– Welche Auswirkungen hätte eine Harmonisierung der Zollansätze bei den verschiedenen Importkategorien?
Das Gesamtkontingent Weiss- und Rotwein wirkt aufgrund der Marktlage nicht begrenzend Unter dieser Voraussetzung ist die Anwendung des Windhundverfahrens zur Verteilung der Zollkontingente zweckmässig, insbesondere weil es administrativ einfacher ist als das Versteigerungsverfahren Bei gleichbleibendem Kontingent und einer Veränderung der Marktlage, das heisst zunehmenden Importen, könnte das Kontingent jedoch wieder bindend wirken Bei einer solchen Situation würden Kontingentsrenten entstehen mit den negativen Folgen für die Volkswirtschaft Sollte sich also die zukünftige Marktlage gegenüber heute deutlich verändern, müsste das Zollkontingent aus wettbewerbspolitischen Gründen wieder versteigert werden Für die Zukunft ist daher eine eingehende Marktbeobachtung von grosser Bedeutung
Die Auswirkungen einer Erhöhung bzw einer Aufhebung des Gesamtkontingentes gemäss ETH-Studie sind: Wenn der Inlandpreis unter normalen Verhältnissen durch den KZA gestützt wird, hat eine Erhöhung des Zollkontingentes keinen Einfluss auf die Preisbildung Der grosse Importanteil beim Wein von ca 60% bewirkt, dass auch bei grösseren Ernten eine Stützung im Ausmass des KZA wirksam bleibt Allerdings wird dieser Effekt beim Weisswein mit dem tieferen Importanteil geringer sein als beim Rotwein
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 183
■ Weinmarkt
In der Praxis haben erste Erfahrungen nach der erfolgten Zusammenlegung allerdings gezeigt, dass insbesondere beim Weisswein ein grosser Preisdruck auf die einheimischen Weine entsteht Die Importpreise sinken, so dass der Zollschutz zum Teil aufgehoben wird. Auf dem Weltmarkt sind sowohl Weiss- als auch Rotweine zu Preisen weit unter einem Franken pro Liter zu erstehen Eine genaue Beobachtung der Entwicklung der Importmengen und der Importpreise im Jahr 2001 wird dazu mehr Anhaltspunkte liefern
Eine Harmonisierung der Zollansätze für Flaschen- und Fasswein mit einem Wert von 50 Fr /hl sollte, laut ETH-Studie, keine zusätzliche Belastung der Importe bringen Die relative Senkung des bisher höheren Zollansatzes für Flaschenwein ist gerade gleich gross wie die relative Erhöhung des Zollansatzes beim Fasswein. Die Frage, inwieweit in der WTO Zölle überhaupt angehoben werden dürfen, auch wenn bei anderen Positionen (Flaschenwein) kompensiert wird, bleibt offen Auf jeden Fall aber würde eine Harmonisierung den Trend in Richtung vermehrter Importe von Wein in Flaschen noch verstärken

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
184
2.2 Direktzahlungen
Die Direktzahlungen sind ein zentrales Element der Agrarpolitik. Sie ermöglichen eine Trennung der Preis- und Einkommenspolitik vor allem aber eine Abgeltung der von der Gesellschaft geforderten Leistungen Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen

Ausgaben für die Direktzahlungen
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich Die Werte in Abschnitt 2 2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ausgabenbereich 1999 2000 Mio Fr Mio Fr Allgemeine Direktzahlungen 1 779 1 804 Ökologische Direktzahlungen 326 361 Total 2 105 2 165
Quelle: BLW 185
■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
2.2.1 Bedeutung der Direktzahlungen
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere Diese Beiträge haben das Ziel, eine flächendeckende Nutzung und Pflege sicherzustellen In der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt Voraussetzung für alle Direktzahlungen (ohne Sömmerungsbeiträge) ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN).

■ Abgeltung besonderer ökologischer Leistungen
Die ökologischen Direktzahlungen geben einen Anreiz für besondere ökologische Leistungen, die über den ÖLN hinausgehen Zu ihnen gehören die Öko-, Sömmerungsund Gewässerschutzbeiträge Die Beiträge bezwecken, die Artenvielfalt in den Landwirtschaftsgebieten zu erhalten und zu erhöhen, die Nitrat- und Phosphorbelastung der Gewässer sowie die Verwendung von Hilfsstoffen zu vermindern, landwirtschaftliche Nutztiere besonders tierfreundlich zu halten und das Sömmerungsgebiet nachhaltig zu nutzen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 186 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Die Direktzahlungen machten 2000 rund 64% der Ausgaben des BLW aus. Von den Direktzahlungen kamen 64% der Berg- und Hügelregion zugute
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich Die Werte in Abschnitt 2 2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs
Die Hügel- und Bergregion ist bei den Produktionsbedingungen benachteiligt Die wichtigsten Nachteile sind:
– Die kürzere Vegetationsperiode, welche geringere Erträge und höhere Aufwendungen für die Futterkonservierung sowie hohe Arbeitsspitzen zur Folge hat
Die Bewirtschaftung von Hanglagen ist aufwendiger, die Mechanisierung teurer und weniger leistungsfähig
– Die im Durchschnitt ungünstigere Verkehrslage bedingt einen höheren Zeitaufwand und Mehrkosten für Transporte, Schulwege, Märkte, Produkteabnehmer, Einkäufe usw
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 187
Direktzahlungen
Beitragsart Total Talregion Hügelregion Bergregion 1 000 Fr Total Direktzahlungen 2 164 967 Allgemeine Direktzahlungen 1 803 658 625 598 475 026 692 957 Flächenbeiträge 1 186 770 552 878 305 495 328 397 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 258 505 67 444 64 265 126 795 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 251 593 2 989 70 423 178 181 Allgemeine Hangbeiträge 96 714 2 287 34 843 59 584 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 10 076 Ökologische Direktzahlungen 361 309 Ökobeiträge 278 981 151 359 76 123 51 500 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 108 130 58 885 29 378 19 867 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 33 398 22 103 10 128 1 168 Extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland (Übergangsbestimmungen befristet bis Ende 2000) 17 150 14 861 2 243 46 Beiträge für den biologischen Landbau 12 185 4 585 2 520 5 080 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 108 118 50 925 31 855 25 339 Sömmerungsbeiträge 81 238 Gewässerschutzbeiträge 1 090
2000
Quelle: BLW
–
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen 2000
■ Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von Betrieben nach Regionen 2000
Die erschwerende Bewirtschaftung in diesen Regionen wird mit den Beiträgen für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen, den Hangbeiträgen und den Sömmerungsbeiträgen abgegolten Folgerichtig nimmt die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis zu Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
Für den Bezug von Direktzahlungen sind von den Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter zahlreiche Anforderungen zu erfüllen Diese umfassen einerseits allgemeine Bedingungen wie Rechtsform, zivilrechtlicher Wohnsitz usw , anderseits sind auch strukturelle und soziale Kriterien für den Bezug massgebend wie beispielsweise die Mindestgrösse des Betriebes, der Arbeitsbedarf von mindestens 0,3 Standardarbeitskräften, das Alter der Bewirtschafter, das Einkommen und Vermögen. Hinzu kommen spezifisch ökologische Auflagen, die den Begriff ÖLN Anforderungen aus dem Umweltbereich betreffen Darunter fallen eine ausgeglichene Düngerbilanz, ein angemessener Anteil ökologischer Ausgleichsflächen, eine geregelte Fruchtfolge, ein geeigneter Bodenschutz, eine gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln sowie eine tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere Eine Verletzung oder ein Verstoss gegen die massgebenden Vorschriften haben Sanktionen in Form einer Kürzung oder Verweigerung der Direktzahlungen zur Folge
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 188
Merkmal Einheit Total Tal- Hügel- Bergregion region region Betriebe Anzahl 3 419 1 517 1 017 885 LN im Ø ha 18,78 19,41 17,83 18,63 Allgemeine Direktzahlungen Fr 31 858 24 416 31 976 44 876 Ökobeiträge Fr 5 542 6 560 5 607 3 677 Total Direktzahlungen Fr 37 400 30 976 37 583 48 553 Rohertrag Fr 199 145 242 054 183 249 191 707 Anteil Direktzahlungen am Rohertrag % 18,8 12,9 20,5 34,8 Quelle: FAT
Tabellen 37a–38, Seiten A43–A46
Begriffe und Methoden, Seite A86
■ Verteilung der Direktzahlungen aus Sicht der Empfänger
Die meisten statistischen Angaben über die Direktzahlungen in diesem Abschnitt stammen aus der vom BLW entwickelten Datenbank AGIS (Agrarpolitisches Informationssystem) Dieses System wird einerseits mit Daten der jährlichen Strukturerhebungen, welche die Kantone zusammentragen und übermitteln, und andererseits mit Angaben über die Auszahlungen (bezahlte Flächen und Tierbestände sowie entsprechende Beiträge) für jede Direktzahlungsart (Massnahme) gespiesen Die Datenbank dient in erster Linie der administrativen Kontrolle der von den Kantonen an die Bewirtschafter ausgerichteten Beträge Eine weitere Funktion des Systems besteht in der Erstellung allgemeiner Statistiken über die Direktzahlungen Dank der Informationsfülle und der leistungsfähigen EDV-Hilfsmittel können zahlreiche agrarpolitische Fragen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden Auf Ersuchen der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates wird nachfolgend auf die Verteilung der Direktzahlungen aus Sicht der Empfänger eingegangen Folgende Aspekte sind dabei von Interesse:
– Welche Bedeutung haben rechtliche Einschränkungen bei den Direktzahlungen?
– Wie wirken sich die Abstufungen und Begrenzungen gemäss der Direktzahlungsverordnung aus?
– Wie verteilen sich die Direktzahlungen entsprechend den Merkmalen Produktionsform, Betriebstyp, Standardarbeitskraft (SAK) und Alter?
– In welche Regionen fliessen die Direktzahlungen?
Von 72'930 im AGIS erfassten Betrieben im Jahr 2000 beziehen deren 60'702 Direktzahlungen Die meisten der restlichen 12'228 Betriebe sind zu klein, um Anspruch auf Beiträge zu haben, das heisst, sie weisen zu wenig Fläche oder zu wenig SAK auf
■ Auswirkungen der Abstufungen und Begrenzungen
Begrenzungen und Abstufungen wirken sich auf die Verteilung der Direktzahlungen aus Bei den Begrenzungen handelt es sich um die Einkommens- und Vermögensgrenze sowie den Höchstbeitrag pro SAK, bei den Abstufungen um die Degressionen bei Fläche und Tieren
Wirkung der Begrenzungen der Direktzahlungen 2000
Begrenzung Betroffene Gesamtbetrag Anteil der Anteil Betriebe Kürzungen Kürzungen am Kürzungen an Beitragstotal der gesamten der betroffenen DirektzahlungsBetriebe summe (CH)
Quelle: BLW
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 189
Anzahl Fr %% pro SAK (45 000 Fr ) 1 555 2 035 911 3,44 0,09 auf Grund des Einkommens 2 692 9 742 376 10,74 0,45 auf Grund des Vermögens 428 5 107 741 47,91 0,24
Die Begrenzungen haben Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge, insbesondere für jene 428 Betriebe, deren Vermögen zu hoch ist Von den Einkommensgrenzen waren im Jahr 2000 fast 2'700 Betriebe betroffen Die Kürzung der Direktzahlungen betrug bei diesen Betrieben im Durchschnitt rund 10%. Insgesamt wurden aufgrund der Begrenzungen fast 17 Mio Fr an Direktzahlungen gekürzt; dies entspricht 0,78% des Gesamtbetrages
sind 7‘091 Betriebe von den Abstufungen gemäss Direktzahlungsverordnung betroffen Bei den meisten Betrieben gibt es Abzüge bei verschiedenenen Massnahmen Die Kürzungen betragen total fast 25 Mio Fr Sie wirken sich insbesondere bei den Flächenbeiträgen stark aus, wo die Abstufungen bei über 6‘000 Betrieben (10% aller Betriebe mit Direktzahlungen) zur Anwendung kommen Von den Betrieben mit Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere sind 126 Betriebe von diesen Kürzungen betroffen, da sich andere spezifische Begrenzungen dieser Massnahme wie die Förderlimite und der Milchabzug bereits vor der Abstufung der Direktzahlungen auswirken Von Beitragsreduktionen betroffen sind auch die ökologischen Direktzahlungen. So werden z.B. die Direktzahlungen für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (RAUS und BTS) bei rund 2'300 Betrieben um 7–10% gekürzt, und rund 500 Bio-Betriebe erhalten um 8% herabgesetzte Direktzahlungen Gemessen an den gesamten Direktzahlungen umfassen diese Kürzungen
1,34%
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 190
Wirkung der Abstufung der Beiträge nach Flächen oder Tierzahl Massnahme Betroffene Fläche oder Kürzung Anteil am Anteil an Betriebe Tierbestand Beitrag der Gesamtpro Betrieb Betriebe summe Anzahl ha oder GVE Fr %% Flächenbeiträge 6 362 41,4 22 478 139 7,2 1,89 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 126 60,6 430 206 6,9 0,02 Allgemeine Hangbeiträge 68 34,9 33 381 3,4 0,03 Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 0 0,0 0 0,0 0,00 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 6 39,8 20 440 9,3 0,02 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 30 38,4 24 725 5,5 0,07 Beiträge für den biologischen Landbau 481 39,4 222 748 7,8 1,83 Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme 902 65,3 602 266 9,8 2,43 Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien 1 414 61,3 881 947 7,3 1,06 Total 7 091 1 24 693 852 7,2 1,34 1 ohne Doppelzählungen Insgesamt
■ Verteilung der Direktzahlungen nach Produktionsformen
Bei der Auswertung nach Produktionsformen wird unterschieden zwischen Betrieben, die den ÖLN (ÖLN-Betriebe) erfüllen, Betrieben, die den ÖLN ebenfalls erfüllen, zusätzlich aber nach den Regeln des biologischen Landbaus (Bio-Betriebe) wirtschaften und schliesslich Betrieben, die Direktzahlungen erhalten, ohne dass sie den ÖLN erbringen (Konventionelle Betriebe)

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 191
Direktzahlungen der ÖLN-Betriebe 2000 0 –5 0 0 0 1 0 0 0 1 –1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 –2 5 0 0 0 3 0 0 0 1 –3 5 0 0 0 4 0 0 0 1 –4 5 0 0 0 5 0 0 0 1 –5 5 0 0 0 6 0 0 0 1 –6 5 0 0 0 7 0 0 0 1 –7 5 0 0 0 8 0 0 0 1 –8 5 0 0 0 9 0 0 0 1 –9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 –1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 –1 1 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 –1 2 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 –1 3 5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 –1 4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 –1 5 5 0 0 0 A n z a h l k u m u l i e r t e A n z a h l i n % Direktzahlungen in Fr Mittelwert = 34 701 Fr Quelle: BLW 7 500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6 750 6 000 5 250 4 500 3 750 3 000 2 250 1 500 750 0 Direktzahlungen der Bio-Betriebe 2000 0 –5 0 0 0 1 0 0 0 1 –1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 –2 5 0 0 0 3 0 0 0 1 –3 5 0 0 0 4 0 0 0 1 –4 5 0 0 0 5 0 0 0 1 –5 5 0 0 0 6 0 0 0 1 –6 5 0 0 0 7 0 0 0 1 –7 5 0 0 0 8 0 0 0 1 –8 5 0 0 0 9 0 0 0 1 –9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 –1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 –1 1 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 –1 2 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 –1 3 5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 –1 4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 –1 5 5 0 0 0 A n z a h l k u m u l i e r t e A n z a h l i n % Direktzahlungen in Fr. Mittelwert = 44 813 Fr Quelle: BLW 500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Direktzahlungen der konventionellen Betriebe 2000
60'702 Betriebe erhielten im Jahr 2000 Direktzahlungen 51'822 waren ÖLN-Betriebe, 4'904 Bio-Betriebe und 3'976 konventionelle Betriebe. Den Bio-Betrieben wurden mit 44'800 Fr im Durchschnitt am meisten Direktzahlungen pro Betrieb ausgezahlt Im Durchschnitt waren es rund 10'000 Fr mehr als bei den ÖLN-Betrieben Die durchschnittliche Summe der Direktzahlungen für die konventionellen Betriebe betrug rund

11'000 Fr Bei diesen handelt es sich in der Regel um kleinere Betriebe (im Durchschnitt
8 ha gegenüber 16 ha bzw 17 ha für Bio- und ÖLN-Betriebe), die bis Ende 2001 aufgrund der Übergangsmassnahmen Direktzahlungen beanspruchen können
Die Direktzahlungen konzentrieren sich auf Betriebe, die umweltschonend wirtschaften 98% der Direktzahlungen gingen im Jahr 2000 an die Betriebe mit ÖLN bzw ÖLN und Bio
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 192
0 –5 0 0 0 1 0 0 0 1 –1 5 0 0 0 2 0 0 0 1 –2 5 0 0 0 3 0 0 0 1 –3 5 0 0 0 4 0 0 0 1 –4 5 0 0 0 5 0 0 0 1 –5 5 0 0 0 6 0 0 0 1 –6 5 0 0 0 7 0 0 0 1 –7 5 0 0 0 8 0 0 0 1 –8 5 0 0 0 9 0 0 0 1 –9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 –1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 –1 1 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 –1 2 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 –1 3 5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 –1 4 5 0 0 0 1 5 0 0 0 1 –1 5 5 0 0 0 A n z a h l k u m u l i e r t e A n z a h l i n % Direktzahlungen in Fr Mittelwert = 10 966 Fr Quelle: BLW 1 500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 350 1 200 1 050 900 750 600 450 300 150 0
■ Verteilung der Direktzahlungen nach Betriebstypen
Die FAT verwendet für die Zentrale Auswertung von Buchhaltungsdaten 11 verschiedene Betriebstypen Diese Betriebstypologie kann auch auf die im AGIS erfassten Betriebe angewendet werden
Verteilung der Direktzahlungen nach Betriebstypen 2000
Die Bedeutung der Milchproduktion für die Schweizer Landwirtschaft kommt klar zum Ausdruck Rund 20'000 Betriebe sind spezialisiert auf diesen Betriebszweig Insgesamt gehen 750 Mio Fr Direktzahlungen an diese Betriebe, im Durchschnitt sind es 37'500 Fr Mit 54'300 Fr bzw 45'900 Fr werden an die Betriebe «Kombiniert Mutterkühe» und «Mutterkühe» im Mittel jedoch wesentlich höhere Beiträge pro Betrieb ausgerichtet Auf der anderen Seite stehen die «Spezialkulturbetriebe», die im Durchschnitt 15'500 Fr erhalten
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 193
Verkehrsmilch F A TB e t r i e b s t y p e n Kombiniert Andere Kombiniert Veredlung Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau Anderes Rindvieh Pferde/Schafe/Ziegen Spezialkulturen Ackerbau Mutterkühe Veredlung Kombiniert Mutterkühe Anzahl Quelle: BLW 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Anzahl Betriebe Summe der Direktzahlungen 0 100 200 300 400 500 Mio Fr 600 700 800 900 1 000
■ Verteilung nach Standardarbeitskräften
Die Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf einem Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 0,3 SAK besteht.
Verteilung der Direktzahlungen nach SAK 2000
Aus der Verteilung der Betriebe nach SAK geht hervor, dass 5'279 Landwirtschaftsbetriebe zwischen 0,3 und 0,5 SAK aufweisen Dies sind rund 8,7% aller direktzahlungsberechtigten Betriebe Der Anteil der vom Bund ausgerichteten Direktzahlungen betrug im Jahr 2000 hingegen 2,7%. An die grössten Betriebe mit über 5 SAK gingen knapp 3% der für 2000 gewährten Direktzahlungen Die Weiterführung dieser Statistik im Laufe der nächsten Jahre wird die Auswirkungen der AP 2002 auf die Entwicklung der Betriebsstrukturen aufzeigen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 194 Betriebstyp 1 Direktzahlungen pro Betrieb Fr Kombiniert Mutterkühe 54 276 Mutterkühe 45 902 Anderes Rindvieh 38 684 Verkehrsmilch 37 318 Kombiniert Verkehrsmilch / Ackerbau 37 117 Kombiniert Andere 33 966 Kombiniert Veredlung 33 868 Ackerbau 31 093 Veredlung 27 746 Pferde/Schafe/Ziegen 21 391 Spezialkulturen 15 518
1 Die Betriebstypen entsprechen den Kategorien der FAT-Betriebstypologie Quelle: BLW
< 0 , 5 0 0 , 5 0 –0 , 9 9 1 , 0 0 –1 , 4 9 1 , 5 0 –1 , 9 9 2 , 0 0 –2 , 4 9 2 , 5 0 –2 , 9 9 3 , 0 0 –3 , 4 9 3 , 5 0 –3 , 9 9 4 , 0 0 –4 , 4 9 4 , 5 0 –4 , 9 9 5 , 0 0 –5 , 4 9 5 , 5 0 –5 , 9 9 6 , 0 0 –6 , 4 9 6 , 5 0 –6 , 9 9 7 , 0 0 –7 , 4 9 7 , 5 0 –7 , 9 9 u n d g r ö s s e r A n z a h l B e t r i e b e k u m u l i e r t e D i r e k t z a h l u n g e n i n % SAK Mittelwert = 1,759 SAK Quelle: BLW Anzahl Betriebe Kumulierte Direktzahlungen in % 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0
■ Verteilung der Direktzahlungen nach Alter
Bei dieser Auswertung wurden nur die Betriebe mit der Rechtsform «natürliche Personen» und «Personengesellschaften» berücksichtigt Von den 60‘702 direktzahlungsberechtigten Betrieben sind es rund 58‘372 Betriebe
Verteilung der Direktzahlungen nach Alter 2000
■ Verteilung der Direktzahlungen nach Empfängerregionen
Die Verteilung der Beitragsempfänger zeigt die Dominanz der Altersklasse zwischen 35 und 55 Jahren Knapp 45% der Direktzahlungen gingen an Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen unter 40 Jahren
Dank der Aufbereitung von Informationskarten mit einem geographischen Informationssystem (GIS) auf der Basis der entsprechenden AGIS-Daten kann ein Überblick über die regionale Bedeutung der Direktzahlungen geschaffen werden Die beiden ersten Karten stellen die Betriebsstruktur dar (Gemeindedurchschnitt der LN und GVE) und dienen als Basis für die Interpretation der nachfolgenden Karten Diese geben für jede einzelne Direktzahlungsart (Massnahme) Aufschluss über die Dichte der Beitragsempfänger in der jeweiligen Gemeinde (Summe der für die Massnahme ausgezahlten Beiträge dividiert durch die Gesamtzahl Betriebe mit Direktzahlungen)
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 195
≤ 2 0 2 1 –2 5 2 6 –3 0 3 1 –3 5 3 6 –4 0 4 1 –4 5 4 6 –5 0 5 1 –5 5 5 6 –6 0 6 1 –6 5 > 6 5 A n z a h l B e t r i e b e k u m u l i e r t e D i r e k t z a h l u n g e n i n % Altersklasse Mittelwert = 46 Jahre Quelle: BLW Anzahl Betriebe Kumulierte Direktzahlungen in % 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 Karten 1–12,
Seiten A60–A71
Die Kontrolle des ÖLN wird mit Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert Diese können Organisationen, die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten, zum Vollzug beiziehen Sie müssen diese Organisationen stichprobenweise überprüfen. Absatz 4 präzisiert, nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben
Zu kontrollieren sind:
– alle Betriebe, welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen;
– alle Betriebe, bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden und
mindestens 30% der übrigen Betriebe, die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind
Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, welche über den Betrieb falsche Angaben machen oder die an die Beiträge geknüpften Anforderungen nur teilweise oder nicht erfüllen, werden nach einheitlichen Kriterien sanktioniert. Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz hat ein Sanktionsschema erlassen, welches die Kürzungen der Direktzahlungen bei nicht vollständiger Erfüllung der Beitragsvoraussetzungen zwischen den Kantonen harmonisiert
Von den Kantonen bzw den von ihnen beauftragten Kontrollstellen wurden im Jahr 2000 rund 39'100 Betriebe, davon 4‘900 Biobetriebe, auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert. Im Weiteren wurden 15‘300 Betriebe (entspricht 79%), die ihren Tieren regelmässig Auslauf ins Freie (RAUS) gewähren sowie 7‘900 Betriebe (entspricht 83%), die ihre Tiere in besonders tierfreundlichen Ställen (BTS) halten, kontrolliert Gesamthaft wurden über 8‘000 Verstösse festgestellt Dies hatte Beitragskürzungen von 5,1 Mio Fr zur Folge In diesem Betrag nicht enthalten sind Rückbehalte bei nicht beitragsberechtigten Bewirtschaftern sowie nicht ausbezahlte Beiträge, die auf Grund von falschen Angaben bei der Anmeldung verweigert wurden Verstösse gab es hauptsächlich in den folgenden Bereichen: ÖLN-Anforderungen, bei den RAUS- und BTSProgrammen, beim ökologischen Ausgleich, bei den allgemeinen Bedingungen der Gewässerschutzgesetzgebung, bei den Grundanforderungen sowie beim Extensoprogramm Hingegen wurde nur in wenigen Fällen gegen die allgemeinen Bedingungen der Natur- und Heimatschutz- und Umweltschutzgesetzgebung verstossen sowie gegen die Richtlinien des biologischen Landbaues
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 196
–
Vollzug
Kontrolle ■ Durchgeführte Kontrollen 2000
■
und
Zusammenstellung der Verstösse
Aufzeichnungen, tiergerechte Haltung der Nutztiere, fehlende Bodenproben, ungenügender ökologischer Ausgleich, nicht ausgeglichene
Pufferstreifen, Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmittel
oder unzulässige Nutzung, falsche Flächenangaben, Mindestdauer von 6 Jahren nicht eingehalten
300 nicht rechtzeitige Anmeldung, Ernte nicht im reifen Zustand zur Körnergewinnung
fehlende Bodenproben, ungenügender ökologischer Ausgleich, kein Kontrollbericht erhalten, Gewässerschutz, Schnittzeitpunkt bei ÖAF, nicht rechtzeitige Anmeldung
BTS 480 71 100 mangelhafter Liegebereich, Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften, kein Mehrflächen-Haltungssystem, nicht rechtzeitige Anmeldung
RAUS 866 444 600 zu wenig Auslauftage, mangelhafte Aufzeichnungen, Haltung nicht aller Tiere der Kategorie nach den Vorschriften, nicht rechtzeitige Anmeldung, ungenügender Laufhof
■ Sonderbewilligungen im Bereich Pflanzenschutz
Quelle: BLW
In witterungs- und standortbedingten Spezialfällen muss, um die Kultur zu schützen, der Einsatz im ÖLN nicht erlaubter Pflanzenschutzmittel oder Behandlungsarten zugelassen werden Deshalb können die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen, gestützt auf die Direktzahlungsverordnung, Sonderbewilligungen ausstellen Im Jahre 2000 gab es für 8‘027 ha LN 4‘302 Sonderbewilligungen. Die starke Zunahme der ausgestellten Sonderbewilligungen im Vergleich zum Jahr 1999 beruht auf einer besseren Datenerfassung bei den Kantonen
Am meisten bewilligt wurde die Behandlung von Verunkrautung in Naturwiesen oder in Neuansaaten von Kunstwiesen Dabei ging es vor allem um die Blackenbekämpfung
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 197
Kategorie Verstösse Sanktionen Hauptgründe Anzahl Fr. Grunddaten 283 532 500 verspätete
Bewirtschafter Gewässerschutz 311 181 500 keine Angaben möglich Natur und Heimatschutz 5 13 400 keine Angaben möglich Umweltschutz 13 15 200 keine Angaben möglich ÖLN 5 404 3 484 600 mangelhafte
Düngerbilanz,
ÖAF 454 279 300 zu frühe
Extenso 174
Bio 22 28 900 falsche
Anmeldung, falsche Flächenangaben, falsche Tierbestandesangaben, falsche Angaben zum Betrieb oder
32
Angaben,
012 5 083 400
Total 8
Erteilte Sonderbewilligungen 2000

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 198
Bekämpfungsmittel Bewilligungen Fläche Anzahl % ha % Vorlauf-Herbizide 183 4 3 505,2 6,3 Insektizide 393 9,1 1 231 15,3 Mais-Granulate 135 3,1 454 5,7 Rüben-Granulate 247 5,7 603 7,5 Wiesen-Herbizide 3 299 76,7 5 153 64,2 Andere 45 1,0 80,5 1,0 Total 4 302 100 8 027 100 Quelle: BLW
2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen
Flächenbeiträge
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Schutz und Pflege der Kulturlandschaft, Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab Die Beiträge sind grundsätzlich nicht differenziert nach Nutzung der Flächen und nach den Regionen Für die Erschwernisse in der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen die Hangbeiträge und die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen.
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25%. Insgesamt handelt es sich um 5‘128 ha, welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 199 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ansätze 2000 Fr./ha – bis 30 ha 1 200 – 30 bis 60 ha 900 – 60 bis 90 ha 600 – über 90 ha 0
Flächenbeiträge 2000 Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Fläche ha 481 194 263 090 285 615 1 029 899 Betriebe Anzahl 25 615 16 358 18 500 60 473 Fläche pro Betrieb ha 18,8 16,1 15,4 17,0 Beitrag pro Betrieb Fr 21 584 18 676 17 751 19 625 Total Beiträge 1 000 Fr 552 878 305 495 328 397 1 186 770 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 545 168 300 104 317 822 1 163 094 Quelle: BLW
■ Flächendeckende Bewirtschaftung als
Ziel
Tabellen 31a–31b, Seiten A32–A33
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen 2000
Von der Beitragsdegression betroffen sind 7,6% der LN Im Durchschnitt wird pro ha ein Flächenbeitrag von 1'152 Fr ausbezahlt Die Betriebe mit einer Fläche bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 10,8% der LN Eine Betriebsgrösse von mehr als 60 ha weisen lediglich 0,8% der Betriebe aus Diese bewirtschaften 3,7% der LN
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere
Die Massnahme hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig im Grasland Schweiz die flächendeckende Pflege durch Nutzung sicherzustellen
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere, die während der Winterfütterung (Referenzperiode: 1 Januar bis Stichtag des Beitragsjahrs) auf einem Betrieb gehalten werden Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe, Ziegen, Bisons, Hirsche, Lamas und Alpakas Die Beiträge werden für Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt: Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE) Begrenzung
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 200
–
und der Übergangszone 2,0 – in der Hügelzone 1,6 – in der Bergzone I 1,4 – in der Bergzone II 1,1 – in der Bergzone III 0,9 – in der Bergzone IV 0,8 – Heuwiesen im Sömmerungsgebiet 0,7
der Förderung RGVE/ha
in der Ackerbauzone, der erweiterten Übergangszone
über 90 Betriebe in % LN in % 60 – 90 30 –60 20 – 30 15 – 20 10 –15 5 –10 bis 5 Quelle: BLW G r ö s s e n k l a s s e n i n h a LN mit vollen Beiträgen LN von der Beitragsdegression betroffen 30 20 10 0 10 20 30 0,2 0,2 1,2 0,4 18,2 27,0 18,6 16,3 8,8 10,4 0,7 0,1 19,0 18,2 22,3 19,7 9,6 2,0 5,3 ■ Flächennutzung mit Grünland
Die Abstufung der Beitragsbegrenzung nach Zonen orientiert sich einerseits am höchstzulässigen Tierbesatz gemäss Gewässerschutzrichtlinien und berücksichtigt andererseits das abnehmende Ertragspotential Durch die Staffelung wirken die Beiträge produktionsneutral, tragen aber wesentlich zu einer flächendeckenden Bewirtschaftung bei
Beitragsberechtigt ist, wer mindestens eine RGVE auf seinem Betrieb hält sowie die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllt
Die RGVE sind in zwei Beitragsgruppen aufgeteilt Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung, Bisons, Milchziegen und Milchschafe werden 900 Fr. und für die übrigen Ziegen und Schafe, sowie Hirsche, Lamas und Alpakas 400 Fr je RGVE ausgezahlt Der Beitrag pro RGVE für Tiere, welche einen höheren Arbeits- und Gebäudeaufwand verlangen, ist höher angesetzt als für die Tiere mit niedrigem Aufwand.
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2000
Die Beiträge ersetzen die bis 1998 ausbezahlten Beiträge an Kuhhalter, welche keine Milch zur Vermarktung abliefern Der Beitrag wird nicht nur für Kühe, deren Milch nicht vermarktet wird, sondern auch für andere Raufutter verzehrende Tiere bezahlt Bei den Milchproduzenten, die in den Genuss dieser Beiträge kommen, handelt es sich um solche mit einem relativ hohen Anteil an Aufzucht- oder Masttieren im Vergleich zu den Kühen und einer genügenden Grünfläche, also um eher extensiv bewirtschaftete Betriebe. Bei den Milchproduzenten wurde im Jahr 2000 pro 4‘000 kg im Vorjahr abgelieferter Milch eine RGVE vom beitragsberechtigen Bestand in Abzug gebracht
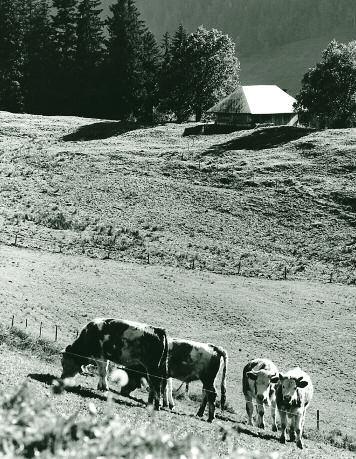
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 201
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Zu Beiträgen berechtigende RGVE Anzahl 77 507 73 614 146 990 298 112 Betriebe Anzahl 10 899 11 392 16 555 38 846 Zu Beiträgen berechtigende RGVE pro Betrieb Anzahl 7,1 6,5 8,9 7,7 Beiträge pro Betrieb Fr 6 188 5 641 7 659 6 655 Total Beiträge 1 000 Fr 67 444 64 265 126 795 258 505 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 65 568 62 745 126 312 254 624
Quelle: BLW
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 2000
ohne vermarkteter vermarktete
Die Betriebe mit vermarkteter Milch erhalten zwar rund 4'000 Fr. weniger RGVEBeiträge als die Betriebe ohne vermarktete Milch Dafür profitieren sie von der Marktstützung in der Milchwirtschaft (z B Zulage für verkäste Milch)
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung), werden bei dieser Massnahme auch soziale, strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt Beitragsberechtigt sind jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, die mindestens 1 ha LN in der Hügel- oder Bergregion bewirtschaften und zugleich mindestens 1 RGVE halten Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere. Die Massnahme begünstigt kleinere Betriebe, indem die Beiträge nur für höchstens 15 RGVE je Betrieb ausgerichtet werden Die Beitragsansätze sind nach Zonen differenziert
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 202
Merkmal Einheit Betriebe
Milch Milch Betriebe Anzahl 23 109 15 737 Tiere pro Betriebe RGVE 22,1 11,8 Abzug aufgrund Beitragsbegrenzung der Grünfläche RGVE 1,1 1,3 Milchabzug RGVE 15,3 0,0 Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE 5,7 10,6 Beiträge pro Betrieb Fr 5 057 9 001 Quelle: BLW
mit Betriebe
Ansätze pro RGVE 2000 Fr /GVE – in der Hügelzone 260 – in der Bergzone I 440 – in der Bergzone II 690 – in der Bergzone III 930 – in der Bergzone IV 1 190 ■ Abgeltung der Produktionserschwernisse
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 2000

Durch die Abnahme des Bestandes der zu Beiträgen berechtigten RGVE in der Hügelund in der Bergregion gingen die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen gegenüber dem Vorjahr um rund 4 Mio Fr zurück
Verteilung der Raufutter verzehrenden Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen nach Grössenklassen 2000
Der Anteil der RGVE ohne Beiträge entsprach 36,8% des Tierbestandes der beitragsberechtigten Betriebe Rund 82% des RGVE-Bestandes wurden auf Betrieben gehalten, die von der Beitragsbegrenzung auf 15 RGVE betroffenen sind Bei diesen Betrieben betrug der Anteil der RGVE ohne Beitrag 44,7%.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 203
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region 1 region region Zu Beiträgen berechtigende RGVE Anzahl 32 727 202 919 214 666 450 313 Betriebe Anzahl 2 303 15 501 17 903 35 707 RGVE pro Betrieb Anzahl 14,2 13,1 12,0 12,6 Beiträge pro Betrieb Fr 1 298 4 543 9 953 7 046 Total Beiträge 1 000 Fr 2 989 70 423 178 181 251 593 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 2 723 72 037 181 121 255 882
Quelle:
1 Betriebe, die einen Teil der Fläche in der Berg- und Hügelregion bewirtschaften
BLW
Quelle:
G r ö s s e n k l a s s e n i n R G V E RGVE mit Beitrag RGVE ohne Beitrag 100 500 50150 100 200 250 45–90 30–45 20–30 15–20 10–15 5–10 bis 5 30 73 95 127 95 17 72 42 9 85 47 18 65 59 58 25 80 65 Betriebe in 100 Tiere in RGVE in 1 000
BLW
■ Allgemeine Hangbeiträge: Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Hangbeiträge
Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung abgegolten. Sie werden nur für Wies-, Streu- und Ackerland ausgerichtet. Die Wiesen und Streuefläche müssen jährlich mindestens ein Mal gemäht werden Ausgeschlossen sind die Hecken und Feldgehölze sowie Weiden und Rebflächen
Anrecht auf Hangbeiträge haben jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllen und auf deren Betrieb die Gesamtfläche mit Hangneigung in der Hügel- oder Bergregion mehr als 50 Aren und pro Bewirtschaftungsparzelle mehr als 5 Aren misst Die Hanglagen sind in zwei Neigungsstufen unterteilt.

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 204
Ansätze 2000 Fr./ha – Neigung 18 bis 35% 370 – Neigung über 35% 510
■ Hangbeiträge: Zur Erhaltung der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen
Beiträge für Hangflächen 2000

Die Hangfläche wurde gegenüber dem Vorjahr um rund 1‘000 ha ausgedehnt Der Umfang der angemeldeten Flächen ändert von Jahr zu Jahr Dies hängt von den klimatischen Bedingungen ab, die einen Einfluss auf die Bewirtschaftungsart (mehr oder weniger Weideland oder Heuwiesen) haben
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei, Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten. Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden, wird für die Bemessung der Beiträge zwischen den steilen und besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern unterschieden Diese Eigenschaften sind einerseits bedeutend für das Landschaftsbild und erschweren anderseits die Bewirtschaftung Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 205
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region 1 region region Zu Beiträgen berechtigende Flächen: – Neigung 18–35% ha 4 419 67 872 74 089 146 380 – über 35 Neigung ha 1 277 19 087 63 123 83 487 Total ha 5 696 86 959 137 212 229 867 Betriebe Anzahl 2 113 14 515 17 252 33 880 Beitrag pro Betrieb Fr 1 082 2 400 3 454 2 855 Total Beiträge 1 000 Fr 2 287 34 843 59 584 96 714 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 2 227 34 761 58 894 95 882
Quelle:
1 Betriebe mit Flächen in der Berg- und Hügelregion
BLW
unter
Neigung 58% 18–35% Neigung 27% 35% und mehr Neigung 15%
Betriebe mit Hangbeiträgen 2000 Quelle: BLW
18%
Total 551 857 ha
Als Terrassenlagen gelten Rebflächen (ab 30% Neigung), welche mit Stützmauern regelmässig abgestuft sind und die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
die Flächen weisen eine minimale Terrassierung auf, das heisst höchstens 30 m Abstand zwischen den Stützmauern;
– die Terrassenlage misst mindestens eine ha;

die Stützmauern müssen mindestens 1 m hoch sein, gewöhnliche Betonmauern werden nicht berücksichtigt
Hangbeiträge für Rebflächen erhalten jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche die Grundvoraussetzungen und Mindestanforderungen der Direktzahlungsverordnung erfüllen und auf deren Betrieb die Fläche mit Hangneigung mehr als 10 Aren und pro Bewirtschaftungsparzelle mehr als 2 Aren misst Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig
für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2000
Der Anteil der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt rund 33% und der Anteil Betriebe gemessen an der Gesamtzahl aller Rebbaubetriebe 60%.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 206
–
–
Ansätze 2000 Fr /ha – für Flächen mit 30 bis 50% Neigung 1 500 – für Flächen mit über 50% Neigung 3 000 – für Flächen in Terrassenlagen 5 000 Beiträge
Einheit Zu Beiträgen berechtigende Flächen total ha 3 352 Steillagen 30 bis 50% Neigung ha 1 710 Steillagen über 50% Neigung ha 349 Terrassenanlagen ha 1 293 Anzahl Betriebe Anzahl 2 833 Fläche pro Betrieb ha 1,2 Beitrag pro Betrieb Fr 3 557 Total Beiträge 1 000 Fr 10 076 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 9 325 Quelle: BLW
Neuerungen 2001

Der Bundesrat hat am 10 Januar 2001 Beschlüsse im Agrarbereich gefasst, von denen auch die allgemeinen Direktzahlungen betroffen sind.
Für 2001 wird erstmals ein Zusatzbeitrag von 400 Fr /ha für die offene Ackerfläche und die Dauerkulturen ausgerichtet (Artikel 27 Absatz 2 Direktzahlungsverordnung) Dadurch soll jener Teil der gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Ackerbau abgegolten werden, welcher als Folge der Schwellenpreissenkung und der Liberalisierung der Getreidemarktordnung nicht mehr anders entschädigt werden kann Damit weiterhin 25% der LN ohne Kürzung der Direktzahlungen als ökologische Ausgleichsfläche angelegt werden können, wird auch die Begrenzung der Direktzahlungen pro Standardarbeitskraft um 10‘000 Fr auf 55‘000 Fr erhöht (Artikel 21 Direktzahlungsverordnung)
Bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere wird der Abzug für vermarktete Milch um 200 auf 4'200 kg/ RGVE (Artikel 31 Direktzahlungsverordnung) erhöht Von dieser Massnahme profitieren tendenziell vor allem Milchviehbetriebe mit einer eher extensiven Milchproduktion
Eine Änderung gibt es auch bei der Einkommens- und Vermögensgrenze So kann neu für die Berechnung des massgeblichen Einkommens ein Abzug von 30'000 Fr für verheiratete Bewirtschafterinnen oder Bewirtschafter (Artikel 22 Absatz 2 Direktzahlungsverordnung) vorgenommen werden Bei der Vermögensgrenze wurde der Abzug pro SAK um 80'000 Fr auf 200'000 Fr erhöht Ausserdem wird neu für verheiratete Bewirtschafterinnen oder Bewirtschafter (Artikel 23 Absatz 1 Direktzahlungsverordnung) zusätzlich ein Vermögensabzug von 200'000 Fr gemacht Mit dem neuen, zivilstandsabhängigen Grenzwert wird die teilweise zu Recht vorgetragene Kritik bezüglich Fraueneinkommen berücksichtigt und der Tatsache Rechnung getragen, dass Einkommens- und Vermögensgrenzen bei der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher und ökologischer Leistungen aus grundsätzlichen Überlegungen problematisch sind.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 207
2.2.3 Ökologische Direktzahlungen

Ökobeiträge
Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab, deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten, bei denen sie freiwillig mitmachen können Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig und die Beiträge können kumuliert werden Zwischen 1999 und 2000 wurden bei den Beitragsansätzen keine Änderungen vorgenommen Veränderungen bei den im Jahr 2000 ausbezahlten Beiträgen gegenüber dem Vorjahr sind ausschliesslich auf die Zu- oder Abnahme bei der Beteiligung zurückzuführen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 208 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ökoausgleich 41% Extenso 13% RAUS 32% BTS 9% Biologischer Landbau 5% Quelle: BLW T
Tabellen 32a–32b Seiten A34–A35 Verteilung der Ökobeiträge auf die verschiedenen Programme 2000
otal 261,8 Mio. Fr.
Ökologischer Ausgleich
Mit der Förderung des ökologischen Ausgleichs soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten bleiben und wo möglich wieder vergrössert werden Der ökologische Ausgleich trägt auch zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig angerechnet werden für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN Daneben gibt es Elemente, die nur für den ökologischen Ausgleich beim ÖLN anrechenbar sind
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Elemente mit Beiträgen Elemente ohne Beiträge, und beim ÖLN anrechenbar nur beim ÖLN anrechenbar extensiv genutzte Wiesen extensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte Wiesen Waldweiden
Streueflächen einheimische standortgerechte
Einzelbäume und Alleen
Hecken, Feld- und Ufergehölze Wassergräben, Tümpel, Teiche
Buntbrachen Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle Rotationsbrachen Trockenmauern
Ackerschonstreifen unbefestigte natürliche Wege Hochstamm-Feldobstbäume Rebflächen mit hoher Artenvielfalt
weitere, von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen
Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und dürfen während sechs Jahren jeweils frühestens Mitte Juni genutzt werden Das späte Mähen soll gewährleisten, dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird Es lässt auch zahlreichen wirbellosen Tieren, bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion Das Düngen und der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln, mit Ausnahme der Einzelstockbehandlung von Problemunkräutern, sind verboten
Für extensiv genutzte Wiesen, Streueflächen, Hecken, Feld- und Ufergehölze werden, abgestuft nach Zonen, gleich hohe Beiträge ausbezahlt
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 209
Ansätze 2000 Fr /ha – Ackerbau- und Übergangszonen 1 500 – Hügelzone 1 200 – Bergzonen I und II 700 – Bergzonen III und IV 450
Extensiv genutzte Wiesen
Tabellen 33a–33d Seiten A36–A39
■
■
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten, welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden. Es gelten grundsätzlich die gleichen Bewirtschaftungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen Die Flächen dürfen jedoch erst ab dem 1 September gemäht werden
Die leichte Abnahme der Streueflächen dürfte darauf zurückzuführen sein, dass einzelne solche Flächen neu als extensive Wiesen angemeldet wurden

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 210 Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000 Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 16 974 8 650 9 230 34 854 Fläche ha 16 804 8 052 13 816 38 672 Fläche pro Betrieb ha 0,99 0,93 1,50 1,11 Beitrag pro Betrieb Fr 1 447 923 786 1 142 Total Beiträge 1 000 Fr 24 567 7 986 7 256 39 809 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 21 494 6 978 6 462 34 934 Quelle: BLW
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000 Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 1 392 1 213 1 911 4 516 Fläche ha 1 299 863 1 549 3 712 Fläche pro Betrieb ha 0,93 0,71 0,81 0,82 Beitrag pro Betrieb Fr 1 387 681 477 812 Total Beiträge 1 000 Fr 1 930 826 911 3 668 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 2 116 956 1 396 4 468 Quelle: BLW
Streueflächen
■ Hecken, Feld- und Ufergehölze
Als Hecken, Feld- oder Ufergehölze gelten Nieder-, Hoch- oder Baumhecken, Windschutzstreifen, Baumgruppen, bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet werden. Sie müssen sachgerecht gepflegt werden Verboten sind sowohl die Düngung als auch die Verwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln Den Gehölzstreifen entlang ist ein ungedüngter Krautsaum von mindestens 3 m Breite anzulegen
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000
■ Wenig intensiv genutzte Wiesen
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem geringen Ausmass mit Mist oder Kompost gedüngt werden. Daneben gelten die selben Nutzungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 211
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 5 129 2 493 1 121 8 743 Fläche ha 1 260 685 330 2 275 Fläche pro Betrieb ha 0,25 0,27 0,29 0,26 Beitrag pro Betrieb Fr 364 280 190 318 Total Beiträge 1 000 Fr 1 865 698 214 2 777 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 1 847 690 230 2 767 Quelle: BLW
Ansätze 2000 Fr /ha – Ackerbau- bis Hügelzone 650 – Bergzonen I und II 450 – Bergzonen III und IV 300 Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000 Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 10 499 9 504 11 100 31 103 Fläche ha 9 164 8 713 22 228 40 106 Fläche pro Betrieb ha 0,87 0,92 2,00 1,29 Beitrag pro Betrieb Fr 560 505 684 587 Total Beiträge 1 000 Fr 5 884 4 797 7 589 18 269 Total Beiträge 1999 1 000 Fr. 6 032 4 806 7 607 18 445 Quelle: BLW
■
Buntbrachen

Als Buntbrachen gelten mehrjährige, mit einheimischen Wildkräutern angesäte Streifen von mindestens 3 m Breite Die Düngung dieser Streifen ist verboten Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind. Ab dem zweiten Standjahr dürfen sie zwischen dem 1 Oktober und dem 15 März zur Hälfte geschnitten werden Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung
Im Jahr 2000 wurden pro ha 3’000 Fr bezahlt Beiträge werden nur für Flächen in der Tal- und Hügelregion ausgerichtet Innerhalb der Hügelregion sind die Flächen der Bergzone I nicht beitragsberechtigt.
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000
1 Hier handelt es sich um Betriebe, die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften
Quelle: BLW
Die Buntbrache ist im im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Getreidemarktes eine wirtschaftlich interessante Alternative zu den Ackerkulturen geworden Dies erklärt den hohen Beteiligungszuwachs
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 212
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 1 493 299 4 1 1 796 Fläche ha 1 126 188 1 1 315 Fläche pro Betrieb ha 0,75 0,63 0,32 0,73 Beitrag pro Betrieb Fr 2 264 1 882 945 2 197 Total Beiträge 1 000 Fr 3 380 563 4 3 946 Total Beiträge 1999 1 000 Fr. 1 981 253 1 2 235
■ Rotationsbrachen
Als Rotationsbrachen gelten ein- bis zweijährige, mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen, die mindestens 6 m breit sind und mindestens 20 Aren umfassen In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich Die Düngung dieser Streifen ist verboten. Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind Rotationsbrachen dürfen zwischen dem 1 Oktober und dem 15 März geschnitten werden In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel, Hasen und Insekten Lebensraum
Im Jahr 2000 wurden pro ha 2’500 Fr ausgerichtet Beiträge gibt es nur für Flächen in der Tal- und Hügelregion Innerhalb der Hügelregion sind die Flächen der Bergzone I nicht beitragsberechtigt.
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000
■ Ackerschonstreifen
Quelle: BLW
Wie bei der Buntbrache ist auch bei der Rotationsbrache der hohe Zuwachs einerseits auf die wirtschaftliche Attraktivität zurückzuführen Andererseits werden Rotationsbrachen erst 1999 gefördert.
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite extensiv bewirtschaftete Randstreifen von Ackerkulturen Verboten sind der Einsatz von Stickstoffdüngern und Insektiziden sowie die breitflächige chemische oder mechanische Unkrautbekämpfung Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind Als Saaten eignen sich Getreide (ausser Mais), Raps, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Soja
Im Jahr 2000 wurden pro ha 1’000 Fr bezahlt Beiträge gibt es nur für Flächen in der Tal- und Hügelregion Innerhalb der Hügelregion sind die Flächen der Bergzone I nicht beitragsberechtigt.
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 213
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 712 118 0 830 Fläche ha 887 132 0 1 019 Fläche pro Betrieb ha 1,25 1,12 0 1,23 Beitrag pro Betrieb Fr 3 115 2 793 0 3 070 Total Beiträge 1 000 Fr 2 218 330 0 2 548 Total Beiträge 1999 1 000 Fr. 735 86 0 821
■ Hochstamm-Feldobstbäume
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000
Die Förderung der Ackerschonstreifen wurde 1999 begonnen Im Vergleich zu den Bunt- und Rotationsbrachen sind Ackerschonstreifen wirtschaftlich weniger attraktiv
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume, die nicht in einer Obstanlage stehen, sowie für Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven Die Stammhöhe muss bei Steinobstbäumen mindestens 1,2 m, bei den übrigen Bäumen mindestens 1,6 m betragen. Der Einsatz von Herbiziden zur Freihaltung des Stammes ist ausser bei Bäumen von weniger als fünf Jahren verboten Die Beitragsberechtigung besteht ab einer Mindestzahl von 20 Bäumen Die Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume können mit jenen für extensiv oder wenig intensiv genutzte Wiesen kumuliert werden
Im Jahr 2000 wurden pro Baum 15 Fr bezahlt
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 214
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 154 35 0 189 Fläche ha 43 50 48 Fläche pro Betrieb ha 0,28 0,15 0 0,26 Beitrag pro Betrieb Fr 280 151 0 256 Total Beiträge 1 000 Fr 43 50 48 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 53 60 59 Quelle: BLW
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 17 979 13 378 5 459 36 816 Bäume Anzahl 1 266 129 944 832 259 539 2 470 500 Bäume pro Betrieb Anzahl 70,42 70,63 47,54 67,10 Beitrag pro Betrieb Fr 1 056 1 059 713 1 007 Total Beiträge 1 000 Fr 18 991 14 172 3 893 37 057 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 19 088 14 098 3 759 36 945 Quelle: BLW
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 2000
Rotationsbrachen 1,1%

Wenig intensiv genutzte Wiesen 43,2% F
Extensiv genutzte Wiesen2 47,8% Streuefläche 4,0%
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 215
eld- und U
BLW 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume 2 inkl extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland Total 92 858 ha
ckerschonstreifen 0,1%
fergehölze 2,4% Quelle:
A
Buntbrachen 1,4%
Extensive Produktion von Getreide und Raps
Diese Massnahme hat zum Ziel, den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren, Fungiziden, chemisch-synthetischen Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und Insektiziden zu fördern Diese Anforderungen sind auf der gesamten Brotgetreide-, Futtergetreide- oder Rapsfläche eines Betriebes einzuhalten

Der Anteil von Brotgetreide, der nach den Auflagen für die extensive Produktion angebaut wird, beträgt 42% der Gesamtproduktion Dieser Anteil liegt bei 63% für Futtergetreide (ohne Körnermais) und bei 25% für Raps
Im Jahr 2000 wurden pro ha 400 Fr. ausgerichtet.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 216
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000 Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 11 916 7 294 1 272 20 482 Fläche ha 55 327 25 336 2 914 83 577 Fläche pro Betrieb ha 4,64 3,47 2,29 4,08 Beitrag pro Betrieb Fr 1 855 1 389 918 1 631 Total Beiträge 1 000 Fr 22 103 10 128 1 168 33 398 Total Beiträge 1999 1 000 Fr. 23 360 10 444 1 332 35 136 Quelle: BLW Aufteilung der Extensofläche 2000 Brotgetreide 50% Raps 4% Futtergetreide 46% Quelle: BLW Total 83 577 ha
Tabelle 34, Seite A40
Biologischer Landbau
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform. Um Beiträge zu erhalten, müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb mindestens die Anforderungen der im August 2000 revidierten Bio-Verordnung vom 22 September 1997 erfüllen Teilumstellungen sind nur bei Betrieben mit Wein-, Obst-, Gemüseproduktion oder Zierpflanzenanbau möglich Gefordert werden unter anderem der Verzicht auf chemisch-synthetisch hergestellte Hilfsstoffe, wie Handelsdünger oder Pestizide Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig, die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen

Im Jahr 2000 umfasste der biologische Landbau 8% der gesamten LN
Dass die biologische Landwirtschaft im Trend ist, zeigt auch die Zunahme der Betriebe im Vergleich zu 1999 um rund 3,5% Die nach der Bioverordnung oder den Biorichtlinien bewirtschaftete Fläche vergrösserte sich um 5,5%
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 217
Ansätze 2000 Fr /ha – Spezialkulturen 1 000 – Offene Ackerfläche ohne Spezialkulturen 600 – Grün- und Streueflächen 100

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 218
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 982 1 117 2 805 4 904 Fläche ha 16 186 17 673 48 962 82 822 Fläche pro Betrieb ha 16,48 15,82 17,46 16,89 Beitrag pro Betrieb Fr 4 669 2 256 1 811 2 485 Total Beiträge 1 000 Fr 4 585 2 520 5 080 12 185 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 4 382 2 384 4 871 11 637 Quelle: BLW
der biologisch
Talregion 20% Bergregion 59% Quelle: BLW Total 82 822 ha Hügelregion 21% Tabelle
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 2000
Anteil
bewirtschafteten Fläche nach Region 2000
32a, Seite A34
■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme
Besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere
Unter diesem Titel werden die beiden im Folgenden beschriebenen Programme BTS und RAUS zusammengefasst
Gefördert wird die Tierhaltung in Haltungssystemen, welche Anforderungen erfüllen, die wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen Es gelten die folgenden Grundsätze:
die Tiere werden frei in Gruppen gehalten; – den Tieren stehen ihrem natürlichen Verhalten angepasste Ruhe-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung;
die Ställe verfügen über genügend natürliches Tageslicht.
Betriebe, Tiere (GVE) und Beiträge 2000
Gegenüber 1999 ist eine markante Zunahme der Anzahl teilnehmender Betriebe (+19%) sowie der Beitragssumme (+18%) zu verzeichnen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 219
–
–
Ansätze 2000 Fr /GVE – Tiere der Rindergattung, Ziegen, Kaninchen 70 – Schweine 135 – Geflügel 180
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 6 724 4 004 2 215 12 943 GVE Anzahl 158 722 73 574 32 940 265 236 GVE pro Betrieb Anzahl 23,61 18,38 14,87 20,49 Beitrag pro Betrieb Fr. 2 213 1 760 1 274 1 912 Total Beiträge 1 000 Fr 14 877 7 049 2 822 24 749 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 12 729 5 996 2 277 21 002 Quelle: BLW
Beitragsberechtigte
35 Seite A41
Tabelle
■ Regelmässiger Auslauf ins Freie
Gefördert wird der regelmässige Auslauf von Nutztieren im Freien, das heisst auf einer Weide, in einem Laufhof bzw in einem Aussenklimabereich, der den Bedürfnissen der Tiere entspricht Für die verschiedenen Tierarten gelten die folgenden Anforderungen:
Raufutter verzehrende Nutztiere
– Weidegang an mindestens 26 Tagen im Monat während der Vegetationsperiode
Auslauf an mindestens 13 Tagen im Monat während der Winterfütterungsperiode
Schweine
Mastschweine, Aufzuchtschweine und Zuchteber: täglicher Auslauf
– Galtsauen: Auslauf an mindestens 3 Tagen in der Woche
Geflügel
– täglicher Auslauf
Beitragsberechtigte Betriebe, Tiere (GVE) und Beiträge 2000
Gegenüber 1999 ist eine markante Zunahme der Anzahl teilnehmender Betriebe (+17%) sowie der Beitragssumme (+15%) zu verzeichnen
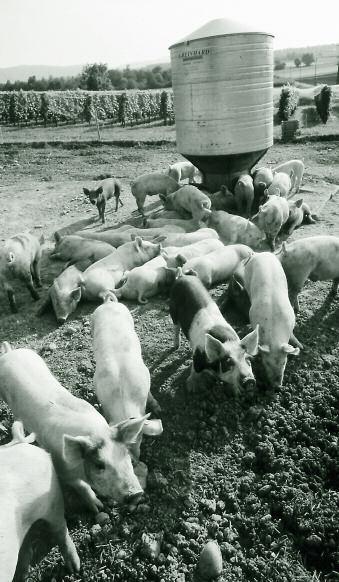
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 220
–
–
Ansätze 2000 Fr /GVE – Tiere der Rinder- und Pferdegattung, Bisons, Schafe, Ziegen, Dam- und Rothirsche sowie Kaninchen 135 – Schweine 135 – Geflügel 180
Merkmal Einheit Tal- Hügel- Berg- Total region region region Betriebe Anzahl 11 244 8 807 10 070 30 121 GVE Anzahl 267 823 183 299 166 878 618 000 GVE pro Betrieb Anzahl 23,82 20,81 16,57 20,52 Beitrag pro Betrieb Fr. 3 206 2 817 2 236 2 768 Total Beiträge 1 000 Fr 36 048 24 806 22 516 83 370 Total Beiträge 1999 1 000 Fr 30 823 21 482 20 384 72 689 Quelle: BLW
■ Aufteilung bei BTS und RAUS nach Tierkategorien
Aufteilung bei BTS nach Tierkategorien 2000 Geflügel 10,2%
Aufteilung bei RAUS nach Tierkategorien 2000 Geflügel 3,0%

ine 8,9%
ere 7,5%
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 221
Quelle: BLW
Rindergattung 67
3%
Total 265 236 GVE
,
Schweine 22,0% Andere 0,5%
Quelle: BLW
Rindergattung 80,6% Schwe
And
Total 618 000 GVE
Bewirtschaftung der Sömmerungsgebiete
Sömmerungsbeiträge
Mit den Sömmerungsbeiträgen soll die Bewirtschaftung und Pflege unserer ausgedehnten Sömmerungsweiden in den Alpen und Voralpen sowie im Jura gewährleistet werden Das Sömmerungsgebiet umfasst rund 600'000 ha, welche mit über 300'000 GVE genutzt und gepflegt werden Beitragsberechtigt sind Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, welche Tiere auf einem Sömmerungs-, Hirten- oder Gemeinschaftsweidebetrieb sömmern

Sömmerungsbeiträge wurden unter der Bedingung gewährt, dass die Betriebe sachgerecht und umweltschonend bewirtschaftet und allfällige kantonale, kommunale oder genossenschaftliche Vorschriften eingehalten werden. Am 29. März 2000 hat der Bundesrat die Sömmerungsbeitragsverordnung revidiert, die Beitragskonzeption den heutigen Anforderungen im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung angepasst und die Bewirtschaftungsanforderungen entsprechend ausgedehnt. Ausserdem hat er der speziellen Problematik der Schafalpung Rechnung getragen
Mit Inkrafttreten der neuen Sömmerungsbeitragsverordnung auf den 1 Mai 2000 erfolgte ein Systemwechsel, indem die Beiträge nicht mehr pro Tier, sondern nach Normalstoss (NST) beziehungsweise GVE ausgerichtet werden. Ein NST entspricht der Sömmerung einer GVE während 100 Tagen Im Sinne einer Besitzstandswahrung erhalten Sömmerungsbetriebe mit kürzerer Alpungsdauer für die gemolkenen Tiere weiterhin den Beitrag nach GVE ausgerichtet. Mit der neuen Verordnung wurden die Nachteile der bisherigen Regelung wie Intensivierungsanreiz, höhere Beiträge für gemolkene Tiere oder Nichtberücksichtigung der Sömmerungsdauer weitgehend beseitigt Gleichzeitig wurden neue Bewirtschaftungsanforderungen, insbesondere auch für die Schafalpung definiert und die Beiträge erhöht Mit der Festlegung des Normalbesatzes aufgrund der Sömmerung in den Jahren 1996 bis 1998 wird neu pro Sömmerungsbetrieb jährlich ein Pauschalbetrag ausgerichtet Dieser bleibt unverändert, sofern sich die Bestossung innerhalb von 75 bis 110% des Normalbesatzes bewegt.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 222
Ansätze 2000 – Für gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe pro GVE (56–115 Tage Sömmerung) 300 – Für Schafe ohne Milchschafe pro NST 120 – Für übrige Raufutter verzehrende Tiere pro NST 260
Nachhaltige
Tabelle 36,
■
Seite A42
Sömmerungsbeiträge 2000
1 Bei dieser Zahl handelt es sich um das Total der beitragsberechtigten Sömmerungsbetriebe (ohne Doppelzählungen)
Beiträge für den Gewässerschutz
Mit dem Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes kann der Bund Massnahmen der Landwirte zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in ober- und unterirdische Gewässer fördern Das Schwergewicht wird auf die Verminderung der Nitratbelastung des Trinkwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen gelegt, in denen der ÖLN, der Biolandbau, Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso, ökologischer Ausgleich) nicht genügen

Gemäss der neuen Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet, für oberund unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und 50% für Bewirtschaftungsmassnahmen 2000 wurden 1'089‘690 Fr ausbezahlt
Das BUWAL und das BLW haben Strategien zur Verminderung der durch die Landwirtschaft verursachten Nitrat- und Phosphorbelastung ausgearbeitet
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 223
Merkmal Beiträge Betriebe GVE oder NST Mio. Fr. Anzahl Anzahl Kühe, Milchziegen und Milchschafe 23 136 3 416 77 227 Schafe ohne Milchschafe 2 961 1 087 25 227 Übrige Raufutter verzehrende Tiere 55 140 7 197 209 973 Total 81 238 7 968 1 Total 1999 67 571 8 233
Quelle: BLW
■ Abschwemmungen und Auswaschung verhindern
Überblick über die Projekte 2000
Voraussichtliche
Verschiedene Projekte sind bei den Kantonen in Vorbereitung Das BLW erwartet mittelfristig 10 Nitrat- und 2 Phosphorprojekte Diese Massnahmen werden über die für die Ökobeiträge bewilligten Kredite bezahlt.
Die Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland ist die effizienteste Massnahme, um die Nitratauswaschung zu reduzieren In Avry-sur-Matran wurden rund 15% mehr Wiesenflächen angelegt.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 224
Kanton Region, Gemeinde
Projektgebiet Projektdauer Jahr ha LU Sempach 1999–2008 4 905 LU Baldeggersee 2000–2008 4325 VD Thierrens 2000–2008 17,35 VD Morand 2000–2008 14,05 ZH Baltenswil 2000–2008 70 0 BE Walliswil 2000–2008 77,7 FR Avry-sur-Matran 2000–2005 36,7 FR Middes 2000–2006 44,96 SO Gäu 2000–2005 657,9 LU/AG Hallwilersee 2001–2008 3 786 AG Wohlenschwil Start 2001 61,5 TG Klettgau Start 2001 174 Phase I AG Büschikon Start 2001 36 Quelle: BLW
Avry-sur-Matran FR offene Ackerflächen Kunstwiese Wiesen /Weiden i n % d e r L N 1999 2001 Quelle: BLW 0 60 50 40 30 10 20 ■ Flächenentwicklung im Projekt Ayry-sur-Matran
■ Ökologischer Ausgleich
Neuerungen 2001
Der Bundesrat hat am 10 Januar 2001 Beschlüsse im Agrarbereich gefasst, von denen auch die ökologischen Direktzahlungen betroffen sind. Bei den folgenden Programmen wurden die Beiträge erhöht:
Die Beiträge für Ackerschonstreifen wurden um 500 auf 1'500 Fr /ha erhöht Damit soll die Attraktivität dieses Elementes des ökologischen Ausgleichs gesteigert werden
■ Biologischer Landbau
Die Flächenbeiträge für den biologischen Landbau wurden gegenüber den Flächenbeiträgen für die ÖLN-Betriebe stärker erhöht Diese besonders umweltfreundliche Produktionsweise wird dadurch vom Bund vermehrt gefördert Die Erhöhung der Beiträge beträgt für die Spezialkulturen 200 Fr., für die offene Ackerfläche 200 Fr. und für die übrige LN 100 Fr
■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme
Die Förderung der Tierhaltung in besonders tierfreundlichen Ställen dient einerseits dem Wohlbefinden der Tiere Andererseits ist die tierfreundliche Haltung der Nutztiere auch ein wichtiges Element für das Image der Landwirtschaft. Durch die Erhöhung der Beiträge für Tiere der Rindergattung, Ziegen, Kaninchen und Schweine um 20 Fr /GVE wird die Attraktivität dieses Programmes erhöht
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 225
Ansätze 2001 Fr /ha – Spezialkulturen 1 200 – Offene Ackerfläche ohne Spezialkulturen 800 – Grün- und Streueflächen 200
Ansätze 2001 Fr /GVE – Rindergattung, Ziegen, Kaninchen 90 – Schweine 155
■ Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien
Auch der regelmässige Auslauf dient dem Wohlbefinden der Tiere. Die Beiträge für dieses Programm wurden für Tiere der Rinder- und Pferdegattung, Bisons, Schafe, Ziegen, Dam- und Rothirsche sowie für Kaninchen um 45 Fr /GVE sowie für Schweine um 20 Fr./GVE erhöht.
Ansätze 2001 Fr /GVE
Tiere der Rinder – und Pferdegattung, Bisons, Schafe, Ziegen, Dam- und Rothirsche, Kaninchen
■ Öko-Qualitätsverordnung
Der Bundesrat hat am 4 April 2001 die Öko-Qualitätsverordnung verabschiedet Damit verstärkt der Bund sein Engagement für eine effiziente Erhaltung der natürlichen Artenvielfalt Die regionalen Massnahmen zur qualitativen Verbesserung sowie zur gezielten Anlage von ökologischen Ausgleichsflächen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen werden stärker unterstützt Die neue Verordnung ist die Antwort auf die wissenschaftlich untermauerte Kritik, ein Teil der ökologischen Ausgleichsflächen sei von ungenügender Qualität und trage nicht zu einer sinnvollen Vernetzung bei.
Die Kantone müssen ihre Anforderungen an die Qualität und Vernetzung selbst festlegen und je nach Finanzkraft 10 bis 30% der Beiträge übernehmen.
An die Finanzhilfen des Bundes sind maximal die folgenden an die Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen ausgerichteten Beiträge anrechenbar:
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 226
–
180 –
155
Schweine
Ansätze 2001 Fr – für die biologische Qualität 500 –/ha – für die Vernetzung 500,.–/ha – für Hochstamm-Feldobstbaum 20 –/Baum
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte und effiziente Nahrungsmittelproduktion
Finanzhilfen für die Grundlagenverbesserung
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt:
Moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen;

– Effiziente und umweltgerechte Produktion;
– Ertragreiche, möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte;
Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt;
– Genetische Vielfalt
227 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
2.3 Grundlagenverbesserung
Massnahme Rechnung Rechnung Budget 1999 2000 2001 Mio Fr Strukturverbesserungen 76 88 91 Investitionskredite 20 100 105 Betriebshilfe 58 35 Beratungswesen und Forschungsbeiträge 23 22 24 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge 362 Pflanzen- und Tierzucht 21 21 22 Total 148 245 279 Quelle: BLW
–
–
2.3.1 Strukturverbesserungen und Betriebshilfe
Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert Dies betrifft insbesondere das Berggebiet und die Randregionen
Als Investitionshilfen stehen zwei Instrumente zur Verfügung:
– Beiträge (à-fonds-perdu) mit Beteiligung der Kantone;
Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen.

Investitionshilfen unterstützen die Landwirtschaft in der Entwicklung und der Erhaltung wettbewerbsfähiger Strukturen, ohne dass sie sich dafür untragbar verschulden muss Auch in andern Ländern, insbesondere in der EU, zählen die Investitionshilfen zu den wichtigsten Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raumes
Die Investitionshilfen werden für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.
Für Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten standen im Jahr 2000 87 Mio Fr zur Verfügung, davon 7 Mio Fr als Nachtragskredit für die Behebung der Unwetterschäden im Jahr 1999 Das BLW genehmigte neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 82 Mio Fr Damit wurde ein Investitionsvolumen von 340 Mio Fr ausgelöst Die Summe der ausgerichteten Bundesbeiträge der genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen», da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise im gleichen Jahr erfolgen und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird.
228 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
■ Finanzielle Mittel für Beiträge
Beiträge des Bundes 2000 Landumlegungen mit
Unwetterschäden und andere Tiefbaumassnahmen Ö
Der Bund setzte im Jahr 2000 14% mehr finanzielle Mittel in Form von Beiträgen ein als im Vorjahr Gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1990/92 ist die Summe aber 27% tiefer Die Erhöhung der Bundeskredite zur Behebung von Unwetterschäden ist in den ordentlichen Rubriken 1994 und 2000 enthalten.
Beiträge des Bundes an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten 1990/92–2000

229 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
2
Tabellen 39–40, Seiten A47–A48
Wegebauten Wasserversorgungen
Infrastrukturmassnahmen
konomiegebä
ür Raufutter
Tiere andere Hochbaumassnahmen Mio Fr 64% 13% 23% Talregion Hügelregion Bergregion 27,1 0 5 10 15 20 25 30 12,2 8,7 8,7 23,7 1,7 Quelle: BLW
ude f
verzehrende
1990/921993 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 M i o F r ordentliche Rubrik Sonderrubrik zur Förderung der Beschäftigung im landw Hochbau Quelle: BLW 1 In den Jahren 1993 und 1994 wurden Sonderkredite für den landwirtschaftlichen Hochbau zur Förderung der Beschäftigung gesprochen 0 20 40 60 80 100 120 140 11991 51 91 151 85 85 82 75 75 87
Im Jahre 2000 bewilligten die Kantone für 2’542 Fälle Investitionskredite von insgesamt 266,1 Mio Fr Von diesem Kreditvolumen entfallen 87,2% auf einzelbetriebliche und 12,8% auf gemeinschaftliche Massnahmen Im Berggebiet können für gemeinschaftliche Projekte auch Überbrückungskredite, so genannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren, gewährt werden
Investitionskredite 2000
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen wurden z B als Starthilfe, für den Neubau, den Umbau oder die Verbesserung von landwirtschaftlichen Wohn- und Ökonomie- oder Alpgebäuden eingesetzt Sie werden durchschnittlich in 13,1 Jahren zurückbezahlt. Die pauschalen Ansätze für die Starthilfe und für die Wohnhäuser wurden ab 2000 um durchschnittlich 25% angehoben
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen und bauliche Massnahmen (Alpgebäude, Gemeinschaftsställe, Gebäude und Einrichtungen für die Verarbeitung und die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte) unterstützt

Investitionskredite 2000 nach Massnahmenkategorie, ohne Baukredite

230
Bestimmung Fälle Betrag Anteil Anzahl Mio Fr % Einzelbetriebliche Massnahmen 2 309 232,0 87,2 Gemeinschaftliche Massnahmen, ohne Baukredite 132 10,0 3,8 Baukredite 101 24,1 9,0 Total 2 542 266,1 100,0 Quelle: BLW
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Finanzielle Mittel für Investitionskredite
Tabellen 41–42 Seiten A49–A50
Ökonomiegebäude Starthilfe Wohngebäude Gemeinschaftlicher Inventarkauf, Verarbeitung und Lagerung landw. Produkte Kauf Betrieb durch Pächter Bodenverbesserungen Mio Fr 26,5% 46,0% 27,5% Talregion Hügelregion Bergregion 113,7 0 2040 60 80 100 120 71,4 47,1 4,2 2,7 2,9 Quelle: BLW
■ Unwetterschäden 1999/ 2000
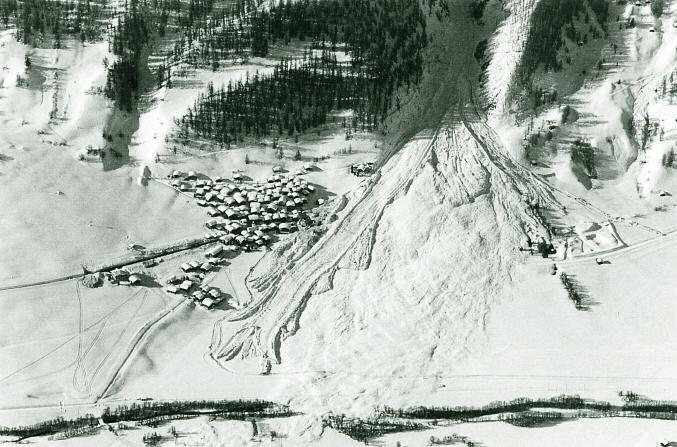
Im seit 1963 geäufneten Fonds de roulement befinden sich rund 1,7 Mrd. Fr. Den Kantonen werden jährlich neue Bundesmittel zur Verfügung gestellt; im Jahre 2000 waren es 100 Mio Fr Sie werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt.
Die ausserordentlichen Lawinen- und Unwetterereignisse im Jahre 1999 haben gesamthaft direkte Schäden von 800 Mio Fr verursacht Im Bereich Landwirtschaft meldeten zwölf Kantone Schäden von 27 Mio Fr an Kulturland und kulturtechnischen Bauten an Zur Behebung dieser Schäden sind im Jahre 2000 Bundesbeiträge im Umfang von 8,3 Mio Fr zugesichert worden Erstmals kam dabei Artikel 95 des Landwirtschaftsgesetzes für Zusatzbeiträge zur Behebung besonders schwerer Folgen von ausserordentlichen Naturereignissen zur Anwendung Für 7 Mio Fr wurden Nachtragskredite gesprochen
Für den Zukauf von Futtermitteln und für Ertragsausfallsentschädigungen bestehen beim Bund keine Unterstützungsmöglichkeiten Die angefallenen Kosten sind weitgehend durch freiwillige Hilfen und Spenden der Hilfsorganisationen gedeckt worden Ertragsausfälle sind zudem vom «Schweizerischen Elementarschädenfonds» entschädigt worden, welcher sich auch an den Kosten der Feinräumung von Privaten beteiligt hat
Nach einer ausserordentlichen Niederschlagsperiode im Oktober 2000 sind im Wallis und auf der Alpensüdseite wiederum grosse Schäden entstanden Bis zu Jahresende sind direkte Schäden von gesamthaft 670 Mio Fr gemeldet worden Im Bereich Landwirtschaft werden diese auf 27 Mio Fr geschätzt Der mutmassliche Bedarf an Bundesmitteln beträgt 15 Mio Fr , wovon ein grosser Teil über Nachtragskredite gedeckt werden soll.
231 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2
■ Durchführung in drei Phasen
Evaluation von Gesamtmeliorationen
Gesamtmeliorationen werden seit Beginn des letzten Jahrhunderts durchgeführt Die früher üblichen Erbteilungen (Code Napoleon) hatten zu einer starken Parzellierung der bewirtschafteten Flächen geführt Aber auch Weg- und Rückerechte und das Fehlen von befahrbaren Wegen hatten die Bewirtschaftung zusehends behindert Mit den Güterzusammenlegungen werden Strukturen geschaffen, die eine effiziente Bewirtschaftung ermöglichen Mit dem landesweiten Ausbau der übergeordneten Infrastruktur ab den fünfziger Jahren (Flughafen Kloten, Autobahnen, später Ausbau der Eisenbahnen) und mit dem Einsetzen der Orts-, Regional- und Landesplanung wurden die Gesamtmeliorationen auch für diese vielfältigen Aufgaben eingesetzt Die Verwirklichung von Anliegen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes setzte verstärkt ab den achtziger Jahren ein Die Durchführung einer Gesamtmelioration wurde mehr und mehr eine interdisziplinäre Aufgabe mit dem Ziel, für die Landwirtschaft und die Öffentlichkeit vorteilhafte Lösungen zu realisieren.
Die öffentlichen Interessen haben im Rahmen von Gesamtmeliorationen im Laufe der Zeit stark zugenommen In den letzten Jahren stellte sich deshalb die Frage, welchen Nutzen die Güterzusammenlegungen für den einzelnen Landwirtschaftsbetrieb haben
Unter dem Titel «Privater Nutzen von Arrondierung und Wegnetz bei Gesamtmeliorationen» hat das Institut für Kulturtechnik der ETH-Zürich die mit diesen Werken erzielten Einsparungen quantifiziert. Dabei wurden die Bewirtschaftungsverhältnisse vor und nach der Gesamtmelioration verglichen Unter Arrondierung versteht man die Verbesserung der Parzellenform, die Gruppierung der Parzellen (Bewirtschaftungseinheiten) wie auch die Zugänglichkeit der Parzellen (Erschliessung) Unter Wegnetz wird die Wegdistanz zwischen Hof und Parzellenschwerpunkt betrachtet
Phase 1 Sichten und Bewerten von Grundlagen
Phase 2
Wahl und Überprüfung eines Berechnungsansatzes anhand eines Pilotprojektes
Phase 3
Statistische Auswertungen anhand von weiteren Beispielen aus der Praxis
In einer ersten Phase wurden 14 verschiedene Arbeiten, welche sich mit ökonomischen Fragen der Landbewirtschaftung befassten, wissenschaftlich ausgewertet, um festzustellen, ob eines der Modelle für den vorgegebenen Auftrag eingesetzt werden konnte Ausgewählt wurde in der zweiten Phase das Modell der Wegleitung 1995 des Schweizerischen Bauernverbandes (SBV) «Berechnungsgrundlagen für wirtschaftliche Auswirkungen veränderter Grössen, Formen und Zufahrtswegen von Parzellen infolge Mehrweg, An- und Durchschneideschäden» Damit können umgekehrt auch die Einsparungen durch verbesserte Feldformen (Arrondierung) und kürzere Feldentfernungen (Wegnetz) für jede einzelne Parzelle berechnet werden Die Einsparungen an Arbeitszeit, Zugkraft und Maschinenkosten nach der Güterzusammenlegung ergeben den privaten Nutzen bei Gesamtmeliorationen in Fr /ha und Jahr
232
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Für das Pilotprojekt wurde mittels Zufallsgenerator die Gesamtmelioration Ermensee LU ausgewählt Es konnte aufgezeigt werden, dass anhand der Wegleitung des SBV die Kostenersparnis für die Bewirtschafter bezüglich Feldentfernung und Feldform erfasst werden konnte und auch aus statistischer Sicht brauchbare Ergebnisse resultierten.
In einer dritten Phase wurden mittels Zufallszahl weitere Gesamtmeliorationen ausgewählt, bei denen die Einsparungen berechnet wurden Die Untersuchungen beziehen sich auf die Jahre 1994/95 In einem ersten Schritt wurden nur die Parzellen im Eigentum in die Untersuchung einbezogen Die Pachtparzellen wurden in einer separaten Arbeit behandelt
Untersuchte Gesamtmeliorationen
1 In diesen Gesamtmeliorationen wurden sowohl das Eigenland als auch das Pachtland untersucht
2 Wallenschwil ist ein kleiner Teilperimeter der Gesamtmelioration
Beinwil-Wiggwil-Winterschwil

233 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
Gesamtmelioration Perimeterfläche ha Pilotprojekt: Ermensee (LU) 1 427 Otelfingen-Boppelsen (ZH) 1 555 Beinwil (AG), Teilperimeter Wallenschwil 2 99 Ins-Gampelen-Gals (BE) 2 457 Sennwald (SG) 1 2 360 Damphreux (JU) 396 Châtillon-Font-Lully (FR) 490
Quelle: BLW 2
■ Gesamtmelioration Ins-Gampelen-Gals

234 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Alter Bestand
Quelle: BLW
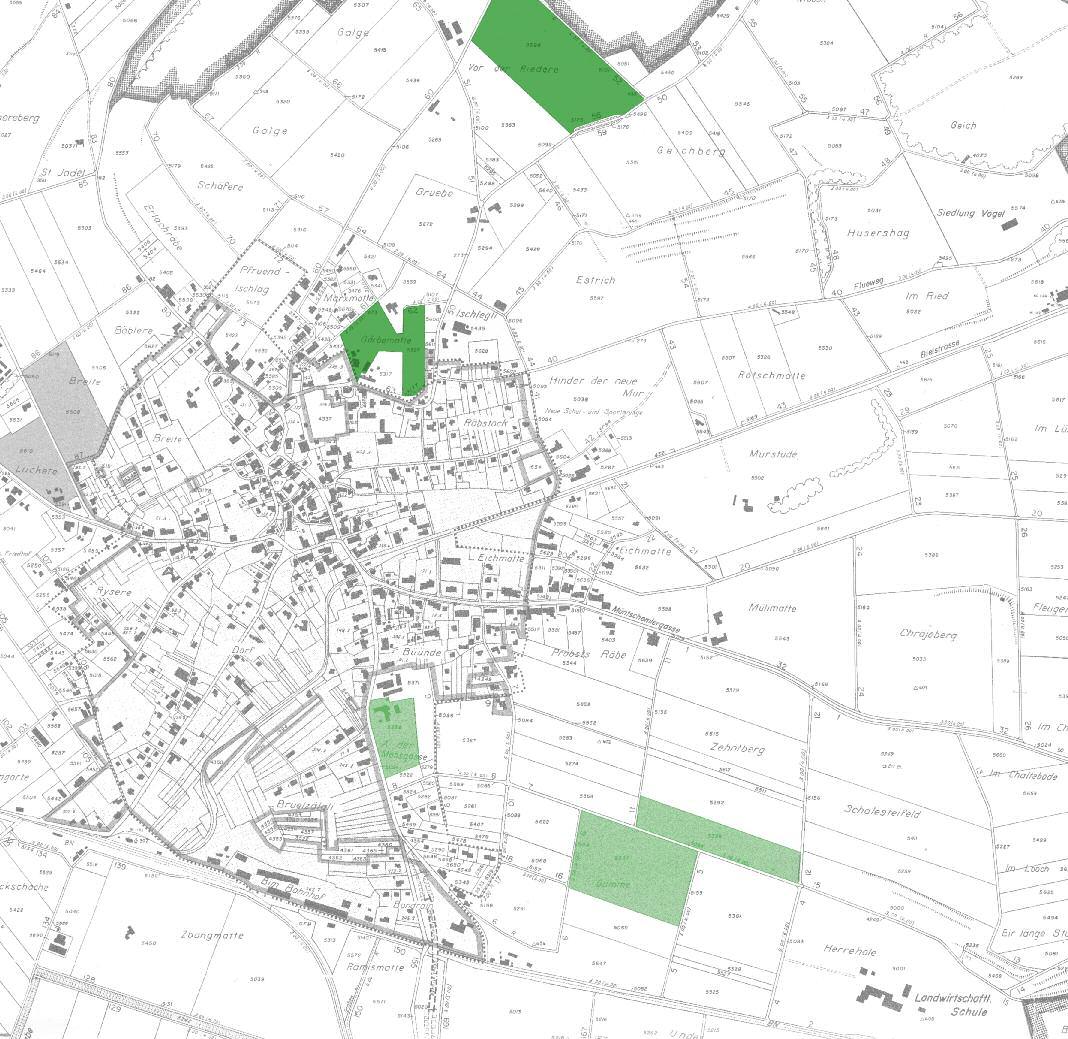
235 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Neuer Bestand
Quelle: BLW
■ 800 Fr. Kostenersparnis auf Land im Eigentum
Die Kostenersparnis beträgt im Durchschnitt aller in der Untersuchung einbezogenen Gesamtmeliorationen 800 Fr pro ha und Jahr Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gebieten sind beträchtlich Hauptgrund dafür ist der unterschiedliche Grad der Parzellierung vor der Güterzusammenlegung. Dies zeigt sich deutlich beim Projekt Wallenschwil, wo die Parzellierung nicht sehr ausgeprägt war
auf Land im Eigentum
pro Betrieb
3 Charakteristisch für die Gesamtmelioration Wallenschwil sind die teilweise grossen Mehrflächen der Betriebe im neuen Zustand, weshalb die Kostenersparnis pro Betrieb wegen der Zunahme des Betriebsaufwandes negativ wird Umgerechnet auf die Flächeneinheit resultieren durch die Verbesserung von Arrondierung und Wegnetz aber positive Werte
4 Bei den «gewichteten Mittelwerten» wurden sämtliche 81 Betriebe der Untersuchung der Eigenlandparzellen miteinbezogen
Quelle: BLW
Die Kosteneinsparungen durch die Feldform (Arrondierung) machen im Durchschnitt rund drei Mal so viel aus wie die Kosteneinsparungen durch die Feldentfernung (Wegnetz) Das heisst, die Wendekosten an den Feldenden und auf den Anhäuptern, die Kosten der Doppelbearbeitung auf den Anhäuptern sowie die Kosten der Mindererträge am Feldrand und auf den Anhäuptern fallen stärker ins Gewicht als die Fuhrkosten zwischen Betriebszentrum und Parzellenschwerpunkt
Bei einer Gesamtmelioration entstehen weitere private Nutzen, die in dieser Arbeit mittels der Grundlage der Wegleitung des SBV nicht quantifiziert werden konnten So werden z B durch bessere Fahrbahnoberflächen des neuen Wegnetzes die Maschinen weniger abgenützt, die Befahrbarkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen verbessert und der Unterhalt der Strassen erleichtert, was ebenfalls zur Reduktion der anfallenden Kosten beiträgt Ebenfalls nicht berücksichtigt wurde die Verbesserung des Boden-Wasser-Haushaltes Drainagen ermöglichen in den Gunstlagen eine ausgeglichene Bewirtschaftung der Felder. Die Kostenersparnis kann dadurch je nach Gebiet erheblich sein
236 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Kostenersparnis
Gesamt-
Fläche melioration Fr Fr /ha Weg- Parzellen- Total Weg- Parzellen- Total kosten formkosten kosten formkosten Gals 2 380 6 593 8 972 265 799 1 064 ChâtillonFont-Lully 2 509 10 594 13 102 178 720 898 Otelfingen 1 277 5 543 6 819 157 715 872 Damphreux 6 123 11 173 17 296 293 518 811 Ermensee 1 684 3 713 5 396 215 396 611 Sennwald 2 032 2 950 4 981 211 265 476 Wallenschwil 3 3 -34 -31 11 133 144 Mittelwert 4 2 171 5 913 8 085 203 574 778
Kostenersparnis
Kostenersparnis pro
■ Kostenersparnis bei Pachtland nur halb so hoch
Die Untersuchung bei den Pachtlandparzellen ergab eine rund halb so grosse Kostenersparnis wie bei den Eigenlandparzellen
Als Gründe für den geringeren Nutzen werden angegeben:
– Pachtlandparzellen weisen häufig eine schlechtere Form und eine inhomogenere Bodeneignung auf;
Pachtlandparzellen sind häufig weniger gut erschlossen und vom Bewirtschaftungszentrum weiter entfernt;
– Die bei einer Betriebsaufgabe frei werdenden Flächen werden zufällig an die übrigen Landwirte verpachtet
Betriebshilfe
Die Betriebshilfe ist eine soziale Begleitmassnahme und dient dazu, eine vorübergehende, unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen Entschuldung
■ Verteilung der Mittel
Im Jahr 2000 wurden in 316 Fällen insgesamt rund 31 Mio. Fr. Betriebshilfedarlehen gewährt Im Vergleich zu 204 im Vorjahr haben die Darlehen um mehr als 50% zugenommen Das Kreditvolumen ist um 13 Mio Fr höher als im Jahre 1999 Das durchschnittliche Darlehen ist von 88‘500 auf 98‘300 Fr. gestiegen und wird in 12,7 Jahren zurückbezahlt
Betriebshilfedarlehen 2000
Der seit 1973 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufnete Fonds de roulement beträgt, zusammen mit den Kantonsanteilen, rund 121 Mio Fr Im Jahr 2000 wurde den Kantonen 7,75 Mio Fr neu zur Verfügung gestellt Diese sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden, die bis Ende 2000 je nach Finanzkraft 40–100% des Bundesanteils betrug. Ab 2001 wurde die Leistung der Kantone auf 20–80% der Bundesleistung herabgesetzt Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Darlehen eingesetzt.
237 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
–
Bestimmung Fälle Betrag Anzahl Mio Fr Umfinanzierung bestehender Schulden 280 28,9 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung 36 2,2 Total 316 31,1
Quelle: BLW
2
Tabelle 43, Seite A51
■ Bildung von vier Kompetenzzentren
2.3.2 Forschung, Beratung, Berufsbildung, Gestüt
Landwirtschaftliche Forschung

Seit Anfang des Jahres 2000 setzen die sechs landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und das Gestüt das Konzept «Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget» (FLAG) um Mit FLAG wird die Weiterentwicklung der Forschung vorangetrieben und ein auf moderner und rationeller Unternehmensführung basierendes Management gefördert Aus den Erfahrungen des ersten Jahres lassen sich bereits nützliche Schlüsse für das weitere Vorgehen ziehen Gesamthaft kann die Umstellung auf FLAG als Erfolg gewertet werden. Die Reaktionen zeigen, dass das neue Führungsinstrument noch einer Anpassungszeit bedarf, bis sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurecht finden und mit dem System vertraut sind
Die Struktur der landwirtschaftlichen Forschung kann mit einer Holding verglichen werden, deren Mutterhaus das BLW ist Dieses arbeitet die langfristigen Strategien aus Die mit FLAG geführten Forschungsanstalten sind operationell handelnde Unternehmen, die im Rahmen ihres Leistungsauftrages über einen recht grossen Spielraum verfügen Die sechs Forschungsanstalten sind ihrerseits in vier Kompetenzzentren zusammengeschlossen
Fachbereiche der Kompetenzzentren
Ackerbau, Grünland und Agrarökologie
Kompetenzzentren
Obstbau, Weinbau und Gartenbau
Tierische
roduktion und
ebensmittel tierischer Herkunft
Agrarwirtschaft und Landtechnik
FAL
RAC
FAW
RAP
FAM
FAT
Umweltressourcen und landwirtschaftlicher Umweltschutz
Natur und
Landschaft
Ökologische Landbausysteme Öko-Controlling
Ackerbau; Weidesysteme
Ackerpflanzenzüchtung; transgene Acker-
pflanzen
Rebbau und Önologie Beeren; Medizinalpflanzen; Gewächshauskulturen
Obstbau, Gemüsebau
Lagerung und
Verwertung von
Obst und Gemüse
Prüfung der
Pflanzenschutzmittel und
phytosanitarische Massnahmen
Milch- und Fleischproduktion
Futtermittelkontrolle
Milch und Käse
Molkereiprodukte
Dienstleistungen
Agrarwirtschaft Landtechnik
Quelle: BLW
238 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
L
P
■ Ziele zu 86% erreicht
Die Forschungsleistung wird anhand konkreter Indikatoren und Zielvereinbarungen beurteilt Die Zielvorgaben wurden zu rund 86% erreicht Der Mangel an Fachpersonal in bestimmten Bereichen sowie die noch laufenden Umstrukturierungsmassnahmen führten bei einigen Projekten zu Verzögerungen.
■ 10% weniger finanzielle Mittel
Die Sparvorgaben für die landwirtschaftliche Forschung betragen für den Zeitraum von 1999 bis Ende 2001 8,3 Mio Fr , was rund 10% der eingesetzten Mittel entspricht
Gesamthaft räumt FLAG den Forschungsanstalten eine grössere Freiheit und eine erhöhte Flexibilität auf operationeller Ebene ein Ein erweiterter Handlungsspielraum bedingt jedoch ein strikteres Berichtswesen. Dank der Berichte ist die Information über die Tätigkeiten in den Forschungsanstalten viel breiter als früher
Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung
Für die Beratung sind die Kantone zuständig Der Bund unterstützt sie, indem er auf drei Ebenen Finanzhilfe gewährt: den kantonalen landwirtschaftlichen und bäuerlichhauswirtschaftlichen Beratungsdiensten, den Spezial-Beratungsdiensten landwirtschaftlicher Organisationen, die gesamtschweizerisch aktiv sind und den Beratungszentralen der Schweizerischen Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft.
Ausgaben für die Beratung 2000
■ Erste Erfahrungen mit dem Erfassen von Beratungsleistungen
Seit Beginn 2000 erfassen und melden die Kantone ihre Beratungsleistungen, für die sie ein Anrecht auf Finanzhilfe des Bundes haben, nach neuen Richtlinien des BLW Die Erfahrungen sind positiv.
Im ersten Jahr gab es zwar einige Anlaufschwierigkeiten zu überwinden: die Zuteilung der Beratungsleistungen in die richtigen Tätigkeitsbereiche ist nicht immer einfach, das Erfassen bedeutet einen administrativen Mehraufwand Mit zunehmender Erfahrung dürften diese Schwierigkeiten geringer werden
239 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
Empfänger Betrag Mio Fr Landwirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone 8,6 Bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone 0,8 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen 0,9 Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft 8,4 Total 18,7 Quelle: Staatsrechnung
2
Die Leitung des kantonalen Beratungsdienstes erhält mit diesem System ein Führungsinstrument, das einen genaueren Einblick in die internen Abläufe ihres Dienstes erlaubt, wie z B die Erfassung des Aufwands pro Leistungskategorie oder Tätigkeitsbereich. Weitere Entwicklungsschritte wie die abgestufte Tarifgestaltung je nach Art der Leistung oder das statistische Erfassen der Weiterbildungsveranstaltungen oder Beratungsfälle werden erleichtert
Das BLW verfügt damit zum ersten Mal über quantifizierte Angaben über die Beratungsleistungen, ganz im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen jeweils nur die Stellenprozente bekannt waren Die Übergangsfrist ist so bemessen, dass den Kantonen genügend Zeit für Erfahrungen und Anpassungen bleibt Aus diesem Grund berechnet das BLW während der Übergangszeit die Finanzhilfe an die Kantone immer noch nach dem bisher gültigen, aufwandorientierten Berechnungssystem
Die zweite Vertragsperiode des BLW mit der Schweizerischen Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft läuft bis Ende 2001 Der Vertrag für die Periode 2002 bis 2005 wurde mit der Vereinigung neu verhandelt Er wurde im Frühjahr 2001 unterzeichnet Er regelt die Aufgaben der beiden Beratungszentralen in Lindau (LBL) und in Lausanne (SRVA).
Der neue Vertrag bringt Konstanz im Inhalt und Neuerungen in der Form Die Vertragsperiode beträgt wie bis anhin vier Jahre; der fachliche und quantitative Leistungsumfang, der von den Beratungszentralen erwartet wird, bleibt im Wesentlichen unverändert; die Finanzhilfe des Bundes bleibt unverändert auf der Höhe von 8,4 Mio Fr pro Jahr
Neu ist der Abschluss einer Leistungsvereinbarung. Dies bedeutet, dass
strategische und spezifische Ziele formuliert;
– eine klare Produkt-Marktstrategie festgelegt, und
die bisherigen Aufgaben als Produkte umschrieben und mit Indikatoren und Standards versehen werden
Die Beratungszentralen erbringen Leistungen vor allem in den folgenden fünf Produkten:
– Methoden entwickeln, Grundlagen und Daten beschaffen, gezielte Untersuchungen und Studien durchführen;
– Beratungskräfte in den Beruf einführen und weiterbilden;
Dokumente, Hilfsmittel und Software herstellen bzw. entwickeln und vertreiben;
– Beratungsdienste, Branchenorganisationen und Regionen projektmässig unterstützen;
Koordinationsplattformen initiieren, managen oder sich mitengagieren.
240 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
–
–
–
–
■ Neuer Vertrag für die Beratungszentralen
■ Die landwirtschaftliche Berufsbildung wird reformiert
Landwirtschaftliche Berufsbildung
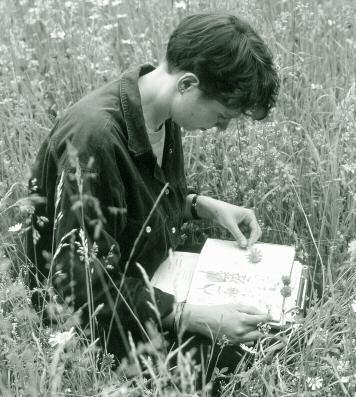
Die landwirtschaftliche Berufsbildung beruht auf dem Landwirtschaftsgesetz und umfasst die Grundausbildung und die Weiterbildung des Landwirts und der Landwirtin sowie von 12 landwirtschaftlichen Spezialberufen Im Zuge der Verwaltungsreformen beim Bund wurde die Koordination der landwirtschaftlichen Berufsbildung vom BLW dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) übertragen
Mit der laufenden Revision des Berufsbildungsgesetzes sollen auch die Rechtsgrundlagen und die Struktur der landwirtschaftlichen Berufsbildung in das allgemeine Berufsbildungssystem integriert werden Der Bundesrat hat letztes Jahr die Botschaft zum neuen Berufsbildungsgesetz verabschiedet, das als Rahmenerlass ausgestaltet ist. Es sieht als wesentliche neue Elemente eine grössere Flexibilität und Durchlässigkeit der Berufsbildung vor Das Grundangebot soll gestrafft und die lebenslange Weiterbildung gefördert werden. Sowohl auf schwache, wie auch auf besonders begabte Lernende soll durch spezielle Angebote und Massnahmen Rücksicht genommen werden Den Berufsverbänden soll bei der Gestaltung der Berufsbildung mehr Spielraum aber auch mehr Verantwortung übertragen werden
Entwicklung landwirtschaftlicher und gewerblich-industrieller
Ein Reformdruck in der landwirtschaftlichen Berufsbildung ergibt sich nicht nur aus Gründen der Verwaltungsrationalisierung, sondern er wird verstärkt durch die Strukturänderungen der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes:
– die starke Abnahme der Lehrlingszahlen stellt die Berufsbildung verschiedener landwirtschaftlicher Spezialberufe in Frage;
– in der landwirtschaftlichen Berufsbildung bestehen Überkapazitäten
241 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Lehrlingszahlen A n z a h l Verträge 1 Lehrjahr
Verträge 1. Lehrjahr Landwirtschaft Quelle: BBT 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
gewerblich-industrielle Berufe (Index)
Die Zahl der landwirtschaftlichen Lehrverhältnisse und der Lehrabschlüsse ist seit Ende der siebziger Jahre im Vergleich zu anderen Berufen überproportional gesunken und hat sich seit einigen Jahren auf einem Niveau von rund 900 Fähigkeitszeugnissen pro Jahr stabilisiert. Diese Entwicklung widerspiegelt vor allem die jeweilige Einschätzung der Zukunftsaussichten in der Landwirtschaft durch die potentiellen Hofnachfolger und ihre Eltern Die Lehrverträge pro 100 Haupterwerbsbetriebe haben von über vier pro Jahr in den siebziger Jahren auf unter zwei in den neunziger Jahren abgenommen Bei einem Generationenwechsel von 25 bis 30 Jahren würde es drei bis vier neue Lehrverhältnisse brauchen, damit bei der heutigen Anzahl alle Haupterwerbsbetriebe von landwirtschaftlich ausgebildeten Betriebsleitern weitergeführt werden könnten
Von der oben geschilderten Entwicklung sind auch die Berufsorganisationen betroffen. So ist der Schweizerische Landwirtschaftliche Verein, der bisher für die Berufsbildung des Landwirts zuständig war, zum Schluss gekommen, dass er unter den oben genannten Umständen seine Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann. Er wird seine Verantwortung für die landwirtschaftliche Berufsbildung an den Schweizerischen Bauernverband (SBV) abtreten Dieser ist daran, eine Bildungsplattform aufzubauen, welche allen interessierten Organisationen zur Verfügung stehen soll Weiter ist der SBV im Rahmen eines Projektes des «Lehrstellenbeschlusses II» durch das BBT beauftragt worden, ein Berufsfeld «grüne Berufe» zu schaffen Die Schaffung von Berufsfeldern entspricht der Botschaft zum neuen Berufsbildungsgesetz Ziele sind die Verbesserung der Durchlässigkeit und der Ausbildungsqualität sowie der effizientere Einsatz der Mittel.
Wie die Landwirtschaft sind auch der Gartenbau und die Forstwirtschaft vorwiegend im ländlichen Raum angesiedelt und gestalten diesen entscheidend mit. Es ist daher naheliegend, dass sich daraus für die Berufsbildung gemeinsame Interessen ergeben Dass die drei Wirtschaftszweige auch in Konkurrenz zueinander stehen, ist für eine Zusammenarbeit in der Berufsbildung kein Nachteil, im Gegenteil Der SBV klärt nun ab, welche Berufe in der Ausbildung des Nachwuchses zusammenarbeiten wollen, und wo in der Ausbildung der verschiedenen Berufe Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Durch Zusammenlegung solcher Ausbildungsteile sollen Doppelspurigkeiten vermieden und Synergien genutzt werden
242 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Berufsfeld «grüne Berufe»
A n z a h l Quellen:
0 1,5 1,0 0,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 1977 1980 1985 2000 1996 1990
Entwicklung neue Lehrverträge je 100 Haupterwerbsbetriebe
BBT, BFS
Als Folge der abnehmenden Schüler- und Teilnehmerzahlen an Kursen bieten heute viele Bildungszentren der Landwirtschaft ein möglichst breites Ausbildungsangebot an Die geringeren Teilnehmerzahlen verteilen sich so auf ein grösseres Ausbildungsangebot. Dadurch verschärft sich die Zersplitterung weiter und die Ausbildungsqualität leidet Mit der Schaffung von Berufsfeldern wird den Ausbildungsinstitutionen auch die Möglichkeit gegeben, ihre Kräfte zu konzentrieren Statt die gesamte Palette des Bildungsangebots bereit zu stellen, kann sich jedes Zentrum auf ein allgemeines Grundangebot und eine passende Spezialisierung konzentrieren Von universalen Anbietern entwickeln sich die Berufsschulen zu Kompetenzzentren
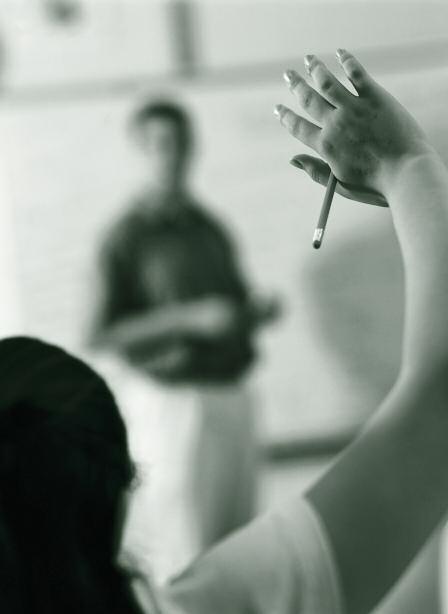
243 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Geschäftsführung des Gestüts
Eidgenössisches Gestüt
Das Gestüt hat die folgenden strategischen Ziele zur Vorgabe: – Förderung einer tiergerechten landwirtschaftlichen Pferdehaltung;

– Erhaltung der Freibergerrasse;
– Optimierung des Wissenstransfers: Information und Dokumentation
Die Führung des Gestüts mit FLAG begünstigte dessen Ausbau zu einem nationalen Kompetenzzentrum für Fragen rund um das Pferd Das Gestüt spielt zudem für die Erhaltung der Freibergerrasse eine tragende Rolle Innovativ zeigt sich das Gestüt mit seinem vielfältigen Leistungsangebot: Publikationen, Kolloquien, Bildung und Beratung werden von der Kundschaft geschätzt Der Kundenkreis weist ein breites Spektrum auf und geht von Produzentinnen und Produzenten über verschiedene nationale und internationale Organisationen bis hin zu Konsumentinnen und Konsumenten
Die Leistungen des Gestüts werden anhand von 43 Indikatoren und Standards beurteilt Diese wurden zu 80% erreicht Der Mangel an Fachpersonal in einigen Bereichen wird teilweise durch eine vermehrte Zusammenarbeit mit externen Kräften wettgemacht
244 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
2.3.3 Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz Saatgut
Im Ackerbau dürfen die Sorten der meisten Arten nur dann eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie zuvor in den vom BLW erstellten Sortenkatalog aufgenommen worden sind Eine Sorte findet Eingang in diesen Katalog, wenn sie gegenüber anderen Sorten beim Anbau oder der Verarbeitung eine Verbesserung bringt Um dies zu kontrollieren, lässt das BLW die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten amtliche Prüfungen durchführen Diese Prüfungen erfolgen im Rahmen eines Versuchsnetzes, welches die unterschiedlichen Produktionsbedingungen in unserem Land repräsentiert Die Resultate werden publiziert
Ziel der Sortenprüfung ist es, den Landwirten Sorten bereit stellen zu können, die den schweizerischen Produktionsbedingungen angepasst sind und sowohl den Erwartungen der Konsumentinnen und Konsumenten als auch den Bedürfnissen der Verarbeitungsindustrie entsprechen
Neben dem Ertrag kommt der Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge spezielle Bedeutung zu Die Sorten werden ohne Behandlung mit Fungiziden oder Insektiziden auf ihre potentielle Resistenz getestet. Um die Standfestigkeit von Getreide zu prüfen, werden keine chemischen Wachstumsregulatoren verwendet
Die Einsatz- und Verarbeitungsmöglichkeiten sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Abklärung, ob eine Sorte den Bedürfnissen des Marktes entspricht Eine Kartoffelsorte wird beispielsweise auf ihre Eignung für die Verarbeitung zu Pommes frites oder Chips getestet Beide Verarbeitungsmethoden erfordern ganz spezielle Merkmale Ein anderes Beispiel ist die Bestimmung der Backqualität einer Getreidesorte Die verschiedenen Getreidesorten weisen grosse Qualitätsunterschiede auf. Das Müllerei- und das Bäckergewerbe benötigen diese Informationen bei der Auswahl der Sorten für die verschiedenen Brotqualitäten
Die Anforderungen für die Aufnahme in den Sortenkatalog sind in der Saat- und Pflanzgut-Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 festgelegt Nach Abschluss der Tests werden die Prüfungsergebnisse von einer beratenden Fachkommission beurteilt, die sich aus Züchtern, Produzenten, Verarbeitern und Verteilern zusammensetzt Die Sorte wird zugelassen, wenn sie die Anforderungen der Verordnung erfüllt.
Die Anzahl der in der Schweiz angebauten Winter- und Sommerweizensorten ist seit 1980 beträchtlich angestiegen. Heute sind über 30 Sorten im schweizerischen Sortenkatalog aufgeführt Ein weiteres interessantes Beispiel ist die Gerste, bei der eine bemerkenswerte Vergrösserung der Sortenauswahl zu beobachten ist Die Landwirte bauen allerdings nicht alle Sorten an
245 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■ Umfangreiche Prüfung von Sorten
Mit dem bilateralen Agrarabkommen wird der Binnenmarkt für die im Sortenkatalog der EU aufgeführten Sorten geöffnet Da im europäischen Katalog Hunderte von Sorten aufgeführt sind, müssen sowohl die Landwirte als auch die Verteiler und die Verarbeitungsindustrie erkennen können, welche Sorten am besten auf unsere Produktionsbedingungen und die Marktbedürfnisse ausgerichtet sind Zu diesem Zweck sind Branchenorganisationen wie Swissgranum, Swisspatat oder die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaus übereingekommen, im Versuchsnetz der Forschungsanstalten Sorten aus dem europäischen Sortenkatalog zu prüfen und entsprechende Listen mit Empfehlungen zu erstellen Das Versuchsnetz dient ausserdem weiterhin dazu, Schweizer Sorten zu prüfen Die Sortenprüfung wird auch in einem liberalisierten Markt ihren Stellenwert beibehalten

Pflanzenschutzmittel
Am 1 August 1999 trat die neue Verordnung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Kraft Die Bewilligungsrunde 2000 wurde zum ersten Mal unter dem neuen Recht durchgeführt In der neuen Pflanzenschutzmittel-Verordnung sind namentlich auch die Anforderungen für die Bewilligung von PSM stärker auf jene der EU ausgerichtet Mit dieser Änderung waren erhebliche Umstellungen sowohl bei den gesuchstellenden Personen wie bei der Zulassungsbehörde verbunden So zeigte etwa die unter dem neuen Recht durchgeführte Vollständigkeits-Kontrolle der eingegangenen Gesuche, dass diese am 15. Januar 2000, dem Stichdatum, nur zu rund 5% den neuen Anforderungen genügten Entsprechend intensiv war deshalb der Dialog zwischen den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern und deren Verbände einerseits und der Zulassungsbehörde andererseits – immer mit dem Ziel, die neuen Anforderungen und Verfahren einzuführen und umzusetzen Der Wandel der Bewilligungspraxis der Zulassungsbehörde unter den neuen internationalen Anforderungen spiegelt sich auch in der notwendigen Bearbeitungszeit für die Vervollständigung und Bearbeitung eines Gesuches wider
246 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
19801990 2001 A n z a h l Weizen Gerste Quelle: BLW 0 40 30 20 10
Entwicklung der Anzahl handelbarer Gersten- und Weizensorten
■ Zukunft der Sortenprüfung
■ Neue Bewilligungspraxis
■
Die ersten Erfahrungen im Jahre 2001 zeigen, dass die zu erwartenden Anfangsschwierigkeiten mit den neuen Regelungen schon recht gut bewältigt worden sind Für die kommenden Jahre wird sich die Zusammenarbeit zwischen gesuchstellenden Personen und Zulassungsbehörde auf dem neuen Niveau einpendeln.
Entwicklung von Gesuchen und Neubewilligungen für PSM
Anmerkung: Nicht mitgezählt sind die Gesuche für erweiterte Anwendungen bereits bewilligter Produkte und Gesuche, die aus Anlass von Änderungen der Geschäftstätigkeit (Fusionen Verkauf von Produkten oder Geschäftszweigen) seitens der Bewilligungsinhaber gestellt wurden
Im Zusammenhang mit der Diskussion um ein Anwendungsverbot von PSM in der Grundwasserschutzzone S2 wurde eine Arbeitsgruppe von Vertretern des BLW und des BUWAL beauftragt, die in der Schweiz bewilligten PSM einer Überprüfung im Hinblick auf eine Grundwassergefährdung zu unterziehen Da sich die Anforderungen an die wissenschaftliche Datenbasis zum Umweltverhalten von PSM wie auch die Beurteilungsmethodik beständig weiterentwickeln, sind solch gezielte Neubeurteilungen sinnvoll Die Beurteilung einer neuen Datenbasis zum Umweltverhalten kann unter Umständen ergeben, dass ein PSM aufgrund seiner Mobilität und Abbaubarkeit in eine Trinkwasserfassung gelangen könnte In diesem Fall verfügt die Bewilligungsbehörde eine entsprechende Wasserschutzauflage, welche die Anwendung in der S2-Zone untersagt. Aufgrund der Pflanzenschutzmittel-Verordnung vom 23. Juni 1999 und der dort aufgeführten Änderung von Anhang 4 3 der Stoffverordnung können solche Auflagen seit Januar 2001 verfügt werden Diejenigen PSM, für welche keine Auflage verfügt wird, dürfen nach wie vor in der S2-Zone verwendet werden.
In den Mitgliedstaaten der EU wird seit einiger Zeit ein Verfahren für die Beurteilung der Grundwassergefährdung erfolgreich eingesetzt Die Anwendung dieses Verfahrens ist im Hinblick auf die internationale Ausrichtung für das BLW verpflichtend Mittels dieser internationalen Beurteilungsmethode und unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Datenbasis wurde für rund 40 prioritäre Wirkstoffe das Umweltverhalten beurteilt Diese wissenschaftlichen Beurteilungen bilden nun die Grundlage für den Entscheid, ob für ein bestimmtes PSM eine Wasserschutzauflage verfügt werden soll oder nicht Die Bereinigung der Liste der Wirkstoffe zwischen den beiden beteiligten Ämtern BLW und BUWAL wird in naher Zukunft abgeschlossen sein
247 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
Jahr Neue Gesuche Neu bewilligte Produkte Anzahl Anzahl 1998 126 110 1999 121 42 2000 100 91
2
Pflanzenschutzmittel in der Grundwasserschutzzone S2
Der Feuerbrand hat im Jahre 2000 in gewissen Regionen der Ost- und Zentralschweiz als Folge ungünstiger Witterungsverhältnisse massive Schäden angerichtet Angesichts der stetigen Verbreitung der Krankheit gibt es kaum Hoffnung auf eine erfolgreiche Eindämmung des Erregers mit den bisherigen Bekämpfungsmassnahmen. Deshalb können neu auch PSM eingesetzt werden Das BLW hat dazu je ein PSM auf Basis saurer Gesteinsmehle («Myco-Sin») und des Bacillus subtilis («Biopro») zugelassen Beide Produkte enthalten keine Antibiotika
Das BLW untersucht zudem eine Bekämpfungsstrategie mit Antibiotika Streptomycin, das sich bis jetzt als einziges Mittel zur Feuerbrandbekämpfung durchgesetzt hat, ist in den USA, Kanada und verschiedenen EU-Ländern, u a Deutschland, zugelassen In Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden soll die Entscheidungsbasis für einen allfälligen Einsatz von Streptomycin weiter vertieft werden, wobei vor allem Fragen der Wirksamkeit und der Sicherheit (Risiko einer Resistenzübertragung) im Vordergrund stehen werden. Die Strategie sieht vor, in Risikozonen kontrollierte, von der FAW wissenschaftlich begleitete Versuche, durchzuführen Zudem wird die Suche nach weiteren wirksamen Bekämpfungsmitteln im Rahmen internationaler Anstrengungen und in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Praxis weitergeführt
Düngemittel
Ausgelöst durch die BSE-Problematik hat das EVD im Sinne der Vorsorge (Verwechslungsgefahr) weitergehende Regelungen für Düngemittel, welche tierische Produkte enthalten, erlassen Seit dem 1 Januar 2001 sind solche Dünger für das Inverkehrbringen bewilligungspflichtig (Verordnung des EVD über Dünger und diesen gleichgestellte Erzeugnisse; Düngerbuch-Verordnung) Darunter fallen Düngemittel, die aus folgenden Bestandteilen bestehen oder solche enthalten:
– Blutmehl und andere Blutprodukte;
Gelatine aus Abfällen von Wiederkäuern;
– Fleischmehl und Fleischknochenmehl;
– Griebenmehl und Griebenkuchen;
Knochenschrot;
– Fett, das aus nicht geniessbaren Teilen von Schlachtabfällen extrahiert wurde;
– Horn- und Klauenmehl
Für die Bewilligung solcher Dünger können beim BLW Gesuche eingereicht werden Die Unbedenklichkeit der verwendeten tierischen Bestandteile ist durch den Gesuchsteller nachzuweisen Fällt die Prüfung der Dossiers durch die zuständigen Bundesämter BVET, BLW und BAG positiv aus, kann das entsprechende Produkt mit einer Einzelbewilligung in Verkehr gebracht werden. Die Beurteilungskriterien, welche in Richtlinien des BLW festgelegt sind, umfassen die Bezeichnung der Risikokategorie des Herkunftslandes, eine lückenlose Herkunftsdeklaration sowie Qualitätskriterien bezüglich der Gewinnung und Behandlung des Materials Seit dem 1 Januar 2001 wurden nur für Produkte aus Horn- und Klauenmehl Bewilligungen erteilt
248 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
–
–
■ Pflanzenschutzmittel und Feuerbrand
■ Feuerbrand: Entwicklung der Situation im Jahr 2000
Pflanzenschutz

Der Feuerbrand ist die für Kernobstgehölze und einige verwandte Zierpflanzen gefährlichste der bekannten Bakterienkrankheiten. Verursacht wird die Krankheit durch das Bakterium Erwinia amylovora, dessen erste Spuren in die Vereinigten Staaten des 19 Jahrhunderts zurückgehen In Europa wurde die Krankheit erstmals Ende der fünfziger Jahre in England festgestellt Der erste Herd auf dem Festland wurde einige Jahre später in Dänemark entdeckt Die Krankheit breitete sich darauf schnell in andere Länder aus und erreichte unter anderem die Niederlande, Deutschland, Belgien und Frankreich Zu Beginn der achtziger Jahre bedrohte der Feuerbrand die Obstanlagen in Baden-Württemberg In der Schweiz trat die Krankheit erstmals im Jahr 1989 im Norden des Kantons Zürich, in der Nähe der deutschen Grenze, auf.
Der Feuerbrand hat in der Schweiz noch nie so grosse Herde entstehen lassen wie im Jahr 2000. Besonders gravierend war die Situation im Kanton Thurgau, dem grössten Obstbaukanton des Landes, wo auf einem Gebiet von rund 100 km2 nicht weniger als 200 ha Obstanlagen und 4'000 Hochstammobstbäume von Befall betroffen waren Die Heftigkeit, mit der die Krankheit in dieser Region im vergangenen Jahr auftrat, ist auf die zum Zeitpunkt der Obstbaumblüte herrschenden Wetterbedingungen zurückzuführen, die für die Ausbreitung und Freisetzung des Bakteriums Erwinia amylovora äusserst günstig waren Die Wirtspflanzen sind während der Blütezeit am anfälligsten für eine Infizierung
249 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2
Der Verlauf des Feuerbrandes im Jahr 2000 zeigt, dass der Krankheitserreger grosse Flächen in kürzester Zeit befallen kann Erstmals sind Feuerbrandherde auch in mehreren Kantonen der Westschweiz und im Tessin aufgetreten In diesen Gebieten handelt es sich bis jetzt jedoch nur um Einzelherde, in welchen vor allem die Zierpflanzenart Cotoneaster salicifolius befallen war






2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 250
Ausbreitung des Feuerbrandes in der Schweiz von 1995 bis 2000 1995 1996 1997 1998 1999 Gemeinden mit Herden 2000 Quelle: FAW
Der Bund erkannte die Bedrohung durch diese Krankheit für den Obst- und Gartenbau frühzeitig und liess umgehend eine Bekämpfungsstrategie ausarbeiten Die Strategie beruht auf einem umfassenden Abwehrkonzept, welches für alle besonders gefährlichen Schadorganismen, die als Quarantäneorganismen gelten, Gültigkeit hat. Das Abwehrkonzept sieht je nach Ausbreitungsgrad des Krankheitserregers unterschiedliche Massnahmen vor:
1 Der Schadorganismus ist im Land noch nicht bekannt; es besteht jedoch Gefahr, den Organismus über die Einfuhr von Wirtspflanzen einzuschleppen
➞ Massnahmen an der Grenze

2. Der Schadorganismus ist nachgewiesen; jedoch begrenzt auf Einzelherde.
➞ Bekämpfungsmassnahmen zur Tilgung des Organismus
3. Der Schadorganismus ist in einigen Gebieten endemisch, andere Regionen sind hingegen noch praktisch verschont geblieben
➞ Massnahmen zur Eindämmung des Organismus
Anfangs der siebziger Jahre wurde die erste Phase der Strategie durch die Importsperre für Feuerbrand-Wirtspflanzen eingeleitet. Diese Massnahme hatte zum Ziel, die Einschleppung des Krankheitserregers über bereits befallene Pflanzen in die Schweiz zu verhindern
Nach der Entdeckung des ersten Befallsherdes im Jahr 1989 eröffneten Tilgungsmassnahmen die zweite Phase Die Tilgungsmassnahmen bestehen in der systematischen Vernichtung befallener und befallsverdächtiger Pflanzen, auch wenn letztere keine Symptome aufweisen Seit 1997 wird die Tilgung von Einzelherden durch die vorsorgliche Rodung besonders anfälliger Wirtspflanzen ergänzt.
Da in einigen Regionen zunehmend dauernde Herde beobachtet wurden, begann 1999 die dritte Phase des Abwehrkonzeptes. In den als Befallszonen erklärten Gebieten wird die Eindämmung des Feuerbrandes über eine grösstmögliche Reduktion des Infektionspotenzials angestrebt, wobei die Sanierungsmassnahmen an den erkrankten Pflanzen möglichst massvoll angewendet werden Dementsprechend wird der Rückschnitt bzw die Entfernung befallener Zweige dem Fällen des gesamten Baumes vorgezogen
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 251
■ Bekämpfungsstrategie 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Finanzielle Unterstützung
Die Kosten für die Bekämpfung des Feuerbrandes enthalten einerseits die durch die Sanierung verursachten Ausgaben und gegebenenfalls Entschädigungen der Eigentümer, die für die angeordnete Vernichtung von Pflanzen gewährt werden Die seit 1989 ausbezahlten Beträge wurden durchschnittlich zu zwei Drittel vom Bund und einem Drittel von den Kantonen übernommen
Kosten für die Bekämpfung des Feuerbrandes
■ Ausblick
Angesichts des Ausmasses der durch den Feuerbrand verursachten Schäden im Jahr 2000 hat das EVD erweiterte Entschädigungsmöglichkeiten beschlossen. Die neu erlassenen Bestimmungen sehen die Gewährung von Entschädigungen durch die Kantone vor, wenn die Vernichtung gewerbsmässig produzierte und angebaute Pflanzen betrifft und der daraus entstandene Schaden mindestens 1‘500 Fr beträgt Die Beteiligung des Bundes an den Entschädigungen bewegt sich je nach Fall zwischen 50 und 75%. Das EVD will auf diese Weise die finanziellen Auswirkungen für Obstproduzenten, deren Bäume aus Gründen des Pflanzenschutzes zerstört werden mussten, mildern
Die Ausbreitung des Feuerbrandes in den letzten 40 Jahren in Europa lässt nur wenig Hoffnung zu, dass die Krankheit in den nächsten Jahren in der Schweiz zurückgehen wird Dank der gemeinsam von Bund und Kantonen eingesetzten Massnahmen der ersten beiden Etappen des Bekämpfungsplanes konnten zunächst die Einschleppung und später die Verbreitung der Krankheit in der Schweiz um mindestens zehn Jahre hinausgezögert werden Das bisherige Abwehrkonzept kommt daher weiterhin zum Einsatz, um insbesondere die bisher noch verschonten Regionen und Gebiete mit Einzelherden zu schützen Zur Verstärkung der bestehenden Massnahmen bewilligte das BLW ab Frühjahr 2001 den Einsatz von zwei Produkten im Rahmen der Bekämpfung des Feuerbrandes: Das erste Produkt besteht aus einem antagonistisch wirksamen Bakterium (Bacillus subtilis), das zweite enthält Gesteinsmehl Beide Produkte erfüllen die Anforderungskriterien des biologischen Landbaus
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 252
M i o F r Quelle: BLW * Schätzungen,
aus 0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 8990 91 92 93 94 95 96 97 9899 2000*
die Schlussabrechnungen der Kantone stehen noch
■ Nationaler Aktionsplan für pflanzengenetische Ressourcen
In einer wachsenden Anzahl von Gebieten erscheint die Tilgung des Feuerbranderregers als nicht mehr aussichtsreich Die zu entwickelnden Eindämmungsmassnahmen stellen für den Obstbau und die Forschung eine neue Herausforderung dar Das Forschungsprogramm wird sich deshalb auf folgende Schwerpunkte konzentrieren:
– Intensivierung der epidemiologischen Studien über den Feuerbrand unter schweizerischen Verhältnissen;
– Ausbau der Prognose- und Warndienste;
– Vertiefung der biologischen Wirksamkeitsprüfung
Pflanzengenetische Ressourcen
Die Ausrichtung des Nationalen Aktionsplanes der Schweiz zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen in Ernährung und Landwirtschaft richtet sich nach den Vorgaben des globalen Aktionsplanes der FAO von 1996 Der Nationale Aktionsplan der Schweiz ergänzt als neue Massnahme die bereits bestehenden agrarpolitischen Massnahmen und Anstrengungen im Bereich der Arten- und Ökosystemvielfalt
Die Einführungsphase dauert von 1999 bis 2002 Die folgenden Aufgaben wurden dabei als vordringlich erachtet:
Inventare der verschiedenen Kulturpflanzen zeigen auf, welche Sorten in welcher Anzahl in der Schweiz vorkommen Sie sind aber auch eine Voraussetzung, um den Gefährdungsgrad zu beurteilen und abzuklären, ob spezielle Erhaltungs- und Nutzungsprogramme notwendig sind
Erhaltungsprogramme für Obstarten, die als fremdbefruchtende Arten nicht mittels Samen erhalten werden können Es ist notwendig, die einzelnen Bäume in sogenannten «Erhaltungs-Obstgärten» anzupflanzen und zu pflegen. Das Erhaltungskonzept sieht vor, nationale und regionale Obstgärten anzulegen, die von interessierten Organisationen oder den Kantonen betreut werden

2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 253
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Stand der Umsetzung
Erhaltungs- und Nutzungsprogramme vor Ort (im Feld) sind ein Kernstück des nationalen Aktionsplanes, um die langfristige Nutzung unternutzter Landsorten vor Ort sicherzustellen Deshalb wird versucht, das Wissen der ländlichen Bevölkerung über Anbau, Verwertung und Eigenschaften der Landsorten vor Ort zu erhalten und zu nutzen Ein Beispiel ist das Projekt «Ribelmais» im Rheintal, ein anderes dasjenige im Kanton Graubünden, bei dem alte Bündner Getreidesorten wieder in Kultur genommen werden
Regenerationsprogramme für Pflanzenarten, deren Saatgut für die langfristige Erhaltung in sogenannten Genbanken eingelagert ist Die Pflanzenarten in Genbanken bilden die langfristige Basis für die Züchtung Das eingelagerte Saatgut muss zur Erhaltung der Vitalität in gewissen Zeitabständen erneuert werden.
Sorten, Populationen und Linien in Genbanken der RAC und der FAL
Die Massnahmen des Nationalen Aktionsplanes werden in Projekten umgesetzt Interessierte Organisationen können dazu entsprechende Vorschläge einreichen Die Rechtsgrundlage für die finanzielle Unterstützung bildet Artikel 140 LwG. Das BLW hat die Gesamtleitung und die Oberaufsicht
Die RAC ist für die wissenschaftlichen Aspekte des Nationalen Aktionsplanes verantwortlich, und leitet insbesondere die Arbeiten betreffend die Genbanken Sie sichert zudem die Koordination im Forschungsbereich insbesondere mit der ETH
Die breit abgestützte Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen begleitet die Arbeiten als beratendes Organ. Sie koordiniert die vielfältigen Arbeiten (Landwirtschaftliche Forschung, Universitäten, Saatgutproduzenten, Biobauern, spezifische Züchter etc ) und erstellt jedes zweite Jahr einen Bericht zuhanden des BLW über die Situation im Bereich der pflanzengenetischen Ressourcen in Ernährung und Landwirtschaft
1999 und 2000 wurden 47 Projekteingaben eingereicht 21 davon wurden akzeptiert und Verträge mit einer Laufzeit bis maximal Ende 2002 abgeschlossen Die Ausgaben betrugen 1999 0,88 Mio. Fr. und 1,357 Mio. Fr. im Jahr 2000. Das finanzielle Engagement des Bundes hatte zur Folge, dass geeignete Zusammenarbeitsstrukturen mit privaten Organisationen aufgebaut, sowie die Rollen und Aufgaben der Akteure klar definiert werden mussten.

2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 254
A n z a h l Quelle: Schweizerische Komission für die Erhaltung von Kulturpflanzen 0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 W e i z e n D i n k e l G e r s t e T r i t i c a l e S o j a G e m ü s e M a i s F u t t e rp f l a n z e n R o g g e n K a r t o f f e l n Ü b r i g e 4 3222 244 796784 608 398 381119 62 52 582
■ Züchter und Organisationen nutzen Spielraum
Wie in anderen Bereichen der Landwirtschaft hat sich die Liberalisierung positiv auf die Entwicklung der Tierzucht ausgewirkt Die Züchter und ihre Organisationen haben den Spielraum genutzt und die ihnen neu übertragene Verantwortung wahrgenommen
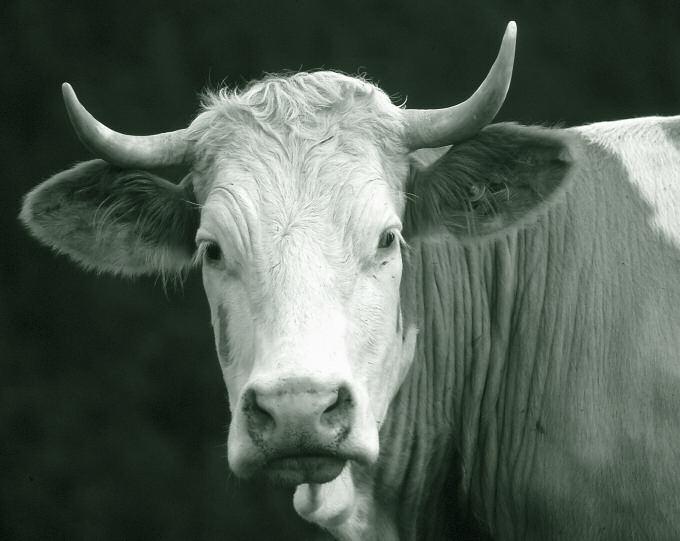
Von Staates wegen wird der Züchter in seinem Handeln kaum mehr eingeschränkt Der Bund und die Kantone unterstützen die züchterischen Tätigkeiten über Beiträge an die Tierzuchtorganisationen Für die züchterischen Dienstleistungen wie die Herdebuchführung, die Durchführung der Leistungsprüfungen, die Auswertung der züchterischen Daten, einschliesslich der Zuchtwertschätzung, sowie für Erhaltungsprogramme für gefährdete Schweizer Rassen wenden Bund und Kantone zusammen jährlich rund 40 Mio Fr auf Jede dieser Massnahmen leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung einer eigenständigen inländischen Tierzucht.
Der Bund hat bisher 31 Zuchtorganisationen für Rinder, Pferde, Schweine, Schafe und Ziegen anerkannt Damit die von den Züchtern verlangten Dienstleistungen möglichst kostengünstig und flexibel angeboten werden können, wurden die Verbandsstrukturen bei den meisten Zuchtorganisationen neu organisiert und gestrafft. Die Schweizerische Zentralstelle für Kleinviehzucht, bisher verantwortlich für die Herdebuchführung beim Kleinvieh und der Verband für Mast- und Schlachtleistungsprüfungen, bisher verantwortlich für die Durchführung der Leistungsprüfungen beim Schwein, wurden auf den 31 Dezember 1999 bzw auf den 31 Dezember 2000 aufgelöst Die zuständigen Kleinviehzuchtorganisationen haben die Tätigkeiten dieser Stellen übernommen Strukturanpassungen waren auch bei den Rinder- und Pferdezuchtorganisationen unumgänglich, um die züchterischen Herausforderungen im neuen agrarpolitischen Umfeld zu meistern.
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 255 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2.3.4 Tierzucht
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■
Einfuhr von Zuchttieren und Rindersperma
Der Bund ist zuständig für die Bewirtschaftung der Zollkontingente sowie für die Einfuhr von Zuchttieren und Samen von Stieren Für die Zuteilung der Zollkontingentsanteile gilt grundsätzlich das Windhundverfahren Beim Rindvieh überstieg die Nachfrage nach ausländischen Rassen das zur Verfügung stehende Zollkontingent in solchem Masse, dass eine Zuteilung nach dem Windhundverfahren administrativ nicht mehr zu bewältigen war Deshalb werden die Zollkontingentsanteile für Rinder ab dem 1 Januar 2001 analog zu den Sportpferden versteigert Die jährliche Zollkontingentsmenge ist auf 1‘200 Zuchttiere festgesetzt 70% des Zollkontingents werden vor Beginn und 30% im ersten Halbjahr der Kontingentsperiode versteigert Die Versteigerung gewährleistet eine wettbewerbsgerechte Verteilung der Zollkontingentsanteile Aufgrund der unsicheren Entwicklung der Lage bei der Maul- und Klauenseuche und der BSE-Problematik wurde auf die Ausschreibung der Zollkontingentsanteile für das Jahr 2001 verzichtet
Einfuhren innerhalb des Zollkontingentes 2000
■ Tiergenetische Ressourcen
Mit der Unterstützung von Projekten zur Erhaltung und Förderung gefährdeter einheimischer Nutztierrassen leisten Bund und Kantone einen wichtigen Beitrag zu Gunsten der landwirtschaftlichen Biodiversität. Mit dieser Massnahme wird gleichzeitig ein globaler Auftrag zur Erhaltung der tiergenetischen Ressourcen erfüllt In der Schweiz gelten rund 30 Nutztierrassen als ursprünglich oder angestammt Jede dieser Rasse weist neben besonderen genetischen Eigenschaften auch einen besonderen ökologischen, wirtschaftlichen oder kulturell-historischen Stellenwert auf Für die Erhaltung und Förderung der Rassen sind in erster Linie die anerkannten Zuchtorganisationen verantwortlich Sie definieren und erarbeiten Erhaltungs- und Förderungsprogramme für gefährdete Populationen und reichen dem BLW entsprechende, zeitlich begrenzte Projekte zur Bewilligung ein Eine solche wird erteilt, nachdem ein eingereichtes Projekt durch eine externe Expertengruppe geprüft und als positiv beurteilt worden ist Gegenwärtig werden für sämtliche Schweizerrassen der Gattungen Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde, die gemäss internationalen Kriterien als gefährdet gelten, Erhaltungsprogramme durchgeführt und mit öffentlichen Beiträgen unterstützt Es handelt sich dabei um das Evolèner Rind, das Engadinerschaf, das Bündner Oberländerschaf, das Spiegelschaf, das Walliser Landschaf, die Stiefelgeiss, die Appenzellerziege, die Bündner Strahlenziege und die Pfauenziege Weiter sind Präventivmassnahmen für das Freiberger Pferd, das Original Braunvieh und die Walliser Schwarzhalsziege bewilligt worden Diese Rassen sind zur Zeit nicht gefährdet, verzeichnen jedoch seit einigen Jahren eine kontinuierliche Abnahme der Populationen. Mit rechtzeitig ergriffenen Massnahmen soll verhindert werden, dass diese Rassen in den Gefährdungsstatus abgleiten
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 256
Marktordnung Einfuhr Zollkontingent Anzahl Anzahl Zuchtpferde Tiere 81 200 Rinder Tiere 2 604 2 500 Schafe/Ziegen Tiere 254 600 Rindersperma Dosen 639 897 800 000 Quelle: zolltarifarischer Bericht des Bundesrates
2.4. Weiterentwicklung der Agrarpolitik
Die Landwirtschaft wird auch in Zukunft aus innen- und aussenpolitischen Gründen mit einem hohen Rhythmus an Veränderungen konfrontiert bleiben Die Reformen können deshalb mit der Agrarpolitik 2002 (AP 2002) nicht abgeschlossen sein Damit die erforderlichen Anpassungen für die Betroffenen verkraftbar bleiben, müssen sie in kontinuierlichen und überschaubaren Schritten erfolgen Deshalb wurden die nötigen Vorarbeiten für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik bereits in der Phase der Konsolidierung der AP 2002 geleistet Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, um rechtzeitig und offensiv agieren zu können anstatt später unter Druck und Zeitnot reagieren zu müssen.
Die anstehende Weiterentwicklung der Agrarpolitik wird mit dem Begriff «Agrarpolitik 2007» (AP 2007) umschrieben Die Zahl 2007 entspricht dem letzten Jahr der nächsten vierjährigen Zahlungsrahmen 2004–2007 und signalisiert den Abschluss der Umsetzung der vorgesehenen Teilrevision des LwG Die diesbezüglichen Vorschläge basieren auf Vorarbeiten der Beratenden Kommission Landwirtschaft, dreier Arbeitsgruppen und Erkenntnissen aus internen und externen Evaluationen. Der Auftrag zur Überprüfung des agrarpolitischen Instrumentariums leitet sich unter anderem aus Artikel 187 LwG und verschiedenen parlamentarischen Vorstössen ab

■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 4 W E I T E R E N T W I C K L U N G D E R A G R A R P O L I T I K 2 257
■ Agrarpolitik 2007
■ Lancierung der Diskussionen
Strategiepapier «Horizont 2010»
Den Auftakt für die Diskussionen um die Weiterentwicklung der Agrarpolitik gab das BLW am 4. Juli 2000 mit der Veröffentlichung des Strategiepapiers «Horizont 2010» (online unter www blw admin ch, Thema «Agrarpolitik 2007») In diesem Papier zeigte das BLW seine Überlegungen und Vorschläge auf, in welche Richtung die Agrarpolitik im Zeitraum der nächsten zwei Zahlungsrahmen-Perioden (2004/7 und 2008/11) weiterentwickelt werden soll
Im Strategiepapier kommt das BLW zum Schluss, dass einer weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zentrale Bedeutung zukommt. Für die Umsetzung dieser Stossrichtung wird eine Optimierung aller agrarpolitischen Massnahmenbereiche mit einem Schwerpunkt bei den Marktordnungen vorgeschlagen Die resultierenden Effizienzgewinne bei der Marktstützung sollen für die Finanzierung zeitlich befristeter sozialer Begleitmassnahmen verwendet werden, um eine allfällige Beschleunigung des Strukturwandels abfedern zu können Diese Strategie fördert die Wettbewerbsfähigkeit aller Marktstufen direkt über Marktsignale Die Strukturen werden damit vorwiegend durch den Markterfolg und weniger durch staatliche Eingriffe beeinflusst
Die Reaktionen auf die Publikation des Strategiepapiers reichten von Rückweisung bis volle Zustimmung Auch wenn teilweise harsche Kritik laut wurde, kann aus heutiger Sicht festgestellt werden, dass das Dokument eine zweckmässige Grundlage für die Lancierung der Debatte um die Weiterentwicklung der Agrarpolitik bildete
Beratende Kommission Landwirtschaft
Basierend auf Artikel 186 LwG wurden mit Bundesratsbeschluss vom 31 Mai 2000 die Beratende Kommission Landwirtschaft eingesetzt und 14 Mitglieder gewählt Die Kommission wird von Staatsrat Dr. Urs Schwaller, Finanzdirektor des Kantons Freiburg, präsidiert Der Auftrag der Kommission besteht darin, den Bundesrat in der Anwendung und Weiterentwicklung des LwG zu beraten Die Beratende Kommission Landwirtschaft hat sich mit strategischen Fragestellungen rund um die Weiterentwicklung der Agrarpolitik befasst und in diesem Zusammenhang Empfehlungen verabschiedet Als Bilanz zu den bisherigen Reformschritten wies die Kommission darauf hin, dass mit der neuen Agrarpolitik (AP 2002) grosse Fortschritte im Bereich der Ökologie und auf den Märkten erzielt worden seien, und sie stellte fest, dass sich die Landwirtschaft auf dem Pfad der Nachhaltigkeit befinde.
■ Strategische Empfehlungen
Auch in Zukunft würden sich der Landwirtschaft jedoch zahlreiche Herausforderungen stellen Unter anderem gelte es, Marktanteile bei offeneren Grenzen zu halten und die multifunktionalen Leistungen der Landwirtschaft auch inskünftig sicher zu stellen In Anbetracht der anstehenden Herausforderungen hat sich die Kommission deshalb für eine konsequente Weiterentwicklung der Agrarpolitik auf dem eingeschlagenen Weg ausgesprochen. Als strategische Eckpunkte hat die Kommission folgende Elemente festgehalten:
2 . 4 W E I T E R E N T W I C K L U N G D E R A G R A R P O L I T I K 2 258
■ Beurteilung der Vorschläge der Arbeitsgruppen
– Die bestehende Verfassungsgrundlage (Artikel 104 der Bundesverfassung) sowie die Grundzüge und Ziele der AP 2002 sollen nach wie vor Gültigkeit haben Vor grundlegenden Änderungen sei die heutige Politik zu konsolidieren Für die nächste Etappe 2004–2007 sollen darum blosse Feinabstimmungen der heutigen Instrumente vorgeschlagen werden
Eine weitere Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft muss zentral sein Daher sind alle Partner der Wertschöpfungskette einzubeziehen Vor diesem Hintergrund ist eine Überprüfung und Optimierung sämtlicher agrarpolitischer Massnahmen nötig
Den Bäuerinnen und Bauern sollen im Rahmen der Weiterentwicklung Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt werden Dazu sollen insbesondere die Strukturverbesserungsmassnahmen für dynamische Betriebe verstärkt werden Der Rhythmus der notwendigen Strukturanpassungen und Reformschritte soll in einem für die Betroffenen möglichst erträglichen Tempo erfolgen In diesem Zusammenhang sind Massnahmen zur Senkung der Produktionskosten sowie die Einführung von zeitlich befristeten Begleitmassnahmen nötig
Diese Elemente stellen Anhaltspunkte für die Ableitung einer Strategie dar. Mit der Frage der Finanzierung der agrarpolitischen Massnahmen hat sich die Kommission bisher nicht vertieft befasst
In Koordination mit der Beratenden Kommission Landwirtschaft wurden im Oktober 2000 drei Arbeitsgruppen zu den Themen «Märkte» (Vorsitz: Prof Dr P Rieder, ETHZ), «Direktzahlungen» (Vorsitz: Prof Dr B Lehmann, ETHZ) und «Produktionsfaktoren/ Soziales» (Vorsitz: Prof. Dr. W. Meier, FAT) mit dem Auftrag eingesetzt, Vorschläge zur Optimierung der agrarpolitischen Massnahmen und zur Umsetzung der strategischen Vorgaben auf Stufe der Massnahmen auszuarbeiten Dazu hat die Kommission umfassende Mandate an die Arbeitsgruppen verabschiedet.
Die Beratende Kommission hat die Vorschläge der Arbeitsgruppen für gesetzliche Anpassungen beurteilt und unterstützt insbesondere folgende Vorschläge:
– Arbeitsgruppe «Märkte»: Flexibilisierung des Milchmarktes (Kann-Formulierung beim Zielpreis und bei der Milchkontingentierung); Unterstützung von überbetrieblichen Marktanpassungsprogrammen bei Obst und Gemüse
– Arbeitsgruppe «Direktzahlungen»: Weitgehende Aufhebung der sozial und politisch motivierten Bezugsgrenzen; Möglichkeit für Regionsbeiträge
– Arbeitsgruppe «Produktionsfaktoren/Soziales»: massvolle Erweiterung des Förderungsbereiches bei den Investitionshilfen; strukturelle Begleitmassnahmen (Umschulungs- und Weiterbildungsbeihilfen, Regelung der Liquidationsgewinne, Betriebsaufgabeentschädigung); Aufhebung Pflanzenschutzfonds (Finanzierung über allgemeine Bundesmittel).
2 . 4 W E I T E R E N T W I C K L U N G D E R A G R A R P O L I T I K 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 259
–
–
Arbeitsgruppen
In den drei Arbeitsgruppen sind die interessierten Kreise vertreten Zur Sicherstellung einer gegenseitigen Information besteht ein Koordinationsgremium, das sich aus dem Präsidenten der Kommission, den Vorsitzenden der Arbeitsgruppen und der Geschäftsleitung des BLW zusammensetzt
Projektorganisation Arbeitsgruppen – Beratende Kommission
Arbeitsgruppe «Märkte»
Arbeitsgruppe «Direktzahlungen»
Koordinationsgremium

Beratende Kommission Landwirtschaft
Arbeitsgruppe «Produktionsfaktoren/ Soziales»
Ende März 2001 haben die drei Arbeitsgruppen Berichte vorgelegt (online unter www blw admin ch, Thema «Agrarpolitik 2007») Gemäss den Vorgaben im Mandat wurden darin primär Vorschläge für Anpassungen auf Gesetzesstufe unterbreitet. Die Auslegeordnung der Vorschläge macht deutlich, dass sich die Arbeitsgruppen nicht an einer finanzpolitischen Vorgabe orientierten Alle Arbeitsgruppen kommen aber zum Schluss, dass keine grundsätzliche Neuorientierung der Agrarpolitik erforderlich ist
260 2 . 4 W E I T E R E N T W I C K L U N G D E R A G R A R P O L I T I K 2
■ Vorschläge der Arbeitsgruppe «Märkte»
Ein grosser Teil der in der Arbeitsgruppe «Märkte» aufgeworfenen Probleme lässt sich auf Verordnungsstufe lösen Auf Ebene des LwG schlägt die Arbeitsgruppe folgende Anpassungen vor:
Marktordnungen
– Flexiblere Formulierung beim Zielpreis Milch und bei der Milchkontingentierung;
– Verarbeitungsbeiträge für Körnerleguminosen;
– Unterstützung von Verarbeitungsgemüse;
– Marktanpassungsprogramme bzw Umstellungsbeiträge bei Früchten, Gemüse und im Weinbau;
– Umwandlung der auf Pilot- und Demonstrationsanlagen beschränkten Förderung der nachwachsenden Rohstoffe in eine unbefristete Stützung;
– Delegation der Klassierung im Weinbau an den Bundesrat
Übergreifende Vorschläge
– Möglichkeit für staatlich unterstützte Versicherungslösungen zur Abdeckung der Produktionsrisiken;
Staatliche Bürgschaften für Kredite zur Finanzierung von Vorräten;
– Verpflichtung zur Koordination bei der Verfolgung von Zuwiderhandlungen in den Bereichen Kennzeichnung, Ein-, Durch- und Ausfuhr sowie Deklaration.
■ Vorschläge der Arbeitsgruppe «Direktzahlungen»
Den Zeitpunkt für einen grundsätzlichen Systemwechsel bei den Direktzahlungen erachtet die Mehrheit der Arbeitsgruppe als verfrüht Insgesamt sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit dem gegenwärtigen Direktzahlungssystem recht zufrieden Dennoch schlägt die Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Teilrevision des LwG verschiedene Anpassungen vor, die einer – wenn auch oft nur knappen – Mehrheitsmeinung entsprechen und die weiter zu prüfen seien:
– Einführung von Regionsbeiträgen zur Berücksichtigung besonderer regionaler Anliegen;
– Einführung eines an die Arbeitskraft gebundenen Beitrages;
– Streichung der Mindestgrösse und Grenzwerte (insbesondere Einkommens- und Vermögensgrenze);
– Begriffliche Trennung in Ökobeiträge und Tierwohlbeiträge;
– Abgeltung von erschwerenden Produktionsbedingungen im Sömmerungsgebiet sowie Förderung der besonders naturnahen Bewirtschaftung von Sömmerungsflächen
2 . 4 W E I T E R E N T W I C K L U N G D E R A G R A R P O L I T I K 2 261 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
–
■ Vorschläge der Arbeitsgruppe «Produktionsfaktoren/Soziales»
Die bestehende Landwirtschaftsgesetzgebung kennt wenige spezifische Regelungen im Sozialbereich Entsprechend gross wäre der Handlungsbedarf für gesetzliche Anpassungen, wenn spezifische Sozialmassnahmen eingeführt werden sollen Demgegenüber sind die Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserung und im Bereich der Produktionsmittel im heutigen LwG sehr umfassend geregelt Vor allem bei letzteren stuft die Arbeitsgruppe den Handlungsbedarf auf Gesetzesebene als gering ein Die Arbeitsgruppe schlägt Anpassungen in folgenden Bereichen vor:
Soziales
Verstärkung der Umschuldung über die Betriebshilfe;
– Ausbau der Sozialberatung als Aufgabe der Betriebsberatung;
Einführung von Umschulungs- und Weiterbildungsbeihilfen;
– Einführung einer Betriebsaufgabeentschädigung bzw Vorruhestandsregelung;
– Anpassung der Liquidationsgewinnbesteuerung zwecks Erleichterung der Betriebsaufgabe;
– Förderung der Betriebshelferdienste;
– Vorschlag für eine Ferienprämie
Strukturverbesserungen
– Wechsel des Eintretenskriteriums vom Einkommen zur standardisierten Arbeitskraft als Voraussetzung für einzelbetriebliche Massnahmen;
– Unterstützung des periodischen Unterhalts von Bodenverbesserungen;
Finanzhilfen für den Aufbau bäuerlicher Selbsthilfeorganisationen (z.B. Tätigkeiten im Bereich der rationellen Betriebsführung und der gemeinsamen Vermarktung in der Region erzeugter Produkte);
Massnahmen für technische Einrichtungen im Pflanzenbau und für Pflanzungen zur Anpassung an veränderte Marktbedingungen;
– Regional differenzierte Beurteilung der Wettbewerbsneutralität mit einer entsprechenden Ausweitung der Förderungsmöglichkeiten (Vermarktung, Diversifizierung der Tätigkeiten)
Produktionsmittel
– Streichung der finanziellen Beteiligung der Kantone bei der Tierzucht;
Einführung eines Leistungsauftrags für eine neutrale Taxation der Schafwolle;
– Aufhebung des Pflanzenschutzfonds (Finanzierung über allgemeine Bundesmittel);
– Vorschriften über die Verwendung und Herstellung landwirtschaftlicher Hilfsstoffe
■ Ausblick
Auf Basis der verschiedenen Vorarbeiten hat die Verwaltung einen Vernehmlassungsbericht mit Vorschlägen für gesetzliche Anpassungen erarbeitet Dieser Bericht wurde den interessierten Kreisen am 21 September 2001 zur Stellungnahme unterbreitet Nach Auswertung der Vernehmlassung soll im Frühling 2002 die Botschaft an das Eidgenössische Parlament verabschiedet werden Es ist geplant, gleichzeitig mit den gesetzlichen Revisionsvorschlägen die Botschaft über die Zahlungsrahmen für 2004–2007 zu unterbreiten, damit das Parlament die Massnahmen und die Finanzierung parallel beraten kann (voraussichtlich zwischen Herbst 2002 und Frühling 2003). Die revidierten Gesetzesbestimmungen, die entsprechenden Verordnungsänderungen und die neuen Zahlungsrahmen sollen gemeinsam auf den 1 Januar 2004 in Kraft treten
262 2 . 4 W E I T E R E N T W I C K L U N G D E R A G R A R P O L I T I K 2
–
–
–
–
–

3 263 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 3. Internationale
Aspekte
In den letzten 20 bis 30 Jahren sind supranationale Aspekte wichtiger geworden. Beim Austausch von Gütern schliessen sich immer grössere Gebiete zu Märkten zusammen, in denen die Waren ungehindert von Schranken an nationalen Grenzen frei zirkulieren können. Ein Beispiel dafür ist die zunehmende Integration in Europa mit dem Gemeinsamen Markt Im Umweltbereich wurden internationale Abkommen zur Verminderung der Belastungen von Natur und Umwelt abgeschlossen
Die Schweiz ist stark exportorientiert und daher daran interessiert, einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten zu haben Beim WTO-Abkommen von Marrakesch 1994 wurde erstmals auch die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk über den Handel von Gütern und Dienstleistungen eingebunden Ebenso bildet das Agrarabkommen ein Bestandteil der bilateralen Verträge mit der EU. Die Schweiz setzt sich auf internationaler Ebene stark für eine multifunktionale Landwirtschaft ein
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung Das dritte Kapitel behandelt internationale Themen
– Der erste Teil dieser Ausgabe enthält in einem Schwerpunkt Informationen über internationale Organisationen wie die WTO, die OECD und die FAO. Diese Organisationen setzen sich teilweise oder überwiegend mit landwirtschaftsrelevanten Fragen auseinander Vorgestellt werden ausserdem der Stand im Europadossier und eine Studie der EU-Kommission über Risikomanagementstrategien.
– In einem zweiten Teil geht es um internationale Vergleiche Je mehr sich die Schweizer Landwirtschaft mit der ausländischen Konkurrenz messen muss, desto wichtiger sind Informationen über die Verhältnisse im Ausland Im vorliegenden Bericht werden die im Jahr 2000 begonnenen internationalen Preisvergleiche fortgeführt Die Preisvergleiche werden zusätzlich unter dem Aspekt der Kaufkraftparität dargestellt In einem weiteren Beitrag werden Ergebnisse von Buchhaltungsbetrieben der Schweiz mit jenen der EU verglichen.
3 . I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 264
3.1 Internationale Entwicklungen

Die Berichterstattung über internationale Entwicklungen in dieser Ausgabe des Agrarberichts ist zu einem grossen Teil internationalen Organisationen (WTO, OECD, FAO) gewidmet, welche sich teilweise oder überwiegend mit landwirtschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen
Als erstes wird aber kurz auf die laufenden bilateralen Verhandlungen mit der EU im Bereich landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte eingegangen, eine Studie der EU über Strategien für das Risikomanagement vorgestellt sowie die Entwicklung bei den Freihandelsabkommen erläutert. Der WTO-Teil berichtet über den Stand der WTOVerhandlungen im Agrarbereich und die Überprüfung der Schweizer Handelspolitik durch die WTO Mehr indirekt beeinflussen die Arbeiten der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, den Gang der Dinge bei verwandten Organisationen Es werden verschiedene Arbeiten vorgestellt, die auch für die schweizerische Landwirtschaft von Bedeutung sind, wie beispielsweise die Evaluation unserer Landwirtschaftspolitik, die Multifunktionalität oder das Stützungsmass für die Landwirtschaft (PSE) Schliesslich wird im letzten Beitrag der Stand der Arbeiten im Rahmen der FAO zur Verbesserung der Welternährungslage dargelegt.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 265 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Kein Stillstand im Europadossier

Nach der massiven Ablehnung der Initiative «Ja zu Europa» in der Volksabstimmung vom 4. März 2001, die den Bundesrat zur sofortigen Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union gezwungen hätte, wird die Schweiz in den nächsten Jahren dem bilateralen Weg den Vorzug geben Die Inkraftsetzung und der Vollzug der sieben bilateralen Verträge, die 1999 mit der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnet wurden und zu denen auch das Agrarabkommen gehört, haben kurzfristig erste Priorität Die Verträge werden voraussichtlich anfangs 2002 in Kraft treten
In den Mitgliedstaaten der EU ist der Ratifizierungsprozess im Gange Die Schweiz hat die Verträge bereits am 16 Oktober 2000 ratifiziert
In der Schlussakte zu den bilateralen Abkommen vereinbarten beide Vertragsparteien eine erneute Verhandlungsaufnahme, um in bisher nicht behandelten Bereichen von gemeinsamem Interesse («Leftovers») Vereinbarungen abzuschliessen. Der Agrarsektor ist insbesondere von den Verhandlungen zur Bereinigung des Protokolls 2 zum Freihandelsabkommen (FHA) von 1972 über landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte betroffen Bei den Verhandlungen über die Zusammenarbeit im Bereich Statistik und in der Betrugsbekämpfung spielt die Landwirtschaft ebenfalls eine Rolle Eine neue Verhandlungsrunde wurde Mitte 2001 aufgenommen.
Das Protokoll Nr. 2 zum Freihandelsabkommen von 1972 regelt die Details zur zolltarifarischen Behandlung der verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte (z B Schokolade, Biscuits, Suppen, Saucen, Teigwaren, Instant-Café, Konfitüre, Fruchtjoghurt) Es ist jedoch nicht mehr zeitgemäss und verursacht bei seiner Anwendung eine Reihe von Problemen Für die Schweiz stehen die Ausdehnung und Harmonisierung des Deckungsbereichs des Protokolls Nr. 2 sowie die Verbesserung des Preisausgleichsmechanismus an der Grenze im Vordergrund Das bisherige und das neue System werden im Folgenden am Beispiel von Mehl, das in Form von Biscuits exportiert oder importiert wird, dargestellt.
Bei der Ausfuhr erhält der Exporteur einen Ausfuhrbeitrag, weil ihn das Mehl in der Schweiz Fr 111 41/100 kg kostet Sein Konkurrent in der EU bezahlt dagegen für «sein» Mehl nur Fr 29 11/100 kg Die Differenz von Fr 82 30 ist das Rohstoffhandicap der schweizerischen Industrie und wird ausgeglichen Da die EU aber ihrerseits solche Produkte mit Zöllen belastet – in unserem Beispiel mit Fr 20 31/100 kg – wird dieser Betrag dem schweizerischen Exporteur ebenfalls noch vergütet Die Schweiz erhebt ihrerseits bei den Biscuitseinfuhren einen Zoll für den Mehlbestandteil (= beweglicher Teilbetrag), um das höhere Inlandpreisniveau für Mehl zu stützen
Ziel der Mitte dieses Jahres angelaufenen bilateralen Verhandlungen ist es, den Preisausgleichsmechanismus für die landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukte zu verbessern Durch die Einführung eines Preisausgleichs mit Referenzbasis EU-Marktpreis statt wie bisher dem Weltmarktpreis müssten weniger Mittel für Exportsubventionen, sowohl auf Seiten der Schweiz als auch auf Seiten der EU, aufgewendet werden. Beim Beispiel Mehl würde die EU für Mehl in Biscuits keinen Zoll (momentan Fr 20 31) mehr erheben, wodurch der Ausfuhrbeitrag in der Schweiz um diesen Betrag sinken würde Andererseits würde der bewegliche Teilbetrag reduziert, wodurch auch die EU auf Ausfuhrbeihilfen für Lieferungen in die Schweiz verzichten könnte. Diese
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 266
■ «Aktualisierung des Protokolls 2»
Regelung hätte den Vorteil, dass beide Seiten die im Rahmen der WTO-plafonierten Finanzmittel für Exporterstattungen in möglichst effizienter Weise einsetzen können Angesichts der WTO-Plafonierung unserer Exportbeiträge für verarbeitete Nahrungsmittel (maximal 114,9 Mio. Fr.) wäre dies sehr wünschenswert, weil dadurch eine grösstmögliche Menge landwirtschaftlicher Basisprodukte in verarbeiteter Form von den Exporterstattungen profitieren kann
Daneben wird mit diesen Verhandlungen angestrebt, für Zucker in Verarbeitungsprodukten im Verkehr mit der EU den Freihandel einzuführen Der Zucker in den Biscuits würde im gegenseitigen Warenverkehr weder in der Schweiz noch in der EU belastet Diese Regelung könnte aufgrund des ähnlichen Preisniveaus ohne Marktverzerrungen eingeführt werden.
1 Weltmarktpreis = EU-Marktpreis minus EU-Abschöpfung
131 71 EU-Mehlpreis in importiertem Verarbeitungsprodukt
2 bT (beweglicher Teilbetrag) = Zollbelastung Rohstoff ohne Industrieschutzelement
Preisausgleich mit Referenzbasis EU-Marktpreis
111 41 EU-Mehlpreis in importiertem Verarbeitungsprodukt
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 267
System Ausfuhr Einfuhr Fr / 100 kg Fr / 100 kg Fr / 100 kg Inlandpreis 111 41 EU-Marktpreis 29 11 29 11 EU-Marktpreis EU-Abschöpfung –20 31 Weltmarktpreis 1 –8 80 Ausfuhrbeitrag 102.60 102.60 bT 2 Schweiz Schweiz gerundet
Heutiges
Ausfuhr Einfuhr Fr / 100 kg Fr / 100 kg Fr / 100 kg Inlandpreis 111 41 EU-Marktpreis 29 11 –29 11 29 11 EU-Marktpreis Ausfuhrbeitrag 82 30 82 30 bT Schweiz Schweiz
Risikomanagementstrategien – eine Studie der EU

Die EU-Kommission hat Anfang 2001 eine Studie zum Thema Risikomanagement in der EU-Landwirtschaft publiziert (Risk Management Tools for EU Agriculture – with a special focus on insurance) Sie geht davon aus, dass in der Landwirtschaft sowohl Preis- wie auch Produktionsrisiken weiter zunehmen werden Die Preisrisiken werden mit der fortschreitenden Handelsliberalisierung im Agrarsektor steigen, da diese die Abschottung der EU-Landwirtschaft vom Weltmarkt reduziert Auch wird erwartet, dass die Produktionsrisiken weiter steigen Dies aufgrund eines Trends zur Verschärfung der Regeln bezüglich des Hilfsstoffeinsatzes (wie z B der Verwendung von Medikamenten in der Tierproduktion), einer Zunahme der Mobilität und des weltweiten Handels mit Tieren und Pflanzen, den zu erwartenden negativen Auswirkungen des Klimawandels sowie der Zunahme der Spezialisierung in der Landwirtschaft
Grundsätzlich werden folgende Arten von Risikomanagementstrategien unterschieden:
1 Strategien auf dem Landwirtschaftsbetrieb: Dazu gehören die Wahl von Produkten, die weniger risikobehaftet sind (z B solche, bei denen die staatlichen Stützungsmassnahmen eine Verminderung des Preisrisikos bewirken) oder die Diversifizierung des Produktionsprogramms, um so wenig wie möglich von einem einzelnen Produkt abhängig zu sein;
2. Strategien zur Risikoteilung: Dazu gehören das Abschliessen von Versicherungen und längerfristigen Abnahmeverträgen oder die Absicherung von Preisen an Warenterminbörsen;
3 Strategien ausserhalb des Landwirtschaftsbetriebs: Erschliessung von nicht-landwirtschaftlichen Einnahmequellen.
Warentermingeschäfte und Versicherungen sind die wichtigsten Marktinstrumente zur Absicherung von landwirtschaftlichen Preis- respektive Produktionsrisiken. In der EU werden zurzeit an fünf Warenterminbörsen Terminkontrakte für Landwirtschaftsprodukte gehandelt Es ist zu erwarten, dass Warentermingeschäfte mit zunehmenden Preisschwankungen infolge weiterer Handelsliberalisierung an Bedeutung gewinnen werden Die Marktstützungsinstrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) werden aber auch in Zukunft eine wichtige Rolle zur Begrenzung des Preisrisikos für wichtige Produkte spielen
Demgegenüber werden sich die privaten Versicherungsmärkte für landwirtschaftliche Produktionsrisiken auch in Zukunft nicht wesentlich entfalten Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele landwirtschaftliche Risiken nicht oder nur schwierig versicherbar sind. Dies gilt insbesondere für Risiken wie Naturkatastrophen und Epidemien. Dabei handelt es sich um Grossrisiken, die selten auftreten und grosse Schäden verursachen Versicherer sind oft nicht bereit, selber solche Grossrisiken abzudecken und die Absicherung bei Rückversicherern ist nicht immer möglich oder sehr teuer Ausserdem ist die Berechnung von Prämien für solch seltene Risiken sehr schwierig, weil die Versicherer nicht über genügend Daten zur Berechnung der Eintretenswahrscheinlichkeit und der Höhe des durchschnittlichen Schadens verfügen Dies bedeutet auch, dass Versicherer nicht bereit sind, neue Risiken (wie BSE) abzudecken Hinzu kommt, dass Landwirtinnen und Landwirte Grossrisiken oft unterschätzen und dementsprechend
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 268
■ Kurzfristig kein grundsätzlicher Handlungsbedarf auf Stufe EU
nicht bereit sind, regelmässig Prämien zu zahlen, um sich dagegen zu versichern. Andere Instrumente zur Eindämmung von Produktionsrisiken sowie staatliche Kompensationszahlungen stellen zudem eine Konkurrenz zu privaten, kostenpflichtigen Versicherungslösungen dar.
In den EU-Mitgliedstaaten hat sich auf privater Basis wie in der Schweiz lediglich die Hagelversicherung überall durchgesetzt Eine breitere Palette an Versicherungsinstrumenten zur Abdeckung von landwirtschaftlichen Produktionsrisiken wird nur in denjenigen Ländern angeboten, wo der Staat kräftige Unterstützung leistet (Spanien, Portugal) Alle Mitgliedstaaten, wie auch die EU selbst, sind aktiv im Bereich der Prävention (sanitarische und phytosanitarische Massnahmen)
Bezüglich Preisrisiken sieht die EU-Kommission keinen spezifischen Handlungsbedarf, da die Landwirtinnen und Landwirte vielfältige Möglichkeiten haben, ihre Preise kurzfristig abzusichern Zudem ist in der EU eine dynamische Entwicklung der Warenterminmärkte für landwirtschaftliche Produkte zu beobachten Die einzige Möglichkeit sieht die Kommission in der Unterstützung von EU-weiten Ausbildungsprogrammen zur Verbesserung der Kenntnisse bezüglich der Funktionsweise von Warentermingeschäften.
Bezüglich Produktionsrisiken hält die Kommission fest, dass die Mitgliedstaaten einen grossen Handlungsspielraum in diesem Bereich haben und diesen auch ausschöpfen (sanitarische und phytosanitarische Massnahmen, Unterstützung von Versicherungssystemen, Katastrophenhilfe) Es besteht deshalb auch hier auf Stufe EU kein unmittelbarer Handlungsbedarf
In ihrer Studie behandelt die Kommission auch die Frage der Effizienz von staatlich unterstützten Versicherungslösungen Bei solchen Partnerschaften zwischen Staat und Versicherungswirtschaft ist die Versicherungswirtschaft die Partnerin mit – zumindest anfänglich – wesentlich mehr Know-how. Um zu kontrollieren, ob öffentliche Gelder via die Versicherungen effizient eingesetzt werden, muss entsprechende Kompetenz und ein Kontrollapparat in der Verwaltung aufgebaut werden Weiter will die Versicherungswirtschaft für ihre Leistungen entschädigt sein, was für den Staat zusätzliche Kosten bedeutet Der Staat hat zudem laufend zu evaluieren, ob die Gewinne, die die Versicherungswirtschaft im Rahmen solcher halbstaatlicher Versicherungssysteme erwirtschaftet, dem von ihr übernommenen Risiko angemessen sind Wo solche Systeme existieren (z B USA, Spanien), sind diese in der Zwischenzeit so komplex, dass sie intransparent und schwierig reformierbar geworden sind. Die Erfahrungen der USA und Spaniens zeigen zudem, dass trotz einer umfassenden Palette von Versicherungsprodukten nie alle Risiken abgedeckt werden können und die Produkte nie für alle Landwirtinnen und Landwirte attraktiv sein können. Deshalb behalten staatliche Ad-hoc-Zahlungen weiterhin Bedeutung
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 269
Die EU-Kommission hält fest, dass solche Systeme nur dann sinnvoll sind, wenn sie streng auf die Bedürfnisse der Landwirtinnen und Landwirte ausgerichtet sind und aus der Nähe überwacht werden Deshalb kämen regionale Lösungen eher in Frage als EUweite. Ein längerfristiges Engagement der EU würde eine vertiefte Abklärung der Effizienzfrage erfordern und auch davon abhängen, ob sich ein solches Instrument harmonisch in die Massnahmenpalette einer weiterentwickelten GAP einfügen würde Allfällige Schritte müssten auch davon abhängig gemacht werden, ob die WTO die Rolle der öffentlichen Hand bei derartigen Instrumenten in Zukunft als nicht-handelsverzerrend einstuft

Freihandelsabkommen
Im Rahmen ihres Beziehungsnetzes mit Drittländern schloss die Europäische Freihandels-Assoziation (EFTA) im Berichtsjahr ein Freihandelsabkommen mit Mazedonien ab Dieses trat am 1 Januar 2001 in Kraft, gleichzeitig mit der für jeden einzelnen Mitgliedstaat abgeschlossenen Vereinbarung über den Agrarhandel, die im Falle der Schweiz nur von begrenztem Ausmass ist Mit Mexiko unterzeichnete die EFTA zudem am 27 November 2000 erstmals ein Freihandelsabkommen mit einem Überseeland Dessen Geltungsbereich ist im Vergleich zu den übrigen EFTA-Abkommen deutlich grösser Um den verschiedenen Agrarpolitiken der EFTA-Länder Rechnung zu tragen, wurde über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Verarbeitungsprodukten wie üblich ein bilaterales Abkommen zwischen jedem einzelnen Mitgliedland und Mexiko abgeschlossen Das Agrarabkommen mit Mexiko verpflichtet die Schweiz zur Reduktion oder Aufhebung von Zöllen auf einigen Produkten, die für Mexiko von Interesse sind (z B Kaffee, Honig zur industriellen Verarbeitung, Bananen, gewisse Gemüsesorten) Im Gegenzug gewährt Mexiko der Schweiz Zollkonzessionen für bestimmte Früchte und Gemüse (Salat, Zwiebeln und Aprikosen). Die Zugeständnisse Mexikos sind jedoch mit Einschränkungen verbunden, da einerseits Milchprodukte, Fleisch und Getreide von dieser Vereinbarung ausgenommen sind und andererseits Mexiko Konzessionen im Zusammenhang mit Agrarprodukten verweigerte, für die Exportsubventionen ausgerichtet werden Das Freihandelsabkommen mit Mexiko und die Vereinbarung im Agrarbereich sind am 1 Juli 2001 in Kraft getreten Durch das Freihandelsabkommen dürften die schweizerischen Exporte mit rund 100 Mio Fr weniger an Zollabgaben belastet werden
Die EFTA brachte ebenfalls ihre Verhandlungen mit Kroatien und Jordanien zu einem erfolgreichen Abschluss Im Agrarsektor konnten aber nur Vereinbarungen begrenzten Umfangs getroffen werden. Im Dezember 2000 erfolgte die Verhandlungsaufnahme mit Chile und im Juli 2001 mit Singapur Als nächstes Land soll Südafrika an der Reihe sein Die EFTA setzt übrigens ihre Verhandlungen mit einigen Ländern des Mittelmeerraumes fort (Ägypten, Zypern und Tunesien).
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 270
■ Verhandlungsvorschlag der Schweiz
Die Verhandlungen betreffend die Bereinigung des Übereinkommens zur Errichtung der EFTA vom 4 Januar 1960 fanden im Laufe des Jahres 2001 ihren Abschluss Im Agrarbereich konnte die von der Schweiz angestrebte Liberalisierung, wie sie unser Land mit der EU vereinbart hatte, aufgrund des grossen Widerstandes aus Norwegen nicht erzielt werden Dennoch wurde im Käsesektor das zollfreie Kontingent, das Norwegen der Schweiz gewährt, deutlich von 14 auf 60 t pro Jahr angehoben Die Schweiz räumte ihrerseits Norwegen und Island ein zollfreies Kontingent von 60 t ein Zusätzlich zu diesen Zollkonzessionen einigten sich die EFTA-Länder im Bereich der technischen Handelshemmnisse auf die Gleichwertigkeit der Bestimmungen über Saatgut und den biologischen Landbau Diese Äquivalenz stützt sich einerseits auf den Inhalt des bilateralen Agrarabkommens zwischen der Schweiz und der EU und andererseits auf den Acquis des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Das neue EFTAÜbereinkommen sollte gleichzeitig mit den sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG in Kraft treten
WTO-Verhandlungen in Genf
Durch das Übereinkommen über die Landwirtschaft (Agrarabkommen) haben sich die WTO-Mitglieder verpflichtet, die Einfuhrzölle, die Inlandstützung und die Exportsubventionen über einen Zeitraum von sechs Jahren bis Ende 2000 zu reduzieren Die Schweiz ist ihren Verpflichtungen nachgekommen Aufgrund von Artikel 20 des Agrarabkommens sind im Jahre 2000 in Genf neue Verhandlungen mit dem Ziel einer schrittweisen, wesentlichen Senkung der Stützungs- und Schutzmassnahmen aufgenommen worden In dieser ersten Phase sind durch die Delegationen die Verhandlungsfelder abgesteckt worden Auch die Schweiz hat im Dezember 2000 einen detaillierten Verhandlungsvorschlag eingebracht
Die Schweiz will eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige landwirtschaftliche Produktion erhalten. Die Herstellung von öffentlichen Gütern, wie beispielsweise die Pflege der Kulturlandschaft, die dezentrale Besiedelung oder die Erhaltung der natürlichen Ressourcen wird mittels Direktzahlungen entschädigt Die Schweiz verlangt in ihrem Verhandlungsvorschlag, dass jedes Land autonom die Höhe solcher Direktzahlungen aufgrund seiner eigenen agrar-, umwelt- und regionalpolitischen Ziele bestimmen kann Die Schweiz ist aber auch bereit, sich für eine präzisere Umschreibung der Kriterien einzusetzen, um den Vorwurf einer indirekten Stützung der Produktion von Nahrungsmitteln, für die ein funktionierender Markt besteht, entkräften zu können. Dahinter steht die Absicht, für unsere produktionsunabhängigen Direktzahlungen eine höhere Rechtssicherheit zu erreichen
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 271
Daneben gilt es aber auch, bezüglich der drei bisherigen Pfeiler – Marktzutritt, Inlandstützung und Exportsubventionen – über die Regeln, Disziplinen und Kriterien zu verhandeln, bevor über weitere Abbaumassnahmen gesprochen werden kann
1 Beim Marktzutritt sollen die Verhandlungen auf der Basis von gegenseitigen Zugeständnissen erfolgen Für die ärmsten Entwicklungsländer sind spezielle Zutrittsbedingungen auszuhandeln Bei der Verteilung von Zollkontingenten soll weiterhin der Grundsatz gelten, dass die Art der Zuteilung eine landesinterne Domäne ist, solange die Zutrittsmöglichkeit effektiv gewährleistet wird Die im Landwirtschaftssektor vorgesehene mengenmässige und preisliche Sonderschutzklausel ist beizubehalten Es werden konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht
2 Bei der Inlandstützung sind die Umschreibungen für die drei Boxen – amber, blue und green – präziser vorzunehmen als bisher Bei der Amber-Box handelt es sich um produktionsbezogene, abbaupflichtige Massnahmen, bei der Blue-Box um nichtabbaupflichtige Prämien und bei der Green-Box um produktionsunabhängige, nicht abbaupflichtige Unterstützungsmassnahmen Im Bereich der Green-Box soll jedes Land nach seinen spezifischen Bedürfnissen den Umfang der von der Landwirtschaft geforderten Leistungen selber bestimmen können Ein Plafond wird abgelehnt Damit können die Leistungen einer multifunktionalen Landwirtschaft entsprechend des im Inland erwünschten Umfangs abgegolten werden Dazu gehören neben der Pflege der Kulturlandschaft, der dezentralen Besiedelung und der Erhaltung der natürlichen Ressourcen auch die Lebensmittelsicherheit, die Lagerhaltung zwecks Versorgungssicherheit und die artgerechte Tierhaltung
3 Bei den Exportsubventionen sind nicht nur die direkten Erstattungen zu berücksichtigen, sondern auch die indirekten, wie beispielsweise Exportkredite, oder gewisse Formen von Staatshandel (Möglichkeiten zu Mischpreisen).
Die Schweiz wünscht, dass über drei weitere Bereiche gesprochen wird, die in anderen Abkommen geregelt sind, aber einen Bezug zur Landwirtschaft haben.
– Ein besserer Schutz geografischer Herkunftsangaben: Nicht nur die Herkunftsangaben der Weine und Spirituosen sollen geschützt werden, sondern auch jene anderer Produkte, speziell diejenigen für den Käse
Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen mehr Produkteinformationen erhalten als bisher Dazu gehören Angaben über die Produktionsmethode wie beispielsweise Informationen über die Umweltbelastungen oder das Tierwohl, aber auch die Deklaration von GVO-Produkten Solche Informationen erhöhen die Transparenz und verbessern die Funktionsfähigkeit der Märkte, ohne damit unnötige technische Handelsbarrieren zu errichten.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 272
–
■ Verhandlungsfahrplan 2001/2002

– In verschiedenen Abkommen sollen die drei Nachhaltigkeitsdimensionen (Ökonomie, Ökologie und Soziales) in geeigneter Weise berücksichtigt werden Handelsmassnahmen, die einen negativen Einfluss auf einen oder mehrere der drei vorgenannten Aspekte haben, sind zu vermeiden. Externe Kosten, die bei der Produktion von landwirtschaftlichen Produkten anfallen können, sind zu internalisieren
Die Verhandlungsvorschläge der Schweiz sind zwar von den agrarexportierenden Ländern als zu wenig weitgehend hinsichtlich der Marktliberalisierung kritisiert, aber von den anderen Ländern generell als ein konstruktiver Beitrag gewürdigt worden
Nachdem Ende März 2001 die erste Phase der formellen Verhandlungen abgeschlossen worden ist, wurde die zweite Phase in Angriff genommen, die gemäss Arbeitsprogramm bis zum Frühjahr 2002 dauern wird Diese Verhandlungsphase ist mehr technischer Natur und wird sich mit allen Verhandlungsgegenständen, die in den Eingaben der WTO-Mitglieder aufgeführt worden sind, befassen Es werden beispielsweise handelsbezogene Aspekte wie Zollkontingente oder Zollansätze, aber auch nicht handelsbezogene wie Ernährungssicherheit, Sicherheit der Nahrungsmittel oder ländliche Entwicklung behandelt Wichtig für den weiteren Verhandlungsverlauf wird die vierte Ministerkonferenz vom 9. bis 13. November 2001 in Qatar sein. Dort wird entschieden, ob eine erweiterte neue WTO-Runde eingeleitet und ob das Verhandlungsmandat im Agrarbereich Änderungen erfahren wird
Neben den formellen Verhandlungen gibt es verschiedene informelle Gruppen, die im Verhandlungsprozess spezifische Anliegen vertreten Die Schweiz gehört mit der EU, Japan, Korea, Norwegen und Mauritius zur Gruppe der Multifunktionalisten, die die Rolle der Landwirtschaft nicht nur durch die Produktion von Nahrungsmitteln, sondern auch durch deren verschiedene, nicht produktebezogene Leistungen gesichert haben wollen Im Anschluss an die Konferenz im Sommer 2000 im norwegischen Ullensvang wurde Ende Mai 2001 eine solche in Mauritius mit etwa 50 Ländern organisiert, um alle sogenannten «nicht handelsbezogenen Anliegen» zu diskutieren. Besonders für die zahlreichen Entwicklungs- und Transitionsländer konnten dabei die spezifischen Herausforderungen dieser komplexen Agrarverhandlungen analysiert werden
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 273
WTO und die schweizerische Handelspolitik
Die WTO überprüft nach einem bestimmten Verfahren in gewissen Zeitabständen die Handelspolitik der Mitgliedsstaaten. Die letzte Überprüfung der Schweiz fand im Berichtsjahr statt Es werden sämtliche Sektoren der Volkswirtschaft analysiert Naturgemäss nimmt die Landwirtschaft einen grossen Stellenwert ein
Der folgende Auszug stammt aus dem WTO-Sekretariatsbericht «Examen des politiques commerciales Suisse et Liechtenstein» vom 6 November 2000:
Dank der 1993 eingeleiteten und im Rahmen der «Agrarpolitik 2002» fortgesetzten Reformen konnten die staatlichen Eingriffe im Agrarsektor reduziert werden Die vom Staat gewährten Direktzahlungen zur Stützung des Agrareinkommens sind oft an ökologische Leistungen gebunden Im Weiteren wurde der Anwendungsbereich der Margen- und Preisgarantien deutlich verringert Dennoch macht die staatliche Agrarstützung immer noch drei Viertel der landwirtschaftlichen Bruttoeinnahmen aus Für Milchprodukte, Vieh, Pferde, Früchte, Kartoffeln und einige landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte werden weiterhin Exportsubventionen ausgerichtet. Die Reformschritte haben sich aufgrund der fehlenden Konkurrenz in verschiedenen Bereichen, aufgrund der Preisstützungsmassnahmen und aufgrund der Ablösung ehemaliger Vermarktungsorganisationen durch staatlich beauftragte Institutionen nur in beschränktem Masse auf die Preise ausgewirkt Eine Rolle spielt ebenfalls das Übernahmesystem (bei der Einfuhr bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse angewandt), das den Zugang zu Zollkontingenten nur über den Kauf von inländischen Produkten ermöglicht Als Folge davon blieben die Inlandpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Verhältnis zu anderen Ländern auf einem hohen Niveau. Die nachteiligen Auswirkungen der hohen Preise für Agrarprodukte, welche die Agro-Industrie zur Weiterverarbeitung nutzt, wurden durch sehr unterschiedlich ausgestaltete Anreize abgefedert. Die Landwirtschaft bleibt nach wie vor einer der am stärksten geschützten Sektoren Das Wertäquivalent der unter Meistbegünstigungsbedingungen angewandten Zölle auf Agrareinfuhren beträgt im arithmetischen Mittel rund 34% bzw das Vierfache des allgemeinen Durchschnitts, mit einem Maximum von 678% Die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse unterliegt im Übrigen einer Bewilligungspflicht Gründe dafür sind einerseits sanitarische und phytosanitarische Anforderungen und andererseits die Pflichtlagerhaltung, die Bewirtschaftung von Zollkontingenten sowie Vorschriften über die Etikettierung Insgesamt ist die Agrarpolitik nach wie vor als komplex zu bewerten.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 274
■ Die schweizerische Landwirtschaft im Urteil der WTO
Die von der Regierung gesetzten Ziele stützen sich auf den Verfassungsartikel und das LwG vom 29 April 1998:
1. Eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft muss sich in unserer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ihren Platz sichern können
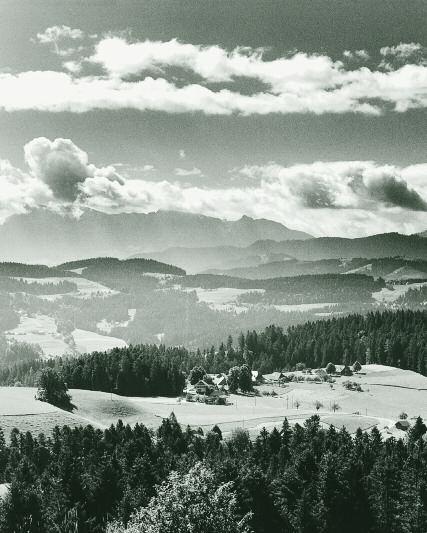
2 Die Landwirtschaft muss in der Lage sein, auf den in- und ausländischen Märkten marktgerechte Erzeugnisse und Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen anzubieten
3 Die Landwirtschaft hat die Ressourcen nachhaltig zu nutzen und auf diese Weise einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt, zur Landschaftspflege und zur Entwicklung des ländlichen Raumes zu leisten
Das Konzept zur Erreichung der erwähnten Ziele besteht sowohl in der Trennung von Preis- und Einkommenspolitik als auch in der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher (z B ökologischer) Leistungen über staatliche Beiträge
– Der Markt regelt grundsätzlich die Nahrungsmittelproduktion und den Anbau nachwachsender Rohstoffe. Die wenigen noch gewährten Marktstützungen sind derart ausgestaltet, dass sich ihre Auswirkungen auf die Marktmechanismen auf ein Minimum beschränken Die staatlichen Eingriffe in das Marktgeschehen sollen deutlich zurückgehen.
– Der Staat gilt über Direktzahlungen Leistungen ab, für die kein Markt besteht Beispiele dafür sind die Pflege der Kulturlandschaft oder die Erhaltung der natürlichen Ressourcen Es geht im Weiteren um die Abgeltung bestimmter Leistungen, die auf Wunsch der Gesellschaft im Bereich Umwelt- und Tierschutz erbracht werden Die Zahlungen dürfen nicht an die Produktion gebunden sein
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 275
■
Kommentar der Schweiz
■ Was versteckt sich dahinter?
OECD – der diskrete Riese
Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird oft als Denkfabrik, Beobachtungsstation, Club der reichen Länder oder als inoffizielle Hochschule bezeichnet Jede dieser Bezeichnungen trägt zwar ein Quentchen Wahrheit in sich, aber keine wird der eigentlichen Funktion der OECD gerecht
Als Organisation mit 30 Mitgliedländern bietet die OECD in erster Linie den Regierungen einen Rahmen zur Prüfung, Erarbeitung und Weiterentwicklung der Wirtschaftsund Sozialpolitiken Die Regierungen tauschen in diesem Forum ihre Erfahrungen aus, suchen Lösungen für gemeinsame Problemstellungen und bemühen sich um eine Abstimmung der nationalen und internationalen Politiken, deren Harmonisierung sich angesichts der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft immer mehr aufdrängt Die Diskussionen können zu formellen Beschlüssen führen wie z B die Einführung von rechtlich verbindlichen Regeln zur Gewährleistung des freien Kapital- und Dienstleistungsverkehrs, das Ergreifen von Massnahmen zur Betrugsbekämpfung oder die Abschaffung der Schiffbausubventionierungen Doch in erster Linie dienen die Gespräche der besseren Information der Regierungen, damit diese in der Folge bei ihrem Handeln im eigenen nationalen Kontext sämtlichen Aspekten der öffentlichen Politiken Rechnung tragen und die Auswirkungen der nationalen Politik auf die internationale Gemeinschaft besser einschätzen können Zudem bietet die OECD Gelegenheit zum Gedanken- und Meinungsaustausch mit Ländern, die ähnliche Voraussetzungen aufweisen.
Die OECD ist ein Zusammenschluss gleichgesinnter Länder Sie stellt insofern einen Club der Reichen dar, als ihre Mitglieder zusammen zwei Drittel aller Güter und Dienstleistungen der Welt produzieren Die OECD ist aber kein Privatclub Als Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft in der OECD muss ein Land nach den Regeln der Marktwirtschaft und der pluralistischen Demokratie funktionieren Zu den ursprünglichen Gründerländern Europas und Nordamerikas gesellten sich nacheinander Japan, Australien, Neuseeland, Finnland, Mexiko, die Tschechische Republik, Ungarn, Holland, Polen und Südkorea Im Rahmen von Programmen mit Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Asiens und Lateinamerikas pflegt die OECD zudem zahlreiche Kontakte mit der restlichen Welt Im einen oder anderen Fall können diese Beziehungen durchaus in einen Beitritt münden
■ Arbeiten im Rahmen des Agrarkomitees und dessen Arbeitsgruppen
Das BLW vertritt in der OECD die Schweizer Interessen im Agrarkomitee und in verschiedenen Arbeitsgruppen. In den vergangenen drei Jahren richtete sich ein wachsender Teil der dortigen Aktivitäten auf die Erarbeitung analytischer Grundlagen für die neuen Agrarverhandlungen im Rahmen der WTO Erwähnt seien in diesem Zusammenhang die Arbeiten zu den Effekten der GATT-Uruguay-Runde und zur Definition und Bewertung der Multifunktionalität der Landwirtschaft
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 276
■ Policy Evaluation Matrix (PEM): Erste Pilotstudie abgeschlossen
Im Agrarbereich (inkl. Agrarhandels- und Agrarumweltfragen) hat die OECD einen wichtigen Beitrag zu einer Versachlichung der Diskussionen zwischen der alten und der neuen Welt geleistet Das Landwirtschaftsdirektorat im OECD-Sekretariat steht seit 1987 und noch bis Ende 2001 unter der Leitung des Schweizers Gérard Viatte. Unter seiner Leitung erlebt die Qualität und die unmittelbare Politikrelevanz der Arbeit der OECD im Agrarbereich einen Höhepunkt
Für 2001 und 2002 werden die wichtigsten Aktivitäten des Agrarkomitees und dessen untergeordneten Arbeitsgruppen die folgenden sein:
– Beurteilung und Überwachung der Agrarpolitiken;
Abwägen der künftigen Entwicklung der Agrarmärkte und des -handels;
– Beurteilung und Förderung der Handelsliberalisierung;
– Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit der Landwirtschaft;
Analyse der Schnittstellen zwischen den inländischen und ausländischen Einflüssen und Politiken
Bei der PEM handelt es sich um ein partielles Gleichgewichtsmodell für jede Marktordnung mit einer Produktionsfunktion. Mit diesem Modell werden die Effekte marginaler Änderungen der Stützung (Marktpreisstützung, Direktzahlungen) auf das landwirtschaftliche Einkommen, Welthandel, Steuerzahler- und Konsumentenkosten analysiert. Man versucht auch, diese Effekte auf die Beschäftigung und Umwelt zu modellieren und zu analysieren Im Frühjahr 2001 wurden die Resultate der Pilotstudie für den Ackerbau publiziert Zurzeit erarbeitet die Expertengruppe ein solches Modell für den Milchmarkt Vorgesehen ist, die PEM beim Ländermonitoring und in verschiedenen Arbeiten der OECD zu verwenden Das BLW arbeitet seit November 1998 am Pilotprojekt PEM mit. Seit Anfang 1999 beteiligt sich zusätzlich die ETH im Rahmen eines Forschungsauftrages des BLW an der Modellierung der Schweizer Märkte für die PEM
■ Rahmenwerk zur Multifunktionalität der Landwirtschaft
Seit einigen Jahren befasst sich die OECD mit dem Thema der Multifunktionalität der Landwirtschaft Im Frühjahr 2001 hat sie ein umfassendes analytisches Konzept zur Multifunktionalität publiziert Die Schweiz hat die Arbeiten an diesem für sie zentralen Thema im Rahmen der entsprechenden Komitees und Arbeitsgruppen initiiert, eng begleitet, und arbeitet an deren Weiterentwicklung mit Trotz der unterschiedlichen Meinungen und Positionen der Mitgliedländer der OECD über die Multifunktionalität der Landwirtschaft konnte dieses analytische Konzept vom Agrarkomitee verabschiedet werden

3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 277
–
–
■ Weitere wichtige Arbeiten der OECD im vergangenen Jahr
Im Dokument werden die Beziehung der Multifunktionalität zur Nachhaltigkeit, die Koppelproduktion wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Güter in der Landwirtschaft, verschiedene Dimensionen der nicht warenbezogenen Leistungen, deren ausserlandwirtschaftliche Bereitstellung und Externalitäts- und Gemeingutsaspekte untersucht Dabei kommt die OECD zum Schluss, dass ein begrenztes Eingreifen des Staates dann erforderlich sein kann, wenn erstens ein hoher Koppelungsgrad zwischen landwirtschaftlichen Waren und nicht warenbezogenen Leistungen besteht, wenn zweitens ein mit nicht warenbezogenen Leistungen verbundenes Marktversagen existiert und wenn drittens keine privaten Optionen (wie die Schaffung neuer Märkte oder der freiwilligen Bereitstellung) als effizienteste Strategien zur Bereitstellung dieser nicht warenbezogenen Leistungen bestehen
Die OECD hat im Bereich Landwirtschaft Dokumente zu den Themen geographische Ursprungsbezeichnungen, Implementierung der Urugay-Runde der WTO, Entkoppelung der Agrarstützungsinstrumente, Biotechnologie und Agrarmärkte, Staatshandelsunternehmen, Exportkredite, Abschaffung der Exportsubventionen und Agrarumweltindikatoren publiziert Damit leistet die OECD überdies wichtige Vorbereitungsarbeiten für die laufenden Agrarverhandlungen im Rahmen der WTO in Genf
■ Schweizer Agrarpolitik im Spiegel der OECD
In ihrem jährlichen Bericht «Agrarpolitik in den OECD-Ländern: Monitoring und Evaluation 2001» wird die Schweiz weiterhin für ihren hohen Grad des Agrarschutzes kritisiert, der nach wie vor einer der grössten der Welt ist
Die OECD anerkennt jedoch, dass die Verschiebung mit der «AP 2002» weg von der Marktpreisstützung hin zu produktungebundenen Agrarumweltzahlungen in die richtige Richtung geht.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 278
■ OECD-Beurteilung der Schweizer Agrarpolitik
Der nachfolgende Kasten enthält eine Zusammenfassung der OECD-Beurteilung über die Schweizer Agrarpolitik im Berichtsjahr
Die schweizerische Landwirtschaft ist geprägt durch eine hohe Marktstützung, die den Marktmechanismen nur wenig Platz lässt Die Struktur der Agrarstützung hat sich seit Mitte der achtziger Jahre verändert: Der Anteil der Martkpreisstützung nahm ab, während derjenige der Budgetzahlungen anstieg Die Preisgarantien fielen im Jahr 2000 weg In der Folge glichen sich die inländischen Preise vermehrt dem Weltmarktniveau an Obwohl der nominale Produzentenstützungskoeffizient (Producer Nominal Protection Coefficient [NPCp], welcher das Verhältnis darstellt zwischen dem PSE und dem Gesamtwert der Brutto-Betriebseinnahmen berechnet zu Weltmarktpreisen, ausschliesslich sämtlicher Budgetzahlungen) im Vergleich zum Zeitraum 1986–1988 um rund 25% abgenommen hat und im Jahr 2000 bei 2 93 liegt, bleiben die inländischen Produzentenpreise im Durchschnitt rund drei Mal höher als die Weltmarktpreise Die Zahlungen an die Landwirte zum Ausgleich der tieferen Markterlöse und zur Abgeltung der Bereitstellung von nicht produktbezogenen Leistungen nahmen zu Der Anteil der Budgetzahlungen an der gesamten Produzentenstützung erhöhte sich von 18% während des Zeitraumes 1986–1988 auf 39% im Jahr 1999 und auf 41% im Jahr 2000. Die markantesten Anstiege waren im vergangenen Jahr bei den an die Produktion und den Produktionsmittelverbrauch gebundenen Zahlungen und bei den mit Auflagen betreffend Produktionsmittelverbrauch zu beobachten. Langfristig hat sich die Ausgestaltung der budgetären Zahlungen deutlich verändert: Der Anteil der Zahlungen gebunden an den Produktionsmittelverbrauch ging von 44% im Zeitraum 1986–1988 auf 14% im Jahr 2000 zurück und die Zahlungen zur Kompensation von Marktpreisstützungsabbau aus dem Jahr 1993 berechneten Zahlungen stiegen auf 39% an Insgesamt verzeichnet das PSE in Prozentzahlen einen leichten Rückgang (71% im Jahr 2000 gegenüber 73% während der Periode 1986–1988) Dennoch bleibt die Stützung der Landwirtschaft eine der höchsten in der OECD Die landwirtschaftlichen Bruttoeinnahmen 2000 (einschliesslich Subventionen) fielen fast um das Dreieinhalbfache höher aus, als wenn keine Stützung erfolgt wäre
Im Rahmen der AP 2002 ist die Ausrichtung von Zahlungen zugunsten der Landwirtschaft an gewisse ökologische Leistungen gebunden Die «ökologischen Direktzahlungen», die Auflagen betreffend die landwirtschaftliche Praxis unterliegen, sind denn auch gegenüber den früheren Jahren deutlich angewachsen Der schrittweise Abbau der Preisstützung zugunsten Agrarumweltzahlungen und weiterer Direktzahlungen wird zu einem verstärkt marktorientierten und nachhaltigen Agrarsektor führen Dennoch lassen die Umverteilung von Budgetmitteln zur Marktpreisstützung im Milchsektor und die Einführung eines neuen Flächenbeitrages für offene Ackerflächen und Dauerkulturen, wie von Parlament und Regierung Ende 2000 und anfangs 2001 beschlossen, eine Gefährdung des von der AP 2002 vorgesehenen Abbaus der produktionsgebundenen Stützung befürchten
Im Weiteren verharrt die Stützung zugunsten der Landwirte in der Schweiz deutlich über dem OECD-Durchschnitt, so dass weitere Reformanstrengungen nötig erscheinen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft auf dem Weltmarkt zu fördern
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 279
■ Kommentar der Schweiz
Das OECD-Urteil fiel für die Schweiz beispielsweise im Vergleich zu den anderen drei Ländern mit sehr hohen Agrarstützungsniveaus (Norwegen, Japan, Südkorea) positiv aus Die Reformen im Rahmen der «AP 2002» hin zu mehr Marktorientierung, weniger Marktpreisstützung und der vermehrten direkten Abgeltung von nicht produktbezogenen Leistungen wie Landschaftspflege oder Biodiversität erhalten gute Noten Dennoch kommt die OECD zum Schluss, dass weitere Reformanstrengungen nötig sind, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft zu stärken
■ Wofür steht das PSE?
Die so genannte PSE-Methode (Producer Support Estimate) wird zur Berechnung der Agrarstützung verwendet. Das PSE ist ein Indikator für den Geldwert der Bruttoumverteilung von den Konsumenten und Steuerzahlern zur Stützung der Agrarproduzenten auf Stufe Betrieb Art, Zielsetzungen oder Auswirkungen dieser Umverteilung auf die Produktion oder das landwirtschaftliche Einkommen werden in der Gesamtstützungszahl nicht berücksichtigt
Das BLW steht der PSE-Methode teilweise skeptisch gegenüber: Die OECD unterscheidet nämlich bei der Gesamtstützung und dem prozentualen Anteil der Stützung an den Betriebseinnahmen nicht zwischen Marktpreisstützung (berechnet nach der Differenz zwischen Weltmarkt- und Schweizer Produzentenpreisen) und den von der Nahrungsmittelproduktion entkoppelten Direktzahlungen zur Erreichung von nicht produktebezogenen Leistungen. Ein anderes Problem bei der PSE-Berechnung ist die Definition der Weltmarktpreise Während dies im Falle von Getreide recht einfach ist, so ist dies beispielsweise bei der Milch schwierig, da fast ausschliesslich verarbeitete Milchprodukte gehandelt werden Im Falle der Milch wurde der Produzentenpreis des New Zealand Dairy Board zum Referenzweltmarktpreis bestimmt Die Weltmarktpreise unterliegen grossen Schwankungen, was dazu führt, dass die PSE-Werte selbst dann schwanken, wenn es keine inländischen Politikänderungen und keine inländischen Preisschwankungen gibt Denselben Effekt haben Wechselkursschwankungen Hier liegt denn auch der Hauptunterschied zur Berechnung der Inlandstützung im Rahmen der Amber-Box des WTO-Agrarabkommens: Dort ist nämlich der Referenzpreis ein fixer Preis, im Falle der Schweiz oft der EU-Preis Weiter zählt die WTO die Massnahmen der so genannten Green-, Blue- und Amber-Boxes nicht zusammen, sondern weist sie getrennt aus
Die Steigerung der Höhe der Direktzahlungen, die immer mehr an nicht produktebezogene Leistungen gekoppelt sind, und der gleichzeitige Abbau der Marktpreisstützung führten zu einem geringeren Wert der Agrarproduktion. Dabei steigt das PSE automatisch Diese Verfälschung kann aus Sicht der OECD so lange nicht geändert werden, als es keine objektiv klare und einfach anwendbare Kriterien für die Unterscheidung von Zahlungen für produktebezogene und für nicht produktebezogene Leistungen gibt. Es ist äusserst schwierig Zahlungen zu unterscheiden, die produktespezifisch respektive nicht produktespezifisch sind Beispielsweise wäre eine Düngersubvention nicht produktespezifisch, obwohl der Einfluss auf die Produktion sehr gross ist Solche Unterscheidungen sind technisch noch kaum möglich und es fehlt auch der politische Wille, solchen Differenzierungen zum Durchbruch zu verhelfen. Erst nach Vorliegen solcher Zuteilungskriterien könnte man die Zahlungen für nicht produktebezogene Leistungen in der PSE-Berechnung getrennt ausweisen Die OECD kann sich dabei nicht auf die aus ihrer Sicht zu wenig präzisen Kriterien für die Green-Box des WTO-
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 280
Agrarabkommens stützen. Zum Thema Entkoppelung, das heisst in diesem Kontext die Suche nach solchen Kriterien, sind jedoch zurzeit verschiedene Arbeiten in der OECD im Gange
Die von der OECD vorgenommene Aufteilung des PSE zeigt hingegen für die Schweiz grosse Veränderungen in den letzten Jahren: Während die Marktpreisstützung in den neunziger Jahren zurückging, stiegen die budgetären kompensatorischen Ausgaben (produktegebundene und teilweise produktegebundene) und die produkteungebundenen Ausgaben für spezifische nicht produktebezogene Leistungen an
Das BLW wird sich auch in Zukunft im Agrarkomitee der OECD und dessen untergeordneten Arbeitsgruppen dafür einsetzen, dass die PSE-Methode den Schweizer Reformen besser Rechnung trägt und die PSE-Publikationen der OECD in Zukunft mehr Gewicht auf die Aufteilung des PSE als auf die Gesamtstützungszahl und die Prozentzahl des Stützungsanteils legen.
Unterstützungsmass für die Landwirtschaft im Jahr 2000

3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 281
Zusammensetzung Schweiz EU USA Producer Support Estimate (PSE) (Schätzung) Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. PSE in absoluten Werten 7 501 152 520 82 667 Marktpreisstützung 4 432 89 608 26 460 Zahlungen gebunden an 297 7 967 15 584 die Produktion Zahlungen gebunden an 846 38 774 5 939 Anbauflächen / Anzahl Tiere Zahlungen zur Kompensation 1 190 972 17 783 von Marktpreisstützungsabbau Zahlungen gebunden an 423 10 126 11 248 den Verbrauch von Produktionsmitteln Zahlungen mit Auflagen betreffend 124 4 976 3 338 Produktionsmittelverbrauch Zahlungen gebunden an das 00 2 315 einzelbetriebliche Gesamteinkommen Diverse Zahlungen 190 97 0 PSE in Prozenten der Bruttoeinnahmen 71 38 22 auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb SNB-Devisenkurse 2000: Fr /EURO 1 5578 / Fr /US-$ 1 6886 Quelle: OECD
Das OECD-Sekretariat macht sich zur Zeit Gedanken, wie die Gruppierung des PSE verbessert werden könnte, und zwar in Form einer Rangordnung gemäss den Auswirkungen der PSE-Massnahmen auf die Produktion im Vergleich mit der Marktpreisstützung. Die zurzeit diskutierte Rangfolge wäre: Marktpreisstützung, Zahlungen gebunden an die Produktion, Zahlungen gebunden an den Verbrauch von Produktionsmitteln, Zahlungen gebunden an Anbauflächen/ Anzahl Tiere, Zahlungen zur Kompensation von Marktpreisstützungsabbau, Zahlungen verbunden mit Auflagen betreffend Produktionsmittel und Zahlungen an das einzelbetriebliche Gesamteinkommen
Die kompletten Berichte der OECD und weitere Informationen können unter der Homepage www oecd org/agr eingesehen werden Einige davon befinden sich auch auf der Homepage www.blw.admin.ch des BLW.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 282
■ Kommentar der Schweiz
Welternährung und FAO
Der Agrarbericht 2000 begann mit einer optimistischen Rückschau zur Welternährungslage und leitete über zu Engpässen, die das künftige globale Agrarpotential bedrohen Ein Jahr später haben sich die limitierenden Faktoren vorerst durchgesetzt Die von der FAO anvisierte schnellere Gangart im Kampf gegen den Hunger läuft Gefahr, sich ins Gegenteil zu wenden
Seit dem Welternährungs-Gipfel von 1996 konnten in der Verbesserung der Welternährungslage kaum Fortschritte erzielt werden Die sieben Verpflichtungen, 27 Zielsetzungen und 182 Aktionen, welche auf der Erklärung von Rom aus dem Jahr 1996 basieren, wurden sehr mangelhaft umgesetzt
Fünf Jahre nach dem Gipfel von 1996 muss festgestellt werden, dass die Entwicklung der Welternährung weit von jenem Pfad entfernt ist, der zur Halbierung der Anzahl Hungernder bis zum Jahre 2015 führen würde Die Generalkonferenz der FAO im November 2001 wird sich in einem umfassenden «Review» mit den Gründen für diese Entwicklung auseinandersetzen
Bereits kann aber folgendes festgehalten werden:
– immer noch leiden über 800 Mio Menschen an Unterernährung und Hunger, davon 792 Mio. in Entwicklungsländern;
– die Investitionen in Projekte zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Entwicklung sind weltweit, aber auch seitens der Schweiz, rückläufig;
Globalisierung und Liberalisierung haben zu einseitigen Wohlstandseffekten geführt Sie haben den ärmsten Menschen in den Entwicklungsländern kaum die erhofften positiven Resultate gebracht;
die von Menschen verursachten Katastrophen haben zugenommen; 60 Mio Menschen in 35 Entwicklungsländern befinden sich heute in Nothilfesituationen, mehr als je zuvor;
– Klimaveränderungen haben unvorhersehbare Auswirkungen auf die Verteilung der Niederschläge und auf die landwirtschaftlichen Erträge;

die Ausbreitung von HIV/AIDS hat sich beschleunigt 95% der Fälle treten in Entwicklungsländern auf Die Pandemie ist in vielen Ländern des Südens ausser Kontrolle geraten, hat die schwächsten Gruppen am härtesten getroffen und wirkt sich negativ auf deren landwirtschaftliche Produktion aus;
– der weitverbreitete Hunger erlaubt nur geringe Fortschritte bei der Armutsbekämpfung. Armut und Hunger bedingen sich gegenseitig; Hunger ist zugleich Ursache und Auswirkung von Armut
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 283
■ Im Schatten des Aktionsplans und der Erklärung von Rom
–
–
–
■ Prognosen zur weiteren Entwicklung
Gemäss Trendanalysen der FAO für 2015 und 2030 wird die Zahl der unterernährten Menschen in den Entwicklungsländern bis 2015 auf 580 Mio zurückgehen Damit würde die Anzahl Hungernder zwar abnehmen, die Zielvorgabe des Welternährungsgipfels aber nicht erreicht. Es dürfte erst im Jahr 2030 gelingen, die Zahl hungernder Menschen auf ungefähr 400 Mio zu halbieren
Auch regional wird die Entwicklung unterschiedlich eingeschätzt Gemäss den Prognosen dürften Süd- und Ostasien das Ziel bis 2015 erreichen Die Situation in den Ländern Afrikas südlich der Sahara und des Nahen Ostens wird negativer beurteilt Lateinamerika würde eine Position dazwischen einnehmen
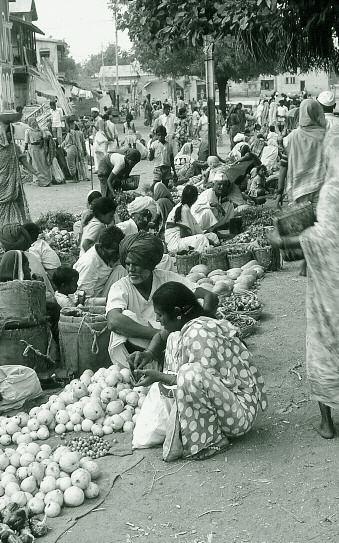
Prognosen zur Entwicklung der Unterernährung
Die Hochrechnungen der FAO für die nächsten 15 Jahre beruhen auf einem Wachstum der Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern von jährlich 2% Damit dieser Trend anhält, sind aber bedeutende Investitionen in die kleinbäuerliche Landwirtschaft und in die ländliche Entwicklung von Nöten. Wirtschaftswachstum allein löst die Problematik der Unterernährung nicht von selbst Die Armen sollen aus Investitionen vermehrt Nutzen ziehen können Dabei ist die finanzielle Unterstützung der Agrarforschung für Produktionssteigerungen und für angepasste Technologien, die den Armen in der Landbewirtschaftung Wachstumschancen bieten, unabdingbar für den Erfolg an der Hunger- und Armutsfront
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 284
1996-98 2015 2030 1996-98 2015 2030 Anteil an der Bevölkerung Anzahl in % in Mio Länder Afrikas südlich der Sahara 34 22 15 186 184 165 Naher Osten / Nordafrika 10 86 36 38 35 Lateinamerika und Karibik 11 75 55 45 32 China und Indien 16 73 348 195 98 Restliches Asien 19 10 5 166 114 70 Entwicklungsländer 18 10 6 791 576 400 Quelle: FAO
■ Der Weg in die Zukunft Für die Beseitigung des Hungers gibt es nebst humanitären Gründen auch erhebliche wirtschaftliche Motive Die ökonomischen Kosten von Hunger und Mangelernährung sind hoch Unterernährung vermindert deutlich die körperliche Leistungsfähigkeit und die geistige Entwicklung, was sich in geringerer Produktivität niederschlägt. Sie zerstört nicht nur das Leben einzelner Menschen und ihrer Familien, sondern reduziert auch den Ertrag aus sozialen und ökonomischen Investitionen
Das Ausmass des Hungers
«Das Ausmass des Hungers oder das Nahrungsdefizit werden folgendermassen berechnet: Die durchschnittliche Nahrungsenergie, die unterernährte Menschen aus ihrer Nahrung erhalten, wird mit dem Mindestbedarf an Nahrungsenergie verglichen, den sie benötigen, um ihr Körpergewicht zu halten und leichte Tätigkeiten ausüben zu können.
Die tägliche Nahrung der meisten der 800 Mio chronisch hungernden Menschen weist einen Mangel von 100–400 Kcal auf Diese Menschen sterben nicht an Hunger Sie sind oft dünn, aber nicht stark abgemagert Der chronische Hunger fällt nicht immer sofort auf, denn der Körper kompensiert eine unzureichende Ernährung, die körperliche Aktivität sinkt und bei Kindern verlangsamt sich das Wachstum Abgesehen von der verstärkten Anfälligkeit für Krankheiten, bedeutet chronischer Hunger, dass Kinder teilnahmslos werden und sich in der Schule nicht mehr konzentrieren können, dass Mütter untergewichtige Kinder gebären und es Erwachsenen an Kraft fehlt, ihr volles Potential einsetzen zu können
Zahlenmässig gibt es in Asien und im pazifischen Raum mehr chronisch Hungernde, aber das Ausmass des Hungers ist eindeutig in den Ländern Afrikas südlich der Sahara am grössten In 46% der Länder südlich der Sahara liegt der durchschnittliche Nahrungsmangel bei den Unterernährten bei mehr als 300 Kcal pro Person und Tag. Im Vergleich dazu leiden in nur 16% der Länder Asiens oder des Pazifiks die Unterernährten an einem Nahrungsmangel dieses Ausmasses

Dort, wo das durchschnittliche Defizit an Kilokalorien sehr hoch ist, fehlt es in der Nahrung der Menschen an allem, einschliesslich eines genügenden Anteils an stärkehaltigen Grundnahrungsmitteln (Mais, Kartoffeln, Reis, Weizen und Maniok) Wo das Defizit weniger gross ist, verfügen die Menschen in der Regel über ausreichende Mengen von Grundnahrungsmitteln Bei ihnen mangelt es häufig an Nahrungsmitteln, die eine ausgewogene Ernährung sicherstellen: Hülsenfrüchte, Fleisch, Fisch, Öle, Milchprodukte, Gemüse und Obst, die neben Energie auch Proteine, Fett und Mikronährstoffe liefern Die Ernährung dieser Menschen abzurunden, ist notwendig, um Ernährungssicherheit zu erreichen.»
Quelle: FAO
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 285
Damit sich die Situation verbessert ist es entscheidend, die Armen in die Entwicklungsplanung mit einzubeziehen Traditionelle ländliche Entwicklungspolitik konzentrierte sich bisher darauf, Infrastruktur und Dienstleistungen zu verbessern Die Bedürfnisse der Armen wurden dabei zu wenig berücksichtigt, weil angenommen wurde, dass die Wachstumserträge schon zu ihnen durchsickern würden Die Erfahrung der FAO zeigt, dass kleine initiative Gruppen, deren Mitglieder ähnliche Ziele verfolgen, Wege aus Hunger und Armut finden
«Dringenden Handlungsbedarf gibt es in 82 Ländern mit niedrigem Einkommen und Nahrungsmangel Viele von ihnen sind entweder nicht in der Lage, alle benötigten Nahrungsmittel selbst zu produzieren, oder die Devisen aufzubringen, um die Einfuhr von Nahrung bezahlen zu können Viele dieser Staaten sind ausserdem stark verschuldet, die Schuldentilgung bindet die Mittel, die dringend für Investitionen in die Entwicklung benötigt werden. Die Schuldenlast erschwert es diesen Ländern, die Grundbedürfnisse der Benachteiligten zu befriedigen und ihnen ein Leben ohne Hunger zu ermöglichen »
Quelle: FAO
Allerdings gilt, dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die von Hunger und Unterernährung bedroht sind, je eigenständige Lösungsansätze anstreben müssen Diese kommen aber nur zum Tragen, wenn auf nationaler und internationaler Ebene jene ökonomischen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die Menschen befähigen, dem Hunger und der Armut durch eigene Initiative ein Ende zu bereiten Das Fundament zu diesem Fortschritt müssen die Entwicklungsländer im Verbund mit der internationalen Gemeinschaft legen, indem sie die eingegangenen Verpflichtungen, die im Aktionsplan des Welternährungs-Gipfels von 1996 enthalten sind, zielstrebig umsetzen.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 286
3.2 Internationale Vergleiche
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Welt beeinflussen in verstärktem Ausmass auch die schweizerische Landwirtschaft Das WTO-Agrarabkommen und das bilaterale Agrarabkommen mit der EU z B wirken sich direkt auf die Rahmenbedingungen für die Schweizer Landwirtschaft aus In diesem Zusammenhang können internationale Vergleiche Aufschluss geben über den Stand der Schweizer Landwirtschaft gegenüber der ausländischen Konkurrenz
Nachfolgend werden zunächst die im Agrarbericht 2000 begonnenen Preisvergleiche fortgeführt. Es werden ausgewählte Produzenten- und Konsumentenpreise im In- und Ausland einander gegenübergestellt und es wird gezeigt, wie die Entwicklungen in den letzten Jahren verlaufen sind Anschliessend werden diese Preisvergleiche noch umfassender unter dem Aspekt der Kaufkraftparität dargestellt. In einem weiteren Beitrag werden Ergebnisse von Buchhaltungsbetrieben der Schweiz mit jenen der EU verglichen

3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 ■■■■■■■■■■■■■■■■
287
■ Was erhalten die Produzentinnen und Produzenten?
Internationale Preisvergleiche
Die im letzten Jahr begonnenen Preisvergleiche werden auf der gleichen Basis fortgeführt. Ausgehend vom Schweizermarkt werden Vergleiche mit gleichen, ähnlichen oder wichtigen Märkten des Auslandes angestellt
Solche Preisvergleiche sind mit gewissen Schwierigkeiten verbunden Darunter fallen die Auswahl der Produkte, die Verfügbarkeit der Daten, die Relevanz der Messgrössen, die unterschiedlichen Produktions- und Verkaufsformen oder die währungsspezifischen Einflüsse Es stehen daher nicht die absoluten Werte im Vordergrund, sondern die Veränderungen im Verlaufe der Zeit
Die effektiv realisierten Produzentenerlöse bilden die Grundlage für den Vergleich Sie werden für alle Länder entsprechend der Zusammensetzung der Endproduktion in der Schweiz gewichtet Das Produktionsmuster der Schweiz wird so auf die Vergleichsländer übertragen Damit kann gezeigt werden, wie gross beispielsweise die relative Differenz zu den USA ist, wenn für unsere Landwirtschaft die amerikanischen Produzentenerlöse zugrunde gelegt werden
Die Zahlen der EU beziehen sich auf die vier umliegenden Länder (EU-4/6) Die Länder fünf und sechs betreffen die Niederlande und Belgien Sie werden bei den Kartoffeln und beim Gemüse zusätzlich miteinbezogen, weil diese beiden Länder in diesen Sektoren beachtliche Produktionsvolumina aufweisen Die Durchschnittsberechnung für die EU beruht auf den Produktionsanteilen der einbezogenen Länder am Gesamtausstoss dieser Ländergruppe. Die vier, respektive sechs Länder erzeugen zwischen 47 und 83% der jeweiligen gesamten EU-Produktionsmengen
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 288
ausgewählten Ländern CH EU-4/6 D F I A USA I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 1990/92 1998/2000 zu CH 1990/92 Quellen: SBV, BLW, Eurostat, ZMP (D), US Departement of Agriculture 0 100 90 70 80 60 40 50 30 20 10
Tabellen 47–48b, Seiten A55–A57 Entwicklung der Produzentenpreise: Schweiz in Relation zu
■ Was zahlen die Konsumentinnen und Konsumenten?
Der Abwärtstrend bei den Produzentenpreisen setzt sich fort. Diejenigen der Schweiz sind zwischen den beiden Beobachtungszeiträumen um 21% gefallen Zwischen 1999 und 2000 sind die Preise allerdings um 0,4 Prozentpunkte angestiegen Bei den umliegenden EU-Ländern ergibt sich eine Reduktion von 21% zwischen den beiden Beobachtungszeiträumen Der relative Abstand zwischen der Schweiz und der EU hat sich somit bei den betrachteten Produkten nicht verkleinert In absoluten Werten ist der Abstand allerdings beträchtlich geringer geworden Wenn unsere Bäuerinnen und Bauern den gleichen Warenkorb wie die umliegenden Länder produzieren und dort verkaufen würden, betrügen die Preise noch 53% der schweizerischen Die einzelnen Differenzen im Verhältnis zur Schweiz – für den Zeitraum 98/00 – sind allerdings beträchtlich: Konnten in Italien für die Kartoffeln mit einem Wert von 110% mehr als in der Schweiz gelöst werden, betrug der Produzentenerlös für die Karotten in Belgien nur 16% von demjenigen der Schweiz Für Raps und Weizen werden mit 26%, resp 25% ebenfalls sehr tiefe Werte ausgewiesen
Anders ist die Entwicklung in den USA verlaufen Die Produzentenpreise sind weiterhin im Steigen begriffen Allerdings ist dies primär auf den gestiegenen Dollarkurs zurückzuführen Die Differenz zu den USA ist zwischen den Beobachtungsräumen sowohl relativ als auch absolut kleiner geworden Für den gleichen Warenkorb betragen die Preise 47% derjenigen in der Schweiz.
Für diesen Vergleich wurden die Preisabstände zwischen der Schweiz und den einbezogenen Ländern gemäss dem alten Gewichtungsschema des schweizerischen Landesindex der Konsumentenpreise zusammengefasst Das schweizerische Konsumschema wird auf die anderen Länder umgelegt Nicht berücksichtigt werden die Unterschiede in den Kaufkraftparitäten und im Kostenumfeld
Entwicklung der Konsumentenpreise: Schweiz in Relation zu ausgewählten Ländern
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 289
CH EU-4/5 ø EU-tiefø EU-hoch USA I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 1990/92 1998/2000 zu CH 1990/92 Quellen: BFS, BLW, ZMP (D), Statistikämter Turin (I), F, B, A, USA 0 100 90 70 80 60 40 50 30 20 10
Tabellen 49–50, Seiten A58–A59
Bei der EU-4 handelt es sich wiederum um die umliegenden Länder Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien, wobei beim letzteren die Zahlen aus der Stadt Turin als Vergleichsbasis genommen wurden Beim Gemüse und bei fehlenden Zahlen aus den Nachbarländern wurde Belgien noch miteinbezogen. Daneben werden die jeweils in diesen vier, resp fünf Ländern festgestellten tiefsten und höchsten Preise zu je einer Gruppe zusammengefasst
Das Preisgefälle zwischen der Schweiz und der EU ist nicht so hoch, weil die Preisbildung in der Schweiz auch durch die importierten Güter beeinflusst wird
Die schweizerischen Konsumentenpreise der für diesen Vergleich ausgewählten Produkte sind zwischen den beiden Beobachtungszeiträumen 1990/92 und 1998/2000 um 4% gesunken Dieser Wert wurde schon im letzten Berichtsjahr für die Vergleichsperiode 1990/92 zu 1997/99 ausgewiesen In der EU dagegen beträgt die Reduktion 8%, gegenüber 7% im letzten Berichtsjahr. Der Abstand der Schweiz zu den umliegenden EU-Ländern betrug 1990/92 29% und ist für die Periode 1998/2000 auf 32% angestiegen Die Kluft zwischen der Schweiz und der EU wird bei den Konsumentenpreisen grösser Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bleiben aber enorm Während in der EU der Zucker generell und ein Teil der italienischen Milchprodukte mehr kosten als in der Schweiz sind die Schweinekoteletts in der EU nur halb so teuer.

Unsere Ergebnisse decken sich auch mit einer Erhebung, die die EU-Kommission im Rahmen ihrer Binnenmarktstudien in Auftrag gegeben hat. Es wurden die Preise innerhalb der EU für gleiche Güter im Zeitraum eines Jahres (August 1999 bis August 2000) miteinander verglichen Ein Warenkorb von elf Produkten kostet – inklusive Mwst – in Spanien Fr 28 –, in Dänemark Fr 48 – und im EU-Durchschnitt Fr 39 – Werden für diese Warenkorbberechnung schweizerische Preise eingesetzt, ergibt sich ein Wert von Fr. 65.–. Damit bewegt sich das Preisniveau der EU im Vergleich zu demjenigen der Schweiz bei 59% gegenüber unseren Berechnungen mit 67% für das Jahr 2000 Die Differenz erklärt sich dadurch, dass für unser Preisvergleich die Länder gemäss ihrem Anteil an den Konsumausgaben gewichtet wurden und nicht gemäss dem arithmetischen EU-Durchschnitt Zudem fehlen bei der Binnenmarktstudie die Werte für Österreich, das bei den vorliegenden Berechnungen hingegen mit einbezogen wurde
In den USA dagegen sind die Konsumentenpreise angestiegen, entsprechend ist das Gefälle zur Schweiz kleiner geworden Es beträgt noch 32% Hauptgrund ist allerdings der gestiegene Dollarkurs
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 290
■ Kaufkraftparität –ein Beispiel und eine Definition
Internationale Preisvergleiche mit Hilfe von Kaufkraftparitäten
Die Ausführungen des vorhergehenden Kapitels werden durch weitere Preisvergleiche ergänzt Damit kann gezeigt werden, dass die Ergebnisse je nach Umfang der mitberücksichtigten Daten wohl unterschiedlich ausfallen, aber in der Tendenz ähnlich sind
Eine Kaufkraftparität liegt dann vor, wenn der Wechselkurs so bestimmt wird, dass bei gegebenem Preisniveau in zwei Ländern die Kaufkraft der in- und ausländischen Währung gleich hoch ist Das heisst nichts anderes, als dass die Preise für dieselben Produkte gleich sind. Da dies aber in der Praxis üblicherweise nicht der Fall ist, gilt es die Abweichungen zu berechnen Eine einfache Möglichkeit für die approximative Berechnung von Kaufkraftparitäten besteht darin, ein Produkt zu wählen, dass auf der ganzen Welt erhältlich ist. Als das aus der englischen Zeitschrift «Economist» weltbekannte Beispiel wählen wir den Hamburger Ein Big Mac kann in 120 Ländern gekauft werden und ist in seiner Zusammensetzung immer gleich Er müsste daher auf der ganzen Welt gleich teuer sein
Hamburgerpreise im April 2001 für ausgewählte Länder
Land Preis in Preis in
Die Preisdifferenzen sind sehr gross In der Schweiz ist der Hamburger am teuersten, während der Preis in der EU um 38% und in den USA um 30% tiefer liegt Wäre der Hamburgerpreis repräsentativ für das schweizerische Preisniveau, ergäbe sich daraus, dass die Schweiz ein deutlich höheres Preisniveau als die EU und die USA aufweist
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 291
Landeswährung Dollar Schweizer im Vergleich Franken zur Schweiz $ Fr % CH Fr 6 30 3 65 6 30 100 EU Euro 2 57 2 27 3 92 62 - D DM 5 10 2 30 3 97 63 - F FF 18 50 2 49 4 30 68 - I Lit 4 300 1 95 3 37 53 - A öSch Keine Angaben USA US $ 2 54 2 54 4 38 70 Quelle:
Preis in Niveau
Economist
Die Kaufkraftparität kann – gemäss BFS – wie folgt umschrieben werden:
«Kaufkraftparitäten messen die reale Kaufkraft der einzelnen Währungen im gegenseitigen Vergleich Sie drücken das in den verschiedenen Landeswährungen gemessene Preisverhältnis zwischen gleichen Warenkörben (z B Hamburger oder eine Vielzahl von Produkten) zweier oder verschiedener Länder aus Die Kaufkraftparität gibt die Anzahl ausländischer Währungseinheiten an, mit denen man im Ausland eine gleiche Menge an Gütern kaufen kann, wie man im Inland für eine inländische Währungseinheit erhalten würde »
Bezogen auf den Hamburger-Vergleich kann die Definition wie folgt präzisiert werden: Ein Hamburger kostet in der Schweiz Fr 6 30 und in den USA $ 2 54 Das ergibt eine Kaufkraftparität von 0,4032 ($ 2.54 / Fr. 6.30), das heisst die Kaufkraft von einem Schweizerfranken ist gleich der Kaufkraft von 0 4032 US-Dollar in den USA Die Kaufkraftparität ist – anders ausgedrückt – der Umrechnungsfaktor zwischen zwei Währungen, der ohne den Umweg über Wechselkurse die reale Kaufkraft dieser zwei Währungen zueinander in Beziehung setzt Der Dollarkurs entspricht in diesem Fall einem Wert von Fr. 2.48 und nicht dem Wechselkurs von Fr. 1.73, so wie er Mitte April 2001 auf dem Devisenmarkt gehandelt worden ist
Die Berechnung der Kaufkraftparität auf der Basis des Hamburger-Preisvergleiches deutet auf eine Überbewertung des Schweizerfrankens am Devisenmarkt hin. Interessant ist die Tatsache, dass auch innerhalb der EU (Eurozone) grössere Differenzen auftreten, trotz der festen Wechselkurse und einer aufeinander abgestimmten Wirtschaftspolitik Dies deckt sich mit den Ergebnissen der im vorhergehenden Kapitel erwähnten Binnenmarktstudie der EU
Die Überbewertung des Schweizerfrankens, die sich aufgrund dieses Hamburgervergleiches zeigt, beträgt gegenüber dem Euro 38%, gegenüber dem US$ 30% und gegenüber dem britischen Pfund 22%. Der Vergleich ist allerdings auch mit gewissen Unzulänglichkeiten versehen, die sich durch Preisverzerrungen (Zölle oder andere Grenzschutzmassnahmen), Verbrauchssteuern oder Immobilienpreise ergeben Aus agrarpolitischer Sicht ist darauf zu verweisen, dass in den schweizerischen Hamburgerpreisen primär das Kosten-Umfeld der vor- und nachgelagerten Stufen reflektiert wird
Im Folgenden werden Preisniveauvergleiche auf der Basis des Konzeptes der Kaufkraftparität vorgestellt
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 292
Kaufkraft und Wechselkurs Stand 17 April 2001 1 Fr zu US$ 1 US$ zu Fr Kaufkraft gemäss Hamburgervergleich 0 4032 2 4803 Wechselkurs gemäss Notierung am Devisenmarkt 0 5822 1 7314
■ Kaufkraftparität und Preisniveauvergleich
Für internationale Vergleiche, bei denen auch die Schweiz mitmacht, werden eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, die die Grundlage für das Bruttoinlandprodukt bilden, zur Berechnung der Kaufkraftparität herangezogen Die Liste umfasst 3'000 bis 3'500 Produkte. Die EU erhebt diese Produkte rotierend in einem Zeitraum von drei Jahren, während die OECD alle drei Jahre eine vollständig neue Berechnung anstellt Bei der OECD war dies für 1996 und 1999 der Fall, wobei die Auswertungen für 1999 noch nicht vorliegen Als Behelfsgrösse rechnen sowohl die EU wie auch die OECD mit den entsprechenden Preisindizes, primär mit dem Konsumentenpreisindex Bei der Interpretation der folgenden Zahlenreihen ist diesen Einschränkungen Rechnung zu tragen

Auf der Basis der berechneten Kaufkraftparitäten können auf den verschiedensten Aggregationsstufen Preisindizes berechnet werden Im Folgenden werden diejenigen auf der Stufe Nahrungsmittel dargestellt Die letzten verfügbaren Zahlen stammen von Eurostat und beziehen sich auf das Jahr 1998. Der Schweizer Indexwert für Fleisch weist im EU-Vergleich die höchsten Werte auf und der Wert für Obst/Gemüse/Kartoffeln liegt am nächsten beim Durchschnitt Neben den ursprünglichen EU-Zahlen (EU=100) werden die Werte in dem Sinne umgerechnet, dass die Schweiz auf 100 indexiert wird, um einen Vergleich mit den Ergebnissen aus dem vorhergehenden Abschnitt zu ermöglichen.
Preisniveauindizes 1998 für Nahrungsmittel
Quellen: BFS, Eurostat
Werden die Ergebnisse für alle Nahrungsmittel denjenigen im Abschnitt «Internationale Preisvergleiche» gegenübergestellt, so zeigt sich, dass das Resultat praktisch identisch ist Die Differenz beträgt lediglich einen Indexpunkt (70 im Vergleich zu 69) Die Ursache dafür liegt in der Methodik. Der Warenkorb ist auf einige wenige Produkte beschränkt, die Daten werden für jedes Jahr neu berechnet und die EU-Länderliste bezieht sich nur auf die umliegenden Länder
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 293
Land Total Fleisch Obst, Gemüse, Nahrungsmittel Kartoffeln EU = 100 CH = 100 EU = 100 CH = 100 EU = 100 CH = 100 CH 142 100 172 100 132 100 EU 100 70 100 58 100 76 - D 106 75 117 68 107 81 - F 107 75 110 64 108 82 - I 98 69 94 55 97 73 - A 108 76 108 63 104 79 USA Keine Angaben
Preisniveauvergleich 2000 und Mai 2001 für den gesamten Warenkorb der Volkswirtschaft
Diese Zahlen widerspiegeln die Preisentwicklung der gesamten Wirtschaft eines Landes, und zwar gemessen am Bruttoinlandprodukt Der Anteil der Nahrungsmittel beträgt auf dieser Aggregationsstufe nur noch 7% Neben den Zahlen aus dem Berichtsjahr werden noch die aktuell verfügbaren vom Mai 2001 dargestellt, allerdings fehlt der Zusammenzug für die gesamte EU.
Die Zahlenreihe zeigt klar: je umfassender die Produktepalette, desto kleiner das Preisniveaugefälle zwischen der Schweiz und den Vergleichsländern. Der Vergleich zur EU verdeutlicht dies: Betrug die Differenz beim Hamburgerindex noch 38 Indexpunkte, sinkt sie für die Nahrungsmittel auf 30 und für das gesamte Bruttoinlandprodukt auf 21 Indexpunkte Für die USA liegen weniger Vergleichsdaten vor, allerdings haben die Wechselkursschwankungen einen grösseren Einfluss auf das Ergebnis Steigt der Dollarkurs von Fr. 1.30 auf Fr. 1.80 ergibt sich eine starke Annäherung an das schweizerische Preisniveau Dieser Effekt ist im Euro-Raum aufgrund der Währungspolitik der Schweizerischen Nationalbank weniger ausgeprägt
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 294
Land Preisniveauindex Preisniveauindex Jahr 2000 Mai 2001 CH = 100 CH = 100 CH 100 100 EU 79 - D 82 78 - F 83 76 - I 68 66 - A 80 78 USA 90 84 Quelle: OECD
■ Buchhaltungsnetz
INLB der EU Begriffe und Methoden, Seite A91
Schweizer Landwirtschaftsbetriebe im EU-Vergleich
Zur Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft spielen internationale Vergleiche eine wichtige Rolle. Solche Vergleiche sind aber nur mit einer geeigneten Datengrundlage möglich und sinnvoll Die EU-Kommission betreibt zusammen mit allen EU-Mitgliedstaaten ein Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB), das auf einer einheitlichen Methodik beruht Die FAT hat die Daten in der schweizerischen Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der Jahre 1996 –1998 gemäss der INLB-Methodik umgerechnet Damit stehen vergleichbare Ergebnisse zur Verfügung
Zwischen INLB und der zentralen Auswertung bestehen methodische Unterschiede Zu den wichtigsten Unterschieden, die bei der Umrechnung berücksichtigt werden müssen, gehören die Betriebsdefinition und -typologie, die Bewertung der Aktiven sowie die Definition der Grundgesamtheit und die Gewichtung der Ergebnisse
Die wichtigsten INLB-Standardvariablen
Bruttogesamterzeugung
+ Saldo Betriebsbeihilfen und -steuern (v a Direktzahlungen)
– Vorleistungen
= Bruttobetriebseinkommen
Abschreibungen
= Betriebseinkommen
– Insgesamt Fremdfaktoren (Löhne, Pachten, Zinsen)
+ Saldo aus Investitionsbeihilfen und –steuern
= Familienbetriebseinkommen
Quelle: EU-Kommission INLB
Das Familienbetriebseinkommen entschädigt die nichtentlohnten Familienarbeitskräfte und im Betrieb eingesetztes Eigenkapital, entspricht also begrifflich dem landwirtschaftlichen Einkommen in der Zentralen Auswertung
Die Standardvariable «Saldo Betriebsbeihilfen und -steuern» entspricht im Wesentlichen den Direktzahlungen der öffentlichen Hand In den Abbildungen weiter unten werden diese mit den «Investitionsbeihilfen und -steuern» als «Beihilfen und Steuern» zusammengefasst
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 295
–
■ Einkommen der Schweizer Betriebe über EU-Durchschnitt
Aufgrund der Datenverfügbarkeit beschränken sich die folgenden Analysen auf die Jahre 1996 bis 1998 Aktuellere EU-Daten werden laufend im Internet verfügbar gemacht (http://europa eu int/comm/agriculture/rica/index en cfm)
Mittlere Betriebsstrukturen in ausgewählten europäischen Ländern 1996/98
Die durchschnittliche Fläche liegt in der Schweiz deutlich unter dem Niveau der Nachbarländer und der EU (15) (Mittelwert aller 15 EU-Mitgliedsländer). Die Tierbestände sind mit Österreich und dem EU-Mittel vergleichbar Die eingesetzte Arbeit weicht nur unwesentlich von den Nachbarländern ab, liegt aber über dem EU-Mittel
Obwohl die Schweizer Betriebe kleiner sind, ist die Bruttoerzeugung sowie die Summe von Bruttoerzeugung und «Beihilfen und Steuern» (v a Direktzahlungen) mit derjenigen deutscher und französischer Betriebe vergleichbar. Die tierische Bruttoerzeugung und die Direktzahlungen sind in der Schweiz am bedeutendsten Der Anteil «Beihilfen und Steuern» liegt in Österreich bei 22%, in der Schweiz bei 20%, in Deutschland und Frankreich sowie im Mittel der EU-Länder um 13% bis 14%
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 296
CH DFA EU (15) Arbeitskräfte insgesamt in Jahresarbeitseinheiten (JAE) 1,86 1,99 1,79 1,91 1,50 Nicht entlohnte Arbeitskräfte (JAE) 1,38 1,47 1,44 1,81 1,23 Landwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 19,7 53,1 63,9 24,8 31,3 Gesamtviehbestand in Vieheinheiten (VE) 28,9 57,6 52,2 25,3 27,3 Quellen: EU-Kommission, INLB, FAT
Bruttoerzeugung und Beihilfen 1996/98
E C U / B e t r i e b
CH D F A EU (15)
Quellen: EU-Kommission, FAT 1 ECU = 1.61 Fr
0 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Beihilfen und Steuern Sonstige Bruttoerzeugung
Tierische Bruttoerzeugung Pflanzliche Bruttoerzeugung
Die Schweizer Betriebe schneiden auf der Aufwandseite verhältnismässig gut ab, so dass ein Familienbetriebseinkommen resultiert, das deutlich über dem entsprechenden Wert in den ausgewählten Ländern und über dem EU-Mittelwert liegt Bei der Interpretation muss beachtet werden, dass die schweizerischen Betriebe bezogen auf das mengenmässige Produktionsvolumen gegenüber den deutschen und französischen Betrieben deutlich kleiner sind Somit verdienen Schweizer Betriebe trotz kleinen Strukturen Einkommen, die im europäischen Vergleich überdurchschnittlich sind Die besseren Einkommen müssen allerdings durch die Tatsache relativiert werden, dass die Kaufkraft eines ECU in der Schweiz um 20–30% tiefer ist als in den Vergleichsländern

3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 297
Aufwand und Familienbetriebseinkommen 1996/98 CH D F A EU (15) E C U / B e t r i e b Fremdfaktoren Abschreibungen Quellen: EU-Kommission, FAT 1 ECU = 1,61 Fr Vorleistungen Familienbetriebseinkommen 0 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
■ Vergleich ähnlich grosser Milchbetriebe
Der Vergleich zwischen ähnlich grossen Milcherzeugungsbetrieben zeigt, wie Schweizer Betriebe mit vergleichbaren strukturellen Voraussetzungen im internationalen Vergleich dastehen Für den Vergleich werden Betriebe mit einer Fläche zwischen 30 und 50 ha ausgewählt.
Um den Effekt der erschwerenden Produktionsbedingungen im Berggebiet sichtbar zu machen, werden für die Schweiz die Betriebe in der Tal- und der Hügelregion separat dargestellt Zum Vergleich werden INLB-Regionen herangezogen, in denen die Milchproduktion eine grosse Bedeutung hat Neben Bayern und Schleswig-Holstein wird auch die französische Region Rhônes-Alpes betrachtet, die neben dem Alpengebiet auch Teile des Rhonetals umfasst Für Österreich sind nur auf nationaler Ebene Daten verfügbar.
Bei dieser stark eingeschränkten Auswahl der Betriebe muss berücksichtigt werden, dass diese in der Schweiz und Österreich im Vergleich zu allen Milcherzeugungsbetrieben überdurchschnittlich gross sind, während sie in Deutschland etwa dem nationalen Mittel entsprechen Die Betriebe der Region Rhônes-Alpes sind deutlich kleiner als der mittlere französische Milcherzeugungsbetrieb
Der hohe Arbeitseinsatz in der Schweiz von über zwei Arbeitskräften wird gerade noch in österreichischen Betrieben erreicht Angestellte kommen in den Betrieben der EUVergleichsregionen kaum vor, machen in den Schweizer Betrieben aber 0,7 bis 0,9 Arbeitskräfte aus Die Milchleistung je Kuh ist in der Schweiz eher überdurchschnittlich
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 298
Betriebsstrukturen (30–50
CH CH Bayern Schleswig- Rhônes- A Alle Tal- und Holstein Alpes Regionen Hügelregion Vertretene Betriebe 2 747 1 437 12 072 1 656 3 125 3 282 Arbeitskräfte insgesamt (JAE) 2,3 2,5 1,6 1,5 1,5 2,4 Nicht entlohnte Arbeitskräfte (JAE) 1,6 1,6 1,6 1,3 1,5 2,3 Landwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 36,5 36,1 37,1 41,0 39,3 35,8 Gesamtviehbestand (VE) 42,9 51,7 56,8 72,4 39,4 38,0 Milchkühe (VE) 23,6 28,0 31,4 36,2 26,5 22,3 Milchleistung (kg/Kuh) 5 905 6 120 5 500 5 879 5 357 5 269 Milchproduktion (kg) 139 600 171 500 172 900 212 500 142 000 117 400 Quellen: EU-Kommission INLB FAT
ha LN) spezialisierter Milcherzeugungsbetriebe 1996/98
Hoher Arbeitseinsatz in Schweizer Milchbetrieben
■
■ Bruttoerzeugung und Direktzahlungen in Schweizer Milchbetrieben wesentlich höher
Bei ähnlicher Betriebsstruktur erwirtschaften die Schweizer Betriebe aus der landwirtschaftlichen Produktion die 1,5 bis 2-fache Bruttoerzeugung der EU-Vergleichsbetriebe Dazu kommen noch Direktzahlungen, die mit rund 40‘000 ECU auch von Österreich mit 21‘000 ECU nicht annähernd erreicht werden. Die analysierten deutschen und französischen Betriebe kommen auf Direktzahlungen von 6‘000 bis 13‘000 ECU
Bruttoerzeugung und Beihilfen Milchbetriebe 1996/98

■ Aufwand in Schweizer Milchbetrieben rund doppelt so hoch
Auch beim Aufwand unterscheiden sich die Schweizer Betriebe deutlich von ihren Nachbarn Bei allen dargestellten Aufwandpositionen liegen die beiden Gruppen mit Schweizer Betrieben deutlich über den EU-Vergleichsgruppen. Am stärksten stechen die Lohnkosten ins Auge, die bei EU-Betrieben dieser Grösse kaum vorkommen Auch die Kosten für Pacht- und Schuldzinsen sind in der Schweiz absolut betrachtet überdurchschnittlich. Der Anteil gepachteter Flächen liegt bei den Schweizer Betrieben bei rund 60% und wird nur durch die Betriebe in der Region Rhônes-Alpes übertroffen, wobei die Pachtkosten in den französischen Betrieben vergleichsweise gering sind Die deutschen Betriebe weisen Pachtanteile zwischen 40% und 50% aus, die österreichischen Betriebe liegen bei einem Drittel Der Aufwand für Unterhalt von Gebäude und Reparaturen beträgt in den untersuchten Schweizer Betrieben mindestens das Doppelte der deutschen und österreichischen Nachbarn, verglichen mit der französischen Region sogar das Vierfache Die bayerischen Betriebe erreichen bei den Abschreibungen fast das schweizerische Niveau, während die anderen Regionen deutlich tiefer liegen
Der Gesamtaufwand (Vorleistungen, Abschreibungen, Fremdfaktoren) erreicht in den französischen und österreichischen Betrieben nur 40% des Gesamtaufwandes der schweizerischen Tal- und Hügelbetriebe Die deutschen Betriebe liegen bei rund 60% des schweizerischen Wertes
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 299
CH Alle Regionen CH Tal-/ Hügelregion Bayern Schleswig Holstein RhônesAlpes A E C U / B e t r i e b Beihilfen und Steuern Sonstige Bruttoerzeugung Pflanzliche Bruttoerzeugung Quellen: EU-Kommission FAT 1 ECU = 1.61 Fr Tierische Bruttoerzeugung ohne Milch Bruttoerzeugung Kuhmilch und übrige Milch 0 200 000 160 000 180 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Diese massiven Kostenunterschiede sind nicht durch die Betriebsgrösse erklärbar, da Betriebe ähnlicher Grösse verglichen werden Höhere Preise sind beispielsweise bei den Futtermitteln im Wesentlichen für die Mehrkosten in schweizerischen Betrieben verantwortlich. Bei anderen Aufwandspositionen dürften aber die höheren Einsatzmengen ausschlaggebend sein Vor allem bei der Arbeit, beim eingesetzten Fremdkapital und beim Gebäude- und Maschinenunterhalt fällt dies auf Sicher sind auch topographische und klimatische Voraussetzungen sowie Umwelt- und Tierschutzauflagen mitverantwortlich für den höheren Produktionsaufwand in der Schweiz Die grossen Differenzen, z.B. zu Österreich, können damit aber nicht vollständig erklärt werden
Die Differenz von Bruttoerzeugung inkl Beihilfen und Gesamtaufwand ergibt das Familienbetriebseinkommen Liegt dieses bei den Schweizer Betrieben bei 44‘000 bzw fast 50‘000 ECU, so erreichen die Österreicher Betriebe dank vergleichsweise geringen Kosten noch 40‘000 ECU, während die anderen Gruppen zwischen 19‘000 und 24‘000 ECU erzielen Beim Quervergleich ist zu berücksichtigen, dass die österreichischen Betriebe rund 2,3 nicht entlohnte Arbeitskräfte ausweisen, während in allen anderen Regionen und in der Schweiz das Familienbetriebseinkommen zwischen 1,3 und 1,6 nicht entlohnte Arbeitskräfte
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 300
entschädigt.
1996/98 CH Alle Regionen CH Tal-/ Hügelregion Bayern Schleswig Holstein RhônesAlpes A E C U / B e t r i e b Pacht, Zinsen Gezahlte Löhne Abschreibungen Andere Vorleistungen Quellen: EU-Kommission, FAT 1 ECU = 1.61 Fr Unterhalt Gebäude und Maschinen Futter für Raufutterfresser Familienbetriebseinkommen 0 200 000 160 000 180 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 ■ Schweizer Familienbetriebseinkommen an der Spitze
Aufwand
und Familienbetriebseinkommen Milchbetriebe
301
Mitarbeit am Agrarbericht 2001
■ Projektleitung, Werner Harder
Sekretariat
■ Autoren
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Bedeutung und Lage der Landwirtschaft
Landwirtschaft als Teil der Volkswirtschaft
Alessandro Rossi
Märkte
Ursula Gautschi (Koordination), Andreas Berger, Anders Gautschi, Jean Girardin, Simon Hasler, Katja Hinterberger, Thomas Meier, Beat Ryser
Wirtschaftliche Lage
Vinzenz Jung
Soziales
Esther Muntwyler
Ökologie
Brigitte Decrausaz (Koordination), Rhea Beltrami, Anton Candinas, Olivier Félix, Michel Fischler, Heinz Hänni, Esther Muntwyler
Beurteilung der Nachhaltigkeit
Vinzenz Jung
■ Agrarpolitische Massnahmen
Produktion und Absatz
Ursula Gautschi (Koordination)
Übergreifende Instrumente
Friedrich Brand, Jean-Marc Chappuis, Emanuel Golder, Simon Hasler, Samuel Heger, Niklaus Olibet, Marco Vanazzi
Milchwirtschaft
Katja Hinterberger
Viehwirtschaft
Simon Hasler
Pflanzenbau
Thomas Meier, Frédéric Rothen, Beat Ryser
302
Direktzahlungen
Thomas Maier (Koordination), Hanspeter Berger, Viktor Kessler, Daniel Meyer, Hugo Roggo, Olivier Roux, Beat Tschumi, Peter Zbinden
Grundlagenverbesserung
Strukturverbesserungen
René Weber (Koordination), Jörg Amsler, Willi Riedo, Andreas Schild
Forschung, Beratung, Berufsbildung, Gestüt
Fabio Cerutti, Hans Marthaler, Anton Stöckli
Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz
Martin Huber, Alfred Klay, Hansjörg Lehmann, Jean-Daniel Tièche
Tierzucht
Karin Wohlfender
Weiterentwicklung der Agrarpolitik
Markus Wildisen, Marc Zuber
■ Internationale Aspekte
Niklaus Olibet (Koordination)
Internationale Entwicklungen
Vinzenz Jung, Anton Kohler, Niklaus Olibet, Hubert Poffet, Daniel Zulauf
Internationale Vergleiche
Vinzenz Jung, Niklaus Olibet
■ Übersetzungsdienste Deutsch: Yvonne Arnold
Französisch: Christiane Bokor, Pierre-Yves Barrelet, Yvan Bourquard, Giovanna Mele, Paule Valiquer, Magdalena Zajac
Italienisch: Patrizia Vanini, Simona Stückrad
■ Internet Denise Vallotton
■ Technische Unterstützung Hanspeter Leu, Peter Müller
303
304
A N H A N G A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Anhang Tabellen Strukturen A2 Tabellen Märkte A4 Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse A14 Tabellen Ausgaben des Bundes A27 Tabellen Internationale Aspekte A55 Karten Direktzahlungen A60 Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft A72 Begriffe und Methoden A75 Abkürzungen A93 Literatur A95
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Strukturen
A2 A N H A N G Tabelle 1 Landwirtschaftsbetriebe, Landwirtschaftliche Nutzfläche und Grossvieheinheiten Grössenklassen in ha Betriebe Landwirtschaftliche Nutzfläche Grossvieheinheiten landwirtschaftlicher Nutzfläche 1990 1996 2000 1990 1996 2000 1990 1996 2000 Anzahl Anzahl Anzahl ha ha ha Anzahl Anzahl Anzahl 0-1 6 629 5 054 3 609 2 895 2 123 1 336 82 550 54 588 61 016 1-3 13 190 7 113 4 762 23 828 12 614 8 861 34 466 22 522 14 753 3-5 8 259 6 926 5 393 32 243 27 004 21 348 42 473 34 355 27 714 5-10 18 833 15 148 13 149 141 403 113 654 99 056 209 784 156 778 127 361 10-15 18 920 15 907 13 812 233 888 197 421 171 817 341 563 273 225 230 628 15-20 12 710 11 970 11 172 218 771 207 194 193 856 290 523 268 163 247 517 20-25 6 677 7 248 7 244 147 772 161 294 161 311 173 896 187 984 191 057 25-30 3 364 4 143 4 430 91 271 112 886 121 005 97 680 120 265 130 901 30-40 2 674 3 669 4 168 90 726 124 930 142 266 87 709 119 097 142 628 0 40-50 875 1 351 1 591 38 672 59 904 70 501 32 214 50 956 61 914 50-70 507 728 921 28 849 41 226 52 672 23 172 32 761 42 707 70-100 127 166 209 10 371 13 287 17 021 7 414 9 490 13 290 > 100 50 56 77 7 802 9 339 11 444 6 315 6 005 8 025 Total 92 815 79 479 70 537 1 068 490 1 082 876 1 072 492 1 429 759 1 336 189 1 299 511 Quelle: BFS
Tabelle 2
Entwicklung der Anzahl Beschäftigte in der Landwirtschaft
A N H A N G A3
Kategorie Vollzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte Total 1990 1996 2000 1990 1996 2000 1990 1996 2000 Betriebsleiter Männer 62 720 59 560 49 339 26 169 20 831 25 385 88 889 80 391 74 724 Frauen 1 456 1 505 524 2 470 1 375 1 822 3 926 2 880 2 346 Andere Familieneigene Männer 21 796 13 828 8 749 22 729 25 118 18 212 44 525 38 946 26 961 Frauen 14 367 22 043 14 281 65 770 36 634 47 665 80 137 58 677 61 946 Familieneigene total 100 339 96 936 72 893 117 138 83 958 93 084 217 477 180 894 165 977 Familienfremde Schweizer/innen Männer 12 453 11 435 10 836 2 949 6 188 5 125 15 402 17 623 15 961 Frauen 3 200 2 851 2 592 3 304 4 976 4 194 6 504 7 827 6 786 Ausländer/innen Männer 10 910 8 726 8 061 1 758 4 949 3 454 12 668 13 675 11 515 Frauen 663 1 528 1 613 847 3 602 1 941 1 510 5 130 3 554 Familienfremde total 27 226 24 540 23 102 8 858 19 715 14 714 36 084 44 255 37 816 Beschäftigte total 127 565 121 476 95 995 125 996 103 673 107 798 253 561 225 149 203 793 Quelle: BFS
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Märkte
A4 A N H A N G
Tabelle 3 Landwirtschaftliche Nutzfläche nach Nutzungsarten Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1 1990/92–1998/2000 ha ha ha ha % Getreide 207 292 186 867 182 257 182 669 -11 3 Brotgetreide 102 840 100 962 97 542 99 259 -3 5 Weizen 96 173 95 917 92 861 94 109 -2 0 Dinkel 2 160 1 542 1 221 1 467 -34 7 Roggen 4 432 3 367 3 433 3 643 -21 5 Mischel von Brotgetreide 75 136 27 41 -9 3 Futtergetreide 104 453 85 905 84 715 83 411 -18 9 Gerste 59 695 49 020 48 942 45 741 -19 8 Hafer 10 434 7 198 5 866 5 067 -42 1 Mischel von Futtergetreide 238 540 211 291 45 9 Körnermais 25 739 21 046 21 647 22 006 -16 2 Triticale 8 347 8 101 8 049 10 306 5 7 Hülsenfrüchte 2 258 2 866 2 950 2 892 28 5 Futtererbsen (Eiweisserbsen) 2 112 2 468 2 680 2 581 22 0 Ackerbohnen 146 398 270 275 114 8 Lupinen 36Hackfrüchte 36 385 34 183 34 429 34 775 -5 3 Kartoffeln (inkl Saatgut) 18 333 13 883 13 740 14 153 -24 0 Zuckerrüben 14 308 16 675 17 450 17 725 20 8 Futterrüben (Runkeln, Halbzuckerrüben) 3 744 3 625 3 239 2 897 -13 1 Ölsaaten 18 203 19 449 18 914 17 618 2 5 Raps 16 730 15 169 14 865 13 112 -14 0 Sonnenblumen - 1 396 1 776 3 554Soja 1 474 2 884 2 273 952 38 2 Nachwachsende Rohstoffe - 1 631 1 728 1 413Raps - 1 531 1 576 1 231Andere (Kenaf, Hanf, usw ) - 100 152 182Freilandgemüse 8 250 8 076 8 189 8 459 -0 1 Silo- und Grünmais 38 204 40 997 40 475 40 486 6 4 Grün- und Buntbrache 319 4 375 3 424 2 510 978 3 Übrige offene Ackerfläche 830 917 1 581 1 725 69 5 Offenes Ackerland 311 741 299 361 293 947 292 548 -5 3 Kunstwiesen 94 436 113 116 115 933 115 490 21.6 Übrige Ackerfläche 3 977 2 967 3 009 2 920 -25 4 Ackerland Total 410 154 415 444 412 889 410 958 0 7 Obstbaumkulturen 7 162 7 210 7 172 6 984 -0 6 Reben 14 987 14 991 15 042 15 058 0 3 Chinaschilf 3 274 260 267 8800 0 Naturwiesen, Weiden 638 900 632 428 626 799 629 416 -1 5 Andere Nutzung sowie Streue- und Torfland 7 394 8 058 9 737 9 809 24 4 Landwirtschaftliche Nutzfläche 1 078 600 1 078 405 1 071 899 1 072 492 -0 4 1 provisorisch Quellen: SBV, BFS
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1997/2000
Quellen:
Milch und -produkte: SBV (1990–98) ab 1999 TSM
Fleisch: Proviande
Eier: GalloSuisse Getreide, Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV, alle Mengen 2000 provisorisch
Obst: Schweizerischer Obstverband
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein: BLW Kantone
A N H A N G A5 Tabelle 4 Produktion Produkt Einheit 1990/1992 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Milch und -produkte Konsummilch t 549 810 488 486 438 000 508 918 -13 0 Rahm t 68 133 66 400 70 400 67 770 0 1 Butter t 38 766 40 800 37 238 36 611 -1 4 Milchpulver t 35 844 34 468 35 534 42 361 4 5 Käse t 134 400 136 800 134 306 167 382 8 8 Fleisch und Eier Rindfleisch t SG 130 710 110 788 110 435 95 700 -19 2 Kalbfleisch t SG 36 656 36 715 36 419 32 619 -3 8 Schweinefleisch t SG 266 360 231 574 225 657 224 901 -14 6 Schaffleisch t SG 5 065 6 078 6 316 5 528 18 0 Ziegenfleisch t SG 541 514 494 550 -3 9 Pferdefleisch t SG 1 212 1 353 1 196 1 265 4 9 Geflügel t Verkaufsgewicht 20 733 25 608 26 367 28 406 29 2 Schaleneier Mio St 638 691 680 652 5 6 Getreide Weichweizen t 546 733 594 098 489 813 561 200 0 3 Roggen t 22 978 22 306 18 538 22 400 -8 3 Gerste t 341 774 329 732 254 093 274 100 -16 3 Hafer t 52 807 39 855 27 996 26 300 -40 6 Körnermais t 211 047 191 813 194 321 212 400 -5 5 Triticale t 43 940 51 048 43 779 64 100 20 6 Andere t 11 469 12 123 6 678 9 000 -19 2 Hackfrüchte Kartoffeln t 833 333 560 000 484 000 600 636 -34 2 Zuckerrüben t 925 867 1 126 125 1 187 334 1 409 959 34 1 Ölsaaten Raps t 46 114 47 167 38 376 39 060 -9 9 Andere t 3 658 11 604 12 552 15 267 259 2 Obst (Tafel) Äpfel t 91 503 1 100 936 90 161 103 693 5 5 2 Birnen t- 15 437 14 808 16 081Aprikosen t 3 407 1 3 144 2 341 2 845 -28 6 2 Kirschen t 1 818 1 2 142 942 2 205 -21 0 2 Zwetschgen t 2 837 1 2 803 2 397 2 369 -13 9 2 Erdbeeren t 4 263 5 162 5 065 5 111 19 9 Gemüse (frisch) Karotten t 49 162 55 145 57 746 51 389 11 4 Zwiebeln t 23 505 24 468 27 529 27 368 12 6 Knollensellerie t 8 506 8 752 8 686 10 093 7 9 Tomaten t 21 830 29 951 27 384 30 932 34 8 Kopfsalat t 18 821 20 110 15 877 17 086 -6 0 Blumenkohl t 8 331 7 509 6 666 6 701 -16 5 Gurken t 8 608 9 076 8 881 8 371 2 0 Wein Rotwein hl 550 276 547 620 591 410 605 975 5 7 Weisswein hl 764 525 624 621 718 256 669 746 -12 2
A6 A N H A N G Tabelle 5 Produktion Milchprodukte Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Total Käse 134 400 136 800 134 306 167 382 8 8 Frischkäse 4 387 11 343 13 093 35 101 352 4 Mozzarella - 8 495 9 634 11 582Übrige Frischkäse - 2 848 3 459 23 519Weichkäse 4 812 5 230 5 851 6 618 22 6 Tommes 1 249 1 694 1 054 737 -7 0 Weissschimmelkäse, halb- bis vollfett 1 573 1 191 1 909 2 141 11 1 Übrige Weichkäse 1 990 2 345 2 888 3 740 50 3 Halbhartkäse 40 556 41 492 44 293 45 928 8 3 Appenzeller 8 725 8 664 8 878 8 813 0 7 Tilsiter 7 736 6 385 6 103 6 260 -19 2 Raclettekäse 9 898 11 033 11 123 12 993 18 4 Übrige Halbhartkäse 14 197 15 410 18 189 17 862 20 8 Hartkäse 84 629 78 727 70 824 79 240 -9 9 Emmentaler 56 588 47 988 41 637 45 325 -20 5 Gruyère 22 464 25 776 24 566 26 209 13 6 Sbrinz 4 659 3 713 3 090 3 303 -27 7 Übrige Hartkäse 918 1 250 1 531 4 403 160 9 Spezialprodukte 1 15 8 245 494 1560 0 Total Frischmilchprodukte 680 822 625 702 612 900 697 769 -5 2 Konsummilch 549 810 488 486 438 000 508 918 -13 0 Übrige 131 012 137 216 174 900 188 851 27 5 Total Butter 38 766 40 800 37 238 36 611 -1.4 Vorzugsbutter 27 200 34 400 33 222 7 142 -8 4 Übrige 11 566 6 400 4 016 29 469 14 9 Total Rahm 68 133 66 400 70 400 67 770 0 1 Total Milchpulver 35 844 34 468 35 534 42 361 4 5 1 reiner Schafkäse und reiner Ziegenkäse Quellen: SBV, TSM Tabelle 6 Verwertung der vermarkteten Milch Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 1 000 t Milch 1 000 t Milch 1 000 t Milch 1 000 t Milch % Konsummilch 549 488 438 462 -15 7 Verarbeitete Milch 2 490 2 594 2 633 2 714 6 3 zu Käse 1 531 1 545 1 503 1 410 -2 9 zu Butter 356 402 337 459 12 2 zu Rahm 430 438 460 252 -10 9 andere Milchprodukte 173 209 333 593 118 7 Total 3 039 3 082 3 071 3 176 2.3 Quellen: SBV TSM
1 Brotgetreideverwertung pro Kalenderjahr
2 Durchschnitt der Jahre 1990/93
3 Veränderung 1990/93–1997/2000
4 entsprechende Zahlen sind erst im Jahr 2002 verfügbar
5 Veränderung 1990/93–1996/99
Quellen:
Brotgetreide: BLW
Kartoffeln: Eidgenössische Alkoholverwaltung, swisspatat
Mostobst: BLW; Spirituosen: Eidgenössische Alkoholverwaltung
Verarbeitungsgemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
A N H A N G A7 Tabelle 7 Verwertung der Ernte im Pflanzenbau Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Brotgetreide 1 Übernahme Bund 569 000 576 799 460 894 547 100 -7 2 Lagerveränderung - 26 333 - 18 100 - 11 800 0 -62 2 Menschliche Ernährung 399 000 394 700 389 700 391 900 -1 7 Verfütterung 196 333 199 400 171 400 155 200 -10 7 Kartoffeln Speisekartoffeln 285 300 173 400 170 700 167 600 -40 2 Veredlungskartoffeln 114 700 121 400 121 900 120 900 5 8 Saatgut 35 933 22 300 27 000 31 200 -25 3 Frischverfütterung 225 967 208 100 8 181 600 -42 5 Verarbeitung zu Futtermitteln 146 900 27 900 23 400 76 000 -71 1 Schweizer Mostäpfel und -birnen (Verarbeitung in gewerblichen Mostereien) 183 006 2 315 803 103 609 256 352 3 8 3 Mostobst-Menge für Rohsaft 182 424 2 315 575 103 172 256 143 4 0 3 Frisch ab Presse 10 477 2 8 429 7 620 8 621 -23 9 3 Obstwein zur Herstellung von Obstbrand 3 297 2 3 539 548 806 -59 6 3 Konzentratsaft 165 263 2 295 775 92 398 246 482 6 9 3 Andere Säfte (inkl Essig) 3 387 2 7 832 2 606 234 9 7 3 Obst eingemaischt 582 2 228 437 209 -53 8 3 Spirituosenerzeugung aus Schweizer Äpfel und Birnen 40 255 2 39 876 23 458 4 -23 3 5 aus Schweizer Kirschen und Zwetschgen 23 474 2 23 678 11 938 4 -26 3 5 Schweizer Frischgemüse für Nährmittelherstellung Tiefkühlgemüse 26 061 22 004 26 855 26 209 -4 0 Konservengemüse (Bohnen, Erbsen, Pariserkarotten) 19 776 12 190 15 258 15 770 -27 2 Sauerkraut (Einschneidekabis) 8 091 6 101 5 894 6 885 -22 2 Sauerrüben (Rübe) 1 535 1 221 1 182 1 117 -23 6
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1997/2000
Milch und -produkte, Eier, Getreide, Hackfrüchte, Ölsaaten, Obst, Gemüse und Wein: OZD
Fleisch: Proviande
Zucker: Treuhandstelle Schweizerischer Lebensmittelimporteure
A8 A N H A N G Tabelle 8 Aussenhandel Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Milch und -produkte Milch 19 23 007 46 22 988 30 22 795 24 23 017 72 7 -0 3 Joghurt 1 195 17 925 78 1 156 110 2 694 101 33 2 466 7 Rahm 909 25 1 523 8 1 559 6 1 509 166 68 4 137 2 Butter 0 4 154 0 4 136 17 4 987 31 7 370 - 32 3 Milchpulver 8 158 3 266 2 884 4 289 17 768 2 584 13 992 1 606 41 6 -13 5 Käse 62 483 27 328 56 474 30 548 63 359 31 208 53 880 30 829 -7 3 12 9 Fleisch und Eier Rindfleisch 1 994 9 668 3 527 8 973 3 954 9 601 2 645 12 824 69 3 8 3 Kalbfleisch 0 916 0 586 0 1 345 0 2 007 - 43 4 Schweinefleisch 1 055 4 185 806 14 543 1 064 15 167 780 15 653 -16 3 261 3 Schaffleisch 5 6 093 0 6 157 0 5 611 0 7 616 -100 0 6 0 Ziegenfleisch 0 403 0 503 0 413 0 453 - 13 1 Pferdefleisch 0 4 609 0 4 041 0 3 884 0 3 922 - -14 3 Geflügel 8 35 238 302 39 962 448 37 562 324 38 348 4569 6 9 6 Eier 0 31 401 0 22 589 0 23 281 0 23 579 - -26 3 Getreide Weizen 6 232 134 49 184 617 86 249 619 25 298 922 738 7 5 3 Roggen 0 3 057 75 2 261 0 10 233 3 10 435 - 150 1 Gerste 436 44 504 141 22 893 1 11 491 0 74 732 -89 1 -18 3 Hafer 131 60 885 1 555 38 624 0 23 411 0 45 863 295 9 -40 9 Körnermais 194 60 512 70 47 523 78 29 428 68 24 981 -62 9 -43 9 Hackfrüchte Kartoffeln 9 695 8 722 1 647 16 336 1 702 42 361 818 39 142 -85 7 273 9 Zucker 41 300 124 065 91 068 109 063 119 084 137 404 140 971 178 106 183 4 14 1 Ölsaaten Ölsaaten 453 135 456 834 151 083 830 135 408 923 136 229 90 1 4 0 Pflanzliche Öle und Fette 18 680 57 765 13 227 83 636 15 426 84 021 18 127 86 735 -16 5 46 8 Obst (frisch) Äpfel 683 1 12 169 1 185 9 385 3 125 6 295 367 9 164 86 8 2 -30 9 2 Birnen 491 1 11 803 1 178 10 671 369 8 529 141 7 857 -53 9 2 -22 2 2 Aprikosen 226 1 10 578 1 56 8 866 3 12 199 62 9 322 -81 4 2 1 2 2 Kirschen 256 1 1 062 1 269 924 7 1 567 22 1 134 -68 4 2 19 5 2 Zwetschgen und Pflaumen 12 1 3 290 1 53 3 241 0 4 678 0 4 370 25 0 2 25 0 2 Erdbeeren 150 11 023 12 11 880 11 11 823 23 11 576 -89 8 6 7 Trauben 23 33 691 3 35 034 0 36 969 10 39 888 -81 4 10 7 Zitrusfrüchte 161 135 780 21 129 626 49 122 668 11 124 099 -83 2 -7 6 Bananen 85 77 896 1 72 684 0 74 554 0 72 334 -99 6 -6 0 Gemüse (frisch) Karotten 71 1 710 0 7 140 185 5 867 21 6 089 -3 3 272 2 Zwiebeln 862 3 444 1 8 257 3 5 644 0 4 756 -99 8 80 6 Knollensellerie 0 206 0 56 0 831 0 119 0 0 62 5 Tomaten 402 35 700 1 39 772 56 42 138 41 42 392 -91 9 16 1 Kopfsalat 37 3 954 0 2 575 1 3 244 0 2 453 -99 1 -30 3 Blumenkohl 11 9 985 14 9 331 0 9 503 3 9 261 -50 0 -6 2 Gurken 65 17 479 19 17 050 0 17 996 2 17 225 -89 2 -0 3 Wein (Trinkwein) Rotwein (in hl) 3 499 1 494 294 7 992 1 480 708 8 814 1 474 733 7 470 1 424 552 131 3 -2 3 Weisswein (in hl) 7 590 76 835 5 260 168 542 4 681 175 844 5 174 177 643 -33 6 126 5
Quellen:
A N H A N G A9 Tabelle 9 Aussenhandel Käse Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 tttt% Einfuhr Frischkäse 1 4 175 8 280 8 485 8 491 101 7 Reibkäse 2 233 271 333 312 31 2 Schmelzkäse 3 2 221 2 499 2 550 2 527 13 7 Schimmelkäse 4 2 276 2 306 2 414 2 346 3 5 Weichkäse 5 6 628 5 502 5 618 5 664 -15 6 Halbhartkäse 6 11 795 5 722 5 234 4 617 Hartkäse 7 5 970 6 574 6 872 -1 2 Total Käse und Quark 27 328 30 548 31 208 30 829 12 9 Ausfuhr Frischkäse 1 21 10 29 558 3 Reibkäse 2 104 103 156 130 24 3 Schmelzkäse 3 8 245 6 532 6 733 6 020 -22 0 Schimmelkäse 4 029 16Weichkäse 5 30 52 50 64 83 3 Halbhartkäse 6 54 102 7 072 6 944 7 033 Hartkäse 7 42 712 49 457 40 588 -5 2 Total Käse und Quark 62 483 56 474 63 359 53 880 -7 3 1 0406 1010 0406 1020 406 1090 2 0406 2010, 0406 2090 3 0406 3010 0406 3090 4 0406 4010, 0406 4021, 0406 4029, 0406 4081, 0406 4089 5 0406 9011 0406 9019 6 0406 9021, 0406 9031, 0406 9051, 0406 9091 7 0406 9039 0406 9059 0406 9060 0406 9099 Quelle: OZD
und -produkte, Eier, Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV, 2000 teilweise provisorisch
Proviande
BWL
BLW
A10 A N H A N G Tabelle 10 Pro-Kopf-Konsum Produkt 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 kg kg kg kg % Milch und -produkte Konsummilch 104 37 91 00 86 60 88 80 -14 9 Rahm 6 43 6 40 6 70 6 20 0 0 Butter 6 20 6 20 5 90 5 90 -3 2 Käse 14 73 15 50 15 60 16 60 7 9 Frischkäse 1 50 2 70 2 90 3 30 97 8 Weichkäse 1 83 1 80 1 80 1 90 0 0 Halbhartkäse 6 17 5 80 5 60 5 50 -8 6 Hartkäse 5 20 5 20 5 30 5 90 5 1 Fleisch und Eier Rindfleisch 13 71 11 25 11 53 10 30 -19 6 Kalbfleisch 4 25 4 04 4 08 3 73 -7 0 Schweinefleisch 29 73 26 28 25 63 25 43 -13 3 Schaffleisch 1 42 1 49 1 43 1 61 6 3 Ziegenfleisch 0 12 0 13 0 11 0 12 -2 7 Pferdefleisch 0 75 0 66 0 62 0 62 -15 9 Geflügel 8 05 9 03 8 71 9 04 10 8 Schaleneier (in St ) 199 190 195 181 -5 2 Getreide Brot- und Backwaren 50 70 52 1 52 7 51 7 2 9 Hackfrüchte Kartoffeln und Kartoffelprodukte 44 17 43 1 53 80 44 00 6 3 Zucker (inkl Zucker in Verarbeitungsprodukten) 42 37 40 1 41 70 43 50 -1 4 Ölsaaten Pflanzliche Öle und Fette 12 80 14 5 14 3 14 50 12 8 Obst (Tafel) Äpfel 15 26 1 15 51 12 96 15 62 -5 4 2 Birnen - 3 65 3 16 3 31Aprikosen 2 04 1 1 68 2 02 1 68 -10 7 2 Kirschen 0 39 1 0 39 0 35 0 46 -8 3 2 Zwetschgen und Pflaumen 0 91 1 0 84 0 98 0 94 0 9 2 Erdbeeren 2 24 2 40 2 34 2 31 4 9 Zitrusfrüchte 20 09 18 25 17 03 17 23 -12 9 Bananen 11 53 10 24 10 35 10 05 -11 4 Gemüse (frisch) Karotten 7 53 8 77 8 81 7 98 13 2 Zwiebeln 3 86 4 61 4 61 4 46 18 0 Knollensellerie 1 29 1 24 1 32 1 42 2 8 Tomaten 8 46 9 82 9 65 10 18 16 8 Kopfsalat 3 37 3 20 2 66 2 71 -15 2 Blumenkohl 2 71 2 37 2 25 2 22 -15 9 Gurken 3 85 3 68 3 73 3 55 -5 2 Wein Rotwein (in l) 31 97 28 50 28 70 28 80 -10 3 Weisswein (in l) 14 47 12 50 12 80 12 70 -12 4 Wein total (in l) 46 43 41 00 41 50 41 50 -11 0 1 Durchschnitt der Jahre
2 Veränderung
Quellen: Milch
Getreide:
Obst, Gemüse und Wein:
1990/93
1990/93–1997/2000
Fleisch:
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1997/2000
3 Restzahlung nicht berücksichtigt, effektiver Preis 10% bis 15% höher
Quellen:
Milch: BLW
Geflügel, Eier: SBV
Getreide, Hackfrüchte und Ölsaaten: FAT
Obst: Schweizerischer Obstverband
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
A N H A N G A11 Tabelle 11 Produzentenpreise Produkt Einheit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Milch CH gesamt Rp /kg 104 97 82 10 80 93 79 41 -23 0 Verkäste Milch (erst ab 1999) Rp /kg 79 96 79 14Biomilch (erst ab 1999) Rp /kg 91 55 94 05Schlachtvieh Kühe T3 Fr / kg SG 7 82 4 75 4 90 6 54 -31 0 Kühe X3 Fr / kg SG 7 53 3 66 3 77 5 02 -44 9 Jungkühe T3 Fr / kg SG 8 13 5 18 6 40 7 73 -20 8 Muni T3 Fr / kg SG 9 28 7 38 7 77 8 90 -13 7 Ochsen T3 Fr / kg SG 9 83 7 38 7 90 8 79 -18 3 Rinder T3 Fr / kg SG 8 66 6 85 7 37 8 67 -11 9 Kälber T3 Fr / kg SG 14 39 11 36 11 03 13 13 -17 7 Fleischschweine Fr / kg SG 5 83 4 80 4 38 4 69 -20 7 Lämmer bis 40 kg, T3 Fr / kg SG 15 40 13 47 11 46 12 60 -18 8 Geflügel und Eier Poulets Kl I, ab Hof Fr / kg LG 3 72 2 97 2 84 2 81 -22 8 Eier aus Bodenhaltung an Läden Fr /100 St 41 02 43 61 42 86 41 47 4 0 Eier aus Freilandhaltung an Läden Fr /100 St 46 21 50 42 49 01 54 29 10 9 Eier, verkauft an Sammelstelle >53 g Fr /100 St 33 29 24 33 22 21 20 98 -32 4 Getreide Weizen Fr /100 kg 99 34 75 65 75 41 66 35 -27 0 Roggen Fr /100 kg 102 36 62 69 62 77 51 82 -42 3 Gerste Fr /100 kg 70 24 50 13 48 83 48 52 -30 0 Hafer Fr /100 kg 71 40 47 68 48 83 48 23 -32 4 Triticale Fr /100 kg 70 69 49 45 49 44 48 61 -30 5 Körnermais Fr /100 kg 73 54 53 21 51 91 47 65 -30 8 Hackfrüchte Kartoffeln Fr /100 kg 38 55 35 27 37 76 36 12 -5 6 Zuckerrüben Fr /100 kg 14 84 13 99 11 85 11 58 -15 9 Ölsaaten Raps Fr /100 kg 203 67 147 89 146 11 61 26 3 -41 9 Soja Fr /100 kg 204 67 162 14 164 58 50 71 3 -38 5 Obst Äpfel: Golden Delicious I Fr / kg 1 12 1 0 60 1 06 0 86 -24 8 2 Äpfel: Idared I Fr / kg 0 98 1 0 45 0 82 0 55 -31 1 2 Birnen: Conférence Fr / kg 1 33 1 0 78 1 09 0 88 -19 7 2 Aprikosen Fr / kg 2 09 1 2 28 2 66 2 17 16 9 2 Kirschen Fr / kg 3 20 1 3 30 3 05 3 30 5 1 2 Zwetschgen: Fellenberg Fr / kg 1 40 1 1 40 1 40 1 50 4 5 2 Erdbeeren Fr / kg 4 77 4 40 4 80 4 80 -2 1 Gemüse Karotten (Lager) Fr / kg 1 09 1 18 1 05 1 15 3 4 Zwiebeln (Lager) Fr / kg 0 89 1 03 0 96 1 02 12 7 Knollensellerie (Lager) Fr / kg 1 62 1 41 1 84 1 63 0 2 Tomaten rund Fr / kg 2 42 1 89 1 92 2 15 -17 9 Kopfsalat Fr / kg 2 37 2 20 2 89 2 72 9 8 Blumenkohl Fr / kg 1 85 1 78 1 88 1 88Salatgurken Fr / kg 1 66 1 66 1 73 1 97 7 8
Schlachtvieh,
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93
2 Veränderung 1990/93–1997/2000
A12 A N H A N G Tabelle 12 Konsumentenpreise Produkt Einheit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Milch und -produkte Vollmilch, pasteurisiert,verpackt Fr /l 1 85 1 66 1 58 1 55 -13 7 Milchdrink, pasteurisiert, verpackt Fr /l 1 85 1 66 1 58 1 54 -13 9 Magermilch UHT Fr /l - 1 55 1 48 1 42Emmentaler Fr /kg 20 15 20 65 20 66 20 18 1 7 Greyerzer Fr /kg 20 40 20 93 20 67 20 17 0 9 Tilsiter Fr /kg - 17 76 17 49 17 47Camembert 45% (FiT) 125 g - 2 58 2 54 2 54Weichkäse Schimmelreifung 150 g - 2 34 3 34 3 36Mozzarella 45% (FiT) 150 g - 2 35 2 32 2 30Vorzugsbutter 200 g 3 46 3 01 2 89 2 97 -14 5 Die Butter (Kochbutter) 250 g 3 44 3 00 2 92 2 94 -14 1 Vollrahm, verpackt 1⁄2 l- 5 44 5 19 4 83Kaffeerahm, verpackt 1⁄2 l- 2 75 2 62 2 49Jogurt, aromatisiert oder mit Früchten 180 g 0 89 0 73 0 71 0 69 -20 2 Rindfleisch Entrecôte, geschnitten Fr /kg 48 36 44 36 45 68 50 14 -3 4 Plätzli, Eckstück Fr /kg 37 59 33 69 34 76 39 24 -4 5 Braten, Schulter Fr /kg 26 34 23 52 24 09 27 73 -4 7 Hackfleisch Fr /kg 15 00 13 61 13 42 15 29 -6 0 Kalbfleisch Ia Koteletten, geschnitten Fr /kg 35 32 37 07 35 84 40 77 7 3 Braten, Schulter Fr /kg 32 56 31 01 30 80 34 96 -0 9 Voressen Fr /kg 21 67 25 46 24 67 28 68 21 2 Schweinefleisch Ia Koteletten, geschnitten Fr /kg 19 88 17 91 18 26 19 80 -6 2 Plätzli, Eckstück Fr /kg 24 48 24 44 22 38 24 58 -2 8 Braten, Schulter Fr /kg 18 43 17 60 16 75 18 60 -4 2 Voressen, Schulter Fr /kg 16 69 17 29 15 75 17 39 0 7 Lammfleisch Inland frisch Gigot ohne Schlossbein Fr /kg 26 34 26 68 27 10 27 15 2 4 Koteletten, geschnitten Fr /kg 30 32 31 69 31 57 32 66 5 4 Fleischwaren Hinterschinken, Model geschnitten Fr / kg 25 56 27 23 26 18 27 13 5 0 Salami Inland I, geschnitten Fr /100 g 3 09 3 35 3 42 3 75 13 4 Poulets Inland, frisch Fr / kg 8 41 8 42 8 43 8 49 0 4 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte Weissmehl Fr / kg 2 05 1 80 1 80 1 75 -13 0 Ruchbrot Fr /500 g 2 08 2 00 1 98 1 82 -7 1 Halbweissbrot Fr /500 g 2 09 2 05 2 02 1 83 -5 9 Weggli Fr / St 0 62 0 75 0 75 0 70 18 3 Gipfeli Fr / St 0 71 0 87 0 89 0 84 22 1 Spaghetti Fr /500 g 1 66 1 39 1 43 1 54 -12 4 Kartoffeln Fr / kg 1 43 1 66 1 77 1 87 23 5 Kristallzucker Fr / kg 1 65 1 52 1 50 1 41 -10 5 Sonnenblumenöl Fr /l 5 05 4 44 4 46 3 96 -15 1 Obst (Herkunft In- und Ausland) Äpfel: Golden Delicious Fr / kg 3 15 1 3 10 2 98 3 40 0 4 2 Birnen Fr / kg 3 25 1 3 32 3 26 3 36 2 2 2 Aprikosen Fr / kg 3 93 1 4 73 4 24 4 69 15 0 2 Kirschen Fr / kg 7 35 1 8 24 8 13 8 89 14 5 2 Zwetschgen Fr / kg 3 42 1 3 46 3 22 3 46 0 4 2 Erdbeeren Fr / kg 8 69 9 51 9 44 9 59 9 5 Gemüse (Frischkonsum; Herkunft In- und Ausland) Karotten (Lager) Fr / kg 1 91 1 87 1 78 1 78 -5 2 Zwiebeln (Lager) Fr / kg 1 86 2 14 2 03 1 94 9 5 Knollensellerie (Lager) Fr / kg 3 14 3 32 3 67 3 36 9 9 Tomaten rund Fr / kg 3 73 3 31 3 18 3 50 -10 7 Kopfsalat Fr / kg 4 46 4 39 5 15 5 25 10 5 Blumenkohl Fr / kg 3 58 3 49 3 59 3 58 -0 8 Salatgurken Fr / kg 2 80 2 88 2 86 3 14 5 7
Quellen: Milch,
Pflanzenbau und
Fleisch: BLW
pflanzliche Produkte: BLW, BFS
1 inkl Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide, jedoch ohne Ölkuchen; ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 einschliesslich Hartweizen, Speisehafer, Speisegerste und Mais
3 Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche
4 Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5 einschliesslich Fleisch von Pferden, Ziegen, Kaninchen sowie Wildbret, Fische, Krusten- und Weichtiere
6 verdauliche Energie in Joules, alkoholische Getränke eingeschlossen
7 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen, Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
Quelle: SBV
A N H A N G A13 Tabelle 13 Selbstversorgungsgrad Produkt 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Mengenmässiger Anteil: %%%% Brotgetreide 118 108 120 99 -9 0 Futtergetreide 1 61 72 73 70 10 7 Getreide total 2 64 67 69 62 2 0 Speisekartoffeln 101 94 100 82 -9 0 Zucker 46 62 60 58 14 0 Pflanzliche Fette, Öle 22 23 21 18 -1 3 Obst 3 72 71 82 68 1 7 Gemüse 55 56 54 52 -1 0 Konsummilch 97 97 97 97 0 0 Butter 89 89 92 88 0 7 Käse 137 129 126 123 -11 0 Milch und Milchprodukte total 110 110 110 111 0 3 Kalbfleisch 4 97 99 98 95 0 3 Rindfleisch 4 93 98 92 88 -0 3 Schweinefleisch 4 99 90 93 92 -7 3 Schaffleisch 4 39 42 43 46 4 7 Geflügel 4 37 41 39 42 3 7 Fleisch aller Arten 45 76 72 71 70 -5 3 Eier und Eikonserven 44 49 49 47 4 3 Energiemässiger Anteil 6: Pflanzliche Nahrungsmittel 43 44 47 40 0 7 Tierische Nahrungsmittel brutto 97 95 95 95 -2 0 Nahrungsmittel im ganzen brutto 60 62 64 58 1 3 Nahrungsmittel im ganzen netto 7 58 54 56 54 -3 3 Wertmässiger Anteil Nahrungsmittel im ganzen 8 72 66 65 63 -7 3
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse
A14 A N H A N G
Tabelle
Endproduktion der Landwirtschaft
Fr Produkt 1990/92 1998 1999 1 2000 2 1990/92 – 2001 3 1998/2000–1998/2000 2001 %% Getreide 807 539 658 938 515 434 527 000 -29 8 421 000 -25 8 Hülsenfrüchte 1 318 1 134 976 1 075 -19 4 800 -24 6 Kartoffeln 231 342 162 636 165 299 169 000 -28 4 164 000 -1 0 Zuckerrüben 141 784 154 526 139 138 155 000 5 5 138 800 -7 2 Ölsaaten (Raps, Soja, Sonnenblumen) 102 033 89 879 78 587 40 000 -31 9 39 000 -43 9 Tabak 16 945 21 328 16 554 19 800 13 5 20 000 4 0 Gemüse 379 455 422 262 404 782 435 000 10 9 435 000 3 4 Obst und Beeren 371 296 381 521 293 435 349 500 -8 0 298 000 -12 7 Futterpflanzen (Heu, Silomais, Grünfutter, ) 14 077 8 359 - 8 445 15 000 -64 7 0 -100 0 Nebenprodukte der pflanz Produktion 14 044 14 004 12 395 16 500 1 8 14 000 -2 1 Weinmost 586 831 509 883 563 561 540 000 -8 4 530 000 -1 5 Übriger Pflanzenbau 14 144 9 731 10 574 10 000 -28 6 10 000 -1 0 Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse 2 680 807 2 434 201 2 192 290 2 277 875 -14 2 2 070 600 -10 0 Rindvieh 1 580 377 952 107 958 042 1 139 000 -35 7 930 000 -8 5 Schweine 1 556 531 1 079 380 974 148 1 041 000 -33 7 1 029 000 -0 2 Einhufer (Pferde, Esel, Maultiere) 20 475 22 165 5 759 5 900 -44 9 5 900 -47 7 Schafe 71 810 69 133 58 475 60 100 -12 9 68 000 8 7 Ziegen 4 906 4 627 4 029 4 300 -12 0 3 700 -14 3 Geflügel (Poulets, Truten, Enten, Gänse) 186 808 176 698 176 454 188 000 -3 4 188 000 4 2 Übrige Tiere (Kaninchen, Bienenvölker) 26 010 19 795 17 703 17 500 -29 5 17 000 -7 3 Milch 3 461 227 2 807 490 2 565 444 2 560 000 -23 6 2 598 000 -1 8 Eier 207 617 178 358 154 644 155 000 -21 7 153 500 -5 6 Wolle 507 93 00 -93 9 0 -100 0 Honig 47 917 57 529 37 667 40 000 -6 0 42 000 -6 8 Übrige tierische Erzeugnisse 5 042 4 349 3 971 4 400 -15 9 4 400 3 8 Tiere und tierische Erzeugnisse 7 169 228 5 371 724 4 956 336 5 215 200 -27 7 5 039 500 -2 7 Lohnarbeiten auf der landw Erzeugerstufe 52 400 87 888 90 420 90 000 70 7 90 000 0 6 Endproduktion total 9 902 435 7 893 813 7 239 046 7 583 075 -23.5 7 200 100 -4.9 1 provisorisch Stand Winter 2000/2001 2 Schätzung, Stand Winter 2000/2001 3 Schätzung Stand Sommer 2001 Quelle: SBV
14
zu laufenden Preisen, in 1000
1 Wenn die Mwst auf den Verkäufen landwirtschaftlicher Produkte nicht gleich hoch ist wie die auf den Ankäufen von Vorleistungen und Investitionsgütern bezahlten Steuern, wird sie in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgeglichen Wurde auf der Produktionsseite mehr als auf der Kostenseite verrechnet, wird diese Überkompensation als zusätzliche Einnahmequelle betrachtet Bis jetzt war in der Schweiz immer eine Unterkompensation zu verzeichnen
2 inkl stationäre Einrichtungen
3 provisorisch, Stand Winter 2000/2001
4 Schätzung, Stand Winter 2000/2001
5 Schätzung, Stand Sommer 2001
A N H A N G A15 Tabelle 15 Landwirtschaftliche Gesamtrechnung zu laufenden Preisen, in 1000 Fr Merkmal 1990/92 1998 1999 3 2000 4 1990/92– 2001 5 1998/2000–1998/2000 2001 %% Endproduktion 9 902 435 7 893 813 7 239 046 7 583 075 -23 5 7 200 100 -4 9 Vorleistungen total 4 172 848 3 855 446 3 796 404 3 922 500 -7 5 3 954 000 2 5 Saat- und Pflanzgut 235 204 215 502 222 353 213 000 -7 8 204 000 -6 0 Vieh 7 535 10 858 10 862 16 000 66 9 11 000 -12 5 Energie 397 171 421 653 437 145 481 000 12 4 480 000 7 5 Düngemittel 243 903 149 114 147 004 144 000 -39 9 153 000 4 3 Pflanzenschutzmittel 138 587 120 376 123 364 125 000 -11 3 126 000 2 5 Futtermittel 1 721 238 1 474 221 1 447 754 1 516 000 -14 1 1 550 000 4 8 Material und Unterhalt Maschinen 682 312 730 918 732 244 727 500 7 0 740 000 1 3 Unterhalt Wirtschaftsgebäude 182 658 136 711 132 770 136 000 -26 0 140 000 3 6 Dienstleistungen 564 240 596 093 542 908 564 000 0 6 550 000 -3 1 Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 5 729 587 4 038 367 3 442 642 3 660 575 -35 2 3 246 100 -12 6 Beiträge der öffentlichen Hand (Subventionen) 1 317 038 2 439 386 2 424 077 2 417 000 84 3 2 679 000 10 4 Überkompensation der Mwst 1 Produktionssteuern 123 433 194 331 120 824 76 000 5 6 62 000 -52 4 Unterkompensation der Mwst 1 - 79 074 97 552 98 000 - 105 000 14 7 Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 6 923 192 6 204 348 5 648 343 5 903 575 -14 5 5 758 100 -2 7 Abschreibungen Total 2 030 896 1 852 603 1 836 788 1 859 000 -8 9 1 899 000 2 7 Abschreibungen für Gebäude 2 1 057 197 791 850 768 363 788 000 -26 0 809 000 3 4 Abschreibungen für Maschinen 973 699 1 060 753 1 068 425 1 071 000 9 6 1 090 000 2 2 Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 4 892 296 4 351 745 3 811 555 4 044 575 -16 8 3 859 100 -5 2 Pachten und Zinsen 844 689 700 485 690 883 729 000 -16 3 759 000 7 4 Pachten 227 754 225 485 225 427 224 000 -1 2 225 000 0 0 Zinsen 616 936 475 000 465 456 505 000 -21 9 534 000 10 8 Nettoeinkommen aus landw Tätigkeit 4 047 607 3 651 260 3 120 672 3 315 575 -16 9 3 100 100 -7 8 aller in der Landwirtschaft Beschäftigten Entlöhnung der familienfremden Arbeitskräfte 827 058 763 996 738 113 715 000 -10 6 715 000 -3 3 Nettoeinkommen aus landw Tätigkeit 3 220 549 2 887 264 2 382 559 2 600 575 -18 5 2 385 100 -9 1
Familienarbeitskräfte
der
Quelle: SBV
Tabelle 16
Betriebsergebnisse: Alle Regionen
(Mittelwert)
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A16 A N H A N G
Merkmal Einheit 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Referenzbetriebe Anzahl 4 302 3 901 3 861 3 494 3 419 -8 9 Vertretene Betriebe Anzahl 62 921 57 194 56 579 54 906 53 896 -4 1 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16 06 17 92 18 08 18 41 18 78 3 5 Offene Ackerfläche ha 4 90 5 14 5 11 5 08 5 17 1 2 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 88 1 76 1 73 1 70 1 70 -1 7 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 39 1 32 1 31 1 29 1 30 -0 5 Kühe total Anzahl 12 9 13 3 13 3 13 4 13 5 1 3 Tierbestand total GVE 23 2 23 6 23 6 23 5 23 8 1 0 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 606 321 667 440 680 090 689 619 716 645 5 5 davon: Umlaufvermögen total Fr 116 932 133 175 130 317 135 278 144 196 8 5 davon: Tiervermögen total Fr 60 662 42 860 40 396 41 172 44 706 7 8 davon: Anlagevermögen total Fr 428 727 491 405 509 377 513 169 527 743 4 6 davon: Aktiven Betrieb Fr 558 933 614 913 627 590 636 990 662 417 5 7 Fremdkapitalquote % 43 42 41 41 41 -0 8 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 19 808 11 928 10 146 11 089 15 193 37 4 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 184 762 187 643 183 882 181 702 199 145 8 0 davon: Direktzahlungen Fr 13 594 39 319 37 667 38 872 39 307 1 8 Sachkosten Fr 91 735 101 981 104 464 102 844 108 460 5 2 Betriebseinkommen Fr 93 027 85 662 79 418 78 858 90 685 11 5 Personalkosten Fr 13 775 13 476 12 983 12 128 12 369 -3 8 Schuldzinsen Fr 11 361 8 757 7 931 7 405 8 001 -0 4 Pachtzinsen Fr 5 069 5 455 5 425 5 536 5 640 3 1 Fremdkosten Fr 121 941 129 669 130 802 127 912 134 470 3 9 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 62 822 57 974 53 079 53 789 64 675 17 7 Nebeneinkommen Fr 16 264 18 627 18 254 18 638 19 208 3 8 Gesamteinkommen Fr 79 086 76 601 71 333 72 427 83 883 14 2 Privatverbrauch Fr 59 573 60 768 62 003 59 220 62 650 3 3 Eigenkapitalbildung Fr 19 513 15 833 9 330 13 207 21 233 66 0 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 46 914 40 922 49 585 41 856 44 964 1 9 Cashflow 3 Fr 44 456 43 108 40 398 42 238 46 043 9 8 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 105 81 101 102 6 6 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 66 68 60 66 67 3 6 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 52 49 44 47 52 11 4 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 26 24 21 21 25 13 6 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 10 14 20 17 12 -29 4 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 13 15 15 11 -23 3 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 49 473 48 616 45 846 46 376 53 426 13 8 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 5 796 4 780 4 393 4 282 4 829 7 7 Kapitalproduktivität 12 % 16 7 13 9 12 7 12 4 13 7 5 4 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % 0 8 -1 6 -2 4 -2 3 -0 6 -71 4 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -2 2 -5 2 -6 3 -5 9 -3 2 -44 8 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 31 025 34 755 32 854 33 050 38 099 13 5
Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 29 465 31 778 30 125 29 770 34 410 12 6 (Median)
Tabelle 17
Betriebsergebnisse: Talregion*
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion: Ackerbauzone plus Übergangszonen
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A17
Merkmal Einheit 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Referenzbetriebe Anzahl 2 356 1 800 1 789 1 565 1 517 -11 7 Vertretene Betriebe Anzahl 29 677 26 064 26 275 25 499 25 094 -3 3 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16 66 18 91 18 90 19 33 19 41 1 9 Offene Ackerfläche ha 8 34 9 20 9 07 9 05 9 13 0 3 Arbeitskräfte Betrieb JAE 2 05 1 91 1 86 1 83 1 80 -3 6 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 36 1 30 1 27 1 26 1 26 -1 3 Kühe total Anzahl 12 8 13 3 13 3 13 4 13 3 -0 3 Tierbestand total GVE 22 9 23 6 23 4 23 4 23 5 0 1 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 706 406 775 592 774 628 778 173 814 917 5 0 davon: Umlaufvermögen total Fr 149 871 166 383 159 909 165 188 179 657 9 7 davon: Tiervermögen total Fr 61 461 44 204 40 588 41 791 44 637 5 8 davon: Anlagevermögen total Fr 495 074 565 005 574 131 571 194 590 623 3 6 davon: Aktiven Betrieb Fr 642 757 707 725 710 317 712 424 746 171 5 1 Fremdkapitalquote % 41 40 40 40 39 -2 5 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 23 633 14 094 11 839 12 686 17 549 36 3 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 225 249 229 974 224 055 218 369 242 054 8 0 davon: Direktzahlungen Fr 7 248 35 048 33 541 32 359 32 944 -2 1 Sachkosten Fr 110 193 122 378 123 500 122 085 129 262 5 4 Betriebseinkommen Fr 115 056 107 596 100 555 96 284 112 792 11 1 Personalkosten Fr 20 784 20 477 19 172 18 194 18 330 -4 9 Schuldzinsen Fr 13 463 10 363 9 073 8 424 9 051 -2 5 Pachtzinsen Fr 7 015 7 486 7 425 7 698 7 673 1 8 Fremdkosten Fr 151 456 160 704 159 170 156 400 164 316 3 5 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 73 794 69 270 64 885 61 968 77 738 18 9 Nebeneinkommen Fr 16 429 18 703 17 507 17 580 17 805 -0 7 Gesamteinkommen Fr 90 223 87 973 82 392 79 548 95 543 14 7 Privatverbrauch Fr 67 985 69 861 70 676 66 577 69 756 1 0 Eigenkapitalbildung Fr 22 238 18 112 11 716 12 971 25 787 80 8 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 56 951 45 697 55 734 46 615 52 271 5 9 Cashflow 3 Fr 52 079 50 541 47 108 45 807 53 548 12 0 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 92 111 85 98 102 4 1 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 67 61 64 69 7 8 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 52 49 45 47 54 14 9 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 24 21 20 17 23 19 0 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 12 17 22 20 13 -33 9 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 13 13 16 10 -28 6 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 56 050 56 330 54 204 52 755 62 635 15 1 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 6 908 5 691 5 321 4 981 5 810 9 0 Kapitalproduktivität 12 % 17 9 15 2 14 2 13 5 15 1 5 6 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % 2 1 -0 1 -0 7 -1 2 0 9 -235 0 Eigenkapitalsrentabilität 14 % 0 0 -2 6 -3 3 -4 1 -0 5 -85 0 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 36 924 42 423 41 723 39 210 47 891 16 5 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 36 186 39 552 39 191 36 114 44 561 16 4 (Median)
Tabelle 18
Betriebsergebnisse: Hügelregion*
(Mittelwert)
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A18 A N H A N G
Merkmal Einheit 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Referenzbetriebe Anzahl 1 125 1 103 1 119 1 029 1 017 -6 2 Vertretene Betriebe Anzahl 17 397 15 796 15 420 14 967 14 588 -5 2 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 30 16 92 17 07 17 19 17 83 4 5 Offene Ackerfläche ha 3 08 3 08 2 98 2 99 3 15 4 4 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 81 1 66 1 65 1 62 1 62 -1 4 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 40 1 30 1 29 1 28 1 29 0 0 Kühe total Anzahl 14 4 14 7 14 8 14 7 15 3 3 8 Tierbestand total GVE 26 0 26 3 26 6 26 0 27 0 2 7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 553 876 622 467 648 445 655 042 677 784 5 6 davon: Umlaufvermögen total Fr 95 672 116 547 114 116 116 937 122 136 5 4 davon: Tiervermögen total Fr 66 366 46 483 44 218 44 452 49 901 10 8 davon: Anlagevermögen total Fr 391 838 459 437 490 111 493 653 505 747 5 1 davon: Aktiven Betrieb Fr 516 933 572 477 595 810 602 991 626 182 6 1 Fremdkapitalquote % 46 45 45 45 45 0 0 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 17 271 10 424 8 959 9 825 13 318 36 8 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 170 201 172 687 169 697 167 340 183 249 7 9 davon: Direktzahlungen Fr 15 415 38 489 37 258 37 996 39 135 3 2 Sachkosten Fr 85 602 95 988 99 789 96 378 102 222 5 0 Betriebseinkommen Fr 84 599 76 699 69 908 70 962 81 027 11 7 Personalkosten Fr 9 943 9 792 9 839 9 037 9 183 -3 9 Schuldzinsen Fr 10 915 8 507 8 136 7 618 8 330 3 0 Pachtzinsen Fr 3 903 4 660 4 513 4 422 4 789 5 7 Fremdkosten Fr 110 363 118 948 122 277 117 455 124 525 4 2 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 59 838 53 740 47 420 49 885 58 725 16 6 Nebeneinkommen Fr 14 544 18 973 19 283 19 849 21 814 12 6 Gesamteinkommen Fr 74 382 72 713 66 703 69 734 80 539 15 5 Privatverbrauch Fr 55 272 56 859 57 769 55 890 59 963 5 5 Eigenkapitalbildung Fr 19 110 15 854 8 934 13 844 20 576 59 8 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 41 428 40 324 47 691 39 227 39 674 -6 5 Cashflow 3 Fr 41 445 40 313 39 269 40 759 43 650 8 8 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 100 100 82 104 110 15 4 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 68 70 61 67 68 3 0 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 50 47 43 46 50 10 3 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 30 29 25 26 31 16 3 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 8 10 15 13 8 -36 8 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 14 17 15 11 -28 3 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 46 654 46 179 42 381 43 842 50 119 13 6 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 5 533 4 534 4 096 4 128 4 545 6 9 Kapitalproduktivität 12 % 16 4 13 4 11 7 11 8 12 9 4 9 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % 0 4 -2 0 -3 1 -2 5 -1 1 -56 6 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -3 3 -6 5 -8 3 -7 0 -4 5 -38 1 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 30 335 33 228 29 714 31 292 35 336 12 5
Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 29 520 31 182 28 701 29 459 33 156 11 3 (Median)
Tabelle 19
Betriebsergebnisse: Bergregion*
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1990: 6 40%; 1991: 6 23%; 1992: 6 42%; 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion: Bergzonen II bis IV
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A19
Merkmal Einheit 1990/92 1997 1998 1999 2000 1997/1999–2000 % Referenzbetriebe Anzahl 821 998 953 900 885 -6 9 Vertretene Betriebe Anzahl 15 847 15 334 14 884 14 440 14 214 -4 5 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 76 17 28 17 67 18 06 18 63 5 4 Offene Ackerfläche ha 0 44 0 36 0 32 0 25 0 28 -9 7 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 63 1 61 1 60 1 57 1 60 0 4 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 42 1 39 1 38 1 37 1 39 0 7 Kühe total Anzahl 11 4 11 7 11 8 11 9 11 8 0 0 Tierbestand total GVE 20 5 20 6 20 7 21 1 21 0 1 0 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 476 486 529 934 545 982 569 082 583 036 6 3 davon: Umlaufvermögen total Fr 78 573 93 858 94 862 101 469 104 230 7 8 davon: Tiervermögen total Fr 52 902 36 846 36 097 36 681 39 497 8 1 davon: Anlagevermögen total Fr 345 011 399 230 415 023 430 932 439 309 5 8 davon: Aktiven Betrieb Fr 448 089 500 870 514 474 539 022 551 742 6 5 Fremdkapitalquote % 45 42 41 40 40 -2 4 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 15 432 9 795 8 388 9 580 12 957 40 0 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 124 931 131 097 127 656 131 838 139 707 7 3 davon: Direktzahlungen Fr 23 476 47 435 45 373 51 279 50 719 5 6 Sachkosten Fr 63 905 73 483 75 698 75 569 78 140 4 3 Betriebseinkommen Fr 61 026 57 614 51 958 56 269 61 567 11 4 Personalkosten Fr 4 860 5 370 5 316 4 619 5 116 0 3 Schuldzinsen Fr 7 918 6 286 5 704 5 386 5 808 0 3 Pachtzinsen Fr 2 707 2 821 2 837 2 872 2 922 2 8 Fremdkosten Fr 79 390 87 960 89 556 88 445 91 986 3 8 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 45 541 43 137 38 101 43 392 47 721 14 9 Nebeneinkommen Fr 17 853 18 139 18 505 19 250 19 011 2 0 Gesamteinkommen Fr 63 394 61 276 56 606 62 642 66 732 10 9 Privatverbrauch Fr 48 548 49 338 51 077 49 678 52 865 5 7 Eigenkapitalbildung Fr 14 846 11 938 5 529 12 964 13 867 36 7 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 34 138 33 423 40 694 36 177 37 494 2 0 Cashflow 3 Fr 33 482 33 355 29 723 37 469 35 247 5 2 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 98 100 73 104 94 1 8 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 70 68 59 70 65 -1 0 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 54 50 44 50 51 6 3 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 26 24 19 23 23 4 5 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 8 14 20 15 14 -14 3 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 12 12 17 12 12 -12 2 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 37 418 35 692 32 445 35 950 38 532 11 1 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 3 874 3 333 2 940 3 115 3 304 5 6 Kapitalproduktivität 12 % 13 6 11 5 10 1 10 4 11 2 5 0 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % -2 3 -4 6 -5 6 -4 4 -3 8 -21 9 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -7 4 -10 2 -11 6 -9 2 -8 2 -20 6 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 21 201 24 022 21 498 24 747 25 064 7 0 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 20 707 22 920 20 629 22 991 22 851 3 0 (Median)
Tabelle 20a
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 1998/2000
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99 (vgl Anhang: Begriffe und Methoden)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A20 A N H A N G
Pflanzenbau Tierhaltung Merkmal Einheit Mittel alle Spezial- Verkehrs- Mutter- Anderes Betriebe Ackerbau kulturen milch kühe Rindvieh Referenzbetriebe Anzahl 3 591 138 81 1 421 62 160 Vertretene Betriebe Anzahl 55 127 3 378 3 479 20 548 1 255 3 568 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 42 22 34 12 80 17 86 17 07 14 89 Offene Ackerfläche ha 5 12 18 40 6 21 0 97 0 75 0 15 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 71 1 34 2 42 1 64 1 33 1 42 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 30 1 04 1 33 1 35 1 11 1 29 Kühe total Anzahl 13 4 3 6 2 0 15 7 15 8 9 2 Tierbestand total GVE 23 6 7 9 3 1 24 2 21 3 16 4 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 695 451 735 002 782 113 621 780 650 807 496 577 davon: Umlaufvermögen total Fr 136 597 166 032 219 487 112 657 113 533 92 607 davon: Tiervermögen total Fr 42 091 15 080 8 023 42 769 41 692 32 642 davon: Anlagevermögen total Fr 516 763 553 890 554 603 466 354 495 582 371 328 davon: Aktiven Betrieb Fr 642 332 685 381 724 621 578 157 615 565 466 941 Fremdkapitalquote % 41 35 34 43 39 41 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 12 143 14 245 15 384 10 640 12 041 8 904 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 188 243 203 028 244 981 152 909 129 432 108 448 davon: Direktzahlungen Fr 38 615 35 912 22 041 39 004 58 622 51 826 Sachkosten Fr 105 256 110 779 115 032 83 794 69 921 64 677 Betriebseinkommen Fr 82 987 92 249 129 949 69 115 59 511 43 771 Personalkosten Fr 12 494 10 446 42 464 7 333 6 295 2 849 Schuldzinsen Fr 7 779 7 659 8 299 6 942 6 574 4 898 Pachtzinsen Fr 5 533 8 291 6 781 4 545 2 236 1 725 Fremdkosten Fr 131 062 137 175 172 575 102 614 85 025 74 149 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 57 181 65 853 72 405 50 295 44 406 34 299 Nebeneinkommen Fr 18 700 23 652 19 334 17 946 32 486 20 915 Gesamteinkommen Fr 75 881 89 505 91 739 68 241 76 892 55 214 Privatverbrauch Fr 61 291 77 943 77 251 55 087 56 464 46 508 Eigenkapitalbildung Fr 14 590 11 562 14 488 13 154 20 428 8 706 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 45 468 46 913 35 272 41 172 44 289 34 796 Cashflow 3 Fr 42 893 44 560 42 880 37 738 45 033 29 130 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 95 127 92 102 84 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 59 65 66 70 65 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 48 45 43 48 69 42 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 22 17 18 24 16 25 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 16 26 25 15 7 20 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 14 12 14 13 8 13 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 48 549 68 723 53 611 42 209 45 097 30 801 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 4 502 4 127 10 146 3 866 3 483 2 933 Kapitalproduktivität 12 % 12 9 13 5 17 9 11 9 9 7 9 3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % -1 8 1 2 -0 3 -3 3 -1 7 -6 6 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -5 1 0 1 -2 4 -8 1 -4 6 -13 2 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 34 667 49 712 42 625 29 308 29 319 19 628 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 31 435 50 854 35 133 27 297 32 394 18 920 (Median)
Tabelle 20b
Betriebsergebnisse nach Betriebstypen* 1998/2000
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* neue Betriebstypologie FAT99 (vgl Anhang: Begriffe und Methoden)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A21
Tierhaltung Kombiniert Pferde/ VerkehrsMerkmal Einheit Mittel alle Schafe/ milch/ MutterBetriebe Ziegen Veredlung Ackerbau kühe Veredlung Andere Referenzbetriebe Anzahl 3 591 28 52 495 26 672 456 Vertretene Betriebe Anzahl 55 127 1 152 1 205 6 393 371 6 136 7 642 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 42 13 33 11 05 23 98 23 87 18 53 19 58 Offene Ackerfläche ha 5 12 0 33 1 00 12 97 10 49 6 46 6 42 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 71 1 24 1 51 1 96 1 70 1 83 1 74 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 30 1 14 1 12 1 35 1 22 1 31 1 29 Kühe total Anzahl 13 4 1 8 11 3 18 1 21 7 15 2 14 5 Tierbestand total GVE 23 6 12 1 43 0 27 9 30 3 37 3 25 9 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 695 451 429 673 768 141 796 715 751 879 846 797 755 276 davon: Umlaufvermögen total Fr 136 597 69 903 103 390 167 027 171 056 154 937 147 753 davon: Tiervermögen total Fr 42 091 20 799 60 762 50 395 60 902 59 499 50 713 davon: Anlagevermögen total Fr 516 763 338 971 603 989 579 293 519 921 632 361 556 810 davon: Aktiven Betrieb Fr 642 332 401 474 735 263 738 399 676 900 780 164 672 270 Fremdkapitalquote % 41 44 47 41 45 41 44 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 12 143 7 279 12 782 13 996 12 001 14 756 12 267 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 188 243 86 844 260 768 238 756 221 521 264 222 196 748 davon: Direktzahlungen Fr 38 615 40 508 25 803 39 654 68 635 35 860 38 532 Sachkosten Fr 105 256 55 159 177 400 130 831 121 287 160 486 110 410 Betriebseinkommen Fr 82 987 31 685 83 368 107 925 100 234 103 736 86 338 Personalkosten Fr 12 494 2 024 11 908 18 468 16 844 15 928 12 884 Schuldzinsen Fr 7 779 5 375 10 656 8 902 8 275 9 747 8 738 Pachtzinsen Fr 5 533 1 502 3 232 9 225 12 311 5 704 6 153 Fremdkosten Fr 131 062 64 061 203 196 167 426 158 717 191 865 138 186 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 57 181 22 784 57 572 71 330 62 804 72 357 58 563 Nebeneinkommen Fr 18 700 30 162 16 151 13 507 23 281 16 154 19 814 Gesamteinkommen Fr 75 881 52 946 73 723 84 837 86 085 88 511 78 377 Privatverbrauch Fr 61 291 49 689 59 678 66 603 70 878 67 540 63 088 Eigenkapitalbildung Fr 14 590 3 257 14 045 18 234 15 207 20 971 15 289 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 45 468 39 106 31 360 55 160 52 063 59 650 49 604 Cashflow 3 Fr 42 893 24 410 50 596 51 428 47 273 56 922 44 924 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 71 205 93 97 97 91 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 51 74 63 61 67 65 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 48 45 37 48 45 52 47 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 22 21 27 22 21 21 23 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 16 14 16 16 12 14 15 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 14 20 20 14 22 13 15 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 48 549 25 630 55 357 54 988 58 987 56 652 49 755 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 4 502 2 379 7 552 4 498 4 221 5 588 4 409 Kapitalproduktivität 12 % 12 9 7 9 11 4 14 6 14 8 13 3 12 8 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % -1 8 -8 8 0 3 -0 5 -0 6 0 4 -1 6 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -5 1 -18 3 -2 2 -2 9 -3 4 -1 4 -5 1 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 34 667 13 646 39 805 42 509 41 639 44 097 35 757 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 31 435 10 701 29 666 41 129 39 327 40 210 33 094 (Median)
Tabelle 21
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Alle Regionen 1998/2000
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A22 A N H A N G
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 3 591 741 886 975 990 Vertretene Betriebe Anzahl 55 127 13 797 13 776 13 777 13 777 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 42 14 05 16 64 19 36 23 66 Offene Ackerfläche ha 5 12 2 60 3 21 5 19 9 50 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 71 1 62 1 68 1 71 1 82 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 30 1 29 1 38 1 34 1 19 Kühe total Anzahl 13 4 10 5 12 8 14 8 15 4 Tierbestand total GVE 23 6 18 5 22 1 25 2 28 6 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 695 451 619 880 618 087 713 549 830 393 davon: Umlaufvermögen total Fr 136 597 98 803 114 349 146 408 186 873 davon: Tiervermögen total Fr 42 091 33 116 39 504 44 779 50 980 davon: Anlagevermögen total Fr 516 763 487 961 464 234 522 362 592 540 davon: Aktiven Betrieb Fr 642 332 581 090 575 729 653 437 759 160 Fremdkapitalquote % 41 42 42 40 41 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 12 143 10 890 10 682 12 597 14 403 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 188 243 129 653 157 470 196 046 269 884 davon: Direktzahlungen Fr 38 615 33 891 37 279 39 439 43 859 Sachkosten Fr 105 256 88 101 92 408 106 261 134 278 Betriebseinkommen Fr 82 987 41 552 65 062 89 785 135 606 Personalkosten Fr 12 494 10 166 8 779 11 276 19 754 Schuldzinsen Fr 7 779 7 383 7 016 7 659 9 059 Pachtzinsen Fr 5 533 3 008 4 186 5 911 9 032 Fremdkosten Fr 131 062 108 657 112 389 131 107 172 123 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 57 181 20 995 45 081 64 939 97 761 Nebeneinkommen Fr 18 700 27 100 18 391 15 414 13 883 Gesamteinkommen Fr 75 881 48 095 63 472 80 353 111 644 Privatverbrauch Fr 61 291 51 346 56 159 63 520 74 154 Eigenkapitalbildung Fr 14 590 -3 251 7 313 16 833 37 490 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 45 468 37 559 40 270 46 443 57 614 Cashflow 3 Fr 42 893 25 058 33 674 45 042 67 822 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 68 84 98 118 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 64 54 64 69 72 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 48 31 46 56 59 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 22 14 23 23 29 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 16 31 16 11 7 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 14 24 15 10 5 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 48 549 25 644 38 727 52 344 74 401 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 4 502 2 959 3 909 4 637 5 727 Kapitalproduktivität 12 % 12 9 7 1 11 3 13 7 17 8 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % -1 8 -7 8 -4 8 -1 0 4 5 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -5 1 -15 8 -10 5 -3 7 5 7 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 34 667 7 839 24 981 39 156 69 767 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 31 435 (Median)
Tabelle 22
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Talregion* 1998/2000
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Talregion: Ackerbauzone plus Übergangszonen
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A23
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 1 624 350 418 427 429 Vertretene Betriebe Anzahl 25 623 6 439 6 379 6 412 6 392 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 19 21 15 34 17 36 19 94 24 23 Offene Ackerfläche ha 9 08 6 63 7 36 9 16 13 19 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 83 1 75 1 80 1 83 1 92 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 26 1 25 1 36 1 29 1 15 Kühe total Anzahl 13 3 10 7 13 8 14 6 14 1 Tierbestand total GVE 23 4 18 6 23 3 24 0 27 7 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 789 239 731 282 739 408 791 608 895 032 davon: Umlaufvermögen total Fr 168 251 127 612 159 675 171 623 214 392 davon: Tiervermögen total Fr 42 339 34 387 41 488 43 913 49 605 davon: Anlagevermögen total Fr 578 649 569 283 538 245 576 072 631 035 davon: Aktiven Betrieb Fr 722 971 681 318 669 179 725 434 816 124 Fremdkapitalquote % 40 41 39 39 40 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 14 024 13 097 13 008 14 190 15 808 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 228 159 168 894 200 513 233 622 309 940 davon: Direktzahlungen Fr 32 948 26 438 30 073 34 418 40 895 Sachkosten Fr 124 949 110 051 114 643 123 334 151 849 Betriebseinkommen Fr 103 210 58 843 85 870 110 288 158 091 Personalkosten Fr 18 565 17 403 14 163 17 157 25 532 Schuldzinsen Fr 8 849 8 960 8 251 8 429 9 755 Pachtzinsen Fr 7 599 4 898 6 218 8 283 11 008 Fremdkosten Fr 159 962 141 312 143 275 157 203 198 143 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 68 197 27 582 57 238 76 419 111 796 Nebeneinkommen Fr 17 631 26 154 16 869 14 120 13 324 Gesamteinkommen Fr 85 828 53 736 74 107 90 539 125 120 Privatverbrauch Fr 69 004 59 694 64 985 70 200 81 200 Eigenkapitalbildung Fr 16 824 -5 958 9 122 20 339 43 920 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 51 540 42 671 49 365 55 318 58 834 Cashflow 3 Fr 48 821 27 129 40 292 51 101 76 893 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 95 64 83 92 130 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 65 51 64 67 74 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 49 28 48 58 60 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 20 12 18 22 28 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 18 36 18 12 7 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 13 24 16 8 5 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 56 532 33 708 47 653 60 349 82 082 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 5 371 3 840 4 955 5 529 6 518 Kapitalproduktivität 12 % 14 3 8 6 12 8 15 2 19 3 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % -0 3 -6 2 -3 0 0 5 6 0 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -2 6 -12 8 -7 1 -1 0 8 1 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 42 941 11 620 32 505 48 391 83 341 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 39 955 (Median)
Tabelle 23
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Hügelregion* 1998/2000
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Hügelregion: Hügelzone und Bergzone I
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A24 A N H A N G
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 1 055 204 250 282 319 Vertretene Betriebe Anzahl 14 992 3 761 3 745 3 727 3 758 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 17 36 12 37 15 39 18 30 23 39 Offene Ackerfläche ha 3 04 1 67 2 33 3 31 4 85 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 63 1 56 1 63 1 62 1 71 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 29 1 24 1 36 1 32 1 23 Kühe total Anzahl 14 9 11 8 14 0 15 9 18 1 Tierbestand total GVE 26 5 20 5 23 8 27 7 34 1 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 660 424 603 108 614 506 662 665 761 310 davon: Umlaufvermögen total Fr 117 730 90 883 107 390 117 423 155 184 davon: Tiervermögen total Fr 46 190 35 406 41 827 48 334 59 197 davon: Anlagevermögen total Fr 496 504 476 819 465 289 496 908 546 929 davon: Aktiven Betrieb Fr 608 328 557 246 565 548 611 177 699 317 Fremdkapitalquote % 45 48 46 44 44 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 10 700 9 375 9 926 10 944 12 558 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 173 429 125 158 151 127 180 133 237 312 davon: Direktzahlungen Fr 38 130 29 879 33 874 39 856 48 908 Sachkosten Fr 99 463 87 111 89 683 99 613 121 426 Betriebseinkommen Fr 73 966 38 047 61 444 80 520 115 886 Personalkosten Fr 9 353 8 601 7 163 8 260 13 372 Schuldzinsen Fr 8 028 8 039 7 442 7 698 8 929 Pachtzinsen Fr 4 575 2 575 3 614 5 154 6 956 Fremdkosten Fr 121 419 106 326 107 902 120 725 150 683 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 52 010 18 832 43 225 59 408 86 629 Nebeneinkommen Fr 20 315 30 525 20 407 15 709 14 574 Gesamteinkommen Fr 72 325 49 357 63 632 75 117 101 203 Privatverbrauch Fr 57 873 49 708 55 151 60 287 66 374 Eigenkapitalbildung Fr 14 452 - 351 8 481 14 830 34 829 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 42 197 39 155 38 316 42 304 49 028 Cashflow 3 Fr 41 226 27 714 33 925 40 837 62 408 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 99 72 89 97 129 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 65 57 65 66 73 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 47 32 45 51 56 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 27 17 27 28 36 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 12 24 14 9 3 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 14 27 14 12 5 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 45 447 24 499 37 770 49 718 67 631 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 4 256 3 078 3 989 4 396 4 945 Kapitalproduktivität 12 % 12 1 6 8 10 9 13 2 16 5 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % -2 2 -7 9 -4 8 -1 3 3 6 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -6 6 -18 1 -11 5 -4 7 4 2 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 32 114 7 607 24 504 36 833 60 296 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 30 439 (Median)
Tabelle 24
Betriebsergebnisse nach Quartilen: Bergregion* 1998/2000
1 Verzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen (1998: 2 81%; 1999: 3 02%; 2000: 3 95%)
2 Bruttoinvestitionen (ohne Eigenleistungen) minus Subventionen und Desinvestitionen
3 Eigenkapitalbildung (ohne Eigenleistungen für Investitionen) plus Abschreibungen plus/minus Veränderungen Vorräte- und Viehvermögen
4 Cashflow zu Investitionen total
5 Anteil Betriebe mit Cashflow > Investitionen total
6 Anteil Fremdkapital <50% und positive Eigenkapitalbildung
7 Anteil Fremdkapital >50% und positive Eigenkapitalbildung
8 Anteil Fremdkapital <50% und negative Eigenkapitalbildung
9 Anteil Fremdkapital >50% und negative Eigenkapitalbildung
10 Betriebseinkommen zu Arbeitskräfte Betrieb
11 Betriebseinkommen zu Landwirtschaftlicher Nutzfläche
12 Betriebseinkommen zu Aktiven Betrieb
13 (Schuldzinsen plus kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Aktiven Betrieb
14 (kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital) zu Eigenkapital Betrieb
15 (Landwirtschaftliches Einkommen minus Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb) zu Familien-Jahresarbeitseinheiten (FJAE)
* Bergregion: Bergzonen II bis IV
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
A N H A N G A25
sortiert nach Arbeitsverdienst Merkmal Einheit Mittel 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0 –25%) (25 –50%) (50 –75%) (75 –100%) Referenzbetriebe Anzahl 913 191 214 238 269 Vertretene Betriebe Anzahl 14 512 3 639 3 622 3 628 3 624 Betriebsstruktur Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 12 13 78 15 69 18 56 24 48 Offene Ackerfläche ha 0 28 0 13 0 16 0 30 0 54 Arbeitskräfte Betrieb JAE 1 59 1 57 1 63 1 59 1 56 davon: Familienarbeitskräfte FJAE 1 38 1 35 1 46 1 41 1 30 Kühe total Anzahl 11 8 9 4 11 0 11 9 15 0 Tierbestand total GVE 20 9 16 9 18 7 21 6 26 4 Kapitalstruktur Aktiven total Fr 566 033 526 395 511 774 568 715 657 445 davon: Umlaufvermögen total Fr 100 187 76 240 92 488 103 038 129 108 davon: Tiervermögen total Fr 37 425 29 717 34 069 38 949 46 993 davon: Anlagevermögen total Fr 428 421 420 438 385 217 426 728 481 344 davon: Aktiven Betrieb Fr 535 079 502 767 488 196 539 179 610 338 Fremdkapitalquote % 40 41 41 39 41 Zinsanspruch Eigenkapital Betrieb 1 Fr 10 308 9 772 9 410 10 442 11 613 Erfolgsrechnung Rohertrag Fr 133 067 100 337 117 769 137 689 176 594 davon: Direktzahlungen Fr 49 124 40 810 45 568 49 798 60 352 Sachkosten Fr 76 469 70 716 70 713 76 389 88 072 Betriebseinkommen Fr 56 598 29 621 47 056 61 300 88 522 Personalkosten Fr 5 017 5 242 3 988 4 483 6 354 Schuldzinsen Fr 5 633 5 539 5 161 5 382 6 448 Pachtzinsen Fr 2 877 2 145 2 309 3 061 3 997 Fremdkosten Fr 89 996 83 643 82 170 89 315 104 871 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 43 071 16 695 35 598 48 374 71 723 Nebeneinkommen Fr 18 923 25 707 18 358 15 902 15 696 Gesamteinkommen Fr 61 994 42 402 53 956 64 276 87 419 Privatverbrauch Fr 51 207 44 036 48 819 53 172 58 830 Eigenkapitalbildung Fr 10 787 -1 634 5 137 11 104 28 589 Investitionen und Finanzierung Investitionen total 2 Fr 38 122 33 880 30 433 39 248 48 952 Cashflow 3 Fr 34 146 22 907 27 316 33 281 53 123 Cashflow-Investitionsverhältnis 4 % 90 69 89 85 111 Betriebe mit Finanzierungsüberschuss 5 % 65 55 64 68 71 Finanzielle Stabilität Betriebe mit guter finanzieller Situation 6 % 48 31 48 53 62 Betriebe mit beschränkter finanz Selbständigkeit 7 % 22 14 17 27 27 Betriebe mit ungenügendem Einkommen 8 % 16 32 19 10 5 Betriebe mit bedenklicher finanzieller Situation 9 % 14 23 16 10 6 Produktivität Arbeitsproduktivität 10 Fr /JAE 35 642 18 844 28 934 38 493 56 713 Flächenproduktivität 11 Fr /ha 3 120 2 153 3 000 3 302 3 608 Kapitalproduktivität 12 % 10 6 5 9 9 6 11 4 14 5 Rentabilität Gesamtkapitalsrentabilität 13 % -4 6 -9 9 -7 5 -3 9 1 4 Eigenkapitalsrentabilität 14 % -9 7 -18 6 -14 7 -8 2 0 6 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 23 770 5 156 17 987 26 956 46 094 (Mittelwert) Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft 15 Fr /FJAE 22 157 (Median)
Tabelle 25
Betriebsergebnisse nach Regionen, Betriebstypen und Quartilen: 1990/92–1998/2000
A26 A N H A N G
Einheit Alle Betriebe Talregion Hügelregion Bergregion Einkommen nach Regionen 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 16 06 18 42 16 66 19 21 15 30 17 36 15 76 18 12 Familienarbeitskräfte FJAE 1 39 1 30 1 36 1 26 1 40 1 29 1 42 1 38 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 62 822 57 181 73 794 68 197 59 838 52 010 45 541 43 071 Nebeneinkommen Fr 16 264 18 700 16 429 17 631 14 544 20 315 17 853 18 923 Gesamteinkommen Fr 79 086 75 881 90 223 85 828 74 382 72 325 63 394 61 994 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 31 025 34 667 36 924 42 941 30 335 32 114 21 201 23 770 Einheit Ackerbau Spezialkulturen Verkehrsmilch Mutterkühe Einkommen nach Betriebstypen 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 21 23 22 34 8 92 12 80 15 30 17 86 15 32 17 07 Familienarbeitskräfte FJAE 1 08 1 04 1 29 1 33 1 42 1 35 1 20 1 11 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 60 284 65 853 67 184 72 405 53 923 50 295 36 627 44 406 Nebeneinkommen Fr 26 928 23 652 21 555 19 334 16 044 17 946 33 558 32 486 Gesamteinkommen Fr 87 212 89 505 88 739 91 739 69 967 68 241 70 185 76 892 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 34 375 49 712 30 334 42 625 26 471 29 308 17 348 29 319 Einheit Anderes Pferde/Schafe/ Veredlung Rindvieh Ziegen Einkommen nach Betriebstypen 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14 20 14 89 Nur sieben 13 33 9 34 11 05 Familienarbeitskräfte FJAE 1 37 1 29 Betriebe 1 14 1 35 1 12 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 38 407 34 299 vorhanden 22 784 86 288 57 572 Nebeneinkommen Fr 20 570 20 915 30 162 14 614 16 151 Gesamteinkommen Fr 58 977 55 214 52 946 100 902 73 723 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 16 793 19 628 13 646 48 182 39 805 Einheit Kombiniert Kombiniert Kombiniert Kombiniert Verkehrsmilch/ Mutterkühe Veredlung Andere Ackerbau Einkommen nach Betriebstypen 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 20 37 23 98 17 93 23 87 15 59 18 53 17 24 19 58 Familienarbeitskräfte FJAE 1 45 1 35 1 24 1 22 1 40 1 31 1 43 1 29 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 75 368 71 330 51 161 62 804 84 363 72 357 66 705 58 563 Nebeneinkommen Fr 11 802 13 507 20 475 23 281 12 032 16 154 15 000 19 814 Gesamteinkommen Fr 87 170 84 837 71 636 86 085 96 395 88 511 81 705 78 377 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 36 420 42 509 27 456 41 639 42 927 44 097 32 732 35 757 Einheit 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Einkommen nach Quartilen (Arbeitsverdienst) 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 1990/92 1998/2000 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14 68 14 05 15 30 16 64 15 78 19 36 18 47 23 66 Familienarbeitskräfte FJAE 1 36 1 29 1 49 1 38 1 42 1 34 1 27 1 19 Landwirtschaftliches Einkommen Fr 26 883 20 995 52 294 45 081 69 198 64 939 102 975 97 761 Nebeneinkommen Fr 27 789 27 100 14 629 18 391 12 064 15 414 10 557 13 883 Gesamteinkommen Fr 54 672 48 095 66 923 63 472 81 262 80 353 113 532 111 644 Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft Fr /FJAE 4 367 7 839 23 592 24 981 36 016 39 156 62 665 69 767 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Ausgaben des Bundes
A N H A N G A27
Tabelle 26 Absatzförderung: Verfügte Mittel Sektor Produkt-Markt-Bereich Rechnung 2000 Verfügte Mittel 2001 Fr Fr Milchproduktion 35 788 653 37 462 604 Käse Ausland 26 975 377 27 730 019 Käse Inland 2 462 776 3 849 000 Milch 6 350 500 5 883 585 Tierproduktion 2 575 391 3 059 894 Fleisch 1 523 571 1 861 144 Eier 720 000 650 000 Fische 8 250 0 Lebende Tiere 313 550 548 750 Honig 10 020 0 Pflanzenbau 5 704 595 6 264 552 Gemüse 1 465 631 1 765 168 Obst 1 613 305 1 904 684 Getreide 1 048 627 770 000 Kartoffeln 1 125 000 750 000 Ölsaaten 452 032 374 700 Zierpflanzen 0 700 000 Gemeinsame Massnahmen 4 170 782 5 151 450 Übergreifende Massnahmen (Bio, IP) 1 539 906 1 911 500 Reserviert für Schlussabrechnungen und längerfristige Verpflichtungen 7 868 615 3 500 000 National 57 647 942 57 350 000 Regional 1 1 873 084 2 500 000 Total 59 521 026 59 850 000 1 rollende Planung Quelle: BLW Ausgaben für Produktion und Absatz
Tabelle 27
Ausgaben Milchwirtschaft
A28 A N H A N G
Bezeichnung Rechnung 1999 Rechnung 2000 Budget 2001 Fr Fr Fr Übergangsmassnahmen und Liquidationen Befristete Übergangsmassnahmen Milch 567 683 912 Liquidation Butyra 5 000 000 Liquidation Schweizerische Käseunion 100 000 000 672 683 912 Marktstützung (Zulagen und Beihilfen) Zulage auf verkäster Milch 108 968 404 280 058 833 320 900 000 Zulage für Fütterung ohne Silage 30 031 589 50 693 222 49 000 000 Inlandbeihilfen für Butter 89 627 206 108 493 186 114 200 000 Inlandbeihilfen für Magermilch und Milchpulver 31 963 298 57 780 162 57 700 000 Inlandbeihilfen für Käse 19 342 307 27 139 882 10 950 000 Ausfuhrbeihilfen für Käse 75 388 626 159 647 903 85 500 000 Ausfuhrbeihilfen für andere Milchprodukte 19 364 575 24 886 812 21 200 000 374 686 005 708 700 000 659 450 000 Marktstützung (Administration) Rekurskommissionen Milchkontingentierung 58 788 83 770 100 000 Administration Milchverwertung und -kontingentierung 4 799 622 7 372 665 6 600 000 4 858 410 7 456 435 6 700 000 Total 1 052 228 327 716 156 435 666 150 000 Quellen: Staatsrechnung, BLW
Tabelle 28
Ausgaben Viehwirtschaft
A N H A N G A29
Bezeichnung Rechnung 1999 Rechnung 2000 Budget 2001 Fr Fr Fr Fleischfonds Entschädigung an private Organisationen Schlachtvieh und Fleisch 4 800 000 7 373 585 Ankauf Rindfleisch für humanitäre Zwecke 6 000 000 0 Einlagerungsbeiträge von Kalbfleisch 3 814 856 1 466 554 Einlagerungsbeiträge Rindfleisch von Banktieren (Muni, Rinder, Ochsen) 1 508 931 2 035 345 Einlagerungsbeiträge Rindfleisch von Verarbeitungstieren (Kühen) 499 716 1 988 930 Verbilligungsbeiträge Rindsstotzen 1 241 387 199 041 Wurstkälberaktion 16 311 0 17 881 201 13 065 455 16 000 000 Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte Umstellungsbeiträge für besonders tierfreundliche Legehennenhaltung 5 840 190 3 388 478 Sammel- und Sortierkostenbeiträge 4 376 741 3 898 951 Aufschlagsaktionen 1 030 045 1 202 531 Verbilligungsaktionen 552 750 729 217 Praxisnahe Versuche beim Geflügel 199 867 121 629 Mehrwertsteuer: Vorsteuerkürzung 108 959 0 12 108 552 9 340 806 13 625 000 Ausfuhrbeihilfen Zucht- und Nutzvieh Exportbeiträge für Zucht- und Nutzvieh aus dem Berggebiet 919 700 2 768 200 Ausstellungen 512 860 20 803 Entlastungskäufe und übrige Massnahmen 162 721 0 1 595 281 2 789 003 17 000 000 Verwertungsbeiträge Schafwolle 1 000 000 1 000 000 800 000 Total 32 585 034 26 193 264 47 425 000 Quellen: Staatsrechnung, BLW
Tabelle 29
Ausgaben Pflanzenbau
A30 A N H A N G
Bezeichnung Rechnung 1999 Rechnung 2000 Budget 2001 Fr Fr Fr Ackerbaubeiträge 53 043 064 56 391 275 37 580 000 Flächenbeiträge für Ölsaaten 3 191 737 27 175 149 32 250 000 Flächenbeiträge für Körnerleguminosen 3 409 376 3 671 201 3 654 000 Flächenbeiträge für Faserpflanzen 940 425 525 190 800 000 Anbauprämien für Futtergetreide 45 501 526 25 019 735 876 000 Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge 122 960 705 90 687 642 98 220 000 Zuckerrübenverarbeitung 32 589 784 46 829 775 48 000 000 Ölsaatenverarbeitung 36 809 863 1 481 824 4 000 000 Kartoffelverarbeitung 12 367 967 18 909 564 19 500 000 Saatgutproduktion 2 066 126 3 465 960 3 600 000 Obstverwertung 39 126 965 19 283 193 21 495 000 Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe 0 717 326 1 625 000 Förderung des Weinbaus 7 175 779 5 746 598 7 120 700 Sachausgaben 88 199 81 263 83 500 Förderung des Rebbaus 1 349 030 1 061 542 1 100 000 Verwertungsmassnahmen 1 5 738 550 4 603 793 5 937 200 Total 183 179 548 152 825 515 142 920 700 1 Weinabsatzförderung im Ausland Quellen: Staatsrechnung, BLW
Ausgaben für Direktzahlungen
Tabelle 30
Entwicklung der Direktzahlungen
A N H A N G A31
1999 2000 Beitragsart 1 000 Fr 1 000 Fr Total Direktzahlungen 2 105 327 2 164 967 Allgemeine Direktzahlungen 1 778 807 1 803 658 Flächenbeiträge 1 163 094 1 186 770 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 254 624 258 505 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 255 882 251 593 Allgemeine Hangbeiträge 95 882 96 714 Hangbeiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 9 325 10 076 Ökologische Direktzahlungen 326 520 361 309 Ökobeiträge 258 788 278 981 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 100 674 108 130 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 35 135 33 398 Beiträge für extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland (Übergangsbestimmung bis Ende 2000) 17 652 17 150 Beiträge für den biologischen Landbau 11 637 12 185 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 93 690 108 118 Sömmerungsbeiträge 67 571 81 238 Gewässerschutzbeiträge 161 1 090 Quelle: BLW
Tabelle 31a
Allgemeine Direktzahlungen 2000
A32 A N H A N G
Flächenbeiträge Beiträge
Nutztiere Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe RGVE Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 3 933 71 299 81 656 183 2 000 14 065 12 067 800 BE 13 235 188 613 222 489 468 8 643 53 558 48 322 602 LU 5 275 76 810 91 197 863 3 098 18 458 17 146 207 UR 696 6 685 7 665 906 638 5 288 4 574 181 SZ 1 765 24 015 27 133 288 1 539 13 249 11 536 226 OW 733 8 103 9 357 179 635 3 691 3 276 496 NW 516 6 098 7 026 440 422 2 325 2 028 969 GL 440 7 224 8 595 561 422 3 506 3 098 798 ZG 614 10 700 12 327 698 407 2 688 2 403 884 FR 3 451 75 686 88 455 839 2 218 14 855 13 275 834 SO 1 482 31 422 36 241 329 987 8 212 7 184 661 BL 983 21 308 24 442 179 679 5 703 4 976 753 SH 600 13 981 15 624 759 249 2 267 2 025 752 AR 800 12 047 14 154 172 659 4 451 4 117 365 AI 607 7 277 8 688 924 391 2 099 2 115 915 SG 4 662 72 580 83 815 725 3 554 26 442 22 813 141 GR 2 915 51 470 59 016 740 2 776 34 618 28 435 534 AG 3 257 57 907 66 561 901 1 643 12 106 10 600 927 TG 2 864 49 736 58 111 340 942 5 590 4 678 817 TI 955 12 865 14 664 487 749 6 898 5 331 266 VD 4 171 104 982 118 940 350 1 920 17 534 15 447 584 VS 4 041 36 899 40 620 001 2 516 18 136 13 101 899 NE 1 007 33 104 36 868 217 718 6 848 6 232 564 GE 334 10 874 10 653 599 96 1 246 1 029 296 JU 1 137 38 215 42 460 670 945 14 278 12 682 197 Schweiz 60 473 1029 899 1186 769 818 38 846 298 112 258 504 668 Zone 1 Tal 25 615 481 194 552 878 415 10 899 77 507 67 444 422 Hügel 8 506 143 727 166 838 240 5 363 35 677 31 005 465 BZ I 7 852 119 363 138 656 422 6 029 37 937 33 259 616 BZ II 9 517 155 501 178 544 715 7 823 63 340 56 926 768 BZ III 5 921 85 141 98 129 424 5 746 55 652 47 262 079 BZ IV 3 062 44 972 51 722 602 2 986 27 998 22 606 318
Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
für Raufutter verzehrende
1
Tabelle 31b
Allgemeine Direktzahlungen 2000
A N H A N G A33
Tierhaltung unter Allgemeine Hangbeiträge Hangbeiträge Steil- und erschwerenden Bedingungen Terrassenlagen im Rebbau Total Total Total Betriebe RGVE Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Betriebe Fläche Beiträge Anzahl Anzahl Fr Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 852 11 337 3 565 855 828 5 331 2 187 963 212 196 374 655 BE 9 384 115 898 64 060 450 8 756 48 366 20 285 876 67 107 349 929 LU 3 177 40 951 18 529 450 3 375 21 735 9 072 311 10 16 27 120 UR 689 7 619 6 637 343 645 4 729 2 243 069 000 SZ 1 566 19 973 11 666 514 1 524 10 186 4 358 654 10 7 13 980 OW 699 9 176 5 385 601 673 4 858 2 231 970 10 750 NW 481 6 368 3 360 054 462 3 847 1 719 639 000 GL 397 5 166 3 839 832 387 3 362 1 527 361 12 7 950 ZG 394 5 415 2 519 490 376 3 051 1 249 210 10 930 FR 1 919 28 124 10 576 815 1 645 7 465 2 950 461 20 14 21 430 SO 618 8 101 3 135 659 595 5 013 1 922 938 000 BL 707 9 224 2 598 739 695 6 127 2 354 211 39 36 61 905 SH 124 1 528 260 675 147 874 328 314 123 96 158 100 AR 794 10 610 6 100 054 792 6 635 2 794 851 28 24 425 AI 598 7 841 5 204 374 581 3 368 1 405 031 000 SG 3 022 40 116 19 461 926 3 078 25 338 10 565 184 75 105 280 625 GR 2 798 34 494 33 252 111 2 709 31 416 13 724 728 31 23 51 045 AG 1 112 14 270 2 985 162 1 235 7 892 3 030 895 124 170 289 140 TG 168 2 396 824 582 149 1 188 527 429 81 102 157 470 TI 707 7 233 5 901 017 596 3 134 1 383 395 179 163 315 020 VD 1 353 18 561 8 153 310 1 028 5 874 2 328 740 350 520 1 871 910 VS 2 512 21 695 19 860 297 2 404 12 959 5 808 527 1 402 1 641 5 818 205 NE 830 12 397 7 500 298 596 3 537 1 330 260 55 81 153 555 GE 000000 48 58 89 265 JU 806 11 820 6 213 510 604 3 581 1 382 521 26 9 090 Schweiz 35 707 450 313 251 593 118 33 880 229 867 96 713 538 2 833 3 352 10 076 499 Zone 1 Tal 2 303 32 727 2 988 916 2 113 569 645 2 286 660 1 787 2 251 6 712 235 Hügel 7 945 104 933 27 108 851 7 372 3 893 567 15 224 926 194 285 731 373 BZ I 7 556 97 987 43 314 273 7 143 4 802 299 19 617 806 201 235 677 436 BZ II 9 003 114 608 78 407 082 8 445 6 209 709 26 237 620 500 526 1 758 605 BZ III 5 857 66 923 61 889 128 5 783 4 837 045 21 270 534 106 43 156 530 BZ IV 3 043 33 135 37 884 868 3 024 2 674 427 12 075 992 45 12 40 320 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
umgerechnet in Aren
2 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet 3 SG, OW, AR, SZ: Ohne NHG-Flächen und entsprechende Sockelbeiträge
A34 A N H A N G
Ökologischer Ausgleich 1 Biologischer Landbau Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 3 845 8 153 11 108 458 311 5 674 1 165 475 BE 12 823 17 947 16 381 414 1 179 16 341 2 296 676 LU 5 255 8 637 9 387 067 229 3 466 513 824 UR 693 1 228 624 653 36 392 39 569 SZ3 1 644 2 440 2 150 366 108 1 616 164 499 OW 3 732 1 072 899 320 97 1 193 120 440 NW 519 937 750 825 49 645 67 176 GL 437 1 131 687 515 67 1 114 111 121 ZG 615 1 525 1 627 373 68 1 185 137 794 FR 3 356 5 952 5 955 925 71 1 215 349 457 SO 1 468 3 870 4 494 006 105 2 601 399 348 BL 975 3 198 4 086 339 120 2 608 440 206 SH 571 1 408 1 968 541 15 307 95 929 AR 3 652 639 547 794 130 2 053 205 872 AI 442 483 349 484 22 331 33 021 SG 3 4 283 6 038 6 858 755 420 6 820 780 155 GR 2 844 14 872 5 887 107 1 075 21 490 2 324 369 AG 3 205 6 690 8 706 732 183 3 134 758 141 TG 2 798 4 978 6 806 186 177 2 789 731 652 TI 852 1 531 1 032 444 86 1 254 185 486 VD 3 851 7 806 9 148 575 79 1 471 419 732 VS 2 367 5 766 3 258 408 186 2 639 470 094 NE 775 1 941 1 469 101 37 1 013 151 339 GE 291 643 1 050 702 5 82 53 816 JU 1 102 2 966 2 892 466 49 1 388 169 714 Schweiz 56 395 111 851 108 129 556 4 904 82 822 12 184 905 Zone 2 Tal 24 111 43 245 58 884 749 982 16 186 4 585 204 Hügel 8 370 16 626 19 297 401 484 8 095 1 360 989 BZ I 7 505 11 460 10 080 179 633 9 579 1 158 615 BZ II 8 143 13 551 9 303 813 1 031 16 742 1 736 100 BZ III 5 391 14 486 6 043 829 1 045 18 402 1 945 169 BZ IV 2 875 12 483 4 519 585 729 13 818 1 398 828
Hochstammobstbäume
Tabelle 32a Ökobeiträge 2000
1
Quelle: BLW
Tabelle 32b
Ökobeiträge 2000
A N H A N G A35
Extensive Produktion von Besonders tierfreundliche Haltung Getreide und Raps landwirtschaftlicher Nutztiere Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe GVE Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 1 745 6 664 2 661 570 1 757 53 821 6 324 034 BE 6 288 19 530 7 810 786 7 665 170 708 21 755 863 LU 1 626 4 082 1 632 624 3 272 112 422 13 639 756 UR 000 306 4 519 570 587 SZ 27 36 14 300 757 16 971 2 118 961 OW 12 800 364 8 055 1 016 436 NW 000 225 5 846 718 856 GL 68 3 112 253 5 783 743 941 ZG 89 192 76 748 349 11 533 1 383 334 FR 1 422 6 450 2 579 977 2 083 72 464 9 167 461 SO 907 4 468 1 782 184 881 23 951 2 879 433 BL 728 3 722 1 471 015 456 16 168 1 901 681 SH 360 2 740 1 079 859 211 8 506 962 617 AR 000 525 12 459 1 621 592 AI 000 367 8 775 1 188 861 SG 488 1 018 398 487 2 372 70 886 8 902 879 GR 391 983 392 957 2 048 45 770 5 633 103 AG 1 935 8 134 3 251 959 1 492 46 081 5 495 340 TG 1 039 3 212 1 283 749 1 563 55 325 6 506 820 TI 85 118 122 371 674 13 052 1 557 380 VD 1 916 12 381 4 947 407 1 551 54 505 6 372 754 VS 148 423 166 570 848 9 975 1 260 133 NE 499 3 147 1 257 623 561 19 030 2 260 558 GE 181 2 466 946 909 46 1 675 183 980 JU 601 3 802 1 517 457 807 34 985 3 952 014 Schweiz 20 482 83 577 33 398 464 31 433 883 266 108 118 374 Zone 1 Tal 11 916 55 327 22 102 587 12 131 426 566 50 925 071 Hügel 4 749 17 332 6 924 472 4 782 144 165 17 737 584 BZ I 2 545 8 004 3 203 789 4 369 112 715 14 116 941 BZ II 1 002 2 607 1 044 916 5 195 116 542 14 802 024 BZ III 222 268 107 316 3 301 56 731 7 181 239 BZ IV 48 38 15 384 1 655 26 546 3 355 515 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN,
bewirtschaftet Quelle: BLW
die ein Betrieb in einer Zone
Tabelle 33a
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2000
der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
OW, AR, SZ: Ohne NHG-Flächen und entsprechende Sockelbeiträge
A36 A N H A N G
Extensiv genutzte Wiesen Wenig intensiv genutzte Wiesen Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 3 043 3 588 5 049 166 1 275 1 181 751 118 BE 6 819 5 532 5 201 819 8 171 6 940 3 375 693 LU 3 858 3 464 3 519 881 2 657 1 974 1 027 244 UR 378 443 226 068 507 635 200 496 SZ 2 790 651 463 764 672 593 250 129 OW 2 581 617 396 359 227 144 60 701 NW 371 446 279 504 233 190 81 235 GL 384 777 461 391 189 242 91 197 ZG 311 241 276 760 294 215 118 423 FR 1 833 1 788 2 265 570 2 250 2 905 1 680 896 SO 1 123 1 666 2 035 763 722 966 561 251 BL 706 925 1 087 115 499 626 379 517 SH 509 758 1 056 045 211 232 151 127 AR 2 275 125 90 957 432 285 129 246 AI 255 177 124 699 128 96 43 156 SG 2 2 058 1 390 1 562 670 2 347 1 782 971 212 GR 2 084 5 067 2 441 197 2 507 9 418 2 905 082 AG 2 410 2 823 3 789 452 1 489 1 268 817 103 TG 1 625 1 232 1 798 917 1 365 895 578 623 TI 496 571 437 228 454 770 273 642 VD 2 674 3 169 4 189 483 1 532 2 575 1 346 396 VS 885 1 246 720 409 1 729 3 737 1 263 901 NE 417 575 571 955 500 1 154 535 478 GE 253 416 623 700 20 38 24 627 JU 716 983 1 139 475 693 1 243 651 782 Schweiz 34 854 38 672 39 809 343 31 103 40 106 18 269 274 Zone 1 Tal 16 974 16 804 24 567 442 10 499 9 164 5 884 086 Hügel 4 974 4 872 5 677 591 5 009 4 761 2 986 524 BZ I 3 676 3 180 2 308 012 4 495 3 952 1 810 074 BZ II 4 110 4 246 2 862 706 4 931 6 238 2 739 436 BZ III 3 235 5 677 2 620 190 3 737 7 738 2 358 193 BZ IV 1 885 3 893 1 773 402 2 432 8 252 2 490 961
Quelle: BLW
1 Zuteilung
2 SG,
Tabelle 33b
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2000
1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
2 SG, OW, AR, SZ: Ohne NHG-Flächen und entsprechende Sockelbeiträge
A N H A N G A37
Streueflächen Hecken, Feld- und Ufergehölze Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 1 147 1 249 1 698 256 924 184 265 411 BE 748 535 335 117 1 995 427 443 648 LU 209 96 125 515 286 59 79 206 UR 39 37 27 531 10 84 SZ 2 554 435 295 659 20 159 OW 2 77 34 27 034 10 1 884 NW 116 95 81 483 15 2 1 279 GL 54 44 30 786 10 2 1 146 ZG 293 506 390 248 175 42 45 822 FR 83 39 40 232 771 235 311 554 SO 000 310 90 111 673 BL 000 241 70 85 285 SH 86 9 210 215 61 84 774 AR 2 57 11 7 581 42 9 6 345 AI 183 156 108 983 61 11 7 546 SG 2 415 164 146 306 185 35 41 631 GR 73 36 17 428 110 29 23 387 AG 96 50 72 794 971 288 377 039 TG 166 89 128 534 470 93 137 686 TI 28 31 44 570 12 3 4 142 VD 89 66 50 287 1 082 346 468 092 VS 53 18 12 336 292 78 55 179 NE 33 2 058 124 47 44 686 GE 35 8 235 112 34 50 940 JU 22 9 7 771 327 129 129 239 Schweiz 4 516 3 712 3 667 952 8 743 2 275 2 776 834 Zone 1 Tal 1 392 1 299 1 930 117 5 129 1 260 1 865 482 Hügel 555 405 478 982 1 598 425 509 562 BZ I 658 458 347 450 895 259 188 269 BZ II 1 030 870 601 436 771 248 174 720 BZ III 622 451 206 702 279 69 32 597 BZ IV 259 227 103 265 71 14 6 205
Quelle: BLW
Tabelle 33c
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2000
A38 A N H A N G
Buntbrachen Rotationsbrachen Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl ha Fr Kanton ZH 307 182 545 340 132 147 367 900 BE 198 103 309 835 95 104 258 924 LU 62 36 107 910 16 17 42 075 UR 000000 SZ 000000 OW 000000 NW 000000 GL 13 7 800 000 ZG 88 24 000 23 7 900 FR 88 71 214 060 56 69 173 137 SO 30 18 54 900 30 38 95 050 BL 109 74 220 890 42 60 150 225 SH 111 57 170 490 35 57 141 950 AR 000000 AI 000000 SG 93 84 250 830 13 10 25 300 GR 12 7 22 020 88 19 550 AG 292 105 315 960 109 104 259 975 TG 94 58 175 170 55 72 179 800 TI 5 11 32 520 2 22 55 750 VD 207 292 877 170 154 186 464 900 VS 68 97 290 220 18 32 79 975 NE 27 30 90 990 12 27 67 325 GE 54 58 172 620 32 33 81 500 JU 30 21 63 420 19 31 76 600 Schweiz 1 796 1 315 3 946 145 830 1 019 2 547 836 Zone 1 Tal 1 493 1 126 3 379 516 712 887 2 218 214 Hügel 290 182 546 420 117 130 324 122 BZ I 95 16 429 12 5 500 BZ II 31 3 390 000 BZ III 10 390 000 BZ IV 000000 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 33d
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2000
1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A N H A N G A39
Ackerschonstreifen Hochstamm-Feldobstbäume Betriebe Fläche Total Beiträge Betriebe Bäume Total Beiträge Anzahl ha Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 21 6 5 690 2 682 161 698 2 425 434 BE 36 14 13 580 8 750 429 259 6 438 887 LU 91 1 010 4 460 298 945 4 484 176 UR 000 250 11 360 170 400 SZ 000 1 084 76 039 1 140 585 OW 000 499 27 621 414 315 NW 000 379 20 487 307 305 GL 000 146 6 344 95 160 ZG 000 544 50 948 764 222 FR 000 2 003 84 511 1 267 404 SO 41 1 460 1 207 108 927 1 633 905 BL 10 1 1 300 937 144 134 2 162 013 SH 71 1 440 388 23 567 353 505 AR 000 362 20 911 313 665 AI 000 76 4 340 65 100 SG 81 1 390 3 256 257 313 3 859 405 GR 31 550 570 30 555 458 325 AG 24 5 5 480 2 703 204 592 3 068 774 TG 14 4 3 840 2 372 253 592 3 803 617 TI 000 218 12 303 184 559 VD 34 9 8 980 2 220 116 231 1 743 465 VS 000 724 55 745 836 175 NE 30 400 185 10 414 156 210 GE 10 2 2 230 121 5 790 86 850 JU 61 1 080 680 54 874 823 110 Schweiz 189 48 48 430 36 816 2 470 500 37 056 566 Zone 1 Tal 154 43 43 138 17 979 1 266 129 18 991 332 Hügel 32 5 5 162 7 336 584 563 8 768 441 BZ I 30 130 6 042 360 269 5 403 699 BZ II 000 4 086 194 787 2 921 799 BZ III 000 1 172 55 040 825 601 BZ IV 000 201 9 712 145 694
Quelle: BLW
Tabelle 34
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2000
nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet
A40 A N H A N G
Brotgetreide Futtergetreide Raps Total Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche Total Beiträge Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Fr Kanton ZH 1 275 4 092 1 309 2 282 200 290 2 661 570 BE 3 783 8 734 5 661 10 330 346 467 7 810 786 LU 936 1 625 1 379 2 353 73 104 1 632 624 UR 0000000 SZ 55 24 30 11 14 300 OW 120000 800 NW 0000000 GL 006800 3 112 ZG 24 40 77 141 8 12 76 748 FR 861 3 130 1 265 3 121 97 198 2 579 977 SO 634 2 284 810 2 065 69 118 1 782 184 BL 547 1 872 674 1 753 46 97 1 471 015 SH 344 2 144 196 496 62 100 1 079 859 AR 0000000 AI 0000000 SG 174 286 414 689 24 43 398 487 GR 164 427 354 544 8 11 392 957 AG 1 584 4 654 1 673 3 286 142 194 3 251 959 TG 824 2 088 679 992 84 132 1 283 749 TI 11 45 10 73 00 122 371 VD 998 5 929 1 617 5 274 518 1 179 4 947 407 VS 97 292 98 126 15 166 570 NE 197 909 484 2 105 50 132 1 257 623 GE 135 1 481 166 880 22 105 946 909 JU 303 1 470 542 2 180 50 153 1 517 457 Schweiz 12 897 41 508 17 438 38 727 1 801 3 342 33 398 464 Zone 1 Tal 8 576 31 557 9 495 21 059 1 430 2 711 22 102 587 Hügel 3 085 7 586 4 311 9 219 317 527 6 924 472 BZ I 1 032 2 091 2 424 5 813 50 101 3 203 789 BZ II 147 225 955 2 379 43 1 044 916 BZ III 47 43 208 225 00 107 316 BZ IV 10 6 45 33 00 15 384 1 Zuteilung
Fläche
Quelle: BLW
der
Tabelle 35
Beiträge für besonders tierfreundliche Haltung von Nutztieren 2000
A N H A N G A41
Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme Regelmässiger Auslauf im Freien Betriebe GVE Total Beiträge Betriebe GVE Total Beiträge Anzahl Anzahl Fr Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 891 18 688 1 577 920 1 656 35 114 4 746 114 BE 2 579 41 825 4 297 963 7 475 128 884 17 457 900 LU 1 900 41 748 4 212 484 3 095 70 674 9 427 272 UR 57 703 55 907 304 3 816 514 680 SZ 205 3 733 328 762 740 13 238 1 790 199 OW 124 1 982 193 867 348 6 074 822 569 NW 109 2 004 201 306 216 3 843 517 550 GL 42 748 63 197 253 5 034 680 744 ZG 170 3 494 306 186 335 8 039 1 077 148 FR 1 105 21 468 2 176 343 1 949 50 996 6 991 118 SO 441 7 399 650 203 819 16 552 2 229 230 BL 242 5 662 489 375 441 10 507 1 412 306 SH 157 4 521 427 729 173 3 985 534 888 AR 120 1 746 175 006 523 10 713 1 446 586 AI 99 1 936 255 364 360 6 839 933 497 SG 828 17 678 1 709 550 2 306 53 208 7 193 329 GR 478 8 856 658 308 2 046 36 914 4 974 795 AG 770 16 654 1 528 273 1 368 29 416 3 967 067 TG 788 20 325 1 815 553 1 450 35 001 4 691 267 TI 200 3 184 233 497 670 9 868 1 323 883 VD 882 20 785 1 806 792 1 396 33 719 4 565 962 VS 93 1 318 99 551 835 8 657 1 160 582 NE 205 5 258 417 783 547 13 773 1 842 775 GE 21 575 44 732 42 1 100 139 248 JU 437 12 948 1 022 959 774 22 037 2 929 055 Schweiz 12 943 265 236 24 748 610 30 121 618 000 83 369 764 Zone 1 Tal 6 724 158 722 14 877 304 11 244 267 823 36 047 767 Hügel 2 371 46 408 4 494 730 4 528 97 751 13 242 854 BZ I 1 633 27 166 2 554 268 4 279 85 548 11 562 673 BZ II 1 352 21 181 1 944 602 5 134 95 360 12 857 422 BZ III 604 8 102 614 776 3 286 48 629 6 566 463 BZ IV 259 3 658 262 930 1 650 22 888 3 092 585 1 Zuteilung der Fläche nach Hauptanteil der LN, die ein Betrieb in einer Zone bewirtschaftet Quelle: BLW
Tabelle 36
Sömmerungsbeiträge 2000
A42 A N H A N G
Betriebe Kühe Milchziegen Milchschafe Übrige Schafe Übrige Raufutter Beiträge gemolken verzehrende Tiere Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Fr Kanton ZH 10 0 11 00 741 126 360 BE 1 994 27 995 3 635 70 25 292 68 878 17 084 148 LU 266 1 287 168 0 2 640 9 343 1 813 432 UR 384 4 079 510 1 16 268 7 000 2 130 277 SZ 444 3 229 789 0 9 323 18 760 3 364 829 OW 284 4 494 206 0 2 737 7 654 2 466 493 NW 134 1 530 168 0 2 022 4 186 1 117 643 GL 119 3 582 132 0 4 173 5 813 1 883 889 ZG 5 32 200 175 30 152 FR 651 7 578 694 0 5 098 32 402 6 311 478 SO 67 170 20 77 4 383 676 792 BL 14 0000 854 121 464 SH 10000 141 25 904 AR 123 1 329 199 00 2 892 746 610 AI 144 1 710 380 0 912 3 111 941 883 SG 454 9 257 694 4 14 745 27 973 5 816 162 GR 1 055 20 214 3 568 454 64 789 85 764 13 863 885 AG 6000 192 310 40 000 TG 20000 155 20 713 TI 233 4 888 5 468 6 13 768 5 932 2 472 821 VD 681 12 012 294 327 7 876 31 696 8 722 375 VS 530 12 921 257 0 54 191 16 218 6 744 035 NE 165 812 30 852 6 391 1 171 637 GE 1000 723 0 10 169 JU 201 3 256 33 0 1 245 11 640 3 535 075 Total 7 968 120 375 17 213 862 226 923 352 412 81 238 226 Quelle: BLW
Tabelle 37a
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2000
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der FAT 2
alte Kuhhalterbeiträge, alter 31a Betriebsbeitrag, alte IP-Beiträge, kantonale und private Ökobeiträge
A N H A N G A43
Talzone HZ Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 756 432 157 282 147 38 Vertretene Betriebe Anzahl 10273 5655 2706 3621 1514 676 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 28 24 15 36 10 14 89 23 96 37 71 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 19 649 30 806 44 195 25 517 39 315 59 459 Flächenbeiträge Fr 18 049 28 389 40 315 17 433 28 444 43 232 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 1 454 2 205 3 639 2 597 4 080 9 323 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 70 106 87 3 528 3 639 3 827 Hangbeiträge Fr 76 106 154 1 959 3 152 3 077 Ökobeiträge total Fr 5 494 7 762 11 334 5 579 8 253 11 248 Ökologischer Ausgleich Fr 2 312 3 091 5 047 2 121 3 750 4 493 Extensive Produktion Fr 786 1 136 1 724 733 1 221 2 375 Biologischer Landbau Fr 303 278 477 237 89 203 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 2 093 3 257 4 086 2 488 3 193 4 177 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 25 143 38 568 55 529 31 096 47 568 70 707 Rohertrag Fr 191 458 274 693 358 754 171 839 245 915 311 146 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 13 1 14 0 15 5 18 1 19 3 22 7 Andere Direktzahlungen 2 Fr 1 243 2 184 4 317 1 117 3 058 4 848 Total Direktzahlungen Fr 26 386 40 752 59 846 32 213 50 626 75 555 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 13 8 14 8 16 7 18 7 20 6 24 3
Sömmerungsbeiträge,
Quelle:
Anbaubeiträge,
FAT
Tabelle 37b
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2000
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der FAT
2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, alte Kuhhalterbeiträge, alter 31a Betriebsbeitrag, alte IP-Beiträge,kantonale und private Ökobeiträge
A44 A N H A N G
BZ I BZ II Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 243 111 41 227 131 69 Vertretene Betriebe Anzahl 3 057 1 264 636 3 209 1 486 894 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 14 90 24 40 35 13 15 23 24 37 37 56 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 30 966 44 361 56 440 37 664 48 857 64 879 Flächenbeiträge Fr 17 686 28 766 40 723 17 658 27 148 40 786 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 3 345 4 889 4 733 5 701 6 913 9 135 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 6 579 6 845 6 916 10 118 10 202 10 734 Hangbeiträge Fr 3 356 3 861 4 068 4 187 4 594 4 224 Ökobeiträge total Fr 4 385 6 286 9 145 3 278 5 130 7 171 Ökologischer Ausgleich Fr 1 379 1 893 2 487 1 168 1 591 2 318 Extensive Produktion Fr 254 596 1 886 30 95 467 Biologischer Landbau Fr 302 341 363 240 596 532 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 2 450 3 456 4 409 1 840 2 848 3 854 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 35 351 50 647 65 585 40 942 53 987 72 050 Rohertrag Fr 159 713 217 729 260 544 137 169 178 377 228 087 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 22 1 23 3 25 2 29 8 30 3 31 6 Andere Direktzahlungen 2 Fr 889 1 557 3 435 1 615 2 748 3 055 Total Direktzahlungen Fr 36 240 52 204 69 020 42 557 56 735 75 105 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 22 7 24 0 26 5 31 0 31 8 32 9
Quelle:
FAT
Tabelle 37c
Direktzahlungen auf Betriebsebene1: nach Zonen und Grössenklassen 2000
A N H A N G A45
BZ III BZ IV Merkmal Einheit 10 – 20 20 – 30 30 – 50 10 – 20 20 – 30 30 – 50 ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN ha LN Referenzbetriebe Anzahl 122 64 21 77 40 18 Vertretene Betriebe Anzahl 1 923 875 280 1 378 526 295 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 15 22 24 52 35 40 14 57 24 45 34 10 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 44 689 60 860 75 737 46 258 62 635 77 008 Flächenbeiträge Fr 17 054 27 766 39 915 16 859 27 276 40 954 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 9 713 12 279 13 425 9 118 11 476 11 177 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 12 926 14 072 14 944 15 287 17 621 17 268 Hangbeiträge Fr 4 996 6 743 7 453 4 994 6 262 7 609 Ökobeiträge total Fr 2 846 4 315 6 737 2 507 4 566 6 476 Ökologischer Ausgleich Fr 1 013 1 557 2 445 1 278 2 059 3 626 Extensive Produktion Fr 0 13 175 00 14 Biologischer Landbau Fr 337 665 1 226 283 752 1 326 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 1 496 2 080 2 891 946 1 755 1 510 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 47 535 65 175 82 474 48 765 67 201 83 484 Rohertrag Fr 114 277 156 270 195 708 98 288 149 279 164 977 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 41 6 41 7 42 1 49 6 45 0 50 6 Andere Direktzahlungen 2 Fr 2 244 2 493 4 801 1 693 3 691 4 741 Total Direktzahlungen Fr 49 779 67 668 87 275 50 458 70 892 88 225 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 43 6 43 3 44 6 51 3 47 5 53 5 1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der FAT 2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, alte Kuhhalterbeiträge, alter 31a Betriebsbeitrag, alte IP-Beiträge, kantonale und private Ökobeiträge Quelle: FAT
Tabelle 38
Direktzahlungen auf Betriebsebene1 : nach Regionen 2000
1 Die Ergebnisse basieren auf den Daten der zentralen Auswertung der FAT
2 Sömmerungsbeiträge, Anbaubeiträge, alte Kuhhalterbeiträge, alter 31a Betriebsbeitrag, alte IP-Beiträge, kantonale und private Ökobeiträge
A46 A N H A N G
Merkmal Einheit Alle Tal- Hügel- BergBetriebe region region region Referenzbetriebe Anzahl 3 419 1 517 1 017 885 Vertretene Betriebe Anzahl 53 896 25 094 14 588 14 214 Landwirtschaftliche Nutzfläche ha 18 78 19 41 17 83 18 63 Direktzahlungen nach Direktzahlungsverordnung (DZV) Allgemeine Direktzahlungen total Fr 31 858 24 416 31 976 44 876 Flächenbeiträge Fr 21 513 22 321 20 734 20 885 Raufutterverzehrerbeiträge Fr 3 953 1 912 3 680 7 835 Beiträge für Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Fr 4'428 69 4'871 11'671 Hangbeiträge Fr 1 964 114 2 691 4 485 Ökobeiträge total Fr 5 542 6 560 5 607 3 677 Ökologischer Ausgleich Fr 2 239 2 870 2 045 1 324 Extensive Produktion Fr 652 957 699 64 Biologischer Landbau Fr 316 301 218 443 Besonders tierfreundliche Nutztierhaltung Fr 2 335 2 432 2 645 1 846 Total Direktzahlungen nach DZV Fr 37 400 30 976 37 583 48 553 Rohertrag Fr 199 145 242 054 183 249 139 707 Anteil Direktzahlungen nach DZV am Rohertrag % 19 13 21 35 Direktzahlungen pro ha Fr /ha 1 991 1 596 2 108 2 606 Andere Direktzahlungen 2 Fr 1 907 1 968 1 552 2 166 Total Direktzahlungen Fr 39 307 32 944 39 135 50 719 Anteil Direktzahlungen total am Rohertrag % 19 7 13 6 21 4 36 3
Quelle:
FAT
Ausgaben für Grundlagenverbesserung
Tabelle 39
An die Kantone ausbezahlte Beiträge 2000
A N H A N G A47
Kanton Bodenverbesserungen Landwirtschaftliche Gebäude Total Beiträge Fr Fr Fr ZH 1 850 118 410 600 2 260 718 BE 11 570 555 2 929 900 14 500 455 LU 2 938 222 1 171 200 4 109 422 UR 819 618 1 022 400 1 842 018 SZ 1 807 327 1 075 000 2 882 327 OW 489 560 608 000 1 097 560 NW 274 780 225 565 500 345 GL 347 620 557 800 905 420 ZG 11 000 199 200 210 200 FR 3 805 399 2 555 400 6 360 799 SO 1 709 940 196 600 1 906 540 BL 270 143 498 948 769 091 SH 75 000 201 500 276 500 AR 155 372 853 100 1 008 472 AI 492 966 298 000 790 966 SG 4 445 092 2 660 500 7 105 592 GR 9 958 507 2 149 400 12 107 907 AG 1 011 661 560 000 1 571 661 TG 1 191 201 25 800 1 217 001 TI 1 416 475 1 370 380 2 786 855 VD 6 391 430 808 300 7 199 730 VS 5 771 685 3 587 017 9 358 702 NE 858 942 1 132 500 1 991 442 GE 300 000 300 000 JU 2 856 093 1 049 065 3 905 158 Diverse 35 216 35 216 Total 60 853 922 26 146 175 87 000 097 Quelle: BLW
Tabelle 40
Beiträge an genehmigte Projekte nach Massnahmen und Gebieten 2000
A48 A N H A N G
Massnahme Beiträge Gesamtkosten Talregion Hügelregion Bergregion Total Total 1 000 Fr Bodenverbesserungen Landumlegungen (inkl Infrastrukturmassnahmen) 9 749 5 832 11 543 27 124 81 635 Wegebauten 208 1 350 10 599 12 157 40 828 Übrige Transportanlagen 00 245 245 757 Massnahmen zum Boden-Wasserhaushalt 446 - 1 392 1 838 6 259 Wasserversorgungen - 3 225 5 460 8 685 30 817 Elektrizitätsversorgungen - 142 338 480 1 922 Wiederherstellungen und Sicherungen 30 595 5 462 6 087 15 823 Grundlagenbeschaffungen 4 27 31 108 Total 10 437 11 144 35 066 56 647 178 149 Landwirtschaftliche Gebäude Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere - 7 496 16 171 23 667 148 515 Hofdüngeranlagen - 215 279 494 4 239 Alpgebäude 1 124 1 124 8 216 Gemeinschaftsgebäude für Verarbeitung und Lagerung - 70 42 112 990 Total - 7 781 17 616 25 397 161 960 Gesamttotal 10 437 18 925 52 682 82 044 340 109 Quelle: BLW
Tabelle 41
Von den Kantonen bewilligte Investitionskredite 2000
A N H A N G A49
Kanton Gemeinschaftliche Einzelbetriebliche Total Massnahmen Massnahmen Baukredite Investitionskredite Investitionskredite Anzahl 1 000 Fr Anzahl 1 000 Fr Anzahl 1 000 Fr Anzahl 1 000 Fr ZH 3 195 123 14 354 126 14 549 BE 30 6 335 12 1 039 413 39 844 455 47 218 LU 1 320 16 1 029 222 23 389 239 24 738 UR 1 200 1 30 23 2 126 25 2 356 SZ 26 4 709 54 5 804 80 10 513 OW 4 209 40 3 522 44 3 731 NW 14 1 507 14 1 507 GL 2 205 10 1 273 12 1 478 ZG 33 4 192 33 4 192 FR 9 686 191 19 920 200 20 606 SO 3 1 186 6 683 60 5 933 69 7 802 BL 35 4 173 35 4 173 SH 1 20 23 2 036 24 2 056 AR 1 30 46 3 533 47 3 563 AI 3 110 40 2 921 43 3 031 SG 1 200 4 234 216 21 682 221 22 116 GR 14 5 615 7 339 118 11 161 139 17 115 AG 1 24 134 13 070 135 13 094 TG 1 40 96 11 488 97 11 528 TI 2 800 7 326 21 2 030 30 3 156 VD 1 200 31 2 498 171 16 214 203 18 912 VS 22 4 536 13 1 365 80 7 493 115 13 394 NE 5 350 48 4 361 53 4 711 GE 2 380 5 463 7 843 JU 3 200 93 9 469 96 9 669 Total 101 24 101 132 9 992 2 309 231 958 2 542 266 051 Quelle: BLW
Tabelle 42
Gliederung der Investitionskredite nach Massnahmenkategorien 2000 (ohne Baukredite)
A50 A N H A N G
Kanton Starthilfe Kauf des Wohn- Ökonomie- Boden- Verarbeitung Gemein- Total Betriebes gebäude gebäude verbes- und Lagerung schaftlicher durch serungen landw InventarPächter Produkte kauf 1 000 Fr ZH 4 255 441 2 686 7 132 35 14 549 BE 10 920 615 8 909 19 694 745 40 883 LU 7 205 7 605 8 580 796 232 24 418 UR 270 1 210 676 2 156 SZ 1 890 2 047 1 867 5 804 OW 580 984 1 985 162 20 3 731 NW 90 980 436 1 506 GL 130 274 1 029 45 1 478 ZG 1 840 280 252 1 820 4 192 FR 4 310 272 3 060 12 278 340 70 276 20 606 SO 2 910 156 1 000 1 867 643 40 6 616 BL 1 685 445 164 1 879 4 173 SH 710 50 1 276 20 2 056 AR 1 240 845 1 448 30 3 563 AI 620 979 1 323 110 3 032 SG 7 030 120 3 764 10 971 30 21 915 GR 2 760 3 749 4 772 38 131 50 11 500 AG 6 587 1 472 5 011 24 13 094 TG 3 765 1 523 6 240 11 528 TI 650 90 1 581 15 20 2 356 VD 7 215 118 1 641 8 312 675 751 18 712 VS 620 1 922 5 508 580 25 202 8 857 NE 1 532 190 544 2 095 235 115 4 711 GE 390 73 380 843 JU 2 180 1 332 5 857 200 100 9 669 Total 71 384 2 637 47 082 113 710 2 854 2 432 1 849 241 948 Quelle: BLW
Tabelle 43
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 2000 (Bundes- und Kantonsanteile)
A N H A N G A51
Kanton Anzahl Summe pro Fall Tilgungsdauer 1 000 Fr Fr Jahre ZH 10 709 70 900 15 2 BE 85 7 971 93 776 13 6 LU 33 3 716 112 606 17 3 UR 1 100 100 000 20 0 SZ 7 679 97 000 13 2 OW 4 270 67 500 14 0 NW 2 140 70 000 14 0 GL ZG FR 6 505 84 167 10 8 SO 6 523 87 167 12 8 BL 8 535 66 875 5 1 SH 1 75 75 000 10 0 AR 9 461 51 222 8 3 AI 2 142 71 000 7 5 SG 21 1 940 92 381 14 0 GR 2 190 95 000 17 5 AG 9 1 010 112 222 14 2 TG 5 430 86 000 11 6 TI 4 370 92 500 17 0 VD 29 3 968 136 828 11 2 VS 66 6 943 105 197 10 5 NE 3 175 58 333 9 6 GE JU 03 210 70 000 8 6 Total 316 31 062 98 297 12 7 Quelle: BLW
Tabelle 44
Übersicht über Beiträge, Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen
A52 A N H A N G
Massnahme Genehmigte Projekte 1999 Genehmigte Projekte 2000 1 000 Fr Beiträge 75 654 82 044 Landumlegungen und Infrastrukturmassnahmen 30 814 27 124 Wegebauten 10 600 12 157 Wasserversorgungen 5 807 8 685 andere Tiefbaumassnahmen 3 310 8 681 Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere 22 055 23 667 andere Hochbaumassnahmen 3 068 1 730 Investitionskredite 1 204 719 241 951 Ökonomiegebäude 102 547 113 710 Starthilfe 57 525 71 385 Wohngebäude 33 679 47 082 Gemeinschaftlicher Inventurkauf, Verarbeitung und 5 264 4 182 Lagerung landwirtschaftlicher Produkte Kauf Betrieb durch Pächter 2 949 2 737 Bodenverbesserungen 2 755 2 855 Betriebshilfedarlehen 2 18 057 31 062 Total 298 430 355 057 1 vom Kanton bewilligte Kredite 2 vom Kanton bewilligte Darlehen Quelle: BLW
Tabelle 45
Finanzhilfen für die Tierzucht 2000
A N H A N G A53
Tierart Betrag Züchter Herdebuchtiere Zuchtorganisationen Fr Anzahl Rindvieh 14 722 000 32 500 543 665 8 Herdebuchführung 2 713 000 Milch- und Fleischleistungsprüfungen 11 230 000 Exterieurbeurteilungen 779 000 Pferde 1 091 000 8 500 10 500 18 Schweine 1 792 000 280 16 882 2 Herdebuchzucht 668 000 Mastleistungsprüfungs-Anstalt Sempach 1 124 000 Schafe 1 169 000 5 680 85 278 2 Ziegen und Milchschafe 808 000 4 622 23 596 4 Herdebuchzucht 599 000 Milchleistungsprüfungen 209 000 Gefährdete Rassen 102 000 2 Total 19 684 000 679 921 31 Quellen: Staatsrechnung/Zuchtorganisationen
Anmerkung: Die Staatsrechnung 1999 bildet die Basis für die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Aufgabengebiete
So wurden z B die Aufwendungen für die Kartoffel- und Obstverwertung oder die Ausgaben für die Getreideverwaltung
1990/92 als Ausgaben des BLW einbezogen Zu diesem Zeitpunkt gab es dafür noch separate Rechnungen
Die Zahlen für 1990/92 sowie 1998 sind deshalb nicht identisch mit den Angaben in der Staatsrechnung
Die Zunahme der Verwaltungsausgaben ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Leistungen wie z B für die Pensionskassen in der Staatsrechnung nicht mehr zentral geführt sondern auf die einzelnen Ämter aufgeteilt werden
Quellen: Staatsrechnung BLW
A54 A N H A N G Tabelle 46 Ausgaben des Bundes für Landwirtschaft und Ernährung, in 1 000 Fr Ausgabenbereich 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Ausgaben BLW 2 699 442 3 518 568 3 794 868 3 359 161 31 8 Produktion und Absatz 1 684 994 1 203 247 1 317 539 954 696 -31 2 Absatzförderung 49 546 59 521 Milchwirtschaft 1 127 273 966 885 1 052 228 716 156 -19 1 Viehwirtschaft 133 902 34 743 32 585 26 193 -76 7 Pflanzenbau 423 819 201 619 183 180 152 826 -57 7 Direktzahlungen 772 258 2 125 689 2 285 600 2 114 470 181 7 Allgemeine Direktzahlungen 758 332 1 329 503 1 846 188 1 758 985 116 9 Ökologische Direktzahlungen 13 926 796 186 439 412 355 485 3708 4 Grundlagenverbesserung 208 761 147 153 148 467 245 503 -13 6 Strukturverbesserungen 133 879 76 400 76 400 88 000 -40 0 Investitionskredite 27 136 20 000 20 000 100 000 72 0 Betriebshilfe 952 2 000 4 987 7 753 416 1 Beratungswesen und Forschungsbeiträge 21 476 22 164 23 226 22 015 4 6 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge 1 449 5 639 3 354 6 735 261 8 Pflanzen- und Tierzucht 23 869 20 950 20 500 21 000 -12 8 Verwaltung 33 429 42 479 43 262 44 492 29 9 Weitere Ausgaben 348 163 407 432 402 132 368 329 12 8 Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte 93 867 136 747 129 466 111 842 34 3 Familienzulagen in der Landwirtschaft 77 996 92 600 90 420 91 230 17 2 Landwirtschaftliche Forschungsanstalten 96 431 97 060 99 472 117 619 8 6 Gestüt 6 843 8 825 5 525 6 514 1 6 Übriges 73 026 72 199 77 249 54 687 -6 8 Total Landwirtschaft und Ernährung 3 047 605 3 926 000 4 197 000 3 727 490 29 6
Tabellen Internationale Aspekte
Tabelle 47
Produzentenpreise tierische Erzeugnisse
1 Bei der EU-4 handelt es sich um die Nachbarländer Deutschland (D) Frankreich (F) Italien (I) und Österreich (A)
2 Bei Italien für 2000 mit entsprechendem EG-Index der Erzeugerpreise absoluten Wert errechnet
BLW, SBV, Eurostat, U S Department of Agriculture
A N H A N G A55
Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Rohmilch CH Rp /kg 104 97 82 10 80 93 79 41 -23 EU-4 1 Rp /kg 56 33 50 79 48 70 49 08 -12 - D Rp /kg 55 40 50 62 48 08 49 16 -11 - F Rp /kg 48 97 48 92 47 03 47 20 -3 - I 2 Rp /kg 69 20 56 48 54 58 54 08 -20 - A Rp /kg 66 27 46 64 46 37 45 14 -31 USA Rp /kg 40 57 49 25 47 60 45 81 17 Muni CH Fr /kg SG 9 28 7 38 7 77 8 90 -14 EU-4 1 Fr /kg SG 5 64 4 97 4 80 4 71 -14 - D Fr /kg SG 5 38 4 46 4 27 4 18 -20 - F Fr /kg SG 5 58 4 58 4 47 4 39 -20 - I Fr /kg SG 5 86 5 13 5 06 4 88 -14 - A Fr /kg SG 6 53 4 62 4 42 4 39 -31 USA Fr /kg SG 3 40 2 86 3 14 3 82 -4 Schweine CH Fr /kg SG 5 83 4 80 4 38 4 69 -21 EU-4 1 Fr /kg SG 2 98 2 01 1 85 2 23 -32 - D Fr /kg SG 2 77 1 93 1 80 2 20 -29 - F Fr /kg SG 2 86 1 97 1 82 2 17 -30 - I 2 Fr /kg SG 3 50 2 42 2 15 2 52 -32 - A Fr /kg SG 3 38 1 66 1 53 1 87 -50 USA Fr /kg SG 1 81 1 27 1 30 1 94 -17 Poulets CH Fr /kg LG 3 72 2 97 2 84 2 81 -23 EU-4 1 Fr /kg LG 1 64 1 22 1 12 1 15 -29 - D Fr /kg LG 1 41 1 19 1 08 1 07 -21 - F Fr /kg LG 1 31 1 13 1 01 1 02 -20 - I 2 Fr /kg LG 1 91 1 44 1 36 1 45 -26 - A Fr /kg LG 2 28 1 33 1 26 1 22 -44 USA Fr /kg LG 0 98 1 27 1 21 1 34 29 Eier CH Fr /100 St 33 29 24 33 22 21 20 98 -32 EU-4 1 Fr /100 St 11 62 8 90 8 17 10 01 -22 - D Fr /100 St 13 58 9 89 8 83 10 65 -28 - F Fr /100 St 8 66 6 45 5 87 7 02 -26 - I 2 Fr /100 St 12 94 11 75 11 08 13 11 -7 - A Fr /100 St 12 81 7 50 6 62 13 47 -28 USA Fr /100 St 7 55 7 93 7 53 9 10 8
Quellen:
■■■■■■■■■■■■■■■■
1 Bei der EU-4 handelt es sich um die Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
2 Bei Italien für 2000 mit entsprechendem EG-Index der Erzeugerpreise absoluten Wert errechnet
3 EU-4 plus Niederlande (NL) und Belgien (B)
4 Durchschnitt der Jahre 1990/93 und Veränderung 1990/93–1997/2000
Quellen: BLW, SBV, Eurostat, U S Department of Agriculture
A56 A N H A N G
48a Produzentenpreise pflanzliche Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Weizen CH Fr /100 kg 99 34 75 65 75 41 66 35 -27 EU-4 1 Fr /100 kg 30 00 18 65 18 20 18 00 -39 - D Fr /100 kg 27 94 17 97 17 72 17 81 -36 - F Fr /100 kg 28 54 18 62 18 09 17 65 -37 - I 2 Fr /100 kg 36 15 23 61 22 87 23 75 -35 - A Fr /100 kg 43 38 17 05 16 95 16 73 -61 USA Fr /100 kg 15 32 15 45 14 25 15 88 -1 Gerste CH Fr /100 kg 70 24 50 13 48 83 48 52 -30 EU-4 1 Fr /100 kg 26 81 17 11 17 17 16 94 -36 - D Fr /100 kg 25 39 16 22 16 34 15 85 -36 - F Fr /100 kg 25 83 17 53 17 72 17 61 -32 - I 2 Fr /100 kg 34 75 22 76 22 74 23 76 -34 - A Fr /100 kg 36 27 16 10 15 73 14 90 -57 USA Fr /100 kg 12 30 11 49 10 85 13 15 -4 Körnermais CH Fr /100 kg 73 54 53 21 51 91 47 65 -31 EU-4 1 Fr /100 kg 33 91 20 60 21 17 20 33 -39 - D Fr /100 kg 31 13 20 13 18 45 17 29 -40 - F Fr /100 kg 29 84 19 35 19 65 19 27 -35 - I 2 Fr /100 kg 41 09 23 38 24 95 23 59 -42 - A Fr /100 kg 36 60 17 05 16 98 16 91 -54 USA Fr /100 kg 12 76 12 56 11 16 22 36 20 Kartoffeln CH Fr /100 kg 38 55 35 27 37 76 36 12 -6 EU-6 3 Fr /100 kg 23 68 20 76 23 83 10 32 -23 - D Fr /100 kg 22 70 16 58 20 60 9 56 -31 - F Fr /100 kg 15 65 20 98 23 99 10 51 18 - I 2 Fr /100 kg 44 08 38 69 43 96 37 12 -9 - A Fr /100 kg 30 46 17 00 16 85 17 33 -44 - NL Fr /100 kg 16 47 23 77 26 27 5 40 12 - B Fr /100 kg 12 63 18 09 17 06 6 41 10 USA Fr /100 kg 18 08 18 06 19 47 21 31 8 Zuckerrüben CH Fr /100 kg 14 84 13 99 11 85 11 58 -16 EU-4 1 Fr /100 kg 7 49 6 66 6 39 6 20 -14 - D Fr /100 kg 8 06 7 02 6 88 6 43 -16 - F Fr /100 kg 5 88 5 57 5 27 5 41 -8 - I 2 Fr /100 kg 9 65 8 28 7 91 7 46 -18 - A (ab 92) Fr /100 kg 8 87 7 59 7 47 7 27 -16 USA Fr /100 kg - - - -Raps CH Fr /100 kg 203 67 147 89 146 11 61 26 -42 EU-4 1 Fr /100 kg 49 10 35 96 26 45 28 42 -38 - D Fr /100 kg 53 62 35 33 26 21 27 72 -45 - F Fr /100 kg 42 19 36 67 26 94 29 33 -27 - I Fr /100 kg 53 08 - - -- A (ab 92) Fr /100 kg 53 03 32 05 20 52 22 68 -53 USA Fr /100 kg - - - -Äpfel: Golden Delicious CH 4 Fr /kg 1 12 0 60 1 06 0 86 -25 EU-4 1 Fr /kg 0 85 0 51 0 53 0 47 -41 - D Fr /kg 0 95 0 56 0 56 0 49 -43 - F Fr /kg 0 76 0 50 0 57 0 46 -33 - I 2 Fr /kg 0 88 0 51 0 47 0 46 -45 - A (diverse) Fr /kg 1 07 0 40 0 45 0 40 -61 USA (diverse) Fr /kg 0 66 0 59 0 59 0 73 -3
Tabelle
1 Durchschnitt der Jahre 1990/93 und Veränderung 1990/93–1997/2000
2 Bei der EU-4 handelt es sich um die Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
3 Bei Italien für 2000 mit entsprechendem EG-Index der Erzeugerpreise absoluten Wert errechnet
4 EU-4 plus Niederlande (NL) und Belgien (B)
A N H A N G A57 Tabelle 48b Produzentenpreise pflanzliche Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Birnen I CH 1 Fr /kg 1 33 0 78 1 09 0 88 -20 EU-4 2 Fr /kg 1 05 0 75 0 74 0 70 -30 - D Fr /kg 1 09 0 73 0 76 0 56 -37 - F Fr /kg 1 17 1 11 0 95 0 95 -14 - I 3 Fr /kg 0 98 0 65 0 67 0 64 -34 - A (ab 92) Fr /kg 1 21 0 72 0 81 0 60 -41 USA Fr /kg 0 57 0 54 0 64 0 58 2 Karotten CH Fr /kg 1 09 1 18 1 05 1 15 3 EU-6 4 Fr /kg 0 62 0 48 0 53 0 48 -20 - D Fr /kg 0 48 0 46 0 49 0 31 -13 - F Fr /kg 0 44 0 44 0 58 0 47 12 - I 3 Fr /kg 0 84 0 67 0 71 0 70 -17 - A Fr /kg 0 41 0 25 0 33 0 28 -30 - NL Fr /kg 0 39 0 41 0 47 0 51 19 - B Fr /kg 0 36 0 27 0 14 0 15 -48 USA Fr /kg 0 41 0 38 0 55 0 51 17 Zwiebeln CH Fr /kg 0 89 1 03 0 96 1 02 13 EU-5 (EU-6 ohne NL) Fr /kg 0 63 0 55 0 46 0 44 -24 - D Fr /kg 0 33 0 29 0 20 0 16 -35 - F Fr /kg 0 60 0 77 0 70 0 66 18 - I 3 Fr /kg 0 71 0 60 0 52 0 54 -22 - A (ab 92) Fr /kg 0 28 0 36 0 16 0 16 -17 - NL Fr /kg - - - -- B Fr /kg 0 21 0 49 0 25 0 19 45 USA Fr /kg 0 40 0 50 0 45 0 45 18 Tomaten CH Fr /kg 2 42 1 89 1 92 2 15 -18 EU-6 4 Fr /kg 1 10 0 89 0 82 0 93 -20 - D Fr /kg 0 95 0 96 1 04 1 09 9 - F Fr /kg 1 32 1 15 1 13 1 38 -7 - I 3 Fr /kg 0 91 0 79 0 74 0 84 -13 - A (ab 92) Fr /kg 1 08 0 77 0 80 0 92 -23 - NL Fr /kg 1 26 1 34 1 15 1 17 -3 - B Fr /kg 1 23 1 17 1 08 1 39 -1 USA Fr /kg 1 00 1 16 0 93 1 17 8
BLW SBV Eurostat U S Department of Agriculture
Quellen:
1 Bei der EU-4 handelt es sich um die Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
zu Land: (min) und (max) –> jeweils in einem Jahr ausgewiesener tiefster, resp höchster Preis des betreffenden Landes; ohne Jahreszahl gilt der Wert für alle Jahre, ausser ein anderes Land – mit Hinweis auf Jahr – wird aufgeführt
Quellen: BLW, BFS, ZMP (D), nationale Statistikämter von F, B, A, USA, Statistikamt der Stadt Turin (I)
A58 A N H A N G
Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Frischmilch CH Fr /l 1 85 1 66 1 58 1 55 -14 EU-4 1 Fr /l 1 30 1 14 1 13 1 09 -13 - D (min) Fr /l 1 07 0 96 0 93 0 86 -14 - I (max) Fr /l 1 82 1 77 1 75 1 77 -3 USA Fr /l 1 04 1 03 1 13 1 24 9 Käse CH-Emmentaler Fr /kg 20 15 20 65 20 66 20 18 2 EU-4 1 (mit B, ohne F) Fr /kg 15 98 13 15 13 55 12 65 -18 - D (min) Fr /kg 13 52 10 88 11 30 10 09 -20 - B (max) Fr /kg 17 63 17 69 17 51 17 13 -1 USA (Cheddar) Fr /kg 11 14 11 33 12 49 14 26 14 Butter CH Fr /kg 13 76 12 00 11 68 11 76 -14 EU-4 1 Fr /kg 9 04 8 37 8 17 8 01 -10 - D (min) Fr /kg 6 81 6 26 5 92 5 70 -12 - I (max) Fr /kg 12 90 12 50 12 25 12 01 -5 USA Fr /kg 5 96 9 14 8 79 9 38 53 Rahm CH Fr / 1⁄4 l 3 58 3 07 2 95 2 79 -18 EU-3 (EU-4 mit B, ohne F+I) Fr / 1⁄4 l 1 25 1 01 1 01 0 96 -21 - D (min) Fr / 1⁄4 l 1 13 0 93 0 93 0 87 -20 - B / A-90/92 (max) Fr / 1⁄4 l 2 53 1 66 1 67 1 64 -34 USA Fr / 1⁄4 l - - - -Braten Rind CH Fr /kg 26 34 23 52 24 09 27 73 -5 EU-4 1 Fr /kg 16 00 15 10 15 14 14 92 -6 - F (min) Fr /kg 11 85 11 80 11 92 11 76 -0 - A (max) Fr /kg 24 32 24 46 24 21 23 93 -0 USA Fr /kg 9 26 8 71 9 15 10 95 4 Braten Schwein CH Fr /kg 18 43 17 60 16 75 18 60 -4 EU-4 1 Fr /kg 11 80 11 76 10 95 10 99 -5 - D / A-90/92 (min) Fr /kg 10 00 10 56 9 79 9 66 0 - I (max) Fr /kg 13 67 13 56 12 57 12 43 -6 USA Fr /kg - - - -Koteletten Schwein CH Fr /kg 19 88 17 91 18 26 19 80 -6 EU-4 1 Fr /kg 10 62 9 89 9 07 9 24 -11 - D (min) Fr /kg 9 71 9 17 8 30 8 39 -11 - I / A-99 + 00 (max) Fr /kg 12 43 11 45 10 42 10 36 -14 USA Fr /kg 10 02 10 30 10 51 12 54 11 Schinken CH Fr /kg 25 56 27 23 26 18 27 13 5 EU-4 1 Fr /kg 22 13 20 82 19 94 19 70 -9 - F / D-90/92 + 00 (min) Fr /kg 20 38 19 10 18 07 18 63 -9 - I (max) Fr /kg 27 15 25 27 24 59 23 17 -10 USA Fr /kg 8 85 8 99 9 49 12 54 17 Poulets frisch CH Fr /kg 8 41 8 42 8 43 8 49 0 EU-4 1 Fr /kg 5 72 5 19 4 93 4 90 -13 - F (min) Fr /kg 4 84 3 91 3 82 3 86 -20 - I (max) Fr /kg 6 17 6 13 5 71 5 89 -4 USA Fr /kg 2 74 3 33 3 50 3 99 32 Eier CH Fr /Sk 0 57 0 57 0 57 0 58 2 EU-4 1 (mit B, ohne F) Fr /Sk 0 25 0 26 0 25 0 25 2 - B (min) Fr /Sk 0 22 0 21 0 20 0 21 -8 - A (max) Fr /Sk 0 33 0 36 0 35 0 34 4 USA Fr /Sk 0 10 0 13 0 13 0 15 32
Tabelle 49 Konsumentenpreise tierische Erzeugnisse
Anmerkung
1 Bei der EU-4 handelt es sich um die Nachbarländer Deutschland (D), Frankreich (F), Italien (I) und Österreich (A)
2 Durchschnitt der Jahre 1990/93 und Veränderung 1990/93–1997/2000 Anmerkung
jeweils in einem Jahr
Preis des betreffenden Landes; ohne Jahreszahl gilt der Wert für alle Jahre, ausser ein anderes Land – mit Hinweis auf Jahr – wird aufgeführt
Quellen: BLW, BFS, ZMP (D), nationale Statistikämter von F, B, A, USA, Statistikamt der Stadt Turin (I)
A N H A N G A59 Tabelle 50 Konsumentenpreise pflanzliche Erzeugnisse Schweiz – diverse Länder Produkt Land Einheit 1990/92 1998 1999 2000 1990/92–1998/2000 % Weissmehl CH Fr /kg 2 05 1 80 1 80 1 75 -13 EU-4 1 (mit B, ohne F) Fr /kg 1 10 0 99 0 94 0 91 -13 - B / D-90/92 (min) Fr /kg 0 79 0 83 0 82 0 79 3 - A (max) Fr /kg 1 67 1 01 1 02 1 00 -39 USA Fr /kg 0 75 0 96 0 97 1 08 34 Weissbrot CH Fr /1⁄2 kg 2 09 2 05 2 02 1 83 -6 EU-4 1 Fr /1⁄2 kg 1 49 1 53 1 53 1 50 2 - D Roggenbrot (min) Fr /1⁄2 kg 1 16 1 03 1 06 0 99 -11 - A (max) Fr /1⁄2 kg 2 98 2 86 2 85 2 98 -3 USA Fr /1⁄2 kg 1 12 1 37 1 47 1 73 37 Kartoffeln CH Fr /kg 1 43 1 66 1 77 1 87 24 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 0 92 1 02 1 09 1 00 12 - B / D-00 (min) Fr /kg 0 56 0 72 0 84 0 74 38 - F / A-90/92 (max) Fr /kg 1 27 1 52 1 57 1 50 20 USA Fr /kg 1 04 1 20 1 31 1 41 26 Zucker CH Fr /kg 1 65 1 52 1 50 1 41 -11 EU-3 (EU-4 mit B, ohne F+I) Fr /kg 1 75 1 61 1 57 1 54 -10 - B (min) Fr /kg 1 67 1 51 1 50 1 46 -11 - A (max) Fr /kg 1 89 1 73 1 71 1 66 -10 USA Fr /kg 1 22 1 32 1 38 1 52 15 Pflanzenöl CH - Sonnenblumen Fr /l 5 05 4 44 4 46 3 96 -15 EU-4 1 (mit B / ohne D) Fr /l 2 11 2 40 2 48 2 34 14 - I-Soja/Soblu (min) Fr /l 1 94 2 18 2 26 2 12 13 - F-Soblu / A-90/92 Speiseöl Fr /l 2 70 2 57 2 64 2 50 -5 USA - Salatöl (kg) Fr /l 2 71 3 25 3 46 3 90 30 Äpfel: Golden Delicious CH 2 Fr /kg 3 15 3 10 2 98 3 40 0 EU-4 1 (F/A: div Sorten) Fr /kg 3 10 2 48 2 49 2 37 -21 - I / A-90/92 (min) Fr /kg 2 94 2 19 2 27 1 97 -27 - F / D-90/92 (max) Fr /kg 3 25 2 73 2 70 2 72 -16 USA Fr /kg 2 58 3 01 2 97 3 42 21 Birnen CH 2 Fr /kg 3 25 3 32 3 26 3 36 2 EU-4 1 Fr /kg 3 43 2 89 2 66 2 75 -19 - I / D-90/92 (min) Fr /kg 3 32 2 57 2 39 2 40 -26 - A / F-90/92 + 00 (max) Fr /kg 3 62 3 29 2 95 3 17 -13 USA Fr /kg 2 52 2 98 3 15 3 59 29 Bananen CH Fr./kg 2.52 2.83 2.82 2.83 12 EU-4 1 Fr /kg 2 61 2 45 2 30 2 17 -12 - D (min) Fr /kg 1 89 2 32 2 14 1 99 14 - A / I-90/92 (max) Fr /kg 3 56 2 92 2 69 2 46 -24 USA Fr /kg 1 45 1 58 1 63 1 87 16 Karotten CH Fr./kg 1.91 1.87 1.78 1.78 -5 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 1 71 1 43 1 53 1 32 -17 - B (min) Fr /kg 1 06 1 12 1 23 0 94 4 - I / A-99 (max) Fr /kg 2 32 1 61 1 97 1 55 -26 USA Fr /kg 1 35 1 79 1 86 2 09 42 Zwiebeln CH Fr./kg 1.86 2.14 2.03 1.94 10 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 1 54 1 79 1 55 1 48 4 - B (min) Fr /kg 0 92 1 27 1 05 0 92 17 - F / I-90/92 (max) Fr /kg 1 75 2 42 2 07 1 92 22 USA Fr /kg 1 29 - - -Tomaten CH Fr./kg 3.73 3.31 3.18 3.50 -11 EU-5 (EU-4 plus B) Fr /kg 3 60 3 07 2 96 3 37 -13 - D/A-98 / B-90/92 (min) Fr /kg 3 35 2 95 2 58 2 97 -15 - I / F-98 (max) Fr /kg 4 41 3 37 3 37 3 81 -20 USA (Freiland) Fr /kg 3 29 4 71 4 54 5 15 46
–>
ausgewiesener tiefster,
höchster
zu Land: (min) und (max)
resp
■■■■■■■■■■■■■■■■ Karten Direktzahlungen
Karte 1
Landwirtschaftliche Nutzfläche der Betriebe mit Anspruch auf Direktzahlungen 2000
ha pro Betrieb 1
■ 0
■ <10
■ 10 –19,9
■ 20 –29,9
■ ≥30
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, LN total dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
A60 A N H A N G
Karte 2
Nutztierbestand der Betriebe mit Anspruch auf Direktzahlungen 2000
GVE pro Betrieb 1
■ 0
■ <10
■ 10 –19,9
■ 20 –29,9
■ ≥30
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, massgebender GVE-Bestand dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
A N H A N G A61
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
Karte 3
Flächenbeiträge 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <12 000
■ 12 000– 23 999
■ 24 000– 35 999
■ ≥36 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
A62 A N H A N G
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
Karte 4
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <4 000
■ 4 000– 7 999
■ 8 000– 11 999
■ ≥12 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
Quelle: BLW
Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
A N H A N G A63
Karte 5
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <4 000
■ 4 000– 7 999
■ 8 000– 11 999
■ ≥12 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
A64 A N H A N G
Karte 6
Allgemeine Hangbeiträge 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
A N H A N G A65
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
Karte 7
Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <1 000
■ 1 000– 1 999
■ 2 000– 2 999
■ ≥3 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
A66 A N H A N G
Karte 8
Beiträge für den ökologischen Ausgleich 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
A N H A N G A67
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
Karte 9
Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <1 000
■ 1 000– 1 999
■ 2 000– 2 999
■ ≥3 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
A68 A N H A N G
Karte 10
Beiträge für den biologischen Landbau 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
A N H A N G A69
Karte 11
Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <1 000
■ 1 000– 1 999
■ 2 000– 2 999
■ ≥3 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
A70 A N H A N G
Karte 12
Beiträge für den regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) 2000
Fr pro Betrieb 1
■ 0
■ <2 000
■ 2 000– 3 999
■ 4 000– 5 999
■ ≥6 000
■ Sömmerungsgebiet
1 pro Gemeinde, Summe der Beiträge für die Massnahme dividiert durch Gesamtzahl der Betriebe mit Direktzahlungen
A N H A N G A71
Quelle: BLW Kartendaten GG25 © Bundesamt für Landestopografie (BA013557)
■■■■■■■■■■■■■■■■ Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft
Gesetze
– Bundesgesetz vom 29 April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910 1)
– Bundesgesetz vom 20 März 1959 über die Brotgetreideversorgung des Landes (Getreidegesetz, SR 916 111 0)
Bundesgesetz vom 4 Oktober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB, SR 211 412 11)
– Bundesgesetz vom 4 Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG, SR 221 213 2)
–
Bundesgesetz vom 8 Oktober 1982 über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG, SR 531)
Bundesgesetz vom 13 Dezember 1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632 111 72)
–
Zolltarifgesetz vom 9 Oktober 1986 (ZGT, SR 632 10)
Bundesgesetz vom 20 März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz, SR 232 16)
Bundesgesetz vom 20 Juni 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG, SR 836 1) –
–
Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, SR 700)
Bundesgesetz vom 9 Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817 0)
– Bundesgesetz vom 24 Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG, SR 814 20) – Tierschutzgesetz vom 9 März 1978 (TSchG, SR 455)
Bundesgesetz vom 1 Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451)
– Bundesgesetz vom 7 Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG, SR 814 01)
Verordnungen
Allgemeines
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV, SR 910 91)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Erhebung und Bearbeitung von landwirtschaftlichen Daten (Landwirtschaftliche Datenverordnung, SR 919 117 71)
Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (SR 919.118)
Produktion und Absatz
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Branchen- und Produzentenorganisationen (SR 919 117 72)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Unterstützung der Absatzförderung von Landwirtschaftsprodukten (Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung, SR 916 010)
– Verordnung vom 28 Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung, SR 910 12)
– Verordnung vom 22 September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die entsprechende Kennzeichnung der pflanzlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung, SR 910 18)
– Verordnung vom 3 November 1999 über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV, SR 916.51)
Allgemeine Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV, SR 916 01)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Kontingentierung der Milchproduktion (Milchkontingentierungsverordnung, MKV, SR 916 350 1)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über Zielpreis, Zulagen und Beihilfen im Milchbereich (Milchpreisstützungsverordnung, MSV, SR 916 350 2)
– Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über die Höhe der Beihilfen für Milchprodukte sowie über Vorschriften für den Buttersektor und die Einfuhr von Vollmilchpulver (SR 916.350.21)
A72 A N H A N G
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Verordnung vom 7 Dezember 1999 für den Übergang zur neuen Milchmarktordnung (Übergangsverordnung Milch, SR 916 350 3)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in der Milchwirtschaft (Milchqualitätsverordnung, MQV, SR 916 351 0)
– Verordnung vom 13. April 1999 über die Qualitätssicherung bei der Milchproduktion (SR 916.351.021.1)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten, Speiseöl und Speisefetten sowie von Kaseinen und Kaseinaten (Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung, VEMSK, SR 916 355 1)
– Verordnung des BLW vom 30 März 1999 über die Buttereinfuhr (SR 916 357 1)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung (Pferdeeinfuhrverordnung, PfEV, SR 916 322 1)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Schlachtvieh- und Fleischmarkt (Schlachtviehverordnung, SV, SR 916 341)
– Geflügelverordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 (SR 916 341 61)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion (Höchstbestandesverordnung, HBV, SR 916 344)
Verordnung vom 7 Juli 1971 über die Verwertung der inländischen Schafwolle (SR 916 361)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Eiermarkt (Eierverordnung, EiV, SR 916 371)
– Eierverordnung des EVD vom 18. Juni 1996 (SR 916.371.1)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über Flächen- und Verarbeitungsbeiträge im Ackerbau (Ackerbaubeitragsverordnung, ABBV, SR 910 17)
– Allgemeine Verordnung vom 16 Juni 1986 zum Getreidegesetz (SR 916 111 01)
Verordnung des EVD vom 16 Juni 1986 über die Brotgetreideversorgung des Landes (Brotgetreideverordnung, SR 916 111 011)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr von Saatgetreide, Futtermitteln, Stroh und Waren, bei deren Verarbeitung Futtermittel anfallen (Einfuhrverordnung Saatgetreide und Futtermittel, SR 916 112 211)
– Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Verwertung sowie die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln (Kartoffelverordnung, SR 916 113 11)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben (Zuckerverordnung, SR 916 114 11)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG, SR 916 121 10)
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Marktentlastungsmassnahmen bei Steinobst und die Verwertung von Kernobst (Verordnung über die Massnahmen bei Obst, SR 916 131 11)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über den Rebbau und die Einfuhr von Wein (Weinverordnung, SR 916 140) – Verordnung des BLW vom 7. Dezember 1998 über das Rebsortenverzeichnis und über die Prüfung der Rebsorten (SR 916.143.5)
Direktzahlungen
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverorndung, DZV, SR 910 13)
Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS-Verordnung, SR 910 132 4)
– Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren im Freien (RAUS-Verordnung, SR 910 132 5)
Verordnung vom 29 März 2000 über Sömmerungsbeiträge (Sömmerungsbeitragsverordnung, SöBV, SR 910 133)
– Verordnung vom 4 April 2001 über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung, ÖQV, SR 910 14)
Grundlagenverbesserung
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft (Strukturverbesserungsverordnung, SVV, SR 913 1)
– Verordnung des BLW vom 7 Dezember 1998 über die Abstufung der pauschalen Ansätze für Investitionshilfen (PAUV, SR 913 211)
Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Betriebshilfe als soziale Begleitmassnahme in der Landwirtschaft (Betriebshilfeverordnung, BHV, SR 914 11)
Verordnung vom 8 November 1995 über die landwirtschaftliche Forschung (VLF, SR 426 10)
– Verordnung vom 13 Dezember 1993 über die landwirtschaftliche Berufsbildung (VLB, SR 915 1)
– Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Tierzucht (SR 916.310)
A N H A N G A73
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Verordnung vom 7 Dezember 1998 über die Produktion und das Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Saatgut-Verordnung, SR 916 151)
Verordnung des EVD vom 7 Dezember 1998 über Saat- und Pflanzgut von Acker- und Futterpflanzenarten (Saat- und Pflanzgut-Verordnung des EVD, SR 916.151.1)
Verordnung des EVD vom 11 Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von anerkanntem Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Obst, Beerenobst und Reben (SR 916 151 2)
– Verordnung des BLW vom 7 Dezember 1998 über den Sortenkatalog für Getreide, Kartoffeln, Futterpflanzen und Hanf (Sortenkatalog-Verordnung, SR 916 151 6)
– Verordnung vom 23 Juni 1999 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-Verordnung, SR 916 161)
– Verordnung vom 26 Januar 1994 über das Inverkehrbringen von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen (DüngerVerordnung, SR 916 171)
– Verordnung vom 28 Februar 2001 über Pflanzenschutz (Pflanzenschutzverordnung, PSV, SR 916 20)
Verordnung des EVD vom 25 Januar 1982 über die Meldung von gemeingefährlichen Schädlingen und Krankheiten (SR 916 201)
– Verordnung vom 28. April 1982 über die Bekämpfung der San-José-Schildlaus, des Feuerbrandes und der gemeingefährlichen Obstvirosen (SR 916 22)
– Verordnung vom 26 Mai 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung, SR 916 307)
Verordnung des EVD vom 10 Juni 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung, Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung, FMBV, SR 916 307 1)
Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 16 Juni 1999 über die GVO-Futtermittelliste (SR 916 307 11)
Es bestehen folgende Möglichkeiten, die Gesetzestexte einzusehen oder zu beschaffen:
Zugriff via Internet www admin ch/ch/d/sr/sr html
Bestellen bei der EDMZ
via Internet www admin ch/edmz
A74 A N H A N G
–
–
–
–
–
–
–
–
–
via Fax 031 325 50 58
■■■■■■■■■■■■■■■■ Begriffe und Methoden
Begriffe
Abiotische Eigenschaften: Chemische oder physikalische Eigenschaften eines Raumes, wie klimatische Faktoren (Licht, Temperatur, usw ), Bodeneigenschaften, hydrologische Verhältnisse, Relief
Biotische Eigenschaften: Eigenschaften eines Raumes, der durch die darin vorkommenden Pflanzen und Tiere hervorgehen
Evaluation: Synonym auch für Erfolgskontrolle Evaluation ist eine Methode zur Ermittlung und Beurteilung der Effektivität (Mass der Zielerreichung), Wirksamkeit (Ursache-Wirkungs-Beziehung) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) von Massnahmen oder Instrumenten Im Voraus definierte Ziele sind Voraussetzung für eine Evaluation Evaluationen dienen v a für Vergleiche: Kontrollgruppenvergleich, vorher/nachher-Vergleich, Querschnittsvergleich
Externe Effekte: Externe Effekte oder Externalitäten sind positive oder negative Nebeneffekte auf Dritte oder die Gesellschaft, die durch Konsum- oder Produktionsvorgänge einzelner Akteure entstehen Sie werden nicht unmittelbar über den Markt bzw den Marktpreis erfasst und führen deshalb zu Marktverzerrungen und Fehlallokation von Gütern und Produktionsfaktoren Ziel einer rationalen Wirtschaftspolitik ist es, die externen Effekte zu internalisieren
Beispiele von Externen Effekten:
Produktion
Konsum
Negativ externe Effekte (soziale Kosten) Negative Beeinträchtigung von Übermässiger Konsum von Alkohol und Tabak Trink-, Grund- und Oberflächenwasser bringt hohe Kosten im Gesundheitswesen durch unsachgemässe Düngung
Positiv externe Effekte (soziale Nutzen) Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft Breitensport als Freizeitbeschäftigung durch die landwirtschaftliche Produktion senkt die Kosten des Gesundheitswesens
Landwirtschaftlicher Umweltindikator: Repräsentative Erhebung, die Daten über eine Ursache, einen Zustand, eine Umweltveränderung oder ein Umweltrisiko vereint, welche aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten hervorgehen und für die Entscheidungsträger von Bedeutung sind (z.B. Erosionsgrad der Böden; Definition der OECD)
Marktspanne: Differenz zwischen Konsumenten- und Produzentenpreis (absoluter Wert) bzw Anteil am Konsumentenfranken, der den Marktstufen Verarbeitung und Handel zukommt (relativer Wert) Der Begriff Marge wird als Synonym verwendet
Median: Zentralwert (statistische Grösse): Wert, der bei der Abzählung einer Reihe von der Grösse nach geordneten Merkmalswerten (z B Messreihe) in der Mitte liegt
Milchäquivalent: Ein Milchäquivalent entspricht dem durchschnittlichen Fett- und Proteingehalt eines kg Rohmilch (73 g) und dient als Massstab zur Berechnung der in einem Milchprodukt verarbeiteten Milchmenge
Mittel(wert): Durchschnitt (statistische Grösse): Summe der Zahlen einer Reihe dividiert durch die Anzahl der Zahlen.
Monitoring: Laufendes Beobachten anhand von Indikatoren über einen Zeitraum ohne problemorientiertes Erkennen der kausalen Zusammenhänge Resultat eines Monitorings sind Entwicklungen aufzuzeigen Beispiele: Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, Vogelpopulationen usw
A N H A N G A75
Multifunktionalität der Landwirtschaft: Das Konzept einer multifunktionalen Landwirtschaft umschreibt die vielfältigen Funktionen, die die Landwirtschaft erfüllt Es umfasst die Leistungen, die über die eigentliche Agrarproduktion hinausgehen Hierzu zählen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, die Pflege der Kulturlandschaft, die Erhaltung der natürlichen Produktionsgrundlagen und Artenvielfalt, sowie der Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes. Eine multifunktionale Landwirtschaft trägt wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung bei Die multifunktionalen Aufgaben der Landwirtschaft sind in der Bundesverfassung (Art 104) festgehalten
Öffentliche Güter: Öffentliche Güter zeichnen sich durch zwei Merkmale aus: Nichtrivalität und fehlendes Ausschlussprinzip
Nichtrivalität im Konsum heisst, dass aufgrund des Konsums andere Konsumenten und Konsumentinnen nicht beeinträchtigt werden
Fehlendes Ausschlussprinzip heisst, dass es bei öffentlichen Gütern nicht möglich ist, einzelne NutzerInnen vom Konsum auszuschliessen Öffentliche Güter sind zum Beispiel die Landesverteidigung, die Freizeiterholung im Wald, der Genuss einer naturnahen Landschaft Für öffentliche Güter existiert kein Markt und damit auch kein Marktpreis Aus diesem Grund müssen öffentliche Güter durch den Staat selbst oder in dessen Auftrag von Dritten bereitgestellt werden
Quartil: Viertel (statistische Grösse): Aufteilung einer der Grösse nach geordneten Reihe in vier Teile.
Schoggigesetz: Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632 111 72): Umsetzung des Protokolls 2 des Freihandelsabkommens Schweiz – EG von 1972 Ausgleich der Rohstoffpreisdifferenz zwischen Inland- und Weltmarktpreis für landwirtschaftliche Grundstoffe (Ausfuhr: Ausfuhrbeiträge / Einfuhr: bewegliche Teilbeträge)
Streuung: Varianz (statistische Grösse): Verteilung der Beobachtungen oder Messwerte um einen Mittelwert
Veredlungsverkehr: Veredlungsverkehr bedeutet, dass für Waren, die zur Bearbeitung, Verarbeitung oder Reparatur vorübergehend eingeführt werden, unter bestimmten Voraussetzungen Zollermässigung oder -befreiung gewährt wird Bei Landwirtschaftsprodukten und landwirtschaftlichen Grundstoffen wird der Veredlungsverkehr gewährt, wenn gleichartige inländische Erzeugnisse nicht in genügender Menge verfügbar sind oder für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachteil für die schweizerische Nahrungsmittelindustrie nicht durch andere geeignete Massnahmen ausgeglichen werden kann
Zielpreis: Vom Bundesrat festgelegte Orientierungsgrösse je kg vermarktete Milch mit insgesamt 73 g Fett und Protein Der Zielpreis soll für Milch erreicht werden können, die zu Produkten mit hoher Wertschöpfung verarbeitet und gut vermarktet wird Die Höhe des Zielpreises hängt insbesondere von der Einschätzung der Marktlage und den verfügbaren Mitteln zur Marktstützung ab. Die Zulage für die Fütterung ohne Silage wird dabei nicht berücksichtigt
Weitere Begriffe sind zu finden in:
– «Betriebswirtschaftliche Begriffe in der Landwirtschaft»
(Bezug bei: Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Länggasse 79, 3052 Zollikofen)
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (SR 910 91)
A76 A N H A N G
–
Methoden
Milchpreiserhebung
Das BLW erhebt die Produzentenpreise monatlich und orientiert über die Ergebnisse in der Publikation «Milchbericht» Unterschieden werden dabei folgende vier Preise: gesamte Milch, Industriemilch, verkäste Milch und Biomilch Die Milchpreise werden nicht nur gesamtschweizerisch erhoben, sondern auch aufgeteilt in fünf Regionen: Region I: Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Jura und Teile des französischsprachigen Gebiets des Kantons Bern (Bezirke La Neuveville, Courtelary und Moutier) Region II: Bern (ausser Bezirke der Region I), Luzern, Unterwalden (Obwalden, Nidwalden), Uri, Zug und ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Schwyz und Küssnacht) Region III: Baselland und Basel-Stadt, Aargau und Solothurn Region IV: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, Appenzell (Innerrhoden und Ausserrhoden), St Gallen, ein Teil des Kantons Schwyz (Bezirke Einsiedeln, March und Höfe), Glarus, Graubünden Region V: Wallis und Tessin
Die fünf Regionen der Preiserhebung
Quelle: BLW
An der Milchpreiserhebung, die gemäss Übergangsverordnung Milch bei den Milchverwertern durchzuführen ist, nehmen alle wichtigen industriellen Milchverarbeiter sowie eine repräsentative Auswahl an Käsereien teil. Auf diese Weise können über 60% der produzierten Milch erfasst werden Als ausbezahlter Milchpreis gilt gemäss Übergangsverordnung der Preis für Milch am Erfassungsort (ab Hof oder Sammelstelle), einschliesslich ortsüblicher Zulagen und Abzüge Die Zulage für die Fütterung ohne Silage, freiwillige Verbandsbeiträge sowie Abzüge für Molke sind im erhobenen Milchpreis nicht enthalten
A N H A N G A77
I II III IV V
Berechnung der Marktspannen
Milch und Milchprodukte
Die Marktspanne bei Milch und Milchprodukten beinhaltet in einem ersten Schritt eine theoretische Wertschöpfungsberechnung in den Segmenten Konsummilch, Käse, Butter, Konsumrahm und Joghurt Dabei wird die Wertschöpfung für die einzelnen Produkte je kg verarbeitete Rohmilch berechnet Die Marktspanne Milch und Milchprodukte stellt also die Differenz zwischen dem Preisniveau des Milchproduzenten und dem effektiven Konsumentenpreis des Endproduktes dar
Die so berechnete Wertschöpfung wird in einem zweiten Schritt korrigiert um die jeweiligen produktspezifischen Eigenschaften So fliessen z B Beihilfen des Bundes, produktgebundene Ab- bzw Zuschläge und der Wert der anfallenden Nebenprodukte in die Berechnung der Einzelspannen ein Die Marktspanne bei Milch und Milchprodukten ist das Resultat aus der Wertschöpfung und den produktspezifischen Eigenschaften
Bei der Gesamtspanne Milch und Milchprodukte handelt es sich um einen Zusammenzug aller Marktspannen der Produktgruppen Konsummilch, Käse, Butter, Konsumrahm und Joghurt. Diese setzen sich ihrerseits aus den Kalkulationen der beobachteten Indikatorprodukten zusammen
Basis für die Berechnung der Gesamtspanne Milch und Milchprodukte, sowie der Einzelspannen Konsummilch, Käse, Butter, Rahm und Joghurt bildet die in der Schweiz verwertete jährliche Rohmilchmenge Entsprechend ihrem Anteil an der Rohmilchmenge wird jede Verwertungsart gewichtet
Die Spannenberechnung beschränkt sich auf die Wertschöpfung der in der Schweiz produzierten und konsumierten Milchprodukte Die verarbeitete Milchmenge muss daher um den exportierten Anteil korrigiert werden.
Entsprechend der Gewichtung nach Verwertungsarten werden auch die Produkte innerhalb einer Verwertungsart mengenmässig gewichtet
Für die Erhebung der Konsumentenpreise wird zwischen den drei Verkaufskanälen Grossverteiler, Discounter und Fachhandel unterschieden Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des Institutes für Marktanalysen, Hergiswil (IHA GfM), nach Marktanteilen gewichtet
Fleisch Marktspanne Emmentaler (Oktober 2000)
Ausbeute: 8% Beihilfen, Abgaben Wert der Nebenprodukte, etc.
A78 A N H A N G
VP1/kg Emmentaler
VP1/kg Rohmilch Milchpreis
Marktspanne Emmentaler
F r / k g 1 VP = Verkaufspreis Quelle: BLW 0 20 44 1 64 0.81
Die «Bruttomarge» Verarbeitung und Verteilung auf Frischfleisch für den Konsum ist ein Nennwert (zu laufenden Preisen) ohne Mwst (oMwst ) Sie wird in kg Schlachtgewicht warm (SG) ausgedrückt Die Bruttomarge stellt die Differenz sowohl zwischen dem «Rohertrag» und den «variablen Kosten» als auch zwischen den «Nettoeinnahmen» und dem «Einstandspreis» dar
Der «Rohertrag» entspricht dem «Umsatz» des Verarbeitungs- und Verteilungssektors bzw den Ausgaben der Konsumentinnen und Konsumenten (Privathaushalte und Grosshandel) Darin eingeschlossen sind der Verkauf von Frischfleisch für den Konsum sowie die Verwertung von Wurstfleisch, Haut und Schlachtnebenprodukten auf Grosshandelsstufe Die «variablen Kosten» umfassen einerseits den Einstandspreis des Viehs, der dem Produzenten bezahlt wird Es handelt sich hierbei um einen gewichteten Durchschnittspreis (konventionell, Label und andere Verkaufskanäle), franko Schlachthof, der also auch eine eventuelle Handelsspanne oder Transportkosten einschliesst Andererseits sind in den variablen Kosten die Auslagen für die Entsorgung von Schlachtabfällen, Kopf und Füssen; die Zerlege-, Lagerungs- und Auskühlverluste; die Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und der Beitrag zum Basismarketing der Proviande enthalten
Frisches Bankfleisch (Einzelhandelspreis)
14.74 Fr./kg SG
Nettoeinnahmen 15.74 Fr./kg SG
Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung 7 60 Fr./kg SG
Wurstfleisch
(Grosshandelspreis)
0.52 Fr./kg SG
Schlachtabfälle für Verkauf (Grosshandelspreis)
0.64 Fr./kg SG
Schlachtabfälle und Knochen für Verbrennung LSVA, Marketing, 0.64 Fr./kg SG
Einstandspreis = Preis bezahlt an Bauer (franko Schlachthof)
8.13 Fr./kg SG
Anmerkung: Die Verhältnisse in dieser Abbildung sind nicht realitätsgetreu Die angegebenen Preise dienen als Beispiel für die Berechnung der Bruttomarge auf frischem Rindfleisch im Januar 2001 Rechnungseinheit sind Fr. pro kg Schlachtgewicht warm (SG) zu Festpreisen (Realwert 01.1999) ohne Mwst Eventuelle Differenzen sind durch Rundungen bedingt. Quelle: BLW
Die detaillierte Definition der Bruttomarge findet sich in der Sonderausgabe des Fleischberichtes von Januar 2001, Nummer 140, der von der Sektion Marktbeobachtung des BLW herausgegeben wird Diese Nummer ist auf Anfrage erhältlich
Die rückwirkende Schätzung der Bruttomarge Verarbeitung und Verteilung für die Jahre 1990 bis 1998 basiert auf vereinfachenden zusätzlichen Annahmen Insbesondere für den Zeitraum von 1994 bis 1998 musste der mittlere Einstandspreis für Bankvieh (Label –konventionell) geschätzt werden
Diese Schätzungen erfolgten anhand von Erhebungen des Einstandspreises für konventionelles Schlachtvieh, der Preisdifferenz zwischen Labelfleisch und konventionellem Fleisch und des Anteils des Label-Viehs am gesamten Bankvieh Zudem wurde angenommen, dass die Umstellung von der Warenumsatzsteuer (Wust) auf die Mehrwertsteuer (Mwst ) im Januar 1995 keine Kosten oder zusätzlichen Einkünfte für die Verarbeitung und Verteilung verursacht hat Der Gewichtungsschlüssel zwischen den drei Fleischsorten (Schwein, Rind, Kalb) entspricht dem Jahreskonsum der Privathaushalte
A N H A N G A79
R o h e r t r a g ( = K o n s u m e n t e n f r a n k e n ) : 1 5 . 9 0 F r . / k g S G T o t a l v a r i a b l e K o s t e n : 8 2 9 F r / k g S G
Früchte und Gemüse
Die Marktspanne Früchte und Gemüse ist die Differenz zwischen dem Einstandspreis der ersten Handelsstufe eines Produktes, ausgenommen Gebinde- und Verpackungskosten, und dem Endverkaufspreis (inkl allfällige Gebinde- und Verpackungskosten) Sowohl die Daten des Inlandmarktes als auch diejenigen des Importmarktes fliessen in die Spannenberechnungen ein. Beim Import sind die Zollabgaben enthalten Berücksichtigt werden dabei je sieben bedeutende, umsatzstarke Früchte und Gemüse Bei den Früchten sind dies Äpfel (Werte von Golden Delicious und den wichtigsten Lagersorten, sowie Granny Smith Import, mengengewichtet), Birnen (Werte Inlandbirnen und importierten Birnen ohne Abate- und Nashibirnen, mengengewichtet), Erdbeeren, Nektarinen, Kirschen, Aprikosen und Orangen Beim Gemüse sind es Tomaten (Fleischtomaten, runde Tomaten, beide mit mengengewichtetem Anteil), Blumenkohl, gelbe Zwiebeln, Karotten, Brüsseler Witloof, Gurken und Kartoffeln Die Mengengewichtungen stützen sich auf Zahlen des IHA GfM, der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau (SZG), des Schweizerischen Obstverbandes (SOV), des Bundesamtes für Statistik (BFS) und der Oberzolldirektion (OZD)
Marktspanne Früchte und Gemüse
Marktspanne Gemüse
Der Einstandspreis der einzelnen Produkte setzt sich bei Inlandware aus dem Preis franko Verlader (bei Lagerware werden die Lagerkosten mitberücksichtigt) und bei Importware dem Importwert franko Grenze verzollt, beide mengengewichtet, zusammen Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA GfM nach Marktanteilen gewichtet Die Einzelspannen jedes Produktes werden in der Marktspanne Gemüse zusammengefasst
Marktspanne Früchte
Hier ist das periodische Hinzustossen und Wegfallen von nur kurz auftretenden saisonalen Früchten eine Besonderheit bei der Gesamtspanne Trotzdem kann diese Gesamtbetrachtung gerade im Mehrjahresvergleich wertvolle Anhaltspunkte liefern
Der Einstandspreis setzt sich bei Inlandware aus dem Produzentenpreis franko Sammelstelle und bei der Importware dem Importwert franko Grenze verzollt, beide mengengewichtet, zusammen. Lager- und Zinskosten sind berücksichtigt. Für die Erhebung der Konsumentenpreise werden sowohl die Verkaufsdaten der bedeutendsten Grossverteiler als auch der Wochenmärkte verwendet Die Verkaufskanäle werden entsprechend der Angaben des IHA GfM nach Marktanteilen gewichtet Die Einzelspannen jedes Produktes werden in der Marktspanne Früchte zusammengefasst
A80 A N H A N G
P Import P Einstand P Inland P Endverkauf Marktspanne Quelle: BLW
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung wird durch das Sekretariat des SBV im Auftrag und unter der Aufsicht des BLW sowie des BFS nach dem europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (Eurostat) berechnet. Die international anerkannte Methode erlaubt einen Vergleich mit anderen Ländern Die Ergebnisse werden an verschiedene internationale Organisationen (OECD, UNO) weitergeleitet
Darstellung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
Endproduktion
Bestandesveränderung 1 Selbsterstellte Anlagen Verkäufe im Inland und Exporte Eigenverbrauch der Produzenten Rohprodukte verarbeitet durch Produzenten
Produktionswert
Zusammensetzung der Endproduktion
Beiträge der öffentlichen Hand
Endproduktion
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten Nettowertschöpfung zu Faktorkosten
Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte
Entlöhnung der familienfremden Arbeitskräfte
Pachten und Zinsen Abschreibungen
Unterkompensation der Mwst 2 Produktionssteuern Vorleistungen
Einnahmen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit
Wertschöpfung
Verwendung der Einnahmen
1 In diesem Schema wird der Endbestand höher angenommen als der Anfangsbestand so dass eine positive Bestandesveränderung resultiert 2 Wenn die Mwst auf den Verkäufen landwirtschaftlicher Produkte nicht gleich hoch ist wie die auf den Ankäufen von Vorleistungen und Investitionsgütern bezahlten Steuern wird sie in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgeglichen Wurde auf der Produktionsseite mehr als auf der Kostenseite verrechnet wird diese Überkompensation als zusätzliche Einnahmequelle betrachtet Bis jetzt war in der Schweiz immer eine Unterkompensation zu verzeichnen
Quelle: SBV
Der Produktionswert der Landwirtschaft (Endproduktion) entspricht dem Geldwert sämtlicher Agrarerzeugnisse der Schweiz und bildet zusammen mit den Beiträgen der öffentlichen Hand (Subventionen) die Einnahmen aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit Auf Seite der Ausgaben sind die Vorleistungen (Kosten für Energie, Unterhalt sowie andere Güter und Dienstleistungen) die gewichtigste Position Aus der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben resultiert das Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit der Familienarbeitskräfte Dieses sektorale Einkommen dient als Entschädigung der Arbeit der Familienarbeitskräfte und des investierten Eigenkapitals Es ist auf einzelbetrieblicher Ebene (Buchhaltungsdaten) in etwa mit dem landwirtschaftlichen Einkommen vergleichbar
A N H A N G A81
Zentrale Auswertung der FAT
Neue Auswertungsmethodik
Mit den Buchhaltungsabschlüssen des Jahres 1999 erfuhr die Zentrale Auswertung grundlegende methodische Änderungen. In der Vergangenheit wurden für die Ermittlung der Einkommen restriktiv abgegrenzte «Testbetriebe» verwendet (z B Beschränkung des Nebenverdienstes, Forderung einer Fachschulbildung) Auf Grund der bewussten positiven Selektion der Testbetriebe konnten konsequenterweise auch nur Aussagen über diese Betriebe selbst gemacht werden Im neuen System erlauben die sogenannten «Referenzbetriebe» repräsentative Aussagen über die gesamte Landwirtschaft
Überblick über die methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung
– Als Grundgesamtheit werden diejenigen schweizerischen Betriebe bezeichnet, die grundsätzlich als Referenzbetriebe für die Zentrale Auswertung in Frage kommen Dazu müssen sie minimale physische Schwellen erreichen Sobald ein Betrieb z B mindestens 10 ha Land bewirtschaftet oder mindestens 6 Kühe hält, gehört er zur Grundgesamtheit Die Grundgesamtheit umfasst rund 57‘000 Betriebe, was rund 90% der bewirtschafteten Fläche und rund 90% der Produktion entspricht.
– Aus der Grundgesamtheit werden ca 3‘500 Referenzbetriebe ausgewählt
Da die Strukturen der Referenzbetriebe der Zentralen Auswertung von den Strukturen in der Gesamtlandwirtschaft abweichen, werden die Buchhaltungsergebnisse gewichtet Dazu wird aus der Betriebsstrukturerhebung die Verteilung der Betriebe nach Betriebsgrössen, Betriebstypen und Zonen herangezogen Mit diesem Vorgehen ist gewährleistet, dass z B Buchhaltungsergebnisse von kleineren Betrieben, die in der Auswahl der Referenzbetriebe untervertreten sind, in der Auswertung das entsprechende Gewicht erhalten.
– Eine neue Betriebstypologie erlaubt eine bessere Unterscheidung der agrarpolitisch bedeutenden Betriebstypen Rund zwei Drittel der Betriebe entfallen auf sieben spezialisierte Betriebstypen, die eine Konzentration auf bestimmte Betriebszweige des Pflanzenbaus oder in der Tierhaltung aufweisen Das restliche Drittel teilt sich auf in vier Typen kombinierter Betriebe (vgl weiter unten)
Die weiter gefasste Grundgesamtheit und die Gewichtung verbessert die Aussagekraft der Ergebnisse der Zentralen Auswertung für die gesamte Landwirtschaft erheblich. Auch die internationale Vergleichbarkeit der Buchhaltungsdaten wird erleichtert. Die methodischen Änderungen sind insgesamt derart bedeutend, dass eine Vergleichbarkeit mit älteren Berichten der Zentralen Auswertung nicht mehr gegeben ist Um dennoch Mehrjahresvergleiche anstellen zu können, wurden die Buchhaltungsergebnisse der Vorjahre ebenfalls mit der neuen Methodik berechnet
Die neue Betriebstypologie FAT99
Im Rahmen der methodischen Änderungen der Zentralen Auswertung der FAT wurde die alte Betriebstypologie nach Grüner Kommission (1966) durch eine neue Typologie (FAT99) ersetzt Neben der Verwendung in der Ergebnisdarstellung wird die Betriebstypologie für den Auswahlplan der Betriebe der Zentralen Auswertung und für die Gewichtung der einzelbetrieblichen Ergebnisse eingesetzt
Die Einteilung der Betriebe nach der neuen Typologie erfolgt ausschliesslich auf der Basis von physischen Kriterien, nämlich Flächen und GVE verschiedener Tierkategorien. Mit insgesamt zehn Kennzahlen bzw. acht Quotienten je Betrieb ist eine differenzierte und eindeutige Einteilung möglich
A82 A N H A N G
–
Definition der neuen Betriebstypologie FAT99
Die Kriterien in einer Zeile müssen alle gleichzeitig erfüllt sein
Abkürzungen:
GVE Grossvieheinheit
LN Landwirtschaftliche Nutzfläche in ha
GVE/LN Viehbesatz je ha LN
OAF/LN Anteil offene Ackerfläche an LN
SKul/LN Anteil Spezialkulturen an LN
RiGVE/GVE Anteil Rindvieh-GVE am Gesamtviehbestand
VMiK/RiGVE Anteil Verkehrsmilchkühe am Rindviehbestand
MAK/RiGVE Anteil Mutter-/Ammenkühe am Rindviehbestand
PSZ/GVE Anteil Pferde- Schaf- und Ziegen-GVE am Gesamtviehbestand
SG/GVE Anteil Schweine- und Geflügel-GVE am Gesamtviehbestand
Quelle: FAT
Es werden sieben spezialisierte und vier kombinierte Betriebstypen unterschieden Die spezialisierten Pflanzenbaubetriebe (11 und 12) verfügen über einen Viehbesatz von weniger als einer GVE je ha LN. Bei den Ackerbaubetrieben überschreitet der Anteil offener Ackerfläche 70% der LN, für die Spezialkulturbetriebe liegt der Anteil entsprechender Kulturen über 10% Die spezialisierten Tierhalter (21 bis 41) haben als gemeinsame Beschränkung maximal 25% offene Ackerfläche und maximal 10% Spezialkulturfläche Die Verkehrsmilchbetriebe weisen über 25% des Rindviehbestandes als Milchkühe mit vermarkteter Milch (Verkehrsmilch) aus, analog werden die Mutterkuhbetriebe abgegrenzt In der verbleibenden Gruppe «Anderes Rindvieh» befinden sich vor allem Betriebe mit Milchkühen ohne Kontingent (spezialisierte Kälbermäster oder Aufzuchtbetriebe im Berggebiet) In den Veredlungsbetrieben machen Schweine- und Geflügel-GVE mehr als die Hälfte des Viehbestandes aus Betriebe, die sich keinem der sieben spezialisierten Betriebstypen zuteilen lassen, gelten als kombinierte Betriebe (51 bis 54)
A N H A N G A83
Bereich Betriebstyp GVE/ OAF/ SKul/ RiGVE/ VMiK/ MAK/ PSZ/ SG/ Andere LN LN LN GVE RiGVE RiGVE GVE GVE Bedingungen 11 Pflanzenbau Ackerbau max über max 1 70% 10% 12 Spezialkulturen max über 1 10% 21 Tierhaltung Verkehrsmilch max max über über max 25% 10% 75% 25% 25% 22 Mutterkühe max max über max über 25% 10% 75% 25% 25% 23 Anderes Rindvieh max max über nicht 21 25% 10% 75% oder 22 31 Pferde/Schafe/ max max über Ziegen 25% 10% 50% 41 Veredlung max max über 25% 10% 50% 51 Kombiniert Verkehrsmilch/ über über über max nicht Ackerbau 40% 75% 25% 25% 11– 41 52 Mutterkühe über max über nicht 75% 25% 25% 11– 41 53 Veredlung über nicht 25% 11– 41 54 Andere nicht 11– 53
Aspekte der Darstellung
Artikel 7 der Nachhaltigkeits-Verordnung legt fest, dass die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft auch regionenweise zu beurteilen ist Dementsprechend werden auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung drei Regionen definiert:
Talregion: Ackerbauzone, Übergangszonen
– Hügelregion: Hügelzone, Bergzone I
– Bergregion: Bergzonen II bis IV
Abgrenzung Tal-, Hügel- und Bergregion (Zuteilung der Gemeinden nach grösstem Zonenanteil)
Um eine differenzierte Beurteilung der Streuung von bestimmten Kennzahlen zu erreichen, werden die Betriebe in Quartile eingeteilt Einteilungskriterium ist der Arbeitsverdienst pro Familienarbeitskraft (FJAE) In jedem Quartil (0–25% / 25–50% / 50–75% / 75–100%) befinden sich je ein Viertel der Betriebe aus der Grundgesamtheit
Die Darstellung nach Quartilen erlaubt eine ökonomisch differenzierte Beurteilung Auf eine ökologische Differenzierung wird verzichtet, weil der Anteil der Referenzbetriebe ohne ÖLN weniger als 3% ausmacht und die Differenz der Arbeitsverdienste minimal ist
Gemäss Artikel 5 LwG ist die wirtschaftliche Lage «im Durchschnitt mehrerer Jahre» zu beurteilen Bei Entwicklungen werden deshalb mehrere Jahre dargestellt Die statischen Betrachtungen stellen auf das aktuellste verfügbare Drei-Jahresmittel (1998/2000) ab
A84 A N H A N G
–
Talregion Hügelregion Bergregion Quelle: AGIS-Daten 1998 Bundesamt für Landwirtschaft, LPK Gemeindegrenzen: © BFS GEOSTAT
Einkommensvergleich
Für die Gegenüberstellung der Arbeitseinkommen wird auf der Seite der Landwirtschaft der Arbeitsverdienst und auf der Seite der übrigen Bevölkerung ein Jahres-Bruttolohn ermittelt Die Lohnsituation der übrigen Bevölkerung wird durch die vom BFS alle zwei Jahre durchgeführte Lohnstrukturerhebung erfasst. In den dazwischen liegenden Jahren werden die Werte mit Hilfe der Entwicklung des Lohnindexes aktualisiert Die Lohnstrukturerhebung gibt einen repräsentativen Überblick über die Lohnsituation der Beschäftigten in der Industrie (Sekundärsektor) und im Dienstleistungsbereich (Tertiärsektor)
Erfasste Lohnkomponenten (gemäss Lohnstrukturerhebung BFS)
Bruttolohn im Monat Oktober (inkl Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherung, Naturalleistungen, regelmässig ausbezahlte Prämien-, Umsatz- oder Provisionsanteile), Entschädigungen für Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit, 1⁄12 vom 13 Monatslohn und 1⁄12 von den jährlichen Sonderzahlungen
Standardisierung: Umrechnung der erhobenen Beiträge (inkl Sozialabgaben) auf eine einheitliche Arbeitszeit von 4 1⁄3 Wochen à 40 Stunden
Die Werte der Lohnstrukturerhebung werden auf Jahres-Bruttolöhne umgerechnet Anschliessend wird für jede Region der Median über alle im 2 und 3 Sektor Beschäftigten gebildet
Auf Seite der Landwirtschaft wird als Pendent zu den Jahres-Bruttolöhnen der landwirtschaftliche Arbeitsverdienst pro FJAE berechnet Die Basis für eine FJAE sind 280 Arbeitstage, wobei eine Person maximal 1,0 FJAE entspricht
Berechnung des landwirtschaftlichen Arbeitsverdienstes
Landwirtschaftliches Einkommen
Zins für das im Betrieb investierte Eigenkapital
(mittlerer Zinssatz für Bundesobligationen)
= Arbeitsverdienst der Betriebsleiterfamilie
: Anzahl Familienarbeitskräfte (FJAE)
(Basis: 280 Arbeitstage)
= Arbeitsverdienst pro FJAE
A N H A N G A85
–
Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen (Stand August 2001)
Allgemeine Anforderungen
Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben Keine Direktzahlungen gibt es für Betriebe des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sowie für Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, deren Tierbestände die Grenzen der Höchstbestandesverordnung überschreiten Ebenfalls ausgeschlossen sind juristische Personen, sofern es sich nicht um Familienbetriebe handelt (Artikel 2 Direktzahlungsverordnung)
Weitere Bedingungen
Die Beitragsberechtigung ist an weitere strukturelle und soziale Kriterien geknüpft Die Übersicht fasst die Bedingungen für die Ausrichtung der Direktzahlungen stichwortartig zusammen
Bedingungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen
Mindestgrösse des Betriebes
Minimaler Arbeitsbedarf
Betriebseigene Arbeitskräfte
1 ha
Spezialkulturen: 50 Aren
Reben in Steil- und Terrassenlagen: 30 Aren
0,3 Standard-Arbeitskräfte (SAK)
Mindestens 50% der für die Bewirtschaftung erforderlichen Arbeiten mit betriebseigenen Arbeitskräften (Familie und Angestellte) ausführen
Alter des Bewirtschafters bis 65 Jahre
Beitragsbegrenzungen
maximaler Betrag pro SAK 45 000 Fr
– steuerbares Einkommen (vermindert um 30 000 Fr für verheiratete Summe der Direktzahlungen wird ab 80 000 Fr steuerbares Einkommen Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter) reduziert
– massgebliches Vermögen (steuerbares Vermögen, vermindert um Summe der Direktzahlungen wird ab 800 000 Fr massgebliches Vermögen 200 000 Fr pro SAK und um 200 000 Fr für verheiratete reduziert; übersteigt das massgebliche Vermögen 1 Mio Fr werden keine Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter) Direktzahlungen ausbezahlt
Quelle: Direktzahlungsverordnung
A86 A N H A N G
– Abstufung Fläche in
Tiere in GVE Ansatz in % bis 30 45 100 30–60 45–90 75 60–90 90–135 50 über 90 135 0 –
ha
Quelle: Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
Die Berechnung der SAK wird mit Umrechnungsfaktoren für die LN und die Nutztiere vorgenommen Für gewisse Nutzungen wie z B den arbeitsaufwendigeren biologischen Landbau, gibt es Zuschläge. Die Faktoren sind abgeleitet aus der standardmässigen Erfassung arbeitswirtschaftlicher Abläufe Sie sind für den Vollzug der Direktzahlungen und der Massnahmen zur Strukturverbesserung vereinfacht worden Für die Berechnung des effektiven Arbeitsbedarfs sind sie nicht geeignet, weil dieser von den speziellen Eigenschaften des einzelnen Betriebes wie der Oberflächengestaltung, der Arrondierung, den Gebäudeverhältnissen und dem Mechanisierungsgrad abhängt
der Beiträge nach Artikel 20 Direktzahlungsverordnung
Die prozentuale Abstufung gilt für sämtliche Beitragsarten mit Ausnahme der Sömmerungs- und der Gewässerschutzbeiträge
A N H A N G A87 Landwirtschaftliche Nutzfläche SAK/ha LN ohne Spezialkulturen 0,035 Spezialkulturen 0,400 Rebflächen in Steil- und Terrassenlage 1,000 Nutztiere SAK/GVE Milchkühe, Milchschafe, Milchziegen 0,05 Mastschweine 0,01 Zuchtschweine 0,02 andere Nutztiere 0,04 Zuschläge für Hanglagen im Berggebiet/Hügelzone 0,02
Hochstamm-Feldobstbäume
SAK pro ha für biologischen Landbau wie bei LN plus 20% für
0,01 SAK/10 Bäume
Abstufung
Flächenbeiträge 1–30 ha >30–60 ha >60–90 ha >90 ha F r . / h a Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere 1–45 RGVE >45–90 RGVE >90–135 RGVE >135 RGVE F r . / R G V E 0 1 200 900 600 300 0 900 675 450 225
Ökologischer Leistungsnachweis
Der ÖLN strebt eine gesamtheitliche Betrachtung der Agro-Ökosysteme und der landwirtschaftlichen Betriebe an Zu diesem Zweck wurden der bei der Integrierten Produktion (IP) entwickelte Ansatz übernommen. So wird der ÖLN aufgrund der Auflagen der IP (Stand 1996) konkretisiert Zusätzlich hat der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachzuweisen, dass die Vorschriften des Tierschutzgesetzes eingehalten werden Somit ist die IP, ergänzt mit den Auflagen der Tierschutzbestimmungen, zum Standard der Landwirtschaft in der Schweiz geworden Direktzahlungen werden nur an Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ausbezahlt, die den ÖLN erbringen Betriebe auf denen der ÖLN nicht erfüllt ist, erhalten noch Direktzahlungen bis zum 31 Dezember 2001 Der Flächenbeitrag wird jedoch für diese Betriebe um 800 Fr je ha beitragsberechtigter Fläche gekürzt Mit der Einführung des ÖLN wurden Auflagen der Integrierten Produktion (IP, Stand 1996) übernommen Die Einführung von Direktzahlungen hat die Bewirtschaftungsmethoden und dadurch die Ökologie ganz wesentlich beeinflusst Dies zeigt die starke Zunahme der nach den ÖLN- und Bio-Richtlinien bewirtschafteten Flächen: Zu Beginn der ersten Etappe der Agrarreform im Jahre 1993 betrug dieser Anteil knapp 20% der LN Heute sind es etwa 96% der LN Dank gezielten finanziellen Anreizen konnte diese hohe Beteiligung der Betriebe erreicht werden Zusätzlich ist noch zu vermerken, dass gewisse Betriebe, wie z B Staatsbetriebe oder juristische Personen im Direktzahlungssystem nicht erfasst sind, obwohl sie die ÖLN- oder Bio-Anforderungen erfüllen.
Der ÖLN umfasst die folgenden Punkte:
Aufzeichnungs- und Nachweispflicht: Wer Direktzahlungen beansprucht, erbringt der kantonalen Behörde den Nachweis, dass er die ökologischen Leistungen auf dem gesamten Betrieb erfüllt Als Nachweis gilt das Attest einer vom Kanton beigezogenen Kontrollorganisation Um diese Bestätigung zu erhalten, macht der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin regelmässige Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs
Tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere: Die Bestimmungen der Tierschutzverordnung sind einzuhalten Dabei gilt die Beweislastumkehr, das heisst, der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat zu belegen, dass auf dem Betrieb das Tierschutzgesetz eingehalten wird
– Ausgeglichene Düngerbilanz: Um die Nährstoffverluste in die Umwelt zu verringern und möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe zu erzielen, muss die Stickstoff- und Phosphorzufuhr aufgrund des Bedarfs der Pflanzen und des Produktionspotenzials des Betriebs berechnet werden Mit der Düngerbilanz werden prioritär die Hofdünger eingesetzt; Mineraldünger und Abfalldünger werden nur wenn nötig eingesetzt. Eine Toleranzgrenze von plus 10% wird gewährt.
– Mindestens alle zehn Jahre sind parzellenweise Bodenanalysen durchzuführen, um die Nährstoffreserven im Boden zu ermitteln und die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit notwendige Düngermenge entsprechend anzupassen
– Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF): Mindestens 3,5% der LN bei Spezialkulturen und 7% bei der übrigen LN sind mit ÖAF zu belegen Entlang von Wegen sind Wiesenstreifen von mindestens 0,5 m und entlang von Oberflächengewässern, Hecken, Feldgehölzen, Ufergehölzen und Waldrändern von mindestens 3 m zu belassen
Geregelte Fruchtfolge: Für Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche muss zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit der Pflanzen die Fruchtfolge jedes Jahr mindestens vier Kulturen umfassen Zudem sind Höchstanteile der Hauptkulturen an der Ackerfläche oder Anbaupausen vorgeschrieben.
A88 A N H A N G
–
–
–
Geeigneter Bodenschutz: Für jede Kultur ist ein Bodenschutzindex festgelegt Damit Bodenerosion, Nährstoffverluste und Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln verringert werden, muss jeder Betrieb mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche einen minimalen mittleren Bodenschutzindex erreichen Beim Ackerbau beträgt dieser 50 Punkte, beim Gemüsebau 30 Punkte Die Stichtage sind jeweils der 15 November und der 15 Februar
Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln: Pflanzenbehandlungsmittel können in die Luft, den Boden und die Gewässer gelangen und nachteilige Auswirkungen auf Organismen haben Daher sind natürliche Regulationsmechanismen und biologische Verfahren vorzuziehen. Im Acker- und Futterbau sind gewisse Behandlungsverfahren (z.B. Vorauflaufbehandlung mit Herbiziden bei Weizen) verboten Bei den Spezialkulturen werden mit gewissen Verwendungseinschränkungen zugelassene Produkte in regelmässig aktualisierten Listen aufgeführt
A N H A N G A89 Beispiele von Höchstanteilen in
der Ackerfläche – Getreide (ohne Mais und Hafer) 66 – Weizen und Korn 50 – Mais 40 – Hafer 25 – Rüben 25 – Kartoffeln 25 –
%
Beispiele für den Bodenschutzindex im Ackerbau Punkte Raps 80 Wintergerste, Triticale, Roggen, Winterhafer 50 Winterweizen, Korn 40 Kunstwiese bis 15 November 80 Kunstwiese bis 15 Februar 100 –
Einhaltung von Gesetzen
Wird die Einhaltung landwirtschaftsrelevanter Vorschriften wie diejenigen des Gewässer-, des Umwelt- sowie des Natur- und Heimatschutzgesetzes verletzt, kommt zusätzlich zur Busse eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Direktzahlungen hinzu.
Nachfolgend einige Beispiele von Vorschriften, deren Verletzung Sanktionen zur Folge haben kann:
Einhaltung der Sorgfaltspflicht um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Artikel 3 Gewässerschutzgesetz);
– Verbot, Stoffe die Gewässer verunreinigen können in ein Gewässer einzubringen, oder versickern zu lassen oder so zu lagern oder auszubringen, dass dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (Artikel 6 Gewässerschutzgesetz);
Nichteinhalten der DGVE-Grenzwerte nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz (gemessen an der düngbaren LN);
– Nicht vorschriftsgemässe Lagerkapazität für Hofdünger nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz;
– Zerstörung oder Beschädigung eines vom Bund oder Kanton geschützten Biotopes, insbesondere Riedgebiete und Moore, Hecken, Feldgehölze und Trockenstandorte , sowie eines geschützten Natur- oder Kulturdenkmals, eine geschützte geschichtliche Stätte oder eine geschützte Naturlandschaft (inkl Moorlandschaft), sofern sie durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung verursacht wird (Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 18 Absatz 1bis Natur- und Heimatschutzgesetz);
– Verstösse gegen das Verbot von Verbrennen von Abfällen (Artikel 26 Luftreinehalteverordnung)
Verstösse gegen die Vorschriften werden je nach Vorgeschichte und Wirkung der Widerhandlung im Einzelfall einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet:
– Erstmalige Verstösse ohne Dauerwirkung Beispiel: Einmaliges gewässerschutzwidriges Güllen (Kürzung um 5 bis 25%, höchstens 2‘500 Fr );
Erstmalige Verstösse, deren Wirkung andauert oder deren Handlung oder Unterlassung sich über eine mehrere Tage, Wochen oder Monate umfassende Zeitspanne erstreckt Beispiel: Unbefestigter Miststock Mehrmaliges gewässerschutzwidriges Güllen an verschiedenen Tagen (Kürzung um 10 bis 50%, höchstens 10‘000 Fr );
Wiederholte Verstösse, also Widerhandlungen gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von drei Jahren Massgebend sind die Vorfälle ab dem Jahr 1999 (Kürzung um 20 bis 100%)
A90 A N H A N G
–
–
–
–
EU-Buchhaltungsvergleich
Was ist das INLB?
Das Informationsnetz Landwirtschaftlicher Buchführungen der Europäischen Union (INLB) wurde 1965 geschaffen. Der Zweck besteht in der Sammlung von Buchführungsdaten landwirtschaftlicher Betriebe zur Ermittlung der Einkommen und zur Analyse ihrer betriebswirtschaftlichen Verhältnisse
Zur Zeit umfasst die jährliche Stichprobe etwa 60‘000 Betriebe, mit denen über 90% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche und über 90% der gesamten landwirtschaftlichen Produktion der EU abgebildet werden
In den meisten EU-Ländern werden auch nationale Buchhaltungsnetze betrieben, aus denen die INLB-Daten für die EU-Kommission entnommen werden können Das INLB bildet die einzige Datenquelle mit EU-weit vergleichbaren wirtschaftlichen Ergebnissen landwirtschaftlicher Betriebe
Umsetzung der INLB-Methodik
Die Datenerhebung und Auswertung im INLB weicht in mehreren Bereichen von der Methodik in der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten der FAT ab Um schweizerische Buchhaltungsergebnisse INLB-vergleichbar darzustellen, nimmt die FAT Umrechnungen an den Schweizer Daten auf verschiedenen Ebenen vor Dadurch sind die im Textteil dargestellten Ergebnisse von Schweizer Betrieben nicht mit den Auswertungen der Referenzbetriebe vergleichbar
Der Ausschluss des Wohnhauses bedingt Anpassungen bei den Gebäudekosten inkl Abschreibungen, den Erträgen aus Gebäudevermietung, einer anteiligen Reduktion der Schuldzinsen, der Pachtzinsen bei reinen Pachtbetrieben, der Aktiven und der Passiven Buchwerte und Abschreibungen werden auf Wiederbeschaffungswerte korrigiert: Maschinen +5%, Gebäude +20% Für Boden und andere Aktiven werden die Werte der Zentralen Auswertung übernommen (auch Deutschland und Irland machen eine Ausnahme von der Bewertung zu Marktpreisen) Für die Erfolgsrechnung inkl Korrektur der Tierbewertung, die Bilanzdarstellung und Finanzierungsindikatoren werden die INLB-Standardvariablen berechnet Die Erfassungsschwelle für die Schweiz wird bei 16 Europäischen Grösseneinheiten festgelegt Mit der Umsetzung der EU-Betriebstypologie und einer analogen Gewichtung werden knapp 50‘000 Betriebe mit über 90% der Fläche und der Produktion abgebildet Die Umsetzung der INLB-Methodik für die Schweiz wurde durch die FAT erstmals 1996 vorgenommen
A N H A N G A91
Methodische Unterschiede INLB und Zentrale Auswertung
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen der EU
Betriebsdefinition
Landwirtschaftlicher Betrieb ohne Wohnhaus
Bewertung und Abschreibung
Boden, Tiere, Vorräte und Naturallieferungen zu Marktpreisen, Anlagen zu Wiederbeschaffungswerten bewertet
Abschreibungen aufgrund von Wiederbeschaffungswerten; regelmässige Bilanzbrüche
Erfolgsrechnung
Gesamterzeugung und Vorleistungen inkl innerbetriebliche Lieferungen; Wertveränderungen bei den Zuchttieren nur bei mengenmässiger Veränderung erfolgswirksam
Betriebstypologie
EU-Betriebstypologie: Jeder Betriebszweig (ha oder Tierzahl) wird mit einem Standarddeckungsbeitrag (SDB) multipliziert Die Zusammensetzung des gesamtbetrieblichen Standarddeckungsbeitrags ergibt die Betriebswirtschaftliche Ausrichtung (BWA) Die Summe des Standarddeckungsbeitrages ergibt die wirtschaftliche Betriebsgrösse in Europäischen Grösseneinheiten (EGE; 1 EGE= 1200 ECU SDB)
Grundgesamtheit und Stichprobe
Das INLB bildet Haupterwerbsbetriebe ab Haupterwerbsbetriebe müssen eine wirtschaftliche Mindestgrösse (in EGE) überschreiten
Diese Schwellen werden landesabhängig unterschiedlich festgelegt
Die Nachbarländer der Schweiz haben meist 8 EGE als Erfassungsschwelle, Italien 2 EGE
Gewichtung der Ergebnisse
Grundlage bildet Schichtung der Betriebe nach Betriebstyp (BWA), wirtschaftlicher Betriebsgrösse (in EGE) und INLB-Regionen (z B Bundesländer in Deutschland)
Referenzbetriebe Zentrale Auswertung
Wohnhaus gehört zum Betrieb; kalkulatorische Vermietung an Betriebsleiterfamilie
Bewertung nach Gestehungskostenprinzip, d h Boden meist zum Ertragswert; Richtzahlen für Tiere, Vorräte und Naturallieferungen
Abschreibung der historischen Netto-Anschaffungskosten; Bilanzkonstanz
Rohertrags-Fremdkostenrechnung ohne innerbetriebliche Lieferungen
Jede Bewertungsänderung bei Tieren ist erfolgswirksam
Betriebstypologie FAT99: Der Betriebstyp wird aufgrund physischer Kriterien (Bodennutzung und Zusammensetzung des Tierbestandes) ermittelt Im Gegensatz zur EU-Typologie mit jährlich schwankenden SDB führt die FAT99Typologie im Zeitablauf zu einer stabileren Einteilung
Als Betriebsgrössenmass wird meistens die landwirtschaftliche Nutzfläche verwendet
Die Grundgesamtheit der Referenzbetriebe wird durch minimale physische Schwellen abgegrenzt und umfasst mit gut 55‘000 Betrieben auch viele Nebenerwerbsbetriebe
Grundlage: Schichtung der Betriebe nach Betriebstyp (FAT99), Grössenklasse (LN ) und Region (Tal-, Hügel- und Bergregion, abgeleitet aus Produktionszonen)
Quelle: EU-Kommission, FAT
A92 A N H A N G
Abkürzungen
Organisationen/Institutionen
BAG Bundesamt für Gesundheit, Bern
BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Bern
BLW Bundesamt für Landwirtschaft, Bern
BSV Bundesamt für Sozialversicherung, Bern
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern
BVET Bundesamt für Veterinärwesen, Bern
BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, Bern
ETH Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich
EU Europäische Union
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Bern
FAL Eidg Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Zürich-Reckenholz
FAM Eidg Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, Bern-Liebefeld
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rom
FAT Eidg Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik, Tänikon
FAW Eidg Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil
FiBL Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, Frick
IAW Institut für Agrarwirtschaft, Zürich
LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris
OZD Oberzolldirektion, Bern
RAC Eidg Forschungsanstalt für Pflanzenbau, Changins
RAP Eidg Forschungsanstalt für Nutztiere, Posieux
SBV Schweizerischer Bauernverband, Brugg
seco Staatssekretariat für Wirtschaft, Bern
SMP Schweizerische Milchproduzenten, Bern
SRVA Service romand de vulgarisation agricole, Lausanne
TSM Treuhandstelle Milch, Bern
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation), Genf
ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, Bonn
Masseinheiten
dt Dezitonne = 100 kg
Fr Franken
ha Hektare = 10 000 m2
hl Hektoliter
Kcal Kilokalorien
kg Kilogramm
km Kilometer
l Liter
m Meter
m2 Quadratmeter
Mio Million
Mrd. Milliarde
A N H A N G A93 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Rp Rappen
St Stück
t Tonne
% Prozent
Ø Durchschnitt
Begriffe/Bezeichnungen
AGIS Agrarpolitisches Informationssystem
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
AK Arbeitskraft
AKZA Ausserkontingentszollansatz
BSE Bovine spongiforme Enzephalopathie ("Rinderwahnsinn")
BTS Besonders tierfreundliches Stallhaltungssystem
bzw beziehungsweise
BZ I, II, Bergzone
ca zirka
CO2 Kohlendioxid
EO Erwerbsersatzordnung
FJAE Familien-Jahresarbeitseinheit
GAP Gemeinsame Agrarpolitik der EU
GGA Geschützte Geografische Angaben
GUB Geschützte Ursprungsbezeichnung
GVE Grossvieheinheit
GVO Gentechnisch veränderte Organismen
inkl inklusive
IP Integrierte Produktion
IV Invalidenversicherung
JAE Jahresarbeitseinheit
KZA Kontingentszollansatz
LG Lebendgewicht
LN Landwirtschaftliche Nutzfläche
LwG Landwirtschaftsgesetz
Mwst Mehrwertsteuer
N Stickstoff
NWR Nachwachsende Rohstoffe
ÖAF Ökologische Ausgleichsfläche
ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis
P Phosphor
PSM Pflanzenschutzmittel
RAUS Regelmässiger Auslauf im Freien
RGVE Raufutter verzehrende Grossvieheinheit
SAK Standardarbeitskraft
SG Schlachtgewicht
u a unter anderem
vgl vergleiche
z B zum Beispiel
Verweis auf weitere Informationen im Anhang (z.B. Tabellen)
A94 A N H A N G
Bättig M., Kahlmeier S., Braun-Fahrländer C., 1999.
Aktionsplan Umwelt und Gesundheit: Wissen und Handeln zum Thema Ernährung und Umwelt
Diplomarbeit Abt für Umweltnaturwissenschaften, ETH, Zürich Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel, Basel
Bösch L , Kuster J , (Brugger, Hanser und Partner), 2001
Absatzförderung Landwirtschaft: Überprüfung der Plausibilität des Konzepts zur Mittelverteilung.
Forschungsauftrag des BLW
Braun M , Aschwanden N , Wüthrich-Steiner C , 2001
Evaluation Ökomassnahmen: Phosphorverluste durch Abschwemmung
Agrarforschung 8, S 36-41
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2000
Agrarbericht 2000, Bern
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2001
Veröffentlichung der Zuteilung der Zollkontingente.
Gemäss Punkt 2 des Berichtes vom 21 Februar 2001 des Bundesrates über zolltarifarische Massnahmen 2000, Separatdruck
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 2001.
Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme
Vierter Zwischenbericht, Bern
Bundesamt für Statistik (BFS), verschiedene Jahrgänge
Einblicke in die schweizerische Landwirtschaft, Neuenburg
Bundesamt für Statistik (BFS), 2001 Arealstatistik.
Bodennutzung im Wandel, Neuenburg
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 1996
Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissionen
Schriftenreihe Umwelt Nr 273, Bern
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 1998
Methanemissionen der schweizerischen Landwirtschaft.
Schriftenreihe Umwelt Nr 298, Klima, Bern
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2000.
Graue Treibhausgas-Emissionen des Energie- und des Ernährungssektors der Schweiz 1990 und 1998
Umweltmaterialien Nr 128, Klima, Bern
De Rosa R , 1999
La réorientation de la politique agricole suisse: analyse financière et endettement.
Forschungsprojekt im Auftrag des BLW, Freiburg
A N H A N G A95
■■■■■■■■■■■■■■■■ Literatur
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), 1999
Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 1995
Schriftenreihe der FAL 28, Spiess E , Zürich
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), 2000
Lachgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft.
Schriftenreihe der FAL 33, Zürich
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), 2001
Evaluation der Ökomassnahmen Phosphorbelastung der Oberflächengewässer durch Bodenerosion
Schriftenreihe der FAL 37, Prasuhn V , Kaufmann U , Zürich
Europäische Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft, 2001
Risk Management Tools for EU Agriculture. With a special focus on insurance, Brüssel.
Europäische Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft, 2001
Ein Konzept für Indikatoren der wirtschaftlichen und sozialen Dimension einer nachhaltigen Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums, Brüssel
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2000
L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde.
La faim au quotidien et la crainte permanente de la famine, Rom.
Gaillard G , Rossier D , FAL, FAT, SRVA, LBL, FiBL, 2001
Bilan écologique de l’exploitation agricole Méthode et application à 50 entreprises
GfS-Forschungsinstitut und Institut für Agrarwirtschaft (IAW), 2000 Univox Teil III A Landwirtschaft 2000.
GfS-Forschungsinstitut, Wirtschaftsforschung und Sozialmarketing, 2001
Befindlichkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung. Bericht einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung im Auftrag des BLW, Zürich
Herter U et al , 2001
Risikoanalyse zur Abfalldüngerverwertung in der Landwirtschaft Bericht im Auftrag des BLW, Bern
Institut für Kulturtechnik der ETH Zürich, 2001
Privater Nutzen von Arrondierung und Wegnetz bei Gesamtmelorationen. Forschungsauftrag des BLW, Zürich.
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel (ISPM), 2000 Ausgangslage im Teilbereich «Natur und Wohlbefinden», Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt, Basel
Jenny, M , Weibel, U , Lugrin, B , Josephy B , Regamey J -L , Zbinden N (in Druck/2001)
Förderung von typischen Brutvogelarten der offenen Feldflur durch ökologische Ausgleichsflächen in intensiv genutzten Ackerbaugebieten des Klettgaus SH und der Champagne genevoise GE. BUWAL Schriftenreihe Umwelt, Bern.
A96 A N H A N G
Jörin R , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2000
Die Regelung des Marktzutrittes, Theorie Forschungsauftrag des BLW, Zürich
Jörin R , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2000
Die Regelung des Marktzutrittes beim Wein. Forschungsauftrag des BLW, Zürich
Koch B , Rieder P , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2001
Fleischmarktanalyse
Forschungsauftrag des BLW, Zürich
Koch B , Rieder P , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2001 Eiermarktanalyse.
Forschungsauftrag des BLW, Zürich.
Koch B , Rieder P , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2001
Marktanalysen, Theorie und Methoden Forschungsauftrag des BLW, Zürich
Koch B , Rieder P , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2001 Getreidemarktanalyse.
Forschungsauftrag des BLW, Zürich.
König M , Senti R , 2001
Überprüfung der Methodik bei der Mittelverteilung in der landwirtschaftlichen Absatzförderung Forschungsauftrag des BLW, Zürich
Lehmann B et al , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2001 Evaluation des Milchmengenmanagements, Hauptstudie. Forschungsauftrag des BLW, Zürich.
Lehmann B et al , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 1999 Auswirkungen der Agrarreform auf das N-Verlustpotenzial in der Landwirtschaft Schlussbericht der ETH, Zürich
Lehmann B et al , (Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich), 2000 Lebensqualität in der Schweizer Landwirtschaft Grundlagen für eine zukünftige Sozialberichterstattung, Zürich
Mauch Consulting, INFRAS, Ernst Basler und Partner AG, 2001 Politik der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz. Standortbestimmung und Perspektiven, Zürich
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2001
Indicateurs environnementaux pour l’agriculture Volume 3, Méthodes et résultats, Paris
A N H A N G A97
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2001
Politique agricole dans les pays de l’OCDE Monitoring et évaluation 2001, Paris
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2001 Multifonctionnalité.
Elaboration d’un cadre analytique, Paris
Rossier D , FAT, FAL, FiBL, SRVA, LBL, 2000
Evaluation simplifiée de l’impact environnemental potentiel de l’agriculture suisse
Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie, verschiedene Jahrgänge
Statistische Erhebungen über Pflanzenschutzmittel, Zürich
Schweizerischer Bauernverband (SBV), verschiedene Jahrgänge. Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung der Schweiz, Brugg
Schweizerischer Bauernverband (SBV), verschiedene Jahrgänge
Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg
Schweizerischer Bundesrat, 1992
Siebter Landwirtschaftsbericht, Bern
Schweizerischer Bundesrat, 1996
Botschaft zur Reform der Agrarpolitik. Zweite Etappe (Agrarpolitik 2002), Bern
Schweizerischer Bundesrat, 1998 Botschaft zu einem Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2000 bis 2003, Bern
Vogelwarte Sempach, 2001
Rebhuhnprojekt, Sempach
World Trade Organization (WTO), 2001
Examen des politiques commerciales: Suisse et Liechtenstein. Rapport du Secrétariat, Genf
A98 A N H A N G
A N H A N G A99
A100 A N H A N G