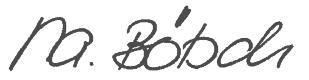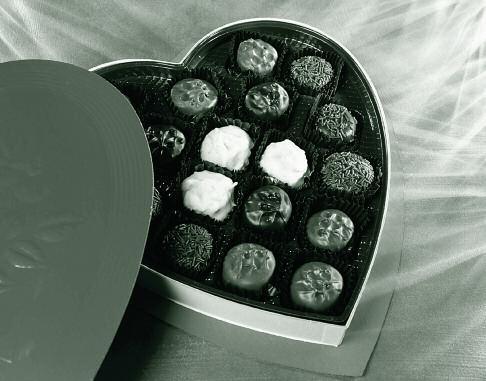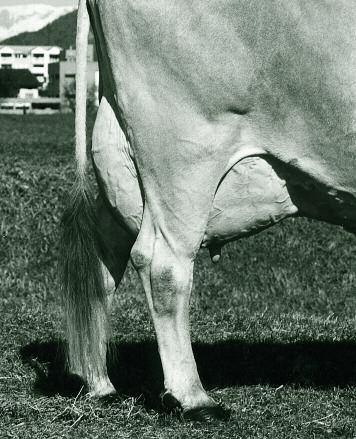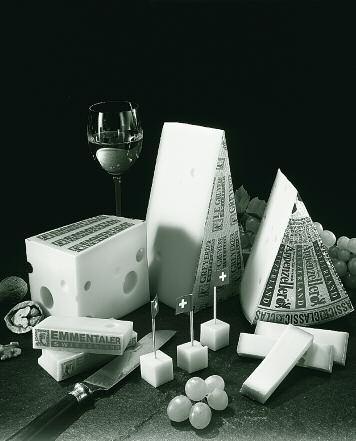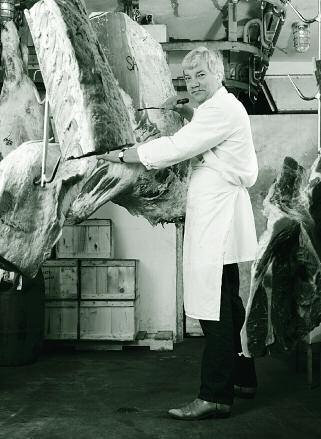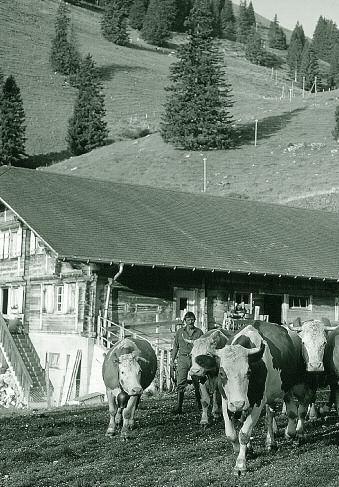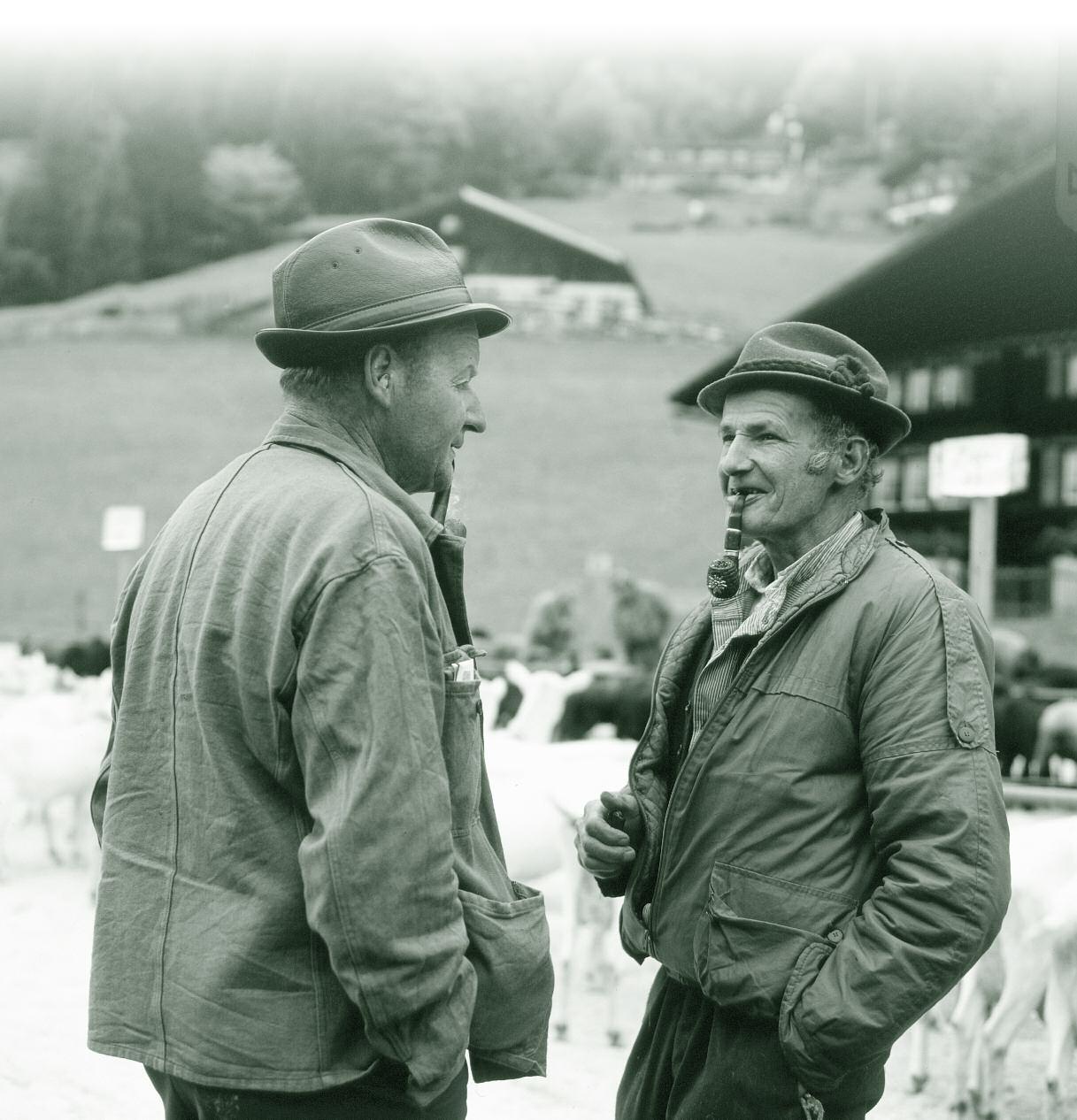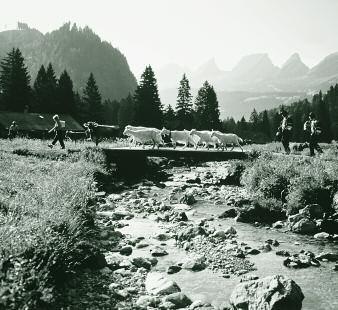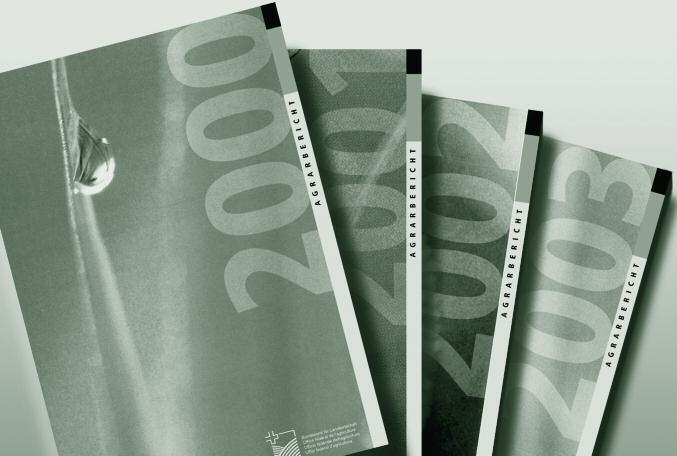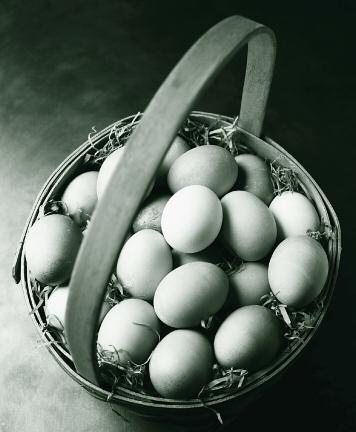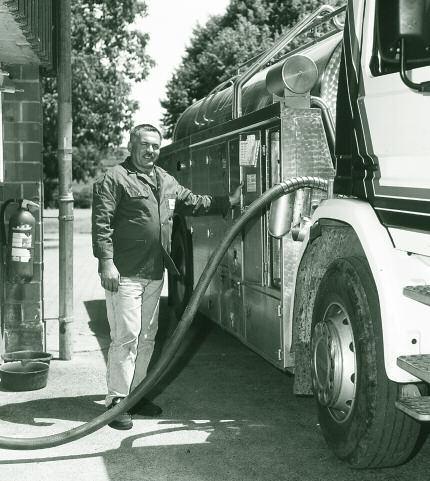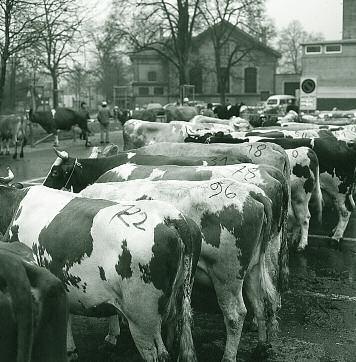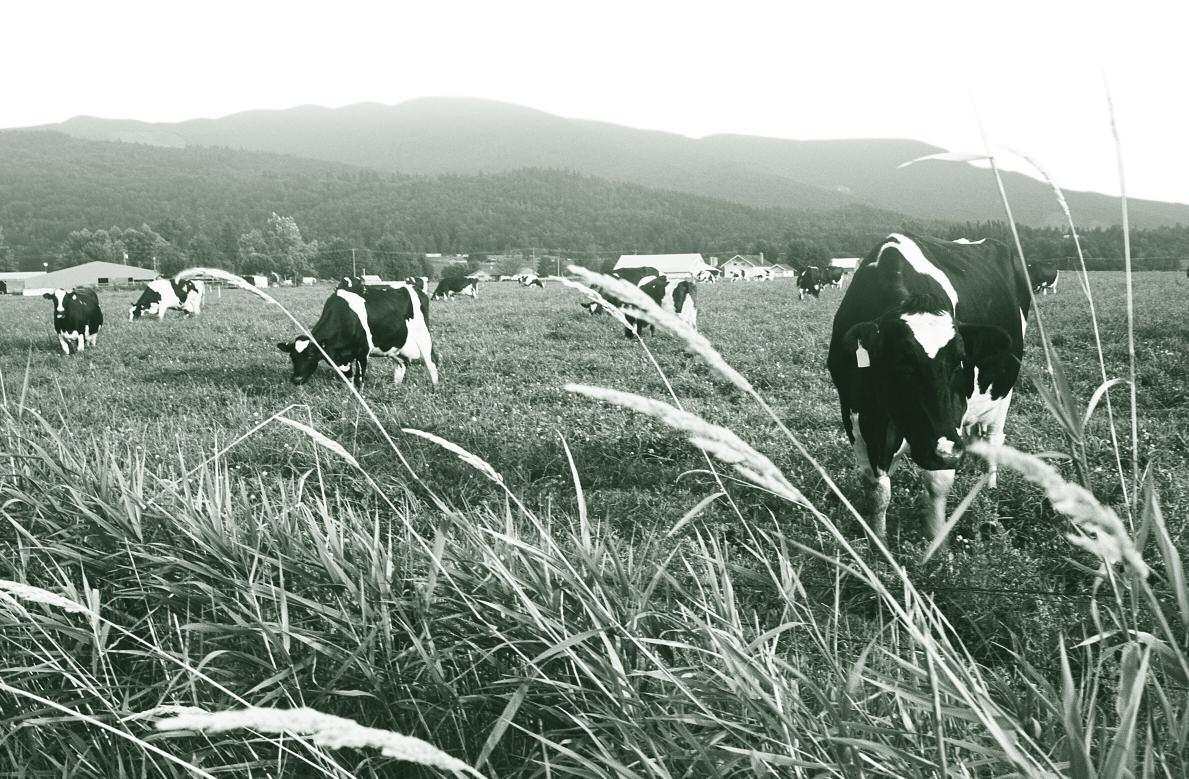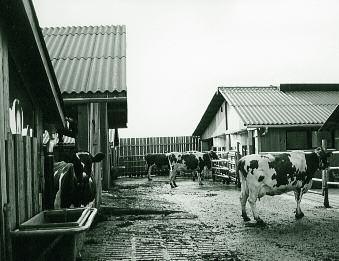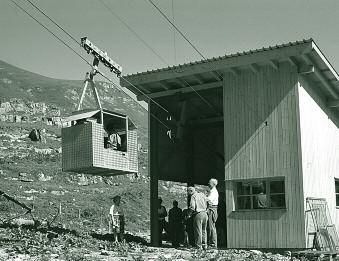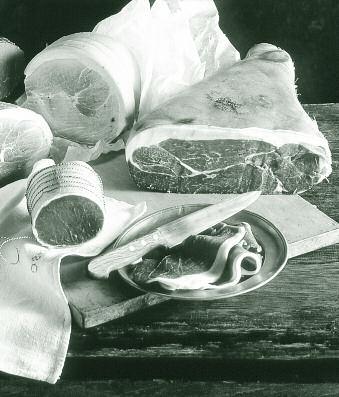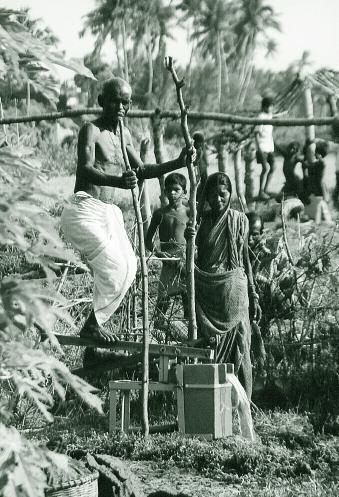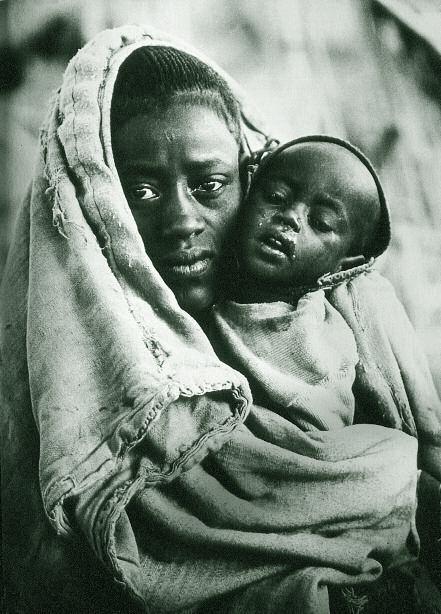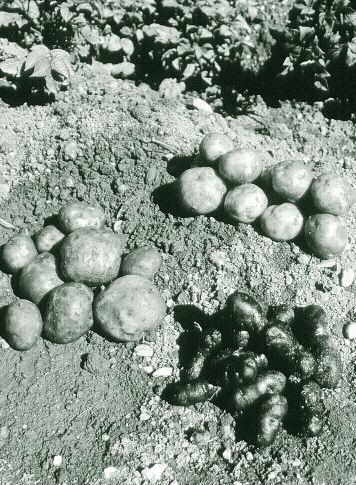Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe nach Betriebstypen 1997/99
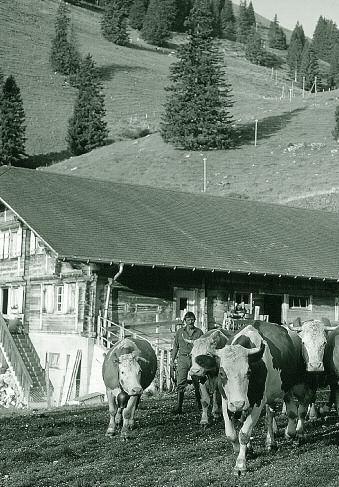
57 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Betriebstyp Landw. Familien- Landw. Neben- GesamtNutzfläche arbeits- Einkommen einkommen einkommen kräfte ha FJAE Fr Fr Fr Mittel alle Betriebe 18,14 1,31 54 948 18 506 73 454 Ackerbau 22,40 1,04 66 024 27 940 93 964 Spezialkulturen 12,54 1,31 62 233 20 052 82 285 Verkehrsmilch 17,43 1,36 47 668 17 900 65 568 Mutterkühe 16,99 1,13 43 711 31 311 75 022 Anderes Rindvieh 14,46 1,30 31 931 19 619 51 550 Pferde/Schafe/Ziegen 12,53 1,16 24 740 29 819 54 559 Veredlung 10,88 1,19 59 634 15 559 75 193 Kombiniert Verkehrsmilch/Ackerbau 23,58 1,37 68 193 12 986 81 179 Kombiniert Mutterkühe 24,65 1,23 57 118 25 445 82 563 Kombiniert Veredlung 17,95 1,31 72 448 16 085 88 533 Kombiniert Andere 19,40 1,30 56 633 18 637 75 270 Quelle: Zentrale Auswertung, FAT Tabellen
1
18a –18b, Seiten A18 – A19 Begriffe und Methoden, Seite A61
■
Im Durchschnitt der Jahre 1997/99 erzielten die Ackerbau- und Spezialkulturbetriebe zusammen mit den kombinierten Veredlungsbetrieben die höchsten landwirtschaftlichen Einkommen Am meisten Kapazitäten für Nebeneinkommen bestanden bei Betrieben mit arbeitsextensiven Betriebszweigen (Ackerbau, Mutterkühe, Pferde, Schafe, Ziegen) Insgesamt erwirtschafteten Verkehrsmilch-, Rindviehhaltungs- und Tierhaltungsbetriebe von Pferden, Schafen und Ziegen die tiefsten Gesamteinkommen
Die in den folgenden Ausführungen verwendeten Kennzahlen werden auf der Basis der Darstellung in Quartilen beurteilt
Der von den Landwirtschaftsbetrieben erwirtschaftete Arbeitsverdienst ist sowohl nach Regionen als auch in den einzelnen Quartilen sehr unterschiedlich In der Talregion betrug 1997/99 der durchschnittliche Arbeitsverdienst im 1 Quartil 24% und derjenige im 4. Quartil 198% des Mittelwertes aller Betriebe. Die Betriebsstrukturen dagegen variierten weniger stark Die LN im 1 Quartil lag bei 79% und im 4 Quartil bei 125% des Mittelwertes Beim Arbeitskräfteeinsatz des Betriebes (JAE) war die entsprechende Streuung nochmals kleiner (98% im 1 Quartil gegenüber 104% im 4 Quartil) Die von einer Arbeitskraft bewirtschaftete Fläche lag bei den Talbetrieben im 4 Quartil bei 120% (12,3 ha) und im 1. Quartil bei 80% (8,2 ha) des Mittelwertes (10,2 ha). Diese Aussagen lassen sich analog auf die Hügel- und die Bergregion übertragen
Arbeitsverdienst der Landwirtschaftsbetriebe 1997/99: nach Regionen und Quartilen
Arbeitsverdienst 1 in Fr pro FJAE 2

1 Eigenkapitalverzinsung zum mittleren Zinssatz der Bundesobligationen: 1997: 3 40%; 1998: 2 81%; 1999: 3 02%
2 Familien-Jahresarbeitseinheiten: Basis 280 Arbeitstage
Quelle: Zentrale Auswertung FAT
Die Höhe des Arbeitsverdienstes ist somit nur beschränkt eine Frage der Betriebsstruktur Vielmehr besteht ebenfalls ein starker Einfluss des Betriebsleiters oder der Betriebsleiterin auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des Betriebes. Auffallend ist auch, dass die Ausgaben für den Lebensunterhalt der Familie (Privatverbrauch) zwischen den Quartilen nur leicht variieren
In der Tal- und Hügelregion erreichte 1997/99 das oberste Quartil der Landwirtschaftsbetriebe den entsprechenden Jahres-Bruttolohn der übrigen Bevölkerung In der Bergregion liegt der mittlere Arbeitsverdienst im 4 Quartil rund 8'000 Fr unter dem Vergleichswert
58 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Median Mittelwerte Region 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Quartil (0–25%) (25–50%) (50–75%) (75–100%) Talregion 38 286 9 849 31 101 47 255 81 326 Hügelregion 29 781 8 212 24 265 35 801 58 198 Bergregion 22 180 5 469 17 848 27 007 44 733
Tabellen 19 –22, Seiten A20 –A23
Grosse Unterschiede beim Arbeitsverdienst
■ Finanzielle Stabilität
Vergleichslohn nach Regionen 1997/99
Zieht man das Nebeneinkommen mit in die Beurteilung ein, sieht die Situation der landwirtschaftlichen Haushalte deutlich besser aus, als der alleinige Vergleich von Arbeitsverdienst mit Vergleichslohn erscheinen lässt. Die durchschnittlichen Nebeneinkommen liegen in allen Regionen bei rund 19‘000 Fr
Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital (= Aktiven total) gibt Auskunft über die Verschuldung des Unternehmens Kombiniert man diese Kennzahl zur Verschuldung mit der Grösse der Eigenkapitalbildung lassen sich Aussagen über die Tragbarkeit einer Schuldenlast machen Ein Betrieb mit hoher Fremdkapitalquote und negativer Eigenkapitalbildung ist auf die Dauer – wenn diese Situation über Jahre hinweg anhält –finanziell nicht existenzfähig
Auf Basis dieser Überlegungen werden die Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität eingeteilt
Einteilung der Betriebe in vier Gruppen mit unterschiedlicher finanzieller Stabilität
Betriebe mit Verschuldungsgrad (Fremdkapitalquote)
Tief (<50%) Hoch (>50%)
Positiv ... guter ... beschränkter
Eigenkapitalbildung
finanzieller Situation finanz Selbständigkeit Negativ ungenügendem bedenklicher
Einkommen finanzieller Situation
Quelle: De Rosa
Die Beurteilung der finanziellen Stabilität der Betriebe zeigt in den drei Regionen ein ähnliches Bild Knapp die Hälfte der Betriebe befindet sich in einer finanziell guten Situation und rund ein Drittel sind als Problembetriebe einzustufen (Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung) Ein beträchtlicher Teil der Betriebe weist eine Eigenkapitalbildung um Null aus
59 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Region Vergleichslohn1 Fr. pro Jahr Talregion 62 182 Hügelregion 56 788 Bergregion 52 656
1 Median der Jahres-Bruttolöhne aller im Sekundär- und Tertiärsektor beschäftigten Angestellten Quellen: BFS, FAT
1
Beurteilung der finanziellen Stabilität 1997/1999: nach Regionen
10 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 14 20 19 47 15 13 27 45 14 16 22 48
TalregionHügelregionBergregion A n t e i l B e t r i e b e i n %
Zusätzliche Auswertungen zeigen, dass junge Landwirte systematisch eine höhere Verschuldung aber auch eine höhere Eigenkapitalbildung vorweisen Dagegen weisen ältere Landwirte systematisch eine niedrige Eigenkapitalbildung bei geringerer Verschuldung aus Analog zur Streuung bei der Einkommenssituation fällt die Beurteilung der finanziellen Stabilität in den einzelnen Quartilen sehr unterschiedlich aus
Beurteilung der finanziellen Stabilität 1997/1999: Talregion nach Quartilen 1
100 90 80 70 60 50 40 30 20
14 20 19 47
24 41 10 25
17 18 19 46
9 13 20 58
5 8 28 59
Mittel1. Quartil (0–25%)
2. Quartil (25–50%)
bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle 10 0
3. Quartil (50–75%)
4. Quartil (75–100%)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
In der Talregion gab es 1997/99 im 4 Quartil lediglich 13% Betriebe mit negativer Eigenkapitalbildung, während dieser Anteil im 1. Quartil bei rund zwei Dritteln lag. Der mittlere Verschuldungsgrad (Fremdkapitalquote) war im 1 Quartil (41%) nur leicht höher als im 4 Quartil (39%) Die grosse Streuung bei der Eigenkapitalbildung (Mittelwert 1 Quartil: -10‘127 Fr ; 4 Quartil: 39‘031 Fr ) ist vor allem auf die Abweichungen bei den Gesamteinkommen (50‘820 Fr gegenüber 120‘387 Fr ) zurückzuführen, da beim Privatverbrauch der Familie die Differenzen kleiner sind (60‘947 Fr. gegenüber 81‘356 Fr )
60 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
A n t e i l B e t r i e b e i n %
1 Sortierkriterium: Arbeitsverdienst Situation
Zentrale Auswertung,
bedenkliche finanzielle Situation ungenügendes Einkommen beschränkte finanzielle Selbständigkeit gute finanzielle Situation Quelle:
FAT
■ Produktivität Die Produktivität misst das Verhältnis zwischen Ertrag (Output) und Faktoreinsatz (Input) Gesamtbetriebliche Aussagen zur Produktivität der eingesetzten Produktionsfaktoren lassen sich mit Hilfe des Betriebseinkommens anstellen Die gesamtbetriebliche Produktivität gibt an, wieviel Betriebseinkommen mit den eingesetzten Produktionsfaktoren (Arbeit, Fläche, Kapital) erwirtschaftet wird
Ableitung der gesamtbetrieblichen Produktivitäten
Betriebseinkommen
pro Fr. investiertes Kapital (Aktiven Betrieb)
ArbeitsproduktivitätKapitalproduktivität Flächenproduktivität
In den Tabellen im Anhang stehen alle drei Indikatoren für die Produktivitätsbeurteilung zur Verfügung Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Darstellung der Flächenproduktivität. Bezüglich der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital werden andere aussagekräftige Indikatoren (Arbeitsverdienst und Kapitalrentabilität) vertieft präsentiert
Flächenproduktivität 1997/99, nach Regionen und nach
In den drei Regionen und zwischen den Quartilen bestehen beträchtliche Unterschiede Die mittlere Flächenproduktivität der Betriebe im 4. Quartil lag 1997/99 rund 67% (Talregion), 63% (Hügelregion) bzw 70% (Bergregion) über dem entsprechenden Wert im 1 Quartil Als Sortierkriterium für die Einteilung in die Quartile dient der Arbeitsverdienst Betriebe mit einem guten Arbeitsverdienst erzielen somit auch eine gute Flächenproduktivität und umgekehrt

61 1 . 1 Ö K O N O M I E 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
pro ha LN
pro JAE (Angestellte + Familie)
1
F r / h a L N
1 Sortierkriterium:
Talregion Hügelregion Bergregion 0 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 5 3 3 1 3 1 2 9 2 1 3 0 2 9 4 4 3 4 2 9 3 6 2 2 4 2 5 3 3 0 9 6 3 8 9 9 3 9 4 0 4 8 2 2 4 4 1 3 5 4 5 8 5 0 3 5 6 5 1 7 1
Quartilen
Mittel1. Quartil (0–25%) 2. Quartil (25–50%) 3. Quartil (50–75%) 4. Quartil (75–100%)
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT
Arbeitsverdienst
■ Rentabilität Die Kennzahlen zur Rentabilität zeigen auf, welche Entlohnung für die eingesetzten Produktionsfaktoren resultiert Die Kapitalrentabilität ist von der Kapitalproduktivität zu unterscheiden Die Kapitalproduktivität sagt aus, wieviel Betriebseinkommen durch das investierte Kapital erwirtschaftet wird. Die Kapitalrentabilität dagegen gibt an, zu welchem Zinssatz das investierte Kapital betriebsintern verzinst wird
Ableitung der Kapitalrentabilität
Eigenkapitalrentabilität
Gesamtkapitalrentabilität
Eigenkapitalrente 1
Eigenkapital Betrieb
Reinertrag 2 Aktiven Betrieb
1 Kalkulatorischer Gewinn/Verlust plus Zinsanspruch Eigenkapital; oder: landwirtschaftliches Einkommen minus kalkulatorische Abgeltung der familieneigenen Arbeit zum Ansatz des Vergleichslohnes

2 Schuldzinsen plus Eigenkapitalrente
Das landwirtschaftliche Einkommen vieler Betriebe vermag die Arbeit der Betriebsleiterfamilie nicht zum Ansatz des Vergleichslohnes abzugelten Kalkulatorisch resultiert daher eine negative Eigenkapitalrente und damit ebenfalls eine negative Eigenkapitalrentabilität. Generell sind die Streuungen der Kapitalrentabilitäten beträchtlich Die realisierten Zinssätze reichen beim Eigenkapital von -20,4% bis zu 7,7% und beim Gesamtkapital von -10,3% bis zu 5,9% Nur die Betriebe im 4 Quartil erreichten 1997/99 im Durchschnitt eine positive Verzinsung sowohl beim Eigenkapital als auch beim Gesamtkapital
Gesamtkapitalrentabilität 1997/99: nach Regionen und nach Quartilen 1
Gründe, wieso ein Landwirtschaftsbetrieb selbst bei einer negativen Verzinsung des Kapitals weitergeführt wird, bzw warum die Betriebsleiterfamilie eine tiefere Arbeitsentschädigung als den Ansatz des Vergleichslohnes in Kauf nimmt, sind neben ökonomischen Überlegungen (z B mangelnde Alternativen) auch in nicht-monetären Werten wie Selbständigkeit, Leben in der Natur, Bindung an den Familienbesitz und regionale Verbundenheit zu suchen.
62 1 . 1 Ö K O N O M I E 1
Mittel1. Quartil (0–25%) 2. Quartil (25–50%) 3. Quartil (50–75%) 4. Quartil (75–100%) V e r z i n s u n g G e s a m t k a p i t a l i n %
Talregion Hügelregion Bergregion 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,04 , 92 , 50, 71 0 , 37 , 77 , 86 , 75 , 13 , 81, 6 1 , 1 3 , 3 5 , 9 0, 33 , 3
Quelle: Zentrale Auswertung, FAT 1 Sortierkriterium: Arbeitsverdienst
Die soziale Situation der Landwirtschaft wurde bisher wenig systematisch untersucht. Deshalb müssen entsprechende Methoden erst noch entwickelt werden Die Kriterien, anhand derer die soziale Lage der Bauernfamilien beurteilt werden kann, müssen umschrieben werden Daraus können Indikatoren abgeleitet werden, mit denen die Entwicklung im sozialen Bereich verfolgt werden kann
Für die Darstellung der sozialen Lage werden hier im Wesentlichen zwei Ansätze gewählt: Zuerst wird gezeigt, welche Leistungen der Sozialwerke in welchem Ausmass durch Bäuerinnen und Bauern in Anspruch genommen werden. Ferner orientieren erste Resultate einer Grundlagenstudie an der ETH Zürich über die Lebensqualität aus Sicht der Landwirtschaft
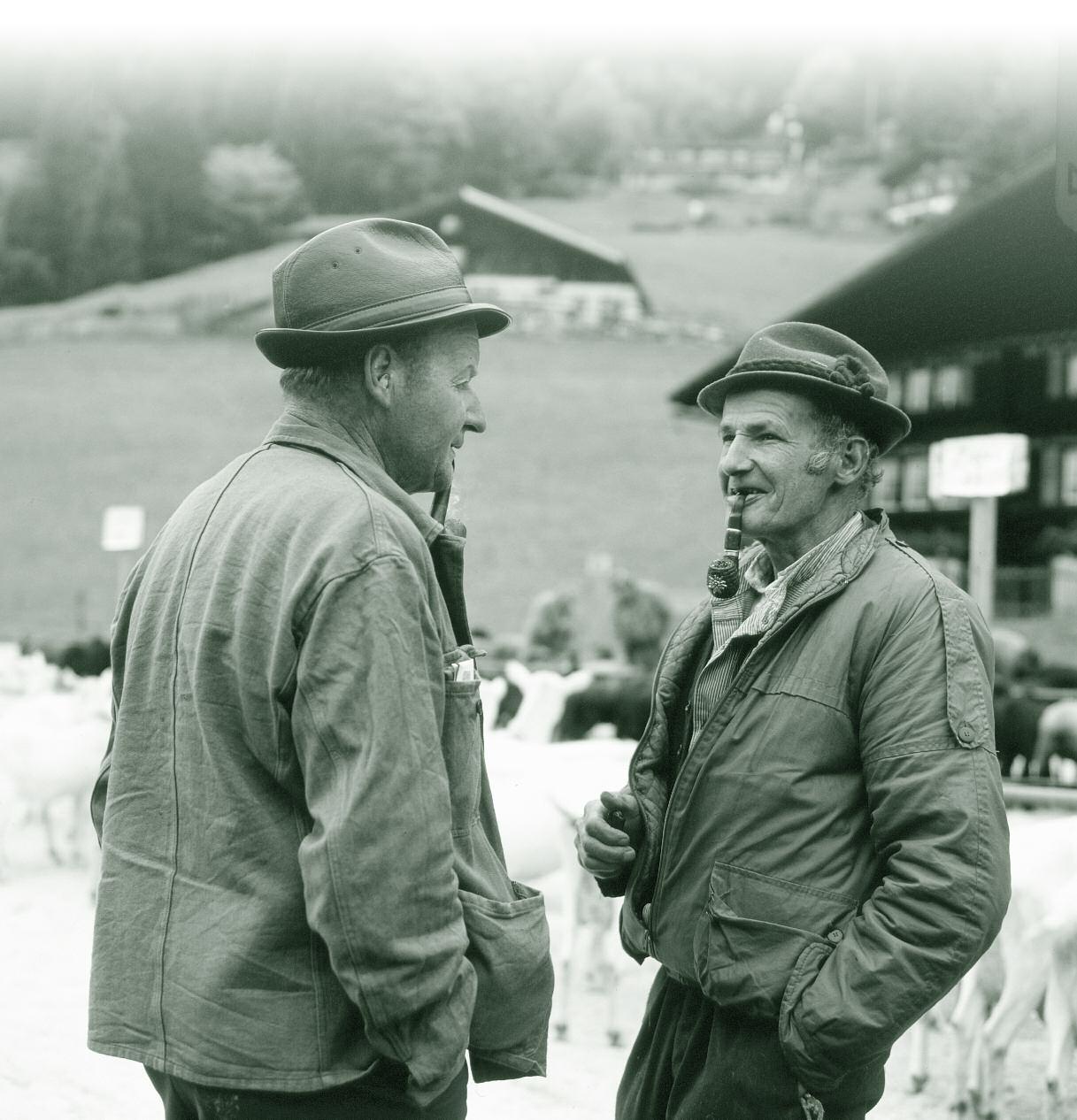
1 . 2 S O Z I A L E S ■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 Soziales
1 63
■ Alters- und Hinterlassenenversicherung
1.2.1 Inanspruchnahme sozialer Leistungen
Die staatlichen Sozialwerke sowie Personen- und Sachversicherungen bilden sowohl für die bäuerliche als auch für die nicht-bäuerliche Bevölkerung das formale Sicherheitsnetz Die Inanspruchnahme dieses Netzes von bäuerlicher Seite sowie auch weiterer sozialer Einrichtungen lässt Vergleiche mit andern Bevölkerungsgruppen zu Am Ende dieses Abschnitts wird schliesslich auf die Hemmnisse bei der Inanspruchnahme sozialer Leistungen eingegangen
Staatliche Sozialwerke
Die 1948 eingeführte AHV-Rente ist abhängig vom beitragspflichtigen Einkommen in der aktiven Zeit sowie von allfälligen Erziehungs- und Betreuungsgutschriften.

Aus der AHV-Einkommensstatistik für das Jahr 1995 ergibt sich, dass unter den insgesamt 4'125'675 Beitragszahlern 24'384 selbständige Landwirte figurieren – davon 1'206 Frauen, die keine andere beitragspflichtige Erwerbstätigkeit hatten 30'486 selbständige Landwirte – davon 935 Frauen – gingen zusätzlich einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach
und AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen 1995, in Fr.
Es zeigt sich, dass diejenigen Landwirtinnen und Landwirte, die gleichzeitig als Arbeitnehmer beschäftigt sind, im Alter Renten beziehen, die nur leicht unter dem schweizerischen Durchschnitt liegen, während bei ausschliesslich selbständigen Landwirtinnen und Landwirten unterdurchschnittliche Rentenbezüge vorliegen
Der selbständige Rentenanspruch der Bäuerin (Vor-Splitting) ist meistens sehr gering Sofern die Bäuerin nicht ein ausserbetriebliches Einkommen erwirbt, erhält sie kein AHV-rechtliches Einkommen; das ganze AHV-Einkommen wird dem Mann gutgeschrieben. Es ist zwar möglich, der mitarbeitenden Ehefrau ein Erwerbseinkommen auszuzahlen, oder wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, die Bäuerin als Selbständigerwerbende mit eigenem Einkommen zu deklarieren In der Praxis wird von diesen Möglichkeiten aber sehr selten Gebrauch gemacht. Die 10. AHV-Revision hat die Situation durch die Einführung der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften wesentlich verbessert
1 . 2 S O Z I A L E S 1 64 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Arbeitsverhältnis
Selbständige Landwirtinnen und Landwirte 36 496 Andere Selbständigerwerbende 65 896 Landwirtinnen und Landwirte mit Nebenerwerb 53 785 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 56 800
■ Invalidenversicherung
Die degressive Beitragsskala hat, infolge der tiefen AHV-Einkommen, welche in der Landwirtschaft erwirtschaftet werden, eine besondere Bedeutung Das durchschnittliche AHV-Einkommen der selbständigen Bauern betrug 1995 rund 36'000 Fr Vereinfacht gerechnet resultiert daraus ein AHV/IV/EO Beitragssatz von 6,942% anstelle eines Beitragssatzes ohne degressive Skala von 9,5% Die Differenz entspricht einer jährlichen Prämienreduktion von durchschnittlich 920 Fr pro Betrieb
Hauptanliegen der IV ist die Wiedereingliederung und damit die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
Gemäss einer Untersuchung (Donini) haben im Jahr 1985 knapp 7% der Landwirte eine IV-Rente bezogen 1993 waren es über 7,5% der Rentenbezüger Diese Anteile entsprechen mehr als dem Doppelten des Anteils bei der gesamten erwerbstätigen Wohnbevölkerung in der Schweiz. Dies ist auf die Schwere der Arbeit und das hohe Durchschnittsalter der in diesem Sektor aktiven Personen zurückzuführen (jede bzw jeder siebte Arbeitende ist über 62 bzw 65 jährig)
Bei den Landwirtinnen und Landwirten, die nebenbei noch anderweitig arbeiten, sieht das Bild anders aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine IV-Rente beziehen, ist viel kleiner: 1985 mit 2,8% und 1993 mit 3% lag die Inanspruchnahme nahe am Durchschnitt der Schweizer Erwerbsbevölkerung
Von besonderer Bedeutung der Wiedereingliederungsmassnahmen ist die Kapitalhilfe Die Kapitalhilfe hat zum Ziel, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern Entscheidend ist, dass die notwendigen Umstellungen im Landwirtschaftsbetrieb durch die Invalidität bedingt sind, und dass nach der Umstellung die wirtschaftliche Existenz gesichert ist. Die Kapitalhilfe kann ohne Rückzahlungspflicht oder als zinsloses Darlehen gewährt werden Sie kann auch in Form von Betriebseinrichtungen oder Garantieleistungen erbracht werden Das Gesetz legt kein Maximum fest: Die Hilfe muss im Rahmen der notwendigen und angemessenen Grenzen angesetzt werden. Der Gesamtbetrag aller noch laufenden Darlehen erreicht 1999 rund 16 Mio Fr Jährlich kommen zwischen 120 und 145 Landwirte in den Genuss solcher Hilfsmittel
■ Ergänzungsleistungen
Die Ergänzungsleistungen werden an Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger der AHV oder IV ausgerichtet, wenn diese Renten den Existenzbedarf nicht decken Bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen für Rentnerinnen und Rentner, denen ein Landwirtschaftsbetrieb gehört hat oder noch gehört, ist in der Regel entscheidend, wie hoch das Nettovermögen ist und wie die vermögensrechtliche Übergabe (Wohnrecht, Verzicht etc ) erfolgte
Im Rahmen der Stiftung «Landwirtschaft und Behinderte» werden Ergänzungsleistungen an behinderte Personen ausgerichtet, die von Bauernfamilien betreut werden und im Betrieb mithelfen
1 . 2 S O Z I A L E S 1 65 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ Familienzulagen
Besondere Kennzahlen zur Ausrichtung von Ergänzungsleistungen in der Landwirtschaft liegen nicht vor Verschiedene Studien zeigen jedoch, dass Bauern und Bäuerinnen auf den Sozialämtern untervertreten sind (Joost 1999, Wicki und Pfister 2000). Eine Einflussgrösse, welche die Bezugsquote relativ zum schweizerischen Durchschnitt herabsetzt, ist die überdurchschnittlich häufige Erzielung eines Erwerbseinkommens über das AHV-Rentenalter hinaus Ein Faktor, welcher die Bezugsquote eher ansteigen lässt, ist die mangelnde Versicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge

Mit dem Erwerbsersatz soll der Verdienstausfall für Zeiten, in welchen die Versicherten in der Armee oder im Zivildienst sind, entschädigt werden: Es soll verhindert werden, dass kleinere Bauernbetriebe, aufgrund der Dienstpflicht ihrer Mitarbeiter, in Schwierigkeiten geraten Deshalb werden Betriebszulagen an mitarbeitende Familienmitglieder ausgerichtet.
Mit dieser Sonderregelung wird die Landwirtschaft – im Vergleich mit anderen Branchen, in denen Familienunternehmen tätig sind – privilegiert behandelt
Das Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft hat eine familienpolitische Zielsetzung: Bauernfamilien mit Kindern, die nur über ein bescheidenes Einkommen verfügen, sollen unterstützt werden. Die Ausrichtung von Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer/innen sowie an Berg- und Kleinbauern wird durch bundesrechtliche Vorschriften geregelt Dabei liegt die Einkommensgrenze bei 30'000 Fr zuzüglich 5'000 Fr je zulageberechtigtes Kind Für die Gewährung von Familienzulagen an Arbeitnehmer ausserhalb der Landwirtschaft sind dagegen die gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Kantone massgebend. In den Kantonen ZH, FR, SH, SG, VD, VS, NE, GE und JU werden ergänzende Beiträge zu den Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer ausgerichtet Auch für die selbständigen Landwirte kennen einige Kantone ergänzende oder zusätzliche Regelungen (ZH, SO, SH, SG, VD, VS, NE, GE, JU) Die Zulagen werden über die kantonalen Familienausgleichskassen ausgerichtet
1 . 2 S O Z I A L E S 1 66
■ Erwerbsersatzordnung
■ Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung
Nach dem Bundesgesetz werden Familienzulagen in Form von Kinder- und Haushaltszulagen gewährt
Kinder- und Haushaltzulagen
Kinderzulage pro Kind je Monat Talgebiet 160 Fr für die ersten zwei Kinder 165 Fr ab dem dritten Kind
Berggebiet 180 Fr für die ersten beiden Kinder 185 Fr ab dem dritten Kind
Haushaltszulage an landwirtschaftliche Arbeitnehmer je Monat 100 Fr
Gliederung der Familienzulagen: Jahresrechnung 1999
Das Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung will AHV-pflichtige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine angemessene Erwerbsausfallentschädigung garantieren, wenn sie durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, schlechtem Wetter oder bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers betroffen sind.
Da Selbständigerwerbende generell nicht versichert sind, können auch selbständige Landwirte keine Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung ableiten Von der Versicherung ausgenommen sind ebenfalls die mitarbeitenden Familienmitglieder, die den selbständigen Landwirten gleichgestellt sind Relevant ist diese Versicherung daher nur bei einer Tätigkeit im Nebenerwerb
Überdies können landwirtschaftliche Betriebe – im Gegensatz zu anderen wetterabhängigen Gewerbebetrieben – nicht von der Schlechtwetterentschädigung profitieren
1 . 2 S O Z I A L E S 1 67 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Ertrag Mio Fr Aufwand Mio Fr Beiträge Arbeitgeber 11,7 Geldleistungen 145,7 Beiträge öffentliche Hand 137,2 Verwaltungskosten 3,2 davon Bund 2/3 91,5 + Entlastungsbeitrag 1,5 - Total Kosten Bund 93,0 - davon 1/3 Kantone 42,2 Total Ertrag 148,9 Total Aufwand 148,9 Quelle: BSV
■ Krankenversicherung
Personenversicherungen
Die Krankenversicherung umfasst obligatorisch die nötige medizinische Versorgung (bei Krankheit und Unfall) und freiwillig die Taggeldversicherung. Die meisten Landwirte sind für die Grundversicherung und eine Zusatzversicherung für ergänzende Leistungen im ambulanten Bereich, und für die allgemeine Spitalabteilung versichert
Der Schadenverlauf bei der Krankenkasse AGRISANO, deren Mitgliederbestand vorwiegend aus der Landwirtschaft stammt, zeigt, dass die Inanspruchnahme der bäuerlichen Bevölkerung unterdurchschnittlich ist und sich dies auch auf die Prämien auswirkt: Die Pflegeleistungen werden oft innerhalb der Familie erbracht Landwirte dürften zudem tendenziell eher in den kostengünstigeren Regionen prämienpflichtig sein.
Die Prämienverbilligungssysteme vieler Kantone benachteiligen die Selbständigerwerbenden durch die Festsetzung der Vermögenslimiten: Gerade die Bauern mit kleinen Einkommen sind darauf angewiesen, ihr Vermögen in den Betrieb zu investieren, wo es als steuerbares Vermögen in Erscheinung tritt Viele Landwirte mit tiefen Einkommen erhalten aus diesem Grunde keine Prämienverbilligung 1998 sind im Kanton Waadt 32% der Wohnbevölkerung in den Genuss von Prämienverbilligungen gekommen – was dem gesamtschweizerischen Durchschnitt entspricht –, in der landwirtschaftlichen Bevölkerung betrug der Anteil lediglich 23%
■ Unfallversicherung
Die Unfallversicherung ist eine Versicherung für alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen von Berufsund Nichtberufsunfällen sowie Berufskrankheiten Die selbständigerwerbenden Landwirte und ihre mitarbeitenden Familienangehörigen unterstehen nicht den Vorschriften des Gesetzes über die Unfallversicherung. Die familienfremden landwirtschaftlichen Arbeitnehmer werden von den privaten Unfallversicherern versichert
Das Unfallrisiko in der Landwirtschaft ist deutlich höher als in den anderen Sektoren der Wirtschaft; dementsprechend sind die laufenden Kosten pro Versicherten bzw die Prämien auch viel höher Hingegen sind die Nichtberufsunfälle weniger häufig und die Kosten pro Versicherten tiefer
■ Militärversicherung
Die Militärversicherung will im Militär-, Zivil- oder Zivilschutzdienst stehende Personen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Gesundheitsschäden, die sich im Dienst ereignen, schützen.
Die Militärversicherung kennt für Selbständigerwerbende – und damit auch für die selbständigen Landwirte – besondere Entschädigungen. Angemessen vergütet wird der Schaden, der während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Struktur des Betriebes durch weiterlaufende feste Betriebskosten entsteht
1 . 2 S O Z I A L E S 1 68
■ Obligatorische berufliche Vorsorge
Im Alter soll mit der beruflichen Vorsorge ein Ersatzeinkommen für den Versicherten garantiert sein, der die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung ermöglicht
Die Selbständigerwerbenden und ihre mitarbeitenden Familienmitglieder unterstehen nicht der obligatorischen beruflichen Vorsorge In der Landwirtschaft gehen mehr als die Hälfte der Betriebsleiter neben der selbständigen Tätigkeit einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nach Bei den Männern mit gemischter Tätigkeit resultiert dabei im Durchschnitt 50,2% des Einkommens aus der Tätigkeit als Landwirt Beim durchschnittlichen von der AHV erfassten Einkommen von 53'785 Fr (1995) entfällt somit ein Einkommen von 26'785 Fr auf die unselbständige Erwerbstätigkeit: Die Grenze gemäss Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge von 24'120 Fr wird also nur knapp erreicht: Dieser rein rechnerische Durchschnitt lässt jedoch keinen Rückschluss darauf zu, wieviele Landwirte mit zusätzlicher unselbständiger Tätigkeit dem Gesetzesobligatorium unterstehen und in welchem Ausmass eine Versicherungsdeckung vorliegt. Bei den Frauen, welche als selbständige Landwirtinnen und gleichzeitig als Arbeitnehmerinnen erfasst sind, ergibt sich ein durchschnittlicher Gesamtverdienst von 32'165 Fr Nur gerade 26% des Einkommens stammen aus der Landwirtschaft Im Durchschnitt erreichen die Frauen die im Gesetz festgelegte Grenze nicht Der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen Personen, welche im Alter, bei Invalidität oder Todesfall aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge keinen oder nur einen sehr geringen Versicherungsschutz hat, dürfte daher sehr hoch sein
Seit der Einführung der Steueraufzeichnungspflicht (ab Steuerperiode 93/94), hat für viele Landwirte die steuerbegünstigte Vorsorge der Säulen 2b und 3b stark an Bedeutung gewonnen Besondere Bedeutung hat die Säule 2b infolge der Einführung der Einkommens- und Vermögensgrenzen für die Ausrichtung der Direktzahlungen gemäss AP 2002 und das Prämienverbilligungsverfahren bei der Krankenversicherung erlangt. Durch Beiträge an die 2. Säule kann sowohl das massgebende Einkommen wie auch das massgebende Vermögen reduziert werden

Sachversicherungen
■ Haftpflichtversicherung
Die Haftpflichtversicherung deckt den einem Dritten zugefügten Schaden bei Personen- und bei Sachschädigungen Landwirte schliessen in der Regel eine kombinierte Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung ab
Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist obligatorisch für alle Motorfahrzeuge, die in den öffentlichen Verkehr gebracht werden: Dies gilt für landwirtschaftliche Motorfahrzeuge, wie Traktoren, Mähdrescher etc Die Versicherung für Motorhandwagen und Motoreinachser wird mit der Einlösung des Versicherungskennzeichens auf der Polizeistelle abgeschlossen.
Landwirtschaftliche Fahrzeuge werden üblicherweise mit der grünen Nummer ausgerüstet Entsprechend werden die Fahrten auf landwirtschaftliche (und gemeinnützige) Tätigkeiten eingeschränkt Die Prämie ist aufgrund des im Vergleich zu andern Fahrzeugen tieferen Risikos geringer als bei den andern Nummern.
1 . 2 S O Z I A L E S 1 69 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ Gebäude- und Fahrhabeversicherung
Den Gebäuden und der Fahrhabe drohen viele Gefahren: Die wichtigsten sind die Feuer- und Elementarschäden Die Feuerversicherung deckt z B die Schäden infolge von Brand, Rauch und Explosion Auch allfällige Folgeschäden (durch Löschwasser, Russ etc.) sind mitversichert. In den meisten Kantonen ist die Gebäudeversicherung obligatorisch Für das Mobiliar besteht hingegen häufig kein Versicherungszwang
Die Landwirtschaft trägt insbesondere bei den Gebäuden ein erhöhtes Risiko, was über leicht höhere Prämien als bei andern Gebäuden berücksichtigt wird
■ Hagelversicherung
Die Schweizerische Hagelversicherungsgesellschaft in Zürich ist die einzige Gesellschaft, welche Kulturen gegen Hagel versichert.
In den Hauptanbaugebieten unseres Landes besitzen 90% der Bauern eine Hagelversicherung. Die Prämien der Hagelversicherung richten sich nach der Hagelempfindlichkeit der versicherten Kulturen, der örtlichen Hagelgefahr und der individuellen Beanspruchung durch den Versicherten (Bonus/Malus-System)
■ Viehversicherung
Das Viehversicherungswesen ist hauptsächlich auf privater Ebene und auf Gemeindeebene organisiert Viele Landwirte haben ihre Kühe gegen Unfall sowie Krankheit und Pferde auch gegen Tod versichert
Die Entschädigungen für Tierverluste infolge Seuchenfällen werden nach den Bestimmungen der Bundesgesetzgebung geleistet Zur Bemessung der Entschädigungen wird in der Regel eine amtliche Schätzung der Tiere oder der Bestände vorgenommen Diese Schätzungen erfolgt nach den Richtlinien des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET) Massgebend sind dabei der Schlacht-, Nutz- und Zuchtwert, wobei der Schätzwert die festgelegten Höchstansätze nicht überschreiten darf
1 . 2 S O Z I A L E S 1 70
Angaben zur Hagelversicherung 1999 Kultur Versicherte Fläche Versicherungssumme Versicherungskosten 2 % 1 Fr /ha Fr /ha bei mässigem Risiko mittlerem Risiko Getreide 85 5 000 45 110 Kartoffeln 60 15 000 135 330 Mais 55 5 200 93 166 Zuckerrüben 50 9 000 90 189 Wein (ohne Kt VS) 80 30 000 1 140 1 890 Obst 50 25 000 1 750 2 800 Gras (Wiesen und Weiden) 5 Pauschalversicherung 28 60 1 geschätzte Grössen an den gesamten Kulturflächen 2 Durchschnittswerte Quelle: Schweizerische Hagelversicherungs-Gesellschaft
■ Beziehungsnetz
Andere Sicherheitsnetze
Die in der Regel bestehende Einheit von Arbeits- und Wohnort wirkt sich positiv auf die Kinder- und Altenbetreuung aus. Es werden immer noch viele Betagte, die in der übrigen Gesellschaft in Pflegeheimen untergebracht werden, auf den Höfen gepflegt Andererseits nehmen die Betagten auf vielen Betrieben Kinderbetreuungsaufgaben wahr und verrichten wertvolle Arbeitsleistungen Die besondere Situation in der Landwirtschaft kann aber auch Ursache von Spannungen zwischen oder innerhalb der Generationen sein
■ Betriebsberatung
Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beraterinnen und Berater sind bei Schwierigkeiten oft die ersten Ansprechpartner einer Bauernfamilie
Beratungskräfte mit langjährigen Erfahrungen in gesamtbetrieblicher Beratung haben normalerweise grosse soziale und menschliche Kompetenzen, die hinter den fachtechnischen Kenntnissen nicht zurückstehen Lösungen für Probleme, die soziale und betriebliche Ursachen haben, sollten im Zusammengehen von landwirtschaftlicher und sozialer Beratung gefunden werden
■ Betriebshelferdienste und Hauspflege
Die Betriebshelferdienste sind bäuerliche Selbsthilfeorganisationen, die das Ziel verfolgen, Landwirten, welche infolge Krankheit, Unfall, Militärdienst, Arbeitsüberlastung, etc in eine (Arbeits-) Notlage geraten, zu günstigen Bedingungen, qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen Im Vordergrund stehen dabei die Arbeiten in Feld und Stall Zum Teil werden auch Betriebshelferdienste vermittelt, um den Bezug von Ferien zu ermöglichen Die Einsatzdauer ist beschränkt
In beinahe allen Kantonen bestehen Betriebshelfer- bzw Betriebshelferinnendienste Meistens wurden diese durch die kantonalen Bauernverbände gegründet Zum Teil sind es aber auch Vereine, die völlig unabhängig funktionieren. In einzelnen Fällen wird der Betriebshelferdienst auch von landwirtschaftlichen Genossenschaften angeboten Bei Bedarf wendet sich die Bauernfamilie an die Vermittlungsstelle, welche die notwendige Hilfe organisiert Die Vermittlungs- oder Verrechnungsstelle stellt in diesen Fällen den Bauernfamilien für die Einsatzzeit Rechnung und entschädigt die Helferdienste
Auch für die Bäuerin bestehen verschiedene Dienstleistungsangebote, die sie bei ihren täglichen Arbeiten im Haushalt und bei der Haushaltsführung unterstützen Im Falle von Krankheit, Unfall, Wochenbett, Arbeitsüberlastung stehen Krankenpflege- und Hauspflegedienste (Familienhelferinnen) zur Verfügung; sie leisten einen befristeten Einsatz Diese und zusätzliche Dienste sind weitgehend unter den lokalen SpitexOrganisationen der Gemeinden oder Gemeindeverbänden zusammengefasst. Daneben existieren in einzelnen Regionen verschiedene Formen von privaten Vereinigungen (Landfrauenvereine, Bäuerinnenvereinigungen usw ), die spezifisch bäuerliche Haushalte mit eigenen Familienhelferdiensten versorgen
1 . 2 S O Z I A L E S 1 71 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ Private Institutionen
Es gibt drei Arten von Leistungen: Geld-, Arbeits- und Materialleistungen. Die Hilfswerke haben sich im allgemeinen auf eine Art der Leistung spezialisiert An dieser Stelle werden nur einige Hauptakteure erwähnt Es gibt weitere zahlreiche Fonds und Stiftungen, die auch auf diesem Gebiet aktiv sind.
Hilfe bei Investitionen in der
■ Landdienst
Das Hauptziel des Landdienstes ist nicht direkt die Sozialhilfe, sondern die Förderung des Verständnisses zwischen Stadt und Land: Die Jugendlichen lernen die Lebens- und Arbeitswelt der Bauern kennen und erhalten für ihre Mithilfe, neben freier Kost und Logis, ein Sackgeld. Die Bauernfamilien werden durch die Mithilfe der Landdienstler entlastet und lernen die Lebensauffassung dieser jungen Leute kennen
■ Sorgentelefon:
«Kleine Sorgen machen viele Worte, grosse sind oft stumm »
Das Sorgentelefon ist ein Verein und wurde 1996 gegründet Zur Trägerschaft gehören: Schweizerische reformierte Arbeitsgemeinschaft Kirche und Landwirtschaft, Schweizerischer Verband katholischer Bäuerinnen, Schweizerische katholische Bauernvereinigung sowie Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau Das Sorgentelefon wird über Mitgliederbeiträge und Spenden finanziert
Das Team von Freiwilligen ist das Herz des Sorgentelefons Es sind vorwiegend Bäuerinnen und Bauern, verstärkt durch Leute, die durch ihre Lebens- und Berufserfahrung mit der Landwirtschaft eng verbunden sind Sie unterstehen der strikten Schweigepflicht Seit 1997 haben knapp 400 Personen das Sorgentelefon für Bäuerinnen, Bauern und ihre Angehörigen gewählt. Unter den Anrufenden ist die
1 . 2 S O Z I A L E S 1 72
Finanzielle
Institution 1996 1997 1998 1999 1 000 Fr Patenschaft für Berggemeinden an Gemeinschaftsprojekte Landwirtschaft 2 200 3 775 2 488 Schweizer Berghilfe, Einzelbetriebe und einige Gemeinschaftsprojekte 13 502 15 048 22 116 20 453 COOP-Patenschaft 1 787 1 085 1 370 >2 000 Stiftung Weihnachtsaktion (Beobachter) Wohnbausanierungen 75 133 190 Betriebssanierungen 264 185 230 121 Stiftung zur Selbst- und Sozialhilfe in der Landwirtschaft, insbes Berggebiet 90 207 133 122 Hilfe für Berggemeinden (Gemeinschaftsprojekte Landwirtschaft) 300 400 400 410 Schweizerische Vereinigung für betriebliche Verbesserungen
der Berglandwirtschaft 313 336 402 688 Bergheimat 15 10 12 12 Total 16 346 19 604 28 628 26 300
Landwirtschaft
in
Zahlen zum Einsatz vom Landdienst Jahr 1996 1997 1998 1999 Arbeitstage 77 773 73 253 72 852 67 510 Teilnehmer 3 884 3 765 3 608 3 249 Einsatzdauer in Tagen (ø) 20 19 5 20 2 20 8
Altersstufe zwischen 56 und 65 Jahren am meisten vertreten: Diese Generation setzt sich mit der Hofübergabe auseinander Es rufen mehr Frauen als Männer an (1999: Frauen 61%, Männer 39%), wobei einige Frauen in Stellvertretung anrufen Ungefähr zwei Drittel der Anrufe erfolgen aus dem Berggebiet. Die Anrufe kommen aus der ganzen Schweiz Die meisten stammen aus der Innerschweiz und der Ostschweiz Das ist vermutlich der ständigen Publikation der Sorgentelefonnummer im entsprechenden Regionalteil landwirtschaftlicher Zeitungen zuzuschreiben (Sorgentelefon Jahresbericht)
Gewichtung der Probleme 1997 bis 1999
persönlich 30%
Suche 4%
finanziell 5%
sozial 14%
Betrieb 14%
Familie 33%
persönlich 21%
Suche 2%
finanziell 21%
Familie 8%
sozial 21%
Betrieb 27%
Unter der Rubrik «Suche» ist die Suche nach Ehepartner, Haushaltshilfe, Hof, Adressen etc gemeint Die privaten wie die beruflichen Probleme auf dem Bauernbetrieb sind häufig miteinander verflochten Dazu kommt vielmals auch eine Häufung der Probleme Nimmt man eine feinere Einteilung der Problemkreise vor, so sind die 10 meist genannten Probleme bei Frauen und Männern (1999) folgende:
Frauen Männer
Probleme mit Partner Chropfleerete
Psyche Finanzielle Probleme
Generationskonflikte Pacht, Verpachtung
Dauerbelastung

Chropfleerete
Hofnachfolgeprobleme
Gesundheitliche Probleme
Umbau, Neubau
Suche nach Finanzquellen
Probleme mit Behörden und Beratung
Rechtliche Probleme
Krise Hofaufgabe
Probleme mit Kindern
Rechtliche Probleme
Gesundheitliche Probleme
Sorgen über Agrarpolitik
Diese Gegenüberstellung zeigt eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung der Probleme zwischen Mann und Frau auf
1 . 2 S O Z I A L E S 1 73 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
FrauenMänner
■ Information, Transparenz und Kenntnisstand
Hemmnisse bei der Inanspruchnahme sozialer Leistungen
Die Landwirtschaft verfügt über ein Netz von neutralen landwirtschaftlichen Versicherungsberatern. Die Versicherungsberatungsstellen haben auch regen Kontakt mit der Betriebsberatung und den AGRO-Treuhandstellen, so dass die Informationen auch über diese Kanäle zugänglich sind Die Vorsorgestiftung der schweizerischen Landwirtschaft und die Krankenkasse AGRISANO informieren laufend in der landwirtschaftlichen Presse über das Versicherungswesen Es werden Kurse angeboten, Vorträge gehalten und Merkblätter sowie Informations-Broschüren erstellt
Eine Studie (Wicki und Pfister) zeigt jedoch, dass trotzdem der Kenntnisstand in bezug auf die formale Sicherheit nur knapp ausreichend ist: Während die blosse Existenz von Ergänzungsleistungen den meisten Befragten (83%) bekannt war, konnte nur eine Minderheit korrekt angeben, wer sie bezahlt (37%) und wer darauf Anspruch hat (43%). Etwas mehr Personen wussten in der gleichen Studie, bei wem man die Ansprüche anmelden muss (57%) Wiederum nur eine Minderheit kannte die Hilflosenentschädigung (43%) Die Hilflosenentschädigung beziehungsweise die Pflegebeiträge sind Leistungen der IV für dessen Anspruch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen Es wusste kaum jemand, wo man einen solchen Anspruch abklären könnte. Lückenhaft sind die Kenntnisse bezüglich der Sozialhilfe; deren Aufgaben und Zuständigkeiten werden unterschätzt Auch über die Organisation an sich herrscht Unklarheit
■ Besondere Hemmnisse
Der Bedarfsnachweis als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Sozialleistungen führt dazu, dass die finanziellen Verhältnisse des Haushaltes und Betriebes aufgedeckt werden Bisher Privates muss einer Behörde oder einem Sozialdienst mitgeteilt werden. In ländlichen Verhältnissen ist dieser in der Regel nahe bei den Kunden. Die Sozialhilfebezugsquoten sind auf dem Lande deutlich tiefer als in den Städten
Unter den Landwirten verbreitete Werte wie Autonomie, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit stehen der Inanspruchnahme öffentlicher Hilfe entgegen Viele Bauern und Bäuerinnen würden sich in ihrem Stolz verletzt fühlen, sollten sie Sozialhilfe beziehen müssen: Den meisten (ca 80%) würde es sehr schwer fallen, Sozialhilfe zu beziehen Auch wenn die Mehrheit (74%) der Landwirte glaubt, dass bei Personen, die Sozialhilfe beziehen wirtschaftliche Schwierigkeiten vorliegen, führen sie den Sozialhilfebezug doch auch auf persönliches Versagen zurück (knapp 50%) Den Bezügerinnen und Bezügern werden teilweise schwerwiegende Vorurteile entgegengebracht («frech», «wollen nicht arbeiten», etc.). Wer solche Vorurteile hegt, wird selbst nur schwerlich Sozialhilfe in Anspruch nehmen (Wicki und Pfister)
1 . 2 S O Z I A L E S 1 74
Joost hat in ihrer Vollerhebung bei allen Sozialdiensten des Kantons Baselland nur einen einzigen Unterstützungsfall aus der Landwirtschaft entdeckt Die Tendenz der Bauern und Bäuerinnen, den Sozialdienst so spät wie möglich oder gar nicht aufzusuchen, hängt vermutlich auch mit der Angst vor dem Stigma «SozialhilfebezügerIn» zusammen Wegen der mangelnden Professionalisierung der ländlichen Sozialarbeit (Fluder & Stremlow) ist Sozialhilfebezug in den kleinen Dörfern eine öffentliche Angelegenheit Veröffentlichte Fürsorgeabhängigkeit wird als belastend erlebt In der Konsequenz trauen sich Bauern in finanziellen Krisensituationen nicht, öffentliche Hilfe zu beanspruchen Viel häufiger leben sie «von der Substanz», d h es werden keine oder nur noch ungenügende Investitionen getätigt Trotz der erwähnten Stigmatisierungsproblematik wird noch am ehesten (63% der Befragten) die Beanspruchung einer Überbrückungshilfe bei der Fürsorge in Erwägung gezogen (Wicki und Pfister).
Es gibt nur wenig Hinweise dafür, dass administrative Hürden für eine mangelhafte Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen verantwortlich sein könnten. Es dürfte sich eher um mangelnde Kenntnisse über administrative Abläufe und Zuständigkeiten handeln als um Probleme der Administration selbst In rechtlicher Hinsicht gilt es zu beachten, dass die Sozialhilfe keine längerfristige Unterstützung an Landwirte und Landwirtinnen gewähren sollte: 1999 hat das Bundesgericht gegen eine Bauernfamilie entschieden, die eine Fortsetzung von Sozialhilfeunterstützung eingefordert hatte. Das Bundesgericht ging wie bei anderen Selbständigerwerbenden davon aus, dass Sozialhilfegelder nicht zur Erhaltung unrentabler Betriebe eingesetzt werden sollen
Neben diesen Hemmnissen gibt es eine Anzahl landwirtschaftlicher Eigenheiten, welche die Inanspruchnahme sozialer Leistungen stark beeinflussen
Landwirtschaftsbetrieb und Privathaushalt sind eng verbunden. Es bestehen soziale und buchhalterische Verflechtungen Treten grössere finanzielle Schwierigkeiten auf, so kann dies zur Falle werden, denn die betroffene Bauernfamilie haftet mit ihrem Vermögen.

In der Landwirtschaft treten jedoch kaum Konkurse auf Dies ist auf verschiedene Einflussgrössen zurückzuführen:
– Zwischen Haushalt und Betrieb besteht eine grosse Flexibilität; bei knappen finanziellen Mitteln kann der Verbrauch reduziert werden
Die agrarpolitischen Massnahmen haben zu akzeptablen Einkommen geführt und damit den Strukturwandel in einem sozialverträglichen Rahmen gehalten
Betriebe in finanziellen Schwierigkeiten leben vielfach von ihren stillen Reserven; sie können auf Investitionen verzichten und die Abschreibungen konsumieren Im Notfall können sie Land und Gebäude zum Verkehrswert verkaufen, welche sie zum Ertragswert übernommen haben.
1 . 2 S O Z I A L E S 1 75 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
–
–
■ Landwirtschaftliche Eigenheiten
Die Betriebshilfe (vgl. auch 2.3 Grundlagenverbesserung) erlaubt die Ablösung bestehender Schulden durch zinslose Darlehen Sie kann aber auch zur Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Bedrängnis eingesetzt werden In der Auswirkung entspricht sie einer einzelbetrieblichen Umschuldungsaktion. 1999 wurden in 204 Fällen insgesamt rund 18,1 Mio Fr Betriebshilfedarlehen gewährt Einzelne Kantone haben in letzter Zeit für die Lösung besonders schwieriger Fälle Krisenstäbe eingesetzt, in denen neben den Behörden, der Beratung und den Berufsorganisationen auch die Banken vertreten sind
Die Einräumung des Wohnrechtes kann als wesentlicher Bestandteil der Altersvorsorge für die Bauernfamilien betrachtet werden Die Lebenshaltungskosten können somit, gegenüber einer Fremdmiete oder einem privaten Wohnungskauf, ganz wesentlich tiefer gehalten werden Die Gewährung des Rechts auf Bezug von Naturalien wie Milch, Fleisch, Gemüse und Obst, muss je nach Betrieb bewertet und festgelegt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Inanspruchnahme sozialer Leistungen allgemein nur gering ist: Die Bauern und Bäuerinnen beziehen durchschnittlich kleine Renten Wegen Vorbehalten beziehungsweise landwirtschaftlichen Eigenheiten sind sie auf den Sozialdiensten untervertreten.

1 . 2 S O Z I A L E S 1 76
■ Zielsetzung
1.2.2 Sozialindikatoren
Grundlagenstudie
Am Institut für Agrarwirtschaft der ETH Zürich wird zur Zeit eine Studie zur sozialen Lage in der Schweizer Landwirtschaft durchgeführt Die Ziele der Studie sind:
– Definition von Lebensqualität;
– Einschätzung der aktuellen Lebensqualität aus der Sicht von Bauernfamilien;
– Entwicklung von Sozialindikatoren für ein Monitoring der Lebensqualität
Anhand der Sozialindikatoren wird ein Hilfsmittel für die Beurteilung der sozialen Lage der Bauern und Bäuerinnen entstehen
■ Konzept der Lebensqualität
Ein Ansatz zur Bestimmung der wesentlichen Kriterien sozialer Nachhaltigkeit aus der Sicht der betroffenen Akteure bildet das Konzept der Lebensqualität Unter Lebensqualität wird der objektive Lebensstandard und das subjektive Wohlbefinden verstanden
In der Grundlagenstudie wird das Kriterium Zufriedenheit für das subjektive Wohlbefinden verwendet, um die persönliche Bewertung von Lebensbereichen zu vergleichen Dabei wird die vorliegende Lebenssituation mit Lebenszielen, Wünschen und Plänen verglichen Entsprechend dem Ergebnis dieses Vergleichs ist die Lebenszufriedenheit hoch oder niedrig Die analysierten Lebensbereiche betreffen Arbeit, Bildung, Einkommen, Lebensstandard, Familie und soziales Umfeld, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Freizeit, Gesundheit, Werte/Einstellungen sowie Religion
Eine hohe Lebensqualität resultiert, wenn «objektiv» messbare Lebensbedingungen vorliegen und diese von den Akteuren aufgrund ihres Zielsystems und dem aktuellen Zielerreichungsgrad subjektiv positiv bewertet werden.
■ Methodisches Vorgehen:
Zwei Phasen
Das methodische Vorgehen der Grundlagenstudie gliedert sich in zwei Phasen Auf Basis von theoretischen Ansätzen in der Literatur wurden Hypothesen über wichtige Lebensbereiche und Sozialindikatoren abgeleitet Diese wurden in einer ersten Phase mit Hilfe von problemorientierten Interviews auf die Schweizer Landwirtschaft angepasst und ergänzt In der zweiten Phase wurden diese Hypothesen getestet: Im Frühjahr 2000 wurde eine breit abgestützte schriftliche Befragung bei 1500 Landwirtinnen und Landwirte (einfache Zufallsstichprobe) im Kanton Bern durchgeführt Insgesamt haben 560 Personen den Hauptfragebogen für Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter und 461 Personen das Zusatzblatt für Ehe-/PartnerIn zurückgesandt. Der auswertbare Rücklauf beläuft sich auf 527 Fragebogen (36%) und 461 Zusatzblätter (31%)
1 . 2 S O Z I A L E S 1 77 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Wichtige Lebensbereiche
Erste Resultate
Aufgrund der Einschätzung der Wichtigkeit sowie der Zufriedenheit der Lebensbereiche wird ein Lebensqualitätsindex ermittelt.
Die ersten Ergebnisse bestätigen die Wichtigkeit der ausgewählten Lebensbereiche für die Bestimmung von Lebensqualität in der Schweizer Landwirtschaft Diese können folglich als relevante Bestandteile des Lebensqualität-Konzeptes bezeichnet werden Für jeden dieser Bereiche sind in der Folge entsprechende Sozialindikatoren zu entwickeln
Einschätzung der Wichtigkeit der Lebensbereiche (in % aller Nennungen, n = 511)
Weiterbildung Einkommen
Lebensstandard
Familie

Soziales Umfeld
Rahmenbedingungen
Freizeit
Gesundheit
Werte, Einstellungen
Religion
sehr wichtig eher unwichtig eher wichtig völlig unwichtig unbestimmt keine Antwort
Aus der Auswertung der 511 Antworten geht hervor, dass Gesundheit und Familie für über 80 Prozent der Antwortenden sehr wichtig sind Für über 50% sehr wichtig und für rund 30% eher wichtig sind Arbeit, Ausbildung sowie Werte und Einstellungen. Eine Sonderstellung nimmt das Einkommen ein, das zwar für weniger als die Hälfte sehr, jedoch für über 50% als eher wichtig eingestuft wird
1 . 2 S O Z I A L E S 1 78
L e b e n s b e r e i c h e Ausbildung
Arbeit
in %
0102030405060708090100
Quelle: IAW-ETH
■ Einschätzung der Zufriedenheit
Die Bäuerinnen und Bauern wurden gebeten, ihre subjektive Zufriedenheit für die einzelnen aufgeführten Lebensbereiche anzugeben Die Resultate dieser Einschätzung sind in der folgenden Abbildung dargestellt Es wird deutlich, dass
im Lebensbereich Familie 60% der Antwortenden sehr zufrieden sind;
– in weiteren sechs Lebensbereichen – nämlich Arbeit, Ausbildung, Lebensstandard, soziales Umfeld, Gesundheit, Werte/Einstellung – die Mehrheit der Antwortenden sehr zufrieden oder eher zufrieden sind;
– in den Lebensbereichen Einkommen und Rahmenbedingungen die eingeschätzte Zufriedenheit am geringsten ist
In jedem der Lebensbereiche wurde den befragten Bäuerinnen und Bauern eine Reihe von Zusatzfragen gestellt. Dieses Vorgehen erlaubt die Einschätzung der Lebensqualität in einem spezifischen Lebensbereich Des weiteren ermöglicht dieses Vorgehen die Analyse der Beweggründe für die Einschätzung der Zufriedenheit in diesem Bereich
Einschätzung der Zufriedenheit der Lebensbereiche (in % aller Nennungen, n = 511)
Arbeit Ausbildung
Weiterbildung
Einkommen
Lebensstandard
Familie
Soziales Umfeld
Rahmenbedingungen
Freizeit Gesundheit
Werte, Einstellungen
Religion
sehr zufrieden unzufrieden zufrieden sehr unzufrieden unbestimmt keine Antwort
Quelle: IAW-ETH
■ Lebensqualitätsindex
Die Aussagen zur Wichtigkeit der ausgewählten Lebensbereiche kombiniert mit der Einschätzung subjektiver Lebensqualität in den einzelnen Bereichen führt zum Lebensqualitätsindex Der Frage über die Wichtigkeit einzelner Lebensbereiche wurde eine Skala von 0,2 bis 1 (völlig unwichtig bis sehr wichtig) zugrundegelegt Die Antworten zur Frage über die Zufriedenheit mit den einzelnen Lebensbereichen wurden auf einer Skala von -3 (sehr unzufrieden) bis +3 (sehr zufrieden) normiert Der Lebensqualitätsindex wurde schliesslich als Summenprodukt aus dem Wert für die Wichtigkeit bzw. der Zufriedenheit über alle zwölf Lebensbereiche gebildet Basierend auf der in der Studie gewählten Skalierung der Antworten kann der Lebensqualitätsindex Werte zwischen -36 und +36 annehmen.
1 . 2 S O Z I A L E S 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 79
–
in %
L e b e n s b e r e i c h e 0102030405060708090100
Bei der Interpretation des Indexes ist zu beachten, dass es sich um eine Gesamtbewertung der Lebensqualität handelt Eine negative Zufriedenheit in einem Bereich kann durch eine positive Zufriedenheit in einem anderen Bereich kompensiert sein
Generell lässt sich sagen, dass unter den befragten Bäuerinnen und Bauern grosse Unterschiede in Bezug auf die subjektiv empfundene Lebensqualität vorhanden sind Die Mehrheit der Antwortenden, nämlich rund 70%, weist einen Index zwischen 14 und 26 auf Mithin sind sie, gemessen an den gewählten Kriterien, mit ihrer sozialen Lage recht zufrieden In 15 Fällen resultiert ein negativer Index Diese Bäuerinnen und Bauern drücken eine eindeutige Unzufriedenheit in den zwölf Bereichen aus Im Indexbereich von 0 bis 24 kann eine hohe Unzufriedenheit in einzelnen Bereichen durch eine hohe Zufriedenheit in anderen Bereichen kompensiert werden. Antwortende mit einem Index von mehr als 24 weisen im allgemeinen in sämtlichen Bereichen einen hohen Zufriedenheitsgrad auf
Quelle: IAW-ETH
■ Ausblick Wenn 80% oder mehr der Befragten einen Faktor als «sehr wichtig» oder «eher wichtig» für die Zufriedenheit in diesem Lebensbereich bezeichnen, so gilt der Faktor als lebensqualitätsfördernd Andererseits wird ein Faktor als lebensqualitätsmindernd bezeichnet, wenn 80% oder mehr der Meinung sind, dass diese Faktoren Auslöser von Unzufriedenheit sind Ausgehend von diesen Lebensqualität fördernden bzw mindernden Faktoren wird die ETH in ihrer Studie Sozialindikatoren ableiten
1 . 2 S O Z I A L E S 1
80 Verteilung der empfundenen Lebensqualität ≤ 0 > 0 bis ≤ 2 > 2 bis ≤ 4 > 4 bis ≤ 6 > 6 bis ≤ 8 > 8 bis ≤ 10 > 10 bis ≤ 12 > 12 bis ≤ 14 > 14 bis ≤ 16 > 16 bis ≤ 18 > 18 bis ≤ 20 > 20 bis ≤ 22 > 22 bis ≤ 24 > 24 bis ≤ 26 > 26 bis ≤ 28 > 28 bis ≤ 30 > 30 bis ≤ 32
Antwortende
Anzahl
01020304050607080
I n d e xB e r e i c h ■ Lebensqualität in der Schweizer Landwirtschaft
Mit der Nahrungsmittelproduktion befriedigt die Landwirtschaft ein Grundbedürfnis des Menschen Damit verbunden sind Eingriffe in die Natur Positiv wahrgenommen wird der Beitrag der Landwirtschaft zur Gestaltung der Landschaft, zur Erhaltung und Bereicherung von Lebensräumen sowie zur Pflege der Kulturlandschaft Negativ eingeschätzt werden Auswirkungen wie die Umweltbelastung durch schädliche Emissionen, der Rückgang der Artenvielfalt oder die Verarmung von Lebensräumen
Für die Ermittlung der Auswirkungen auf die Umwelt unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Davon wurden zwei ausgewählt: eine Auswahl agrarökologischer Indikatoren und eine vereinfachte Methode zur Beurteilung der Umweltbelastung der Landwirtschaft Beide Instrumente sind in einer Phase des Aufbaus. Es wird intensiv an Verbesserungen und Ergänzungen gearbeitet. Zusätzlich zu den Informationen über die beiden Instrumente wird der Bereich Biodiversität etwas vertiefter dargestellt sowie über eine Studie berichtet, die externe Effekte der Schweizer Landwirtschaft zu bewerten versucht

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3 Ökologie
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 81
1.3.1 Agrarökologische Indikatoren
Die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf die Umwelt, das Wohlbefinden der Tiere und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen können mit Indikatoren gemessen werden Diese liefern Entscheidungsträgern und interessierten Kreisen Informationen und helfen ihnen, die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und Umwelt besser zu verstehen Sie ermöglichen auch, die Effizienz der Massnahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen Landwirtschaft zu beurteilen Die Indikatoren müssen leicht nachvollziehbar, zweckmässig, analytisch richtig, messbar und international vergleichbar sein Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dienen sie in erster Linie dazu, die Probleme mit langfristiger Wirkung und globaler oder regionaler Tragweite besser zu erkennen Daneben gibt es aber auch einzelne Indikatoren für lokale Probleme oder solche mit kurzfristigen Auswirkungen
Die Zahl der Umweltindikatoren ist gross. International beschäftigt sich u.a. die OECD mit dieser Fragestellung Unter den zahlreich verfügbaren Indikatoren wurde aufgrund der vorerwähnten Kriterien eine Auswahl getroffen Darunter befinden sich einige für die Schweiz besonders relevante agrarökologische Indikatoren der OECD sowie weitere, die speziell der schweizerischen Problemstellung entsprechen Für die Auswahl wurden wissenschaftliche Experten, interessierte Kreise sowie die Bundesämter beigezogen, die dem Interdepartementalen Ausschuss Rio angehören

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 82 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Zeit- und Raumdimension von Umweltproblemen lokal Toxizität für den Menschen Erosion Bildung von Photooxydantien Ökotoxizität Übersäuerung Biodiversität Treibhausgase Zerstörung der Ozonschicht regionalglobal Raum Z e i t ( J a h r e ) 1 1 000 100 10
Die agrarökologischen Indikatoren sind abgeleitet von Kriterien, die die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt beschreiben Da die Zusammenhänge komplex sind, lassen sich die Indikatoren nicht einzeln analysieren Zur besseren Verständlichkeit werden sie zusammengefasst und in sechs Gruppen aufgeteilt:
Landwirtschaftliche Prozesse: Stickstoff (N), Energie und Phosphor (P) sind die Triebkräfte der landwirtschaftlichen Produktion
Landwirtschaftliche Praxis: die Landwirte verwenden Hilfsstoffe für die landwirtschaftliche Produktion
Abiotische Ressourcen: die landwirtschaftliche Produktion hat Auswirkungen auf Wasser, Boden, Luft und Klima
Biotische Ressourcen: die Landwirtschaft wirkt sich auf die biologische Vielfalt aus
Umweltverhalten: das gesellschaftliche Verhalten sowie die Einkaufsgewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten beeinflussen die Landwirtschaft
Verhalten den Tieren gegenüber: die Haltung der Konsumentinnen und Konsumenten und der Landwirte den Tieren gegenüber wird analysiert, wobei auch das Wohlbefinden der Tiere berücksichtigt wird
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 83
Kriterien im Mensch-Umwelt-System Klima, Luft Boden Relief Wasser Flora, Fauna Belebte und unbelebte Natur Ernährung, Gesundheit Wirtschaft, Arbeit Erholung, Freizeit Verkehr, Mobilität Siedlung, Wohnen Mensch Dünger Pflanzenschutzmittel Futtermittel Maschinen 2 Klima, Luft, Wasser, Bodenfruchtbarkeit 3 Landwirtschaftliche Biodiversität Lebensraum für wildlebende Arten Landschaft 4 Verhalten gegenüber der Umwelt 5 Verhalten gegenüber den Tieren 6 Stickstoff Energie Phosphor 1 Landwirtschaft Art der Landnutzung Bereiche 1 2 3 4 5 6
Es sind zwei Arten von Indikatoren zu unterscheiden:
– Hauptindikatoren ermöglichen eine übersichtsmässige Bewertung, aus welcher Trends ersichtlich sind. Sie wenden sich vor allem an politische Entscheidungsträger und an die betroffenen Kreise

Zusatzindikatoren erlauben eine detailliertere Analyse, um zusätzliche Informationen zu erhalten sowie einen mit den Hauptindikatoren festgestellten Trend zu bestätigen oder zu relativieren Diese Indikatoren werden vorwiegend von Fachleuten verwendet
Die Indikatoren sind als Gesamtheit zu betrachten; bei der Bewertung der einzeln resultierenden Trends ist Vorsicht geboten Die ausgewählten Indikatoren sind nicht als statische Grösse zu verstehen Sie werden aufgrund neuer Erkenntnisse und Technologien, der Erwartungen der Gesellschaft und politischer Weichenstellungen weiterentwickelt Eine gewisse Konstanz ist jedoch unerlässlich, damit die Vergleichbarkeit gewahrt bleibt und die Entwicklung von Trends verfolgt werden kann
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 84
–
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 85 Zusammenstellung der ausgewählten agrarökologischen Indikatoren Kategorien Bereiche Indikatoren Methode Angaben AB2000 1 Stickstoff Landwirtschaftliche Stickstoffbilanz ■■■ Landwirtschaft- Anteil der Landwirtschaft an den liche Prozesse globalen Auswirkungen ■✐ Landwirtschaftliche Stickstoffeffizienz ✐■ Internationaler Vergleich ■■■ Umweltrisiko global und je Betrieb ■■■ Energie Energieverbrauch und -produktion ■■■ Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ✐✐ Energieeffizienz ✐✐ Internationaler Vergleich ✐✐ Phosphor Phosphorbilanz ■■■ Düngemittel Stickstoff und Phosphor in Düngemitteln ■■■ Landwirtschaft- Grossvieheinheiten Schweiz ■■■ liche Praxis Grossvieheinheiten nach Regionen ■■■ (Verbrauch) Pflanzenschutzmittel Pestizidrisiko ✐✐ Verkäufe von Pflanzenschutzmitteln ■■■ Internationaler Vergleich ■■■ Futtermittel Einfuhr und Produktion von Futtermitteln ■■ Energie Fossile Energie ■■ Klima Treibhausgasemissionen aus der Abiotische Landwirtschaft ■■■ Ressourcen Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ■■■ Internationaler Vergleich ■■■ Methanemissionen pro kg Milch ■■■ Luft ✐✐✐ Wasser Nitrat-, Phosphor- und Pestizidbelastung landwirtschaftlichen Ursprungs ✐✐ Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ■✐ Boden Pestizidgehalt und Auswirkungen ✐✐ Erosion, Verdichtung ✐✐ Anteil der Landwirtschaft an den globalen Auswirkungen ✐✐ Landwirtschaftliche Verwendete Rassen und Arten ■■■ Biotische Artenvielfalt Von der Landwirtschaft abhängige Ressourcen wilde Arten ■✐ Lebensräume Ökologischer Ausgleich gesamthaft ■■ Ökologischer Ausgleich nach Zonen ■■■ Ökologischer Ausgleich nach Betriebstypen ■✐ Landschaft ✐✐✐ Gesellschaft ✐✐✐ Verhalten Konsumenten ✐✐✐ gegenüber Biomarkt ✐✐ Umwelt Pestizide, Nitrat in Nahrungsmitteln ■✐ Landwirte ✐✐✐ Biofläche oder ökologischer Leistungsnachweis ■■■ Bio, IP international ■■■ Ausbildung, Beratung ✐✐ Gesellschaft Markt und Wohlbefinden der Tiere ✐✐ Verhalten Landwirte ✐✐✐ gegenüber Tieren Tiere in tiergerechten Haltungsformen ■■■ Wohlbefinden der Tiere ✐✐✐ 1 Für den Agrarbericht 2000 verwendete Indikatoren Zeichenerklärung: Fett: Hauptindikatoren Normal: Zusatzindikatoren ✐ Indikatoren weiter zu entwickeln oder genauer zu bestimmen ■ Methode bzw Daten bekannt 1 2 4 5 6 3 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ N-Bilanz: immer weniger N aus der Landwirtschaft
Der erste Agrarbericht beschränkt sich auf Resultate von ausgewählten Indikatoren, bei denen Angaben auf schweizerischer Ebene verfügbar sind Die Datenlage präsentiert sich auch bei diesen Indikatoren unterschiedlich Zeitreihen mit einer einheitlichen Referenzperiode sind deshalb nicht möglich. Die grössten Lücken bestehen in den Bereichen Luft, Wasser, Boden und Landschaft Am meisten Daten gibt es zu den landwirtschaftlichen Prozessen und zur landwirtschaftlichen Praxis Bei den Indikatoren, die die Beziehung Umwelt und Gesellschaft (Umweltverhalten) sowie Umwelt und Wirtschaft abbilden, drängen sich weitere Untersuchungen auf Der Einbezug fehlender Bereiche, eine genauere Umschreibung der Methoden sowie eine bessere Qualität und Verfügbarkeit der Daten sollen dazu beitragen, die Aussagekraft der ausgewählten Indikatoren laufend zu verbessern
Landwirtschaftliche Prozesse
Die schweizerische Landwirtschaft erzeugt rund 60% der im Inland verbrauchten Nahrungsmittelenergie, bzw beinahe 75% des Eiweissverbrauchs Ein wichtiger Baustein von Eiweiss ist N Zusammen mit Energie und P sind es die Schlüsselelemente in der gesamten belebten Umwelt und damit auch im Zyklus Landwirtschaft-Ernährung
Die N-Bilanz wird nach der von der OECD verwendeten Methode «N-Bilanz an der Bodenoberfläche» berechnet. Dabei misst man die Differenz zwischen der gesamten, während eines Jahres zugeführten N-Menge (Mineraldünger, Abfalldünger, Hofdünger, biologische N-Fixierung und Einträge aus der Luft) und der dem Boden entzogenen NMenge durch Acker- und Futterbauprodukte wie Gras, Heu und Getreide
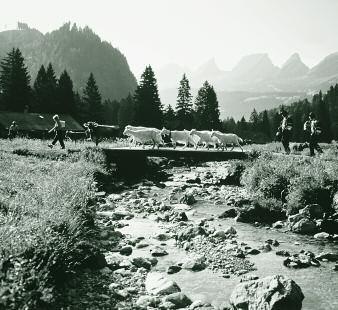
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 86
in der Umwelt Entwicklung der N-Bilanz 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 1 N i n t
1 provisorische Angaben Input total Output total Bilanz 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
Quelle: BFS
Die N-Belastung hat seit 1985 um 25% abgenommen. Der Input ging kontinuierlich zurück, während der Output ungefähr auf demselben Niveau geblieben ist Die Landwirte setzen heute den Stickstoff wesentlich effizienter ein als noch vor 10 Jahren
Die Hälfte der gesamten N-Menge wird in Form von Hofdüngern, ein Viertel in Form von Mineraldüngern zugeführt Der Rest stammt von den Ablagerungen aus der Luft und von der N-Fixierung durch die Leguminosen Entzogen wird N zu 80% durch die Gras- und Heuproduktion und zu 20% durch andere Kulturen
Die Zufuhr von N in Form von Hofdüngern hat seit 1985 kontinuierlich insgesamt um rund 20'000 t abgenommen Ab 1992 wurden auch deutlich weniger Mineraldünger eingesetzt. 1998 waren es 12'000 t weniger als 1992. Der Entzug von N ging bei der Gras- und Heuproduktion ab 1992 stark zurück Diese Entwicklung lief gleichgerichtet mit der Ausdehnung der LN, die als Wiesen extensiv oder wenig intensiv genutzt wird
■ N-Überschuss pro ha in der Schweiz entspricht dem europäischen Durchschnitt Enwicklung der N-Bilanz mehrerer OECD-Staaten
Die oben beschriebene Methode zur Berechnung der N-Bilanz wurde für die Jahre 1985 bis 1997 von allen OECD-Mitgliedländern verwendet
In den meisten Ländern geht der N-Überschuss durch die Landwirtschaft zurück, wobei allerdings zum Teil regionale Unterschiede bestehen Im Gegensatz zur Schweiz weisen die meisten OECD-Staaten, darunter auch die EU, die Mineraldünger als wichtigste N-Quelle aus. Beim Entzug von N ist in der EU dieselbe Entwicklung zu beobachten wie in der Schweiz Der Entzug beim Futterbau ist rückläufig, bei den Ackerkulturen nimmt er leicht zu
Hinsichtlich Verringerung der N-Überschüsse liegt die Schweiz im oberen Mittelfeld Der Überschuss pro ha entspricht in etwa dem EU-Durchschnitt.
in % von 1985/87 bis 1995/97kg
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 87
Quelle: OECD Kanada USA Neuseeland Japan Frankreich EU Niederlande Österreich Schweiz Italien Deutschland 6 25 5 145 59 69 314 35 80 45 88 13 31 6 135 53 58 262 27 60 31 61 117 24 20 -7 -10 -16 -17 -23 -25 -31 -31
N/ha LN 1985–871995–97 -50050100150 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Veränderung
■ Umweltrelevante N-Verluste: Verringerung um 17% seit 1990
Die umweltrelevanten N-Verluste aus der Landwirtschaft setzen sich zusammen aus den Ammoniakemissionen im Stall, während der Lagerung von Hofdüngern und auf dem Feld (insgesamt gut die Hälfte der Gesamtverluste), der Nitratauswaschung (über ein Drittel) sowie den Lachgasemissionen aus Böden. Für alle diese Prozesse bestehen Modellrechnungen Die Ergebnisse dieser Berechnungen für rund 260 repräsentative Buchhaltungsbetriebe wurden auf den Sektor Landwirtschaft hochgerechnet Das Vorgehen zur Berechnung der umweltrelevanten N-Verluste ist anders als bei der N-Bilanz Die Ergebnisse sind deshalb nicht vergleichbar
Entwicklung der umweltrelevanten N-Verluste
■ Entwicklung des N-Verlustpotenzials
199019941998
Quellen: BUWAL, für 1990; IAW-ETH, für 1994 und 1998
Die umweltrelevanten N-Verluste aus der Landwirtschaft nahmen von 1990 bis 1998 gesamthaft um 17% ab Je nach Zone entwickelten sie sich zwischen 1994 und 1998 ganz unterschiedlich Im Talgebiet gingen die umweltrelevanten N-Verluste um 13% zurück, im Berggebiet erhöhten sie sich um 6% Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Viehbestand im Berggebiet zu-, im Talgebiet jedoch abgenommen hat Besonders im Talgebiet ist gleichzeitig auch der Mineraldüngerverbrauch zurückgegangen. Allerdings sind die umweltrelevanten N-Verluste im Talgebiet 1998 mit 60'000 t entsprechend der grösseren Produktion höher als im Berggebiet mit 29'000 t
Entwicklung des N-Verlustpotenzials nach Betriebstypen in der Talzone AckerbauFutterbauKombiniertAufstockung
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 88
N i n 1 0 0 0 t
0 120 100 80 60 40 20 107 95,9 88,9
N i n k g / h a Verlustpotenzial 1994 Verlustpotenzial 1998 Quelle: IAW-ETH 0 250 200 150 100 50
■ Energieverbrauch seit 1990 stabil

Das N-Verlustpotenzial bezeichnet den N, der theoretisch in die Umwelt entweichen kann Es umfasst die Summe der Stall- und Lagerungsverluste, den Verlust beim Ausbringen und des in den Boden gelangenden, aber von den Pflanzen nicht ausgenutzten Stickstoffs. Das N-Verlustpotenzial entwickelte sich je nach Betriebstyp zwischen 1994 und 1998 unterschiedlich
Das N-Verlustpotenzial der Aufstockungs- und Ackerbaubetriebe war 1998 gegenüber 1994 stark vermindert, was weitgehend mit dem abnehmenden Einsatz von Düngern erklärt werden kann Trotzdem weisen die Aufstockungsbetriebe sowohl 1994 wie 1998 das höchste N-Verlustpotenzial auf Das N-Verlustpotenzial war auch bei den übrigen viehhaltenden Betrieben höher als bei den Ackerbaubetrieben Dies ist auf den hohen Anteil an Hofdüngern am gesamten N-Düngerverbrauch zurückzuführen, denn die N-Verluste sind bei den Hofdüngern höher als bei den Mineraldüngern Beim N-Verlustpotenzial der Futterbau- und der kombinierten Betriebe war 1998 gegenüber 1994 keine Verbesserung festzustellen.
Bei der Energie wird sowohl die Entwicklung des Energieverbrauchs durch die Landwirtschaft betrachtet als auch diejenige, die in Agrarerzeugnissen enthalten ist
Entwicklung der eingesetzten Energie und der Energie in Agrarerzeugnissen 197019801985199019951998
In der Zeit von 1970 bis 1990 stieg der Energieverbrauch, stabilisierte sich aber im Verlauf der neunziger Jahre Gleichzeitig erhöhte sich die in Agrarerzeugnissen enthaltene, für die menschliche Ernährung nutzbare Energie Sie ist in der Zeit von 1970 bis 1990 um mehr als 20% gestiegen. Trotzdem stieg der Energieverbrauch der Landwirtschaft in der Periode 1970 bis 1990 schneller als die Energieproduktion Dies ist vor allem auf den Ersatz von menschlicher und tierischer Arbeitskraft durch Maschinen, Fahrzeuge und andere technische Hilfsmittel zurückzuführen. Seit 1990 ist nun eine allgemeine Stabilisierung der Situation eingetreten, wie im direkten Vergleich zwischen der eingesetzten Produktionsenergie und der in Agrarerzeugnissen enthaltenen Energie zum Ausdruck kommt
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 89
T e r a j o u l e Energie für Produktionszwecke Energie in Agrarerzeugnissen Quelle: Rossier 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
■ P-Bilanz: starke Verringerung der P-Überschüsse
Bei der P-Bilanz wird die schweizerische Landwirtschaft wie ein Betrieb betrachtet. Die Zufuhr umfasst importierte Futtermittel, Mineral- und Abfalldünger, das importierte Saatgut und die Depositionen aus der Luft Die Wegfuhr setzt sich aus den pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln und andern Produkten zusammen, welche die Landwirtschaft verlassen
■ Mineraldüngerverbrauch ist stark rückläufig
Die P-Überschüsse sind von 1990/92 bis 1998 von knapp 20'000 t P auf 9000 t zurückgegangen Zurückzuführen ist dies auf die Abnahme der Zufuhr, vor allem durch den verminderten Einsatz von Mineraldüngern und durch die tieferen Futtermittelimporte Gleichzeitig hat die Wegfuhr leicht zugenommen
Landwirtschaftliche Praxis
Zu diesem Bereich zählen Indikatoren, die den Einsatz von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen (Dünger, Pestizide, Futtermittel, Energie) aufzeigen Angaben zum Verbrauch lassen allerdings nur indirekt umweltbezogene Schlüsse zu Es sind zusätzlich Risikoanalysen und Beobachtungen im Feld erforderlich
Das Rückgrat der Nährstoffversorgung der schweizerischen Landwirtschaft bilden die Hofdünger Zur Ergänzung des Bedarfs werden Mineral- und Abfalldünger eingesetzt Über den Mineraldüngerverbrauch besteht eine langjährige Statistik.
Der Gesamtverbrauch an N- und P-Mineraldüngern hat seit Anfang der neunziger Jahre stark abgenommen. Während der Verbrauch an P-Düngern heute noch halb so hoch ist wie 1950, ist der Rückgang beim N-Mineraldünger weniger ausgeprägt Der Verbrauch liegt etwa in der Höhe der siebziger Jahre
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 90
Entwicklung der P-Bilanz 1990–92199319941995199619971998 P i n t Quelle: FAL Total Zufuhr Bilanz Total Wegfuhr 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
Entsprechend der Tierart und dem Tiergewicht wird ein Normwert für den Hofdüngeranfall gebildet, die Düngergrossvieheinheit. Eine Einheit entspricht 35 kg P und 105 kg N, die pro Kuh und Jahr im Durchschnitt ausgeschieden werden
Der gesamte Nutztierbestand, ausgedrückt in Düngergrossvieheinheiten, hat in der Schweiz seit 1990 deutlich, um 140'000 Einheiten oder knapp 10%, abgenommen

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 91 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Entwicklung
1946195019561960196619701976198019861999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1990 N Quelle: SBV P 0 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 i n t
Tieferer Tierbestand reduziert Hofdüngeranfall Entwicklung des Tierbestandes 1990199419961998 D G V E 1 i n 1 0 0 0 Quelle: BFS 1 DGVE: Düngergrossvieheinheit 0 1600 1200 800 400 1443 1376 1336 1303
des Mineraldüngerverbrauchs
■
■ Tierbesatz geht in viehstarken Gebieten zurück
Die kantonalen Daten zum Viehbesatz werden gruppiert auf Grund des Viehbesatzes je ha Kantone mit ähnlich hohen Viehbesatzdichten werden zusammengefasst
Entwicklung des Tierbestandes gruppiert nach Viehbesatzdichte
■ Pflanzenschutzmittel: 30% weniger verkauft als 1990
Der Tierbesatz ist in der Schweiz je nach Gebiet sehr unterschiedlich Die Inner- und die Ostschweiz weisen eine überdurchschnittliche Tierdichte auf, während die Westschweiz wegen des ausgedehnten Ackerbaus, die Berggebiete entsprechend der geringeren Rauhfutterproduktion, weniger Tiere pro ha halten Die übrigen Mittellandkantone nehmen eine Mittelstellung ein. Der Tierbesatz hat vor allem in den viehstarken Gebieten abgenommen
Die hier verwendeten Daten basieren auf der Pflanzenschutzmittel-Statistik und werden in die verschiedenen Biozidgruppen aufgeschlüsselt.
Entwicklung des Pflanzenschutzmittelverkaufes
Der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln ist zwischen 1990 und 1998 um rund 31% von 2'300 t auf 1'600 t aktive Substanzen zurückgegangen. Die beiden am häufigsten eingesetzten Stoffgruppen, Fungizide und Herbizide, weisen in dieser Zeitperiode eine Abnahme um 25% aus Mit 77% am deutlichsten rückläufig ist der Verkauf von Wachstumsregulatoren.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 92
D G V E 1 / h a
1 Düngergrossvieheinheit 1990 1994 19961998
TG,
GR,
0,0 2,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
Quelle: BFS
GE, NE, VDBL, BS, SH, JU FR, BE, SO, AG, ZH LU, SZ, UR, NW, OW, GL, ZG
SG, AI, AR
TI, VS
i n %
Fungizide, Bakterizide und Samenbehandlungsmittel Herbizide Insektizide Wachstumsregulatoren Total 19901992199419961998 0 120 100 80 60 40 20
Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie
■ Pestizidverbrauch in der OECD
Die Mitgliedländer der OECD erheben Daten über den Verbrauch und die Verkäufe von Pestiziden Bei den Angaben handelt es sich um die Menge aktiver Substanzen Dadurch werden internationale Vergleiche ermöglicht, wobei jedoch angesichts der unterschiedlichen Bodenarten, klimatischen Bedingungen und Bewirtschaftungsweisen bei der Interpretation Vorsicht geboten ist Auch sind die Erhebungsmethoden nicht vollständig harmonisiert
Entwicklung des Pestizidverbrauchs mehrerer OECD-Staaten
Veränderung in % von 1985/87 bis 1995/97Aktive
Anmerkungen: Daten der EU ohne Deutschland und Portugal.
Die unter 85–87 aufgeführten Daten der Schweiz sind diejenigen von 1988.

Bei den Daten 95–97 sind für die USA diejenigen von 91–93 und für Kanada diejenigen von 1994 eingetragen.
Quelle: OECD
In den meisten OECD-Ländern stagnierte der Pestizidverbrauch im letzten Jahrzehnt oder ging gar zurück Die Schweiz gehört nicht zu den Ländern mit dem stärksten Rückgang; sie liegt im Durchschnitt der EU.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 93 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
Neuseeland Frankreich USA Japan Kanada EU Schweiz Österreich Niederlande Schweden 3 690 96 897 377 577 97 672 35 370 333 804 2 456 5 670 20 241 3 885 3 752 97 229 373 115 84 850 29 206 253 684 1 832 3 552 10 553 1 454 1 0 -1 -13 -17 -24 -25 -37 -48 -62
Substanzen in t 1985–871995–97
-60-50-40-30-20-1001020
■ Treibhausgasemissionen: Landwirtschaft trägt mehr zur Reduktion bei als die übrigen Verursacher
Abiotische Ressourcen (Klima, Luft, Wasser, Boden)
Die landwirtschaftliche Tätigkeit kann eine chemische oder physikalische Belastung der abiotischen Ressourcen zur Folge haben. Stichworte dazu sind Nitrat und Pestizide im Wasser, Eutrophierung der Gewässer und des Bodens oder Treibhausgasemissionen Landwirtschaftliche Nutzflächen können aber auch eine Pufferwirkung ausüben und die Umweltqualität verbessern Zudem kann sich die Schädigung der abiotischen Ressourcen durch ausserlandwirtschaftliche Emissionen auch negativ auf die Landwirtschaft auswirken

Aus methodischen Gründen oder mangels geeigneter Daten ist eine Zusammenfassung der Informationen bezüglich Emissionen im Wasser, in der Luft und im Boden sowie bezüglich Erosion auf nationaler Ebene im Augenblick schwierig Für den ersten Agrarbericht wird deshalb darauf verzichtet Daten von guter Qualität gibt es dagegen bei den klimarelevanten Treibhausgasemissionen.
Im Bereich Klima können die Treibhausgase nach den vier Hauptquellen unterschieden werden: Verkehr, Industrie und Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft sowie Haushalte Für die Jahre 1980 bis 1995 werden die durch den Menschen effektiv verursachten gesamtschweizerischen Luftschadstoffemissionen erfasst, ab 1995 wird auf Prognosen abgestellt Die Berechnungen beziehen sich auf die Emissionen der drei in der Landwirtschaft am häufigsten anfallenden Treibhausgase CO2, Methan und Lachgas, wobei Methan- und Lachgasemissionen in CO2-Äquivalente umgerechnet werden.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 94
Entwicklung der Treibhausgasemissionen: Schweiz total sowie Land- und Forstwirtschaft
■ Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in der Schweiz stärker rückläufig als im Durchschnitt der EU
Sowohl die treibhausrelevanten Emissionen der gesamten Gesellschaft als auch diejenigen der Landwirtschaft sind seit Beginn der achtziger Jahre kontinuierlich am Sinken Der Anteil der Landwirtschaft an den Gesamtemissionen ist in diesem Zeitraum von 21% (1980) um rund 3 Prozentpunkte auf 18% (Prognose 2000) gesunken Den Hauptanteil der Emissionen der Landwirtschaft machen Methan und Lachgas aus. Diese Gase stammen vor allem aus der Tierhaltung Die Reduktionserfolge der Landwirtschaft sind zurückzuführen auf den Abbau des Tierbestandes, auf die bewusste Wahl emissionsoptimierter Lager- und Ausbringungstechniken von Hofdüngern sowie auf die Sensibilisierung der Landwirte und Landwirtinnen, Mist- und Gülle zum optimalen Zeitpunkt auszubringen
Angaben zu den Treibhausgasemissionen stehen für alle OECD-Länder zur Verfügung. Da die Vorgaben jedoch nicht überall gleich sind, ist beim Vergleich eine gewisse Vorsicht geboten
Veränderung der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in verschiedenen Ländern der OECD in % von 1990/92 bis 1995/97
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 95 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
1980198519902000 1995 i n t Total Schweiz Land- und Forstwirtschaft Quelle: BUWAL 0 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
Quelle: OECD Kanada USA Niederlande Italien Österreich Neuseeland EU Frankreich Schweiz Japan Deutschland 7 4 1 12 1 -1 -2 -3 -6 -6 -8 -10-5051015
■ Methanemissionen: 26% weniger pro kg Milch als 1980

In den meisten OECD-Ländern ist der aus der Landwirtschaft stammende Anteil der Treibhausgasemissionen relativ klein Er geht ausserdem seit Anfang der neunziger Jahre tendenziell zurück, vor allem wegen der Abnahme der Viehbestände
Die produzierte Energie in Agrarerzeugnissen hat im Laufe der Jahre leicht zugenommen Die Emissionen klimarelevanter Gase (in CO2-Äquivalenten) aus der Landwirtschaft hingegen sind seit 1980 am Sinken Beispielhaft für diese Effizienzsteigerung werden die Methanemissionen pro kg produzierte Milch betrachtet, welche sehr eng mit der Tierhaltung verknüpft sind
Der Kuhbestand hat seit 1980 kontinuierlich abgenommen Im gleichen Zeitraum ist die Leistung pro Kuh stetig gestiegen Die Methanemissionen haben aufgrund der kleiner werdenden Tierzahlen seit 1980 um 50‘000 t auf 225'000 t pro Jahr abgenommen Die aufgezeigten Entwicklungen führten dazu, dass sich das Verhältnis Methanemissionen pro kg Milch verbesserte und heute rund 26% weniger Methan pro kg Milch emittiert wird als noch 1980.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 96
1980198519902000 1995 I n d e x ( 1 9 9 0 = 1 0 0 ) Quellen: BLW, BUWAL 0 140 120 100 80 60 40 20
Entwicklung der Methanemissionen bei der Milchproduktion
■ Viele landwirtschaftliche
und Sorten
Biotische Ressourcen
Bei den Indikatoren für die biotischen Ressourcen (Fauna und Flora) werden drei Kategorien unterschieden: landwirtschaftliche Biodiversität (eingetragene Nutztierrassen und Nutzpflanzensorten, von der Landwirtschaft abhängige wilde Arten); Lebensräume in der Landwirtschaft für Wildarten (entspricht dem ökologischen Ausgleich); Landschaft Auf nationaler Ebene steht heute noch kein Indikator für die Landschaft zur Verfügung
Der Viehbestand in der Schweiz umfasst heute verschiedene eingetragene Nutztierrassen; es werden auch unterschiedliche Kulturpflanzensorten angebaut.
Entwicklung der Einträge von Nutztierrassen in einem Herdebuch
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 97 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
verfügbar
SchweineRinder A n z a h l R a s s e n Quelle: BLW 1985 1990 1995 1998 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Entwicklung der Einträge von Nutzpflanzensorten KartoffelnGetreide A n z a h l S o r t e n Quelle: BLW 1985 1990 1995 1998 0 35 30 25 20 15 10 5
Rassen
Seit 1985 nimmt in der Schweiz die Anzahl genehmigter oder verwendeter Nutztierrassen und Pflanzensorten zu, vor allem seit 1995
Entwicklung des Anteils der wichtigsten Nutztierrassen und Nutzpflanzensorten an der gesamten Produktion
Diese genetischen Ressourcen werden aber unterschiedlich genutzt. So machen zwei Schweine- und drei Rinderrassen fast 100% des schweizerischen Bestands aus Diese Konzentration lässt sich in geringerem Masse auch bei der Pflanzenproduktion feststellen, vor allem im Getreidebau.
Als ÖAF gelten extensiv und wenig intensiv genutzte Wiesen, extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland, Streueflächen, Hecken, Feld- und Ufergehölze, Bunt- und Rotationsbrachen, Ackerschonstreifen und Hochstamm-Feldobstbäume.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 98
Schweine (2)Rinder (3)Kartoffeln (5)Getreide (5) i n % Quelle: BLW 1985 1990 1995 1998 0 100 80 60 40 20 ■ Ökologische Ausgleichsflächen (ÖAF) nehmen markant zu ■ Nur einige Rassen werden genutzt Entwicklung der ÖAF 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 i n 1 0 0 0 h a Quelle: BLW 1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume 0 20 40 60 80 100
Entwicklung des Anteils der ökologischen Ausgleichsflächen in % der LN
Die ÖAF haben zwischen 1993 und 1999 von annähernd 50'000 ha auf fast 90'000 ha zugenommen Der Anteil an der LN betrug 1999 total 8,3% In den Bergzonen III und IV ist der Anteil an ÖAF bedeutend höher als in den Gebieten bis Bergzone II

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 99 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
i n % Quelle: BLW 1 Ackerbauzonen bis Hügelzone 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 0 25 20 15 10 5
ABZ – HZ1 BZ I – BZ IIBZ III – BZ IV
■ Umweltschonende Flächenbewirtschaftung
Umweltverhalten / Umweltbewusstsein
Es werden gegenwärtig Indikatoren entwickelt, um das Umweltbewusstsein der Landwirte und Landwirtinnen, der landwirtschaftlichen Kreise und der Konsumenten und Konsumentinnen zu messen Dabei soll ermittelt werden, ob eine effektive Nachfrage nach besonders umweltgerecht produzierten Erzeugnissen besteht Da diese Indikatoren noch nicht verfügbar sind, wurde als Ersatz die Beteiligung der Landwirte an den agrarökologischen Programmen gewählt Er dient gleichzeitig auch als Indikator für das globale Umweltrisiko
Der ökologische Leistungsnachweis (ÖLN) stellt auf gesamtschweizerischer Ebene die Regeln für die umweltschonende Flächenbewirtschaftung auf Er gilt ab 1999 als Grundvoraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen Diese Regeln betreffen den ganzen Betrieb. International spricht man von einem globalen Umweltbewirtschaftungsplan, dem sich die Betriebe unterziehen
Entwicklung des Anteils der Fläche mit umweltschonender Bewirtschaftung
umweltschonende Bewirtschaftung1
Quelle: BLW
Die 1993 eingeführten Direktzahlungen zur Abgeltung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft erzielten einen hohen Wirkungsgrad bei der umweltschonenden Bewirtschaftung auf gesamtbetrieblicher Basis Im Einführungsjahr betrug der Flächenanteil 18,4% Im Berichtsjahr wurden 95,3% der Fläche nach den Regeln des ÖLN bewirtschaftet 7,3% der LN wurden nach den Regeln des biologischen Landbaus bewirtschaftet, 1993 lag der Anteil bei 1,8%

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 100
innerhalb von
Jahren verfünffacht
sechs
i n % d e r L N
davon Bio
1 1993
1993199419951999 19971998 1996 0 100 60 80 40 20
bis 1998: IP+Bio, ab 1999: ÖLN
■ Bioproduktion: die Schweiz unter den führenden Ländern
Da die biologische Landwirtschaft auf internationaler Ebene relativ gut definiert ist, sind Ländervergleiche möglich
Entwicklung des Flächenanteils des Biolandbaus in verschiedenen Ländern der OECD
■ Umweltschonende Produktion auf Gesamtbetrieb: Schweiz führend
Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich die nach biologischen Methoden bewirtschaftete Fläche in den OECD-Mitgliedstaaten beträchtlich ausgedehnt. In der EU sind es nunmehr fast 2% der LN Beim Anteil an biologisch bewirtschafteten Flächen zählt die Schweiz international zu den führenden Ländern
Bei globalen Umweltbewirtschaftungsplänen, die nicht die Regeln des Biolandbaus befolgen, sind auf internationaler Ebene Bestrebungen zur Harmonisierung im Gange Die OECD-Mitgliedländer haben sich auf eine Definition geeinigt, die in den Grundzügen den schweizerischen Regeln des ÖLN entspricht.
Entwicklung des Flächenanteils umweltschonender Bewirtschaftung (ohne Biolandbau) in verschiedenen Ländern
Von den Ländern, die diesbezügliche Daten geliefert haben, weist die Schweiz den grössten Anteil an Betrieben auf, die nach einem globalen Umweltbewirtschaftungsplan wirtschaften.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 101 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
G r o s sb r i t a n n i e n F r a n k r e i c h B e l g i e n S p a n i e n T s c h e c h R e p u b l i k N i e d e r l a n d e D e u t s c h l a n d I t a l i e n S c h w e i z S c h w e d e n Ö s t e r r e i c h Anfang der neunziger JahreMitte/Ende der neunziger Jahre Quelle: OECD 0 12 10 8 6 4 2 i n % d e r L N
ItalienJapanSchwedenSchweiz i n % d e r L N 19931997 Quelle: OECD 1 Keine Angaben für Österreich 1993 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Österreich1
■ RAUS und BTS: Beteiligung stark angestiegen
Verhalten gegenüber den Tieren
Im ersten Agrarbericht wird die Beteiligung an den Programmen regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS) und besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) zur Bewertung des Verhaltens der Landwirte den Tieren gegenüber verwendet
Das RAUS-Programm regelt die Erfordernisse für den Auslauf, die Weide, den Laufhof sowie die Haltung der Tiere, z B die Gestaltung des Liegebereichs Das BTS-Programm stellt weitere Anforderungen an den Stall und an die Tierhaltung wie z B das Vorhandensein und die Gestaltung eines Haltungssystems, das den Tieren für verschiedene Tätigkeiten angepasste Zonen bereithält.
Entwicklung der Beteiligung an den Programmen RAUS und BTS
Quellen: BLW, BFS
Der Anteil der beteiligten GVE nimmt bei beiden Programmen stetig zu. Die Beteiligung am RAUS-Programm ist eindeutig höher Dies ist damit zu erklären, dass für die Erfüllung der BTS-Richtlinien oft erhebliche bauliche Massnahmen nötig sind, was die Teilnahme erschwert.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 102
G V EA n t e i l i n % RAUSBTS
1993199419951999 19971998 1996 0 40 50 35 30 25 20 15 10 5
■ Beteiligung nach landwirtschaftlichen Zonen

Die GVE-Anteile werden auf den GVE-Bestand der entsprechenden Zone bezogen.
GVE-Anteile in den Programmen RAUS und BTS nach Zonen 1998
Da die baulichen Massnahmen wegen der Stufenwirtschaft und der Topographie im Berggebiet um einiges anspruchsvoller umzusetzen sind, ist der GVE-Anteil beim BTSProgramm dort geringer Auf der anderen Seite ist der GVE-Anteil beim RAUS-Programm im Berggebiet höher
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 103
G V EA n t e i l i n % RAUSBTS Quelle: BLW 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 A c k e r b a u z o n e E r w e i t e r t e Ü b e r g a n g s z o n e Ü b e r g a n g s z o n e H ü g e l z o n e B e r g z o n e I B e r g z o n e I I B e r g z o n e I I I B e r g z o n e I V
■ Gesamtheitliche Betrachtung als methodischer Ansatz
1.3.2 Beurteilung der Umweltbelastung der Schweizer Landwirtschaft
Eine Studie, bei der die Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik Tänikon (FAT), der Service romand de vulgarisation agricole (SRVA), die Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL), das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und die Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) beteiligt sind, befasst sich mit einer vereinfachten Beurteilung der potenziellen Umweltbelastung durch die schweizerische Landwirtschaft (Rossier) Das Ziel ist es, aufgrund gesamtschweizerischer Daten und mittels einer so weit als möglich auf der Ökobilanz gemäss ISO-Norm 14040 basierenden Methode auf vereinfachte Weise die potenziellen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die unbelebte Umwelt (Ressourcen, Klima, Luft, Boden und Wasser) zu erfassen
Im Folgenden werden die Methode und die ersten Resultate der Studie vorgestellt Es handelt sich um Resultate, die vorsichtig auszulegen sind und einer kritischen Analyse bedürfen Besondere Zurückhaltung ist bei den Resultaten vor 1990 angebracht, da vor allem hinsichtlich Emissionen Extrapolationen nötig waren Dagegen hat sich erwiesen, dass mit dieser Methode wertvolle Aussagen gemacht werden können, und das Instrument kann für ein jährliches Umweltmonitoring des Landwirtschaftssektors zweckmässig eingesetzt werden
Die gewählte Methode verfolgt die in einem Produktionssystem verwendeten Substanzen «von der Wiege bis zur Bahre» und analysiert die Auswirkungen der erzeugten Emissionen So werden z B die Stoffflüsse von der Gewinnung der Stoffe bis zur Entsorgung der Abfälle aufgezeichnet. Grundsätzlich werden alle Emissionen berücksichtigt, die sich auf die Umwelt auswirken Die Studie behandelt jedoch vor allem die Einflüsse, die auf internationaler Ebene heute für die Umwelt als besonders gefährlich gelten. Dank dem globalen Ansatz kann ein Produktionssystem gesamthaft untersucht werden, ohne dass dabei Verschmutzungseffekte einem anderen Produktionssektor zugeschrieben werden und umgekehrt Hingegen können heute die Bodenfruchtbarkeit, die Biodiversität, die naturnahen Lebensräume und die Landschaft noch nicht berücksichtigt werden
Die Schweizer Landwirtschaft wird als eine Einheit betrachtet, die Inputs verwendet, Nahrungsmittel produziert und Emissionen verursacht Es werden Produktionsdaten erhoben und Inventare der Emissionen und Energieflüsse erstellt. Angesichts unvollständiger statistischer Angaben mussten für die Jahre 1970 bis 1990 Extrapolationen von neueren Daten zu Hilfe genommen werden Dies gilt auch für die Emissionsfaktoren.
Für acht Umweltkategorien wurden die Auswirkungen der Emissionen errechnet, die Inventare der Energie- und Stoffflüsse erstellt und deren Auswirkungen auf die Umwelt analysiert

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 104 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Negative Auswirkungen auf die Umwelt nehmen ab
Die Auswirkungen der schweizerischen Landwirtschaft auf die Umwelt lassen sich mit Bezug auf die bewirtschaftete Fläche gesamthaft ermitteln Wird auch die Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion mitberücksichtigt, kann ein Bezug zur produzierten Nahrungsenergie hergestellt werden. Bei beiden Vorgehensweisen zeichnen sich dieselben Tendenzen ab
Entwicklung der Umweltauswirkungen
Nicht erneuerbare Energieträger
Der Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger nahm bis 1990 zu und stabilisierte sich danach, was auf eine bessere Bewirtschaftung dieser Ressourcen hindeutet
Treibhauseffekt
Insgesamt erhöhte sich der Beitrag der Landwirtschaft am Treibhauseffekt bis 1980; seither hat er abgenommen Der Rückgang des Beitrags der Landwirtschaft zum Treibhauseffekt ist insbesondere dem abnehmenden Bestand an Rindern und Schweinen sowie dem geringeren Verbrauch von mineralischen N-Düngern ab 1990 zu verdanken
Ozonbildung
Der Einfluss der schweizerischen Landwirtschaft auf die Ozonbildung hat sich seit 1980 stabilisiert Die Emissionen von Stickstoffoxid und flüchtigen organischen Verbindungen, hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Energien, machen mehr als 90% der Ozonbildung landwirtschaftlichen Ursprungs aus
Versauerung der Böden
Die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Versauerung der Böden nahmen seit 1980 regelmässig ab, in erster Linie wegen des Rückgangs der Ammoniak-Emissionen in die Luft um fast 20%
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 105 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
pro Einheit produzierte Nahrungsenergie N i c h t e r n e u e r b a r e E n e r g i e t r ä g e r T r e b h a u s e f f e k t O z o n b i d u n g V e r s a u e r u n g ( B o d e n ) G e s a m t e u t r o p h e r u n g T o x i z t ä t f ü r M e n s c h e n Ö k o t o x i z i t ä t ( B o d e n ) Ö k o t o x i z i t ä t ( W a s s e r ) Quelle: Rossier 1970 1980 19901998 0 120 80 100 60 40 20 I n d e x ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
Gesamteutrophierung
Die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Gesamteutrophierung (N- und PEmissionen zusammengenommen) gehen seit 1980 kontinuierlich zurück Die NitratEmissionen ins Wasser und die Ammoniak-Emissionen in die Luft bilden mit je 45% den Hauptanteil
Toxizität für die Menschen
Anhand der verwendeten Methode konnte eine seit 1980 abnehmende Belastung bezüglich Schwermetallen und Nitraten festgestellt werden
Ökotoxizität im Boden
Die bisherigen Resultate zeigen seit 1980 eine klare und regelmässige Verringerung der Belastungen des Bodens Dies ist unter anderem auf einen viel kleineren Gehalt an Schwermetallen des in der Landwirtschaft verwendeten Klärschlamms zurückzuführen, aber auch auf einen deutlich geringeren Verbrauch von Phosphor-Düngern. Die Landwirtschaft wirkt sich auf die Ökotoxizität im Boden vor allem durch die Zufuhr von Schwermetallen aus Dabei spielt Zink die Hauptrolle Die verwendete Methode, die den Schwermetallen mehr Gewicht beimisst als den organischen Verbindungen, ist noch zu verfeinern
Ökotoxizität im Wasser

Die Belastungen der Landwirtschaft auf die Ökotoxizität im Wasser sind seit 1980 kontinuierlich zurückgegangen, grösstenteils aus den gleichen Gründen wie bei der Ökotoxizität im Boden Es gelten hier auch dieselben methodischen Vorbehalte
■ Ausblick Die Studie versucht, die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt mit einer einfachen Methode zu ermitteln. Diese erlaubt auch eine jährliche Nachführung. Es ergibt sich ein einfaches und relativ leicht zu vermittelndes Bild Die Methode ist allerdings noch weiter zu entwickeln und zu verfeinern In Zukunft soll es auch möglich sein, eine Beurteilung nach Bewirtschaftungsweise, Produkt oder Region vornehmen zu können Zusätzlich sollen Aspekte wie Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Landschaft einbezogen werden
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 106
■ Forschungsprojekt über Landschaftliche Vielfalt und Artenvielfalt
1.3.3 Biodiversität – auch ein Produkt der Landwirtschaft
Gestützt auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt, ratifiziert von der Schweiz 1994, wurde die Agrarpolitik in den letzten Jahren so gestaltet, dass Anreize zur Erhaltung, Förderung und nachhaltigen Nutzung der Biodiversität geschaffen wurden Dadurch ist es gelungen, auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen eine Entwicklung der Bewirtschaftung einzuleiten, die sich stark an der Biodiversitätskonvention orientiert Diese umfasst die Erhaltung, Förderung und nachhaltige Nutzung der folgenden drei Bereiche:
– Ökosystemvielfalt;
– Artenvielfalt;
– genetische Vielfalt
In der Folge wird auf diese drei verschiedenen Bereiche eingegangen, um aufzuzeigen, wie die Landwirtschaft zur Erhaltung, Förderung und nachhaltigen Nutzung der Biodiversität beiträgt
Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) untersucht in drei landschaftlich und landwirtschaftlich unterschiedlichen Gebieten die Auswirkungen von ÖAF auf die Biodiversität. In das Forschungsprojekt einbezogen sind die Station Fédérale de Recherches Agronomiques de Changins (RAC), das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), der Service romand de vulgarisation agricole (SRVA) und die Schweizerische Vogelwarte Bei den drei Gebieten handelt es sich um das Rafzerfeld im Kanton Zürich, ein Ackerbaugebiet, ein Gebiet mit Ackerbau und Futterbau in Combremont/Nuvilly (VD / FR) sowie ein Futterbaugebiet in Ruswil/ Buttisholz (LU) Untersucht werden Landschaft, ÖAF, Vegetation, Tagfalter, Laufkäfer, Spinnen und Vögel
■ Ökologischer Ausgleich ist positiv für die landschaftliche Vielfalt
Die drei Gebiete unterscheiden sich bezüglich Lage, Relief und Klima Diese Faktoren prägen auch die landwirtschaftliche Nutzung Das Rafzerfeld ist das wärmste und flachste der drei Untersuchungsgebiete, Combremont/Nuvilly ist höher gelegen, im Sommer etwas kühler und das Relief ist bewegter Ruswil/Buttisholz ist das höchst gelegene und feuchteste Gebiet mit hügeligem Relief
Das Rafzerfeld wird neben der landwirtschaftlichen Nutzung von Siedlungen, Strassen und Kiesgruben stark geprägt Diese Elemente fehlen in den beiden anderen Gebieten oder nehmen weniger Fläche ein
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 107 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ackerbau Kunstwiese Naturwiese/Weide
Spezialkultur Hochstammobstgarten Ökologische Ausgleichsflächen
Gehölz, Saum, Böschungen Kies/Gewerbe Strassen, Siedlung, Freizeit
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 108 0500 5001000 Quelle: FAL
Rafzerfeld
/ Nuvilly
/ Buttisholz
Fallstudiengebiet
Fallstudiengebiet Combremont
Fallstudiengebiet Ruswil
Wald Meter
Die Anreize durch die Agrarpolitik führten seit 1993 in der ganzen Schweiz zu einer Zunahme der ÖAF In zwei Gebieten wurden aufgrund von bisher zwei Untersuchungen folgende Veränderungen festgestellt:
Ruswil / Buttisholz: Anteil der ÖAF an der LN
19971999
1 Hochstamm-Feldobstbäume (1 HF wird als 1 Are gerechnet)
2 wenig intensiv genutzte Wiese
3 extensiv genutzte Wiese auf stillgelegtem Ackerland
4 extensiv genutzte Wiese
Rafzerfeld: Anteil der ÖAF an der LN
Quelle: FAL
19971999
1 Buntbrachen
2 wenig intensiv genutzte Wiese
3 extensiv genutzte Wiese auf stillgelegtem Ackerland 4 extensiv
Quelle: FAL
Die Untersuchungen zeigen, dass durch den ökologischen Ausgleich vorhandene naturnahe Elemente erhalten und neue geschaffen werden
Schliesst man die Hochstamm-Feldobstbäume aus, nehmen Wiesen überall den grössten Anteil ein, in Combremont/Nuvilly vor allem die extensiv genutzten Wiesen auf stillgelegtem Ackerland Im Rafzerfeld wurden Hecken zu einem grossen Teil für den ökologischen Ausgleich neu angepflanzt Hochstamm-Feldobstbäume kommen nur in den beiden Fallstudiengebieten Combremont/Nuvilly und Ruswil/Buttisholz vor Buntbrachen sind nur im Rafzerfeld vorhanden, sie werden dort durch ein Zusatzprogramm gefördert

1 . 3 Ö K O L O G I E 1 109 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
i n % HF 1 Hecken WI 2 EWSA 3 EW 4
1 0 6 5 4 3 2
i n % BB 1 Hecken WI 2 EWSA 3 EW 4
0,5 0 3,5 3,0 2,5 1,5 2,0 1,0
genutzte Wiese
Wie wirken sich die ÖAF auf die Artenvielfalt aus? Aus zwei Untersuchungsgebieten liegen erste Ergebnisse vor: In Ruswil/Buttisholz wurden 1998 16 Tagfalterarten erfasst Keine dieser Arten ist in der Schweiz gefährdet 84% der beobachteten Individuen gehören zu den in der Schweiz häufigen und weit verbreiteten Weisslingen. Die Dominanz der Weisslinge und die geringe Anzahl Arten sind typisch für landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete
Vier beobachtete Arten, die vorwiegend in extensiv genutzten Wiesen, Weiden und Säumen leben – der Schwalbenschwanz, der Hauhechelbläuling, der Aurorafalter und der Kleine Perlmutterfalter – lassen jedoch darauf schliessen, dass die ÖAF erste Früchte tragen

Im ackerbaulich intensiv genutzten Rafzerfeld wurden 22 Tagfalterarten erfasst Die drei gleichen Weisslinge wie in Ruswil/Buttisholz sind auch hier mit beinahe 70% der beobachteten Individuen dominant. Entlang der Hecken konnte die grösste Anzahl Arten beobachtet werden Der Kleine Fuchs und der Schwalbenschwanz wurden zu 75% in Buntbrachen beobachtet
In Ruswil/Buttisholz wurden insgesamt 135 Spinnenarten gefangen, im Rafzerfeld 127. Die verschiedenen Wiesentypen wiesen immer ungefähr die selbe Anzahl Spinnenarten auf Von Wiesentyp zu Wiesentyp unterschiedlich ist hingegen die Zusammensetzung der Arten So kommen in intensiv genutzten Wiesen vorwiegend Spinnenarten vor, die ausschliesslich in unbewaldeten Lebensräumen leben. In extensiv genutzten Wiesen kommen Arten vor, die auch in bewaldeten Lebensräumen leben können Bei den auf der Bodenoberfläche lebenden Spinnen konnten keine Unterschiede zwischen der Fauna der Buntbrachen und derjenigen der umgebenden Hauptkultur festgestellt werden Die Zusammensetzung der Spinnenarten in den Wiesen unterscheidet sich von derjenigen in den Winterweizenfeldern.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 110
■ Artenvielfalt regionsspezifisch fördern und erhalten
■ Genetische Vielfalt
Die Wirkung der verschiedenen ÖAF auf die Tiergruppen ist unterschiedlich:
Buntbrachen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Tagfalter;
– extensiv genutzte Wiesen werden häufiger von Tagfaltern besucht als intensiv genutzte Wiesen;
– in extensiv genutzten Wiesen kommen Spinnenarten vor, die auch im Wald oder am Waldrand leben In intensiv genutzten Wiesen fehlen diese Arten
Diese Beispiele veranschaulichen die vielfältigen Auswirkungen der ÖAF auf die Biodiversität
Eine wichtige Rolle spielen die botanische Qualität der einzelnen ÖAF einerseits und ihre Vernetzung andererseits. Eine botanisch wertvolle Wiese bietet vielen Pflanzenarten Lebensraum, die wiederum die Lebensgrundlage für viele Tierarten (Insekten, Vögel) bilden Die botanische Vielfalt von ÖAF ist gefährdet, wenn diese voneinander isoliert sind, sodass der notwendige Austausch von Genen behindert wird. Deshalb ist ein Netz von ÖAF anzustreben Sinnvoll vernetzte ÖAF bieten auch Tieren wie Hasen oder Rebhühnern Korridore und somit eine wichtige Voraussetzung für ihr Überleben
Jede Region hat aufgrund ihrer topographischen und klimatischen Bedingungen ihr spezifisches Artenpotenzial. Die regional angepasste Förderung der botanischen Qualität von ÖAF und deren Vernetzung sind Aufgaben, die nur mit regionalen Konzepten erfüllt werden können Die Rolle des Bundes ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die notwendige Fläche an ÖAF bereitgestellt wird. So soll 2001 ein Regionalisierungskonzept in Kraft treten, welches dem Bund ermöglicht, regionale Projekte zur gezielten Förderung der Landschafts- und der Artenvielfalt finanziell zu unterstützen
Ausgehend von der Biodiversitätskonvention wurde ein globaler Aktionsplan entwickelt Das BLW erarbeitete darauf basierend einen nationalen Aktionsplan zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung genetischer Ressourcen von Pflanzen und Tieren für Ernährung und Landwirtschaft in der Schweiz Es ist auch in der Schweiz eine Tatsache, dass viele alte Kulturpflanzenarten und landwirtschaftliche Nutztierrassen heute immer weniger genutzt werden und deshalb vom Aussterben bedroht sind Damit besteht die Gefahr, dass ohne Erhaltungsmassnahmen ein grosser Teil der Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion, in Form der genetischen Vielfalt sowie des spezifischen Fachwissens der bäuerlichen Bevölkerung, verloren geht In Zusammenarbeit mit interessierten Organisationen und Ämtern wurden deshalb für die Periode 1999 bis 2002 die wichtigsten Massnahmen festgelegt und folgende Aufgaben als vordringlich eingestuft:
im Pflanzenbereich
– Erstellen von Inventaren;
– Erhaltungsprogramme für Obstarten; – Durchführung von Erhaltungs- und Nutzungsprogrammen vor Ort (im Feld);
– Durchführung von Regenerationsprogrammen von Genbankenmaterial
im Tierbereich
– Erhaltungsprogramme für gefährdete schweizerische Nutztierrassen;
Aufbau einer Datenbank für gefährdete Nutztierrassen.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 111 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T
–
–
Alleine bei den pflanzengenetischen Ressourcen sind in der Schweiz rund 17'000 Varietäten, Populationen oder Linien bekannt, die entweder in Genbanken oder im Feld aktiv erhalten werden Die Konservierung in Genbanken geschieht vor allem in den landwirtschaftlichen Forschungsanstalten, aber auch durch private Institutionen und Züchter Private Züchter und Organisationen haben die Möglichkeit, im Rahmen des internationalen Aktionsplanes Projekte einzureichen und sie durch Bundesgelder fördern zu lassen Zur Zeit werden im Bereich der pflanzengenetischen Ressourcen 13 Projekte, im Bereich der Tierrassen 3 Projekte vom Bund unterstützt Die laufenden Bestrebungen im Bereich der genetischen Vielfalt unterstützen und ergänzen die laufenden Bestrebungen und Anstrengungen in den Bereichen Arten- und Landschaftsvielfalt

112 1 . 3 Ö K O L O G I E 1
■ Methodisches Vorgehen
1.3.4 Externe Effekte der Schweizer Landwirtschaft
In einer Studie im Auftrag des BLW wurden die Externalitäten der schweizerischen Landwirtschaft quantitativ erfasst (Pillet, Maradan, Zingg; ECOSYS SA) Der Auftrag bestand darin, die ökologischen und gesellschaftlichen Funktionen der Landwirtschaft zu bewerten
Die Studie ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Ausweitung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung auf nicht vermarktete Güter und Dienstleistungen Es handelt sich um einen Bereich, in dem bis heute keine wissenschaftlichen Bewertungen in diesem umfassenden Sinn vorgenommen wurden. Die Ergebnisse sind entsprechend vorsichtig zu interpretieren
In der Studie wurden drei Arten von Externalitäten bearbeitet:
– Die externen Effekte im klassischen Sinn, das heisst die nicht marktbezogenen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt, wie z B die Pflege der Landschaft, die Luftverschmutzung und die Bodenerosion
– Die gesellschaftlichen Externalitäten, z B der Beitrag der Landwirtschaft zur Dorferhaltung, zum Brauchtum sowie zur Versorgungssicherheit
– Die sogenannten Emternalitäten, das heist der nicht marktbezogene Input aus der Umwelt wie z B die Sonnenenergie und der Regen
Wirtschaftliche Analyse der externen Effekte
Die externen Effekte können Vorteile bringen, die nicht bezahlt werden (saubere Luft, reines Wasser, usw.), aber auch Nachteile (Lärm, Rauch, Schmutz, Verkehr, usw.), für welche keine Entschädigungen ausgerichtet werden
Da die externen Effekte das Wohlergehen von Individuen beeinflussen und diese dafür nicht zahlen bzw nicht entschädigt werden (fehlender Markt), erfolgt die Bewertung mit Methoden, die den fehlenden Markt ersetzen Dabei wird das Verhalten auf echten oder hypothetischen Märkten beobachtet und die nicht marktbezogenen Aspekte der Produktionsaktivitäten anhand der Zahlungsbereitschaft, der Akzeptanz sogenannt hedonistischer Preise oder der Reisekostenmethode quantifiziert.
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 113 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Bewertungsmethoden
Realer Markt
direkte Umfragen indirekte Umfragen
■ Konsumentennutzen und ■ Hedonischer Preisansatz Zahlungsbereitschaft (Marktpreismethode)
■ Wiederherstellungskosten, ■ Reisekostenmethode Vermeidungskosten
■ Methode der vorbeugenden
■ Beziehung zwischen Belastung Ausgaben und Wirkung (dose respond method)
Hypothetischer Markt ■ Kontingenter Bewertungsansatz ■ Zuweisung voraussichtlicher (Zahlungsbereitschaft, Ausgaben und Einkommen Entschädigungsforderung)
■ Klassieren verschiedener Alternativen (contingent ranking method)
Quellen: Hoevenhagel (1991), Pillet (1993)
Die externen Effekte der Landwirtschaft wurden aufgrund von schweizerischen und ausländischen Studien quantifiziert
– Die mit Wertvorstellungen zusammenhängenden externen Nutzen wurden erfasst, indem Daten aus der Literatur auf die Schweizer Landwirtschaft übertragen wurden Dabei musste ein Nutzentransferprotokoll erstellt werden, um schweizspezifische Bedingungen zu berücksichtigen.
– Die externen Kosten wurden aufgrund der Verschmutzungs- und Wiederherstellungskosten ermittelt
Beispiele von verwendeten Werten für die Bewertung der externen Nutzen und Kosten der Landwirtschaft
Bereich Übernommener Wert Quellen
Nutzen
Landschaft 14 DM / Haushalt / Monat Zahlungsbereitschaft in Deutschland für Landschaftspflege
Erholung 7 ECU / Besuch / Jahr
Bodenschutz 25 Fr / ha / Jahr
Bewertung des Erholungswerts in Italien mit der Reisekostenmethode
Kosten in Fr zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
Artenvielfalt 35 Fr / Person / Monat Zahlungsbereitschaft für die Erhaltung der Artenvielfalt im Jura
Kosten Nitratbelastung 12 Fr / kg N
Kosten für die Ausrüstung von Abwasserreinigungsanlagen zur Denitrifikation
Phosphatbelastung 4 Fr / kg P Kosten der Chemikalien zur P-Ausfällung in Abwasserreinigungsanlagen
Quelle: Pillet, Maradan, Zingg
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 114
■ Nettonutzen beträgt
2 Mrd Fr
In der Studie wird angenommen, dass sich die Landwirtschaft bis zum Jahr 2008 kaum mehr negativ auf die natürlichen Lebensgrundlagen und das Klima auswirken wird Es handelt sich dabei nicht um eine Umweltbelastung von Null, sondern um eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Begrenzung der Umweltbelastung. Der Annahme, dass diese Situation bis 2008 eintritt, liegen die Entwicklungen zugrunde, die seit der Einführung der Umweltprogramme eingetreten sind (vgl Abschnitt 1 3 1)
Externe Effekte der schweizerischen Landwirtschaft 2008
Externe Kosten und Nutzen Nutzen Kosten Mio Fr Mio Fr
Gemeinwirtschaftliche Leistungen
1 120,5Kosten (Verschmutzung, Wiederherstellung)
Natürliche Lebensgrundlagen 910,3Klima, Gesundheit, Gefahren 36,6Nettonutzen
Gesellschaftliche Externalitäten
2 067,4 -
Quelle: Pillet, Maradan, Zingg
Gesellschaftliche Externalitäten sind eng mit sozialen Zielvorstellungen und Normen verbunden, die das kollektive Wertsystem der Gesellschaft widerspiegeln. Sie gehen über die wirtschaftliche Definition von externen Effekten hinaus und zeigen den positiven oder negativen Beitrag der Landwirtschaft zur Realisierung der Ziele und Normen auf (z B Beitrag zur Erhaltung der Traditionen, zur Versorgungssicherheit)
Beispiele gesellschaftlicher Externalitäten
Auswirkung der Landwirtschaft auf Bezeichnung
Gesellschaftsstrukturen
Raumstrukturen
Dorferhaltung
Brauchtum, lokale Traditionen
Dezentrale Besiedlung
Gleichgewicht Stadt - Land
Gesellschaftliche Wertvorstellungen Beitrag zur Versorgungssicherheit
Bewahrung des traditionellen Know-how

Quelle: Pillet Maradan Zingg
Gesellschaftliche Wertsysteme offenbaren sich in sozialen Normen. Es stellt sich also die Frage, ob die Landwirtschaft die ihr aufgetragenen Rollen und Funktionen tatsächlich wahrnimmt, das heisst ob sie z B wirklich einen Beitrag an eine dezentralisierte Besiedlung leistet. Folglich lassen sich die gesellschaftlichen Externalitäten ermitteln, indem ein Bezug zwischen der Entwicklung der Landwirtschaft und der Erfüllung entsprechender gesellschaftlicher Normen hergestellt wird
Die Landwirtschaft trägt in Bezug auf die gesellschaftlichen und räumlichen Strukturen zur Zielerreichung bei; ihr Beitrag schwächt sich tendenziell ab. Der Beitrag zum Wertsystem ist positiv
1 . 3 Ö K O L O G I E 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 115
Die Emternalitäten können als Gegenstück zu den Externalitäten betrachtet werden. Sie bezeichnen den Beitrag der Umwelt zur Produktionstätigkeit Die Vorsilbe «Em» zeigt an, dass es sich um einen Input handelt Die Bewertung der Emternalitäten im landwirtschaftlichen Bereich ist wichtig, denn einerseits leistet die Umwelt einen beträchtlichen Beitrag an die Herstellung von Landwirtschaftsprodukten, anderseits üben die landwirtschaftlichen Aktivitäten einen Druck auf die Umwelt aus Die Emternalitäten wurden physikalisch in Energieeinheiten gemessen und auch international verglichen
Input in die Landwirtschaft
Umweltinput Marktinput
erneuerbar nicht erneuerbar
Sonne, Regen, Bodenverluste Elektrizität, Schmiermittel, Diesel, Benzin, Erdzyklus, … Arbeit, Dünger, Pestizide, Maschinen, Saatgut, industrielle Futtermittel, Raufutter,
Quelle: Pillet, Maradan, Zingg
Um die Emternalitäten zu bewerten, wurde der in die Landwirtschaft einfliessende Input in erneuerbare und nicht erneuerbare Umweltelemente einerseits und marktbezogene Elemente andererseits eingeteilt
Die Analyse ergibt, dass in der Schweizer Landwirtschaft die nicht erneuerbaren Inputs nur eine untergeordnete Rolle spielen Diese sind eher negativ zu beurteilen, denn ihr Verbrauch hat unerwünschte Auswirkungen auf die Umwelt Das Verhältnis zwischen Umweltinputs und Marktinputs ist 1 : 4 Dies bedeutet, dass die Landwirtschaft 20% der Inputs von der Umwelt in Form z.B. der Sonneneinstrahlung oder des Regens bezieht Die schweizerische Landwirtschaft schneidet im internationalen Vergleich gut ab Sie verbraucht mehr erneuerbare als nicht erneuerbare Emternalitäten
116 1 . 3 Ö K O L O G I E 1
■ Emternalitäten der Schweizer Landwirtschaft
1.4 Beurteilung der Nachhaltigkeit
Im ersten Agrarbericht wurde ein Schwerpunkt gesetzt bei der Festlegung von Indikatoren für die drei Dimensionen Ökonomie, Soziales und Ökologie Damit wird eine Grundlage geschaffen, um die weitere Entwicklung der Auswirkungen der Agrarpolitik beobachten zu können Die Indikatoren werden in den nächsten Jahren, insbesondere in den Bereichen Soziales und Ökologie, ergänzt und weiterentwickelt Daneben werden Arbeiten weiter verfolgt, die es erlauben sollen, die Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit mit einem einfachen Konzept beurteilen zu können Die Beurteilung der Nachhaltigkeit wird nachfolgend mit Aussagen qualitativer Art vorgenommen.
■ Ökonomie Die wirtschaftliche Lage ist insgesamt als stabil zu beurteilen Die Einführung der Agrarpolitik 2002 hat zu keinen Turbulenzen auf den Märkten geführt. Der Übergang beim Milchmarkt verlief geordnet und der Milchpreis übertraf 1999 den vom Bundesrat festgelegten Zielpreis von 77 Rp pro kg Milch In der Verarbeitungsbranche ist ein Restrukturierungs- und Anpassungsprozess in Gang gesetzt worden
Die einzelbetrieblichen Einkommen 1999 sind praktisch gleich hoch wie der Durchschnitt der Jahre 1996/98 Die tiefen Werte für 1999 auf Sektorebene (Endproduktion, Sektoreinkommen) sind einerseits auf das witterungsbedingt schlechte Pflanzenbaujahr zurückzuführen, anderseits ist die Endproduktion als Folge der tieferen Preise seit Beginn der Agrarreform tendenziell rückläufig
Nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe sind in der Lage unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein mit der übrigen Bevölkerung vergleichbares Einkommen zu erzielen.
■ Soziales Für die Beurteilung der sozialen Situation der Landwirtschaft sind noch wenig Grundlagen vorhanden. Die soziale Situation der Landwirtschaft wurde bisher auch kaum systematisch untersucht Eine durch das BLW eingesetzte Arbeitsrguppe trug Informationen über die soziale Sicherheit und die Nutzung sozialer Dienste in der Landwirtschaft zusammen Der entsprechende Bericht wurde im Juni 2000 veröffentlicht Die ETH Zürich erarbeitet im Auftrag des BLW ein Konzept, um die soziale Situation mit geeigneten Indikatoren verfolgen zu können Dazu liegt ein erster Zwischenbericht vor
Der erste Agrarbericht zeigt auf, dass die landwirtschaftliche Bevölkerung die Sozialdienste im Vergleich zur übrigen Bevölkerung wenig in Anspruch nimmt Neben den Hemmnissen für die Inanspruchnahme sozialer Unterstützung und den Besonderheiten im bäuerlichen Betrieb dürften dafür auch die staatlichen Rahmenbedingungen verantwortlich sein Der Strukturwandel wickelt sich nach wie vor weitgehend im Rahmen des Generationenwechsels ab
Die Einkommens- und Verschuldungssituation ist in den letzten Jahren im Durchschnitt aller Betriebe stabil geblieben. Das Einkommensniveau ist im Durchschnitt allerdings um einiges tiefer als dasjenige der übrigen Bevölkerung Es gibt ausserdem erhebliche Unterschiede zwischen den Betrieben mit den besten und den schlechtesten wirtschaftlichen Ergebnissen.
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 1 B E D E U T U N G U N D L A G E D E R L A N D W I R T S C H A F T 117 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Ökologie Die Anreizstrategie mit den Direktzahlungen und die Anstrengungen im Bereich Bildung, Forschung und Beratung zeigen Wirkung Die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft haben zugenommen und der Einsatz umweltbelastender Stoffe ist zurückgegangen. Es gibt heute aber noch zu wenig gesicherte Grundlagen, wie sich diese positive Entwicklungen auf die Boden- oder Wasserqualität, auf das Tierwohl oder die Artenvielfalt auswirken Einerseits sind die Zusammenhänge im ökologischen Bereich komplex, Ursache und Wirkung können nicht immer eindeutig identifiziert werden, anderseits sind positive Auswirkungen oft erst nach Jahren zu beobachten
Umweltprobleme, die einen Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion haben, treten oft regional oder lokal unterschiedlich auf Ein Beispiel dafür ist die Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Landwirtschaft, welche vor allem in Einzugsgebieten von Wasserfassungen anzutreffen ist Entsprechend wurde diese Problematik mit einem regionalen Ansatz angegangen Ähnliches gilt für die Vernetzung und die Qualität von Ökoausgleichsflächen. Werden lokale oder regionale Probleme auf gesamtschweizerischer Ebene zu lösen versucht, nimmt die Regelungsdichte automatisch zu Diese hat bereits heute eine kritische Schwelle erreicht
■ Gesamtbeurteilung Die Einführung der Agrarpolitik 2002 hat im Berichtsjahr keine nennenswerten Probleme verursacht. Die Schätzungen für das Jahr 2000 deuten auf ein gutes Landwirtschaftsjahr hin Für die Zukunft zeigt sich aber immer mehr ein Zielkonflikt zwischen der Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen und der Notwendigkeit zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, damit die Landwirtschaft ihre Marktanteile bzw ihre produktive Funktion aufrecht erhalten kann Das bilaterale Agrarabkommen mit der EU eröffnet Chancen für den Absatz von Schweizer Agrarprodukten Um diese wahrzunehmen, müssen sie im Wettbewerb mit den europäischen Produkten bestehen können Dabei spielt auch der Preis eine wichtige Rolle Die Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit ist auch für qualitativ hochstehende Produkte Voraussetzung, um in einem offeneren Markt bestehen zu können
Der Möglichkeit, tiefere Preise mit Direktzahlungen zu kompensieren, sind Grenzen gesetzt Zum einen sind die finanziellen Mittel dafür nicht unbeschränkt vorhanden, zum andern sollte ein sinnvolles Mass nicht überschritten werden Die Höhe der heutigen Direktzahlungen dürfte ungefähr dem positiven Nutzen entsprechen, den die Landwirtschaft für die Gesellschaft erbringt und für den es keine Abgeltung über den Markt gibt Zusätzlich ist zu erwarten, dass der Vergleichslohn in den nächsten Jahren stärker ansteigt als in den letzten Jahren Die landwirtschaftlichen Betriebe müssen sich anpassen, wenn sie mit der allgemeinen Einkommensentwicklung Schritt halten wollen. Es dürfte vermehrt Betriebe geben, die in der Landwirtschaft keine Entwicklungsperspektiven mehr sehen Der Anpassungsdruck wird in der Landwirtschaft in den nächsten Jahren weiterhin gross sein Auf der einen Seite sind die agrarpolitischen Massnahmen so zu gestalten, damit entwicklungsfähige und -willige Betriebe die Chance haben, auf dem Markt bestehen zu können Auf der anderen Seite müssen begleitende Sozialmassnahmen geprüft werden, damit der Anpassungsprozess sozialverträglich ablaufen kann und Betrieben, die keine Zukunft sehen in der Landwirtschaft Alternativen angeboten werden können Schliesslich sind die Ökomassnahmen zu konsolidieren.
1 . 4 B E U R T E I L U N G D E R N A C H H A L T I G K E I T 1 118

■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. Agrarpolitische Massnahmen 119 2
Das Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998 enthält die Regelungen zur Umsetzung von Artikel 104 der Bundesverfassung aus dem Jahr 1996 Mit dem neuen Gesetz und den entsprechenden Verordnungen wurde die Reform der Agrarpolitik, bekannt unter dem Begriff Agrarpolitik 2002, am 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt. Die staatliche Regelungsdichte ist mit der Agrarpolitik 2002 deutlich zurückgegangen Die Anzahl der Gesetzesartikel hat sich mehr als halbiert Im Marktbereich sind viele Detailregelungen weggefallen, so insbesondere die direkten staatlichen Markteingriffe mit Preis- und Absatzgarantien Aufgelöst wurden ebenfalls die parastaatlichen Organisationen Käseunion und Butyra
Der Bundesrat hat im Dezember 1998 37 neue Verordnungen für den Vollzug des Agrarrechts verabschiedet. Gleichzeitig konnten 99 Erlasse des alten Rechts aufgehoben werden Die Regelungsdichte hat auch auf dieser Ebene stark abgenommen
Die neue Gesetzgebung hat ausserdem im Bereich von Verfahren und Bewilligungen erhebliche Erleichterungen gebracht. Insbesondere im Marktbereich sind viele Aufgaben an die Direktbetroffenen delegiert worden
Die agrarpolitischen Massnahmen werden in drei Bereiche eingeteilt:
– Produktion und Absatz: Bei den Massnahmen in diesem Bereich geht es um die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Produktion und den Absatz von Nahrungsmitteln Das Gesetz gibt vor, dass die Aufwendungen des Bundes für Produktion und Absatz innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten gegenüber den Ausgaben 1998 um einen Drittel abgebaut werden müssen Im Jahr 2003 können für diese Massnahmen noch rund 800 Mio Fr eingesetzt werden
– Direktzahlungen: Diese Zahlungen gelten Leistungen zugunsten der Gesellschaft wie die Landschaftspflege, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und den Beitrag zur dezentralen Besiedlung sowie besondere ökologische Leistungen ab Die Preise für die Nahrungsmittel enthalten diese Leistungen nicht, weil dafür kein Markt besteht. Mit den Direktzahlungen stellt der Staat sicher, dass die Leistungen zugunsten der Allgemeinheit von der Landwirtschaft erbracht werden
Grundlagenverbesserung: Mit diesen Massnahmen fördert und unterstützt der Bund eine umweltgerechte, sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion Im einzelnen sind es Massnahmen zur Strukturverbesserung, im Bereich Forschung und Beratung sowie bei den landwirtschaftlichen Hilfsstoffen und im Pflanzen- und Sortenschutz
Das Parlament hat im Juni des Berichtsjahrs einem Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2000 bis 2003 zugestimmt Verabschiedet wurden drei Zahlungsrahmen für die obgenannten agrarpolitischen Massnahmenbereiche Darin sind rund 85% der Ausgaben zugunsten von Landwirtschaft und Ernährung enthalten Pro Jahr stehen aus diesen Zahlungsrahmen rund
3,5 Mrd Fr zur Verfügung Die Ausgaben des Bundes zugunsten der Landwirtschaft stabilisieren sich damit auf dem Niveau von 1996/97
120 2 . A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2
–
2.1 Produktion und Absatz
Die Massnahmen im Bereich Produktion und Absatz schaffen Rahmenbedingungen, die es der schweizerischen Landwirtschaft ermöglichen, ihre Marktanteile unter härteren Konkurrenzverhältnissen zu halten Die finanziellen Mittel zur Förderung von Produktion und Absatz tragen dazu bei, dass die Landwirtschaft aus dem Verkauf der Produkte einen möglichst hohen Markterlös erzielen kann Die Massnahmen unterstützen die produktive Funktion der Landwirtschaft, wobei das Subsidiaritätsprinzip eine tragende Rolle spielt Selbsthilfemassnahmen der Branche stehen bei Problemlösungen im Vordergrund Der Bund beschränkt seine direkten Eingriffe in das Marktgeschehen auf ein Minimum. Innovation und Unternehmertum werden dadurch gefördert, was für die Erhaltung der Marktanteile entscheidend ist

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 121 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
■ Finanzielle Mittel 1999 Im Jahr 1999 wurden zur Förderung von Produktion und Absatz rund 1,3 Mrd. Fr. aufgewendet Die im Vergleich zum Vorjahr um 5,8% höheren Ausgaben sind hauptsächlich auf einmalige zusätzliche Aufwendungen für die Liquidation der halbstaatlichen Organisationen Schweizerische Käseunion AG und Butyra zurückzuführen.
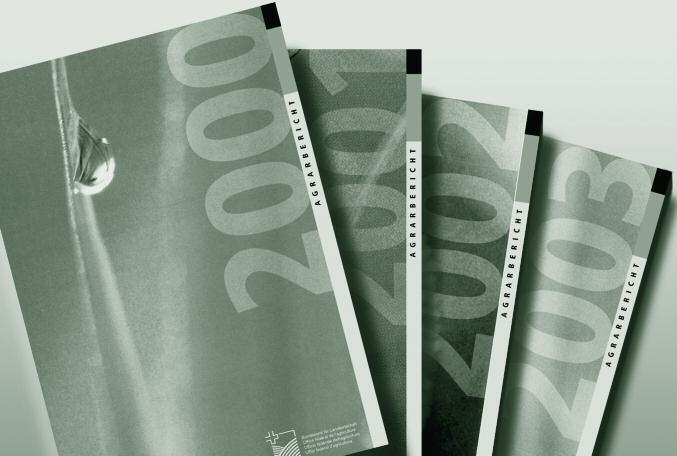
Ausgaben für Produktion und Absatz 1999
■ Ausblick In den Übergangsbestimmungen des LwG ist eine Abbauverpflichtung betreffend Ausgaben im Bereich Produktion und Absatz festgelegt Die Summe der Bundesbeiträge für die in Artikel 187 Absatz 12 aufgeführten Bereiche ist in den fünf Jahren nach Inkrafttreten des LwG um einen Drittel gegenüber den Ausgaben für das Jahr 1998 (Basis) abzubauen In der Zeitspanne 1999 bis 2003 ist die Marktstützung auf rund 800 Mio. Fr. zu reduzieren. Im Bereich Absatzförderung sollen die Mittel in den kommenden Jahren auf einem konstanten Niveau gehalten werden, weil dieses Instrument in einem liberaleren Marktumfeld einen wichtigen Stellenwert einnimmt
Die Zeitspanne ist zu kurz, um abschliessende Aussagen über die Wirksamkeit der agrarpolitischen Massnahmen im Bereich Produktion und Absatz machen zu können. Im LwG (Artikel 187 Absatz 13) ist festgelegt, dass fünf Jahre nach Inkraftsetzung des Gesetzes die Auswirkungen der agrarpolitischen Massnahmen in verschiedenen Bereichen zu überprüfen sind. In diese Evaluation werden auch die Instrumente zur Marktstützung einbezogen Das BLW hat die entsprechenden Arbeiten aufgenommen Über die Ergebnisse und mögliche Konsequenzen wird jeweils im Agrarbericht informiert
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 122
Ausgabenbereich Betrag Anteil Mio Fr % Absatzförderung 50 3,8 Milchwirtschaft 1 052 79,8 Viehwirtschaft 33 2,5 Pflanzenbau (inkl Weinbau) 183 13,9 Total 1 318 100,0 Quelle: Staatsrechnung
■ Staat greift nicht direkt ins Marktgeschehen ein
2.1.1 Übergreifende Instrumente
Als übergreifende Instrumente werden agrarpolitische Massnahmen bezeichnet, mit denen der Bund über alle Produktionsbereiche hinweg zur Erreichung eines möglichst hohen Erlöses aus dem Produktverkauf beiträgt Die Regelungen betreffen die Selbsthilfe, die Qualität, die Absatzförderung, die Kennzeichnung von Produkten, den Import oder Export von Produkten, die Marktbeobachtung und die Marktentlastung
Der Staat greift bei diesen Massnahmen, mit Ausnahme der Marktentlastung, die grundsätzlich nur bei ausserordentlichen Ereignissen Anwendung findet, nicht direkt ins Marktgeschehen ein Es handelt sich somit um rechtliche Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die Akteure in eigener Initiative bewegen können Massnahmen in diesen Bereichen sind weitgehend Sache der direkt betroffenen Kreise. Der Selbsthilfe kommt ein hoher Stellenwert zu Der Staat handelt nur subsidiär
Produzenten- und Branchenorganisationen
Mit den Artikeln 8 und 9 des LwG hat der Bundesrat die Möglichkeit, Produzentenoder Branchenorganisationen in ihren Selbsthilfemassnahmen zu unterstützen So kann er brancheninterne Selbsthilfemassnahmen zur Förderung der Qualität und des Absatzes sowie zur Anpassung der Produktion und des Angebots an die Erfordernisse des Marktes allgemein verbindlich erklären Der staatliche Eingriff ist an verschiedene Bedingungen geknüpft Namentlich muss die Organisation repräsentativ und der Eingriff in das Marktgeschehen notwendig und verhältnismässig sein
In der Bildung von Branchenorganisationen war im Berichtsjahr eine hohe Dynamik zu verzeichnen Verschiedene Bestrebungen sind im Gange, um die Strukturen der Verbände zukunftsgerichtet umzubauen und gleichzeitig auf das agrarpolitische Instrumentarium im Bereich der Unterstützung von Selbsthilfemassnahmen auszurichten Im Berichtsjahr wurden keine Anträge zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Selbsthilfemassnahmen gestellt
■ Ausblick
Analog zu ausländischen Modellen können voraussichtlich ab 2001 breit abgestützte Beschlüsse von Produzenten- und Branchenorganisationen zur Finanzierung von Selbsthilfemassnahmen für eine bestimmte Zeitdauer allgemein verbindlich erklärt werden Damit werden potenzielle Trittbrettfahrer in die Mittelbeschaffung eingebunden Die entsprechende Änderung des LwG war Teil der flankierenden Massnahmen zu den bilateralen Verträgen mit der EU.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 123 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2
Absatzförderung
Die schrittweise Liberalisierung der Marktordnungen in Kombination mit der zunehmenden Marktöffnung erhöht die Bedeutung eines professionellen Marketings. Der Bund unterstützt Erfolg versprechende Massnahmen zur Absatzförderung Er übernimmt maximal 50% der anrechenbaren Ausgaben
Die staatlich unterstützten Massnahmen betreffen insbesondere die MarketingKommunikation (namentlich Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung, Marktforschung) im In- und Ausland Für die Projekte wird, mit der Absicht des gemeinsamen Auftritts gegenüber der ausländischen Konkurrenz, eine enge Koordination unter den Akteuren verlangt. In Abstimmung mit der Regionalpolitik des Bundes (insbesondere mit dem Bundesbeschluss «Regio Plus») werden auch regionale Absatzförderungsprojekte während höchstens vier Jahren gefördert Bei regionalen Projekten wird die Zusammenarbeit verschiedener Partner inner- oder ausserhalb der Landwirtschaft vorausgesetzt Damit soll das Potenzial einer Region besser ausgeschöpft werden
Im Jahr 1999 wurden zwei Neuheiten lanciert:
– Erstmals wurde der Prix d’innovation Agricole, ein Innovationspreis für die Schweizer Landwirtschaft vergeben. Bei diesem Preis, der mit einer Gewinnsumme von 100‘000 Fr dotiert ist und von der Agro-Marketing Suisse organisiert wird, werden Neuheiten aus der Land- und Ernährungswirtschaft ausgezeichnet Der Vorsteher des EVD hat das Patronat des Wettbewerbs übernommen.

– Ebenfalls zum ersten Mal präsentierte sich die Schweiz offiziell an der Grünen Woche Berlin, der grössten europäischen Konsumentenmesse der Land- und Ernährungswirtschaft Durchgeführt wurde der Auftritt durch die Agro-Marketing Suisse, mit Unterstützung des Bundes im Rahmen der Landwirtschaftlichen Absatzförderungsverordnung.
■ Finanzielle Mittel 1999 1999 war im Bereich der Absatzförderung ein Übergangsjahr. Die Verordnung sah aus Rücksicht auf laufende Massnahmen bisheriger Mittelempfänger wie z B für die Milch-, Fleisch- oder Obstproduzenten eine einjährige Übergangsregelung vor Im Berichtsjahr konnten aber auch neue Projekte unterstützt werden Damit wurde ein optimaler Übergang zum neuen Recht und die Kontinuität für bereits laufende Projekte sichergestellt
Im Berichtsjahr standen 45 Mio Fr für nationale Projekte im In- und Ausland zur Verfügung. 60% wurden an bereits laufende Projekte aufgrund der Übergangsbestimmungen und 40% an neue Finanzhilfeempfänger ausbezahlt Im Zusammenhang mit der Ablösung der alten Milchmarktordnung per 1 Mai 1999 standen für den Käse zusätzlich 14 Mio. Fr. zur Verfügung. Zudem beanspruchten die 16 unterstützten Regionalprojekte rund 50% der für 1999 budgetierten 5 Mio Fr
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 124
■ Zusicherungen für das Jahr 2000
Bereits 1999 wurden die für das Jahr 2000 eingereichten Projekte beurteilt. Die entsprechenden Beiträge hat das BLW per 30 September 1999 zugesichert Im Jahr 2000 werden auf überregionaler und nationaler Ebene sowie im Ausland insgesamt 61 Projekte von 31 Gesuchstellern unterstützt.
Mittelverteilung 2000 nach Produkt-Markt-Bereichen
Käse Ausland
Käse Inland
Milch Obst
Fleisch
Gemüse
Kartoffeln
Getreide
Eier Ölsaaten
Lebende Tiere
Quelle: BLW
Zur Verteilung der Mittel wurden Produkt-Markt-Bereiche gebildet und in einem Portfolio bewertet. Diese Portfolio-Analyse wurde vom BLW in Auftrag gegeben, um die Marktattraktivität und die Wettbewerbsstärke der einzelnen Landwirtschaftsprodukte zu bewerten Der grösste Anteil der Bundesmittel fliesst in den Sektor Milch und Milchprodukte
■ Ausblick Voraussetzung für eine Unterstützung im Bereich der Absatzförderung ist die Koordination der Massnahmen unter den Finanzhilfeempfängern
In mehreren Bereichen entwickelt sich die Zusammenarbeit positiv Die Produzenten treten im Inland vermehrt gemeinsam mit dem Absender «Produktionsland Schweiz» auf. Im Ausland ist es besonders die Switzerland Cheese Marketing AG, die im gemeinsamen Interesse der Schweizer Produzenten unter der gemeinsamen Botschaft «Käse aus der Schweiz» dominant auftritt Um in einem liberalisierten Markt bestehen zu können, ist die Zusammenarbeit in der Absatzförderung wichtig Nur so können die Instrumente des Marketings ihre optimale Wirkung entfalten
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 125
Mio. Fr. 051015202530
Honig Fische Gemeinsame Massnahmen
Tabelle 23 Seite A24 2
Kennzeichnung
Der Schutz bestimmter Bezeichnungen für Landwirtschaftsprodukte bezweckt, den Konsumenten wirksam vor Täuschung zu schützen und – im Interesse der Landwirtschaft – den unlauteren Wettbewerb in der Verwendung dieser Begriffe zu verhindern Der Schutz umfasst Bioprodukte sowie Erzeugnisse mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben Entsprechende Regelungen finden sich in der Bio-Verordnung und in der Verordnung über Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben Diese ermöglichen auch die gegenseitige Anerkennung von Qualitätsprodukten zwischen der Schweiz und der EU Damit wird der Zugang und der Schutz dieser Produkte auf dem europäischen Markt sichergestellt Vorerst ist dies nur für Bioprodukte gewährleistet.
Die Bio-Verordnung, die am 1. Januar 1998 in Kraft getreten ist, erweist sich als ein wirkungsvolles Instrument, um die Transparenz im Biomarkt zu verbessern Dies ist bedeutungsvoll, ist doch die biologische Anbaumethode in den letzten Jahren auch mit Hilfe der staatlichen Direktzahlungsprogramme aus der Nische herausgetreten 7,3% der LN wird heute nach biologischen Grundsätzen bewirtschaftet Bioprodukte haben sich am Markt, auch bei den Grossverteilern, fest etabliert. Mit der Bio-Verordnung wird bei importierten pflanzlichen Erzeugnissen die Gleichwertigkeit mit unserer Gesetzgebung sichergestellt Dies ist wichtig, weil nach wie vor ein ansehnlicher Anteil der konsumierten Bioprodukte aus dem Ausland stammt.
Die Bio-Verordnung hat nach Ablauf der meisten Übergangsfristen sowie einer sorgfältigen Einführung im Vollzug ihre binnenwirtschaftliche Wirkung entfaltet Bereits konnten verschiedene Missbräuche im Zusammenhang mit der Bezeichnung «Bio» erfolgreich bekämpft sowie die Transparenz bezüglich Mindestanforderungen und Kontrollen gegenüber der vorherigen, rein privatrechtlichen Regelung wirksam erhöht werden
Die Wirkung der Verordnung stösst jedoch auch an Grenzen: Bedingt durch die dominante Stellung des Markenzeichens «Knospe» auf dem schweizerischen Markt findet heute nur ein geringer Wettbewerb statt So ist nur eine einzige Stelle zur Ausstellung von Zertifikaten für die Knospe ermächtigt Die Bio-Verordnung sieht einen freien Wettbewerb unter den einzelnen Zertifizierungsstellen vor Die Erfahrung zeigt, dass Marktsegmente, in denen der Wettbewerb nicht oder zu wenig spielt, mittelfristig Anpassungsprobleme haben werden
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 126
■ Schutz von Bezeichnungen für Landwirtschaftsprodukte
■ Bio-Regeln schaffen Transparenz
■ Aufbau des Registers für GUB und GGA
Nachdem sich die Prozedur der Registrierung der Geschützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und der Geschützten Geographischen Angaben (GGA) Schritt für Schritt entwickelt hat, geht man davon aus, dass bis Ende 2000 alle hängigen Dossiers publiziert sind. Voll wirksam wird dieses agrarpolitische Instrument aber erst nach Eintragung der verschiedenen Bezeichnungen und der damit verbundenen Übergangsfristen, also erst in etwa drei bis fünf Jahren
Eine detaillierte Berichterstattung zum Bereich der GUB und GGA findet sich im Geschäftsbericht 1998 der Kommission für Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben
■ Leistungsförderer in der Fleischproduktion sowie Eier aus Käfighaltung deklarieren
Artikel 18 des LwG beauftragt den Bundesrat, für Erzeugnisse, die nach Methoden produziert werden, die in der Schweiz verboten sind, Vorschriften über die Deklaration zu erlassen und die Zölle zu erhöhen. Dabei dürfen die internationalen Verpflichtungen nicht verletzt werden
Der Bundesrat hat am 3 November 1999 die Deklarationsverordnung erlassen Zu deklarieren sind Produkte, bei denen in der Produktion Hormone und/oder antimikrobielle Stoffe zur Leistungsförderung verwendet werden sowie Konsumeier aus Käfighaltung Diese Produktionsmethoden sind in der Schweiz verboten Es müssen nur Frischfleisch und Konsumeier sowie deren Zubereitungen deklariert werden Auf die sofortige Unterstellung weiterer Produkte wurde aus Gründen der Vollzugseffizienz verzichtet Eine Erhöhung der Einfuhrzölle war nicht möglich, da eine Differenzierung gestützt auf unterschiedliche Produktionsmethoden gegen die eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen der WTO und gegen die von der Schweiz abgeschlossenen Freihandelsverträge verstösst
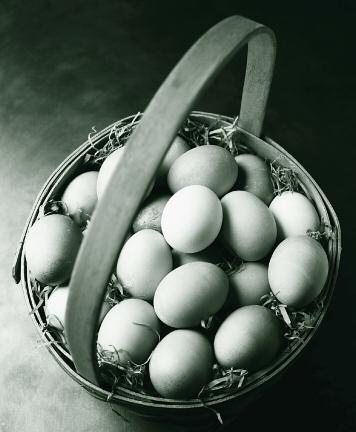
Der landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung wurde das Konzept der Lebensmittelgesetzgebung zugrunde gelegt Danach müssen die Verkäuferinnen und Verkäufer die verbotene Produktionsmethode am Endverkaufspunkt deklarieren. Dies gilt sowohl für den Detailhandel wie auch für die Verpflegungsstätten Der Vollzug liegt bei den Kantonen In der Regel sind die Lebensmittelinspektoren dafür zuständig
Die landwirtschaftliche Deklarationsverordnung ist am 1 Januar 2000 in Kraft getreten Im Internet publizierte Merkblätter geben den betroffenen Kreisen konkrete Tipps für eine praxisgerechte Umsetzung Das BLW publiziert ausserdem eine Liste, in der diejenigen Länder aufgeführt sind, die gleichwertige Verbote wie die Schweiz verordnet haben.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 127
2
■ Ausblick Die EU hat die schweizerische Bio-Verordnung als gleichwertig mit ihrer Verordnung anerkannt Die Schweiz ist auf der Drittlandliste der EU vermerkt, das heisst, dass zertifizierte Produkte aus der Schweiz grundsätzlich ungehindert in der EU vermarktet werden können. Diese Regelung gilt vorerst nur für die pflanzlichen Produkte.
Der Einbezug der Nutztierhaltung in den Geltungsbereich der Bio-Verordnung ist in Ausarbeitung Die revidierte Verordnung soll 2001 in Kraft treten Die Landwirtschaftsminister der EU verabschiedeten im Juni 1999 die seit langem erwartete europäische Tierhaltungsregelung für den Biolandbau, welche als Grundlage für die schweizerische Regelung dienen soll Basierend auf dem bilateralen Agrarabkommen mit der EU soll auch für die Erzeugnisse der biologischen Nutztierhaltung ein Gleichwertigkeitsabkommen erreicht werden, was z.B. für Schweizer Bio-Käse den Zugang zum europäischen Markt sicherstellen wird
Beim Vollzug sind ebenfalls Anpassungen vorgesehen. Die vom BLW durchgeführte Überprüfung der Gleichwertigkeit von importierten Produkten wird von der Branche als aufwändig empfunden Andererseits verlangt auch die Kontrolle der Dokumente durch das BLW einigen Aufwand Eine Überprüfung des Verfahrens mit dem Ziel einer Vereinfachung, jedoch unter Sicherstellung der staatlichen Aufgaben, drängt sich mittelfristig auf.
Unser Ziel ist die Realisierung eines eurokompatiblen Systems zum Schutz der GUB und der GGA. Die EU hat 600 geographische Angaben registriert. Gemessen an Unterschieden und der Grösse unseres Landes ist mit der Registrierung von ungefähr 40 GUB und GGA zu rechnen Die bilateralen Verträge enthalten eine Absichtserklärung, nach welcher die Register gegenseitig anerkannt werden
Instrumente des Aussenhandels
■ Einfuhrregelungen unterstützen produktive Landwirtschaft
Im Rahmen der Uruguay-Runde des GATT/WTO sind durch die sogenannte Tarifizierung alle nichttarifären Handelshemmnisse von den Mitgliedstaaten in Zölle umgewandelt worden Die Einfuhrregelungen sind wichtige Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieser aussenhandelspolitischen Verpflichtungen und für die inländische Nahrungsmittelproduktion
Zur Steuerung der Einfuhren sind nur tarifarische Massnahmen, das heisst Zölle auf den Importprodukten erlaubt Möglich ist es, die Einfuhrmengen aufzuteilen in einen Teil mit höheren Zollansätzen und einen Teil mit tieferen Ansätzen, innerhalb der sogenannten Zollkontingente Dieses Vorgehen erlaubt Einfuhren zu Preisen, die teilweise nur sehr wenig vom ausländischen Preisniveau abweichen Entsprechend begehrt sind Anteile an diesen Importmengen. Zollkontingente gibt es vor allem bei Fleisch, Milchprodukten, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Brotgetreide, Schnittblumen und Wein
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 128
Die Verteilung der Kontingentsmengen erfolgt mittels Versteigerung, aufgrund der Zukäufe inländischer Erzeugnisse, nach Massgabe der bisherigen Importtätigkeiten oder nach der Reihenfolge des Eingangs der Zuteilungsgesuche bei der Bewilligungsstelle. Die freigegebenen Mengen und die effektiv erfolgten Einfuhren zum Kontingentszollansatz sind aus dem jährlich erscheinenden Bericht des Bundesrates über die zolltarifarischen Massnahmen ersichtlich Die Ausnützung der Zollkontingentsanteile war bisher je nach Erzeugnissen unterschiedlich

Bei anderen Produkten wird die Einfuhr allein über Zölle gesteuert Bei der Festsetzung der Zölle werden die Versorgungslage im Inland und die Absatzmöglichkeiten für gleichartige Produkte berücksichtigt sowie den gesamtwirtschaftlichen Interessen Rechnung getragen. Bei den Futtermitteln werden die Zollansätze mit dem System der Schwellenpreise periodisch an die Entwicklung der Preise franko Schweizergrenze angepasst
Der Grenzschutz beinhaltet neben dem quantitativen auch einen qualitativen Aspekt, indem er zu gewährleisten hat, dass die Einfuhren gesundheitlich unbedenklich sind (Sicherheit der Nahrungsmittel)
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 129
Apr 98 Jul 98 Okt 98 Jan 99 Apr 99 Jul 99 Okt 99 Apr 00 F r / d t Quelle: BLW 0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Grenzabgaben Bandbreite Schwellenpreis Importpreis verzollt Preis franko Schweizergrenze 2
Schwellenpreissystem am Beispiel der Gerste
■ WTO-Sonderschutzklausel: erstmalige Anwendung bei Schweinefleisch
Eine Einfuhrregelung, die allein auf unterschiedlichen Zollansätzen beruht, kann zu unverhältnismässigen Auswirkungen auf dem Inlandmarkt führen In diesen Fällen sieht das WTO-Agrarabkommen eine spezielle Schutzklausel für Agrarprodukte vor Danach können Zollansätze auf landwirtschaftlichen Produkten vorübergehend und in einem genau definierten, beschränkten Ausmass erhöht werden, falls die Importpreise stark sinken (preisliche Schutzklausel) oder die Einfuhrmengen übermässig ansteigen (mengenmässige Schutzklausel) Der Sonderschutzklausel kam im Rahmen der Verhandlungen der Uruguay-Runde eine wesentliche Bedeutung als Sicherheitsinstrument gegen unerwartete Auswirkungen der Tarifizierung zu

Durch das Zusammentreffen verschiedener Faktoren (z B Asien- und Russlandkrisen; beträchtliche Ausdehnung der Schweineproduktion sowohl in der EU wie in den USA) sanken die Preise für Schlachthälften z B in Deutschland zeitweilig auf Tiefstwerte von umgerechnet rund Fr 1 – pro kg SG Die Preisdifferenzen zum Ausland führten zu hohen Einfuhren von Schweinefleisch ausserhalb des Zollkontingentes. Die Produzenten beantragten die Anrufung der WTO-Sonderschutzklausel, da sie einen negativen Einfluss auf die inländische Produktion befürchteten
Gestützt auf die Entwicklung der Preise franko Schweizergrenze für Schweinefleisch wurde im Mai des Berichtsjahres auf dem Dringlichkeitsweg die erstmalige Anrufung der preislichen WTO-Sonderschutzklausel durch die Schweiz für insgesamt sieben Tarifpositionen von Schweinefleisch verordnet (Verordnung über die Anwendung der WTO-Sonderschutzklausel im Bereich Schweinefleisch vom 30. April 1999). Diese Verordnung war gültig bis Ende 1999
In der achtmonatigen Periode wurden über die relevanten Zollpositionen zum Ausserkontingentszollansatz (AKZA) insgesamt 3‘682 t Schweinefleisch mit einem Warenwert von rund 25 Mio. Fr. importiert. Davon wurden 1'002 t mit einem Warenwert von ungefähr 4 Mio Fr mit einem Zollzuschlag von total 0,38 Mio Fr belastet
Ergebnisse der Anwendung der Sonderschutzklausel bei Schweinefleisch
Einfuhren Waren- Zoll- Zoll- Verteuewert abgaben Zuschlag rung t Mio Fr Mio Fr Mio Fr %
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 130
Verzollungsart
Ohne Sonderschutzklausel-Zuschlag 2 680 21 12,25 Mit Sonderschutzklausel-Zuschlag 1 002 4 4,45 0,38 4,5 Total 3 682 25 16,70 0,38 0,9 Quelle:
OZD
■ Ein- und Ausfuhren von Verarbeitungsprodukten (Schoggigesetz)
Eine Bremswirkung der Massnahme auf die Importe zum AKZA – infolge der Verteuerung durch die Zollzuschläge – ist anzunehmen, indes nicht abschliessend quantifizierbar Die Erfahrungen mit der ersten Anwendung der WTO-Sonderschutzklausel beim Schweinefleisch zeigen unter anderem, dass die zeitgerechte Anwendung Voraussetzung für die bestmögliche Wirkung ist Der zukünftige Einsatz wird deshalb überprüft, einschliesslich der Möglichkeit einer systematischen Anwendung für sensible Produkte Im Hinblick auf die nächste WTO-Verhandlungsrunde sind die Erfahrungen mit der Sonderschutzklausel wertvoll
Mit den Ausfuhrbeiträgen für Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten wird die Differenz zwischen in- und ausländischen Rohstoffpreisen ausgeglichen und das Ziel verfolgt, möglichst viele inländische landwirtschaftliche Rohstoffe in Verarbeitungsprodukten auszuführen
Der bewegliche Teilbetrag ergibt zusammen mit dem Zoll (Industrieschutzelement) die Grenzbelastung Mit dem beweglichen Teilbetrag wird die Differenz zwischen den inund ausländischen Rohstoffpreisen ausgeglichen Damit werden auf dem Schweizer Markt für in- und ausländische Produkte preislich vergleichbare Wettbewerbsverhältnisse geschaffen
Verarbeitungsprodukte aus landwirtschaftlichen Grundstoffen: Schoggigesetz
Mechanismus Ausfuhr Einfuhr
Inlandpreis
Ausfuhrbeitrag
auf verarbeitetem landwirtschaftlichem Erzeugnis
Beweglicher Teilbetrag
auf verarbeitetem landwirtschaftlichem Erzeugnis
Weltmarktpreis
(Mehl in Form von Biskuits)
(Mehl in Form von Biskuits)
Das Schoggigesetz gleicht die Rohstoffkostendifferenz Inland-Weltmarkt, nicht aber die Produktionskostendifferenz aus.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 131
2
Im WTO-Abkommen von 1994 hat sich die Schweiz zu einem Abbau der Ausfuhrbeiträge für Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten um 36% innerhalb von sechs Jahren ab 1995 verpflichtet (von 179,6 Mio Fr in den Basisjahren 1991/92 auf 114,9 Mio. Fr. ab dem Jahr 2000). Wenn bei steigenden Ausfuhren die finanziellen Mittel nicht mehr ausreichen, um die Kostendifferenz auf den verarbeiteten landwirtschaftlichen Rohstoffen auszugleichen, kann nur mit «anderen geeigneten Massnahmen» (z B Selbsthilfemassnahmen der Produzenten) eine Ausdehnung des Veredlungsverkehrs vermieden werden Veredlungsverkehr bedeutet, dass die Rohstoffe ohne Zollbelastung eingeführt, in der Schweiz verarbeitet und in konsumfertigen Produkten wieder ausgeführt werden (z B ausländischer Zucker wird zollfrei eingeführt und in schweizerischer Schokolade wieder exportiert) Eine Zunahme des Veredlungsverkehrs hat für die einheimische Landwirtschaft einen Verlust von Marktanteilen zur Folge, sofern nicht ohnehin Importe getätigt werden
Die Nahrungsmittelindustrie hat 1999 im asiatischen Raum einen beträchtlichen Rückgang der Exporte (vor allem Schokolade) erlitten In den übrigen Märkten, insbesondere im EU-Raum, sind die Umsatzzahlen weiter angestiegen
■ Ausblick Die verschiedenen Importregime werden kurzfristig keine grundlegenden Änderungen erfahren Änderungen können z B aufgrund von Ergebnissen der nächsten WTO-Verhandlungsrunde notwendig werden Anpassungen, z B bei den Kriterien zur Verteilung der Zollkontingente, können aber auch aus internen Gründen erforderlich sein.

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 132
Ausfuhrmengen / Ausfuhrbeiträge Ausfuhrmengen t Ausfuhrbeiträge Mio. Fr. Quelle: BLW 180 128 137 130 92 000 78 000 85 000 84 000 1991/921997199819991991/92199719981999
Marktbeobachtung
Der Bundesrat kann nach Artikel 27 des LwG Waren, die durch agrarpolitische Massnahmen beeinflusst werden, einer Preisbeobachtung unterstellen. Dabei können alle Marktstufen, von der Produktion bis zum Verbrauch, einbezogen werden
Wichtigstes Ziel der Preisbeobachtung ist es, die Markttransparenz zu verbessern Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob tiefere Produzentenpreise auch effektiv an die Konsumenten weitergegeben werden Daneben soll die Preisbeobachtung Informationen für die Evaluation der agrarpolitischen Massnahmen liefern
Im BLW nimmt die Sektion Marktbeobachtung diese Tätigkeit wahr. Sie hat folgende Aufgaben:
– Erfassung des Preisniveaus landwirtschaftlicher Erzeugnisse und deren Verarbeitungsprodukte;
– Förderung der Transparenz in der Preisbildung mittels Information der Öffentlichkeit Folgende landwirtschaftliche Produkte können der Marktbeobachtung unterstellt werden:
– Milch- und Milchprodukte;
– Fleisch sowie Fleisch- und Wurstwaren;
– Eier und Geflügel;
– Ackerbauprodukte und deren Verarbeitungserzeugnisse;
– Früchte und Gemüse sowie deren Verarbeitungserzeugnisse
Um den Vollzug sicherzustellen, können Verarbeitungs- und Handelsunternehmen sowie öffentliche Verwaltungsstellen zur Erhebung und Lieferung von Daten verpflichtet werden. Die Sektion Marktbeobachtung veröffentlicht kommentierte monatliche Berichte über die Märkte Milch, Fleisch, Früchte und Gemüse Ausserdem erstellt sie im Sommer wöchentliche und im Winter vierzehntägliche Übersichten über die Marktpreise der interessantesten Produkte auf den wichtigsten Wochenmärkten. Die Ermittlung der Marktspannen für Fleisch, Milch und Milchprodukte erlaubt zudem, die Auswirkungen der Agrarpolitik laufend zu verfolgen Zu diesem Zweck wird seit dem 1 Mai 1999 auch der von den Produzenten erzielte Milchpreis erhoben
■ Ausblick Im Jahr 2000 wird neu eine Marktspanne der wichtigsten Früchte und Gemüse veröffentlicht und der Milchbericht mit Daten der Treuhandstelle Milch (TSM) zu einem monatlichen Bulletin über die Marktlage erweitert. Zudem werden die Grundlagen für die Berechnung einer Eierspanne erarbeitet, insbesondere werden die Produzentenund Konsumentenpreise der wichtigsten Eierkategorien erhoben Ausserdem wird die Ermittlung der Fleischspanne im Hinblick auf einen Neustart per Anfang 2001 methodisch angepasst
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 133
2
■ Kontrolltätigkeit im Berichtsjahr
Kontrollen und Untersuchungen
Die Kontrolle der Massnahmen im Bereich von Produktion und Absatz obliegt einer speziellen Einheit des BLW, dem Inspektorat. Das Inspektorat übt keine Vollzugsaufgaben aus Es führt einerseits Kontrollen und Revisionen durch, anderseits Ermittlungen in Strafverfahren Die Kontrolltätigkeit umfasst neben den produktebezogenen Massnahmen ebenfalls die Bereiche Futter- und Pflanzenschutzmittel
Das Inspektorat führte im Berichtsjahr 1'113 Kontrollen und Revisionen durch Dabei mussten im Milchbereich Beihilfen von rund 1,5 Mio Fr beanstandet und zurückverlangt werden. Auf der anderen Seite gab es Betriebe, die per Gesuch zu wenig Beihilfen verlangt hatten Diesen wurde gegen 300'000 Fr nachgezahlt Die Beanstandungen und Nachzahlungen lassen sich überwiegend erklären durch gewisse Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Milchmarktordnung.
Die Schwerpunkte der Arbeiten im Berichtsjahr waren:
Von Mai bis Oktober wurde das Hauptgewicht der Tätigkeit im Aussendienst auf Kontrollen in den Bereichen Butter, Gemüse, Obst, Schnittblumen, Eier, Fleisch und Pferde gelegt. Das ganze Jahr hindurch fanden ebenfalls regelmässige Kontrollen in den Bereichen Milchersatzfuttermittel, Vollmilchpulver und Milchkondensat statt
– In den letzten drei Monaten des Jahres war das Inspektorat insbesondere im Getreide-, Kartoffel- und Käsebereich (Produktion und Verarbeitung) tätig sowie bei der Revision der Zuckerfabrik Aarberg/Frauenfeld beteiligt
– Das Inspektorat war einbezogen in Überprüfungen im Zusammenhang mit dioxinhaltigen Futtermitteln Es hatte die Aufsicht über den Rückzug von 108 t dieser Futtermittel bei 60 Landwirten Diese Futtermittel wurden anschliessend einer fachund umweltgerechten Entsorgung zugeführt.
– Bei den Pflanzenschutzmitteln wurde der Vertrieb untersucht Im Berichtsjahr speziell war die Aufsicht über die Vernichtung des GVO-Mais, den das BLW angeordnet hatte.
■ Untersuchungen bei Straffällen
Das Inspektorat hat nicht nur die Aufgabe, Kontrollen durchzuführen Es führt auch Untersuchungen durch bei Straffällen Straftatbestände entstehen z B wenn Landwirte Bestimmungen der Milchkontingentierung nicht einhalten Straffälle mit einer Busse bis zu 500 Fr kann das Inspektorat selbständig an Ort und Stelle beurteilen In diesen Fällen kommt ein abgekürztes Verfahren zur Anwendung, d h die Fälle gelten mit dem Strafbescheid und dem Bezahlen der Busse als erledigt. Rekursmöglichkeiten bestehen nicht Alle übrigen Fälle werden innerhalb des BLW an den Rechtsdienst weitergeleitet Dieser behandelt die Fälle weiter Im Berichtsjahr hat das Inspektorat 84 Bussen ausgesprochen.
134 2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
–
Massnahmen 1999/2000

Die Milch spielt eine wichtige Rolle in der schweizerischen Landwirtschaft, denn sie trägt rund einen Drittel zum Wert der Endproduktion bei Kein anderes landwirtschaftliches Produkt ist so stark exportorientiert Rund 25% der Milchmenge werden ausgeführt, vor allem als Käse
Die neue Milchmarktordnung setzt Rahmenbedingungen, damit auf den in- und ausländischen Märkten eine möglichst grosse Menge Milch und Milchprodukte abgesetzt werden kann Zu diesem Zweck werden auf allen Stufen der Milchwirtschaft wettbewerbsfähige, marktnahe Strukturen gefördert. Die Produkte müssen hohen Qualitätsstandards genügen und gut vermarktet werden, damit der Zielpreis auf Stufe Milchproduzent erreicht werden kann Die Massnahmen zur Produktionslenkung und Marktstützung sind so ausgestaltet, dass die Marktkräfte in Produktion, Verarbeitung und Handel stärker als bisher zur Geltung kommen
1 nicht für alle Käse
2 nur für bestimmte Verwendungszwecke
3 nur bei Inlandverarbeitung
4 nach Käsesorte und Destination (EU - andere Länder) differenziert
5 nicht für Konsummilch
Quelle: BLW
Zusätzlich zu den Instrumenten Zulagen, Beihilfen und Grenzschutz trägt die Milchkontingentierung zu berechenbaren Verhältnissen auf dem Milchmarkt bei Hervorzuheben ist, dass die finanziellen Stützungsmassnahmen stark auf den Käse ausgerichtet sind Sein Markterfolg ist entscheidend für eine prosperierende Milchwirtschaft
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 135
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.1.2 Milchwirtschaft
Produkt Käse Butter Magermilch Milchpulver Konsummilch Rahm Frischmilchprodukte Massnahme Grenzschutz ■■■■■ Zulagen ■ Inlandbeihilfen ■ 1 ■ 2 ■ 2 ■ 3 Ausfuhrbeihilfen ■ 4 ■■ 5
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Finanzielle Mittel 1999 In der Staatsrechnung für das Jahr 1999 sind Ausgaben nach altem und neuem Recht zusammengefasst Deshalb sind Vergleiche mit Vorjahren nur bedingt möglich Gegenüber dem Vorjahr haben die Ausgaben des Bundes zugunsten der Milchwirtschaft –trotz 1998 eingeleiteten Sparmassnahmen – zugenommen. Diese Entwicklung ist mit der Übergangsfinanzierung in die neue Milchmarktordnung zu erklären
Mittelverteilung 1999
Total 1 052 Mio. Fr.
Quellen: Staatsrechnung, BLW
1999 betrugen die Ausgaben des Bundes im Milchbereich insgesamt 1‘052 Mio Fr Diese Summe setzt sich zusammen aus 568 Mio Fr für die befristeten Übergangsmassnahmen (Milchverwertung November 1998 bis April 1999), 105 Mio. Fr. Liquidationskosten für die Auflösung der halbstaatlichen Organisationen Schweizerische Käseunion AG und Butyra sowie 379 Mio Fr für die Marktstützung nach neuem Recht (Mai bis November 1999) Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte zeigt, dass der Bereich Käse 711 Mio Fr (68%) beanspruchte 258 Mio Fr (25%) wurden im Butterbereich und 83 Mio. Fr. (7%) im Pulverbereich eingesetzt.
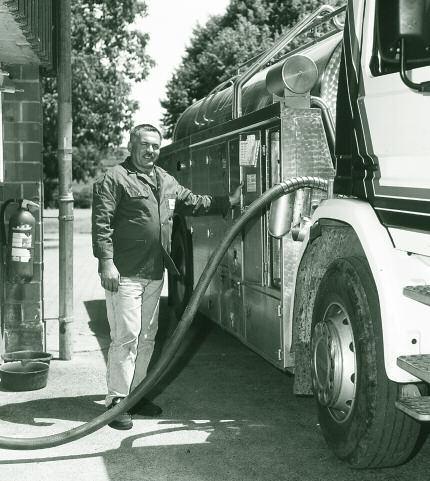
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 136
Ausfuhrbeihilfen 9% Zulagen 13% Liquidationskosten 10%
Inlandbeihilfen 13% Befristete Übergangsmassnahmen 55%
Tabelle 24, Seite A25
Milchkontingentierung
Mit der neuen Milchmarktordnung wird die 1977 eingeführte Milchkontingentierung im Grundsatz fortgesetzt. Die Milchmenge ist auf rund 3,2 Mio. t begrenzt. Indirekt stützt diese Massnahme den Milchpreis, da der Ausgleich zwischen der angebotenen und der nachgefragten Menge nicht völlig den Marktkräften überlassen wird Ebenso waren regionalpolitische Gründe massgebend, dass die Mengenbeschränkung beibehalten wurde, auch wenn sich dadurch der Handlungsspielraum des einzelnen Milchproduzenten und die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt vermindern

Einzelbetriebliche Milchkontingente können in der neuen Milchmarktordnung frei und ohne staatliche Eingriffe zwischen den Bewirtschaftern eines Betriebes gehandelt werden, wobei die Übertragung von Kontingenten vom Berg- ins Talgebiet im Grundsatz untersagt ist Die Produzenten erhalten mit der Miete oder dem Kauf den nötigen Spielraum, um ihre Kontingentsmengen den betrieblichen Verhältnissen anzupassen. Der Kontingentshandel trägt zu einer effizienten Milchproduktion bei
Zusatzkontingente sind für den Viehabsatz aus dem Berggebiet von Bedeutung und unterstützen die Arbeitsteilung Berg-Tal Produzenten, die Tiere aus dem Berggebiet zukaufen, erhalten für eine befristete Zeit pro zugekauftes Tier 1'500 kg Milch zugeteilt Jedes Jahr finden ca 17'000 Tiere über diesen Kanal den Weg vom Berg- ins Talgebiet Dafür wird jährlich eine annähernd gleichbleibende Menge von 25'000 t benötigt. Dies entspricht 0,8% der gesamten Kontingentsmenge.
Sonderkontingente nach Artikel 33 LwG sind für spezifische Kontingentsaufstockungen reserviert Der Bundesrat wird Sonderkontingente unter Vorbehalt der WTO-Verpflichtungen dann gewähren, wenn die Mittel für Ausfuhrbeiträge für Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten nicht ausreichen und ein zusätzlicher Bedarf an Milch besteht, um solche Produkte zu exportieren Mit dieser Massnahme kann der Veredlungsverkehr der Nahrungsmittelindustrie, die über diesen Weg billigeren Rohstoff im Ausland beschaffen kann, vermieden werden.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 137
2
■
Reger Kontingentshandel
Der in der Ausgestaltung einfache Kontingentshandel wurde rege und zielkonform genutzt Indem die Kontingente neu nicht mehr an die Fläche gebunden sind, sondern dem Bewirtschafter eines Betriebes zufallen, ist der Handlungsspielraum grösser geworden. Bei der Miete gibt es zwei Vertragstypen. Miete I beinhaltet eine normale nicht endgültige Übertragung, Miete II hingegen beinhaltet eine nicht endgültige Übertragung von Milchkontingentsmengen vom Berg- ins Talgebiet, gekoppelt mit der Übertragung der Aufzucht des Rindviehs vom Tal- ins Berggebiet
Ergebnisse des ersten Jahres Kontingentshandel (Milchjahr 1999/2000)
Im ersten Milchjahr (Mai 1999 – Ende April 2000) mit Kontingentshandel wurden insgesamt rund 386 Mio kg Kontingente auf andere Milchproduzenten übertragen Dies sind gut 12% der gesamten Kontingentsmenge Allerdings sind in dieser Menge rund 206 Mio. kg Kontingente enthalten, die durch die Auflösung der Betriebszweiggemeinschaften als vermietet erscheinen, effektiv aber bereits früher auf den oder die Partner der Betriebszweiggemeinschaft übertragen wurden Zwischen 10 und 15% der Produzenten haben einen Kauf- oder Mietvertrag zur Übertragung eines Milchkontingentes abgeschlossen Der Preis der gehandelten Kontingente, soweit er den Administrationsstellen bekannt gegeben wurde, hat sich im Berichtsjahr für den Verkauf um einen Durchschnitt von 1 38 Fr pro kg Milch bewegt Für die Miete hat er sich bei 10 Rp oder rund 13% des Zielpreises eingependelt
■ Ausblick
Über Fragen im Zusammenhang mit der Milchkontingentierung hat das BLW dem Institut für Agrarwirtschaft (IAW) der ETH Zürich eine Studie in Auftrag gegeben. Diese ist in eine Vorstudie (2000) und eine Hauptstudie (2001) aufgeteilt Ziel der Studie ist es, die verschiedenen Fragen betreffend Wirkung und Effektivität im Zusammenhang mit der Milchkontingentierung zu untersuchen Insbesondere ist deren Einfluss auf Mengen, Preise, Kosten und Einkommen der Produzenten, auf Strukturen und Regionen sowie auf die Nachhaltigkeit zu analysieren
In der Vorstudie wird die Struktur der Milchproduktion in der Schweiz aufgrund verfügbarer Einzelbetriebsdaten durch zehn Betriebstypen abgebildet. Diese dienen als Grundlage für die benötigten Berechnungen mit einem mathematischen Modell Als Ergänzung dazu ist bei den Produzenten eine Repräsentativumfrage durchgeführt worden.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 138
Verkauf Vermietung I Vermietung II Total Anzahl Verfügungen 3 075 14 079 338 17 492 Mio kg total 67,4 308,6 10,3 386,3 kg je Übertragung 21 915 21 922 30 464 22 084 Quelle: BLW
Aufgeteilt nach Betriebstypen haben Ende 1999 rund 3‘000 Landwirte in allen Gegenden der Schweiz einen Fragebogen zum Thema Milchproduktion erhalten Die erfreulich hohe Rücklaufquote von rund 54% hat gezeigt, dass sich die Landwirte intensiv mit der Zukunft der Milchproduktion und deren Kontingentierung beschäftigen.

In einem Kurzbericht zuhanden der Landwirte sind die ersten Resultate der Umfrage zusammengefasst worden Möglichkeiten zur Kostensenkung in der Milchproduktion sehen 72% der Antwortenden bei der Umstellung des Weidesystems, 69% bei der Synchronisierung der Milchproduktion in der Herde und 61% bei der Senkung der Lohnkosten Als kleines oder kein Kostensenkungspotenzial beurteilen 70% der Befragten die Ausdehnung der Milchmenge und 55% die Steigerung der Milchleistung pro Kuh. Entgegen den Erwartungen wird die Kostensenkung durch sparsamen Einsatz der Produktionsmittel gesucht, nicht aber durch die Steigerung der Produktionsmenge
Betreffend ihres Aufstallungssystems geben 86% der Antwortenden an, ihre Tiere im Anbindestall zu halten Nur 11% verfügen bereits über einen Boxenlaufstall Im Mittel könnten bei den Antwortenden rund 35'000 kg Milch zugemietet werden, ohne zusätzliche Investitionen in die Stallgebäude tätigen zu müssen Diese Betriebe verfügen durchschnittlich über fünf freie Milchkuhplätze
Der durchschnittliche Milchpreis, bis zu dem die Antwortenden weiterhin Milch produzieren würden, liegt bei 64 Rp je kg Bei einem Preis unter 70 Rp würden 60% und unter 65 Rp knapp 40% der Antwortenden die Milchproduktion noch weiterführen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 139
Tiefstes Milchpreisniveau, zu dem noch produziert würde 70 Rp.65 Rp.60 Rp.55 Rp. Preis pro kg Milch 50 Rp.45 Rp.40 Rp.35 Rp. A n z a h l B e t r i e b e Quelle: IAW-ETH 0 100 200 300 400 500 416 234 282 64 53 422 2
Marktstützung mit Zulagen und Beihilfen
Ein Viertel der Milchmenge wird im Ausland abgesetzt Die Erlöse für die exportierten Produkte, insbesondere Käse, orientieren sich dabei an den europäischen Preisen. Der inländische Produzentenpreis für Milch würde sich folglich diesem Niveau angleichen Die finanziellen Mittel für die Marktstützung ermöglichen ein Niveau zu erreichen, das heute knapp 30 Rp über demjenigen der EU liegt Mit dem Abbau der verfügbaren finanziellen Mittel im Milchbereich um 40% bis 2003 wird sich diese Differenz verringern Die Marktstützung trägt dazu bei, dass die Milchproduktion im Vergleich zu anderen Produktionsrichtungen wirtschaftlich interessant bleibt
Die Zulage für verkäste Milch ist das zentrale Element der neuen Milchmarktordnung. Diese Beiträge werden für sämtliche zu Käse verarbeitete Milch und über das ganze Jahr ausbezahlt Mit dieser Zulage wird der Rohstoff Milch verbilligt Damit ist es den Verarbeitern möglich, Käse zu konkurrenzfähigen Preisen herzustellen. Exportsubventionen für den Verkauf in die EU verlieren damit an Bedeutung Gemäss Käseabkommen im Rahmen der bilateralen Verträge mit der EU hat die Schweiz die Ausfuhrbeihilfen ohnehin stufenweise auf Null abzubauen Somit beschränken sich die Ausfuhrbeihilfen für Käse mittelfristig auf die Erschliessung von Entwicklungsmärkten ausserhalb der EU.
Zur Unterstützung der Absatzmöglichkeiten gewisser anderer Milchprodukte werden Beihilfen ausgerichtet. Die Butterverbilligung ist infolge des relativ schwachen Grenzschutzes für pflanzliche Speisefette und -öle notwendig Für besondere Verwertungsarten wie die Herstellung von Säurekasein, Labkasein und Kaseinaten sowie Proteinkonzentraten und Milchersatzfuttermitteln wird die Magermilch verbilligt Zur Förderung des Exportes anderer Milchprodukte als Käse wird zudem eine Beihilfe je Milchäquivalent, die sich nach dem Fett- und Proteingehalt des Milchprodukts bemisst, ausgerichtet Jedes Milchprodukt hat damit die gleiche Ausgangslage, um seine Exportchance wahrzunehmen

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 140
■ Milchmarktordnung besteht Praxistest
Mit der neuen Milchmarktordnung soll die Wettbewerbsfähigkeit auf allen Marktstufen verbessert werden Darunter ist zu verstehen, dass das Preis-/Leistungsverhältnis besser wird und die Marktanteile mindestens gehalten werden können Eine erste Zwischenbilanz ein Jahr nach Inkrafttreten der neuen milchwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeigt, dass – gemessen an den Reformzielen der Milchpolitik – die neue Marktordnung den Praxistest bestanden hat Der Zielpreis von 77 Rp je kg Milch wurde im Durchschnitt erreicht Prophezeiungen über Preiskollapse und Absatzeinbrüche haben sich nicht bewahrheitet Die Restrukturierung der nachgelagerten Stufe ist im Gang und die Verwertungsstruktur entwickelt sich in die gewünschte Richtung Marktanteile gingen keine verloren Im Gegenteil, die Aussenhandelsbilanz entwickelte sich positiv Zudem sind auch die Lagerbestände an Käse, Butter und Milchpulver gesund. Es darf bilanziert werden, dass der Übergang geordnet verlaufen ist Eine Kurskorrektur drängt sich folglich nicht auf Die Umsetzung zu verstärkter Wettbewerbsfähigkeit ist aber nach wie vor mit aller Konsequenz voranzutreiben, denn noch sind nicht alle Hypotheken aus der Vergangenheit abgetragen.
■ Ausblick Gemäss Zahlungsrahmen 2000 bis 2003 ist im Jahr 2001 ein Abbau der finanziellen Mittel um 80 Mio Fr vorgesehen Dies hat zur Folge, dass im Jahr 2001 die Beihilfen reduziert werden müssen.
Im Rahmen der Evaluation der AP 2002 ist ein Forschungsauftrag an das IAW der ETH Zürich vergeben worden. In diesem Forschungsauftrag werden insbesondere die Instrumente im Milchmarkt hinsichtlich Wirkung, Effektivität und Effizienz untersucht

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 D I E A G R A R P O L I T I S C H E N M A S S N A H M E N 141
2
2.1.3 Viehwirtschaft
Die Fleisch- und Eierproduktion trägt rund einen Drittel zur Endproduktion bei. Im Unterschied zur Milchwirtschaft beschränkt sich der Absatz fast ausschliesslich auf das Inland Das wichtigste Instrument zur Unterstützung der Fleischproduktion sind die Massnahmen an der Grenze; für die Eierproduktion kommen die Inlandbeihilfen dazu Der Bund setzt gemessen am Anteil an der Endproduktion wenig finanzielle Mittel für die Fleisch- und Eierproduktion ein Massnahmen 1999
Im Berichtsjahr gab es keine Marktabräumung in Schlachtbetrieben und für Schafe ab öffentlichen Märkten Ausserdem wurde kein Schweinefleisch eingelagert bzw verbilligt
■ Finanzielle Mittel 1999 1999 budgetierte der Bund 49,1 Mio. Fr. für Massnahmen der Viehwirtschaft. Rund 60% dieser Mittel stammen aus zweckgebundenen Zollanteilen, die auf Einfuhren von Fleisch, Eiern und Eiprodukten erhoben werden und in den Fleischfonds und die Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte fliessen. Die effektiven Ausgaben beliefen sich auf 32,6 Mio Fr Vom Budget wurden 16,5 Mio Fr vor allem aufgrund der noch bestehenden Exportrestriktionen für Zucht- und Nutzvieh nicht beansprucht
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 142 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tier/Produkt Rinder Kälber Schweine Pferde Schafe Ziegen Geflügel Eier Massnahme Grenzschutz ■■■■■■■■ Marktabräumung ab öffentlichen Märkten ■■■ Marktabräumung in Schlachtbetrieben ■■■■■ Einlagerungsaktionen ■■■ Verbilligungsaktionen ■■■ Praxisnahe Versuche ■ Umstellungsbeiträge ■ Sammel- und Sortierkostenbeiträge ■ Aufschlagsaktionen und Vermarktungsmassnahmen ■ Verwertungsbeiträge Schafwolle ■ Ausfuhrbeiträge 1 ■■■■ Höchstbestände ■■■■ 1 beschränkt auf Zucht- und Nutzvieh Quelle: BLW
Schlachtvieh und Fleisch: minimales Sicherheitsnetz auf dem Inlandmarkt
Mittelverteilung 1999
Total 32,6 Mio. Fr. Verwertungsbeiträge
Schafwolle 3%
Ausfuhrbeihilfen
Zucht- und Nutzvieh 5%
Beiträge zur Unterstützung der inländischen Eierproduktion 37%
Leistungsauftrag Proviande 15%
Einlagerungs- und Verbilligungsbeiträge für Rind- und Kalbfleisch 40%
Quellen: Staatsrechnung, BLW
Im Jahr 1999 wurden die Bundesmittel insbesondere zur Unterstützung des Eiersektors (37%) sowie des Rindfleisch- (28%) und Kalbfleischsektors (12%) eingesetzt
Die Massnahmen im Schlachtvieh- und Fleischsektor werden mit Mitteln aus dem Fleischfonds, der aus zweckgebundenen Zollanteilen geäufnet wird, finanziert. Im Berichtsjahr diente der Fleischfonds zur Finanzierung von Rind- und Kalbfleischeinlagerungsaktionen bei saisonalen und anderen vorübergehenden Überschüssen, zur Verbilligung von Rindsstotzen für die Trockenfleischfabrikation sowie zur Vergütung der von der Proviande (Nachfolgeorganisation der Genossenschaft für Schlachtviehund Fleischversorgung) erbrachten Dienstleistungen
Mit 6 Mio Fr machten die Ausgaben für den Ankauf von Rindfleisch für die humanitäre Hilfe den grössten Anteil aus. 3,81 Mio. Fr. wurden als Einlagerungsbeiträge für Kalbfleisch und 1,51 Mio Fr für Rindfleisch ausbezahlt Im Mai und Juni lagerten Unternehmen 303 t Vorderviertelfleisch von Bankmuni und von Januar bis Juli 1‘120 t Kalbfleisch ein. Damit wurden die saisonalen Angebotsspitzen im Frühling und Sommer aufgefangen und die Preise stabilisiert Die gesamte eingelagerte Menge wurde im Herbst wieder dem inländischen Markt zugeführt Von Februar bis Juni verbilligte der Bund mit insgesamt 1,24 Mio Fr zudem 8‘900 Rindsstotzen mit einem Gesamtgewicht von 300 t für die Trockenfleischfabrikation
Die Proviande erhielt 4,8 Mio Fr für die Erfüllung der Dienstleistungen gemäss Artikel 42 der Übergangsbestimmungen in der Schlachtviehverordnung vom 7 Dezember 1998. Mit diesen Mitteln wurden die Erfassung und Kontrolle von Gesuchen um Zollkontingentsanteile, die Überwachung und Abräumung von öffentlichen Schlachtvieh- und Schafmärkten sowie die Durchführung von Einlagerungsaktionen finanziert
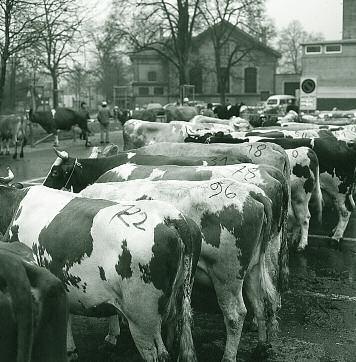
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 143
■ 2
Tabelle 25, Seite A26
■ Zucht- und Nutzvieh: Einfuhrrestriktionen behindern noch immer den Export
Im Rahmen der Marktabräumung (Zuteilung der nicht verkauften Tiere) ab überwachten öffentlichen Märkten teilte die Proviande den Zollkontingentanteilsinhabern 3'842 Stück Grossvieh und 1'565 Kälber zu marktüblichen Preisen zu Die Zuteilungen sind infolge der verbesserten Marktsituation gegenüber 1998 (6'105 Stück Grossvieh und 1'792 Kälber) gesunken Bei den Schafen und Weidelämmern musste die Proviande keine Tiere zuteilen
Das Berggebiet hat komparative Kostenvorteile bei der Aufzucht von Rindern für die Milch- und Fleischproduktion Die Beiträge für den Zucht- und Nutzviehexport unterstützen diesen Betriebszweig Sie blieben im Berichtsjahr grösstenteils ungenutzt, da der Export in die EU-Länder trotz grosser Anstrengungen des Bundesrates und der zuständigen Bundesstellen zur Aufhebung der BSE-bedingten Einfuhrrestriktionen weiterhin versperrt blieb Im Rahmen der humanitären Hilfe konnten dennoch 500 Kühe und tragende Rinder in das Kosovo ausgeführt werden.
■ Eier: Massnahmen zur Unterstützung der inländischen Produktion
Alle Massnahmen im Eiersektor werden mit Mitteln aus der Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte, die aus zweckgebundenen Zollanteilen geäufnet wird, finanziert Die Preisausgleichskasse steht für die Unterstützung der Inlandeierproduktion auf bäuerlichen Betrieben und zur Finanzierung von Verwertungsmassnahmen zugunsten der Schweizer Eier zur Verfügung
Der Übergang von der alten zur neuen Eiermarktordnung fand bereits im Jahre 1996 statt Der Bundesrat hat dannzumal die Teilung des Marktes in einen geschützten (rund ein Drittel der Produktion) und einen nicht geschützten (rund zwei Drittel der Produktion) aufgehoben Im geschützten Markt existierte eine Preis- und Absatzgarantie Der Bundesrat hat als Abfederung zwei Übergangsmassnahmen bis zum Jahre 2001 beschlossen:
1. Das BLW zahlt Sammel- und Sortierkostenbeiträge für die Übernahme von Konsumeiern bei ehemals geschützten Eierproduzentinnen und -produzenten Diese Beiträge in der Höhe von 4,38 Mio Fr dienten im Berichtsjahr auch zur Preisstützung
2 Weiter wird die Umstellung auf tierfreundliche Legehennenhaltung (RAUS und/ oder BTS) gefördert Eierproduzentinnen und -produzenten erhalten zusätzlich zu den RAUS- und BTS-Beiträgen Umstellungsbeiträge 576 Betriebe mit insgesamt 784‘330 Legehennen erhielten 1999 Umstellungsbeiträge in der Höhe von 5,84 Mio. Fr. Dies sind gemessen am Gesamtbestand über 28% der Legehennen; 1997 lag der Anteil erst bei 15% Die annähernde Verdoppelung innerhalb zweier Jahre lässt darauf schliessen, dass die Umstellungsbeiträge ein effektives Instrument zur Förderung der tierfreundlichen Haltung sind.

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 144
■ Nutz- und Sportpferde: erstmalige Versteigerung von Zollkontingentsanteilen
Neben den Übergangsmassnahmen können die Mittel der Preisausgleichskasse für Aufschlagsaktionen und Vermarktungsmassnahmen bei saisonalem Überangebot an Schweizer Hühnereiern verwendet werden Ziel ist, die Preise zu stabilisieren Das BLW stellte 1999 nach Anhörung der interessierten Kreise 2 Mio. Fr. für diese Massnahmen zur Verfügung; sie begannen nach Ostern und dauerten bis Ende Oktober Nach Ostern sinkt die Nachfrage nach Konsumeiern sehr schnell Das Angebot hingegen kann kurzfristig nicht im selben Ausmass reduziert werden Insgesamt wurden 13,7 Mio überschüssige Inlandeier aufgeschlagen und zu Eiprodukten verarbeitet und 11,1 Mio Inlandeier verbilligt an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben Diese Massnahmen, für welche insgesamt 1,58 Mio Fr ausgegeben wurden, trugen mindestens teilweise zur Preisstabilisierung bei
Mittel aus der Preisausgleichskasse dienen zudem der Mitfinanzierung von praxisnahen Versuchen beim Geflügel sowie der Verbreitung der entsprechenden Ergebnisse bei der Bildung und Beratung. Im Jahre 1999 unterzeichneten das BLW und die Geflügelzuchtschule in Zollikofen drei Verträge zur Durchführung von Versuchen, die teilweise bis ins Jahr 2000 laufen Die Ergebnisse werden laufend an Informationsveranstaltungen präsentiert, in den einschlägigen Fachzeitschriften publiziert und fördern dadurch die Verbesserung der Geflügelhaltung
Die neue Pferdeeinfuhrverordnung sieht eine Versteigerung der Zollkontingente vor Das BLW hat im September 1999 die erste Hälfte des Zollkontingentes «Tiere der Pferdegattung (ohne Zuchttiere)» im Umfang von 1‘561 Stück erstmals öffentlich zur Versteigerung ausgeschrieben Die von insgesamt 183 natürlichen und juristischen Personen sowie Personengemeinschaften mit Wohnsitz oder Sitz im schweizerischen Zollgebiet eingereichten 763 Gebote und die berücksichtigbare Gebotsmenge von 5‘203 Stück lassen auf eine wettbewerbsgerechte Verteilung der ersten Tranche des Zollkontingentes schliessen Insgesamt erhielten 146 Personen Zollkontingentsanteile für die Kontingentsperiode 2000 Dies sind mehr als doppelt so viele wie für 1999

2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 145
2
■ Ausblick Der Bundesrat regelt in der Schlachtviehverordnung den Schlachtvieh- und Fleischmarkt grundlegend neu Die Ausschreibung von Leistungsaufträgen, welche unter anderem die Einführung der neutralen Qualitätseinstufung beinhalten, und die neue wettbewerbsgerechte Verteilung der Zollkontingente sind deren Eckpfeiler. Das BLW hat im März 1999 drei Leistungsaufträge öffentlich ausgeschrieben und nach eingehender Evaluation durch eine private Beratungsfirma der Proviande, die bereits Dienstleistungen im Auftrage des Bundes ausführte, zugeschlagen Die drei Verträge zwischen dem BLW und der Proviande traten am 1 Januar 2000 in Kraft:
1 Neutrale Qualitätseinstufung auf überwachten öffentlichen Märkten und in Schlachtbetrieben:
Die Proviande stuft ab 1. Januar 2000 die Qualität aller Tiere der Rindvieh- und Schafgattung auf überwachten öffentlichen Märkten und aller Tiere der Rindvieh-, Schweine-, Pferde-, Schaf- und Ziegengattung in grossen Schlachtbetrieben ein Wie in der EU gilt ein Betrieb, in dem jährlich mehr als 1'200 Schlachteinheiten (z B 1'200 Kühe oder 6'000 Schweine) geschlachtet werden, als «grosser» Schlachtbetrieb

2 Überwachung von öffentlichen Märkten und des Marktgeschehens in Schlachtbetrieben sowie Durchführung von Marktentlastungsmassnahmen:
Die Proviande wird ab 1 Januar 2001 die öffentlichen Märkte der Rindvieh- und Schafgattung überwachen Sie wird auf diesen Märkten die Marktabräumung vollziehen und die Ausschreibung und Kontrolle von Einlagerungs- und Verbilligungsaktionen vornehmen
3 Erfassung und Kontrolle der Gesuche um Zollkontingentsanteile: Das BLW wird die Zollkontingentsanteile beim Schlachtvieh und Fleisch ab 1 Januar 2001 grundsätzlich nach neuen Kriterien zur Bemessung der Inlandleistung zuteilen. Die Inlandleistungen werden von der Proviande mittels Gesuchen erfasst und kontrolliert und ins BLW übermittelt
Im Zuge der Evaluation der AP 2002 ist ein Forschungsauftrag an das IAW der ETH Zürich vergeben worden In diesem Forschungsauftrag werden die Instrumente und die Mittelverteilung im Fleisch- und Eiermarkt hinsichtlich Wirkung, Effektivität und Effizienz untersucht
Die Wettbewerbsfähigkeit in der Schweine-, Geflügel- und Eierproduktion ist infolge der hohen Futtermittelkosten suboptimal Die Futtermittelkosten belaufen sich auf ungefähr 50% (Schweinemast mit Alleinfutter) und rund 70% (Geflügelfleisch- und Eierproduktion) der Direktkosten Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Produktionszweige leisten tiefere Futtermittelpreise einen wichtigen Beitrag Dies kann in erster Linie durch eine Schwellenpreissenkung bzw. eine Senkung der Zölle auf eingeführten Futtermitteln erreicht werden Damit verbunden wären aber Einkommenseinbussen, insbesondere bei den inländischen Getreide-, Ölsaaten- und Kartoffelproduzenten Um diese Einbussen mindestens teilweise zu kompensieren, werden neue Massnahmen geprüft
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 146
Die Massnahmen im Pflanzenbau bezwecken, dass der Anbau von Acker- und Spezialkulturen in Konkurrenz zur Milch-, Fleisch- und Eierproduktion und zu den Importen wirtschaftlich interessant bleibt Sie streben zudem einen Ausgleich zwischen den verschiedenen pflanzlichen Produkten an Damit gewährleisten sie, dass die Landwirtschaft ihre verfassungsmässigen Aufgaben, wie Versorgungssicherheit und Pflege einer vielfältigen Kulturlandschaft, wahrnehmen kann
1 Beiträge für Kartoffeln in Verwertungsbeiträgen integriert; gilt nicht für die gesamte Erntemenge (Marktreserve für Kernobstsaftkonzentrat; Frischverfütterung von Kartoffeln)
2 Beiträge teilweise im Verwertungsauftrag integriert (Saatkartoffeln)
3 Weinbau: Nur für Rebflächen in Steil- oder Terrassenlagen Quelle: BLW
Die Massnahmen für den Pflanzenbau basieren auf dem Grenzschutz Beim Brotgetreide und bei den Ölsaaten galten 1999 noch die begrenzten Preis- und Übernahmegarantien Die Flächenbeiträge, insbesondere diejenigen für Futtergetreide (Anbauprämien), sorgten für einen Ausgleich, damit die wirtschaftliche Parität der Ackerkulturen gewährleistet werden konnte Erstmals erhielten die Zuckerfabriken im Berichtsjahr einen Verarbeitungsauftrag für die Produktion von inländischem Zucker Zahlreiche administrative Arbeiten beim Vollzug gingen vom BLW neu an Branchenorganisationen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 147 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.1.4
Pflanzenbau
Massnahmen 1999 Massnahme Grenzschutz ■■■■■■■ Begrenzte Preis- und Übernahmegarantie ■■ Verarbeitungsbeiträge ■■ Verwertungbeiträge 1 ■ Leistungsaufträge ■ Flächenbeiträge ■ 3 Ausfuhrbeiträge ■ 2
über K u l t u r B r o t g e t r e i d e F u t t e r g e t r e i d e, K ö r n e rl e g u m i n o s e n , N a c hw a c h s e n d e R o h s t o f f e, W e i n b a u Ö l s a a t e n z u r S p e i s e ö l g e w i n n u n g K a r t o f f e l n , O b s t b a u Z u c k e r r ü b e n S a a t g u t G e m ü s e, S c h n i t t b l u m e n 2
■ FinanzielleMittel1999
DreiViertelderBundesausgabenfürdieMarktstützungsmassnahmenimPflanzenbau wurdenfürdenAckerbaueingesetzt.Davonwurden70%fürdiePreisstützung verwendet.DieübrigenMittelflosseninFormvonFlächenbeiträgendirektzuden Landwirtschaftsbetrieben.DasFuttergetreidebeanspruchte86%,dienachwachsendenRohstoffe8%unddieKörnerleguminosen(Eiweisserbsen,Ackerbohnen)6%der Anbaubeiträge.MiteinemViertelderpflanzenbaulichenMarktstützungsausgaben wurdederObst-undWeinbauunterstützt.
Tabelle26,SeiteA27
Mittelverteilung1999
Total 183 Mio. Fr.
Leistungsaufträge1%
Flächenbeiträge 29%
■ Getreide:zumzweitletztenMalPreis-und Übernahmegarantie
Verarbeitungsbeiträge 18%
Verwertungsbeiträge 32% BegrenztePreis-und Übernahmegarantie (Verarbeitungsbeiträge) 20%
Quellen: Staatsrechnung, BLW
Ackerkulturen
DiewirtschaftlicheParitätundderAnteildereinzelnenAckerkulturenverändertesich imBerichtsjahrnurgeringfügig.
DerBundübernahmausderErnte1999zumzweitletztenMaldiesogenannte GarantiemengeBrotgetreide(388'700t)zufestgesetztenPreisen.DieseMengeverkaufteerzudenSelbstkostenandieMüller.DasübrigeBrotgetreidewurdedeklassiert undmittelsVersteigerungimFuttersektorabgesetzt.DieProduzentendecktendie KostenderDeklassierungmiteinemVerwertungsbeitragvonFr.6.40/dt.

DiewirtschaftlicheParitätzwischendemAnbauvonBrot-undFuttergetreidewurde mitAnbaubeiträgensichergestellt.DasNiveauderinländischenFuttergetreidepreise wirddurchdievomBundesratproProduktegruppefestgelegtenSchwellenpreisefür importierteFuttermittelgesteuert.DievondenProduzentenerzieltenPreisefürFuttergetreidesindrundFr.15.–bisFr.20.–/dttieferalsfürBrotgetreide.
GestütztaufdieSchwellenpreiselegtdasEVDfürdieeinzelnenProduktedieImportrichtwertefest.DasBLWsetztaufgrundderSchwellenpreiseundImportrichtwertedie Zollansätzesofest,dassdieImportpreisederFuttermittelinnerhalbeinerBandbreite von±3Fr.liegen.DieAnpassungderZölleandieEntwicklungderWeltmarktpreise erfolgtinderRegelaufBeginneinesQuartals.
2.1PRODUKTIONUNDABSATZ 2 148
■ Zuckerrüben: neue Regelung hat sich gut eingespielt
Den inländischen Zuckerrübenanbau regelt ein Verarbeitungsauftrag des Bundes an die Zuckerfabriken Der Auftrag setzt eine Mindestmenge von 120'000 t und eine Höchstmenge von 185'000 t Rübenzucker fest Die Zuckerfabriken vereinbaren die erforderliche Rübenmenge, die Verteilung auf die Pflanzerinnen und Pflanzer sowie die Preise und die Übernahmebedingungen jährlich mit dem Schweizerischen Verband der Zuckerrübenpflanzer Sie sind verpflichtet, den erzeugten Zucker und die Nebenprodukte nicht unter den Importpreisen zu verkaufen und die Verarbeitung kostengünstig zu gestalten
Die Zuckerfabriken erhalten vom Bund eine pauschale Abgeltung des Verarbeitungsauftrages Die Abgeltung für die Verarbeitung der Zuckerrübenernte 1998 betrug im Berichtsjahr 32,6 Mio. Fr. Die Verarbeitung der Ernte 1999 gemäss neuer Marktordnung wird im Jahr 2000 abgerechnet Dafür wurden 45 Mio Fr budgetiert Liegt der erzielte durchschnittliche Zuckererlös, nach Abzug der Grenzabgaben, ausserhalb der Bandbreite von 35 bis 45 Fr. je dt Zucker, so wird der Saldo der Mehr- oder Mindererträge bei der Festlegung der Abgeltung für die nächste Periode berücksichtigt Da der Zuckerpreis auf dem Weltmarkt unter Fr 35 –/dt lag, hatte dies zur Folge, dass der Bund zusätzlich zur ordentlichen Abgeltung die Mindererträge von rund 2,7 Mio Fr beim Zuckererlös decken muss
■ Kartoffeln: mit kleiner Ernte in die neue Marktordnung
Die Erträge beim Kartoffelanbau sind witterungsbedingt starken Schwankungen unterworfen. Besonders in Jahren mit hohen Erträgen kommen die Marktpreise stark unter Druck Die Massnahmen zu Gunsten des Kartoffelanbaus, insbesondere die Verwertung im Futtersektor, tragen zu stabileren Produzentenpreisen bei Das BLW hat der Branchenorganisation swisspatat einen Verwertungsauftrag erteilt Dieser ermöglicht, die Frischverfütterung von deklassierten Kartoffeln, die Lagerhaltung von Speisekartoffeln (max. 3000 t) und die Verarbeitung von unerlesenen Kartoffeln zu Futtermitteln (Trocknung) mit Beiträgen zu unterstützen Für die Verwertung der Ernte 1999 wurde der swisspatat eine Pauschale von 18 Mio Fr ausbezahlt Die Hälfte davon wurde im Rechnungsjahr 1999 fällig.
Ausgaben für die Verwertung der Kartoffelernte 1999
Lagerhaltung
Speisekartoffeln 5%
Verwertung
Saatkartoffeln 13%
Trocknung 48% Export Kartoffelprodukte 8%
Frischverfütterung 26%
Quelle: swisspatat
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 149
2
■ Ölsaaten: Vorbereitung auf die Liberalisierung
Mit der Verwertung der Saatkartoffeln wurde der Schweizerische SaatgutproduzentenVerband beauftragt Dieser kann die zur Verfügung stehenden Mittel für die Frischverfütterung, die Verarbeitung zu Futtermitteln (Trocknung) und den Export einsetzen Der Beitrag an den Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verband belief sich auf
2,6 Mio Fr für die Verwertung der Ernte 1999
Zusätzlich gewährt das BLW Exportbeiträge für Kartoffelprodukte Von der WTO sind Limiten festgelegt Ab 2000 dürfen die Exportsubventionen (inkl Saatkartoffelexporte)
2,3 Mio Fr und 8'437 t Kartoffeln nicht übersteigen Das WTO-Agrarabkommen verpflichtet die Schweiz zudem, ab 2000 einen minimalen Marktzutritt von 22'250 t Kartoffeln zu gewährleisten Als Referenzgrösse für die Verteilung des Teilzollkontingentes für Saat-, Speise- und Veredlungskartoffeln gilt die Inlandleistung. Das Teilzollkontingent für Kartoffelprodukte wird versteigert
Die Kartoffelanbaufläche war in den letzten Jahren rückläufig und lag 1999 knapp unter dem für die Selbstversorgung nötigen Niveau von 14'000 ha Da ausserdem die Kartoffelerträge tief waren, war die Erntemenge nicht ausreichend, um den Inlandbedarf an Speisekartoffeln in der erforderlichen Qualität zu decken Eine Erhöhung des Zollkontingentes für zusätzliche Einfuhren, vor allem von Kartoffeln für die Veredlungsindustrie, wurde notwendig.
1999 war das letzte Jahr mit einer Preis- und Abnahmegarantie für eine Ölsaatenfläche von maximal 21'000 ha Dabei durfte die Rapsfläche 16'000 ha nicht überschreiten Die Ölwerke erhielten für die Verarbeitung der inländischen Ölsaaten einen Beitrag, der sich an den ausgewiesenen Kosten orientierte Um eine günstige Ausgangslage für die neue Marktordnung zu schaffen, hat der Bund 1999 Rapsölverkaufsaktionen im Inland unterstützt. Zusätzlich wurden 400 t Rapsöl der Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung gestellt
Auf importierten Speisefetten und -ölen wird wie auf Importbutter ein Zoll zum Schutz der inländischen Butter- und Ölsaatenproduktion erhoben Die Weltmarktpreise für Öl und Schrot und der Zoll auf diesen Produkten bestimmen im wesentlichen die Importpreise für Ölsaaten
Die Bundesaufwendungen für die Übernahme, Verarbeitung und den Verkauf von Ölsaaten betrugen 1999 36,8 Mio Fr Die definitive Abrechnung wird nach der vollständigen Liquidation der bisherigen Marktordnung vorliegen
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 150
■ Nachwachsende Rohstoffe: Übergang zu den neuen Stützungsmassnahmen
Die Förderung der nachwachsenden Rohstoffe erlaubt die technische Erprobung und die Markteinführung von alternativen Produkten auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen Bei den nachwachsenden Rohstoffen galt 1999 noch die alte Marktordnung. Von den 1'852 ha beitragsberechtigten Anbauflächen entfallen 83% auf Raps und 14% auf Chinaschilf Daneben wurden noch geringe Flächen an Hanf, Sonnenblumen, Soja und Kenaf unterstützt Für Flächenbeiträge für nachwachsende Rohstoffe wurden 3,7 Mio Fr ausgegeben
Die Rohstoffverbilligungsbeiträge für die Verarbeitung von Biomasse zu Ethanol oder für produzierte Energie konnten 1999 erstmals geltend gemacht werden Im Berichtsjahr gab es noch keine entsprechenden Gesuche
■ Ausblick Das Parlament hat in der Frühlingssession 2000 die Aufhebung des Getreidegesetzes gutgeheissen. Die Aufhebung ist auf den 30. Juni 2001 vorgesehen. Mit der Ernte 2001 wird sich der Bund weitgehend aus dem Marktgeschehen beim Brotgetreide zurückziehen Ablieferungs- und Übernahmepflichten entfallen, ebenso die garantierten Grundpreise Brot- und Futtergetreide werden einen Markt bilden Wesentliches staatliches Steuerungsinstrument werden weiterhin die Massnahmen an der Grenze sein. Geht die Ernte nicht über den inländischen Bedarf hinaus, werden die Weltmarktpreise plus die Grenzabgaben das Preisniveau bestimmen Die Importregelung für Getreide wird per 1 Juli 2001 mit der Einführung der neuen Marktordnung angepasst Die Anbaubeiträge für Futtergetreide wurden für die Ernte 2000 von Fr. 770.–/ha auf Fr 400 –/ha reduziert Ab der Ernte 2000 wurden zudem die Anbaubeiträge für Körnerleguminosen auf Lupinen ausgedehnt

Für die Ernte 2000 gilt eine neue Ölsaatenmarktordnung Der Grenzschutz, ein spezifischer Flächenbeitrag und ergänzende Verarbeitungsbeiträge sind die wichtigsten Instrumente zur Stützung des inländischen Anbaus von Raps, Soja und Sonnenblumen Sie dienen dazu, eine angemessene inländische Ölsaatenverarbeitung zu erhalten Der Flächenbeitrag für Ölsaaten wird unabhängig davon gewährt, ob die Ölsaaten für die menschliche Ernährung oder anderweitig eingesetzt werden Diese neue Regelung für Ölsaaten entspricht in den wesentlichen Grundzügen derjenigen der EU
Die Ölsaaten wurden bisher in der Schweiz von drei Ölwerken zu Speiseöl verarbeitet Das Ölwerk LIPTON-SAIS wendete bei der Ölgewinnung das Extraktionsverfahren an Die beiden Ölwerke Florin AG und Oleificio SABO gewinnen das Öl mit einem reinen Pressverfahren und gelten als sogenannte Presswerke Sie haben gemessen am Ausgangsprodukt eine 4 bis 6% tiefere Ölausbeute. Die Verarbeitungsbeiträge gleichen die unterschiedlichen Ausbeuten der beiden Verfahren aus Da die Lipton-Sais ihr Extraktionswerk auf Ende Oktober 2000 einstellen wird, verliert diese Ausgleichsfunktion an Bedeutung.
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 151
2
■ Obst und Gemüse: Grenzschutz als Kernelement der Marktordnungen
Die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen wird ab der Ernte 2000 durch folgende Massnahmen gefördert:
– Flächenbeiträge für alle Faserpflanzen: Voraussetzung ist die Ernte in reifem Zustand
Verarbeitungsbeiträge für Ölsaaten und auf LN produzierte Biomasse: Rohstoffverbilligung, wenn sie in Pilot- und Demonstrationsanlagen als nachwachsende Rohstoffe verarbeitet werden
Die Beiträge an die Verarbeitung von Ölsaaten in Pilot- und Demonstrationsanlagen werden für das Jahr 2000 auf Fr 30 –/dt erhöht Damit soll während dem Übergang die Parität zu den anderen Ackerkulturen gewährleistet werden Ab 2001 gilt der Ansatz von Fr 20 –/dt Ölsaaten
Am 10 März 1999 wurde die Schweizerische Branchenorganisation Getreide und Ölsaaten gegründet Die Branchenorganisation umfasst die Produktion, die Sammelstellen, den Handel und die Verarbeiter. Sie ist bestrebt, bisherige Aufgaben des Bundes im Bereich Getreide und Ölsaaten zu übernehmen, insbesondere die Organisation der Produktion und der Absatzförderungsmassnahmen Ab dem 15 September 2000 heisst die Branchenorganisation neu «swiss granum»
Spezialkulturen
Beim Obst werden insbesondere zwei Massnahmen angewendet:
1 Der Grenzschutz vermindert den starken Konkurrenzdruck als Folge der Einfuhr gleichartiger Früchte Ausserhalb des Zeitraums, in dem durchwegs zum tiefen KZA importiert werden kann, erfolgt eine dem Angebot an Schweizer Früchten angepasste zeitliche Abstufung der Zollkontingente Auf diese Weise führen die Importe zu einer marktkonformen Ergänzung der schweizerischen Produktion. Wird der Bedarf im Inland durch die einheimische Produktion gedeckt, dann sind keine Importe zum KZA mehr zulässig In solchen Phasen der Selbstversorgung gilt der reduzierte AKZA.
2 Der Bund beteiligt sich finanziell an der Verwertung von Mostobst und an den Marktentlastungsmassnahmen für Steinobst Er zahlt insbesondere die Lager- und Kapitalzinskosten für die Kernobstsaftkonzentratreserven, die den normalen Bedarf der Mostereien übersteigen und gewährt Exportbeiträge für Kernobstprodukte (Konzentrat, Saft und Pulver) sowie verarbeitete und frische Kirschen Die Übernahme der Vermarktungskosten für die Kirschen- und Zwetschgenlieferungen ins Berggebiet fällt ebenfalls in diese Unterstützungskategorie und kommt einem einkommensschwachen Teil der Bevölkerung zugute.
Diese Massnahmen stellen in erster Linie ein Sicherheitsnetz für die Obstproduzenten dar, die naturgemäss mit starken und oft unvorhersehbaren Preisschwankungen konfrontiert werden, sobald das Angebot den Bedarf übersteigt Angesichts der natürlichen Ernteschwankungen (Alternanz), der beschränkten Möglichkeit zur zeitlichen Staffelung der Ernten und der begrenzten Haltbarkeit der Erzeugnisse, können die Produzenten nur bedingt eigene Massnahmen treffen Bei den Hochstammkulturen werden die extensive Produktion, die Landschaftspflege und die Erhaltung der biologischen Vielfalt im Rahmen des Direktzahlungssystems mit einem Beitrag für den ökologischen Ausgleich entschädigt
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2 152
–
■ Weinwirtschaft: Kommunikationsoffensive zur Steigerung der Marktanteile
Die einzige direkte Interventionsmassnahme des Staates im Gemüsesektor ist der Grenzschutz, der ähnlich gehandhabt wird wie beim Obst Bei den Schnittblumen ist dieser Schutz auf den Zeitraum vom 1 Mai bis zum 25 Oktober beschränkt In beiden Fällen wird mit diesem Instrument die starke Konkurrenz gedämpft, die der Schweiz aus der EU und den Überseeländern erwächst

Ausgaben für die Obstverwertung 1999
Lager Kernobstsaftkonzentrate 9,6%
Export Birnensaftkonzentrat 28,2%
Export Kirschen 1,6%
Export andere Kernobstprodukte 2%
Total 39,1 Mio. Fr.
Export Apfelsaftkonzentrat 58,1%
Anderes 0,4% Marktentlastung (Kirschen und Zwetschgen) 0,1%
Quelle: BLW
Im Jahr 1999 hat der Bund die Obstverwertung mit insgesamt 39,1 Mio Fr unterstützt Darin inbegriffen ist die Mitfinanzierung der Exporte von Apfelsaft- und Birnensaftkonzentraten der Obsternte 1998 Zudem leistete die Obstbranche im Rahmen der Selbsthilfe einen Beitrag von 19,2 Mio Fr
Die Massnahmen in der Weinwirtschaft dienen der Absatzförderung – insbesondere im Ausland –, der Erhaltung der Rebflächen an Steil- und Terrassenlagen, der Qualitätsverbesserung durch Mengenbegrenzung und Mindestanforderungen sowie den entsprechenden Kontrollmassnahmen und dem Schutz der Ursprungsbezeichnungen. Die staatlichen Massnahmen werden vom Rebbaufonds finanziert Er dient zur Unterstützung:
a der Massnahmen zur Erhaltung der Rebflächen, insbesondere der Direktzahlungen zu Gunsten von Steil- und Terrassenlagen;
b der Absatzförderung von Produkten des Weinbaus, wobei die Absatzförderung von Wein auf die Ausfuhr beschränkt ist;
c des ungedeckten Aufwandes des BLW für Qualitätsbestätigungen
Das Importkontingent für Weisswein wurde vollständig ausgeschöpft und wirkte daher limitierend Beim Rotwein erreichte der Ausschöpfungsgrad 96,1%; somit hat das Zollkontingent nicht einschränkend auf die Importe gewirkt.
Die Beiträge zu Gunsten der schweizerischen Weinwirtschaft betrugen 7,2 Mio Fr Davon wurden 1,4 Mio Fr für die Weinlesekontrolle und 5,8 Mio Fr für die Absatzförderung (davon 5,5 Mio Fr für den Export) eingesetzt
2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 153
2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
■ Tabak: eine unvermeidliche Partnerschaft
Seit 1992 hat sich der Bund völlig von der Finanzierung der schweizerischen Tabakproduktion zurückgezogen Heute legt er nur noch als Richtwert den maximalen Produzentenpreis fest Anbau und Übernahme des inländischen Tabaks sind durch die zwischen dem Verband der schweizerischen Tabakpflanzer und der Einkaufsgenossenschaft für Inlandtabak abgeschlossene Konvention geregelt Gemäss Finanzierungssystem für Schweizer Tabak müssen die Zigarettenhersteller und -importeure auf der für den Inlandmarkt bestimmten Ware eine Abgabe von 0,13 Rp je Zigarette in einen Fonds entrichten Damit wird die Differenz zwischen dem Erlös aus dem Verkauf des Tabaks an die Hersteller von Tabakfabrikaten und den Erntekosten – insbesondere die Bezahlung der Pflanzer zu den von der Branchenorganisation festgesetzten Preisen
gedeckt Im Rahmen der Marktorganisation Tabak haben 394 Familienbetriebe, das heisst 14 weniger als 1998, auf 647 ha einen Erntewert von 16,9 Mio. Fr. erzielt.
■ Ausblick
Die zunehmende Konzentration in den Sektoren Obst, Gemüse und Zierpflanzen stellt die Lieferanten vor neue Herausforderungen In Zukunft wird ihre Fähigkeit, auf einem liberaleren Markt als dauerhafte Partner der Grossverteiler zu bestehen, nicht nur von den Verkaufsmengen, sondern auch von den Dienstleistungen abhängen Die Massnahmen des Bundes zur Unterstützung der Spezialkulturen werden sich vermehrt an der langfristigen Erhaltung der Marktanteile orientieren müssen.

Auch die schweizerische Weinwirtschaft muss sich vermehrt an der ausländischen Konkurrenz messen. Ab 1. Januar 2001 werden die Zollkontingente für Weisswein und Rotwein in einem einzigen Zollkontingent von 170 Mio Litern Wein zusammengefasst
Es ist zu erwarten, dass dadurch der Druck insbesondere auf die einheimische Produktion von Weisswein steigt Durch die Zusammenlegung der Kontingente können nämlich die bisher nicht vollumfänglich ausgeschöpften Rotweinkontingente inskünftig der zollgünstigen Einfuhr von Weissweinen dienen. Im Hinblick auf diese Entwicklung werden die Marktinterventionen auf das Notwendige beschränkt und die Kontrollen im Sektor Weinwirtschaft harmonisiert
154 2 . 1 P R O D U K T I O N U N D A B S A T Z 2
–
2.2 Direktzahlungen
Die Direktzahlungen sind ein zentrales Element der Neuorientierung der Agrarpolitik. Sie ermöglichen einerseits eine Trennung der Preis- und Einkommenspolitik und andererseits eine Abgeltung der von der Gesellschaft geforderten Leistungen Unterschieden wird zwischen allgemeinen und ökologischen Direktzahlungen Die Ökobeiträge sind Teil der ökologischen Direktzahlungen
Ausgaben für die Direktzahlungen 1999
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich Die Werte in Abschnitt 2 2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs Quelle: BLW

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ausgabenbereich Mio Fr Allgemeine Direktzahlungen 1 769 Ökologische Direktzahlungen 309 Total 2 078
2 155
■ Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen
2.2.1 Konzept, Bedeutung, Anforderungen, Vollzug und Kontrolle
Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft werden mit den allgemeinen Direktzahlungen abgegolten Zu diesen zählen die Flächenbeiträge und die Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere Diese Beiträge haben das Ziel, eine flächendeckende Nutzung und Pflege sicherzustellen In der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zusätzlich Hangbeiträge und Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen Damit werden die Bewirtschaftungserschwernisse in diesen Regionen berücksichtigt Voraussetzung für alle Direktzahlungen ist die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises

■ Abgeltung besonderer ökologischer Leistungen
Die ökologischen Direktzahlungen geben einen Anreiz für besondere ökologische Leistungen, die über den Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) hinausgehen Zu ihnen gehören die Öko-, Sömmerungs- und Gewässerschutzbeiträge Die Beiträge bezwecken, die Artenvielfalt in den Landwirtschaftsgebieten zu erhalten und zu erhöhen, die Nitrat- und Phosphorbelastung der Gewässer sowie die Verwendung von Hilfsstoffen zu vermindern und landwirtschaftliche Nutztiere besonders tierfreundlich zu halten
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 156 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Wirtschaftliche Bedeutung der Direktzahlungen
Die Direktzahlungen machten 1999 rund 55% der Ausgaben des BLW aus. 63% der Direktzahlungen (inkl Sömmerungsbeiträge) kamen 1999 der Berg- und Hügelregion zugute
Anmerkung: Ein direkter Vergleich mit den Angaben der Staatsrechnung ist nicht möglich Die Werte in Abschnitt 2 2 «Direktzahlungen» beziehen sich auf das gesamte Beitragsjahr; die Staatsrechnung dagegen wiedergibt die getätigten Ausgaben während eines Kalenderjahrs
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 157
Direktzahlungen
Beitragsart Total Talregion Hügelregion Bergregion 1 000 Fr Total Direktzahlungen 2 078 350 Allgemeine Direktzahlungen 1 769 482 615 686 469 647 684 149 Flächenbeiträge 1 163 094 545 168 300 104 317 822 Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 254 624 65 568 62 745 126 312 Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 255 882 2 723 72 037 181 121 Hangbeiträge 95 882 2 227 34 761 58 894 Ökologische Direktzahlungen 308 868 Ökobeiträge 241 136 124 638 68 179 48 319 Beiträge für den ökologischen Ausgleich 100 674 53 345 27 874 19 455 Beiträge für die extensive Produktion von Getreide und Raps (Extenso-Produktion) 35 135 23 360 10 443 1 332 Beiträge für den biologischen Landbau 11 637 4 382 2 384 4 871 Beiträge für die besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 93 690 43 551 27 478 22 661 Sömmerungsbeiträge 67 571 Gewässerschutzbeiträge 161
Quelle: BLW
1999
nach Regionen 1999

Die Hügel- und Bergregion ist bei den Produktionsbedingungen benachteiligt Die wichtigsten Nachteile sind:
– die kürzere Vegetationsperiode, welche geringere Erträge und höhere Aufwendungen für die Futterkonservierung sowie hohe Arbeitsspitzen zur Folge hat;
die Bewirtschaftung von Hanglagen ist aufwendiger, die Mechanisierung teurer und weniger leistungsfähig;
– die im Durchschnitt ungünstigere Verkehrslage bedingt einen höheren Zeitaufwand und Mehrkosten für Transporte, Einkäufe usw
Die erschwerende Bewirtschaftung in diesen Regionen wird mit den Beiträgen für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen, den Hangbeiträgen und den Sömmerungsbeiträgen abgegolten Folgerichtig nimmt die Summe der Direktzahlungen pro ha mit zunehmender Erschwernis zu Infolge der gleichzeitig sinkenden Erträge steigt der Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von der Tal- zur Bergregion an.
Anteil der Direktzahlungen am Rohertrag von Betrieben nach Regionen 1999
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 158
–
Merkmal Einheit Total Talregion Hügelregion Bergregion Betriebe Anzahl 3 494 1 565 1 029 900 LN im Ø ha 18,41 19,33 17,19 18,06 Allgemeine Direktzahlungen Fr 31 176 24 114 30 851 43 982 Ökobeiträge Fr 5 272 6 338 5 244 3 420 Total Direktzahlungen Fr 36 338 30 452 36 095 47 402 Rohertrag Fr 181 702 218 369 169 340 131 838 Anteil Direktzahlungen am Rohertrag % 20,1 13,9 21,6 36,0 Quelle: FAT Direktzahlungen
TalregionHügelregionBergregion F r . / h a Quelle: FAT 0 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1575 2100 2625
Tabellen 33a–34, Seiten A40–A43
■ Allgemeine Anforderungen
Anforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, welche einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben Keine Direktzahlungen gibt es für Betriebe des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sowie für Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, deren Tierbestände die Grenzen der Höchstbestandesverordnung überschreiten Ebenfalls ausgeschlossen sind juristische Personen, sofern es sich nicht um Familienbetriebe handelt (Artikel 2 Direktzahlungsverordnung)
■ Weitere Bedingungen
Die Beitragsberechtigung ist an weitere strukturelle und soziale Kriterien geknüpft. Die Übersicht fasst die Bedingungen für die Ausrichtung der Direktzahlungen stichwortartig zusammen
Bedingungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen
Mindestgrösse des Betriebes 1 ha
Spezialkulturen: 50 Aren
Reben in Steil- und Terrassenlagen: 30 Aren
Minimaler Arbeitsbedarf
Betriebseigene Arbeitskräfte
0,3 Standard-Arbeitskräfte (SAK)
Mindestens 50% der für die Bewirtschaftung erforderlichen Arbeiten mit betriebseigenen Arbeitskräften (Familie und Angestellte) ausführen
Alter des Bewirtschafters bis 65 Jahre
Beitragsbegrenzungen
Abstufung
Fläche in ha Tiere in GVE Ansatz in % bis 30 45
maximaler Betrag pro SAK 45 000 Fr
– steuerbares Einkommen
Summe der Direktzahlungen wird ab 80 000 Fr steuerbares Einkommen reduziert
Summe der Direktzahlungen wird ab 800 000 Fr massgebliches (steuerbares Vermögen, vermindert um Vermögen reduziert; übersteigt das massgebliche Vermögen 120 000 Fr pro SAK)
massgebliches Vermögen
1 Mio Fr werden keine Direktzahlungen ausbezahlt
Quelle: Direktzahlungsverordnung
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 159
–
100 30–60 45–90 75 60–90 90–135 50 über
135 0 –
90
–
Zuschläge für Hanglagen im Berggebiet/Hügelzone

0,02 SAK pro ha für biologischen Landbau wie bei LN plus 20% für Hochstamm-Feldobstbäume 0,01 SAK/10 Bäume
Quelle: Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
Die Berechnung der SAK wird mit Umrechungsfaktoren für die LN und die Nutztiere vorgenommen. Für gewisse Nutzungen wie z.B. den arbeitsaufwendigeren biologischen Landbau, gibt es Zuschläge Die Faktoren sind abgeleitet aus der standardmässigen Erfassung arbeitswirtschaftlicher Abläufe Sie sind für den Vollzug der Direktzahlungen und für die Massnahmen zur Strukturverbesserung vereinfacht worden. Für die Berechnung des effektiven Arbeitsbedarfs sind sie nicht geeignet, weil dieser von den speziellen Eigenschaften des einzelnen Betriebes wie der Oberflächengestaltung, der Arrondierung, den Gebäudeverhältnissen und dem Mechanisierungsgrad abhängt
Abstufung der Beiträge nach Artikel 20 Direktzahlungsverordnung
Die prozentuale Abstufung gilt für sämtliche Beitragsarten mit Ausnahme der Sömmerungs- und der Gewässerschutzbeiträge.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 160 Landwirtschaftliche Nutzfläche SAK/ha LN ohne Spezialkulturen 0,035 Spezialkulturen 0,400 Rebflächen in Steil- und Terrassenlage 1,000 Nutztiere SAK/GVE Milchkühe, Milchschafe, Milchziegen 0,05 Mastschweine 0,01 Zuchtschweine 0,02 andere Nutztiere 0,04
Flächenbeiträge
F r . / h a Beiträge für Raufutter verzehrende Nutztiere
F r . / R G V E 0 1 200 900 600 300 0 900 675 450 225
1–30 ha>30–60 ha>60–90 ha>90 ha
1–45 RGVE>45–90 RGVE>90–135 RGVE>135 RGVE
Seit 1999 werden Direktzahlungen nur noch an Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ausbezahlt, die den ÖLN erbringen Betriebe auf denen der ÖLN nicht erfüllt ist, erhalten noch Direktzahlungen bis zum 31 Dezember 2001 Der Flächenbeitrag wird jedoch für diese Betriebe um 800 Fr. je ha beitragsberechtigter Fläche gekürzt. Mit der Einführung des ÖLN wurden Auflagen der Integrierten Produktion (IP, Stand 1996) übernommen Zusätzlich hat der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachzuweisen, dass die Vorschriften des Tierschutzgesetzes eingehalten werden Somit ist die IP, ergänzt mit den Auflagen der Tierschutzbestimmungen, zum Standard der Landwirtschaft in der Schweiz geworden und existiert als eigene Massnahme nicht mehr
Direktzahlungen haben die Bewirtschaftungssysteme und damit die Ökologie ganz wesentlich beeinflusst. Dies zeigt die starke Abnahme der konventionell bewirtschafteten Flächen seit Beginn der ersten Etappe der Agrarreform im Jahre 1993 Mit finanziellen Anreizen wurden die IP und der biologische Landbau als eigenständige ÖkoProgramme gezielt gefördert und erreichten im Jahre 1998 einen Flächenanteil von 90% an der gesamten LN Mit der Einführung des ÖLN 1999 ist mit 95% der gesamten LN praktisch eine flächendeckende, naturnahe und umweltschonende Bewirtschaftung sichergestellt Die noch bestehende Differenz ist teilweise mit der erwähnten Übergangsfrist zu erklären
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 161
■ Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN)
ab 1993
ab 1999 IPÖLN und Beweislastumkehr
Tierschutz
199319941995199619971998 i n % Konventionell Biologischer Landbau IP Quelle:
20 10 0 30 40 50 60 70 80 90 100
Übergang von der IP zum ÖLN Freiwilliges Programm, besondere Beiträge
Mindestanforderungen für Direktzahlungen
beim
Entwicklung der LN nach Bewirtschaftungssystemen
BLW
Der ÖLN umfasst die folgenden Punkte (gemäss Anhang Direktzahlungsverordnung):
– Aufzeichnungs- und Nachweispflicht: Wer Direktzahlungen beansprucht, erbringt der kantonalen Behörde den Nachweis, dass er die ökologischen Leistungen auf dem gesamten Betrieb erfüllt Als Nachweis gilt das Attest einer vom Kanton beigezogenen Kontrollorganisation Um diese Bestätigung zu erhalten, macht der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin regelmässige Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung des Betriebs
Tiergerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere: Die Bestimmungen der Tierschutzverordnung sind einzuhalten Dabei gilt die Beweislastumkehr, das heisst der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat zu belegen, dass auf dem Betrieb das Tierschutzgesetz eingehalten wird
Ausgeglichene Düngerbilanz: Um die Nährstoffverluste in die Umwelt zu verringern und möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe zu erzielen, muss die Stickstoff- und Phosphorzufuhr aufgrund des Bedarfs der Pflanzen und des Produktionspotenzials des Betriebs berechnet werden So wird ein Überschuss vermieden Eine Toleranzgrenze von 10% wird gewährt
Mindestens alle zehn Jahre sind parzellenweise Bodenanalysen durchzuführen, um die Nährstoffreserven im Boden und die zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit notwendige Düngermenge zu ermitteln.
– Angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (ÖAF): Mindestens 3,5% der LN bei Spezialkulturen und 7% bei der übrigen LN sind mit ÖAF zu belegen Entlang von Wegen sind Wiesenstreifen von mindestens 0,5 m und entlang von Oberflächengewässern, Hecken, Feldgehölzen, Ufergehölzen und Waldrändern von mindestens 3 m zu belassen
Geregelte Fruchtfolge: Zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit der Pflanzen muss die Fruchtfolge jedes Jahr mindestens vier Kulturen umfassen Zudem ist für Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche ein Höchstanteil der Hauptkulturen an der Ackerfläche oder Anbaupausen vorgeschrieben

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 162
–
–
–
Beispiele von Höchstanteilen in % der Ackerfläche Getreide (ohne Mais und Hafer) 66 Weizen und Korn 50 Mais 40 Hafer 25 Rüben 25 Kartoffeln 25
■ Einhaltung von Gesetzen
– Geeigneter Bodenschutz: Für jede Kultur ist ein Bodenschutzindex festgelegt. Damit Bodenerosion, Nährstoffverluste und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln verringert werden, muss jeder Betrieb mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche einen minimalen mittleren Bodenschutzindex erreichen. Beim Ackerbau beträgt dieser 50 Punkte, beim Gemüsebau 30 Punkte Die Stichtage sind jeweils der 15 November und der 15 Februar
Beispiele für den Bodenschutzindex im Ackerbau
– Auswahl und gezielte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: Pflanzenschutzmittel können in die Luft, den Boden und die Gewässer gelangen und nachteilige Auswirkungen auf Organismen haben Daher sind natürliche Regulationsmechanismen und biologische Verfahren vorzuziehen. Die mit gewissen Verwendungseinschränkungen zugelassenen Produkte werden in einer regelmässig aktualisierten Liste aufgeführt
Wird die Einhaltung landwirtschaftsrelevanter Vorschriften wie diejenigen des Gewässer-, des Umwelt- sowie des Natur- und Heimatschutzgesetzes verletzt, kommt zusätzlich zur Busse eine Kürzung oder sogar eine Verweigerung der Direktzahlungen hinzu.
Einige Beispiele von Vorschriften, deren Verletzung Sanktionen zur Folge haben können:
– Einhaltung der Sorgfaltspflicht um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden (Artikel 3 Gewässerschutzgesetz);
Verbot, Stoffe die Gewässer verunreinigen können in ein Gewässer einzubringen, oder versickern zu lassen oder so zu lagern oder auszubringen, dass dadurch die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers entsteht (Artikel 6 Gewässerschutzgesetz);
Nichteinhalten der DGVE-Grenzwerte nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz (gemessen an der düngbaren LN);
Nicht vorschriftsgemässe Lagerkapazität für Hofdünger nach Artikel 14 Gewässerschutzgesetz;
– Nicht funktionstüchtige oder undichte Lageranlagen für Hofdünger nach Artikel 28 Gewässerschutzverordnung;
– Permanente Lagerung von Mist im Feld (>3 Monate)
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 163
Punkte Raps 80 Wintergerste, Triticale, Roggen, Winterhafer 50 Winterweizen, Korn 40 Kunstwiese bis 15 November 80 Kunstwiese bis 15 Februar 100
–
–
–
Verstösse gegen die Vorschriften werden je nach Vorgeschichte und Wirkung der Widerhandlung im Einzelfall einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet:
erstmalige Verstösse ohne Dauerwirkung. Beispiel: Einmaliges gewässerschutzwidriges Güllen (Kürzung um 5 bis 25%, höchstens 2‘500 Fr );
erstmalige Verstösse, deren Wirkung andauert oder deren Handlung oder Unterlassung sich über eine mehrere Tage, Wochen oder Monate umfassende Zeitspanne erstreckt Beispiel: Unbefestigter Miststock Mehrmaliges gewässerschutzwidriges Güllen an verschiedenen Tagen (Kürzung um 10 bis 50%, höchstens 10‘000 Fr );
wiederholte Verstösse, also Widerhandlungen gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von drei Jahren Massgebend sind die Vorfälle ab dem Jahr 1999 (Kürzung um 20 bis 100%).
Vollzug und Kontrolle
Die Kontrolle über den ökologischen Leistungsnachweis wird mit Artikel 66 der Direktzahlungsverordnung an die Kantone delegiert Diese können Organisationen, die für eine sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten, zum Vollzug beiziehen Sie müssen diese Organisationen stichprobenweise überprüfen. Absatz 4 präzisiert, nach welchen Kriterien die Kantone oder die beigezogenen Organisationen die Betriebe zu kontrollieren haben
Zu kontrollieren sind:
– alle Betriebe, welche die entsprechenden Beiträge zum ersten Mal beanspruchen;
alle Betriebe, bei deren Kontrolle im Vorjahr Mängel festgestellt wurden und
– mindestens 30% der übrigen Betriebe, die nach dem Zufallsprinzip auszuwählen sind.
Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, welche falsche Angaben über den Betrieb machen oder die an die Beiträge geknüpften Anforderungen nicht oder nur teilweise erfüllen, werden seit 1999 nach einheitlichen Kriterien sanktioniert Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz hat ein entsprechendes Sanktionsschema erlassen
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 164
–
–
–
–
■ Durchgeführte Kontrollen 1999
Von den Kantonen bzw. den von ihnen beauftragten Kontrollstellen wurden 1999 rund 30'000 Betriebe, davon 4‘500 Biobetriebe, auf die Einhaltung des ÖLN kontrolliert Im Weiteren wurden 58,2% der Betriebe, die ihren Tieren regelmässig Auslauf im Freien (RAUS) gewähren sowie 58,5% der Betriebe, die ihre Tiere in besonders tierfreundlichen Ställen (BTS) halten, kontrolliert
Gesamthaft wurden knapp 4’000 Verstösse festgestellt Dies hatte Beitragskürzungen von 8,2 Mio Fr zur Folge In diesem Betrag nicht enthalten sind Rückbehalte bei nicht beitragsberechtigten Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen sowie nicht ausbezahlte Beiträge, die auf Grund von falschen Angaben bei der Anmeldung verweigert wurden Verstösse gab es hauptsächlich in den folgenden Bereichen: ÖLN-Anforderungen, beim RAUS-Programm, beim ökologischen Ausgleich, bei den BTS-Bedingungen, bei den allgemeinen Bedingungen der Gewässer- und Tierschutzgesetzgebung sowie bei den Grundanforderungen
15 15 000 Missachtung der Bewirtschaftungsauflagen
100 65 000 Stall- und Haltungsvorschriften nicht erfüllt, Lichtverhältnisse, Weidetage
540 6 750 000 mangelhafte Aufzeichnungen, ungenügender ökologischer Ausgleich, nicht ausgeglichene Nährstoffbilanz, fehlende Bodenanalysen, unkorrekte Fruchtfolge, andere nicht spezifizierte Gründe ÖAF 540 186 000 Missachtung von Schnittzeitpunkt, falsche Flächenangaben, zu späte oder unkorrekte Anmeldung, verbotene Düngung Extenso
13 8 900 fehlende Aufzeichnungen
17 6 500 keine Angaben möglich
110 31 000 nicht konforme Stallungen, ungenügender Liegebereich, andere nicht spezifizierte Gründe RAUS 254 65 000 zu wenig Auslauf- resp. Weidetage, fehlende Aufzeichnungen, ungenügender Auslauf
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 165
Zusammenstellung der Verstösse Kategorie Verstösse Sanktionen Hauptgründe Anzahl Fr Grunddaten 200 670 000 falsche Flächenangaben, zu späte Anmeldung, falsche Angaben zum Milchkontingent, nicht beitragsberechtigter Bewirtschafter Gewässerschutz 170 378 000 ungenügender Hofdüngerlagerraum, mangelhafte Lagerstätten
Natur und Heimatschutz
Tierschutz
Umweltschutz 15
ÖLN
1 Gefährdung von Gewässern
2
Bio 2
BTS
Total 3 974 8 175 000
1 keine Angabe möglich 2 Angaben von 7 Kantonen
Sonderbewilligungen
Die kantonalen Pflanzenschutzfachstellen können gestützt auf die Direktzahlungsverordnung Sonderbewilligungen ausstellen. Im Jahre 1999 gab es für 2’771 ha LN 2’270 Sonderbewilligungen Am meisten bewilligt wurde die Behandlung von Verunkrautung in Naturwiesen oder in Neuansaaten von Kunstwiesen Dabei ging es vor allem um die Blackenbekämpfung
Erteilte Sonderbewilligungen 1999

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 166
Produkt Bewilligungen Anteil Anzahl % Vorlauf-Herbizide 84 3,7 Insektizide 302 13,3 Mais-Granulate 93 4,1 Rüben-Granulate 7 0,3 Wiesen-Herbizide 1 435 63,2 Andere 349 15,4 Total 2 270 100
2.2.2 Allgemeine Direktzahlungen
Flächenbeiträge
Die Flächenbeiträge gelten die gemeinwirtschaftlichen Leistungen wie Schutz und Pflege der Kulturlandschaft, Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion und Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen ab Die Beiträge sind nicht differenziert nach Nutzung der Flächen und nach den Regionen Für die Erschwernisse in der Hügel- und Bergregion erhalten die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen die Hangbeiträge und die Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen
Für angestammte Flächen in der ausländischen Wirtschaftszone reduzieren sich die Ansätze bei allen flächengebundenen Direktzahlungen um 25% Insgesamt handelt es sich um 5‘128 ha, welche seit 1984 in der ausländischen Grenzzone bewirtschaftet werden
Flächenbeiträge 1999
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 167 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Ansätze 1999 Fr /ha – bis 30 ha 1 200 – 30 bis 60 ha 900 – 60 bis 90 ha 600 – über 90 ha 0
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Fläche ha 480 769 261 164 280 012 1 021 945 Betriebe Anzahl 25 766 16 430 18 500 60 696 Fläche pro Betrieb ha 19 16 15 17 Beitrag pro Betrieb Fr 21 158 18 266 17 180 19 163 Total Beiträge 1 000 Fr 545 168 300 104 317 822 1 163 094 Quelle: BLW
■ Flächendeckende Bewirtschaftung als Ziel
Tabellen 27a–27b, Seiten A28–A29
Flächennutzung mit Grünland
Verteilung der Betriebe und der LN nach Grössenklassen
Auf 7,3% der LN wirkt die Kürzung aufgrund des gestaffelten Beitragsansatzes Im Durchschnitt wird ein Flächenbeitrag von 1'138 Fr ausbezahlt Die Betriebe bis 10 ha bewirtschaften insgesamt 11,2% der LN
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere
Die Massnahme hat zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Fleischproduktion auf Raufutterbasis zu erhalten und gleichzeitig im Grasland Schweiz die flächendeckende Pflege durch Nutzung sicherzustellen
Die Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere werden ausgerichtet für Tiere, die während der Winterfütterung (Referenzperiode: 1 Januar bis Stichtag des Beitragsjahrs) auf einem Betrieb gehalten werden. Als Raufutter verzehrende Nutztiere gelten Tiere der Rinder- und der Pferdegattung sowie Schafe, Ziegen, Bisons, Hirsche, Lamas und Alpakas Die Beiträge werden für Dauergrün- und Kunstwiesenfläche bezahlt: Die verschiedenen Tierkategorien werden umgerechnet in Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten (RGVE)
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 168
>90 Betriebe in %LN in % 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 bis 5 Quelle: BLW G r ö s s e n k l a s s e n i n h a LN mit vollen Beiträgen LN von der Beitragsdegression betroffen 302010 0 102030 0,2 1,11,5 (1,1 17,4 26,7 19,0 17,1 9,2 9,7 0,6 0,1 18,5 18,3 23,1 20,1 9,52,0 5,0 0,4) (0,20,20,8 0,4) 0,2 0,1 0,61,11,5 0,8
Begrenzung der Förderung RGVE/ha – in der Ackerbauzone, der erweiterten Übergangszone und der Übergangszone 2,0 – in der Hügelzone 1,6 – in der Bergzone I 1,4 – in der Bergzone II 1,1 – in der Bergzone III 0,9 – in der Bergzone IV 0,8 – Heuwiesen im Sömmerungsgebiet 0,7 ■
Die Abstufung der Beitragsbegrenzung nach Zonen orientiert sich einerseits am höchstzulässigen Tierbesatz gemäss Gewässerschutzrichtlinien und berücksichtigt andererseits das abnehmende Ertragspotential Durch die Staffelung wirken die Beiträge produktionsneutral, tragen aber wesentlich zu einer flächendeckenden Bewirtschaftung bei
Beitragsberechtigt ist, wer mindestens eine RGVE auf seinem Betrieb hält Die RGVE sind in zwei Beitragsgruppen aufgeteilt Für Tiere der Rindvieh- und der Pferdegattung, Bisons, Milchziegen und Milchschafe werden 900 Fr und für die übrigen Ziegen und Schafe, sowie Hirsche, Lamas und Alpakas 400 Fr je RGVE ausgezahlt Der Beitrag pro RGVE für Tiere, welche einen höheren Arbeits- und Gebäudeaufwand verlangen, ist höher angesetzt als für die Tiere mit niedrigem Aufwand.

Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere 1999
Die Beiträge ersetzen die bis 1998 ausbezahlten Beiträge an Kuhhalter, welche keine Milch zur Vermarktung abliefern Neu wird der Beitrag nicht nur für Kühe, deren Milch nicht vermarktet wird, sondern auch für andere Raufutter verzehrende Tiere bezahlt Betriebe, die Kühe halten, deren Milch abgeliefert wird, profitieren von der Marktstützung im Milchbereich Diese Kühe werden von den Beiträgen ausgeschlossen, indem pro 4‘000 kg im Vorjahr abgelieferte Milch eine RGVE in Abzug gebracht wird Bei den Milchproduzenten, die in den Genuss dieser Beiträge kommen, handelt es sich um solche mit einem relativ hohen Anteil an Aufzucht- oder Masttieren im Vergleich zu den Kühen und einer genügenden Grünfläche, also um eher extensiv bewirtschaftete Betriebe
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 169
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Zu Beiträgen berechtigte RGVE Anzahl 74 419 70 599 144 449 289 467 Betriebe Anzahl 10 815 11 412 16 541 38 768 Zu Beiträgen berechtigte RGVE pro Betrieb Anzahl 6,9 6,2 8,7 7,5 Beitrag pro Betrieb Fr 6 063 5 498 7 636 6 568 Total Beiträge 1 000 Fr 65 568 62 745 126 312 254 624 Quelle: BLW
Beiträge für Betriebe mit und ohne vermarktete Milch 1999
Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen
■ Abgeltung der Produktionserschwernisse
Mit den Beiträgen werden die erschwerenden Produktionsbedingungen der Viehhalter im Berggebiet und in der Hügelzone ausgeglichen Im Gegensatz zu den allgemeinen Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, bei welchen die Flächennutzung mit Grünland im Vordergrund steht (Pflege durch Nutzung), werden bei dieser Massnahme auch soziale, strukturelle und siedlungspolitische Ziele verfolgt Beitragsberechtigt sind jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, die mindestens 1 ha LN in der Hügel- oder Bergregion bewirtschaften und zugleich mindestens 1 RGVE halten. Beitragsberechtigt sind dieselben Tierkategorien wie bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere Die Massnahme begünstigt kleinere Betriebe, indem die Beiträge nur für höchstens 15 RGVE je Betrieb ausgerichtet werden Die Beitragsansätze sind nach Zonen differenziert
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 170
Merkmal Einheit Betriebe mit Betriebe ohne vermarkteter Milch vermarktete Milch Betriebe Anzahl 23 903 14 865 Tiere pro Betrieb RGVE 22,1 12,1 Abzug aufgrund Beitragsbegrenzung der Grünlandfläche RGVE 1,2 1,5 Milchabzug RGVE 15,3 0,1 Tiere zu Beiträgen berechtigt RGVE 5,6 10,5 Beitrag pro Betrieb Fr 4 930 9 201 Quelle: BLW
Ansätze pro RGVE 1999 Fr /ha – in der Hügelzone 260 – in der Bergzone I 440 – in der Bergzone II 690 – in der Bergzone III 930 – in der Bergzone IV 1 190
Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerenden Produktionsbedingungen 1999

1 Betriebe die einen Teil der Fläche in der Berg- und Hügelregion bewirtschaften
Verteilung der Raufutter verzehrenden Nutztiere unter erschwerenden Produktionsbedingungen nach Grössenklassen
BLW
BLW
Insgesamt liegen 36,5% des Viehbestandes der beitragsberechtigten Betriebe über 15 RGVE Etwas mehr als ein Drittel der RGVE ist somit nicht beitragsberechtigt
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 171
Merkmal Einheit Talregion1 Hügelregion Bergregion Total Zu Beiträgen berechtigte RGVE Anzahl 29 633 207 304 218 240 455 177 Betriebe Anzahl 2 074 15 648 17 971 35 693 RGVE pro Betrieb Anzahl 14,3 13,2 12,1 12,7 Beitrag pro Betrieb Fr 1 313 4 603 10 079 7 161 Total Beiträge 1 000 Fr 2 723 72 037 181 121 255 882
Quelle:
G r ö s s e n k l a s s e n i n R G V E RGVE mit Beitrag RGVE ohne Beitrag 15010050050150100200250 45–90 30–45 20–30 15–20 10–15 5–10 bis 5 27 7193 131 10118 732 41 1 7 88 46 16 69 60 58 20 83 65 Betriebe in 100Tiere in RGVE in 1 000
Quelle:
■ Allgemeine Hangbeiträge: Zur Abgeltung erschwerender Flächenbewirtschaftung
Hangbeiträge

Mit den allgemeinen Hangbeiträgen werden die Erschwernisse der Flächenbewirtschaftung abgegolten Sie werden nur für Wies-, Streu- und Ackerland ausgerichtet Die Wiesen und Streueflächen müssen jährlich mindestens ein Mal gemäht werden Ausgeschlossen sind die Hecken und Feldgehölze sowie Weiden und Rebflächen
Anrecht auf Hangbeiträge haben jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, auf deren Betrieb die Gesamtfläche mit Hangneigung in der Hügel- oder Bergregion mehr als 50 Aren und pro Bewirtschaftungsparzelle mehr als 5 Aren misst Die Hanglagen sind in zwei Neigungstufen unterteilt.
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 172
Ansätze 1999 Fr./ha – Neigung 18 bis 35% 370 – Neigung über 35% 510
Beiträge für Hangflächen 1999
■ Hangbeiträge: Zur Erhaltung der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen
Die rund 34'000 beitragsberechtigten Betriebe weisen auf 42,3% ihrer LN eine Hangneigung von über 18% aus Auf die ganze Schweiz bezogen betragen die Flächen der Hang- und Steillagen 22,4% der LN, für die Flächenbeiträge ausgerichtet werden
Die Hangbeiträge für Reben tragen dazu bei, Rebberge in Steil- und Terrassenlagen zu erhalten Um den Verhältnissen der unterstützungswürdigen Rebflächen gerecht zu werden, wird für die Bemessung der Beiträge unterschieden zwischen den steilen Reblagen, den besonders steilen Reblagen und den Rebterrassen auf Stützmauern Diese Eigenschaften sind einerseits bedeutend für das Landschaftsbild und erschweren anderseits die Bewirtschaftung Beiträge für den Rebbau in Steil- und Terrassenlagen werden für Flächen mit einer Hangneigung von 30% und mehr ausgerichtet.
Als Terrassenlagen gelten Rebflächen ab 30% Neigung, welche mit Stützmauern regelmässig abgestuft sind und die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
– die Flächen weisen eine minimale Terrassierung auf, das heisst höchstens 30 m Abstand zwischen den Stützmauern;
– die Terrassenlage misst mindestens eine ha;
– die Stützmauern müssen mindestens 1 m hoch sein, gewöhnliche Betonmauern werden nicht berücksichtigt
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 173
Merkmal Einheit Talregion 1 Hügelregion Bergregion Total Zu Beiträgen berechtigende Flächen: – Neigung 18 bis 35% ha 4 349 68 242 73 416 146 007 – Neigung über 35% ha 1 268 19 075 62 549 82 892 Total ha 5 618 87 316 135 964 228 898 Betriebe Anzahl 2 032 14 568 17 303 33 903 Beitrag pro Betrieb Fr 1 096 2 386 3 404 2 828 Total Beiträge 1 000 Fr 2 227 34 761 58 894 95 882
1 Betriebe mit Flächen in der Berg- und Hügelregion Quelle: BLW
Betriebe mit Hangbeiträgen 1999
unter 18% Neigung 57,7% 35% und mehr Neigung 15,3% 18–35% Neigung 27,0%
Quelle: BLW
Total 541 800 ha
Hangbeiträge für Rebflächen erhalten jene Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, deren beitragsberechtigte Rebfläche mehr als 10 Aren und pro Bewirtschaftungsparzelle mehr als 2 Aren misst Die Beitragsansätze sind zonenunabhängig
Beiträge für Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen 1999
Der Anteil der Rebflächen in Steil- und Terrassenlagen an der gesamten Rebfläche beträgt 31,8% und der Anteil Betriebe gemessen an der Gesamtzahl aller Rebbaubetriebe 57,2%

2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 174
Ansätze 1999 Fr /ha – für Flächen mit 30 bis 50% Neigung 1 500 – für Flächen mit über 50% Neigung 3 000 – für Flächen in Terrassenlagen 5 000
Merkmal Einheit Zu Beiträgen berechtigende Flächen total ha 3 122 Steillagen 30 bis 50% Neigung ha 1 601 Steillagen über 50% Neigung ha 340 Terrassenlagen ha 1 181 Betriebe Anzahl 2 650 Fläche pro Betrieb ha 1,18 Beitrag pro Betrieb Fr 3 519 Total Beiträge 1 000 Fr 9 325 Quelle: BLW
2.2.3 Ökologische Direktzahlungen
Ökobeiträge
Die Ökobeiträge gelten besondere ökologische Leistungen ab, deren Anforderungen über diejenigen des ÖLN hinausgehen Den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen werden Programme angeboten, bei denen sie freiwillig mitmachen können Die einzelnen Programme sind von einander unabhängig und die Beiträge können kumuliert werden
Verteilung der Ökobeiträge auf die verschiedenen Programme 1999
RAUS 30%
BTS 9%
Biologischer Landbau 5%
Ökologischer Ausgleich
Ökologischer Ausgleich 41%
Extensive Produktion von Getreide und Raps 15%
Quelle: BLW
Mit der Förderung des ökologischen Ausgleichs soll der Lebensraum für die vielfältige einheimische Fauna und Flora in den Landwirtschaftsgebieten erhalten bleiben und wo möglich wieder vergrössert werden Der ökologische Ausgleich trägt auch zur Erhaltung der typischen Landschaftsstrukturen und -elemente bei Gewisse Elemente des ökologischen Ausgleichs werden mit Beiträgen abgegolten und können gleichzeitig angerechnet werden für den obligatorischen ökologischen Ausgleich des ÖLN Daneben gibt es Elemente, die nur für den ökologischen Ausgleich beim ÖLN anrechenbar sind
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 175 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tabellen 28a–28b, Seiten A30–A31
Tabellen 29a–29d, Seiten A32–A35
Total 241,1 Mio. Fr.
Elemente des ökologischen Ausgleichs mit und ohne Beiträge
Elemente mit Beiträgen und beim ÖLN anrechenbar Elemente ohne Beiträge, nur beim ÖLN anrechenbar extensiv genutzte Wiesen extensiv genutzte Weiden wenig intensiv genutzte Wiesen
Waldweiden
Streueflächen einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen
Hecken, Feld- und Ufergehölze Wassergräben, Tümpel, Teiche
Buntbrachen
Rotationsbrachen
Ackerschonstreifen
Hochstamm-Feldobstbäume
Ruderalflächen, Steinhaufen und -wälle
Trockenmauern
unbefestigte natürliche Wege
Rebflächen mit hoher Artenvielfalt weitere, von der kantonalen Naturschutzfachstelle definierte ökologische Ausgleichsflächen
Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und dürfen während sechs Jahren jeweils frühestens Mitte Juni genutzt werden Das späte Mähen soll gewährleisten, dass die Samen zur Reife gelangen und die Artenvielfalt durch natürliche Versamung gefördert wird. Es lässt auch zahlreichen wirbellosen Tieren, bodenbrütenden Vögeln und kleinen Säugetieren genügend Zeit zur Reproduktion Das Düngen ist verboten und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, mit Ausnahme der Einzelstockbehandlung von Problemunkräutern, verboten.
Für extensiv genutzte Wiesen, Streueflächen, Hecken, Ufer- und Feldgehölze werden, abgestuft nach Zonen, die gleich hohen Beiträge ausbezahlt
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 1999
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 176
Ansätze 1999 Fr /ha – Ackerbau- und Übergangszonen 1 500 – Hügelzone 1 200 – Bergzonen I und II 700 – Bergzonen III und IV 450
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 16 284 8 211 8 906 33 401 Fläche ha 14 743 7 021 12 384 34 148 Fläche pro Betrieb ha 0,91 0,86 1,39 1,02 Beitrag pro Betrieb Fr. 1 320 850 726 1 046 Total Beiträge 1 000 Fr 21 494 6 978 6 462 34 934 Quelle: BLW
Extensiv genutzte Wiesen
■
■ Streueflächen
Als Streueflächen gelten extensiv genutzte Grünflächen auf Feucht- und Nassstandorten, welche in der Regel im Herbst oder Winter zur Streuenutzung gemäht werden Es gelten grundsätzlich die gleichen Bewirtschaftungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen. Die Flächen dürfen jedoch erst ab dem 1. September gemäht werden.
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 1999
Als Hecken, Ufer- oder Feldgehölze gelten Nieder-, Hoch- oder Baumhecken, Windschutzstreifen, Baumgruppen, bestockte Böschungen und heckenartige Ufergehölze Die Flächen müssen mindestens 5 Aren messen und während sechs Jahren ununterbrochen entsprechend bewirtschaftet werden. Sie müssen regelmässig zurückgeschnitten oder maximal zu einem Drittel jährlich auf den Stock gesetzt werden Verboten sind sowohl die Düngung als auch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Entlang dieser ökologischen Ausgleichsflächen ist ein ungedüngter Krautsaum von mindestens 3 m Breite anzulegen
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 1999

Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 1 478 1 421 2 443 5 342 Fläche ha 1 431 1 014 2 268 4 713 Fläche pro Betrieb ha 0,97 0,71 0,93 0,88 Beitrag pro Betrieb Fr 1 432 673 572 836 Total Beiträge 1 000 Fr 2 116 956 1 396 4 468 Quelle: BLW
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 5 066 2 517 1 148 8 731 Fläche ha 1 249 679 356 2 283 Fläche pro Betrieb ha 0,25 0,27 0,31 0,26 Beitrag pro Betrieb Fr 365 274 200 317 Total Beiträge 1 000 Fr 1 847 690 230 2 767 Quelle:
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 177
BLW
■ Hecken, Ufer- und Feldgehölze
Wenig intensiv genutzte Wiesen dürfen in einem gewissen Ausmass mit Hofdünger gedüngt werden Daneben gelten die selben Nutzungsvorschriften wie für extensiv genutzte Wiesen
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 1999

Als Buntbrache gelten mehrjährige, mit einheimischen Wildkräutern angesäte Streifen. Die Düngung dieser Streifen ist verboten Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind Ab dem zweiten Standjahr dürfen sie zwischen dem 1 Oktober und dem 15 März zur Hälfte geschnitten werden Buntbrachen dienen dem Schutz bedrohter Wildkräuter. In ihnen finden auch Insekten und andere Kleinlebewesen Lebensraum und Nahrung Zudem bieten sie Hasen und Vögeln Deckung
1999 wurden pro ha 3’000 Fr. bezahlt. Beiträge werden nur für Flächen in der Tal- und Hügelregion ausgerichtet Innerhalb der Hügelregion sind die Flächen der Bergzone I nicht beitragsberechtigt
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 178
Ansätze 1999 Fr /ha – Ackerbau- bis Hügelzone 650 – Bergzonen I und II 450 – Bergzonen III und IV 300
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 10 775 9 530 10 939 31 244 Fläche ha 9 397 8 686 22 305 40 388 Fläche pro Betrieb ha 0,87 0,91 2,04 1,29 Beitrag pro Betrieb Fr 560 504 695 590 Total Beiträge 1 000 Fr 6 032 4 806 7 607 18 445 Quelle: BLW
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 1 108 199 21 1 309 Fläche ha 661 84 0 745 Fläche pro Betrieb ha 0,60 0,42 0,14 0,57 Beitrag pro Betrieb Fr 1 788 1 270 405 1 707 Total Beiträge 1 000 Fr. 1 981 253 1 2 235 1 Hier handelt es sich um Betriebe, die Flächen in der Hügel- oder Talregion bewirtschaften Quelle: BLW
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 1999
Wiesen ■ Buntbrache
■ Wenig intensiv genutzte
■ Rotationsbrache
Als Rotationsbrache gelten ein- bis zweijährige, mit einheimischen Ackerwildkräutern angesäte Flächen In geeigneten Lagen ist auch die Selbstbegrünung möglich Die Düngung dieser Streifen ist verboten Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie nicht mit angemessenem Aufwand mechanisch bekämpfbar sind Bei grossen Unkrautproblemen kann die kantonale Behörde mit einer Sonderbewilligung eine chemische Unkrautbekämpfung zulassen Rotationsbrachen dürfen zwischen dem 1 Oktober und dem 15 März geschnitten werden In Rotationsbrachen finden bodenbrütende Vögel, Hasen und Insekten Lebensraum
1999 wurden pro ha 2’500 Fr ausgerichtet Beiträge gibt es nur für Flächen in der Talund Hügelregion. Innerhalb der Hügelregion sind die Flächen der Bergzone I nicht beitragsberechtigt
■ Ackerschonstreifen
Ackerschonstreifen bieten den traditionellen Ackerbegleitpflanzen Raum zum Überleben Als Ackerschonstreifen gelten 3 bis 12 m breite mit Ackerkulturen angesäte extensiv genutzte Randstreifen. Verboten ist der Einsatz von Stickstoffdüngern und Insektiziden sowie die breitflächige chemische oder mechanische Unkrautbekämpfung Problemunkräuter dürfen mittels Einzelstockbehandlung chemisch bekämpft werden, falls sie nicht mit angemessenem Aufwand mechanisch bekämpfbar sind. Als Saaten eignen sich Getreide (ausser Mais), Raps, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Soja
1999 wurden pro ha 1’000 Fr bezahlt Beiträge gibt es nur für Flächen in der Tal- und Hügelregion Innerhalb der Hügelregion sind die Flächen der Bergzone I nicht beitragsberechtigt
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge
1999
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 179
Betriebe, Flächen und Beiträge 1999 Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 266 41 0 307 Fläche ha 294 34 0 328 Fläche pro Betrieb ha 1,11 0,84 0 1,07 Beitrag pro Betrieb Fr 2 764 2 090 0 2 674 Total Beiträge 1 000 Fr 735 86 0 821 Quelle: BLW
Beitragsberechtigte
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 210 35 0 245 Fläche ha 53 60 59 Fläche pro Betrieb ha 0,25 0,17 0 0,24 Beitrag pro Betrieb Fr 251 174 0 240 Total Beiträge 1 000 Fr 53 60 59 Quelle: BLW
■ Hochstamm-Feldobstbäume
Beiträge werden ausgerichtet für hochstämmige Kern- und Steinobstbäume. Kastanien- und Nussbäume in gepflegten Selven geben ebenfalls Anrecht auf Beiträge Die Beitragsberechtigung besteht ab einer Mindestzahl von 20 Bäumen Die Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume können mit jenen für extensiv oder wenig intensiv genutzte Wiesen kumuliert werden
1999 wurden pro Baum 15 Fr bezahlt
Betriebe, Bäume und Beiträge 1999

Total 82 665 ha
0,1% Rotationsbrachen 0,4%
Buntbrachen 0,9%
Aufteilung der ökologischen Ausgleichsflächen1 1999 Extensiv genutzte Wiesen 41,3%
Wenig intensiv genutzte Wiesen 48,9%
1 ohne Hochstamm-Feldobstbäume und ohne extensiv genutzte Wiesen auf stillgelegtem Ackerland
Feld- und Ufergehölze 2,8% Quelle: BLW
5,7%
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 180
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 18 233 13 398 5 417 37 048 Bäume Anzahl 1 272 781 939 847 250 606 2 463 234 Bäume pro Betrieb Anzahl 69,81 70,15 46,26 66,49 Beitrag pro Betrieb Fr. 1 047 1 052 694 997 Total Beiträge 1 000 Fr 19 088 14 098 3 759 36 945 Quelle: BLW
Beitragsberechtigte
Streuefläche
Ackerschonstreifen
Extensive Produktion von Getreide und Raps
Diese Massnahme hat zum Ziel, den Anbau von Getreide und Raps unter Verzicht auf Wachstumsregulatoren, Fungizide, chemisch-synthetische Stimulatoren der natürlichen Abwehrkräfte und auf Insektizide zu fördern Diese Anforderungen sind auf der gesamten Brotgetreide-, Futtergetreide- oder Rapsfläche eines Betriebes einzuhalten Die Ernte zur Körnergewinnung muss im reifen Zustand erfolgen, und die Kulturen dürfen nicht stark verunkrautet sein

1999 wurden pro ha 400 Fr ausgerichtet
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 1999
Aufteilung der Extensofläche 1999
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 181
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 13 218 7 824 1 496 22 538 Fläche ha 58 316 26 115 3 330 87 761 Fläche pro Betrieb ha 4,41 3,34 2,23 3,89 Beitrag pro Betrieb Fr 1 767 1 335 890 1 559 Total Beiträge 1 000 Fr 23 360 10 444 1 332 35 136 Quelle: BLW Tabelle 30 Seite A36
Brotgetreide 48% Raps 4% Futtergetreide 48% Quelle: BLW Total
87 761 ha
Biologischer Landbau
Ergänzend zu den am Markt erzielbaren Mehrerlösen fördert der Bund den biologischen Landbau als besonders umweltfreundliche Produktionsform. Um Beiträge zu erhalten, müssen die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der Bio-Verordnung vom 22 September 1997 erfüllen Eine schrittweise Umstellung ist nur bei Betrieben mit Wein-, Obst-, Gemüseproduktion oder Zierpflanzenanbau möglich Gefordert wird unter anderem der Verzicht auf chemisch-synthetische Hilfsstoffe Für den Landwirt ist es deshalb besonders wichtig, die natürlichen Kreisläufe und Verfahren zu berücksichtigen
1999 umfasste der biologische Landbau 7,3% der gesamten LN.
Beitragsberechtigte Betriebe, Flächen und Beiträge 1999
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche nach Region 1999
Total 78 454 ha
Talregion 20%
Bergregion 59%
Hügelregion 21%
Quelle: BLW
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 182
Ansätze 1999 Fr./ha – Spezialkulturen 1 000 – Offene Ackerfläche ohne Spezialkulturen 600 – Grün- und Streueflächen 100
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 955 1 066 2 723 4 744 Fläche ha 15 296 16 683 46 476 78 454 Fläche pro Betrieb ha 16,02 15,65 17,07 16,54 Beitrag pro Betrieb Fr 4 588 2 237 1 789 2 453 Total Beiträge 1 000 Fr 4 382 2 384 4 871 11 637 Quelle: BLW
Tabelle 28a, Seite A30
■ Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)
Besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere
Mit diesen Massnahmen werden Betriebe gefördert, in denen die Nutztiere auf besonders tierfreundliche Art gehalten werden oder regelmässig Auslauf haben
Gefördert werden Haltungssysteme, welche wesentlich über das von der Tierschutzgesetzgebung verlangte Niveau hinausgehen Es gelten die folgenden Grundsätze:
– die Tiere werden frei in Gruppen gehalten; – den Tieren stehen ihrem natürlichen Verhalten angepasste Ruhe-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung;
– die Ställe verfügen über genügend natürliches Tageslicht
Beitragsberechtigte Betriebe, Tiere (GVE), und Beiträge 1999
■ Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)
Gefördert werden Betriebe, welche ihren Nutztiere regelmässigen Auslauf im Freien gewähren Für die verschiedenen Tierarten gelten die folgenden Anforderungen:

Raufutter verzehrende Nutztiere
– Auslauf an mindestens 26 Tagen im Monat während der Vegetationsperiode
Auslauf an mindestens 13 Tagen im Monat während der Winterfütterungsperiode
Schweine
Auslauf an mindestens 3 Tagen in der Woche
Geflügel
täglicher Auslauf
2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 183
Ansätze 1999 Fr /GVE – Tiere der Rindergattung, Ziegen, Kaninchen 70 – Schweine 135 – Geflügel 180
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 5 783 3 431 1 691 10 905 GVE Anzahl 136 336 62 623 26 474 225 434 GVE pro Betrieb Anzahl 23,58 18,25 15,66 20,67 Beitrag pro Betrieb Fr 2 201 1 748 1 347 1 926 Total Beiträge 1 000 Fr 12 729 5 996 2 277 21 002 Quelle: BLW
–
–
–
Tabelle 31, Seite A37
■ Beteiligung verschiedener Tierkategorien am BTS- und RAUSProgramm
Für alle Tierkategorien müssen Weide, Laufhof, Aussenklimabereich und Stall den Bedürfnissen der Tiere entsprechen
Beitragsberechtigte Betriebe, Tiere (GVE), und Beiträge 1999
Beteiligung RAUS 1999
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 184
Ansätze 1999 Fr /GVE – Raufutter verzehrende Tiere, Kaninchen 135 – Schweine 135 – Geflügel 180
Merkmal Einheit Talregion Hügelregion Bergregion Total Betriebe Anzahl 9 457 7 493 8 845 25 795 GVE Anzahl 229 258 158 418 150 992 538 667 GVE pro Betrieb Anzahl 24,24 21,14 17,07 20,88 Beitrag pro Betrieb Fr 3 259 2 867 2 305 2 818 Total Beiträge 1 000 Fr 30 823 21 482 20 384 72 689 Quelle: BLW Beteiligung
Andere (Ziegen, Kaninchen) 0% Geflügel 11% Quelle: BLW Total 225 434 GVE Rindergattung 70% Schweine
BTS 1999
19%
Andere (Pferde,
Geflügel
Quelle: BLW Total 538
GVE Rindergattung
Schweine
Bison, Schafe, Ziegen) 7%
3%
667
83%
7%
Sömmerungsbeiträge

MitdenSömmerungsbeiträgensolldieBewirtschaftungundPflegederSömmerungsweidenindenAlpenundVoralpensowieimJuragewährleistetwerden.Das Sömmerungsgebietumfasstrund600'000Hektaren,welchemitüber300'000GVE genutztundgepflegtwerden.BeitragsberechtigtsindBewirtschafteroderBewirtschafterinnen,welcheTiereaufeinemSömmerungs-,Hirten-oderGemeinschaftsweidebetriebsömmern.
SömmerungsbeiträgewurdenunterderBedingunggewährt,dassdieBetriebesachgerechtundumweltschonendbewirtschaftetundallfälligekantonale,kommunaleoder genossenschaftlicheVorschrifteneingehaltenwerden.MitderneuenSömmerungsbeitragsverordnungvom29.März2000hatderBundesratdieBeitragskonzeptionden heutigenAnforderungenimSinneeinernachhaltigenBewirtschaftungangepasstund dieBewirtschaftungsanforderungenergänzt.AusserdemhaterderspeziellenProblematikderSchafalpungRechnunggetragen.
FürGemeinschaftsweidebetriebewurdeeinBeitragproNormalstoss(NST)ausgerichtet.EinNSTentsprichtderSömmerungeinerRGVEwährend100Tagen.
2.2DIREKTZAHLUNGEN 2 2.AGRARPOLITISCHEMASSNAHMEN 185
Ansätze1999 Fr./Tier –gemolkeneKühe 300 –Zuchtstiereüber1-jährig,Mutter-,Ammen-undGaltkühe 200 –RinderundOchsen1bis3-jährig 100 –Kälber1/2bis1-jährig 50 –Pferde,Mauleselund-tiereüber3-jährig 140 –Pferde,Mauleselund-tierebis3-jährig,Esel 80 –Milchziegen,Milchschafe(ZiegenundSchafediewährendder Sömmerungsdauerregelmässiggemolkenwerden) 60 –übrigeZiegenundSchafe 10
Ansätze1999 Fr./NST –gemolkeneKühe,MilchziegenundMilchschafe 300 –übrigesRindvieh,Pferde,Mauleselund-tiere,Esel 200 –übrigeZiegenundSchafe 60 Sömmerungsbeiträge1999 Merkmal BeiträgeBetriebeGVEoderNST Mio.Fr.AnzahlAnzahl Sömmerungs-undHirtenbetriebe 632967890283415 Gemeinschaftsweidebetriebe 427534319720 Total 675718233297015 Quelle:BLW ■ Nachhaltige Bewirtschaftungder Sömmerungsgebiete Tabellen32a–32b,SeitenA38–A39
■ Abschwemmungen und Auswaschung verhindern
Beiträge für den Gewässerschutz
Mit dem neuen Artikel 62a des Gewässerschutzgesetzes kann der Bund Massnahmen der Landwirte zur Verhinderung der Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen in ober- und unterirdische Gewässer fördern Das Schwergewicht wird auf die Verminderung der Nitratbelastung des Grundwassers und der Phosphorbelastung der oberirdischen Gewässer in Regionen gelegt, in denen der ÖLN, der Biolandbau, Verbote und Gebote sowie vom Bund geförderte freiwillige Programme (Extenso, ökologischer Ausgleich) nicht genügen
Gemäss der neuen Gewässerschutzverordnung sind die Kantone verpflichtet, für oberund unterirdische Wasserfassungen einen Zuströmbereich zu bezeichnen und bei unbefriedigender Wasserqualität Sanierungsmassnahmen anzuordnen Diese Massnahmen können im Vergleich zum Stand der Technik bedeutende Einschränkungen bezüglich Bodennutzung und untragbare finanzielle Einbussen mit sich bringen. Die Beiträge des Bundes an die Kosten betragen 80% für Strukturanpassungen und Bewirtschaftungsänderungen sowie 50% für produktionstechnische Massnahmen 1999 wurden 161‘306 Fr ausbezahlt
Das BUWAL und das BLW haben Strategien zur Verminderung der durch die Landwirtschaft verursachten Nitrat- und Phosphorbelastung ausgearbeitet
Eingereichte Projekte 1999
Region, Zugesicherte Bundesbeiträge Projekt-
Die Beiträge dieser Massnahmen sind im Budget für die Ökobeiträge enthalten
2 . 2 D I R E K T Z A H L U N G E N 2 186
Kanton
Gemeinde gebiet Jahr Fr ha LU Sempach 1999 –2004: 4 000 000 4 905 LU Baldeggersee 2000 –2005: 5 100 000 4 325 VD Thierrens 2000 –2005: 105 376 17,35 VD Morand 2000 –2001: 22 480 14,05 ZH Baltenswil 2000 –2005: 480 000 145 BE Walliswil 2000 –2005: 201 600 98 Quelle: BLW
Die Massnahmen unter dem Titel Grundlagenverbesserung fördern und unterstützen eine umweltgerechte, sichere und effiziente Nahrungsmittelproduktion
Ausgaben für die Grundlagenverbesserung 1999
Anmerkung: Die Ausgaben für Grundlagenverbesserung in der Tabelle enthalten nur die Aufwendungen in der Rechnung des BLW Nicht in der BLW-Rechnung enthalten sind beispielsweise die finanziellen Mittel zugunsten der Forschungsanstalten (99 5 Mio Fr ) und des Gestüts (5 5 Mio Fr ) Die gesamten Aufwendungen betragen 322 Mio Fr
Staatsrechnung 1999
Mit den Massnahmen zur Grundlagenverbesserung werden folgende Ziele angestrebt: – moderne Betriebsstrukturen und gut erschlossene landwirtschaftliche Nutzflächen; – effiziente und umweltgerechte Produktion; – ertragreiche, möglichst resistente Sorten und qualitativ hochstehende Produkte; – Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt; – genetische Vielfalt
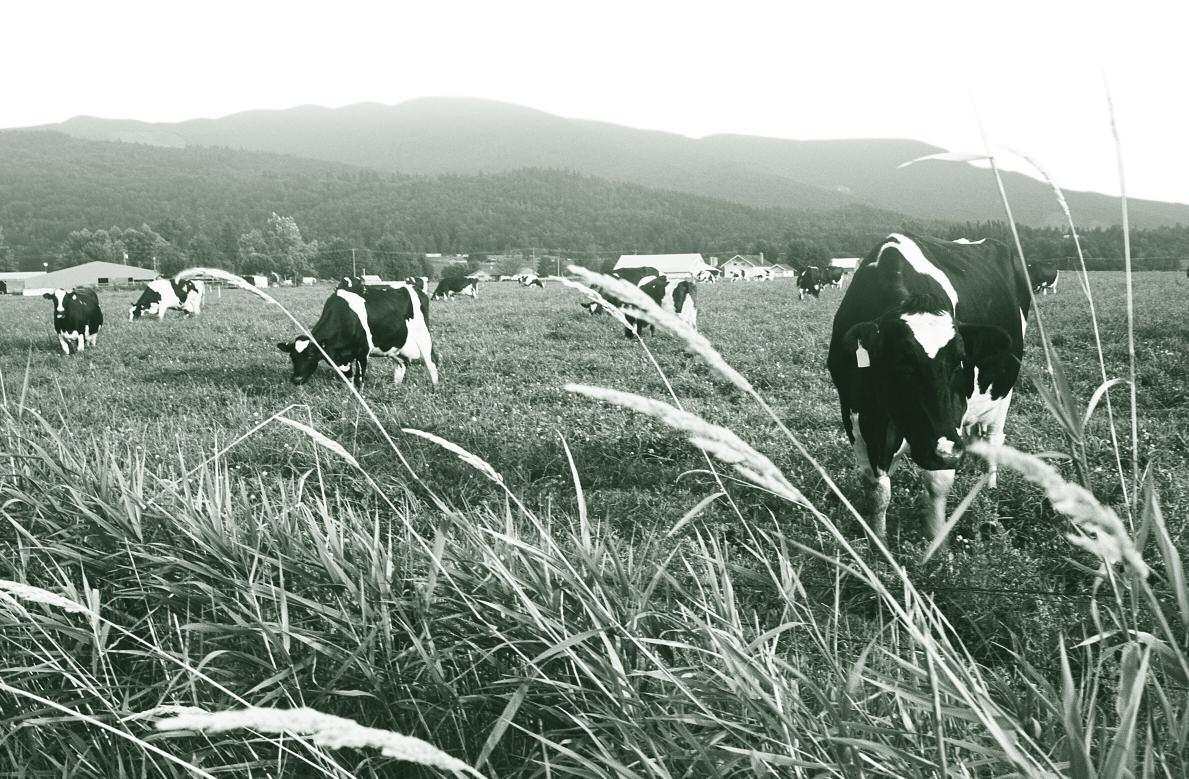
187 ■■■■■■■■■■■■■■■■
2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2.3 Grundlagenverbesserung
Ausgabenbereich Mio Fr Strukturverbesserungen 76 Investitionskredite 20 Betriebshilfedarlehen 5 Beratungswesen und Forschungsbeiträge 23 Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge 3 Pflanzen- und Tierzucht 21 Total 148
Quelle:
2
■ Einzelbetriebliche Massnahmen
2.3.1 Strukturverbesserungen und Betriebshilfe
Strukturverbesserungen
Mit den Massnahmen im Bereich der Strukturverbesserungen werden die Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse im ländlichen Raum verbessert Dies betrifft insbesondere das Berggebiet und die Randregionen
Als Investitionshilfen stehen zwei Instrumente zur Verfügung:
Beiträge (à-fonds-perdu) mit Beteiligung der Kantone;
Investitionskredite in Form von zinslosen Darlehen.
Investitionshilfen unterstützen die Landwirtschaft in der Entwicklung und im Unterhalt wettbewerbsfähiger Strukturen, ohne dass sie sich dafür untragbar verschulden muss. Auch in andern Ländern, insbesondere in der EU, zählen die Investitionshilfen zu den wichtigsten Massnahmen zur Förderung des ländlichen Raumes
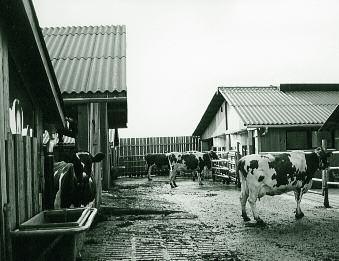
Die Investitionshilfen werden für einzelbetriebliche und für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.
Die einzelbetrieblichen Massnahmen kommen hauptsächlich im landwirtschaftlichen Hochbau zur Anwendung. Die Investitionshilfen leisten einen Beitrag zur Finanzierung und langfristigen Tragbarkeit von Bauten und Einrichtungen, die für eine rationelle Bewirtschaftung und für die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen des Tier- und Gewässerschutzes notwendig sind Gleichzeitig werden die Anliegen der Raumplanung, des Natur-, Heimat- und Landschaftsschutzes sowie des Umweltschutzes berücksichtigt.
Zu den wichtigsten einzelbetrieblichen Massnahmen zählen Investitionen in Wohnund Ökonomiegebäude, auf Sömmerungsbetrieben in Ställe und Gebäude für das Alppersonal und für die Milchverarbeitung sowie die Starthilfe für Junglandwirte und Junglandwirtinnen
Einzelbetriebliche Massnahmen können grundsätzlich mit Investitionskrediten und Beiträgen à fonds perdu unterstützt werden Investitionskredite erhalten Betriebe im Berg- und Talgebiet Die Ausrichtung von Beiträgen à fonds perdu für Hochbauten beschränkt sich dagegen auf Gebäude für Raufutter verzehrende Tiere im Hügel- und Berggebiet sowie auf Alpgebäude. Beiträge und Investitionskredite werden pauschal und damit unabhängig von den effektiven Kosten festgesetzt Ein Zuschlag wird für den Bau besonders tierfreundlicher Ställe bezahlt
Die Starthilfe wird als Darlehen gewährt Sie dient dazu, die Startbedingungen junger Pächter und Eigentümer zu verbessern und ist für Massnahmen zu verwenden, die in engem Zusammenhang mit dem bäuerlichen Betrieb stehen Der Empfänger kann in diesem Rahmen über das Darlehen frei verfügen und es z B zur Reduktion der verzinslichen Bankschulden, für den Kauf von Inventar oder Grundstücken oder für die Erneuerung der landwirtschaftlichen Gebäude einsetzen
188 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
–
–
■ Gemeinschaftliche Massnahmen
Gemeinschaftliche Massnahmen tragen zu einem lebenswerten ländlichen Raum bei und helfen der Landwirtschaft, ihre Produktionskosten zu senken
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen geht es insbesondere um sogenannte Bodenverbesserungen Dazu zählen Werke und Anlagen im ländlichen Tiefbau wie Wegebauten und Transportanlagen, Wasserversorgungen, Elektrizitätsversorgungen, Massnahmen zum Wasserhaushalt des Bodens sowie die Neuordnung des Grundeigentums und der Pachtverhältnisse Ziel ist die Verbesserung der Strukturen innerhalb eines klar abgegrenzten Beizugsgebietes einer oder mehrerer Gemeinden Die Trägerschaft wird meist durch eine Genossenschaft oder eine Gemeinde ausgeübt Bei solchen Werken werden neben landwirtschaftlichen auch raumplanerische Ziele und Schutzanliegen realisiert. Darunter fallen Massnahmen, die dem ökologischen Ausgleich, der Biotopvernetzung sowie dem Boden- und Gewässerschutz dienen
Gemeinschaftliche Massnahmen erhalten finanzielle Unterstützung überwiegend in Form von Beiträgen à fonds perdu Die Beitragsberechtigung beschränkt sich dabei fast ausschliesslich auf den Bau der Infrastrukturen Der Unterhalt ist Sache der Beitragsempfänger Für Bodenverbesserungen mit erschwerter Finanzierung sind im Berg- und Sömmerungsgebiet Zuschläge möglich Zusatzbeiträge für freiwillige ökologische Massnahmen schaffen Anreize, diese auch dort durchzuführen, wo sie nach dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz nicht vorgeschrieben sind
Investitionskredite werden gewährt für die Restfinanzierung von Bodenverbesserungen sowie für Bauten, Einrichtungen und Maschinen, welche Produzenten oder Produzentinnen in gemeinsamer Selbsthilfe erstellen oder anschaffen Ebenso sind Investitionskredite für Gemeinschaftseinrichtungen für den Wein- und Obstbau sowie den gemeinschaftlichen Kauf von Maschinen und Fahrzeugen möglich Für grössere, mehrjährige Projekte im Berggebiet werden Investitionskredite auch in Form von Baukrediten gewährt
■ Finanzielle Mittel für Beiträge à-fonds-perdu
Für landwirtschaftliche Strukturverbesserungen stand 1999 wie im Vorjahr eine Beitragssumme von 75 Mio Fr zur Verfügung Das BLW genehmigte neue Projekte mit Bundesbeiträgen von insgesamt 75,7 Mio Fr Damit wurde ein Investitionsvolumen von 311,5 Mio Fr ausgelöst Die Summe der Bundesbeiträge der genehmigten Projekte ist nicht identisch mit der Budgetrubrik «Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen», da die Zusicherung eines Beitrages und dessen Auszahlung nur ausnahmsweise auf das gleiche Jahr fallen und vielfach von einem genehmigten Projekt nur eine Kredittranche zugesichert wird.

189 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
2

190 Beiträge des Bundes 1999 Landumlegungen mit Infrastrukturmassnahmen Wegebauten Wasserversorgungen andere Tiefbaumassnahmen Ökonomiegebäude für Raufutter verzehrende Tiere andere Hochbaumassnahmen Mio. Fr. 62% 18% 20% Talgebiet ohne Hügelzone Hügelzone und Bergzone I Bergzonen II–IV und Sömmerungsgebiet 30,8 05101520253035 10,6 5,8 3,3 22,1 3,1 Quelle: BLW 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Der Bund setzte 1999 rund 40% weniger finanzielle Mittel in Form von Beiträgen à fonds perdu ein als 1990 In den Jahren 1993 und 1994 wurden Sonderkredite für den landwirtschaftlichen Hochbau zur Förderung der Beschäftigung gesprochen Die Wiederherstellung von Unwetterschäden in den Kantonen Wallis und Tessin ist in der ordentlichen Rubrik 1994 enthalten
Im Jahre 1999 bewilligten die Kantone für 2395 Fälle Investitionskredite von insgesamt 237,6 Mio. Fr. Von diesem Kreditvolumen entfielen 81,4% auf einzelbetriebliche und 18,6% auf gemeinschaftliche Massnahmen Im Berggebiet können auch Überbrückungskredite, sogenannte Baukredite mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren, gewährt werden
Von den Kantonen bewilligte Investitionskredite 1999
ohne
Die Kredite für einzelbetriebliche Massnahmen entfallen zur Hauptsache auf die Starthilfe, auf den Neu- und Umbau sowie die Verbesserung von landwirtschaftlichen Wohn-, Oekonomie- und Alpgebäuden Sie werden durchschnittlich in 12,7 Jahren zurückbezahlt
Bei den gemeinschaftlichen Massnahmen wurden insbesondere Bodenverbesserungen sowie Investitionen in Gebäude und Einrichtungen für die Verarbeitung und die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte unterstützt
191 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N
1990199119921993199419951996199719981999 M i o F r ordentliche Rubrik Sonderrubrik zur Förderung der Beschäftigung im landw. Hochbau Quelle: BLW 0 20 40 60 80 100 120 140 1271301009191 5 15 8585827575 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
Beiträge des Bundes 1990–1999 an Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten
Bestimmung Fälle Betrag Anteil Anzahl Mio. Fr. % Einzelbetriebliche Massnahmen 2‘162 193,30 81,4 Gemeinschaftliche Massnahmen,
Baukredite 129 11,42 4,8 Baukredite 104 32,83 13,8 Total 2‘395 237,55 100 Quelle:
BLW
■ Finanzielle Mittel für Investitionskredite
2
Tabellen 37–38, Seiten A46–A47
Tabellen 35–36, Seite A44–A45
■ Ausblick
Investitionskredite 1999 nach Massnahmenkategorien, ohne Baukredite
Gemeinschaftlicher Inventarkauf, Verarbeitung und Lagerung landw.
Im seit 1963 geäufneten Fonds de roulement befinden sich rund 1,6 Mrd Fr 1999 hat der Bund den Kantonen 20 Mio Fr neue Bundesmittel zugeteilt Sie werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt
Wegen den ausserordentlichen Unwetterschäden (Lawinen, Rutsche, Murgänge, Überschwemmungen) im Berichtsjahr wurden diverse Motionen und Postulate eingereicht Eine Arbeitsgruppe, gebildet aus Vertretern verschiedener Bundesämter, kam zum Schluss, dass der Finanzbedarf für die Unwetterschäden in der Landwirtschaft im ordentlichen Verfahren mit Nachtragskrediten gedeckt werden soll Zur Behebung der Schäden von 27 Mio Fr in der Landwirtschaft (ohne Gebäude und Fahrhabe) besteht neben Beiträgen der Kantone und des schweizerischen Elementarschädenfonds ein Finanzbedarf des Bundes von 7 Mio Fr , welcher durch Nachtragskredite im Jahr 2000 gedeckt wird Die Schäden traten vorwiegend im Berggebiet auf
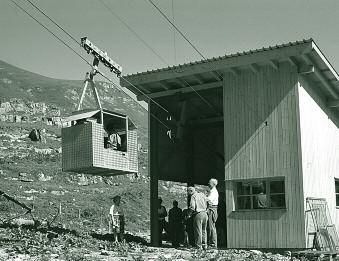
192
Ökonomiegebäude Starthilfe Wohngebäude
Produkte Kauf Betrieb durch Pächter Bodenverbesserungen Mio. Fr. 24% 49% 27% Talgebiet ohne Hügelzone Hügelzone und Bergzone I Bergzonen II–IV und Sömmerungsgebiet 102,5 020406080100120 57,5 33,7 5,3 2,9 2,8 Quelle: BLW 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Betriebshilfe
Die Betriebshilfe ist eine soziale Begleitmassnahme und dient dazu, eine vorübergehende, unverschuldete finanzielle Bedrängnis zu verhindern oder zu beheben. Sie erlaubt die Ablösung bestehender Schulden durch zinslose Darlehen Diese müssen in maximal 20 Jahren zurückbezahlt werden Betriebshilfe in Anspruch nehmen kann, wer infolge veränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen oder misslicher Umstände wie Todesfall, Unglück im Stall oder wegen besonderer Umwelteinflüsse in ausserordentliche finanzielle Bedrängnis gerät In der Auswirkung entspricht die Betriebshilfe einer einzelbetrieblichen Entschuldung Sie wird für gut strukturierte Betriebe mit Zukunftsaussichten eingesetzt
■ Verteilung der Mittel 1999 wurden in 204 Fällen insgesamt rund 18,1 Mio Fr Betriebshilfedarlehen gewährt Im Vergleich zu 243 im Vorjahr sind etwas weniger Darlehen ausgewiesen Das Kreditvolumen ist um 2,3 Mio. Fr. höher als im Jahre 1998. Das durchschnittliche Darlehen ist von 65'100 Fr auf 88'500 Fr gestiegen Die Darlehen werden durchschnittlich in 12,4 Jahren zurückbezahlt
Von den Kantonen bewilligte Betriebshilfedarlehen 1999
Der seit 1973 mit neuen Bundesmitteln und Rückzahlungen geäufnete Fonds de roulement beträgt rund 109 Mio Fr Den Kantonen werden jährlich neue Bundesmittel zur Verfügung gestellt (1999: 5 Mio Fr ) Diese sind an eine angemessene Leistung des Kantons gebunden, die je nach Finanzkraft 40 –100% des Bundesanteils beträgt. Die neuen Mittel von Bund und Kantonen werden zusammen mit den laufenden Rückzahlungen für die Gewährung von neuen Krediten eingesetzt
■ Ausblick Die Betriebshilfe ist in erster Linie als Bereitschaftsinstrument zu verstehen Je nach Entwicklung, insbesondere der Zinssätze und der Veränderung auf den Märkten, werden für diese Massnahme zusätzliche Mittel erforderlich sein, was in der Finanzplanung berücksichtigt worden ist.
193 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
Bestimmung Fälle Betrag Anzahl Mio Fr Umfinanzierung bestehender Schulden 172 16,05 Überbrückung einer ausserordentlichen finanziellen Belastung 32 2,01 Total 204 18,06 Quelle: BLW
Tabelle 39 Seite A48 2
2.3.2 Forschung, Beratung, Gestüt
Landwirtschaftliche Forschung

Die öffentliche landwirtschaftliche Forschung in der Schweiz gliedert sich im wesentlichen wie folgt auf:
– Das Departement für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften der ETH-Zürich ist vornehmlich in der Grundlagenforschung sowie in der Lehre auf universitärer Stufe tätig
– Die sechs eidgenössischen Forschungsanstalten richten ihre Tätigkeit auf die Erreichung der Ziele der Landwirtschaftspolitik aus. Sie sind dem BLW unterstellt und machen zusammen die Forschung des BLW aus
– Die neu gegründeten Fachhochschulen betätigen sich in der tertiären Ausbildung sowie in Forschung und Entwicklung.
Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau – als private Stiftung – befasst sich in der Forschung mit der Weiterentwicklung des Biolandbaus Seine Aktivitäten werden vom BLW und von anderen Bundesämtern, Kantonen, Firmen sowie Privaten unterstützt.
■ Die Forschung des BLW Die Forschung des BLW ist eng mit den sechs landwirtschaftlichen Forschungsanstalten verbunden Diese befassen sich einerseits mit eigentlicher Forschungstätigkeit, anderseits mit Vollzugs- und Kontrollaufgaben Das BLW will mit seiner Forschung eine Position als national und international anerkannte Einrichtung für die Förderung einer nachhaltig produzierenden Landwirtschaft erreichen und damit auch die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Produkte verbessern. Dazu wird die Forschungstätigkeit auf die speziellen Bedürfnisse unserer Landwirtschaft ausgerichtet Die Bewilligungs-, Vollzugs- und Kontrollaufgaben machen rund 40% der Tätigkeiten aus Obwohl diese Aufgaben keine eigentlichen Forschungsaktivitäten darstellen, benötigen sie eine wissenschaftliche Ab- und Unterstützung
Aufwendungen des Bundes für die sechs Forschungsanstalten 1999
Bruttoaufwendungen 99 Mio. Fr.
43% Bewilligungen, Kontrolle
39 Mio. Fr.
Einnahmen
8 Mio. Fr.
57% Forschung
52 Mio. Fr.
100%
Nettoaufwendungen 91 Mio. Fr.
Quelle: BLW
194 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Planung und Organisation
Für die strategische Planung seiner Forschung steht dem BLW der Landwirtschaftliche Forschungsrat beratend zur Seite Der Forschungsrat besteht aus Persönlichkeiten, die sich in ihrem Berufsleben mit agrar-, forschungs-, umwelt- und gesellschaftspolitischen Fragen auseinander setzen. Damit ist gewährleistet, dass im Rahmen der langfristigen Forschungsplanung alle Bereiche einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt werden
Organisation der Forschung des BLW
■ Strategische Ziele
Bei der operativen Umsetzung steht jeder Forschungsanstalt eine spezifische Begleitende Expertengruppe zur Seite. Diese unterstützt die Forschungsanstalt bei der Erfassung der praxisbezogenen Forschungsbedürfnisse
In der Begleitenden Expertengruppe sind die wichtigsten Kunden und Partner der entsprechenden Forschungsanstalt vertreten Dazu gehören die landwirtschaftliche Praxis sowie Organisationen und Verbände der vor- und nachgelagerten Stufen, Konsumenten-, Umwelt- und Tierschutzorganisationen, interessierte Bundesämter und kantonale Stellen, interessierte Hochschulen, Fachhochschulen und andere Institute sowie die landwirtschaftlichen Beratungszentralen. Die Begleitenden Expertengruppen werden vom BLW eingesetzt
Für die Jahre 2000–2003 hat der Bundesrat der Forschung des BLW sechs strategische Ziele vorgegeben:
– Verbesserung der Marktfähigkeit durch umweltverträgliche, qualitäts-, tier- und marktgerechte Agrarproduktion;
– Verstärkung der ökologischen Ausrichtung: Ökosysteme/natürliche Ressourcen;
– Unterstützung eines sozialverträglichen Strukturwandels: sozio-ökonomische Entwicklungen und ländliche Strukturen;
– Aufbau eines wirksamen Früherkennungssystems: ökologische Aspekte wie grenzübergreifende Erhaltung der natürlichen Ressourcen, Auswirkung der Klimaveränderung, globales Schwinden der biologischen Vielfalt; wirtschaftlich-politische Aspekte wie Globalisierung, Ernährungssicherheit, Produktesicherheit;
– Optimierung des Wissenstransfers durch Information und Dokumentation;
– Förderung der Fachkompetenz und Profilierung durch Schwerpunktbildung, Qualität sowie nationale und internationale Zusammenarbeit
195 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
Quelle: BLW
BLW Bundesamt für Landwirtschaft Geschäftseinheit Landwirtschaftliche Forschung
RAC Pflanzenbau Changins
FAL Agrarökologie und Landbau Zürich-Reckenholz
FAW Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil
FAT Agrarwirtschaft und Landtechnik Tänikon
RAP Nutztiere Posieux 2
FAM Milchwirtschaft Bern-Liebefeld
Die Forschung des BLW ist in den Neunziger Jahren umfassend restrukturiert worden. Zwischen 1994 und 1998 wurden 14 Mio Fr , das heisst 13,5 % der Mittel, eingespart und 92 Stellen abgebaut
Aufgrund einer weiteren Anpassung der Aufgaben und Strukturen müssen die Forschungsanstalten bis Ende 2001 weitere Einsparungen von 8,2 Mio Fr realisieren Dies hat eine weitere Abnahme um ca 80 Stellen zur Folge Insgesamt reduzieren sich die Mittel der Forschungsanstalten zwischen 1994 und 2001 insgesamt um rund 24%.
Der Bundesrat hat im Rahmen der Regierungs- und Verwaltungsreform beschlossen, dass die landwirtschaftlichen Forschungsanstalten mit Leistungsauftrag und Globalbudget zu führen sind Die Ziele des neuen Führungsmodells decken sich mit dem Konzept des New Public Management Es wurde auf den 1 Januar 2000 eingeführt
Mit dem neuen Führungsmodell wird die Forschung des BLW noch stärker leistungsund wirkungsorientiert ausgerichtet Das BLW leitet die Forschungsanstalten mit übergeordneten fachlichen, organisatorischen und finanziellen Vorgaben Gleichzeitig wird den Forschungsanstalten ein hoher operationeller Spielraum eingeräumt. Strukturen und Kompetenzen folgen dem Subsidiaritätsprinzip Im Vordergrund stehen dabei die Initiative der Betroffenen sowie eine stufengerechte Delegation der Kompetenzen Die Autonomie der Forschungsanstalten wird dadurch erhöht
Ein Controlling- und Qualitätssicherungssystem stellt die Kosten- und Leistungstransparenz gegenüber dem BLW, dem Bundesrat und dem Parlament sicher Aus diesem Grund wurden für die sechs strategischen Ziele Indikatoren und Standards festgelegt. Damit wird die Zielerreichung beobacht- und beurteilbar. Gleichzeitig wird durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung eine weitere Verstärkung des Kostenbewusstseins und der Kostentransparenz gegen innen und aussen erreicht
196 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Restrukturierung der Forschungsanstalten ■ Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget Personalabbau bei den Forschungsanstalten 1990/92199319941995199619971998 S t e l l e n 700 720 740 760 780 800 820 Quelle: BLW
■ Kundennähe Die neuen Führungsstrukturen der BLW-Forschung unterstützen das unternehmerische Handeln Die Forschungsanstalten sind als Unternehmen zu führen und erfolgreich auf dem Markt zu positionieren Die Nähe und die Kommunikation zu den Kunden werden dabei zentrale Elemente für den Erfolg sein.
Alle Projekte der Forschungsanstalten für die Periode 2000–2003 sind in einem Forschungskatalog zusammengefasst, der es allen Kunden und Interessierten ermöglicht, rasch die gewünschten Informationen über die in den Forschungsanstalten durchgeführten Arbeiten und über Kontaktpersonen zu finden Der Forschungskatalog kann auch im Internet unter «http://www admin ch/sar» konsultiert werden
Landwirtschaftliche und bäuerlich-hauswirtschaftliche Beratung
Die Beratung ist, wie Forschung und Bildung, Teil des landwirtschaftlichen Wissenssystems Die landwirtschaftliche und bäuerlich hauswirtschaftliche Beratung bietet den in der Landwirtschaft und in der bäuerlichen Hauswirtschaft tätigen Personen Unterstützung an, damit sie ihre berufsbezogenen Probleme lösen und sich den wandelnden Verhältnissen anpassen können. Beratung umfasst nicht nur Einzelberatung im engeren Sinne, sondern auch gezielte berufliche Weiterbildung der Bauernfamilien, Förderung des Wissenstransfers innerhalb der bäuerlichen Bevölkerung und Begleitung von innovativen Prozessen und Projekten.

Diese umfassende Sicht ist das Ergebnis der durch die Regierungs- und Verwaltungsreform ausgelösten breiten Diskussion über die Aufgaben der Beratung Die ehemals als Teil der Berufsbildung betrachtete Beratung wurde von der Bildung getrennt Auf Verwaltungsebene ist das BLW zuständig dafür. Für die Bildung ist es das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Die Beratung der Bauernfamilien ist Sache der Kantone Dazu unterhalten sie Beratungsdienste oder haben ihre Aufgaben einer bäuerlichen Organisation übertragen Der Bund unterstützt die Beratungsdienste finanziell, indem er Finanzhilfen an die Gehälter der Beratungskräfte gewährt Der Prozentsatz der Finanzhilfe ist abhängig von der Finanzkraft des Kantons
Der Bund unterstützt direkt 14 Organisationen, die Spezialberatung anbieten, für die eine gesamtschweizerische oder regionale Lösung sinnvoll ist.
Die Kantone und mehr als 50 Organisationen sind Träger der Schweizerischen Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft. Die Vereinigung führt die Beratungszentralen in Lindau (LBL) und in Lausanne (SRVA) Diese unterstützen die kantonalen, regionalen und schweizerischen Beratungsdienste Sie bieten die fachliche und methodische Weiterbildung der Beratungskräfte an, arbeiten Forschungsresultate auf oder stellen Hilfsmittel und Dokumente zur Verfügung Der Bund unterstützt die Vereinigung pauschal aufgrund einer Leistungsvereinbarung, bei der bereits über die dritte Vertragsperiode verhandelt wird
197 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2
■ Organisation und Formen der Beratung
■ Finanzierung der kantonalen Beratungsdienste neu regeln
Ausgaben für die Beratung 1999

Die Finanzierung der kantonalen Beratungsdienste ist aufwandorientiert. Ausserdem gibt es keinen Unterschied zwischen Leistungen, die vor allem im privaten Interesse der Leistungsbezüger/innen (z B Milchvieh-Fütterung, Haushaltsplanung) oder vorwiegend im öffentlichen Interesse (z.B. umweltgerechte Nutzung schützenswerter Flächen, Massnahmen der Regionalentwicklung) liegen
In Zukunft soll die Finanzhilfe aufgrund der erbrachten Leistungen und abgestuft nach öffentlichem Interesse gewährt werden Die verschiedenen Leistungen werden nach Tätigkeitsbereichen und Leistungskategorien eingeteilt, der Anteil des öffentlichen Interesses je Kategorie festgelegt und der Wert (nach Tarifpunkten) jeder Leistungseinheit definiert Die Kantone müssen die Leistungen ab Januar 2000 nach dem neuen Konzept erfassen und anschliessend dem BLW melden. Um den Kantonen Anpassungen zu erlauben, soll die Finanzhilfe aber erst ab dem Jahre 2002 nach dem neuen System berechnet werden
198 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
Empfänger Betrag Mio. Fr. Landwirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone 9,9 Bäuerliche-hauswirtschaftliche Beratungsdienste der Kantone 0,8 Spezial-Beratungsdienste landwirtschaftlicher Organisationen 1,0 Schweizerische Vereinigung für Beratung in der Landwirtschaft 8,4 Total 20,2 Quelle: Staatsrechnung
■ Leistungsauftrag 2000–2003

Eidgenössisches Gestüt
Das Eidgenössische Gestüt in Avenches unterstützt eine wettbewerbsfähige und tiergerechte landwirtschaftliche Pferdehaltung. Priorität hat dabei die Erhaltung und Förderung der Freibergerrasse
Als Kompetenzzentrum für die landwirtschaftliche Pferdehaltung stellt das Gestüt den Produzentinnen und Produzenten sowie den Zucht- und Verwertungsorganisationen seine Infrastruktur, Zuchttiere und Know-How zur Lösung der anstehenden Probleme zur Verfügung
Das Gestüt wird seit dem 1 Januar 2000 mit Leistungsauftrag und Globalbudget geführt Mit dem Leistungsauftrag 2000–2003 gibt der Bundesrat dem Gestüt folgende strategische Ziele vor:
– Verbesserung der Qualität der landwirtschaftlichen Pferdeproduktion;
– Verbesserung der artgerechten Haltung des Pferdes in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der natürlichen Bedürfnisse und durch Förderung der Verhaltensforschung;
– Unterstützung bei der Begleitung des sozialen, wirtschaftlichen und strukturellen Wandels der landwirtschaftlichen Pferdeproduktion;
– Förderung der Fachkompetenz für die Lösung neuer Fragestellungen: Ethische und gesundheitliche Aspekte der Pferdezüchtung, Erhaltung der Freibergerrasse;
– Optimierung des Wissenstransfers durch Information und Dokumentation
■ Restrukturierung Die 1994 in Gang gesetzte Restrukturierung und Teilprivatisierung des Eidgenössischen Gestüts bewirkte, dass ab 1999 jährlich 2,21 Mio. Fr. eingespart werden können Der Personalbestand nahm um 23 Etatstellen (30%) von 75 auf 52 ab Mit der Einführung des neuen Führungsmodells müssen diese zusätzlich um 10% reduziert werden. 1999 hat der Bund das Gestüt mit 5,5 Mio. Fr. unterstützt.
199 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2
2.3.3 Hilfsstoffe, Pflanzen- und Sortenschutz
Landwirtschaftliche Hilfsstoffe

In der Gesetzgebung werden vier Gruppen landwirtschaftlicher Hilfsstoffe unterschieden: Dünger, Pflanzenschutzmittel, Futtermittel und pflanzliches Vermehrungsmaterial (Saat- und Pflanzgut) Es handelt sich dabei sowohl um Stoffe als auch um Organismen, die der landwirtschaftlichen Produktion dienen
Die Gesetzgebung über die landwirtschaftlichen Hilfsstoffe legt die Grundsätze für das Inverkehrbringen der Hilfsstoffe fest. Diese müssen für den vorgesehenen Gebrauch geeignet sein und dürfen bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren negativen Nebenwirkungen haben
Die Eignung von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen ist eng mit dem Begriff der Wirksamkeit verbunden Ein Teil der Gesetzgebung deckt diesen Bereich ab Die Landwirte erhalten damit Gewähr, dass ein Hilfsstoff beim beabsichtigten Einsatz ausreichend wirkt Beim Ausbau der Gesetzgebung über die Hilfsstoffe tritt der Wirkungsaspekt allerdings gegenüber der Frage nach den Nebenwirkungen zunehmend in den Hintergrund
Als Nebenwirkungen betrachtet man die indirekten Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und Tiere sowie auf die Umwelt Darunter fällt z B der Einfluss eines Insektizids auf Nützlinge oder derjenige eines Zusatzstoffs für Futtermittel auf die Fruchtbarkeit der Nutztiere Beim Schutz der menschlichen Gesundheit kommen weitere Gesetzesbestimmungen zur Anwendung wie z B das Giftgesetz Zu berücksichtigen sind auch die im Umweltschutzgesetz festgelegten Grundsätze.
200 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Im Bereich der Hilfsstoffe werden acht Vollzugsinstrumente verwendet. Gesetzliche Grundlage dafür ist mit Ausnahme der Anforderungen an die Produktion bei Dünger und Pflanzenschutzmittel (PSM) das LwG Angesichts der Besonderheiten der einzelnen Stoffe kommen die Instrumente allerdings nicht überall gleichermassen zum Einsatz:
Instrumente für den Vollzug im Bereich der landwirtschaftlichen Hilfsstoffe
Instrument Dünger Pflanzen- Futtermittel Saatgut schutzmittel
an die Produkte
an die Produktion
1 Die Basis für die Anforderungen an die Produktion bei Dünger und PSM ist nicht das LwG sondern das Gift- und Umweltschutzgesetz
Quelle: BLW
Zulassungspflicht: Hilfsstoffe dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie zugelassen sind Auf diese Weise können sie vorgängig auf allfällige Nebenwirkungen hin überprüft und nötigenfalls verboten werden
Anforderungen an die Produkte: die Gesetzesbestimmungen legen Mindestanforderungen fest, die ein Produkt erfüllen muss, damit es in Verkehr gebracht werden kann.
Anforderungen an die Produktion: es sind Qualitätsregeln definiert, die bei der Produktion bestimmter Hilfsstoffe eingehalten werden müssen
Etikettierungsregeln: es ist festgelegt, welche Informationen und Warnungen auf der Verpackung anzubringen sind
Verwendungsvorschriften: in diesen Vorschriften wird die bewilligte Verwendungsweise beschrieben, um unannehmbare nachteilige Nebenwirkungen auszuschliessen
Meldepflicht: diese Pflicht erleichtert die Konformitätskontrolle bei gewissen Hilfsstoffen
Sortenkatalog: die meisten landwirtschaftlichen Pflanzen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn die Sorten im offiziellen Sortenkatalog aufgeführt sind; es werden ausschliesslich Sorten darin verzeichnet, die den Aufnahmekriterien genügen (Krankheitsresistenz, Ertrag, Qualität)
Zertifizierung: beim Saatgut wird von Amtes wegen kontrolliert, ob die Anforderungen an die Produkte erfüllt sind; jeder Saatgutposten wird zertifiziert.
201 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
■■■
■■■■ Anforderungen
■ 1 ■ 1 ■■ Etikettierungsregeln ■■■■ Verwendungsvorschriften ■■■ Meldepflicht ■■ Sortenkatalog ■ Zertifizierung ■
Zulassungspflicht
Anforderungen
2
■ Instrumente für den Vollzug
■ Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
Bei den Hilfsstoffen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, besteht zusätzlich zum normalen Verfahren die Pflicht, jedes Produkt vor dem Inverkehrbringen bewilligen zu lassen und zu deklarieren
Bei den Futtermitteln wurde ein Deklarationswert eingeführt Dies war wie bei den Lebensmitteln notwendig, weil beim Herstellungsprozess oder beim Transport Verunreinigungen mit GVO nicht ausgeschlossen werden können Für Einzelfuttermittel wurde der Deklarationswert bei 3%, bei Mischfuttermitteln bei 2% festgelegt
Die Anforderungen bezüglich Gesuchsunterlagen und Erteilung von Bewilligungen sind in der Freisetzungsverordnung definiert Für Hilfsstoffe, die GVO enthalten gelten sowohl die Bestimmungen dieser Verordnung als auch jene der jeweiligen Verordnung über die einzelnen Hilfsstoffe Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wurde das Bewilligungsverfahren in den letzteren geregelt
■ Düngemittel Auf den 1 September 1999 wurde die Kontrolle des Inverkehrbringens von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen dem BLW unterstellt Die Dünger-Verordnung und die Düngerbuch-Verordnung werden zur Zeit revidiert Neben weiteren Anpassungen an die entsprechenden Vorschriften der EU wird auch eine Liberalisierung im Bereich der Mineraldünger ähnlich derjenigen bei den Pflanzenschutzmitteln durchgeführt
■ Pflanzenschutzmittel Am 1. August 1999 wurde die neue Pflanzenschutzmittelverordnung vom 23. Juni 1999 in Kraft gesetzt Sie brachte drei wesentliche Neuerungen:
– PSM dürfen neu ohne Bewilligung in die Schweiz eingeführt und hier in Verkehr gebracht werden, wenn sie in eine Positivliste des BLW aufgenommen worden sind;
– Es wird ein EU-kompatibler Erstanmelderschutz für die Daten der Ersteinreichung gewährt;
Die technisch-wissenschaftlichen Anforderungen für die Bewilligung von PSM sind neu stärker auf jene der EU ausgerichtet
Auf Grund der Positivliste wird der Landwirtschaft eine grössere und im Verlaufe der Zeit wachsende Zahl von Produkten zur Verfügung stehen, die aus dem Ausland eingeführt werden können Die landwirtschaftlichen Produzenten und Produzentinnen werden von der daraus resultierenden Senkung der Kosten für den Pflanzenschutz profitieren können
■ Futtermittel Im Berichtsjahr haben zwei Fälle von Dioxinverunreinigungen das Vertrauen der Landwirte und Konsumenten in die Qualität der Futtermittel erschüttert. Im ersten Fall, der vor allem Belgien betraf, liess sich die Verseuchung von Futtermitteln auf rückgewonnene Pflanzenöle, unter anderem Haushaltsöle zurückführen, die durch Industrieöle verschmutzt waren. Im zweiten war die bei der Herstellung von Futtermitteln als Bindemittel verwendete Kaolinit-Tonerde die Ursache
Der Verunreinigungsgrad im Fall der Kaolinit-Tonerde war in der Schweiz allerdings wesentlich geringer als in Belgien Als Vorsichtsmassnahme wurden die betreffenden Futtermittel dennoch aus dem Handel gezogen.
202 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
–
■ Saatgut Im Frühjahr 1999 ordnete das BLW ein Handelsverbot für GVO-verunreinigtes Maissaatgut an Bereits ausgesäte Kulturen (ca 230 ha) wurden vernichtet und die betroffenen Landwirte durch den Importeur entschädigt

Um solche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden, wurden die Saatgutkontrollen verstärkt Angesichts der zunehmenden Internationalisierung des Saatguthandels und des unvermeidbaren Risikos einer versehentlichen Verunreinigung einzelner Saatgutposten wird es für die Branche des Saatguthandels wie für die Kontrollbehörden jedoch schwierig sein, jegliche Verunreinigung auszuschliessen
Pflanzenschutz
Die Pflanzenschutzmassnahmen bezwecken, die Einschleppung und Ausbreitung neuer Schadorganismen zu verhindern. Bekanntes Beispiel in diesem Zusammenhang sind die Bekämpfungsmassnahmen gegen die Ausbreitung des Feuerbrands
Die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen, die Träger von besonders gefährlichen Schadorganismen sein können, unterliegt sehr strengen Vorschriften Derartige Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse sowie Pflanzenmaterial, die in die Schweiz importiert werden, müssen von einem Pflanzenschutzzeugnis begleitet sein, das die Anforderungen der Internationalen Pflanzenschutz-Konvention erfüllt Das Pflanzenschutzzeugnis bescheinigt, dass das importierte Material den in der Schweiz geltenden Pflanzenschutzvorschriften entspricht Bei der Zollabfertigung überprüfen die Kontrolleure des Eidg Pflanzenschutzdienstes, ob die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden Damit soll die Einschleppung von Schadorganismen verhindert werden
Zuständig für die Massnahmen im Innern des Landes sind die kantonalen Pflanzenschutzdienste, die in ihrer Arbeit von den eidgenössischen Forschungsanstalten unterstützt werden Hauptaufgaben dieser Dienste sind, die Situation auf dem Kantonsgebiet zu überwachen und die nötigen Massnahmen zu ergreifen, wenn ein besonders gefährlicher Schadorganismus entdeckt wird Tritt dieser zum ersten Mal in der betroffenen Region auf, so ist er mit geeigneten Mitteln auszurotten Ist dagegen der entdeckte Organismus bereits angesiedelt und kann eine Ausrottung aus technischen Gründen nicht in Betracht gezogen werden, dann besteht das Ziel, die ökonomischen Auswirkungen in Grenzen zu halten und zu verhindern, dass sich der Organismus in noch nicht befallene Regionen verbreitet Überwacht werden insbesondere die Parzellen, welche der Produktion von Vermehrungsmaterial dienen (Saatgut, Setzlinge usw.).
Gegenwärtig ist ein Projekt in Gang zur Totalrevision der gesetzlichen Bestimmungen Ein Ziel ist dabei, ein Kontrollsystem für den Pflanzenschutz aufzubauen, das die Anforderungen der EU erfüllt Damit könnten die Regelungen gegenseitig anerkannt werden Der grenzüberschreitende Verkehr mit Pflanzen würde erheblich erleichtert
203 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2
Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutz)
Für Pflanzensorten werden keine Erzeugnispatente erteilt Der Ausschluss beim Patentrecht ist historisch bedingt. Im Zeitpunkt der Einführung des Patentrechts galten Züchtungsergebnisse von Pflanzen mangels hinreichender Wiederholbarkeit nicht als patentfähig Um diese dennoch zu schützen, wurde ein besonderes Schutzsystem entwickelt International setzt das Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen entsprechende Mindestanforderungen Die Schweiz hat dieses Abkommen in der Fassung von 1978 ratifiziert Das Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) enthält die Bestimmungen, die für die Schweiz gelten Das Gesetz ist systematisch dem Immaterialgüterrecht zugeordnet Das Büro für Sortenschutz des BLW vollzieht das Gesetz.
Der Sortenschutz ist ein dem Patent vergleichbares Ausschliesslichkeitsrecht und schützt das geistige Eigentum an Pflanzenzüchtungen Es berechtigt den Inhaber der Züchtung allein, Vermehrungsmaterial der Sorte gewerbsmässig in Verkehr zu bringen, zu erzeugen oder anzubieten Der Züchter erhält die Möglichkeit, seine Investitionen zu amortisieren Der Sortenschutz leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Züchtung neuer Pflanzensorten, die wirtschaftlichen und ökologischen Erfordernissen gerecht werden Ohne das im Sortenschutz verankerte Züchterrecht ist nicht auszuschliessen, dass die Schweiz bei der Belieferung mit interessanten Neuheiten aus dem Ausland benachteiligt würde.
Der Sortenschutz erfasst nicht die Erzeugung von Vermehrungsmaterial für den eigenen Bedarf Dazu gehört auch Vermehrungsmaterial von landwirtschaftlichen Kulturarten, das ein Landwirt für seinen Eigengebrauch erzeugt Man spricht in diesem Zusammenhang vom Landwirteprivileg. Eine geschützte Sorte darf für Neuzüchtungen benutzt werden, ohne dass die Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers nötig ist Der Züchter ist auch berechtigt, die neu gezüchtete Sorte ohne Zustimmung des Schutzinhabers der benutzten Sorte zu verwerten. In diesem Fall spricht man vom Züchtervorbehalt
Der Sortenschutz setzt voraus, dass die Sorte neu, unterscheidbar, homogen und beständig ist Eine strenge Anbauprüfung anhand von Merkmalen, die in internationalen Richtlinien festgelegt sind, garantiert, dass eine Sorte diese Kriterien erfüllt Für das Kriterium «neu» gilt, dass die Sorte zum Zeitpunkt der Anmeldung in der Schweiz noch nicht und im Ausland seit höchstens vier bzw sechs Jahren vermarktet worden ist. Die Anbauprüfung, aber nicht die Neuheit, ist auch für die Aufnahme in den Sortenkatalog notwendig Sortenschutz und Sortenkatalog sind jedoch unabhängig voneinander
204 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Schutz des geistigen Eigentums an Pflanzenzüchtungen
■ Unterschiede zwischen Sorten- und Patentrecht

Das Sortenschutzrecht unterscheidet sich heute in wesentlichen Punkten vom Patentrecht Letzteres schützt Erfindungen auf dem Gebiet der Technik unter der Voraussetzung, dass sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. An das Kriterium der Neuheit werden dabei strengere Anforderungen gestellt als beim Sortenschutz Im Weiteren sind beim Patentrecht die Schutzfristen kürzer und es gibt keine Ausnahmen wie den Züchtervorbehalt oder das Landwirteprivileg beim Sortenschutz Patentierte Erfindungen können zwar für Forschungszwecke frei verwendet werden, für die Verwertung einer darauf beruhenden neuen Erfindung ist hingegen eine Abhängigkeitslizenz nötig. Die Schutzwirkung beschränkt sich beim Sortenschutz auf das Vermehrungsmaterial Das Patentrecht gewährt einen umfassenden Schutz
■ Überarbeitung von Sorten- und Patentrecht
Zur Zeit werden sowohl das Sortenschutz- als auch das Patentgesetz überarbeitet und internationalen Bestimmungen angepasst Für das Sortenschutzgesetz steht dabei das internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen von 1991 im Vordergrund, für das Patentgesetz die EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen Die Fortschritte in der Biotechnologie erlauben es heute, biotechnologische Verfahren und ihre Ergebnisse zu reproduzieren Deshalb können bereits heute Pflanzen als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens unter den Schutzbereich eines Verfahrenspatentes fallen Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung nähern sich auch die beiden Schutzsysteme an
205 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G Geschützte Sorten, Stand 31.12.99 Sorten Anzahl Getreide und Feldsaaten 94 (Weizen, Mais, Dinkel, Hafer, Gerste, Triticale, Soja, Erbsen, Kartoffeln, Klee und Gräser) Obst und Beerenarten 152 Gemüsearten 11 Zier- und Heilpflanzen 451 Total 708 Quelle: Patent-
Muster- und Markenblatt (Die Bewegungen im Sortenschutz werden alle 2 Monate publiziert)
2
Vertiefung: Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel
Pflanzenschutzmittel (PSM) werden zum Schutz der Nutzpflanzen und zur Sicherung des Ertrags eingesetzt. PSM sind biologisch aktive Stoffe, die neben den erzielten Schutzwirkungen auch Nebenwirkungen auf die Kulturpflanzen selbst, auf NichtzielOrganismen und die Umwelt haben können Deshalb werden neben der Wirksamkeit auch die Sicherheit von PSM in Bezug auf Menschen, Kulturpflanzen und die Umwelt sorgfältig überprüft und in einem umfassenden Zulassungsverfahren beurteilt PSM dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie in der Schweiz zugelassen sind Im schweizerischen Zulassungsverfahren sind verschiedene Bundesämter sowie Forschungsanstalten des BLW involviert Zulassungsbehörde ist das BLW
Die Rahmenbedingungen für das Zulassungsverfahren für PSM in der Schweiz wurden mit der Reform der Agrarpolitik neu festgelegt Wichtige Neuerungen beinhalten namentlich den EU-kompatiblen Erstanmelderschutz sowie die Ausrichtung der technisch-wissenschaftlichen Anforderungen auf die Vorschriften der EU und der OECD im Hinblick auf eine internationale Kooperationsfähigkeit Zudem wurde die rechtliche Basis geschaffen für den freien Import von in der Schweiz und im Ausland zugelassenen PSM Die neue Verordnung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-Verordnung) bildet die rechtliche Basis für die Umsetzung dieser Neuerungen Sie ist am 1 August 1999 in Kraft gesetzt worden
Die gesetzlichen Grundlagen des Zulassungsverfahrens umfassen Datenanforderungen und Bewertungsgrundsätze bezüglich der Wirksamkeit und des Schutzes von Mensch und Umwelt vor schädlichen Auswirkungen Damit soll die Sicherheit von PSM für Konsumenten, Anwender, Nutzpflanzen und Umwelt gewährleistet werden Das schweizerische Zulassungsverfahren sieht aber auch vor, ökologische Zielsetzungen der Agrarpolitik zu unterstützen. Im Hinblick auf die angestrebte Verbesserung der Umweltqualität besteht auch im Rahmen des Zulassungsverfahrens für PSM die Möglichkeit, Massnahmen wie Anwendungseinschränkungen zu ergreifen, um damit die Umweltbelastung und das Risiko weiter zu reduzieren. Sowohl in der Schweiz wie im Ausland sind zahlreiche Programme zur Erfassung der Umweltrisiken und zur Risikoreduktion im Gange Sie werden vom BLW unterstützt und die Zulassungsbehörde beteiligt sich im Rahmen der OECD an internationalen Programmen zur RisikoReduktion

Zulassungspflicht und -verfahren sind wirkungsvolle, präventive Massnahmen, um die Risiken von PSM zu reduzieren und das Vorsorgeprinzip bezüglich Gesundheits- und Umweltschutz umzusetzen
Wer in der Schweiz eine Zulassung für ein PSM haben will, muss beim BLW ein Registrierdossier einreichen Am Zulassungsverfahren sind im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufträge verschiedene Bundesämter und Forschungsanstalten mitbeteiligt Die Gesundheitsaspekte beurteilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Das BUWAL ist für spezifische Fragestellungen im Umweltbereich zuständig An der DossierAnalyse zur Beurteilung der PSM hinsichtlich landwirtschaftlicher Eignung, Qualität der landwirtschaftlichen Ausgangsprodukte für Lebensmittel und Umweltverträglichkeit beteiligen sich vor allem die Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil (FAW) und die Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Zürich-
206 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Grundlagen für die Zulassung von PSM
Reckenholz (FAL). Daten und Beurteilungsresultate der verschiedenen Stellen kommen bei der Zulassungsbehörde zusammen, welche die Entscheidungsdokumente und die entsprechende Argumentation für oder gegen eine Zulassung erstellt Fällt die Bewertung positiv aus, wird die Zulassung erteilt.
Um die Risiken eines Einsatzes von PSM abschätzen zu können und eine gute Entscheidungsbasis für eine Zulassung zu haben, ist eine umfassende Datenbasis zur Beurteilung möglicher Auswirkungen auf den Konsumenten, auf den Anwender und die belebte Umwelt notwendig
Die Datenbasis umfasst die Resultate zahlreicher wissenschaftlicher Studien mit der Testsubstanz, die modellhaft in Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Die Resultate beinhalten qualitative wie quantitative Angaben über Schadeffekte und die Beziehung zwischen Effekten und entsprechender Dosis Die Studien werden zur Hauptsache von der forschenden Industrie durchgeführt. In speziellen Fällen werden die Daten noch durch Resultate eigener Forschungstätigkeiten der Forschungsanstalten ergänzt Ein Registrierdossier muss auf Grund heutiger Anforderungen folgende Angaben umfassen:
– Identität des Wirkstoffes und des PSM-Produktes;
– Physikalisch-chemische, technische Eigenschaften;
– Wirkungsweise und Anwendung; – toxikologische Eigenschaften (inklusive Metabolismus im Säugetier);
– mögliche Rückstände auf Erntegut, Lebensmitteln, Futtermitteln;
– Verbleib und Verhalten in der Umwelt;
ökotoxikologische Untersuchungen: Wirkungen auf Nützlinge wie Fische, Vögel
Toxikologische Untersuchungen bei Pflanzenschutzmitteln
Akute Toxizität
Rückstandsanalytik
Humantoxikologie Auswirkung auf den Menschen
• bei der Anwendung
• über Rückstände in Lebensmitteln
Chronische Toxizität Kanzerogenität Mutagenität
Akute Toxizität bei Einzelorganismen
Umwelttoxikologie

Auswirkung auf Organismen
• in Boden und Wasser
• auf wildlebende Tiere Stoffwechsel
Zusammenhänge im Ökosystem Wirkung auf Fortpflanzung
Langzeitstudien zu Fruchtbarkeit, Vermehrung und Verhalten Fruchtschädigende Wirkung
Quelle: BLW
207 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
–
2
■ Beurteilung der Humantoxikologie
Beurteilungsstelle der humantoxikologischen Aspekte ist das BAG. Die bei den Behörden eingereichten Daten zu toxikologischen Untersuchungen an Labortieren (z B akute, chronische Toxizität, toxikologische Spezialuntersuchungen) dienen der Beurteilung von möglichen Schadwirkungen auf die verschiedenen Organsysteme nach kurzzeitiger oder langzeitiger Behandlung mit der Testsubstanz Kontaktmöglichkeiten zu PSM ergeben sich bei der Anwendung oder der Aufnahme als Rückstand in Nahrungsmitteln Die wichtigste Zielsetzung dieser Studien ist die Abklärung der DosisEffekt-Beziehung, das heisst die Information darüber, welche Wirkungen bei welcher Menge zu erwarten sind Aus dieser Information kann auf der Basis eines international gebräuchlichen Verfahrens diejenige Menge abgeleitet werden, bei der beim Menschen mit keiner Gefährdung gerechnet werden muss
Der Anwenderschutz berücksichtigt das toxikologische Profil des Wirkstoffs und des entsprechenden Produktes und die Grösse einer möglichen Belastung bei der Anwendung von PSM durch die Einstufung und Kennzeichnung in Giftklassen und Warnvorschriften
Beim Konsumentenschutz geht es um den Schutz der menschlichen Gesundheit beim Essen von Lebensmitteln Eine gesetzliche Limite legt die zulässige Menge der Rückstände von PSM fest. Diese ist so angelegt, dass sie einerseits für den Menschen kein gesundheitliches Risiko darstellen, anderseits die Erfordernisse des praktischen Pflanzenschutzes abdecken
■ Beurteilung der Umwelt toxikologie und -chemie

Beurteilungsstellen sind vor allem die Forschungsanstalten FAW und FAL Umwelttoxikologische Studien untersuchen die Auswirkungen auf Gewässerorganismen wie Fische, Algen, Fischnährtiere, auf Vögel und Nützlinge wie z B Bienen
Studien zu Umweltchemie und Metabolismus beinhalten Laboruntersuchungen, die es erlauben, Rückstände von Wirkstoffen und Abbauprodukten sowie deren Abbauwege hinsichtlich ihrer Abbaubarkeit in Boden und Wasser zu beurteilen. Auch das Versickerungsverhalten im Boden wird untersucht Bei Überschreitung bestimmter Abbauzeiten (langsamer Abbau) oder Unterschreitung festgelegter Adsorptionswerte im Boden werden die Resultate durch Modellrechnungen und Freilandversuche, so genannte Lysimeteruntersuchungen, ergänzt Dabei wird das Verhalten der Wirkstoffe und deren Abbauprodukte in verschiedenen Böden untersucht Kriterien sind der Abbau im Boden, die Möglichkeit zur Anreicherung, die Zersetzung bei Wasser- und Lichteinwirkung, das Versickerungsverhalten, d h Auswaschung in tiefere Bodenschichten oder sogar in das Grundwasser.
Die sorgfältige Beurteilung der umfassenden Daten eines Registrierdossiers und der Risiken unter Berücksichtigung von Kriterien und Bewertungsgrundsätzen, wie sie im EU-Raum ebenfalls angewendet werden, gewährleistet die Sicherheit von PSM für Mensch, Tier und Umwelt Die Beurteilung der Sicherheit ist eine wichtige präventive Massnahme
208 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2
■ Weiterführende Massnahmen zur Reduktion der Umweltbelastung von PSM und ihrer Risiken
Das Zulassungsverfahren erlaubt das Ergreifen von Massnahmen zur Reduktion der Umweltbelastungen und der Risiken auch nach der Erteilung einer Zulassung Im Rahmen verschiedener Projekte wird schwerpunktsmässig die Umweltbelastung durch PSM, die im Pflanzenschutz verwendet werden, untersucht. Solche Monitoring-Untersuchungen beinhalten z B die quantitative Erfassung von Anwendungsmengen bei der Behandlung oder Erhebungen von PSM-Rückständen in der Umwelt z B in Gewässern Diese Daten dienen zur Überprüfung der Risikobeurteilungen, die während des Zulassungsverfahrens vorgenommen wurden Die nach der Zulassung erhobenen Monitoringdaten geben Hinweise auf das Verhalten der Stoffe im Ökosystem unter realen Anwendungsbedingungen Zeigen Resultate Probleme auf – wird z B ein PSM häufig im Grundwasser nachgewiesen –, kann zur Reduktion des Risikos die Anwendung des entsprechenden PSM eingeschränkt oder verboten werden. So wurde z.B. die Anwendung des Herbizids Atrazin im Maisbau eingeschränkt und auf Bahngeleisen, an Strassenrändern und in Karstgebieten verboten
Die Methodik von Risikobeurteilung und -management wird auf internationaler Ebene ständig weiterentwickelt und die Zulassungsbehörde hat die Aufgabe, ihre Strategien und Kriterien laufend den neuesten Erkenntnissen anzupassen Die Zielsetzung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft hat weltweit zur Lancierung verschiedener Projekte zur Erfassung der Umweltbelastung durch PSM und ihrer Risiken geführt. Die Zulassungsbehörde in der Schweiz beteiligt sich ebenfalls an nationalen wie internationalen Risiko-Reduktions-Programmen
■ Internationale Projekte zur Ableitung und Überprüfung von Risikoindikatoren
Es ist nicht möglich das Gesamtrisiko durch alle PSM-Einsätze in der Landwirtschaft in einer einzigen Zahl zu quantifizieren Deshalb wurde im Rahmen der UNO und OECD vorgeschlagen, Kennwerte (Indikatoren) für das durch PSM verursachte Umweltrisiko zu entwickeln. Es sind Hilfsgrössen zur Abschätzung eines Gesamtrisikos, modellhaft berechnet auf der Basis einiger ausgewählter umweltrelevanter Parameter Diese Hilfsgrössen sollen dazu dienen, die Wirkungen agrarökologischer Massnahmen im Hinblick auf eine Risikoreduktion zu quantifizieren. Im Rahmen eines OECD-Pilotprojektes sollen von den OECD-Ländern nun drei vorgeschlagene Indikatoren für Oberflächengewässer aufgrund der verfügbaren länderspezifischen Daten auf ihre Anwendbarkeit und vor allem auf ihre Aussagekraft überprüft werden Das BLW und die FAW beteiligen sich an diesem internationalen Projekt
■ Verzeichnis der bewilligten PSM
Heute sind in der Schweiz rund 400 Wirkstoffe mittels des beschriebenen Verfahrens zugelassen. Rund 1'400 Handelsprodukte, welche diese Wirkstoffe enthalten, stehen als PSM zur Verfügung Die bewilligten PSM sind im jährlich erscheinenden «Verzeichnis der Pflanzenbehandlungsmittel» aufgelistet Das Verzeichnis enthält auch die Angaben der vorgesehenen Anwendung, Anwendungseinschränkungen, Konzentrationsangaben, Giftklasssierung und Warnaufschriften
209 2 A G R A R P O L I T I S C H E M A S S N A H M E N 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G
2
Ziel der Massnahmen ist die Erhaltung einer eigenständigen schweizerischen Tierzucht. Die züchterische Wertschöpfung soll im Inland realisiert werden Unterstützung erhalten das Rindvieh, die Pferde, die Schweine, die Schafe und die Ziegen Die Massnahmen dienen ausserdem der Erhaltung gefährdeter, einheimischer Nutztierrassen Bund und Kantone leisten gleich hohe Beiträge zur Finanzierung der Massnahmen
■ Bund setzt Leitplanken Der Bund setzt mit der Tierzuchtverordnung die züchterischen Leitplanken fest Züchter und Zuchtorganisationen regeln die Einzelheiten in eigener Verantwortung. Der Bund anerkennt Zuchtorganisationen, wenn diese die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen Zu den grundlegenden züchterischen Dienstleistungen gehören:

die Herdebuchführung;
– die Durchführung objektiver Leistungsprüfungen;
– die Auswertung der züchterischen Daten, einschliesslich Zuchtwertschätzung der Tiere
Ausgaben für die Tierzucht 1999
Der Bund beaufsichtigt die von ihm anerkannten Zuchtorganisationen Die Anerkennung ist Voraussetzung für die Gewährung von Beihilfen Der Bund ist weiter zuständig für die Bewilligung von Organisationen zur künstlichen Besamung beim Rindvieh, für die Bewilligung der Importe von Zuchttieren und Rindersperma sowie für Massnahmen zur Erhaltung gefährdeter einheimischer Nutztierrassen
Im Berichtsjahr unterstützte der Bund die Zuchtorganisation Pro Specie Rara für den Ausbau eines Herdebuchprogrammes für gefährdete Rassen sowie für Projekte zur Erhaltung von Stiefelgeiss, Bündner Oberländer Schaf, Engadiner Fuchsschaf, Walliser Landschaf und Spiegelschaf.
210 2 . 3 G R U N D L A G E N V E R B E S S E R U N G 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Tierzucht
2.3.4
–
Tierart Betrag Mio. Fr. Rindvieh 14,67 Pferde 1,08 Schweine 1,66 Schafe 1,06 Ziegen und Milchschafe 0,75 Gefährdete Rassen 0,07 Total 19,29 Quelle: Staatsrechnung
Tabelle 40, Seite A49

3 211 ■■■■■■■■■■■■■■■■
3. Internationale Aspekte
In den neunziger Jahren ist der Globalisierungsprozess weiter vorangeschritten. Mit den neuen Kommunikationstechnologien können Informationen rasch und ohne Rücksicht auf nationale Grenzen übermittelt werden Beim Austausch von Gütern schliessen sich immer grössere Gebiete zu Märkten zusammen, in denen die Waren ungehindert von Schranken an nationalen Grenzen frei zirkulieren können Ein Beispiel dafür ist die zunehmende Integration in Europa mit dem Gemeinsamen Markt
Die Schweiz ist stark exportorientiert und daher daran interessiert, einen möglichst freien Zutritt zu ausländischen Märkten zu haben Beim WTO-Abkommen von Marrakesch 1994 wurde erstmals auch die Landwirtschaft in das internationale Regelwerk über den Handel von Gütern und Dienstleistungen eingebunden Ebenso bildet das Agrarabkommen einen Bestandteil der bilateralen Verträge mit der EU. Für die Schweizer Landwirtschaft sind internationale Aspekte in den letzten Jahren wichtiger geworden Dies wird sich in Zukunft noch verstärken
Der Agrarbericht trägt diesen Entwicklungen Rechnung Der erste Bericht setzt zwei Schwerpunkte
– In einem ersten Teil werden Entwicklungen auf internationaler Ebene aufgezeigt, die einen Einfluss auf die ökonomische, ökologische und soziale Situation der Landwirtschaft haben können Themen sind: das bilaterale Agrarabkommen mit der EU, die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, das WTO-Agrarabkommen, der Einbezug der Landwirtschaft bei verschiedenen Freihandelsabkommen, Internationale Übereinkommen im Bereich nachhaltige Entwicklung und Umwelt sowie Welternährung und FAO
– In einem zweiten Teil geht es um internationale Vergleiche Je mehr sich die Schweizer Landwirtschaft mit der ausländischen Konkurrenz messen muss, desto wichtiger sind Informationen über die Verhältnisse im Ausland Die zwei Themen sind: Internationale Preisvergleiche sowie Entwicklung der Marktspanne in der Schweiz, in Deutschland und in den USA.
3 . I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 212
3.1 Internationale Entwicklungen
Nachfolgend wird zunächst auf das bilaterale Agrarabkommen, die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, das WTO-Agrarabkommen sowie auf verschiedene Freihandelsabkommen eingegangen Diese Ereignisse wirken sich insbesondere auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Schweizer Landwirtschaft aus Als weiteres wird das Thema Welternährung behandelt und die FAO als Spezialorganisation der UNO für Ernährung und Landwirtschaft kurz vorgestellt Im letzten Beitrag unter diesem Abschnitt werden die landwirtschaftlichen Aspekte von internationalen Übereinkommen im Bereich nachhaltige Entwicklung und Umwelt dargelegt

3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 213 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der Schweiz und der EU
Auf politischer Ebene kamen die bilateralen Verhandlungen mit der EU im Dezember 1998 zum Abschluss Die Texte der sieben Abkommen wurden am 26 Februar 1999 in Bern ratifiziert und am 21 Juni 1999 in Luxemburg unterzeichnet

Die Eidgenössischen Räte behandelten die Abkommen und Begleitmassnahmen in der Sondersession vom 30 August bis 2 September und in der Herbstsession 1999 Nationalrat und Ständerat genehmigten die Vorlagen am 8 Oktober 1999 mit grosser Mehrheit Gegen das Abkommen kam das Referendum zustande Volk und Stände stimmten am 21. Mai 2000 dem Abkommen zu. Dieses dürfte spätestens am 1. Januar 2002 in Kraft treten
Das Agrarabkommen sieht gegenseitige Zollreduktionen, Erleichterungen im Bereich der technischen Handelshemmnisse sowie die gegenseitige Anerkennung von Bezeichnungen vor
– Die vollständige gegenseitige Liberalisierung des Käsehandels nach einer fünfjährigen Übergangsperiode ist der eigentliche Kern des Abkommens in Bezug auf den Zollabbau Beträchtliche gegenseitige Zollkonzessionen sind auch bei Gemüse und Obst, beim Gartenbau, inklusive Schnittblumen, sowie in geringerem Masse bei einigen Trockenfleisch- und Weinspezialitäten vereinbart
Durch das Abkommen werden technische Handelshemmnisse in den Bereichen Veterinärwesen, Pflanzenschutz, Futtermittel, Saatgut, Bioprodukte und Vermarktungsregeln für Weinbauprodukte verringert bzw. abgeschafft, und zwar in der Regel auf Grund von Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit der Gesetzgebungen Ausserdem wird der Schweiz von der EU die Kompetenz erteilt, auf ihrem Territorium die Exporte von frischem Obst und frischem Gemüse den gemeinschaftlichen Vermarktungsnormen gemäss zu zertifizieren
Die geographischen und traditionellen Bezeichnungen beim Wein und die Bezeichnungen bei Spirituosen werden gegenseitig anerkannt und geschützt
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 214
–
–
■ Eine Chance für unsere Landwirtschaft
Als sogenannte Begleitmassnahme verstärkte das Parlament die Mittel zur Selbsthilfe durch eine Anpassung der entsprechenden Bestimmungen im Landwirtschaftsgesetz Konkret erhält der Bundesrat die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Beitragszahlung auf die Gesamtheit der Produzenten, Verarbeiter und gegebenenfalls Händler auszudehnen, wenn eine Organisation bei ihren Mitgliedern Beiträge erhebt, die ausschliesslich der Finanzierung von Selbsthilfemassnahmen dienen. Das Parlament änderte ausserdem das Lebensmittelgesetz Damit besteht die Möglichkeit, den Vollzug im Bereich der tierischen Produktion mit demjenigen in der EU zu harmonisieren
Die interne Umsetzung des Agrarabkommens bedingt eine Totalrevision der Freihandelsverordnung im landwirtschaftlichen Bereich, eine neue Verordnung für den Käsesektor, die Anpassung mehrerer Verordnungen der landwirtschaftlichen Gesetzgebung sowie diejenige der Lebensmittelverordnung und verschiedene Verordnungen im Veterinärwesen.
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 215 Gegenseitige Zollkonzessionen in wichtigen Bereichen Produkt Konzessionen CH Konzessionen EU Milch Käse freier Zugang freier Zugang nach 5 Jahren nach 5 Jahren Joghurt / Rahm keine 2 000 t Fleisch Rohschinken (Schwein) 1 000 t keine Trockenfleisch (Rind) 200 t 1 200 t Gemüse Tomaten 10 000 t 1 000 t Karotten keine 5 000 t Kartoffelerzeugnisse keine 3 000 t Früchte Äpfel keine 3 000 t Birnen keine 3 000 t Erdbeeren keine 10 000 t Früchte-, Gemüsepulver keine freier Zugang Anderes Olivenöl 50% Zollreduktion keine Schnittblumen 1 000 t freier Zugang Zierpflanzen freier Zugang freier Zugang
■ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit als Hauptziel
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
Mit der Annahme von rund zwanzig Gesetzesvorlagen brachte die EU am Berliner Gipfel im März 1999 das Projekt «Agenda 2000» zum Abschluss. Dieses Gesetzespaket umfasst vier eng zusammenhängende Hauptbereiche: die Reform der GAP, die Reform der Strukturpolitik, die Instrumente zur Vorbereitung der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten und den neuen Finanzrahmen
Im Landwirtschaftsbereich hat die Reform insbesondere folgende Ziele: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der gemeinschaftlichen Agrarerzeugnisse auf dem Binnenund dem Weltmarkt, stärkere Berücksichtigung von Umwelt- und Strukturanliegen, Vereinfachung des Landwirtschaftsrechts und Dezentralisierung seiner Umsetzung, Verstärkung der Verhandlungsposition der EU in der WTO und Stabilisierung der Ausgaben für die Landwirtschaft.
Zur Erreichung dieser Ziele sind zwei Arten von Massnahmen vorgesehen: neue gemeinsame Marktorganisationen in den Bereichen Weinbauprodukte, Ackerbau, Rindfleisch und Milch sowie übergreifende Massnahmen
■ Neue Marktordnungen
Beim Getreide wird der Interventionspreis ab der Ernte 2000/2001 um 15% gekürzt Bei der Milch werden die Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver in drei Etappen ebenfalls um 15% herabgesetzt Damit wird aber erst ab dem Wirtschaftsjahr 2005/2006 begonnen Die Milchkontingentierung wird bis 2007/08 beibehalten Die Gesamtquote wird bis zu diesem Zeitpunkt um rund 2,8 Mio t aufgestockt Dies entspricht fast der gesamten Kontingentsmenge der Schweiz Die Milchmenge der EU wird damit um 2,4% angehoben. Beim Rindfleisch wird ab Juli 2002 ein Sicherheitsnetz auf sehr tiefem Niveau eingeführt Gleichzeitig wird der Interventionspreis durch eine Regelung zur privaten Lagerhaltung ersetzt Der Grundpreis für die private Lagerhaltung liegt ab dem Jahr 2000 um 20% tiefer als der Preis, bei dem nach altem Recht die Intervention ausgelöst werden konnte
Diese Preissenkungen werden teilweise mit produktgebundenen Direktzahlungen an die Landwirte kompensiert Bei der Milch wird ab 2005 eine Prämie je kg Milch ausbezahlt Im Jahr 2007 dürfte dies – zu heutigen Wechselkursen umgerechnet – rund 2,7 Rp je kg Milch betragen Im Rindfleischbereich kann neu für alle Tierkategorien eine Schlachtprämie ausgerichtet werden Stark aufgestockt wird die Prämie für die extensive Rindviehhaltung.
Neu wird den Ländern ein Teil der Mittel für die Gewährung von Prämien in den Bereichen Rindfleisch und Milch als Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt. Die Länder können innerhalb festgelegter Höchstsätze selber bestimmen, welche Grundprämien sie aufstocken
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 216
■ Entwicklung des ländlichen Raums
Das Agrarpaket umfasst auch die Verordnung über die ländliche Entwicklung – zweiter Pfeiler der GAP –, mit der die Zukunft der ländlichen Räume in Europa wie folgt gesichert werden soll:
Weiterführung der im Jahre 1992 eingeführten Begleitmassnahmen (Vorruhestandsregelung, agroökologische Massnahmen und Aufforstung);
– Diversifizierung der Landwirtschaftsbetriebe (Unterstützung bei der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie bei der Berufsbildung, Förderung und Umstellung der Landwirtschaft, usw );

– Strukturanpassung der Betriebe und Starthilfen für junge Landwirte
■ Übergreifende Massnahmen
Eine marktordnungsübergreifende, horizontale Verordnung gibt den einzelnen Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Ausrichtung der Direktzahlungen an die Erfüllung ökologischer Anforderungen zu knüpfen sowie Kürzungen vorzunehmen, wenn die Anzahl der Arbeitskräfte auf einem Betrieb unterhalb einer bestimmten Grenze liegt und Einkommen und Vermögen eine gewisse Höhe überschreiten Die ökologischen Anforderungen und Grenzen können die einzelnen Mitgliedländer selber bestimmen
Gemäss der neuen Verordnung über die Finanzierung der GAP werden die Mitgliedländer ihren Anteil an den Krediten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) autonom bewirtschaften können, wobei sie allerdings gewisse gemeinschaftliche Kriterien zu beachten haben
Die Umsetzung der GAP-Reform hat im Jahr 2000 begonnen Am 1 Januar traten die neuen Verordnungen über die ländliche Entwicklung, die gemeinschaftlichen Regeln über die Direkthilfen und die Finanzierung der GAP in Kraft Die neuen Bestimmungen über verschiedene Marktordnungen (Ackerbau, Getreide, Kartoffelstärke, Rindfleisch und Wein) gelten erstmals für die Kampagne 2000/2001.
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 217
–
WTO-Agrarabkommen
Im Rahmen der Uruguay-Runde (1986 –1994) wurde die Landwirtschaft unter gleichzeitiger Anerkennung ihrer Multifunktionalität erstmals in das multilaterale Handelssystem integriert Durch das Agrarabkommen verpflichteten sich die WTO-Mitglieder, die Einfuhrzölle, die Stützungsmassnahmen und die Exportsubventionen über einen Zeitraum von sechs Jahren (1995 –2000) schrittweise zu verringern Für die Entwicklungsländer gelten besondere Bestimmungen
Schweizerische Verpflichtungen und Verhandlungsvorschläge
Themenbereich Verpflichtungen 1995 –2000
Marktzutritt
Mögliche Themen ab 2001
Zollbindung – Minus 36% im Durchschnitt – Weitere, differenzierte über alle Zolltariflinien Zollreduktionen
Mindestens 15% für jede Linie
Zollkontingente (ZK) – Einfuhrmengen 1986/88 – Einzollsysteme oder 5% des Inlandkonsums – ZK-Verteilungsmechanismen als Minimum
Schwellenpreissysteme
Inlandstützung
Produktionsunabhängige – Keine Abbauverpflichtung
Genaue Umschreibung, Direktzahlungen keine Produktionsanreize
Produktgebundene
Minus 20% (CH: Abbau von
Stützung 5,3 auf 4,3 Mrd Fr )
Exportsubventionen
Mengen
Werte
Nicht handelsbezogene Anliegen
Minus 21%
– Minus 36%
➞ Höhe frei
Weitere Reduktionen
Weiterer Abbau oder Aufhebung
Multifunktionalität – Kennzeichnung
(Herkunft und Produktionsmethoden) – Tierwohl
Die Schweiz ist am 1 Juli 1995 der WTO beigetreten Im Jahr 2000 wird die letzte Etappe als Umsetzungsverpflichtung erfüllt
Die WTO-Verpflichtungen bezüglich Marktzutritt sowie Inlandstützung konnten eingehalten werden Die vereinbarten Zollkontingente und Zollsenkungen verursachten keine Störungen auf dem Inlandmarkt Mit der Reform der Agrarpolitik und der damit verbundenen Trennung von Preis- und Einkommenspolitik wurde auch die produktgebundene Inlandstützung weiter abgebaut und betrug 1999 gemäss Notifikation WTO noch 2,9 Mrd Fr Damit wurde die in der WTO festgelegte Maximalhöhe (1995: 5,3 Mrd Fr , ab 2000: 4,3 Mrd Fr ) unterschritten Dagegen waren 1999 die Exportsubventionen für verarbeitete Nahrungsmittel (Schoggigesetz) leicht über dem WTO-Plafonds, wobei diese Überschreitung gegen die in den Vorjahren nicht beanspruchten Mittel aufgerechnet werden konnte
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 218
–
–
–
–
–
–
–
–
■ Wie weiter mit der Landwirtschaft?
Seattle
Vom 30 November bis 3 Dezember 1999 tagten in Seattle die Wirtschaftsminister der WTO-Mitgliedstaaten mit dem Ziel, Agenda und Struktur einer neuen WTO-Runde zu beschliessen Die 135 WTO-Mitglieder konnten sich jedoch nicht auf eine umfassende Verhandlungsrunde einigen Der Wille zu einer solchen Runde besteht aber weiterhin bei den meisten Mitgliedern, insbesondere auch bei den wichtigsten Industrieländern Auch die Schweiz sieht darin die beste Chance, den unterschiedlichen Ansprüchen der einzelnen Mitglieder Rechnung zu tragen und so ein Gesamtresultat zu erzielen, das für alle Mitglieder insgesamt positiv ausfällt

Ob und wann eine umfassende Verhandlungsrunde zustande kommen wird, kann im Moment nicht beurteilt werden Seattle hat den Prozess für eine neue Runde verzögert, nicht aber gänzlich gestoppt
Auf Grund der im WTO-Agrarabkommen eingebauten Neuverhandlungsklausel (Art 20) haben in Genf die Arbeiten zu einer neuen Agrarrunde begonnen Die ersten drei Sondersitzungen des Agrarkomitees (März, Juni, und September 2000) wurden dazu benützt, die Standpunkte der Delegationen zu den vier Verhandlungsfeldern Inlandstützung, Marktzutritt, Exportsubventionen und den sogenannten nicht handelsbezogenen Anliegen abzustecken Bis Ende Jahr haben die WTO-Mitglieder Zeit, ihre Verhandlungsvorschläge dazu einzubringen. Der Bundesrat wird ein entsprechendes Mandat erteilen Dieses wird unter Anhörung der interessierten Kreise erarbeitet
■ Weitere Reformschritte prüfen
Die Schweiz ist – wie alle WTO-Mitglieder – bereit, weitere Reformschritte in den traditionellen Disziplinen (Marktzutritt, Interne Stützung, Exportsubventionen) gemäss der Verpflichtung und im Rahmen von Artikel 20 des Übereinkommens – welcher explizit auch die Berücksichtigung der «nicht handelsbezogenen Anliegen» vorschreibt – zu prüfen.
Ein Vorteil solcher weltweit vereinbarten Reformschritte besteht darin, dass auch die Exportmärkte für unsere Agrarprodukte zugänglicher werden und die Störungen der internationalen Märkte durch staatliche Ausfuhrsubventionen abnehmen Ausserdem sollen auch geografische Herkunftsangaben – ein wichtiges Instrument für Spezialitäten der Schweiz – besser geschützt werden können
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 219
Beim Marktzutritt würde eine Erhöhung der Zollkontingente es erschweren, die Mengenanteile der schweizerischen Landwirtschaft zu halten Deshalb soll ein angemessenes Schutzniveau z B über ein Einzollsystem angestrebt werden Wieweit das bei den Futtermitteln angewandte Schwellenpreissystem auf andere Agrarprodukte ausgedehnt werden kann und soll, ist in geeigneten Fällen im Rahmen des Verhandlungsmandates zu überprüfen Allfällige weitere Zollreduktionen müssen zwischen sensiblen und nichtsensiblen Produkten unterscheiden Die besondere Schutzklausel für die Landwirtschaft soll beibehalten werden, wobei sinnvolle Anpassungen gesucht werden müssen
«Besondere Schutzklausel»
Sie kann autonom angewendet werden, wenn die Einfuhrmengen eine bestimmte Schwelle überschreiten oder der Importpreis unter ein bestimmtes Niveau fällt In beiden Fällen dürfen zusätzliche Zölle erhoben werden, ohne dass die betroffenen Exportstaaten handelspolitische Kompensationen fordern können
Die Schweiz hat erstmals im zweiten Halbjahr 1999 beim Schweinefleisch von der preislichen Schutzklausel Gebrauch gemacht (vgl Abschnitt 2 1 1)
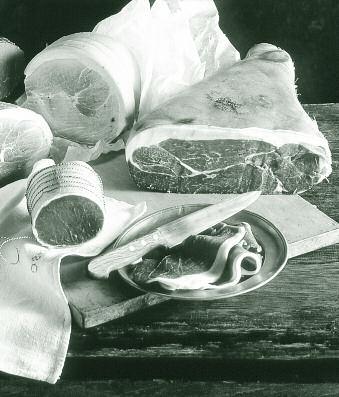
Auf Grund der eingeleiteten Agrarreformen hat die Schweiz für weitere Anpassungen bei der internen Stützung einen gewissen Spielraum. Die Abgrenzung der produktionsunabhängigen Direktzahlungen, die als sogenannte «Green-Box»-Massnahmen keiner Abbaupflicht unterliegen, zu den produktegebundenen Stützungen ist nicht immer einfach Im Rahmen der OECD laufen zur Zeit Arbeiten, die eine klarere Klassifizierung der «Green-Box»-Massnahmen erlauben sollen Diese sollen zielgerichtet, effizient, transparent und nicht produktions- oder handelsverzerrend sein. Es muss aber den einzelnen Ländern weiterhin möglich sein, über die absolute Höhe der finanziellen Mittel in dieser Kategorie autonom zu entscheiden
Bei den Exportsubventionen ist ein weiterer Abbau auch aus grundsätzlichen Überlegungen angezeigt Für die Schweiz wäre es allerdings von Vorteil, wenn bei den Verarbeitungsprodukten darauf verzichtet werden könnte Das bilaterale Agrarabkommen zwischen der Schweiz und der EU sieht eine schrittweise Aufhebung der Exportsubventionen im Käsebereich vor Vor dem Hintergrund solcher Entwicklungen gilt es, diese und andere Exportinteressen der Schweiz auch in der WTO offensiv zu vertreten Zusätzlich zu den Exportsubventionen im klassischen Sinn sollen auch Exportkredite und andere Formen der direkten und indirekten Ausfuhrsubventionierung mit in die Verhandlungen eingeschlossen werden In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist der Beschluss der OECD-Ministerkonferenz vom Juni 2000, auch die landwirtschaftlichen Exportkredite in das Exportkreditabkommen der OECD zu integrieren und die konkreten Verhandlungen über die Modalitäten möglichst bis Ende 2000 abzuschliessen Innerhalb der WTO sind alle Länder auf die Beschränkung bzw Aufhebung von Exporthilfen jeglicher Art zu verpflichten
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 220
Bei den «nicht handelsbezogenen Anliegen» tritt die Schweiz für die Verbesserung der völkerrechtlichen Basis für die Bewahrung einer multifunktionalen Landwirtschaft ein Die Schweiz hat sich in der ersten Arbeitsphase aktiv am Vorbereitungsprozess der Verhandlungen und an der Konkretisierung des Konzepts der Multifunktionalität beteiligt Zusammen mit der EU, Japan, Norwegen, Korea und Mauritius wurde eine gemeinsame Plattform geschaffen Diese wird nun von rund 40 Ländern unterstützt Bezüglich der Umsetzung stehen für die Schweiz «Green-Box»-Massnahmen im Vordergrund In anderen für die Landwirtschaft relevanten Gebieten sucht die Schweiz zudem einen verbesserten Schutz geografischer Herkunftsbezeichnungen sowie die Klärung der rechtlichen Basis für die Deklaration von Herkunft und Produktionsmethoden mit dem Ziel der Konsumenteninformation Gemäss Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS-Abkommen) sind die WTO-Mitgliedstaaten bereits zum Schutz von geografischen Angaben verpflichtet Im TRIPS-Rat werden nun zwei Fragen behandelt: die Erstellung eines multilateralen Registers der Weine und Spirituosen, denen dadurch ein zusätzlicher Schutz gewährt werden soll, und die Ausdehnung dieses Schutzes auf andere Produkte Für die Schweiz, die z B ihre Käsesorten nicht nur innerhalb der EU, sondern auch auf internationaler Ebene schützen möchte, ist diese Frage von besonderem Interesse
Freihandelsabkommen und Landwirtschaft
Die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), die heute vier Mitgliedstaaten zählt (Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein), hat seit Beginn der neunziger Jahre eine Reihe von Freihandelsabkommen mit Drittstaaten abgeschlossen Durch die Freihandelsabkommen der EFTA soll die Schweizer Wirtschaft vergleichbare Marktzutrittsbedingungen erhalten wie ihre Hauptkonkurrenten, vor allem in Europa Vierzehn der bisher insgesamt fünfzehn präferenziellen Abkommen sind in Kraft. Bei den meisten sind Länder in Mittel- und Osteuropa (11) Vertragspartner, bei den restlichen Mittelmeerländer (4) 1999 traten am 1 Juli bzw am 1 Dezember die mit der PLO und Marokko abgeschlossenen Abkommen in Kraft. Im Juni 2000 wurde von der EFTA zudem ein Freihandelsabkommen mit Mazedonien unterzeichnet
Gegenwärtig sind Verhandlungen mit den folgenden Ländern im Gang: Kanada, Mexiko, Zypern, Ägypten, Jordanien und Tunesien Geplant sind Verhandlungen mit Chile und Südafrika, später soll auch mit weiteren Ländern verhandelt werden
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 221
■ Multifunktionalität international besser verankern
■ Einbezug der Landwirtschaft
Diese Abkommen betreffen Industrieprodukte, die meisten verarbeiteten Landwirtschaftserzeugnisse, Fischereiprodukte und andere Meererzeugnisse Dagegen werden die in den Kapiteln 1–24 des Zolltarifs erwähnten landwirtschaftlichen Grundstoffe nicht abgedeckt. Diese sind Gegenstand separater bilateraler Vereinbarungen zwischen den einzelnen EFTA-Staaten und dem betreffenden Drittland, die parallel zum Freihandelsabkommen in Kraft treten Dieses Verfahren drängt sich auf, weil jeder EFTA-Staat seine eigene Agrarpolitik betreibt und im Rahmen der EFTA kein Freihandel für landwirtschaftliche Erzeugnisse besteht Obwohl die Landwirtschaft also formell nicht darunter fällt, bildet sie aus politischen Gründen in der Praxis dennoch einen integrierenden Bestandteil der Freihandelsabkommen
Die von der Schweiz im Landwirtschaftsbereich gewährten Konzessionen beschränkten sich bisher auf Produkte, welche die Ziele unserer Agrarpolitik nicht in Frage stellen In den letzten Jahren bestand die Strategie der Schweiz darin, Gesuchen stattzugeben, wenn die entsprechenden Konzessionen bereits anderen Ländern gewährt worden waren und auf neue Zugeständnisse einzutreten, wenn diese für den Erfolg der Verhandlungen ausschlaggebend waren und die schweizerische Agrarpolitik nicht gefährdeten Dieses Vorgehen hat sich im Grossen und Ganzen bewährt Nun haben jedoch einzelne Staaten, mit denen die EFTA über Freihandelsabkommen zu verhandeln gedenkt, ein besonderes Interesse am Export von Landwirtschaftsprodukten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die EU diesen Staaten im Agrarbereich stark entgegengekommen ist Die Schweiz muss sich demnach darauf gefasst machen, dass künftig im Gegenzug zum freien Marktzutritt für ihre Industrieprodukte mehr Zugeständnisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse verlangt werden Sie wird dafür sorgen müssen, in solchen Verhandlungen ein optimales und ausgewogenes Resultat zu erzielen und Entscheide zu vermeiden, die sich negativ auf die interne Agrarreform auswirken könnten
■ Ergebnisse der Vereinbarungen mit der PLO und Marokko
Die am 1 Juli 1999 in Kraft getretene bilaterale Vereinbarung über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen der Schweiz und der PLO sieht die Gewährung von Zollkonzessionen durch unser Land insbesondere für Schnittblumen sowie gewisse Früchte und Gemüse vor Die von der palästinensischen Behörde gewährten Konzessionen betreffen Milchprodukte und bestimmte verarbeitete Landwirtschaftserzeugnisse
In der am 1 Dezember 1999 in Kraft getretenen Vereinbarung mit Marokko verpflichtet sich die Schweiz zum Abbau bzw zur Abschaffung der Zölle auf Landwirtschaftsprodukten, die für Marokko besonders wichtig sind. Dafür wurden der Schweiz Konzessionen in den Bereichen Käse, Fette und Öle sowie Fruchtpulver gemacht
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 222
Welternährung und FAO

In den vergangenen 30 Jahren hat die Anzahl hungernder und unterernährter Menschen in Entwicklungsländern von 920 Mio. auf ungefähr 800 Mio. abgenommen. Im selben Zeitraum ist die Weltbevölkerung um mehr als 2,3 Mrd Menschen auf heute 6 Mrd angewachsen
Entwicklung des Hungers in der Welt
Jahr Bevölkerung Hungernde Hungernde in Relation zur Bevölkerung Mrd
1 Trend hochgerechnet
2 Ziel des FAO Welternährungsgipfels vom November 1996 Quellen: UNFPA, FAO
Die Verbesserung der Welternährungslage stellt einen beachtlichen Erfolg von Eigenanstrengungen in Entwicklungsländern, gepaart mit den Leistungen internationaler Entwicklungszusammenarbeit dar Nicht zuletzt durch den Einsatz verbesserter Agrartechniken ist es gelungen, die landwirtschaftlichen Erträge in Entwicklungsländern von 1970 bis 1990 um jährlich 3,3% zu steigern Dazu kommt, dass die Bevölkerung auch in den Entwicklungsländern zuletzt nur noch um 1,7% pro Jahr zunahm. Das Produktionswachstum stiess in den neunziger Jahren aber auch an Grenzen und betrug nur noch 2,6% Bezieht man die Industrieländer mit ein, beträgt die jährliche Steigerung noch 1,8%.
Gründe für diese Entwicklung: – der zu sorglose Umgang mit den natürlichen Ressourcen und die langjährige Vernachlässigung der Grundsätze einer nachhaltigen landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung erschweren heute weitere Produktivitätsfortschritte;
die Anzahl absolut Armer von 1,2 Mrd Menschen, welche im Jahre 1999 täglich über weniger als einen Dollar und damit über praktisch keine Kaufkraft verfügten, um Nahrungsmittel nachzufragen;
– eine Vielzahl von natürlichen und vom Menschen verursachten Katastrophen, Kriegen und Konflikten, welche das Angebot und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln in den betroffenen Regionen verringerten;
– in Afrika südlich der Sahara vermag die Zunahme der landwirtschaftlichen Produktivität (3,0%) mit dem immer noch starken Bevölkerungswachstum (3,2%) nicht Schritt zu halten
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 223
1970 3,7 920 Jeder 4 1980 4,5 900 Jeder 5 1990 5,3 840 Jeder 6. 1995 5,8 820 Jeder 7 2000 6,0 800 Jeder 7,5 2010 1 7,2 720 Jeder 10 2015 2 7,5 400 Jeder 19
Mio
–
■ Welternährungslage besser als vor 30 Jahren
Tabellen 47–48, Seiten A56–A57
Damit es im Jahr 2025 bei einer geschätzten Weltbevölkerung von 8,5 Mrd. Menschen keine Hungernden mehr geben würde, müsste die landwirtschaftliche Produktion gegenüber den neunziger Jahren um rund 75% gesteigert werden Die Bewältigung dieser grossen Herausforderung verlangt weltweite Solidarität. Für uns ergibt sich daraus die Verpflichtung zu einem engagierten Einsatz für die Stärkung des Agrarsektors in der Dritten Welt, aber auch zur Erhaltung einer produktiven Landwirtschaft in der Schweiz
Die Fortschritte in der Welternährung, insbesondere in relativen Zahlen gemessen, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass immer noch jeder siebte Erdbewohner Hunger leidet oder unterernährt ist. In den neunziger Jahren drohte die Anzahl Hungernder auf einem hohen Niveau zu stagnieren Die FAO berief deshalb 1996 einen Welternährungs-Gipfel ein Am Gipfel wurden ein Aktionsplan und die Erklärung von Rom von Staatspräsidenten und Regierungsvertretern aus 186 Ländern genehmigt. Als Ziel wurde vereinbart, die Anzahl hungernder und unterernährter Menschen bis zum Jahr 2015 zu halbieren
Bei der Formulierung des Planes hat sich die Schweiz für vier Schwerpunkte eingesetzt, auf die auch bei der Umsetzung des Aktionsplans besonderer Wert gelegt wird:
– die Notwendigkeit einer guten Regierungsführung;
– eine mehreren Zielen dienende, multifunktionale Landwirtschaftspolitik;
eine nachhaltige Produktionsweise;
– eine demokratische Mitbestimmung, insbesondere der Frauen
Vier Jahre nach dem Gipfel muss festgestellt werden, dass die Weltgemeinschaft noch weit von jenem Pfad entfernt ist, auf dem das 1996 gesteckte Ziel erreicht werden könnte. Die Anzahl Hungernder, die bis zum Jahr 2015 auf 400 Mio. zurückgeführt werden sollte, ist auch im Jahre 1999 nicht wesentlich unter 800 Mio Menschen gesunken
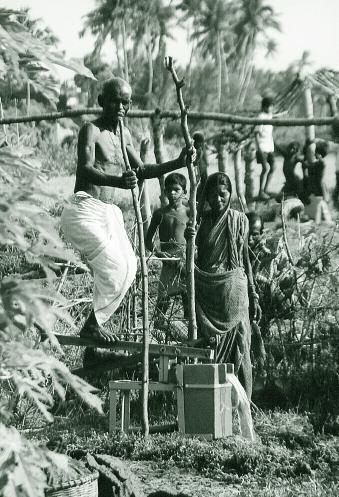
Folgendes sind die Hauptgründe dafür:
– trotz global zunehmender Nahrungsmittelproduktion ist die absolute Armut breiter Bevölkerungsschichten weiter gestiegen;
– die unternommenen Anstrengungen der betroffenen und der geldgebenden Länder reichen nicht aus, um die gesetzten Ziele im Kampf gegen den Hunger zu erreichen Nach wie vor besteht eine abnehmende Investitionsneigung zugunsten landwirtschaftlicher Entwicklung in den ärmsten Ländern;
die natürlichen und vom Menschen verursachten Katastrophen haben sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt Mehr als die Hälfte der unterernährten Bevölkerung sind von Kriegen, anderen bewaffneten Konflikten und Umweltkatastrophen stark betroffen;
– in den letzten Jahren haben Wirtschafts- und Finanzkrisen in Russland und verschiedenen Ländern Asiens Fortschritte in der Armuts- und Hungerbekämpfung wieder zunichte gemacht
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 224
–
–
■ Der Welternährungsgipfel 1996 in Rom
■ FAO: Spezialorganisation der UNO für Ernährung und Landwirtschaft
Die FAO wurde am 16. Oktober 1945 mit den Zielen gegründet:
weltweit zu einem höheren Lebensstandard, zur besseren Ernährung und zur Überwindung von Hunger und Unterernährung einen Beitrag zu leisten;
Die Effizienz in Produktion und Verteilung von Agrarerzeugnissen zu verbessern;
– günstige Lebensverhältnisse für die ländliche Bevölkerung zu schaffen;
– sowie die weltwirtschaftliche Entwicklung zu fördern
Die normativen Aufgaben der FAO sind:
– Sammlung, Auswertung und Verbreitung von statistischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Informationen zur Entwicklung der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie der Fischerei weltweit (www fao org);
Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die globale, regionale und nationale Agrarentwicklung, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und anderen internationalen Organisationen;
Entwicklung von Agrar- und Ernährungsstrategien, vor allem für Entwicklungsländer, unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Schutzes der natürlichen Ressourcen
Operationelle Aufgaben, welche die FAO wahrnimmt sind:
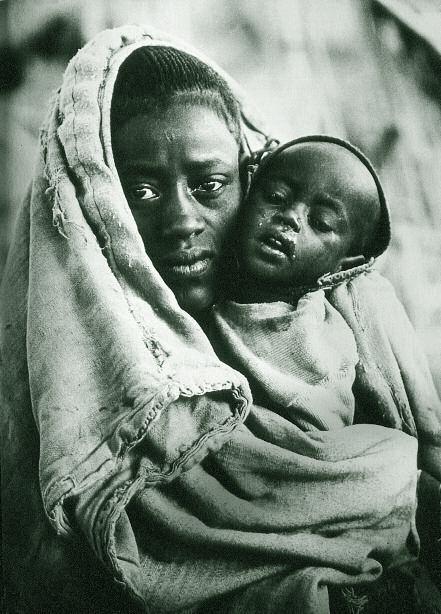
– Durchführung von Entwicklungsprogrammen und -projekten mit Mitteln des regulären Haushalts bzw. finanziert durch Weltbank, Geberstaaten oder andere Institutionen;
– Mitwirkung bei Nahrungsmittelhilfemassnahmen im Rahmen des FAO/UNO Welternährungsprogrammes;
– Einführung eines Spezialprogrammes für die Ernährungssicherheit in einkommensschwachen Entwicklungsländern, die Nahrungsmittel importieren
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 225
–
–
–
–
■ Abkommen, die für die Landwirtschaft von spezieller Bedeutung sind
Die Schweiz ist seit 1947 Mitglied dieser Spezialorganisation der UNO. Das Schweizerische FAO-Sekretariat im BLW ist federführende Koordinationsstelle des Bundes gegenüber der FAO in Rom Es nimmt auch die Sekretariatsaufgaben für das vom Bundesrat gewählte schweizerische FAO-Komitee wahr und ist für die Folgearbeiten und die Umsetzung des Aktionsplanes des Welternährungsgipfels zuständig
Das FAO-Komitee ist eine vom Bundesrat gewählte ausserparlamentarische beratende Kommission für alle Fragen betreffend FAO und Welternährung Sie setzt sich aus Vertretern von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zusammen, namentlich aus dem Entwicklungsbereich, der Wirtschaft und der Wissenschaft
Die Schweiz leistet einen jährlichen Beitrag an die Aufwendungen der FAO. Der Mitgliederbeitrag berechnet sich nach einem von der UNO-Generalversammlung für zwei Jahre beschlossenen Beitragsschlüssel Für die Periode 2000/01 kommt die Schweiz für 1,2% oder rund 6 Mio. Fr. des Budgets auf. Die Schweiz leistet darüber hinaus Beiträge an Entwicklungsprojekte und Programme zur Verbesserung der Ernährungssicherheit im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit
Internationale Übereinkommen im Bereich nachhaltige Entwicklung und Umwelt
Die weltweit rasche demographische und wirtschaftliche Entwicklung führte zu immer höherem Umweltkonsum in den letzten fünfzig Jahren In den siebziger Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, dass die grossen Umweltprobleme international zu lösen sind 1972 fand in Stockholm die erste globale Umweltkonferenz statt Zum ersten Mal wurden Umweltfragen auf breiter Ebene diskutiert Die zweite globale Umweltkonferenz im Jahr 1992 in Rio de Janeiro zeigte, dass Umweltschutz ohne sozialen Fortschritt und ohne wirtschaftliche Effizienz nicht realisierbar ist Ökologie, Ökonomie und Soziales bilden die drei Säulen einer nachhaltigen Entwicklung Als Ergebnis der Konferenz von Rio wurde ein umfassendes Entwicklungs- und Umwelt- Aktionsprogramm verabschiedet Darin wird von den Regierungen verlangt, Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten In den letzten Jahren wurden verschiedene weitere Umweltübereinkommen unterzeichnet
Agenda 21;
– Internationale Verpflichtung über pflanzengenetische Ressourcen in Ernährung und Landwirtschaft (International Undertaking on Plant Genetic Resources)
– Übereinkommen über die biologische Vielfalt;
– Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen;
Konvention über grenzüberschreitende Luftverunreinigungen;
– Wiener Protokoll zum Schutz der Ozonschicht;
– Übereinkommen zum Schutz der Alpen;

Berner Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume;
– Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks.
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 226
–
–
–
■ FAO und die Schweiz
■ Internationale Verpflichtung und Biodiversitätskonvention: Landwirtschaftliche
Aspekte
Von den verschiedenen internationalen Übereinkommen sind nicht alle von derselben Bedeutung für den Sektor Landwirtschaft und Ernährung Wichtig sind insbesondere die Herausforderungen, welche sich aus der Internationalen Verpflichtung über pflanzengenetische Ressourcen in Ernährung und Landwirtschaft (International Undertaking on Plant Genetic Resources), der Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity (CBD)) sowie der Klimakonvention (Framework Convention on Climate Change (FCCC)) ergeben
Für die langfristige Sicherung der Ernährung der Bevölkerung spielt die genetische Vielfalt eine wichtige Rolle Ende der siebziger Jahre wurden die Anstrengungen zur Konservierung von pflanzengenetischen Ressourcen auf nationaler und internationaler Ebene verstärkt Die FAO verabschiedete 1983 an ihrer 22 Konferenz ein globales Programm zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen im Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Darin eingebettet ist eine nicht bindende internationale Verpflichtung (International Undertaking), die das Ziel hat, den freien Zugang sowie den Informationsaustausch zu gewährleisten
Die Mitgliedstaaten der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten im Mai 1992 in Nairobi die Biodiversitätskonvention. Diese deckt alle Aspekte der biologischen Vielfalt (genetische Vielfalt, Artenvielfalt, Vielfalt der Ökosysteme) ab Sie bietet einen internationalen Rahmen, um der Verarmung der biologischen Vielfalt zu begegnen. Die Vertragsstaaten der Rahmenkonvention haben sich gemäss Artikel 1 der Konvention zur Umsetzung der folgenden Ziele verpflichtet:
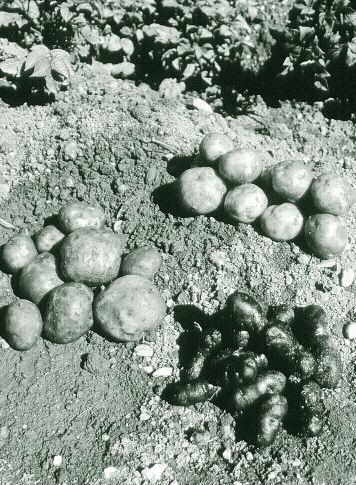
– Erhaltung der biologischen Vielfalt;
nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile;
– ausgewogene und gerechte Aufteilung, der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile.
Im Weiteren sind die Vertragsstaaten dazu aufgerufen:
die internationale Zusammenarbeit zu verstärken;
– die Ziele der Biodiversitätskonvention in nationalen Strategien, Plänen und Politiken (inkl Sektorpolitiken) umzusetzen;
wirtschaftlich und sozial verträgliche Massnahmen zu ergreifen, die Anreize für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt schaffen;
– die Erarbeitung von wissenschaftlichem und technischem Know-how zu fördern;
zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit beizutragen
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 227
–
–
–
–
■ Rechte der Landwirte und Benefit Sharing
Die Biodiversitätskonvention anerkennt im Bereich der genetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft die führende Rolle der FAO Es zeichnet sich ab, dass die Internationale Verpflichtung zu den pflanzengenetischen genetischen Ressourcen in Ernährung und Landwirtschaft zu einem zentralen Element für eine nachhaltige Landwirtschaft wird Die bisherige Verpflichtung ist eine Vereinbarung zwischen interessierten Kreisen der Pflanzenzucht und der Forschung Die neue und zur Zeit in Verhandlung stehende Verpflichtung soll mit den Anliegen der Biodiversitätskonvention harmonisiert werden und in ein rechtsverbindliches Protokoll überführt werden In der Abbildung sind die hauptsächlichen neuen Verhandlungspunkte dargestellt
Vergleich bisherige und neue Verpflichtung
Neue Verpflichtung
Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen
Bisherige Verpflichtung
– Genbanken
– Internationale Agrarforschung
– Zugang zu Genbankmaterial
– Informationsnetz
– Finanzierung
Benefit Sharing
Rechte der Landwirte
Nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen auf dem Betrieb
Kostentragung und Finanzierung der neuen Aufgaben
Mit der Anerkennung der Rechte der Landwirte (Farmers Rights) soll zum Ausdruck gebracht werden, dass erbrachte wie zukünftige Leistungen der Landwirtschaft für die Erhaltung und Entwicklung der genetischen Ressourcen zu Gunsten der Allgemeinheit in Wert gesetzt werden müssen In zunehmendem Masse konzentrieren sich die Agrarproduktionssysteme auf Leistungen, die vom Markt abgegolten werden Ohne direkte oder subsidiäre staatliche Eingriffe besteht die Gefahr, dass nicht marktgängige Leistungen, wie der Anbau seltener Sorten oder die Erhaltung von alten Nutztierrassen, immer weniger erbracht werden
Der Begriff Benefit Sharing umschreibt die Aufteilung der Vorteile, welche sich aus der kommerziellen oder sonstigen Nutzung von genetischen Ressourcen ergeben Diese Nutzung ist nur deshalb möglich, weil Landwirte seit Generationen Pflanzen züchteten und das damit verbundene Wissen über die Eigenschaften sowie Verwendungszwecke der Pflanzen und Tiere erhalten und überliefert haben
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 228
An der fünften Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention in Nairobi im Juni 2000 wurde unter anderem über den Zugang zu genetischen Ressourcen (Access) die gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung genetischer Ressourcen (Benefit Sharing) sowie dem Schutz von traditionellem Wissen diskutiert.
Die Verhandlungen haben gezeigt, dass der Wissensstand betreffend Zustand und Entwicklung der Biodiversität in Ernährung und Landwirtschaft noch sehr unterschiedlich ist Interdisziplinäres Wissen ist nur lückenhaft vorhanden, die Gründe für den Verlust der Biodiversität sind unklar und allgemeine Indikatoren zur Bewertung der Biodiversität fehlen Um diese Unsicherheiten auszuräumen wurde ein Arbeitsprogramm entworfen, das zur Lösung folgender Fragen beitragen soll:

– Handlungsbedarf erkennen;
– geeignete Politiken zur Umsetzung der Biodiversitätskonvention identifizieren;
– Wissensbildung und -transfer intensivieren
An der Konferenz wurde auch das Biosafetyprotokoll zur Unterschrift aufgelegt Das Protokoll regelt den zwischenstaatlichen Handel mit gentechnisch veränderten Organismen
Auf institutioneller Ebene wurde die enge Zusammenarbeit mit der FAO bestätigt. Die FAO wurde ersucht, die Internationale Verpflichtung zu den pflanzengenetischen Ressourcen raschmöglichst abzuschliessen Ausserdem entschied die Konferenz, bei der WTO ein Gesuch um Beobachterstatus im Agrarkomitee einzureichen. Dies deshalb, weil zwischen der WTO und der Biodiversitätskonvention zum Teil enge Beziehungen bestehen So anerkennt die WTO, dass verschiedene Beschlüsse der Biodiversitätskonvention wie z B der Beschluss betreffend die landwirtschaftliche Biodiversität, der Beschluss über fremde Pflanzen, welche einheimische Ökosysteme, Lebensräume oder Pflanzen bedrohen, oder der Beschluss betreffend dem Immaterialgüterrecht von weitreichender Bedeutung sind, die auch Auswirkungen auf Handelsregeln haben können
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 229
■ Ergebnisse der fünften Vertragsstaatenkonferenz im Bereich Landwirtschaft
■ Klimarahmenkonvention: Landwirtschaftliche Aspekte
Die Klimakonvention will dem weiteren Anstieg der Durchschnittstemperaturen auf der Erdoberfläche Einhalt gebieten Sie formuliert als Endziel die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimas verhindert wird. Ein solches Niveau soll innerhalb eines Zeitraumes erreicht werden, der ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaänderungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann Im Protokoll von Kyoto wurden rechtsverbindliche Zielvorgaben und ein zeitlicher Rahmen für die Reduzierung der Emissionen festgelegt Gemäss Protokoll hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, ihre Emissionen von Treibhausgasen bis 2012 um 8% gegenüber 1990 zu senken Diese Verpflichtung hat die Schweiz als gesamtes zu erfüllen. Auch die Landwirtschaft muss ihren Beitrag leisten.
Beim Kyotoprotokoll geht es primär um die Reduktion von Emissionen aus Verbrennungsprozessen. Das Protokoll lässt die Möglichkeit offen, die Reduktionsverpflichtungen auch mit Senken, statt allein mit der Reduktion der Emissionen, zu erfüllen Unter einer Senke versteht man einen Prozess, der der Atmosphäre ein Treibhausgas entzieht und es über einen gewissen Zeitraum bindet Der Mensch kann nun mit gewissen Aktivitäten bewusst dazu beitragen, solche Senken neu zu schaffen, z.B. mit dem Wiederaufforsten gerodeter Flächen oder bodenschonenden Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft Bis zum 1 August 2000 konnten die einzelnen Staaten Eingaben an das Sekretariat der Klimakonvention machen Die Schweiz hat diese Chance genutzt und entsprechende Eingaben gemacht. Der weitere Verhandlungsverlauf wird zeigen, wie weit solche anthropogenen Senken bei der Berechnung zukünftiger Inventare berücksichtigt werden
3 . 1 I N T E R N A T I O N A L E E N T W I C K L U N G E N 3 230
3.2 Internationale Vergleiche
Die Schweizer Landwirtschaft wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der internationalen Konkurrenz weitgehend abgeschottet Diese Situation hat sich in den neunziger Jahren geändert Der Globalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft kann sich auch die Landwirtschaft immer weniger entziehen Das WTO-Abkommen von Marrakesch aus dem Jahre 1994 stellte erstmals auch Regeln für den Handel von Agrargütern auf und leitete einen Prozess zum Abbau des Protektionismus in diesem Bereich ein Im Rahmen der bilateralen Verträge mit der EU wurde ein Agrarabkommen abgeschlossen, das eine gewisse gegenseitige Marktöffnung bei verschiedenen Produkten mit sich bringen wird.
In dieser Situation stellt sich die Frage immer öfter, wo unsere Landwirtschaft international steht. In diesem Abschnitt soll speziell darauf eingegangen werden. Im ersten Bericht werden einerseits Produzenten- und Konsumentenpreise von Agrarprodukten zwischen der Schweiz und verschiedenen anderen Ländern aufgezeigt, anderseits die Margen der Schweiz mit denjenigen in Deutschland und in den USA verglichen In den nächsten Berichten soll dieser Bereich weiter ausgebaut werden Bereits in Auftrag gegeben wurde eine Studie über einen Vergleich der Produktionskosten zwischen der Schweiz und Deutschland In diesem Projekt geht es darum, die Kostenunterschiede zwischen repräsentativen Schweizer Betriebsgruppen und entsprechenden Betriebsgruppen in Deutschland darzustellen und die Gründe für die Kostenunterschiede zu analysieren Untersucht werden sollen insbesondere der Preis- und Grösseneffekt sowie übrige Effekte wie unterschiedliche Vorschriften oder Parzellengrössen

3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 231
■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Was erhalten die Produzentinnen und Produzenten?
Internationale Preisvergleiche
Ausgehend vom Schweizermarkt werden Vergleiche mit gleichen, ähnlichen oder wichtigen Märkten des Auslandes angestellt. Die Position und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft im internationalen Umfeld stehen dabei im Vordergrund Damit soll eine Versachlichung der Diskussion erreicht werden, indem die internationalen Preisvergleiche über einen längeren Zeitraum auf der gleichen Basis erfolgen
Das Anstellen von internationalen Preisvergleichen ist nicht einfach Schwierigkeiten bestehen bei der Auswahl der Produkte, der Verfügbarkeit der Zahlen, der Relevanz der Messgrössen, den unterschiedlichen Produktions- und Verkaufsformen oder den währungsspezifischen Einflüssen Es stehen daher nicht die absoluten Werte im Vordergrund, sondern die Veränderungsraten im Verlaufe der Zeit
Die effektiv realisierten Produzentenerlöse bilden die Grundlage für den Vergleich Sie werden für alle Länder entsprechend der Zusammensetzung der Endproduktion in der Schweiz gewichtet Das Produktionsmuster der Schweiz wird so auf die Vergleichsländer übertragen. Damit kann gezeigt werden, wie gross z.B. die relative Differenz zu den USA ist, wenn für unsere Landwirtschaft die amerikanischen Produzentenerlöse zugrunde gelegt werden
Die Zahlen der EU beziehen sich auf die vier umliegenden Länder (EU-4) Die Niederlande und Belgien werden bei den Kartoffeln und beim Gemüse zusätzlich miteinbezogen, weil die beiden Länder in diesen Sektoren beachtliche Produktionsvolumen aufweisen (EU-6) Die Durchschnittsberechnung für die EU beruht auf den Produktionsanteilen der einbezogenen Länder am Gesamtausstoss dieser Ländergruppe. Die vier, respektive sechs Länder erzeugen zwischen 45 und 80% der jeweiligen gesamten EU-Produktionsmengen
Entwicklung der Produzentenpreise: Schweiz in Relation
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 232
Tabellen 42–43b, Seiten A51–A53
zu ausgewählten Ländern
I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 90/92 97/99 zu CH 90/92 Quellen: SBV, BLW, Eurostat, U.S. Departement of Agriculture 0 100 60 80 40 20 10 70 90 50 30
CHEU-4/6DUSA IA F
Die schweizerischen Produzentenpreise sind zwischen den beiden Beobachtungszeiträumen um 19% gefallen, fast gleich viel wie diejenigen der vier umliegenden EULänder Dies mag mit Blick auf eine Annäherung an das europäische Preisniveau wenig sein, aber absolut gesehen entspricht dies im Vergleich zur EU einem doppelten Betrag je Einheit Wenn unsere Bäuerinnen und Bauern den gleichen Warenkorb in den umliegenden Ländern produzierten, würden ihre Preise in den beiden Perioden 53% der schweizerischen betragen Die Bandbreite ist jedoch sehr gross So lagen 1999 die Kartoffelerlöse in Italien um 16% über denjenigen der Schweiz
Interessant sind die Vergleichszahlen für Österreich Sie zeigen den Stand vor und nach dem Beitritt zur EU Die Produzentenerlöse lagen 1990/92 um 38% unter dem schweizerischen Durchschnitt, 1997/99 hat sich dieser Abstand auf 52% erhöht.
Eine andere Entwicklung ist in Bezug auf die USA festzustellen Die zum jeweiligen Wechselkurs umgerechneten Produzentenerlöse sind generell auf Grund des höheren Dollarkurses angestiegen (+4%), in Einzelfällen auch in der Landeswährung selber, wie z B für Rohmilch (+10%) Die Differenz zu den USA hat sich somit verkleinert
Für diesen Vergleich wurden die Preisabstände zwischen der Schweiz und den einbezogenen Ländern gemäss dem Gewichtungsschema des schweizerischen Landesindex der Konsumentenpreise zusammengefasst Das schweizerische Konsumschema wird auf die anderen Länder umgelegt. Nicht berücksichtigt werden die Unterschiede in den Kaufkraftparitäten und im Kostenumfeld
Bei der «EU-4» handelt es sich um die Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich Für Italien wurde mangels Alternativen auf das detaillierte Zahlenmaterial der Stadt Turin zurückgegriffen, was angesichts der geografischen Nähe zum schweizerischen Markt trotzdem als guter Preisindikator gelten kann Beim Gemüse (inkl Kartoffeln) und bei fehlenden Vergleichspreisen von einem oder mehreren der vier anderen Ländern wurde zusätzlich noch Belgien berücksichtigt. Für die Niederlande waren keine offiziellen Konsumentenpreise erhältlich Die jeweils in diesen vier, resp fünf Ländern festgestellten tiefsten (EU-min) und höchsten (EU-max) Preise werden zu je einer Gruppe zusammengefasst

3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 233
■ Was zahlen die Konsumentinnen und Konsumenten?
Tabellen 44–45, Seiten A54–A55
Entwicklung der Konsumentenpreise: Schweiz in Relation zu ausgewählten Ländern
Das Preisgefälle zum Ausland ist verglichen zu den Produzentenpreisen weniger hoch, weil u a in den Konsumentenpreisen auch die importierte Ware enthalten ist
Die Konsumentenpreise der für diesen Vergleich ausgewählten Produkte sind in der Schweiz um 4% gefallen. Relativ gesehen ist der Rückgang kleiner als bei den Produzentenpreisen In absoluten Grössen entspricht die Summe ungefähr derjenigen bei den Produzentenpreisen, weil der Anteil der Landwirtschaft am Endverkaufswert der Nahrungsmittel im Durchschnitt nur 24% (vgl. Entwicklung der Marktspanne Schweiz, Deutschland, USA) beträgt Dies bedeutet, dass die tieferen Produzentenpreise in etwa den Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wurden Bei den berücksichtigten europäischen Ländern beträgt die Verminderung 7%, dies sowohl beim hohen wie auch beim tiefen Preissegment Der Abstand der Schweiz zu den umliegenden Ländern ist entsprechend von 29% auf 31% angestiegen. Die Schwankungen innerhalb der beobachteten Länder sind jedoch sehr hoch Werden jeweils nur die Maxima berücksichtigt, so ist das Preisniveau vergleichbar hoch wie in der Schweiz Dies ist primär auf die Preise in Turin und Österreich zurückzuführen. Einzelne Produkte wie Weissbrot, Zucker oder Zwiebeln sind in der Schweiz sogar billiger als in den Vergleichsländern
Wie schon bei den Produzentenpreisen hat sich auch das Preisgefälle bei den Konsumentenpreisen zwischen den USA und der Schweiz verringert Die Preise sind beim hier verwendeten Warenkorb in den USA um 13% angestiegen Der Abstand zur Schweiz hat sich von 49% auf 37% verringert
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 234
CHEU-4/5USA ø EU-max ø EU-min I n d e x ( 1 9 9 0 / 9 2 = 1 0 0 ) 90/92 97/99 zu CH 90/92 Quellen:
0 100 60 80 40 20 10 70 90 50 30
BFS, BLW, ZMP (D), Statistikämter von Turin (I), F, B, A, USA
■ Methode zur Berechnung der globalen Marktspanne
Entwicklung der Marktspanne Schweiz, Deutschland, USA
Die meisten Agrarprodukte gehen nicht in ihrer ursprünglichen Form vom Produzenten (Landwirt) zum Konsumenten. Auf dem Weg von der agrarischen Produktion zum Angebot in den Detailhandelsgeschäften und Gaststätten erfahren die landwirtschaftlichen Erzeugnisse eine Werthinzufügung in Form von Transport- und Lagerleistungen sowie Be- und Verarbeitung Die Ausgaben der Verbraucher für Nahrungsmittel enthalten somit zwei Komponenten: das Entgelt für die Agrarerzeugnisse «ab Hof» und die Entlöhnung der Werthinzufügung Die folgende Berechnung versucht das Ausmass dieser beiden Komponenten zu bestimmen, einerseits für die Schweiz, anderseits für Deutschland und die USA Je nach betrachteter Komponente wird vom Erzeugeranteil oder von der Marktspanne gesprochen. Der Erzeugeranteil (Anteil Landwirtschaft) setzt den Erlös der Landwirtschaft aus dem Verkauf der Agrarerzeugnisse ins Verhältnis zu den Ausgaben der Konsumenten für die von ihnen nachgefragten Nahrungsmittel Im Gegensatz dazu zeigt die Marktspanne den Anteil der Werthinzufügung an den Verbrauchsausgaben
Die folgenden Ausführungen basieren auf einer Arbeit (Senti, König), die im Auftrag des BLW durchgeführt wurde
In einem ersten Schritt wird der Produktionswert jener landwirtschaftlichen Erzeugnisse ermittelt, die dem schweizerischen Nahrungsmittelverbrauch zufliessen. Vom totalen Produktionswert der schweizerischen Landwirtschaft werden die Einkommen und die Erlöse aus dem Verkauf von Agrargütern, die nicht dem Nahrungsmittelbereich zugerechnet werden können (z B Einkommen aus Pensionspferdehaltung oder Erlös aus dem Verkauf von Tabak) sowie die Nahrungsmittelexporte in Abzug gebracht
Darstellung der Berechnungsmethode
Endproduktion der Landwirtschaft
minus Produktionswert der nichtnahrungsmittelrelevanten Agrargüter
minus Exportwert der Nahrungsmittel
Landwirtschaftlicher Produktionswert
«Erzeugeranteil»
Werthinzufügung in Form von Transportund Lagerleistungen sowie Be- und Verarbeitung
«Marktspanne»
Verbrauchsausgaben für Nahrungsmittel
minus Verbrauchsausgaben für importierte Nahrungsmittel
Verbrauchsausgaben für im Inland produzierte Nahrungsmittel der Ansässigen und Touristen
Quelle: Senti
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 235
■ Anteil der Landwirtschaft am Konsumentenfranken
1988 und 1998
In einem zweiten Schritt erfolgt die Berechnung des Verbrauchswerts der Nahrungsmittel, die aus der inländischen Produktion stammen Dieser Wert setzt sich zusammen aus den Nahrungsmittelausgaben der privaten Haushalte und der Kollektivhaushalte (Spitäler, Altersheime usw.) sowie den Ausgaben für auswärtiges Essen. Den Verbrauchsausgaben der Gebietsansässigen sind die Aufwendungen der Touristen beizufügen, die sich in der Schweiz aufhalten Da sich die Berechnung nur auf die in der Schweiz erzeugten und konsumierten Nahrungsmittel bezieht, ist von den Verbrauchsausgaben der Wert der Nahrungsmittelimporte abzuzählen Aus der Gegenüberstellung von Produktions- und Verbrauchswert ergeben sich der Erzeugeranteil und die Marktspanne, ausgedrückt in % des Verbrauchswerts
■ Langfristige Entwicklung der Marktspanne
Der Produktionswert der Landwirtschaft machte im Jahr 1988 total 8,5 Mrd Fr aus und ging bis zum Jahr 1998 auf 6,5 Mrd. Fr. zurück. Die Verbrauchsausgaben für die inländischen Agrarprodukte beziehungsweise für die daraus erzeugten Nahrungsmittel stiegen in der gleichen Zeitperiode von 22,8 auf 27,2 Mrd Fr an Im Jahr 1988 betrug der Anteil des Produktionswerts an den Verbrauchsausgaben 37,6%. Dieser Anteil nahm in den folgenden Jahren kontinuierlich ab und belief sich 1998 noch auf 23,9% Vom Konsumentenfranken erhielten die Produzenten der landwirtschaftlichen Grundprodukte im Jahr 1998 rund 24 Rp
Mit Hilfe von früheren Berechnungen (Angehrn, Senti), die den Zeitraum von 1950 bis 1989 umfassen, lassen sich Aussagen über die längerfristigen Tendenzen der Marktspanne ableiten. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden müssen zum Zwecke der Harmonisierung gewisse Anpassungen bei den früheren Ergebnissen vorgenommen werden Abgesehen von kleineren Fluktuationen folgte der Erzeugeranteil langfristig einem negativen Trend, wobei eine lineare Beziehung die Entwicklung relativ gut abbildet Über die betrachtete Zeitspanne ging der Anteil der Landwirtschaft an den Verbrauchsausgaben pro Jahr im Durchschnitt um 0,76 Prozentpunkte zurück
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 236
ab Entwicklung der Marktspanne und des Erzeugeranteils 19881989 Marktspanne Erzeugeranteil 199019911992199319941995199619971998 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Quelle: Senti i n %
nahm zwischen
Tabelle 46, Seite A56
Langfristige Entwicklung der Marktspanne und des Erzeugeranteils
■ Erzeugeranteil ging in Deutschland und in den USA gleich zurück wie in der Schweiz
Sowohl in Deutschland (Wendt) als auch in den USA (United States Departement of Agriculture) werden seit längerer Zeit die Spannen im Nahrungsmittelbereich ermittelt Der Vergleich mit dem Ausland gibt erste Anhaltspunkte für eine Interpretation der Entwicklung der schweizerischen Nahrungsmittelspannen Aufgrund methodischer Unterschiede ist beim Vergleich allerdings Vorsicht angebracht. Insbesondere berücksichtigen die Berechnungen Deutschlands und der USA den Ausser-Haus-Verzehr nicht Da beim auswärtigen Essen die Marktspanne besonders hoch ist, wäre bei Berücksichtigung des Ausser-Haus-Verzehrs in den deutschen und US-amerikanischen Erhebungen der Erzeugeranteil tiefer
Entwicklung des Erzeugeranteils im internationalen Vergleich
Im Jahr 1988 lagen die Anteile des landwirtschaftlichen Produktionserlöses an den Verbrauchsausgaben der Schweiz und Deutschlands sehr nahe beieinander Die niedrigeren Erlöse der US-Landwirtschaft werden in der Regel mit den geographisch verursachten hohen Transportkosten, den hohen Convenience-Leistungen und den niedrigen Produktpreisen auf Landwirtschaftsebene erklärt. Im Verlauf des folgenden Jahrzehnts, das heisst von 1988 bis 1998 sind die Erzeugeranteile in allen drei Ländern relativ gleichmässig zurückgegangen

3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 237
Jahr Schweiz Deutschland USA %%% 1988 37,6 36,1 30,2 1993 30,7 27,9 25,9 1998 23,9 25,8 22,2
Quelle: Senti
1950 Marktspanne Erzeugeranteil 19601970198019902000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Quelle: Senti i n %
Bis 1994 ging der Anteil der Landwirtschaft in der Schweiz weniger stark zurück als in Deutschland jedoch etwas stärker als in den USA, wobei zu berücksichtigen ist, dass der US-Anteil bereits auf einem niedrigeren Niveau lag (Basiseffekt) In den folgenden Jahren sank der schweizerische Erzeugeranteil stärker als in Deutschland und in den USA
Trotz der unterschiedlichen Berechnungsmethoden ist festzustellen, dass in den drei berücksichtigten Industrieländern mit ungefähr gleichem Wohlstandsniveau und vergleichbaren Konsumgewohnheiten sowohl die Struktur als auch die Entwicklung der Verbrauchsausgaben für Nahrungsmittel und ihre Verteilung auf die Landwirtschaft und die ihr nachgelagerten Wirtschaftsbereiche ähnlich sind
Der Anteil der Landwirtschaft am Konsumentenfranken verringerte sich in der Schweiz in den Jahren 1988 bis 1998 von rund 38 auf 24 Rp Eine direkte Ursache für diese Entwicklung war die Neuausrichtung der schweizerischen Agrarpolitik mit dem Übergang von den produktbezogenen Stützungen zum System der Direktzahlungen. Die Produzentenpreise gingen zurück Der Ertragsausfall wurde der Landwirtschaft teilweise mit Direktzahlungen kompensiert Die Verbraucherpreise blieben hingegen weitgehend stabil
Die immer wieder geäusserte Vermutung, die Marktspanne steige wegen der vermehrten Ausgaben für das Essen in Restaurants, findet dagegen keine Bestätigung Der Anteil des auswärtigen Essens an den Verbrauchsausgaben blieb von 1988 bis 1998 praktisch konstant.
Ein Grund für die Abnahme des Erzeugeranteils mag in den ändernden Konsumgewohnheiten liegen. Die Nachfrage nach Fleisch und Fleischprodukten sowie nach Milch und Milcherzeugnissen, das heisst nach Produkten mit einem überdurchschnittlich hohen landwirtschaftlichen Wertanteil, geht mengenmässig seit Jahren zurück Andererseits steigt die Bedeutung von Produkten mit einem niedrigen Erzeugeranteil Diese Nachfrageverschiebung lässt den durchschnittlichen Anteil der Landwirtschaft sinken.
3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 238 Entwicklung des Erzeugeranteils im internationalen Vergleich 19881989199019911992199319941995199619971998 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Quelle: Senti Schweiz Deutschland USA I n d e x ( 1 9 8 8 = 1 )
■ Interpretation der Ergebnisse
Zu berücksichtigen gilt es, dass der Transport, die Lagerung, die Konservierung und die Weiterverarbeitung unabdingbare Teile der Nahrungsmittelproduktion sind Aufgrund der fortschreitenden Konzentration der Bevölkerung in Agglomerationen ist eine Grobund Feinverteilung der Nahrungsmittel ohne professionellen Transport und Handel nicht möglich Die veränderten Konsumgewohnheiten – der Wunsch nach einem ganzjährigen Angebot an Frischprodukten, die steigende Nachfrage nach verarbeiteten und tischfertigen Nahrungsmitteln sowie nach Convenience-Leistungen
führen zu einer zunehmenden Weiterverarbeitung Indem der Zwischenhandel die bestehenden Marktlücken ausfindig macht, wird insgesamt die Nachfrage nach Nahrungsmitteln beziehungsweise Agrarprodukten angehoben Bei der Interpretation der Spannen ist weiter zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der letzten Jahre in Einklang mit der langfristigen Entwicklung stehen und mit den Erfahrungen im Ausland übereinstimmen
Die Berechnungen zeigen lediglich Entwicklungen auf, nicht aber ihre Ursachen. Insbesondere lassen die Ergebnisse keine Aussage darüber zu, inwieweit die auf Erzeugerund Verarbeitungssektor entfallenden Anteile angemessen und wirtschaftlich gerechtfertigt sind Um darüber vertiefte Kenntnisse zu erhalten, sind weitere Analysen erforderlich
3 I N T E R N A T I O N A L E A S P E K T E 3 . 2 I N T E R N A T I O N A L E V E R G L E I C H E 3 239
–
240
A N H A N G A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Anhang Tabellen Märkte A2 Tabellen Wirtschaftliche Ergebnisse A12 Tabellen Ausgaben des Bundes A24 Tabellen Internationale Aspekte A51 Rechtserlasse im Bereich Landwirtschaft A58 Begriffe und Methoden A61 Abkürzungen A64 Literatur A66
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabellen Märkte
Landwirtschaftliche Nutzfläche nach Nutzungsarten
A2 A N H A N G
1
Tabelle
Produkt 1990/92 1997 1998 1999 1990/92 –1997/99 ha ha ha ha % Getreide 207 292 186 373 186 867 182 256 -10 7 Brotgetreide 102 840 101 751 100 962 97 542 -2 7 Weizen 96 173 95 432 95 917 92 861 -1 5 Dinkel 2 160 2 174 1 542 1 221 -23 8 Roggen 4 432 3 973 3 367 3 433 -19 0 Mischel von Brotgetreide 75 172 136 27 48 9 Futtergetreide 104 453 84 622 85 905 84 714 -18 5 Gerste 59 695 48 115 49 020 48 941 -18 4 Hafer 10 434 8 157 7 198 5 866 -32 2 Mischel von Futtergetreide 238 583 540 211 86 8 Körnermais 25 739 20 244 21 046 21 647 -18 5 Triticale 8 347 7 523 8 101 8 049 -5 5 Hülsenfrüchte 2 258 3 305 2 866 2 950 34 6 Futtererbsen (Eiweisserbsen) 2 112 2 955 2 468 2 680 27 9 Ackerbohnen 146 350 398 270 131 9 Hackfrüchte 36 385 35 584 34 183 34 429 -4 5 Kartoffeln (inkl Saatgut) 18 333 14 962 13 883 13 740 -22 6 Zuckerrüben 14 308 16 727 16 675 17 450 18 5 Futterrüben (Runkeln, Halbzuckerrüben) 3 744 3 895 3 625 3 239 -4 2 Ölsaaten 18 203 18 103 19 449 18 914 3 4 Raps 16 730 14 745 15 169 14 865 -10 8 Sonnenblumen - 1 017 1 396 1 776Soja 1 474 2 341 2 884 2 273 69 9 Nachwachsende Rohstoffe 0 1 535 1 631 1 591Raps - 1 513 1 531 1 533Andere (Kenaf, Hanf, usw ) - 22 100 58Freilandgemüse 8 250 8 474 8 076 8 189 0 0 Silo- und Grünmais 38 204 42 279 40 997 40 475 8 0 Grün- und Buntbrache 319 4 009 4 375 3 406 1 1133 3 übrige offene Ackerfläche 830 1 076 917 1 739 49 8 offenes Ackerland 311 741 300 738 299 361 293 949 -4 4 Kunstwiesen 94 436 113 865 113 116 115 933 21 0 übrige Ackerfläche 3 977 2 998 2 967 3 575 -20 0 Ackerland total 410 154 417 601 415 444 413 457 1 1 3 Obstbaumkulturen 7 162 7 219 7 210 7 172 1 0 5 Reben 14 987 14 934 14 991 15 042 1 0 0 Chinaschilf 3 280 274 260 8944 4 Naturwiesen, Weiden 638 900 627 457 632 428 626 799 -1 6 Andere Nutzung sowie Streue- und Torfland 7 394 8 237 8 059 9 169 14 8 Landwirtschaftliche Nutzfläche 1 078 600 1 075 728 1 078 405 1 071 899 -0 3 1 provisorisch Quellen: SBV, BFS
und -produkte: SBV (1990–98), ab 1999 TSM
Fleisch: Proviande
Eier: GalloSuisse
Getreide Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV alle Mengen 1999 provisorisch
Obst: Schweizerischer Obstverband
Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Wein: BLW, Kantone
A N H A N G A3 Tabelle 2 Produktion Produkt Einheit 1990/1992 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Milch und -produkte Konsummilch t 549 810 496 714 488 486 438 000 -13 7 Rahm t 68 133 67 500 66 400 70 400 0 0 Butter t 38 766 39 700 40 800 37 238 1 2 Milchpulver t 35 844 33 590 34 468 35 534 -3 7 Käse t 134 400 136 200 136 800 134 306 1 0 Fleisch und Eier Rindfleisch t SG 130 710 114 801 110 788 110 435 -14 3 Kalbfleisch t SG 36 656 37 409 36 715 36 419 0 5 Schweinefleisch t SG 266 360 214 257 231 574 225 657 -16 0 Schaffleisch t SG 5 065 6 215 6 078 6 316 22 5 Ziegenfleisch t SG 541 542 514 494 -4 4 Pferdefleisch t SG 1 212 1 511 1 353 1 196 11 7 Geflügel t Verkaufsgewicht 20 733 26 240 25 608 26 367 25 7 Schaleneier Mio St 638 663 691 680 6 2 Getreide Weichweizen t 546 733 572 520 594 098 500 400 6 7 Roggen t 22 978 23 971 22 306 18 900 0 7 Gerste t 341 774 304 488 329 732 259 600 -7 2 Hafer t 52 807 45 337 39 855 28 600 -19 3 Körnermais t 211 047 187 727 191 813 198 700 -10 1 Triticale t 43 940 44 805 51 048 44 800 9 1 Andere t 11 469 15 235 12 123 6 800 19 3 Hackfrüchte Kartoffeln t 833 333 685 000 560 000 484 000 -25 3 Zuckerrüben t 925 867 1 181 272 1 126 125 1 187 334 24 6 Ölsaaten Raps t 46 114 50 020 47 167 38 376 5 4 Andere t 3 658 9 134 11 604 12 552 183 4 Obst (Tafel) Äpfel t 93 490 91 533 100 936 90 161 0 8 Birnen t- 11 173 15 437 14 808Aprikosen t 6 667 1 830 4 000 2 900 -56 4 Kirschen t 1 841 453 2 142 942 -36 0 Zwetschgen t 2 575 2 203 2 803 2 397 -4 2 Erdbeeren t 4 263 5 279 5 162 5 065 21 3 Gemüse (frisch) Karotten t 49 162 51 939 55 145 57 746 11 8 Zwiebeln t 23 505 34 858 24 468 27 529 23 2 Knollensellerie t 8 506 13 724 8 752 8 686 22 1 Tomaten t 21 830 27 296 29 951 27 384 29 2 Kopfsalat t 18 821 20 040 20 110 15 877 -0 8 Blumenkohl t 8 331 7 941 7 509 6 666 -11 5 Gurken t 8 602 10 585 9 074 8 877 10 6 Wein Rotwein hl 550 276 488 234 547 620 591 410 -1 4 Weisswein hl 764 525 556 733 624 621 718 256 -17 2 Quellen: Milch
A4 A N H A N G Tabelle 3 Produktion Milchprodukte Produkt 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Total Käse 134 400 136 200 136 800 134 306 1 0 Frischkäse 4 387 10 527 11 343 13 093 165 7 Mozzarella - 7 986 8 495 9 634Übrige Frischkäse - 2 541 2 848 3 459Weichkäse 4 812 5 358 5 230 5 851 13 9 Tommes 1 249 1 664 1 694 1 054 17 7 Weissschimmelkäse, halb- bis vollfett 1 573 1 344 1 191 1 909 -5 8 Übrige Weichkäse 1 990 2 350 2 345 2 888 27 0 Halbhartkäse 40 556 41 532 41 492 44 293 4 6 Appenzeller 8 725 8 313 8 664 8 878 -1 2 Tilsiter 7 736 6 997 6 385 6 103 -16 0 Raclettekäse 9 898 10 599 11 033 11 123 10 3 Übrige Halbhartkäse 14 197 15 623 15 410 18 189 15 6 Hartkäse 84 629 78 774 78 727 70 824 -10 1 Emmentaler 56 588 48 629 47 988 41 637 -18 6 Gruyère 22 464 24 646 25 776 24 566 11 3 Sbrinz 4 659 4 286 3 713 3 090 -20 7 Übrige Hartkäse 918 1 213 1 250 1 531 45 0 Spezialprodukte 1 15 98 245 482 2 Total Frischmilchprodukte 680 822 632 950 625 702 612 900 -8 4 Konsummilch 549 810 496 714 488 486 438 000 -13 7 Übrige 131 012 136 236 137 216 174 900 14 1 Total Butter 38 766 39 700 40 800 37 238 1.2 Vorzugsbutter 27 200 32 200 34 400 33 222 22 3 Übrige 11 566 7 500 6 400 4 016 -48 4 Total Rahm 68 133 67 500 66 400 70 400 0 0 Total Milchpulver 35 844 33 590 34 468 35 534 -3 7 1 reiner Schafkäse und reiner Ziegenkäse Quellen: SBV, TSM Tabelle 4 Verwertung der vermarkteten Milch Produkt 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 1 000 t Milch 1 000 t Milch 1 000 t Milch 1 000 t Milch % Konsummilch 549 497 488 438 -13 6 Verarbeitete Milch 2 490 2 564 2 594 2 633 4 3 zu Käse 1 531 1 539 1 545 1 503 -0 1 zu Butter 356 375 402 337 4 3 zu Rahm 430 440 438 460 3 7 andere Milchprodukte 173 210 209 333 44 9 Total 3 039 3 061 3 082 3 071 1.1 Quellen: SBV TSM
1 Brotgetreideverwertung pro Kalenderjahr
2 entsprechende Zahlen sind erst im Jahr 2001 verfügbar
3 Veränderung 90/92 – 97/98
Quellen:
Brotgetreide: BLW
Kartoffeln: Eidgenössische Alkoholverwaltung, swisspatat
Mostobst: BLW; Spirituosen: Eidgenössische Alkoholverwaltung
Verarbeitungsgemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
A N H A N G A5 Tabelle 5 Verwertung der Ernte im Pflanzenbau Produkt 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Brotgetreide Übernahme Bund 569 000 605 000 576 000 549 300 1 4 Lagerveränderung -26 333 -5 900 -18 100 -11 800 -54 7 Menschliche Ernährung 399 000 400 600 394 700 389 700 -1 0 Verfütterung 196 333 210 300 199 400 171 400 -1 3 Kartoffeln Speisekartoffeln 285 300 187 000 173 400 170 700 -37 9 Veredlungskartoffeln 114 700 117 600 121 400 121 900 4 9 Saatgut 35 933 32 400 23 600 29 800 -20 4 Frischverfütterung 225 967 244 500 206 800 129 800 -14 3 Verarbeitung zu Futtermitteln 146 900 100 400 27 900 24 300 -65 4 Schweizer Mostäpfel und -birnen (Verarbeitung in gewerblichen Mostereien) 194 234 84 231 315 803 103 609 -13 6 Mostobst-Menge für Rohsaft 193 598 84 029 315 575 103 172 -13 4 Frisch ab Presse 10 548 7 230 8 429 7 620 -26 4 Obstwein zur Herstellung von Obstbrand 3 916 436 3 539 548 -61 5 Konzentratsaft 175 928 72 171 295 775 92 398 -12 8 Andere Säfte (inkl Essig) 3 207 4 192 7 832 2 606 52 1 Obst eingemaischt 636 202 228 437 -54 6 Spirituosenerzeugung aus Schweizer Äpfel und Birnen 40 650 26 924 39 8762 -17 8 3 aus Schweizer Kirschen und Zwetschgen 24 637 12 676 23 6782 -26 2 3 Schweizer Frischgemüse für Nährmittelherstellung: Tiefkühlgemüse 26 061 20 268 22 004 26 855 -11 6 Konservengemüse (Bohnen, Erbsen, Pariserkarotten) 19 776 17 058 12 190 15 258 -25 0 Sauerkraut (Einschneidekabis) 8 091 6 090 6 101 5 894 -25 5 Sauerrüben (Rübe) 1 535 1 243 1 221 1 182 -20 8
A6 A N H A N G Tabelle 6 Aussenhandel Produkt 1990/1992 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Milch und -produkte Milch 19 23 007 53 22 805 46 22 988 30 22 795 122 8 -0 6 Joghurt 1 195 17 873 50 925 78 1 156 110 -17 6 366 7 Rahm 909 25 1 587 9 1 523 8 1 559 6 71 2 -69 7 Butter 0 4 154 0 5 338 0 4 136 17 4 987 - 16 0 Milchpulver 8 158 3 266 4 972 5 186 2 884 4 289 17 768 2 584 4 7 23 1 Käse 62 483 27 328 60 703 30 856 56 474 30 548 63 359 31 208 -3 7 13 0 Fleisch und Eier Rindfleisch 1 994 9 668 6 615 7 805 3 527 8 973 3 644 10 024 130 5 -7 5 Kalbfleisch 0 916 1 389 0 586 0 1 345 - -15 5 Schweinefleisch 1 055 4 185 653 18 334 806 14 543 754 14 999 -30 1 281 3 Schaffleisch 5 6 093 0 6 588 0 6 157 0 5 611 - 0 4 Ziegenfleisch 0 403 0 482 0 503 0 413 - 15 5 Pferdefleisch 0 4 609 0 4 104 0 4 041 0 3 883 - -13 0 Geflügel 8 35 238 384 38 990 302 39 962 448 37 562 4830 4 10 2 Eier 0 31 401 0 22 709 0 22 589 0 23 281 - -27 2 Getreide Weizen 6 232 134 80 224 343 49 184 617 86 249 619 1025 7 -5 4 Roggen 0 3 057 0 2 235 75 2 261 0 10 233 - 60 6 Gerste 436 44 504 1 15 221 141 22 893 1 11 491 -89 1 -62 8 Hafer 131 60 885 3 51 048 1 555 38 624 0 23 411 296 6 -38 1 Körnermais 194 60 512 83 60 033 70 47 523 78 29 428 -60 4 -24 5 Hackfrüchte Kartoffeln 9 695 33 420 2 043 11 341 1 647 16 336 1 702 42 361 -81 5 -30 1 Zucker 41 300 124 065 76 619 119 867 91 068 109 063 119 084 137 404 131 5 -1 6 Ölsaaten Ölsaaten 453 135 456 842 138 112 834 151 083 830 135 408 84 2 4 5 Pflanzliche Öle und Fette 18 680 57 765 14 778 73 283 13 227 83 636 15 426 84 021 -22 5 39 0 Obst Äpfel 770 15 548 1 426 8 786 185 9 385 3 125 6 295 104 9 -47 5 Birnen 404 12 556 217 9 673 178 10 671 579 8 529 -19 6 -23 3 Aprikosen 283 10 431 47 12 413 56 8 866 3 12 199 -87 5 7 0 Kirschen 340 1 819 26 1 902 269 1 340 7 3 138 -70 4 16 9 Zwetschgen und Pflaumen 15 3 047 7 4 162 53 3 241 0 4 678 33 3 32 1 Erdbeeren 150 12 299 11 13 025 12 13 373 11 13 417 -92 5 7 9 Trauben 23 33 691 2 34 824 3 35 034 0 36 969 -92 9 5 7 Zitrusfrüchte 161 135 780 19 130 224 21 129 626 49 122 668 -81 6 -6 1 Bananen 85 77 896 0 74 245 1 72 684 0 74 554 -99 6 -5 2 Gemüse (frisch) Karotten 71 1 710 2 8396 0 7140 185 5867 -12 2 317 1 Zwiebeln 862 3 444 1193 3055 1 8257 3 5644 -53 7 64 1 Knollensellerie 0 206 0 75 0 56 0 831 - 55 4 Tomaten 402 35 700 0 42586 1 39772 56 42138 -0 7 16 2 Kopfsalat 37 3 954 0 3106 0 2575 1 3244 -99 1 -24 8 Blumenkohl 11 9 985 1 9 239 14 9 331 0 9 503 -55 9 -6 3 Gurken 65 17 479 22 16 820 19 17 050 0 17 996 -78 9 -1 1 Wein Rotwein (in hl) 3 499 1 505 794 8 701 1 496 195 7 994 1 491 200 8 815 1 486 098 143 0 -1 0 Weisswein (in hl) 7 590 163 835 6 183 244 944 5 260 264 905 4 680 252 588 -29 2 55 1 Quellen: Milch und -produkte, Eier, Getreide, Hackfrüchte, Ölsaaten, Obst, Gemüse und Wein: OZD Fleisch: Proviande Zucker: Treuhandstelle Schweizerischer Lebensmittelimporteure
A N H A N G A7 Tabelle 7 Aussenhandel Käse Produkt 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 tttt% Einfuhr Frischkäse 1 4 175 8 136 8 280 8 485 98 8 Reibkäse 2 233 232 271 333 19 8 Schmelzkäse 3 2 221 2 541 2 499 2 550 13 9 Schimmelkäse 4 2 276 2 392 2 306 2 414 4 1 Weichkäse 5 6 628 5 238 5 502 5 618 -17 7 Halbhartkäse 6 6 225 5 722 5 234 Hartkäse 7 11 795 6 092 5 970 6 574 1 2 Total Käse und Quark 27 328 30 856 30 548 31 208 13 0 Ausfuhr Frischkäse 1 211 10 96 7 Reibkäse 2 104 103 103 156 15 6 Schmelzkäse 3 8 245 6 731 6 532 6 733 -19 2 Schimmelkäse 4 0229Weichkäse 5 30 43 52 50 59 7 Halbhartkäse 6 7 330 7 072 6 944 Hartkäse 7 54 102 46 493 42 712 49 457 -1 4 Total Käse und Quark 62 483 60 703 56 474 63 359 -3 7 1 0406 1010 0406 1020 406 1090 2 0406 2010, 0406 2090 3 0406 3010 0406 3090 4 0406 4010, 0406 4021, 0406 4029, 0406 4081, 0406 4089 5 0406 9011 0406 9019 6 0406 9021, 0406 9031, 0406 9051, 0406 9091 7 0406 9039 0406 9059 0406 9060 0406 9099 Quelle: OZD
A8 A N H A N G
8 Pro-Kopf-Konsum Produkt 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 kg kg kg kg % Milch und -produkte Konsummilch 104 37 92 90 91 00 86 60 -13 6 Rahm 6 43 6 50 6 40 6 70 1 6 Butter 6 20 6 30 6 20 5 90 -1 1 Käse 14 73 15 60 15 50 15 70 5 9 Frischkäse 1 50 2 60 2 70 2 90 82 2 Weichkäse 1 83 1 80 1 80 1 80 -1 8 Halbhartkäse 6 17 5 90 5 80 5 70 -5 9 Hartkäse 5 20 5 30 5 20 5 30 1 3 Fleisch und Eier Rindfleisch 13 71 10 99 11 25 11 53 -17 9 Kalbfleisch 4 25 4 12 4 04 4 08 -3 9 Schweinefleisch 29 73 25 29 26 28 25 63 -13 4 Schaffleisch 1 42 1 57 1 49 1 43 5 4 Ziegenfleisch 0 12 0 13 0 13 0 11 0 0 Pferdefleisch 0 75 0 68 0 66 0 62 -13 3 Geflügel 8 05 9 03 9 03 8 71 10 8 Schaleneier (in St ) 199 184 190 195 -4 7 Getreide Brot- und Backwaren 50 7 50 4 52 1 - 1 1 Hackfrüchte Kartoffeln und Kartoffelprodukte 44 2 46 2 43 1 - 1 1 Zucker (inkl Zucker in exportierten Verarbeitungsprodukten) 42 4 40 8 40 1 - -4 5 Ölsaaten Pflanzliche Öle und Fette 12 8 13 6 14 3 - 9 0 Obst (Tafel) Äpfel 16 04 13 93 15 51 13 15 -11 5 Birnen - 2 91 3 65 3 21Aprikosen 2 49 2 00 1 80 2 13 -20 7 Kirschen 0 49 0 33 0 45 0 57 -8 2 Zwetschgen und Pflaumen 0 83 0 90 0 84 1 00 9 8 Erdbeeren 2 43 2 58 2 61 2 60 6 8 Zitrusfrüchte 20 09 18 34 18 25 17 27 -10 6 Bananen 11 53 10 46 10 24 10 50 -9 8 Gemüse (frisch) Karotten 7 53 8 50 8 77 8 93 16 1 Zwiebeln 3 86 5 17 4 61 4 67 24 7 Knollensellerie 1 29 1 94 1 24 1 34 16 8 Tomaten 8 46 9 84 9 82 9 78 16 0 Kopfsalat 3 37 3 26 3 20 2 69 -9 5 Blumenkohl 2 71 2 42 2 37 2 28 -13 1 Salatgurken 3 85 3 86 3 68 3 78 -2 1 Wein Rotwein (in l) 31 97 28 60 28 50 28 70 -10 5 Weisswein (in l) 14 47 12 70 12 50 12 80 -12 4 Wein total (in l) 46 43 41 30 41 00 41 50 -11 1 Quellen: Milch und -produkte, Eier, Hackfrüchte und Ölsaaten: SBV, 1999 provisorisch Fleisch: Proviande Getreide: BWL Obst, Gemüse und Wein: BLW
Tabelle
Geflügel, Eier: SBV (LG-Preise von Schlachtvieh mit Ausbeutefaktor in SG-Preise umgerechnet)
A N H A N G A9 Tabelle 9 Produzentenpreise Produkt Einheit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Milch CH gesamt Rp / kg 104 97 84 00 82 10 80 93 -21 6 Verkäste Milch (erst ab 1999) Rp / kg 79 96Biomilch (erst ab 1999) Rp / kg 91 55Schlachtvieh Kühe T3 Fr / kg SG 7 82 4 67 4 75 4 90 -39 0 Kühe X3 Fr / kg SG 7 53 3 45 3 66 3 77 -51 8 Jungkühe T3 Fr / kg SG 8 13 5 94 5 18 6 40 -28 2 Muni T3 Fr / kg SG 9 28 7 70 7 38 7 77 -17 9 Ochsen T3 Fr / kg SG 9 83 7 60 7 38 7 90 -22 4 Rinder T3 Fr / kg SG 8 66 6 87 6 85 7 37 -18 8 Kälber T3 Fr / kg SG 14 39 10 84 11 36 11 03 -23 0 Fleischschweine Fr / kg SG 5 83 5 59 4 80 4 38 -15 6 Lämmer bis 40 kg, T3 Fr / kg SG 15 40 13 74 13 47 11 46 -16 3 Geflügel und Eier Poulets Kl I, ab Hof Fr / kg LG 3 72 3 01 2 97 2 84 -21 0 Eier aus Bodenhaltung an Läden Fr /100 St 41 02 42 64 43 61 42 86 4 9 Eier aus Freilandhaltung an Läden Fr /100 St 46 21 48 38 50 42 49 01 6 6 Eier, verkauft an Sammelstelle>53 g Fr /100 St 33 29 26 47 24 33 22 21 -26 9 Getreide Weizen Fr /100 kg 99 34 75 58 75 65 75 41 -23 9 Roggen Fr /100 kg 102 36 56 99 62 69 62 77 -40 6 Gerste Fr /100 kg 70 24 51 94 50 13 48 83 -28 4 Hafer Fr /100 kg 71 40 51 61 47 68 48 83 -30 8 Triticale Fr /100 kg 70 69 52 45 49 45 49 44 -28 6 Körnermais Fr /100 kg 73 54 54 65 53 21 51 91 -27 6 Hackfrüchte Kartoffeln Fr /100 kg 38 55 32 89 35 27 37 76 -8 4 Zuckerrüben Fr /100 kg 14 84 13 87 13 99 11 85 -10 8 Ölsaaten Raps Fr /100 kg 203 67 161 84 147 89 146 11 -25 4 Soja Fr /100 kg 204 67 162 36 162 14 164 58 -20 3 Obst Äpfel: Golden Delicious I Fr / kg 1 13 0 85 0 60 1 06 -26 0 Äpfel: Idared I Fr / kg 0 97 0 88 0 45 0 82 -26 4 Birnen: Conférence Fr / kg 1 38 1 52 0 78 1 09 -18 3 Aprikosen Fr / kg 1 96 2 66 2 28 2 66 29 5 Kirschen Fr / kg 3 20 3 80 3 30 3 05 5 7 Zwetschgen: Fellenberg Fr / kg 1 27 1 55 1 40 1 40 14 5 Erdbeeren Fr / kg 4 77 4 80 4 40 4 80 -2 1 Gemüse Karotten (Lager) Fr / kg 1 09 1 20 1 18 1 05 4 9 Zwiebeln (Lager) Fr / kg 0 89 0 72 1 03 0 96 1 5 Knollensellerie (Lager) Fr / kg 1 62 1 34 1 41 1 84 -5 7 Tomaten rund Fr / kg 2 42 2 12 1 89 1 92 -18 3 Kopfsalat Fr / kg 2 37 2 41 2 20 2 89 5 5 Blumenkohl Fr / kg 1 85 1 80 1 78 1 88 -1 4 Salatgurken Fr / kg 1 66 1 71 1 66 1 73 2 6 Quellen: Milch: BLW Schlachtvieh,
Getreide,
Obst: Schweizerischer Obstverband Gemüse: Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau
Hackfrüchte und Ölsaaten: FAT
A10 A N H A N G Tabelle 10 Konsumentenpreise Produkt Einheit 1990/92 1997 1998 1999 1990/92–1997/99 % Milch und -produkte Vollmilch, pasteurisiert,verpackt Fr / l 1 85 1 66 1 66 1 58 -11 7 Milchdrink, pasteurisiert, verpackt Fr / l 1 85 1 66 1 66 1 58 -11 7 Magermilch UHT Fr / l - 1 55 1 55 1 48Emmentaler Fr / kg 20 15 20 79 20 65 20 66 2 7 Greyerzer Fr / kg 20 40 19 80 20 93 20 67 0 3 Tilsiter Fr / kg - 17 63 17 76 17 49Camembert 45% (FiT) 125 g - 2 57 2 58 2 54Weichkäse Schimmelreifung 150 g - 3 32 2 34 3 34Mozzarella 45% (FiT) 150 g - 2 34 2 35 2 32Vorzugsbutter 200 g 3 46 3 01 3 01 2 89 -14 2 Die Butter (Kochbutter) 250 g 3 44 3 04 3 00 2 92 -13 2 Vollrahm, verpackt, 1/2 l - 5 50 5 44 5 19Kaffeerahm, verpackt, 1/2 l - 2 73 2 75 2 62Jogurt, aromatisiert oder mit Früchten 180 g 0 89 0 73 0 73 0 71 -18 7 Rindfleisch Entrecôte, geschnitten Fr / kg 48 36 43 89 44 36 45 68 -7 7 Plätzli, Eckstück Fr / kg 37 59 33 18 33 69 34 76 -9 9 Braten, Schulter Fr / kg 26 34 23 42 23 52 24 09 -10 1 Hackfleisch Fr / kg 15 00 13 22 13 61 13 42 -10 6 Kalbfleisch Ia Koteletten, geschnitten Fr / kg 35 32 35 71 37 07 35 84 2 5 Braten, Schulter Fr / kg 32 56 29 13 31 01 30 80 -6 9 Voressen Fr / kg 21 67 23 00 25 46 24 67 12 5 Schweinefleisch Ia Koteletten, geschnitten Fr / kg 19 88 20 25 17 91 18 26 -5 4 Plätzli, Eckstück Fr / kg 24 48 25 44 24 44 22 38 -1 6 Braten, Schulter Fr / kg 18 43 18 80 17 60 16 75 -3 9 Voressen, Schulter Fr / kg 16 69 17 94 17 29 15 75 1 8 Lammfleisch Inland frisch Gigot ohne Schlossbein Fr / kg 26 34 25 62 26 68 27 10 0 5 Koteletten, geschnitten Fr / kg 30 32 30 78 31 69 31 57 3 4 Fleischwaren Hinterschinken, Model geschnitten Fr / kg 25 56 27 32 27 23 26 18 5 3 Salami Inland I, geschnitten Fr /100 g 3 09 3 24 3 35 3 42 7 9 Poulets Inland, frisch Fr / kg 8 41 8 12 8 42 8 43 -1 1 Pflanzenbau und pflanzliche Produkte Weissmehl Fr / kg 2 05 1 81 1 80 1 80 -12 0 Ruchbrot Fr /500 g 2 08 1 99 2 00 1 98 -4 3 Halbweissbrot Fr /500 g 2 09 2 04 2 05 2 02 -2 6 Weggli Fr / St 0 62 0 75 0 75 0 75 21 0 Gipfeli Fr / St 0 71 0 86 0 87 0 89 23 0 Spaghetti Fr /500 g 1 66 1 35 1 39 1 43 -16 3 Kartoffeln Fr / kg 1 43 1 65 1 66 1 77 18 4 Kristallzucker Fr / kg 1 65 1 52 1 52 1 50 -8 3 Sonnenblumenöl Fr / l 5 05 4 30 4 44 4 46 -12 9 Obst (Herkunft In- und Ausland) Äpfel: Golden Delicious Fr / kg 3 19 3 17 3 10 2 98 -3 3 Birnen Fr / kg 3 26 3 30 3 37 3 24 1 3 Aprikosen Fr / kg 3 81 4 59 5 10 4 74 26 2 Kirschen Fr / kg 7 39 8 66 8 72 8 72 17 7 Zwetschgen Fr / kg 3 44 3 87 3 51 3 13 1 8 Erdbeeren Fr / kg 8 69 9 23 9 69 9 34 8 4 Gemüse (Frischkonsum; Herkunft In- und Ausland) Karotten (Lager) Fr / kg 1 91 1 92 1 87 1 78 -2 8 Zwiebeln (Lager) Fr / kg 1 86 1 85 2 14 2 05 8 2 Knollensellerie (Lager) Fr / kg 3 14 2 96 3 32 3 67 5 6 Tomaten rund Fr / kg 3 73 3 24 3 24 3 18 -13 7 Kopfsalat Fr / kg 4 46 4 89 4 39 5 15 7 8 Blumenkohl Fr / kg 3 58 3 53 3 45 3 59 -1 6 Salatgurken Fr / kg 2 80 2 70 2 88 2 86 0 5 Quellen: Milch, Fleisch: BLW Pflanzenbau und pflanzliche Produkte: BLW, BFS
1 inkl Müllereiprodukte und Auswuchs von Brotgetreide, jedoch ohne Ölkuchen; ohne Berücksichtigung der Vorräteveränderungen
2 einschliesslich Hartweizen, Speisehafer, Speisegerste, Mais und Reis
3 Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche
4 Anteil der Inlandproduktion am Gewicht des verkaufsfertigen Fleisches und der Fleischwaren
5 einschliesslich Fleisch von Pferden, Ziegen, Kaninchen sowie Wildbret, Fische, Krusten- und Weichtiere
6 verdauliche Energie in Joules, alkoholische Getränke eingeschlossen
7 ohne aus importierten Futtermitteln hergestellte tierische Produkte
8 Inlandproduktion zu Produzentenpreisen, Einfuhr zu Preisen der Handelsstatistik (franko Grenze unverzollt) berechnet
A N H A N G A11 Tabelle 11 Selbstversorgungsgrad Produkt 1990/92 1996 1997 1998 1990/92–1996/98 % Mengenmässiger Anteil: %%%% Brotgetreide 118 138 108 120 4 0 Futtergetreide 1 61 74 72 73 12 0 Getreide total 2 64 71 67 69 5 0 Speisekartoffeln 101 99 94 100 -3 3 Zucker 46 64 62 60 16 0 Pflanzliche Fette, Oele 22 19 23 21 -1 0 Obst 3 72 79 71 86 6 7 Gemüse 55 60 56 54 1 7 Konsummilch 97 97 97 97 0 0 Butter 89 89 89 92 1 0 Käse 137 128 129 126 -9 3 Milch und Milchprodukte total 110 109 110 110 -0 3 Kalbfleisch 4 97 99 99 98 1 7 Rindfleisch 4 93 105 98 92 5 3 Schweinefleisch 4 99 89 90 93 -8 3 Schaffleisch 4 39 39 42 43 2 3 Geflügel 4 37 37 41 39 2 0 Fleisch aller Arten 45 76 72 71 71 -4 7 Eier und Eikonserven 44 48 49 49 4 7 Anteil Nahrungsenergie 6 : Pflanzliche Nahrungsmittel 43 47 44 47 3 0 Tierische Nahrungsmittel brutto 97 95 95 95 -2 0 Nahrungsmittel im ganzen brutto 60 64 62 64 3 3 Nahrungsmittel im ganzen netto 7 58 60 54 56 -1 3 Wertmässiger Anteil Nahrungsmittel im ganzen 8 72 69 66 65 -5 3
Quelle: SBV
■■■■■■■■■■■■■■■■