DIE GARTENSTADT
AM TIVOLI
BEN HERMES FLORIAN FENZBezirk - Meidling
Wien
Die Gartenstadt „Am Tivoli" 1927-1930

Inhaltsverzeichnis
VORWORT 1 SCHUTZZONE
§ 7 Wiener Bauordnung (Schutzzonen) 5
Denkmalschutzgesetz § 2a 7
GESCHICHTE
Gebietsentwicklung 11
Die Türkenkapelle mit dem Moldauer Kreuz 15
Wilhelm Peterle 19
OBJEKTANALYSE
Die Siedlungsanlage „Am Tivoli" 23
Typ A
Typ C
Typ D
Typ D1
Typ D2
Typ E
Typ F
Typ G
Geschäftslokal
Kindergarten der Stadt Wien
Wäscherei
Doppelhaus
ZEITLICHE ENTWICKLUNG
Straßeneinsicht - Hohenbergstraße / Schwenkgasse 101 Straßeneinsicht - Tyroltgasse / Krastelgasse 103 Haustyp C - Tyroltgasse / Krastelgasse 105 Haustyp D - Meixnerweg 107 Ansicht Moldauerkapelle 109 Haustyp G - Arnsburggasse 111 Haustyp G - Arnsburggasse / Moldauerkapelle 113 Haustyp E - Brockmanngasse / Hohenbergstraße 115 Kindergarten - Krastelgasse / Stranitzkygasse 117
INVENTARISIERUNG
Allgemein 121 Hohenbergestraße 3-23 123 Weißenthurngasse 1-21 125 Baualtersplan 127
BAULICHE VERÄNDERUNGEN
Allgemein 131 Zubau Geschäftslokal 133 Zubau Wäscherei 137 Fenstertypen 141
SCHLUSSWORT 143
QUELLENVERZEICHNIS 145
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Im Zuge der Lehrveranstaltung „Stadtbild und Schutzzonen" sollten die Bauten und Ensembles eines bestimmten Gebietes in Wien analysiert werden. Dieses Buch führt den Leser durch die Gartenstadt „Am Tivoli" im 12. Wiener Gemeindebezirk. Es werden historische Entwicklungen und Qualitäten der Wohnsiedlung aufgezeigt, damit bauliche Bedürfnisse sowie denkmalpflegerische Ziele entsprechend beachtet werden können, um den Erhalt der Schutzzone zu gewährleisten.
Für die umfangreiche Bereitstellung von historischem Bild- sowie Planmaterial gilt ein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Hans Werner Bousska vom Bezirksmuseum Meidling.
Wiener Bauordnung (Schutzzonen)
Nach § 7 der Wiener Bauordnung (1)IndenFlächenwidmungs-undBebauungsplänenkönnendiewegenihresörtlichen Stadtbildes in ihrem äußeren Erscheinungsbild erhaltungswürdigen Gebiete als in sichgeschlossenesGanzes(Schutzzonen)ausgewiesenwerden.
(1a) Bei der Festsetzung von Schutzzonen sind die prägende Bau- und Raumstruktur und die Bausubstanz sowie auch andere besondere gestaltende und prägende Elemente, wie die natürlichen Gegebenheiten oder Gärten und Garten anlagen,zuberücksichtigen.
(2) Die Schutzzonen sind von den übrigen Gebieten eindeutig abzugrenzen. Die GrenzenderSchutzzonenkönnenmitFluchtlinienzusammenfallen.
(3) Für Schutzzonen können im Bebauungsplan über die Festsetzung gemäß § 5 Abs. 4 hinaus die erforderlichen Bestimmungen über die Anordnung einzelner Baukörper (Brunnen, Säulen, Bildstöcke, Schuppen und dergleichen), die Anordnung und Ausgestaltung von Höfen und die Ausgestaltung und Ausstattung der öffentlichen Bereiche (Verkehrsflächen, Beleuchtungskörper und dergleichen) festgesetztwerden.
(4) Umfassen Kataloge oder planliche und bildliche Darstellungen (Fassadenpläne, Fotos u. dgl.) zur Präzisierung der gemäß § 5 Abs. 4 und § 7 Abs. 3 festgesetzten Bestimmungen einzelner Bauwerke und Bauwerksteile, wie Brunnen, Säulen, Bildstöcke, Dachaufbauten, Ein- und Abfriedungen, Fenster- und Türverzierungen,Hauszeichen,Inschriftenu.dgl.einerSchutzzone,bildendieseeinen BestandteildesBebauungsplanes.
(5) Durch die Verhängung einer zeitlich begrenzten Bausperre über ein Stadtgebiet, das in einer Schutzzone liegt, werden die aus der Schutzzone erfließenden Verpflichtungennichtberührt.[ 2 ]
Mit der im Jahr 1972 beschlossenen Altstadterhaltungsnovelle kann die Stadt Wien unabhängigvomDenkmalschutzSchutzzonenfestlegenunddamitcharakteristische EnsemblesvorAbbruchoderÜberformungschützen.
Schutzzonen werden im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan dargestellt. Es handelt sich um jene Bereiche, in welchen die Erhaltung des charakteristischen Stadtbildeszugewährleistenist.DiesbetrifftseinenatürlichenGegebenheiten,seine historischenStrukturen,seineprägendeBausubstanzunddieVielfaltderFunktionen. [ 1 ]
Denkmalschutzgesetz § 2a
Vorläufige Unterschutzstellung durch Verordnung
§ 2a. (1) Das Bundesdenkmalamt wird ermächtigt, unbewegliche Denkmale, die gemäß § 2 oder § 6 Abs. 1 kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen,durchVerordnungunterdieBestimmungendiesesParagrafenzustellen.Für die solcherart festgestellten Denkmale gilt weder die Beendigung der Unterschutz stellung gemäß § 2 Abs. 4 noch eine Beschränkung der Veräußerung gemäß § 6 Abs.1.DieVerordnunghatingenauerundunverwechselbarerWeisedieDenkmale zubezeichnenundhatwenigstensdietopografischenundgrundbücherlichenDaten derDenkmalezuenthalten.
(2) Eine Unterschutzstellung auf Grund dieses Paragrafen hat zur Voraussetzung, dassessichumeinDenkmalhandelt,demBedeutungineinerWeisezugesprochen werdenkann,dassfürdenFallderverfahrensmäßigenPrüfunggemäßAbs.5oder
6 die Feststellung des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der Erhaltung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Bestimmungen des § 1 über die Bedeutung, Miteinbeziehung, Teilunterschutzstellung und dergleichen gelten in vollemUmfang.
(5)NacherfolgterUnterschutzstellungdurchVerordnungistsämtlichenEigentümern nachweislich von der - anstelle der bisher bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) bestehenden - nunmehr konkret erfolgten Feststellung des öffentlichen Interesses Kenntnis zu geben. Den Benachrichtigten ist gleichzeitig als Rechtsbelehrung mit zuteilen, dass sie, ebenso wie alle anderen Antragsberechtigten, im Sinne des § 2 Abs. 1 bzw. § 26 Z 2 und 3 nach wie vor befugt sind, einen Antrag dahingehend zustellen,esmögebescheidmäßigfestgestelltwerden,obeinöffentlichesInteresse anderErhaltunginderVerordnungzuUnrechtangenommenwurdeodernicht.Für dieEinbringungdiesesAntragesgibteskeinezeitlicheBegrenzung.ÜberAnträge gemäßdiesemAbsatzistbinnenzweiJahrenzuentscheiden.
(6)DasBundesdenkmalamtkannimSinnedes§2Abs.2jederzeitauchvonAmts wegen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmalstatsächlichgegebenist.
(3) Das Bundesdenkmalamt hat vor Erlassung der Verordnung deren beabsichtigten Inhalt unter Anschluss kurzer gutächtlicher Angaben über die Bedeutung der einzelnen Denkmale im Äußeren wie im Inneren zumindest den jeweiligen Eigentümern, den Landeshauptmännern und den Bürgermeistern, in derenGebietdieDenkmalegelegensind,zurKenntniszubringenundGelegenheit zugeben,sichzudenbeabsichtigtenFeststellungeninnerhalbeinerMindestzeitvon sechsMonatenzuäußern(Begutachtungsverfahren).
(4)VerordnungengemäßAbs.1sindzumindestimVerordnungsblattfürdieDienst bereiche der Bundesministerien für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten/ WissenschaftundVerkehrsowieimAmtsblattzurWienerZeitungzuverlautbaren.
(7) Die Tatsache der Unterschutzstellung durch Verordnung ist im Grundbuch im Sinne der Bestimmung des § 3 Abs. 3 ersichtlich zu machen. Die Mitteilung des Bundesdenkmalamtes an das Grundbuchsgericht hat spätestens ein Jahr nach InkrafttretenderVerordnungzuerfolgen.DasErgebnisvonVerfahrengemäßAbs.5 und6istdemGrundbuchsgerichtspätestenssechsMonatenachRechtskraftdieser BescheidezumZweckderErsichtlichmachungmitzuteilen.[
GESCHICHTE
Gebietsentwicklung
Die Türkenkapelle mit dem Moldauer Kreuz Wilhelm Peterle
Gebietsentwicklung
Das Gatterhölzl erstreckte sich vom Schlosspark Schönbrunn bis zum Meidlinger Bahnhof und war von den Resten eines einst riesigen Waldes bedeckt. Der Name des Bereiches stammt von der bereits 1311 erwähnten „Kattermühle". Diese Anlage wurde zur Katterburg ausgebaut und in der Zweiten Türkenbelagerung 1683 stark beschädigt. Ab 1695 diente sie als Basis für einen repräsentativen Neubau - das Schloss Schönbrunn.
In den Grenzen des Schlossparks wurde dieser Wald kultiviert und bis heute erhalten. Östlich davon dezimierte sich das Gatterhölzl nach und nach, bis nur mehr ein kleiner Waldbestand links und rechts der Hohenbergstraße, die Querverbindung des Areals zur Gloriette, stehen blieb. Dort entstand eine Remise - ein Schutzgehölz für Hoch- und Niederwild - welches als eine natürliche Barriere für die Tiere vom Schlosspark diente und einen Lebensraum für das Wild der Umgebung schaffte.[ 4 ]

Die frei gewordenen Flächen am Abhang zum Wienfluss zwischen Schönbrunner Schlosspark und Meidlinger Hauptstraße wurden bis etwa 1890 für landwirtschaftliche Zwecke genutzt. Ab dann fand eine Parzellierung statt, bis langsam die Verbauung des Gebiets einsetzte.[ 5

Im Jahr 1830 wurde die Vergnügungsstätte „Tivoli" als erste Bebauung in dieser Gegend errichtet. Ab dem Bau der Südbahn wurde der Wald in das westliche Gatterhölzl und das östliche „Augustinerwaldl" zweigeteilt. Seitdem ging der Wald bestand des Gatterhölzls langsam, aber beständig zurück.[ 6

Um 1902/03 ging der Baumbestand von Osten her zurück, da dort die Meidlinger Trainkaserne errichtet wurde. Der Rest des Waldes wurde 1915 durch die Anlegung des Kriegsspitals Nr. IV als Barackensiedlung entfernt. Die dortige „Russenkirche" blieb als einziges Objekt des Kriegsspitales stehen und wurde 1935 zur Pfarre Gatterhölzl erhoben. Zwischen 1955 und 1959 wurde am selben Standort eine neue Kirche nach Plänen von Ladislaus Hruska erbaut. 7 ]
In den Jahren 1927 bis 1930 wurde im Sinne der aus England stammenden „Gartenstadt"-Bewegung die villenartige Siedlung „Am Tivoli" errichtet. In diesem Plan entsprechen die Baukörper jedoch nicht den heutigen Gegebenheiten, da dieser vor der Fertigstellung entstand.[ 8


Die Türkenkapelle mit dem Moldauer Kreuz
Am heutigen Standort der Türkenkapelle (bzw. Moldauerkapelle) in der Gartenstadt „Am Tivoli" befand sich im Jahre 1683, während der 2. Türkenbelagerung Wiens, eine dichte Bewaldung, das Gatterhölzl. Auch nach dessen Rodung und der Errichtung der Wohnsiedlung befindet sich die Moldauerkapelle immer noch an ihrem Standort als Erinnerung an die kriegerischen Zeiten.[ 9 ]

Während der 2. Türkenbelagerung lagerte der christliche Fürst und Wojode Scherban II. Cantacucino mit seinem 10.000 Mann starken Heer im Gebiet des Gatterhölzl, das gezwungenermaßen mit den Türken zur Eroberung Wiens in den Krieg zog. Seine Truppen umfassten Männer aus Siebenbürgen, der Walachei und der Moldau.
Unklar bleibt, ob der Grund für die Errichtung eines Kreuzes die Wiedergutmachung Cantacucinos für die Teilnahme an der türkischen Belagerung gewesen war. Das Kreuz, welches die Kopie eines bzyantinischen Heiligtums darstellen soll, wurde im Wald des Gatterhölzls erbaut. Bevor die türkischen Truppen abzogen, versteckte man das Kreuz im Wald. Nach der erfolglosen Belagerung Wiens ließ Cantacu cino dem Bischof Kollonitsch die Bitte zukommen, das Kreuz auszugraben und wieder- zuerrichten, welches jedoch davor schon von einer holzsuchenden Magd gefunden und nach Wien gebracht wurde. Erst im folgenden Jahr wurde das Kreuz wieder an seinem ursprünglichen Standort errichtet und zum Schutz eine Kapelle darüber erbaut. Seitdem wird das Kreuz von der Bevölkerung als Moldauer Kreuz bezeichnet.
In den nächsten 100 Jahren, im noch bewaldeten Gatterhölzl in Vergessen heit geraten, wurde das Kreuz 1785 fremdartig entwendet und blieb daraufhin spurlos verschwunden. 1923 wurde die Kapelle, zirka 200 m südlich von seinem ursprünglichen Standort, an ihrem heutigen Platz errichtet und renoviert. 10 ]

Wilhelm
Kein Bild vorhanden
DATEN
Name: Wilhelm Peterle
Nationalität: Österreich (damals Österreich-Ungarn)
Geboren: 27.06.1893
Geburtsort: Ried im Innkreis, Oberösterreich
Gestorben: 29.12.1959
Sterbeort: Wien
Beruf: Architekt
LEBEN
Der im Jahre 1893 geborene Wilhelm Pertele begann sein Architekturstudium an der Technischen Universiät in Graz, welches er nach einem Wechsel im Jahre 1913 auf die Technische Universität Wien weiterführte. Nebenbei sammelte er Praxiserfahrungen im Atelier von Lepold Simony. Wegen seiner Kriegsdienstleistung im Ersten Weltkrieg musste er seine Ausbildung kurzfrisitg abbrechen und schloss sein Studium erst 1921 ab. Kurz nach seinem Abschluss begann er seine beruflichen Tätigkeiten im Wiener Stadtbauamt, wo er hauptsächlich für die Planung und den Bau von Wiener Gemeindewohnhausanlagen verantwortlich war. Später wurde er zum Baurat ernannt. Wilhelm Peterle verstab am 29. Dezember 1959 in Wien.
REALISIERTE WERKE
1922-1927 Siedlungen Müllnermais und Neues Leben, Wien 22, Am Müllnermais 1-12 (mit Wilhelm Baumgarten)
1923-1924 Ehem. Bezirksjugendamt, Wien 21, Gerichtsgasse 10 (mit Friedrich Jäckel)
1924-1925 WHA d. Gem.Wien, Wien 19, Leidesdorfgasse 1, 2A, 3A, 4 / Sonnbergplatz 9-10 / Obkirchergasse 16-18
1925 3.Tor beim Zentralfriedhof, Wien 11, Simmeringer Hauptstraße
1925 Dienstwohnhäuser, Wien 11, Simmeringer Hauptstraße 240
1925-1926 WHA d. Gem.Wien „Janecek-Hof", Wien 20, Engerthstraße 99109 / Wehlistraße 88-98 / Donaueschingenstraße 30 / Traisengasse 23-25
1927-1928 WHA d. Gem.Wien „Faber-Hof", Wien 8, Pfeilgasse 42-42A
1927 WHA d. Gem.Wien, Wien 14, Hüttelbergstraße 7 / Greilweg / Bujattigasse 10
1927-1930 WHA d. Gem.Wien „Am Tivoli", Wien 12, Hohenbergstraße 3-23/ Weißenthurngasse 1-9, 2-8 / Ludwig-Martinelligasse 1-5, 2-10 / Schwenkgasse 48-52 / Krastelgasse 2-14 / Arnsburggasse 1-4 / Brockmanngasse 1-3 / Stranitzkygasse/ Gotteslebengasse 1-4 / Hasenhutgasse 2 / Tyroltgasse 1-9 / Wildauergasse 1-9, 2-8 / Pechegasse 3-7 / Hohenbergstraße 3-12 / Krügerweg 1-7, 2-6 / Lukasweg 1-9, 2-8 / Meixnerweg 2-8 / Schroederweg 1-7 / JosefineWessely-Weg 1-2 / Betty-Rose-Weg 1-2
SIEDLUNG AM TIVOLI
Wilhelm Peterle war ein großer Anhänger der Gartenstadtbewegung. Die Wohn siedlung „Am Tivoli" konzipierte er, nicht wie in der Zeit üblich als Reihenhaussiedlung, sondern als mehrere villenartige Haustypen mit dazugehörigen Gärten. Durchaus war dieser Bautypus durch die Nähe zum Schloss Schönbrunn geprägt.[ 11
1930 WHA d. Gem.Wien, Wien 9, D´Orsay-Gasse 6
1932 WHA d. Gem.Wien, Wien 4, Schelleingasse 18-20
1933-1934 WHA d. Gem.Wien, Wien 18, Erndtgasse 34-36 / Messerschmidtgasse 33-37
1935-1937 WHA d. Gem.Wien, Wien 3, Eslarngasse 1 / Landstraßer Hauptstraße 128
OBJEKTANALYSE
Die Siedlungsanlage „Am Tivoli" Typ A Typ C Typ D Typ D1 Typ D2 Typ E Typ F Typ G
Geschäftslokal
Kindergarten der Stadt Wien Wäscherei Doppelhaus
Siedlungsanlage „Am Tivoli"
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges errang die Sozialdemokratische Partei in Wien die Mehrheit. Um den überfüllten Wohnungen und Notunterkünften mit spärlichen sanitären Einrichtungen entgegenzuwirken, startete die neue Volksvertretung, neben Reformen im Gesundheits- und Bildungswesen, ein umfangreiches kommunales Bauprogramm, mit dem Ziel helle, trockene und mit Wasserlei tung sowie WC ausgestattete Wohnungen, zu schaffen. Gemeinschaftseinrichtungen wie Bäder, Kindergärten, Waschküchen, Ambulatorien, Turnhallen, Bibliotheken etc. waren ein wesentlicher Bestandteil dieser Anlagen. Die Finanzierung erfolgte durch eine, im Jänner 1923 eingeführte, zweckgebundene Wohnbausteuer.
In den Jahren 1927 bis 1930 wurde nach den Plänen von Wilhelm Peterle, im Sinne der aus England stammenden „Gartenstadt"-Bewegung, die villenartige Kolonie „Am Tivoli" errichtet. Sehr umstritten war, dass diese Siedlung im Gegensatz zu anderen Wohnungstypen, neben hohen Bau- und Erschließungskosten, deutlich weniger Wohnraum schaffte.
Die weitläufige Anlage entstand in zwei Bauetappen (1927/28 und 1929/30), südlich der Hohenbergstraße. Die Siedlung besteht aus 65 Mehrfamilienhäusern und umfasst ein parkähnliches Gelände, das von mehreren Wegen und Gassen begrenzt wird und im Gegensatz zu früheren Anlagen keinen einzigen Mittelpunkt der Anlage erkennen lässt. Die einzelnen Gebäude sind „Vierlingshaus-Typen" (ein Haus mit vier Wohnungen) bzw. gekoppelte „Vierlingshäuser" und frei, in lockerer Verbauung, auf dem Areal verteilt. Neben den 8 Wohnungstypen (Typ A, C, D, D1, D2, E, F, G) enthält die Anlage Geschäftslokale, eine öffentliche Waschküche und einen Kindergarten.[ 12 ]

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Gebäude der Siedlung von privaten bzw. öffentlichen Grünflächen umgeben. Diesen Gärten wurde eine ca. 1,50 Meter hohe Begrenzung aus Beton, mit Elementen aus Eisengitter, vorgesetzt.
Als Typ A bezeichnet, ist dies eines von mehreren Wohnhäusern, die man als „Vier lingshaus-Typ" in der Siedlung „Am Tivoli" errichtete. Die Bezeichnung richtet sich nach der Wohnungsanzahl des Bauvolumens. Vertikal geteilt, erstrecken sich die einzelnen Wohnungen vom Erdgeschoss bis zum Obergeschoss.[ 13


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Zeltdach
FASSADENGLIEDERUNG
- Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Hervorheben des Einganges
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Putzfelder
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Backsteinexpressionismus im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
Reliefierung durch Putzfeld
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig)
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
Reliefierung durch Putzfeld bzw. Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (einteilig)
gesimsartiges Vordach mit Backsteindekor
Eingangstür mit rechteckigem Sprossenfenster
Eingangstür mit geometrischem Dekor
Einfassung durch Backstein (Backsteinexpressionismus)
Als weiterer „Vierlingshaus-Typ" wird der als zweithäufigste auftretende Typ C genannt. Vier Wohnungen, horizontal auf zwei Geschoße verteilt, sind durch innen liegende Stiegenhäuser und Eingänge vom Erdgeschoß aus erreichbar. Von allen anderen Typen unterscheidet sich dieser durch sein Grabendach, welches untypisch für Wohnhäuser dieser Zeit war.[ 14


DACH
- Flachdach bzw. Grabendach
- abgetreppt
FASSADENGLIEDERUNG
- teilweise Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch Erker
- Hervorheben des Einganges
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Putzfelder
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Backsteinexpressionismus im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
Reliefierung durch Putzfeld
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig)
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (dreiteilig)
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
flankierender Erker Gesims
gesimsartiges Vordach mit Backsteindekor
Eingangstür mit rechteckigem Sprossenfenster
Eingangstür mit geometrischem Dekor
Einfassung durch Backstein (Backsteinexpressionismus)
Als am häufigsten vorkommender Bautyp steht dieses Gebäude als Aushängeschild für den Charakter der Siedlung. Dieser wurde um zwei weitere Typen (Typ D1, Typ D2) erweitert. Der Grundriss ist horizontal in zwei Wohnungen pro Geschoß geteilt, welche durch zwei turmartige Stiegenhäuser erreichbar sind.[ 15 ]


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Zeltdach
- Spitzgauben
- Stiegenhaus durchbricht Dachhaut
- Stiegenhaus als Flachdach ausgeführt
FASSADENGLIEDERUNG
- teilweise Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch starken Vorsprung des Stiegenhauses
- Hervorheben des Stiegenhauses und Einganges
- stromlinig abgerundetes Stiegenhaus (vager Symbolismus)
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Putzfelder bzw. Backstein
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Einfassung aus Backstein im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
- bei einigen Fenstern bis zum Sohlbankgesims hinauf gemauert
Traufgesims mit Backsteindekor
Reliefierung durch Putzfeld
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig)
Einnfassung durch Putzfeld
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
gesimsartige Fensterverdachung mit Backsteindekor rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig)
Einnfassung durch Backstein
Sohlbankgesims mit Backsteindekor Naturstein
Traufgesims mit Backsteindekor
rechteckige Fenster (dreiteilig)
Reliefierung durch Putzfeld
abgerundetes Stiegenhaus (vager Symbolismus)
rechteckige Fenster (dreiteilig)
gesimsartiges Vordach mit Backsteindekor
Sturz aus Backstein
Reliefierung durch Putzfeld
Eingangstür mit rechteckigem Sprossenfenster
Eingangstür mit geometrischem Dekor
Einfassung durch Backstein
Die vom Ur-Typus D ausgehende bauliche Grundstruktur, Erschließungsform sowie Geschoß- & Wohnungsanzahl, wurde verlängert bzw. vergrößert und beidseitig um zwei Balkone erweitert.[ 16 ]


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Walmdach
- Schleppgauben
- Stiegenhaus als Flachdach ausgeführt
- Stiegenhaus durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- teilweise Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch starken Vorsprung des Stiegenhauses
- Gliederung durch Loggia
- Hervorheben des Stiegenhauses und Einganges
- stromlinig abgerundetes Stiegenhaus (vager Symbolismus)
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Putzfelder bzw. Backstein
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Einfassung aus Backstein im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
- bei einigen Fenstern bis zum Sohlbankgesims hinauf gemauert
Dieses Gebäude ist eine Kopplung von zwei Häusern des Ur-Typus D. Mit insgesamt acht Wohnungen (jeweils vier pro Geschoß) ist dieser somit größer, als die zwei gleichnamigen Typen D & D1. 17 ]


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Walmdach
- Schleppgauben
- Stiegenhaus als Flachdach ausgeführt
- Stiegenhaus durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- teilweise Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch starken Vorsprung des Stiegenhauses
- Hervorheben des Stiegenhauses und Einganges
- stromlinig abgerundetes Stiegenhaus (vager Symbolismus)
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Putzfelder bzw. Backstein
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Einfassung aus Backstein im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein - bei einigen Fenstern bis zum Sohlbankgesims hinauf gemauert
Einer der größeren Bauten der Wohnsiedlung ist der Typ E. Das rechteckige Gebäude besteht aus zwei gekoppelten Wohnäusern mit je sechs Wohneinheiten. Ein Hauptmerkmal des Gebäudes sind die, auf der Front- sowie der Hinterfassade angeordneten, Balkone. Durch zwei Stiegenhäuser, die sich turmartig in die Frontfassade eingliedern, gelangt man in den Baukörper.


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Walmdach
- Schleppgauben
- Stiegenhaus als Flachdach ausgeführt
- Stiegenhaus durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch starken Vorsprung des Stiegenhauses
- Gliederung durch Loggien und Balkone
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Einfassung aus Backstein im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
- bei einigen Fenstern bis zum Sohlbankgesims hinauf gemauert
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (dreiteilig) rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (dreiteilig)
Natursteinsockel
Gesims
Stütze mit Backsteindekor
Balkongeländer mit geometrischen Dekor Loggiengeländer mit geometrischem Dekor
Stütze mit Backsteindekor
Natursteinsockel
Wie am Lageplan zu erkennen, sticht der Typ F durch seine Grundrissform heraus. Als einziges Gebäude der Wohnsiedlung weist es keine symmetrisch gekoppelte Form auf. Im Baukörper befinden sich sechs Wohneinheiten pro Geschoß, die auch wie beim Typ E, durch zwei turmartige Stiegenhäuser erschlossen werden. An der Frontfassade befinden sich auf beiden Geschoßen Loggien, sowie ein dreieckiger Erker, der sich vom restlichen Stil der Siedlung hervorhebt.


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Walmdach
- Schleppgauben
- Gebäudevorsprung durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch Erker
- Gliederung durch Loggien und Balkone
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Backstein
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Einfassung aus Backstein im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
- bei einigen Fenstern und Loggien bis zum Sohlbankgesims hinauf gemauert
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig)
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig)
Einnfassung durch Backstein
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
Natursteinsockel
Traufgesims mit Backsteindekor
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig) dreieckiger Erker Gesims
Traufgesims mit Backsteindekor
Balkongeländer mit geometrischem Dekor
Gesims
Gesims
Loggia
Stütze mit Backsteindekor
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
Natursteinsockel
Als letzter Typ der Wohnanalage reiht sich der Typ G in die Gebäudeart der „Vierlingshäuser" ein. Horizontal geteilte Wohneinheiten, die durch ein zentrales, an der Frontfassade gelegendes, Stiegenhaus erschlossen werden. Als Hauptmerkmal der Hinterfassade befinden sich noch zwei kleine Balkone im Obergeschoß.


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Walmdach
- Schleppgauben
- Stiegenhaus als Flachdach ausgeführt
- Stiegenhaus durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch leichten Rücksprung des Stiegenhauses
- Gliederung durch Loggia
- Hervorheben des Stiegenhauses und Einganges
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Backsteinexpressionismus im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL
- Naturstein
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (zweiteilig) rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (dreiteilig)
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (dreiteilig)
abgestufte Betonkonsolen
Eingangstür mit rechteckigem Sprossenfenster
Eingangstür mit geometrischem Dekor
Einfassung durch Backstein (Backsteinexpressionismus)
gesimsartiges Vordach mit Backsteindekor Wandpfeiler aus Backstein mit Natursteinsockel
Geschäftslokal
Das „Hauptgebäude" der Wohnanlage besitzt mit Gerwerbe- und Wohnflächen mehrere Nutzungen. Während den Anfangsjahren befanden sich im Erdgeschoß einige Versorgungsläden wie z.B. eine Molkerei oder ein Selbstbedienungsladen. Später verschwanden diese Läden und es etablierte sich bis heute nur eine kleines Cafe und Leerstand. Zusätzlich sind sechs Wohneinheiten pro Geschoß untergebracht.
Im Jahr 1957 enstand an der Ostseite des Hauptgebäudes ein Zubau für einen Selbstbedienungsladen. In den darauffolgenden Jahren fanden zwei Umbauten statt - 1991 in eine Poststelle und 2008 schlussendlich in die Apotheke „Zum lachenden Pinguin".


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Walmdach
- Spitzgauben
- Stiegenhaus als Flachdach ausgeführt
- Stiegenhaus durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch starken Vorsprung des Stiegenhauses
- Gliederung durch Loggien und Balkone
- Hervorheben des Stiegenhauses und Einganges
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Einfassung aus Backstein der Stützen im Eingangsbereich
- Einfassung aus Steinplatten bzw. Backstein im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
Balkongeländer mit geometrischen Dekor
Gesims
Eingangstür mit rechteckigem Fenster
Eingangstür mit geometrischem Dekor
Einfassung durch Backstein bzw. Naturstein
Balkongeländer mit geometrischem Dekor
Gesims
Stütze mit Backsteindekor
Kindergarten der Stadt Wien
Für die Kinder der Umgebung wurde im Zentrum der Wohnanlage ein großzügiger Kindergarten errichtet. Das Grundstück ist ganzflächig umzäunt und verfügt über eine große Freifläche für die spielenden Kinder. Am Anfang verfügte der Kindergarten im Obergeschoß über zwei Loggien, die später aus thermisch durch Fenster geschlossen wurden, um mehr Innenraum zu schaffen.


DACH
- Dachraum; keine Nutzfläche
- Walmdach bzw. Falchdach
- Spitzgauben
- Gebäudevorsprung durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch Vor- und Rücksprünge
- Gliederung durch Loggien und Balkone
- Hervorheben des Einganges
- Betonung der Ecken durch Fenster mit durchlaufendem Gesims
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Backstein
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Backsteinexpressionismus im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis
- teilweise aus Backstein
SOCKEL
- Naturstein
- bei einigen Fenstern bis zum Sohlbankgesims hinauf gemauert
Balkongeländer mit geometrischem Dekor
Gesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster mit Oberlichte (zweiteilig)
Einnfassung durch Backstein
Natursteinsockel
Traufgesims mit Backsteindekor
Loggiengeländer mit geometrischem Dekor
Gesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster mit Oberlichte (zweiteilig)
Einnfassung durch Backstein
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
Wäscherei
Neben den Einrichtungen des Kindergartens und Lebensmittelladens verfügte die Wohnsiedlung über eine große Waschküche. In der damaligen Zeit war es üblich, in öffentlichen, sanitären Einrichtungen die Schmutzwäsche zu säubern. Auch nach über 80 Jahren ist die Wäscherei heute immer noch in Betrieb, aussgestattet mit moderner Gerätschaft.
Um die Nahversorgung zu gewährleisten, wurde 1981 das Gebäude der alten Waschküche südseitlich um einen Zubau eines Lebensmittelladens erweitert. Dabei wurde auf den Stil der Wohnanlage Rücksicht genommen.


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Walmdach bzw. Falchdach
- Stiegenhaus durchbricht Dachhaut
FASSADENGLIEDERUNG
- Betonung der Horizontalität
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch Vor- und Rücksprünge
- Hervorheben des Einganges
- Trauf- und Sohlbankgesims
- unterschiedliche Materialtät bzw. Farbgebung der Nullfläche und hervortretenden Bauflächen
- Einfassung aus Backstein im Eingangsbereich
GESIMS & FRIES
- Trauf- und Sohlbankgesmis - teilweise aus Backstein
SOCKEL - Naturstein
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte rechteckige Sprossenfenster ohne Oberlichte (drei- und zweiteilig)
Sohlbankgesims mit Backsteindekor
Traufgesims mit Backsteindekor
gesimsartiges Vordach mit Backsteindekor
Reliefierung durch Putzfeld
Eingangstür mit rechteckigen Fenstern
Eingangstür mit geometrischem Dekor
Einfassung durch Backstein
Doppelhaus
Das Doppelhaus ist das einzige Gebäude der Schutzzone, welches nicht zur Siedlungsanalge gehört. Ein paar Jahre nach der Fertigstellung der Siedlung enstand dieses gekoppelte Zweifamilienhaus. Obwohl 1937 errichtet, weist die Bausubstanz keine Merkmale der Zwischenkriegszeit auf, womit man es auf den ersten Blick als ein Objekt der Nachkriegszeit zuordnen würde.
Bis auf eine zusätzliche Einteilung der Fenstersprossen und eines neuen Dachflächenfensters fanden keine weiteren baulichen Veränderungen am äußerlichen Erscheinungsbild statt.


DACH
- Dachraum; keine Wohnfläche
- Satteldach
- Dachflächenfenster
FASSADENGLIEDERUNG
- schlichter, schmuckloser, glatter Verputz
- Gliederung durch Vorsprung
- Im Bereich der Fenster Reliefierung durch Putzfeld
- rechteckige twei- und dreiteilige Fenster mit Läden
- unterschiedliche Farbgebung der Fassade
SOCKEL
- unterschiedliche Farbgebung von Sockel und Fassade
- Einfahrtstore für Garage
- Fenster zum Keller
ZEITLICHE ENTWICKLUNG
Straßeneinsicht - Hohenbergstraße / Schwenkgasse
Straßeneinsicht - Tyroltgasse / Krastelgasse
Haustyp C - Tyroltgasse / Krastelgasse
Haustyp D - Meixnerweg
Ansicht Moldauer Kapelle
Haustyp G - Arnsburggasse
Haustyp G - Arnsburggasse / Moldauer Kapelle
Kindergarten - Krastelgasse / Stranitzkygasse
Haustyp E - Brockmanngasse / Hohenbergstraße
Anhand fehlender Plandokumente war eine Fassadenabwicklung der einzelnen Bauten nicht möglich. Um jedoch Veränderungen der Sieldung zu veranschaulichen, wurden historische, fotografische Aufnahmen mit Aktuellen verglichen.
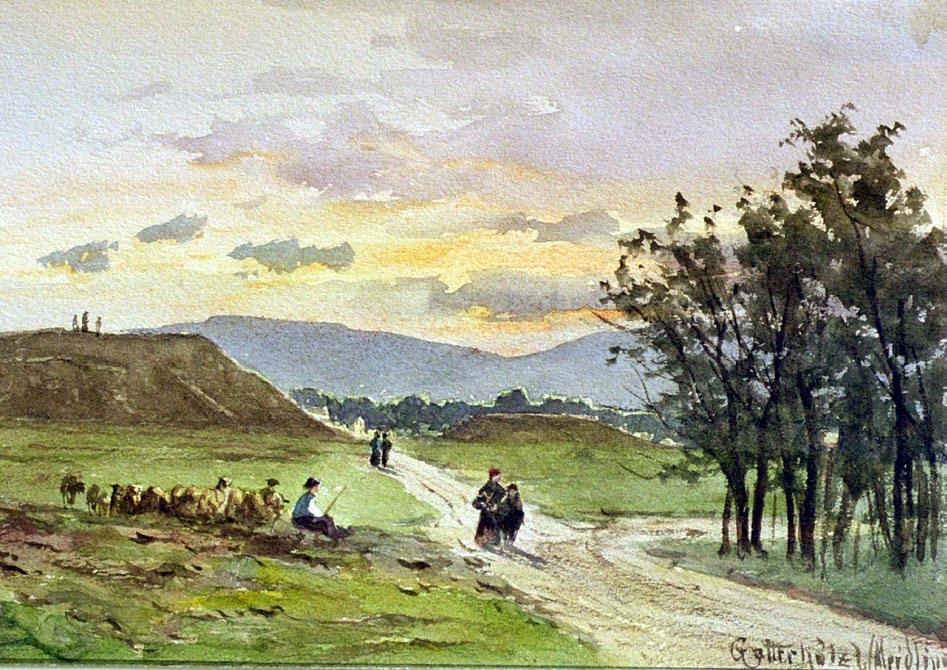
- Hohenbergstraße
- 1915
















Kindergarten


INVENTARISIERUNG
Allgemein Hohenbergstraße 3-23
Weißenthurngasse 1-21
Allgemein
Um bestimmte Objekte besser vergleichen bzw. bewerten zu können, ist eine Inventarisierung erforderlich. Für die Siedlung „Am Tivoli" wurde folgend eine Bestandsaufnahme der Hohenbergstraße 3-23; sowie der Weißenthurngasse 1-21 durchgeführt.
Hohenbergstraße 3-23
Weißenthurngasse 1-21
Hohenbergstraße 3-23
E i n l a g e n z a h S t r a ß e n b e z e i c h n u n g N u m m e r I d e n t a d r e s s e O b j e k t b e z e i c h n u n g B a u p e r i o d e B a u d a t e n A r c h i t e k t N u t z u n g G e b ä u d e t y p " A m T i v o l i " G r u n
1980 Hohenbergstraße 3 Schwenkgasse 48 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ F gekoppeltes
1980 Hohenbergstraße 5 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ E gekoppeltes
1980 Hohenbergstraße 7 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ E gekoppeltes
1980 Hohenbergstraße 9 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ E gekoppeltes
1980 Hohenbergstraße 11 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Leerstand Geschäftslokale
2430 Hohenbergstraße 11 Apotheke zum lachenden Pinguin 1946-1978 1957 Baugesellschaft Paitl & Meissner
Öffentliche Apotheke
1980 Hohenbergstraße 13 Ludwig-Martinelli-Gasse 1 Espresso am Tivoli 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Gastronomie Leerstand
Geschäftslokale
1980 Hohenbergstraße 15 Ludwig-Martinelli-Gasse 2 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 17 Schroederweg 2 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 19 Schroederweg 4 Schroederweg 6 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 21 Tyroltgasse 1 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 23 Josefine-Wessely-Weg 1 Tyroltgasse 2 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Weißenthurngasse 1 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ C "Vierlingshaus"
i v o l i " G r u n d r i s s t y p A n z a h d e r G e s c h o s s e F e n s t e r F a s s a d e n v e r ä n d e r u n g Z u b a u A r c h i t e k t J a h r U m b a u A r c h i t e k t J a h r
gekoppeltes "Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Satellitenschüssel
gekoppeltes "Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Neues Regenfallrohr Loggia teilweise verglast
gekoppeltes "Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Markise im OG
gekoppeltes "Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Loggia Sichtschutz Markise im OG Gitterverbau am Balkon
2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Neuer Anstrich im EG Bau eines Konsum Selbstbedienungsladens Baugesellschaft Paitl & Meissner 1957
1 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Geländer im EG
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Fenstergitter im EG
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Neues Regenfallrohr Rollladenkasten im OG Neue Metalldeckung bei Vordach
Post- und Telegrafendirektion Apotheke "Zum lachenden Pinguin" Pittel + Brausewetter HAE Elektrotechnik GmbH 1991 2008
1980 Hohenbergstraße 15 Ludwig-Martinelli-Gasse 2 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
Weißenthurngasse 1-21
1980 Hohenbergstraße 17 Schroederweg 2 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 19 Schroederweg 4 Schroederweg 6 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
E i n l a g e n z a h l S t r a ß e n b e z e i c h n u n g N u m m e r I d e n t a d r e s s e O b j e k t b e z e i c h n u n g B a u p e r i o d e B a u d a t e n A r c h i t e k t N u t z u n g G e b ä u d e t y p " A m T i v o l i " G r u n
1980 Hohenbergstraße 21 Tyroltgasse 1 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
Hohenbergstraße 3 Schwenkgasse 48 F
1980 Weißenthurngasse 1 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ C "Vierlingshaus"
1980 Weißenthurngasse 3 Wildauergasse 8 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ C "Vierlingshaus"
Hohenbergstraße 1919-1945 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ E gekoppeltes Hohenbergstraße 7 E
1980 Weißenthurngasse 5 Wildauergasse 9 Lucasweg 9 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Weißenthurngasse 7 Lucasweg 7 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ E gekoppeltes
Hohenbergstraße 11 Wilhelm Peterle Leerstand Geschäftslokale
1980 Weißenthurngasse 9 Lucasweg 5 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
2430 Hohenbergstraße 11 Apotheke zum lachenden Pinguin 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Öffentliche Apotheke
1980 Weißenthurngasse 11 Lucasweg 3 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 13 Ludwig-Martinelli-Gasse 1 Espresso am Tivoli 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Gastronomie Leerstand
Geschäftslokale
1980 Weißenthurngasse 13 Lucasweg 1 Pechegasse 6 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 Weißenthurngasse 15 Pechegasse 7 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ C "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 15 Ludwig-Martinelli-Gasse 2 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
Hohenbergstraße Schroederweg 2 Wilhelm Peterle D
1980 Weißenthurngasse 17 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ C "Vierlingshaus"
1980 Hohenbergstraße 19 Schroederweg 4 Schroederweg 6 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
2310 Weißenthurngasse 19 1919-1945 1937 Allgemeine Baugesellschaft A. Porr Wohnnutzung Doppelhaus
1980 Hohenbergstraße 21 Tyroltgasse 1 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ D "Vierlingshaus"
1980 1 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Typ C
2000 Weißenthurngasse 21 1919-1945 1937 Allgemeine Baugesellschaft A. Porr Wohnnutzung Doppelhaus
1980 Weißenthurngasse 3 Wildauergasse 8 1919-1945 1927-1930 Wilhelm Peterle Wohnnutzung Typ C "Vierlingshaus"
Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Fenstergitter im EG
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
i v o l i " G r u n d r i s s t y p A n z a h d e r G e s c h o s s e F e n s t e r F a s s a d e n v e r ä n d e r u n g Z u b a u A r c h i t e k t J a h r U m b a u A r c h i t e k t J a h r
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Neues Regenfallrohr Rollladenkasten im OG Neue Metalldeckung bei Vordach
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Rollladenkasten im EG Neue Metalldeckung bei Vordach Neuer Edelstahlrauchfang
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Neue Metalldeckung bei Traufe
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Satellitenschüssel
gekoppeltes "Vierlingshaus" Original (Holz) Satellitenschüssel gekoppeltes "Vierlingshaus" 2 Neu (Kunststoff) Neues Regenfallrohr Loggia teilweise verglast gekoppeltes "Vierlingshaus" Markise im OG gekoppeltes "Vierlingshaus" 2 Neu (Kunststoff) Loggia Sichtschutz Markise im OG Gitterverbau am Balkon Neu (Kunststoff) Neuer Anstrich im EG
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
1 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
Bau eines Konsum Selbstbedienungsladens Baugesellschaft Paitl & Meissner 1957 Post- und Telegrafendirektion Apotheke "Zum lachenden Pinguin" Pittel + Brausewetter HAE Elektrotechnik GmbH 1991 2008
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Rollladenkasten im EG
Neu (Kunststoff) Geländer im EG
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" Original (Holz) Fenstergitter im EG Neu (Kunststoff)
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Neue Haustüre Rollladenkasten im EG Neue Metalldeckung bei Erker und Vordach Satellitenschüssel Neuer Edelstahlrauchfang
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
Doppelhaus 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Sockelzone erhöht Alarmanlage
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff)
Doppelhaus 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Sockelzone erhöht Neues Dachfenster
"Vierlingshaus" 2 Original (Holz) Neu (Kunststoff) Neues Regenfallrohr Rollladenkasten im OG Neue Metalldeckung bei Vordach
"Vierlingshaus" 2
Original (Holz) Neu (Kunststoff) Rollladenkasten im EG Neue Metalldeckung bei Vordach Neuer Edelstahlrauchfang
Baualtersplan
Um die Kernbauten und Erweiterungsphasen der Siedlung „Am Tivoli" und ihrer unmittelbaren Umgebung deutlicher voneinander unterscheiden zu können, wurde dieser Baualtersplan erstellt. Dort ist klar ersichtlich, dass die Siedlung überwiegend aus der unbedingt schützenswerten Bausubstanz des Originalzustands besteht.
Als Grundlage für diesen Baualtersplan dienten diverse Bauakten, sowie die digitalen Karten der Stadt Wien. Die Epocheneinteilung orientiert sich am Abrihanschen Baualtersplan.[ 18
Späthistorismus, Jugendstil und Neoklassizismus 1891-1918
Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg 1918-1945
Bauten nach 1946-1978
Bauten ab 1978
BAULICHE VERÄNDERUNGEN
Allgemein
Zubau Geschäftslokal
Zubau Wäscherei Fenstertypen
Allgemein
In der Siedlung „Am Tivoli" blieb das ursprüngliche Erscheinungsbild weitgehend erhalten. Neben kleineren Eingriffen, wie z.B. Geräteschuppen, Rollläden oder Markisen, wurden in der Schutzzone mehrfach Fenster getauscht. Es gab nur zwei große bauliche Veränderungen. An das „Geschäftslokal" und die Wäscherei fanden Zubauten statt.
Von 1994 bis 1996 wurden in der gesamten Siedlung Sanierungsarbeiten an den Dächern und Fassaden durchgeführt.
Über Jahre hinweg wuchs die Bepflanzung, wurde ersetzt oder ergänzt und veränderte so das äußere Erscheinungsbild der Siedlung - ganz im Sinne der Gartenstadt.









Zubau Geschäftslokal
Am Geschäftslokal in der Hohenbergstraße 11 fanden mehrere bauliche Veränderungen statt. Im Jahre 1957 erweiterte sich das Gebäude Richtung Osten um einen eingeschossigen Zubau. Durch die Verwendung selber bzw. ähnlicher Materialen fügte sich die Erweiterung sehr gut in den Bestand ein. Dort befand sich ein Selbstbedienungsladen, bis dieser 1991 zu einer Poststelle umgebaut wurde. Dabei veränderte sich das äußere Erscheinungsbild, sowie die Innengestaltung. Die Fassadengliederung, Fenster- und Türformen, sowie die Sockelzone wurden dem historischen Bestand angepasst. Der Zubau erhielt ebenso eine neue Beschilderung.
2008 fand ein neuer Umbau zu einer Apotheke im Innen- und Außenraum statt. Der Eingangsbereich wurde zurückversetzt und mit einer automatischen Schiebetüre modernisiert. Zusätzlich bekam die verputzte Fassade einen neuen Anstrich. Dadurch hebt sich der Anbau stärker vom Bestand ab.

KONSUM ÖSTERREICH

ÖSTERREICHISCHE

Zubau Wäscherei
Um die Nahversorgung der Siedlung zu gewährleisten, wurde von der Firma „Konsum Österreich" im Jahr 1981 ein Lebensmittelladen als Zubau an die Wäscherei in der Stranitzkygasse 3 errichtet. 2003 wurden, unter neuem Namen der Firma, bauliche Veränderungen durchgeführt. Eine neue Überdachung des Einganges, neue Fenster, sowie eine neue Schrifttafel.


KONSUM ÖSTERREICH
Lebensmittelladen 1981
Beim Entwurf 1981 wurden die Stützen im Eingangsbereich, die Gesimse, sowie die Traufen mit Backstein verkleidet bzw. dekoriert. Dabei wurde auf die ursprünglichen Gestaltungsprinzipien der Anlage Rücksicht genommen. Dadurch fügte sich der Neubau sehr gut in die Umgebung und den Bestand ein.
Fenstertypen
Wenn man die Fenster der einzelnen Gebäude in der Schutzzone genauer betrachtet, ist eine gewisse Heterogenität sofort erkennbar. Die meisten der originalen Sprossenfenster aus Holz wurden mit der Zeit durch Kunststofffenster ersetzt. Leider wurde nur teilweise auf die typische Einteilung der Sprossen geachtet. Durch diese Mischung aus neuen und alten Typen ist das ursprüngliche Erscheinungsbild mancher Gebäude verändert worden.
Bei einigen Bauten wurden Loggien mit einer Verglasung ausgestattet, um mehr Innenraum zu schaffen. (z.B. Kindergarten der Stadt Wien)
Bis auf diese Eingriffe blieb die Fassadengliederung überwiegend unverändert bzw. wurde dem Originalzustand entsprechend in Stand gehalten.












Schlusswort
Durch diese ausführliche Analyse der Schutzzone wurde das äußere Erscheinungs bild der historischen Wohnsiedlung „Am Tivoli" erläutert. Als letzte Anlage, im Sinne der Gartenstadt-Bewegung des Roten Wien, sollte der Siedlung große Bedeutung zugesprochen werden. Vor allem ist auf die Wahrung des historischen Bau- und Grünraumbestandes zu achten, damit der unverwechselbare Charakter des Ensembles erhalten bleibt. Trotz einiger Eingriffe, wie Zubau bzw. Einbau, blieb die Charakteristik der Schutzzone erhalten. Bei allen baulichen Veränderungen wurde versucht, die ursprüngliche Formensprache nachzubilden. Als einziges Gebäude der Schutzzone gehört das Doppelhaus „Weißenthurngasse 19 & 20" nicht zur eigent lichen Wohnsiedlung. Obwohl 1937 erbaut, kann sein Äußeres der Nachkriegszeit zugeordnet werden. Daher wäre es vorstellbar, dieses Zweifamilienhaus der Schutz zone zu entnehmen.
Aufgrund ihrer historischen Strukturen und der prägenden Bausubstanz ist es wichtig, dass die Siedlung eine berechtigte Schutzzone ist und in Zukunft auch bleibt. Daher ist bei neuen baulichen Veränderungen darauf zu achten, dass sich diese in das Ensemble und das Stadtbild einfügen.[ 19 ]
Quellenverzeichnis
[ 1 ] Zitat - https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/schutzzonen/
[ 2 ] Zitat - http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=711&paid=7&mvpa=18
[ 3 ] http://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundenomen&Gesetzesnummer=10009184&Artikel=&Paragraf=2a&Anlage=&Uebergangsrecht=
[ 4 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 71/72, 2010, BOUSSKA Hans W.
[ 5 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 71/72, 2010, BOUSSKA Hans W.
[ 6 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 71/72, 2010, BOUSSKA Hans W.
[ 7 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 71/72, 2010, BOUSSKA Hans W.
[ 8 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 71/72, 2010, BOUSSKA Hans W.
[ 9 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 13, 1982, ROLLER Walter, TSCHIEDEL Ernst
[ 10 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 13, 1982, ROLLER Walter, TSCHIEDEL Ernst
[ 11 ] http://www.architektenlexikon.at/de/460.htm
[ 12 ] Museumsblatt des Bezirksmuseum Meidling, Heft 71/72, 2010, BOUSSKA Hans W. http://www.wienerwohnen.at/hof/59/Wohnsiedlung-Am-Tivoli.html
[ 13 ] Das Rote Wien, WEIHSMANN Helmut, Promedia, 1985, S. 211-212
[ 14 ] Das Rote Wien, WEIHSMANN Helmut, Promedia, 1985, S. 211-212
[ 15 ] Das Rote Wien, WEIHSMANN Helmut, Promedia, 1985, S. 211-212
[ 16 ] Das Rote Wien, WEIHSMANN Helmut, Promedia, 1985, S. 211-212
[ 17 ] Das Rote Wien, WEIHSMANN Helmut, Promedia, 1985, S. 211-212
[ 18 ] http://www.ewald.org/MartinerHof/baualtersplaene.htm https://www.wien.gv.at/kultur/kulturgut/architektur/wehdorn.html
[ 19 ] https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/schutzzonen/
Abbildungsverzeichnis
Abb. 01 Wien Karte, bearbeitet http://www.geps23.at/gepsonline/su/wien/wien.gif
Abb. 02 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli" - Google Earth
Abb. 03 Lageplan Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet https://www.wiengv.at/ma41datenviewer/public/
Abb. 04 Lageplan Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet https://www.wiengv.at/ma41datenviewer/public/
Abb. 05 Historischer Plan - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 06 Historischer Plan - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 07 Historischer Plan - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 08 Historischer Plan - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 09 Historischer Plan - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 10 Historische Zeichnung - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 11 Historisches Foto - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 12 Es konnte kein Bild / Foto des Architekten gefunden werden
Abb. 13 Historisches Foto - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 14 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth
Abb. 15 Eigenes Foto
Abb. 16 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth
Abb. 17 Eigenes Foto
Abb. 18 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth
Abb. 19 Eigenes Foto
Abb. 20 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth
Abb. 21 Eigenes Foto
Abb. 22 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth
Abb. 23 Eigenes Foto
Abb. 24 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth
Abb. 25 Eigenes Foto
Abb. 26 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth
Abb. 27 Eigenes Foto Abb. 28 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth Abb. 29 Eigenes Foto
Abb. 30 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth Abb. 31 Eigenes Foto Abb. 32 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth Abb. 33 Eigenes Foto Abb. 34 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth Abb. 35 Eigenes Foto Abb. 36 Satellitenbild Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet - Google Earth Abb. 37 Eigenes Foto Abb. 38 Historische Zeichnung - Bezirksmuseum Meidlung Abb. 39 Historisches Foto - Bezirksmuseum Meidlung Abb. 40 Eigenes Foto Abb. 41 Historisches Foto - Bezirksmuseum Meidlung Abb. 42 Eigenes Foto Abb. 43 Historisches Foto - Bezirksmuseum Meidlung Abb. 44 Eigenes Foto Abb. 45 Historisches Foto - Bilderarchiv, Österreichische Nationalbibliothek Abb. 46 Eigenes Foto Abb. 47 Historisches Foto - Bezirksmuseum Meidlung Abb. 48 Eigenes Foto Abb. 49 Historisches Foto - Bilderarchiv, Österreichische Nationalbibliothek Abb. 50 Eigenes Foto Abb. 51 Historisches Foto - Bilderarchiv, Österreichische Nationalbibliothek Abb. 52 Eigenes Foto Abb. 53 Historisches Foto - Bilderarchiv, Österreichische Nationalbibliothek Abb. 54 Eigenes Foto Abb. 55 Historisches Foto - Bezirksmuseum Meidlung
Abb. 56 Eigenes Foto
Abb. 57 Lageplan Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet https://www.wien.gv.at/ma41datenviewer/public/
Abb. 58 Lageplan Wohnsiedlung „Am Tivoli", bearbeitet https://www.wien.gv.at/ma41datenviewer/public/
Abb. 59 Eigene Fotos
Abb. 60 Eigenes Foto
Abb. 61 Planunterlagen - MA37, Gebietsgruppe West, Bezirke 12 bis 19
Abb. 62 Planunterlagen - MA37, Gebietsgruppe West, Bezirke 12 bis 19
Abb. 63 Eigenes Foto
Abb. 64 Planunterlagen - MA37, Gebietsgruppe West, Bezirke 12 bis 19
Abb. 65 Eigene Fotos
