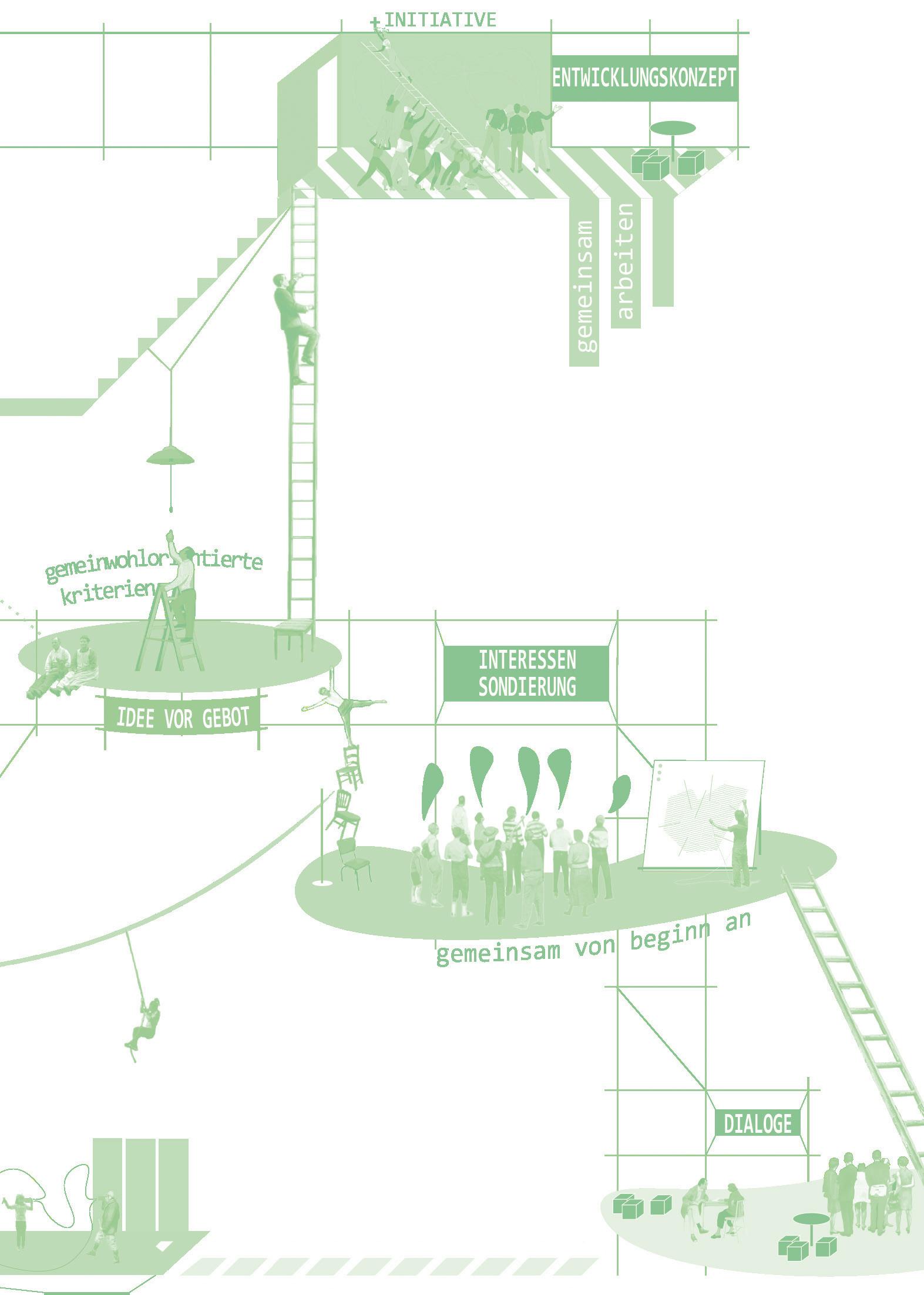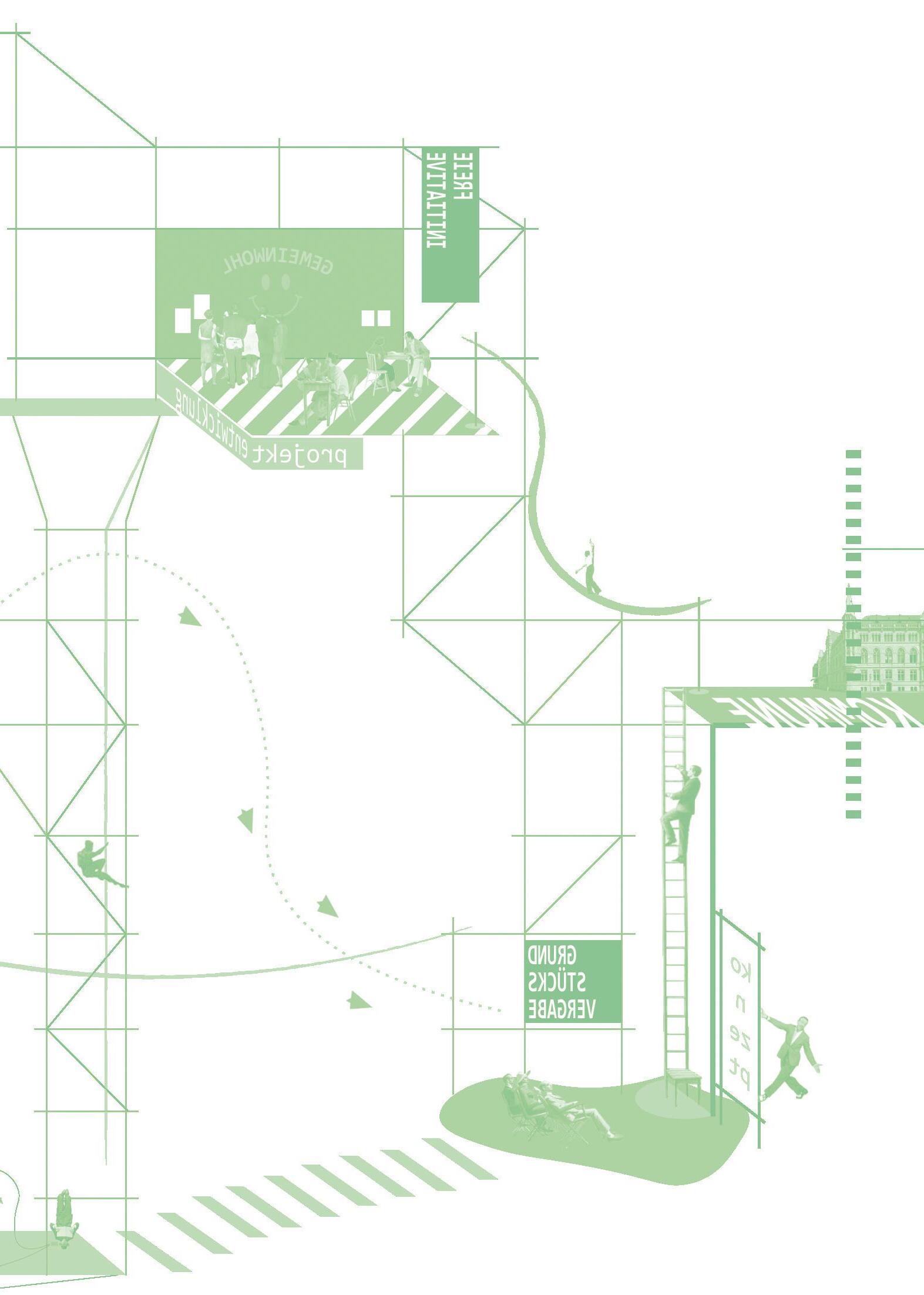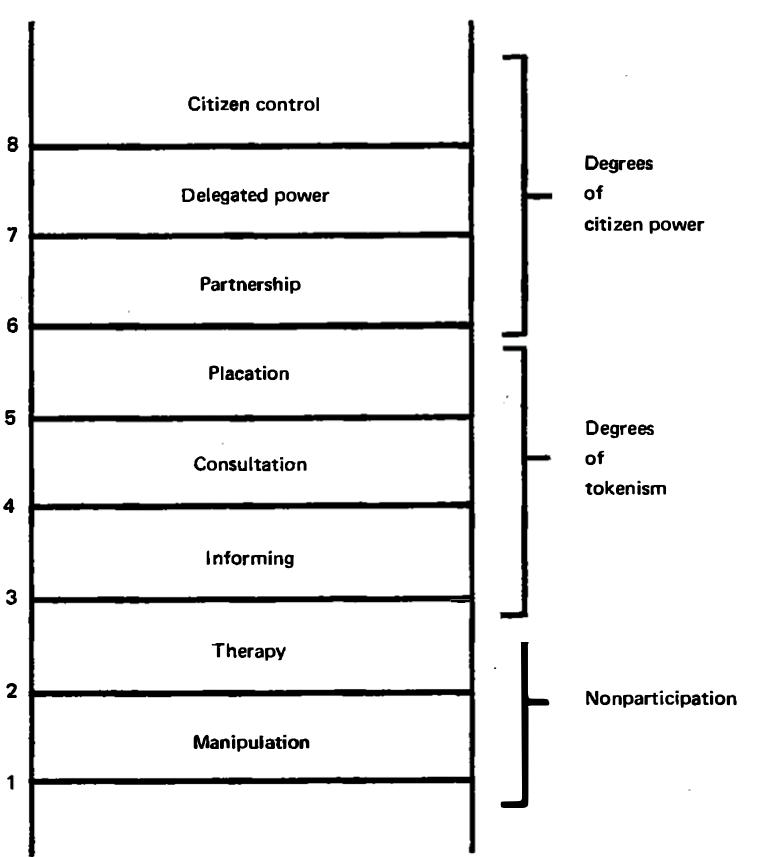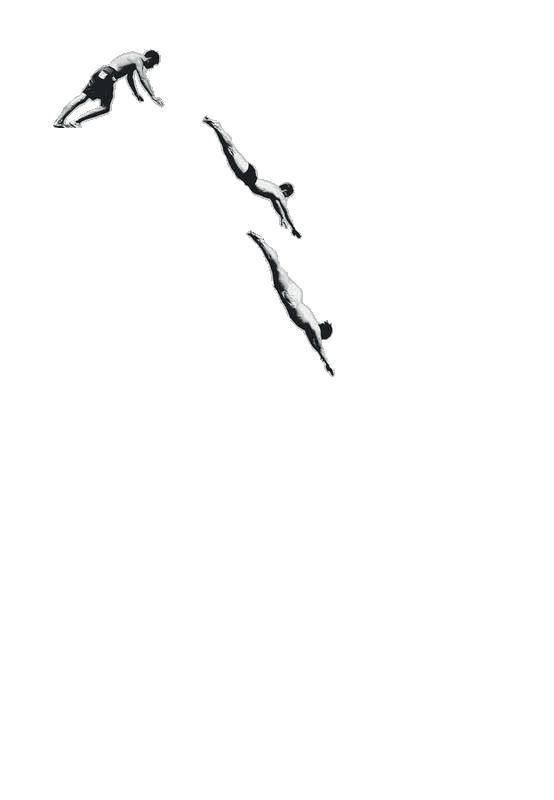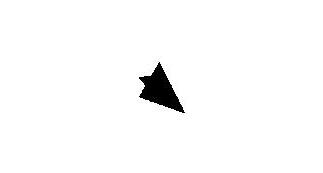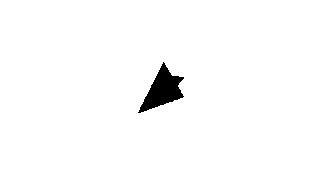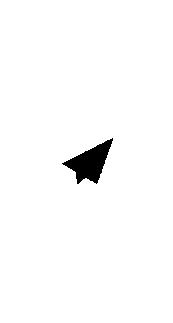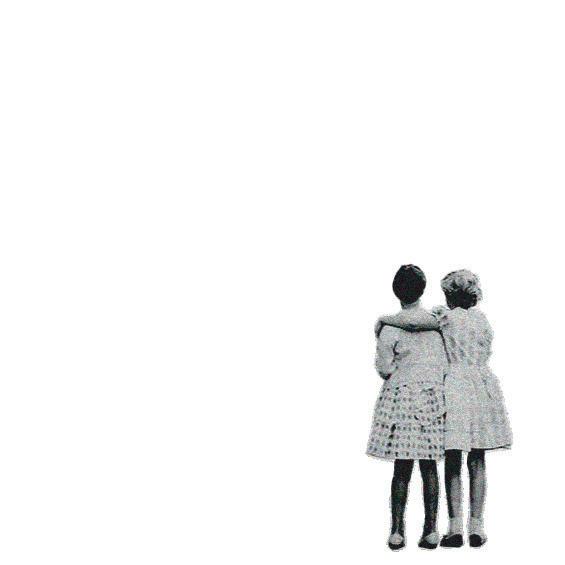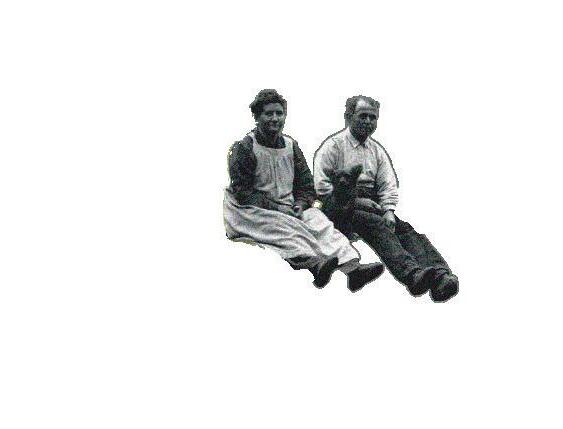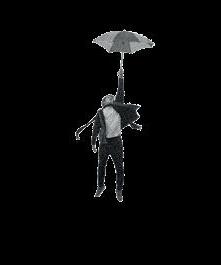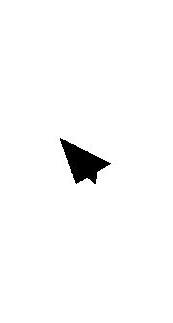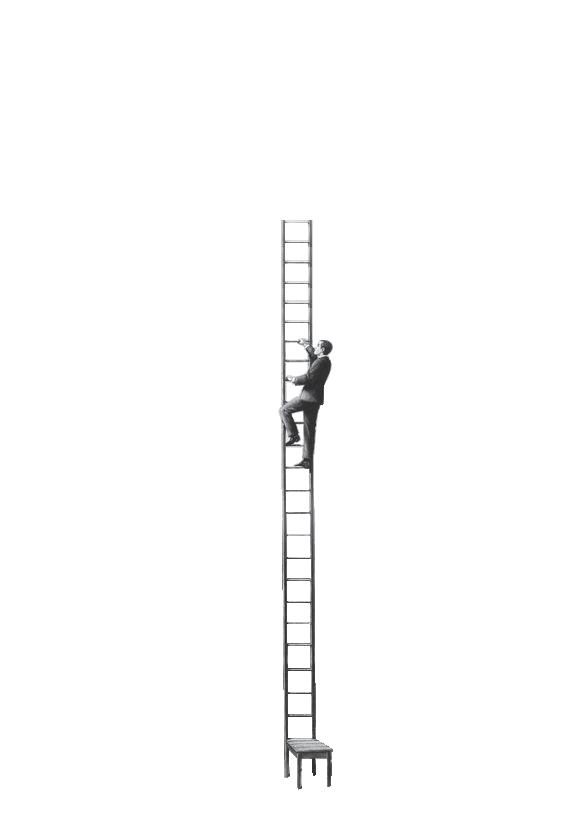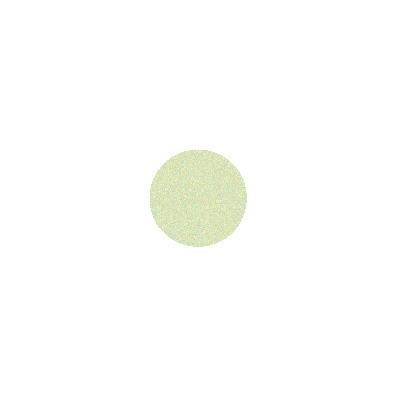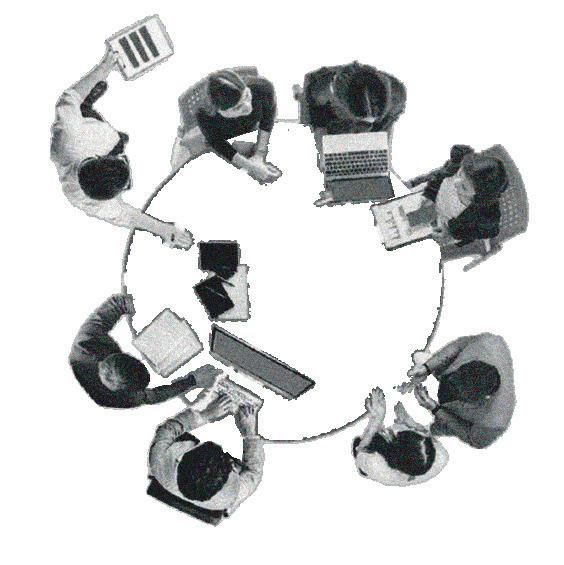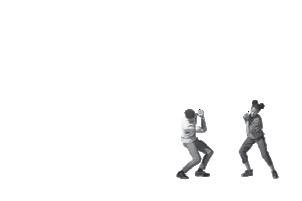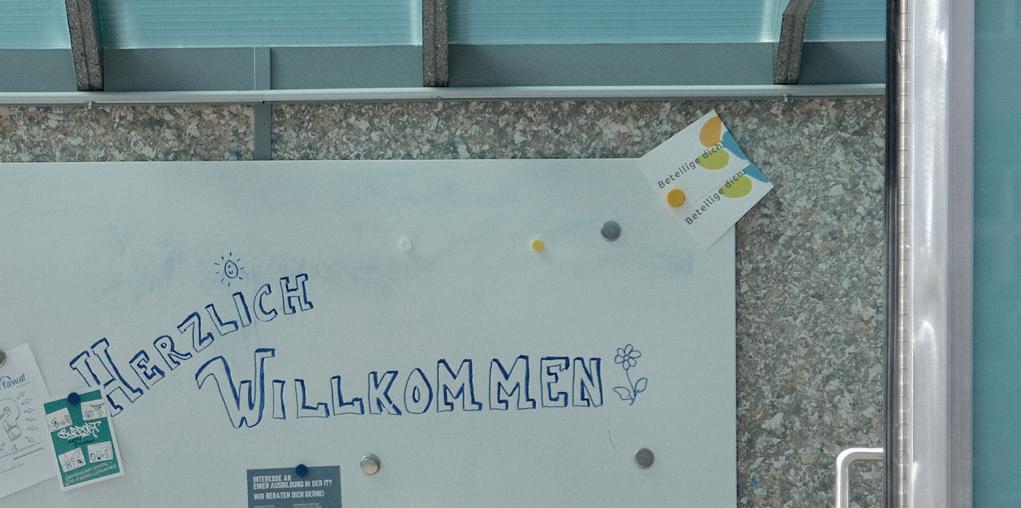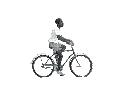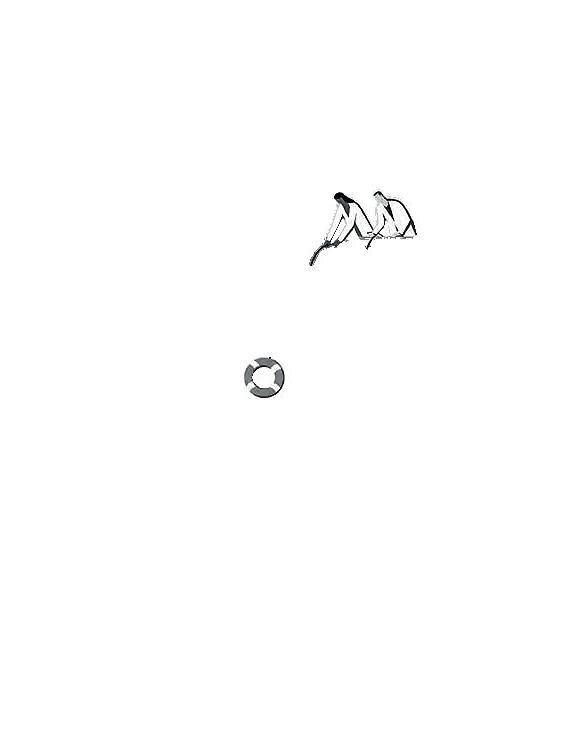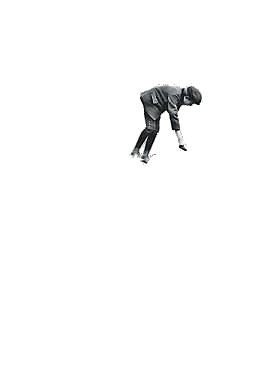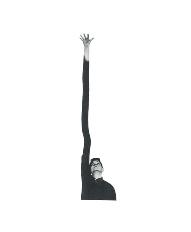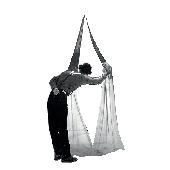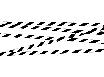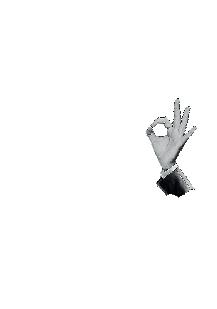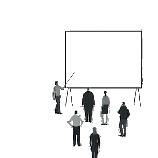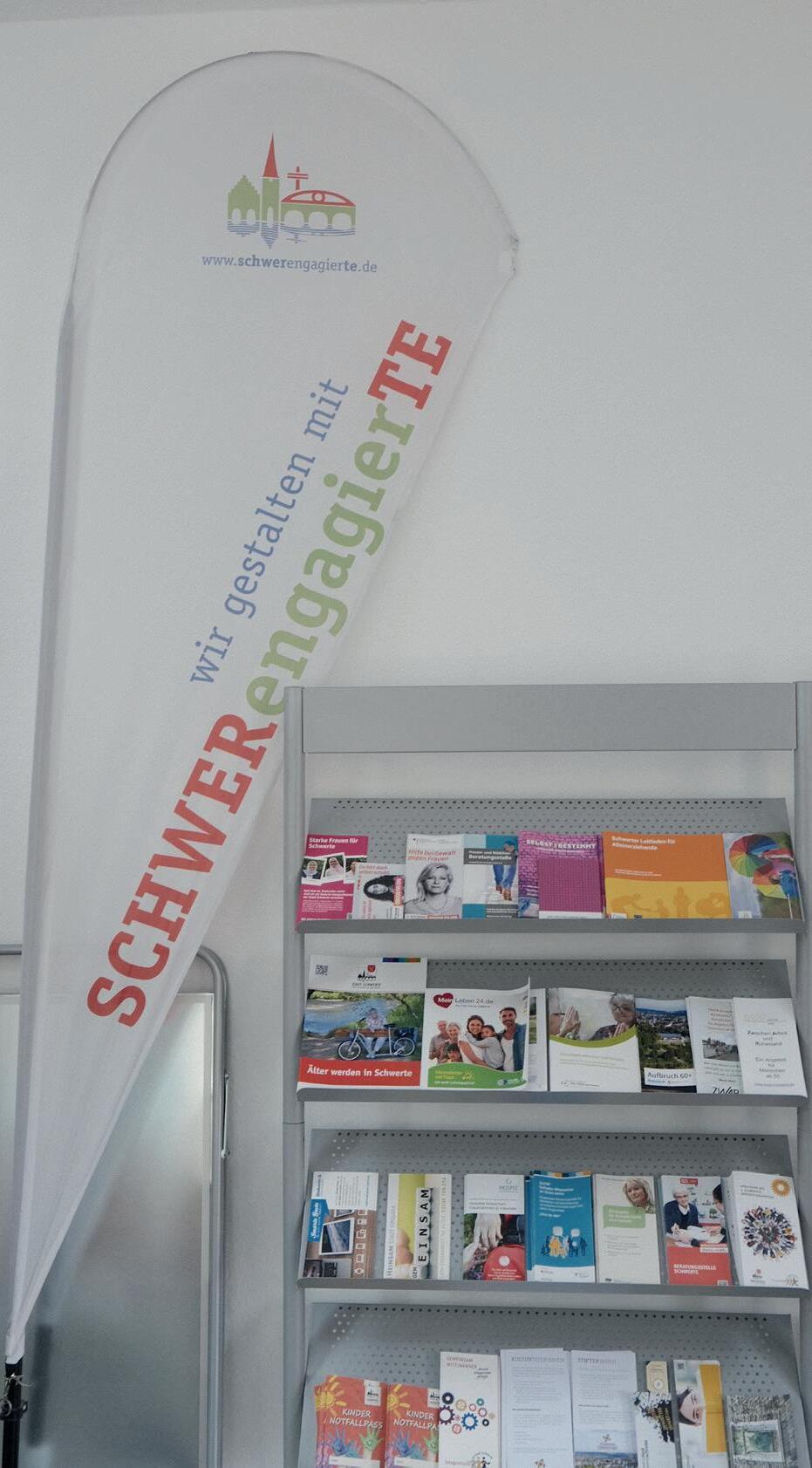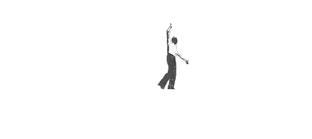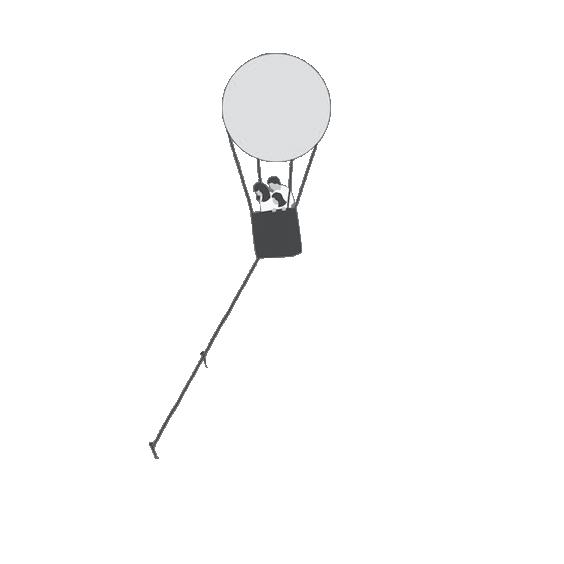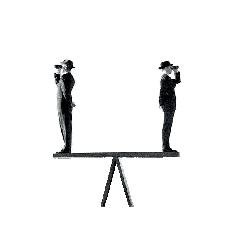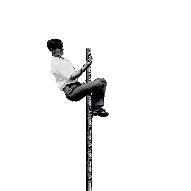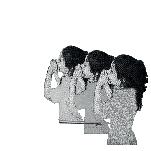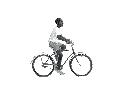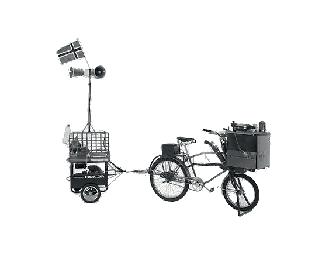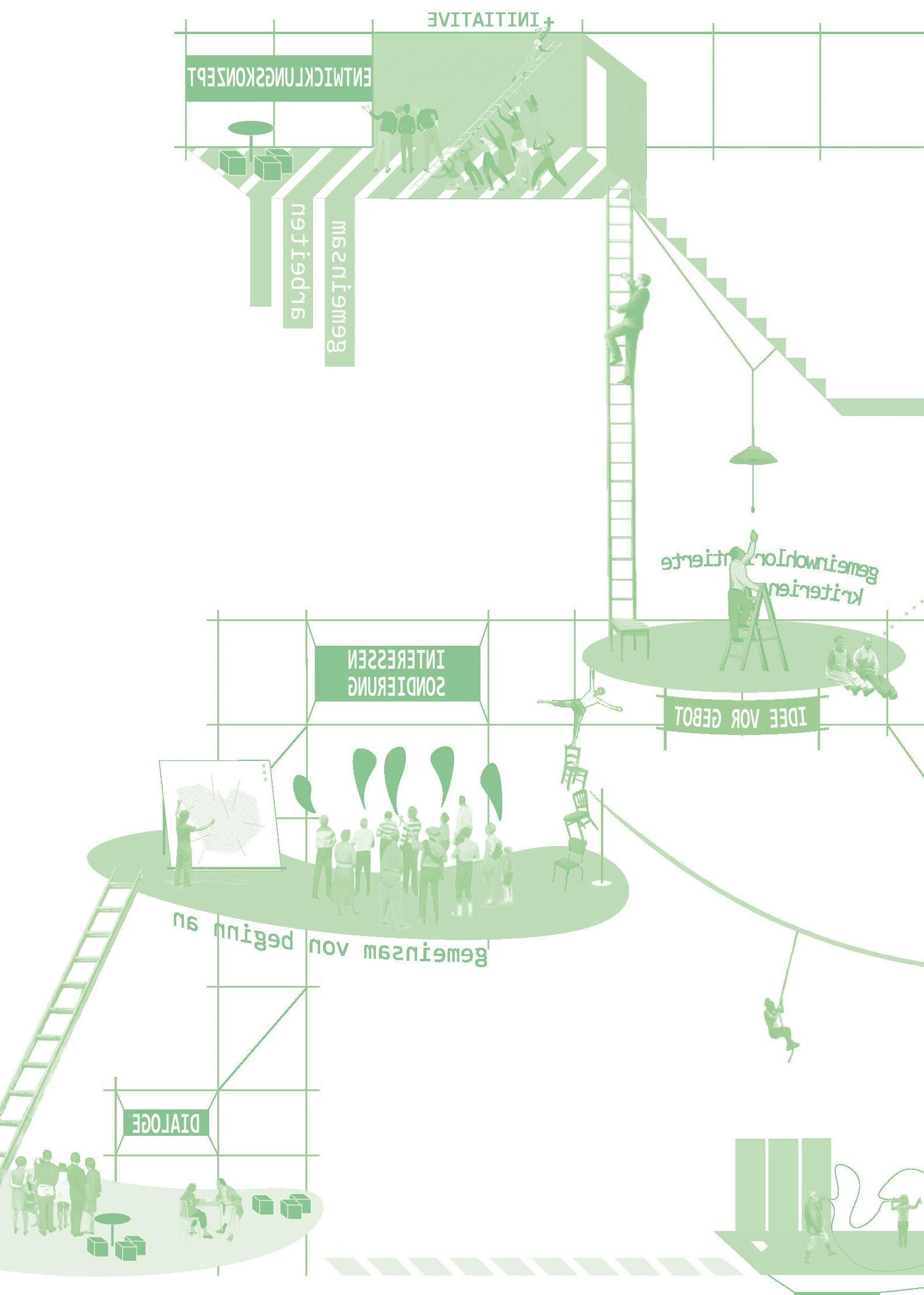STADT GEMEINSAM MACHEN
DAS
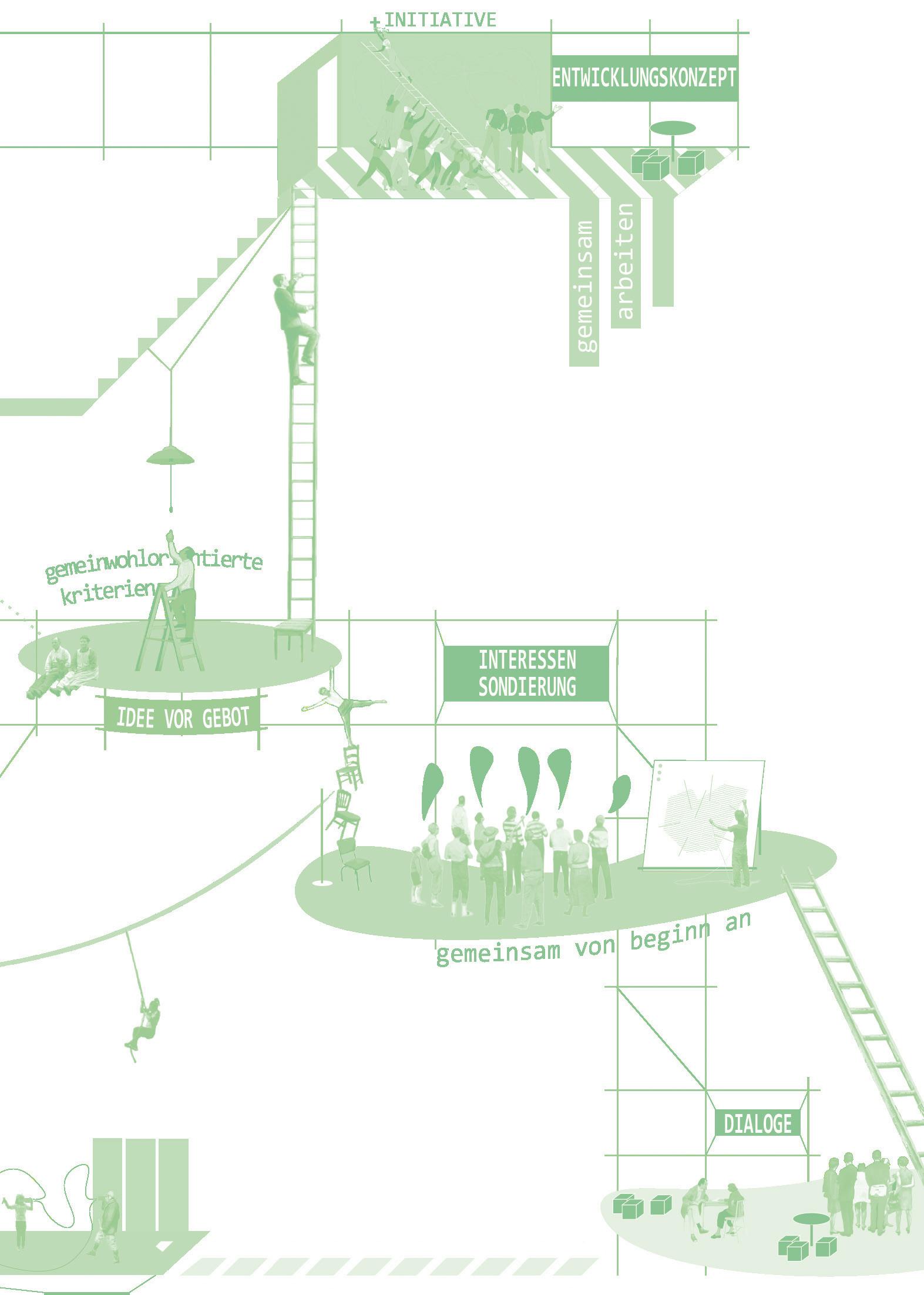
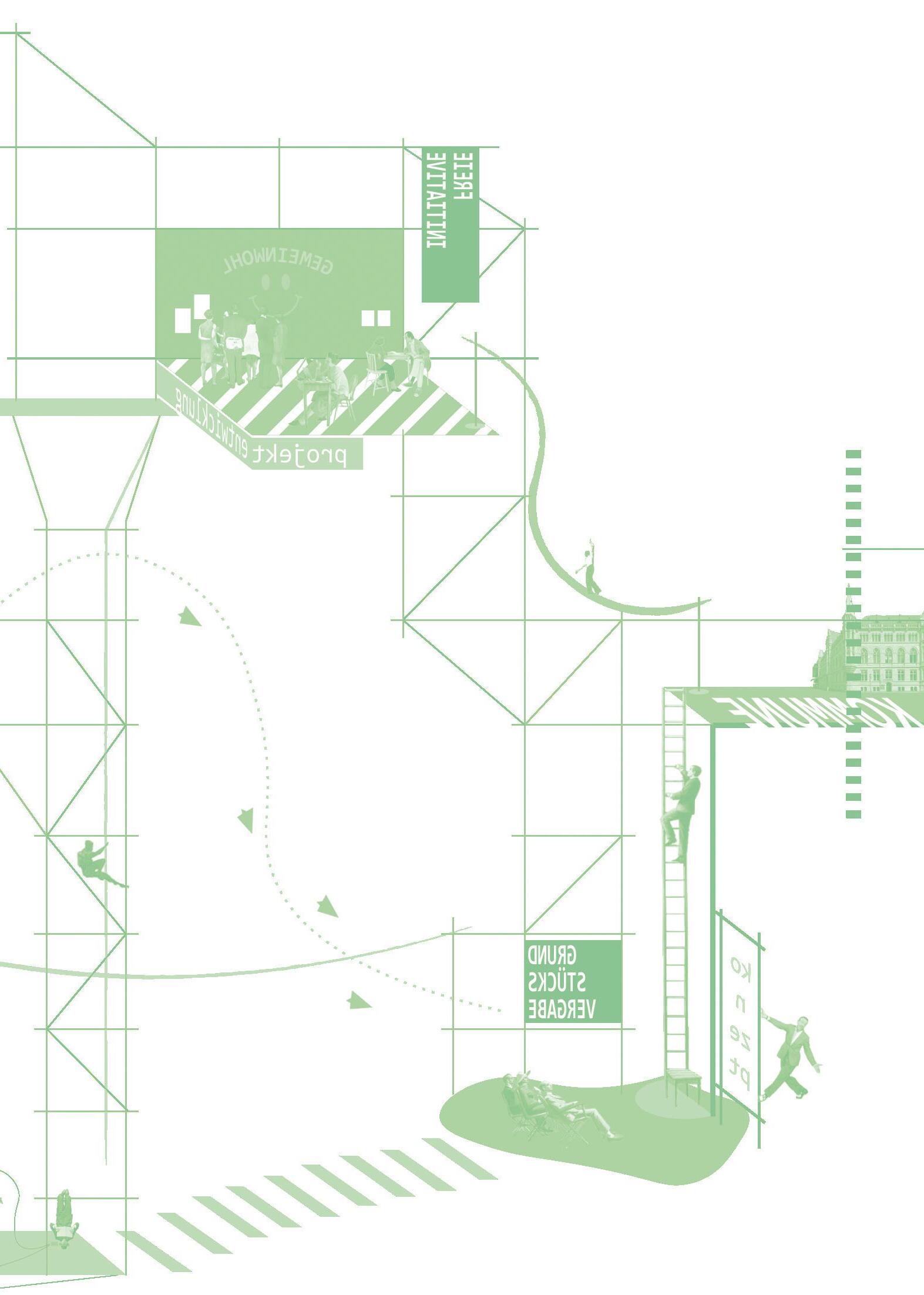
POTENZIAL VON KOOPERATIONEN
PARTIZIPATIVEN STADTGESTALTUNGSPROZESSEN
IN
KOOP.STADT
Bausteine und
Sichtbarmachen
Case-Studies
Tiny Rathaus, Kiel
MitMachBüro, Schwerte
Überlagerung der Kooperationsgerüste
Im Gespräch mit Expertinnen
Hanna Noller
Kristin Lazarova Reflexion
4 6 9 15 27 33 35 38 64 84 104 112 120 128 INHALTSVERZEICHNIS Einleitung Eingliederung in den Planungsprozess Grundlagen des kooperativen Stadtmachens Neue Leipzig-Charta Partizipation & Teilhabe
in Planungsprozessen
Einführung und Definition
Kooperation
Allgemeine
Aktionsfelder
von kooperativen Prozessen
Die Gestaltung unserer gebauten Umwelt betrifft alle menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen, die in und zwischen dieser leben. Sie beeinflusst unsere Wahrnehmung im Alltag und wird erst durch unsere Nutzung aktiviert und belebt. In Stadtgestaltungsprozessen können allzu oft Entscheidungen getroffen werden, die über die potenziellen Nutzer*innen hinweg getroffen werden und mit denen man alltäglich konfrontiert wird. Wir alle kennen sogenannte Bausünden, die in uns Fragen aufwerfen können und uns kritisch unserer gebauten Umwelt gegenüber werden lässt. Als Stadtbürgerin habe ich mich oft gefragt, wann solche Entscheidungsprozesse stattfinden und ob diese transparent mit den eigentlichen Nutzer*innen kommuniziert werden. Städte verändern sich stetig und bringen besondere Anforderungen an ihre Ausgestaltung mit – die Berücksichtigung bedarfsgerechter Kriterien ist notwendig, um gegen eine Entfremdung der Bürger*innen zu ihrer gebauten Umwelt zu wirken und die Zugehörigkeit zu dieser zu stärken.
In meinem Studium der Architektur hatte ich die Möglichkeit, mich durch meine Arbeit am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt kritisch mit meiner gebauten Umwelt auseinanderzusetzen und durch verschiedene Methoden diese zu analysieren und auf sie einzugehen, mich auf sie einzulassen. Insbesondere durch die Mitarbeit an zwei Reallabor-Projekten in der Stadt wurde ich auf etwas Besonderes aufmerksam: Das Potenzial der kollektiven Kraft und die Zusammenwirkung der Erfahrungen und des Wissens aller Beteiligten, die wesentlich für die Realisierung der Projekte waren. Als angehende Architektin hat mich die Kooperation in diesen Prozessen und das Potenzial dieser für die Gestaltung gemeinwohlorientierter Konzepte und Planungen besonders interessiert. Wie können wir als Planende Kooperationen nutzen, um unsere Umwelt mit den Nutzer*innen gemeinsam zu entwerfen und diese aktiv in die Planungen einbeziehen? Welche neuen Methoden braucht es, um miteinander zu arbeiten und nicht über die Interessen der Nutzer*innen hinweg wichtige Entscheidungen für
04
EINLEITUNG
unsere gebaute Umwelt zu treffen? Das kritische Hinterfragen von bestehenden Strukturen und das Sichtbarmachen des Potenzials von partizipativen Methoden fließen in die Bewältigung dieser Herausforderungen mit ein. In diesem Zuge möchte ich herausfinden, wie ich als Architektin und Stadtmacherin in bestehende Prozesse eingreifen kann, um Prinzipien für eine partizipative Stadtgestaltung umzusetzen und aus den Erfahrungen anderer Personen, Gruppen und Orten zu lernen. Wo ist der größte Handlungsbedarf und welche Strukturen und Prozesse müssen verändert werden, um die Erreichung dieser Ziele zu vereinfachen bzw. ermöglichen? Welche Rolle nehmen Kooperationen und die Anwendung kooperativer Methoden und Instrumente in diesen Prozessen ein und wie wirkt kooperative Praxis auf die Förderung von Beteiligung und Mitwirkung an der Stadtgestaltung?
Die vorliegende Arbeit soll informieren, motivieren und Möglichkeiten neuer Formen des Zusammenarbeitens sichtbar machen. Es soll außerdem dabei helfen, Prozesse zu verstehen und das Potenzial des kooperativen Stadtmachens für die Politik und Verwaltung, für Architekt*innen und Stadtplaner*innen und generell für alle an der Planung und Stadtgestaltung beteiligten Akteur*innen hervorheben. Insbesondere das Sichtbarmachen des bereits gesammelten Wissens in diesen Prozessen und die Erfahrungen von Expert*innen sollen dabei helfen, das Stadtmachen hinsichtlich kooperativer Prozesse besser zu verstehen und eine Grundlage schaffen, auf welche aufgebaut werden kann. Die Arbeit setzt sich inhaltlich mit dem Praxisbezug für Architekt*innen und Stadtplaner*innen und einigen Grundlagen für die Entwicklung von gemeinwohlorientierten, zukunftsfähigen und partizipativen Planungskonzepten auseinander. Hinsichtlich dieser wird der Begriff „Partizipation“ vertieft und die Bedeutung der Beteiligung und Teilhabe in integrierten Stadtgestaltungsprozessen weiter veranschaulicht. Darauf aufbauend folgt eine allgemeine Betrachtung des Begriffes der Kooperation und wird durch die Darstellung von verschiedenen Best-Practice Projekten und einer ausführlichen Prozessanalyse von ausgewählten Projekten weiter vertieft. Zuletzt ermöglicht ein Gespräch mit Kooperationsexpert*innen ein besseres Verständnis der kooperativen Praxis und macht die Erfahrungen aus diesen Prozessen sichtbar.
05
EINGLIEDERUNG IN DEN PLANUNGPROZESS
„Phase Null“
Die Baukultur wird größtenteils in Form der gebauten Umwelt sichtbar und prägt das Leben aller Lebewesen, die von ihr umgeben sind.
Der Begriff umfasst dabei neben den Bereichen der Architektur und Baukunst im Detail auch den Ingenieurbau, den Städtebau, die Landschaftsplanung und insbesondere die Untersuchung von Maßstäben für qualitative Planungs- und Bauprozesse1. Baukultur ist also auch Prozess- und Planungskultur, in der die Art und Herangehensweise eines Vorhabens, die Entwicklung und Aushandlung diverser Formen der Gestaltung und die Erarbeitung qualitativer Grundlagen und Ergebnisse behandelt werden2 . Aus dem Baukulturbericht 2014/15 der Bundesstiftung Baukultur geht unter anderem hervor, dass folgende Faktoren und Prozesse für eine qualitative Bau- und Planungskultur relevant sind: Die aktive Einbindung aller Beteiligten, eine integrierte und ressortübergreifende Planungskultur, Innovationen und Experimente für die Erprobung nachhaltiger Formate und insbesondere die Stärkung der „Leistungsphase Null“3. Die Leistungsphasen der HOAI (Gebührenordnung für Architekt*innen) umfasst alle Phasen eines Bauvorhabens, die von der Grundlagenermittlung (Phase 1) bis hin zur Dokumentation (Phase 9) dieser reichen und eine signifikante Grundlage für die Arbeit der Architekt*innen, Stadtplaner*innen und weiteren Akteur*innen des Bauwesens abbildet. Die vorliegende Arbeit ist in die „Leistungsphase Null“ einzuordnen, auf die im Folgenden genauer eingegangen wird.
Die „Leistungsphase Null“ schafft einen Raum für eine angemessene Planungsvorbereitung und legt den Fokus auf eine qualitative Ausarbeitung von Bedarfen und Zielen eines Planungsvorhabens. Diese setzt ganz bewusst noch vor der eigentlichen Anfangsphase der Leistungsphasen an, da in diesen die Klärung der Bauaufgabe und Erarbeitung einer konkreten Planungsidee erfolgen und in diesem Stadium wichtige Entscheidungen hinsichtlich des Bauvorhabens und der späteren Umsetzung getroffen werden, welche „weitreichende Folgen für Architektur und Städtebau sowie
06
für die ökonomische und ökologische Qualität der Gebäude“4 haben. Die baukulturelle Qualität kann nur dann gesteigert werden, wenn die wesentlichen Zielsetzungen eines Planungsvorhabens schon zu Beginn feststehen und einen Rahmen zur Orientierung vorgeben können. Hinzu kommen eine weitreichende Analyse der Situation und der Handlungsbedarfe. Durch eine qualitativ ausgearbeitete Informations- und Handlungsgrundlage lassen sich starke und nachhaltige Konzepte entwickeln, die Nachwirkungen wie Verlagerungs- oder Verdrängungseffekte vermeiden können.5 Die Beteiligungskultur ist in diesen Prozessen ebenso von besonderer Bedeutung, da idealerweise die Sammlung des Wissens und das kreative Potenzial mit in Planungsprozesse einfließen und diese bestärken können (ebd.). Die Organisation dieser Mitwirkung und die Einflussnahme des Wissens in Gestaltungsprozesse zählt zu den Aufgaben des Prozessverantwortlichen, also der Architekt*innen und den Planenden. Zuletzt ist es wichtig zu differenzieren, dass eine gute Beteiligungskultur nicht quantitativ, sondern qualitativ zu betrachten ist: Die Anzahl der Teilnehmenden überliegt nicht der Qualität der Ergebnisse; in bestimmten Fällen muss akzeptiert werden, dass nicht immer ein Interesse an einer Mitwirkung an Entscheidungsprozessen von Planungsvorhaben besteht6. Gleichzeitig sind nicht immer alle Themen für eine Öffentlichkeitsbeteiligung geeignet: In diesen gilt es, einen fachlichen Rahmen vorzugeben, innerhalb dessen Beteiligungen zu ermöglichen sind (ebd.).
Abb. 1
Ergänzung der Leistungsphasen (eigene Grafik basierend auf: Bundesstiftung Baukultur, 2014, S.96)
07
GRUND LAGEN
08
GRUNDLAGEN DES KOOPERATIVEN STADTMACHENS
Neue Leipzig-Charta
Die Neue Leipzig-Charta, die im Rahmen der deutschen EURatspräsidentschaft 2020 verfasst wurde, dient als Leitlinie für eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik. Sie baut auf die im Jahr 2007 von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedete Leipzig-Charta auf und ergänzt diese im Hinblick auf die drängenden globalen Herausforderungen wie den Klimawandel, die Ressourcenknappheit, den demografischen Wandel und die Migration.7 Dieses politisches Dokument ist als Leitfaden zu verstehen, welches aufgrund der wachsenden Herausforderungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit ihm geht die Dringlichkeit für die Bewältigung globaler Konflikte einher. In den folgenden Abschnitten werden die Kernaussagen der Neuen Leipzig-Charta im Hinblick auf die Maßnahmen, in denen Kooperationsprozesse verankert sind, genauer betrachtet und erläutert.
Das neue Leitdokument befasst sich mit der Umwandlung europäischer Städte hin zu einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Die dicht bebauten Stadtstrukturen weisen in ihren unterschiedlichen Größen diverse Potenziale und Herausforderungen für ein kulturelles, soziales ökologisches und wirtschaftliches Zusammenspiel auf. Die Stadtstruktur ist dabei als flexibel und wandelbar zu betrachten. Dadurch kann auf Ereignisse und Belastungen reagiert, sowie auf die Erfahrungen anderer Städte und Kommunen zurückgegriffen werden, sodass die Widerstandsfähigkeit durch die robusten städtischen Strukturen gefördert wird. Kooperationen setzen hier an und ermöglichen das Teilen und Lernen aus bereits gesammeltem Wissen durch andere an der Stadtentwicklung beteiligte Akteur*innen. Die Stadt ist somit ein Experimentierfeld für die Erarbeitung neuer Lösungsansätze, sozialer Innovationen und die Stärkung des Miteinanders.8
Die Neue Leipzig-Charta bezieht sich auf fünf Grundprinzipien für eine gute Stadtentwicklungspolitik, die auf drei Dimensionen und drei räumliche Ebenen der Stadt angewendet werden. Die räumlichen Ebenen der Stadt beziehen sich auf die Quartiersebene,
09
die Kommune und auf funktional zusammenhängende Räume. Die Kommunen sind im nationalen Kontext für die lokale Stadtentwicklung verantwortlich und fungieren als Schnittstelle zwischen kleinteiligeren Stadtquartieren und den größeren zusammenhängenden Stadträumen, die aus einem komplexen Netzwerk aus funktionalen Abhängigkeiten und Partnerschaften, wie beispielsweise Metropolregionen, bestehen. Ihre Aufgabe ist es, eine bürgernahe Stadtentwicklungspolitik durch eine kooperative Zusammenarbeit dieser Ebenen zu ermöglichen, in der gemeinsam über zukunftsfähige Strategien abgestimmt wird.9 Ein grundlegender Bestandteil für die städtische Transformation ist die Integration sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Dimension. Diese werden über drei Handlungsdimensionen formuliert, die in einer wechselseitigen Wirkung zueinander stehen: die gerechte, grüne und produktive Stadt. Die gerechte Stadt strebt eine Stadtgesellschaft an, die inklusiv ist und Chancengleichheit sowie Umweltgerechtigkeit für alle ermöglicht, unabhängig von Geschlecht, Status, Alter und Herkunft. Sie zielt auf die gleichberechtigte Teilhabe an sozialer Infrastruktur ab und schafft Zugänglichkeit auf verschiedenen Ebenen. Die grüne Stadt steht für eine klimafreundliche und umweltschonende Stadtentwicklung, die sich beispielsweise durch nachhaltige Flächennutzungen und Mobilität, klimaneutrale Energieversorgung, CO2-neutrales Bauen und die Schaffung eines gesunden Lebensumfelds durch vernetzte grüne und blaue Infrastrukturen auszeichnet. Die produktive Stadt hingegen schafft solide, wirtschaftliche Grundlagen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, indem die lokale Wirtschaft durch innovative, wettbewerbsfähige, klima- und umweltfreundliche Strukturen gestärkt und die regionale Produktion gefördert wird. Die Wissensgesellschaft kann dabei Anreize für neue, nachhaltige Formen der urbanen Produktion geben und die Grundlage für neue Formen von nutzungsgemischten Quartieren bilden.10 Für die Erarbeitung der drei Dimensionen stellt sich eine besondere Anforderung an die Planung: alle Dimensionen setzen eine gemeinsame und klare Ausarbeitung der Belange und Bedürfnisse der Stadtbewohner*innen wie auch das Sichtbarmachen von Missständen und den daraus resultierenden Anforderungen für
10
Städte und ihre Quartiere voraus. Um diese Herausforderungen kollektiv anzugehen, werden fünf Handlungsprinzipien formuliert, die ihre Anwendung auf den drei Dimensionen finden und für eine gute und nachhaltige Stadtentwicklungspolitik maßgeblich sind: der integrierte Ansatz, die Beteiligung und Koproduktion, der Mehrebenen-Ansatz, der ortsbezogene Ansatz und die gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik. Der integrierte Ansatz baut auf einer gleichwertigen Berücksichtigung aller für die Stadtentwicklung relevanten Belange und Interessen der Bürger*innen auf, wodurch integrierte und nachhaltige Konzepte und Planungen erstellt werden können. Das Schlüsselprinzip der Beteiligung und Koproduktion baut unter Berücksichtigung der Belange und des Fachwissens wirtschaftlicher Akteur*innen, der Zivilgesellschaft sowie weiterer Stakeholder auf dem integrierten Ansatz auf. Ausschlaggebend für die Erarbeitung dieser Konzepte und Planungen ist die Entwicklung neuer Methoden für partizipative Gestaltungsprozesse, die eine Zusammenarbeit mit allen am Projekt beteiligten Akteur*innen voraussetzt und mittels gemeinsamer Ko-Produktion in Planungsprozessen erreicht wird. Diese Form der Kooperation auf Planungsebene setzt die Förderung der breiten Beteiligung voraus, um alle Bedarfe gleichwertig zu betrachten und hin auf eine nachhaltige, demokratische und pluralistische Stadtentwicklung zu arbeiten. Für die Bewältigung komplexer Herausforderungen in Planungsprozessen sollte darüber hinaus die Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Stadtentwicklungs- und Raumordnungspolitik nach dem Mehrebenen-Ansatz angestrebt werden. Die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Akteur*innen, der Verwaltung, der Zivilgesellschaft wie auch der Privatwirtschaft bilden eine wichtige Grundlage für diesen Ansatz. Entscheidend ist hierbei jedoch die Ausrichtung der Kooperationen in horizontaler, wie auch in vertikaler Ebene, mit der Einbindung von „Bottom-Up“ als auch „Top-Down“ Formaten.11
Des Weiteren werden in der Neuen Leipzig-Charta weitere Grundlagen formuliert, die für die Stärkung der lokalen Handlungsfähigkeit der Städte essenziell sind. Hinsichtlich kooperativer Planungsprozesse sind sowohl geeignete rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, die neue
11
kooperative Formen in den Planungen und Prozessen stützen und fördern, als auch das Weiterbilden bzw. Einstellen von qualifiziertem Personal für die sich ständig verändernden, komplexen
Herausforderungen. Außerdem kann die Stärkung von Kooperationsformen auch bedeuten, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen müssen. Hierfür sollten geeignete politische Strategien und entsprechende Fördermöglichkeiten erarbeitet werden – Kommunen brauchen dafür passende Rahmenbedingungen aus allen Regierungsebenen, um so die Umsetzung einer integrierten und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung zu fördern. Dies beinhaltet unter anderem den Austausch von Erfahrung und Wissen zwischen Städten nach dem Mehrebenen-Ansatz oder auch die Entwicklung und Neuausrichtung von nationalen oder regionalen Förderprogrammen. Zuletzt braucht es für die Optimierung von Stadtentwicklungsprozessen auch die Nutzung des digitalen Wandels12 , durch welchen neue dynamische Formen der Kommunikation entstehen und ein transparenter Informationsfluss innerhalb einer kooperativen Planung optimiert und gefördert werden kann.
Abschließend ist zu sagen, dass die Neue Leipzig-Charta (mit der neuen Auffassung) ein strategisches Rahmenwerk schafft, durch welches die Ziele aus den europäischen und internationalen Abkommen auf bundesweiter und kommunaler Ebene berücksichtigt und umgesetzt werden können. Das Dokument bildet dabei keine Rechtsgrundlage und kann nicht forciert werden. Es ist demnach als Motor für eine auf Gemeinwohl basierende Stadtentwicklungspolitik zu verstehen, in der die Verfolgung gemeinsamer Ziele hinsichtlich globaler Herausforderungen im Vordergrund stehen und gemeinsam zu bekämpfen sind. Die Neue Leipzig-Charta richtet sich an Städte und Kommunen, an regionale Behörden und alle Stadtentwicklungsakteur*innen aus allen Regierungsebenen. Aus ihr lässt sich ableiten, dass insbesondere die Zusammenarbeit verschiedener Akteur*innen in allen Dimensionen ein großes Potenzial für die Umsetzung einer nachhaltigen, gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungspolitik aufweist. Kooperationen auf horizontaler und vertikaler Ebene bilden hierbei weitgehend die Grundlagen für die Erreichung gemeinsamer Ziele.
12
EXKURS: KOPRODUKTION
Der Begriff Koproduktion findet im Kontext der integrierten und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung häufig Verwendung. Doch was genau bedeutet es, zu koproduzieren?
Bei koproduktiven Prozessen geht es insbesondere darum, dass Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam angegangen und gelöst werden. Beteiligte Personen oder Gruppen arbeiten in diesen Verfahren nicht eigenständig an Teilaufgaben, sondern miteinander an einem Ziel, indem sie ihre Kompetenzen und Kenntnisse in den Prozess mit einbringen und Aufgaben gemeinsam bewältigen. Dieser Prozess bringt das Potenzial mit sich, Stärken und Erfahrungen miteinander zu verknüpfen und kollektiv bessere Lösungen zu erarbeiten. In Stadtentwicklungsprozessen kann Koproduktion zu Beginn eines Projekts stattfinden, aber auch während des Entwicklungsprozesses bis hin in die Nutzungsphasen, beispielsweise in Form einer gemeinsamen Organisationsform. In diesen Prozessen ist die Aufteilung der Verantwortung unter den Beteiligten (den gesamten Prozess hindurch) ebenso relevant wie die Auflösung des Antagonismus zwischen formeller und informeller Stadtentwicklung, da in diesen Prozessen gemeinsam – mit Rücksicht auf die zu vertretenden Interessensbelange – gearbeitet wird. Bei einer Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, der Politik und der Verwaltung spicht man auch von einer „Civicpublic-Partnership“. Letztendlich lässt sich für die Koproduktion im Sinne der gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung sagen, dass die Beteiligten, wie etwa Initiativen, Investierende, Stadtgesellschaften und Kommunen miteinander an zukunftsfähigen Strukturen und Lösungen arbeiten.13
13
PARTI ZIPA TION &TEIL HABE
14
GRUNDLAGEN DES KOOPERATIVEN STADTMACHENS
Partizipation & Teilhabe
Wie aus der Neuen Leipzig-Charta zu entnehmen ist, bildet die Beteiligung der Zivilgesellschaft und somit auch die Partizipation eine wichtige Grundlage für integrierte Planungsprozesse. Sie ist in allen fünf Schlüsselprinzipien für eine Stadtentwicklung im Sinne des Gemeinwohls tief verankert und kann mittels diverser, demokratischer Beteiligungsprozesse sichtbar machen, welche Belange, Interessen und Herausforderungen in allen Ebenen einer Stadt vorzufinden sind. Durch partizipative Beteiligungsprozesse kann die Teilhabe und Mitwirkung der Zivilgesellschaft an der Gestaltung der gebauten Umwelt ermöglicht und gefördert werden. Doch was genau bedeutet Partizipation und in welcher Form müssen Beteiligungsprozesse durchgeführt werden, um von einer Teilhabe der Gesellschaft an der Stadtgestaltung sprechen zu können? Sind Beteiligungsprozesse im Kontext der Stadtplanung messbar und in welcher Verbindung stehen Kooperationen dazu? Um diesen Fragestellungen nachzugehen, wird im Folgenden der Begriff Partizipation in Stadtentwicklungsprozessen definiert und anhand von sogenannten Stufenmodellen zur Differenzierung der Intensitätsgrade weiter vertieft.
Partizipation ist ein Begriff, der gegenwärtig vielfach Verwendung findet und durch den Gebrauch in verschiedenen Bereichen diverse Interpretationen erfährt. Der Begriff Partizipation geht auf das lateinische Wort „particeps“(=“teilnehmend“) zurück und steht für Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung oder Einbeziehung14. Folglich bedeutet dies, dass darunter eine Vielfalt an Aktivitäten mit sehr unterschiedlichen Reichweiten fallen. Eine Gemeinsamkeit dieser facettenreichen Bedeutung des Begriffs ist „das Handeln mehrerer Akteure, das sich auf eine gemeinsame Angelegenheit bezieht. Die Art der Mitwirkung der einzelnen Akteure an dieser gemeinsamen Sache – ihre jeweils konkrete »Teilhabe« – kann dabei sehr verschieden sein“15 (Selle, 2010, S.3). Nach Selle wird der Begriff der Partizipation in der Fachdiskussion fast ausschließlich mit der
15
„Teilhabe an öffentlichen Planungsprozessen“ gleichgesetzt, was zu einer Begrenzung des Begriffs führt und nur einen kleinen Bestandteil der tatsächlichen Bedeutung von Teilhabe abbildet (s. Abb. 2).
Abb. 2
Was »Teilhabe an der Stadtentwicklung« heißen kann (eigene Grafik basierend auf: Selle, 2010, S.11)
Neben mehreren differenzierten Begriffsdefinitionen gibt es die Unterscheidung in politische, soziale, ökonomische und kulturelle Partizipation. Dabei ist die politische Partizipation, welche die Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess durch Wahlen meint, die bekannteste Möglichkeit der Partizipation16. Die politische Willensbildung ist dabei im Allgemeinen der Prozess, „bei dem (mit unterschiedlichem Gewicht) bestimmte Gegebenheiten (Zustände, Fakten) und bestimmte Absichten (Interessen, Ideen) zu politischen Überzeugungen, zu politischen Zielen und ggf. politischen Handlungen führen“17 (Schubert/Klein, 2020, S.3). Die Definition der politischen Partizipation oder politischen Beteiligung umfasst sämtliche Handlungen, „die Bürger freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen“18 (Kaase, 1992, zitiert in Berger, 2009, S.41). Gegenüber der politischen Partizipation wird die soziale Partizipation mit sozialer Teilnahme verglichen und bezeichnet „Art und Ausmaß, mit denen Einzelne oder soziale Gruppen am sozialen Leben im Sinne von nicht an Vereine, Organisationen usw. gebundener Geselligkeit teilnehmen“19 (Fuchs-Heinritz et.al., 2007, zitiert in Berger, 2009, S.41). Zu diesem sozialen Leben gehören auch alltägliche Tätigkeiten, wie Wohnen und Einkaufen, die Nutzung der
16
Infrastruktur sowie der Zugang zu Bildungseinrichtungen. Die politische Partizipation ist im Hinblick auf den Einfluss der Bürger*innen auf politische Entscheidungen in integrierten Stadtentwicklungsprozessen, die alle Ebenen des politischen Systems betreffen, die bedeutendste für die Mitwirkung der Zivilgesellschaft an Planungsvorhaben. Für
Stadtentwicklungsprozesse, in denen sich engagierte Bürger*innen ohne eine feste Organisation oder Vereinsstruktur an der Stadtgestaltung beteiligen, ist die soziale Partizipation anwendbar. Aus den vorangegangenen Definitionen lässt sich ableiten, dass Partizipation in Stadtentwicklungsprozessen jene Prozesse bezeichnet, die eine „freiwillige und aktive Beteiligung [...] an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen“ der politischen und sozialen Bereiche des Lebens meint20.
Eine tiefergehende Untersuchung der Bedeutung von Partizipation in Planungsprozessen liefert die Publikation „Architecture and Participation“, welches von Peter Jones Blundell, Doina Petrescu und Jeremy Till im Jahr 2005 veröffentlicht wurde. In dieser wird die kritische Hinterfragung des Begriffes der Partizipation und die Notwendigkeit einer Neubewertung aufgrund der unkritischen Akzeptanz der Partizipation in Planungsprozessen durch das Fachwissen von diversen Expert*innen thematisiert21. Dazu lässt sich grob sagen, dass die unkritische Akzeptanz eine Diskussion über die „politics of participation“ auslöste, die unter anderem meint, dass Partizipation nicht immer als eine Garantie für die Nachhaltigkeit eines Projektes angesehen wird, sondern als einen Ansatz, der Risiken und Ungewissheit mit sich bringt22 . Im Hinblick auf die verschiedenen Definitionen der Expert*innen von Partizipation lässt sich folgendes festhalten: „At the level of the lowest common denominator, architectural participation can be defined as the involvement of the user at some stage in the design process“23 (Bundell Jones/Petrescu/Till, 2005, S. 13).
21 Für eine ausführliche Darstellung ist eine Auseinandersetzung mit der Begriffsbedeutung der Partizipation, der unkritischen Akzeptanz des Begriffes in Partizipationsverfahren, den umstrittenen Bedingungen des partizipatorischen Prozesses und seine konfliktreichen Möglichkeiten relevant, dazu ausführlich: Bundell Jones, P./ Petrescu, D./ Till, J. (2005) in „Architecture and Participation“, S. 3 ff.
17
In den folgenden Abschnitten wird nun der Begriff der Partizipation hinsichtlich der Intensitätsgrade und den Stufen der Partizipation weiter veranschaulicht.
Der Partizipations- oder Beteiligungsprozess lässt sich nach dem Stufenmodell von Arbter in drei Intensitätsstufen gliedern und umfasst die Stufen der Information, Konsultation und Kooperation (s. Abb.3). Die erste Stufe der Partizipation oder Beteiligung bezeichnet die Information, die nach der Einweg-Kommunikation das Informieren der Beteiligten – kontextuell meint Arbter hier die Öffentlichkeit – über Planungen oder Entscheidungen vonseiten der Stadtverwaltung und Politik umfasst, ohne dass diese beeinflusst werden können. Das Informieren könnte beispielsweise über eine Website oder einem Folder erfolgen. Mit dem Begriff der Öffentlichkeit sind Bürger*innen, Interessengruppen und die
Abb. 3
Intensitätsstufen der Partizipation (eigene Grafik basierend auf: Arbter, 2012, S.11)
18
Fachöffentlichkeit, also relevante Fachleute mit Bezug zum Thema, gemeint. Die Stadtverwaltung, politische Institutionen und Unternehmen zählen nicht dazu. 24 Die Konsultation ist die zweite Stufe der Partizipation und bildet die Zweiweg-Kommunikation ab. In dieser können Beteiligte mittels Online-Fragebögen oder Stellungnahmeverfahren zu einem Entwurf Stellung nehmen und Fragen an die Stadt kommunizieren. Die dritte und letzte Stufe der Partizipation umfasst die Kooperation und damit eine MehrwegKommunikation zwischen der Stadt und der Öffentlichkeit. In dieser entwickeln Beteiligte miteinander, beispielsweise in Online-Dialogen oder Runden Tischen, und gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Planung. Alleine betrachtet stellt die Stufe der Information keine Form der Beteiligung dar, da die Öffentlichkeit ihre Meinung nicht einbringen kann und dadurch keinen Einfluss auf Entscheidungsprozesse hat. Jedoch funktioniert Beteiligung auch nicht ohne die „Information“, weshalb diese als Grundstufe der Partizipation das Fundament jedes Beteiligungsprozesses darstellt. Sie ist für aktiv Beteiligte, nicht aktiv Beteiligte (die weiterhin informiert werden wollen) und für politische Entscheidungsträger*innen, die durch das Verfolgen des Beteiligungsprozesses die Ergebnisse optimal berücksichtigen können, relevant. Auf der Grundstufe der Information bauen die weiteren, intensiveren Stufen der Konsultation und Kooperation auf. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen darin, ob die Beteiligten miteinander agieren oder nicht; die Konsultation zeichnet sich dabei durch den Fokus auf Einzelmeinungen aus. Die Kooperation hingegen basiert auf dem Austausch der Beteiligten und die gemeinsame Erarbeitungen von Lösungen im Dialog. Hierbei kann sich die Intensität der Kooperation durch die Art der Zusammenarbeit unterscheiden: Beteiligte können sich gegenseitig inspirieren, gemeinsam Ideen entwickeln, konsensuale Pläne aushandeln oder auch Entscheidungsmächte übernehmen. Grundsätzlich gilt für die Intensitätsstufen nach Arbter, dass die Einordnung in den Intensitätsstufen höher wird, umso stärker die Beteiligten die Entscheidungsprozesse beeinflussen können. Die chronologische Reihung der drei Stufen muss dabei nicht automatisch bedeuten, dass die Beteiligung qualitativ besser wird.
19
Die Stufen können je nach Aufgabe auch einzeln betrachtet werden oder – wie es in den meisten Beteiligungsprozessen der Fall ist –miteinander kombiniert werden. 25
Eine detaillierte untergliederte Darstellung der Partizipationsstufen bildet die „Ladder of Participation“ von Sherry R. Arnstein, welche im Jahr 1969 veröffentlicht wurde und einen signifikanten Beitrag zur Diskussion um demokratische Beteiligungsprozesse und die Intensität dieser in den 70er Jahren leistete (s. Abb.4). Ergänzend dazu ist in Abbildung 5 ein geringfügig modifiziertes Modell der Partizipationsleiter nach Selle (1996, S.170) dargestellt, welches die grundsätzliche Abfolge und den dreiteiligen Aufbau beibehält.
Arnsteins Modell der Partizipationsleiter baut auf die grundlegenden Theorien des öffentlichen Engagements und Partizipation in Bezug auf die Art und Weise, wie öffentliche Institutionen und ermächtigte
Beamt*innen den Bürger*innen die Macht vorenthalten, auf und schafft mit der Partizipationsleiter ein Modell, welches eine
Abb. 4 Partizipationsleiter: Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969, S.217)
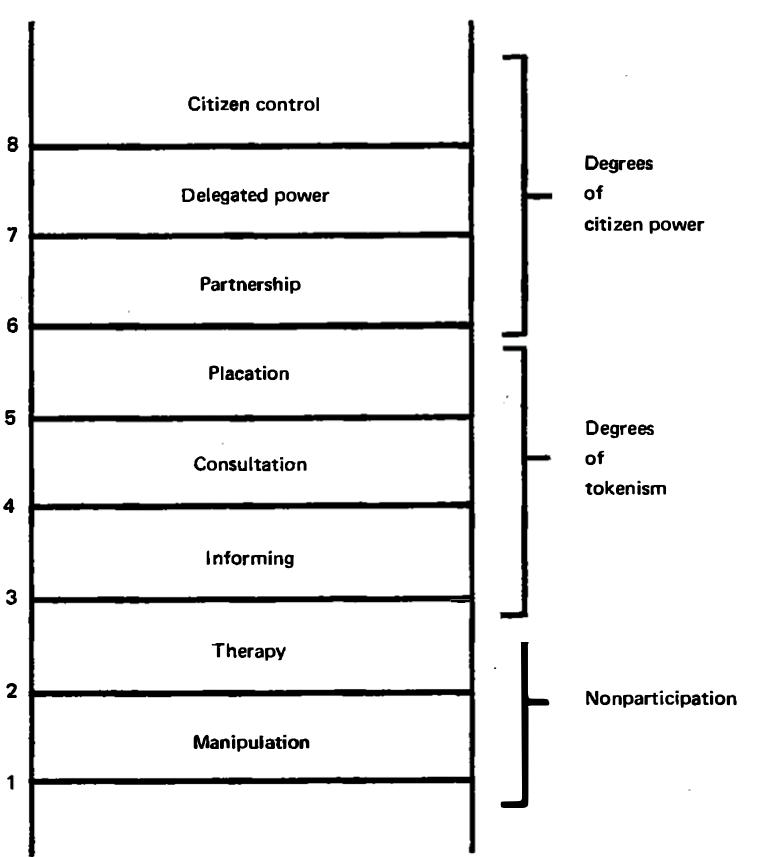
20
grundlegende Untersuchung und Einstufung der Partizipationsprozesse vermittelt. Nach Arnstein erfordert eine echte Partizipation bzw. Beteiligung der Bürger*innen an demokratischen
Prozessen die Umverteilung von Macht: “[...] citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future. [...] In short, it is the means by which they can induce significant social reform which enables them to share in the benefits of the affluent society. [...] participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the powerless“26 (Arnstein, 1969, S.216). Die Beteiligungstiefe entscheidend für die Qualität von Partizipationsprozessen. Dabei setzen erfolgreiche Prozesse eine inhaltliche Mitwirkung voraus: „There is a critical difference between going through the empty ritual of participation and having the real power needed to affect the outcome of the process“ (ebd.). In der Partizipationsleiter werden dazu
Abb. 5 Die Stufen der Partizipation (eigene Grafik basierend auf: Selle, 1996, S.170)
21
unterschiedlich qualitative Stufen der Teilhabe dargestellt, die in drei Ebenen zusammengefasst werden: die unterste Ebene stellt keine Beteiligung dar, die mittlere eine Scheinbeteiligung und die oberste die Bürgermacht. 27 Die untersten Stufen der „Nichtbeteiligung“ umfassen das Desinformieren und Manipulieren sowie das Befrieden, Erziehen und Therapieren. Nach diesen erhalten Bürger*innen lediglich ausgewählte Informationen, um mögliche Bedenken bei geplanten Vorhaben ausräumen zu können. Die nächste Ebene, die „Scheinbeteiligung“, setzt sich aus den Stufen des Informierens, Anhörens und Erörterns sowie der gemeinsamen Beratung und Entscheidung zusammen. In diesen besitzen Bürger*innen zwar eine Stimme in Entscheidungsprozessen, jedoch besteht dabei weder eine verbindliche Berücksichtigung noch ein formeller Einfluss auf diese. Erste Formen von Beteiligung, wie sie in den vorangegangenen Abschnitten formuliert wurden, sind auf dieser Ebene verordnet. Erst in den Stufen der Ebene der Bürgermacht, die aus der Kooperation oder Partnerschaft, dem Einräumen von Kontrollbefugnissen und/oder der Durchführungsmacht sowie dem Delegieren bzw. Institutionalisieren von Entscheidungsmacht besteht, wird „das traditionelle Herrschaftsgefälle zwischen Planern und Betroffenen wesentlich verändert: Mit der Kooperation werden partnerschaftliche Lösungsfindungen versucht und die letzten zwei Stufen beinhalten echte Umverteilung von Planungsmacht – bis hin zur »citizen control«“28 (Selle, 1996, S.170).
Nach Arnstein bilden erst die letzten drei Stufen der Leiter, die unter der Bürgermacht aufgelistet sind, wahre Beteiligung oder Partizipation ab, da erst die direkte Einflussnahme auf Ergebnisse in Entscheidungsprozessen und letztlich auch die Verlagerung von Entscheidungskräften ein bestimmendes Kriterium von echter Partizipation darstellen. Eine Kritik dazu, die von den Wissenschaftlern Kevin Collins und Ray Ison formuliert wurde, ist der hierarchische Aufbau der Partizipationsleiter und die damit einhergehende absolute Delegitimierung der Stufen der Nichtbeteiligung und Scheinbeteiligung: „We [...] suggest that it is in the process of participation that the nature of the policy issue is best
22
determined. The linear conceptualization of participation does little to emphasize the importance of either the process or the existence of feedback loops, which shape understandings of the situation“29 (Collins/Ison, 2009, S.362). Eine weitere Kritik, die sich auf die Delegitimierung der unteren beiden Partizipationsebenen bezieht, bildet die Begrifflichkeit der Partizipationsleiter, denn „die mit der verwendeten Terminologie verbundene Wertung legt das Verständnis nahe, dass nur die auf der Leiter weit oben angesiedelten Verfahren angemessene Formen der Partizipation darstellen und die weiter unten angesiedelten nicht“30 (DAEF, 2016, S.10). Ein Stufenmodell wie nach Arbter, in welchem neutralere Begrifflichkeiten Verwendung finden, „reflektiert stärker die Erfahrungen der Praxis, in der vielfach Beteiligungsformate der einzelnen Stufen miteinander kombiniert werden, um zu einem qualitativ höherwertigen Ergebnis zu gelangen [...]. Denn eine höhere Stufe der Partizipation ist nicht per se die beste Lösung sondern kann nur dann effektiv wirksam werden, wenn sie durch Maßnahmen der unteren Stufen fundiert ist“31 (DAEF, 2016, S.11).
Nichtsdestotrotz würde sich durch die direkte Einstufung der Beteiligungsprozesse nach Arnstein in Stadtentwicklungsprozessen eine Möglichkeit ergeben, um gegen ein Problem der Ausgestaltung von Partizipationsverfahren entgegenzuwirken: Alibibeteiligungen, die nach Arnstein als Scheinbeteiligung zu verstehen sind, finden heutzutage häufig Anwendung. Diese Verfahren der Beteiligung verleihen dem Planungsprozess zwar eine Wertigkeit, ohne diese jedoch zu verändern bzw. beeinflussen32 . Seit dem Partizipation und Beteiligungsprozesse in öffentlichen Planungsvorhaben zu einem obligatorischen Bestandteil und somit institutionalisiert wurden, ist die Durchführung dieser Verfahren mit Tokenismus gleichzusetzen und werden durchgeführt, um benötigte Genehmigungen und Finanzierungen zu erhalten (ebd.). „Participation becomes an organised (and potentially manipulated) part of any regeneration project, in which users are meant to be given a voice, but the process stifles the sound coming out“33 (Bundell Jones/Petrescu/Till, 2005, S. 14). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Begriff Partizipation unkritisch übernommen wird und idealisierte
23
Vorstellungen impliziert, die auf das Konzept des Konsens aufbauen (ebd.). Bei der Partizipation in Planungsprozessen muss insbesondere zwischen den Forderungen der Kund*innen und den Wünschen der Nutzer*innen unterschieden werden. Oft positionieren sich Architekt*innen, die auf Kund*innen mit Macht und Geld angewiesen sind, mit der ideologischen und ökonomischen Vorstellungen dieser und bauen ihre Architekturpraxis darauf aufdurch das Ausschließen der Wünsche der Nutzer*innen wird dabei ein Gefühl der Entfremdung dieser zu ihrer Umwelt ausgelöst34. Das Ausschließen bei der Mitwirkung an Entscheidungsprozessen von Planungsvorhaben schafft in Folge eine Unstimmigkeit zwischen der gebauten Umwelt und den eigentlichen, bedarfsgerechten Anforderungen an diese (ebd.). „Participation effectively addresses this gap through involving the user in the early stages of architectural production, leading to an environment that not only has a sense of ownership but is also more responsive to change“ (ebd.). Um das Gefühl der Zugehörigkeit der Menschen zu ihrer Umwelt zu stärken, bildet die „echte“ Partizipation bzw. Beteiligung dieser an den Räumen, in denen sie leben, eine fundamentale Ausgangsbasis und ist grundlegend für die Förderung der Mitwirkung an Stadtentwicklungsprozessen.
Ein weiterer Grund für das Entstehen von Alibibeteiligungen ist, dass konkrete Ziele eines Planungsvorhaben häufig schon bereits vor dem Partizipationsverfahren festgelegt und unabhängig von den Ergebnissen der Beteiligungsverfahren auch durchgesetzt werden –die Prozesse dienen dabei lediglich dem Befrieden der Konflikte bzw. Beseitigen der Bedenken der Stadtgesellschaft35 (s. Stufe 2 nach Arnstein). Dieses hängt auch mit den rechtlichen Regelungen vieler Beteiligungsverfahren zusammen, denn nur wenige sind gesetzlich festgelegt und setzen keine echte Partizipation – wie auf den letzten drei Stufen nach Arnstein oder der Kooperation nach Arbter –voraus. Auch die Verwendung neutralerer Begrifflichkeiten schafft einen dehnbaren Interpretationsraum, durch welchen Alibi-Verfahren legitimiert werden können. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass in einigen Planungsprozessen die finanziellen und zeitlichen Ressourcen für Beteiligungsverfahren nicht immer genügend
24
einkalkuliert werden, weshalb Planenden oftmals die Zeit und/oder das Geld fehlt, um qualitative Partizipationsprozesse durchführen zu können (s. Interview MitMachBüro). Während der Recherche nach aktuellen, der Öffentlichkeit dienenden Planungsvorhaben in Braunschweig und den Ergebnissen der Beteiligungsprozesse dazu musste ich feststellen, dass diese nur bedingt zurückverfolgbar sind und die Transparenz bei der Kommunikation dieser fehlt. In den meisten Fällen wurde erwähnt, dass Partizipationsprozesse zwar stattgefunden haben, jedoch ohne genauere Ergebnisse zu diesen zu veröffentlichen. Die Intransparenz in diesen Verfahren kann auch dazu führen, dass Prozesse nach ihrer Legitimation und ihrer Handfestigkeit hinterfragt werden, da nicht festzustellen ist, ob diese ausreichend durchgeführt wurden und in Planungsprozesse eingeflossen sind.
Eine Anwendung der Partizipationsstufen nach Arnstein für die Bewertung und Legitimation von Beteiligungsprozessen in Planungsvorhaben würde also bedeuten, dass eben solche Scheinbeteiligungen nicht zulässig wären und verhindert werden können. Damit geht allerdings einher, dass die Planungen solcher Verfahren grundlegend verändert bzw. angepasst werden müssen, da qualitative Partizipationsprozesse insbesondere mit der Bereitstellung von zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen verbunden sind und ohne diese nicht umgesetzt werden können.
25
KO OPE RATI ON ?
26
KOOPERATION IN PLANUNGSPROZESSEN
Allgemeine Einführung und Definition
Für die Planung und Umsetzung von integrierten und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungsprozessen sind Kooperationen von besonderer Bedeutung. Wie in den vorangegangenen Abschnitten erörtert, bilden diese zum einen im Rahmen der Neuen Leipzig-Charta innovative Möglichkeiten, neue Methoden und Herangehensweisen für die Bekämpfung globaler Herausforderungen hinsichtlich der Stadtentwicklungsprozesse zu erarbeiten. Zum anderen bieten sie auch im Sinne der integrierten und bürgernahen Stadtgestaltung im Kontext der Partizipation und Bürgerbeteiligung Optionen, gemeinsam an Prozessen zu arbeiten, Konzepte zu entwickeln und – mit Bezug auf die Stufenmodelle nach Arbter und Arnstein – Partnerschaften zu bilden und Entscheidungskräfte zu verlagern. Bei der Suche nach einer allgemeingültigen Definition von Kooperationen wird schnell sichtbar, dass der Begriff Kooperation diverse Interpretationen beinhalten kann. Je nach Anwendungsbereich, Projekt und kontextueller Gliederung können Kooperationen unterschiedliche Grade und Formen annehmen. Die folgenden Abschnitte dienen einer genaueren Untersuchung des Begriffs im Bereich der partizipativen Stadtentwicklung. Sie setzen sich mit einer allgemeinen Definition, dem Bezug auf die Partizipazionsstufen aus dem vorherigen Abschnitt und einer Vertiefung in verschiedene Projekte, die für ihre Kooperationsformen vom Bund ausgezeichnet wurden, auseinander.
Im stadtpolitischen Kontext lassen sich Kooperationen durch „eine strategische und zeitlich begrenzte Zusammenarbeit auf klar definierten Kooperationsfeldern zwischen gleichberechtigten Personen“36 (Bruns/Lynen/Braun, 2020, S.89) beschreiben. Im Fokus steht dabei das Erreichen gemeinsamer Ziele, die ohne die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten nicht bzw. nicht gut erarbeitet werden könnten. Insbesondere in Kooperationsformen, in denen mehrere Akteur*innen in Prozesse eingebunden sind, besteht
27
ein großes Potenzial für die Erarbeitung neuer Ansätze für den Umgang mit jeweiligen Herausforderungen. Die Beteiligten können ihre Erkenntnisse, Praxiserfahrungen und ihr Fachwissen in die Findung dieser einbauen. Für eine demokratische Stadtgestaltung im Miteinander wird eine erfolgreiche Kooperation zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Initiativen vorausgesetzt, da in diesen Kooperationsformen das Wissen und die Bedürfnisse aller beteiligten Akteur*innen berücksichtigt werden und in die Planungsprozesse einfließen können. Auch hier spricht man von einer „Civicpublic-Partnership“. Wichtig ist dabei allerdings die Unterscheidung von der kollaborativen Arbeitsweise der Koproduktion, da in kooperativen Prozessen Aufgaben unter den beteiligten Partner*innen aufgeteilt und selbstständig erarbeitet werden. Ein weiteres Potenzial, welches durch kooperative Prozesse geschaffen werden kann, ist das Entstehen von neuen Gemeingütern, die für die Allgemeinheit zugänglich sind und eine gerechte Teilhabe am Stadtleben fördern. Diese entstehen durch das Erproben und Schaffen neuer Möglichkeiten des sozialen Ausgleichs, die durch formelle und informelle Prozesse neue Formen der Wissensproduktion und -vermittlung in und zwischen der Verwaltung und der Zivilgesellschaft schaffen (s. Interview mit Kristin Lazarova).
Zuletzt ermöglicht die Anwendung kooperativer Methoden und Werkzeuge in Planungsprozessen das Abflachen von Hierarchien und dadurch einen Austausch auf Augenhöhe. Dieses bildet neben der Neugier, Wertschätzung und dem gegenseitigen Vertrauen zwischen den Akteur*innen die Basis für eine erfolgreiche Kooperation.37 Generell geht es in Kooperationen stets um ein ständiges Lernen voneinander und das Anerkennen der unterschiedlichen, fachspezifischen Wissenshorizonten zur Erarbeitung neuer Formen der Stadtentwicklungs- und Gestaltungsprozessen im Sinne des Gemeinwohls.
In Bezug auf die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Stufen der Partizipation nach Arnstein und die Intensitätsgrade der Beteiligung nach Arbter bilden Kooperationen die intensivsten Stufen der Partizipation ab. Nach Arnstein sind Kooperationen auf den letzten drei Stufen der Bürgermacht und nach Arbter auf der
28
letzten Stufe der Mehrweg-Kommunikation, in der Beteiligte gemeinsam mit der Verwaltung die Planung entwickeln, tief verankert. Die Kooperationsform in diesen Stufen sind in die zuvor genannte „Civicpublic-Partnership“, also der Kooperation in zivilgesellschaftlich-öffentlichen Partnerschaften, einzuordnen. Wichtig ist hierbei eine Differenzierung der Kooperation in Beteiligungsprozesse und kooperative Planungsprozesse in der Stadtentwicklung, denn „der Begriff Beteiligung beinhaltet immer ein Machtgefälle, weil es einem Akteur obliegt, andere zu beteiligen und damit Vorentscheidungen zu Zeitpunkt, Fragestellung und die Einflussmöglichkeiten zu treffen. Während dieses Vorgehen in formellen und einigen informellen Punkten aus Sicht der Planung zu rechtfertigen ist, ist genau dieser Aspekt aber ein entscheidender Unterschied zu kooperativen Planungsprozessen“38 (Tribble, 2023, S.49f). In diesen gelten (wie bereits definiert) die transparente Kommunikation der Informationen, die Stellungen der Beteiligten sowie das Ermöglichen von Einflussnahme als wesentlich zwischen Planenden, Bürger*innen und weiteren beteiligten Akteur*innen zur Erarbeitung „eines geteilten gemeinsamen Wissens als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage“ (Tribble, 2023, S.50). Zu kooperieren bedeutet also nicht, einseitig an Planungsvorhaben zu arbeiten, sondern meint das gemeinschaftliche Erarbeiten von Planungsprozessen – bei bereits bestehenden Vorplanungen sollte über diese transparent informiert und eine Überarbeitung oder Ergänzung der „gemeinsamen Entscheidungsgrundlage“ ermöglicht werden.39 Wie zuvor erwähnt, ist in Kooperationen das Auflösen von hierarchischer Strukturen elementar, Beteiligte sind in diesen Prozessen gleichgestellt und Interessen und Belange werden in gleichem Maße berücksichtigt. Eine transparente Kommunikation ist ebenso essentiell für einen optimalen Informationsfluss untereinander, wie auch das Ausgleichen von Machtverhältnissen unter den beteiligten Partner*innen, da die Verlagerung bzw. Aufteilung von Entscheidungsmacht als grundlegend für eine erfolgreiche Kooperation gilt.40
29
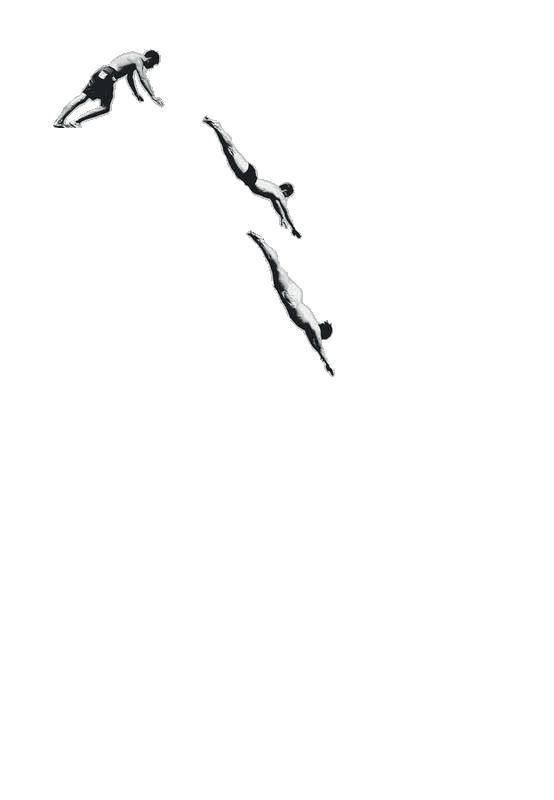

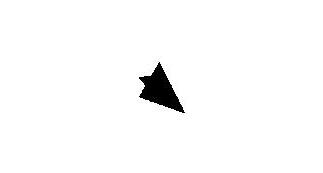

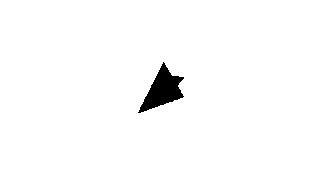












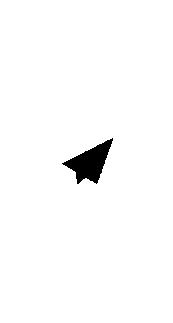
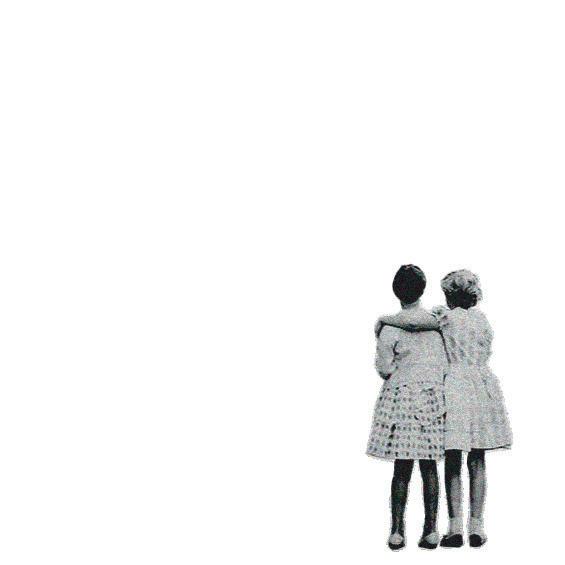


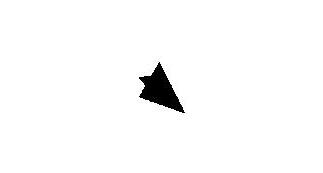
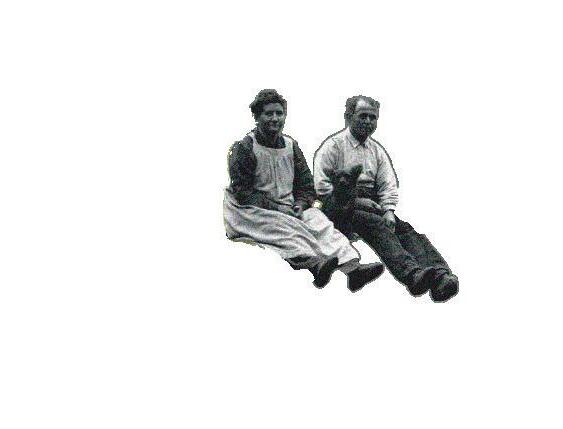
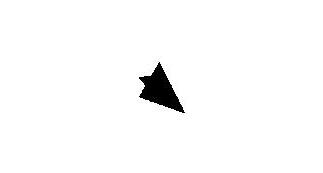

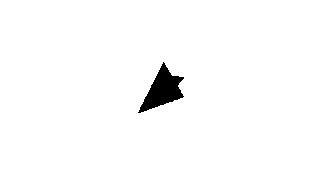
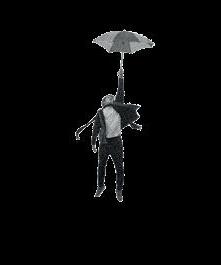
PLAAAN


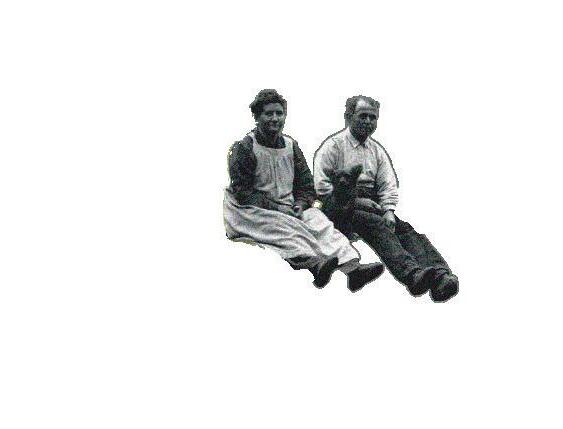
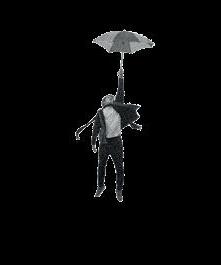

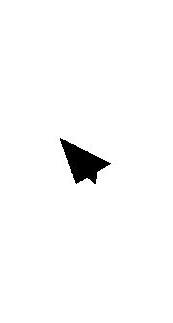

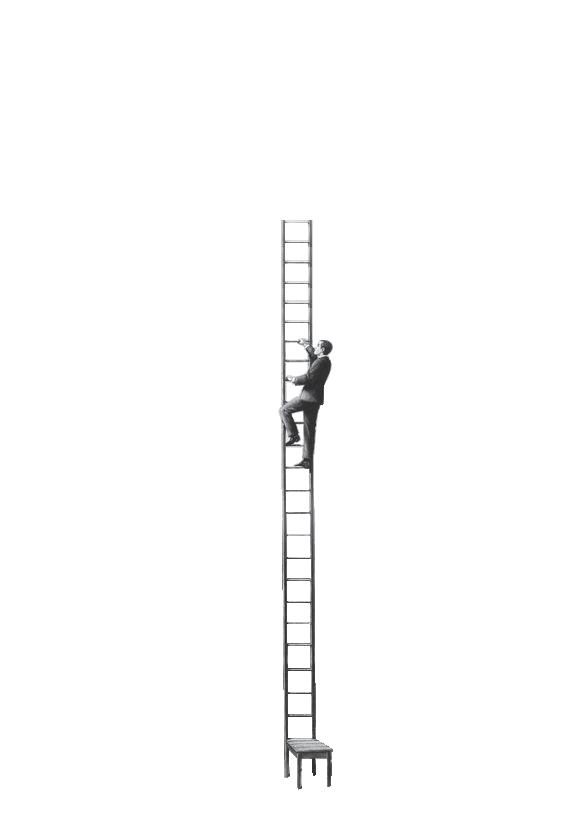

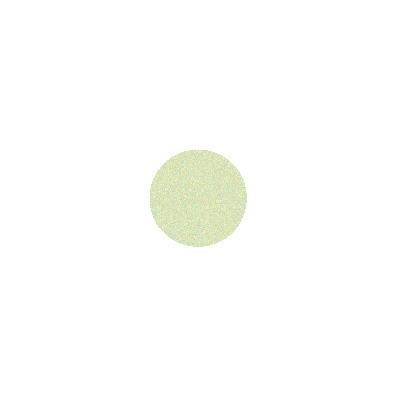


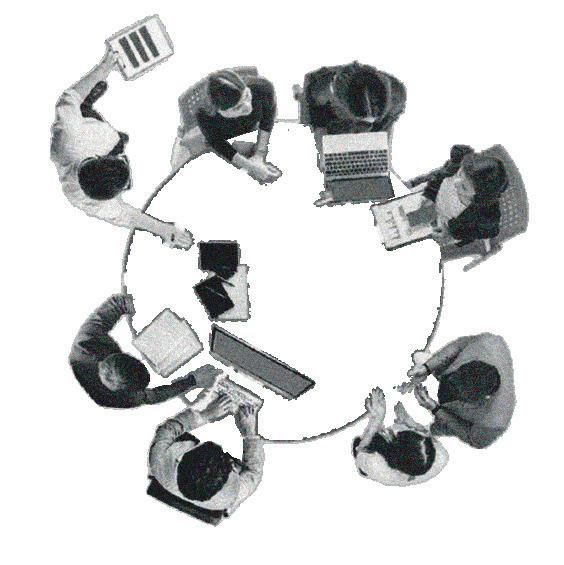

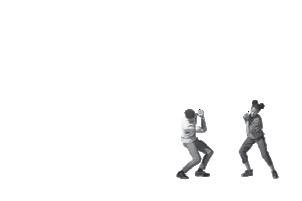
31
KO OPE RATI VE STADT
32
KOOP.STADT
Bundespreis Kooperative Stadt
Im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik wurde 2021 erstmals der „Bundespreis für kooperative Stadt“ ausgelobt, mit dem die Kommunen ausgezeichnet wurden, die die Arbeit von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen und soziokulturellen Akteuren aktiv fördern und somit zur Stärkung der Mitwirkung und Mitgestaltung des urbanen Raumes beitragen. Hierbei wurden jene Projekte ausgezeichnet, welche die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft mit dem Ziel fördern, rechtliche, politische und strukturelle Rahmenbedingungen zu setzen, sodass Kooperationen auf verschiedenen Ebenen entstehen und die neuen Möglichkeiten dieser kooperativen Planungsprozesse sichtbar werden.41
„Die Idee des Bundespreises kooperative Stadt beruht auf der Erfahrung, dass ein konstruktives Miteinander auf Augenhöhe noch längst nicht in jeder Kommune Realität ist. Für Stadtmacherinnen und Stadtmacher ist es oft schwer, die richtige Ansprechpartnerin in der Verwaltung zu finden oder sich im allgemeinen Dickicht der Verordnungen und erforderlichen Genehmigungen zurechtzufinden.
[...] Der Bundespreis lenkt den Blick auf Geschichten des Gelingens, unkonventionelle Werkzeuge der Zusammenarbeit und mutige Wegbereiterinnen und Wegbereiter in den Verwaltungen deutscher Städte. Die Sammlung der Werkzeuge und Instrumente soll Mut machen, Stadt gemeinsam zu gestalten.“42 (Svenja Noltemeyer, zitiert in KOOP.STADT, 2021, S.9)
Um ein besseres Verständnis von Kooperationen in der Praxis zu bekommen, werden in den folgenden Abschnitten zum einen die Bausteine der kooperativen Stadt nach der KOOP.STADT erläutert, die für das Ermöglichen von kooperativen Planungsprozessen grundlegend sind, und zum anderen die Aktionsfelder dargestellt, in denen die Projekte der KOOP.STADT verordnet sind. Die Diversität des Begriffs der Kooperationspiegelt sich durch die Einordnung der
33
Projekte in die unterschiedlichen Kooperationsbereiche wieder. Die diversen Möglichkeiten der Kooperation finden auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt und machen sichtbar, wie umfangreich die Formen für die Mitwirkung an Planungsvorhaben sein können. Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass die kooperative Stadt sich durch eine Vielzahl an Aktivitäten auszeichnet, welche zusammen eine neue Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Stadtmacher*innen ermöglichen.43 Bei einem ersten Versuch allgemeingültige Kriterien für Kooperationen zu erarbeiten, hat sich herausgestellt, dass diese durch die umfangreiche Anwendung in unterschiedlichen Planungsprozessen zunächst schwer zu definieren sind. Je nach Art, Form sowie lokalpolitischen und strukturellen Gegebenheiten ergeben sich sehr spezifische Kooperationen, die durch weitere Entwicklungen innerhalb von Prozessen als beweglich, wachsend und/oder schrumpfend zu verstehen sind – sie sind also anpassungsfähig. Aus diesem Grund bilden die nachfolgend dargestellten Analysen einen Zwischenstand der Prozesse ab. Sie sind also als eine Art Momentaufnahme von Kooperationsprozessen zu verstehen. Die Prozesse wurden daraufhin auf ihre zeitliche Abfolge, Impulse, die die Kooperationsprozesse angestoßen haben, eine obere „tragende“ bzw. ermöglichende Struktur, die einen gewissen Rahmen vogibt und darauf aufbauende konkrete strategische Maßnahmen untersucht. Zuletzt wurden die für die Umsetzung der Maßnahmen relevanten kooperativen Instrumente und Methoden ermittelt, die in einem komplexen System zusammenhängen und teils voneinander abhängig sein können. Eine tiefergreifende Analyse wurde mittels der Case-Studies und geführten Interviews durchgeführt, die im darauffolgenden Kapitel thematisiert wird und ergänzend zu den Voruntersuchungen den Zustand der Verstetigung ermittelt. Die Prozessdiagramme wurden dabei auf weitere fehlende Komponenten untersucht.
Eine allgemeine Grundlage, die für alle kooperativen Projekte gilt, ist, dass sich generell die Grundhaltung gegenüber Stadtmacher*innen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen ändern muss44, da Kooperationen bereits hier ansetzen und darauf aufbauen.
34
KOOP.STADT
Bausteine Grundlegend für die Schaffung einer neuen Kooperationskultur ist, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen so verändern, dass sie die Realisierung der neuen und überwiegend experimentellen Vorhaben ermöglichen.45 Um einen Überblick über diese zu schaffen, werden in der KOOP.STADT drei Sphären46 definiert, die dafür relevant sind:
// politisch
Ein aktives Einbeziehen der Stadtmacher*innen in die Gestaltung der Stadt ist eine Haltungsfrage von Seiten der Stadt und somit politisch. Eine grundlegende kooperative Haltung, das Festlegen einer gemeinsamen Handlungsgrundlage und die rechtliche Verankerung der Kooperation mittels eines Leitdokuments ist essenziell für die Realisierung dieser. Stadtmacher*innen erhalten dadurch die Legitimation ihrer Praxis und zugleich wird ein rechtlicher Rahmen für die Stadt geschaffen, um neue Formate der Planung zu ermöglichen und Kooperationsinstrumente zu stützen.
// strukturell
Neue Formen des Zusammenarbeitens der Stadt und Zivilgesellschaft gehen mit unkonventionellen Anfragen an die Verwaltung einher. Dafür müssen ausreichend zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen eingeplant und bestehende Strukturen ergänzt und erweitert werden. Die Schaffung eines niedrigschwelligen, dritten Raumes zwischen der Verwaltung und Zivilgesellschaft kann dabei Verwaltungsstrukturen entlasten.
// rechtlich
Für die Legitimation unkonventioneller Anfragen des kooperativen Stadtmachens braucht es ebenfalls passende rechtliche Rahmenbedingungen. Ohne die Anpassung rechtlicher Grundlagen können kooperative Formen der partizipativen Stadtgestaltung nicht realisiert und erprobt werden.
35
KOOP.STADT
Aktionsfelder
Die Instrumente des kooperativen Stadtmachens sind sehr vielschichtig und können in ihrer Komplexität und Verzahnung miteinander in verschiedene Bereiche der Planungsprozesse greifen. Um eine praxisnahe Übersicht zu schaffen und die Anwendung dieser zu kategorisieren, werden in der KOOP.STADT fünf Aktionsfelder definiert47, denen die Projekte untergeordnet sind. Im Rahmen dieser Arbeit werden Projekte vertiefend betrachtet, die in den Aktionsfeldern, auch Spektren genannt, „Offene Planung“ und „Neue Schnittstellen“ angesiedelt sind.
OFFENE PLANUNG
Offene Planungsprozesse schaffen einen frühen Zugang zu bevorstehenden Planungsvorhaben und ermöglichen das Beteiligen und aktive Mitgestalten an diesen Prozessen. Durch die Öffnung dieser Vorhaben entsteht ein Möglichkeitsraum für aktive Stadtmacher*innen sich frühzeitig zu beteiligen und gemeinsam an integrierten und gemeinwohlorientierten Konzepten und Planungen zu arbeiten.48
Stadtmachen-Prozess/ Koproduktive Planung/ StadtteilAkupunktur/ Flächenentwicklungsbeirat
NEUE SCHNITTSTELLEN
Die Einrichtung neuer Schnittstellen zwischen der Stadtverwaltung, Eigentümer*innen und der Zivilgesellschaft ermöglicht neue Formen des Zusammenarbeitens. Durch niedrigschwellige Anlauf- oder Vermittlungsstellen können neue Kooperationen erprobt und gefördert werden.49
Raumbörse/ Netzwerk Baugemeinschaften/ Tiny Rathaus/ Engagement-Büro
36
GEMEINSAM ENTSCHEIDEN
Kooperationen schaffen durch das Auflösen von hierarchischen Strukturen einen Austausch auf Augenhöhe und ermöglichen dadurch das gleichwertige Berücksichtigen der Belange und Interessen beteiligter Akteur*innen in Planungsprozessen.50
Bürgerrat/ Kinder- und Jugendparlament/ Stadtteilforum/ Partizipatives Budget/ Zukunftsrat
RÄUME ÖFFNEN
Ungenutzte Flächen und Räume, die für Stadtmacher*innen unzugänglich erscheinen, können durch die Kombination bestimmter rechtlicher und kooperativer Methoden geöffnet und für gemeinwohlorientierte Nutzungen und Planungen nutzbar gemacht werden.51
Innenstadt-Impulse/ Pioniernutzungen/ Kooperative Konzeptplanung/ Überlassungsvertrag/ Erbbaurecht für Stadtmacher/ Bodenfonds für das Gemeinwohl
TRÄGERMODELLE
Einige Planungsvorhaben bedürfen besondere Formen der Organisations- oder Finanzierungsform zur Vereinfachung bestimmter Prozesse. Ebenso relevant ist die Schaffung robuster Strukturen für eine gute und zukunftsfähige Zusammenarbeit zwischen beteiligten Partner*innen.52
Kooperationsvereinbarungen/ Quartiersmanagement von unten/ Civic-Public-Partnership/ Bürgergenossenschaft/ Dachgenossenschaft/ Ko-Finanzierung
37
OFFENE
STADTMACHEN-PROZESS
Im Stadtmachen-Prozess arbeiten Kommunen zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und Stadtmacher*innen gemeinsam an Planungsvorhaben. Für die Umsetzung dieser ist eine Kombination verschiedener kooperativer Instrumente von besonderer Bedeutung. Der Prozess beginnt damit, dass Planungsvorhaben für die Mitwirkung von beteiligten Akteur*innen geöffnet und zugänglich gemacht werden. Dieser Schritt kann zusammen mit dem Anerkennen von zivilgesellschaftlichen Initiativen als Projektentwickler*innen und eines Vergabeverfahrens nach dem Prinzip der Konzeptvergabe von öffentlichen Grundstücken, die nicht für den Gemeinbedarf genutzt werden, eine sogenannte tragende/obere Struktur der Kooperationsstruktur bilden. Die Ausführung der daraus resultierenden Maßnahmen und Instrumente können ohne die Prozesse der obene Struktur nicht ermöglicht werden. Grundstücke können durch diese Schritte für die Stadtgesellschaft geöffnet und Aufgaben der Konzept- und Projektentwicklung an Initiativen und Gruppen delegiert werden, die sich aktiv und intensiv mit lokalen, gemeinwohlorientierten Themen auseinandersetzen. Die darauffolgenden Maßnahmen können sich zum einen aus der frühzeitigen Beteiligung – also das Ermitteln der Interessen vor der städtebaulichen Qualifizierung – und der gemeinsamen Erarbeitung der besten Idee unter der Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Kriterien für das Quartier, die noch vor dem besten Gebot stehen, zusammensetzen. Zum anderen zählen hier auch weitere Instrumente wie eine transparente, dynamische Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Stadtmacher*innen beim formellen Grundstücksvergabeverfahren und das gemeinsame Arbeiten an Entwicklungskonzepten mit bzw. durch Initativen, die zu Beginn als Projektentwickler*innen anerkannt wurden, dazu. Die Maßnahmen können durch die Anwendung kooperativer Instrumente der koproduktiven Planung, die Bildung von Partnerschaften mit der Stadtgesellschaft, eine frühzeitigen, breiten Beteiligung der Öffentlichkeit und das Ergänzen mit niedrigschwelligen Formaten stärken bzw. realisieren lassen.53
38
PLANUNG
KOPRODUKTIVE PLANUNG
Die koproduktive Planung oder auch das Community-based-Design zielen auf das gemeinsame Planen der Konzept- und Projektentwicklung mit den zukünftigen Nutzer*innen eines Planungsvorhabens ab. Grundlegend für diesen Prozess ist eine frühzeitige, breite Beteiligung interessierter Stadtmacher*innen, die zugleich aktiv Druck bzw. Impulse für die Mitwirkung an öffentlichen Bauvorhaben ausüben und anstoßen können, um die Mitgestaltung mitunter zu forcieren. Für die gemeinsame Planung müssen beteiligte Stadtmacher*innen sich mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen, technischen Informationen und der baurechtlicher Genehmigungsfähigkeit auseinandersetzen. Diese bilden die obere Struktur ab und können durch weitere Maßnahmen wie der Wissensvermittlung durch fachliche Expert*innen und eine verständliche Kommunikation der Aufgaben – und der Aufbrechung dieser in Bestandteile – ergänzt werden. Gleichzeitig können das Wissen, die Erfahrungen und insbesondere die lokale Expertise der Stadtmacher*innen in den Planungsprozesse mit einfließen und dabei die Ermittlung und Berücksichtigung der Bedarfe zukünftiger Nutzer*innen ermöglichen. Durch den gemeinsamen Gestaltungsprozess kann so stufenweise die Entscheidungs- und Handlungsmacht übertragen werden. Bedeutsam ist ebenfalls eine stetige, transparente Kommunikation untereinander und die Abflachung hierarchischer Strukturen für einen Austausch auf Augenhöhe. Folglich kann so der Gemeinschaftssinn gestärkt und die Identifikation mit dem Projekt gefördert werden. Das Ziel der koproduktiven Planung ist, die Energie und Erfahrung, das Wissen und die lokale Expertise der Beteiligten in Planungsprozesse einfließen zu lassen und zusammen an integrierten Konzepten und Entwürfen zu arbeiten.54
39
40
41
42
43
STADTTEIL-AKUPUNKTUR
Die Stadtteil-Akupunktur zielt auf ein punktuelles Anwenden von gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen an genau den Orten, wo sie gebraucht werden, ab. Dieser Prozess kann beispielsweise durch einen politischen Beschluss festgelegt werden, um die Strategie der lokalen Stadterneuerung als Interventionsmethode zu verfolgen. Das Arbeiten im Sinne einer Akupunktur braucht eine gezielte Steuerung der Maßnahmen und Prozesse. Insbesondere kurze Abstimmungswege, die mithilfe einer Steuerungsgruppe, bestehend aus Führungspersonen relevanter Fachbereiche der Stadt, dem Quartiersmanagement, aktiven Initiativen und evtl. auch städtebaulichen Baugesellschaften, erarbeitet und umgesetzt werden können. Eine gemeinsame Trägerstruktur kann zudem weitere Prozesse wie das Beantragen von Fördermitteln, die Vergabe von Leistungen und generell die Umsetzung von Projekten vereinfachen. Strategisch wird bei der Stadtteil-Akupunktur die Aktivierung von Selbstheilungskräften eines Quartiers angestrebt. Die Selbstheilungskräfte können durch kleine, wirkungsvolle und insbesondere kurzfristige Veränderungen angestoßen werden und dabei bereits vorhandene lokale Strukturen stärken. Zur Erarbeitung und Realisierung dieser Maßnahmen sind Instrumente wie das Ausarbeiten konkreter Handlungsfelder zusammen mit Stakeholdern und die aktive Einbindung der Stadtgesellschaft in Planungsprozesse relevant. Standardisierte Planungsprozesse können dabei durch die Stadtgesellschaft überprüft und angepasst werden. Gleichzeitig kann dabei die Verantwortungsübernahme durch lokale Akteur*innen stattfinden und diese besser in Prozesse eingebunden werden. Auch hier ist ein stetiger Austausch zwischen der Stadtverwaltung, dem Quartiersmanagement und lokalen Akteur*innen von großer Bedeutung. Die Stadtteil-Akupunktur wirkt lang andauernden Prozessen der Konzeptentwicklung entgegen und strebt eine bedarfsgerechte Entwicklung von Stadtteilen und Quartieren an.55
44
FLÄCHENENTWICKLUNGSBEIRAT
Potenziell nutzbare Flächen werden in Städten immer knapper, was zu einer wachsenden Flächenkonkurrenz führt. Dazu können unterschiedliche Vorstellungen einer Flächenentwicklung weitere Konflikte auslösen deren Entwicklung erschweren. Die Gründung eines Flächenentwicklungsbeirats kann beispielsweise durch die Entscheidung der Kommune oder Gemeinde initiiert werden. Dieser kann als Vertretung aller Parteien, die Berücksichtigung der Interessen überwachen und somit einen konfliktarmen, kollaborativen Entwicklungsprozess ermöglichen. Strategisch gesehen dient der Beirat als Vermittlungsstelle zwischen den Eigentümer*innen, Investor*innen, Stadtmacher*innen und der Stadtverwaltung und kann durch eine externe Moderation oder ein Planungsbüro unterstützt und begleitet werden. Die getroffenen Maßnahmen lassen sich durch die Verknüpfung mehrerer kooperativer Instrumente realisieren: Zum einen kann eine stufenweise Herangehensweise und die Ausarbeitung gemeinsamer Vorstellungen im Dialog angestrebt werden, um die unterschiedlichen Ideen und Haltungen für die Nutzung einer Fläche zu sammeln. Zum anderen ist die Beteiligung aller relevanten Akteur*innen für die Erarbeitung der Interessensvielfalt einer Fläche erforderlich. Wichtig ist bei diesen Prozessen eine konsensorientierte Grundhaltung aller Beteiligten und eine stetige, transparente Kommunikation untereinander. Mithilfe des moderierten Verfahrens kann außerdem ein konsensfähiger Plan erarbeitet und als informelles Kommunikationsinstrument für weitere Entscheidungsprozesse genutzt werden – das Verfahren ist dabei keinem formellen Verfahren der Bauleitung zuzuordnen, sondern nimmt die Funktion der Vermittlung und Beratung an. Die dabei entstehenden Kosten sollten bestenfalls von den Eigentümer*innen selbst getragen werden, denn Stadtmacher*innen investieren bereits ehrenamtlich ihre Zeit in diese Prozesse, wohingegen die restlichen Akteur*innen die Möglichkeit haben, über ihre professionelle Tätigkeit an diesen Verfahren mitzuwirken.56
45
46
47
48
49
SCHNITT
RAUMBÖRSE
Die Suche nach nutzbaren Freiräumen in der Stadt kann für kreative Stadtmacher*innen eine große Herausforderung darstellen. Um dem Bedarf entgegenzukommen und potenziell nutzbare Stadträume sichtbar zu machen, können Städte und Kommunen sich mit freien Initiativen, Vereinen, kreativen Akteur*innen und der Verwaltung zusammenschließen und gemeinsam ein (Frei-)Raumkonzept erarbeiten. In diesem Zuge entstand die Idee eines „Raumagenten“, also einer Raumbörse, welche die Suche nach den nutzbaren (Frei-)Räumen erleichtert und diese in der Stadt sichtbar macht. Die Raumbörse übernimmt dabei die Vermittlungsfunktion zwischen kreativen Akteur*innen, der Verwaltung und den Eigentümer*innen. Für die Planung und Ausarbeitung des Konzepts ist es wichtig, dass die Verwaltung zusammen mit den kreativen Akteur*innen und Stadtmacher*innen koproduktiv und im regelmäßigen Dialog arbeitet und dabei vorhandene Netzwerke und Strukturen berücksichtigt und mit einbezieht. Eine Beteiligung bereits im Anfangsstadium ist essenziell für die Planung. Durch den regelmäßigen Austausch in Form von runden Tischen können zudem aktuelle und konkrete Themen besprochen und Konflikte gemeinsam gelöst werden. In diesen sollten auch verschiedene Bereiche der Verwaltung vertreten sein, um einen transparenten Informationsfluss zwischen den Beteiligten zu schaffen. Die Umsetzung der Raumbörse kann zu Beginn prototypisch erprobt und unter realen Bedingungen durch Testobjekte optimiert werden. Durch die Vermittlerstelle kann zudem Wissen produziert und zentral gesammelt werden, um gleichzeitig eine beratende und unterstützende Anlaufstelle für kreative Stadtmacher*innen zu schaffen. Beispielsweise können durch die Erarbeitung von flexiblen Musterverträgen standardisierte Nutzungsvereinbarungen getroffen werden, um die entstehenden Kooperationen durch verbindliche Rahmenbedingungen festzulegen und Antragstellungen zu vereinfachen. Eine Raumbörse bringt das Potenzial mit sich, die freie Kunst- und Kulturszene zu stärken und die Arbeit von Vereinen, freien Initiativen und Kollektiven zu fördern. Zusätzlich kann dabei zivilgesellschaftliches Engagement angeregt und gefördert werden.57
50
STELLEN
NETZWERK BAUGEMEINSCHAFTEN
Immer mehr Menschen suchen nach neuen Alternativen für gemeinschaftliche Wohnformen in urbanen Räumen. Baugemeinschaften bieten dabei eine Möglichkeit, Wohneigentum selbst zu nutzen und bezahlbaren Wohnraum (in Städten) zu schaffen. Als relevante Akteur*innen für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung bieten Baugemeinschaften unter anderem besondere Lösungen für schwer zu vermarktende Grundstücke, sodass sie die Vielfalt von Nachbarschaften fördern und diese dadurch gleichzeitig stärken. Städte und Kommunen können diese Wohnformen fördern und unterstützen, indem sie kollektive Baugemeinschaften durch die Initiierung einer Kontaktbörse sichtbar machen und damit die Wichtigkeit dieser hervorheben. Auch die Berücksichtigung bei der städtischen Wohnungsflächenvergabe, nach dem Prinzip eines Konzeptvergabeverfahrens, ist für die Unterstützung dieser Wohnform wichtig. Das Sichtbarmachen von Baugemeinschaften lässt sich durch die Stärkung des Wiedererkennungswertes und den Aufbau einer festen Community fördern, weshalb dieser Prozess auch auf die Mitwirkung von Mitgliedern von bereits bestehenden Baugemeinschaften und interessierten Personen angewiesen ist. Dieser Schritt kann zudem durch das Organisieren von Inputvorträgen, diskursiven Austauschformaten und Vernetzungstreffen ergänzt werden. Über solch eine Kontaktbörse, die analog und digital aufgebaut sein kann, wird die Nachfrage von potenziellen Bauherr*innen zentral gebündelt und zugänglich gemacht. Die Verwaltung kann dabei eine feste, kommunale Koordinierungs- und Anlaufstelle einrichten und zugleich interessierten Personen, durch die Bereitstellung einer Informationsdatenbank, unterstützend und beratend zu Inhalten der finanziellen und rechtlichen Fördermöglichkeiten zur Seite stehen. Auch in diesem Prozess ist ein transparenter Informationsfluss, mit regelmäßig aktualisierten Informationen von großer Bedeutung. Durch die Förderung von Baugemeinschaften können Menschen dazu befähigt werden, eigenständig an der Gestaltung der Stadt und ihrer Nachbarschaft mitzuwirken.58
51
52
53
54
55
TINY RATHAUS
Das Tiny Rathaus ist eine mobile Version des Rathauses in der Stadt und bildet einen dritten, niedrigschwelligen Raum zwischen der Verwaltung und der Stadtgesellschaft. Die ersten Impulse für die Idee des mobilen Rathauses wurden von kreativen Akteur*innen geliefert. Gestützt wurden diese durch einen bereits im Vorhinein beschlossenen Ratsbeschlusses, der eine Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Bildung des Referats „Kreative Stadt“ vorsieht. Ziel des Tiny Rathauses ist, die Herausforderungen der Stadtentwicklung gemeinsam mit Stadtmacher*innen anzugehen und auf Augenhöhe zu agieren. Die bürgernahe Anlaufstelle kann bestenfalls für Verwaltungsabläufe entlastend wirken. Mithilfe von Fördermöglichkeiten durch die Stadt können die Kosten für die Entwicklung des Konzepts und der Bau eines Protoyps zunächst gedeckt werden. Für die Umsetzung ist – neben der gemeinsamung Planung des mobilen Rathauses mit relevanten Akteur*innen im Anfangsstadium – insbesondere eine erste interne Konzeptentwicklung durch ein ko-kreatives Verfahren innerhalb der Verwaltung notwendig, um anschließend die Verwaltungsabläufe im Rahmen einer Testwoche unter realen Bedingungen zu prüfen und zu optimieren. In diesem Rahmen wird auch die Annahme von Seiten der Stadtbewohner*innen getestet und ein Raum für Feedback, Kritik und Wünsche geschaffen. Begleitend stattfindende Veranstaltungen mit fachlichen Expert*innen können einen Wissenstransfer anregen. Das mobile Rathaus dient als Testlabor im öffentlichen Raum und kann als permanenter Probe- und Umsetzungsraum zum Beispiel für frühzeitige Beteiligungen, zur Vernetzung oder für die Vorstellung innovativer Projekte genutzt werden. Kennzeichnend dabei sind der dezentrale Bürgerkontakt und der Austausch auf Augenhöhe. Mit dem Tiny Rathaus können gemeinsam mit der Stadtgesellschaft neue Methoden und Lösungen für komplexe Herausforderungen der Stadtentwicklung erforscht werden, indem Bürger*innen die Möglichkeit erhalten, in offenen Gesprächen kreative Impulse zu liefern oder Kritik zu äußern.59
56
ENGAGEMENT-BÜRO/MITMACHBÜRO
Die Einrichtung eines MitMachBüros kann das Engagement und die Beteiligung einer Stadtgesellschaft für integrierte Planungsprozesse und die Mitwirkung an der Gestaltung einer Stadt fördern, wodurch die lokale Demokratie und Teilhabe gestärkt wird. Dies geschieht durch ein neues Zusammenspiel von kommunalpolitischen Entscheidungsfindungen, Bürgerbeteiligungen, bürgerschaftlichem Engagement und Verwaltungshandeln. Mithilfe der Unterstützung aus dem Förderprogramm „Engagierte Stadt“ können Politik, Verwaltung, Wirtschaftsakteur*innen und die Stadtgesellschaft gemeinsam eine neue Leitlinie für die Förderung des Engagements in einer Stadt erarbeiten. Aus diesem geht die Einrichtung einer offiziellen zentralen Anlaufstelle hervor, die mittels Ratsbeschluss umgesetzt werden und die Mitwirkung an der Stadtgestaltung fördern kann. Die Anlaufstelle sollte zentral liegen, um als Vermittlungsstelle zwischen der Verwaltung und Stadtgesellschaft agieren zu können. Sie übernimmt somit eine Scharnierfunktion zwischen den Beteiligten des öffentlichen Dienstes und der Zivilgesellschaft. Durch die direkte Andockung an die Verwaltung können zudem kurze Abstimmungswege geschaffen werden, die einen transparenten Informationsfluss ermöglichen. Das Büro bietet einen niedrigschwelligen Zugang zu den Themen Beteiligung und Stadtmachen. Mithilfe von Fördermitteln, die durch die Stadtverwaltung und weiteren Förderprogrammen bereitgestellt werden, können Beteiligungsprozesse gefördert, Konzeptentwicklungen oder Fördermittelakquisen unterstützt und kreative Akteur*innen gezielt an die zuständigen Fachbereiche der Verwaltung vermittelt werden. Gleichzeitig bietet der Raum eine Präsentationsfläche für kommunale Planungsvorhaben der Stadt und kann diese analog und digital mit der Stadtgesellschaft kommunizieren. Die Zentralität ist insbesondere für die Sichtbarkeit und Präsenz des Büros relevant und schafft einen Raum für Vernetzung, Austausch, Weiterbildungen und weitere Diskursformate.60
57
58
59
60
61
CASE STU
62
DIES
63

Tiny Rathaus
64

65
CASE-STUDIES
Tiny Rathaus
Das Tiny Rathaus ist ein Rathaus auf Rädern und schafft einen mobilen Raum zwischen der Verwaltung und der Kieler Stadtgesellschaft. Es öffnet einen Raum für Vernetzung und Dialoge, schafft eine Präsentationsfläche für innovative Projekte, aber auch einen Raum, in dem neue Dinge ausprobiert, mit neuen Formaten experimentiert und voneinander gelernt werden kann. Eine bürgernahe Stadtverwaltung bekommt durch das Tiny Rathaus eine ganz neue Bedeutung, denn: Das Tiny Rathaus ist mobil, es besucht zwischen Juni und Oktober mehrere Standorte in Kiel und sorgt somit für einen dezentralen Bürgerkontakt. Nicht die Stadtgesellschaft geht in das Rathaus, sondern das Rathaus rollt zu der Stadtgesellschaft und ist durch den umfunktionierten, türkisfarbenen Bauwagen sichtbar und präsent. Entwickelt wurde das Konzept des Tiny Rathauses durch das Kreativzentrum
Anscharcampus - aus welchem auch die ersten Impulse dazu angestoßen wurden - der Landeshauptstadt Kiel, dem Referat Kreative Stadt, der Stabsstelle Digitalisierung und der Koordinierungsstelle für Bürger*innenbeteiligung.
Zum Zeitpunkt eines Besuches vor Ort stand das Tiny Rathaus auf dem Rathausplatz und war, wie dem Bild zu entnehmen ist, vor dem eigentlichen Rathausgebäude. An dem Tag wurde der mobile Raum von mehreren Akteur*innen bespielt: Vor Ort waren Ansprechpersonen der Fortbildungsakademie der Wirtschaft und zu einem späteren Zeitpunkt gab es eine Bürger*innensprechstunde mit einer Landtagsabgeordneten auf dem öffentlichen Platz. Das Tiny Rathaus bietet den Raum für verschiedene Zwecke an und kann mittels freier Bewerbungen gebucht werden. Der Raum kann darüber hinaus als Bühne funktionieren, um Projekte, Vorhaben und Innovationen vorzustellen, als Werkstatt umgenutzt werden, in der Workshops, Aktionen und Beteiligungen durchgeführt werden, oder sich in eine ruhige Stube umwandeln, in dem Gespräche und Dialoge stattfinden können.
66


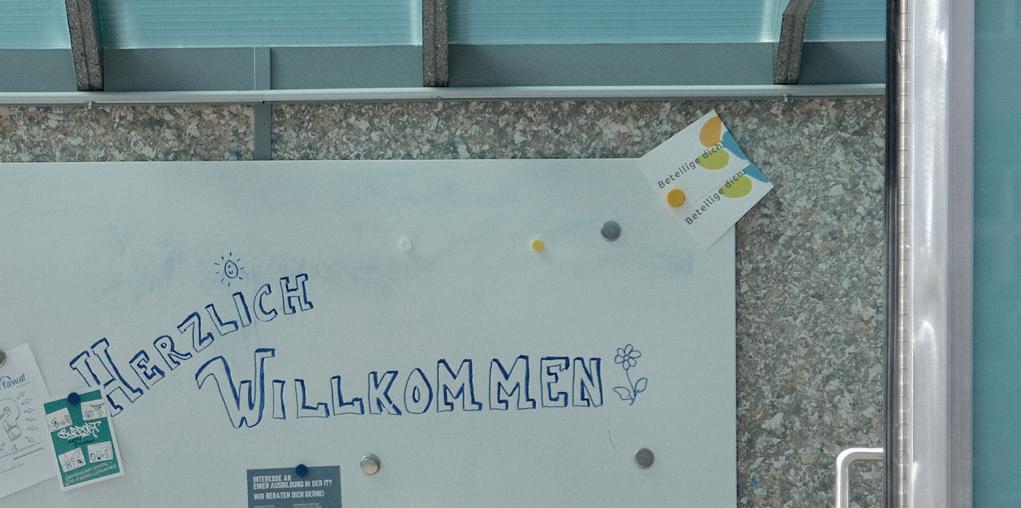


In einem ersten Prozessdiagramm des Tiny Rathauses, welches auf den vorherigen Seiten dargestellt ist, wurden mittels der Recherchen aus der Publikation KOOP.STADT Prozessschritte erarbeitet, aus der bereits eine obere Struktur ermittelt wurde. Die definierten konkreten Maßnahmen und die darauf aufbauenden kooperativen Instrumente, die für die Umsetzung dieser relevant sind, wurden im nächsten Schritt durch ein Gespräch mit der Initiatorin des Tiny Rathauses und der Community Managerin überprüft und ergänzt. Des Weiteren ist im Anschluss auf das aktualisierte Prozessdiagramm eine collagierte Darstellung des darauf aufbauenden Kooperationsgerüsts zu finden, welches als weiteres Instrument dazu dienen soll, Kooperationsprozesse und ihre Eigenschaften sichtbar und zugänglicher zu machen. Für die Untersuchung der Diagramme und das Gerüst wurden folgende Themen behandelt: Die Ermittlung von Informationen zu den „Gerüstbauenden bzw. -tragenden“, elementaren Komponenten der Kooperation, ohne welche die Kooperation nicht gelingen würde, neuralgische Punkte, die die Ausbaufähigkeit von einzelnen Instrumenten darstellen und weitere Eigenschaften zu Prozessschritten, die beispielsweise in ihrer Ausarbeitung auf Widerstand gestoßen sind und Irritationen während der Prozessschritte ausgelöst haben.
Zunächst ist dem Prozessdiagramm eine zeitliche Ebene zu entnehmen, die eine direkte Abfolge von Prozessschritten mittels größerer Pfeile darstellt. Ergänzend dazu führen schmalere Pfeile auf die Prozessschritte, die aus der direkten Abfolge resultieren, die zwar bewusst angestrebt wurden, jedoch vielmehr Eigenschaften abbilden. Durch das Gespräch mit der Initiatorin und der Community Managerin hat sich herausgestellt, dass das zuvor erarbeitete Prozessdiagramm nur die ersten beiden Phasen des Tiny Rathauses abbildet, da dieser Stand zum Zeitpunkt der Auslobung durch die KOOP.STADT erfasst wurde. In der ersten Phase wurde die Idee des Tiny Rathauses der Politik und Verwaltung vorgestellt und mittels einer internen Testwoche innerhalb der Verwaltung erprobt, die zweite Phase umfasst eine weitere Testwoche, die unter realen Bedingungen stattgefunden hat und der Optimierung von Abläufen diente. Anknüpfend an diese fand im vergangenen Jahr die dritte
68
Phase statt, in der das Projekt entwickelt und das Tiny Rathaus durch einen Prototypen umgesetzt wurde. Diese wurden den kooperativen Instrumenten des Prozesses hinzugefügt. Der Prototyp galt dabei als Testfläche für die Themen der Beteiligung und Stadtinnovation. Anschließend wurde mittels eines Open Calls ein Bewerbungsverfahren eingeleitet, in dem sich die Verwaltung mit diversen Beteiligungsformaten bewerben und neue Formate austesten konnte. Die Ergebnisse wurden mit dem dabei gesammelten Wissen in einem Handbuch zusammengefasst und dokumentiert. Des Weiteren lässt sich zu den Impulsgebenden ergänzen, dass die Initiatorin des Projekts sich zwar als Stadtmacherin sieht, jedoch auch gleichzeitig eine professionelle Tätigkeit im Kreativzentrum Anscharcampus ausübt und in diesem Rahmen den Impuls und die Initiative zum Tiny Rathaus angestoßen hat. Die ersten Impulse basieren dabei auf die eigene Praxis und Erfahrung, die in den Projekten „VekselWirk“ und durch die Teilnahme am „Creative Bureaucracy Festival“ gesammelt wurden. Das Projekt „VekselWirk“ beschäftigt sich dabei mit der Sichtbarkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft über die dänische und deutsche Grenze hinweg und hat an dem Aufbau eines Netzwerks und der Umsetzung von Co-Creation-Aktivitäten gearbeitet; das „Creative Bureaucracy Festival“ hingegen zeichnet außergewöhnliche, herausstechende Innovationen im öffentlichen Sektor aus und richtet sich an Mitarbeiter*innen des öffentlichen Dienstes, die die Experimentierfreude und den Tatendrang für mehr Gemeinwohl fördern und sich dafür einsetzen. Die Stadtmacherin und Akteurin des Kreativzentrums erkannte das Potenzial in diesen Projekten und griff diese emergenten Impulse und Ideen auf. Für die obere Struktur lässt sich ergänzen, dass der Ratsbeschluss für die Bildung des Referats „Kreative Stadt“ zuvor schon beschlossen wurde und die Impulsgeberin an diesen anknüpfen und für das Projekt aneignen konnte. Die Grundidee zum Tiny Rathaus konnte nur deshalb weiterentwickelt werden, weil die Politik zuvor eine Förderung des Kreativsektors beschlossen hatte und diesen aktiv unterstützt hat. Dasselbe gilt auch für die Förderungsstrukturen, die sich aus dem Referat Kreative Stadt ergeben haben und an welche direkt angeknüpft werden konnte. Unter dem Titel KreativKiel unterstützt
69
das Referat Kreative Stadt zudem kreative Akteur*innen und fördert die Umsetzung einer kreativen Bürokratie, welche ideale Bedingungen für die Entwicklung und Realisierung des Tiny Rathauses anbot und den Prozess dadurch vereinfachte. Für die obere Struktur und die Zusammenarbeit der Akteur*innen aus Verwaltung und Kreativzentrum ist im Allgemeinen zu betonen, dass die wichtigen Entscheidungen für das Projekt immer gemeinsam getroffen wurden und die Verantwortung in diesen Prozessen untereinander aufgeteilt wird. Weiterhin ist den strategischen Maßnahmen hinzuzufügen, dass es, wie bereits zu Beginn beschrieben, während der ersten Phase und der Konzeptentwicklung durch ein ko-kreatives Verfahren innerhalb der Verwaltung eine interne Testphase gab, in dem diese erprobt und verbessert werden konnte. Die Testphasen sind generell von großer Bedeutung für die Erarbeitung des Tiny Rathauses, da die strukturellen Abläufe anpassend an Verwaltungsstrukturen funktionieren müssen, um die Verwaltungsabläufe nicht zu belasten und die Andockung an diese zu optimieren. Zuletzt wurden die kooperativen Instrumente durch das Community Management, einer Prozessmoderation innerhalb der internen Strukturen und der Koproduktion mit den beteiligten Partner*innen, welche durch einen wöchentlichen Jour-Fixe Termin ausgeübt wird, ergänzt. Die Community Managerin ist auch Mitarbeiterin des Kreativzentrums und mit ihrer Tätigkeit essenziell für die Kommunikation unter allen Beteiligten und Akteur*innen, die das Tiny Rathaus buchen. Die Organisation von Programmen und Abläufen zählen ebenfalls zu ihren Aufgabenbereichen.
Prozessschritte, die notwendig für die Realisierung des Projektes und von denen weitere kooperative Instrumente abhängig sind, ist zum einen das Community Management und somit die Kommunikation. Ein feinstimmiger Prozess ist dort wichtig, da das Community Management das gesamte Programm und die Zeiten koordiniert, die Absprache mit Initiativen, Gruppierungen und Vereinen, die das Tiny Rathaus nutzen möchten, hält und die Genehmigungen der Standorte in Absprache mit den zuständigen Fachbereichen organisiert. Die Ausübung dieser Tätigkeit bringt besondere Anforderungen mit sich: Der Umgang mit den Menschen
70
vor Ort, der Austausch auf Augenhöhe, ehrliches Interesse für die Themen mit denen Personen sich beschäftigen und die Aufmerksamkeit, mit der man in diese Gespräche geht, benötigen bestimmte Softskills, die für eine Mitwirkung auf Augenhöhe und die Betreuung der Projekte von großer Bedeutung sind. Zum anderen sind Veranstaltende, die den Raum nutzen und ihre Ideen in diesen umsetzen, ebenso wichtig für die Umsetzung des Tiny Rathauses. Dazu zählen auch die interne Koproduktion, der regelmäßige Austausch mit den Partner*innen und die Prozessmoderation innerhalb dieser Strukturen. Im Allgemeinen ist ein wertschätzender Umgang wesentlich für die kooperative Zusammenarbeit der Akteur*innen - insbesondere für die Aufgaben der Community Managerin und der Prozessmoderation - und die Schaffung einer gemeinsamen Vertrauensbasis, die das Agieren auf Augenhöhe bestärkt.
Des Weiteren wurden in dem Gespräch ausbaufähige Prozessschritte und Instrumente behandelt und vertieft. Für die Arbeit des Community Managements gilt: Je mehr personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, desto mehr Anfragen können bearbeitet und organisiert werden. Das bedeutet auch, dass Programme vorzeitig geplant und besser strukturiert werden können. Die Stelle wird bisher von einer Person besetzt, was auch von den verfügbaren finanziellen Mitteln abhängig ist. Die Qualitäten der Veranstaltungen könnten durch einen personellen Ausbau und ausreichend finanziellen Mitteln gesteigert und mehr Standorte eingeplant und angefahren werden. Insbesondere die Koproduktion und Mitwirkung der Partner*innen aus der Verwaltung sind verbesserungswürdig, da bisher keine reelle Koproduktion zwischen den Beteiligten stattfindet - die eigentlichen Tragenden des Projektes sind bislang die Mitarbeiter*innen des Kreativzentrums, welche die operativen Akteur*innen bilden. Von den Akteur*innen des Kreativzentrums wurde darauf basierend der Wunsch geäußert, dass alle Partner*innen ihre Stärken mit in das Projekt einbringen und sich bei der Umsetzung von Programmen und weiteren Aktivitäten stärker beteiligen. Durch die Einbringung würde das Projekt gestärkt und auch die Verankerung in das strukturelle System gefördert
71
werden. Grundsätzlich ist noch hinzuzufügen, dass die Haltung der Menschen hinsichtlich dieser Experimentierräume noch als zurückhaltend zu bezeichnen ist und man an diesem arbeiten muss.
Die Akteur*innen des Tiny Rathauses arbeiten daran positive Lernräume zu schaffen, um das Interesse an der Mitwirkung und Beteiligung zu fördern und somit die Zugänglichkeit zu diesen Projekten zu fördern. Dabei wird das Ziel verfolgt, eine konstruktive Haltung zu schaffen, um nachhaltige Effekte zu erzeugen. Durch die Arbeit des Tiny Rathauses hat sich auch gezeigt, dass Herausforderungen, die gemeinsam gelöst wurden, positive Auswirkungen und Effekte erzeugen, wodurch der gesamte Prozess bestärkt und mehr dazu gelernt wurde. Dahingehend werden des Öfteren Begegnungsorte für diese „Community of Change“ inszeniert und Orte geschaffen, an denen gemeinsam und voneinander gelernt werden kann.
Letztlich wurden Prozesspunkte thematisiert, die in ihrer Umsetzung besonders schwer zu erarbeiten waren. Dazu zählen insbesondere die Umsetzung und Realisierung des Tiny Rathauses, denn: Bei Fragen rund um Barrierefreiheit gab es besondere Schwierigkeiten, mit denen die Akteur*innen aus dem Kreativzentrum alleine konfrontiert waren. In diesen Prozessen wurden die Akteur*innen nicht oder nur wenig unterstützt und haben durch die zuständigen Fachbereiche keine Beratung oder aktive Unterstützung für die Erarbeitung von Lösungen erhalten. Auch bei Fragen rund um die Versicherung wurde keine große Unterstützung von Seiten der Verwaltung und den Fachbereichen geboten, daher herrschte lange Unklarheit bezüglich dieser Themen.
Das Tiny Rathaus ist für das Jahr 2023 weiterhin projektfinanziert und wurde (noch) nicht institutionalisiert. Da sich das Projekt in einer Entwicklungs- bzw. Übergangsphase befindet und noch weiter erprobt werden muss, müssen Ideen für die weitere Verstetigung noch gemeinsam erarbeitet werden. Bisher gibt es keinen politischen Beschluss, durch den das Tiny Rathaus fest in Verwaltungsstrukturen verankert werden könnte. In den Anfangsphasen des Projektes konnte diese Stufe der Kooperation und die ausstehende
72
Institutionalisierung zum Vorteil genutzt werden, da politische Beschlüsse einen festen Rahmen mit sich bringen und den Experimentierraum eventuell eingeschränkt hätten.
Zum Abschluss des Gesprächs wurde eine Einordnung der Projektphasen in die Ansätze des TopDown und BottomUp vorgenommen. Zu Beginn wurde geäußert, dass der Prozess sich im Bereich der Impulse von dem BottomUp Ansatz in Richtung des Miteinanders auf Augenhöhe entwickelt hat. Jedoch wurde im diesem Zuge auch ergänzt, dass ein klassischer BottomUp Ansatz eine ehrenamtliche Tätigkeit betreffen würde und dieses für das Tiny Rathaus nicht zutrifft: Die Arbeit der Akteur*innen aus dem Kreativzentrum wurde immer im Rahmen der professionellen Tätigkeit ausgeübt; das Kreativzentrum Anscharcampus sieht sich dabei zwar als Akteur aus der Zivilgesellschaft, wird in seiner Arbeit aber von Seiten der Politik unterstützt und gefördert. Die Hauptakteurin und Initiatorin des Tiny Rathauses stuft sich selber als Stadtmacherin ein, konnte ihre Arbeit und Praxis jedoch durch die Tätigkeit im kreativzeit auf eine feste Basis aufbauen. Außerdem sind die Partner*innen aus der Verwaltung, mit denen gearbeitet wurde, nach ihrer Einschätzung nach nicht als TopDown einzustufen, da in diesen Prozessen nicht mit den Verwaltungsspitzen, sondern mit Vertreter*innen der Verwaltung agiert wurde. Des Weiteren würde ein klassischer TopDown Ansatz bedeuten, dass es einen politischen Beschluss für die Initiierung des Tiny Rathauses gegeben hätte, welches in diesem Prozess nicht der Fall ist. Ein gemeinsamer Vorschlag für die Einordnung der Phasen lautet wie folgt: Für die Ebenen der Impulse und der oberen Struktur kommen die Ansätze des BottomUp nicht von ganz unten, und die Ansätze von TopDown nicht von ganz oben; für die weitere Mitwirkung gilt ein Miteinander auf horizontaler Ebene.
73
74 n
75
bürgernahe ve g
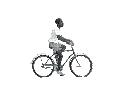


kreativzentrum
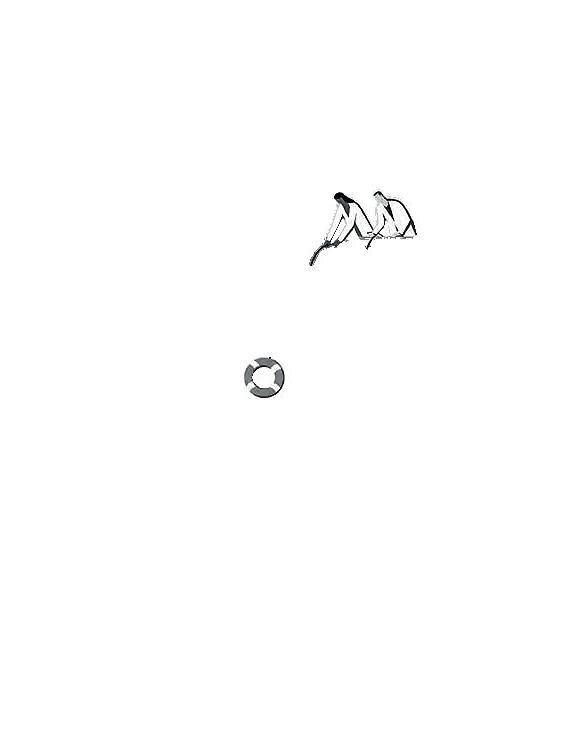
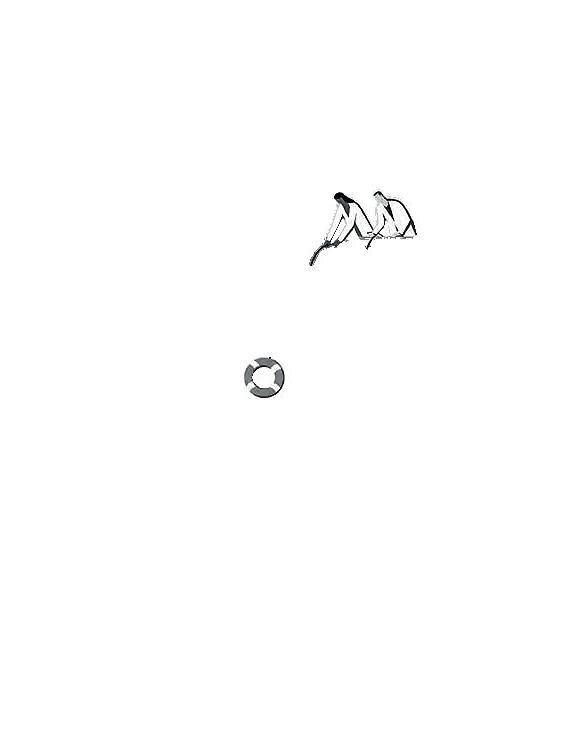


initiieren projekt



kreative bürokratie
referat k r e a t i v e s t a d t
BERATUNG + UNTERSTÜTZUNG



referat kreative stadt
förderung kultur &kreativwirtschaft

rathaus

(bottom)up entraler





76
KOMMUNE
IDEE
+ DENKANSTÖßE VISION
IDEE
VORSTELLUNG
CITIES regional budget+ smarte kielregion FÖRDERPROGRAMM
RATSBESCHLUSS SMART
o r g a n i s a t i o n & struktur
under construction





herausforderungen stadtentwicklung
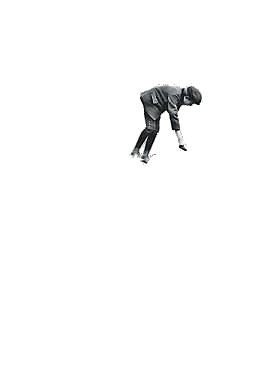





werts c h ä t z e n d e r u m g a n g

expertise


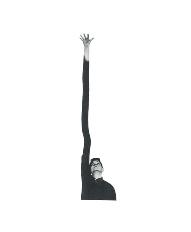

bürgerkontak

ZUSAMMENARBEIT
stadtm a c h e n d ne

b e t e i l i g u n g + ver

e n h ö h e







NIEDRIGSCHWELLIGES
MOBILE ANLAUFSTELLE KONZEPT ENTWICKLUNG

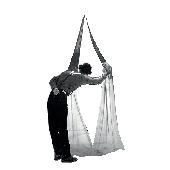
PROZESSMODERATION
ENTWICKLUNG + UMSETZUNG


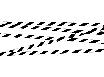




TESTWOCHEN
teste setsets t es


PROTOTYPING
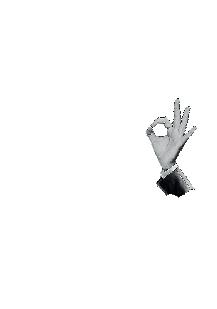
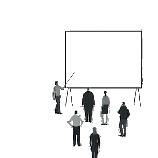
caution under construction

v e rwaltun e tfahcsll KOPRODUKTION






sabläufe o p t i m i e r e n

77
kokreatives v e r f a h r e n
AUSTAUSCH
wöchentlicherjour-fixe
innerhalbd e r s t r u k t u r e n v e r w a l t u n g
rathaus begleit
COMMUNITY MANAGEMENT
v e r a n s t a l t u n g e n plan aufaug
beteiligungsforma t e e r p r o ben
reale be
DRITTER RAUM +
WISSENSTRANSFER
VERMITTLUNG
CASE-STUDIES
Tiny Rathaus: Interview
Sophie Mirpourian ist Sozialanthropologin und die Initiatorin des Tiny Rathauses. Sie baut Infrastrukturen für Zukunftsgestaltung und ist als Kommunikationsleiterin und Projektmacherin im Kreativzentrum Anscharcampus tätig./ Lisa Radtke ist Designerin, Community Managerin des Tiny Rathauses und arbeitet im Kreativzentrum Anscharcampus. Sie hat Raumstrategien studiert und interessiert sich für die Gestaltung und Entwicklung von zukunftsfähigen Städten.
Burcu Daglayan: Wie ist das Projekt entstanden? Wer ist daran beteiligt und welche Räume werden genutzt?
Sophie Mirpourian: Also ursprünglich ist es entstanden, weil ich ein Projekt zum Thema Kultur und Kreativwirtschaft gemacht habe. In dem Zuge habe ich mal eine Veranstaltung organisiert, die “Creative Retreat” hieß. Das war eine Arbeitswoche am Strand, in der wir verschiedene Coworking Elemente und mobile Arbeitsorte zusammengebracht und dadurch ein Popup Coworking-Dorf aufgebaut haben. Wir hatten ein CoWorkLandContainer und ein Tiny Office dabei. Die CoWorkLand-Container waren deswegen interessant, weil diese Popup Elemente Teil eines Projekts waren, Coworking in den ländlichen Raum zu bringen. Während der Zeit habe ich viel im Tiny Office gearbeitet. Was ich interessant fand, ist, dass es relativ entspannt war, da zu arbeiten. Das hat mich dann dazu inspiriert über
einen mobilen Raum nachzudenken, der sich durch die Stadt bewegen kann und gleichzeitig Nähe und Ruhe zusammenbringt. Nach einigen Gesprächen mit verschiedenen Leuten ist die Idee daraus entstanden, die Verwaltung näher an uns als Kreativzentrum zu bringen. Und daraus hat sich die Idee entwickelt, dass eigentlich viele Leute Vorzüge davon hätten, das Rathaus näher zu bringen. Deswegen ist es nicht nur eine Schnittstelle zwischen Rathaus und Kreativzentrum, sondern eine zwischen der Zivilgesellschaft und Verwaltung. Daraus ist dann 2019 das Konzept des Tiny Rathauses entstanden. Im Herbst des selben Jahres habe ich Kontakt zum Referat Kreative Stadt aufgenommen, das Referat ist nämlich auch per Ratsbeschluss an der Schnittstelle Kreativwirtschaft und Verwaltung entstanden. Gleichzeitig gab es noch einen anderen Prozess für die Förderung der “Kreativen Bürokratie”, also thematisch war der Diskurs schon da, auch im Hinblick auf andere Projekte, wie das “Creative Bureaucracy Festival” in Berlin. Ich habe dem Referat das Konzept vorgeschlagen, und die fanden das ziemlich gut. Ich habe daraufhin ein 3-Phasen Modell vorgeschlagen. In der ersten Phase wurde sich dem Thema angenähert, in der zweiten Phase getestet, also ein Prototyping durchgeführt, und dann in der dritten Phase der Bau und eine Verstetigung erarbeitet. So hat das angefangen. Das Projekt war an die Abteilungen Digitalisierung, Personalwesen aus der Stadtverwaltung, Referat Kreative Stadt und die Abteilung Beteiligung – so hieß es damals, jetzt heißt es Mitwirkung –adressiert. Gemeinsam haben wir dann
78
die Analyse gemacht. Bevor wir direkt in den Kontakt mit Menschen in öffentlichen Räumen treten, haben wir erst mal eine interne Testwoche gemacht. Das ist das Prototyping, aber ohne den ganzen Fachjargon dahinter. Ich habe über die Verwaltung auch gelernt, dass Projekte, die noch nicht durchgedacht wurden, nicht in den öffentlichen Raum gebracht werden. Wir haben also eine Woche lang im neuen Rathaus ein “Office” hingestellt, in den Wagen konnten die Mitarbeiter*innen eine Woche lang kommen und uns Input geben. Der allererste Schritt war also, erst mal mit den Leuten in der Verwaltung zu reden, was für Ideen sie haben, damit kein Top-Down Prozess entsteht. Das war immer ganz wichtig. Darauf folgte dann eine Dokumentation von all dem Wissen, was da zusammengetragen wurde. Das war die Phase eins. Und dann haben wir Phase zwei gestartet, in der wir Förderungen eingeworben haben, um wirklich ins Protoyping zu gehen. Wir haben es dann Testen genannt und gemerkt, dass der Verwaltung gar nicht so viel erlaubt wird zu testen. Deswegen haben wir gesagt “Wir haben eine Lizenz zum Ausprobieren, wir dürfen jetzt alles”. Und weil wir als Kreativzentrum dabei waren, wurden uns viele Sachen gelassen, die sie selber nicht dürfen. Wenn etwas schiefgelaufen ist, dann konnte auf uns gezeigt werden. Also wenn die Verwaltung alles organisieren würde, dann müsste wahrscheinlich eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und sich intensiv mit Genehmigungen auseinandergesetzt werden. Das hätte alles sehr viel Zeit gekostet. Wir haben da etwas mehr Spielraum. Genau, dann haben wir drei öffentliche Testwochen
zusammen durchgeführt. Wir haben von einem Partner aus Aarhus mobile Büros ausgeliehen, also die Tiny Offices, von denen ich gesprochen hatte. Der hat ganz viele unterschiedliche Offices, das heißt, es war auch nie der gleiche da, den wir benutzt haben. Und das erste Mal standen wir auf dem Rathausplatz 2021 im Juni, und haben uns währenddessen mit dem Konzept bei KOOP.STADT beworben und im Juni dann KOOP. STADT gewonnen. Also Kiel hat den Bundespreis tatsächlich in der Kategorie Großstadt gewonnen. Das hat natürlich richtig Wind gebracht, weil so ein Preis natürlich dazu führt, dass die Stadt sich auch damit brüstet. Die KOOP.STADT dachte auch, dass das Tiny Rathaus schon existiert, aber wir hatten zu der Zeit das Konzept und waren noch im Prototyping. Das Projekt fanden sie aber richtig gut. Genau, die Testwochen waren auch gut, um das Projekt anschlussfähiger zu machen. Als wir mit dem Tiny Rathaus im öffentlichen Raum waren, kamen viele auf uns zu und haben gefragt “Was ist denn das Tiny Rathaus?”. Ich habe die Frage immer zurückgeworfen und habe gefragt “Was würdest du denn machen, wenn du diesen Raum hättest und was damit machen könntest?” Das hat dazu geführt, dass das Projekt so anschlussfähig geworden ist. Für mich war das Tiny Rathaus immer ein Projekt, das von allen gemeinsam gestaltet werden kann und wollte den Raum nicht so sehr mit eigenen Ideen füllen, um Platz für Neues zu lassen. Generell hat es vielen Leuten geholfen konkret zu werden und ihre Wünsche zu äußern. Genau. Auf einmal standen wir als erstes auf dem Rathausplatz, dann auf dem anderen Ufer in einer
79
Einkaufsstraße, und dann standen wir im Stadtteil Wik. Nachdem wir am ersten Standort standen, auf dem Rathausplatz, wurde eine Kollegin vom Referat Kreative Stadt, mit der ich viel zusammengearbeitet habe an dem Projekt, vorgeladen vom Beirat für Menschen mit Behinderungen. Es wurde ganz stark kritisiert, dass der Wagen nicht barrierefrei ist. Für uns war das ein wichtiges Thema, was wir sehr ernst genommen und auch gelöst haben. Genau, das ganze Wissen haben wir immer ausgewertet und hatten dann am Ende des Jahres auch eine Raumstrategin dabei, die das Tiny Rathaus begleitet hat, um zu sehen, was mit dem Tiny Rathaus für ein Raum entsteht. Ihre Erkenntnisse waren, dass insbesondere der Außenraum, der dabei entsteht, ein Möglichkeitsraum schafft und dass es wichtig ist, dass dieser einladend ist, Informationen darüber geteilt werden und der Raum zum Verweilen einlädt. Das ist die Phase zwei.
BD: In was für einem Zeitraum sind die Phasen entstanden?
SM: Das waren jeweils ein Jahr, also Phase eins und zwei. In Phase drei ist ein Regionalentwickler mit einem großen Smart City Projekt dazugekommen, welche die Phase drei und den Bau des Tiny Rathauses finanzieren.
BD: Die Finanzierung war bis dahin über ein Förderprogramm der Stadt?
SM: Genau. Das war eine kommunale Förderung, die wir auch deswegen beantragen konnten, weil wir selber nicht die Stadt waren. Deswegen
konnten wir bei der Stadt Geld beantragen. Und dann, in der Phase drei, hat die Stadtverwaltung den Bau in Auftrag gegeben und uns gefragt, ob wir das betreuen wollen. Ich dachte eigentlich, dass die Verwaltung das Tiny Rathaus betreibt, aber das hätten sie nicht geschafft, dafür müsste neues Personal angestellt werden. Und dann dachten wir “Okay, ja, können wir machen, können wir ausprobieren”. Ich habe dann den Bau betreut. Und dann ist Lisa im April letzten Jahres dazugekommen.
Lisa Radtke: Der Wagen wurde quasi gerade gebaut, und ich wurde angestellt. Dann haben wir die erste richtige Saison sozusagen geplant. Wir haben einen Aufruf gestartet und gesagt, “Leute, der Wagen kommt, wir wollen Veranstaltungen machen. Wo sollen wir hinfahren, welche Themen sollen wir bearbeiten?” Danach wurde erstmal ausgewertet und dann ging der wilde Ritt los mit “Ok, der Wagen ist tatsächlich da, und wir fahren damit durch die Stadt zu den meistgenannten Standorten”. Wir waren letztes Jahr an 20 Standorten.
BD: Was waren eure Zielsetzungen bei dem Projekt?
SM: Das entwickelt sich immer so ein bisschen. Ursprünglich gab es die Nähe zwischen Kreativzentrum und Verwaltung. Mein persönliches Ziel war auch, dass ich mal gucken wollte, wie weit man in Kiel eigentlich kommen kann. Ich hatte immer das Gefühl, dass man die richtig wilden Sachen oder ausgefallenen Interventionen, die man aus dem Studium kennt, hier nicht machen kann. Generell ging es aber um
80
diesen ganzen Diskurs, dass sich die Verwaltung ändern muss, dass sich im Endeffekt eigentlich ganz viele Organisationen in unserer Arbeitswelt verändern müssen, die aber nicht wissen, wie sie sich verändern können. Und deswegen war ein Ziel auch, das Rathaus neu zu denken, damit das große Rathaus sich selber angucken und herausfinden kann, wie es auch anders sein kann. Das ist eine spielerische und, sagen wir mal, fast zärtliche Art und Weise, das so zu machen. Genau, also Verwaltungsinnovation war auf jeden Fall auch ein Ziel. Was noch weiter drin ist, ist, wie wir uns als Gesellschaft miteinander unterhalten. Also eine neue Gesprächskultur anregen, denn der Ton wird rauer und irgendwie auch immer gegeneinander gerichtet, und auf der einen Seite reden wir gar nicht mehr so viel miteinander. Deswegen ist eine Art von Gesprächsraum so wichtig, der uns wieder dazu bringt, zusammen über Probleme zu reden. Wir brauchen menschliche Begegnungen. Wir müssen mehr Anlässe schaffen, dass Menschen sich miteinander unterhalten. Die Problemlösung kommt dann von wo anders. Also das Tiny Rathaus löst keine Probleme an sich selber, sondern das Tiny Rathaus schafft nur eine bessere Grundlage dafür, dass wir zusammen Probleme lösen können.
LR: Die Probleme unserer Zeit werden immer komplexer, und viele haben das Bedürfnis, dass wir mehr Expert*innen brauchen. Auf Stadtebene können alle was voneinander lernen. Die Personen, die im Rathaus einen Antrag bearbeiten, wissen vielleicht gar nichts von diesem Stadtteil, um den es geht und was da
eigentlich los ist. Die Leute, die da wohnen, haben aber Expertenwissen und wissen mehr über ihre direkte Umgebung. Das finde ich sehr interessant.
SM: Was auch richtig spannend ist, wenn wir über die Transformation von Gesellschaft reden, ist, dass die Stadtverwaltung wie der Maschinenraum einer Stadt ist. Alle Stellschrauben gehen bei der Verwaltung zusammen. Das ist der Ort, an dem die strukturellen Entscheidungen für die Stadt getroffen werden. Das ist also auch der Ort, den wir alle zusammen transformieren müssen, wenn wir wollen, dass die Stadt anders aussieht.
BD: Welche Strukturen habt ihr vorgefunden? Gegen was habt ihr bei der Planung und Umsetzung agiert? Hat euch dabei etwas irritiert?
SM: Ich hatte das mit dem Beirat und der Barrierefreiheit vorhin erwähnt. Das war etwas, was wir sehr ernst genommen haben, aber irgendwie hat es sich so angefühlt, als würden alle nur Ansprüche stellen, aber nicht mitgestalten und gemeinsam an den Lösungen arbeiten. Das hat gestört. Wir haben wirklich viele Leute getroffen, die uns auch so weit unterstützt haben, wie sie konnten. Man hat aber gemerkt, dass sie keinen Gestaltungsfreiraum haben. Es gab beispielsweise jemanden bei der Verwaltung, der für den Bereich “Barrierefrei Bauen” zuständig war. Das habe ich aber erst erfahren, nachdem wir relativ weit im Prozess waren. Und als ich auf diese Person zugegangen bin, hat die Person sich nicht mitverantwortlich gefühlt für dieses
81
Projekt. Er hat uns zwar sagen können, was wir brauchen, aber nicht, wie wir etwas machen können. Da war kein Interesse da. Wir haben uns die Hilfe dann vom Netzwerk zur Barrierefreiheit in Schleswig-Holstein geholt, die uns sehr weitergeholfen haben. Besonders zu diesen “Muss-Themen” gibt es sehr viele Leute, die in Positionen sitzen, wo sie dir die ganze Zeit erzählen, was du alles einhalten musst. Und wenn es dann zu kompliziert wird, geben Leute auf. Barrierefreiheit ist unglaublich wichtig, da hätte ich mir an solchen Stellen gewünscht, einen starken Partner an der Seite zu haben oder wenigstens eine Person, die interessiert ist und nicht immer nur Ansprüche stellt. Das hat uns das Leben teilweise echt schwierig gemacht.
LM: Das ist vielleicht ein gutes Beispiel für das, was Sophie gerade erzählt hat: Der Wagen war irgendwann da und wir haben losgelegt, Veranstaltungen zu machen. Irgendwann haben wir angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, was eigentlich passiert, wenn mal jemand die Treppe runterfällt oder stolpert? Was ist eigentlich mit mir, wenn ich den Wagen aufbaue oder irgendetwas schiefgeht und ich runterfalle? Es war klar, dass wir eine Versicherung brauchen und wir alle wissen, was eine Versicherung ist, aber wie versichert man einen mobilen Veranstaltungsort? Ich habe mich einmal quer durch die Stadtverwaltung telefoniert und irgendwann auch das Ordnungsamt angerufen, da ich erfahren hatte, dass es eine Person gibt, die Bürger*innen kostenlos zu Versicherungen berät. Und irgendwann bin ich nicht mehr drum herumgekommen, den Abteilungsleiter
von der Rechtsabteilung der Stadt Kiel anzurufen. Ich hatte leider keine hilfreichen Informationen bekommen. Das war auf jeden Fall sehr frustrierend. Wir haben dann im Endeffekt mit den Partner*innen darüber gesprochen, die auch immer wieder mit anderen Leuten gesprochen haben und irgendwann gab es ein Gespräch mit den Partner*innen und dem Abteilungsleiter, wo dann gemeinsam mit der Verwaltung eine Lösung gefunden wurde. Das war alles etwas komplizierter, als wenn man sich als Privatperson versichern lässt.
SM: Dann war es nachher auch eine Frage von Eigentumsverhältnissen. Da musste nicht eine Entscheidung getroffen werden, sondern man musste zusammen erst mal den Sachverhalt verstehen und sich einarbeiten. Dann musste man einen gewissen Sachverhalt auch erst schaffen, weil es nämlich gar nicht ganz klar war, wem der Wagen gehörte. Wir mussten also zuerst festlegen, wem der Wagen gehörte, und dann schauen, wie man den Wagen dadurch versichern kann.
LR: Genau. Es war einfach nicht klar, wie damit umgegangen wird, das wusste niemand vorher. Wird der Wagen jetzt auf uns zugelassen oder auf die Stadt? Und dann auch die Frage, auf wen wird das alles versichert? Und wer zahlt das? Das mussten wir alles noch aushandeln.
SM: Der Wagen gehört jetzt der Landeshauptstadt Kiel, wurde aber aus Mitteln der Smarten KielRegion angeschafft, also aus Geldern, die einen Regionalbezug haben. Es gibt eine formale Eigentümerschaft, aber ganz so einfach ist das nicht. Das hat aber auch
82
Vorteile, weil sich dadurch ein Partner nicht komplett durchsetzen kann.
BD: Was habt ihr mit dem Projekt bewirkt? Wie wurde das Projekt aufgenommen?
LR: Ich würde schon sagen, dass es gut aufgenommen wurde, also zumindest, seit ich da bin. Als ich angefangen habe, musste ich, wenn ich die Stadt oder Vereine angerufen habe, immer erklären, was denn das Tiny Rathaus überhaupt sei. Mittlerweile wissen die Leute in neun von zehn Fällen, was es für ein Projekt ist oder haben zumindest schon mal davon gehört.
BD: Und von Seiten der Verwaltung?
SM: Ich denke auf jeden Fall, dass wir eine Art “community of change” gebildet haben, die sich um das Tiny Rathaus bildet. Ich habe schon ganz oft gefragt, ob es sozusagen ein Meetup in der Verwaltung für Leute gibt, die Veränderung vorantreiben wollen. Das gibt es nicht so richtig, auch wenn sich die Leute untereinander kennen. Am Tiny Rathaus treffen sich eben Leute, die Lust haben auf Veränderungen. Es ist verbunden mit allen Arbeitsrealitäten, weil so viele verschiedene Leute etwas darin machen. Das ist glaube ich ein cooler Effekt für die Verwaltung. Ich glaube schon, dass in dem Projekt im Kleinen ganz viele Veränderungen entstanden sind, wie zum Beispiel die Haltung der Menschen und den kleinen Begegnungen, die man macht.
BD: Wurde das Projekt verstetigt? Wenn ja, in welcher Form?
LR: Da sind wir gerade dabei. Wir haben dieses Jahr wieder eine Förderung gekriegt und machen nochmal ein Jahr lang Veranstaltungen. Währenddessen laufen Gespräche, wie beispielsweise darüber, wo meine Stelle angesiedelt sein wird. Die Finanzierung ist natürlich auch ein Thema. Also, es gibt schon verschiedene Varianten und Überlegungen, wie es weiter gehen soll. Eine Variante, die wahrscheinlich ganz naheliegend ist, ist den Wagen in der Stadt zu belassen, der ist auch auf die Stadt zugelassen. Und dann wäre die Überlegung, eine Stelle von der Verwaltung und eine von der Smarte KielRegion zu besetzen.
SM: Es gibt das SmartCity Projekt von der KielRegion, das auch ein Teil des Betriebes mittragen wird. Bei Projektförderungen kommt man irgendwann an den Punkt, wo man von Verankerung redet. Dann werden Projektförderungen dich finanziell nicht mehr tragen können, weil das Projekt kein Modellprojekt mehr ist. Ein Teil der Finanzen muss also aus den kommunalen Haushalten kommen, und das ist der Knackpunkt. Den Schritt muss die Stadt alleine gehen. Es wurde sich jetzt auch etwas daran gewöhnt, dass wir vom Kreativzentrum viele Prozessschritte angeleitet haben. Es gibt immer Treiber von Prozessen, das waren auf jeden Fall wir. Ich glaube, die Frage ist, ob sie es schaffen auf der anderen Seite einen Treiber zu haben, der/die das Projekt nach vorne bringt. Ich glaube, die Stärke des Projekts ist, dass es schon immer auf Verankerung abgezielt hat. Es war nie einfach nur so ein “Spielprojekt”. Trotzdem ist das ein Sprung, und man weiß nicht genau, wie dieser Sprung ausgehen wird.
83

MitMachBüro
84

85
CASE-STUDIES
MitMachBüro/Schwerte
Das MitMachBüro liegt inmitten der Schwerter Innenstadt und bietet ergänzend zu einem digitalen MitMachPortal Beratung und Unterstützung rund um die Themen des Stadtmachens in Schwerte an. Neben des Informierens über die Themen Ehrenamt und Engagement wird die Stadtgesellschaft mittels dieser Instrumente und Räume auch über aktuelle städtische Vorhaben und Planungen informiert und im Weiteren dazu eingeladen, sich mit ihren Ideen und Meinungen zur Mitwirkung an der Stadtgestaltung zu äußern und aktiv zu beteiligen. Das MitMachBüro ist Teil der Schwerter Leitlinien, die im Rahmen der „MitMachStadt Schwerte“ definiert wurden und die Förderung und Unterstützung des Engagements und der Beteiligung der Schwerter*innen an der Stadtentwicklung zum Ziel haben.
Bei einem Besuch im MitMachBüro wird schnell deutlich, dass die Stadtbürger*innen durch die zentrale Lage des Büros und das niedrigschwellige Format einen Zugang zu einer bürgernahen Anlaufstelle mit Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung haben und unbürokratisch mit den Mitarbeiter*innen vor Ort in den Kontakt treten können. Zum Zeitpunkt des Besuches war das Büro umgeben von einer großen Baustelle auf dem direkt anliegenden, zentralen Marktplatz der Stadt Schwerte. Dies hält laut den Mitarbeiter*innen des Büros die Stadtbewohner*innen aber nicht davon ab, vorbeizuschauen, sich auszutauschen, zu informieren oder Vernetzungstreffen zu organisieren. Neben Fragen zu aktuellen Vorhaben wie beispielsweise der großen Baustelle vor der Tür, allgemeine Informationen zur Beteiligung an niedrigschwelligen Projekten oder auch weiteren Informationen zu Fördermöglichkeiten von Ideen und Vorhaben, die kreative Akteur*innen umsetzen möchten - das MitMachBüro steht den Stadtbewohner*innen beratend und unterstützend zur Seite, vernetzt kreative Akteur*innen miteinander und kann diese durch die direkte Andockung an die Verwaltung an die zuständigen Fachbereiche weiterleiten.
86
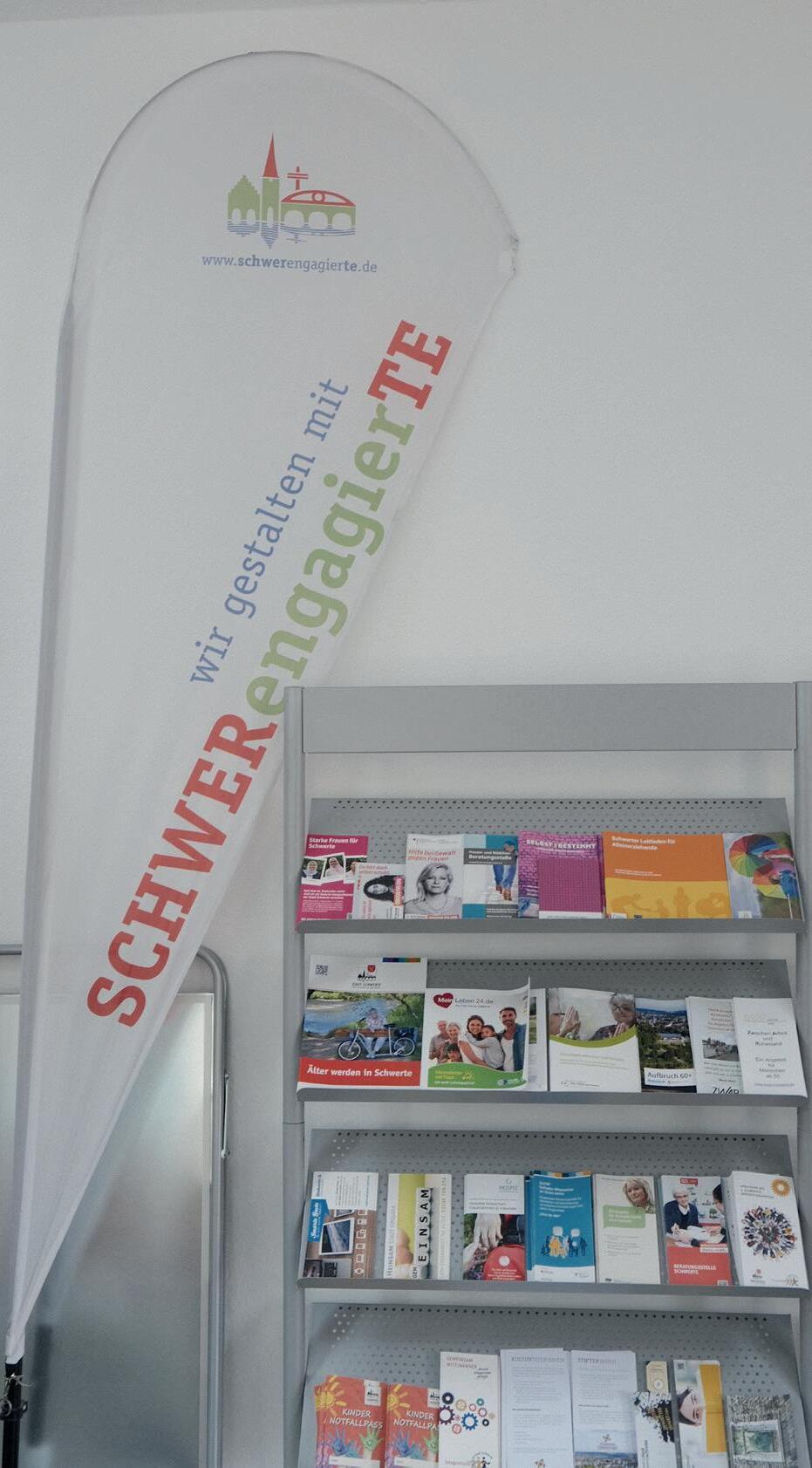



Das Prozessdiagramm des MitMachBüros basiert ebenfalls auf den Informationen der Publikation KOOP.STADT und wurde teils durch weitere Recherchen durch die Schwerter Leitlinien für die „MitMachStadt Schwerte“ ergänzt. Um einen genaueren Einblick in die Arbeit und Praxis des MitMachBüros zu bekommen, wurde ein Interview mit den Mitarbeiter*innen des Büros vor Ort geführt, welches in den folgenden Abschnitten zu finden ist und ein besseres Verständnis über die Arbeit des Büros und der MitMachStadt liefert. In diesem Zuge wurde zudem das im Vorhinein erarbeitete Diagramm und die Prozesse überprüft und gemeinsam ergänzt. In dem folgenden Abschnitt werden diese Informationen zusammengefasst und im Anschluss durch ein aktualisiertes Prozessdiagramm und das darauf aufbauende Kooperationsgerüsts dargestellt, in welchem dieselben Informationen und Themen ermittelt und erfasst wurden, die bereits bei der Analyse des vorangegangenen Projektes beschrieben wurden.
Die zeitliche Ebene des Kooperationsprozesses lässt sich aus der direkten Abfolge der Prozessschritte mittels der großen Pfeile entnehmen, die schmalen Pfeile bilden eine indirekte Abfolge von Schritten ab, die Eigenschaften abbilden und resultierend aus den bewusst gegangenen Prozessschritten entstanden sind. Die in der Schwerter Leitlinie erarbeiteten Rahmenbedingungen geben ebenfalls eine Struktur vor, auf die das MitmachBüro aufbaut. In einem ersten Schritt wurden durch das Gespräch fehlende Prozessschritte in das Diagramm eingebaut, die in der Vorrecherche nicht ersichtlich waren und wichtige Informationen zu Impulsen, konkreten Maßnahmen und Instrumenten abbilden. Die ersten Impulse, die folglich zur Erarbeitung der Leitlinie für die MitMachStadt Schwerte und zu der Gründung des MitMachBüros führten, wurden von zwei Akteur*innen der Verwaltung angestoßen, die einen Handlungsdruck aufgrund des demografischen Wandels der Stadt erkannten und aufgrund dessen die Gründung der Initiative KuBiB (Initiative für Kultur, Bildung und Bürgerschaftliches Engagement) initiierten. Die Initiative setzt sich dabei aus diversen Mitglieder*innen zusammen, die sich schon zuvor aktiv mit den Themen des Engagements, der Beteiligung und Teilhabe an der
88
Stadt auseinandersetzten und sich für die Förderung dieser eingesetzt haben. Das vielschichtige Netzwerk setzt sich aus freiwilligen Stadtakteur*innen, diversen Bürgervereinen, freien Initiativen und Gruppierungen, Kirchengemeinden und Mitarbeiter*innen der Stadt zusammen. Die beteiligten Initiativen und Institutionen haben dabei ihre eigene Praxis und Erfahrung aus dem Bereich der Engagementförderung mit in das Netzwerk eingebracht und somit aktiv den Aufbau der Initiative gestützt. Für die Förderung und Entwicklung der weiteren Arbeit hat sich die Initative nach einer Beratung mit dem Ältestenrat, dem alle im Rat der Stadt Schwerte vertretenden Parteien angehören, für das Förderprogramm „Engagierte Stadt“ beworben und diese auch erhalten. Die Initiative wurde daraufhin in den Arbeitskreis „Engagierte Stadt“ umbenannt und setzte sich im Weiteren für die Entwicklung der MitMachStadt Schwerte ein. Begleitet wurde der Prozess durch die Stiftung Mitarbeit, die ebenfalls ihre Erfahrung und Praxis aus anderen kommunalen Beratungsprozessen mit eingebracht hat. Die Beratung durch den Ältestenrat und der regelmäßige Austausch mit den Fraktionen bilden für die Arbeitsund Herangehensweise des MitMachBüros und die Umsetzung ihrer Vorhaben eine wichtige Komponente und sind in der oberen Struktur tief verankert. Mit dem Druck bzw. den Forderungen der Zivilgesellschaft, die ebenfalls einen festen Bestandteil der oberen Struktur abbilden und auf diese einwirken, können diese beiden Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf Ratsbeschlüsse ausüben und diesen eventuell auch vereinfachen, da das regelmäßige Informieren und Beraten mit den Fraktionen die Transparenz und die Kommunikation in diesen Prozessen bestärkt und ein gemeinsames Agieren ermöglicht. Den konkreten Maßnahmen ist hinzuzufügen, dass das MitMachBüro nicht nur analog, sondern auch digital über das MitMachPortal eine Anlaufstelle anbietet. Durch die Gründung eines MitMachGremiums, welches bei der Umsetzung von Bürgerbeteiligungen darauf achtet, dass die definierten Anforderungen aus der Leitlinie eingehalten werden und Prozesse fair ablaufen, wird das Büro konstruktiv begleitet. Das MitMachGremium setzt sich dabei aus Einwohner*innen, bürgerschaftlich Engagierten sowie Vertreter*innen aus der Politik,
89
Verwaltung und Wirtschaft zusammen. Des Weiteren knüpft das MitMachBüro bezüglich der kooperativen Instrumente mit dem Raum für Vernetzung, Austausch und Weiterbildung an die Vernetzungsarbeit von KuBiB (seit 2011) und der Freiwilligenakademie und „Schwerte zusammen“ (seit 2014) an. Darauf aufbauend wird einmal im Jahr eine Vernetzungskonferenz organisiert, zu welchem externe Referent*innen eingeladen werden, Beobachtungen aufgestellt und anhand dieser gemeinsam reflektiert und gearbeitet wird. Das Programm beinhaltet zum einen Praxishilfen für Engagement und zum anderen diverse Impulsvorträge für die Stadtgesellschaft - die Veranstaltungen dienen als Impulsgeber, um weitere Ideen und Projekte anzustoßen. Zuletzt ist zu der Bereitstellung der finanziellen Ressourcen des Büros durch die Stadtverwaltung und des Förderprogramms zu ergänzen, dass diese zwar keine direkte finanzielle Unterstützung anbieten, jedoch eine Beratung und Unterstützung zu Möglichkeiten der Förderung für kreative Akteur*innen und Initiativen leisten. In dem Zuge wurden beispielsweise Fördermittel organisiert, die über ein Bewerbungsverfahren der Stadt an Vereine ausgezahlt wurde, oder Vereine direkt über geeignete Fördermittel informiert.
Im Weiteren wurden Prozessschritte, die für die Realisierung des kooperativen Prozesses wesentlich sind, ermittelt und mit in das Diagramm aufgenommen. Für die obere Struktur gilt, dass insbesondere der Ratsbeschluss relevant für die Umsetzung der Prozesse ist, da ohne diesen die rechtlichen Grundlagen für den weiteren Verlauf des Projekts nicht gegeben wären und darauf nicht aufgebaut werden könnte. Auch der Handlungsdruck von Seiten der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft ist essenziell für die Realisierung, da ohne den Druck und der gemeinsamen Zielsetzung nicht über Verbesserungen oder der Initiierung von neuen Prozessen und Strukturen nachgedacht werden würde, auch hierfür braucht es immer einen Ratsbeschluss. Aus diesem Grund bilden die Kommunikation mit den Fraktionen und dem Ältestenrat, die Transparenz in diesen und der Druck und das Engagement der Zivilgesellschaft eine wichtige Grundlage für den weiteren Verlauf: Die Umsetzung neuer Ideen und Prozessen braucht die Zustimmung
90
von Entscheidungsträger*innen aus der Politik und Verwaltung (TopDown), und von Seiten der Zivilgesellschaft (BottomUp) immer das Engagement und die Lust, mitzugehen und mitzumachen, da diese auch freiwillig in den Prozessen mitwirken und nur gemeinsam an integrierten Planungen gearbeitet werden kann.
Auf die Frage welche Prozesspunkte ausbaufähig sind, wurde zu Beginn deutlich vermittelt, dass alle Prozessschritte immer weiter ausgebaut werden können, insbesondere die Beteiligung der Menschen in den Prozesse. Bei der Kommunikation und dem Austausch mit der Verwaltung besteht ebenfalls Bedarf nach Verbesserungen, da unterschiedliche Haltungen bezüglich der vorgegebenen Rahmen für Beteiligungsprozesse vertreten sind und diese Konflikte bzw. Auseinandersetzungen mit sich bringen. Auch das Informieren der Verwaltung über aktuelle Sachlagen und Themen kann in bestimmten Fällen herausfordernd sein. Dieser Prozessschritt stellt für die Mitarbeiter*innen ein längerfristiges Problem dar und ist mit besonderen Anstrengungen verbunden.
Weiterhin würden mehr finanzielle Mittel durch die Verwaltungauch wenn ergänzt wurde, dass diese für die Größe der Kommune im Vergleich zu anderen ausreichend ist - bedeuten, dass man mehr erreichen und „größer denken kann“, denn: Je mehr Mittel, desto mehr kann umgesetzt und geplant werden. Gleiches gilt für die personellen Ressourcen. Grundsätzlich gilt für die Ausbaufähigkeit des Projekts, dass generell die Haltung der Politik über Beteiligungen geändert werden sollte. Beteiligungen können von Seiten der Politik als störend empfunden werden, da sie Zeit und Geld kosten und an bregrenzte Zeitrahmen gebunden sind. Gute, qualitative Beteiligung braucht jedoch ausreichend Zeit und kann nicht funktionieren, wenn die äußeren Rahmenbedingungen zu eng gestrickt werden. Gleichzeitig erwarten alle Förderanträge Beteiligung; folglich wird ein Missverhältnis sichtbar, welches ein großes Problem für Beteiligungen in integrierten Prozessen darstellt.
Für die weitere Verstetigung des MitMachBüros und der MitMachStadt Schwerte gilt, dass die Arbeit mittlerweile strukturell so tief verankert ist, dass sie neben den Fördermitteln der
91
„Engagierten Stadt“ auch institutionalisiert wurde und über eine eigene Haushaltsstelle verfügt, durch welche die Kosten für personelle Ressourcen, die Planungen für Beteiligungen und der Förderung von Engagement gedeckt werden. Wichtig ist hierbei die Ergänzung, dass sich die Arbeit nicht nur durch die Ausarbeitung der Mitarbeiter*innen zusammensetzt, sondern die gesamte Arbeit von der Mitwirkung der Ehrenamtlichen in diesen Prozessen, den Impulsgebenden, den Arbeitskreisen bis hin zu den kooperativen Instrumenten essenziell für die Verstetigung des Projektes sind und nur gemeinsam erarbeitet werden konnten bzw. können.
Zuletzt wurde gemeinsam ein Versuch vorgenommen, die Entwicklungsabschnitte des Projekts in die Ansätze von TopDown und BottomUp einzufügen. Für den Abschnitt der Impulse lässt sich zusammenfassen, dass die ersten Anstöße und Impulse durch Akteur*innen der Verwaltung initiiert wurden, wodurch dieser eindeutig als TopDown Ansatz zu deuten ist. Jedoch wurde hier hinzugefügt, dass Impulse, die aus den TopDown Ansätzen kommen, unbedingt auf einen Widerhall stoßen müssen oder sollten, wenn diese umgesetzt werden sollen. Es wurde also betont, dass beide Ansätze essenziell für die Umsetzung gemeinsamer Vorhaben sind. Für die obere Struktur gilt, dass die Kommunikation in beide Richtungen relevant ist – daher ist die Transparenz, Kommunikation und die Mitwirkung bzw. das Interesse der Bürgerschaft auf dieser Ebene wichtig, da nur so ein kooperativer Prozess stattfinden kann. Dieser Abschnitt beinhaltet also beide Ansätze des TopDown und BottomUp. Ergänzt wurde zu dieser Einordnung, dass die Hauptamtlichen die Zeit und Ressourcen mitbringen und sich in der Rolle sehen, eine Ermöglichungskultur zu schaffen. Dadurch kann eine Struktur vorgegeben, jedoch inhaltlich kein fester Rahmen gesetzt werden, da dieser nicht vorgegeben, sondern gemeinsam erarbeitet werden sollte. Von Seiten der Ehrenamtlichen braucht es also die Unterstützung und bestenfalls die aktive Mitwirkung. Beispielsweise wird bei manchen Anfragen im MitMachBüro eine aktive Unterstützung, Beratung oder Vermittlung angeboten, um zur Realisierung von Ideen zu verhelfen, in anderen Fällen können beispielsweise bei Raumanfragen direkte Hilfe angeboten werden,
92
indem der eigene Raum zur Verfügung gestellt wird. Es werden also Mittel, die vorhanden sind, für die Bürgerschaft bereitgestellt, um so gut es geht bei Anfragen und Anliegen unterstützen zu können. Auch das Erfahrungswissen der Mitarbeiter*innen fließt in diesen Prozess mit ein. Die weitere Arbeitsweise lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Alle ziehen an einem Strang und es wird gemeinsam auf Augenhöhe, also im Miteinander, gearbeitet. Dabei kann es selbstverständlich Kontroversen geben, aber im Wesentlichen möchten alle Beteiligten die Stadt gemeinsam voranbringen und entwickeln.
Nichtsdestotrotz gab es im Allgemeinen eine Unzufriedenheit mit der Einordnung in die Ansätze des TopDown und BottomUp, da diese eine Hierarchie darstellen. Der Fokus der Arbeit liegt auf dem Erarbeiten gemeinsamer Lösungen mit der Politik, Verwaltung und den Ehrenamtlichen zusammen. Zudem ist die klare Unterteilung, dass die Vorgaben einer Struktur von TopDown und die Inhalte von BottomUp kommen, nicht immer korrekt: In manchen Fällen arbeitet das Büro inhaltlich (beispielsweise über die Mitwirkung bei der Freiwilligenakademie oder die Organisation von Vortragsreihen) und die Ehrenamtlichen an formellen Aufgaben. Daraus lässt sich eine Komplexität herausdeuten, die in der folgenden Grafik durch die horizontale Ausrichtung des „Miteinanders“ dargestellt wird, um die Hierarchie an dieser Stelle zu durchbrechen.
93
94
95





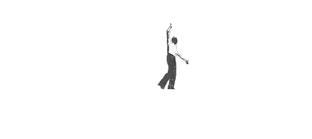













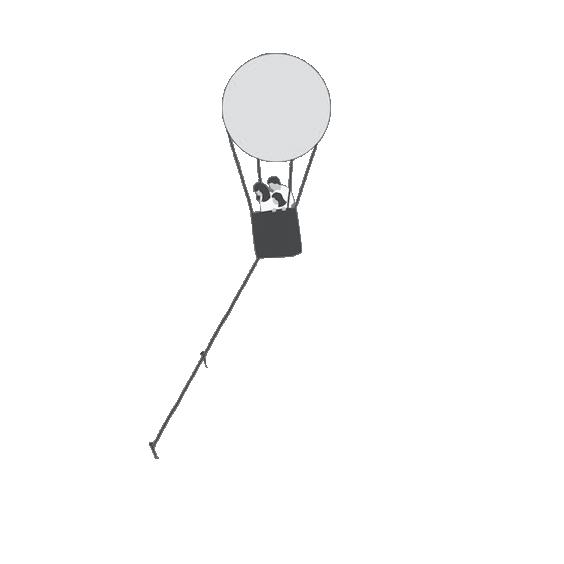

96 gründun sta KOMMUNE en ga ge me nt legitimiert prozesse FÖRDERPROGRAMM ENGAGIERTE STADT politik verwaltung wirtschaft stadtgesellschaft CHANGE + erweitern
INITIATIVE HANDLUNGSDRUCK FORDERUNG po li tik BERATUNG + UNTERSTÜTZUNG transparenz &k o m m u n i k a t i o n RATSBESCHLUSS INITIATIVE
GRÜNDUNG
faire prozesse
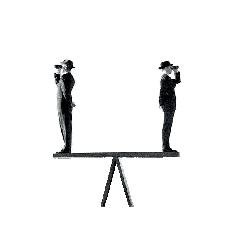

SICHTBARKEIT
zentralität

pl n



PRÄSENTATIONS FLÄCHE



city caution
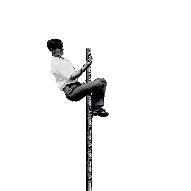








under construction ZENTRALE ANLAUFSTELLE





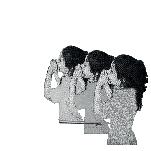
verwaltung



FINANZIELLE

NETZWERK ERWEITERN


RAUM ÖFFNEN netzwerk weiterbildung austausch




bereitstellung d u r c h v e r w a l t u n g

97 ng mitma
k o m m u n a l e planung andocku
RESSOURCEN KURZE ABSTIMMUNGSWEGE
& stadtmachen ili g u ng för d e nr
NIEDRIGSCHWELLIGER ZUGANG GRÜNDUNG MITMACHGREMIUM pa rticipa teparti cipate
FÖRDERMITTELAKQUISE
an bestehende n e t z w e r k e a n d o c k e n
CASE-STUDIES
MitMachBüro: Interview
Anke Skupin ist Diplom-Pädagogin und kommunale Mitarbeiterin der Stadt Schwerte. Sie arbeitet im MitMachBüro und ist verantwortlich für die Organisation und Moderation des partizipativen Entwicklungsprozesses in der Engagierten Stadt./ Dr. Christopher Wartenberg ist Kulturwissenschaftler und arbeitet als Ehrenamtskoordinator im MitMachBüro. Er beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung zivilgesellschaftlicher Engagement- und Partizipationsstrukturen.
Burcu Daglayan: Wie ist das Projekt entstanden? Wer ist daran beteiligt und welche Räume werden genutzt?
Anke Skupin: Mit dem Projekt gestartet sind wir 2015, weil es an ein Förderprogramm aufgehangen wurde. Das nannte sich “Engagierte Stadt” und hat uns ermöglicht, einmal über die finanziellen Mittel, die wir bekommen haben, ein Institut mit an Bord zu holen, das uns begleitet hat. Die “Stiftung Mitarbeit” aus Bonn und wir haben einen vierjährigen Prozess gemacht, partizipativ, um das zu erarbeiten, worauf die MitMachStadt heute fußt. Der Bürgermeister war mit dabei genauso wie Wirtschaftsakteure, Menschen aus der Verwaltung, aus jeder politischen Fraktion eine Person, Menschen aus Initiativen und Vereinen, die durch einen Auswahlprozess in das Gremium reingekommen sind. Wir haben damals versucht, ein Stück Stadtgesellschaft abzubilden, und damals war unser Weg noch hin zur Bürger*innenkommune. Wir haben ein
Konzept geschrieben, die Schwerter Leitlinien, welches auf den Ergebnissen mehrerer Partizipationsverfahren aufbaut und 2019 veröffentlicht wurde. Wir haben damals einen einstimmigen Ratsbeschluss bekommen, was sehr schön war. Ich glaube, es lag daran, dass wir uns in dem vierjährigen Prozess eigentlich jedes Jahr einen Beschluss geholt haben. Wir sind mit Teilen der Entwicklungsgruppe immer in die Fraktion gegangen und haben vorgestellt, was wir erarbeitet haben, haben noch mal gehört, was ihnen wichtig ist, was könnte noch mit rein, sodass es dann auch einfach war, 2019 ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen.
Christopher Wartenberg: Genau, wir hatten immer einen einstimmigen Ratsbeschluss, eben weil wir in den Fraktionen waren. Das heißt, wenn da Themenfelder waren, wo die Politiker*innen gesagt haben, das sehen wir kritisch, dann konnte man direkt nicht nur mit der Verwaltung oder dem Engagement, sondern auch noch mit Leuten aus der Wirtschaft sprechen und so die Bedenken aus dem Weg räumen. Das hat immer gut funktioniert.
AS: Und die Leitlinie ist eigentlich das Grundsatzpapier, auf dem dann alles aufgebaut worden ist. Wir haben dieses MitMachBüro zentral am Marktplatz eröffnet, was die Funktion hat, dass Menschen sich dort beraten lassen können zum Thema bürgerschaftliches Engagement. Vereine, Initiativen können dort hinkommen und es gibt die Möglichkeit zu schauen, was für Fördermöglichkeiten vorhanden sind. Wir machen dort kleinere Workshops zum Bereich Kommunikation oder Digitales, also relativ breit aufgestellt.
98
Das ist so der eine Teil, also die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in dieser Stadt. Der andere Teil ist, Beteiligung in der Stadtgesellschaft zu fördern. Wir sitzen hier direkt am Markt, und vor uns ist das größte Umbauprojekt, was wir, glaube ich, in den letzten 15 Jahren hatten oder haben – die Umgestaltung des Schwerter Marktplatzes. Wir haben hier sehr viele Gespräche geführt, weil das sehr kontrovers in der Bürgerschaft diskutiert worden ist. Das ist bei Beteiligungen oder Planungsanliegen häufig so, dass Veränderungen nicht immer positiv angenommen werden. Beim Marktplatz war das ähnlich. Der Marktplatz hat eine hohe Identifikation in der Stadtgesellschaft, ist sozusagen das Wohnzimmer in einer Stadt, sodass es große Kontroversen gab zwischen denen, die bewahren wollten, und denen, die gesagt haben, wir müssen hier etwas tun. Themen waren Barrierefreiheit, Abdichtung des Tiefgaragendaches und eine neue Architektursprache umzusetzen. Damals standen hier vorne Bäume, zwei davon sind verpflanzt worden, zwei waren hinfällig, die konnten nicht gehalten werden. Das war auch ein Riesenthema. Es hätte fast zu einem Bürgerbegehren geführt. Die Stimmenanzahl dafür war damals nicht ausreichend. Wir haben zur Verfügung gestanden, haben die Pläne erklärt, Anregungen, Befürchtungen, Sorgen aufgenommen und waren sehr viel im Kontakt. Das war sozusagen das Analoge. Aber das gibt es eben nicht nur im persönlichen Kontakt. Unsere Öffnungszeiten sind so gewählt, dass wir immer zu den Marktzeiten geöffnet haben, einmal im Monat, Samstag, einen langen Tag in der Woche, das ist
der Donnerstag bis 19 Uhr, eben für Berufstätige, dass sie uns auch ansprechen können, und wir haben das digitale MitMachPortal aufgebaut.
CW: Genau, es gab aber noch einen Schritt davor. Voraussetzung dafür, dass wir das Büro aufmachen konnten, war erstmal, dass eine Stelle geschaffen wurde, die nur für die Engagementförderung da ist. 2021 wurde dann das MitMachPortal online geschaltet, auf dem Allgemeine Informationen zum Hintergrund, Aktuelles und Leitlinien zu finden sind. Man kann auch noch unter Engagierte und Gruppen gucken, was in Schwerte an Engagement läuft, da ist ganz viel aufgelistet und man kann sich gut einen Überblick schaffen. Unter Ideen der Bürger*innen kann man selbst in einem formlosen Formular seine Idee einreichen und wenn man innerhalb von acht Wochen 100 Unterstützer*innen findet, dann geht es in den politischen Fachausschuss. Unter Vorhaben der Stadt findet man aktuelle Vorhaben aus fast allen Ämtern. Wir haben fünf Stufen der Beteiligung festgelegt, diese beginnen bei “reiner Information”, dann “Dialog”, dann “Meinung einholen” und zuletzt “Bürger*innen entscheiden mit” und “Bürger*innen entscheiden alleine”. Die letzteren Fälle hatten wir noch nicht. Das meiste, was rausgeht, ist zur Information über Bauvorhaben da. Es gibt außerdem Bebauungspläne, die dem Portal zu entnehmen sind. Was wir auch schon einige Male hatten, war, in den Dialog mit dem*der Bürger*in zu treten. Es gibt auch eine Seite für Beteiligungsprojekte, die dafür da ist, dass, wenn direkte Abstimmungen laufen, die dort verlinkt sind. Nach der
99
Eröffnung des Büros und der Onlineschaltung des MitMachPortals wurde dann das MitMachGremium ins Leben gerufen, das die Fortsetzung der Entwicklungsgruppe ist. Das erste Gremium hat Ende 2021 getagt. In der ursprünglichen Entwicklungsgruppe war Politik, Wirtschaft, Engagement und Verwaltung. Wir haben es noch mal ergänzt und jetzt haben wir fünf Leute aus der Politik, also aus jeder Fraktion, fünf Personen aus der Verwaltung, die durch den Bürgermeister bestimmt werden, außerdem drei Teilnehmende aus der Wirtschaft, drei Teilnehmende aus dem Engagement Bereich, vier zufällig Ausgewählte und eine Person aus dem Kinder- und Jugendparlament. Der Bürgermeister ist auch mit dabei, hat aber genauso eine Stimme, wie die zufallsausgewählte Person. Das Gremium ist ein beratendes Gremium und tagt viermal im Jahr. Wir gehen die Themen der Leitlinien immer wieder durch und schauen, wo etwas verbessert werden kann. Wenn es das Gremium nicht geben würde, dann läge das Thema und die Entscheidung alleine bei der Verwaltung und die Politik hätte noch ein Auge drauf. Man hätte eben nicht diese Einflüsse von außen, die mitsprechen. Das Gremium arbeitet ausdrücklich nicht inhaltlich, sondern nur an der Form, wie Beteiligung und Engagementförderung funktioniert, es wird also darüber debattiert, wie man die Leute dazu kriegt, sich beispielsweise an Gestaltungsprozessen zu beteiligen.
AS: Das Gremium hat den Rückhalt von allen, und hat sich als ein sehr gutes Instrument herausgestellt, wenn man Beteiligung und Engagement in der Stadt fördern will. Wenn es eben
gewollt ist durch eine Gruppe, die sich engagiert, hat es einen anderen Stellenwert. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine Frage.
BD: Vielleicht können Sie in wenigen Sätzen zusammenfassen, was Ihre Zielsetzungen waren.
AS: Als grobe Zielsetzung natürlich das, was an bürgerschaftlichem Engagement in dieser Stadt ist, zu halten und zu fördern, diese auch als gesellschaftliche Stadtakteur*innen zu begreifen, die Stadt mitgestalten und entwickeln. Alles, was an Zukunftsaufgaben da ist, können die Verwaltung und Politik gar nicht alleine. Wir haben Initiativen, die zum Beispiel das Bürgerbad Elsebad aufgebaut haben und die ganz viel zum Thema Klimaschutz machen. Es ist ein unglaublicher Mehrwert, den wir natürlich versuchen, bestmöglich zu halten, aber auch weiterzuentwickeln. Wir fragen die Initiativen auch oft, was sie brauchen, wenn wir unser Doppelprogramm
“Freiwilligenakademie und Schwerte zusammen” gestalten. Das eine sind ganz konkrete Angebote zur Unterstützung, ob zu Kommunikation oder digitales arbeiten. Der andere Teil, also “Schwerte zusammen”, gibt gesellschaftspolitische Impulse und Inputs, die oftmals auch aufgegriffen werden. Es geht uns immer auch darum, möglichst viele Anregungen und Ideen einzubringen, damit es eine höhere Identifikation mit dem gibt, was gebaut wird. Im Moment gibt es auch ganz viel zum Thema Spielplatzgestaltung, und wir merken selber, dass Entscheidungen, die gemeinsam mit der Stadtgesellschaft
100
getroffen werden und Leute die Möglichkeit haben, sich einzubringen, einen sehr großen Mehrwert haben. Es ist nicht immer einfach, die Zielgruppen zu erreichen. Wir hatten zum Beispiel in einem Vorort eine Stadtteilkonferenz und es ging um die Umgestaltung des Ortsteils. Wir wussten, dass die Menschen nicht zur Stadtteilkonferenz kommen und haben uns dann mit Pavillon und Stühlen und Tischen herausgestellt und haben gewartet. Mit denen sind wir dann nochmal in den Dialog gegangen und haben gehört, was so deren Themen und Anregungen sind, was können wir mitnehmen? Also, Beteiligung ist eben auch ein großer Fund. Aber wir merken auch, dass wir noch viel mehr aufeinander zugehen und noch mehr in die Öffentlichkeit müssen. Ich glaube, wir müssen noch mehr auf bestimmte Zielgruppen zugehen, also noch mehr raus, noch mehr in Kontakt.
CW: Genau. Die Frage nach der Zielsetzung würde ich mehr aus der Entwicklung heraus beantworten, also aus dem Arbeitskreis KuBiB (Initiative für Kultur, Bildung und bürgerschaftliches Engagement). Als wir in diesem Kreis zusammensaßen, mit Akteur*innen aus der Stadt, Hauptamtliche wie Ehrenamtliche, kam das Projekt “Engagierte Stadt” herein. Das wurde direkt als Chance gesehen, dass wir das Engagement mit der Beteiligung verbinden. Im Rahmen einer Vernetzungskonferenz wurde das Bild schon in die Stadt getragen, dass Beteiligung und Engagement zwei Seiten derselben Medaille sind. Dann gründete sich aus dieser Initiative der Arbeitskreis Engagierte Stadt, und damit verschob sich dann auch die
Zielsetzung von nur Engagement auf Engagement und Beteiligung. Also seit 2015/16 kann man sagen, dass das Thema Beteiligung sehr stark dazugekommen und auf einer Ebene mit der Engagementförderung ist.
BD: Wann gab es denn die ersten Impulse? Von wem wurden sie angestoßen beziehungsweise durchgesetzt?
AS: Die Initiative KuBiB hat damals den Förderantrag an das Förderprogramm “Die Engagierte Stadt” gestellt. Gegründet haben KuBiB Jochen B. und ich. Das hatte damit zu tun, dass ich damals das Themenfeld in der Verwaltung Begleitung des demografischen Wandels innehatte. Wir haben einen Demografie-Bericht geschrieben, und eine These damals war: Wir brauchen die Menschen, um die Stadt zu entwickeln. Wir können das nicht alleine, weder Politik noch Verwaltung – wie kann das gehen? Daraus hat sich der Arbeitskreis mit verschiedenen Stadtakteur*innen gebildet. Und dann kam die große Chance, mit dem Förderprogramm Engagierte Stadt. Wir haben einen Antrag gestellt und sind dann darüber begleitet worden. Wir sind nach wie vor in diesem bundesweiten Netzwerk der Engagierten Stadt und eben von Anbeginn dabei. Das war auch ein großes Glück, weil damit verbunden waren finanzielle Mittel und die Stiftung Mitarbeit, die wir damals eingekauft haben. Ich glaube, sonst wären wir heute auch nicht so weit, wie wir sind, das muss man einfach sagen. Ich glaube, zu jedem Entwicklungsprozess braucht es manchmal eben die Expertise von außen, und die muss man
101
CW: Ohne das Förderprogramm
“Engagierte Stadt”, wo mehrere 10.000 € hergekommen sind, hätten wir nicht die externe Moderation bei der Bürger*innenkommune gehabt. Meine Stelle als Ehrenamtskoordinator und die Homepage “SchwerEngagierTe” hätten wir nicht finanzieren können, entsprechend auch nicht das Forum “SchwerEngagierTe”, wo sich die Gruppen immer vorgestellt haben, und auch das Büro und die Ladenlokalanmietung. Man muss aber auch sagen, das Programm “Engagierte Stadt” hat nicht nur Geld gegeben, sondern auch ganz viel inhaltlichen Input, Begleitung, Gespräche, Vernetzungstreffen und ganz viel Know-how.
BD: Kann man sagen, dass der allererste Handlungsdruck von Seiten der Stadtverwaltung initiiert wurde?
AS: Also, der demografische Wandel war natürlich etwas, was die Stadtverwaltung damals sehr bewegt hat. Es gab damals diesen klassischen Spruch “Wir werden älter, wir werden weniger und wir werden bunter”. Und wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Also die Veralterung der Städte, das war damals ein bundesweites Thema, und dann natürlich auch 2015 die Zuwanderung, die geflüchteten Menschen, die gekommen sind und die Herausforderungen, die dann da waren. Insofern kann man sagen, das Thema demografischer Wandel und dieses Erkennen, wie wichtig es ist, mit gesellschaftlichen Akteur*innen zusammenzuarbeiten, war eigentlich
der Startpunkt. Und diesen Arbeitskreis “Engagierte Stadt” gibt es ja heute noch, und der macht, im Gegensatz zum MitMachGremium, sehr konkrete Projekte. Im Herbst dieses Jahres wird es beispielsweise eine Vortragsreihe zum Thema Klimawandel mit dem Fokus auf die Stadt Schwerte geben.
CW: Das ist auch ein guter Mix zwischen den Haupt- und Ehrenamtlichen.
BD: Welche Strukturen wurden vorgefunden? Also gegen was wurde bei der Planung und Umsetzung agiert, und hat dabei etwas irritiert?
AS: Ja, auf jeden Fall. Ein klassisches Beispiel war damals in der Entwicklungsgruppe der Bürger*innenkommune, was das Vorgängermodell von dem MitMachGremium war. Da ist mir mal tatsächlich – ich hab‘s gar nicht so gemeint – der Begriff Steuerungsgruppe rausgerutscht, und da entbrannte plötzlich eine Debatte in der Gruppe. Ich meinte aber die Vorbereitungsgruppe für die Sitzung. Es gab plötzlich ein unglaublich großes Misstrauen. Wer sitzt in dieser Steuerungsgruppe? Werden wir hier gesteuert? Wir haben dann sehr breit diskutiert, weil ich glaube, was ganz wichtig ist in diesen Prozessen, ist Transparenz. Man muss immer wieder erklären, man muss immer wieder herleiten und die Prozesse offenlegen. Wie ist es zu Entscheidungen gekommen? Wenn das nicht passiert –übrigens auch grundsätzlich in Beteiligungsprozessen – dann hat man ganz schnell eine Situation, in der die Leute sagen: „Macht euren Kram
102
finanzieren.
alleine. Wenn ich hier nicht auf Augenhöhe dabei sein kann, dann mache ich nicht mit.” Oder “Wenn das, was ich auch beizutragen habe, nicht gehört wird und alle unsere Anregungen nicht zum Tragen kommen, auch in Beteiligungsprozessen, mache ich nicht mit.“ Ich habe einmal diesen Satz von einer sehr guten Referentin zu diesem Thema gehört, die gesagt hat: “Wenn es eine Situation gibt, wo klar ist, dass Dinge nicht umgesetzt werden können, dann lieber gar keine Beteiligung machen.” Sonst hat man eine Stimmung in der Stadt, die kontraproduktiv ist.
BD: Was wurde mit Projekt bewirkt? Wie wurde das Projekt aufgenommen und war/ist es erfolgreich?
AS: Es war in jedem Fall erfolgreich. Also, all das, was wir jetzt beschrieben haben, hätte es so in der Form nicht gegeben. Ich glaube, wir hätten dieses Büro nicht, hätten das Portal nicht, wir hätten diese breite Vernetzung in die Stadtgesellschaft und Verwaltung in dieser Form nicht. Und man muss sagen, dieser Prozess ist deshalb auch erfolgreich, weil sowohl die Verwaltung als auch die Verwaltungsspitze, der Bürgermeister, dabei waren. Also, die Verwaltung und die Politik müssen diesen Weg mitgehen. Wenn man nicht auf diesen Rückhalt die Strukturen aufbaut, also, wir sind ja eine städtische Einrichtung und wenn man diesen Background nicht hat, dann, glaube ich, ist es schwierig. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsgarant, zu sagen “Ja, man kann dann etwas bewegen.”
CW: Ja, es ist ganz wichtig, mit allen im Gespräch zu bleiben. Es ist auch
entscheidend, mit den Fraktionen im Gespräch zu bleiben. Es gibt auch eine verwaltungsinterne Gruppe, in der aus allen Ämtern jeweils eine Person ist, die uns auch unterstützen.
AS: Insofern waren Transparenz und Kommunikation ein großer Erfolg. Das hat aber mit Vielen zu tun, die daran mitgewirkt haben. Verwaltung, Politik sind wichtig, damit es überhaupt entstehen kann. Aber die ganze Bürger*innenschaft, die dahinter steht, die ganzen Vereine und Initiativen, die mitgewirkt haben, müssen natürlich auch wollen, sonst funktioniert der Bereich der Engagementförderung nicht. Insofern würde ich sagen, erfolgreich ja, es ist aber immer noch Luft nach oben, das ist überhaupt keine Frage. Das, was vorhin gesagt wurde, dass uns eigentlich immer noch zu wenig Leute kennen. Wir müssen noch mehr in die Stadtgesellschaft rein, die Beteiligungsprozesse müssen noch mehr zu den Menschen, die schwer zu erreichen sind. Ich glaube allerdings, dass wir uns da nicht so sehr von anderen Städten unterscheiden.
BD: Wurde das Projekt verstetigt? Wenn ja, in welcher Form und von wem?
CW: Das Projekt ist institutionalisiert, wir haben eine feste Haushaltsstelle für die Miete, und ein Budget, um Projekte umzusetzen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es irgendwann wieder einen Bürgermeisterwechsel geben wird. Dann gibt es häufig Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung.
103


GRÜNDUNG INITIATIVE

INITIATIVE
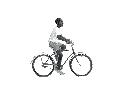

+ erweitern
VORSTELLUNG IDEE
bürgernahe ve g


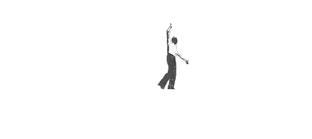
initiieren projekt

kreative bürokratie

FORDERUNG
sta
IDEE + DENKANSTÖßE VISION
HANDLUNGSDRUCK

kreativzentrum
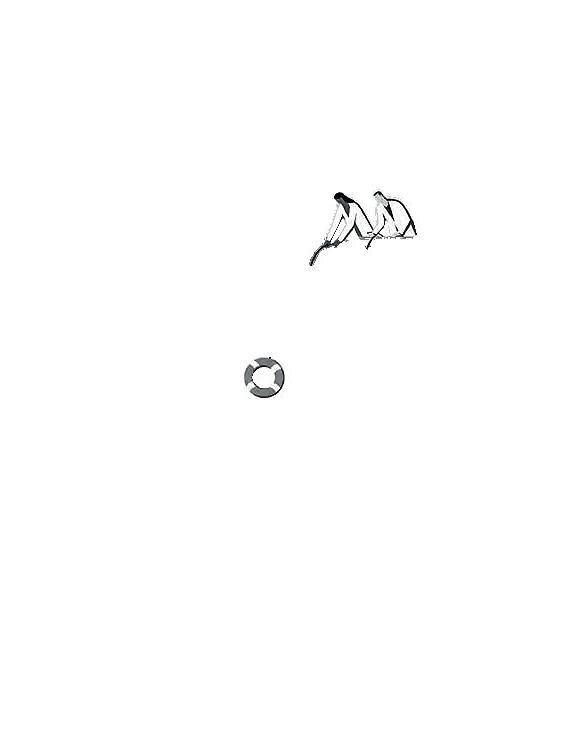

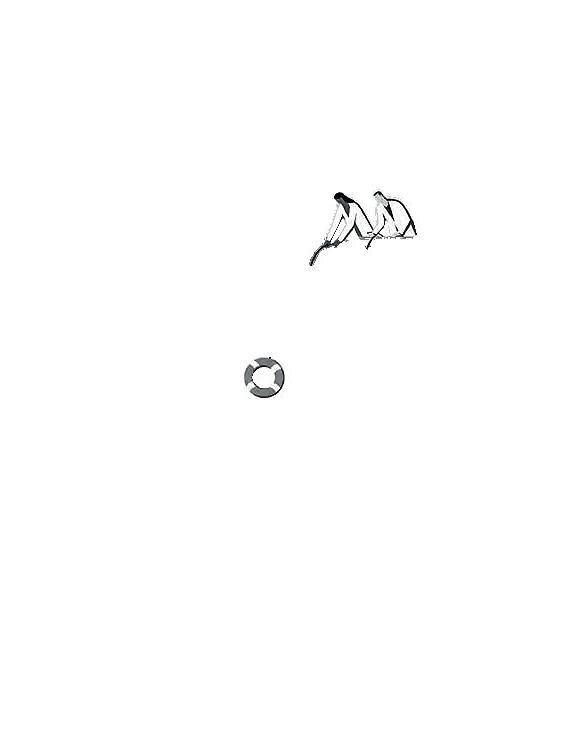










transparenz &k o m m u n i k a t i o n
referat k r e a t i v e s t d t
BERATUNG + UNTERSTÜTZUNG


RATSBESCHLUSS

referat kreative stadt
legitimiert prozesse
förderung kultur &kreativwirtschaft
KOMMUNE en ga



FÖRDERPROGRAMM


politik verwaltung wirtschaft stadtgesellschaft
regional budget+ smarte kielregion
SMART CITIES
ENGAGIERTE STADT
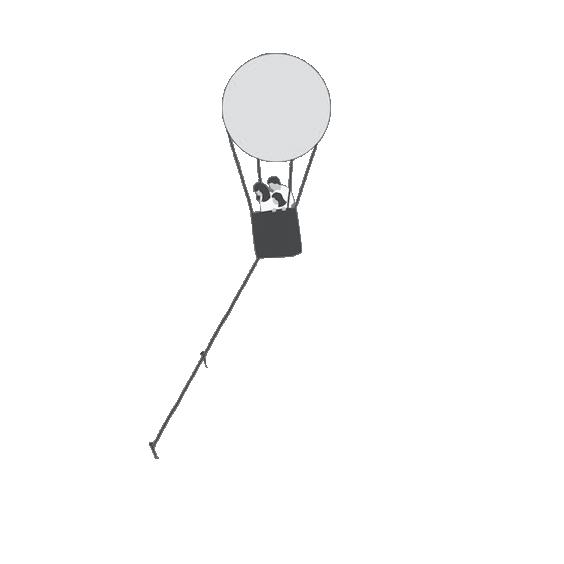

rathaus
(bottom)up entraler
gründung

104
GRÜNDUNG MITMACHGREMIUM
GRÜNDUNG
MITMACHGREMIUM



herausforderungen stadtentwicklung
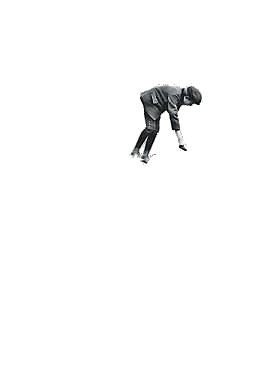

MOBILE

ZENTRALE
ANLAUFSTELLE
o r g a n i s a t i o n & struktur


COMMUNITY MANAGEMENT
under construction caution
SICHTBARKEIT






ZUSAMMENARBEIT
faire prozesse n a l e pl
zentralität

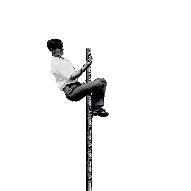


werts c h ä t z e n d e r u m g a n g

WISSENSTRANSFER
expertise

NETZWERK ERWEITERN

RAUM ÖFFNEN


v e r a n s t a l t u n g e n plan aufaug e n h ö h e

b e t e i l i g u n g + ver





g mitma




DRITTER RAUM +



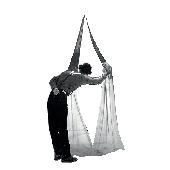
AUSTAUSCH e tfahcsll



begleit
ENTWICKLUNG + UMSETZUNG
stadtm a c h e n d ne kokreatives v e r f a h r e n




NIEDRIGSCHWELLIGER
rathaus



PROZESSMODERATION

KURZE
e r s t r u k t u r e n v e r w a l t u n g
ABSTIMMUNGSWEGE









netzwerk weiterbildung austausch
TESTWOCHEN

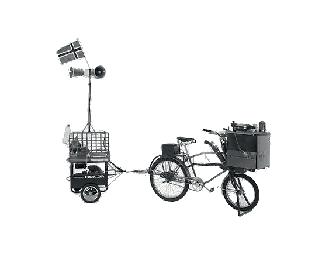
reale be
teste setsets te
KONZEPT ENTWICKLUNG



beteiligungsforma t e e r p r o ben




FINANZIELLE RESSOURCEN

a l t u n g

bereitstellung


an bestehende n e t z w e r k e a n d o c k e construction

FÖRDERMITTELAKQUISE
g u ng för d e nr caution
rticipa teparti cipate
ili
PROTOTYPING


sabläufe o p t i m i e r e n
andocku rwalt g





KOPRODUKTION wöchentlicherjour-fixe

under construction
105
innerhalbd
r bürgerkontak
Eine Überlagerung der Kooperationsgerüste macht sichtbar, wie die Prozessanalysen der Projekte MitMachBüro und Tiny Rathaus in Relation zueinanderstehen und ermöglicht einen Vergleich zwischen diesen. In dem folgendem Abschnitt wird auf die Gemeinsamkeiten und Differenzen der Projekte auf den Ebenen der Impulse, obere Struktur, Instrumente und Methoden und schließlich der Verstetigung eingegangen und inhaltlich weiter vertieft.
Bezüglich der Impulse lässt sich zusammenfassen, dass in beiden Projekten die Impulsgebenden und neue Denkanstöße durch weitere innovative Projekte signifikant sind, um sich kritisch mit bestehenden Strukturen und Prozessen auseinanderzusetzen. Dies ermöglicht das Vertiefen und Erarbeiten neuer Möglichkeiten genauso wie experimentelle, neue Formen der Zusammenarbeit zu erproben und im Allgemeinen bestehende Strukturen zu überdenken. Insbesondere die Impulsgebenden, welche neue Ideen anstoßen und somit eine Schlüsselfunktion für die Anfänge der Projekte bilden, sind essenziell in diesen Prozessen. Die Gründe für die Impulse können, wie in beiden Fällen zu deuten ist, ganz unterschiedlich sein: Ob durch das Sichtbarmachen anderer Best-Practice Projekte oder das Erkennen eines Handlungsdrucks aufgrund des demografischen Wandels und den daraus entstehenden neuen gesellschaftlichen Anforderungen; Impulse fördern das Nachdenken über die Verbesserung von bestehenden Gegebenheiten und sind in diesen Prozessen nicht wegzudenken. Für beide Projekte ist es wichtig zu erwähnen, dass die Hauptakteur*innen – trotz der Unterscheidung in die Ansätze des TopDown und BottomUp – im Rahmen ihrer professionellen Tätigkeit gehandelt haben und sich nicht (zumindest ausschließlich) ehrenamtlich in ihrer Freizeit einbringen mussten. Dieser Hintergrund bringt auch eine feste Basis mit sich, auf die in beiden Fällen aufgebaut werden konnte und schon zu Beginn ein gewisser Spielraum gegeben war. Auch wenn dieser noch erprobt, erweitert und ausgedehnt werden musste, wurde schon zu Beginn ein Rahmen geschaffen, in dem gehandelt werden konnte.
Durch die Überlagerung der Kooperationsgerüste wird sichtbar, dass die Realisierung beider Projekte durch die Unterstützung der Politik
106
und den Ratsbeschlüssen, die in dem Fall des Tiny Rathauses schon zuvor und für das MitMachBüro begleitend im Rahmen der Leitlinie für die MitMachStadt beschlossen wurden, ermöglicht werden konnte. Aus den Erfahrungen der Akteur*innen und ihrer Praxis lässt sich für beide Prozesse sagen, dass die Zustimmung von Entscheidungsträger*innen und die Schaffung eines rechtlichen Rahmens Prozesse erleichtert haben und für die Umsetzung neuer, experimenteller Ideen relevant und erforderlich waren. Diese Form der Kooperation fördert des Weiteren aktiv eine Ermöglichungskultur, welche entgegen einer ablehnenden Haltung im Sinne von der Fokussierung auf Probleme und Einschränkung eine lösungsorientierte Haltung anstrebt, durch die bei neuen Herausforderungen und Konflikten aktiv nach Lösungen und der Schaffung eines Möglichkeitsraumes gesucht wird. Für die Stadt Kiel lässt sich sagen, dass durch das zuvor gegründete Referat „Kreative Stadt“ sich bereits im Vorhinein aktiv mit der Umsetzung der kreativen Bürokratie und der Förderung kreativer Ideen beschäftigt wurde, somit war die Basis für das Tiny Rathaus schon gegeben. Die Stadt Schwerte brachte auch schon das Interesse mit, das Potenzial des Engagement für mehr Beteiligung zu fördern: Darauf aufbauend wurde im Weiteren gemeinsam an einer Leitlinie und neuen Methoden gearbeitet. Die Beratungsfunktion der Politik in diesen Prozessen ermöglichte zudem einen sicheren Umgang bei der Bewerbung um Fördermittel, sei es durch die Unterstützung des Referats Kreative Stadt oder dem regelmäßigen Austausch mit Fraktionsspitzen. Im Allgemeinen ist eine offene Haltung von Seiten der Stadt für die Erarbeitung neuer Schnittstellen zwischen der Verwaltung und Stadtgesellschaft grundlegend und bildet einen signifikanten Baustein für die weitere Praxis beider Projekte.
Die Überlagerung der Gerüste macht in dem Bereich der strategischen Maßnahmen und Instrumente deutlich, dass die Prozessabläufe beider Projekte eine Gemeinsamkeit in der Einrichtung einer neuen, niedrigschwelligen Anlaufstelle aufweisen, die eine bürgernahe Verwaltung ermöglichen. Durch die mobile Anlaufstelle des Tiny Rathauses können inhaltliche Formate der Verwaltung durch ein Bewerbungsverfahren niedrigschwellig und
107
dezentral an die Stadtgesellschaft getragen werden. Das MitMachBüro hingegen bringt eine direkte Andockung an die Verwaltung mit und kann ebenfalls durch den erweiterten, festen Raum niedrigschwellig auf die Themen und Aktionen für die Förderung von Beteiligung aufmerksam machen und Dialoge mit der Stadtgesellschaft führen. Beide Projekte haben also die Vermittlungsfunktion zwischen der Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft und die Schaffung eines neuen, dritten Raumes, welcher als Präsentationsfläche und/oder Probe- und Umsetzungsraum für die Förderung von Beteiligung dient, gemein.
Für die Instrumente und Methoden lässt sich im Allgemeinen zusammenfassen, dass das MitMachBüro bei der Umsetzung der Methoden an bereits bestehende Strukturen und Netzwerke anknüpfen konnte, da die Initiative KuBiB, aus der die Arbeitskreise der MitMachStadt und auf welches die Arbeit des MitMachBüros aufbaut, zuvor in diesen Themen gearbeitet hat und ihre Mitglieder*innen ihre vorherigen Erfahrungen und Praxis mit in die Prozesse und den weiteren Aufbau dieser Strukturen eingebracht haben. Die Umsetzung des Tiny Rathauses beanspruchte im Gegensatz dazu einen längeren Realisierungszeitraum, da zum einen neue Methoden und Instrumente erst erprobt werden mussten, und das mobile Format einen längeren Bearbeitungszeitraum aufgrund der Organisation von Programmen und Standorten mit sich bringt und mit weiteren bürokratischen Prozessen verbunden ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den kooperativen Methoden ist, dass das MitMachBüro durch die bestehende Andockung an die Verwaltung keine ausgiebigen Testphasen durchführen musste, um eine Verbindung zwischen den strukturellen Abläufen herzustellen. Im Fall des Tiny Rathauses mussten diese zuerst erprobt, ausgewertet und durch interne und öffentliche Verfahren optimiert werden und befinden sich bislang im Prozess, diese Strukturen in bestehende Systeme einzubauen. Dass die Koproduktion und die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Akteur*innen des Tiny Rathauses noch verbesserungswürdig sind, erschwert diesen Verankerungsprozess ebenfalls.
108
Damit hängt ebenfalls das Potenzial für eine erfolgreiche Verstetigung im Sinne der Institutionalisierung der Projekte zusammen: Das MitMachBüro hat durch diese direkte Andockung sehr kurze Abstimmungswege in Verwaltungsstrukturen und ist regelmäßig im Austausch mit den Fraktionen. Es baut auf einer Leitlinie auf, die mit und von der Stadt erarbeitet wurde, und konnte daher neue Strukturen schnell in Prozesse verankern und institutionalisieren. Im Gegensatz dazu ist das Tiny Rathaus, mit den bereits beschriebenen Herausforderungen konfrontiert, noch in der Entwicklungsphase, eine feste Basis für die Verankerung aufzubauen. Die Haltung der Politik und Verwaltung ist ebenso relevant für den Verstetigungsprozess, da rechtliche Rahmenbedingungen die Grundlagen für diesen schaffen können.
Für die kooperativen Prozesse beider Projekte lässt sich abschließend sagen, dass Kooperationen in partizipativen Stadtgestaltungsprozessen noch immer erprobt werden und Partner*innen dafür eine offene Haltung mitbringen müssen.
Gegenseitiges Lernen und das Erproben neuer Formen brauchen einen gewissen Spielraum, welcher wesentlich für diese Prozesse ist.
Die Förderung der gemeinwohlorientierten Arbeit von kreativen Stadtakteur*innen und aktiven Personen aus dem öffentlichen Dienst kann durch die Unterstützung von Politik und Verwaltung und einer Offenheit innovativen Ideen gegenüber immens gestärkt werden. Letztendlich verfolgen alle Akteur*innen ein gemeinsames Ziel: Die Förderung der Mitwirkung von der Stadtgesellschaft an der Stadtentwicklung.
109
IM GES
110
PRÄCH
111
...
IM GESPRÄCH MIT EXPERTINNEN
Hanna Noller
Hannah Noller studierte Architektur in Hamburg, Istanbul und Stuttgart. Sie ist Dipl. Betriebswirtin, gelernte Schreinerin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forschung und Lehre an verschiedenen Hochschulen tätig. Sie koordinierte unter anderem das transdisziplinäre Forschungsprojekt Future City Lab – Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur in Stuttgart und das Projekt CoLiving Campus –Kooperatives Wissenschaftsquartier in Braunschweig. Sie ist im Vorstand des gemeinnützigen Vereins Stadtlücken e.V., und untersucht seit 2023 im Rahmen ihrer Dissertation digitalanaloge Räume, in denen stadtgesellschaftliche Koproduktion stattfindet.
Burcu Daglayan: Zu Beginn eine allgemeine Einführung. Wer bist du und an welchen Projekten bist du zurzeit beteiligt?
Hanna Noller: Wer bin ich? Das finde ich immer nicht so einfach zu beantworten, da ich mit einer Schreinerlehre begonnen, ein BWLund Architekturstudium absolviert und somit schon verschiedene Maßstäbe der Architektur durchlaufen habe. Nach meinem Studium habe ich am Städtebauinstitut an der Universität Stuttgart gearbeitet und war dort die Koordinatorin des Projekts “Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur”. Zeitgleich zur Masterthesis habe ich das Projekt Stadtlücken gemeinsam mit weiteren Gestalter*innen gegründet, mit dem wir unterschiedlichste Projekte
in Stuttgart und anderen Orten umgesetzt haben. Ich war vor kurzem in Hannover Mitarbeiterin im Festival Theaterformen, wo es eben darum ging, dass das Staatstheater die Festivalbühne in den öffentlichen Raum bringt. Zeitweise war ich aber auch Mitarbeiterin bei Endboss, die auch viele Projekte zwischen diesen Maßstäben, also viele Beteiligungsprojekte, umsetzen. In den letzten Jahren war ich auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Hannover, wo wir eine Summerschool “Urban Conflicts” umgesetzt haben, wo Studierende kleine Interventionen im öffentlichen Raum umgesetzt haben. Jetzt bin ich Mitarbeiterin an der TU Braunschweig am Projekt CoLiving Campus und arbeite zeitgleich an meiner Dissertation zum Thema öffentliche Planungsplattformen. Diese untersucht die Schnittstelle zwischen Top-Down Planung, Beteiligung und zeitgleich den Bottom-Up Initiativen und versuche dort den Raum zu schaffen, an dem gemeinsam Stadt gestaltet werden kann.
BD: Was für eine Bedeutung haben Kooperationen in diesen Projekten?
Welches Potenzial entstand durch die kooperative Praxis und welche Ideen konnten nur dadurch ermöglicht und umgesetzt werden?
HN: Zum einen würde ich sagen, dass gerade Projekte in der Stadtentwicklung oder im öffentlichen Raum nur durch Kooperation möglich ist, weil der
112
öffentliche Raum niemandem speziell alleine gehört, sondern eigentlich ja uns allen. Ich denke aber, dass auch andere Projekte immer ein Potenzial bieten, zu kooperieren, da es – wenn man möchte, dass Menschen sich daran beteiligen oder teilhaben – immer eine Einstellungsfrage von der Person ist, die in der Entscheiderrolle ist. Wenn diese Person, oder in manchen Fällen auch die Kommune oder eine öffentliche Institution, entscheidet, dass Menschen daran partizipieren sollen, ist Kooperation in dem Sinne notwendig, damit sich Menschen überhaupt damit identifizieren und es nicht eine einfache Auftragslage im Sinne von Auftraggeber*in und Auftragnehmer*in wird. Wenn es darum geht, dass etwas gemeinsam entwickelt werden soll, eine gemeinsame Idee, ein Quartier oder eine Nachbarschaft, dann st es wichtig, dass man auf eine Augenhöhe kommt, damit sich alle Beteiligten auch wirklich mit einer eigenen Motivation einbringen. Das war auch im Reallabor immer ein großes Thema, also wie man die Wertschätzung entgegenbringt. Denn zum Beispiel, wir als Mitarbeitende an der Universität wurden mit einer 50% Stelle bezahlt, und das ist unsere Arbeitszeit. Die Teilnehmer*innen in den Realexperimenten waren entweder Studierende oder zivilgesellschaftliche Akteur*innen. Die Studierenden haben meistens ihr Projekt abgeschlossen und ECTS-Punkte dafür bekommen. Aber für die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen gibt es kein Geld, sondern nur quasi das Wissen, was sie daraus ziehen können oder die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen mit einzubringen. Zu Beginn war das alles kein Problem, aber mit der Zeit sind immer mehr Fragen
aufgekommen. Dasselbe gilt auch für Mitarbeitende aus der Verwaltung und ehrenamtlichen Akteur*innen. Der nächste Punkt ist Verantwortung. Dass wir als Stadtlücken-Gruppe intern miteinander kooperiert haben, hat den Vorteil, dass wir Verantwortung geteilt haben. Wenn ich alleine Projekte austrage, wie zum Beispiel meine Masterarbeit, dann lastet die Arbeit nur auf den eigenen Schultern, das setzt einen gewissen Druck aus. Als ich die Masterarbeit gemeinsam mit Sebastian angefangen habe und wir noch weitere Kolleg*innen dafür gewinnen konnten, Teil von Stadtlücken zu werden, wuchs die Gruppe. Dadurch wächst auch die Kraft, die die Verantwortung trägt. Wenn dann die Stadt mit uns kooperiert, wie zum Beispiel am Österreichischen Platz in Stuttgart, dann wird die Verantwortung ebenfalls wieder geteilt. Da wir als freie Initiative dabei waren hatte die Stadt auch die Rechtfertigung “da gibt es zivilgesellschaftliche Akteur*innen, die das wollen, und deshalb setzen wir das um”. Das kann auch ein Grund für Kooperation sein. Diese Verantwortung ist generell ein unsichtbarer Aspekt, der meiner Meinung nach nicht oft genug im Vorfeld angesprochen wird. Wer trägt eigentlich wirklich die Verantwortung und wie wird die Person dafür entschädigt, oder hat sie dafür auch mehr Entscheidungsgewalt? Da kann man auch noch mal nachjustieren oder schauen, wo der Fokus liegt. Kooperationen haben noch den Vorteil, dass es natürlich ein Multiplikator ist. Das ist wie bei Social Media, wenn beispielsweise nur eine Person einen Instagram Account bedient, dann ist sie damit beschäftigt, die Dinge zu teilen. Wenn dann verschiedene Institutionen
113
dazu kommen, und es immer weitre geteilt wird, dann wird die Reichweite viel größer. Das gilt auch im echten Leben, mit Veranstaltungen und so weiter. Also je mehr Kooperationspartner*innen, desto größer wird die Reichweite. Damit kann man auch arbeiten, wenn man eine gewisse Schlagkraft für die Sichtbarkeit eines Projektes braucht.
BD: Du hast vorhin auch von partizipativen Formaten durch Kooperation gesprochen. Was bedeutet Partizipation in diesem Kontext für dich? Welche Bedeutung haben Kooperationen in integrierten Stadtgestaltungsprozessen?
HN: Ich finde, das ist immer eine Definitionsfrage. Es gibt verschiedene Stufen von Partizipation, man kann zum Beispiel nur Informieren oder gewisse Beteiligungsfenster in Planungsprozessen öffnen. Wenn man aber generell Kooperation macht, ist die Frage, mit wem kooperiert wird und wer daran beteiligt ist, und auch, wie man dauerhaft teilhaben kann. Da sind verschiedene Instrumente gefragt, die auch immer projektabhängig sind. Für mich gibt es dafür keine allgemeingültige Antwort, wo ich sagen würde, dass immer alle mitsprechen können müssen. Es kann sein, dass dadurch vieles auch nicht passiert. Viel wichtiger ist die Frage, wann etwas Sinn macht, und wie das Projekt fortgeführt werden kann. Deshalb denke ich, ist es umso wichtiger, dass solche Prozesse moderiert werden von Personen, die in der Vermittlung stehen und immer wieder schauen, was die eigentliche Idee und das grundlegende Ziel ist. Also Personen, die wie
Anwält*innen der Sache dabei sind, um ein bestmögliches Projekt umzusetzen und immer wieder schauen können, wer beispielsweise wann dazu geholt werden muss. Es ist auch immer eine Frage der Kapazitäten und Ressourcen. Deshalb würde ich das jetzt nicht so einfach beantworten können, was genau Partizipation in dem Bereich bedeutet.
BD: Du hast vorhin deine Dissertation und die Forschung an Top-Down und Bottom-Up Formaten an öffentlichen Planungsplattformen erwähnt. Kannst du darauf etwas weiter eingehen?
HN: Ich forsche an öffentlichen Planungsplattformen, die das Ziel haben, öffentliche Planungsprozesse demokratischer zu gestalten. Eine demokratische Planungskultur beschäftigt sich damit, wie sich Menschen an der Planung und Gestaltung ihrer Stadt beteiligen können. Öffentliche Planungsplattformen sind konkrete Orte in der Stadt, wo Menschen jederzeit hingehen können, Orte die dauerhaft geöffnet sind, kombiniert mit anderen kulturellen Einrichtungen, wo aktuelle Projekte der Stadt immer wieder aktualisiert und ausgestellt werden. Also Orte, an denen immer wieder Diskussionen stattfinden und wo sich Menschen einbringen können, wenn sie Zeit haben und nicht erst, wenn das Projekt das Gestaltungsfenster dazu öffnet. Damit kann eine Kultur des gemeinsamen Planens entstehen, wo das Stadtplanungsamt die Top-Down Prozesse einbringen kann und BottomUp Initiativen mit ihren Projekten hingehen können, um schneller Kooperationen zu bilden. Diese
114
Prozesse sind ständige Entwicklungsund Lernprozesse. Wenn eine Stadt mit solchen Projekten anfängt und niemand weiß, wie es funktioniert, ist das natürlich sehr kompliziert. Wenn Städte aber immer wieder solche Projekte durchführen, kann das auf Dauer auch leichter fallen. Vielleicht können dadurch auch manche Hürden ausgeräumt werden. Für meine Dissertation suche ich jetzt Projekte, die es bereits in der Form gibt. Es gibt nicht die perfekte Planungsplattform, aber es wird weltweit in verschiedenen Städten daran gearbeitet. Ich möchte das untersuchen, um eine Wissensgrundlage zu bilden, damit auch eine Kommune wie Groningen sagen kann „Wir wollen das auch! Wie mache ich das? Wo fange ich an? Und was kann ich von den Anderen lernen?“.
BD: Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wann Partizipationsprozesse handfest und ausreichend sind, und ob man sowohl bei Top-Down als auch Bottom-Up Prozessen von echter Partizipation sprechen kann. Was denkst du darüber?
HN: Ich hatte dazu schon verschiedene Rollen, also dass ich entweder als Initiative an der Top-Down Planung der Stadt mitentscheiden wollte und deshalb diese initiative gegründet habe, um dadurch Aufmerksamkeit zu schaffen und so in Prozesse mit aufgenommen zu werden. Ich als Teil der Initiative habe es aber auch ermöglicht, dass zivilgesellschaftliche Akteur*innen innerhalb unseres Projektes partizipieren können. Ich war also bereits in einer Mittelposition.
Dasselbe passiert gerade auch am CoLiving Campus, wo wir, finde ich, sehr klar Top-Down beteiligen. Die Frage nach dem, wann es genug ist, finde ich schwierig. Partizipation ist etwas, was einem klar sein muss und mir auch immer klarer wurde, was ich auch immer wieder versuche zu vermitteln. Wenn man in solchen Projekten arbeitet, hat man immer das Gefühl, dass es nicht genug ist. Es werden immer Menschen zu dir kommen und sagen, dass noch etwas fehlt, dass sie noch weitere Ideen haben, oder warum es diese Veranstaltung nicht gibt und man eigentlich gleich eine große Veranstaltungsreihe machen sollte und so weiter. Es gibt unglaublich viele Bedürfnisse, denen es sehr schwer ist, gerecht zu werden. Da ist es natürlich wichtig, eine Mitte zu finden und festzulegen, wo die Grenzen liegen. Das ist auch wieder eine Kapazitätsfrage. Es ist wichtig, diese Dinge in den Prozessen zu kommunizieren. Wir als Verein haben zum Beispiel immer in der Email-Unterschrift stehen, dass wir ein ehrenamtlicher Verein sind und es deshalb etwas länger dauern kann, die Emails zu beantworten. Beim CoLiving Campus habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass, wenn man das zu Beginn erklärt, die Menschen auch oft zufrieden sind. Sie brauchen einfach eine regelmäßige und sichere Möglichkeit, wo sie sich einbringen können. Genug gibt es da nicht oder nie und es ist eher die Aufgabe, zu vermitteln. Meine These ist aber – das unterscheidet sich natürlich von Projekt zu Projekt –, dass es immer sinnvoll wäre, einen festen Ort zu haben, der vielleicht nicht immer 24 Stunden geöffnet ist, aber an dem man
115
vorbeigehen und Informationen finden kann. Wir haben das bei Stadtlücken am Österreichischen Platz gemacht. Wir haben festgestellt, dass es gut wäre, wenn dort eine Art “Grundrauschen”, so haben wir das immer genannt, stattfindet. Meistens funktioniert das gut als Kiosk mit ein paar Getränken und die Person, die dort arbeitet, sollte dann ein wenig darüber hinaus ausgebildet sein, sodass eben auch Fragen beantwortet werden können. Für uns war es auch immer wichtig, ein digitalanaloges Netzwerk zu schaffen, weil es eben die analoge Ansprechbarkeit geben muss, aber gleichzeitig auch immer ins digitale übersetzt werden muss. Das ist eben schon oft total ausreichend. Wir, bei Stadtlücken, haben immer zwei Übertitel. Es ist immer Aktivierung statt Beteiligung, weil es für uns wichtiger ist, dass Menschen selbst aktiv werden und dadurch überhaupt teilhaben an der Stadtgestaltung. Es gibt die klassischen politischen Prozesse, über die Ideen eingebracht werden können, wie beispielsweise die Bezirksbeiräte. Es gibt immer öffentliche Sitzungen, zu denen man hingehen und seine Ideen einbringen kann. In den Gremien geht das dann nach oben. Wenn Menschen grundsätzlich dazu ausgebildet werden, politisch aktiv sein zu können, dann natürlich auch die Zeit und Kapazitäten hätten – das ist dann auch wieder eine Bildungsfrage –, dann müsste man sich überhaupt nicht beteiligen. Beteiligung ist für mich oft so ein Pflaster, was man darauf klebt, weil die aktuellen demokratischen politischen Gremien und Prozesse, die wir haben, nicht gut gepflegt sind. Deshalb sagen wir immer “Beteiligung ist zwar super, aber eigentlich müssen wir am
grundsätzlichen Problem arbeiten”, also dass Menschen einfach grundsätzlich aktiv werden können und wollen und auch verstehen, dass das möglich ist. Vor meinem Studium wusste ich das auch nicht. Da dachte man, “keine Ahnung, wie diese Prozesse funktionieren, aber das regelt schon jemand”. Aber eigentlich ist es für jede Person möglich, mitzugestalten.
BD: Was bedeutet integrierte Stadtentwicklung für dich, und wie kann es umgesetzt werden?
HN: Das ist genau der Punkt, den wir bei dem Projekt “Österreichischer Platz” so hautnah erfahren haben. Man spricht nicht mit einer Person bei der Stadt und kann dann das Projekt gestalten, sondern es sind unglaublich viele Ämter und Prozesse davon abhängig oder werden auch dadurch erst wieder angestoßen. Man muss immer ganzheitlich denken, weil ein Eingriff natürlich wieder Einfluss auf andere Situationen in der Stadt hat: Umwelt, Verkehr und auch klimatisch, das spielt alles eine Rolle. Deshalb kann es nur gemeinsam gelöst werden. Was bei uns im Projekt die Mittel oder Tools waren, sind die ganz klassischen Runden Tische, die moderiert werden. Es gab eine Stelle, die immer wieder geschaut hat: Wen braucht es dieses Mal am Runden Tisch, um die aktuellen Fragen klären zu können? Und dann kamen immer wieder unterschiedliche Ämter dazu. Mal war es das Grünflächenamt, mal das Amt für öffentliche Ordnung, je nachdem, welche Zuständigkeit die Expertise dafür hatte. Das ist etwas, was so simpel ist, aber damals extrem neu war in der Stadt, dass überhaupt so ein
116
Prozess so viele Akteur*innen immer wieder über zwei Jahre hinweg an einen Tisch zusammengebracht hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass sich die Menschen in der Verwaltung wieder über ihre Ressorts hinaus ausgetauscht haben. Eigentlich funktioniert die Verwaltung natürlich immer in Leitern, also wenn es ein Thema gibt, dann muss dieses über den oder die Abteilungsleiter*in, Projektleiter*in oder Referatsleiter*in und dann weiter nach unten, anstatt dass zwei Personen miteinander sprechen können. Das verlangsamt die Prozesse enorm. Es gibt bereits verschiedene Kommunen, die versuchen, mit Design-Thinking und weiteren Methoden die Prozesse zu beschleunigen, aber auch da arbeitet jede Kommune unterschiedlich mit Beratungsagenturen und lässt sich neue Prozessstrukturen erarbeiten. Es gibt bisher keine Grundlage, wie das funktionieren und umgesetzt werden könnte. Meine These wäre, gerade in der Stadtentwicklung bzw. Stadtplanung einen Ort zu generieren, wo alles immer wieder zusammenkommen könnte. Dadurch könnte es transparenter nach Außen werden und findet nicht hinter verschlossenen Türen statt.
BD: Gegen welche Hindernisse oder Widerstände bist du in Kooperationen gestoßen? Gibt es Hindernisse, die nicht projektspezifisch sind und immer wieder auftauchen, die vielleicht allgemeingültig in kooperativen Prozessen gelten?
HN: Auf jeden Fall muss man einplanen, dass es Zeit braucht, bis die Kooperationspartner*innen auf demselben Stand sind, das wird oft
vergessen. Jede Position geht davon aus, dass die andere Position versteht, worum es geht. Manchmal wird auch eine komplett andere Sprache oder Fachbegriffe verwendet. Das ist eine Phase Null, die eingeplant werden muss, in der sich die Akteur*innen auch kennenlernen können. Das ist so wichtig, weil das Ganze auch auf Vertrauen basiert, das eben erst aufgebaut werden muss. Das zweite ist, die gemeinsame Sprache zu lernen, um zu verstehen: „Wie funktioniert es bei euch? Wie funktioniert es bei uns, und wie kann man da zusammenkommen?”
Ohne dass die eine Partei der anderen das überstülpt, sonst ist es keine Kooperation auf Augenhöhe. Das macht manchmal vielleicht auch Sinn, muss dann aber kommuniziert werden und beide Seiten müssen damit einverstanden sein. Das ist einfacher, wenn es nicht so unterschiedliche Mächte sind, die miteinander kooperieren. Im Reallabor zum Beispiel, wo man mit verschiedenen Instituten zusammenarbeitet und teilweise so viele unterschiedliche Welten zusammenkommen, ist es nicht so einfach, dort erstmal ein gemeinsames Level, eine gemeinsame Ebene und Struktur zu entwickeln. Hinzu kommen noch die Verantwortung und die Wertschätzung, das ist sehr wichtig. Die Frage, wer die Verantwortung trägt, muss am Anfang ganz klar für alle definiert und niedergeschrieben werden. Bei uns im Verein haftet zum Beispiel der Vorstand mit seinem Privatvermögen, wenn etwas schiefgeht. Das ist einfach eine formale Sache. Das ist rein rechtlich ein großes Problem. Wenn man an einer großen öffentlichen Fläche Veranstaltungen macht und sich da jemand den Fuß
117
bricht, weil irgendwer nicht ordentlich festgeschraubt hat, kann das böse ausgehen. Die Personen, die haften, sind natürlich auch empfindlicher und viel unentspannter. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Leute, die am Anfang nicht verstanden haben, was es bedeutet zu haften, es erst dann verstanden haben, als sie selbst auch mal die Verantwortung hatten. Aber auch das ist ein Punkt, den man im Vorfeld gut besprechen kann, sodass zumindest einmal alle darüber gesprochen haben und man dann eventuell auch die Möglichkeit hat, die Verantwortung auch mal zu übertragen kann.
BD: Spricht man dann von Kooperationsverträgen?
HN: Ja, genau, Kooperationsverträge oder manchmal auch Untermietverträge, wenn die Kooperation nur einmalig für einen Abend ist. Das muss so selbstverständlich angesprochen werden, und nicht erst im Nachhinein als Problem auftaucht. Und eben auch die Wertschätzung. Wer bringt wie viel ein und wessen Arbeit ist wie viel wert? Das ist natürlich eine endlose Diskussion, da gibt es auch, denke ich, noch keine Lösung für. Das aber darauf geachtet wird, finde ich, wird von Kommunen noch überhaupt nicht gesehen, auch weil sie sich oft in der Rolle sehen: “Wir sind so nett und lassen euch mitmachen.“ Das ist schon das erste Problem. Und wenn dann zusammengearbeitet wird, und man in ewigen Sitzungen und ewigen Prozessen sitzt und für Ehrenamtliche gar keine Chance da ist, kann das den Eindruck erwecken, dass quasi gewollt
wird, dass man “so ausblutet”. Und dann war es das wieder. Und manchmal ist es eben nicht das Geld, was die Wertschätzung bringt, sondern eine transparente Kommunikation über die Dauer von Prozessen. Das wären so die drei Punkte, die, denke ich, wenn sie transparent kommuniziert werden, viele andere spezielle Einzelprobleme entknoten können.
BD: Welche Strukturen sind notwendig, um Kooperation zu halten und zu pflegen? Gibt es generell Komponenten, ohne die Kooperation nicht möglich wäre?
HN: Ich denke, da kommt es auch wieder auf die Größe des Projekts an oder wie viele Beteiligte daran mitarbeiten. Je größer, desto wichtiger, finde ich, ist die Moderation, die nochmal aus der Mitte agiert. Oder von beiden Seiten gibt es jeweils eine Person, die involviert ist. Beim CoLiving Campus finde ich zum Beispiel die Aufteilung super. Die Stadt hat eine halbe Stelle und die Uni hat eine halbe Stelle, die gemeinsam das Projekt koordinieren. Wenn die sich im besten Fall gut verstehen, dann hat das eine unglaubliche Schlagkraft in beide Richtungen. Auf kleinerer Ebene, finde ich, kann von null auf angefangen werden zu kooperieren. Elinor Ostrom hat untersucht, wie Menschen mit Allmenden umgehen und wie sie sich gemeinsam organisieren. Und sie sagte, dass Vertrauen, Gegenseitigkeit und Glaubwürdigkeit die drei Faktoren sind, die ein Maß an Kooperation herstellen. Ich leihe dir etwas aus, dann gibst du es mir auch rechtzeitig zurück, und dafür kann ich mir auch bei dir wieder was ausleihen. Und wenn das immer öfter
118
passiert, umso mehr kooperieren wir. Das stellt schon erstmal ein Grundvertrauen her. Wir stellen fest, dass wir ähnliche Interessen haben, und so steigert sich dieses Maß. Das ist etwas, das super wichtig ist. Gewisse Strukturen ergeben sich im Moment, je nachdem, wo man sich gerade aufhält.
BD: Wie würdest du Kooperation für dich bzw. nach deiner Praxis definieren?
HN: Wir haben immer mal wieder darüber diskutiert, was eigentlich der Unterschied zwischen Kooperation und Kollaboration ist. Bei Kollaboration haben quasi alle dasselbe größere Ziel, und sie tun alles, um dahin zukommen. Dafür arbeitet man aber nicht wirklich zusammen, sondern an unterschiedlichen Stellen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich finde, Kooperation ist, dass alle unterschiedliche Interessen haben, zum Beispiel wir als Initiative wollen den Österreichischen Platz zugänglich machen, und die Stadt will generell einen sicheren öffentlichen Raum schaffen. Und um die jeweiligen Ziele zu erreichen, wird für gewisse Sachen kooperiert. Das heißt eigentlich, in der Kooperation ist man freier von den Idealen, das bedeutet, da können auch Menschen mit sehr unterschiedlichen höheren Idealen auf einer Ebene kooperieren. Bei dem Projekt St. Maria für die katholische Kirche war ich zu Beginn auch erst einmal kritisch, weil ich deren höheren Ziele manchmal ein wenig fragwürdig finde. Als ich dann vor Ort war und die Menschen kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass wir für dieses Projekt in dem Zeitraum dieselbe Idee hatten. Und deshalb konnten wir dafür kooperieren.
Danach ist man aber auch wieder raus, und nicht dauerhaft miteinander für alle anderen Ideen ebenfalls verantwortlich.
Da ist für mich die Definition von Kooperation, es ist nichts für immer festgelegtes, sondern für ein gewisses Projekt in einem gewissen Zeitraum, indem man kooperiert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das im besten Fall auf Augenhöhe, das würde ich mir wünschen. Für den eigenen Job sollte man sich auch überlegen, was die eigenen grundsätzlichen Werte sind. Es ist wichtig, in Kooperationen ganz genau nachzufragen, was es ist, wofür man gerade arbeitet und was man dafür eingeht. Deshalb sind
Kooperationsverträge so wichtig, weil dort auf eine Art auch niedergeschrieben werden kann, was die grundsätzliche Idee für das Projekt und das Ziel ist. Da lerne ich wieder viel aus meinem BWL Studium. Es fällt mir schwer zu definieren, was Kooperation in einem integrierten
Stadtentwicklungsprojekt ist. Meine These ist: Es gibt diese Arena, also eine neue Arena der Stadtentwicklung, in der immer wieder zusammengekommen und ausgehandelt werden kann. Diese Arena ist ein Gemeingut, wo transparent darüber diskutiert wird, was geplant und gestaltet wird, aber auch, was die Visionen für die Zukunft sind. Und dann kann man dort immer wieder rein, aber auch rausgehen. Es müssen nicht alle die ganze Zeit in Verbindung miteinander stehen.
119
IM GESPRÄCH MIT EXPERTINNEN
Kristin Lazarova
Kristin Lazarova ist ausgebildete Architektin und Stadtplanerin und arbeitet in der Netzwerkstelle der Urbanen Praxis e.V., in der sie für die Bereiche der Kommunikation und Koordination zuständig ist. Sie ist Teil der Floating University in Berlin und koordiniert seit 2022 das Programm “Learnscapes”, dass es Studierenden möglich macht, mit oder ohne Lehrperson verschiedenste Lernveranstaltungen zu organisieren und Praktiken des co-, un- und relearning kennen zu lernen.
Burcu Daglayan: Zu Beginn eine allgemeine Einführung. Wer bist du und an welchen kooperativen Projekten bist du zurzeit beteiligt?
Kristin Lazarova: Ich bin ausgebildete Architektin und Stadtplanerin, aber nicht unbedingt praktizierend, also ich baue eher selten. Ich arbeite gerade in der Netzwerkstelle der Urbanen Praxis in Berlin. Das ist eine intermediäre Stelle, die zwischen den Initiativen aus der Zivilgesellschaft und Kunst- und Kulturszene und der Politik und Verwaltung vermittelt und das Netzwerk von urbanen Praktiker*innen pflegt. Die urbane Praxis arbeitet also an der Schnittstelle zwischen Architektur und Stadtentwicklung, aber auch Kunst, Kultur, Bildung, Umwelt, Sport und Sozialem. Es gibt seit 15 bis 20 Jahren einige Akteur*innen, die in diesem Bereich aktiv sind und sich in den letzten Jahren zusammengesetzt haben.
Daraus ist die Urbane Praxis entstanden und zu einem großen Netzwerk gewachsen, das auch von einem Verein getragen wird. Ich bin dort in einer koordinierenden Rolle und organisiere neben der Netzwerkkoordination und -kommunikation auch diskursive Formate, die urbane Praxis sichtbar und greifbar machen. Ich versuche auch, jüngere und kleinere Projekte und Initiativen bei der Politik und Verwaltung sichtbar zu machen und geeignete Formate zu finden, durch die Praktiker*innen untereinander auch Wissen austauschen und Neues produzieren können. Ansonsten bin ich noch in der Floating University tätig und koordiniere dort das LearnscapesProgramm, wo Studierende zur Floating kommen und den Ort als Lernort nutzen können. Das findet in Form von Blockseminaren oder Vorträgen statt oder auch durch Design-Studios, die vor Ort praktiziert werden. Manchmal gibt es auch Workshops, die über eine Woche lang stattfinden. Genau, ansonsten bin ich auch Teil vom Alumni-Netzwerk der Urbanen Liga, das ist das Jugenforum Stadtentwicklung und auch ein Partizipationsformat. Ich habe selber dort 2018 bis 2019 mit einem Projekt teilgenommen, also im Gründungsjahrgang, und habe danach mit anderen zusammen den Verein gegründet, um diese Ideen weiter voranzutreiben, weiterzutragen und auch die Instrumente der kooperativen Stadt weiterzuentwickeln. Genau, ab
120
und zu arbeite ich aber auch als freischaffende Architektin.
BD: Welche Rolle spielen Kooperationen in all diesen Projekten? Was für ein Potenzial ergibt sich aus Kooperationen für eine integrierte Stadtentwicklung?
KL: Die Netzwerkstelle der Urbanen Praxis wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gefördert bzw. wir bekommen eine Zuwendung für das Entwickeln von einem ressortübergreifenden und mehrjährigen Förderinstrument für Orte der urbanen Praxis. Also auch, um das Netzwerk zu pflegen und auszuweiten. Und in dieser vermittelnden Position sehe ich ein großes Potenzial, weil man eben merkt, dass die Verwaltung nicht allen Herausforderungen nachkommt, die gerade in Bezug auf Klimaanpassung oder klimagerechte Stadtentwicklung und soziale Gerechtigkeit anstehen. Gleichzeitig gibt es ein großes Interesse und Motivation seitens einer organisierten Zivilgesellschaft, die auch sehr heterogen ist, und auch von Seiten der Kunst- und Kulturschaffenden, daran zu arbeiten. Das lässt sich eigentlich ganz gut in kooperativen Prozessen verbinden, die irgendwo spezifisch kontextualisiert sind, aber so, dass die Stadtverwaltung einen Überblick hat und schauen kann, an welchen Stellen es gerade Sinn macht. Wir sind gerade, zum Beispiel, im Gespräch mit den sozialräumlichen Planungskoordinationsstellen in Berlin und gehen in allen zwölf Bezirken auf einzelne Gespräche ein. Also die sind meistens bei dem
Stadtentwicklungsamt angesiedelt, aber nicht zwangsläufig, und haben einen Überblick über Bildungs- und soziale Infrastrukturen in den Bezirken und ermitteln, wo es diese gibt, wo sie gebraucht werden, und Stellen, an denen Neues entstehen soll und so weiter. Da sehen wir ein großes Potenzial zu kooperieren, insbesondere bei Liegenschaften, Brachflächen oder leerstehenden Gebäuden. Die sind vielleicht nicht ganz so einfach zu entwickeln, aber können eventuell durch neue Pioniersnutzungen, künstlerischen Nutzungen oder weiteren Aktionen des Stadtmachens aktiviert werden. Dadurch können neue Ideen entstehen und entwickelt werden, die von der Stadtplanung vielleicht übersehen werden, oder anders ausgedrückt, die vielleicht nicht in das klassische Planungs- und Entwicklungsschema reinpassen.
BD: Gehen die Politik und Verwaltung auf eure Ideen ein? Also wirken die Strukturen, die dabei entstehen, entlastend und erweitern den Horizont dieser Praxis?
KL: Das ist eigentlich schwierig, das so pauschal zu beantworten. Aber bei der Floating als Beispiel kann man schon sagen, dass das Regenwasserrückhaltebecken als Wasserinfrastruktur ein Gemeingut in öffentlicher Hand ist. Aber durch die Eröffnung durch Raumlabor und jetzt dem Verein Floating für die Öffentlichkeit, ist es durch dieses Aufmachen und der Mehrfachnutzung als Bildungsort, als Ort der Natur, Kunst und allgemein als Veranstaltungsstätte für nicht
121
kommerzielle Veranstaltungen bzw. Kulturangebote, zu einer Art “commons” geworden. Die Senatsebene ist für das Regenwasserbecken zuständig, also das ist eine landeseigene Liegenschaft. Die Senatsverwaltung ist sehr positiv eingestellt und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel für andere Orte, auch über Berlin hinaus. Das ist auch allgemein im Sinne der Verwaltung, die Flächen möglichst mehrfach zu nutzen. Natürlich ist das auch gar nicht so einfach im Alltagsbetrieb. Ich glaube, ein Regenwasserrückhaltebecken mit einem Kulturort zu verbinden, funktioniert nur, wenn man sicherstellt, dass die Infrastruktur nach wie vor funktioniert, was an der Floating der Fall ist. Bei anderen Nutzungen ist es vielleicht schwieriger, wenn es beispielsweise darum geht, ein Schulgebäude oder nur den Schulgarten am Wochenende umzunutzen für Veranstaltungen, die von Vereinen oder anderen Akteur*innen organisiert werden. Es kann schon sein, dass es im Alltag an kommunikativen oder pragmatischen Herausforderungen scheitert. Aber solange man irgendwie Lösungen für solche Fälle findet, spricht eigentlich nichts dagegen.
BD: Was bedeutet Partizipation für dich in dem Kontext des kooperativen Stadtmachens?
KL: Ich beziehe mich immer auf die Partizipationsleiter von Sherry Arnstein, in der eine der höchsten Stufen der Partizipation die Selbstorganisation ist. Und da, finde ich, ist auch unsere Selbstanforderung.
Unser Anspruch ist immer, mindestens auf Augenhöhe miteinander zu kooperieren. Noch besser wäre es eigentlich, selbstbestimmt die Stadt auch mitzugestalten und zu produzieren. Bei üblichen Beteiligungsprozessen, wie sie im Baugesetzbuch vorgesehen sind, ist es schon fragwürdig, wer überhaupt Zugang zu diesen Beteiligungsprozessen hat: Wer kann sich das leisten, nach Feierabend, am Wochenende oder teilweise unter der Woche zu solchen Veranstaltungen zu gehen und seine Meinung zu äußern? Wer kann sich in der Sprache, in der häufig ein Fachjargon genutzt wird, überhaupt artikulieren? Und wer wird damit erreicht? Im Netzwerk der Urbanen Praxis, aber auch von der Urbanen Liga, in denen es weniger um diese künstlerischen Aspekte und mehr um das Stadtmachen geht, habe ich immer beobachtet, dass eher die partizipativen Workshops, die praxisorientiert sind und in denen gemeinsam gebaut wird, ganz andere Menschen erreicht werden. Diese Menschen würden sich selber vielleicht gar nicht als Stadtmacher*innen wahrnehmen oder auf die Idee kommen, sich so zu nennen, aber letztendlich auch ihre Stadt durch diese Formate mitproduzieren. Das kann beispielsweise der Bau eines Gemeinschaftsbeets oder Parklets für die Straße sein, oder auch einfach ihr eigenes Sofa für zuhause reparieren. Dass man mit anderen Menschen in Gespräche kommt und ein soziales Netz ausbaut, das gehört auch zur Stadtentwicklung dazu.
122
BD: Was würdest du sagen, auch in Bezug auf die Partizipationsleiter von Arnstein, wie würden diese Prozesse aussehen, wenn wir den Anspruch der höchsten Stufe, also der Bürgermacht und Selbstkontrolle, verfolgen bzw. umsetzen würden? Können dabei noch mehr Konflikte entstehen? Auch in Bezug auf die Ressourcen Zeit und Geld.
KL: Ja, das ist schon nicht so einfach. Die Frage ist auch, wer denn überhaupt die Zivilgesellschaft ist. Und wer ist dazu legitimiert, eine Gruppe von Menschen zu repräsentieren? Und ab wann ist eine Gruppe dazu legitimiert, selbstbestimmt zu agieren? Wird im Interesse des Gemeinwohls gehandelt oder ist es schon privates Interesse? Diese Fragen sind, denke ich, sehr wichtig. Ich finde, es braucht eine gewisse Legitimität von einer Gruppe an Menschen, wenn diese behaupten, dass sie die Akteur*innen sind, die einen Raum prägen. Und, wenn man sich über Gemeingüter bzw. ‘commons’ unterhält, wer genau sind dann die ‘commoners’, also die Bürger*innen? Sind das alle, die mit in diesem Raum involviert sind? Und welche Strukturen braucht es, damit diese dann die ‘commoners’ repräsentieren? Es können auch nicht immer alle am Betrieb teilnehmen und Teil der Organisation bzw. Operativen Ebene sein. Das ist also auf jeden Fall eine Frage der Repräsentation. Man muss dazu auch sagen, dass Stadtmachen auch ein Privileg ist, dafür braucht man noch mehr Zeit, als nur an Beteiligungsprozessen teilzunehmen. Das kann auch sehr herausfordernd sein, da diese Prozesse
nicht innerhalb eines halben Jahres oder ähnliches erledigt sind, da, wenn man eben den Anspruch hat und die Stadt ein Stück mitgestalten will, noch viel mehr Ressourcen dafür benötigt werden. Dann stellt sich auch die Frage, wer diese Ressourcen hat und sich das leisten kann, wer dafür ausgebildet ist und auch sich artikulieren kann, um etwas zu erreichen. Das ist schon auch ein Anspruch, den die Politik und Verwaltung an sich selber haben sollten, also dass möglichst viele Menschen an Kooperationsprozessen teilhaben können. Dafür müssen eben auch diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit auch Menschen, die keine Zeit haben, weil sie einen Vollzeitjob haben, auch entschädigt werden für diese Arbeit und sich die Beteiligung an solchen Prozessen leisten können.
BD: Gegen welche Hindernisse oder Widerstände bist du in Kooperationen gestoßen? Gibt es Hindernisse, die nicht unbedingt projektspezifisch sind, die immer wieder auftauchen?
KL: Ja, gute Frage. Ein Hindernis, was ich immer mal wieder wahrnehme, ist dieses Ressortdenken innerhalb der Verwaltung. Es wird immer sehr steif im eigenen Handlungsbereich agiert und dieser wird oft auch sehr begrenzt wahrgenommen. Auch die Frage der Zuständigkeiten ist nicht einfach, also wer wofür zuständig ist innerhalb der Verwaltung. Da kommt man oft an Grenzen, weil man als Initiative gar nicht so viel machen kann und sich zwischen den Stühlen befindet. Das eine Amt kann dann sagen: “Ne, wir
123
sind dafür nicht zuständig, ihr müsst euch an jemand anderes wenden.” Und die anderen sagen wiederum etwas anderes. Bei Stadtmachen-Projekten geht es oftmals nicht um ein einziges Thema, sondern auch um vielschichtige Angebote, die beispielsweise nicht nur eine Parkanlage gestalten oder bestimme Veranstaltung zu Sportevents oder ähnliches organisieren. Es ist gar nicht so einfach, diese Prozesse und Projekte auf eine einfachere Ebene runter herunterzubrechen.
BD: Welche Strukturen sind notwendig, um Kooperation zu halten und pflegen? Gibt es generell Komponenten, ohne die Kooperationen nicht möglich wären?
KL: Ich denke, dass es Strukturen braucht, die verschiedene Ressourcen innerhalb der Verwaltung auch zusammenbringt, die nicht projektbasiert sind, so wie sich das häufig bei den Best-Practice Projekten ergibt. Also dass man beispielsweise einen Runden Tisch organisiert, wo alle Akteur*innen, die beteiligt sind, die Verwaltung und auch die Eigentümerschaften an einen Tisch zusammenkommen. Das solche Instrumente eben nicht nur projektbasiert sind, sondern tatsächlich ressortübergreifend für die Projekte des Stadtmachens oder der urbanen Praxis insgesamt angewendet werden. Ich glaube, es braucht generell eine agile Verwaltung oder Menschen in der Verwaltung, die bereit sind, auch Unerwartetes und Unbekanntes anzugehen und eine gewisse Offenheit in Planungsprozessen haben. Ich habe
mich generell auch viel mit intermediären Strukturen beschäftigt, diese können auch eine große Hilfestellung sein. Ich finde es auch interessant, die Netzwerkstelle in Berlin mit dem Kulturamt in Köln zu vergleichen. Dort gibt es auch Ideen, die urbane Praxis zu fördern, aber diese Ideen kommen von der Verwaltung. Es gibt in Köln jetzt eine Stabsstelle “Kulturraum Management”, die direkt in der Kulturverwaltung ganz oben angesiedelt ist. Die haben auch ein großes Vorhaben und wollen Flächen aufkaufen und diese zusammen mit der Zivilgesellschaft und der Kunst- und Kulturszene zu Kulturorten entwickeln. Das ist sozusagen die Spiegelstruktur zur Netzwerkstelle in Berlin. In Köln gibt es eher ein loses Netzwerk von Akteur*innen, die in diesem Bereich aktiv sind, und keine feste Struktur oder Verein oder ähnliches. Das Kulturraum Management in Köln hat den Anspruch, in diesem Prozess mit den verschiedenen Ressorts zu kooperieren, sie wollen beispielsweise mit dem Liegenschaftsamt zusammenarbeiten, weil sie die Liegenschaften verwalten, die in Frage kommen würden. Und kooperieren auch mit dem Stadtentwicklungsamt, weil sie auch für die Entwicklung von Kulturorten zuständig sind.
BD: Kann man in diesem Kontext sowohl bei Top-Down als auch
Bottom-Up Prozessen von echter Partizipation sprechen?
KL: Ich mache diesen Unterschied mittlerweile nicht mehr so gerne. Wenn es um Kooperationen geht, geht es
124
hauptsächlich darum, miteinander auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Von daher ist es oder sollte es egal sein, woher die Initiative kommt, ob von oben oder von unten. Im besten Fall sollten beide Perspektiven den gleichen Anspruch und das gleiche Interesse haben, sich irgendwie auf Augenhöhe zu treffen. Also wenn es um intermediäre Strukturen geht, finde ich auch das Beispiel von AKSGemeinwohl in Berlin in Kreuzberg sehr spannend. Das ist eine Arbeits- und Koordinierungsstelle für gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung auf Bezirksebene und agiert als intermediäre Stelle, die Immobilien gemeinwohlorientiert entwickelt. Es geht dabei viel um Nachverdichtung, aber auch um Umbau. Sie arbeiten auch zusammen mit privaten
Immobilieneigentümer*innen die ihre Immobilien gemeinnützig oder gemeindeorientiert entwickeln möchten und verbinden vernetzen sie mit Initiativen, die Interesse haben. Dabei können beispielsweise Wohnprojekte entwickelt werden oder neue Kulturstandorte entstehen. Es geht also auch viel um Wohnen und Gewerbe. Sie arbeiten auch mit der Verwaltung von FriedrichshainKreuzberg, insbesondere im Bereich von Liegenschaften in öffentlicher Hand. Die Struktur ist auch gemischt, insgesamt sind 5 Personen dort angestellt. Zwei Personen sind von der Verwaltung und drei weitere vom gemeinnützigen Verein, also wird eine Seite von der Verwaltung und die andere von der Zivilgesellschaft getragen. Sie arbeiten sozusagen im Team zusammen, das finde ich sehr
spannend. Dadurch trifft man sich wirklich auf Augenhöhe und hat einen kontinuierlichen Austausch, ohne in diese konfrontativen Situationen zu geraten.
BD: Wie würdest du Kooperationen für dich definieren?
KL: Kooperation bedeutet für mich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, in der alle beteiligten Akteur*innen das gleiche Ziel einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung verfolgt.
125
REFLE
126
XION
127
REFLEXION
Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Anwendung kooperativer Methoden und Instrumente im Bereich der partizipativen Stadtgestaltung auseinandergesetzt. Durch die Vertiefung der Prozessanalysen und der Interviews mit Expert*innen haben sich folgende Kooperationskriterien herauskristallisiert, die aufgrund der Analyse der ausgewählten Projekte insbesondere für Kooperationsformen zwischen Politik, Verwaltung und der (kreativen) Stadtgesellschaft gelten und die grundlegenden Anforderungen an erfolgreiche Kooperationsprozesse darstellen:
Im Bereich der politischen Bausteine ist ein wertschätzender Umgang und das gegenseitiges Vertrauen zwischen den Partner*innen relevant, die außerdem eine Offenheit mitbringen und im Allgemeinen eine kooperative Haltung einnehmen sollten, da das Erproben neuer Formen der Zusammenarbeit mit einem gegenseitigen Lernprozess verbunden ist und eine Herausforderung darstellen kann. Kooperationen sind zudem an lokale Strukturen und Gegebenheiten gebunden und können sich mit diesen im Prozess verändern - sie sind demnach als wandelbar und anpassungsfähig zu verstehen und werden stetig weiter entwickelt. Die Abflachung der Hierarchien und der Austausch auf Augenhöhe schaffen eine neue Lernkultur im Miteinander und sind essenziell für kooperative Prozesse und Planungen. Für die strukturellen Bausteine gilt, dass eine aktive Unterstützung der Verwaltung kooperative Projekte weit voranbringen und Prozesse beschleunigen kann. Die Frage der Zuständigkeiten sind in diesen ebenso von großer Bedeutung, da die Bewältigung bürokratischer Hindernisse herausfordernd sein und Frustration mit sich bringen kann, durch welche Prozesse deutlich verlangsamt werden. Im Weiteren kann eine interne und intermediäre Organisationsstruktur einen Kooperationsrahmen vorgeben und die Ausarbeitung eines gemeinsamen Wissens eine Entscheidungs- und Handlungsgrundlage für diese bilden. Mittels Kooperationsvereinbarungen können zudem rechtliche Rahmenbedingungen festgehalten und Kooperationsstrukturen dadurch gestärkt werden. Zuletzt sind im Rahmen der rechtlichen
128
Bausteine die Finanzierung von Kooperationsprozessen und die Bereitstellung finanzieller Mittel essenziell, da Kooperationen im Bereich der Beteiligung und Teilhabe neben zeitlichen Faktoren insbesondere mit finanziellen Ressourcen verbunden sind. Ebenso sind passende rechtliche Rahmenbedingungen für die Ermöglichung neuer Methoden in diesen Prozessen relevant. Für den weiteren Prozess der Kooperationen ist es wichtig zu ergänzen, dass die aufgebauten Strukturen gepflegt bzw. gehalten werden müssen, damit das Kooperationsgerüst nicht zusammenfällt. Besonders für den Bereich der Teilhabeförderung und der Erarbeitung neuer Schnittstellen zu kommunalen Verwaltungsstrukturen ist die Unterstützung der Politik und Verwaltung grundlegend. Daher sollte gemeinsam mit den Kooperationspartner*innen an Grundlagen für die weitere Verstetigung und Institutionalisierung dieser Projekte, die dem Gemeinwohl dienen, gearbeitet werden.
Für die Ergebnisse dieser Arbeit lässt sich abschließend sagen, dass ausschließlich erfolgreiche Kooperationsprojekte untersucht und dadurch nur gelungene Prozesse und Methoden dargestellt wurden. Kooperationen können selbstverständlich auch scheitern, das Sichtbarmachen dieser Prozesse ist allerdings nach außen hin nicht unbedingt erkennbar und braucht eine weiterreichende Auseinandersetzung mit Misserfolgen in diesen, um eine differenzierte Untersuchung und Darstellung von Kooperationen im Allgemeinen zu ermöglichen. Letztlich braucht es auch einen Raum zum Scheitern, um weiterhin anhand des gesammelten Wissens neue Methoden zu optimieren und Lernprozesse zu fördern. Hinsichtlich dieser ist festzuhalten, dass gegenseitige Lernprozesse ein neues Gefühl des Miteinanders entstehen lassen und die Gemeinschaft stärken - eine neue Ermöglichungskultur fördert das Engagement und den Willen der Menschen, sich an der Gestaltung ihrer Umwelt zu beteiligen und macht den Gemeinschaftssinn dadurch sichtbar und zugänglicher. Daraus lässt sich schließen, dass Kooperationen ein besonderes Potenzial für die Umsetzung einer integrierten und partizipativen Stadtgestaltung und -entwicklung im Sinne des Gemeinwohls beinhalten und durch die Ausschöpfung dieser die Beteiligung und Mitwirkung der Gesellschaft in Stadtgestaltungsprozessen weitreichend fördern können.
129
QUELLENVERZEICHNIS
1 Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik (2014): Baukulturbericht: Gebaute Lebensräume der ZukunftFokus Stadt, 2014/15. Bundesstiftung Baukultur (Hg.). Potsdam. S. 10
2 Vgl. ebd., S. 92
3 Vgl. ebd., S. 11
4 Vgl. ebd., S. 93
5 Vgl. ebd., S. 94
6 Vgl. ebd., S. 96
7 Vgl. Die Neue Leipzig-Charta: Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl. 2020, S. 1-2
8 Vgl. ebd., S. 2-3
9 Vgl. ebd., S. 4
10 Vgl. ebd., S. 4-7
11 Vgl. ebd., S. 7-9
12 Vgl. ebd., S. 9-14
13 Vgl. Bruns, Laura/ Lynen, Leona/ Braun, Konrad (2020): Glossar zur gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Nationale Stadtentwicklungspolitik. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hg.). Bonn. S. 90
14 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2023): Partizipation, auf https://www.bmz.de/de/service/lexikon/partizipation-14752, zuletzt abgerufen am 05.08.2023
15 Selle, Klaus (2010): Gemeinschaftswerk? Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Stadtentwicklung. Begriffe, Entwicklungen, Wirklichkeiten, Folgerungen. Kurzgutachten für das Nationale Forum für Engagement und Partizipation. Aachen. S. 3
16 Vgl. Berger, Diana (2009): Partizipative Stadtentwicklung. Ein Überblick verschiedener Ansätze mit Bezug zum Projekt Planungswerkstatt. Zeit für Graz. S. 41
17 Schubert, Klaus/Klein, Martina (2020): Das Politiklexikon. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn. S. 7
18 Kaase, Max (1992) zitiert in: Berger, Diana (2009): Partizipative Stadtentwicklung. Ein Überblick verschiedener Ansätze mit Bezug zum Projekt Planungswerkstatt. Zeit für Graz. S. 41
19 Fuchs-Heinritz, Werner/ Lautmann, Rüdiger/ Rammstedt, Otthein/ Wienold, Hanns (2007) zitiert in: Berger, Diana (2009): Partizipative Stadtentwicklung. Ein Überblick verschiedener Ansätze mit Bezug zum Projekt Planungswerkstatt. Zeit für Graz. S. 41
20 Vgl. Berger, Diana (2009): Partizipative Stadtentwicklung. ein Überblick verschiedener Ansätze mit Bezug zum Projekt Planungswerkstatt. Zeit für Graz. S. 44
130
21 Vgl. Blundell Jones, Peter/ Petrescu, Doina/ Till, Jeremy (2005): Architecture and Participation. S. 3 ff.
22 Vgl. ebd., S. 14
23 Blundell Jones, Peter/ Petrescu, Doina/ Till, Jeremy (2005): Architecture and Participation. S. 13
24 Vgl. Arbter, K. (2012): Praxisbuch Partizipation: Gemeinsam die Stadt entwickeln. Magistrat der Stadt Wien Magistratabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung. Wien. S. 9
25 Vgl. ebd., S. 11-12
26 Arnstein, Sherry R. (1969): A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35:4. S. 216
27 Vgl. Arnstein, Sherry R. (1969): A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35:4. S. 216-224
28 Vgl. Selle, Klaus (1996): Klärungsbedarf, in: Planung und Kommunikation: Gestaltung von Planungsprozessen in Quartier, Stadt und Landschaft; Grundlagen, Methoden, Praxiserfahrungen. WiesbadenBerlin. S. 170
29 Collins, Kevin/ Ison, Ray (2009): Jumping off Arnstein‘s ladder: social learning as a new policy paradigm for climate change adaptation. S. 362
30 Deutsche Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung (2016): Partizipation im Standortauswahlverfahren für ein Endlager. S. 10
31 Deutsche Arbeitsgemeinschaft Endlagerforschung (2016): Partizipation im Standortauswahlverfahren für ein Endlager. S. 11
32 Vgl. Blundell Jones, Peter/ Petrescu, Doina/ Till, Jeremy (2005): Architecture and Participation. S. 13
33 Blundell Jones, Peter/ Petrescu, Doina/ Till, Jeremy (2005): Architecture and Participation. S. 14
34 Vgl. Blundell Jones, Peter/ Petrescu, Doina/ Till, Jeremy (2005): Architecture and Participation. S. 14
35 Rinn, Moritz (2017): Etwas Besseres als Beteiligung? Kritische Partizipation und Partizipationskritik in der Stadtentwicklungspolitik. Bundeszentrale für Politische Bildung, auf: https://www.bpb.de/themen/ stadt-land/stadt-und-gesellschaft/216888/etwas-besseres-als-beteiligung/, zuletzt abgerufen am 10.08.2023
36 Bruns, Laura/ Lynen, Leona/ Braun, Konrad (2020): Glossar zur gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Nationale Stadtentwicklungspolitik. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hg.). Bonn. S. 89
37 Vgl. ebd, S. 89
38 Tribble, Renée (2023): Kooperation und Koproduktion in der Stadtentwicklung: Civic-Public-Partnerships, in: Forum Wohnen und Stadtentwicklung. Heft 1. Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (Hg.). Berlin. S. 49-50
39 Vgl. ebd., S. 50
40 Vgl. ebd.
41 Vgl. Bruns, Laura/ Lynen, Leona (2021): KOOP.STADT. Bundespreis kooperative Stadt. Instrumente
131
und Praxisbeispiele. Nationale Stadtentwicklungspolitik. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hg.). Bonn. S. 12
42 Noltemeyer, Svenja (2021) zitiert in: KOOP.STADT. Bundespreis kooperative Stadt. Instrumente und Praxisbeispiele. Nationale Stadtentwicklungspolitik. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hg.). Bonn. S. 9
43 Vgl. Bruns, Laura/ Lynen, Leona (2021): KOOP.STADT. Bundespreis kooperative Stadt. Instrumente und Praxisbeispiele. Nationale Stadtentwicklungspolitik. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hg.). Bonn. S. 12
44 Vgl. ebd., S. 12
45 Vgl. ebd., S. 12
46 Vgl. ebd., S. 13
47 Vgl. ebd., S. 18
48 Vgl. ebd., S. 21
49 Vgl. ebd., S. 31
50 Vgl. ebd., S. 41
51 Vgl. ebd., S. 52
52 Vgl. ebd., S. 66
53 Vgl. ebd., S. 22
54 Vgl. ebd., S. 24
55 Vgl. ebd., S. 26
56 Vgl. ebd., S. 28
57 Vgl. ebd., S. 38
58 Vgl. ebd., S. 36
59 Vgl. ebd., S. 32
60 Vgl. ebd., S. 34
132
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1: eigene Grafik, basierend auf: Bundestiftung Baukultur (2014): Ergänzung der Leistungsphasen nach der HOAI durch „Phase Null“ und „Phase Zehn“. Potsdam. S. 96
Abb. 2: eigene Grafik, basierend auf: Selle, Klaus (2010): Was Teilhabe an der Stadtentwicklung bedeuten kann, in: Gemeinschaftswerk? Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Stadtentwicklung. Begriffe, Entwicklungen, Wirklichkeiten, Folgerungen. Kurzgutachten für das Nationale Forum für Engagement und Partizipation. Aachen. S. 11
Abb. 3: eigene Grafik, basierend auf: Arbter, K. (2012): Praxisbuch Partizipation: Gemeinsam die Stadt entwickeln. Magistrat der Stadt Wien Magistratabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung. Wien. S. 11
Abb. 4: Arnstein, Sherry R. (1969): A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35:4, S. 217
Abb. 5: eigene Grafik, basierend auf: Selle, Klaus (1996): Klärungsbedarf, in: Planung und Kommunikation: Gestaltung von Planungsprozessen in Quartier, Stadt und Landschaft; Grundlagen, Methoden, Praxiserfahrungen. Wiesbaden-Berlin. S. 170
133
IMPRESSUM
Herausgegeben im
GTAS - Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt
Prof. Tatjana Schneider
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
und im
IBEA - Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur
Prof. Elisabeth Endres
Mühlenpfordtstraße 23
38106 Braunschweig
Herausgeberin
Burcu Daglayan
Layout & Design
Burcu Daglayan
Lektorat
Anna Augstein
Fiona Leitold
Dank für inhaltliche Anregungen und Unterstützung
Tatjana Schneider
Elisabeth Endres
Licia Soldavini
Yamen Abou Abdallah
Fiona Leitold
Hanna Noller
Ayat Tarik
Jennifer Baus
134
135
STADT GEMEINSAM MACHEN: DAS POTENZIAL VON KOOPERATIONEN IN PARTIZIPATIVEN STADTGESTALTUNGSPROZESSEN

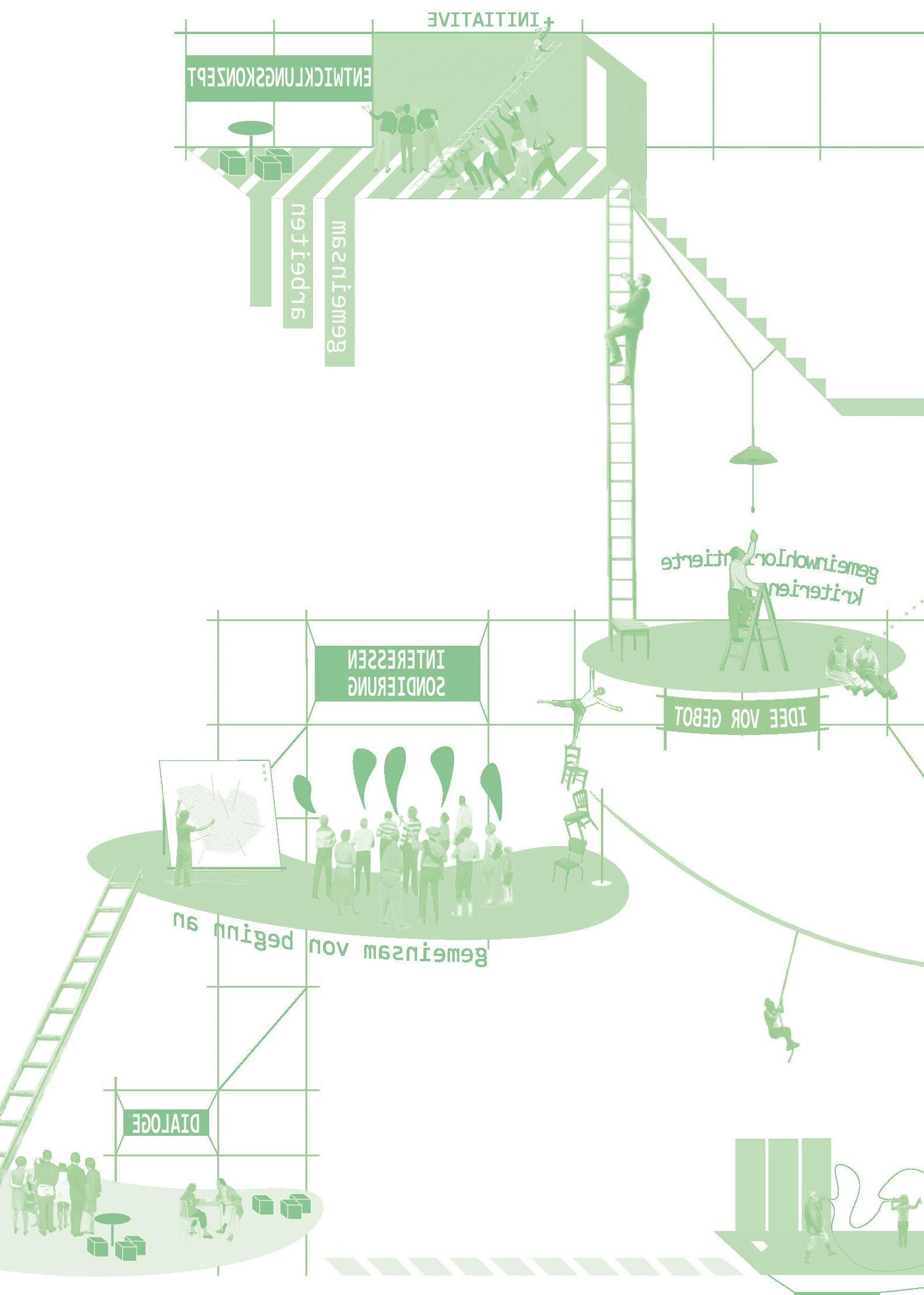
Daglayan
Burcu