EusiRegion
Wege, die wir wählen

Entscheidungen
Was passiert im Hirn und was im «Bauch»?
Die Qual der Wahl
Woher weiss ich, welche Entscheidung richtig ist?
Verlagsbeilage zum Lenzburger Bezirks-Anzeiger vom 15. Mai 2025


Entscheidungen
Was passiert im Hirn und was im «Bauch»?
Die Qual der Wahl
Woher weiss ich, welche Entscheidung richtig ist?
Verlagsbeilage zum Lenzburger Bezirks-Anzeiger vom 15. Mai 2025


Wahlmodus. Viele davon fällen wir allerdings unbewusst, sei es der Gang aufs WC oder der Gang zum Briefkasten. Im Büro oder neuerdings vermehrt im Homeoffice –auch das eine Entscheidung – treffen wir weitere Entscheidungen, zum Beispiel, welche Aufgaben zuerst bearbeitet werden.





Blumenladen und Gärtnerei:
Seetalstrasse 103, 5703 Seon 062 775 20 10 www.gaertnerei-vogel.ch

Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Vielleicht gibt es auch eine To-doListe, die uns das Entscheiden erspart. Sehr empfehlenswert. Denn auch wenn solche Entscheidungen uns in der Regel weniger stressen, kann es sein, dass sie – zu Bergen aufgetürmt –, krank machen. Entscheidungsstress in Dauerschleife.
• S tres s b ewält g ung m it M B S R
• E nführung s tag Acht samkeit und M editation
• K ind erku r s „H er z üb er Kopf“
• M editationsab end e

Was hatten Sie heute Morgen zum Frühstück? Kaffee, Tee, Wasser, Orangensaft. Wenn Sie jünger sind, vielleicht einen Energydrink? Haben Sie hier das Glück, nicht entscheiden zu müssen, weil mittlerweile der Geschmack mit der Gewohnheit verschmolzen ist? Rituale wie die morgendliche Routine machen vieles einfacher, reduzieren Stress und geben uns Sicherheit. Im Leben hat man schliesslich oft genug Entscheidungen zu fällen, oder? Insgesamt trifft ein Mensch täglich bis zu 20’000 Entscheidungen, wir sind also permanent im
Schliesslich hat unser Gehirn nur eine begrenzte Kapazität pro Tag, um qualitativ hochwertige Entscheidungen zu fällen. Dann kann es zu einer Entscheidungserschöpfung (englisch: decision fatigue) kommen. Menschen, die eine Führungsposition haben, alleinerziehend sind oder in der Medizin, Pflege, im Militär oder in der Justiz arbeiten, sind dabei besonders gefährdet. Was hilft, sind einfache Tricks wie eben Routinen etablieren, wichtige Entscheidungen auf den Morgen legen, To-do-Listen und Entscheidungshilfen nutzen, genü-
gend Pausen einbauen, in denen man den Kopf freibekommt. Oder Entscheidungen einfach delegieren. Doch möchten wir in der Beilage weniger auf Entscheidungsüberforderung eingehen, als vielmehr die grossen und lebensbestimmenden Entscheidungen des Lebens hervorheben, aber auch die klitzekleinen, die man z. B. bei einem Brettspiel fällt. Wir möchten erfahren, was in unserem Gehirn passiert und wie die Werbung das nutzt, um uns für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu gewinnen. Vor welchen alltäglichen Entscheidungen steht man als Gastronomin? Und wie kann Achtsamkeitstraining helfen, Klarheit im Kopf zu schaffen? Ein ruhigerer Geist trifft schliesslich überlegtere Entscheidungen und erholt sich schneller von geistiger Ermüdung. Ein paar tiefe Atemzüge vor Entscheidungen können schon helfen, kurz innezuhalten und weniger impulsiv zu handeln. Viel Spass beim Lesen, vielleicht führt das Gelesene ja zu der ein oder anderen Entscheidung bei Ihnen.
Ihre
Dominique Simonnot
IMPRESSUM: Verlagsbeilage zum Lenzburger Bezirks-Anzeiger, Der Seetaler/Der Lindenberg, Donnerstag, 15. Mai 2025 Auflage: 40 185 Expl. (WEMF 2024) Herausgeber: CH Regionalmedien AG, Kronenplatz 12, 5600 Lenzburg, Tel. 058 200 58 20
Leiter Wochenzeitungen: Stefan Biedermann Redaktion: Dominique Simonnot Layout: CH Regionalmedien AG Titelbild: Getty
Anzeigen: Kronenplatz 12, 5600 Lenzburg, Tel. 058 200 53 53, inserate@chmedia.ch Druck: CH Media Print AG, Aarau


Kurs- und Rundfahrten
Extrafahrten
Kulinarische Themenfahrten
Der Weg der Entscheidung Neurologe und Psychiater Piotr Jedrysiak im Gespräch Seite 4 und 5
Achtsamkeit als Schlüssel Bewusste Entscheidungen treffen Seite 7
Leben im Tiny House
Leben auf kleinster Fläche Seite 9
Liebe auf den 2. Blick Einkaufen im Brocki Seite 11
Einmal Schweden und zurück
Prägender Aufenthalt im Ausland Seite 12
Gruppen- oder Einzelsport? Talent und Herz entscheiden Seite 13
Die Wahl der Socken Kampf dem Sockenschwund Seite 15
Branding und Storytelling Was kann Werbung, wie wirkt sie? Seite 16
Die Wahl des Transportmittels Schiene oder Strasse? Seite 17
Essen wie beim Grosi Entscheidungen im Gastrobetrieb Seite 19
Brettspiel «Go» Unendliche Spielzugmöglichkeiten Seite 20 und 21
Von Dürrenäsch in die Welt Bertschi – Global Player in der Region Seite 22
Der Glaube als Wegweiser Stütze bei schweren Entscheidungen Seite 23




Schifffahrtsgesellschaft
Hallwilersee AG Meisterschwanden

5616 Meisterschwanden +41 56 667 00 00

Info@schifffahrt-hallwilersee ch www.schifffahrt-hallwilersee.ch
Der Lenzburger Neurologe und Psychiater Piotr Jedrysiak spricht im Interview über die Entstehung von Entscheidungen, das Bauchgefühl und darüber, ob Entscheidungen wirklich krank machen können.
Interview: Julia Christiane Hanauer
Herr Jedrysiak, ist es Ihnen leichtgefallen, sich für dieses Interview zu entscheiden?
Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Die Entscheidung an sich ist mir tatsächlich etwas schwer gefallen, weil ich zeitlich momentan sehr ausgelastet bin und schauen muss, wie ich es terminlich einrichten kann.
Tagtäglich treffen wir zahlreiche Entscheidungen. Ab welchem Alter lernt der Mensch, Entscheidungen zu treffen, und wie lernt er das?
Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, setzt gewisse funktionierende Hirnstrukturen voraus. Diese beginnen sich bereits im Mutterleib ab etwa der fünften Schwangerschaftswoche zu entwickeln. Zudem beruhen unsere Entscheidungen auch auf bestimmten Prägungen und Werten, die wir von unseren Eltern, unserem Umfeld bereits früh mit auf den Weg bekommen. Als Beispiel sei hier genannt, ob wir eher «ein Migrosoder ein CoopKind» sind. Aus der Psychotraumatologie wissen wir zudem, dass sich ein traumatisierendes Erlebnis der Mutter während der Schwangerschaft auf die späteren Entscheidungen des Kindes auswirken kann. Ich selbst staunte bei meinen Töchtern immer wieder, wie sie bereits im Alter von zwei Jahren genau wussten, was sie anziehen wollten und was nicht.
In welcher Region im Gehirn werden Entscheidungen getroffen, und was geschieht dabei?
Vereinfacht kann man sagen, dass es keine eigentliche «Entscheidungsregion» gibt. Es sind unterschiedliche sogenannte neuronale

Netzwerke, die beim Treffen einer Entscheidung zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst Einfluss nehmen. Für das bewusste Abwägen ist vor allem unser Frontalhirn zuständig. Unser Emotionserleben, das im limbischen System gesteuert wird, hat unbewusst Anteil an unseren Entscheidungen, ebenso wie bestimmte bewusste und unbewusste Wahrnehmungen, beispielsweise, ob wir beim Einkaufen hungrig sind oder nicht.
Gibt es kognitive Unterschiede zwischen eher banaleren Entscheidungen wie «Esse ich lieber eine Karotte oder eine Gurke?» und wichtigen Entschei
dungen, beispielsweise, ob man den Job wechseln soll oder nicht? Bei banaleren Entscheidungen kommt es uns entgegen, dass wir grundsätzlich Gewohnheitstiere sind. Der Spruch «Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht» kommt nicht von ungefähr. So gehen wir beim Wocheneinkauf zum Beispiel fast automatisch durch die Regale und packen die Produkte in den Einkaufswagen, die wir kennen. Dies ist für unser Hirn «der effizienteste Weg». Wir sind geneigt, zu denken, dass wir bei wichtigen Entscheidungen bewusste Abwägungen machen sollten. Tatsächlich gab es dazu interessante Studien, bei denen der Einfluss des
Den grössten Teil unserer täglichen Entscheidungen treffen wir unbewusst.»
Piotr Jedrysiak
sogenannten Bauchgefühls untersucht wurde. Dieses ist nicht zu unterschätzen und hat in bestimmten Untersuchungsreihen tatsächlich zu den vermeintlich besseren Entscheidungen geführt.
Und welchen Einfluss hat das Bauchgefühl genau?
Unter unserem Bauchgefühl fassen wir nicht ganz fassbare Gefühle und Emotionen, unbewusste Eindrücke und Erfahrungen zusammen, die unsere Entscheidungen beeinflussen können. Wir können beispielsweise oft nicht sagen, warum uns eine Person nun sympathisch ist oder eben nicht, weil für diese Bewertung viel Unbewusstes eine Rolle spielt.
Wie entscheidet das Gehirn, welche die beste Entscheidung ist?
Es kommt auf die Situation an. Ein Pilot oder ein Notarzt beispielsweise muss innert Sekunden Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Er kann dann nicht jede einzelne Option und Konsequenz zuerst abwägen, sondern geht xfach geübte und verinnerlichte Entscheidungsprozesse durch. In anderen Situationen haben wir mehr Zeit, um eine Entscheidung bewusst zu treffen, zum Beispiel beim Autokauf. Hier können wir uns aufgrund unserer Präferenzen und Anforderungen vielleicht
auf zwei bis drei Modelle eingrenzen, am Ende spielen konkrete Kriterien wie der Preis, aber auch unbewusste Entscheidungsprozesse hinein, zum Beispiel, ob uns der Verkäufer sympathisch ist.
Wie bewusst oder unbewusst fällen wir Entscheidungen?
Den grössten Teil unserer täglichen Entscheidungen treffen wir unbewusst. Ein Beispiel: ob wir beim Autofahren den Fuss auf die Kupplung setzen beim Gangschalten. In jeder Sekunde unseres Lebens treffen Millionen von Sinneseindrücken auf uns ein, wir verarbeiten davon nur einen ganz kleinen Teil bewusst. Ein grösserer Teil wird unbewusst verarbeitet, und ganz viel wird vorher schon weggefiltert.
Die unbewussten Eindrücke haben aber auch einen Einfluss auf unsere Entscheidung, zum Beispiel, ob ich hungrig einkaufe oder im Casino etwas höhere Risiken eingehe, um meine Begleitung zu beeindrucken.
Was ist dran am Spruch «Diese Entscheidung bereitet mir Bauchschmerzen»? Gibt’s das wirklich?
Psychische Prozesse können körperliche Symptome hervorrufen. Stellen Sie sich vor, dass Sie in eine saftige Zitrone beissen. Sie merken vielleicht, wie sich Ihre Lippen zusammenziehen und der Speichelfluss stärker wird. Das Treffen einer meist unangenehmen Entscheidung, wie das Künden einer Stelle, kann mit einem erhöhten Stresserleben und damit einer einhergehenden Erhöhung bestimmter Hormonspiegel wie Cortisol zu schlaflosen Nächten, Herzklopfen oder eben Bauchweh führen.
Welche Krankheiten hängen mit Entscheidungen zusammen?
Jede Erkrankung sowohl der Psyche als auch des zentralen Nervensystems kann Einfluss auf unsere Entscheidungen haben. Als Beispiele wären Zwangserkrankungen oder Depressionen zu nennen oder Demenzerkrankungen.
Helfen Entscheidungen, um im Alter fit zu bleiben?
Dies möchte ich umkehren: «Wer fit ist im Alter, kann noch selbst entscheiden.» Um im Alter fit zu bleiben, helfen ein gesunder Le
benswandel sowie ausreichende soziale Kontakte, eine stete Neugier sowie der Wille, sich kognitiv zu fordern.
Wie beeinflusst uns unser soziales Umfeld dabei?
Wie bereits erwähnt, lernen wir bereits in der Kindheit von unserem sozialen Umfeld gewisse Werte und Mantras. Einem St. Galler würde es nie in den Sinn kommen, Senf zur Bratwurst zu bestellen, der Basler fiebert für den FCB.
Ob in sozialen Medien, Zeitschriften oder im TV: Wir sind ständig von Werbung umgeben. Wie beeinflusst das unsere Entscheidungen?
Wir sind eindeutig anfälliger, Produkte zu kaufen, für die uns in der Werbung «vorgeschwärmt» wird und die aufgrund der Werbung auf unserem bewussten oder unbewussten Wahrnehmungsradar sind.
Wie kann man sich vor Beeinflussung schützen?
Dies ist unmöglich, ausser wir würden mit Ohrenschützern und Scheuklappen durchs Leben gehen.
Was passiert im Gehirn, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben beziehungsweise eine Entscheidung bereuen?
Emotional stark behaftete Erfahrungen und Ereignisse speichern wir in unserem episodischen Gedächtnis, einem Teil unseres Langzeitgedächtnisses, ab, wo sie lange Zeit abrufbar sind. Im besten Fall lernen wir etwas aus dieser unangenehmen Erfahrung und vermeiden beim nächsten Mal einen solchen Fehler.
Dr. med. Piotr Jedrysiak ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und führt gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. med. Andreas Breunig die neurogeriatrische Praxis in Lenzburg. Er befasst sich besonders mit Krankheitsbildern, bei denen Neurologie und Psychiatrie nicht klar voneinander getrennt werden können, wie zum Beispiel kognitive Defizite bei Demenz, nach einem Schlaganfall, Depression bei Parkinson. Auch klärt er unklare Zustandsbilder ab.

















Schimmelpilze, Radonbelastung, Salzausblühungen und marode Mauerwerke – ob in Alt- oder Neubauten, oft liegt die Ursache im selben Problem: Feuchtigkeit. Die Dobler-Bautenschutz AG bietet effektive und nachhaltige Lösungen, um Gebäude dauerhaft zu schützen.
Seit drei Jahrzehnten steht die DoblerBautenschutz AG für höchste Qualität und dauerhafte Lösungen im Bereich Bautenschutz und Sanierung. Was 1993 mit der Vision von Franz Dobler begann, ist heute ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen mit 20 engagierten Mitarbeitenden – geführt in zweiter Generation von Kevin Dobler und Elian Bertschi.
Als Experten für Altbausanierung, Denkmalschutz, Mauerwerks- und Gewölbesanierung, Radonsanierung, Abdichtungen sowie Schimmelpilzbekämpfung und Wasserschadensanierung bietet die Dobler-Bautenschutz AG massgeschneiderte Lösungen – mit einer beeindruckenden 10-Jahres-Garantie. Modernste Messtechnik und hochwertige Materialien garantieren erstklassige Ergebnisse, unterstützt durch ein hochqualifiziertes Team aus Schimmelpilz- und Schadstoff-Experten sowie Baugutachtern.
Zum 30-jährigen Jubiläum setzt das Unternehmen auch im Personalwesen Massstäbe: Bereits vor zwei Jahren wurde die 4-Tage-Woche eingeführt – ein Schritt, der nicht nur Innovation, sondern auch Wertschätzung für das Team zeigt.
Radonbelastung –
eine unsichtbare Gefahr
Radon – ein unsichtbares, geruchloses Edelgas, das dennoch ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko darstellt. Als natürliches Zerfallsprodukt von Uran und Radium besitzt es radioaktive Eigenschaften und gilt nach dem Rauchen als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs.
Das Gas kann auf unterschiedlichste Weise in Gebäude eindringen – etwa durch alte Bruch- und Mischmauerwerke, Risse, Schächte, Naturkellerböden oder Durchdringungen.
Besonders ältere Bauwerke sind betroffen, doch auch moderne Gebäude können anfällig sein: Da Radon wasserlöslich ist, steigt das Risiko einer Belastung, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk oder den Boden eindringt. Selbst bei zeitgemässen Bauten mit Betonfundamenten kann eine unzureichende Abdichtung zu erhöhten Radonwerten führen.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte frühzeitig Messungen durchführen und bei erhöhter Belastung gezielte Sanierungsmassnahmen ergreifen.
Schimmelbefall – Wenn Feuchtigkeit zur Gesundheitsgefahr wird
Schimmelpilze brauchen drei Dinge, um zu wachsen: Temperaturen zwischen +5 und +45 °C, organische Nährstoffe wie Hausstaub, Holz oder Lebensmittel – und vor allem Feuchtigkeit. Die ersten beiden Faktoren sind in Gebäuden fast immer vorhanden. Entscheidend ist die Feuchtigkeit. Ist sie zu hoch, beginnt der Schimmel zu wachsen und breitet sich aus.
Die Folgen sind weitreichend: Sporen gelangen in die Raumluft und können Atemwegserkrankungen, Allergien und andere gesundheitliche Beschwerden auslösen. Gleichzeitig beschädigt Schimmel Inventar und Bausubstanz und senkt den Wert der Immobilie erheblich.
Kleine Schimmelflecken (bis Handgröße) lassen sich mit geeigneten Mitteln selbst entfernen. Doch sobald der Befall großflächig oder wiederkehrend ist, sollte eine Fachperson hinzugezogen werden. Noch wichtiger ist es, die Ursache zu identifizieren. Denn eines ist sicher: Solange Feuchtigkeit vorhanden ist, wird der Schimmel immer wiederkommen.
Die Lösung: Mauerwerksanierung vom Fachmann
Um langfristige Schäden zu verhindern, sollte nicht nur die sichtbare Ausblühung entfernt, sondern vor allem die Ursache –die Feuchtigkeit – beseitigt werden. Durch
eine gezielte Mauerwerksanierung und Abdichtung lassen sich solche Probleme nachhaltig lösen. Die Dobler-Bautenschutz AG analysiert jeden Fall ganzheitlich und sorgt mit massgeschneiderten Lösungen dafür, dass Feuchtigkeitsprobleme dauerhaft beseitigt werden.
Unser Grundsatz: Ein Problem sollte man nur einmal lösen – und zwar für immer.
Haben Sie Salzausblühungen oder Feuchtigkeitsschäden entdeckt? Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen eine fachgerechte Lösung – sauber, fachmännisch und mit 10 Jahren Garantie.
Kontakt:
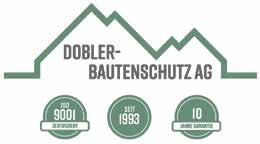
Dobler Bautenschutz AG
Veltheimerstrasse 12 5107 Schinznach-Dorf info@dobler-bautenschutz.ch Telefon 0800 30 31 30


In einer Welt voller Ablenkungen, Zeitdruck und Informationsflut fällt es zunehmend schwer, klare und wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Umso wichtiger ist es, seine Achtsamkeit zu schulen.

Von Dominique Simonnot
Viele kennen das sicher: die Unschlüssigkeit, sich für ein Produkt zu entscheiden. Minutenlanges Verweilen vor dem Spiegel einer Boutique: Soll ich, soll ich nicht? Oder lieber die andere, etwas aussergewöhnlichere Hose? Oft greift man dann aus Gewohnheit oder Zeitdruck zu Altbewährtem. Eine achtsame Entscheidung beginnt hier damit, kurz innezuhalten: Warum tendiere ich zu diesem Produkt? Was reizt mich an dem anderen? Und brauche ich überhaupt eine neue Hose? Diese kurze Unterbrechung kann schon helfen, eine bewusstere Entscheidung zu treffen, denn sie durchbricht Automatismen und hilft, innere und äussere Reize bewusster und differenzierter wahrzunehmen.
Wer innehält, erkennt vielleicht eigene Denkverzerrungen wie voreilige Schlüsse, Wunschdenken oder Gruppendruck. Statt impulsiv zu handeln, entsteht Raum für Reflexion. In wichtigen Entscheidungsprozessen – ich spreche jetzt natürlich nicht von Hosen – kann das den entscheidenden Unterschied machen. So kann z. B. eine Führungskraft durch Achtsamkeit bemerken, ob sie eine Entscheidung aus Angst vor Konflikten trifft oder auf Basis fundierter Argumente.
Insbesondere in Berufen mit hoher Verantwortung ist Achtsamkeit besonders relevant. Ärzte müssen oft unter Zeitdruck Entscheidungen treffen, die mitunter Leben betreffen. Ähnlich ist es bei Piloten, Polizisten, Rettungskräften: Ein klarer, ruhiger Geist kann in brenzligen Situationen Fehlentscheidungen verhindern. Auch in der Justiz hilft Achtsamkeit Richtern, Urteile objektiver und mit mehr innerer Distanz zu fällen. Im pädagogischen Bereich hilft Achtsamkeit Lehrkräften, nicht vorschnell auf Schülerverhalten zu reagieren, sondern konstruktive Wege zu wählen. Achtsamkeit ist also keine esoterische Modeerscheinung, sondern ein hochwirksames Instrument für kluge, reflektierte Entscheidungen – beruflich wie privat.
Achtsamkeit lernen
Achtsamkeit lässt sich lernen. Zum Beispiel an der Akademie für Achtsamkeit und Resilienz in Lenzburg, die nach dem wissenschaftlich erforschten MBSR-Programm (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit) lehrt, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. MBSR vereint dabei Erkenntnisse der modernen Neurowissenschaften, Elemente der Verhaltenspsychologie und spirituelles Wissen. Als Selbsthilfemethode wird das Pro
gramm häufig ergänzend bei medizinischen und psychotherapeutischen Behandlungen angewendet. «Gleichzeitig dient Achtsamkeit der Persönlichkeitsentwicklung und kann helfen, Erkrankungen besser anzunehmen oder Erschöpfung zu vermeiden», weiss Tanja Taugwalder, die mit ihrem Mann Joe die Akademie vom Gründer gekauft hat.
Achtsamkeit muss geübt werden Es gibt zahlreiche Lehrgänge, um zu schnuppern oder um selbst Achtsamkeitstrainer zu werden. Immer häufiger wird das Programm auch von Unternehmen nachgefragt, welche eine positive Arbeitsatmosphäre implementieren und Vertrauen im Team stärken wollen. «In der heutigen dynamischen Arbeitswelt ist es entscheidend, eine Unternehmenskultur zu fördern, die sowohl das Wohlbefinden der Mitarbeitenden als auch die organisationale Resilienz unterstützt», so Joe Taugwalder. «Allerdings ist es wie mit allem: Achtsamkeit muss man üben. Zwar helfen einem die vielen Techniken, aber man muss auch selbst aktiv werden. Im Moment zu leben, kann insbesondere im oft hektischen Alltag am Anfang eine Herausforderung sein, bis man es fest etabliert hat.» achtsamkeit.swiss
Online-Infoabend Dienstag, 3. Juni 2024 * n Automatikfachmann:frau n Automobildiagnostiker:in n AVOR-Spezialist:in n Bereichsleiter:inHotellerieHauswirtschaft n Fertigungsspezialist:in n Hauswart:in n Holzbau Vorarbeiter:in n Instandhaltungsfachmann:frau n Leadership4R n Leiter:ininFacilityManagement und Maintenance n Maschinenbautechniker:in Produktionstechnik, HF n Montagespezialist:in n Photovolteur:in® n Produktionsfachmann:frau n Projektleiter:inSolarmontage n Solarteur:in® n Spezialist:in füralternative Fahrzeugantriebe n Technische(r)Kaufmann:frau n Vorarbeiter:in Werkdienst * kostenlosund unverbindlich, Anmeldungerforderlich www.wbzlenzburg.ch





Den Traum von den eigenen vier Wänden träumen viele – auch Menschen mit schmalem Budget. Mag dies ein Grund sein, um sich für ein Tiny- oder Kleinhaus zu entscheiden?
Von Carolin Frei
«Wir leben in einer hektischen Zeit. Das Streben nach Wachstum und die permanente Reizüberflutung ruft bei vielen Menschen eine starke Sehnsucht nach dem hervor, was wirklich wichtig ist. Daher ist die Redewendung «Weniger ist mehr!» unsere Maxime beim Planen von Wohnraum», sagt Reiner Wildi, Geschäftsführer und Inhaber von ecoModulHaus. «Bei Menschen, deren Wahl auf ein Tiny oder Kleinhaus fällt, stehen meist folgende Überlegungen im Vordergrund: 1. Ich möchte mein Leben vereinfachen, weniger Ressourcen nutzen. 2. Mein Budget lässt mir keinen grossen Spielraum. 3. Ökologische Gründe, ein kleinerer Fussabdruck und verdichtetes Wohnen auf eher kleinem Raum entspricht dem Zeitgeist», sagt Wildi, der seit 2014 ModulLösungen für Private, Hotels und Campingplätze anbietet.
Singles, Familien, Senioren
Mit Kleinhäusern spreche man querbeet alle Bevölkerungsschichten an. Allerdings sei das Interesse bei älteren oder allein lebenden Menschen schon grösser. «Gerade ältere Personen, die ein Haus mit Umschwung haben, überlassen das Wohnhaus gerne einem Kind und nutzen den Platz im Garten, um ein

Minihaus aufzustellen», sagt Wildi. Diese StöckliVariante sei gefragt und werde in der Regel, sofern die Ausnutzungsziffer eingehalten wird, auch vereinfacht bewilligt.
Bei Neubauten auf brachem Bauland könne die Bewilligung für ein einstöckiges Gebäude erschwert sein, da verdichtetes Bauen von Seiten Raumplanung angestrebt werde. Häufig werde seitens Interessenten unterschätzt, dass sämtliche Arbeiten rund um die Kleinwohnform für Abwasser, Wasser und Strom sowie die Baugesuchverfahren und weiteren Bewilli

gungen finanziell ähnlich zu Buche schlagen wie bei einem konventionellen Einfamilienhaus. Kleinwohnformen benötigen hingegen weniger Bauland, was sich positiv aufs Budget auswirken kann. «Diese Wohnkonzepte sind ideal als Wohnraumerweiterung für die Nachverdichtung von bereits bebauten Parzellen oder als zeitlich begrenzte Zwischenlösung von ungenutzten Baulandparzellen.»
Module aus Mondholz ecoModulHaus arbeitet mit einem Partnerunternehmen zusammen, das für die Herstellung der Modulelemente ausschliesslich naturreines, mondphasengeschlagenes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Mondholz – das fusse nicht auf Esoterik, sondern sei eine wissenschaftlich belegbare Erkenntnis. «Das Holz für unsere Wände wird von Thoma Holz100 in den Wintermonaten bei Neumond geschlagen, wenn der Baum in der ‹Saftruhe› ist, um die beste Qualität zu erreichen.» Dadurch wird für eine dichtere Zellstruktur, besseren
Schall und Brandschutz sowie eine lange Lebensdauer gesorgt. Ausserdem kommen bei der Fertigung der Vollholzwände weder Leim noch Bauchemie zum Einsatz. Der Wandaufbau wird durch mechanische Verbindungen mit Holzdübeln geschaffen. Beim Innenausbau – vor allem auch mit multifunktionalen Elementen – wird der Käufer entsprechend beraten.
Kein Fundament nötig Das Aufstellen dieser Wohnmodule verursacht keinerlei Flurschaden. Die erdbebensicheren Wohnmodule werden auf rückbaubare Schraubfundamente gesetzt. Es braucht keine Aushubarbeiten und keine Betonfundamente oder Unterkellerung. Es wäre sogar zu einem späteren Zeitpunkt möglich, das komplette, einmodulare Haus zu verladen und an einem neuen Ort zu platzieren. Und – falls das Modulhaus einmal rückgebaut werden muss, kann das Holz anderen Zwecken zugeführt werden. Auch bei der Nachhaltigkeit hat man die Wahl.



Holzbau Schmied GmbH Telefon062 8960526
Mühleweg 22 Fax062 8960527
5504 Othmarsingen info@holzbau-schmied.ch

www.holzbau-schmied.ch
Nachhaltig, herzlich und immer wieder überraschend: Die neue Brocki in Niederlenz macht es einem einfach, sich für Gebrauchtes zu entscheiden – egal welche Motivation hinter dem Einkauf steckt.
Von Yvonne Imbach





Viele Menschen entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen für gebrauchte Möbel. Oft spielt der Preis eine Rolle – Secondhand ist meist günstiger und bietet trotzdem hohe Qualität. Auch ökologische Aspekte wie Ressourcenschonung und CO2 Einsparung sind wichtig. Manche wollen bewusst ein Zeichen gegen Massenkonsum setzen. Andere schätzen den ästhetischen Reiz von VintageMöbeln oder suchen einzigartige Stücke mit Geschichte und Charakter.
Seit dem 2. Juli 2024 gibt es in Niederlenz eine neue Anlaufstelle für alle, die gerne stöbern, Raritäten und Schnäppchen jagen oder einfach mit einem nachhaltigen Einkauf etwas Gutes tun möchten: die Brocki des Blauen Kreuzes AargauLuzern. Auf über 1000 Quadratmetern bietet die BlaukreuzBrocki Niederlenz alles, was das Herz begehrt – von Kleidung, Haushaltswaren und Möbeln bis hin zu Büchern, Medien und Raritäten für Sammler. «Für jeden ist etwas dabei», sagt Nadja Döbeli, die Leiterin des Hauses.
Die 45Jährige ist von Anfang an mit dabei. Seit dem 1. März 2024 begleitet sie den Aufbau der Brocki mit viel Herzblut. «Für mich steht ‹wieder verwenden statt wegwerfen› ganz oben. Aber es sind auch die vielen emotionalen Momente, wenn Menschen ihre Sachspenden

Es lohnt sich, für den Brocki-Besuch Zeit mitzubringen. Bild: zvg
vorbeibringen, die mich berühren», erzählt sie. Sie sei all jenen dankbar, die das Projekt mit ihren Gaben unterstützen – und es auch weiterhin tun werden.
Neues Leben für Sachen aus zweiter Hand
Die Blaukreuzorganisation, unter deren Dach die Brocki betrieben wird, steht für soziale und nachhaltige Projekte (siehe InfoBox). Auch Hausräumungen gehören zum Angebot. «Dabei nehmen wir so viel wie möglich für den Wiederverkauf mit – die Sachen aus zweiter Hand bekommen ein neues Leben, und der Erlös dient einem guten Zweck», erklärt Döbeli.
Wer die Brocki besucht, kann direkt vor Ort parkieren – die HetexBushaltestelle liegt sogar unmittelbar vor der Tür. Eine gemütliche
KaffeeEcke sucht man allerdings vergeblich. «Das überlassen wir gern den anderen Anbietern auf dem Areal. Aber zu besonderen Anlässen wie dem Weihnachtsmarkt gibt’s schon mal einen Kaffee als kleines Dankeschön.»
Über die Annahme wird vor Ort entschieden
Die Waren kommen auf verschiedenen Wegen ins Haus: einerseits durch Hausräumungen, andererseits durch tägliche Spenden von Privatpersonen. Nicht alles wird übernommen – die Annahme entscheidet vor Ort, was ins Sortiment passt. «Die Artikel müssen in gutem Zustand sein. Und meine Regel lautet: Je älter ein Stück ist, desto mehr Macken darf es haben», so Nadja Döbeli. Jeder Artikel bekommt einen Fixpreis – gehandelt wird nicht.
«Unsere Preise orientieren sich an bewährten Richtlinien und sorgen für Fairness und Transparenz.» Wer denkt, dass man den besten Fund zu bestimmten Zeiten machen kann, liegt übrigens falsch: «Jeder Tag ist auch für uns eine Überraschung. Es lohnt sich immer, einfach vorbeizuschauen.» Damit man beim Stöbern nichts übersieht, rät sie: «Genug Zeit einplanen. Unsere Brocki ist übersichtlich und gut geordnet, aber es gibt so vieles zu entdecken, dass man die Zeit oft schnell vergisst.»
Auch Beratung wird grossgeschrieben. Die Mitarbeitenden und die freiwilligen Helferinnen und Helfer stehen in allen Abteilungen gerne für Fragen bereit – egal ob zur Pfanne, zum Pullover oder zur CD. Das Brockenhaus Niederlenz ist damit mehr als nur ein Ort zum Einkaufen – es ist ein Treffpunkt für Nachhaltigkeit, Menschlichkeit und die Freude am Entdecken.
Die Fachorganisation
Das Blaue Kreuz ist schweizweit die grösste Suchtfachorganisation für Probleme mit Alkohol und begleitenden Suchtmitteln wie Cannabis oder Kokain. Betroffene, Angehörige und deren familiäres Umfeld erhalten kostenlose Beratung und Hilfe. Weiter betreibt das Blaue Kreuz Präventions-, Selbsthilfe- und Integrationsangebote. Die Brockis sind eine wichtige Finanzierungsquelle für das Blaue Kreuz.
Praxis für: Phy iotherapie Spor tph siotherapie K rafttraining
Menschen entscheiden sich aus den unterschiedlichsten Gründen, ins Ausland zu gehen. Auch Tobias Keller zog es mit Familie für einige Jahre nach Schweden – aber auch wieder zurück in die Schweiz.

Interview: Dominique Simonnot
Bei einem Auslandsaufenthalt werden nicht nur Sprachkenntnisse und fachliches Wissen erweitert, sondern auch wichtige persönliche und interkulturelle Kompetenzen entwickelt. Man lernt, sich in neuen Situationen zurechtzufinden, wächst an Herausforderungen und gewinnt neue Perspektiven auf die Welt und die eigene Kultur. Tobias Keller aus Staufen kann davon ein Lied singen. Bereits während seines Studiums lebte Tobias Keller öfter im Ausland. Nachdem er in Luzern Journalismus studiert hatte, zog es ihn für seinen Master in Kunst, Unterhaltungs und Medienmanagement an Universitäten in New York, Mailand und Berlin. 2014 wanderte er mit seiner Frau schliesslich nach Västervik in Schweden aus, wo er sich vom Hotelportier zum Journalisten beim schwedischen Staatssender SVT hocharbeitete. Im Oktober 2022 zogen beide wieder zurück in die Schweiz – nach Staufen, von wo seine Frau Anna stammt. Die Rück
kehr war nicht immer einfach, doch ist die Familie inzwischen im Aargau angekommen. Heute arbeitet er Teilzeit als Kommunikationsspezialist beim Kanton Aargau und profitiert von seinen Erfahrungen in Schweden.
Herr Keller, warum sind Sie 2014 nach Schweden ausgewandert?
Meine Eltern – beides Schweizer –haben sich in den 60erJahren in Stockholm kennengelernt, und ich bin sehr schwedisch aufgewachsen.
Meine Frau spielte Unihockey auf hohem internationalem Niveau und hatte in Schweden den Europacup mit ihrem Team gewonnen und hatte durch den Spitzensport Freunde in Schweden. Wir hatten also eine Verbindung zu dem Land und haben begonnen, die Sprache zu lernen – die Entscheidung, dorthin zu ziehen, war ein schleichender Prozess. Irgendwann haben wir alle Ausbildungspapiere meiner Frau zur Physiotherapeutin ans schwedische Sozialministerium gesendet, mit dem Antrag, dass meine Frau eine Berufsausübungsbewilli
gung für Schweden bekommt. Nach einem Jahr war die «Legitimation» da, und dann ging es los.
War es die richtige Entscheidung?
Auf jeden Fall. Und ich bin stolz, dass es uns gut gelungen ist, in den schwedischen Arbeitsmarkt einzuwandern. Viele Auswanderergeschichten, die hier in der Schweiz aus Funk und Fernsehen bekannt sind, sind solche, in denen sich die Auswanderer im Ausland selbstständig machen. Wir haben auf dem Arbeitsmarkt Jobs gesucht und immer welche gefunden.
Nachtportier in einem VierSterneHotel war mein erster Job, als Journalist beim schwedischen Fernsehen SVT endete meine Laufbahn in Schweden. So eine «Tellerwäscher» Karriere ist erfrischend für den Geist und tut gut.
Wieso gingen Sie wieder zurück in die Schweiz?
Meine Frau wollte irgendwann näher bei ihrer Familie und ihren Freunden sein. Dank Beziehungen
Mannschaftssport oder Einzelsport – eine Entscheidung, die oft unbewusst gefällt wird. Wie sehr sie das Athletenleben prägt, erzählen Robin Grossmann und Valentina Rosamilia.
meiner Frau haben wir ein super Zuhause in Staufen gefunden.
Ist Ihnen die Rückkehr schwergefallen?
Für mich war es sehr schwer, und ich hatte anfangs grosse Mühe. Auch dass ich hier in der Schweiz als «Fremder» bezeichnet worden bin, hat mich erschüttert. So wurde ich in Schweden nie bezeichnet. Auf eine mir unbekannte Art aus meiner Zeit in Schaffhausen und Zürich ist es hier im Aargau wichtig, woher jemand kommt. Gerade hier in der Region Lenzburg, wo Gemeindegrenzen durch Quartierstrassen gehen – was spielt das für eine Rolle? Rückblickend war die Rückkehr in die Schweiz aber keine Fehlentscheidung.
Was verändert sich durch so einen Auslandsaufenthalt?
Man erhält unglaublich viele neue Sichtweisen auf das Zusammenleben als Gesellschaft und stellt fest, dass alle in einer Gesellschaft gleich und gleich viel wert sind. Da bin ich zum Zentralisten geworden – weil ich gemerkt habe, dass in der föderalistischen Schweiz nicht alle überall immer gleich und gleich viel wert sind.
Zum Beispiel beim Schulsystem: In der Schweiz kann schon ein Umzug von 20 Kilometern für eine Familie alles verändern. Kinder kommen auf einmal in ein Schulsystem, in dem es eine Gymiprüfung braucht, die es am alten Wohnort nicht brauchte. Damit verringert sich die Chacengleichheit. In Schweden ist das Schulsystem vereinheitlicht, ebenso die Kinderzulagen, die hier kantonal geregelt sind. In Schweden geht es häufiger ums grosse Ganze, und Dinge wie z. B. der Stromverbrauch sind viel transparenter als in der Schweiz.
Von Sira Heimgartner
Manchmal sind es kleine Impulse, die über grosse Wege entscheiden. «Ich habe als Kind am ‹schnellsten Hunzenschwiler› teilgenommen, aber nicht verstanden, dass man möglichst schnell laufen sollte, und bin ins Ziel gejoggt. Als ich sah, wie schnell meine Schwester war, wollte ich das auch können», erinnert sich Valentina Rosamilia, 22. Bei Robin Grossmann, 37, war es die Faszination für ganz bestimmte Objekte: «Ich habe als kleiner Bub sehr gerne Helme getragen. Als ich auf bei einem Familienausflug in Wohlen Eishockeyspieler mit Helmen sah, wollte ich das ausprobieren», so der Dintiker. Die kindliche Neugier führte die beiden Aargauer aber nicht nur in eine unterschiedliche Sportart, sondern in zwei grundverschiedene Welten des Leistungssports. Auf der einen Seite die absolute Eigenverantwortung und der stille Kampf gegen die Zeit – auf der anderen Seite die geteilte Verantwortung und das soziale Gefüge. «Man hat niemanden, der einem aus der Patsche helfen kann», sagt der EHCBielSpieler über den Einzelsport. Diese Erkenntnis zieht er aus den Mountainbikerennen, die er neben dem Eishockey bis in seine Jugend gefahren ist. «Ich mag es, wenn das Resultat von mir alleine abhängt», sagt hingegen die Läuferin, «und




dass man nicht mehr bekommt als das, was man verdient.» Er wiederum sieht genau darin einen Vorteil des Mannschaftssports: «Man kann selbst an schlechteren Tagen dem Team helfen, indem man kleine Dinge richtig macht.» In jungen Jahren habe er allerdings gemerkt, dass es frustrierend sein kann, wenn die eigene Leistung zwar stimmt, der Teamerfolg aber ausbleibt. «Früher war ich manchmal ein Hitzkopf. Meine zwei Kinder haben mich in dieser Hinsicht aber sehr entschleunigt», so Robin Grossmann.
Die Kehrseite der Medaille Kein festes Team zu haben, das man auch ausserhalb des Sports
treffen kann, ist für Valentina Rosamilia ein kleiner Wermutstropfen. Statt mit Mannschaftskolleginnen trainiert sie in einer Gruppe aus sieben 800MeterLäuferinnen aus verschiedenen Nationen – notabene ihre Konkurrentinnen. Als Leichtathletin organisiert sie ihr Umfeld und ihren Alltag selbst. Dazu gehöre etwa, herauszufinden, welcher Trainer welche Philosophie verfolgt, und was zu einem passt. Entscheidungen, die sich im Mannschaftssport erübrigen: «Trainer, Sportchef, Ferien – vieles ist vorgegeben. Eigentlich ist man wie fremdgesteuert», erzählt Robin Grossmann. Und: «Vielen Eishockeyspielern wird das nach dem Karriereende zum Verhängnis.»
Der 37Jährige, der für diverse NationalLeagueKlubs und die Nationalmannschaft auflief, ist deshalb bereits dabei, sein «Leben danach» aufzugleisen. Zunächst aber absolviert er mit dem EHC Biel das Sommertraining und möchte den jungen Spielern auch in der kommenden Saison mit Tipps zur Seite stehen und ihnen die Freude am Sport vorleben. Valentina Rosamilia denkt noch lange nicht ans Aufhören. Die Schattenseiten ihres sportlichen Settings hat sie aber schon früh kennengelernt. Beim Übergang zur Elite habe sie gespürt, wie viel Druck auf einer Einzelathletin lastet – und wie hohe Selbstansprüche zu Stolpersteinen werden können. «In dieser Zeit wollte ich manchmal zu viel und war versucht, notwendige Schritte auszulassen», erzählt sie. Heute weiss die 22Jährige: «Gewisse Dinge im Training und in der eigenen Entwicklung brauchen Zeit. Der Sport hat mir Geduld und Vertrauen gelehrt.» Mit dieser Haltung hat sie es an den Olympischen Spielen 2024 über 800 Meter bis in den Halbfinal geschafft. Valentina Rosamilia fand ihre Erfüllung im Duell mit sich selbst, Robin Grossmann im gemeinsamen Streben nach Erfolg. Manchmal fällt man eine Entscheidung, ohne dass sie einem bewusst ist – und trifft trotzdem genau ins Schwarze.

Freitag, 30. Mai 14 – 21 Uhr Samstag, 31. Mai 8 – 18 Uhr
Heizungs- und Sanitäranlagen
Bauspenglerei
56 00 Lenzburg 0628 88 13 88 info@rwidmer.ch www.rwidmer.ch
R. Widmer AG
Familientradition und Fachkompetenzseit125 Jahren .
für Elektro- und Kommunikationstechnik
5707 Seengen,Poststrasse2 062 777 19 19
www.elektro-hauri.ch info@elektro-hauri.ch
Es ist doch verhext – irgendwohin verschwinden regelmässig einzelne Socken. Suchen vergeblich. Doch mit einfachen Strategien kann man den Schwund minimieren oder ihm die Gewichtung nehmen.
Von Dominique Simonnot
Es gibt diesen Mythos, der sich wie ein geheimnisvoller Nebel über alle Wäscheständer legt. Demnach verschwinden unsere Socken in der Waschmaschine. Tauchen in einer anderen Dimension wieder auf, deren Tore durch die Kräfte des Schleudergangs geöffnet werden. Die dortige Sockenregierung hat selbst den Überblick verloren, seit
Bewusste Entscheidung für den Standort Schweiz
Un f l nvestier t aufend n den Standor t S chweiz Rund zwe dr t tel der L ieferanten stammen ebenfalls aus dem In and Damit bekennt s ch Unif l k ar zum eingeschlagenen Weg und sicher t nachha tig S chweizer Arbe t sp ät ze Mehr er fahren Sie auf unserer Webse te www.unifil.ch

Wer inserier t, profitiert .
LenzburgerBezirks-Anzeiger
DerSeetaler/Der Lindenberg Verkaufund Beratung
Kronenplatz12, 5600 Lenzburg Tel. 058200 53 53,inserate@chmedia.ch www.lba .chmedia .ch www.chmediawerbung.ch
die Mächte der Unordnung die Macht übernommen haben. Zu absurd? Kann sein. Aber irgendetwas muss man doch dafür verantwortlich machen können, dass unsere Socken spurlos verschwinden. Auch wenn sich das alles jeder Ordnung und Logik entzieht.
Irgendwo da draussen kämpft eine geheime Sockenarmee weiter darum, dass unser Sockenbestand schwindet.»

Diejenigen, die resigniert haben, nehmen es meist mit Humor. Was soll man auch machen? Die Waschmaschine verklagen? Den Hersteller? Bei der Kläranlage nachfragen? Bringt nichts, ha ben wir gemacht: Die Antwort: «Es freut mich, dass wir nicht die Ein zigen sind, welche Socken verlie ren und vielleicht auch wiederfin den.» O-Ton von Roman Bieri, Betriebsleiter des Abwasserver bands Region Lenzburg. Beruhi gend und beirrend gleichzeitig. Der Abwasserverband wurde von dem Phänomen sogar zu seinem Lehrfilm inspiriert, in dem die Protagonisten zwei Socken sind.
Und irgendwo da draussen kämpft eine geheime Sockenarmee weiter darum, dass unser Sockenbestand schwindet. Diejenigen, die nicht resigniert haben, versuchen es mit kreativen Lösungen, die zum Beispiel wie folgt aussehen:

Anja Rosok, «Die verschwundenen Socken – The Missing Socks», ein deutschenglisches Kinderbuch, BoD

Justyna Bednarek, «Die erstaunlichen Abenteuer von zehn Socken (vier rechten und sechs linken)» Woow Books, 2023

Socken anketten Mit Sockenklemmen – alternativ mit Kordeln oder Netzbeuteln – lassen sich Sockenpaare miteinander verbinden. Doch wer will sich schon die Mühe machen, die Socken vor dem Waschen zusammenzustecken – insbesondere bei einer vierköpfigen Familie? Auf der anderen Seite erspart man sich das Sortieren nach der Wäsche.
Farben und Muster kombinieren
In der heutigen Zeit ja sogar Trend: unterschiedliche Socken an den Füssen. Dann ist es sogar egal, wenn einzelne Socken verschwinden. Der Kombination sind keine Grenzen gesetzt – höchstens aber dem guten Geschmack. Denn die
ser Trend ist sicher nicht für alle Berufe geeignet.
Nur schwarze Socken Für Minimalisten und Pragmatiker die perfekte Strategie. Man kauft einfach nur noch schwarze Socken und kombiniert diese wild durcheinander – und unterscheidet maximal zwischen wärmeren und dünneren Socken. Einsame Socken werden gar nicht mehr wahrgenommen. Der Sockenschwund mag also ein ungelöstes Mysterium bleiben, aber mit ein bisschen Vorsicht, cleveren Ideen und ein paar kleinen Helferlein kann man zumindest den Verlust minimieren. Und auch ärgern muss man sich nicht mehr.
Heute muss Werbung divers, genderneutral und nachhaltig daherkommen. Reichte früher ein einfacher flacher Slogan, braucht’s heute oft ein komplexes Storytelling, damit sich jemand für ein Produkt entscheidet.
Von Dominique Simonnot
Also wer hat’s erfunden? Wissen alle! Aber mit welchem Waschmittel weiss man, was man hat? Wissen Sie das noch? Genau! Persil! Für alles andere gibt es? Ja, die Mastercard. Ausser für den Himmel auf Erden – den bekommt man mit? Mövenpick. Also nimm dir Zeit und nicht das Leben –wussten auch die SBB. Und nimmt Calgonit – dann klappt’s auch mit dem Nachbarn. Der steht nämlich auf saubere Gläser. Und streamt’s neuerdings auf TikTok. Macht ebenso Erwachsene froh. Jaja, die liebe Werbung. Sie prägt uns subtil und teils sehr nachhaltig, nämlich dann, wenn die Slogans zu geflügelten Worten werden und in den Alltag wandern. Wie eben der Slogan von Ricola, der einer der am häufigsten zitierten sein dürfte.
Sex sells? Geht heute nicht mehr! Doch wie kommt man zu solchen Sprüchen? Wie geht man vor. Und was funktioniert heute noch? «Heute geht vieles nicht mehr, was in den 80ern und 90ern noch ging, als die Werbung noch lauter, dreister und direkter war», bestätigt auch Christian Carpino, Gründer und Leiter der Agentur Neuzeichen in Lenzburg. «Das ist dem gesellschaftlichen Wandel geschuldet und, ja, eine positive Entwicklung, denn unsere Gesellschaft ist gerechter geworden. In der Werbung muss daher mehr auf Diversität, genderneutrale Darstellung und Nachhaltigkeit geachtet werden. Klassische Rollenbilder wie die Frau als Hausfrau, der Mann als Techniker sind tabu. Und da man –gerade in der aktuellen turbulenten Zeit – niemanden verärgern will, verzichtet man auf allzu Provokantes.» Was ist mit Sex sells? «Du meine Güte, das geht gar nicht mehr!» Wie holt man also heute jemanden

Und je nachdem kann eine Lösung sein, nur Teile des Körpers zu zeigen, so wie bei den Fotos und kurzen Spots der Schulthess Klinik, bei der bestimmte Teile des Körpers gezeigt werden, aber nie Gesichter. «Gerade bei der Schulthess Klinik wollten wir den Fokus zudem auf die einzelnen Gelenke oder Körperteile lenken, bei der Hüftchirurgie zum Beispiel auf die Hüfte.» Clever gelöst. Ebenso im Bereich der Signaletik spielt die Thematik Diversität eine wichtige Rolle. «Signaletik muss – insbesondere in öffentlichen Gebäuden – im besten Fall alle Leute abholen, auch Menschen, die nicht lesen können, die blind oder farbenblind sind. Daher arbeitet man oft mit Symbolik und zusätzlicher Blindenschrift, was auch z. B. in Fahrstühlen sehr wichtig ist.»
ÖV oder Auto? Eine Frage, die zu hitzigen Diskussionen führen kann. Der Autor als bekennender Vielfahrer und Autofreund trifft auf jemanden, der sein Berufsleben dem öffentlichen Verkehr gewidmet hat: René Bossard.
Von Philipp Aeberli
Ich glaube, dass die Kindheit eine grosse Auswirkung auf unsere Mobilität hat. Ich bin neben einer SportwagenWerkstatt aufgewachsen. Dort ist meine Begeisterung für das Auto entstanden.
Wie war das bei Ihnen?
Bossard: Mein Vater hat bei den SBB gearbeitet. So war für mich früh klar, dass ich meine Lehre bei der Bahn machen werde. Später wechselte ich zum Kanton Aargau, wo ich für den Ausbau des Busnetzes zuständig war. Und schliesslich arbeitete ich 33 Jahre bei Regionalbus Lenzburg. Ich habe mein Berufsleben dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Also sind Sie nur mit Bus und Bahn unterwegs?


Ride gibt es solche Angebote. Auch mit Mobility waren wir in der Schweiz früh dran, um ein attraktives Paket zu bieten.
ab? «Emotionen gehen immer, das Spielen mit sozialer Zugehörigkeit, Attraktivität und Erfolg. Und Humor natürlich. Charmante und lustige Spots bleiben durch ihre emotionale Wirkung länger im Gedächtnis. Wenn wir schmunzeln oder lachen – wie z. B. über das Huhn Chocolate der Migros –, sympathisiert man meist auch mit dem Produkt oder der Marke.»
Diversität als Herausforderung Um auf Fotos oder in Spots nicht spezifizieren zu müssen, kann eine Lösung sein, auf Personen respektive Gesichter ganz zu verzichten, wie z. B. beim Internetauftritt des Notariats Sekolec in Lenzburg, für das die Agentur ein neues Corporate Design entwickelte. Ein Foto zeigt leere Stühle in einem Sitzungszimmer. «Wir wollten einerseits das Dilemma umgehen, wen wir jetzt an die Stühle setzen: Frau, Mann, dun
kelhaarig, blond, dunkler oder heller Teint, jung oder älter? Andererseits gibt es schon so viele Szenen mit beratenden Menschen, die eigentlich nichts aussagen. Daher haben wir die Stühle leer gelassen und sie so fotografiert, dass es trotzdem stimmig ist.»

Heute geht vieles nicht mehr, was in den 80ern und 90ern noch ging, als die Werbung noch lauter, dreister und direkter war.»
Christian Carpino
Die Moral entscheidet mit Seit fast 30 Jahren gibt es die Werbeagentur Neuzeichen in Lenzburg, nächstes Jahr feiert sie ihr Jubiläum. Der Profi für Branding hat viele Kunden erfolgreich begleitet und legt dabei Wert auf gemeinsame Werte. Gibt es eine Anfrage von einem Kunden, setzt sich das Team zusammen und entscheidet gemeinsam, ob man hinter dem Kunden stehen kann. Das wirkt nicht nur mutig, sondern auch hochgradig sympathisch in der heutigen Zeit, in der Moral häufig mit Füssen getreten wird. «Wir sind ja eine FullService Agentur und stecken in jedes Projekt viel Herzblut, da muss man gemeinsame Werte haben.» Es gibt Dinge, die man nicht kaufen kann. Merci, dass es euch gibt!
Keinesfalls. Ich probiere, für die richtige Gelegenheit das richtige Verkehrsmittel zu wählen. Ich habe auch ein eigenes Auto.
Das hätte ich nicht gedacht.
Vor der Wahl des richtigen Verkehrsmittels steht aber die Frage, ob man Mobilität vermeiden kann.
In Städten können die Leute fast alles zu Fuss erledigen: Arbeitsweg, Einkäufe, Arztbesuche. Dafür braucht es aber bezahlbaren Wohnraum in der Stadt.
Auch das Reisen im ÖV ist teuer. Dafür haben wir in der Schweiz ein hervorragendes ÖV-Netz.
Ich empfinde die Preise für gewisse Strecken dennoch als zu hoch und wähle das Auto. Sollte der öffentliche Verkehr nicht günstiger sein?
Der Preis ist ein wichtiger Faktor. Ich bin jedoch der Meinung, dass Mobilität einen angemessenen Preis haben muss. Es gab den Versuch in einer Aargauer Gemeinde,
den ÖV innerhalb des Ortes umsonst anzubieten. Das hat dazu geführt, dass der Bus für Strecken genutzt wurde, die man davor zu Fuss zurücklegte.
Was halten Sie davon, das Autofahren zu verteuern?
Das hätte wohl nicht den gewünschten Effekt. Während der Ölkrise in den 1970ern ging der Verkehr trotz hoher Benzinpreise nicht drastisch zurück.
Man müsste Anreize durch sinnvolle Alternativen schaffen. Parkzonen am Stadtrand mit guter ÖV-Anbindung zu zahlbaren Preisen. Eine interessante Idee, mit Park and
Trotzdem: Das Auto bleibt meine erste Wahl für Strecken, die zu Fuss nicht machbar sind. Doch: Kürzlich musste ich zu einem Termin nach Paris. Für diese Strecke ist der Zug die beste Wahl. In welchen Situationen greifen Sie zum Autoschlüssel? Zum Beispiel, wenn ich meinen Sohn und meine Enkelkinder in Deutschland besuche. Da habe ich viel Gepäck dabei. Auch in den nächsten Urlaub nach Italien werde ich mit dem Auto fahren. Dort schätze ich die Flexibilität vor Ort.
Das kann ich verstehen. Ich schätze das Reisen im Auto oft auch, weil es mir einen Raum für mich bietet. Das sieht im Zug und im Bus, gerade zu Stosszeiten, anders aus … Allerdings. Doch der Verkehr auf unseren Strassen ist zeitweise sehr dicht. Das erfordert viel Konzentration. Gerade auf Strecken wie Lenzburg–Bern fühle ich mich im Zug deutlich wohler.


Südwestgarage Lenzburg AG
Aarauerstrasse 20, 5600 Lenzburg Telefon +41 62 891 14 61 info@suedwestgarage.ch
Gestalte deineZukunft im Holzbau!
Werde: ZimmermannoderZimmerinEFZ
Schnupperebei unsrein und starte 2026 oder 2027 miteiner Lehrstelle durch!




Wir fahren – damit Sie gut ankommen!
Ob Sie zur Arbeit fahren, in die Schule wollen oder einen SBB-Anschluss benötigen: Wir haben von morgens früh bis abends spät die besten Verbindungen für Sie.
Extrafahrten
• Firmenanlässe / Gruppenfahrten
• Shuttlebetriebe
• Geburtstage
• Hochzeiten usw.
Regionalbus Lenzburg AG
Lenzhardstrasse 3
5600 Lenzburg
Tel. 062 886 10 00
www.rbl.ch



• Sonnenstoren -M ar kisen
• Sonnenschutz fürungewöhnliche Fensterformen
• Lamellenstoren undRollladen
• Klappläden
• Reparaturenund Service
• Verkauf, Montage, Stoffersatz
Wirberaten Siepersö nlich

Bedachungen undFassaden
5707 Seengen •Tel.062 777 28 49
Jetzt isolieren und doppelt profitieren! Dächer undFassaden /Kellerdecken und Estrich
www.blaser-bedachungen.ch
Planen Sie jetzt
WärmetechnischeSanierung
Steildächer|Estrichböden| Fassaden Fenster |Kellerdecken



Wer einen Gastronomiebetrieb führt, muss viele Entscheidungen treffen – wirtschaftliche, moralische und ganz praktische. Zu Besuch bei Mirjam Strub von «Maria’s Esszimmer im Seetal».
Von Dominique Simonnot
Jedes Geschäft fängt lange vor Eröffnung mit einer Idee an, das ist bei einem Gastronomiebetrieb nicht anders. Die Idee im Kopf wuchert und nimmt irgendwann konkrete Formen an, Entscheidungen werden dabei fast unbewusst gefällt. Mit in die Entscheidungen fliessen Erfahrungen und Erinnerungen – vielleicht schon aus der Kindheit. So auch bei Mirjam Strub, die seit 2017 das Restaurant Maria’s Esszimmer im Seetal führt. «Schon als ganz kleines Mädchen gab es für mich nichts Schöneres, als in einem Restaurant nicht am Tisch, sondern hinter dem Buffet stehen zu dürfen und beim Abtrocknen der Kaffeelöffeli mitzuhelfen», erinnert sie sich. Aus solchen Momenten entstand ihr Traum, einmal ein Restaurant zu führen. Die junge Frau machte eine Ausbildung im Hotel, gründete eine Familie und liess ihrem Traum Zeit, konkret zu werden. Als dann die Gelegenheit kam,
«Ich wollte nostalgische Gerichte anbieten, die viele von früher kennen und die einen zurückholen in das Wohnzimmer des Grosis.»
Mirjam
Strub



«Ich wollte nostalgische Gerichte anbieten, die viele von früher kennen und die einen zurückholen in das Wohnzimmer des Grosis. Gerichte, die es heute nicht mehr überall gibt, allerdings verspielt angerichtet.» Erinnerungen, die durch den Magen gehen. Erstaunlicherweise holt sie damit auch die junge Generation ab. «Vielleicht nicht gerade mit Kutteln, das ist schon ein spezielles Gericht. Aber ansonsten sind gerade junge Leute auch neugierig auf ‹alte typische› Gerichte wie z. B. Hacktätschli.»
Entscheidung für Nachhaltigkeit
das ehemalige Restaurant Seetal in Beinwil am See zu übernehmen, war die Entscheidung klar, der Traum wurde realisiert, das Konzept umgesetzt, das sich mit der Zeit in ihrem Kopf festgesetzt hatte.
Dass die Zutaten aus der Region kommen – die Kräuter bestenfalls aus dem Garten hinterm Haus –, versteht sich für die junge Gastgeberin von selbst, das war keine schwere Entscheidung. Deshalb gibt es im Frühjahr zum Beispiel Bärlauchgnocchi. Erdbeeren erst, wenn die Erdbeersaison in der Schweiz beginnt. Das Fleisch kommt vom Metzger aus Seon, der Fisch aus dem Hallwyler oder dem
Sempachersee, der Käse aus Seengen. «Bei uns findet man nichts Tiefgefrorenes, alles ist frisch und wird auch frisch zubereitet.» Zum Konzept der nostalgischen Küche passt der Name «Maria′s Esszimmer» wie der Kartoffelstock zum Hacktätschli. Er klingt so vertraut nach der guten alten Essstube, dass man fast die Wärme des Kachelofens spürt. «Für den Namen hatte ich mich entschieden, nachdem ich Sarah Wieners ‹Sarahs Speisezimmer› in Berlin besucht hatte. Für mein Konzept fand ich das bildlich sehr passend, also habe ich die Schweizer Form gewählt, das Esszimmer.» Aber weshalb dann nicht Mirjams Esszimmer? «Maria ist die lateinische Form des hebräischen Namens Mirjam und tönt einfach besser.» Ganz pragmatisch.
Saisonale Anpassung
Setzt man wie Mirjam Strub auf Nachhaltigkeit und kocht mit saisonalen lokalen Gerichten, muss man auch die Karte saisonal anpassen. «Viermal im Jahr wechseln wir die
Karte, überlegen gemeinsam, was wir neben den Klassikern Neues anbieten können. Die Mittagskarte wird wöchentlich gewechselt und vorrangig von den Köchen selbst bestimmt – die können am besten planen und wissen, wie sie Sachen verwerten.» Es gibt drei Menüs: ein schnelleres, ein aufwendigeres und ein Vegi Gericht. Das hat sich bewährt.
Doch manchmal muss man anfangs getroffene Entscheidungen auch revidieren – z. B. aus wirtschaftlichen Gründen. «Wir hatten anfangs durchgehend geöffnet, haben uns dann aber entschieden, nachmittags zu schliessen, weil wir zu wenig Gäste hatten.» Im Jahr 2023 war «Maria’s Esszimmer» dann sogar für drei Monate geschlossen. «Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es ging nicht anders, wir hatten schlichtweg keine Köche.» Umso schöner, wenn sich eine schwere Entscheidung letztendlich als Weg entpuppt, der zu etwas noch Besserem führt.
Das Spiel «Go» gehört zu den Brettspielen mit den meisten Spielzugmöglichkeiten überhaupt. Der Einstieg ist einfach, denn die Komplexität kommt mit dem Spielen.
Von Dominique Simonnot
Die Zahl an möglichen Spielzügen ist so gross, dass sie nicht nur unsere Vorstellung übersteigt, sondern auch die geschätzte Anzahl an Atomen im Universum. Es ist diese 10 mit 768 Nullen, die nicht nur Mathematiker oder Physiker an diesem Spiel reizt. Diese allerdings ganz besonders. «Wir haben natürlich ein Faible für Zahlen. Und ein Interesse an logischen Abläufen bringen die meisten «Go»Spieler mit», erklärt uns Dieter Stender aus Lenzburg, selbst Physiklehrer und
seit 17 Jahren leidenschaftlicher «Go»Spieler. «Da der Zugang und die Regeln einfacher sind als z. B. beim Schach sind, interessieren sich aber auch Menschen für «Go», denen Schach zu kompliziert ist.»
Aller Anfang ist leicht Tatsächlich gibt es nur weisse und schwarze Steine, die man auf einem Brett platziert – Anfänger auf einem 9 × 9 Felder grossen Brett, Fortgeschrittene auf einem 19 × 19 Brett. Die schier unerschöpfliche, strategische Komplexität kommt mit dem Spielen: Durch geschicktes Platzie
ren der eigenen Steine versucht man, mehr Gebiet auf dem Spielbrett zu kontrollieren als der Gegner. Man versucht, gegnerische Steine einzukreisen und eigene Gruppen zu sichern. Mit seinen schwarzen und weissen Steinen erinnert «Go» an Ying und Yang und im Gleichgewicht von Angriff und Verteidigung, um Gewinnung von leerem Raum, den Attributen Zeit und Geduld sowie der Kunst, mit dem anderen zu koexistieren, sehen viele Spieler, aber auch Philosophen eine Art Spiegel des Lebens, des Denkens und sogar der Weltan
«Go» kennenlernen
Wer Lust bekommen hat, «Go»-Luft zu schnuppern, wendet sich am besten an den Schweizer «Go»-Verband und fragt nach Gruppen in der Nähe.
Im Aargau trifft sich jeden Montag eine Gruppe zum «Go»-Spielen in der FHNW in Brugg, Gebäude 1, Raum 1.025, Beginn 19 Uhr.
Anfänger sind herzlich willkommen und werden ins Spiel eingeführt.
Mehr Infos unter: swissgo.org/
Brille oder Kontaktlinsen? Kunststoffgestell oder doch lieber ein 3-D-Modell? Die Wahl ist nicht immer einfach – Trotter Optik hilft bei der Entscheidungsfindung.

«In 90 Prozent der Fälle hat die Kundschaft die Wahl, ob sie sich für eine korrigierte Brille oder Kontaktlinsen entscheiden möchte», sagt Beatrice Steiner, Geschäftsführerin von Trotter Optik Seon. Die Vorteile von Linsen sind etwa, dass man ein uneingeschränktes Blickfeld hat ohne Brillenrahmen und dass weder Gläser anlaufen noch Bügel hinter dem Ohr drücken. Je nach Bedürfnis kann man zwischen Tages-, Wochen-, Monatsoder Jahreslinsen wählen. Sportliche Betätigung ist mit Kontaktlinsen sozusagen uneingeschränkt möglich. Anders sieht das bei Brillenträgern
aus. Beim Sport kann die Brille hinderlich sein, wenn schnelle, ruckartige Bewegungen nötig sind oder es zu Körperkontakt kommt. Vorteile einer Brille sind hingegen, dass man mit ihr Akzente setzen und sie als modisches Accessoires nutzen kann. «Zudem gibt es Menschen, die sich mit einer Brille wohler fühlen als mit Kontaktlinsen. Bei multivokalen Korrekturen kann es ausserdem sinnvoller sein, diese mit einer Brille anzupassen», sagt die diplomierte Augenoptikerin.
schauung. Und das schon seit mindestens 2000 Jahren, denn solange wird «Go» schon gespielt, vor allem in den asiatischen Ländern wie China, Japan oder Südkorea.
Auch die Intuition ist gefragt «Damit bekommt man selbst geisteswissenschaftliche Schüler», weiss Dieter Stender, der mittlerweile an Turnieren teilnimmt und selbst eine Gruppe an der Kantonsschule in Zug gegründet hat, wo er unterrichtet. «Vielleicht spielen diese dann einfach anders, aber das ist ja das Schöne am ‹Go›. Wegen der immensen Zahl an Möglichkeiten ist exaktes Vorausrechnen über viele Züge praktisch unmöglich. Man rechnet vielleicht 3 bis 5, maximal 10 Züge im Voraus, mehr nicht.»
Denn beim «Go» geht auch viel mit Intuition, Mustererkennung und globalem Verständnis. Die linke und rechte Gehirnhälfte wird glei
ANZEIGE
chermassen gefordert. «Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man es leichter spielen kann, im Kindergarten zum Beispiel ähnlich wie Mühle als einfaches Fangspiel. Erst in der normalen komplexeren Variante geht es dann darum, Gebiete zu kontrollieren.»
Dann wird die Sprache mitunter sehr bildhaft, man unterscheidet leere Gruppen von toten, spielt Augen, macht Treppen oder spielt Elefantenfüsse oder Rösselsprünge – alles Konzepte, die sich auf das Überleben und Fangen von Steinen beziehen. Das Rangsystem, in dem die Spieler spielen, erinnert an Judo und Karate, es gibt Kyu und DanSpieler. Allerdings hat Judo im 19. Jh. das DanSystem vom «Go»Spiel übernommen und danach KyuRänge hinzugefügt. Dieter Stender spielt inzwischen auf 2. KyuNiveau. Sein Ziel? «Ich habe eigentlich kein Ziel, sondern spiele einfach, weil es Spass macht, mich entspannt und mit interessanten Leuten zusammenbringt. Wenn ich dabei aufsteige, umso besser.»

FENSTER| TÜREN| KÜCHEN| SCHRÄNKE
Trotter Optik Seon
Reussgasse 3
5703 Seon
Telefon 062 775 32 78
Trotter Optik Lenzburg
Poststrasse 6
5600 Lenzburg
Telefon 062 891 52 12


Grosse Sommeraktion!

Beim Kauf einer Korrekturbrille schenken wir Ihnen eine korrigierte Sonnenbrille.*



Auch bei den Gläsern kann man aus einer Fülle wählen. Meist kommt Kunststoff zum Einsatz, der hartbeschichtet ist, somit weniger anfällig für Kratzer und entspiegelt ist. Wer möchte, kann ein Mineralglas nehmen. Zudem gibt es Einstärken-, Gleitsicht- oder Arbeitsgläser, je nach Korrekturbedarf bzw. Einsatz. Auch individualisierte Gläser stehen im Angebot. Die Gläser werden bei Reize Optik in Trimbach hergestellt. Eine grosse Auswahl besteht zudem bei den Gestellen, egal ob aus Kunststoff, superleichtem Titan, Holz oder synthetischem 3-D-Material. «Es gibt ausserdem Fassungen aus PET oder auf Pflanzenbasis. Bei uns findet man immer Spannendes – auch von kleineren Kollektionen. Für die Beratung nehmen wir uns viel Zeit. Nebst der passenden Korrektur ist wichtig zu wissen, welche Bedürfnisse die Sehhilfe erfüllen muss.» Bei Trotter Optik Seon sind zwei Personen beschäftigt, in der Filiale Lenzburg sechs.






















Hardstrasse 11 5702 Niederlenz +4162891 61 61 info@objektbau.ch




Die Bertschi AG, Weltmarktführerin in Sachen Transport chemischer Güter, hat sich nicht nur ganz bewusst für eine rigorose Nachhaltigkeitsstrategie entschieden, sondern auch für den Hauptsitz Dürrenäsch.
Von Lucas Huber
Gerade hat Bertschi eine Auszeichnung für ihren Service am Standort in Zhangjiagang erhalten. Das liegt in China, wo das Unternehmen einen der modernsten Transporthubs für gefährliche Güter in ganz Asien betreibt. Im vergangenen Jahr hat Bertschi zudem Zweigstellen in Indien, Japan und Südkorea eröffnet. Weitere Niederlassungen befinden sich in der Slowakei und in Spanien, in Finnland, Belgien, Singapur, Brasilien, SaudiArabien – den USA. Und ja, die Liste wäre beinah beliebig erweiterbar.
Bertschi, das eigentlich ist die Bertschi AG, Weltmarktführerin, wenn es um den Transport chemischer Güter geht: Lösungsmittel, Kunststoffgranulate, Säuren, Farboder Klebstoffe. Auch diese Liste ist lediglich eine kleine Auswahl.
Familiengeführter Global Player
Bei all der internationalen Vernetzung, bei aller Bedeutung, die das Unternehmen für die globalen Warenflüsse hat, und bei aller Bedeutung, die das weltweite Transportgeschäft für das Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht hat, so

für Nachhaltigkeit.» 270’000 Tonnen CO2, rechnet das Unternehmen vor, spare es ein pro Jahr dank der Beförderung ihrer Güter auf Wasser und Schiene. Apropos: Allein durch den Gotthardtunnel tuckern jedes Jahr 80’000 Bertschi Container auf Zugwaggons. Das ist einer alle sechs Minuten.
Visionäre Ideen
Bei Entscheidungsschwierigkeiten können der Glaube und die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft Orientierung geben, indem Vertrauen und Werte in den Fokus gestellt werden.
hat es sich bei der Wahl seines Hauptsitzes doch ganz bewusst für jenen Standort entschieden, wo alles begann: die Schweiz, der Aargau genauer – respektive: die Gemeinde Dürrenäsch im Bezirk Kulm mit knapp 1400 Einwohnerinnen und Einwohnern wichtigster Arbeitgeber: Bertschi.
Hier liegen die unternehmerischen Wurzeln des heute erfolgreichen Global Players mit einem Jahresumsatz von knapp über einer Milliarde Franken und weltweit mehr als 3200 Mitarbeitenden. Das macht Bertschi zur Weltmarktführerin, wenn es um den Transport von Chemikalien aller Art geht. Oder haben Sie etwa noch keine Lastwagen oder Zugskompositionen mit den Containern mit dem gelben Logo gesehen?


Und die familiengeführte Aktiengesellschaft – aktuell übrigens in zweiter und dritter Generation – ist auch ganz vorne dabei, wenn es um die Dekarbonisierung der Logistik geht. «Als Familienunternehmen», sagt Verwaltungsratspräsident HansJörg Bertschi im aktuellen Nachhaltigkeitsrapport, «ist das langfristige Wohlergehen der Umwelt tief in unserer Kultur verankert. Wir setzen den Massstab
Und nicht nur das: Nachdem Hans Bertschi die Firma 1956 mit einem einzigen Lkw gegründet hatte, unternahm er mehrere Versuche, die SBB von einer visionären Idee zu überzeugen: dem Verlad von Lastwagen auf die Bahn. Seine Hartnäckigkeit wurde schliesslich belohnt: 1964 feierte er die Geburtsstunde des alpenquerenden kombinierten Güterverkehrs – und revolutionierte ganz nebenbei nicht nur die Schweizer Logistikbranche.
Man stelle sich die Staus am Gotthard ohne die Entscheidung des Firmengründers vor, für sein innovatives Ziel zu kämpfen. Daraus entstand übrigens die Hupac AG, deren Verwaltungsratspräsident ebenfalls HansJörg Bertschi ist.
«Wenn sich eine Tür schliesst, öffnet sich eine andere.» Dieses Sprichwort kennen viele – doch was ist, wenn man im Dunkeln steht und keine neue Tür zu sehen ist? In solchen Momenten des Zweifelns, wenn der nächste Schritt unklar ist und Entscheidungen schwer auf den Schultern lasten, kann der Glaube zu einer inneren Orientierung werden. «Der Glaube ersetzt dann vielleicht das Bedürfnis nach vollständiger Kontrolle durch ein Vertrauen in eine höhere Macht, die einen leitet», so Pastoralraumpfarrer Roland Häfliger der HerzJesuKirche Lenzburg. «Dieses Urvertrauen, das viele Gläubige empfinden, ist wie ein innerer Kompass. Es flüstert: «Du musst nicht alles wissen. Du bist getragen. Und das ist enorm erleichternd.»
Innehalten, prüfen, handeln
In schwierigen Zeiten kann der Glaube auch bei Entscheidungen helfen, indem er Werte und Massstäbe vorgibt. Wer zum Beispiel aus dem Glauben heraus handelt – etwa aus Barmherzigkeit, Vergebung
oder Nächstenliebe –, dem wird manches moralische Dilemma klarer. Zwar nimmt einem der Glaube die Entscheidung nicht ab, aber er ordnet die Möglichkei ten, die man sieht. So fällt es leichter, mit sich selbst im Reinen zu sein – unabhängig vom Ergebnis. «In einem vernünftigen Glauben – und Vernunft ist sehr sehr wichtig – geht es viel um Reflexion und damit verbunden auch um Achtsamkeit. Ähnlich wie bei Meditation kann ein Gebet oder ein Gespräch dazu führen, innezuhalten, zu betrachten und zu reflektie

In schwierigen Zei ten kann der Glaube auch bei Entscheidungen helfen, indem er Werte und Massstäbe vorgibt.»
Roland Häfliger
ren.» Das tut auch Roland Häfliger regelmässig. «Wenn ich eine schwierige Entscheidung fällen muss, ziehe ich mich zurück, nehme mir Zeit und stelle Fragen wie ‹Was spricht dafür?› oder ‹Wo stehe ich mir im Weg?›. Auch die Intuition und die persönliche Prägung, auch durch den Glauben, spielen eine Rolle. Das Bauchgefühl kann eine grosse Hilfe sein.»
Zuhören als Königsdisziplin
Zudem kann der Glaube die Last der Entscheidung lindern, indem er Verantwortung nicht allein auf das eigene Ich konzentriert. Wer betet, tut das nicht nur, um zu bitten, sondern auch, um loszulassen. Ein Gebet kann wie eine Meditation wirken: Es schafft Raum zum Innehalten, zur Selbstreflexion und zur Öffnung nach innen – oder nach oben. Und wer innehält, hört oft klarer, was wirklich wichtig ist. «Der Glaube vereinfacht das Leben nicht in dem Sinne, dass es keine Probleme mehr gibt, sondern weil



er einen Rahmen bietet, ein Grundgerüst, in dem Probleme eingeordnet werden können.» Gerade als Seelsorger weiss Pfarrer Häfliger, wie wichtig Zuhören ist, nicht nur während der Beichte, sondern auch in Seelsorgegesprächen. «Über etwas reden schafft oft schon mehr Klarheit, weil es uns aus dem reinen Denken führt. Als Zuhörer und Seelsorger kann ich auch einfacher die Perspektive wechseln und andere Wege aufzeigen bzw. andere Aspekte erfragen.»
Unterstützung in der Gemeinschaft Und noch etwas kann bei Entscheidungen helfen: die Gemeinschaft eines Glaubens, in diesem Fall der Kirche. Hier findet man Menschen, die zuhören, mittragen und aus eigener Erfahrung Mut machen können – das schenkt Halt in Zeiten der Unsicherheit. Wer sich von anderen getragen fühlt, trifft Entscheidungen nicht mehr ganz allein, sondern im Vertrauen darauf, Teil eines grösseren Ganzen zu sein. Gut zu wissen also: Die Türen der Kirche sind immer und für alle offen.






Gemeinsammit Vertrauen, Fairness undTransparenz zum Erfolg.
MitkompetenterBeratungbegeisternwir Siepersönlich sowiedigital undbietenIhnen individuelle undverlässliche Lösungen.