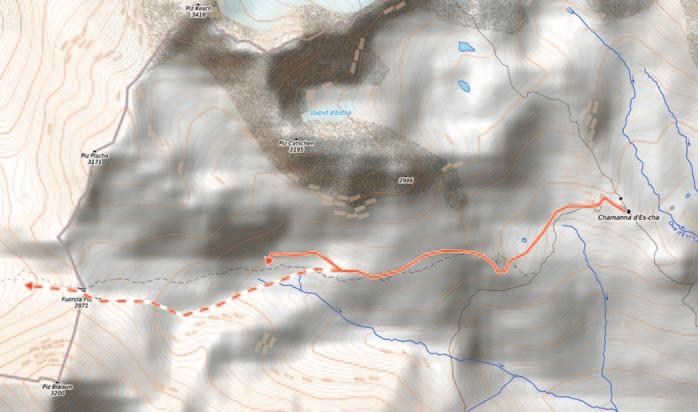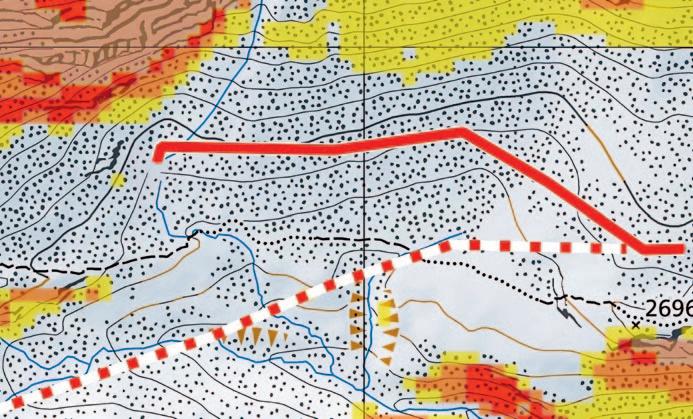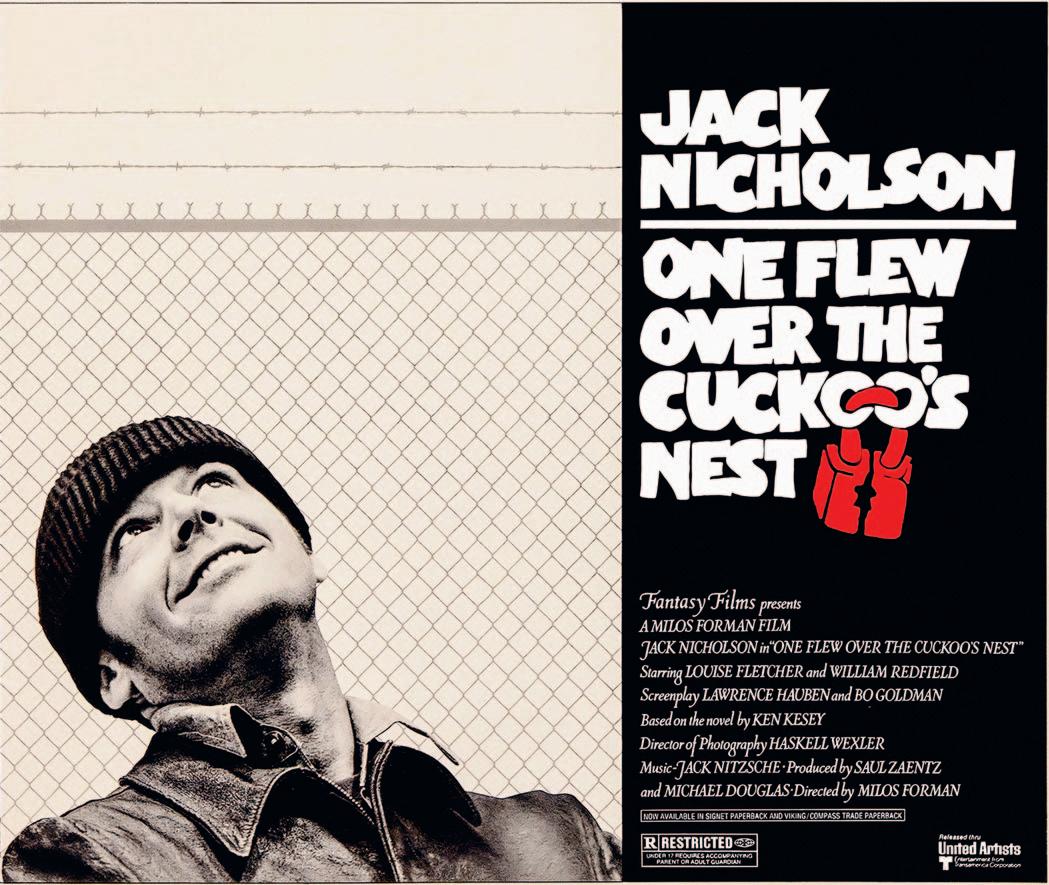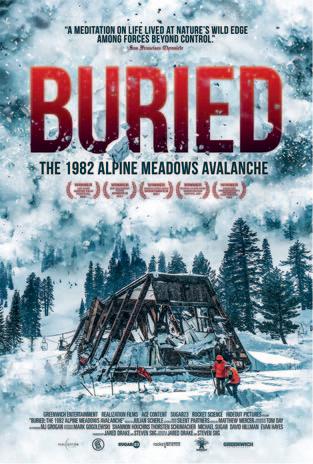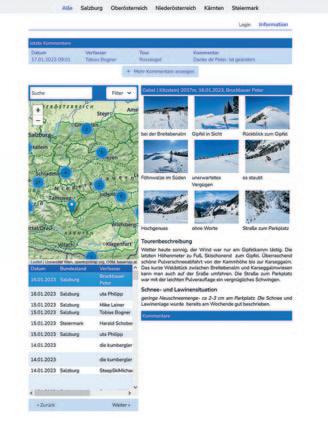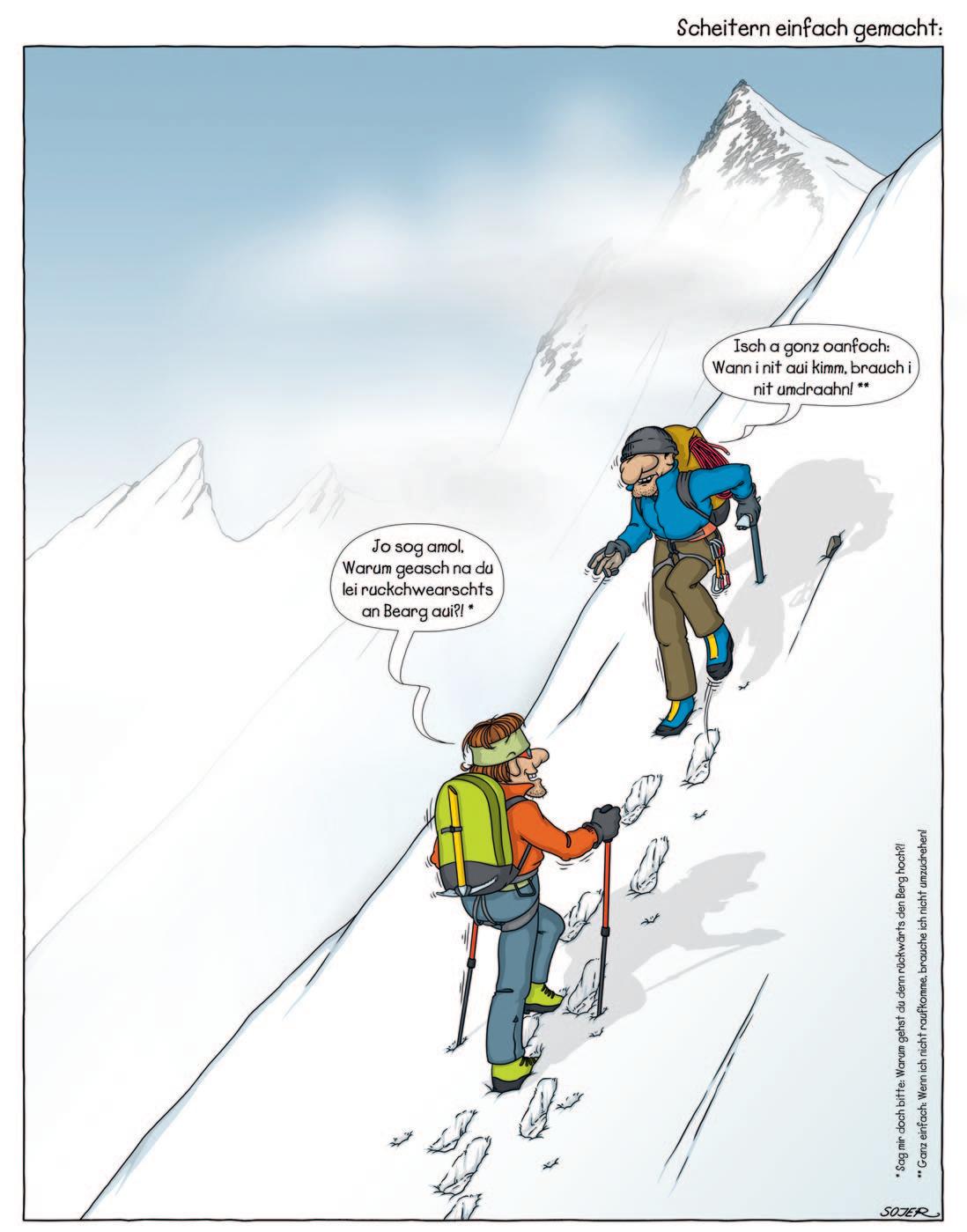Scheitern



23
Frühling
/ #122



CADIN II GTX MID | MOUNTAINEERING www.lowa.at PERFEKTION KENNT KEINE KOMPROMISSE, BIS INS KLEINSTE DETAIL OPTIMIERT.
Besuchen Sie uns auch auf www.bergundsteigen.com


Liebe Leserin, lieber Leser!
Offensichtlich bin ich gescheitert. Schon öfter beim Bergsteigen. Dieses Mal beim Verfassen des Editorials. Diese Angst vor dem leeren Blatt: unüberwindbar. Schreibblockade. Aber was soll’s! Scheitern gehört zum Bergsteigen wie zum echten Leben. Wer scheitert, lernt schneller. Wer scheitert, gewinnt. Das behaupten zumindest neunmalkluge Managementhandbücher. Gleiches gilt vielleicht auch fürs Bergsteigen – zumindest solange das Scheitern nicht irreversibel wird und tödlich endet. In diesem Sinne bitte ich um Verzeihung für das halbleere Blatt und wünsche Ihnen: mehr Mut zu scheitern! ;-)

Ihr Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen
P.S.: Jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Apropos scheitern. „Die Proteste sind gescheitert“, verkündete unlängst der iranische Präsident Ebrahim Raisi. Auf dem Cover dieser Ausgabe ist Elnaz Rekabi abgebildet. Jene iranische Wettkampfkletterin, die bei der Asienmeisterschaft ohne das von den iranischen Behörden vorgeschriebene Kopftuch an den Start ging. Anschließend hieß es, Rekabi sei festgenommen worden. Dann Dementi. Ihre Geschichte ging um die Welt. Wenige Tage später war der mediale Tsunami um die „freiheitskämpferische Kletterheldin“ bereits wieder vorbei. Denn den Gesetzen der Ökonomie der Aufmerksamkeit folgend wurde es höchste Zeit, eine neue, aufregendere Sau durchs Dorf der internationalen Berichterstattung zu treiben. Die Revolution im Iran ging indes weiter. bergundsteigen-Redakteur Tom Dauer hat sich von den medialen Gesetzen der Ökonomie der Aufmerksamkeit nicht irritieren lassen und für unseren Schwerpunktteil „Scheitern“ noch einmal genauer hingeschaut. Dazu hat er mit einer lauten Stimme des iranischen Widerstandes gesprochen: der Kletterin Nasim Eshqi. „Wir sollten ihr zuhören. Tun wir das nicht, scheitern alle“, meint Tom Dauer. „Wir, die Unterdrückten und die Freiheit.“
bs editorial
Roland Striemitzer und Gebi Bendler nach einem gescheiterten, aber lehrreichen Versuch, den Fitz Roy über die Route „Californiana” zu besteigen.
„Hoi Gebi!“
So beginnt meist das Mail unseres südlichsten Mitarbeiters. „Hier der Kommentar.“ So endet es lapidar. Kurz und bündig sind aber nur unsere ritualisierten Redaktionsabläufe, viel länger und intensiver hingegen kann man sich mit Stefan bei einem guten Glas Südtiroler Wein unterhalten. Dann zum Beispiel über die Gemeinsamkeiten und feinen Unterschiede zwischen Süd- und Nordtirol. Seit 2005 ist Stefan Steinegger aus Tramin Mitarbeiter des Alpenvereins Südtirol (AVS) und inzwischen für den Bereich Bergsport & Ausbildung zuständig. Für diese Themen ist er auch für bergundsteigen im Redaktionsbeirat verantwortlich.
Eigentlich hatte Stefan von Kindheit an Eishockey gespielt, aber mit 19 wurde es einfach unerträglich – wie er erzählt –, Wochenende für Wochenende nicht auf Skitour gehen zu können, sondern den Abend und damit das nächste Hockeyspiel abzuwarten. Die Bergleidenschaft hatte ihm sein Vater mitgegeben; der Schritt hin zum Jugendführer im Alpenverein war dabei die logische Entwicklung. Im Alter von 24 übernahm er ehrenamtlich für die AVS-Ortsstelle Tramin die Leitung der lokalen Kletterhalle und mit zwei guten Freunden konnte er sogar ein Wettkampfteam aufbauen, in dem aktuell über 30 Kinder und Jugendliche trainieren.

Stefan, Klettern oder Skitour?
Ski- oder noch besser Telemarktour, abseits der Modegipfel, mit guten Freunden.

Vinschgerl oder Semmel?
Das frische, hausgemachte Brot meiner Frau.
Achterknoten oder Bulin?
Achter, damit auch meine Kinder bei ihrem alten Vater den Partnercheck machen können. Falls sie mich noch mitnehmen …
Wein oder Bier?
Als Traminer klar Wein – nicht in einem noblen Restaurant, sondern in einem unserer urigen Weinkeller.
Bohrhaken sind …
Da bin ich mal lieber still! Aber nur so viel: Als AVS-Mitarbeiter für Bergsport gebe ich im Auftrag meines Referates jährlich rund 500 Normalhaken für Erstbegehungen aus.
Tourenskier: Unter 80 mm Mittelbreite oder über 90?
Ich fahre seit über 20 Jahren 105 mm, damals wurde man dafür noch ausgelacht …
Aperol Spritz oder Lagrein?
Mann, ich stamme aus einem Südtiroler Weindorf!!!
Welches LVS-Gerät?
Egal, Hauptsache volle Batterien.
Die schönsten Klettertouren in den Dolomiten?
Das sind für mich persönlich jene, bei denen ich die schönsten Abenteuer und Erinnerungen mit meinen Freunden hatte. Zum Beispiel der „Weg ohne Haken“ von Heini Holzer am Burgstall am Schlern mit meinem Freund Peter, und das am Tag des Schlernkirchtages. Eine wirklich fantastische Alpintour! Haken haben wir tatsächlich keine gefunden, dafür dann den Kirchtag am Schlern!
Der wichtigste Rat, den ich je bekommen habe, ist … Lege dir ein Schwarzgeldkonto zu, bevor du heiratest.
Wenn ich Präsident des AVS wäre, würde ich … … einen Geldgeber benötigen, denn Zeit zum Arbeiten hat man dann keine mehr. Angst befällt mich, wenn … …. ich bedenke, dass meine Kinder möglicherweise bald zu den jungen Wilden gehören.
In 10 Jahren möchte ich … … noch immer den Telemark-Knick schaffen. Erst wenn nichts mehr geht, steige ich auf normale, leichte Tourenskier um.
Wenn ich nochmal 20 wäre, dann … … würde ich mit der Weitsicht von heute noch mehr bergsteigen und weniger feiern gehen.
Stefan auf AVS-Skitourenreise in der Türkei. Natürlich niemals ohne seine geliebten Telemarkski. Foto: Johannes Pardeller

b intern s
■
[Gebi Bendler]
Erstbegehung Arco Hotel Olivio
Thomas Alva Edison unternahm fast 9000 Versuche, bis er die Glühlampe zur Marktreife entwickelt hatte. Nach dem 1000. Versuch sprach ein Mitarbeiter vom Scheitern. Edison erwiderte: „Ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 Wege, wie man keine Glühlampe baut.“ Gerhard Hörhager (55) brauchte nicht ganz so viele Versuche, um die Route „Il coltello e la rosa“ (8b+) im Hotel Olivio in Arco erstzubegehen. Ein bisschen gedauert hat es aber schon, bis der Durchbruch gelang.
Ob Klettern mit genialem Erfindertum gleichgesetzt werden kann und soll?
Genial ist jedenfalls, mit 55 noch so hart zu klettern und sich immer wieder aufs Neue dem Scheitern zu stellen.


fokus s
b im
Foto: Michael Meisl
rubriken unsicherheit
bergsönlichkeit Lawinengefahr Mensch
Im Gespräch mit dem Lawinenexperten Fabiano Monti aus Livigno, Italien.

Menschen machen Fehler: Das Konzept der FACETS von Ian McCammon und was sich seither getan hat. Über kognitive Kosten, Strategic Mindsets und andere menschengemachte Lawinenprobleme.
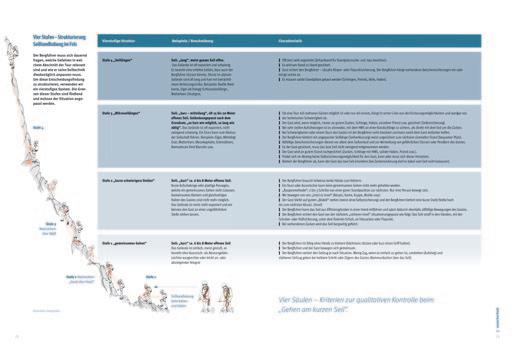
Kurzschluss?

„Führen am kurzen Seil“ in der Schweizer Bergführerausbildung. Wir stellen euch die Ausbildungsstruktur der vier Stufen und vier Säulen vor.
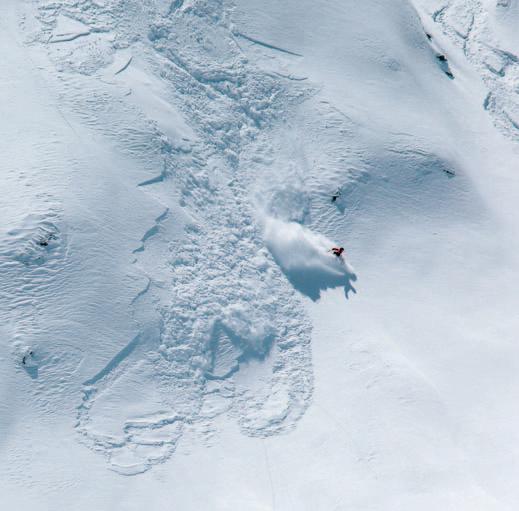
34 78
62
Die Kraft des Wirbelwinds
Die Kletterin Nasim Eshqui aus dem Iran kämpft gegen ein grausames, antidemokratisches Regime. Wir sollten ihr zuhören. Tun wir das nicht, scheitern wir alle. Wir, die Unterdrückten und die Freiheit.
Schlecht gelaufen?
Was die eine als Misserfolg sieht, kann für den anderen ein großartiges Bergerlebnis sein. Scheitern am Berg hat immer auch mit persönlichen Erwartungen und Zielen zu tun. Vier Alpinist*innen. Vier Ansichten.


10 kommentar
12 dialog
20 dies & das
22 pro & contra
24 How to Aid Climb!?
Thomas Wanner, Ben Lepesant
34 Lawinengefahr Mensch
Lea Hartl
44 Wie gehen Skitourengruppen bei ihren Entscheidungen vor?
Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung
54 Space Blanket
Markus Isser, Hannah Salchner, Franz J. Wiedermann, Bernd Wallner, Wolfgang Lederer
62 Kurzschluss?
Reto Schild, Manuel Gilgien
76 verhauer
Vom sonnigen Gletscher in die Kanalisation
78 bergsönlichkeit
Fabianos Blick in die Schneedecke von morgen
88 Die Kraft des Wirbelwinds
Tom Dauer
98 Schlecht gelaufen?
Christian Penning
104 „Ich habe akzeptiert, dass ich bei dem, was ich tue, sterben kann.“
Claus Lochbihler
110 19 Minuten
Thomas Käsbohrer
116 Gescheiter(t)
Dominik Prantl
118 Stichwort Scheitern
n rubrik n unsicherheit n scheitern
b inhalt s scheitern
98
88
alpinhacks
lehrer lämpel
medien 128 kolumne
Bewegende Zitate zum Thema 120
122
126
kommentar s
Ehren? AMT?
160 Jahre Alpenverein mit Hütten und Wegen verdankst du Generationen von Freiwilligen, die Wissen, Können und Freizeit einbrachten, und auch unzähligen Spendern. Seinen Fortbestand nach 1945, als der Verfassungsgerichtshof den Alpenverein mit Sitz in Innsbruck als Rechtsfortsetzer des 1945 zunächst übrigens verbotenen DAV (bis 1938 DuOeAV) anerkannte, verdanken wir Heimkehrern aus der Kriegsgefangenschaft. Für meine Studentengeneration war es weder eine anzustrebende „Ehre“ noch fühlten wir uns als (Alpenvereins-) „Beamte“ (der Begriff stammt übrigens aus der „Preußischen Städteordnung 1808“), um Funktionen zu übernehmen, als ich 1949/50 in die wiedergegründete Akademische Sektion Wien (ASW) eintrat. Die Leistungen unserer „AV-Vorfahren“, die neben vielen Erstbegehungen drei Schutzhütten erbaut und ein heimeliges Sektionsheim eingerichtet hatten, waren für uns Motiv genug. Es gab nur einige aktive ältere Herren. Die Mitglieder der „Aktivitas“ waren entweder im Krieg gefallen, noch in Kriegsgefangenschaft oder mussten ihr Studium dringend fortführen. So wurden wir gleich für verschiedene Tätigkeiten eingespannt und waren bald auch im „Ausschuss“ (Vorstand) als irgendein „…wart“. Eine Kollegin wurde „Säckelwart“, wie auch die Kassiererin damals im Studentenjargon bezeichnet wurde.
Wie in keinem anderen Verein hast du im Alpenverein neben dem Schwergewicht der alpinen Aus- und Weiterbildung noch viele weitere Möglichkeiten, um dein Talent in die Gemeinschaft einbringen zu können. Wissenschaftliche oder kulturelle Ambitionen? Leite eine Botanik-, Geologie- oder Umweltgruppe, eine Fotogruppe, einen Sing- oder Volkstanzkreis oder ein alpines Kabarett zur Belustigung der Hauptversammlung. Viele Sektionsvorsitzende haben beim Alpenverein als Jugendführer begonnen. Auch Louis Oberwalder, 1979 bis 1988 Vorsitzender des Gesamtvereins, der seine Erfahrungen als Erwachsenenbildender von Tirol einbrachte und wichtigste Impulse für die Alpenverein-Akademie setzte, „bergundsteigen“ wäre sein Wunschtraum gewesen.
Also mach mit! Du wirst einst, im Dienste der Alpenvereins-Gemeinschaft ergraut, gerne an die schönste Zeit deines Bergsteigerlebens zurückdenken.
Aber beachte schon bei der Tourenplanung: Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht durch eine Kette von Fehlern, die du vermeiden kannst.
Harald Engländer (94)
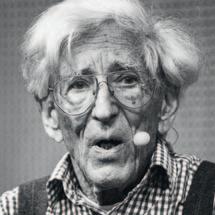
Ehrenmitglied des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit. Er war im ÖAV ehrenamtlich tätig und arbeitete für den Bergwegekataster.
Über das Scheitern
„Allez! Auf geht’s jetzt!“ Durch das Rauschen des Windes verzerrt dringen die Worte meines Sicherungspartners kaum an meine Ohren, als ich in die Crux meines Projekts hineinklettere. Von hier aus sind es sieben schwere Züge bis zum Umlenker. Ich fühle mich fit – das Training der letzten Wochen hat gewirkt. Am letzten Rastpunkt konnte ich mich gut runterschütteln. Beherzt trete ich an, steige hoch und kreuze in den schlechten Seitgriff. Doch ich erinnere mich an die richtige Trittsequenz und kann die Bewegung auflösen. Weiter! Die nächsten Züge laufen gut rein. Mein Puls steigt. Ich werde flattrig in der Brust und weiß – jetzt klappt’s. Endlich! Ich kann das Ding klettern. Doch dann passiert es: Kurz vor dem Umlenker steige ich auf den falschen Tritt und schiebe mich hinüber. Noch während ich schiebe, merke ich, dass ich zu tief für den Topzug stehe. Diesen Fehler kann ich nicht mehr korrigieren. Ich versuche einen verzweifelten Hepper an den Topgriff, aber es hat keinen Zweck – chancenlos tropfe ich ab. Ich bin schon wieder gescheitert! Und mit dem Scheitern kommen die Zweifel.
Wie oft haben wir diese Situation schon erlebt? Oftmals gehen wir in diesen Momenten hart mit uns ins Gericht. „Du hast es schon wieder vergeigt“, sage ich mir und dem ersten negativen Gedanken folgen weitere. Doch endlich schaffe ich es, mich an die Worte eines guten Freundes zu erinnern: „Nur die Mutigen scheitern.“ Zu Beginn fiel es mir schwer, in diesen emotionalen Momenten an etwas Positives zu denken. Doch ich beginne zu verstehen, dass im Scheitern die Chance für wichtige Lernerfahrungen steckt.
Der Duden erklärt den Begriff des Scheiterns mit dem Nicht-Erreichen von Zielen. In dieser Erklärung liegt die eigentlich großartige Bedeutung des Scheiterns verborgen. Denn nur wer sich Ziele setzt, kann scheitern. Zu scheitern bedeutet noch lange nicht aufzugeben. Darin liegt der zentrale Unterschied. Wenn wir es schaffen, das Scheitern im Sinne einer positiven Fehlerkultur als notwendigen Schritt des Erfolgs zu verstehen, ebnen wir den Weg für einen wertschätzenden Umgang mit unseren Fehlern. Nur wer den Mut hat, sich das Scheitern einzugestehen und sich aktiv mit seinen Fehlern auseinandersetzt, hat die Chance, daraus zu lernen und erfolgreich zu werden. Wer das Scheitern vermeiden will, kann dies nur auf Kosten ehrgeiziger Ziele tun.
Anmerkung: Das Scheitern ist stets vor dem Hintergrund des zu erwartenden Schadens zu betrachten. Im alpinen Gelände können Fehler tödliche Konsequenzen haben.
Nico Schlickum Bundestrainer Bildung & Wissenschaft, Sportklettern

10 / bergundsteigen #122 / frühling 23
b
Solaaaaarrrrgh
Ja, der Klimawandel ist da. Ja, der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Abkehr von den Fossilen ist das Gebot der Zeit. (Neben Stromsparen und Energieffizienz natürlich, aber damit darf man ja kaum argumen-tieren, sonst: Planwirtschaft.)
Und: Ja, der Ausbau der Photovoltaik ist dabei der Königsweg, der forciert werden muss. Aber: Doch bitte nicht so! Im September hat das Schweizer Parlament in Windeseile ein Gesetz verabschiedet, das den Bau alpiner Photovoltaik-Großanlagen bis zu einem Zubau von zwei Terawattstunden (= 2000 Gigawattstunden) massiv vereinfacht und subventioniert: Diese Anlagen sind standortgebunden, benötigen keine Planungspflicht und der Bund bezahlt bis 60 Prozent der Investitionskosten. Das Gesetz gibt keine Qualitätskriterien vor und dank Subventionen (im Umfang von total ein bis zwei Milliarden CHF) werden auch schlechte Projekte rentabel, die sonst nie vorangetrieben würden. Und dies in einer Phase mit hohen Strompreisen, in der gute Projekte auch ohne staatliche Unterstützung rentabel wären. Ergo: Es herrscht Goldgräberstimmung wie einst am Yukon, die Stromkonzerne und viele Gemeinden im Berggebiet suchen nach Standorten.
Wie sollen sich hier die alpinen Vereine verhalten? Beim SAC haben wir folgende Überlegungen gemacht:
y Wir können alpine Freiflächenanlagen nicht einfach ablehnen: Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und auch aufgrund des fehlenden Rahmenabkommens Schweiz-EU ist der politische Druck enorm.
y Es braucht eine Positivplanung („Wo liegen die besten Standorte?“) UND eine Negativplanung („Ausschlussgebiete“).
y Bei einer Positivplanung ist dem Kriterium der Vorbelastung mit Infrastruktur zentrale Bedeutung beizumessen. Für den SAC akzeptable Standorte könnten z. B. entlang größerer Straßen, in Skigebieten oder in der Nähe anderer Energieinfrastrukturanlagen liegen.
y Wir müssen im Dialog mit der Branche versuchen darauf hinzuwirken, dass möglichst nur gute Projekte vorangetrieben werden.
Zwar stehe ich noch immer unter dem Schock dieser radikalen Gesetzgebung, gleichzeitig bin ich aufgrund der Kontakte mit der Branche auch verhalten positiv: Auch Projektentwickler müssen ein intrinsisches Interesse daran haben, dass die ersten solchen Anlagen positive Standards setzen. Und zeigen, dass Klimaschutz und ein sorgsamer Umgang mit Natur und Landschaft kein Widerspruch sind. Denn sonst droht das bisher positive Image der Photovoltaik nachhaltig Schaden zu nehmen.
Affaire à suivre!
Philippe Wäger Ressortleiter Hütten und Umwelt

Erfolg und Scheitern
Der Alpenverein ist eine Erfolgsgeschichte seit seiner Gründung. Beschäftigt man sich aber mit den vielen Facetten in der über 150 Jahre alten Geschichte, so finden sich dort auch Misserfolge. Die Vereinsführung könnte heute nicht so gut den Alpenverein führen, hätte man nicht aus Misserfolgen gelernt. Eine Organisation, die den Anspruch erheben darf, für eine gesamte Gebirgskette zu sprechen, hat nicht immer nur Erfolge, sondern scheitert auch, wie zum Beispiel im Kampf gegen weitere Erschließungen der alpinen Hemisphäre. Aber immer wieder, auch nach Misserfolgen, geht der Kampf weiter und mit Einsatz wird für die Interessen des Bergsteigers gekämpft. Das Scheitern ist hier Ansporn, sich weiter stark zu behaupten und noch besser zu werden. Der Misserfolg ist bald vergessen, auch wenn es schmerzt. Die Vorfreude für den Erfolg überwiegt, gibt Kraft und spornt an.
Diese Überlegungen treffen bei einem Mitglied genauso zu. Der allgemeine Bergsteiger ist nun einmal ein Individualist, der nicht unbedingt seine Erfolge und Misserfolge an die große Glocke hängt. Mag nun das Scheitern am Berg für den Einzelnen oder die Gruppe sehr unangenehm sein, ergibt sich immer noch die Möglichkeit, das Ziel nochmals zu versuchen. So gelingt es, durch das Scheitern zu wachsen und Mut für einen neuen Versuch zu sammeln. Fehler können passieren, das ist kein Scheitern. Ebenso ist Versagen kein Scheitern. Beim Scheitern treten unvorhersehbare Ereignisse ein, die zum Abbruch einer Tour führen können. Erfolgreiches Bergsteigen ist somit begleitet vom Scheitern. Es ist zu akzeptieren, es kann, aber es muss nicht eintreffen. Dieses Wort trägt so viele Geheimnisse in sich, während der Erfolg eine überaus klare Definition besitzt.
Die Sportkletterer sind der beste Beweis, wie Erfolg, Misserfolg und das Scheitern eng nebeneinander liegen. Die Koordination und die Kraftausdauer müssen richtig abgestimmt sein, um zum verfolgten Ziel zu kommen. Wie oben beschrieben ist der immer wiederkehrende Versuch allein jenes Modell, das zum Ziel führt. Der Adrenalinschub ist hier wohl das Gegenmittel des Scheiterns an der Wand.
Erfolge, Misserfolge und Scheitern gehören nicht nur zur Vereinsführung, zum Bergsteigen und zum Sport, ja sie sind Bestandteile unseres Lebens und vollkommen normal. Menschen mit viel Erfahrung in diesen Gebieten waren in der Lage, daran zu wachsen. Erlebnisse dieser Art haben Menschen geformt. Wird das Scheitern nicht verurteilt, so ist später sicher ein Erfolg möglich.
 Dr. Ing. Elmar Knoll Vizepräsident AVS
Dr. Ing. Elmar Knoll Vizepräsident AVS
11 | kommentar
Der Quad Anchor in der Anwendung
Foto: Dale Remsberg, alpinesavvy.com

Zum Beitrag der Webseite von www. alpinesavvy.com
k[kolumne von Tom Dauer „Verschämt – unverschämt“, #120, Herbst 22] Lieber Tom! Es ist Sonntagabend. Ich hatte ein schönes Wochenende zu Hause mit der Familie. Meine Kinder sind aus beruflichen und Studiengründen derzeit in Österreich verstreut und waren auf Besuch. Nachdem sie nachmittags wieder abreisen mussten, hat es mich überkommen dieses Gefühl, diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Momenten, wie du schreibst, in denen es darum geht, einfach nur Spaß zu haben, erfüllt zu sein, sich selbst zu spüren. Ich habe den Moment gefunden: Es hat nicht mehr gebraucht als eine intensive Runde mit dem Mountainbike im wunderschönen herbstlichen Alpenvorland des Ybbstals. Irgendwann im Laufe des Tages habe ich deinen Artikel „Verschämt-unverschämt“ gelesen.
Einige Aussagen haben mich nicht mehr losgelassen. Ich stimme dir zu, dass es für das Klima, auf gut Mostviertlerisch völlig „wurscht“ ist, ob ich mich fürs Fliegen schäme oder nicht. Dasselbe gilt, wie du schreibst, fürs Autofahren oder jegliches andere Verhalten, welches Treibhausgas erzeugt. Deinen Vorschlag zur Einrichtung zwischenstaatlicher Flugverbotszonen möchte ich ganz klar auf Europa ausdehnen. Sich vor Reisen, Abenteuern, sei es die nächste Klettertour, Skitour usw., die Frage zu stellen, was meine Motivation hierfür ist und ob ich diesen Genussfaktor vielleicht auch auf ökologisch vertretbarere Art oder im näheren Umkreis erreichen kann, finde ich super. Was mich in deinem Artikel jedoch irritiert, ist die Infragestellung des moralischen Denkens in Verbindung mit klimaschädigendem Verhalten. Ich weiß nicht, was du in diesem Zusammenhang als Moralpredigen verstehst.
Aus meiner Sicht kann es keinesfalls sein, dass das Aufzeigen der dringlichsten Änderungen unseres Verhaltens, auch das Aufzeigen von Fehlverhalten, als Moralpredigen abgetan wird. Moral bedeutet ja, dass sich der Mensch als Freiheitswesen begreift und damit sein eigenes Verhalten zu verantworten hat. Menschen an diese ihre Verantwortung zu erinnern, sollte nicht vorschnell abgewertet werden. Ich tue mir auch sehr schwer mit deiner Aussage „ansonsten ist es in meinen Augen völlig okay, ab und an etwas Sinnfreies wie ... zu unternehmen“. Dem möchte ich, ab dem Punkt, wo das individuelle Tun mit einer weiteren starken Belastung unseres Klimas einhergeht, ganz entschieden widersprechen. Können wir es vertreten, das Gefühl, die Sehnsucht, das Verlangen nach Momenten, in denen es darum geht, einfach nur Spaß zu haben, erfüllt zu sein, sich selbst zu spüren, über unsere Verantwortung gegenüber nächsten Generationen zu stellen?
Wenn ich mir einen Auszug aus der Präambel der Aarhuskonvention (bergauf Heft 4/2022) durchlese – „(...) jeder Mensch das Recht hat, in einer seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt zu leben, und dass er sowohl als Einzelperson, als auch in Gemeinschaft mit anderen die Pflicht hat, die Umwelt zum Wohle gegenwärtiger und künftiger Generationen zu schützen und zu verbessern; (...)“ – dann komme ich zu der klaren Entscheidung, dass unsere persönliche Freiheit dort ihre Grenzen findet, wo sie die Entfaltung von Freiheit und Würde anderer gefährdet. Ob du diese Zeilen auch als Moralpredigt empfindest oder nicht, musst du mit dir ausmachen. Ich werde sie weiter suchen, die Momente, in denen es darum geht, einfach nur Spaß zu haben, erfüllt zu sein, sich selbst zu spüren. Ich finde sie immer mehr auch ohne Klimabelastung.
b dialog s
12 / bergundsteigen #122 / frühling 23
P.S.: Falls es dich einmal ins Ybbstal verschlägt, drehe ich gerne eine Runde mit dem Mountainbike mit dir. Die Anreise lässt sich gut mit Öffis gestalten.








Peter Harlacher, Naturschutzreferent ÖAV Sektion Waidhofen an der Ybbs

q[Quad Anchor] Zurzeit klettere ich viel mit einem amerikanischen Kletterpartner, der zum Standplatzbau in Mehrseillängen häufig den sogenannten Quad Anchor (siehe Abb.) verwendet. Er verwendet eine 8-mm-Reepschnur und zwei Schnappkarabiner (wire gates) für die Bohrhaken und baut Selbst- und Partnersicherung an jeweils zwei Reepschnursträngen auf. Mir war dieses System zuvor nicht bekannt, in Plaisirrouten baue ich die Stände entweder mit dem weichen Auge in einer vernähten 10-mm-Bandschlinge oder direkt mit dem Kletterseil, beides mit Schraubkarabinern. Ich würde gerne fragen, ob ihr kurz die Vor- und Nachteile des Systems besprechen könnt? Wisst ihr, warum das System im europäischen Raum kaum Verwendung findet?



Mein größter Reibungspunkt ist die Verwendung von zwei Schnappern, andererseits weiß ich, dass auch beim weichen Auge nicht mehr unbedingt zwei Schraubkarabiner verlangt werden. Argumentiert wird dabei entweder, dass beide Karabiner immer belastet sind, die Karabiner nicht kritisch sind (siehe: https://www. alpinesavvy.com/blog/debunking-anchor/climbing-myths-part-1, Punkt 3) oder dass ein Schnapper nicht verklemmen kann, was zum Zerschneiden oder Zurücklassen des Standplatzes führt. Folgen kann ich den Argumenten aus meiner begrenzten Erfahrung aber nicht, Schnapper könnten sich beim Sturz des Vorsteigers und Umklappen nach oben öffnen, einen kaum zu öffnenden Karabiner hatte ich nur im Eis, da zugefroren.
Vorteilhaft beim Quad Anchor sehe ich die Lastverteilung über beide Bohrhaken. Der dynamische Lasteintrag beim Ausbrechen eines Bohrhakens dürfte durch den kurzen Weg nicht zu groß sein. Nachteilig sehe ich das Umklappen des gesamten Systems bei einem Sturz des Vorsteigers, da der Weg größer sein dürfte als beim Aufbau mit einem weichen Auge.
Paul Schlitz
Bezugnehmend auf deine Anfrage möchte ich gern etwas weiter ausholen und damit (hoffentlich) zwei Fliegen auf einen Schlag fangen: Erste Fliege „Lehrmeinung“: Grundsätzlich gibt es eine beinahe unüberschaubare Vielzahl an Standplatzsystemen, die – rein sicherheitstechnisch – alle ihre Berechtigung haben. Wir als ausbildender Verein – und das ist auch der große Unterschied zu privaten Endverbrauchern – müssen zu unseren Themen eine Lehrmeinung entwickeln, die möglichst folgenden Kriterien standhält:
y Sie muss den Sicherheitsanforderungen gerecht werden.
y Sie muss einfach (und schnell) gehen, dabei aber auch wenig fehleranfällig sein.
y Sie muss ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken.
y Sie muss leicht zu verstehen und methodisch gut vermittelbar und sein.
Wir müssen also abwägen, welche Methode am ehesten all diese


























PERFEKT EINGESTELLT Fein anpassbar für eine präzise Passform.
FEST UMSCHLOSSEN
Eine eng anliegende, sichere Passform verbessert die Laufeffizienz und reduziert die Stoßbelastung.
ZUVERLÄSSIG
Entwickelt, um unter den






Bedingungen zu bestehen.
 BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
härtesten
Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.
ALTRA MONT BLANC BOA
BOA® FIT SYSTEM
PERFORMANCE POWERED BY THE
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
härtesten
Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.
ALTRA MONT BLANC BOA
BOA® FIT SYSTEM
PERFORMANCE POWERED BY THE
Selbstsicherung im Standplatzkarabiner vs. Selbstsicherung mit eigenem Karabiner im „Weichen Auge“.
Illustrationen: Georg Sojer

Quad Anchor und doppelt abgebundene Ausgleichsverankerung. Illustrationen: Georg Sojer

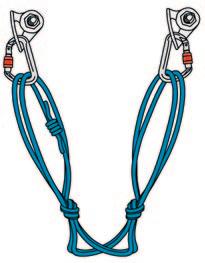
Kriterien erfüllt und dabei müssen auch Abstriche gemacht werden (frei nach dem Motto: kein Vorteil (z. B. Schnelligkeit) ohne Nachteil (z. B. geringeres Anwendungsspektrum)).
Beispiel: Die Selbstsicherung wird direkt in den unteren Standplatzkarabiner des „Weichen Auges“ eingehängt. Das ist sicherheitstechnisch absolut in Ordnung, geht schneller, als wenn ich dafür einen eigenen Karabiner verwende, und spart natürlich Material (ein Karabiner weniger). Der Nachteil: Es funktioniert nur so lange gut, solange ich in Wechselführung unterwegs bin. Das Gleiche gilt, wenn man die „Reihe“ mit dem Kletterseil herstellt: Eine superschnelle Lösung und sicherheitstechnisch absolut in Ordnung, aber wehe, der Vorsteiger/die Vorsteigerin ändert sich wider Erwarten …
Zweite Fliege „Quad Anchor“: Auch das von dir angesprochene System – mal abgesehen von den zwei Schnappkarabinern – ist sicherheitstechnisch absolut in Ordnung. Allerdings kenne ich den Stand mit 2 Schraubkarabinern und bin auch der Meinung, dass sie an dieser Stelle ihre Berechtigung haben: Gerade am Standplatz möchte ich alle Eventualitäten so gut es geht ausschließen und deshalb gehören da auch 2 Schraubkarabiner (bzw. mindestens einer) hin. Das empfehlen wir auch beim Standplatzsystem mit dem „Weichen Auge“. Nachdem wir den „Stand“ – also die Bandschlinge mit „Weichem Auge“ und die beiden Karabiner – ohnedies fixfertig um die Schulter tragen, kann man hier ruhig 2 kleine (!) Schrauber verwenden.

Vorteil des „Quad Anchors“ ist zweifelsohne die von dir angesprochene Lastverteilung auf die beiden Fixpunkte – ähnlich wie bei der in Europa bekannten „doppelt abgebundenen Ausgleichsverankerung (oder Kräftedreieck)“. Wobei hier erwähnt werden muss, dass die Verteilung trotz des beweglichen Ausgleichs nie 50 zu 50 ist.
Einen weiteren Nachteil – den wir z. B. bei der „Reihe“ nicht haben –hast du auch schon angesprochen: das Umklappen des Systems. Der nächste Nachteil – und jetzt schließt sich der Kreis – ist die Praxistauglichkeit: Passt die Lage der Fixpunkte nicht ideal zum Abstand der beiden Knoten in der Reepschnur, kann man schon ordentlich Zeit in der (Fein)Anpassung liegen lassen.
Gerhard Mössmer, Berg- und Skiführer, Abteilung Bergsport ÖAV
g[Girth-X beim Südtiroler Stand] Im verlinkten Video von Yann Camus mit dem Titel „Girth and Clove at the Belay Station - Static and Dynamic Testing“ (https://www.youtube.com/watch?v=UMuCkC3jshA) werden ähnliche Ergebnisse wie in eurem Artikel von Chris Semmel zum Südtiroler Stand (#119, Sommer 22) vorgestellt und besprochen. Interessant finde ich dabei vor allem die Überlegung, eine der Schlingen beim Einhängen zu verdrehen (X-Variante), um die Eigenschaften des Knotens zu verbessern. Habt ihr euch dazu auch schon Gedanken gemacht?
Gregor
Hier gehtʼs zum YouTube-Video von Yann Camus mit dem Titel „Girth and Clove at the Belay Station - Static and Dynamic Testing“.
Girth Hitch ist die englische Bezeichnung des Ankerstichs. Mit Girth-X wird ein Ankerstich bezeichnet, bei dem einer der beiden Stränge einmal gedreht wird, also ähnlich wie beim alten Kräftedreieck (siehe Abb). Ankerstich an Dyneema-Schlauchband gefährlich? Von Yann Camus aus Quebec/Kanada kam der Vorschlag, statt dem Ankerstich
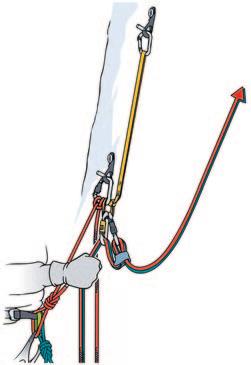
14
am Zentralpunktkarabiner einen „Gekreuzten Ankerstich“ zu legen. Vorweg: Kann man gerne machen – muss man aber nicht.
Die Argumentation von Yann war folgende: Eine rundgeflochtene Dyneema-Schlinge (Schlauchband) wie z. B. die „Mammut Contact Sling“ läuft in statischen Zugversuchen bei einer Kraft von ca. 4 kN. In dynamischen Tests, bei denen eine 100-kg-Stahlmasse direkt über eine Stahlkette in die Schlinge stürzte (ohne HMS, ohne Kletterseil), zeigten sich Durchlaufwerte von 2–3 kN.
Yann befürchtet, dass nun die Schlinge komplett im Ankerstich durchrutscht und sich der Ankerstich damit auflöst. Yann räumt ein, dass das nur möglich ist, wenn der Karabiner bricht oder die Schlinge durchtrennt wird. Bei seinen Schlussfolgerungen bezieht sich Yann auf Tests, die von Walter Siebert durchgeführt wurden (Link: https://www.youtube.com/watch?v=UMuCkC3jshA).
In den Tests wurde (wie auch bei unseren Versuchen) festgestellt, dass herkömmliche gewebte Dyneema-Bandschlingen wie z. B. die Petzl „St Anneau“ nicht rutschen. Das Rutschen tritt also nur bei geflochtenem Schlauchband aus Dyneema auf. Hintergrund: Flachband wird gewebt. Es entsteht ein flaches Gewebe, das einen rechteckigen Querschnitt besitzt. Schlauchband wird geflochten und hat die Form wie ein Seilmantel ohne Kern, es gleicht also einem „Schlauch“.
Unsere Sicht der Dinge:
Auch bei unseren Messungen im Ausbildungszentrum der Bergwacht Bayern begann die 8-mm-Schlauchbandschlinge aus Dyneema von Mammut bei statischem Zug bei 2-2,7 kN zu rutschen. Wurde der Ankerstich am Karabiner zuvor zugezogen (wie durch den Ausbruch des versagenden Fixpunktes), dann rutschte der Ankerstich erst bei 5–5,8 kN. Auch bei unseren dynamischen Tests zeigten sich genau bei diesen Schlauchbandschlingen aus Dyneema sowie vereinzelt auch bei sehr schmalem Flachband aus Dyneema (< 8 mm) ein Laufen zwischen 19 und 40 cm. Wir teilen also die Beobachtungen. Nur wir interpretieren das Phänomen komplett anders.
Begründung:
Bei den statischen Zugversuchen stimmen unsere wie Walter Sieberts Test komplett überein. Bei den dynamischen Tests hingegen führten wir praxisnahe Versuche durch, während Walter Siebert eine 100-kg-Stahlmasse direkt über eine Stahlkette in einem Faktor-2-Sturz in die am Ankerstich aufgehängte Dyneema-Schlinge fallen ließ (vgl. Link). Der Unterschied ist logisch. Während bei den Tests von Walter Siebert keinerlei sonstige Dynamik besteht, muss die gesamte Energie vom Ankerstich an der DyneemaSchlinge aufgenommen werden.
y In unseren Tests verwendeten wir eine 3-mm-Reepschnur als Sollbruchstelle (Bruchfestigkeit ca. 0,8–1,2 kN), also genau so, wie wenn ein schlechter Normalhaken ausbricht. Dadurch zieht sich der Ankerstich am Zentralpunkt zu und läuft später.
y Wir sicherten wie in der Praxis mit HMS am Fixpunkt mit einer Handkraft von 470 N. Diese Handkraft liegt deutlich über der durchschnittlichen Handkraft von 283 N und simuliert somit einen extrem „starken“ Sichernden. Wir verwendeten dazu die „Simulated Hand“, ein evaluiertes Gerät, mit dem sich die Handkraft am Seil bei Halbmastwurfsicherung einstellen lässt.
Mit Girth-X wird ein Ankerstich bezeichnet, bei dem einer der beiden Stränge einmal gedreht wird, also ähnlich wie beim alten Kräftedreieck. Illustration: Georg Sojer
y In der Praxis ist ja immer auch ein dynamisches Kletterseil im Spiel, in das die Fallmasse (unser Kletterer) stürzt. Walter benutzte eine Stahlkette, wir ein 10,3-mm-Bergseil. y Walter lässt 100 kg Stahl fallen, wir einen 95-kg-Traktorreifen, der ähnlich dem menschlichen Körper Energie aufnehmen kann.
Alles in allem zeigten sich bei uns wie oben und im Artikel in bergundsteigen #119 beschrieben Durchlauflängen von 2–3 cm und bei einigen wenigen Schlingen von 19 bis maximal 40 cm. Wir beurteilten dieses Ergebnis als gut, da es weder zum Riss einer Schlinge kam noch exorbitant hohe Kräfte auftraten. Vor einem Durchrutschen der Schlinge haben wir keine Angst, da der Karabiner oder – wenn direkt gefädelt wird – die Hakenöse als Anschlag das Durchrutschen verhindern. Zudem wurden die großen Durchlauflängen nur bei sehr schmalen bzw. den Schlauchbandschlingen aus Dyneema beobachtet. Werden drei oder gar mehrere Fixpunkte eingefangen so wurde überhaupt kein Durchrutschen beobachtet.
Das „Problem“ ist also auf Stände an zwei fraglichen Fixpunkten sowie sehr dünne (6–8 mm) Dyneema-Schlauchbandschlingen beschränkt und nur dann realistisch, wenn der Karabiner bricht oder die Schlinge durchgeschnitten wird. Wer sehr dünne DyneemaSchlingen zum Standplatzbau benutzt und Bedenken bezüglich des Ankerstichs hat, kann gerne den Gekreuzten-Ankerstich (Girth-X) legen. Eine coole Idee, die vor einem – wenn auch sehr konstruierten – Szenario schützen soll. Wer beim Standplatzbau an fraglichen Fixpunkten Rundmaterial (Kevlar- oder Dyneema-Reepschnüre) verwendet, sollte den gekreuzten Ankerstich besser nicht verwenden. Über den Ankerstich soll ja eine gewisse Dynamik im System bestehen (Kräfteverteilung, Energieabbau).
Chris Semmel, Berg- und Skiführer, langjähriger Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung
15
[Vergleich probabilistischer Instrumente zur Risikoabschätzung im Schneesport, #121, S. 40–47]
Ein sehr interessanter Ansatz, der sicher hilfreich ist, die Reaktion der diversen Reduktionsmethoden auf die Änderung einzelner Parameter besser zu verstehen und dadurch zur Weiterentwicklung der Methoden beizutragen. Aber die Motivation für die Arbeit wird von den Autoren ein klein wenig anders angegeben, nämlich Hilfe zu leisten in der Frage „welches der … probabilistischen Instrumente … feiner und/oder treffsicherer und demnach … das Instrument der Wahl ist“. Es wird auch ein positives Fazit gezogen: „Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Auswahl eines geeigneten Instrumentes einen großen Einfluss auf die Sicherheit der Schneesporttreibenden haben kann.“ Die Untersuchung hilft also nach eigenem Bekunden, die richtige Methode auszuwählen, diejenige, die ein Optimum an Sicherheit bietet.
Ich fürchte nur, dass in der durchgeführten Untersuchung relativ viel Willkür enthalten ist. Denn es wurden Entscheidungen getroffen, die man mit ähnlich plausiblen Begründungen auch anders hätte treffen können – und dann wären die Ergebnisse deutlich anders ausgefallen. Dargestellt werden diese Ergebnisse in bunten Graphiken mit dem generellen Farbcode: grün = die Methode sagt: Es ist gut, du darfst gehen/fahren, rot = die Methode sagt: Es ist gefährlich, du darfst nicht gehen/fahren, gelb und rosa = die Methode sagt: Es sind noch weitere Untersuchungen oder zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Das wird für viele Fälle untersucht und dann tabellarisch zusammengestellt. Je mehr Grün eine Methode in so einer Tabelle ausweist, umso „offensiver“ ist sie, und je mehr Gelb, Rosa und Rot sie ausweist, umso „defensiver“ ist sie. Auf dieser Basis wird z. B. gesagt, dass beim Altschneeproblem Stop or Go „offensiver“ wäre als die SnowCard und die GRM. Das scheint mir aber vor-eilig zu sein.
Begründung: Auf die Schwierigkeit, eine binäre Ja/Nein-Entscheidung einer Methode in mehrere Abstufungen (von grün über gelb bis rot) aufzugliedern, wird im Beitrag ausdrücklich hingewiesen. Gelöst wird dieses Problem z. B. bei Stop or Go so, dass „Rot“ immer dann vergeben wird, wenn das „Nein“ sich schon aus Check 1 ergibt, „Gelb“ (mit dem Zusatz „eventuell“) wird vergeben, wenn die Entscheidung „Ja“ oder „Nein“ erst in Check 2 gefällt werden kann, und „Grün“ wird vergeben, wenn ein Go (= „Ja“) schon mit Check 1 allein entschieden werden kann. Letzteres wäre, wird gesagt, z. B. beim Altschneeproblem der Fall, weil hier der Check 2 mangels Alarmzeichen immer positiv ausfallen müsse. Das kann ich aber nicht nachvollziehen: So wie ich Stop or Go verstehe, muss man bei dieser Methode bei positivem Check 1 immer auch Check 2 durchführen und der kann prinzipiell auch immer zu einem Nein führen. Zur Veranschaulichung müssen wir uns nur überlegen, wodurch überhaupt Fehler in Entscheidungen über Lawinen zustande kommen können. Meines Erachtens nach aus drei Gründen: Erstens weil (fast) alle Aussagen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen sind (Beispiel: Lawinenauslösung schon durch kleine oder erst durch große Zusatzbelastung), zweitens weil wir vor Ort einer Fehlbeurteilung unterliegen können (Beispiel: Hangsteilheit oder Exposition falsch eingeschätzt) und drittens weil auch im Lawinenlagebericht einmal ein Fehler enthalten sein kann (sei es ein echter Fehler, oder nur dadurch, dass der Lagebericht immer nur für eine ganze Region gilt und der spezielle Einzelhang auch anders sein kann). Dadurch kann auch beim
Altschneeproblem nach einem positiven Check 1 auch einmal ein negativer Check 2 eintreten, weil eben doch irgendetwas verdächtig ist. Konsequenterweise müssten daher in der Ergebnistabelle alle solchen Fälle statt mit Grün mit Gelb (und dem Zusatz „eventuell“) bewertet werden. Dann schlägt aber die relative Bewertung vom Stop or Go zur Snow-Card und zur GRM um, dann sind letztere „offensiver“. Das Ergebnis hängt also stark von den willkürlich getroffenen Entscheidungen ab!
Zur Ergänzung möchte ich noch anmerken, dass ich auch noch einige andere Ausweisungen in den Tabellen nicht nachvollziehen kann und jeweils auch keine plausible Erklärung hierfür finden kann: y In Tab. 1 wird die ERM bei 35° und bei 37,5° Hangneigung mit „Grün“ bewertet. Das Basisszenario (das leider nicht genauer beschrieben ist) beruht aber auf GS 3 und da ist bei der ERM meines Erachtens bei 34° Schluss, die entsprechenden Felder in der Tabelle müssten daher rot sein.
y Das Gleiche gilt m. E. auch für Tab. 3, auch da müssten bei der ERM bei GS 3 die Felder bei 35° und bei 37,5° Hangneigung rot sein, sie sind aber grün.
y Noch schärfer ist das m. E. in der Tab. 1 bei der Abhängigkeit von der GS: Bei der ERM müsste es bei GS 4 (und 33° Steilheit) ein klares Nein geben, das Feld ist aber grün.
y Generell „günstige“ und „ungünstige“ Expositionen: Diese Begriffe stammen m. E. aus der Gedankenwelt der SonwCard und GRM, die anderen Methoden kennen diese Einteilung nicht. In den Tabellen sind aber auch hierfür zum Teil deutlich unterschiedliche Ergebnisse für „günstige“ und „ungünstige“ Expositionen ausgewiesen. Das kann m. E. nur infolge unterschiedlicher Basisszenarien zustande kommen, doch werden die leider nicht beschrieben. Es ist daher schwierig zu bewerten, ob dieses Ergebnis Folge der Methode oder des gewählten Basisszenarios ist.
y Besonders problematisch ist das bei der PRM. Die kennt diese Begriffe so auch nicht, berücksichtigt aber eine eigene (und immer gleiche!) Abhängigkeit von der Ausrichtung des Hanges, sogar in insgesamt vier Abstufungen. In dem hier diskutierten Beitrag werden diese Unterschiede zusätzlich noch mit einer Abhängigkeit von „günstig“ und „ungünstig“ überlagert. Ohne nähere Angaben ist das schwer zu bewerten.
Es gibt noch ein weiteres Problem: Der Beitrag untersucht erklärtermaßen nur den probabilistischen Anteil der diversen Methoden. M. E. sind jedoch alle Methoden ein Gemisch aus probabilistischen und analytischen Bestandteilen (mit unterschiedlichen Anteilen). Das beginnt schon damit, dass der Lawinenlagebericht (der seinerseits auf analytischer Basis erstellt wird) nur mit einem gewissen „analytischen Sachverstand“ verstanden und innerhalb der Methode „richtig“ berücksichtigt werden kann. Und bei Anwendung der Methoden ist dann noch weiterer „analytischer Sachverstand“ unerlässlich. Bei Stop or Go z. B. ist das durch die 5 klar gestellten Fragen in Check 2 (und durch die 3 ebenso klaren Go-Faktoren) evident, ein gewisser analytischer Anteil steckt aber auch in allen anderen Methoden drinnen. Z. B. erfordert die Entscheidung zwischen „günstiger“ und „ungünstiger“ Exposition m. E. zwingend ausreichenden „analytischen Sachverstand“ (und sie ist nach meiner Beurteilung auch nicht so gut strukturiert, wie das bei Stop or Go der Fall ist, fordert also eher noch mehr „analytischen Sachverstand“). Auch viele andere Detailentscheidungen können umso besser getroffen werden, je besser
v 16
der „analytische Sachverstand“ ist. Etwas überspitzt könnte man sagen, wie gut eine Methode ist, hängt davon ab, wie gut sie Probabilistik und Analytik miteinander verknüpft. Eine Bewertung einer Methode kann immer nur nach ihrer Gesamtwirkung erfolgen, nicht aus dem probabilistischen Anteil allein.
Mein persönliches Fazit: Der verfolgte Ansatz hilft, Unterschiede zwischen den strategischen Methoden herauszuarbeiten, diese dadurch besser zu verstehen, und dabei gewonnene Erkenntnisse dann für die Weiterentwicklung zu nutzen. Für eine vergleichende Bewertung der Methoden ist der Ansatz aber problematisch.
Eike Roth, Physiker, Autor von „Lawinen: Verstehen/Vermeiden/Praxistipps“
l[Lawinenmantra] Danke für die umfassende Aufarbeitung der lawinenkundlichen Themen in der Ausgabe #121 (Vergleich probabilistischer Instrumente/Achtung Lawine!/ Unterteilung der Gefahrenstufen). Besonderen Dank für die umfassende Darstellung und Gegenüberstellung der probabilistischen Instrumente. Ebenso die Feinjustierung der Gefahrenstufen durch den SLF sehe ich als eine wertvolle Bereicherung, die hoffentlich überall Eingang finden wird. Sie entspricht sicherlich nicht nur meiner bisherigen gedanklichen Vorgehensweise. Eine 3 war für mich nie einfach eine 3. Sollte sich das durchsetzen, werden GRM und SnowCard durch die Darstellung der Zwischenstufen Vorteile gegenüber anderen Reduktionsmethoden gewinnen. Beifall auch für die Integration der GKMR im neuen deutschen Faltblatt ACHTUNG LAWINEN! Bei der Beschäftigung damit ist mir aufgefallen, dass sich diese nahezu deckt mit dem in der Ausbildung des DAV vermittelten Lawinenmantra. Selbst habe ich von Anfang an mit der für mich netten, aber verwirrenden Grafik gehadert, die es mir schwermachte, diese zu vermitteln. Aus diesem Grund hatte ich mir für Kurse das Mantra neu aufbereitet und reduziert. Aber braucht es noch beides? Da die GKMR nun mit allen bestehenden Elementen des Faltblattes verzahnt wurde, hat das Mantra für mich seine Schuldigkeit getan. Joachim Sator, DAV Trainer B Skihochtouren

[Digitale Navigation] Lieber Georg, vielen Dank für deine Antwort zu meinem Leserbrief „Digitale Navigation“ in bergundsteigen #121. Interessant! Dazu eine Anmerkung und eine Anregung:
y Handy anlassen, um Handyortung zu ermöglichen [Anmerkung]: Ich finde, es ist wahrscheinlicher, dass mein Handyakku aufgrund stetiger Verbindungssuche schneller leer ist, als dass ich einen Unfall erleide, bei dem mich die Rettung über mein eingeschaltetes (nicht im Flugmodus) Handy finden kann (bzw. muss). Zumal ich bei letzterem Szenario irgendwo mit Empfang liegen, irgendein Dritter die Rettung alarmieren und die Handyortung dann auch noch alle datenschutzrechtlichen Hürden nehmen muss. Aber das kann, soll, darf jeder selbst entscheiden.
y Handy auf Skitour [Anregung]: Dass der Abstand wichtiger ist als Flugmodus aus/an, bestätigt auch Alex Weijnman, Head of Avalanche Safety bei Mammut im aktuellen Podcast bei ulligunde.com (https://ulligunde.com/2022/12/episode86-lawinen-und-irrtumeralex-weijnman/). Als Trainer C Bergsteigen bin ich keine ausgebildete Fachfrau für den Winter. Dennoch wird meines Wissens immer noch in DAV-Kursen (und zig DAV-Touren) gelehrt und vor der Tour ermahnt, das Handy in den Flugmodus zu schalten. Dass ein Trainer den Teilnehmern rät, das Handy bitte 20 cm entfernt vom LVS zu verstauen (und gleiches für GoPro & Co zu beachten), habe ich noch nie auf einer Sektionstour gehört. Wäre es daher nicht sinnvoll, die sog. „Lehrmeinung“ dazu entsprechend anzupsassen, so dass „Winter Trainer“ bitte ihre Teilnehmer vor der Tour entsprechend briefen?
Anne Zeller
d[Dummyrunner] Ich habe eine kurze Frage zum Thema „Dummyrunner“. Vielleicht könnten mir die Experten hierzu ein kurzes Statement geben? Situation am Stand:
y Zwei gute Fixpunkte, aber keine Bohrhaken y Fixpunkte weit genug voneinander entfernt, dass die HMS im Sturzfall nicht in den Dummyrunner gezogen werden kann y HMS Fixpunktsicherung
y Beide Kletterer etwa gleich schwer
Frage: Ist es belastungstechnisch in diesem Fall besser, den Vorsteiger direkt in den Stand stürzen zu lassen, als am oberen Fixpunkt des Stands einen Dummyrunner einzuhängen?
Illustration zum Lawinenmantra.
Illustration: Georg Sojer
Ich habe mir überlegt, dass die Kraft, die durch den Dummyrunner auf den oberen Fixpunkt wirkt, diesen weit höher belastet (Sturzzug und Fangstoß addieren sich ja dort) und vielleicht zum Versagen bringt, als wenn ich mit einer normalen Ausgleichsverankerung beide Fixpunkte belaste. Es wird ja beim Sturz zuerst nur der obere Fixpunkt durch den Dummyrunner belastet, und erst später auch der untere, wenn die HMS greift. Eine Kräfteverteilung findet in diesem Fall nicht statt. Deshalb ist mir eigentlich nicht klar, wieso diese Methode in dieser Art propagiert wird. Soweit ich mich erinnern kann, ist das Thema der zusätzlichen Belastung des Stands durch die Verwendung eines Dummyrunners noch nicht im Magazin behandelt worden. Auch habe ich leider noch keine Fallversuche dazu in der Literatur gefunden. Aber vielleicht können Sie mir die Situation erhellen …
17
d
Ich persönlich baue wenn immer möglich den Dummyrunner nicht in das Standplatzsystem ein, um dieses Problem auszuschließen.
Gerd Essl, Klagenfurt
In deinem Fall – Partnersicherung mittels HMS im Zentralpunkt –macht der Dummyrunner wenig bis gar keinen Sinn. Eher veschlechtert er die Belastungssituation, wie von dir dargestellt. Einen Fixpunkt (den höher gelegenen) am Standplatz als erste Zwischensicherung (= Dummyrunner) zu verwenden, ist dann wichtig und richtig, wenn ich mit einem Tuber (z. B. Reverso) am Körper sichere. Tuber bieten (fast) keine Bremskraft bei Belastung nach unten (= Sturz in den Stand bzw. Körper)! Eine solide Zwischensicherung stellt sicher, dass der Sturzzug nach oben gerichtet ist und der Tuber seine Bremskraft entwickelt (ca. 2,5 kN).
Die HMS ist für Sturzbelastung nach unten gut geeignet. Die Bremskraft ist in diesem Fall sogar höher (ca. 3,5 kN) als bei Sturzzug nach oben. Auf einen Dummyrunner kann verzichtet werden. Dennoch: Eine solide Zwischensicherung auf den ersten drei Metern über dem Standplatz bleibt eine gute Empfehlung.
Michael Larcher, Leiter Bergsportabteilung ÖAV
l[Leash beim Eisklettern] Eure Zeitschrift habe ich durch meine Ausbildung zum FÜL Klettern C-Trainer vor über 15 Jahren kennengelernt und bin seitdem Abonnent. Jede Ausgabe lese ich immer mit großem Interesse. Der Dialog mit den Lesern ist oft auch sehr interessant. Nun bitte ich euch einmal um euren Ratschlag zum Thema „herabfallende Eisgeräte“. Ich war vor Kurzem Teilnehmer bei einem Eiskletterkurs für Fortgeschrittene in der Taschachschlucht. Der sehr erfahrene Fachübungsleiter war der Meinung, dass die Verwendung einer Leash (Fangleine für die Eisgeräte) für den Kletterer eine zusätzliche Gefahr bedeutet, weil ein herabfallendes Eisgerät von der Leash wieder zurückprallen könnte und den Kletterer dadurch evtl. verletzen kann. Dieser Gefahr bin ich mir bewusst. Mir geht es aber natürlich um den Schutz der vielen Personen (es waren zeitweilig ca. 80–100 Leute in der Schlucht) vor herabfallenden Eisgeräten. Im freien Fall erreichen Gegenstände nach 10 m Fallstrecke ca. 50 km/h! Was ist eure generelle Meinung zur Verwendung einer Leash beim Eisklettern? Wie sieht es eigentlich auf der rechtlichen Seite aus? Muss der Kletterer mit rechtlichen Folgen rechnen, wenn ihm ein Eisgerät runterfällt und eine andere Person dadurch geschädigt wird? Gibt es Unterschiede in der Rechtsprechung je nach Land (D, A, CH, F, IT …)? Wird es evtl. sogar als grob fahrlässig beurteilt, weil eine Leash den Unfall verhindert hätte, und werden sich dann Haftpflichtversicherung darauf berufen und den Schadenersatz verweigern? Über eure Stellungnahme wäre ich sehr dankbar.
Heinrich Sattelmayer
Vielen Dank für deine interessante Anfrage. Ich nehme sie zum Anlass, etwas weiter auszuholen und generell die brandaktuelle Thematik herunterfallender Gegenstände beim Eisklettern zu beleuchten und konkret auch auf die Situation in der Taschachschlucht einzugehen. Aber der Reihe nach:
Früher waren Handschlaufen beim Eisklettern obligatorisch. Aus sportlichen (man spart Kraft, weil man in den Schlaufen hängt) und praktischen (störend beim Wechseln der Eisgeräte im anspruchsvollen Gelände) Gründen sind sie aber von der Bildfläche verschwunden bzw. waren sie sogar verpönt. Dadurch erlebte die Leash ihre Renaissance. Die Sicherung von Eisgeräten in Eisflanken durch zwei Reepschnüre gab es nämlich schon früher. Vorteile der Leash: Die Eisgeräte sind gegen Herunterfallen gesichert, was in langen Touren durchaus ein erheblicher Vorteil ist. Eine Verletzung auf Grund der Leash durch zurückfedernde Eisgeräte ist mir nicht bekannt und das Risiko ist meines Erachtens auch durchaus überschaubar. Ein weiterer Vorteil der Leash ist ein Mini-Backup im Falle eines Rutschers ins Eisgerät. Es gibt Leashes deren Lastarme 3,5 kN statisch (Edelrid) halten. Auch bei der Leash von Black Diamond (2 kN) (siehe Abb.) geht sich ein bewusstes (!) Hineinsetzten aus. Nachteile: Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und besonders im Vorstieg muss man darauf achten, dass man nicht mit den beiden Halbseilen und der Leash zu „stricken“ beginnt. Dafür ist z. B. der kleine Schrauber von Grivel mit Mini-Kreisel (max. 780 kg) ganz praktisch. Fazit: Bei langen, insbesondere kombinierten Touren hat die Leash definitiv ihre Berechtigung, im Eisklettergarten bzw. im Drytooling-Garten ist sie hingegen störend. Nun zu deiner konkreten Frage: Grundsätzlich sind die Personen unterhalb von Kletterern bzw. am Einstieg selbst dafür verantwortlich, dass ihnen nichts auf den Kopf fällt (hier gibt es auch eine Analogie zum Sportklettern: Sturzraum freihalten!).

18
Vollbetrieb in der Taschachschlucht. Foto: Gerhard Mössmer
Leider, leider ist dieses Bewusstsein beim Eisklettern in den letzten Jahren – insbesondere an vielbegangenen, eher leichten Eisfällen – verloren gegangen. Wenn fünf Seilschaften am Einstieg Schlange stehen, gesellt sich noch eine sechste dazu und wenn dann von oben etwas herunterfällt motzen alle. Eisschlag lässt sich beim Eisklettern nicht vermeiden! Man kann zwar schonend und behutsam klettern, aber ganz ausschließen lässt er sich nicht! Genauso lässt es sich nicht ausschließen, dass mein Eisgerät herunterfällt. Deshalb wir auch in der Ausbildung gelehrt, dass Stände immer außerhalb des Eisschlagdeltas (und was sonst noch herunterfallen kann) sein sollen. Das wird natürlich bei zu vielen Seilschaften im Fall zunehmend schwieriger bis unmöglich. Und jetzt zur Taschachschlucht, erlebt an einem Wochenende im Jänner. Der Eisklettergarten ist knackevoll (was sehr erfreulich ist; und bei der Gelegenheit auch Danke an Alfi Dworak für die unermüdliche Arbeit und die perfekten Kletterbedingungen!). Alle zwei Meter hängt ein Toprope-Seil, d. h. jede (!) Linie ist besetzt. Steigen die Topropekletterer möglichst gleichzeitig, dann ist das bezüglich Eisschlag auch kein allzu großes Problem (Tipp: Miteinander reden oder fünf Minuten abwarten!). Will dann aber jemand – so geschehen – dazwischen im Vorstieg hinauf, dann wird’s kritisch. Dass das keine gute Idee ist, liegt auf der Hand. Die Frage, wer die Verantwortung trägt, wenn diesem Helden (er wurde am Start von zwei Bergführern auf die Risiken angesprochen und ist trotzdem eingestiegen) ein Eisgerät oder ein Eisbrocken auf den Kopf fällt, kann jeder für sich selbst beantworten …




Fazit: Nachdem die Leash kein Standard ist – im Gegenteil, im Eisklettergarten wird sie praktisch gar nicht (aus oben genannten Gründen) verwendet –, kann man demzufolge auch keinesfalls von einer Fahrlässigkeit sprechen, wenn jemand sein Eisgerät verliert und dabei einen anderen trifft.

Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten und wünsch dir weiterhin viel Spaß beim Eisklettern.
Gerhard


 Mössmer,
Mössmer,

Abteilung Bergsport ÖAV

l[Lob] Ich muss euch endlich zur neuen Redaktion meine Begeisterung ausdrücken. Das war für mich ein Quantensprung. Es ist einfach alles besser geworden, im speziellen der aktuelle Beitrag von Pit Rohwedder in #121. Fantastisch. Der gehört in den Schulunterricht.
Ciao, Gerald
PERFORMANCE POWERED BY THE
BOA® FIT SYSTEM












PERFEKT EINGESTELLT Fein anpassbar für eine präzise Passform.
FEST UMSCHLOSSEN
Eine eng anliegende, sichere Passform verbessert die Laufeffizienz und reduziert die Stoßbelastung.





ZUVERLÄSSIG
Entwickelt, um unter den härtesten Bedingungen zu bestehen.
Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.
 LA SPORTIVA JACKAL II BOA
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
Leash von Black Diamond. Foto: Gerhard Mössmer ■
LA SPORTIVA JACKAL II BOA
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
Leash von Black Diamond. Foto: Gerhard Mössmer ■
El Capitan Report: Die tägliche Dosis Bigwall
Seit 27 Jahren steht Hobbyfotograf Tom Evans aus Südkalifornien auf der Wiese „El Cap Meadow“ und fotografiert Kletternde bei ihren Bigwall-Abenteuern am großen Stein im Yosemite Valley. Dem pensionierten Lehrer entgeht mit seiner Nikon D5600 mit 600-mmAF1-Objektiv keine Bewegung am El Capitan, sei es an der „Nose“, „Freerider“ oder am „Shield“. Wem die trüben Frühjahrstage zu lange werden, der kann sich an seinem täglichen Blog das Herz erwärmen und mit den internationalen Teams mitfiebern.
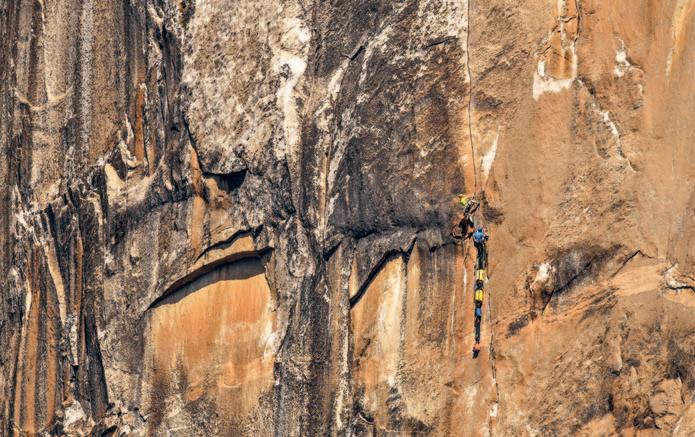

www.elcapreport.com
Urs Wellauer wird neuer Präsident der IFMGA
Im November 2022 hat der Schweizer Urs Wellauer die Präsidentschaft der International Federation of Mountain Guides Association, kurz IFMGA übernommen. In der 1965 gegründeten Dachvereinigung sind Bergführer*innen aus 20 Ländern vertreten. Urs Wellauer ist Leiter der Abteilung Arbeitssicherheit des Schweizer Bergführerverbandes, Vermessungszeichner und natürlich Bergführer.

b
Tom Evans auf seinem Posten.
dies & das s
Der Schweizer Urs Wellauer ist neuer internationaler Bergführerpräsident.
Foto: Markus Burger
20 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Die Augen von El Capitan. Karolina Oska und Michal aus Polen in der Route „El Córazon“. Foto Tom Evans
Rückruf DMM Swivel (2.11.2022)

Dieser Rückruf betrifft alle Produkte von DMM mit eingebauter Mini-Swivel-Einheit. Grund für den Rückruf: Bei der Benutzung eines DMM Director-Produkts (Karabiner mit SwivelEinheit) wurde der Swivel vom Karabiner getrennt, niemand wurde dabei verletzt. DMM bittet alle Kund*innen, die betroffenen Produkte nicht mehr zu benutzen, die Produkte auf dmmwales.com zu registrieren und einzusenden. Einsendedetails bekommt man nach der Online-Registrierung der Produkte. Die Swivel werden überprüft, die betreffenden Schrauben ausgetauscht und ab Februar 2023 an die Besitzer*innen zurückgeschickt.
Betroffene Produkte: SW400 Mini Swivel, SW450 Focus Swivel Bow, SW440 Focus Swivel D, SW470 Nexus Swivel Bow to D, SW480 Nexus Swivel D to D, SW490 Nexus Swivel Bow to Bow, A63x Director Swivel Eye (alle Verschlusstypen), A64x Director Swivel Boss D (alle Verschlusstypen), A 64x Director Swivel Boss Bow (alle Verschlusstypen). Außerdem alle Farbvarianten dieser Produkte. Kontaktformular zur Einsendung des Produktes unter: www.dmmwales.com
Satellitenkommunikation fürs Smartphone
Mit dem inReach Messenger präsentiert Garmin ein neues Satellitenkommunikationsgerät, das über Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden kann. Auch ohne Mobilfunknetz kann man so mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben und sogar Gruppen-Chats einrichten. Damit das Versenden und Empfangen von Nachrichten funktioniert, wird die GarminMessenger APP auf einem kompatiblen Smartphone installiert. Ein Satellitenabonnement muss man auch noch buchen. Bei fehlendem Mobilfunknetz wird direkt das Iridium-Satellitennetz zum Versenden von Nachrichten benutzt. Weitere Funktionen sind „Notruf absetzen“, „Standort teilen“ und „Wetterbericht abrufen“. Alle Funktionen können aber auch ohne Smartphone vom inReach Messenger aus bedient werden, allerdings ist das Display sehr klein und das Erstellen von Nachrichten dauert länger. Eine Trackingfunktion mit Intervallen zwischen zwei Minuten und vier Stunden kann außerdem zum Zurückfinden genutzt werden (Trackback-Funktion). Allerdings gibt es für diese Funktion deutlich bessere Geräte mit größeren Displays (beispielsweise das Garmin inReach Mini 2). Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen (bei freier Sicht zum Himmel) ist man mit dem inReach Messenger auch für längere Unternehmungen gewappnet. Das Gerät ist mit 3,1 x 2,5 Zentimetern bei 114 Gramm handlich und leicht, der Preis liegt aktuell bei 300 Euro.
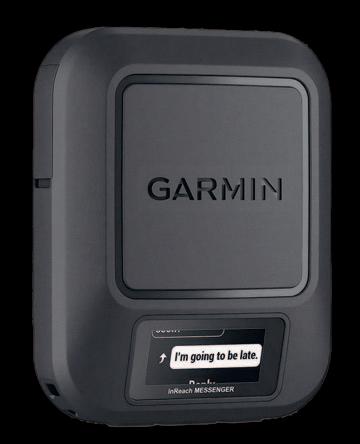
Der inReach Messenger ist ein neues Satellitenkommunikationsgerät, das mit dem Smartphone gekoppelt werden kann. Damit können schnell und einfach längere Textnachrichten über die Smartphone-Tastatur verfasst werden.

21 | dies & das
Rückruf DMM Swivel. Foto: DMM
(Null-)Toleranz bei

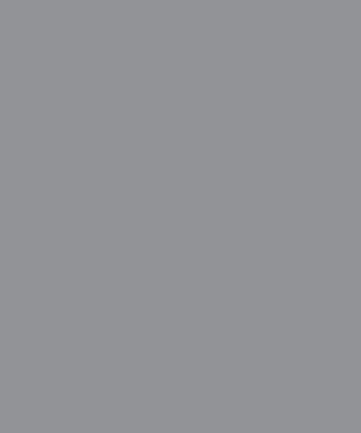

Wir sollten außergewöhnliche menschliche Leistungen feiern. Ich las kürzlich die Forschungsarbeit, die zum Schluss kommt, dass tatsächlich viele der Besteiger*innen aller 14 Achttausender nie die echten Gipfel erreicht haben. Die Nachforschungen behaupten, ich sei einer von drei Bergsteigern, die alle richtigen Gipfel erreicht hätten. Aber mir ist das egal. Mir bedeutet das nicht viel.
Ich denke, es ist wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass sich die Technologie ständig weiterentwickelt. Sie wird immer besser und noch besser und dadurch ist es viel leichter geworden, die wahren Gipfel zu finden. Früher war die Technik lange nicht so ausgereift wie heute. GPS und moderne Kartensysteme haben das Bergsteigen revolutioniert. Daher zu behaupten, diese großartigen menschlichen Leistungen von damals sind nicht gültig, weil die Technik noch nicht so weit war, ist nicht fair. Wenn jemand alle 14 Achttausender bestiegen hat, Tausende und Abertausende Meter mit all seiner damaligen Erfahrung hochgestie-
gen ist und zu jenem Punkt kam, den er für den Gipfel gehalten hat, weil er damals nicht mehr Daten zur Verfügung gehabt hat, dann macht das absolut nichts. Selbst wenn der erreichte Punkt ein paar Meter außerhalb unserer modernen Standards ist. Sie haben hart gearbeitet, sind auf den Gipfel gestiegen, der damals als Gipfel bekannt gewesen ist, und haben deshalb alle 14 Achttausender bestiegen. Niemand kann ihnen das nehmen, diese außergewöhnliche menschliche Leistung! Reinhold Messner ist der größte Bergsteiger aller Zeiten und er hat als Erster alle 14 Achttausender bestiegen – keine Frage! Seine Rekorde sind bahnbrechend. Er war der Erste, der alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff bezwungen hat. Er hat gezeigt, dass es möglich ist, und viele Menschen folgten seinem Weg. Er ist ein großartiger Mann, der Generationen dazu inspiriert hat, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Und er war einer der wenigen Menschen, die an mich geglaubt haben, als ich mein Projekt „14 Achttausender in sieben Monaten“ begonnen habe. Niemand kann ihm und auch nicht den anderen 14-Achttausender-Besteigern ihren großartigen Erfolg nehmen. Niemand! Wir sollten diese tollen Leistungen feiern und andere Bergsteiger unterstützen und in der Community willkommen heißen, damit sie ebenso ihre Träume verwirklichen können.
Nirmal Purja ist ein nepalesischer Bergsteiger und ehemaliger GurkhaSoldat, der seinen Angaben zufolge alle 14 Achttausender in sieben Monaten mit Flaschensauerstoff und Helikoptertransfers bestiegen hat. Nachforschungen ergaben aber, dass auch er nicht innerhalb der sieben Monate auf allen höchsten Punkten der Berge stand.

pro & contra bs
22 / bergundsteigen #122 / frühjahr 22
nicht erreichten 8000ern?
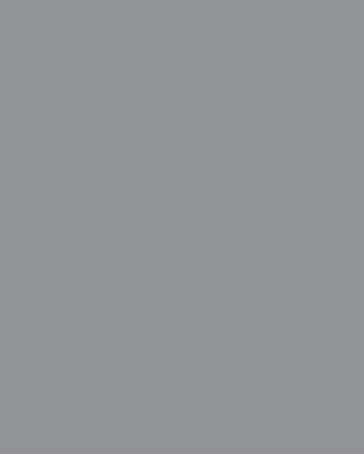

SSeit vier Jahrzehnten sammle ich Fakten über Berge und das Bergsteigen und ich habe immer fest daran geglaubt, dass der höchste Punkt eines Berges der einzige ist, der wirklich als Gipfel zählt. Dank zunehmender Forschung und ausgefeilterer Technik ist es in letzter Zeit jedoch offensichtlich geworden, dass diese ausschließlich topografische Herangehensweise nicht der Erfahrung der Bergsteiger und auch nicht den Gipfeln der Achttausender entspricht. In den letzten zehn Jahren haben einige Kollegen und ich viele Gipfelfotos untersucht, im Speziellen Fotos der drei Achttausender Manaslu, Annapurna I und Dhaulagiri I. Bei diesen Bergen gibt es offene Fragen bezüglich der genauen Verortung der Gipfel sowie der Aufzeichnungen, wer bis wohin aufgestiegen ist. Nach all diesen Untersuchungen und dem Austausch untereinander ist es nun klar, dass viele Bergsteiger – einschließlich einiger gut bekannter – die höchsten Punkte auf einem oder mehreren dieser Berge nicht erreicht haben, und zwar aufgrund der unsicheren Topografie.
Stattdessen sind Bergsteiger – wissentlich oder nicht – an einer Auswahl niedrigerer Stellen stehen geblieben – es geht um 35 bis 190 Meter Distanz, teilweise in noch sehr schwierigem Gelände. Als wir 2019 die PDFs mit den umfangreichen Ausführungen über die Gipfelzonen der drei oben genannten Berge und zugleich alle als Gipfelbesteigung deklarierten Routenendpunkte veröffentlichten, haben anschließend einige ihre vorher falschen Gipfel mit einer neuen Besteigung bis zum höchsten Punkt korrigiert, zumindest bei Annapurna I und Dhaulagiri I. Beim Manaslu kamen,
obwohl auch im PDF erkennbar, die Korrekturen erst 2021, nachdem Drohnenfotos der Gipfelregion gemacht und gezeigt worden waren. Unser 2019 gemachter Vorschlag für „Toleranz-Zonen“ wurde schnell wieder verworfen, weil wir herausfanden, dass Miss Hawley 1997 einem Indonesier mit Namen Misirin den Gipfel aberkannte, weil er einem Klienten hinunterhelfen musste und 30 Meter vor dem Gipfel des Everest umgekehrt war und somit keine Gipfelanerkennung bekommen hatte. Das heißt: Wenn Miss Hawley um all diese viel weiteren Distanzen zum Gipfel gewusst hätte, hätte sie diese behaupteten Besteigungen niemals anerkannt, mit Sicherheit nicht!
Nachdem nun alle unsere Forschungsergebnisse am 8. Juli 2022 mit allen Namen veröffentlicht wurden, gab es gemischte Reaktionen. Es gab Gratulationen zur akribischen Forschungsarbeit, aber auch Beschimpfungen besonders von den Fans der Legenden und von einigen Legenden selbst, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Es wird Menschen geben, die denken, dass unsere Arbeit nicht wichtig sei: Lasst alles beim Alten und macht eine allgemeine Amnestie für alle historischen Besteigungen! Aber viele andere wollen liebend gerne wissen, was Fakt ist: Wie viele Bergsteiger wirklich auf allen echten Gipfeln der 14 Achttausender standen.
Und dafür ist unsere neue Tabelle mit allen Forschungsergebnissen sehr hilfreich (www.8000ers.com). 2022 haben dann auch sehr viele Bergsteiger ihren falschen Manaslu-Gipfel durch eine erneute Besteigung bis zum echten Gipfel korrigiert.

Eberhard Jurgalski ist ein deutscher Berg-Chronist und Buchautor. Er ist bekannt für das Sammeln von Informationen über Achttausender und deren Besteigungen. Zudem beschäftigt er sich mit der systematischen Erfassung von Bergen anhand topografischer Kriterien und geografischer Gebirgsforschung.
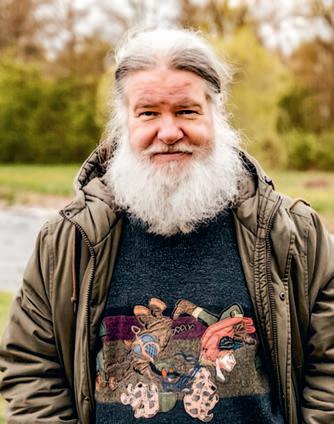
Für die heutige Jagd nach Rekorden im Profibergsteigen ist es nötig, ein möglichst exaktes Bild der historischen Besteigungen zu erhalten, um für die Zukunft eindeutige sportliche Richtlinien zu definieren. Auch Bergsteigen ist nun einmal ein Konkurrenzsport geworden, bei dem es inzwischen um viel Geld geht. Somit sollten die einfachsten Regeln für die Zukunft sein: Als Gipfel gilt ausschließlich der Gipfel, und keine Helikopter vom Basislager zu einem höheren Camp. Die UIAA hat 2002 schon in der „Tyrol Declaration“ geschrieben, dass bei Erstbesteigungen ein Bergsteiger verpflichtet ist, möglichst genaue Angaben zu machen, und wenn berechtigte Zweifel bestehen, muss man denen nachgehen.
Bei großen Besteigungsserien, wie den 4000ern der Alpen, den 6000ern der Anden, den Seven Summits, den Seven Second Summits oder bei den 8000ern, sollten diese Richtlinien ebenso selbstverständlich sein. Hier sollte die UIAA nun tätig werden und die weltweiten Alpinvereine und -organisationen anhalten, uns bei der weiteren Forschung behilflich zu sein. ■
23 | pro & contra
How to Aid Climb!?
In den ersten beiden Teilen dieser Artikelserie zum BigwallKlettern haben wir uns mit Schwierigkeitsgraden, Logistik und Systemen zum Raufziehen des Haulbags befasst. Im letzten Teil wollen wir uns über die spezifische BigwallAusrüstung sowie die Klettertechnik unterhalten, die es braucht, um sich an selbst platzierten Sicherungen mit Steigleitern hochzuarbeiten. Die Fertigkeiten im technischen Klettern sind entscheidend, um in großen Wänden Zeit zu sparen und Risiken zu minimieren.
Von Thomas Wanner und Ben Lepesant
Schon die Schwierigkeitsgrade, die beim technischen Klettern zum Einsatz kommen, geben einen Hinweis darauf, dass das technische Klettern eine weniger ‚feingliedrige‘ Angelegenheit ist als das Freiklettern.
Wie bereits im ersten Teil (Ausgabe #119) genauer beschrieben, gibt es verschiedene Skalen, die verwendet werden, um eine Bigwall-Route zu beschreiben. Die wichtigste und gebräuchlichste ist die A-Skala, die von A0 bis A5 geht und auch über zahlreiche Abstufungen (+/-) verfügt. Die Schwierigkeiten einer Seillänge werden typischerweise mit jeder Begehung geringer: die Placements werden größer und Gebrauchsspuren weisen den Weg. Die fragilsten Placements gehen kaputt und es kommen Bohrhaken und Bat Hooks (Bohrloch zum Hooken) hinzu. Ein weiterer wichtiger Hinweis findet sich im Jahr der Erstbegehung: Eine A4- oder A5-Länge aus den 1970er-Jahren entspricht oft einer A2 oder A3 Seillänge aus den 1990er-Jahren – man bezeichnet die neuen Bewertungen auch als „new wave“. Die abgeschwächte Bewertung ist vor allem dem besseren Material geschuldet. Nicht immer ist klar, wie ‚new wave‘ eine Bewertung ist, aber ein Blick auf das empfohlene Rack (Ausrüstung) gibt meistens Aufschluss darüber, welche Schwierigkeiten zu erwarten sind. Wenn man mit 25 kleinen Haken und Copperheads anrücken muss, erwartet einen wohl etwas anderes, als wenn man hauptsächlich Camalots braucht. Im Endeffekt geben die Bewertungen sehr oft nur einen groben Anhaltspunkt.
24 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Teil
3. Bigwall


„South Seas“ (A3+), El Capitan.
Foto: Christopher Edmands
Das richtige Setup zum technischen Klettern
Bevor wir uns dem technischen Klettern widmen, werfen wir einen Blick auf das klassische Bigwall-Setup. Dafür benötigen wir Folgendes:
y 2 Steigleitern mit starrem Bügel(!) + Keylock Schnappkarabiner. Jede Steigleiter ist mit dem Anseilring am Gurt via Daisychain verbunden. Dabei sollte die Daisy NICHT über den Schnapper laufen, wenn man sich nach oben bewegt, sonst hängt sie sich aus (mit STRING-Gummi von Petzl bleibt die Daisy in der richtigen Position, siehe Abb. 1 und 2). Ein wichtiger Hinweis, der allgemein bekannt sein dürfte, ist, dass immer nur eine Öse der Daisychain in den Karabiner eingehängt werden darf. Werden zwei Daisy-Ösen eingehängt, so „schließt man die Daisy kurz“ und hängt lediglich an der Zwischennaht, die verhältnismäßig wenig aushält.
y Halbwegs feste Schuhe (Zustiegsschuhe), Knieschoner (bevorzugt weiche, die nicht rutschen) und je nach Belieben ein Paar abgeschnittene Arbeitshandschuhe aus Leder oder Klettersteighandschuhe.
y 1 Fifi-Hook, der direkt in den Anseilring mittels Ankerstich geknüpft wird, um im steilen Gelände den Körper schnell zu entlasten.
y Ausreichend Expressschlingen zum Bewältigen der Seillänge. Mit diesem Setup können technische A0-Längen (Fortbewegen an Bohrhaken) bereits gut gemeistert werden – ausreichend Übung vorausgesetzt! An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass dieses Setup individuell verfeinert werden kann. Sogenannte „adjustable Daisys“ werden häufig an Stelle der klassischen Daisychain verwendet. Sie ermöglichen ein schnelles Variieren der Länge und man braucht dann auch keinen Fifi-Hook.
Das kleine 1x1 des technischen Kletterns
Man kann das technische Klettern grob in drei Aspekte aufteilen, die relativ unabhängig voneinander sind und die auch nicht alle gleichzeitig beherrscht werden müssen:
y Wie man sich an den Sicherungen emporbewegt. Der Umgang mit den Steigleitern, die Verwendung eines FifiHooks und von Daisy Chains, die Fähigkeiten beim Hoch-inder-Leiter-Stehen.
y Wie viel Angst man hat, und infolge dessen, wie man angebrachte Sicherungen ‚testet‘, bevor man sich ihnen anvertraut. y Welche Fertigkeiten man beim Anbringen der Sicherungen mitbringt.
Bevor man sich an den Fels wagt, sollte man unbedingt erstmal in die nächste Kletterhalle gehen und im „A0-Gelände“ üben. In anderen Worten: die Grundtechnik perfektionieren. Wem das mit Knieschonern und Leitern in einer Halle (verständlicherweise) zu peinlich ist: Ein Klettergarten mit (sehr) engen Hakenabständen bei Schlechtwetter tut es auch. Die wenigsten Menschen, die man beim technischen Klettern sieht, haben die elementaren Abläufe gut drauf, weil sie sie nie isoliert geübt haben. Aus diesem Grund haben sie sich das Zaudern und Zögern angewöhnt, das zwangsläufig passiert, wenn man
Zweifel hegt, ob die Sicherung hält, oder nicht weiß, wo die nächste Sicherung untergebracht werden kann. Es ist extrem wichtig, die Abläufe des technischen Kletterns zu automatisieren, bevor man sich mit dem Legen mobiler Sicherungen auseinandersetzt, und am besten geht das an Bohrhaken!
Und so geht’s
1) Expressschlinge in den ersten Bohrhaken hängen.
2) Steigleiter in den oberen Karabiner der Exe hängen, die Exe mit der Hand ergreifen und …
3) In die Steigleiter steigen und bis ganz nach oben „klettern“. Hier wird einem sofort auffallen, warum die Knieschoner nützlich sind!
4) Seil in die Exe hängen.
5) Expressschlinge in den zweiten Bohrhaken hängen.
6) Andere Steigleiter in den oberen Karabiner der Exe hängen, die Exe mit der Hand ergreifen und …
7) In die Steigleiter steigen. Sobald die andere Steigleiter entlastet ist, hängen wir sie aus und an den Gurt und klettern in der zweiten Steigleiter wieder bis ganz nach oben.
8) Weiter wie 4.
Drei Dinge gilt es hierbei zu beachten. Erstens und am wichtigsten: Das Seil wird zu keinem Zeitpunkt belastet! Zweitens gibt es keinen Schritt, bei dem der Fifi-Hook zum Einsatz kommen muss. Man sollte ihn nur verwenden, wenn absolut notwendig. Wer sich daran gewöhnt, erstmal im Fifi zu sitzen, verliert immens viel Zeit. Im steilen Gelände hilft der Fifi hingegen, höher zu steigen. Eine gute Faustregel ist, immer erst den Fifi in den oberen Karabiner der Exe zu hängen, da man sonst den Karabiner der Exe nicht loslassen könnte. Drittens und letztens werden beim Üben der Abläufe nicht die Placements getestet (es sind im Übungsfall ja sowieso solide Bohrhaken) und es wird nicht lange geschaut, wie es weitergeht. Man steigt sofort in die Leiter so hoch, wie man kann, ohne zu zögern oder in der Gegend rumzuschauen. Es geht einfach nur darum, eine Seillänge so schnell es geht, ohne unnötiges Schaukeln und Ruckeln an den Bohrhaken hinter sich zu bringen.
Wenn man die ganze Seillänge über gut organisiert bleibt, also verhindert, dass sich am Gurt große Unordnung breitmacht oder sich die Daisys, Leitern und das Seil heillos verknoten und man alle drei Meter den Salat organisieren muss, geht das ruckzuck. Wer hier Routine hat und sich diesen sauberen „Schnelldurchlauf“ angewöhnt, der bringt das nötige Handwerkszeug mit, um anspruchsvollere Längen zu klettern. Je anspruchsvoller eine technische Länge ist, desto länger dauert es auch, da mit dem Platzieren und Testen von Sicherungen einfach viel Zeit verloren geht. Eine technische Länge, die aus 50 Sicherungen besteht, kann in 20 Minuten erledigt sein oder einen ganzen Tag beanspruchen. Schritte 1–8 sind dabei immer zu erledigen. Wer bei jedem dieser Schritte zehn Sekunden verschenkt, packt schon eine Stunde auf die Begehungszeit. Es ist immer wieder zu beobachten, dass ein schneller Kletterer für eine Seillänge nur den Bruchteil der Zeit braucht, die ein langsamer benötigt (z. B. 30 min versus 2 h für eine A2-Länge in einer klassischen Tour).
26
„Native Son“ (A4), El Capitan.

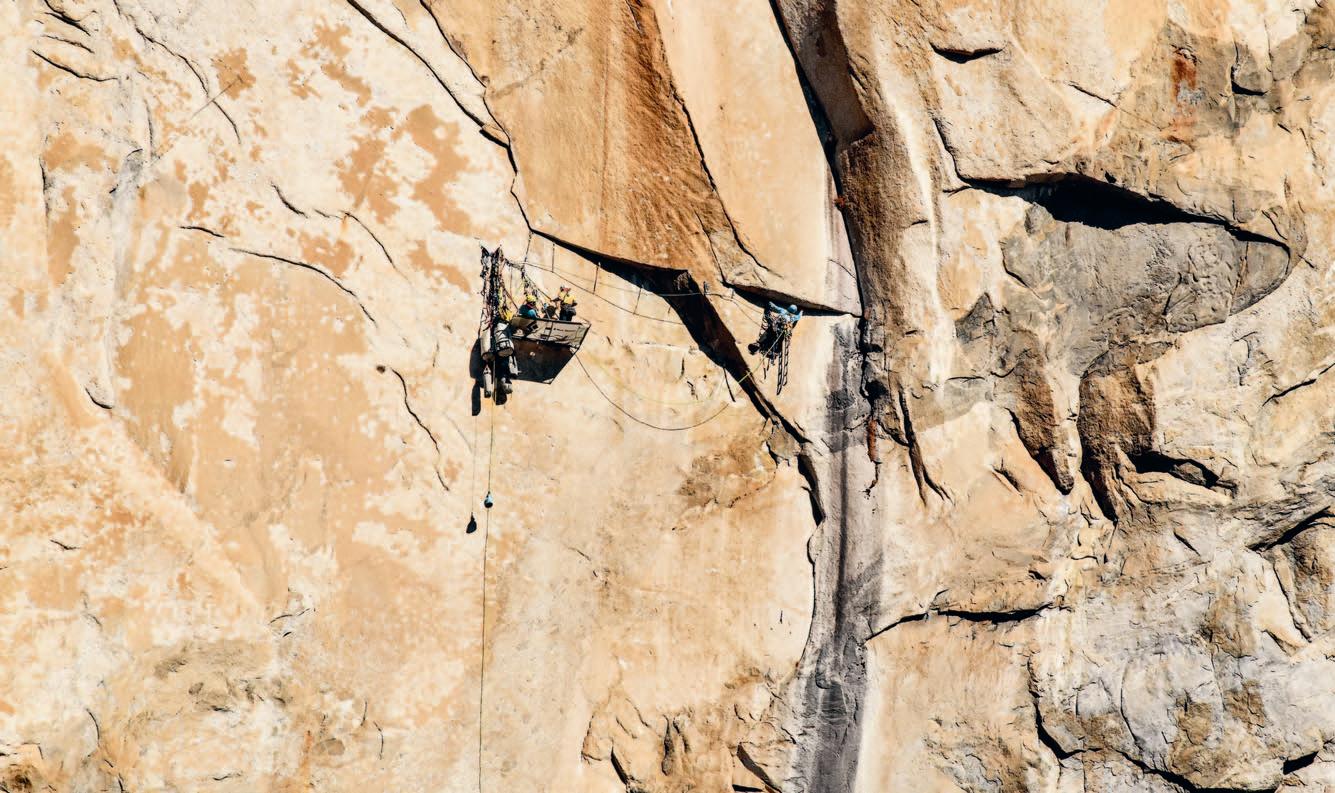
Eine erklärende Bilderserie zum Ablauf findet ihr auf www.bergundsteigen.com
Abb. 1 Setup mit Fifi-Hook am Gurt, 2 Daisychains und 2 Steigleitern. Zustiegsschuhe, Knieschoner und Handschuhe sollten ebenso nicht fehlen.
Abb. 2 Damit sich die kleinen Spezialhaken wie Hooks und Beaks nicht dauernd verhaken, kann man sie angehängt in einem Chalkbag transportieren. Hinten angehängt ist auch die Haulleine mit eingehängter Pro Traxion.
27
Bigwallkletterer von vorne
Bigwallkletterer von hinten
| unsicherheit
Foto: Tom Evans
Erste Gehversuche in richtigen Technorouten
Wer die grundlegende Technik beherrscht, also eine kurze Route im Klettergarten ohne größere Probleme schnell bewältigen kann, der sucht sich danach eine Seillänge, in der selbst Sicherungen angebracht werden können. Am besten, man sucht sich einen Riss, in dem man sich an Friends gut hocharbeiten kann. Die Fortbewegung sollte ausschließlich an den mobilen Sicherungen erfolgen. Die Bewegungsabfolge ist gleich wie in der Halle, also ohne Fifi-Hook und ohne die Sicherungen zu testen. Das alles setzt natürlich voraus, dass man seinen Sicherungen vertraut. Wer mit mobilen Sicherungen wenig Erfahrung hat, wird also erstmal viel testen, Theorie und Zeitdruck hin oder her (siehe bergundsteigen #116, Klemmkeile, Camalots und Co.). Vor allem im Granit ist das Unterbringen der Sicherungen jedoch oft sehr einfach und die Lernkurve dementsprechend steil. Man beachte nur, sich das Testen und Rumsitzen in Sicherungen nicht anzugewöhnen!
Und man testet doch!
Das Testen von Sicherungen macht Sinn, wenn sich mit dem Versagen ernsthafte Folgen ergeben, wie eine Verletzung oder der Ausbruch einer notwendigen fixen Sicherung, die man nicht ersetzen kann. Zweifel, ob die nächste Sicherung hält, frisst nicht nur Zeit, sondern macht auch müde. Vor allem, wenn man danach lange in einer zweifelhaften Sicherung steht. Irgendwann kommt der Moment, in dem man feststellt, dass manche Sicherungen mysteriöserweise erst nach einer Weile ausbrechen, ohne wahrnehmbare Änderung der Krafteinwirkung. Hier liest und hört man regelmäßig vom sogenannten ‚Bouncetesten‘. Das geht so, dass der Kletterer in der nächsten Sicherung mit einem Fuß rum-‚bounced‘ (= springt, eher drücken als springen), um Kräfte zu generieren, die höher sind als das eigene Körpergewicht, während man mit dem anderen Fuß in der anderen Steigleiter steht. In leichteren und sicheren Längen ist das vollkommen unnötig und kontraproduktiv. In schwereren Längen ist es oft nicht möglich, weil diese gerade deshalb schwer sind, weil manche Sicherungen äußerst delikat sind. Es gibt Situationen, in denen Bouncetesten aber Sinn macht: nicht delikate Sicherungen in schweren Längen. Bei zweifelhaften Sicherungen in schweren Längen lohnt sich ein angesetzter Klimmzug an der schon eingehängten Steigleiter, während man sehr eng gesichert wird. Bevor man sich an schwere Längen wagt, sollte man sich beim Testen wohlfühlen! Und die Methoden, die einem persönlich am besten passen, bereits gefunden haben.
Ab A3 ist die eine oder andere Form des Testens also notwendig, darunter sollte man es nur sporadisch gebrauchen. Es kommt vor, dass man in eine Situation gerät, in der man ausgiebig testet und Zeit verliert, weil man schlechte fixe Sicherungen geklippt hat (z. B. Copperheads), die man selber nicht angebracht hat. Zum Beispiel hat man einen guten Camalot gelegt, dann kommen in gutem Sturzgelände fünf sehr miese Copperheads und dann wieder ein guter Riss. Dann ist es am besten, man hängt die Copperheads gar nicht erst als Sicherung ein und testet sie auch nicht groß, sondern nützt sie nur
rasch zur Fortbewegung. Damit minimiert man die Chance, einen Copperhead herauszureißen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass – wenn einer ausbricht – nicht gleich alle im Reißverschlussprinzip versagen.
Tipp! Beim Testen nicht nach oben schauen, sonst haut es einem die ausbrechende Sicherung ins Gesicht. Im besten Fall bricht die Brille, im schlechtesten Fall die Zähne …
Weitere Technik-Tipps
Ein weiterer häufiger Fehler ist das zu frühe Abbrechen der Aufwärtsbewegung in der Steigleiter. Man sollte fast immer, ohne zu schauen, mindestens zur vorletzten Sprosse im steilen Gelände bzw. zur letzten Sprosse im plattigen Gelände steigen. Dann erst wird überlegt, wo das nächste Placement sein wird. Das klingt banal, ist aber letztendlich die entscheidende Fähigkeit beim technischen Klettern. In Klassikern ist das nächste Placement oft viel niedriger und man kann mit „gut höher steigen“ die Zahl der Placements stark reduzieren. Nach dem Motto „mehr Placements = mehr Sicherheit“ neigt man oft schnell dazu, jedes auszunutzen, vor allem, wenn man das Bis-in-die-letzte-Sprosse-Steigen nicht automatisiert hat. Das hat zwei große Nachteile: Erstens ist vor allem in moderatem Gelände nicht die Anzahl der gelegten Sicherungen wichtig, sondern, dass alle paar Meter etwas gelegt ist, was wirklich passt und einen Sturz hält. Wenn einem gegen Ende der Seillänge das Material fehlt, kann man leicht in eine vermeidbare gefährliche Situation kommen, weil man z. B. in einem sehr parallelen Riss plötzlich mit Klemmkeilen hantieren muss, weil einem die Friends ausgegangen sind. Zweitens frisst jedes Placement Zeit, leicht auch mehrere Minuten. Wer auf 50 Metern nicht 50, sondern 35 Sicherungen legt, ist vermutlich fast doppelt so schnell und oft genauso sicher oben.
Man kann es damit natürlich auch übertreiben. Wer ganz oben in der Leiter steht und dann ganz ausgestreckt eine Sicherung legen muss, ist meist in einer recht anstrengenden Position und hat schlechte Sicht auf das Placement. Dadurch können Fehler passieren, die Zeit kosten. Man legt zum Beispiel die Sicherung, steigt rein – sie hält erstmal – und sieht dann erst, dass zwei Klemmbacken komplett offen sind und die anderen zwei im Moos stecken. Wenn man gut gesichert und frisch ist, ignoriert man das, steigt so weit es geht nach oben und hofft, die nächste Sicherung unterzubringen, bevor das Moos den Geist aufgibt. Wenn man nicht gut gesichert oder ängstlich und müde ist, steigt man eher erstmal nicht weiter, sondern probiert – vielleicht sogar unter dem schlechten Placement! – ein besseres zu finden. Unterm aktuellen Placement rumzuwursteln ist in etwa so, wie wenn man mit kurzen Hosen wandern geht und dann die Wollsocken doch bis über die Knie nach oben zu ziehen versucht.
Als finaler Techniktipp sei noch erwähnt, dass man auf das Freiklettern nicht ganz vergisst. Nicht im Sinne, dass man, sobald man einen Zug freiklettern kann, aus den Leitern steigt, sondern dass man sich mit Händen und Füßen auch am Fels halten darf, um leichter in der Steigleiter nach oben zu kommen oder stabiler drinzustehen.
28
 Bei der Erstbegehung von „The Door“ am Belly Tower, Baffin Island.
Foto: Hansjörg Auer
Bei der Erstbegehung von „The Door“ am Belly Tower, Baffin Island.
Foto: Hansjörg Auer
Material World
Wie eingangs erwähnt, ist die Gear List ein guter Hinweis auf die Schwierigkeiten einer Tour. Anders als beim klassischen Alpinklettern in den Alpen sollte die Materialempfehlung bei einer technischen Bigwall-Tour sehr genau und gewissenhaft studiert werden. Schauen wir uns die einzelnen Materialgegenstände sowie deren Verwendung genau an: Ein Standard-A4-Rack im Yosemite könnte in etwa so aussehen:
1 Expressschlingen
Möglichst leichte Ausführungen. Für jeden Copperhead, Stopper, Haken und Rivet braucht man eine Expressschlinge. 25–30 Stück sind durchaus nicht übertrieben. 2–3 Expressen sollten mit Bandfalldämpfer (Screamer) ausgestattet sein.
2 Rivet Hanger
Rivets sind Bohrhaken ohne Lasche, meist einfache Schrauben, die in ein Bohrloch von kleinerem Durchmesser (6–8 mm) geschlagen werden. Die Rivet Hanger werden über den Schraubenkopf gelegt, ziehen sich zu und dienen so als Laschenersatz.
3 Camelots und Friends
Camelots und Friends in allen notwendigen Größen: „Totem Cams“ sind in Pin Scars (Haken-Schlaglöcher) den anderen Modellen überlegen, weil sie bei asymmetrischen Placements besser halten. Wer genug Offset Cams hat, hat aber eh wenig Sorgen (siehe unten).
4 Offset Camelots
Offset Camelots kombinieren zwei Größen (z. B. ein Backenpaar 0.3, das andere 0.2 oder 0.4) und passen so viel besser in nicht parallele Risse. Je mehr man davon hat, desto besser. Nachteil der Offset Cams ist, dass sie sehr teuer sind.
5 Offset Stopper
Offset Stopper sind asymmetrische Klemmkeile und eine gute Ergänzung zu den Offset Cams, auch in monetärer Hinsicht.
6 Klassische Klemmkeile
Klassische Klemmkeile sind gegenüber der Offset-Variante bei technischen Granit-Touren meist im Nachteil, weshalb man auf sie gänzlich verzichtet oder nur einen kleinen Satz mitnimmt.
7 Cam Hooks
Spezialhaken, die man quer in dünne Risse legt und die auf Belastung nach unten verklemmen. Dienen nur zur Fortbewegung.
8 Hammer
Ein solider Holzhammer mit Karabinerloch in der Nase. Am Stielende sollte eine Reepschnur oder einfaches Schlingenmaterial befestigt werden, das man dann wiederum an eine 60erBandschlinge knotet, die man um die Schulter hängt. Am Gurt wird der Hammer mittels Holster vestaut.
9
Bird Peaks/Beaks (Pecker, Tomahawks)
Sehr einfach anzubringende Haken, die manchmal sogar mit der Hand gelegt werden können und somit den Fels schonen. Gibt es in den USA von Moses auch in gebogenen Varianten für Verschneidungen (https://mosesclimbing.us/home/tomahawks/).
10 Hakensortiment
Je härter der Fels, desto härter der Haken! Im harten Granit des Valleys verwenden wir nur Hartstahlhaken. Eine gute Auswahl folgender Varianten ist für technische Routen sinnvoll: Knifeblades/Messerhaken: Heute werden meist Beaks anstelle von Messerhaken verwendet – für sehr dünne Risse.
Lost Arrows: Sie bieten in Rissen, die für Beaks zu breit sind, oft gute Placements.
Angles: Profilhaken/Spreizhaken, die vor allem bei nach außen größer werdenden Rissen sehr sinnvoll sind. Oft funktionieren auch Offset Cams oder Nuts.
Sawed Angles: Abgesägte Spreizhaken, gut für Löcher und Pin Scars. Sie sind ebenfalls häufig durch Offset Cams oder Nuts ersetzbar.
Z-tons: Z-förmige Angles, im Granit nicht so üblich, nur in sehr großen Pin Scars brauchbar. Rurps (Realized Ultimate Reality Piton): Werden nur noch selten verwendet. Kleine Beaks funktionieren fast immer besser.
11 Hooks
Zum Einhängen an horizontalen Leisten. Ideal sind zwei in jeder Größe und ein Dreizack für Bohrlöcher („bathooks“).
12 Copperheads
Aluminium in großen Größen und Kupfer in kleinen Größen. Das weiche Metall wird in seichte Risse und Strukturen geschlagen.
13 Meißel
Braucht man für die kleineren Copperheads, evtl. auch Bürste zum Reinigen von kleinen Rissen.
14 Funkness Device
Damit die Haken beim Herausschlagen nicht herunterfallen. Ein Ende hängt man in den Hammer, das andere in den Haken, den man aushämmern möchte.
15 Bolt Kit
Vor allem ein Handbohrer gehört bei wenig begangenen Routen ins Gepäck. Schuppen und Blöcke brechen immer wieder aus. Wenn dahinter kein Riss ist und man sich nicht mittels Zeltstange einen Rivet oder Head angeln kann, kann es sein, dass man ohne Bohrer nicht weiterkommt. Bohrhaken oder Rivets braucht man seltener, da man die geschlagenen Löcher hooken kann. 2–3 Stück Spreizanker (8 mm ohne Lasche) und einen Schraubenschlüssel mitzunehmen ist kein Fehler.
16 Gearsling
Das ganze Material muss natürlich auch verstaut werden. Eine große doppelte Gearsling für den Vorsteiger und eine einfache für eine schnellere Übergabe am Stand für den Nachsteiger.
30
Hooks: Bathook/Talon, Cliffhanger, Grappling (von links nach rechts) Copperheads
Thomas Wanner arbeitet beim ÖAV in der Abteilu ng Bergsport. Auf mehreren Yosemite-Reisen l ernte er das Tal sowie das Bigwallen lieben.

Funkness Device
Handbohrer Gearsling







Technisches Klettern ist eine Materialschlacht, weshalb man sich bei der Auswahl der Ausrüstung Zeit lassen und die zahlreichen Online-Reviews ausführlich studieren sollte. Marken, von denen man gehört haben sollte und die erstklassiges Material herstellen:
y Moses Climbing https://mosesclimbing.us (v.a. Heads, Beaks, Hooks, Rivet Hangers) und Yates Climbing Gear http://www.yatestactical.com (Steigleitern, Big Wall Gurt, Gear Slings,Screamer).







y D4 https://d4portaledge.com oder Grade7 https://www.grade7.com/
y Die besten Hartstahlhaken und Bigwall-Hammer produziert Black Diamond. Andere renommierte Kletterfirmen wie Metolius, Petzl, Edelrid oder Cassin haben ebenfalls eine gut sortierte Auswahl an Bigwall Gear.
Petzl und Edelrid können vor allem mit ihrem Know-how aus der Arbeitssicherheit punkten und bieten erstklassige Jumars, Seilrollen und Klemmen an.

31
Rivet Hanger
Cam Hook Hammer
Black Diamond Pecker in drei Größen
Moses Tomahawks Knifeblades/ Messerhaken Lost Arrows
Angle/ V-Profilhaken
Z-ton Rurp Piton
| unsicherheit
Ernsthafte Bigwall-Aspiranten merken schnell, dass man um einen bequemen Bigwall-Gurt und eine doppelte Gearsling nicht herumkommt. Bei der Organisation des Materials am Gurt ist es empfehlenswert, größere Gegenstände hinten und kleinere, leichtere Dinge vorne an der Gearsling zu befestigen. Kleine, eher schwere Dinge werden am besten am Hüftgurt fixiert. Weiters ist es sehr praktikabel und schlau, nicht alle Haken eines Typs in den gleichen Karabiner zu hängen. Es empfiehlt sich, mehrere Schnappkarabiner mit vier bis fünf verschiedenen Haken zu bestücken. Sollte mal einer runterfallen, ist man dann nicht alle Haken eines Typs auf einmal los. Damit sich die kleinen Hooks und Beaks nicht dauernd verhaken, kann man sie angehängt in einem Sack (z. B. Chalkbag) transportieren.
Weil am Gurt nicht unendlich Platz ist, klippt man eine Exe in die Materialschlaufe und dann vier Exen an den oberen Karabiner dieser Exe. Das Gleiche kann man mit Cams machen. Das spart Platz am Gurt und es geht schneller, das Zeug an den Partner weiterzureichen.
Anbringen von Sicherungen
Bezüglich der Frage, wie man die Sicherungen legt, kann kein Text Übung und gesunden Menschenverstand ersetzen. Trotzdem ein paar Tipps, die beim ersten Mal hilfreich sind:
y Copperheads. Bevor man einen Head ins Placement schlägt, muss er aufgewärmt werden. Sonst ist das Metall zu hart, und bevor der Head passt, ist das Placement kaputt. Dazu legt man den Head an den Fels, und dreht ihn langsam um die eigene Achse während man mit dem Hammer mit Gefühl draufschlägt. Nach kurzer Zeit ist er spürbar warm. Gute Placements sind solche, in die mit viel Fantasie auch ein Klemmkeil passen könnte (es aber eben nicht tut). Dann Head reinlegen (im Zweifel eher die kleinere Größe) und mit Hammer und Meißel einschlagen. Ziel ist es, nicht zum Draht durchzuschlagen und dabei das Metall des Heads auf möglichst viel Felsfläche zu verteilen.
y Fixe Copperheads sind mal mehr, mal weniger solide und oft schwer zu beurteilen. Wenn man gut gesichert ist und die nächste gute Sicherung in Reichweite ist, empfiehlt es sich, sie weder zu testen noch als Sicherung einzuhängen, weil ein Wiederanbringen oft schwierig oder gar unmöglich ist. Wenn nur das Kabel ausreißt, so ist das noch ungünstiger, weil man den Kopf unter Umständen gar nicht rausbekommt. Die beste Variante ist in diesem Fall, einen kleinen Beak hinter den Copperhead zu schlagen. y Haken. Die Hartstahlhaken sollten von Hand relativ weit in den Riss passen, bevor man mit dem Hammer rangeht (ca. zu ⅔). Dann die Ohren aufsperren, wenn es dumpf klingt oder sehr hoch: nicht gut. Wenn es „singt“: passt! Hier macht Übung den Meister. Vor allem in Routen, die auch frei geklettert werden, sollte man auf Haken jedenfalls verzichten und sie auch sonst sparsam einsetzen, da sie den Fels kaputt machen.
y Expanding Flakes. Das sind vermeintlich „feste“ Schuppen, die leicht auseinandergehen, wenn man einen Haken schlägt. Eine bewährte Taktik ist, gleich unten die Angles durchzudeklinieren. Das bedeutet, erst einen kleineren, dann den nächstgrößeren. Während der reingeht, fällt normalerweise der andere raus. Dann weiter, bis die Schuppe „aus-expanded“ ist. Aufpassen muss man, wenn man vor dem Ende der Schuppe wieder zum Hammer greift. Dann besteht eine gewisse Chance, dass die Sicherung, in der man gerade steht, nach unten rutscht oder rausfliegt, während man den Haken schlägt. Expanding Flakes sind mit das Interessanteste, was es im Granit an technischen Herausforderungen gibt. Wenn man in einer „Expanding Flake“ einen fixen Copperhead oder anderes fixes Material antrifft, sollte man achtgeben. Es kommt vor, dass dieses völlig lose oder kaputt ist, da die Schuppe mit schwankenden Temperaturen auf- und zugeht. Das betrifft auch das eigene Material, wenn man z. B. in der Mitte einer Seillänge abbricht, um am nächsten Tag weiterzuklettern.
y Hooks. Diese hinterlassen unter dem Placement Kratzer, die dann einen Hinweis geben, welche Größe die Vorgänger wo verwendet haben. Generell gilt, dass ein zu großer Hook besser ist als ein etwas zu kleiner. Deshalb ist es gut, mit dem größten Hook im Sortiment zu probieren, wenn man das Placement nicht sieht.
Nicht nur in selten begangenen Routen sollte man sich bewusst sein, welch fatale Folgen es haben kann, wenn eine Schuppe oder ein Block, hinter die oder den man gerade etwas gelegt oder geschlagen hat, ausbricht. Viele sehr schwierige Längen sind vor allem sehr brüchig. Beim technisch Klettern ist „weich greifen“ oft nicht so leicht möglich wie beim Freiklettern.
Schlussbemerkung
Am Ende lohnt ein weiterer Blick auf die zwei Schwierigkeitsskalen. A1–A5 klingt objektiv, F1–F4 tut gar nicht erst so, als wäre die Schwierigkeit unabhängig vom Kletterer. Jemand meinte mal, dass er seine Längen nach der Zeit bewertet, die er benötigt hat: 1 h = A1, 2 h = A2 etc. Von einem anderen, wohl eher furchtlosen Kletterer, stammt das Bonmot „It’s all A1 until you fall“. Das alles sagt viel darüber aus, worum es beim technischen Klettern letztendlich geht: sich nicht unnötig in die Hose zu machen. Vor allem in mittelschweren, steilen Längen hilft der Zugang eines Sportkletterers, der drei Meter über dem Haken nicht nervös wird, weil er weiß, dass ein Sturz kein Problem ist. Und wo soll man jetzt so richtig anfangen, wenn man die Hallensessions und einen ersten cleanen Riss hinter sich hat? Erfahrungsgemäß ist es eher frustrierend, in Routen rumzubasteln, die man selbst auch freiklettern könnte. In kurzen Routen zu üben hat den großen Nachteil, dass man sich ständig in Bodennähe befindet. Wer die Abläufe hinter sich hat, sollte sich deshalb eine „echte“ technische Route suchen und sich an dieser versuchen. Ein paar Vorschläge haben wir am Ende des Artikels zusammengetragen. Wer sich vorher noch mehr detailliertes Wissen aneignen möchte, sollte unbedingt auf www.vdiffclimbing.com reinschauen. Dort finden sich zu allen angesprochenen Themen weitere Tipps und Beispiele aus der Praxis. ■
Gurt-Management
32
Routenempfehlungen
Die großen leichten Klassiker befinden sich fast alle in den USA, besonders im Zion National Park und im Yosemite Valley. Etwas näher an den Alpen bieten sich ein paar Routen in Arco, im Tessin, im Val di Mello oder im Valle dell’Orco an, wobei man sich dort eher an die häufig begangenen Routen halten sollte, um böse Überraschungen zu vermeiden. Auch im Verdon finden sich einige technische Leckerbissen.
Als gute Einsteigertour im Yosemite gilt die „West Face“ am Leaning Tower. In den ersten Längen wiederholt man die Lektionen aus der Kletterhalle, danach folgt steiles, leichtes Gelände in toller Position: eine perfekte Einsteigerroute durch eine tolle Wand. Besonders empfehlenswert im unteren Schwierigkeitssegment am El Capitan ist die „Zodiac“, eine der wenigen durchwegs gut absicherbaren Techno-Routen, die von oben bis unten sehr interessant ist (im Gegensatz dazu bietet der Nachbar „Tangerine Trip“ viele Meter der Sorte leicht und fad). Hat man erstmal Blut geleckt, ergeben sich die nächsten Ziele von selbst.
Literaturempfehlungen
y Andy Kirkpatrick (2018): Higher Education.
A Big Wall Manual.
y Fabio Elli & Peter Zabrok (2019): Hooking Up.
The ultimate Bigwall and Aid Climbing Manual.

y Chris McNamara (2012): How to Big Wall Climb.
Der Luxemburger Ben Lepesant studierte einst in Innsbruck Physik un d war in der Szene als Bigwaller der ersten Stunde bekannt.
Er verbrachte jeden Urlaub in großen W änden, unter anderen auch mit dem viel zu früh verstorbenen Hansjörg Auer.

33
Jorg Verhoeven im „Cyclops Eye“ in der Route „El Niño“ am El Capitan.
| unsicherheit
Foto: Ben Lepesant
Lawinengefahr Mensch
In der letzten Ausgabe wurde im Artikel „Sind Skitourengeher*innen tatsächlich anfälliger für Entscheidungsfallen“ das Konzept der FACETS von Ian McCammon angesprochen. In dieser Ausgabe schauen wir uns die FACETS und was sich seither getan hat etwas genauer an. Über kognitive Kosten, Strategic Mindsets und andere menschengemachte „Lawinenprobleme“.
Von Lea Hartl
Faktor Mensch: Dieser Beitrag von Lea Hartl und der nachfolgende
Artikel der DAV-Sicherheitsforschung


stehen in Verbindung mit der Skitourenstudie des DAV (2020 bis 2022) und beschäftigen sich mit menschlichen Entscheidungen am Berg.
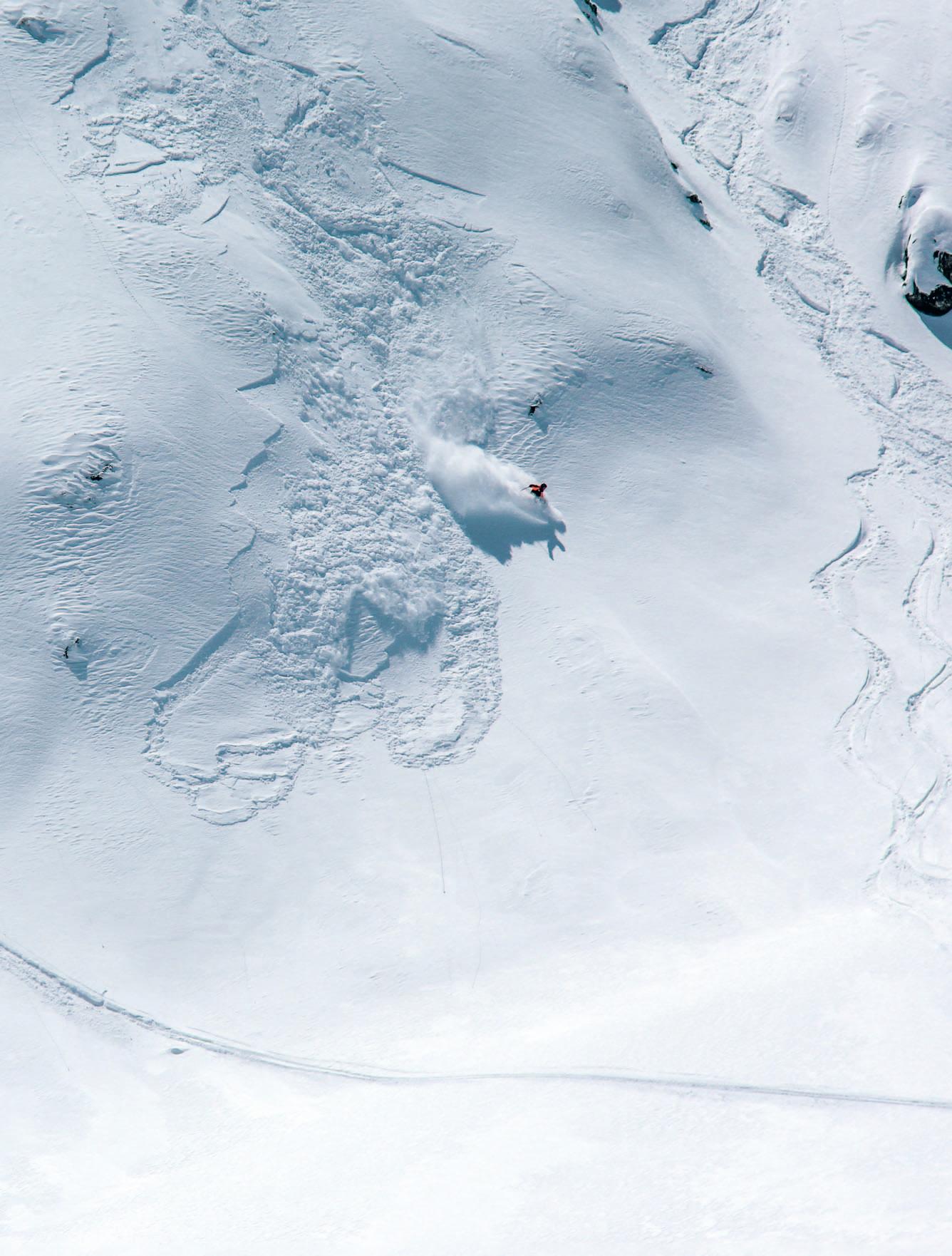
34 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Foto: Lawinenwarndienst Tirol
Die üblichen Zutaten für eine Lawine sind Schnee, Wetter und Gelände. Mit prognostizierten Gefahrenstufen und Lawinenproblemen, dem Wetterbericht und topographischen Karten haben wir viele Tools, um die Gefahren, die sich aus diesen Basiszutaten ergeben, genauer zu benennen. So können wir gezielt auf die aktuelle Situation reagieren, ohne pauschal jedem schneebedeckten Berg aus dem Weg gehen zu müssen. Verschiedene Entscheidungshilfen und -strategien helfen uns dabei. Die Detailschärfe, mit der wir uns über die Lawinenzutat „Mensch“ unterhalten, kann nach wie vor nicht mit jener in der Schnee- oder Wetterkunde mithalten, aber zunehmend werden auch in diesem Bereich Gefahren genauer benannt, erklärt und verstanden. Wie bei der Schneedecke bringt ein besseres Verständnis der Probleme durch den Faktor Mensch neue und gezieltere Ansätze, damit umzugehen.
Ian McCammons FACETS – Lawinenprobleme im Kopf
Aufbauend umgewandelte Kristalle, wie wir sie in heimtückischen Schwachschichten finden, heißen auf Englisch facets. FACETS als Akronym ist in den letzten knapp 20 Jahren auch zu einer Art Synonym für den „Faktor Mensch“ geworden – für das nicht immer ganz fassbare, mitunter ebenfalls heimtückische Menscheln, das uns hin und wieder riskante Entscheidungen treffen lässt, obwohl wir es eigentlich besser wüssten.
Ian McCammon, der die FACETS(1) formuliert hat, beginnt seinen Artikel „Heuristic Traps in Recreational Avalanche Accidents“(2) mit einer persönlichen Anekdote über seinen Bekannten Steve: Steve war ein erfahrener und gut ausgebildeter Skitourengeher. Bei Lawinenwarnstufe „groß“ war er mit ähnlich kompetenten Kollegen in bekanntem Gelände unterwegs. Bei einer Querung geriet die Gruppe in eine Lawine, Steve wurde verschüttet und starb. Im Nachhinein schien die Gefahr offensichtlich. Schnell gab es Kritik: Steve und seine Gruppe hätten eindeutige Gefahrenzeichen ignoriert und sich bewusst entschieden, ein hohes Risiko einzugehen. Anders könne man ihre Entscheidungen nicht erklären.
Wenige Wochen vor dem Unfall hatte Steve dem FACETS-Autor McCammon noch erklärt, dass es für ihn am Berg mittlerweile vor allem darum ging, die Natur zu genießen. Die Sturm-und-Drang-Zeiten lagen hinter ihm, seine Familie und die kleine Tochter waren nun viel wichtiger. Es passt also nicht zu Steves Lebenssituation, dass er sich mutwillig in Gefahr begeben oder bewusst Grenzen ausloten wollte. Viel wahrscheinlicher ist, dass er den Hang anspurte, weil er – warum auch immer – annahm, die Querung wäre sicher.
„Erfahrener Einheimischer von Lawine überrascht“
Steve ist kein Einzelfall. In der Regel haben wir am Berg den Eindruck, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, sonst würden wir uns ja nicht so entscheiden. Wenn es, scheinbar wider besseres Wissen, danebengeht, liegt das oft an der Art und Weise, wie wir entscheiden. In komplexen Situationen, in denen wir über unvollständige Information verfügen (bspw. Skitour bei ungünstiger Lawinensituation), halten wir uns bei Entscheidungen häufig an angewöhnte Regeln, die schon oft funktioniert haben und die wir, besonders im Eifer des Gefechts, nicht hinterfragen. In der Psychologie nennt man diese Art von vereinfachender mentaler Problemlösung Heuristik. Heuristische Vorgehensweisen stehen dabei im Gegensatz zu Algorithmen, die Lösungen garantieren, ohne auf subjektive Erfahrungswerte oder andere gedankliche „Daumenregeln“ zurückzugreifen. Heuristiken können sehr nützlich sein und führen oft schneller zu einem Ergebnis, sie sind aber auch anfälliger für Fehleinschätzungen. Ian McCammon hat mit den FACETS einige spezielle Heuristiken genauer definiert, die häufig am Berg zum Einsatz kommen und gefährlich werden können.
Steve war den Hang, in dem er umkam, schon zigmal gequert, die Route ist beliebt und wird auch von anderen viel begangen. Er fiel wohl der Familiarity-Heuristik zum Opfer, dem Hausbergproblem. Das ist der erste Buchstabe des Akronyms FACETS. In der folgenden Box werden Ian McCammons Abkürzungen erklärt.
Im Editorial der bergundsteigen-Ausgabe #117 erzählt der Chefredakteur Gebi Bendler von einer Skitour, bei der sich alle etwas unwohl gefühlt haben, aber keiner etwas gesagt hat. Social Facilitation? Vielleicht auch Acceptance oder Commitment, ein bisschen Expert Halo? Vermutlich können wir alle einige Gelegenheiten im persönlichen Tourenbuch identifizieren, bei denen wir in eine oder mehrere der FACETS-Fallen getappt sind. Die FACETS sind, wenn man so will, vergleichbar mit den Lawinenproblemen der Lawinenwarndienste. Sie beschreiben zusammenfassend bestimmte Muster, die immer wieder auftreten und zum Unfallgeschehen beitragen, sei es in der Schneedecke oder im Kopf. Die zugrundeliegenden Prozesse werden in der Beschreibung angedeutet und definieren einen gewissen Gefahrenkontext (etwa: Altschnee vs. Nassschnee; Familiarity vs. Expert Halo), liefern aber für sich genommen noch keine Handlungsempfehlung und stellen auch keine grundlegend neue Entdeckung dar.
Die Stärke der FACETS liegt darin, dass sich jede*r auf die ein oder andere Weise darin wiederfinden kann und intuitiv die Problematik
Wenn sie nicht gerade beim Skifahren ist, arbeitet Lea Hartl, PhD am Institut für Interdiszip linäre Gebirgsforschung in Innsbruck als Glaziologin/M eteorologin. Kein Wunder also, da ss sie sich für Schnee und Lawinen interessiert.

35
| unsicherheit
Oida, geil… da is ja no a Line zum Abstaub‘n!
Das T in FACETS steht für Tracks: Andere fahren hier auch, es sind schon Spuren im Hang.
Die FACETS (Akronym für Familiarity, Acceptance, Commitment, Experts, Tracks, Scarcity/Social Facilitation)
y Familiarity – das Hausbergproblem. Ich war hier schon oft, hier ist noch nie etwas passiert, also wird auch nie etwas passieren. McCammon stellt fest, dass vor allem erfahrene Personen in diese Falle tappen, quasi per Definition. Wer das Gelände so gut kennt, dass sich dieser Effekt einstellt, ist kein Anfänger mehr, sondern der klassische „erfahrene Einheimische“.
y Acceptance. Die anderen wollen den Hang fahren, ich möchte von der Gruppe akzeptiert werden.
y Consistency (alternativ: Commitment). Falle der versunkenen Kosten. Wir haben diese Tour geplant, also ziehen wir sie jetzt durch; wir haben uns für diesen Gipfel entschieden und schon viel Zeit für den Zustieg investiert, also drehen wir nicht kurz vor dem Ziel um.
y Expert Halo. Jemand in der Gruppe kennt sich (vermeintlich) besser aus oder ist besonders selbstsicher. Der/die wird schon wissen, was er/sie tut, meine Bedenken sind unbegründet.
y Tracks. Andere fahren hier auch, es sind schon Spuren im Hang.
y Scarcity. Ich habe nur heute frei und will den Tag richtig ausnutzen; ich will vor allen anderen da reinfahren; es hat lange nicht geschneit und jetzt gibt es endlich Powder …
Als alternatives S gilt Social Facilitation: In der Gruppe verhalten wir uns anders als allein. Besonders Expert*innengruppen sind hier anfällig. Mit gleich fitten, gleich erfahrenen Kolleg*innen pusht man sich gegenseitig eher, als dass man einander bremst.
36
versteht. Das Ziel ist Selbsterkenntnis bzw. ein verbessertes Problembewusstsein. Wir können das unerwünschte Verhalten nur abstellen, wenn wir merken, dass wir uns entsprechend verhalten, und wissen, worauf wir achten müssen. Je besser ich mich selbst kenne, desto besser kann ich einschätzen, für welche der FACETS ich besonders anfällig bin.
McCammon’s Fazit lautet: Es muss die Aufgabe von Ausbildungsprogrammen sein, Methoden zu entwickeln und zu lehren, die Anwender*innen eine Alternative zur heuristischen Entscheidungsfindung (siehe Definition nach McCammon oben) bieten. Denn so erstrebenswert Selbsterkenntnis auch ist, bei der konkreten Tourenplanung und dem täglichen, praktischen Risikomanagement kommen wir damit noch nicht allzu weit.
Problemverständnis schärfen: kognitive Kosten
Einige der FACETS beschreiben im Wintersportkontext Gruppendruckphänomene, die wir schon aus der Volksschule kennen: Wenn meine Freunde aus dem Fenster springen, springe ich hinterher. Später dann: Vielleicht kann ich die Älteren, Cooleren beeindrucken, wenn ich auch rauche oder Alkohol trinke. In der Lawinenausbildung wird uns eingeschärft: Nicht blind der Gruppe hinterherfahren!
Um Spuren zu folgen, brauche ich aber keine Gruppe, und auch die Familiarity-Falle fällt nicht in diese sozialen Muster. Gerade am Hausberg sind wir öfter einmal allein unterwegs, weil wir uns dort sicher fühlen. Wir tappen also einerseits „wegen der anderen“, beziehungsweise unserer Beziehung zu „den anderen“, immer wieder in gewisse mentale Fallen, andererseits aber auch, weil wir ganz von allein zu gewissen unbewussten Denkmustern neigen. Hier lässt sich die empirische Ebene in etwa zusammenfassen als: „Je erschöpfter wir sind, desto lieber nehmen wir Abkürzungen“. Und zwar tatsächliche Abkürzungen im Gelände sowie auch mentale Abkürzungen bei der Entscheidungsfindung.
Konkretisiert wird diese Thematik in der kognitiven Systemforschung. Laura Maguire etwa hat mit ihren Studien(3, 4) in den letzten Jahren vor allem im englischsprachigen Raum die Diskussionen zum Faktor Mensch maßgeblich beeinflusst. Sie befasst sich mit dem Verhalten und den Entscheidungen von Expert*innen in von Unsicherheit geprägten Situationen, konkret am Beispiel von Lawinenprognostiker*innen in Kanada. Die Fragen „Warum ist das schwierig?“ bzw. „Was macht das so schwierig?“ bilden einen übergeordneten Rahmen für ihre Untersuchungen. Über diese Fragen lässt sich,
so Maguire, Expert*innentum definieren: Mit welchen Herausforderungen müssen Anwender*innen in einem bestimmten Fachgebiet umgehen, wenn simple, regelbasierte Handlungsvorlagen auf Grund der Komplexität einer Situation nicht mehr greifen? Und wie machen sie das unter Zeitdruck?
Bei der Lawinenwarnung und generell der Einschätzung der Lawinengefahr besteht die kognitive Schwierigkeit in erster Linie darin, dass sehr vielfältige Informationen aus verschiedenen Quellen nach Wichtigkeit gefiltert werden müssen. Neben den entscheidenden Informationen, die auf eine veränderte, kritische Situation hinweisen, gibt es viel Hintergrundrauschen. Noch dazu ändern sich die Bedingungen und die Informationslage ständig. Zusätzlich gibt es je nach Anwendungsgebiet weitere Anforderungen, die ebenfalls Aufmerksamkeit und mentale Arbeit erfordern: Skigebietsbetreiber müssen Pisten sichern und möglichst pünktlich aufsperren. Bergführer*innen müssen neben der Lawinensituation auch die Befindlichkeiten der Gäste im Kopf haben.
Expert*innen beherrschen ihr Handwerk so gut, dass diese Herausforderungen von außen kaum zu erkennen sind. Dennoch wird viel kognitive Arbeit geleistet. Im oft durch körperliche Höchstleistungen geprägten Bergsport stehen diese kognitiven Leistungen und die erforderliche mentale Arbeit im Hintergrund. Maguire betont: Risikoeinschätzungen und entsprechende Entscheidungen am Berg sind kognitiv anspruchsvoll und somit anstrengend, auch wenn man es nicht sieht. Kognitive Anstrengung hat kognitive Kosten. Wie der Körper ermüdet auch der Geist. Und wer müde ist, macht Fehler.
Kognitive Systeme und Verhaltenstheorie erklären die den FACETS zugrunde liegenden Prozesse. Um die nicht ganz stimmige Analogie fortzusetzen: Sie sind quasi die Schneephysik hinter den Lawinenproblemen.
Lösungsansätze: strategische Selbsterkenntnis
Der Diskurs über kognitive Kosten, die bei Entscheidungen am Berg anfallen, sowie über Strategien, diesem Problem zu begegnen, ist in Nordamerika spätestens mit den Arbeiten von Maguire und Reaktionen darauf im Mainstream des Lawinenrisikomanagements angekommen. The Avalanche Review (TAR), das Magazin der American Avalanche Association, gibt dem vielschichtigen Thema regelmäßig Raum. Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Bereichen teilen gleichermaßen Erfahrungen und Tipps. Russ Costa, Professor für Neurowissenschaften und Skitourengeher aus
37 | unsicherheit
Utah, empfiehlt beispielsweise in einer „Decision Making“-Ausgabe von TAR das Abarbeiten bestimmter Checklisten, um zu verhindern, dass man im falschen Moment die kognitiv einfache Lösung wählt(5). Auf dem Checklisten-Prinzip beruht auch die Merkhilfe SOCIAL, die von SLF-Forscher Benjamin Zweifel entwickelt wurde und Themen wie Gruppenzusammensetzung und Kommunikationstechniken anschneidet. SOCIAL ist über die SLF-Homepage im Scheckkartenformat verfügbar, inklusive Zusatzinformationen und Kontrollfragen als Anregung zur „Selbstüberprüfung“.
Wer im Archiv von TAR (oder in ISSW-Publikationen oder den Studien von Benjamin Zweifel) blättert, findet viele weitere Überlegungen, die spezielle Aspekte der Thematik näher beleuchten. Die Grundidee ist stets: Wie verhindere ich gedankliches Abgleiten zu bequemen Lösungen, die zu einfach sind, um der komplexen Situation am Berg gerecht zu werden? Und woran kann ich mich stattdessen orientieren? Letzteres wird in Nordamerika zunehmend mit einer Methode beantwortet, die 2014 bei der ISSW vorgestellt wurde: Die Strategic Mindsets (Tabelle 1) von Heliski-Guide Roger Atkins(6) bieten einen Risikomanagementrahmen, in dem der Faktor Mensch gezielt integriert wird.
Die Basis für die Strategic Mindsets stellen stark kondensierte verhaltenstheoretische Konzepte dar:
1) Es gibt zwei verschiedene Arten des Denkens und Entscheidens. Einerseits den reflektierten, bewussten, rationalen Denkprozess, der sich an klare Regeln hält und logisch und emotionslos Für und Wider abwägt. Andererseits den unbewussten, „automatischen“, intuitiven Prozess, der es uns ermöglicht, auch in Situationen großer Unsicherheit schnell und anpassungsfähig zu entscheiden.
Beide können gleichzeitig zum Einsatz kommen. Entscheidungen, die wir für völlig rational halten, sind es in Wahrheit nicht immer. Nützliche Automatismen bzw. eine verlässliche Intuition zu entwickeln, braucht Zeit. Für Expert*innen ist die durch jahrelange Erfahrung entwickelte Intuition eine wichtige Stütze bei den kognitiv schwierigen Aufgaben der Entscheidungsfindung am Berg. Für Einsteiger*innen ist mitunter eher das Gegenteil der Fall, da die Intuition noch nicht durch ausreichend Erfahrung geschult wurde.
Mit „Mindset“ meint Atkins die gedankliche Einstellung, mit der wir an einen Tag am Berg herangehen. Sie ist einerseits durch charakterliche Eigenschaften vorgegeben, andererseits durch die Erwartungen und Wünsche, die wir an den bevorstehenden Tag haben. Diese mentale, meist unbewusste Haltung legt den Grundstein für den
intuitiven, automatisierten Teil unseres Denkens: Wir haben eine bestimmte Wahrnehmung der Schnee- und Wettersituation und des Geländes und eine Vorstellung davon, was wir heute machen wollen. Unser intuitives Denken möchte unsere Wünsche erfüllen und steuert Entscheidungen in Richtung der Wunscherfüllung: Wenn ich diesen Hang fahren will, konzentriere ich mich unbewusst auf die Argumente, die dafür sprechen.
2) Die Nudge-Theorie beschreibt in der Verhaltensökonomie eine Methode, menschliche Entscheidungen zu beeinflussen, ohne fixe Regeln oder Verbote aufzustellen. Einfache „Nudges“ (etwa: Anstupser) im Alltag sind Süßigkeiten, die an der Supermarktkasse auf Kinderaugenhöhe platziert sind, über die Lüftungsanlage verteilter Backwarengeruch im Einkaufszentrum, der zum Bäcker lockt, abschreckende Bilder auf Zigarettenschachteln usw. Auch am Berg lassen wir uns unbewusst von Nudges beeinflussen: Das Wetter ist besser oder schlechter als gedacht, die Kolleg*innen sind zögerlich oder hochmotiviert, der Schnee fährt sich nicht so gut wie erhofft …
Je nachdem, mit welcher Grundhaltung wir in den Tag gestartet sind, können solche Nudges unser Verhalten mehr oder weniger stark beeinflussen oder auch den rationalen Denkprozess anspringen lassen. Wenn ich mit der Einstellung aufstehe, dass ich heute tollen Powder in super Gelände fahren will, weil endlich das Wetter passt, lasse ich mich durch eine motivierte Gruppe erst recht ermutigen und ignoriere den auflebenden Wind und frischen Triebschnee. Wenn ich mir allerdings schon in der Früh unsicher bin, ob das heute nicht etwas kritisch ist, reagiere ich sensibler auf den Wind und andere Nudges.
Angst und Begehren
Eingebettet in das Mindset, die mentale Grundhaltung zum Tag, sind die Dinge, nach denen wir streben, und die, die wir vermeiden wollen. Staubender Tiefschnee in steilen Hängen steht als Begehrlichkeit der Angst vor dem Lawinentod gegenüber. Unsere Entscheidungen sind dabei durch das geprägt, was wir erreichen wollen: Ich möchte tiefen Powder in möglichst steilem Gelände fahren, also suche ich mir – mehr oder weniger bewusst – immer einen Hang, der gerade so steil ist, dass ich ihn noch mit meiner Risikobereitschaft vereinbaren kann. Das kann zu großartigen Abfahrten und Erfolgserlebnissen führen. Es kann aber auch dazu führen, dass ich durch den grundlegenden „Steep and Deep“-Wunsch bei ungünstigen Bedingungen irgendwann ein zu hohes Risiko eingehe. Im Lawinenkontext geht es vor allem darum, so zu entscheiden,
38
„Kognitive Anstrengung hat kognitive Kosten. Wie der Körper ermüdet auch der Geist. Und wer müde ist, macht Fehler.“
dass das Risiko auf ein akzeptables Maß reduziert wird. Wir reagieren damit nicht in erster Linie auf die Begehrlichkeiten, die uns überhaupt erst an den Berg bringen (steiler Powderhang), sondern auf die Angst vor den möglichen Konsequenzen (Lawine). Atkins setzt in seinen Überlegungen auf der anderen Seite der Gleichung an: Wenn wir unsere Wünsche und Erwartungen flexibel an die Bedingungen anpassen können, steuern wir auch das Mindset, also die Erwartungshaltung, und damit das Risiko.
Anwendungsorientiert zusammengefasst ergeben sich daraus die Strategic Mindsets wie in Diagramm 1 (S. 42) dargestellt. Basierend auf den Schneebedingungen wird ein grundsätzliches Mindset festgelegt, das einen Rahmen für die Gestaltung des Tages vorgibt und die Erwartungshaltung von Anfang an reguliert. Impliziert ist ebenfalls, dass aktiv und bewusst besprochen wird, warum wann welches Mindset gilt, sei es unter Heliskiing-Guide-Kolleg*innen, wie in Atkins’ Anwendungsbeispiel, oder mit der eigenen Tourengruppe. Es wird einerseits ein Handlungsrahmen vorgegeben, der je nach Situation von vornherein die Optionen begrenzt, andererseits wird durch die Bereitstellung von konkreten Begrifflichkeiten und einer Erwartungsstruktur die Kommunikation gefördert.
Das Spiel gewinnen



Neben der tabellarischen Mindset-Struktur für den Praxiseinsatz nennt Atkins grundsätzlich drei Dinge, an denen man arbeiten kann, um die intuitiven und rationalen Denkprozesse auszubalancieren, die zu unseren Entscheidungen führen.
1. Selbsterkenntnis. Je besser wir verstehen, was wir tun und warum, desto mehr Handlungsspielraum haben wir, daran etwas zu ändern.
2. Optionen schaffen. Nur wenn wir mehrere gleich attraktive Optionen haben (selection of desires), können wir:




3. Die eigenen Wunschvorstellungen und Erwartungen der Situation anpassen.
Die Crux liegt wohl in Punkt 2. Es geht nicht in erster Linie darum, konkrete Tourenziele an die Bedingungen anzupassen, da das die zugrunde liegende Motivation nicht ändert („Ich will Powder fahren, aber heute ist es kritisch, also suche ich einen nicht ganz so steilen Powderhang“).
Betrachtet man winterlichen Bergsport als Spiel, bedeutet ein Lawinenunfall, dass man verloren hat. Wir spielen aber in der Regel nicht, um nicht zu verlieren. Dieses Ziel wäre einfacher erreicht,
Angst und Begehren. Unsere Entscheidungen sind durch das geprägt, was wir erreichen wollen: Ich möchte tiefen Powder in möglichst steilem Gelände fahren, also suche ich mir – mehr oder weniger bewusst – immer einen Hang, der gerade so steil ist, dass ich ihn noch mit meiner Risikobereitschaft vereinbaren kann.

39 | unsicherheit
Powder!!
Das A in FACETS steht für Acceptance – soziale Akzeptanz: Die anderen wollen den Hang fahren, ich möchte von der Gruppe akzeptiert werden.
wenn man schlicht nicht spielt. Wir spielen, um zu gewinnen. Wir wollen das Gipfelerlebnis, den Powderhang, die Couloirbefahrung. Um eine echte Auswahl möglicher Gewinnsituationen, eine „selection of desires“ zu haben, muss man in der Lage sein, die angestrebten Glücksgefühle auch jenseits des Adrenalinrausches zu erleben. Damit die flache Almwiesentour, das Naturerlebnis einer Rodelbahn, ein Pistentourenworkout … echte Alternativen darstellen, müssen sie nicht nur den rationalen, sondern auch den emotionalen Teil des Denkprozesses zufriedenstellen. Wir müssen auch solche Erlebnisse emotional unter „Spiel gewonnen“ verbuchen.
Atkins predigt nicht grundsätzlich Verzicht, sondern empfiehlt, von „Verzicht“ als Einstellung Abstand zu nehmen und sich stattdessen auf die Freuden der Alternativen zu konzentrieren. Wenn alles passt, soll man ruhig den steilen, pulvrigen Traumhang ansteuern und das Begehren der Perfektion zulassen. Wenn wir das Glücksgefühl des Skifahrens aber ausschließlich dort finden, bringt uns die Suche danach früher oder später wahrscheinlich um.
Die Grafik und Tabelle auf den folgenden Seiten fassen die Strategic Mindsets zusammen. Die Inhalte stammen aus der Publikation von Roger Atkins und wurden für diesen Artikel ins Deutsche übersetzt.
Illustrationen: Georg Sojer ■
Anmerkungen
Vielen Dank an Laura Maguire für die geduldige Beantwortung vieler Fragen und an Drew Hardesty (Utah Avalanche Center) für den großzügigen Austausch zu diesem Thema.
1) McCammon, Ian (2002). Evidence of heuristic traps in recreational avalanche accidents. Presented at the International Snow Science Workshop, Penticton, Canada, Sept.30-Oct.4. http://avalanche-academy.com/uploads/resources/Traps%20Reprint.pdf
2) McCammon, Ian, 2004. Heuristic Traps in Recreational Avalanche Accidents: Evidence and Implications. Avalanche News, 68. http://www.sunrockice.com/docs/Heuristic%20traps%20IM%202004.pdf
3) Maguire, Laura (2019). Human Performance in uncertain environments. The Avalanche Review 37.4
4) Maguire, L., & Percival, J. (2018). SENSEMAKING IN THE SNOW: EXAMINING THE COGNITIVE WORK OF AVALANCHE FORECASTING IN A CANADIAN SKI OPERATION. In International Snow Science Workshop, Innsbruck, Austria, 2018.
5) Costa, Russ (2021). Tired Bodies, Tired Brains. Decision Fatigue in High Risk Environments. The Avalanche Review 39.4
6) Atkins, Roger (2014). Yin, Yang, And You. In International Snow Science Workshop, Banff, 2014. https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW14_paper_O9.02.pdf

40
„Wir Tiroler lieben unsere deutschen Gäste“
ASI Guides aus Deutschland lieben auch Tiroler Gäste. Und die von irgendwo.
Werde Teil unseres weltoffenen Guideteams und übernimm Aufträge als Bergführer:in (bis € 450) oder Wanderführer:in (bis € 210).
Jetzt bewerben:
jobs@asi.at asi.at/karriere
Informationen einholen · Bild der Situation machen · Welches strategische Mindset passt zur Situation?
Sicheres Gelände Gefährliches Gelände ? ? ? ?







Erste Einschätzung Erkundungstour, um Situation zu bewerten
Radius erweitern Bewegungsradius kann in gefährlicheres Gelände ausgedehnt werden
Status quo
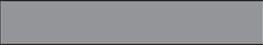
Keine Änderung der Situation, heute gleich wie gestern
Radius verkleinern Rückzug in sicheres Gelände
Verhärtete Front Altschneesituation; heimtückisch, anhaltend problematisch
Günstige Situation
Frühjahrssituation
Nachmittag
Jede Art von Gelände kann in Betracht gezogen werden
Geländewahl an Tagesgang der Lawinengefahr anpassen
Vormittag
Diagramm 1: Strategic Mindsets von Bruce Tremper und Roger Atkins
42
„Der Schnee bestimmt das Mindset, das Mindset bestimmt das Verhalten.“
Mindset
Erste Einschätzung
Typische Bedingungen
Wir haben wenige Informationen und es herrscht hohe Unsicherheit bezüglich des Schneedeckenaufbaus: zum Beispiel bei der ersten Tour in einer neuen Gegend, am Anfang der Saison oder nach einer längeren Phase ohne Beobachtungen oder nach markanten Wetterereignissen.
Radius erweitern
Die Lawinengefahr entspannt sich und/oder wir gewinnen ein klareres Bild der Situation. Das „Radius Erweitern“-Mindset umfasst eine relativ breite Spanne möglicher Situationen und Verhaltensweisen. Wenn wir nicht ganz sicher sind, ob eine positive Einschätzung der lokalen Lage auf angrenzendes Gelände erweitert werden kann, wird der Radius vorsichtig und langsam erweitert (z. B. beginnende Stabilisierung nach Neuschnee, abnehmende Bruchausbreitungstendenz bei Altschnee). Wenn wir sicher sind, dass lokale Beobachtungen auf andere Bereiche extrapoliert werden können, kann der Radius schneller erweitert werden.
Verhalten
Sanftes Gelände auswählen, wo man bei geringem Risiko mehr Informationen einholen kann, um die Gefahreneinschätzung zu verbessern.
Wird der Radius vorsichtig erweitert, ist es üblich, spezifische Informationen über das anvisierte Gelände einzuholen, wobei der Blick auf das Gelände sehr kleinräumig ist (etwa: Situation auf einer bestimmten, sicheren Tour ist bekannt und eine positive Tendenz wird wahrgenommen. Um die positive Tendenz zu überprüfen, werden in direkter Umgebung der bekannten Hänge Schneedeckenuntersuchungen in unterschiedlichen Expositionen/Höhenlagen durchgeführt). Wird der Radius schneller erweitert, extrapolieren wir positive Tendenzen auf ähnliches Gelände in einem größeren Umkreis (etwa: Wir stellen fest, dass sich West- und Nordhänge in einem bestimmten Höhenbereich in uns bekanntem Gelände stabilisiert haben und können aufgrund der Schnee- und Wettersituation davon ausgehen, dass dies in der gesamten Region der Fall ist).
Status quo
Keine wesentliche Änderung der Situation. Beobachtungen stützen die bestehende Gefahreneinschätzung und der unter den Umständen akzeptable Bewegungsradius wurde bereits ausgereizt.
Radius verkleinern
Aufgrund einer Wetteränderung verschlechtert sich die Lawinensituation, oder wir erhalten neue Informationen, durch die sich unsere bestehende Gefahreneinschätzung negativ verändert. Je nach Ausmaß der Veränderung wird der Radius stärker oder weniger stark eingeschränkt (geringe Änderung, z. B.: nach einer längeren Phase mit ruhigem Wetter kommt lebhafter Wind auf. Größere Änderung, z. B.: Wettersturz oder starke Temperaturänderung; überraschende Beobachtungen, die nicht zur bestehenden Gefahreneinschätzung passen).
Verhärtete Front (entrenchement)
Altschneeproblem. Eine „verhärtete Front“ (oder festgefahrene Situation) ist unangenehm und erfordert viel Disziplin, da Verhaltensweisen und Einschränkungen bei der Geländewahl über längere Zeit unverändert durchgehalten werden müssen. Die „verhärtete Front“ ist die letzte Stufe vor dem völligen Verzicht auf Ausflüge ins Gelände (bei Atkins: letzte Stufe vor dem Einstellen des Führungsbetriebs).
Ändere nichts und mach weiter wie bisher.
Geländewahl an die neue Informationslage anpassen (z. B.: grundlegend bekannte Situation, Wind nimmt zu: Es wird auf steile Hänge in Triebschnee-anfälliger Exposition verzichtet. Massive Wetteränderungen: großräumiger Verzicht auf gefährdetes Gelände). Bis sich die Situation grundlegend ändert, wird der Tourenradius auf eine kleine Auswahl an bekanntem Gelände beschränkt, wo die Situation genau einschätzbar und das Risiko akzeptabel ist. Es werden laufend neue Informationen gesammelt, aber das Verhalten wird erst geändert, wenn es sehr starke Hinweise auf eine positive Veränderung gibt (Beispiel Atkins: Lawine räumt einen Hang komplett aus, die kritische Schwachschicht ist somit nicht mehr da).
Günstige Situation
Die Gefahreneinschätzung legt nahe, dass Auslösungen – wenn überhaupt –nur sehr vereinzelt möglich sind und Lawinen – wenn dann – sehr klein sind. Es besteht ein hohes Maß an Vertrauen in die Gefahreneinschätzung.
Frühjahrssituation
Nassschneeproblem. Die Lawinengefahr wird weitestgehend oder ausschließlich durch den Tagesgang der Sonneneinstrahlung bestimmt.
Jegliches Gelände kann in Betracht gezogen werden. Mögliche Konsequenzen kleiner oberflächlicher Rutsche beachten!
Darauf achten, ob sich in der Nacht ein ausreichender Harschdeckel bildet und Gelände an den Tagesgang anpassen.
43 | unsicherheit
Wie gehen Skitourengruppen bei ihren Entscheidungen vor?
Die DAV-Sicherheitsforschung ging in einer Feldstudie unter anderem der Frage nach, wie Skitourengruppen zu ihren Entscheidungen kommen. In der letzten Ausgabe von bergundsteigen (#121; Brugger et al., 2022) wurden das Studiendesign, die soziodemographischen Merkmale und die Ergebnisse zu sogenannten Entscheidungsfallen, also verzerrenden Heuristiken, beschrieben. Die Studie konnte keinen Einfluss solcher Heuristiken auf die Entscheidungen der Gruppen nachweisen. Im jetzigen Beitrag geht es um die Frage, wie Skitourengruppen überhaupt zu ihren Entscheidungen kommen und ob diese mit dem empfohlenen Vorgehen nach Lehrmeinung übereinstimmen.


Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung

44 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Weitere Ergebnisse aus der Skitourenstudie der DAV-Sicherheitsforschung
Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung
Nach Lehrmeinung erfordert lawinenbezogen „gutes Skitourengehen“ eine sorgfältige Tourenplanung inklusive Identifizierung potenzieller Gefahrenstellen, die Berücksichtigung der aktuellen Schnee- und Lawinensituation, die Überprüfung der bei der Tourenplanung gewonnenen Informationen auf Tour, die Wahrnehmung und Beurteilung der Gefahrenstellen im Gelände und die Anwendung angemessener Verhaltensmaßnahmen. Halten sich Skitourengruppen an diese Empfehlungen und wie kommen sie zu ihren Entscheidungen? Nur wenn wir dies verstehen, können auch mögliche Defizite gezielt adressiert und bei neuen Methoden berücksichtigt werden.
Weiter wurde untersucht, ob sich Gruppenmuster finden lassen: z. B. „junge Wilde“, die sich riskant verhalten; oder „alte Hasen“, die sich auf ihre Erfahrung verlassen, aber aktuelle Gefahrenstellen nur unzureichend erkennen. Unterschiedliche statistische Analysen (u. a. Clusteranalysen) zeigten keine nennenswerten signifikanten Effekte zwischen Gruppenmerkmalen und dem Risikopotential einer Tour bzw. dem Erkennen von und Verhalten an Gefahrenstellen. Dies bestätigt den bei der Erhebung gewonnenen Eindruck, dass jede Gruppe bzgl. ihrer Gruppenstruktur eine sehr spezifische individuelle Einheit darstellt, die sich nicht sinnvoll nach Gruppenmustern einteilen lässt.
Zugleich hatten wir aber den Eindruck, dass zwischen den Gruppen große Ähnlichkeiten darin bestehen, wie sie sich ihre geplante Tour „zurechtlegen“. Um dies näher zu untersuchen, gingen wir folgenden Fragen nach: Berücksichtigen Skitourengruppen die Lawinensituation? Gibt es dabei typische Entscheidungsmuster? Erkennen sie Gefahrenstellen im Gelände und verhalten sie sich dann angemessen? Ergebnisse zur Tourenplanung
eWelche Merkmale haben die begangenen Skitouren?
Am Parkplatz nannten alle Gruppen eine konkrete Tour, die sie vorhatten. Obwohl auch ausgefallenere bzw. anspruchsvollere Touren möglich gewesen wären, wurden hauptsächlich Standard- und Modetouren gewählt, die häufig begangen oder befahren werden. Die wenigen Gruppen, die ihre gewählte Tour als nicht machbar einschätzten (aus Zeit-, Wetter- oder lawinenbezogenen Gründen), hatten vorab einen Umkehrpunkt festgelegt. 64 % der Gruppen gaben an, die Tour mindestens schon einmal gegangen zu sein. Die Erheber*innen baten die Gruppen u. a., die geplante Tour auf einer Karte einzuzeichnen, und schätzten die Güte ihrer mentalen Geländevorstellung der Tour ein. Hier lagen die Gruppen im Mittel bei weitgehend vollständiger Geländevorstellung (Skala von 1 = keine Vorstellung bis 4 = vollständig; M = 3.12; SD = 0.93).
45
f | unsicherheit
Welche Rolle spielt die Lawinensituation bei der Tourenauswahl?
Auch wenn vereinzelt andere Aspekte bei der Tourenwahl dominierten (siehe Abbildung 1), fanden die meisten Tourenentscheidungen unter Berücksichtigung der Lawinensituation statt: 85 % der Gruppen erwähnten spontan die Lawinensituation als Beweggrund für die Wahl ihrer Tour oder als Argument für deren heutige Machbarkeit (siehe Abbildung 1 und 2). Von den 65 % der Gruppen, die spontan auch die Lawinengefahrenstufe erwähnten, gaben 93 % diese auch korrekt an. Gefragt nach der Bedeutsamkeit verschiedener Aspekte für ihre Tourenwahl (z. B. Wetter, Schneequalität, Länge, unverspurtes Gelände) gaben die Gruppen die Lawinensituation als am relevantesten an (Skala von 1 = nicht relevant bis 4 = sehr relevant; M = 3.52; SD = 0.78).
Wie bekannt sind lawinenrelevante Informationen?
Bei der offenen Frage, welche lawinentechnischen Überlegungen für die Tourenwahl relevant waren, nannten die Gruppen bei Touren mit relevanten Gefahrenstellen neben der Lawinenwarnstufe spontan zu 56 % das oder die für die Tour vorliegende(n) Lawinenproblem(e) und die Hangsteilheit. Nicht bloß die Nennung, sondern auch die mehrheitlich korrekte Wiedergabe dieser Inhalte stach positiv hervor – weniger prägnante (aber nicht zu vernachlässigende) Aspekte wie Exposition oder Geländeform fielen demgegenüber jedoch deutlich ab. Überlegungen zu den Konsequenzen einer Lawinenauslösung an einer Gefahrenstelle (z. B. mechanische Verletzungen durch Sturz-
bahn über Felsen, zu erwartende Verschüttungstiefe) hatten die Gruppen hingegen gar nicht auf dem Radar.
Um sich über die Lawinensituation zu orientieren, war für 99 % der Gruppen der Lawinenlagebericht das Standardtool, gefolgt von analytischen Überlegungen auf der Basis der Lawinenprobleme mit 49 %. Daneben gaben 51 % an, vorhandenen Spuren zu folgen, um der Lawinengefahr zu entgehen (siehe Abbildung 3).
eErgebnisse zur lawinenbezogenen Haltung der Gruppen direkt vor Antritt der Tour
Haben die Skitourengeher die Standard-Notfallausrüstung dabei?

Die Standard-Notfallausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel und Sonde) führten 98 % aller Befragten mit; bei 92 % der Gruppen hatten alle Gruppenmitglieder diese vollständig dabei und 36 % aller Befragten trugen einen Lawinenairbag.
Wie ist die Grundhaltung der Gruppen bezüglich der Lawinengefahr?
87.5 % der Gruppen gingen am Parkplatz davon aus, dass ihre Tour entweder sicher oder wahrscheinlich machbar ist unter dem Vorbehalt, dass man Checks durchführt.
46
Abb. 1 Was hat euch bewogen, heute diese Tour zu wählen?
Sonstiges (gruppenindividuelle Aspekte) Tourenaspekte
Länge, Gemütlichkeit)
Abb. 2 Was macht die Tour für euch heute machbar?
Anmerkung zu Abb. 1 und Abb. 2: Die Reihenfolge der offenen Antworten auf die Fragen wurde in ein Kategoriensystem übertragen.
Abb. 3 Entscheidungshilfen zur Beurteilung der Lawinengefahr (n = 86)
Anmerkung Antwortwortmöglichkeiten: „kenne ich nicht“, „kenne ich, wende ich aber nicht an“, „kenne ich und wende ich an“, „das ist meine Standardmethode“.
47 | unsicherheit
Schneequalität Lawinensituation Wetter
Vertrautheit
Landschaft,
gruppengeeignet 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % 42% 40% 32% 21% 20% 15% 11%
(Einfachheit,
Anfahrt,
vorhandene Spuren,
Lawinensituation Wetter Schneequalität Tourenaspekte (Einfachheit, Länge, Gemütlichkeit) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % 26% 25% 24% Lawinenlagebericht Analyse typischer Lawinenprobleme Freunde / Bekannte befragen Checkpunkte festlegen Vorhandenen Spuren folgen Schneedeckentests SnowCard Stop or Go 3x3 Reduktionsmethode Skitourenguru oder Ähnliches Systematische Schneedeckendiagnose 0 20 40 60 80 100 % Kenne
Standardmethode 99% 1% 49% 31% 24% 43% 24% 39% 10% 51% 7% 43% 15% 22% 8% 27% 15% 15% 6% 22% 8% 17% 3% 5%
ich und wende ich an
71%
Abb. 4 Zusammenfassung der Ergebnisse
Machbare/eingespurte Touren
Standard- & Modetouren · Die Mehrheit geht bekannte · Touren
Weitgehend vollständige Geländevorstellung
Lawinensituation
85 % erwähnten spontan · die Lawinensituation als Grund für die Wahl oder Machbarkeit der Tour
65 % nannten Lawinenge- · fahrenstufe (zu 93 % korrekt –bei geteilter Stufe: 86 % korrekt)
Lawinensituation am · relevantesten
für die Tourenentscheidung
72 % befürchteten nicht · dass der Hang verspurt ist 69 % verneinten die Frage, · einen bestimmten Hang befahren zu wollen
Grundhaltung Machbarkeitsgefühl
Ausrüstung
Lawinenbezogene Einschätzungen wurden aus ihrer Sicht der Situation angepasst
Welche lawinentechnischen Überlegungen waren bei der Tourenauswahl relevant?
(Spontannennungen)*
· (90 % korrekt) und 60% Hangsteilheit (70% korrekt)
56 % nannten Lawinenproblem
42 % nannten Exposition · (86 % korrekt)
· (92 % korrekt)
44 % nannten Geländeform
2 % nannten Konsequenzen · (100 % korrekt)
98 % aller Befragten führten
· Standard-Notfallausrüstung
(LVS, Schaufel und Sonde) mit 92 % der Gruppen hatten alle · Teilnehmer vollständig die Notfallausrüstung
· Airbag
36 % der Befragten trugen
Einschätzung
Machbarkeit der Tour: 88 % sicher machbar oder wahrscheinlich machbar mit Vorbehalt, Checks durchzuführen (4-stufige Skala 1 = unsicher bis 4 = geht sicher; M = 3.14; SD = 0.79)
Vermutete Gefahrenstellen
25 % der Gefahrenstellen · wurden erst auf Tour gesehen
48 % der Gefahrenstellen · wurden auf Tour als gefährlicher eingestuft
15 % der Gruppen änderten · Tour aus lawinenbezogenen Gründen
Analytische oder probabilistische Methoden an Gefahrenstellen
29 % keine konkreten · Maßnahmen
30 % Gruppengespräche ·
17 % analytische Betrachtungen
6 % Schneedeckenuntersu- · chungen
1 % SnowCard
Verhalten an Gefahrenstellen
An 63 % der Stellen wurden · risikomindernde Verhaltensmaßnahmen umgesetzt
48
1. Planung
2. Auf Tour
3. Am Einzelhang
Ergebnisse DAVFeldstudie (2022)
*89 Gruppen, die Touren mit Gefahrenstellen wählten
Abb. 5 Übereinstimmung in der Einschätzung der Geländestellen zwischen Gruppe und Risikoanalyse (für intendierte und umgesetzte Tour).
Anteil korrekt erkannter gefährlicher und ungefährlicher Geländestellen
Anmerkung: Um beim Vergleich zwischen intendierter und umgesetzter Tour keine Stichprobenverzerrung zu erzeugen, wurden nur die Gruppen einbezogen, die vor und nach der Tour befragt werden konnten (n = 86). Standardabweichung in Klammern.
Abb. 6 Übereinstimmung in der Einschätzung der Gefahrenstellen zwischen Gruppe und Risikoanalyse (für intendierte und umgesetzte Tour).
Anteil korrekt erkannter Gefahrenstellen
Anmerkung: 70 Gruppen intendierten und begingen Touren mit Gefahrenstellen. Standardabweichung in Klammern.
Die Grundhaltung zu Beginn der Touren könnte als ein Machbarkeitsgefühl bezeichnet werden, nach dem Motto: „Unsere Vorstellung von der Tour (Gefahrenstellen) stimmt. Die Entscheidung, heute diese Tour zu wählen, ist richtig. Und andere sehen das auch so (Freunde und Bekannte; vorhandene Spuren).“
eErgebnisse zum Vorgehen bei Einzelhangentscheidungen
Verändern Gruppen ihre lawinenbezogenen Einschätzungen aus der Tourenplanung während der Tour?
Jede Gruppe wurde befragt, welche Gefahrenstellen sie bei ihrer Tour vorher identifiziert hatte bzw. während der Tour sah (= vermutete Gefahrenstellen). 25 % (33 von 132) dieser vermuteten Gefahrenstellen wurden erst auf Tour als solche gesehen. 48 % der vor der Tour vermuteten Gefahrenstellen wurde auf der Tour als gefährlicher eingestuft als vor der Tour (47 von 99). Gruppen sind also grundsätzlich bereit, ihre Annahmen über die Lawinensituation zu revidieren.
Dies zeigte sich auch in ihrer Haltung: Wenn eine Gruppe mehr Gefahrenstellen sah, dann hat sie auch angegeben, dass bei der Tour „Checks gemacht werden müssen“. Und schließlich änderten 15 % der Gruppen (13 von 86) ihre Tour aus Lawinen-bezogenen
Gründen ab. An von ihnen vermuteten Gefahrenstellen setzten 63 % der Gruppen risikomindernde Verhaltensmaßnahmen (Entlastungsabstände, einzeln gehen, Umgehung, Verzicht) um (138 Maßnahmen an 218 Gefahrenstellen), waren also bereit und „wach“, um mithilfe von Vorsichtsmaßnahmen das Lawinenrisiko zu senken. Problematisch dabei ist allerdings, dass Gefahrenstellen nicht ausreichend erkannt werden (siehe unten).
Welche Entscheidungshilfen werden angewandt?
An 29 % der Gefahrenstellen wurden keine konkreten Maßnahmen zur Risikobestimmung durchgeführt. Nur 1 % der Gruppen gab an, die DAV-Snowcard als Hilfsmittel für ihre Gefahreneinschätzung verwendet zu haben, und nur 6 % führten eine Schneedeckenuntersuchung durch. Am häufigsten wurde ein Gruppengespräch durchgeführt (30 %).
qQualität des Vorgehens der Gruppen im Gelände
Um qualitative Aussagen über das Vorgehen der Gruppen im Gelände machen zu können, wurde an jedem Erhebungstag für jede Geländestelle der Touren eine tagesaktuelle Risikoanalyse durchgeführt. Experten schätzten dabei nach einer Geländebegehung für jede Stelle die Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung und die
49
| unsicherheit
Intendierte Tour n = 86 Umgesetzte Tour T-test (zur Unterschiedsprüfung) 77 % (21.0 %) 75 % (21.5 %) t(85) = 0.996, p = .322 kein signifikanter Unterschied
Anteil Intendierte Tour n = 70 Umgesetzte Tour T-test 55 % (38.7 %) 46 % (39.6 %) t(69) = 2.001, p = .049 leicht signifikanter Unterschied (Effektstärke d = .24)
drohenden Konsequenzen eines Lawinenabgangs ein und leiteten davon angebrachte Verhaltensmaßnahmen ab (siehe Brugger et al., 2022). Diese Risikoanalyse wurde als Maß zur Bewertung des Verhaltens der Gruppen verwendet.

Werden Gefahrenstellen erkannt?
Die Gruppen (n = 110) wählten in der Regel lawinenbezogen machbare Touren, sowohl nach ihrer eigenen Einschätzung wie auch nach der Beurteilung der Risikoanalyse. Insgesamt beinhalteten die ausgewählten Touren 862 Geländestellen (im Auf- und Abstieg), von denen an dem jeweiligen Tag nach Risikoanalyse 279 (32 %) als Gefahrenstellen bewertet wurden. Lawinenereignisse gab es an den Erhebungstagen und -orten nicht.
Ein bedeutsamer Anteil der Gefahrenstellen wurde nicht erkannt. Dies zeigte sich bereits bei der intendierten Tour, wo nur etwa die Hälfte der vorliegenden Gefahrenstellen erkannt wurde. Auf Tour verschlechterte sich dies: Weniger als die Hälfte der Gefahrenstellen wurde erkannt. Diese Veränderung ist leicht signifikant. Sie kommt zustande, wenn Gruppen fälschlich zur Einschätzung gelangen, dass zuvor vermutete Gefahrenstellen keine sind, oder auch, wenn bei Änderung der Tour zusätzliche Gefahrenstellen im Gelände unerkannt bleiben. Dies wurde vermutlich nur deswegen nicht zum Problem, weil die Gruppen selten Touren mit Stellen wählten, die nach Risikoanalyse zu umgehen oder gänzlich zu meiden gewesen wären.
Ist das Verhalten an Geländestellen angemessen?
Gruppen verhielten sich an 68 % der Geländestellen (d. h. an ungefährlichen und gefährlichen Stellen) angemessen; d. h., dass eine an diesem Tag ungefährliche Geländestelle im Gruppenverband begangen wurde oder an Gefahrenstellen die seitens der Risikoanalyse geforderte Verhaltensempfehlung umgesetzt wurde.
Das auf den ersten Blick positive Ergebnis geht jedoch zu einem großen Teil auf die Passage ungefährlicher Stellen im Gruppenverband zurück (529 Geländestellen). Es zeigt sich aber auch, dass sich die Gruppen an nur 19 % der Gefahrenstellen (54 von 279, roter Rahmen) angemessen verhielten.
Eine Abweichung um 1 in Richtung riskant (also z. B. als Gruppe über eine Stelle gegangen zu sein, für die Entlastungsabstände empfohlen gewesen wären) trat an 47 % der Gefahrenstellen auf. Gesteht man Skitourengruppen eine solche Abweichung noch als tolerierbares Verhalten zu, dann ergeben sich 184 Übereinstimmungen (grün und gelb; 66 %). Den Großteil macht dabei aus, dass an 107 Stellen Entlastungsabstand empfohlen gewesen wäre, die Gruppe die Passage aber im Gruppenverband beging.
D. h., allein durch das Gehen mit Entlastungsabständen an diesen Stellen könnte das angemessene Verhalten auf 58 % erhöht werden, vorausgesetzt, die Gruppen erkennen die Gefahrenstellen.
50
Abb. 7 Übereinstimmung Verhaltensempfehlung Risikoanalyse (Zeilen) mit Verhaltensmaßnahme
Gruppe (Spalten) an den Gelände- und Gefahrenstellen (k = 862).
türkis: Angemessenes Verhalten; sandfarben: Abweichung um 1 Stufe in Richtung riskant; rot: Abweichung um 2 Stufen in Richtung riskant; grau: übervorsichtiges Verhalten. Der rote Rahmen markiert die Gefahrenstellen (k = 279)
alle Geländestellen (k = 862)
13 % übervorsichtiges Verhalten
15 % leicht riskantes Verhalten (Abweichung von Empfehlung um eine Stufe in Richtung riskant)
5 % deutlich riskantes Verhalten (Abweichung von Empfehlung um mindestens 2 Stufen in Richtung riskant)
68 % angemessenes Verhalten
nur Gefahrenstellen (k = 279)
20 % übervorsichtiges Verhalten
47 % leicht riskantes Verhalten (Abweichung von Empfehlung um eine Stufe in Richtung riskant)
14 % deutlich riskantes Verhalten (Abweichung von Empfehlung um mindestens 2 Stufen in Richtung riskant)
19 % angemessenes Verhalten
als Gruppe gehen Entlastungsabstände einzeln gehen Umgehung als Gruppe gehen Risikoanalyse Entlastungsabstände einzeln gehen umgehen Verzicht 529 107 35 5 39 43 21 0 12 17 11 2 3 7 15 0 0 12 3 1
51 | unsicherheit
s
Schlussfolgerungen
Skifahrerlawinen sind seltene Ereignisse. Basierend auf unserer Studie ist hierbei ein Faktor, dass Skitourengruppen meist defensive Entscheidungen treffen und Touren mit wenig und meist nicht hochriskanten Gefahrenstellen gehen.

Mindset Machbarkeit
Skitourengruppen begeben sich in einen lawinenbezogen ungesicherten Raum und empfinden das auch so. Ihre Haltung ist, eine machbare, lawinenbezogen sichere Tour gehen zu wollen. Der Entscheidungsprozess wird unter anderem vom Grundbedürfnis nach Sicherheit motiviert: Ohne ausreichendes Sicherheitserleben gehen Skitourengruppen nicht los. Also müssen sie die Unsicherheit des freien Skiraums durch die Tourenplanung in gefühlte Sicherheit verwandeln durch:
Wahl von bekannten bzw. Standard- und Modetouren, Verarbeitung des LLB, Befragung von Bekannten, Orientierung über mögliche Gefahrenstellen, Bereitschaft zu Checks, keine Festlegung auf bestimmte Hänge. Das Sicherheitsgefühl wird weiter erhöht, wenn die Gruppe vor Ort verspurtes Gelände vorfindet. Dadurch wird ein Machbarkeitsgefühl hergestellt: „Wir sind vorsichtig und haben uns was überlegt. Was wir vorhaben, geht und ist sicher. Andere sehen
das auch so.“ Mit dieser inneren Haltung bricht die Gruppe auf. Wie wir zeigen konnten, werden bei der Tourenplanung Gefahrenstellen nicht ausreichend erkannt und bei Einzelhangentscheidungen fehlt ein systematisches Vorgehen. Vorhandene Spuren bilden für die Gruppen eine wichtige Entscheidungsgrundlage, ihre Bedeutung wird aber nicht differenziert genug betrachtet.
Das Machbarkeits-Mindset gibt die lawinenbezogene Wirklichkeit der gewählten Tour meist korrekt wieder. Sind aber in der Planung Gefahrenstellen übersehen worden, werden diese auf Tour im Durchschnitt auch nicht mehr erkannt. Man könnte sagen, dass das Machbarkeitsgefühl dem Erkennen von zusätzlichen, evtl. widersprüchlichen Informationen unterwegs (u. a. neue Gefahrenstellen) zuwiderläuft.
Da die Weichen zum Erkennen von Gefahrenstellen im Planungsprozess gestellt werden, wollen wir diesen ausführlicher beleuchten.
Wie werden Gefahrenstellen ermittelt?
Sachlogisch werden Gefahrenstellen zweistufig identifiziert. Zunächst muss geklärt werden, wo es überhaupt gefährlich werden kann. Dann muss geprüft werden, ob eine Geländestelle am Tourentag gefährlich ist und welche Maßnahme an ihr gefordert ist.
Ein solcher Prozess verläuft wahrnehmungs- und entscheidungspsychologisch ganzheitlich (Kruglanski et al, 2012) und nicht schritt-
52
weise ab. Ausgangspunkt bei der Frage „Was könnte gehen?“ oder „Was wollen wir gehen?“ ist eine Tour in ihrer Ganzheit, nicht eine Sequenz von Einzelstellen. Um zu bestimmen, wo es gefährlich sein könnte, wird in die Tour „hineingezoomt“ und sie „überflogen“. Sie wird nicht vom Ausgangspunkt bis zum Gipfel Stelle für Stelle durchgegangen: Probabilistische Entscheidungsverfahren, die genau dies verlangen, sind wenig bekannt und werden kaum angewendet. Dies könnte erklären, warum nur 55 % aller Gefahrenstellen erkannt werden.
Wie kann das Erkennen von Gefahrenstellen verbessert werden?
Die Tourenplanung muss möglichst niederschwellig alle Gefahrenstellen aufdecken und dabei auf einer soliden Informationsbasis stehen. Eine Möglichkeit sind einfache Planungsfaustregeln wie z. B.:
„1. Identifiziere anhand einer Karte mit Steilheitslayer alle Stellen steiler als 30° auf und über deiner Tour als potentielles Lawinengelände!
2. Alle diese Stellen sind Gefahrenstellen, wenn sie gemäß Lawinenlagebericht als ungünstig eingeschätzt werden oder gemäß DAV-SnowCard mindestens als ‚gelb‘ erscheinen!“ Die Methode setzt aufgrund ihrer Einfachheit zwar die Eingangsschwelle herab, erfordert allerdings immer noch ein sequenzielles Vorgehen bei
Literatur
y Brugger, M., Schwiersch, M., Streicher, B., Fritz, L., Hummel, C. & Hellberger F. (2022). Antworten zum Einfluss von Heuristiken aus der Skitourenstudie der DAV-Sicherheitsforschung. bergundsteigen, #121, 55-63. y Kruglanski, A. W. (2012). Lay epistemic theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social psychology: Volume 1 (p. 201-223). Thousand Oaks, CA: Sage.
Autoren
An dieser Publikation der Forschungsgruppe Winter der DAVSicherheitsforschung arbeiteten neben Lukas Fritz von der SiFo folgende Externe mit: Michaela Brugger, Florian Hellberg, Christoph Hummel, Martin Schwiersch, Bernhard Streicher. An den Erhebungen haben zusätzlich mitgewirkt: Philipp Berg, Max Bolland, Steffi Bolland, Anna Gomeringer, Stefan Hinterseer, Alexandra und Georg Hochkofler, Johanna Kozikowski, Johanna Mengin, Jessica Ploner, Paul Schmid, Martin Prechtl, Bernhard Schindele, Laura Schwiersch.

der Planung. Oder: In der Planung einen Algorithmus die Informationen des Lawinenlageberichts ins Gelände rechnen lassen, um Gefahrenstellen und deren Gefahrengrad automatisiert zu bestimmen (z. B. Skitourenguru). Dabei ist allerdings der Algorithmus für die Qualität der Tourenplanung entscheidend. Wenn dieser Algorithmus für jede Geländestelle die relevanten Informationen des LLB (z. B. als Pop-up) darstellt, macht er sich transparent und kann ein Lerntool für den Einsteiger und eine Reflektionshilfe für die Erfahrenen sein. Allerdings muss eine solche detaillierte Auseinandersetzung auch nicht geleistet werden, so dass es passieren kann, dass später am Einzelhang die Entscheidungsgrundlage fehlt.
Haben Gruppen nun ein vollständiges Bild der Gefahrenstellen, dann wird ein angemessenes Risikomanagement auf Tour erst möglich, z. B. in Entlastungsabständen zu gehen oder auch zu wissen, an welchen Stellen Checks notwendig sind.
Skitourengruppen sind auch auf Tour bereit, ihr Bild zu überprüfen. Doch am Einzelhang fehlt ihnen eine Systematik. Eine Beurteilungshilfe, die den Gruppen am Einzelhang an die Hand gegeben werden kann, kann von den Lawinenproblemen ausgehen, da diese nach unserer Studie präsent und akzeptiert sind.
Fotos: Pauli Trenkwalder
■ 53 | unsicherheit
Space Blanket
Einsatzmöglichkeiten der Rettungsdecke

54 / bergundsteigen #120 / herbst 22 54 / bergundsteigen #122 / frühling 23
19. August 2020. Beim „Downhillen“ übersieht ein junger Sportler eine Geländestufe auf dem Trail und stürzt in der Folge über den Lenker seines Bikes. Bei Eintreffen der Bergrettung zittert er vor Kälte und gibt starke Schmerzen (7 auf einer analogen Skala von 0–10) im Bereich der linken Schulter mit von außen erkennbarer Fehlstellung des Schlüsselbeines an.
Nach Anlage eines Tornisterverbandes sind die Schmerzen deutlich niedriger (1–2 auf einer analogen Skala von 0–10). Der Abtransport ins Tal bis zur Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst kann beinahe schmerzfrei durchgeführt werden.
Die multifunktionale Rettungsdecke
Ursprünglich wurde die dünne, aluminiumbeschichtete Polyethylenterephthalat-(PET)Folie in den frühen 1960er-Jahren als „space blanket“ vom NASA Marshall Space Flight Center entwickelt, um Raumfahrzeuge vor Hitze zu schützen. Erstmals als Kälteschutz am Menschen angewandt wurde die Folie von Teilnehmern des New York City Marathons im Jahre 1978.1
Das kleine und leichte Tool im Erste-HilfeSet erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In der Bergrettung Tirol werden im Rahmen der „Taktischen Alpinmedizin“ schon seit Längerem verschiedene Anlagetechniken

für unterschiedlichste Zwecke geschult. In letzter Zeit wurde in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin auch eine Reihe an Untersuchungen zur Effektivitätsprüfung durchgeführt. In experimentellen Studien wurden Rettungsdecken getestet, die aktuell bei der Bergrettung und Flugrettung Tirol sowie beim Österreichischen Roten Kreuz Verwendung finden.
Die zähe Rettungsdecke
Mittels einer Materialprüfmaschine wurden Zugprüfungen zur Feststellung der Reißfestigkeit von Rettungsdecken getestet. Dabei wurden die Enden der längsgefalteten Decke mittels Weberknoten verbunden und der entstandene Ring in eine Seilzugmaschine gespannt.
Die Bruchlast lag bei den in Längsrichtung entfalteten Rettungsdecken (ÖRK, LEINA) zwischen 2812 und 4797 N und erwies sich damit als mehr als ausreichend für verschiedenste Anwendungen unter Zugbelastung.2
Die ausführliche Studie wurde im Journal Wilderness and Environmental Medicine veröffentlicht.3
Im Folgenden beschreiben wir sechs verschiedene Anwendungstechniken, die sich aufgrund der Stabilität und der Multifunktionalität der Rettungsdecke anbieten.
Markus Isser ist gelernter Anästhesiepfleger und ha uptberuflich bei der Bergrettung Tirol als Landesausbildungsleiter-Medizin tätig, Einsatzl eiter und Ortsstellenleiter-Stv. in der Ortsstelle Hall-Umgebung
55
| unsicherheit
In bergundsteigen #109 wurde über die Anwendung der Rettungsdecke als provisorischer UV-Schutz berichtet. Im aktuellen Artikel wollen die Autoren einen Überblick über weitere Einsatzmöglichkeiten der Rettungsdecke bei einem Unfall geben.
Von Markus Isser, Hannah Salchner, Franz J. Wiedermann, Bernd Wallner, Wolfgang Lederer
Rettungsdecke als behelfsmäßiges Tourniquet


Unter besonderen Umständen wird bei lebensbedrohlichen Blutungen durch Verletzungen der Extremitäten eine Abbindung empfohlen.4 Steht am Berg kein handelsübliches Tourniquet zur Verfügung, ist eine behelfsmäßige Abbindung immerhin besser als keine.5



Nicht nur die Reißfestigkeit, sondern auch die Breite von 6–7 cm einer in Längsrichtung gefalteten Rettungsdecke eignen sich besonders gut für das Abbinden einer Extremität. Der Rettungsdeckenstrang wird dabei zweimal um die Extremität gelegt und mittels Weberknoten straff verbunden. Zum Druckaufbau wird ein provisorischer Knebel durch den Knoten gesteckt und solange zugedreht, bis die Blutung aufhört. Anschließend wird der Knebel mit den freien Enden der Decke fixiert.
Als Knebel eignet sich am besten ein stabförmiges Objekt, da sich dieses im Gegensatz zu einem Karabiner einfacher fixieren lässt.
Wichtig ist, dass nach Abbinden einer blutenden Extremität mit Hilfe eines improvisierten Tourniquets überprüft wird, ob auch tatsächlich eine deutliche Verminderung des Blutverlustes zu beobachten ist. Ein Ersthelfer muss auch erkennen, wie viel Druck im Einzelfall notwendig ist, um eine ausreichende arterielle Blutsperre zu erreichen, damit nicht durch unnötig hohe Kompressionskräfte eine zusätzliche Schädigung des Gewebes verursacht wird.6 Andererseits, wenn durch zu wenig Kompression lediglich eine Stauung des venösen Rückstromes bewirkt wird, kann damit der Blutverlust sogar noch erhöht werden. In diesem Fall ist es besser, die Abbindung sofort zu entfernen, da ein nicht-effektiv angelegtes Tourniquet schlechter ist als kein Tourniquet. Zu den möglichen Komplikationen eines Tourniquets gehören Nervenverletzungen, Gewebsischämien entsprechend einem Compartment-Syndrom, venöse Thromboembolien und post-ischämische Reperfusionsschäden. Erstaunlicherweise ist die Häufigkeit von in der Literatur angegebenen Schäden durch notfallmäßiges Abbinden von Extremitäten bei prähospitalen Blutungen nicht hoch.7
56 1 3 4
Hannah
Salchner ist stellvertretend e Landesausbildungsleiterin Mediz in in der Bergrettung Tirol, Bergretterin in der Ortsstelle Neustift im Stubaital, Physiotherapeutin und Ärztin .
2
Rettungsdecke als behelfsmäßige Beckenschlinge
Beckenbrüche kommen bei alpinen Unfällen immer wieder vor. Für die Notfallversorgung eines instabilen Beckenbruches ist die Anwendung einer professionellen Beckenschlinge empfohlen, für einen Ersthelfer aber selten verfügbar. Hierbei ist daher die improvisierte Methode mit einer Rettungsdecke wieder eine Option.



Die Rettungsdecke wird zum Längsstrang von 20–30 cm Breite entfaltet, unter das
Becken gelegt und die Enden unter Zug mittels Weberknoten verbunden. Mit Hilfe eines Karabiners zwischen den zwei Knoten kann der Kompressionsdruck angepasst und der behelfsmäßige Beckengurt fixiert werden.


Die Höhe der Anlage am Becken orientiert sich am großen Rollhügel (Trochanter Major, der Knochenvorsprung am oberen Ende, seitlich am Oberschenkel) – dieser soll sich mittig unter dem Rettungsdeckenstrang befinden. Sollten sich unter Zug die Schmerzen verstärken, dann muss die behelfsmäßige Beckenschlinge wieder entfernt werden.
Franz J. Wiedermann ist Anästh esist an der Uni-Klinik Innsbruck, stv. Bereichsoberarzt und stv. Planungsmanager für die Lehre an den Uni.-Kliniken für Anästh esie und Intensivmedizin

57
| unsicherheit
1 2 3 4
Wolfgang Lederer ist Notarzt und Anästhesist an der Uni-Klini k

Rettungsdecke als behelfsmäßiger Tornisterverband
Mit der hohen Zugfestigkeit und der Länge von 210 cm eignet sich die Rettungsdecke auch perfekt für einen improvisierten Tornisterverband bei einem Schlüsselbeinbruch. Dabei können Schmerzen wesentlich verringert werden (siehe Einsatzbeispiel in der Einleitung).


Die Rettungsdecke wird dabei wie die Tragegurte eines Rucksackes über beide Schultern gelegt, unter den Achseln nach hinten geführt und mit beiden Strängen mittels Weberknoten zwischen den Schulterblättern verknotet. Einer der freien Stränge wird nach oben unter der Lasche am Hals durchgefädelt, dann wieder nach unten gezogen und mit dem zweiten Strang unter Zug verknotet. Dadurch wird der Schultergürtel nach hinten gezogen, was bei Schlüsselbeinbrüchen zu einer Entlastung führt.
Auch hier gilt wie immer:
Sollten sich unter Zug die Schmerzen verstärken, so muss der behelfsmäßige Tornisterverband wieder entfernt werden.
Rettungsdecke als behelfsmäßiges
Chest-Seal
Bei einem Unfall kann ein Loch am Brustkorb, verursacht z. B. durch ein Eisgerät, tödliche Folgen haben. Dabei wird Luft von außen zwischen Lunge und Brustwand angesaugt, die Lunge kollabiert und es entwickelt sich ein Pneumothorax. Wenn eingedrungene Luft nicht mehr ausströmen kann, wird das Lungengewebe immer mehr zusammengedrückt und es entsteht ein lebensbedrohlicher Spannungspneumothorax.
Ein in der Militärmedizin üblicher Ventilverband kann nach perforierenden Thoraxverletzungen die Entwicklung eines tödlichen Spannungspneumothorax verhindern. Da dieser Verband in der zivilen Notfallversorgung kaum verfügbar ist, müssen Ersthelfer auf Alternativen zurückgreifen.

In einem Versuchsaufbau konnten wir zeigen, dass sich die Rettungsdecke mit ihrer glatten Oberfläche sehr gut als Ventilverband eignet. Ein angefeuchtetes, ca. 20 x 20 cm großes Stück der Rettungsdecke

58
1 2
Innsbruck, stv. Bereichsober arzt Notfallmedizin und zuständig f ür die studentische Lehre.
3 4
wird dicht auf die Wunde am Brustkorb gelegt – dieses verhindert beim Einatmen das Einströmen von Luft zwischen Lunge und Brustkorb, aber nicht das Ausströmen von Luft.8

Rettungsdecke als behelfsmäßige Trage
Die erstaunliche Reißfestigkeit der Rettungsdecke ermöglicht auch den Einsatz als Tragering. Hierbei wird die Decke im Strang verwendet, wobei die beiden Enden mittels Weberknoten verbunden werden. Der so entstandene Ring eignet sich zum Tragen von Personen. Mit einer Decke kann man eine verletzte Person mittels Sitzring tragen. Hat man zwei Rettungsdecken bzw. Ringe, so lässt sich eine perfekte Rucksacktrage herstellen. Dabei steigt der Patient jeweils mit einem Bein in einen Ring. Der Ersthelfer schultert die beiden Ringe und kann so den Patienten wie einen Rucksack auf dem Rücken tragen.
Ein liegender Patient kann von zwei Rettern über kurze Strecken transportiert werden, indem je ein Ring unter Schulter sowie Gesäß des Patienten platziert wird. Es ist zu beachten, dass die Materialbeschaffenheit der verschiedenen auf dem Markt angebotenen Produkte voneinander abweichen kann und somit auch eine unterschiedliche Reißfestigkeit möglich ist. Ebenso können Gegenstände mit scharfen Rändern wie zum Beispiel Steine, Äste, aber auch Reisverschlüsse der Kleidung die Folie zum Einreißen bringen. Weiters ist anzumerken, dass Rettungsdecken für die improvisierten Anwendungsformen relativ neu sein müssen – da sie im Laufe der Jahre spröde werden können. Die Ergebnisse unserer experimentellen Untersuch-ungen beschränken sich auf die zwei getesteten Produkte unter Laborbedingungen und ersetzen nicht eine noch ausstehende klinische Anwenderstudie. Wichtig ist, dass auch improvisierte Techniken gut geübt und trainiert werden müssen.
Bernd Wallner ist Facharzt fü r Anästhesie an der Uni-Klinik Inns bruck, Forschungsschwerpunkt Hypothermie.

59
| unsicherheit
Die Rettungsdecke für das Wärmemanagement
Die ursprüngliche Anwendung der Rettungsdecke in der Ersten Hilfe war als Schutz vor Wärmeverlust vorgesehen. Einerseits werden dabei Wärmeübertragung (Thermokonvektion) und Verdampfungskühlung (Evaporation) vermindert und andererseits wird die vom Körper abgegebene Wärmestrahlung reflektiert.
In der Bergrettung findet beim Wärmemanagement die sogenannte Windeltechnik Anwendung. Die Rettungsdecke wird hierbei unter der Bekleidung am Rücken durchgezogen und breitgestrichen. Wichtig ist hierbei, dass sich die Folie über der untersten Bekleidungsschicht befindet. Bei direktem Hautkontakt würde durch Wärmeleitung (Thermokonduktion) ein kühlender Effekt herbeigeführt werden.9 Am oberen Ende
wird die Decke über dem Kopf fixiert und dadurch gleichzeitig eine Kopfbedeckung erzeugt. Am unteren Ende wird die Folie zwischen den Beinen durchgezogen und bauchseitig wie eine Windel fixiert. Mit dieser Anwendungstechnik kann sich der Patient weiterhin uneingeschränkt bewegen und die Rettungsdecke stellt bei einem eventuellen Hubschraubereinsatz auch keine Gefahrenquelle dar.
Unsere Testserien haben auch gezeigt, dass es irrelevant ist, welche Seite der Rettungsdecke zum Patienten zeigt. Egal ob die Silber- oder Goldseite zum Patienten gerichtet war, in den Ergebnissen zeigten sich keine nennenswerten Unterschiede.10 Erwähnenswert scheint noch, dass Rettungsdecken eine negative Auswirkung auf die Suche mittels Wärmebildkameras haben können. Komplett von einer Rettungsdecke umhüllte Personen werden von einer Wär-
mebildkamera nicht erfasst. Die Rettungsdecke wird von der Kamera nur als schwarzer Fleck aufgezeichnet, welcher eine auffallend kältere Temperatur als die Umgebung auf der Wärmebildkamera anzeigt. Es ist zu empfehlen, dass in Not geratene Personen bei Annäherung einer Suchdrohne oder eines Helikopters die Rettungsdecke kurzfristig vom Körper entfernen.11
Schlussbemerkung
Seit gut drei Jahren erforschen wir nun das kleine Wunderding Rettungsdecke und unsere Projekte sind aktuell noch nicht abgeschlossen. Wir sind überzeugt, in nächster Zeit auch noch weitere neue Anwendungsbereiche untersuchen und vorstellen zu können.12 Eines kann man mit Sicherheit sagen – die Rettungsdecke sollte bei keiner Bergtour fehlen.


Hier geht es zum Video „Taktische Alpinmedizin 04 – Wärmeerhalt“

60 1 2 3
Bergsport und Gesundheit #6
Diese Serie organisieren und betreuen Dr. Nicole Slupetzky (Vizepräsidentin des ÖAV und Präsidentin des Clubs Arc Alpin) und Prof. Dr. Marc Moritz Berger (Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Essen, Deutschland; Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Alpinund Höhenmedizin). Der Experte für Prävention und Therapie der akuten Höhenkrankheiten und für alpine Notfallmedizin ist Mitinitiator des Symposiums für Alpin- und Höhenmedizin Salzburg, das gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein organisiert wird.


Literatur
1) National Aeronautics and Space Administration. Spinoff 2006. Reflecting on space benefits: a shining example. 56-57.
2) Isser M, Kranebitter H, Kühn E, Lederer W. Highenergy visible light transparency and ultraviolet ray transmission of metallized rescue sheets. Sci Rep. 2019;9:11208. https://www.nature.com/articles/ s41598-019-47418-8
3) Isser M, Kranebitter H, Fink H, Wiedermann FJ, Lederer W. High resistance to tear forces increases multifunctional use of survival blankets in wilderness emergencies. J Wild Environ Med. 2020;1: https://doi.org/10.1016/j.wem.2019.12.012
4) Kragh JF Jr, Dubick MA. Bleeding control with limb tourniquet use in the wilderness setting: review of science. Wilderness Environ Med. 2017;28(2S):25-32.
5) Cornelissen MP, Brandwijk A, Schoonmade L, Giannakopoulos G, van Oostendorp S, Geeraedts L Jr. The safety and efficacy of improvised tourniquets in life-threatening hemorrhage: a systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019;
6) The Boston Trauma Center Chiefs’ Collaborative. Boston marathon bombings: an after-action review J Trauma Acute Care Surg. 2014;77(3):501-3.
7) Scerbo MH, Mumm JP, Gates K, Love JD, Wade CE, Holcomb JB et al. Safety and Appropriateness of tourniquets in 105 civilians. Prehosp Emerg Care.
2016;20(6):712-22.
8) Schachner T, Isser M, Haselbacher M, Schröcker P, Winkler M, Augustin F, Lederer W. Rescue Blanket as a Provisional Seal for Penetrating Chest Wounds in a New Ex Vivo Porcine Model. Ann Thorac Surg. 2021;S0003-4975(21)01379-5. doi: 10.1016/ j.athoracsur.2021.06.083.
9) Peterson GP, Fletcher LS. Measurement of the Thermal Contact Conductance and Thermal Conductivity of Anodized Aluminum Coatings. Heat Transfer 1990; 112(3), 579-585.
10) Kranebitter H, Isser M, Klinger A, Wallner B, Lederer W, Wiedermann FJ. Rescue Blankets-Transmission and Reflectivity of Electromagnetic Radiation. Coatings. 2020, 10(4), 375, https://doi.org/10.3390/coatings10040375
11) Isser M, Kranebitter H, Kofler A, Groemer G, Wiedermann F, Lederer W, Rescue blankets hamper thermal imaging in search and rescue missions. SN Appl. Sci. 2, 1486 (2020). https://doi.org/10.1007/s42452-020-03252-6
12) Wallner, B.; Salchner, H.; Isser, M.; Schachner, T.; Wiedermann, F.J.; Lederer, W. Rescue Blankets as Multifunctional Rescue Equipment in Alpine and Wilderness Emergencies—A Narrative Review and Clinical Implications. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 12721.
https://doi.org/10.3390/ijerph191912721 ■
61
| unsicherheit
Kurzschluss?
Das In-Anführungszeichen-Setzen des Titels zeigt schon, dass wir genauer definieren sollten, was eigentlich mit dem „Gehen oder Führen am kurzen Seil“ gemeint ist. Diese Definition variiert von Land zu Land, also auch von einer zur anderen Bergführerausbildung, erheblich. In diesem Artikel versuchen wir zu skizzieren, wie die Schweizer Definition vom „Führen am kurzen Seil“ aussieht, wie diese strukturiert ist und warum diese Techniken in den Schweizer Bergen so omnipräsent sind und sehr oft angewandt werden, und zwar nicht nur von Bergführern.
Von Reto Schild und Manuel Gilgien

62 / bergundsteigen #122 / frühling 23
„Führen am kurzen Seil“ in der Schweizer Bergführerausbildung
Die spezifischen Techniken behandeln wir im Folgenden nur oberflächlich. Eine zentrale Aussage könnte aber sein, dass obengenannter Begriff vom „Gehen“ irreführend ist und wir korrekterweise vom „Führen am kurzen Seil“ sprechen sollten. Der Unterschied zwischen Gehen am kurzen Seil und Führen liegt darin, dass beim Führen eine klare Rollenverteilung zwischen dem Führenden (Bergführer) und dem Geführten (Gast) besteht. Gehen am kurzen Seil hingegen legt nicht fest, dass hier eine Person Sorge und Verantwortung für eine oder zwei weitere Personen trägt. Den Hauptfokus richten wir im zweiten Teil des Artikels darauf, euch das geniale methodische Konzept der vier Säulen zur Vermittlung dieser verschiedenen Techniken vorzustellen.
Alle Ausbildungsinhalte zum „Führen am kurzen Seil“ sind in einem Bergführerverbands-internen Lehrmittel festgehalten und strukturiert. Umgangssprachlich sprechen wir in der Schweiz oft vom „Führen am kurzen Seil“, präziser ist aber der Titel dieses Lehrmittels: „Bergführerspezifische Seilhandhabung im Felsen und Firn“. Diese Bezeichnung wiederum zeigt unzweideutig auf, dass die Anwendung dieser beschriebenen Techniken am mehr oder weniger kurzen Seil komplex und herausfordernd ist. Auf klassischen langen Hochtouren sind es für den Bergführer jedoch die einzigen sinnvollen Techniken, um möglichst sicher, effizient und in vernünftiger Zeit auf den Gipfel und wieder ins Tal zu gelangen. Dabei spielt das Seil und dadurch die unmittelbare Verbindung vom Bergführer zum Gast eine entscheidende Rolle. Ebenso zentral für die Sicherheit des Gastes am Berg ist auch das optimale Coaching. Um dies gut umsetzen zu können, braucht es aber eben eine kurze Distanz und damit zwingend auch das „kurze Seil“ zum Gast.
Die Kombination aus „sich sicher fortbewegen“, einer angepassten Seilhandhabung, optimaler Wegfindung und dem Anleiten, Zureden, Motivieren, Beruhigen (Coachen) des Gastes oder der Gäste braucht viel Erfahrung, handwerkliches Geschick und Intuition. Doch wie kann man diese Erfahrung und diese Techniken einem Kandidaten oder einer Kandidatin (= Bergführeranwärter in Ausbildung, Anm. d. Red.) vermitteln? Jede Situation am Berg ist einzigartig. Es gibt unzählige Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Parametern. Darum sind Lerngespräche mit intensiven Diskussionen und Praxisübungen im Gelände in der Ausbildung sehr wichtig.
Reto Schild, Hasliberg, Bergführer, einer von drei technischen Leitern der Schweizer B ergführerausbildung, Verfasser der Lehrunterlage „Bergführerspez ifische Seilhandhabung im Felsen und Firn “ für die Schweizer Bergführerausbildung.

63
„Beim Führen am kurzen
| unsicherheit
Seil suchen wir immer den besten Kompromiss zwischen größtmöglicher Sicherheit und Geschwindigkeit einer Seilschaft (Effizienz).“
Stufe 1 im Firn. „Gemeinsames Gehen“. Das Gelände, die Verhältnisse und die Zusammensetzung der Seilschaft sind günstig. Ein Halten eines Ausrutschers beim gemeinsamen Gehen sollte möglich sein. Oder die Wahrscheinlichkeit eines Stolperns des Gastes oder der Gäste ist gering. Auf diesem Bild ist eine gute Spur zu erkennen, die die Wahrscheinlichkeit des Ausrutschens oder Stolperns reduziert.
Gelände, Erfahrung und Tradition
Gerade in der Schweiz haben wir eine sehr lange Tradition, wenn es darum geht, unsere Gäste am „kurzen Seil“ auf Gipfel zu führen und diese Dienstleistung unseren zukünftigen Bergführern zu vermitteln. Unterschiede in den verschiedenen Bergführerausbildungen sind wohl vorwiegend dem dominierenden Gelände für die anschließende Ausübung des Bergführerberufs geschuldet. Es ist also nicht verwunderlich, dass bei uns die Techniken beim „Führen am kurzen Seil“ sehr wichtig sind. Neben der Lawinen- und Spaltensturzproblematik stellen sie in unserem Land wohl das größte Berufsrisiko dar. Dieser geländebedingte Schwerpunkt hat auch dazu geführt, dass in der Schweiz alle wichtigen Alpinverbände wie SAC oder das Jugend und Sport Programm in ihren Ausbildungen seit je her das „Gehen am kurzen Seil“ ausbilden und im Gelände auch anwenden. Da das Besteigen vieler hochalpiner Gipfel, insbesondere der beliebten Routen auf die 4000er in den Schweizer Alpen oder allgemein in den Westalpen oft über lange Fels- und Firngrate führt, welche klettertechnisch nicht sehr schwierig sind, wenden wir im Idealfall die verschiedenen Seiltechniken situativ so an, dass wir möglichst effizient und mit einem größtmöglichen Maß an Sicherheit unterwegs sein können.

Sämtliche Klassenlehrer und auch die drei technischen Leiter, welche für die Bergführerausbildung in der Schweiz zuständig sind, sind hauptberuflich als Bergführer mit ihren Gästen unterwegs und nur „nebenamtlich“ als Ausbildner für den Schweizer Bergführerverband tätig. Dieser Umstand könnte als unprofessionell wahrgenommen werden, führt aber effektiv dazu, dass im Ausbildungskader im Hinblick auf das hier besprochene Thema Tausende Tage an effektiv gemachten Praxiserfahrungen als Know-how in die Ausbildung und deren Lehrmittel einfließen können.
Diese Erfahrung führt uns zur Überzeugung, dass – richtig angewandt – die Techniken zum „Führen am kurzen Seil“ unverzichtbar und ein sehr taugliches Konzept sind, wenn es darum geht, die Seilschaft vor einem Absturz zu bewahren. In diesem Artikel beschränken wir uns bewusst darauf, die Anwendung der Techniken des „Führens am kurzen Seil“ in einer Bergführer-Gast-Konstellation zu beschreiben.
Die Schweizer Struktur zum „Führen am kurzen Seil“
Der Bergführer muss sich dauernd fragen, welche Gefahren in welchem Abschnitt der Tour relevant sind und wie er seine Seiltechnik diesbezüglich anpassen muss. Um diese Entscheidungsfindung zu strukturieren, verwenden wir ein vierstufiges System. Die Grenzen dieser Stufen sind fließend und müssen der Situation angepasst werden. Um die verschiedenen Techniken zum „Führen am kurzen Seil“ skizzieren zu können, gehen wir kurz auf das Ausbildungssystem mit den verschiedenen Stufen in Firn und Fels ein.1
Wir sprechen von einem zweistufigen System für die Anwendung im Firn:
y Stufe 1 „gemeinsames Gehen“ – Das Gelände, die Verhältnisse und die Zusammensetzung der Seilschaft sind günstig. Ein Halten eines Ausrutschers beim gemeinsamen Gehen sollte möglich sein. Oder die Wahrscheinlichkeit eines Stolperns des Gastes oder der Gäste ist gering.
y Stufe 2 „kurze oder längere heikle Abschnitte“ – Sicherung über einen Fixpunkt.
Sowie einem vierstufigen System für die Anwendung im Felsen:
y Stufe 1 „gemeinsames Gehen“ – einfaches Gelände, gestuft; eher Rutsch- als Sturzbelastung
y Stufe 2 „kurze schwierige Stellen“ – steilere Aufschwünge oder plattige Passagen; der Bergführer benötigt zeitweise beide Hände zur Fortbewegung
y Stufe 3 „Mikroseillängen“ – steiles, nicht zwingend schwieriges Gelände; Sturzbelastung des Gastes möglich
y Stufe 4 „Seillängen“ – Sichern von Standplatz zu Standplatz
Um diese Stufen situationsangepasst anwenden zu können, müssen fortwährend die richtigen Fragen beantwortet werden. Über allem steht immer die Frage nach Wahrscheinlichkeit und Konsequenz einer Rutsch- oder Sturzbelastung des Gastes. Zum Beispiel: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Gast in leichtem, gestuftem Ge-
1 In diesem Artikel behandeln wir unter dem Begriff „kurzes Seil“, die jeweiligen Stufen 1 im Firn bzw. die Stufen 1 und 2 im Felsen der SBV-Ausbildungsunterlage bergführerspezifische Seilhandhabung im Felsen und Firn.
lände ins Seil stürzt? Wahrscheinlich wird er oder sie wohl höchstens ins Rutschen kommen. Befindet sich aber unter uns eine hohe Steilstufe, muss ich wegen der Konsequenzen unter Umständen trotzdem auf Stufe 2 oder gar 3 wechseln. Wichtig bei der Anwendung dieser vier Stufen sind die Selbstreflexion und das Erkennen der Grenzen, um rechtzeitig auf die nächsthöhere Stufe zu wechseln. Umgekehrt aber auch gut zu antizipieren, wann wieder auf eine tiefere Stufe zurückgewechselt werden kann. Wechsel der Sicherungsmethode (Stufe) haben meist auch eine Anpassung der Seilverkürzung zur Folge. In diesem Stufensystem haben wir folgende Struktur platziert: Beschreibung, Charakteristik, Seilführung im Aufstieg, Seilführung im Abstieg, Grundsätze bei Anwendung dieser Technik, und Erkenntnisse aus Praxistests. Mit diesem System der zwei, respektive vier Stufen für das Felsgelände beschreiben wir in unserer Lehrunterlage, wie wir als Bergführer möglichst sicher und effizient eine oder mehrere Personen im klassischen Fels- und Firngelände von A nach B führen können (vgl. Auszug aus Lehrunterlage SBV). Die Ausbildung und Anwendung dieser Lehrinhalte ist ein zentraler Bestandteil der Schweizer Bergführerausbildung. Sie macht den Unterschied zwischen guten Alpinisten (Voraussetzung, um überhaupt mit der Bergführerausbildung beginnen zu können) und Berufsleuten aus, deren Verantwortung und Aufgabe es ist, Gäste im alpinen Gelände auf Gipfel zu führen. Als Bergführer mit Garantenstellung Ist seilfreies Gehen auf alpinen Touren keine Alternative zum Gehen am kurzen Seil.

65
| unsicherheit
„Die zentrale Frage ist: Kann ich mit der Methode, in diesem Gelände, mit diesem Gast die wahrscheinlich auftretenden Kräfte halten oder muss ich die Stufe (Sicherungsmethode) wechseln?“
Manuel Gilgien, Steffisburg, Bergführer , seit vielen Jahren Klassen lehrer in der schweizerischen Bergführerausbildung.
Die zwei wichtigsten Punkte
Aus dem Wissen, das von unseren Vorgängern übermittelt wurde, und aus zahlreichen praxisnahen Tests im Gelände haben sich zwei zentrale Punkte herauskristallisiert, um einen Absturz zu vermeiden und am Berg dennoch effizient voranzukommen:
Erstens muss der Bergführer immer einen Kontakt zum Gast über einen leichten Zug am Seil herstellen. Bei unseren Messungen in praxisnahen Tests hat sich herausgestellt, dass beim gemeinsamen Gehen am kurzen Seil im Schnitt etwa 0,3–0,5 kN über die Hand gehalten werden können. Das ist nicht viel, wenn man an die Kräfte eines fallenden Körpers denkt. Es ist aber auch nicht nichts, wenn man sich überlegt, dass diese Kräfte in der Regel nicht schlagartig auftreten, sondern sich progressiv entwickeln. Entscheidend dabei ist die Reaktionszeit des Führenden. Er/Sie muss auf einen Sturz oder Ausrutscher direkt Einfluss nehmen können. Passiert diese Reaktion unmittelbar, sind die Kräfte noch nicht hoch und man kann sie kontrollieren. Wenn wir von einem Zug am Seil als Kontakt sprechen, dann sind das keine 20 kg, sondern nur ein leichter Zug, gerade so viel, um den Gast in seiner Fortbewegung nicht zu hindern. Um diesen Kontakt vor allem in den entscheidenden Momenten zu gewährleisten, braucht es Training und das Einüben von spezifischen Handgriffen.
Als zweites sind wir überzeugt, dass wir als Bergführer noch viele weitere Möglichkeiten haben, um das Entstehen eines Ausrutschers oder Sturzes zu verhindern. Wir denken da an eine gute Spur im Firnfeld oder an einen dem Gast angepassten ruhigen Rhythmus, an eine optimale Routenfindung, klare Anweisungen und Anleitungen usw.
Als Ausbildner der Bergführerausbildung sind wir unter anderem dazu da, die Leistung der Kandidaten zu beurteilen und zu bewerten. Doch wie machen wir das beim „Führen am kurzen Seil“? Geht es nur um die Seilhandhabung? Geht es um die Zeit bis zum Gipfel? Mit diesen Fragen konfrontiert kam die Idee auf, die ganze Beurteilung und schließlich das Feedback auf vier Säulen aufzuteilen:
y Persönliche Gehtechnik, Trittsicherheit, Klettertechnik, Steigeisentechnik
y Seilhandhabung
y Wegfindung
y Kommunikation mit dem Gast und Coaching
Jedes Kriterium ist als Säule oder Standbein zu betrachten. Wackeln eine oder mehrere der vier Säulen, wird das sichere Führen eines oder mehrerer Gäste erschwert oder gar verunmöglicht. Somit hat die Stabilität jeder Säule auch Auswirkungen auf die Stabilität der anderen! Ein Beispiel:
Je besser und sicherer der Bergführer sich im alpinen Gelände fortbewegt (persönliche Geh- und Klettertechnik, Trittsicherheit), umso mehr Kapazität hat er, den Gast zu coachen, die Seilhandhabung optimal den Gegebenheiten anzupassen und gleichzeitig den einfachsten und sichersten Weg zu finden. Diese vier Säulen sind bei jedem Kandidaten und Bergführer unterschiedlich ausgeprägt und beeinflussen so die Gesamtleistung seiner Arbeit am Berg. Gewisse Mankos in der einen Säule können durch andere teilweise

66
Vier Säulen – die Kriterien zur qualitativen Kontrolle beim „Führen am kurzen Seil“
Stufe 2 im Fels. Kurze schwierige Stellen erfordern, dass der Bergführer zeitweise beide Hände zum Klettern braucht. Der Gast wird über die kurzen Passagen nachgesichert bzw. durch Seilzug unterstützt.
kompensiert werden, aber nie vollständig ersetzt. Schnell hat sich aus diesem anfänglichen Feedbacktool ein eigentliches methodisches Ausbildungskonzept entwickelt. Jede der vier Säulen wird im Gelände einzeln ausgebildet und angewandt. Dieses Konzept erleichtert einerseits die Ausbildung der komplexen Materie, andererseits erleichtert es die Rückmeldung an die Kandidaten. Als vielleicht wichtigsten Punkt für ein langes Bergführerleben fördert es das Bewusstsein für die eigenen Stärken und Schwächen, für die verschiedenen Risiken und die Reflexion darüber.
Die vier Säulen im Detail
In der Folge wollen wir die Inhalte der einzelnen Säulen genauer betrachten:
y Persönliche Gehtechnik, Trittsicherheit, Klettertechnik, Steigeisentechnik
Wenn sich ein Bergführer oder eine Bergführerin mit einem Gast im Gelände bewegt, muss der Bergführer oder die Bergführerin seine bzw. ihre persönliche Technik so einschätzen und anpassen, dass er oder sie sich selbst nicht gefährdet und/oder abstürzt. Die persönliche Geh- und Klettertechnik ist dabei der zentrale Pfeiler. Im Zusammenhang mit klassischen Hochtouren würden wir dies am ehesten mit der Fertigkeit „sich im ‚Gamsgelände‘ zu bewegen“ beschreiben. Insgesamt kann ein hohes Sportkletterniveau in der Bergführerausbildung hilfreich sein. Es ist aber überhaupt kein Garant dafür, dass sich ein*e Kandidat*in auch im alpinen Gelände geschmeidig bewegen kann. Ein präzises Steigen und hohe Trittsicherheit – sei es mit oder ohne Steigeisen – helfen auch, sich in Bezug auf mögliche Belastungen durch das Seil gut und stabil zu positionieren. Ist diese Säule schwach, kommt die gesamte Seilschaft im Gelände nur langsam voran oder der/die Bergführer*in gefährdet sich selbst. Andererseits kann es aber auch dazu führen, wenn ein*e Bergführer*in sich sehr stark, schnell und trittsicher im Gelände bewegt, dass er/sie die Konsequenzen eines Ausrutschers oder Sturzes durch den Gast unterschätzt und die Kräfte nicht halten kann. Auch die stärksten Bergsteiger dürfen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht negieren!
y Seilhandhabung
Die offensichtliche Kernaufgabe der Bergführer hat viel mit handwerklichem Geschick und antrainierten Handgriffen zu tun. Diese muss man sich hart erarbeiten und langfristig festigen, damit man den erwähnten Kontakt über das Seil möglichst immer gewährleisten kann. Beim Wechsel von einer Stufe in die nächste ist ein zentraler Punkt die richtige Arbeitslänge des Seils. Dafür passen wir ständig unsere Seilverkürzung an. Bei einer Dreierseilschaft verändern wir allenfalls mit wenigen Handgriffen die Distanz zwischen den Gästen und die Länge der Weiche. Diese Anpassungen müssen perfekt eintrainiert sein und speditiv (Anm. d. Red.: schweizerisch rasch vorankommend, zügig) erfolgen. Das Wählen der „richtigen Stufe“ und damit einhergehend das Anpassen der Arbeitslänge des Seils ist entscheidend und muss gut antizipiert und rechtzeitig an die jeweilige Situation angepasst werden.
In der Schweiz arbeiten wir auf klassischen Touren sehr oft auch mit kürzeren Seilen von 30 bis 40 Metern. Bei der Stufe 3, den Mikroseillängen, klettern wir kurze Seillängen von maximal 15–20 Metern von Fixpunkt zu Fixpunkt (dies kann auch eine Sicherung über Hüfte oder Schulter sein) oder – wenn nötig – eben dann ganze Seillängen, welche immer noch relativ kurz sind (30–40 Meter/Länge des Seils).
Ziel ist, auch bei Stufe 3 und 4 möglichst Sicht- und Rufkontakt zum Gast zu halten, damit dieser optimal angeleitet werden kann. Das Credo lautet im klassischen Westalpen-Führergelände oft: „So kurz wie möglich, so lang wie nötig!“ (Seildistanz zwischen Führer und Gast). Deshalb haben wir in der Schweizer Lehrunterlage „Bergführerspezifische Seilhandhabung“ sämtliche Techniken auch auf vier Stufen für das Felsgelände aufgeteilt. Die Länge des offenen Seils zwischen Bergführer*in und Gast im Fels- oder Mixedgelände betragen typischerweise für diese vier Stufen immer in etwa folgende Längen: Stufe 1 und 2: 6 bis maximal 8 Meter / Stufe 3: 15–20 Meter / Stufe 4: meist ganzes Seil offen, respektive verkürzt auf 30–40 Meter bei einem 50 Meter Seil.
Erfahrungsgemäß kann gerade mit einer effizienten Seilhandhabung ein*e Bergführer*in sehr viel zur Effizienz und Sicherheit beitragen. Ist dieser Pfeiler stark und gut ausgebildet, lässt sich unglaublich viel Zeit „gewinnen“.
„Wir müssen uns der physikalischen Gesetzmäßigkeiten als Bergführer*in bewusst sein und dementsprechend unsere Techniken im Gelände anpassen. Masse x Weg = Energie, oder so ähnlich … ;-).
67 | unsicherheit
Daher auf anspruchsvollen Touren maximal zwei Gäste und oft nur einen Gast!“ Reto Schild
y Wegfindung, Spurpräparation
Erfolgreiches Bergsteigen hat viel mit Energieeffizienz zu tun. Wir müssen mit der vorhandenen Energie eines Gastes möglichst haushälterisch umgehen. Dabei sind der angepasste Rhythmus und das eingeschlagene Tempo der zentrale Punkt. Ebenso wichtig ist aber die Wegfindung. Die grobe Wegfindung verhindert dabei große, unnötige Umwege. Wir müssen also erkennen, ob man links, rechts oder über den Turm klettert. Die Wegfindung im Kleinen, das heißt auf den nächsten paar Metern trägt viel zur Schonung der Energiereserven und auch zur Sicherheit im Kleinen bei. Große, kraftraubende Schritte sollten vermieden werden.
Oftmals lohnt es sich dabei einen kleinen „Umweg“ von wenigen Metern zu gehen und dabei eine kleinere Steigung zu haben, als einen großen Schritt über eine Steilstufe zu machen. Die Herausforderung in der Ausbildung ist oft, dass die sehr fitten Kandidaten sich dessen gar nicht bewusst sind und die großen Schritte sogar als effizienter wahrnehmen. In diesem Zusammenhang möchten wir gerne die Aussage vom früheren technischen Leiter Edi Bohren erwähnen: Edi sagte immer: „Die kleinste Einheit einer Bergtour ist der einzelne Schritt.“ Stimmt dieser Schritt nicht oder ist dieser nicht an die Energie des Gastes angepasst, hat man schlechtere Chancen, zum Gipfel zu kommen.
Einerseits geht es um Energiereser ven und andererseits natürlich auch um die Stabilität des Gastes und des Bergführers. Das heißt, bei einem kleinen Schritt, einer kleinen Körperschwerpunktverlagerung ist die Gefahr eines Ausrutschers oder des Gleichgewichtsverlustes viel geringer als bei großen Schritten.
Im Firn und Eis kommt neben einer gleichmäßigen, schräg ansteigenden Aufstiegsspur der Spurpräparation eine bedeutende Rolle zu. Im Firn kann eine Spur bedeutend verbessert werden, indem man sie vorritzt. Das heißt, mit der Schaufel des Pickels wird während des Laufens eine kleine Kerbe in den Firn geritzt. Das verbessert nicht nur den Tritt für den Gast, sondern erhöht auch die Stabilität des Bergführers oder der Bergführerin in der Spur. Dies gilt für das Anlegen einer neuen Spur, gilt aber auch zum Verbessern einer schon bestehenden Spur. Fürs Ritzen und Stufenschlagen braucht es das geeignete Werkzeug. Aus diesem Grund beobachtet
man vor allem in der Schweiz zuweilen Bergführer*innen mit Holzpickeln, die aus einer früheren Zeit zu stammen scheinen. Diese klassischen Holzpickel eignen sich für diese Arbeit viel besser als modernere Modelle. Wobei auch mit denen gearbeitet werden kann. Wichtig ist eine gute Schaufel. Die Holzpickel werden immer noch von der Firma Bhend in Grindelwald angefertigt (eispickel.ch).
Auch Stufenschlagen im blanken Eis erhöht die Sicherheit. Wobei man nicht ganze Wände hochhackt. Aber für einige Meter im Blankeis können einige Stufen im Eis die Sicherheit bedeutend erhöhen. Für lange Blankeisstrecken gibt es zum Glück Eisschrauben. Beim Ritzen und Stufenschlagen leidet unter Umständen die Reaktionsfähigkeit des Bergführers oder der Bergführerin in Bezug auf das Seil. Sind die geritzten oder geschlagenen Tritte aber gut, reduziert dies die Wahrscheinlichkeit eines Ausrutschens oder Stürzens des Gastes enorm und ist deshalb oft sogar die sicherere Variante, als in einer schlechten Spur immer maximal aufmerksam sein zu müssen, um einen Ausrutscher oder Sturz des Gastes halten zu können. „Ein Tritt ist ein Tritt“, sagte Erich Sommer, einer der ehemaligen technischen Leiter in der Schweizer Bergführerausbildung, immer. Und von einem guten Tritt rutscht man nicht einfach so ab.
Es gibt auch Situationen, vor allem in Querungen bei sehr harten oder sehr weichen Verhältnissen im Firn/Schnee, bei denen ein Halten des Gastes im Falle eines Ausrutschers unwahrscheinlich ist. Besonders hier ist die einzige mögliche Risikoreduktion, das Tempo drastisch zu reduzieren und eine optimale Spurpräparation.
Das Ritzen einer Spur und das Stufenschlagen sind anspruchsvolle Pickelanwendungen, welche wir deshalb in der Schweiz in der Bergführerausbildung ausbilden, trainieren und auch prüfen. Während der geübte Bergführer eine Spur ritzt, nimmt der Gast im Idealfall keinen Rhythmus- oder Tempounterschied wahr.
68
„Ziel beim ‚Führen am kurzen Seil‘ ist es zu verhindern, dass der Gast (Masse) ungebremst Weg (Beschleunigung) machen kann, damit wir die daraus resultierende Energie kontrollieren können.“ Reto Schild
Eine der vier Säulen: Das Anlegen und „Ritzen“ einer guten Spur ist ein wichtiger Teil der Bergführerarbeit und gehört genauso zum Risikomanagement wie der Umgang mit dem Seil. Foto: Reto Schild

69 | unsicherheit
y Kommunikation mit dem Gast, Coaching
Die Kommunikation hat oft einen direkten Einfluss auf die Leistung eines Gastes. Beruhigende Worte können eine allfällige Anspannung positiv beeinflussen. Oder eine Anleitung zur bevorstehenden Kletterstelle lassen ihn diese rascher passieren. Die physische Nähe zum Bergführer wirkt sich oft vertrauensbildend aus. Dies bedeutet, dass es sinnvoll ist – wenn möglich –, nur kurze Abschnitte weiter voraus zu gehen, um den Blick- oder Rufkontakt nicht zu verlieren. Aber auch nonverbale Kommunikation und nonverbales Coaching sind sehr bedeutend. Das oben erwähnte Beispiel mit der präzisen Mikrowegfindung ist schließlich auch eine Form von Coaching. Wenn wir den Fuß präzise und entspannt auf den optimalen Tritt setzen, sind wir ein direktes Vorbild für den Gast und zeigen vor, wie die Stelle zu meistern ist. Auch über die Seilspannung lässt sich sehr gut und eindeutig kommunizieren. Geben wir für einen heiklen Schritt ein bisschen mehr Seilzug und suchen gleichzeitig Blickkontakt, kann das signalisieren: Ich bin bereit dir zu helfen und halte dich. Wir können den Gast über leichten Zug auch an den rechten Ort dirigieren, ohne zu sprechen, oder ihm dadurch signalisieren, dass er sich an dieser Stelle konzentrieren muss. Dies sind die vier Säulen, welche wir als unabdingbar für eine erfolgreiche und möglichst sichere Arbeit am kurzen Seil definiert haben. Jede ist wichtig. Situ-ativ ist einmal die eine, ein anderes Mal die andere von größerer Bedeutung.
Kooperation
Seit Herbst 2022 sind die Bergführerverbände der Schweiz, von Österreich, Deutschland und Südtirol als Redaktionsbeiräte bei bergundsteigen mit an Bord. Daher erscheint seither in jeder Ausgabe ein Beitrag dieser Verbände. Die Serie soll informieren und zugleich zu einem konstruktiven Austausch zwischen den Verbänden anregen und dadurch auch indirekt die Bergführerausbildung weiterentwickeln.

Resümee
Wichtig ist, die persönlichen Grenzen und Limits zu erkennen und zu akzeptieren. Bekanntermaßen ist die Seilhandhabung im Firn und Fels schwierig und komplex. Fehlt die nötige Übung, kann es rasch gefährlich werden. Mit einer umsichtigen und verantwortungsvollen Arbeitsweise und wachsender Erfahrung werden die vier Säulen gestärkt. Dadurch ist der Bergführer oder die Bergführerin in der Lage, das Risiko beim „Gehen am kurzen Seil“ im Felsen und Firn zu Gunsten seiner Seilschaft zu minimieren.
Last but not least: Geschwindigkeit ist gut, Effizienz im Handeln ist besser. Der „schnellste“ Bergführer muss nicht immer auch derjenige sein, der seinen Job am „besten“ macht. Der Zeitaufwand für eine Bergtour hängt immer von verschiedenen Faktoren ab (Verhältnisse/Gelände/Mensch). Zu einem professionellen Risikomanagement gehört es, diesen Umstand zu akzeptieren. Die schweizerische Berg-Unfallstatistik zeigt, dass der Trend zu immer mehr tödlich verunglückten Alpinisten geht, die seilfrei abstürzen. Und dies obwohl insgesamt in den Schweizer Bergen viel weniger „Soloalpinisten“ unterwegs sind als klassische Zweier- oder Dreierseilschaften. Glücklicherweise ereignen sich im Verhältnis zu allen geführten Touren aller Bergführer in den Schweizer Alpen pro Jahr, bei denen mit den Techniken des „kurzen Seils“ gearbeitet wird, wenige Seilschaftsabstürze im professionellen Bereich. Die Ausbildungsstruktur mit dem „Stufensystem“ und den vier Säulen wurde 2017 im Rahmen eines Treffens des Ausbildungskaders der Schweizer Bergführerausbildung erarbeitet. Seither wird in der Schweizer Bergführerausbildung nach dieser Struktur ausgebildet. 2018 wurde diese Ausbildungsstruktur im Montafon im Rahmen der Generalversammlung der Internationalen Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) den Vertretern anderer Bergführerausbildungen vorgestellt. Seither hat sich unsere Ausbildungsstruktur sehr bewährt und sie wird stetig weiterentwickelt. So entstanden auf Initiative der Bergsteigerschule Bergpunkt das darauf basierende „Merkblatt Hochtouren“ und Lehrvideos. Dieses Merkblatt wird seit 2022 in überarbeiteter Version vom SIB (Sicherheit im Bergsport) herausgegeben und dient auf verschiedenen Ausbildungsstufen als wichtige Ausbildungsgrundlage.
Auf der folgenden Doppelseite findet sich ein Überblick über die vierstufige Schweizer Ausbildungsstruktur.
70
Always there
Über die Schlüsselstelle hinaus. Sich besprechen, Probleme lösen, deiner Sicherung vertrauen. Die Verbindung, die beim Klettern entsteht, ist die stärkste von allen. Diese Partnerschaft begann vor 160 Jahren mit den ersten Mammut Kletterseilen. Daraus hat sich eine komplette Kletterkollektion entwickelt, die höchste Ansprüche an Sicherheit, Robustheit und Bewegungsfreiheit erfüllt. Wir halten dir den Rücken frei – durch die Schlüsselstelle und darüber hinaus.

Vier Stufen – Strukturierung der Seilhandhabung im Fels
Der Bergführer muss sich dauernd fragen, welche Gefahren in welchem Abschnitt der Tour relevant sind und wie er seine Seiltechnik diesbezüglich anpassen muss. Um diese Entscheidungsfindung zu strukturieren, verwenden wir ein vierstufiges System. Die Grenzen dieser Stufen sind fließend und müssen der Situation angepasst werden.
Vierstufige Struktur
Stufe 4 „Seillängen“
Beispiele / Beschreibung
Seil: „lang“, meist ganzes Seil offen. Das Gelände ist oft exponiert und schwierig. Es besteht eine erhöhte Gefahr, dass auch der Bergführer stürzen könnte. Stürze im alpinen Gelände sind oft lang und hart mit beträchtlichem Verletzungsrisiko. Beispiele: Badile Nordkante, Eiger ab Ostegg Schlüsselseillänge, Matterhorn Zmuttgrat.
Stufe 3 „Mikroseillängen“




Stufe 4
Nachsichern über Köpfl
Stufe 3 Nachsichern über Köpfl
Stufe 2 „kurze schwierigere Stellen“
Seil: „kurz bis mittellang“, oft 15 bis 20 Meter offenes Seil. Geländeangepasst nach dem Grundsatz „so kurz wie möglich, so lang wie nötig“. Das Gelände ist oft exponiert, nicht zwingend schwierig. Ein Sturz kann zum Absturz der Seilschaft führen. Beispiele: Eiger, Mittellegigrat, Matterhorn, Moseleyplatte, Schreckhorn, Normalroute Dent Blanche usw.
Nachsichern „Hand über Hand“
Stufe 2 Nachsichern „Hand über Hand“
Stufe 1 „gemeinsames Gehen“
Seil: „kurz“ ca. 6 bis 8 Meter offenes Seil. Kurze Aufschwünge oder plattige Passagen, welche ein gemeinsames Gehen nicht zulassen. Gemeinsames Klettern und gleichzeitiges Halten des Gastes sind nicht mehr möglich. Das Gelände ist meist nicht exponiert und wir können den Gast an einer ungefährlichen Stelle stehen lassen.
Seil: „kurz“ ca. 6 bis 8 Meter offenes Seil Das Gelände ist einfach, meist gestuft, es besteht eher Ausrutsch- als Absturzgefahr. Leichter waagrechter oder leicht an- oder absteigender Felsgrat.
Stufe 1
Seilhandhabung beim Gehen und Halten
72
Illustration: Georg Sojer
Effizienz wird angestrebt (Zeitaufwand für Standplatzsuche- und -bau beachten). y
Es wird von Stand zu Stand gesichert. y
Gast sichert den Bergführer – situativ Körper- oder Fixpunktsicherung. Der Bergführer hängt vorhandene Zwischensicherungen ein oder y bringt solche an.
Es müssen solide Standplätze gebaut werden (Schlingen, Friends, Keile, Haken). y
Ob eine Tour mit mehreren Gästen möglich ist oder nur mit einem, hängt in erster Linie von den Sicherungsmöglichkeiten und weniger von y der technischen Schwierigkeit ab.
Der Gast wird, wenn möglich, immer an gutem Zacken, Schlinge, Haken, einzelnem Friend usw. gesichert (Selbstsicherung). y
Bei sehr steilen Aufschwü ngen ist es sinnvoller, mit dem HMS an einer Bandschlinge zu sichern, als direkt mit dem Seil um die Zacken. y
Bei Schwierigkeiten oder einem Sturz des Gastes ist der Bergführer nicht blockiert und kann somit dem Gast einfacher helfen. y
Der Bergführer klettert mit angepasster Seillänge (Seilverkürzung) meist ungesichert zum nächsten sinnvollen Stand (bequemer Platz). y
Allfällige Zwischensicherungen dienen vor allem dem Seilverlauf und zur Vermeidung von gefährlichen Stürzen oder Pendlern des Gastes. y
Ist der Gast gesichert, muss das lose Seil nicht zwingend mitgenommen werden. y
Der Gast wird an gutem Stand nachgesichert (Zacken, Schlinge mit HMS, solider Haken, Friend usw.). y
Findet sich im Abstieg keine Selbstsicherungsmöglichkeit für den Gast, kann oder muss sich dieser hinsetzen. y
Klettert der Bergführer ab, kann der Gast das lose Seil einziehen (bei Zackensicherung darf er dabei sein Seil nicht loslassen). y
Der Bergführer braucht teilweise beide Hände zum Klettern. y
Ein Sturz oder Ausrutscher kann beim gemeinsamen Gehen nicht mehr gehalten werden. y
„Raupenmethode“: 2 bis 3 Schritte von einer guten Standposition zur nächsten. Nur eine Person bewegt sich. y Wir bewegen uns von „Insel zu Insel“ (Absatz, Kante, Kuppe, Mulde usw.). y
Der Gast bleibt auf gutem „Bödeli“ stehen (meist ohne Selbstsicherung) und der Bergführer klettert eine kurze Stufe/Stelle hoch y bis zum nächsten Absatz (Insel).
Der Bergführer kann das Seil aus Effizienzgründen in einer Hand mitführen und spürt dadurch ebenfalls allfällige Bewegungen des Gastes. y
Der Bergführer sichert den Gast von der nächsten „sicheren Insel“ situationsangepasst wie folgt: Das Seil straff in den Händen, mit der y Schulter- oder Hüftsicherung, unter dem fixierten Schuh, an Felszacken oder Fixpunkt.
Bei vorhandenen Zacken wird das Seil bergseitig geführt. y
Der Bergführer ist fähig, ohne Hände zu klettern (höchstens stützen oder kurz einen Griff halten). y
Der Bergführer und der Gast bewegen sich gemeinsam. y
Der Bergführer variiert den Seilzug je nach Situation. Wenig Zug, wenn es einfach zu gehen ist, umdrehen (Aufstieg) und y stärkeren Seilzug geben bei heiklem Schritt oder Zögern des Gastes (Kommunikation über das Seil).
Charakteristik 73 | unsicherheit ■


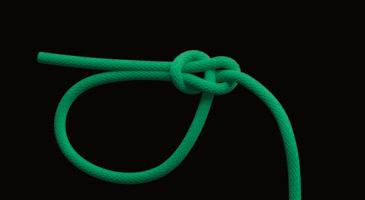



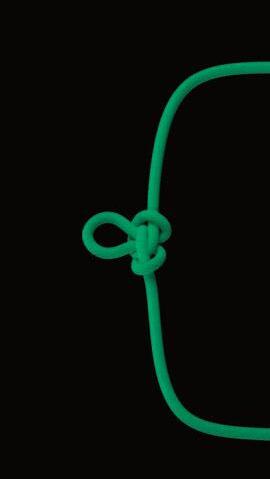









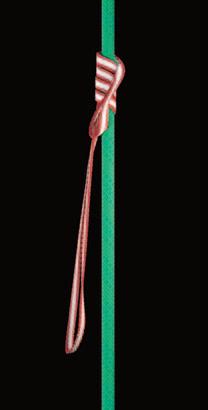








Knoten ÖAV Youtube Playlist Knoten
SicherAmBerg Lehrvideos
Vom sonnigen Gletscher in die Kanalisation
einigen TeilnehmerInnen da im flachen Fels, wo wir den Gletscher verlassen, plötzlich stolpert Helga (Name geändert) und rutscht auf dem Hintern mit den Steigeisen voraus auf mich zu. Obwohl ich vielleicht anderthalb Sekunden Zeit habe, bilde ich mir im Nachhinein ein, dass folgende Gedanken durch meinen Kopf strömten:
y Ich möchte nicht die nagelneuen Zacken ihrer Leihsteigeisen im Knie stecken haben. y Es ist ja kein Absturzgelände.
„Et hätt ja noch mal joot jejange“, so kennen wir das aus dem „kölschen Grundgesetz“ in meiner Heimatstadt. Wenn man dann einen Haken dranmacht, ohne was zu lernen und das Gelernte zu teilen, macht das Grundgesetz keinen Sinn, wohlan:
27.7.2022, ich bin als Bergführer unterwegs mit acht Gästen im „Grundkurs Fels und Eis“ von der Turtmannhütte zur Tracuithütte, Wallis. Erst wandern durchs steile Gässi, dann eine kurze Querung über einen Ausläufer des Brunegggletschers, der auf der Schweizer Landeskarte tatsächlich drei g hintereinander hat, aber wie alle Alpengletscher ansonsten eher kürzer und vor allem dünner wird. Schließlich über den lohnenden Klettersteig zur Adlerflue und weiter Richtung Col du Tracuit.
Bei dieser kurzen Querung, insgesamt vielleicht 60 Meter, passiert es: Ich schlage ein paar Stufen im ersten Steilstück, dann geht’s ein bisschen rauf und, mit vielleicht 20 Grad Gefälle, ca. acht Meter wieder runter in die flachen Felsen. Ich gehe dort mehrmals im Jahr durch und habe an dieser Stelle noch nie gesichert. Wir gehen mit Steigeisen, aber seilfrei. Ich stehe mit
Sie kam richtig geruhsam auf mich zu und ich habe sie nur ein bisschen seitlich nach links abgelenkt. Sie ist dann in der Randkluft zwischen Eis und Fels stecken geblieben und hat laut und schnell geatmet. Der Fels hinter ihr ist steil und glatt, ich kann mich nur vom Eis aus nähern und einen Fixpunkt bauen. Ich springe im Fels los, um sie schnell aus dieser misslichen Lage zu befreien, dabei bricht der Verbindungssteg meines Steigeisens. Ich rufe einem Teilnehmer neben mir zu: „Gib mir schnell dein rechtes Steigeisen!“ Gleiches Fabrikat wie meins, schnell eingestellt und angelegt. Ich setze oberhalb von Helga zwei Eisschrauben, baue einen Expressflaschenzug und werfe ihr das Seil mit Schrauber zu. Dabei segelt in der Hektik mein Pickel links von ihr in die Randkluft. Sie hängt sich ein, ich zieh’ sie raus, alles gut. Sie ist unverletzt und beruhigt sich schnell wieder. Ich schau nochmal in die Randkluft, sehe meinen Pickel nicht und entscheide, ohne ihn weiterzugehen:
y Wir sind spät dran, ich will weiter. y Es sind noch acht Pickel in der Gruppe, man braucht ihn nur für Notfälle. y Ich bin in zwei Wochen nochmals hier auf Tour, dann hole ich in Ruhe meinen Pickel.

76 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Tobias Bach über einen Beinaheunfall wegen des Klimawandels
bs
verhauer Beim Bergsteigen passieren ständig Fehler, die beinahe zu Unfällen führen. Niemand spricht gerne darüber. Wir schon!
Zwei Wochen später. Am Vortag der fraglichen Querung gehe ich nach dem Tagesprogramm meinen Pickel holen. Ich baue wieder einen Stand im Eis und lass mich in die Randkluft ab, vielleicht zwei Meter weiter links. Dann der Schock und Grund für diesen Artikel: ca. 75 Grad steiler, schlonziger Fels, ca. sechs Meter, dann ein reißender Bach unterm Gletscher.
Will sagen: Wäre Helga zwei Meter weiter links abgerutscht, dann wäre sie vermutlich genauso auf nimmer Wiedersehen verschwunden wie mein Pickel.
Feiern wir also das (Über-)Leben, ihr physisches und meins in relativer Unbeschwertheit und fassen wir die Learnings zusammen:
y Im Klimawandel verändern sich die Berge schnell und die Gletscher noch schneller. Sei also auch auf Touren, die du wie deine Westentasche kennst, offen für neue Probleme!

y Wenn du denkst, es wird heikel, nimm dir einen Moment Zeit, um auf die beste Lösung zu kommen.
y Beobachte deine Mitgeher*innen: Beherrschst du das kurze Seil, dann sichere Unsichere auch, wenn die Absturzgefahr nur kurz und nicht so wild ist, ansonsten braucht’s halt Fixpunkte.
y Hast du ein Problem kleiner oder mittlerer Größe, mach es nicht zu einem großen! In meinem Fall: Ich überlegte kurz, ob ich nach dem Steigeisenbruch mit nur einem Steigeisen zu Helga springe. Da, wo ich in Falllinie über ihr stehen musste, um den Stand zu bauen, war’s aber schon ganz schön steil und blank. Da wäre ich schlimmstenfalls noch auf sie draufgedonnert. ■
77
Das neu entstandene Loch auch bekannt unter Randkluft. Foto: Manfred Kröpfli
| verhauer
Tobias Bach, meist Bergführer (gebirgsbach.de), manchmal systemischer Coach (inbewegung.com) und Sportwissenschaftler (Psychologie), lebt in Köln und mittlerweile beruflich auch in Tirol.
bs bergsönlichkeit
Mensch, der beruflich oder ehrenamtlich mit Risiko im Bergsport in Verbindung steht.
Fabianos Blick in die Schneedecke von morgen
Interview mit dem SNOWPACK-Experten Fabiano Monti (geb. 1981) aus Livigno: über seinen lokalisierten Lawinenlagebericht für den Skiort in der Lombardei, die virtuelle Modellierung von Schneeprofilen und seine Zusammenarbeit mit den lokalen Bergführern.
Von Claus Lochbihler
Wie kommt es, dass Livigno einen eigenen Lawinenlagebericht herausgibt?
Das hat letztlich mit der etwas komplizierten Rechtslage in Italien zu tun, was das Skifahren im freien Gelände angeht. Wenn jemand eine Lawine auslöst, wird in Italien immer ermittelt. Selbst, wenn niemand verletzt wurde. Das hat mit einem alten Gesetz aus den – ich glaube – 30er-Jahren zu tun. Wenn du etwas auslöst, was Gefahr nach sich zieht, wird ermittelt. Bis 2013 war es praktisch unmöglich, das Freeriding hier offiziell zu promoten. Bei einem 3er waren Aktivitäten abseits der Pisten verboten. Der Bürgermeister musste befürchten, in Haftung genommen zu werden, falls etwas passiert. 2018 hat sich die Gesetzeslage etwas verbessert. Seitdem ist der Bürgermeister nur noch für das überwachte, gemanagte Gelände verantwortlich. Nicht mehr für das freie Gelände.
Was hältst du von dieser Rechtslage?
Ich glaube, dass die Nachteile überwiegen. Weil es dazu führt, dass die Leute sich bedeckt halten oder Lawinen, die glimpflich ausgegangen sind, verheimlichen. Das verhindert den Austausch und dass wir aus unseren Fehlern lernen.
Seit 2013 gibt es das Freeride-Projekt, das du mit deiner Firma ALPsolut für Livigno umsetzt – auch als Antwort auf diese Rechtslage?
Mit dem Freeride-Projekt versuchen wir, die bestmögliche Information zur lokalen Lawi-
nenlage zur Verfügung zu stellen und auf möglichst vielen Kanälen zu kommunizieren – im Netz, per Mail, im lokalen Fernsehen, im Skigebiet. Wir erläutern den Leuten sogar persönlich in meinem Büro den Lawinenlagebericht, wenn sie das wollen.
Was ändert das an der Rechtslage?
Wir könnten im Fall des Falles schlüssig argumentieren, dass die Kommune alles getan hat, um die Infos zur Verfügung zu stellen, die jemand braucht, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob er die Piste verlässt oder nicht. Das ist die Idee dahinter. Wie es im Fall des Falles juristisch ausgehen würde, ist allerdings immer noch etwas unklar. Das drückt sich auch in der Versicherungssumme aus, die ich für meine Firma jährlich zahlen muss: 5.000 Euro. In der Schweiz wären es nur 1.000.
Ist der Lawinenlagebericht, den du für die 200 Quadratkilometer rund um Livigno erstellst, der präziseste, lokalisierteste Lagebericht der Alpen?
Ich bin nicht so der Marketing-Typ. Deswegen würde ich sagen: Es ist einer der präzisesten und regionalsten und deswegen wahrscheinlich auch einer der besten Lageberichte in den Alpen. Von daher wäre es nicht schlecht, wenn es das, was wir in Livigno bieten, in ähnlicher Form auch anderswo gäbe. Man muss natürlich dazusagen, dass es leichter ist, sich auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet wie das unsrige zu konzentrieren. „Normale“ Lawinenwarn-
78 / bergundsteigen #122 / frühling 23
dienste müssen viel, viel größere Gebiete abdecken, was schwierig ist, gerade auch weil die Bedingungen da sehr unterschiedlich ausfallen. Wir bekommen auch sehr viel Unterstützung von den lokalen Bergführern – das macht die Arbeit nochmal leichter.
Könnten größere LWD auch kleinräumiger arbeiten?
Die Schweizer haben ein sehr flexibles System – die könnten das schaffen. Aber auch nur für Regionen, die größer sind als unser Zuständigkeitsbereich.
Wie kamen Fabiano Monti und Livigno überhaupt zusammen? Du stammst ja nicht von dort, sondern aus Como. Als ich mit meiner Doktorarbeit am SLF in Davos fertig wurde, hätte ich einerseits die Möglichkeit gehabt, weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Aber das wäre wieder nur für ein paar Jahre gewesen. Außerdem wollte ich lieber vom und vor allem im Schnee leben. Und meine Erfahrung und wissenschaftliche Arbeit möglichst praktisch anwenden.
Mit Livigno verband mich, dass ich dort meine Ausbildung zum Snowboard-Lehrer absolviert und schon immer viel Zeit verbracht habe. Also bin ich zum Bürgermeister gegangen und habe ihm meine Idee vorgestellt: dass ich eine Firma gründen möchte, die sich um praktisch anwendbare Schneeund Lawinenanalyse dreht. Und ob wir da nicht zusammenarbeiten könnten. Mein Vorschlag stieß auf Interesse, weil Livigno großes Interesse an Freeride-Gästen hatte. Ich habe dann mein Konzept zu Papier gebracht, es ein paar Mal vorgestellt, und im Winter 2013/14 damit begonnen, es umzusetzen.

Erinnerst du dich an diesen ersten Winter?
Es war stressig, weil ich parallel zur Verteidigung meiner Doktorarbeit alles für die Webseite und den neuen Lagebericht vorbereiten musste. Außerdem hatten wir am 24. Dezember 2013 zum Start unseres Lawinenlageberichts Warnstufe 4. Wir mussten damals sogar Teile des Skigebiets schließen, was
seitdem aber nicht mehr vorgekommen ist. Seitdem ist eigentlich alles ziemlich gut gelaufen. Wir haben mit dem Lagebericht begonnen. Und seitdem ist vieles dazugekommen.
Was?
Meine größte Aufgabe ist nach wie vor der Lawinenlagebericht. Daneben bin ich für die überwachten und markierten Aufstiegsrouten zuständig und die Lawinensicherheit der Straßen und Loipen. Auch mit dem Snowfarming habe ich beratend zu tun. Außerdem briefe ich die Bergführer für das Heli-Skiing.
Ist es manchmal schwierig, mit so viel Verantwortung umzugehen?
Am Anfang war es seltsamerweise einfacher, weil mir da gar nicht so klar war, wie viel Verantwortung mein Job mit sich bringt. Jetzt ist mir das bewusst. Und es ist manchmal schon eine Belastung. Dafür genieße ich jetzt Vertrauen, das ich mir zu Beginn erst mal erarbeiten musste – gerade auch bei den Bergführern. Damals haben wir alle Infos und Erfahrungen auch noch nicht so offen geteilt wie heute. Was uns zusammengeschweißt hat, war ein Unfall. Beziehungsweise dessen Verarbeitung. Ein Gast kam in Begleitung eines Bergführers in einer Lawine ums Leben. Wir haben damals alle versucht, den Bergführer zu unterstützen. Das war dem gegenseitigen Verständnis sehr förderlich. Manchmal entstehen aus den ganz schlechten Dingen auch gute.
Wie sieht ein normaler Tag im Leben des Fabiano Monti aus, wenn es in der Nacht kräftig geschneit hat?
Die erste Priorität haben die Straßen und Langlaufloipen, weil manche Abschnitte lawinengefährdet sind. Es geht also zuerst um Sperrungen. Anschließend um eventuelle Sprengungen. Da haben die Straßen Vorrang. Dann muss ich klären, was sich im Skigebiet mit den Pistenraupen entschärfen lässt und wo wir sprengen müssen. Um das offene Terrain kümmere ich mich als Letztes. Auch um das Heli-Skiing, das wir am ersten
79
| bergsönlichkeit
„Meine größte Aufgabe ist nach wie vor der Lawinenlagebericht.“
Fabiano Monti. Foto: Daniele Castellani
Tag nach starken Schneefällen ohnehin nicht anbieten. Manchmal auch länger nicht. Zum einen weil wir den Heli für Sprengungen benötigen, zum anderen weil es zu gefährlich wäre. Das Heli-Skiing-Terrain in Livigno ist viel exponierter und steiler als zum Beispiel Heli-Skiing-Gelände in Kanada, weil das Gelände, das man in Kanada mit dem Hubschrauber anfliegen würde, hier vom Skigebiet genutzt wird.
Wie kam es überhaupt dazu, dass es in Livigno Heli-Skiing gibt?
Als wir die Straßen von Livogno nach Italien und in die Schweiz auch im Winter offen halten sollten, war klar, dass das für die Sprengungen nicht ohne Heli gehen würde. Und dass wir dafür einen in Livigno stationierten Hubschrauber brauchen, weil der aus Sondrio 25 Minuten bis Livigno fliegt. Das wäre viel zu teuer. Wir mussten den Heli irgendwie gegenfinanzieren. So kamen wir 2014 auf die Idee mit dem Heli-Skiing.
Du bist auch für deine Arbeit mit SNOWPACK bekannt. Kannst du uns erst einmal erklären, was das ist? SNOWPACK ist ein Open-Source-Tool, das vom Schweizer SLF entwickelt wurde. Es modelliert die Entwicklung der Schnee-

decke – in ihrer Schichtung, aber auch den Mikrostrukturen – basierend auf den Daten automatischer Wetterstationen oder auch von Wetterprognosen, indem es die physikalischen Prozesse zwischen Atmosphäre, Schnee und dem Boden simuliert. Also zum Beispiel, wie viel Wärme und Energie die Schneedecke aufnimmt oder abgibt. Die Schweizer setzen es ein, um ihre Lawinenprognostiker zu unterstützen.
Man kann es also prognostisch einsetzen?
Ja. Für bis zu drei Tage im Voraus. Das ist der ganz große Vorteil. Es erlaubt einen Blick auf die Entwicklung der Schneedecke von morgen oder übermorgen. Es liefert die Modellierung eines Schneeprofils, das es so noch gar nicht gibt.
Wie setzen du und deine Kollegen das Programm ein?
Als ich angefangen habe damit zu arbeiten, war mir klar, dass das eine großartige Sache ist. Aber es war mir zu reduktiv. Deswegen habe ich angefangen, immer mehr Daten und Informationen von automatischen Wetterstationen einzuspeisen. Auch um damit die Entwicklung der Schneedecke am Standort der Messstation zu simulieren.
Fabiano Monti unterwegs auf Skiern oberhalb von Trepalle.
Foto: Daniele Castellani
80
„SNOWPACK ist ein Open-Source-Tool, das vom Schweizer SLF entwickelt wurde. Es modelliert die Entwicklung der Schneedecke.“
Wie unterstützt es dich als Lawinenprognostiker?
Indem es mir alle relevanten Parameter liefert, die ich als Lawinenprognostiker für einen Lawinenlagebericht benötige. Vor drei Jahren etwa habe ich einen Parameter entwickelt, der es einem erleichtert, die Instabilität der Schneedecke durch Durchnässung besser einzuschätzen: Bis in welche Tiefe wird die Durchnässung vordringen? Erreicht sie eine Schwachschicht, die dadurch ausgelöst werden könnte? Wo und wann wird der Schnee sumpfig? Gibt es Nassschnee auch im Nordsektor? Bis in welche Tiefe gefriert die Schneedecke in der kommenden Nacht? Das alles kann man aus der Simulation herauslesen. Oder ein anderer, ganz wichtiger Indikator: Schneeverfrachtung.
Klingt easy, ist aber gar nicht so einfach zu simulieren, weil sie ja nicht nur von der leicht messbaren Windstärke und -richtung, sondern von der Schneequalität abhängt. Es gibt Tage mit 50 Stundenkilometern Wind –aber der Schnee ist so hart, dass es nichts zu verfrachten gibt. An anderen Tagen reicht schon viel weniger Wind, um kalten, lockeren Schnee massiv zu verfrachten.
Welche Daten müssen die Wetterstationen liefern, damit du ein SchneedeckenModell mit SNOWPACK simulieren kannst?
Zuerst einmal natürlich die üblichen: die Schneehöhe, den Niederschlag, Windstärke und -richtung etc. Ganz wichtig für die Simulationen mit SNOWPACK ist, dass wir die Strahlung messen, also die Lang- und Kurzwellen, weil sich darüber die Massenund Energiebilanz der Schneedecke berechnen lässt. Deswegen mussten wir einige Stationen auch mit zusätzlichen Sensoren ausstatten.
Was kostet eine solche Station?
Die, die ich aufgebaut habe und betreue, gibt es ab 15.000 Euro.
Wer arbeitet außer dir mit SNOWPACK?
Die Schweizer natürlich, alle italienischen Lawinenwarndienste, für die wir das Programm zur Verfügung stellen, und der LWD Tirol, der uns für Simulationen Daten schickt. Außerdem arbeiten wir für Andorra und die Österreichischen Bundesbahnen. Außerdem für Kanada, was eine gewisse Herausforderung darstellt.
Weshalb?
Weil es dort nur sehr wenige Wetterstationen gibt und das Land so riesig ist. Deswegen gibt es nur wenige Daten zur Schneehöhe, die auf automatisierten Messungen beruhen. Und Wettermodelle, auf die man deswegen zurückgreifen muss, sind immer noch sehr schlecht bei der Vorhersage von Niederschlagsmengen in den Bergen. Das ist oft ein Problem: Vorhergesagt sind 50 Zentimeter, aber tatsächlich fällt dann ein Meter. Dabei ist die exakte Messung der Schneehöhe ein extrem wichtiger Parameter für das Funktionieren der Modellierung. Das ist ein Fehler, der sich dann fortschreibt und die Ergebnisse verschlechtert. Für die Strahlung funktionieren die Wettermodelle schon sehr gut. Aber was die Schneehöhe angeht, gibt es noch immer nichts Besseres als das Messen.
Wie vermeidet ihr solche sich fortschreibenden Fehler?
Indem wir das Programm ständig mit neuen Messdaten füttern. Wir lassen die Modellierung zu jeder vollen Stunde laufen.
Was ist für dich mittlerweile wichtiger: die Simulation der Schneedecke auf SNOWPACK oder ein echtes Schneeprofil?
Für mich die Simulation. Das mag daran liegen, dass ich schon so lange mit dem Programm arbeite. Für andere Lawinenprognostiker ist es vielleicht nicht so leicht zu nutzen wie für mich – aber wir arbeiten daran, dass der Output des Programms leichter zu verwenden und zu lesen ist.
Auch für Kollegen, die damit nicht so vertraut sind. Aber natürlich graben wir immer noch echte Profile – in der Regel mindestens eins pro Woche. In der Regel dort – in einer Höhenlage oder Exposition –, wo wir annehmen, dass es da ein Problem mit der Stabilität der Schneedecke geben könnte. Oft finden wir dann genau das, was wir – auch aufgrund der Schneedeckensimulation –erwartet haben. Oft ist es aber zu gefährlich, dort zu graben, wo man gerne in die Schneedecke schauen würde. Umso besser, dass das auch per Computer geht.
Kannst du dich an dein erstes Schneeprofil erinnern?
Das war in den Dolomiten, als ich 2007 im Rahmen meiner Magisterarbeit mal 8 Monate in Arabba verbracht habe. Dort habe
ich auch das Freeriden entdeckt und die Skitouren. Und musste mich deswegen auch intensiver mit Lawinen und Schneeverhältnissen auseinandersetzen. Zum Glück hatte ich dort beim regionalen Lawinenwarndienst drei wunderbare Mentoren. Die Basics habe ich alle dort gelernt.
Vergleichst du manchmal das Ergebnis des simulierten Schneeprofils mit einem wirklich gegrabenen?
Klar. Wir machen das zum Beispiel, wenn die Modellierung Fragen aufwirft oder unklare Ergebnisse zeigt. Aber generell ist die Modellierung sehr akkurat und verlässlich. Sie ist nicht selten sogar präziser und repräsentativer als ein schlecht gegrabenes oder nicht wirklich repräsentatives Schneeprofil. Man muss natürlich trotzdem im Kopf behalten, dass es nur eine Modellierung ist und nicht die Realität. Ähnlich wie eine Wettervorhersage, die auf einem Wettermodell oder – im besseren Fall – auf mehreren beruht. Eine Modellierung ist immer nur eine Vereinfachung der Realität.
Kannst du das an einem Beispiel festmachen?
Wenn es Neuschnee gibt, geht unsere Modellierung für die Prognose von einer Korngröße von 0,3 Millimetern aus. Wir müssen einen Wert annehmen, weil wir ja nicht wissen können, welche Korngröße der Neuschnee haben wird. Wenn wir dann am nächsten Tag ein Profil graben, sehen wir, dass die Korngröße in Wirklichkeit 1,5 mm beträgt. Das macht natürlich einen Unterschied. Man muss also lernen, wie man diese Modellierung richtig benutzt, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Aber beim richtigen Schneeprofil war das auch nicht anders. Seit den 30er-Jahren lesen und analysieren wir Schneeprofile und haben eine richtige Wissenschaft daraus gemacht. Simulierte Profile verwenden wir erst seit ein paar Jahren. Auch das wird sich weiter verbreiten und intensivieren. Aber letztlich ist jedes Schneeprofil – ob gegraben oder simuliert –nur ein Puzzlestück von vielen.
Kannst du das genauer erklären?
Jeder, der sich auskennt, weiß, dass es falsch ist zu denken: „Jetzt habe ich ein Profil gegraben, die Schneedecke sieht stabil aus, alles okay!“ So viele Profile kann man gar nicht graben, nicht einmal simulieren, dass man von so etwas ausgehen kann. Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass wir
81
| bergsönlichkeit
keine Gewissheiten, sondern nur Wahscheinlichkeiten und Risiken kommunizieren. Es kommt vor, dass wir eine Piste sperren, trotzdem fahren zehn Leute ein – und es passiert nichts, weil sie einfach nur Glück hatten.
Hattest du schon mal so ein „Glück gehabt!“-Erlebnis?
Klar.
Zum Beispiel?
2017 habe ich im Valle del Cantone, wo ich oft unterwegs bin, Anfang März bei Lawinenwarnstufe 3 ein Schneeprofil gegraben. Das Ergebnis: eine Schwachschicht, eingepackt unter 1 Meter 50, die sich aber von einem Skifahrer nicht auslösen ließ. Sechs Tage später kam ein Sturm aus Nordwest mit 150 Stundenkilometern, der alles, aber wirklich alles ausgelöst hat. Das ganze Tal, wo ich zwei Tage vorher noch Ski gefahren war, war abgegangen!
Das bedeutet?
Dass man permanent so viel Info sammeln muss wie möglich, wenn man sich ein Bild von der Schneedecke und ihrer Stabilität oder Instabilität verschaffen will. Das ist wie ein Puzzle, bei dem es kleine und größere Teile gibt, das aber nie restlos vollständig sein wird. Und ein Schneeprofil ist eben nur ein Puzzlestück von vielen. Deswegen ist es auch für einen Lawinenprognostiker so wichtig, sich auf Skiern im Schnee und im Gelän-
dezu bewegen. Nicht nur, weil das Skifahren und Tourengehen so schön ist. Sondern weil man da das Gesamtbild wahrnimmt. Zum Beispiel wie sich die Bedingungen und die Schneequalität mit der Höhenlage verändern. Letztlich ist auch das Skifahren selbst ein Belastungstest: Wenn wir im Abseits der Piste skifahren, testen wir jedes Mal die Schneedecke. Das muss man sich immer wieder klarmachen.
Was sind die anderen Puzzlestücke?
Ein ganz, ganz großes und wichtiges ist die Lawinenaktivität. Je neuer, desto relevanter. Und nochmals relevanter, wenn die Lawinenaktivität mit den Bedingungen zu tun hat, unter denen ich mich auf Skiern bewege. Wir haben ein Tool, in dem wir alle größeren Lawinenabgänge abspeichern: Inklusive Fotos, Lawinenpfad, Lawinentyp, Auslösepunkt etc. Das ist sehr praktisch.
Wird es das, was du auf deinen Rechnern laufen lässt, eines Tages auch als App auf dem Smartphone eines Freeriders oder Tourengehers geben?

Ja. Denkbar wäre zum Beispiel, dass das Programm lernt, die Lawinenprobleme aus den Daten herauszulesen. Aktuell muss der Benutzer der Simulation das noch selbst machen. Man könnte auch an einem Indikator für Schneequalität arbeiten, der einem sagt, wann man in welchen Expositionen und Höhenlagen mit Bruchharsch, Firn, Nassschnee
oder Pulver rechnen kann. Ich denke, dass wir zuerst weiter an der Datenaufbereitung für die Prognostiker arbeiten. Danach kann es auch darum gehen, den Endnutzer zu bedienen.
Wie groß ist eigentlich dein Team?
Wir sind inklusive mir vier feste Mitarbeiter. Dann würde ich auch die Bergführer von Livigno dazuzählen, weil wir wirklich sehr eng, also praktisch täglich, zusammenarbeiten. Dann gibt es noch Leute, die sich um unsere abgesicherten Aufstiegsrouten für Touren- und Schneeschuhgänger kümmern. Und dann haben wir noch drei freie Mitarbeiter, die unsere Software und IT pflegen und programmieren: darunter ein Mathematiker, der außerdem Bergführer ist, und ein Physiker.
Wie sieht eure Zusammenarbeit mit den lokalen Bergführern aus?
Sie kommen ab 7:00/7:30 Uhr bei mir im Büro vorbei. Und dann tauschen wir uns aus. Ihre Beobachtungen und ihre Expertise fließen mit ins Bulletin ein, das wir um 8 Uhr veröffentlichen. Um 8:30 gibt es dann noch einmal ein verpflichtendes Meeting für die Guides, die an dem Tag Heli-Ski-Kunden führen. Da gibt es ein Briefing über die Lawinenlage und die Schneeverhältnisse und wir besprechen, welche Abfahrten an dem Tag möglich sind und welche nicht. Am Nachmittag berichten sie mir, was sie im Gelände
82
Fabiano Monti und Mirko Frigerio, Praktikant beim Livigno Avalanche Center, analysieren die Korngröße von Schneekristallen. Foto: Daniele Castellani
beobachtet haben. Wir haben eine wirklich enge Zusammenarbeit. Wenn ich mein Handy öffne, sehe ich jedes Mal einen Haufen neuer Bilder von Lawinen und Schneebedingungen. Und dazwischen ein paar alberne Sachen. Lacht. Oft rufen auch externe Bergführer an, um sich über die Bedingungen bei uns zu informieren. Auch um zu entscheiden, ob sie überhaupt nach Livigno kommen.
Was bringt dir Arbeit im Team?
Es ist immer gut, sich im Team zu unterhalten – erst recht, wenn das unter Leuten mit guter Ausbildung und viel Erfahrung geschieht. Aber auch da gibt es sehr subjektive Faktoren, die manchmal von der psychologischen Tagesform abhängig sind: Jemand brennt auf eine Tour und blendet vielleicht deshalb die Risiken aus. Wenn er seine geplante Tour im Team diskutiert, wird ihm das vielleicht bewusst. Oder andere weisen ihn darauf hin.
Es kommen ja nicht nur die Bergführer in euer Büro, sondern auch Tourengeher und Freerider, die sich von euch beraten lassen können. Wie viele kommen da am Tag?
Zu viele (lacht). Nein, wir wollen ja, dass sie kommen! Aber es ist schon ein Zeitfaktor. Manchmal sind es fünf, manchmal auch zehn. Ich denke, dass der direkte Austausch, den wir mit Bergführern, aber auch ganz normalen Gästen pflegen, das ist, was an unserem Ansatz hier in Livigno wirklich besonders ist. Und auch wir lernen daraus.
Inwiefern?
Weil wir besser verstehen, ob und wie die Nutzer die Info, die wir zur Verfügung stellen, lesen und verwenden. Und was sie vielleicht zusätzlich benötigen.
Zum Beispiel?
Nehmen wir die Bergführer. Die orientieren sich viel weniger als ein normaler Tourengeher an der Warnstufe, sondern zum Beispiel an den Lawinenproblemen. Ein 3er bei gut erkennbaren Schneebrettern ist im Gelände viel leichter zu handeln als ein 3er, bei dem Neuschnee den Triebschnee überdeckt.
Ganz zu schweigen von Schwachschichten in der Altschneedecke. In der reinen Gefahrenstufe werden diese Unterschiede aber nicht kommuniziert. Deswegen ist es sinnvoll, Zusatzinformationen zu geben, die über das reine Bulletin hinausgehen und die einem helfen, sich möglichst sicher im Gelände zu bewegen. Ich finde zum Beispiel den Blog sehr gut, den es auf der Euregio-Seite gibt.
Wie sprichst du mit Freeridern oder Tourengehern, die keine Bergführer sind?
Ich versuche erst einmal herauszufinden, was es an Vorwissen gibt. Damit ich verstehe, welche Informationen ihnen helfen und wie ich das formulieren muss.
Wie machst du das?
Ich stelle kleine Zwischenfragen. Man darf nie direkt fragen: Kennen Sie sich mit Lawinen aus? Da antwortet jeder: Ja. Deswegen frage ich Sachen wie: Wie finden Sie Harsch?
Fabiano Monti (stehend) und Lawinenprognostiker Luca Dellarole werfen einen Blick auf ein virtuelles Schneeprofil. Die Simulation bildet ein stundenaktuelles Schneeprofil und die gesamte Schneedeckenentwicklung der Saison ab. Foto: Sam Confortola

83
| bergsönlichkeit
„Letztlich ist auch das Skifahren selbst ein Belastungstest: Wenn wir im Abseits der Piste skifahren, testen wir jedes Mal die Schneedecke. Das muss man sich immer wieder klarmachen.“
Wenn dann zurückkommt „Was ist das?“, weiß ich Bescheid, dass das kein Experte sein kann. Oder ich frage, wo sie die Lawinenausrüstung geliehen haben oder ob das ihre eigene ist. Ein erfahrener Tourengeher und Freerider ist immer mit seinem eigenen Sicherheitsequipment unterwegs.
Wie redest du dann mit den Leuten über die Lawinenlage?
So, dass sie es verstehen. Das Gute ist ja, dass ich mich im Gespräch nicht an den Katalog von Sätzen halten muss, mit denen wir das Bulletin formulieren. Da kann ich viel freier formulieren.
Und um was für Themen geht es?
Das ist ganz unterschiedlich. Die einen wollen nur wissen, wo sie auf der Piste den besten Schnee finden. Der andere war noch nie abseits der Piste, will es aber mal versuchen und braucht dafür einen Tipp. Andere wollen für ihre Skitour den Lawinenlagebericht erläutert bekommen. Es geht manchmal auch darum, den Leuten zu erklären, was die Farbschattierungen bedeuten, wo Wildschutzgebiete eingetragen sind und warum. Wir bieten außerdem noch einen Stammtisch in einem Restaurant an, zu dem jeder kommen kann.
Um was geht es da?
Ums Biertrinken (lacht). Nein, wir stellen Skitouren vor, die zum Lagebericht passen. Geben einen Einblick in unsere Arbeit, erklären zum Beispiel, wie man einen Lagebericht richtig liest. Und zwischendurch trinken wir natürlich das eine oder andere Bier. Auch bei dem Stammtisch hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, immer mit Fotos und Videos zu arbeiten. Da verstehen die Leute viel schneller, worum es geht.
Kommen nach Livigno eigentlich mehr Freerider als Tourengeher?
Der typische Off-Piste-Gast macht Ski plus: er kombiniert Lifte mit Aufstiegen. Und kommt so natürlich auf wesentlich mehr Abfahrten als ein reiner Tourengeher. Das bedeutet aber auch mehr Gelände, mehr Abfahrtsmeter, mehr Expositionen, mehr Risiko. Dafür sollte man gut vorbereitet und ausgebildet sein. Hinzu kommt, dass sie auch sehr viel im Hochwinter und bei Neuschnee unterwegs sind. Da ist die Lawinenlage, wie wir alle wissen, oft viel komplexer als bei guten Frühlingsbedingungen, wo es seltener Probleme mit Schwachschichten,
Triebschnee etc. hat. Im Frühling muss man sich oft nur mit einem der fünf Lawinenprobleme auseinandersetzen: der Erwärmung. Und wenn man das durch gutes Timing gut handhabt, hat man schon sehr viel richtig gemacht.
Wie würdest du das Gebiet von Livigno charakterisieren, schnee- und lawinentechnisch?
Livigno ist das letzte Gebiet, das auch von Norden her Schnee bekommt. Wir bekommen insgesamt wegen der inneralpinen Lage natürlich weniger Schnee als die Berge am Alpenrand. Dafür bleibt er wegen der Höhenlage aber auch lange liegen, wenn er mal liegt. Wegen der Kälte und der nicht so hohen Schneemengen gibt es bei uns sehr oft aufbauende Umwandlung bzw. Faceting, was natürlich die Entstehung von Schwachschichten begünstigt. Wir haben Schneeund Lawinenbedingungen, die oft mehr mit denen im Engadin zu tun haben als mit denen im Rest der Lombardei. Genau das spiegelte der Lawinenlagebericht vor 2013 oft nicht wider.
Vom Gelände her ist es so, dass sehr viel Terrain steiler als 30 Grad ist, wenn auch nicht sehr viel steiler. Also perfektes Lawinengelände, zumal es oft nicht so steil und gefährlich aussieht. Livigno ist vom Gelände her trotzdem viel freundlicher und weniger extrem als Chamonix, wo viele Abfahrten nur für absolute Profis geeignet sind. In Livigno braucht man nicht so viel Erfahrung wie in Chamonix, um Freeriden zu gehen.
Wie viele Lawinenereignisse und Tote zählt ihr pro Saison?
Wie überall hat die Zahl der Lawinenereignisse auch bei uns zugenommen – aber nicht die Zahl der Opfer, obwohl so viel mehr Skifahrer im offenen Gelände unterwegs sind. Pro Saison haben wir fünf bis zehn Lawinen mit Personenbeteiligung. In Wirklichkeit sind es vermutlich mehr, aber nicht jede Lawine wird gemeldet, vor allem wenn es glimpflich ausgeht.
Wie hat sich die Zahl der Lawinentoten entwickelt?
In den zehn Jahren bis 2012 gab es hier leider acht Lawinentote. In den vergangenen zehn Jahren hatten wir vier Lawinentote, obwohl die Zahl der Skifahrer, die abseits der Pisten unterwegs sind, enorm zugenommen hat.
84
„Ich hoffe, dass immer mehr der vermeidbaren Unfälle vermieden werden. Auch durch unsere Arbeit. Und das hängt, glaube ich, zunehmend davon ab, wie wir unsere Abeit als Lawinenprognostiker kommunizieren.“
Wo siehst du die Zukunft der Lawinenprognose?
Leider werden wir nie null Lawinentote haben. Das muss man sich klarmachen. Das wäre nur dann der Fall, wenn es eines Tages gar keinen Schnee mehr gibt. Und es wird immer Unfälle geben, die extrem unwahrscheinlich sind – aber trotzdem passieren. Unvermeidbare Unfälle sozusagen, wo häufig auch großes, kaum abschätzbares Pech im Spiel ist. Aber ich hoffe, dass immer mehr der vermeidbaren Unfälle vermieden werden. Auch durch unsere Arbeit. Und das hängt, glaube ich, zunehmend davon ab, wie wir unsere Arbeit als Lawinenprognostiker kommunizieren.
Kannst du ein Beispiel geben für einen unvermeidbaren oder unwahrscheinlichen Unfall?
Vor drei oder vier Jahren kam eine Gruppe aus den Niederlanden nach Livigno. Es gab guten Schnee, tolles Wetter, Lawinenwarnstufe 4 und die Gruppe ist den ganzen Tag nur auf der Piste gefahren. Kurz vor halb 5 –also schon sehr spät – fuhren zwei aus dieser Gruppe durch offenes Gelände, um von einer Piste zur nächsten zu gelangen. Dabei hat der zweite eine kleine Lawine ausgelöst, die ihn verschüttet hat. Der Voranfahrende hat erst im Tal bemerkt, dass er seinen Freund vermisst. Zuerst wurden alle Bars
abgesucht, dann das Gelände. Wir haben ihn erst um halb 11 in der Nacht gefunden, kaum verschüttet, aber doch so, dass es für ihn leider tödlich ausgegangen ist. Da kam vieles zusammen, auch Unwahrscheinliches. Nicht zuletzt, dass wir solche Skifahrer mit unseren Infos oft gar nicht erreichen: Weil sie am Morgen gar nicht vorhaben, am Abend kurz durch offenes Gelände zu queren. Weil sie nicht wissen, dass es auch in Talnähe Lawinen geben kann. Und dass jede Lawine, auch eine kleine, tödlich enden kann.
Man muss also vor allem die Kommunikation verbessern?
Da sehe ich in jedem Fall Verbesserungsmöglichkeiten. Unsere Kommunikation muss effizienter werden. Das heißt, wir müssen die Leute noch besser erreichen. Und sie müssen die Info, die wir ihnen bieten, noch besser verstehen, indem wir sie möglichst optimal und verständlich präsentieren.
Auch auf Social Media, wo ihr bislang noch nicht präsent seid?
Auch da. Ich finde sehr gut, wie der LWD Tirol das macht. Wir diskutieren seit letztem Winter, was wir in Livigno auf Social Media machen wollen. Mit welchen Mitteln und auf welchen Kanälen. Klar ist, dass das leider sehr zeit- und auch kostenintensiv ist. Und dass ich das neben allem nicht auch noch
stemmen kann. Wahrscheinlich brauchen wir dafür zusätzliche Mittel. Außerdem läuft gerade eine Studie, die die Kommunikation aller europäischen Lawinenwarndienste untersucht. Deren Ergebnisse und Empfehlungen wollen wir abwarten. Dann gehen wir auch dieses Thema an.
Wo gibt es noch Spielraum für Verbesserung?
Bei der Lawinenausbildung – zum Beispiel für Jugendliche. Hier in Livigno gibt es eine Skitourengruppe, die in die Schule geht, um die Schüler zu erreichen. Nachdem immer mehr Jugendliche im freien Gelände unterwegs sind, ist das absolut sinnvoll. Auch bei den Daten sehe ich noch Verbesserungsbedarf.
Inwiefern?
Zu viele sitzen noch auf ihren Daten herum. Dabei sollten wir unsere Daten viel mehr teilen und austauschen. Open Data sollte unser Ziel sein. Das ist im Prinzip auch das, was die EU anstrebt. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon auf einem guten Weg. Heute wissen die Leute sehr viel mehr über Schnee und Lawinen als vor zehn Jahren. Die Bergführer sind besser als vor zehn Jahren. Und auch ich bin besser geworden während der letzten zehn Jahre. Wir sind auf einem ziemlich guten Weg. ■

Bergführer Luca Vallata (am Monitor), Fabiano Monti und die Praktikantin
Tiziana Zendrini diskutieren anhand von Temperaturdaten ein Modell, das die (In-)Stabilität von Nassschnee vorhersagt.
Foto: Sam Confortola
85
| bergsönlichkeit
Scheitern



bs schwerpunkt
88 Die Kraft des Wirbelwinds
Die iranische Kletterin Nasim Eshqui kämpft gegen das antidemokratische Regime der Unterdrückung im Iran. Tom Dauer hat mit ihr gesprochen und meint, wir sollten ihr zuhören. Tun wir das nicht, scheitern wir alle. Wir, die Unterdrückten und die Freiheit.
98 Schlecht gelaufen?
Was der eine als Misserfolg sieht, kann für die andere ein großartiges Erlebnis sein. Christian Penning hat bei vier Alpinist*innen nachgefragt, was sie unter Scheitern verstehen.

104 „Ich habe akzeptiert, dass ich bei dem, was ich tue, sterben kann.”
Claus Lochbihler im Interview mit dem norwegischen Freerider und YoTube-Star Nikolai Schirmer. Warum Scheitern zum extremen Skifahren gehört wie das Salz in die Suppe?
110 19 Minuten
Thomas Käsbohrer befragt bergundsteigen-Redakteur
Chris Semmel zu seinem persönlichen Scheitern am Piz Kesch. Chris, Berg- und Skiführer und Sicherheitsforscher, verschätzte sich und eine Lawine erfasste ihn.
116 Gescheiter(t)
Das Scheitern gilt in der Gesellschaft wie beim Bergsteigen häufig als der ultimative Schiffsbruch. Das muss sich ändern. Glosse von Dominik Prantl.
118 Stichwort Scheitern
„Scheitern heißt für mich: Wenn ich sterbe und nicht heimkomme“, sagte Ueli Steck. Acht bewegende Zitate zu unserem Schwerpunktthema.
„Wir müssen scheitern, weil Scheitern eine natürliche Begleiterscheinung menschlichen Handelns ist. Weil die Komplexität unserer Umwelt immer größer ist als unser Verständnis davon,“ meint der Wirtschaftspsychologe Michael Frese. Die Komplexität der Umwelt in den Bergen Patagoniens ist groß. Scheitern und Umkehren gehört dazu. Viele Faktoren, wie Wetter Bedingungen, Psyche usw., bestimmen über den Gipfelerfolg. Erfolgreich zu scheitern lernt man dort. Roli Striemitzer und Gebi Bendler beim Versuch den Cerro Chaltén (Fitz Roy) über die Route Californiana zu besteigen (Jan. 23). Vier Seillängen unter dem Gipfel mussten sie aufgrund vereister Risse umdrehen. Ein schönes und lehrreiches Abenteuer war es trotzdem oder gerade deshalb.
87
| scheitern
Fotos: Roland Striemitzer, Gebi Bendler
Die Kraft des Wirbelwinds

Die Kletterin Nasim Eshqi ist fast so alt wie die Islamische Republik Iran. Im September 2022 hat sie ihre Heimat verlassen. Seitdem gibt sie den Iranerinnen und Iranern, die gegen ein grausames, durchtriebenes und korruptes Regime kämpfen, eine Stimme. Wir sollten ihr zuhören. Tun wir das nicht, scheitern alle. Wir, die Unterdrückten und die Freiheit.
Von Tom Dauer
Nasim Eshqi versucht sich im „Digital Crack“ (8a) hoch über Chamonix. Einige Tage später stirbt ihre Landsfrau Mahsa Amini, und Eshqis Leben verändert sich schlagartig. Foto: Monica Dalmass

88 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Am 9. September 2022 balanciert, schiebt, spreizt und klemmt sich Nasim Eshqi den „Digital Crack“ (8a) empor, am großen Gendarme der Arêtes des Cosmique, hoch über Chamonix, in atemraubenden 3800 Metern. Nicht Rotpunkt, aber macht nichts, sie ist zufrieden. Wie immer, wenn sie klettert, ist die Iranerin farbenfroh gekleidet: hellblaue Hose, blauer Pulli, knallgelber Chalkbag, rot der Helm, ein schöner Tupfer im graubraunen Granit. Überhaupt ist ihr Leben bunt und fröhlich, zumindest auf ihrem Instagram-Account. Bis zum 16. September 2022, dem Tag, an dem die 22-jährige Mahsa Amini im Teheraner Kasra-Krankenhaus an den Verletzungen stirbt, die ihr von der Gascht-e Erschad zugefügt wurden. Die „Sittenpolizei“ hatte die junge Frau festgenommen, weil sie ihren Hidschab nicht korrekt getragen habe. Nachdem ihr Tod bekannt wird, postet Eshqi ein schwarzes Bild, unter das sie schreibt: „Gewidmet allen Frauen in Iran, die bis zuletzt ihre Hoffnung nicht verloren.“ Diesen Frauen eine Stimme zu geben, wird Eshqis Mission. Um ihre persönliche, hart errungene Freiheit für die Freiheit aller Iranerinnen und Iraner einzusetzen.

Nasim Eshqi, geboren zu Nouruz, der Tagundnachtgleiche, dem persischen Frühlingsbeginn, ist sechs Jahre alt, als die Islamische Republik Iran tausende politische Häftlinge hinrichten lässt. Frauen und Männer, ohne Urteil gehängt, immer sechs an einem Galgen, beginnend am 29. Juli 1988, über fünf Monate hinweg. Dem so genannten „Komitee des Todes“, das für die Vollstreckung verantwortlich ist, gehört auch Ebrahim Raisi an, damals stellvertretender Generalstaatsanwalt Teherans, seit 2021 Präsident des Iran. Die Männer, die heute die Machtelite Irans stellen und gegen die Eshqi und viele ihrer Landsleute kämpfen, haben eine lange politische Karriere und an ihren Händen klebt Blut.
Sport als Ventil
Natürlich weiß das Mädchen nicht, wie perfide das System ist, in das es hineingeboren wird. Ayatollah Ruhollah Chomeini hat es nach seiner Rückkehr aus dem französischen Exil aufgebaut. Am 1. April 1979 ruft der Geistliche die Islamische Republik aus und schafft mit dem Amt des Rahbar, des „Revolutionsführers“, ein auf ihn zugeschnittenes Machtzentrum. Fortan wird er die Richtlinien der Politik bestimmen, die Justiz kontrollieren, die reguläre Armee befehligen, ebenso die neu gegründeten Revolutionsgarden, Polizei und Geheimdienste sowie staatliche Medien. Der Revolutionsführer steht damit auf Lebenszeit über allen Organen; auch Parlament und Präsident tanzen nach seiner Pfeife. Die Islamische Republik ist ein einzigartiges Hybrid, eine Mischung aus Theokratie und Republik, die eine religiöse Diktatur mit pseudodemokratischen Elementen geschickt verschleiert.
In Eshqis Familie wird der abrupte Übergang von der Monarchie unter Shah Mohammad Reza Palavi zur Islamischen Republik als unabänderlich hingenommen. Nasims Mutter ist Lehrerin, eine „brave Frau“, die sich weder für Politik noch für Sport oder die Künste interessiert. An den Protesten der Frauen, die im März 1979 gegen die Pläne Ayatollah Chomeinis zur Zwangsver-
89 | scheitern
schleierung demonstrieren, nimmt sie nicht teil. Schon bald wird deutlich, dass die Feindschaft gegen Frauen zu den Grundpfeilern seiner Ideologie gehört: Mit der Kontrolle der Frau kontrolliert das Regime die Gesellschaft. Iranerinnen werden zu Menschen zweiter Klasse. Wenn sie arbeiten, reisen oder sich scheiden lassen wollen, brauchen sie das Einverständnis ihrer Ehemänner, Väter oder Brüder. Ab dem Alter von neun Jahren dürfen sie verheiratet werden. Im öffentlichen Leben wird Geschlechtertrennung eingeführt. Frauen dürfen nicht vor Publikum singen oder schauspielern. Sie werden aus Justiz und hohen Ämtern entfernt, und sie haben keinen Anspruch auf das Sorgerecht für ihre Kinder.
Eshqis Vater ist Universitätsprofessor, ein eher konservativer Mensch. Gläubig ist er nicht, aber sehr belesen und immer darauf bedacht, sich eine eigene Meinung zu den Geschehnissen um ihn herum zu bilden. Dennoch muss seine Tochter wie alle Mädchen einen Hidschab tragen. Das ist Pflicht in der Islamischen Republik, für Frauen seit 1980, für Mädchen ab neun Jahren seit 1983. „Wenn die Islamische Revolution kein anderes Ergebnis haben sollte als die Verschleierung der Frau“, räsonierte Ayatollah Chomeini, „dann ist das per se genug für die Revolution“. Die symbolische Bedeutung des Kopftuchs kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
„Hyperaktiv“ sei sie als Kind gewesen, sagt Eshqi, „aggressiv und zerstörerisch“. Vielleicht muss sie das sein, um den Druck auszuhalten, der von allen Seiten größer wird. Mit ihrer jüngeren Schwester darf sie spielen, mit ihren beiden Brüdern auch, nicht aber mit anderen Jungen. Sobald sie aus dem Haus geht,
Zehn Mal wird Nasim Eshqi iranische Meisterin im Kickboxen, das sie gegen den Willen ihrer Eltern praktiziert. Weil sie sich nicht den Konventionen beugt, muss sie mit 18 ihre Familie verlassen.

fühlt sie sich wie von tausenden Augen beschattet. In der Schule muss sie Regeln folgen, die sie nicht versteht. Wer aus dem Rahmen fällt, dem wird das Leben schwer gemacht. Und immer sieht Eshqi, dass die Jungen ihres Alters ganz anders leben dürfen, wilder, freier. „Ich hasste es, ein Mädchen zu sein.“ Als sie wie alle Schüler den Koran lesen muss, besteht sie darauf, auch die Bibel lesen zu dürfen – mit keinem der heiligen Bücher kann sie etwas anfangen. Eshqi, das wird Eltern und Lehrern bald klar, gibt sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Sie ist neugierig, sie hinterfragt scheinbare Gewissheiten, sie will wissen. Und in Bewegung sein. „Nasim“ ist Farsi und bedeutet „Brise“. Tatsächlich aber ist dieses Kind ein Wirbelwind.
Als sie im Alter von elf Jahren ein Ferienlager besucht, beginnt sie mit dem Kickboxen, Vollkontakt. Ihre Eltern sind dagegen, wollen ihr den Sport verbieten. Eshqi macht heimlich weiter, zehn Mal wird sie iranische Meisterin. Ihre Pokale und Urkunden versteckt sie vor Mutter und Vater. Wichtig sind sie ihr eh nicht. Wichtig ist ihr, dass sie mit dem Sport ein Ventil findet für ihre unbestimmte, allumfassende Wut. Ihr Selbstbewusstsein wächst. Ebenso der Glaube daran, einen eigenen Weg gehen zu können. „Der Sport rettete mir das Leben.“ Und er hilft ihr in dem langen Kampf um Anerkennung, den sie mit ihren Eltern ausficht. Sport zu treiben, laut zu sein, zu feiern, spät heimzukommen, bunte Kleider zu tragen – anders zu sein, ist etwas, wofür sich die Eltern schämen. Sie akzeptieren das Verhalten ihrer Tochter nicht, Eshqi gibt nicht klein bei. Mit 18 muss sie das Haus verlassen.
90
„Nasim ist Farsi und bedeutet Brise. Tatsächlich aber ist dieses Kind ein Wirbelwind.“
Sport ist Nasim Eshqis Ventil, und das Laufen bis heute eine der wichtigsten Ausgleichsmöglichkeiten geblieben. Foto: Ray
Weckruf und Warnung

2000 beginnt sie, Sportwissenschaft zu studieren. Das Studentenleben ist wie eine Befreiung. Eshqi blüht auf, erntet die Früchte ihres langen inneren Widerstands. Seit Juni 1999 gehen tausende Studenten und Studentinnen auf die Straße, um gegen verschärfte Pressegesetze und das Verbot der Reformzeitung „Salam“ zu trommeln. Es sind die größten Proteste seit dem Sturz von Shah Mohammad Reza Palavi. Zum ersten Mal erheben sich die Kinder der Islamischen Revolution gegen den Staat, in dem Glauben, der gemäßigte und reformorientierte Präsident Mohammad Chatami würde sie unterstützen. Schließlich hat er noch bei seiner Wiederwahl 2001 Dialog versprochen, die Stärkung der Pressefreiheit, den Einsatz für Frauenrechte. Auch Eshqi hat ihm ihre Stimme gegeben. Doch die systemimmanenten Grenzen fortschrittlicher Politik werden grausam deutlich. Chatami knickt vor dem Klerus ein, Reformpolitiker werden verhaftet, die Presse eingeschüchtert. Eshqi erlebt, wie brutal die Proteste niedergeknüppelt werden. Als sie mit anderen Studierenden eingekesselt wird, fürchtet sie um ihr Leben. Bitter enttäuscht, schwört sie sich, nie wieder zur Wahl zu gehen. So wie ihr geht es hunderttausenden anderen. Wieder einmal ist es der Sport, der Eshqi Halt gibt. Neben Kickboxen praktiziert sie an der Universität Siebenkampf, Schwimmen, Basketball, Handball, Volleyball, Badminton, Tischtennis, Schießen und Aerobic. Hauptsache kein Stillstand. Und wenn sie mal Ruhe gibt, dann liest sie alles, was sie in die Finger kriegt, wie sie es von ihrem Vater abgeschaut hat. Zwei Autoren haben es ihr besonders angetan: Friedrich Nietzsche, in dessen
Konzept des „Übermenschen“ sie ihren Wunsch nach Unabhängigkeit gespiegelt sieht. Und Arthur Schopenhauer, dessen Lektüre und die Erkenntnis, dass der unbedingte Lebenswille der Motor jeglicher Existenz ist, für sie „ein Schlag ins Gesicht“ gewesen sei, Weckruf und Warnung zugleich. Als Eshqi 2005 ihr Studium abschließt, wird der konservative Hardliner Mahmoud Ahmadinedschad zum Präsident gewählt; vor allem von armen Bevölkerungsschichten, denen der Veteran des Iran-Irak-Kriegs (1980–1988) das Blaue vom Himmel verspricht. Alle vier Jahre dürfen Iranerinnen und Iraner zur Urne gehen. Mit einer freien Entscheidung hat das wenig zu tun, denn über die Kandidaten für Parlament und Präsidialamt entscheidet der zwölfköpfige Wächterrat, dessen Mitglieder – zur Hälfte Kleriker, zur Hälfte Juristen, keine Frauen – direkt und indirekt vom Revolutionsführer bestimmt werden. Natürlich lässt der Wächterrat nur systemtreue Kandidaten zu, die der Veleyat-e Faqih, der „Herrschaft der Rechtsgelehrten“, dem Kernkonzept der Verfassung, zustimmen. Die erste Regierungsperiode Ahmadinedschads wird für den Großteil der Zivilbevölkerung eine Zeit bleiernen Stillstands. Reformen werden zurückgenommen, Moral- und Kleidungsvorschriften noch strenger überwacht. Die Zahl der Hinrichtungen vervierfacht sich. Handelsbeziehungen erreichen einen Tiefpunkt, die Wirtschaft schwächelt, Arbeitslosigkeit und Armut nehmen zu, Korruption grassiert. Es ist Eshqis großes Glück, dass sie in dieser Zeit das Klettern für sich entdeckt. Sie ist 23. Und hört von heute auf morgen mit allen anderen Sportarten auf. Weil sie in den Bergen, an den Felsen, in der Wildnis Irans die Freiheit findet, nach der sie sich stets gesehnt hat.

91
Demski
| scheitern
„The power of pink“ – Nasim Eshqis rosa Fingernägel sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Wenn sie den Lack abends erneuern muss, weiß sie, dass es ein guter Klettertag gewesen ist. Foto: Moritz Attenberger

Als Ahmadinedschad 2009 nur aufgrund massiver Wahlfälschung im Amt bleibt, reißt der urbanen Mittelschicht Irans der Geduldsfaden. Die „Grüne Bewegung“ fordert Aufklärung, Konsequenzen, Veränderungen. Auch ihre Proteste werden mit Gewalt niedergeschlagen. Dutzende Tote, hunderte Verletzte, Verhaftungswellen und Schauprozesse sind die Folge. Danach fühlt es sich an, als sei jegliche Opposition erstarrt. Eshqi ist zu dieser Zeit nicht in Iran. Ihr Wunsch nach einem anderen Leben hat sie in die Vereinigten Arabischen Emirate geführt, wo sie in einer Kletterhalle arbeitet. Sie hat sich in eine Art innere Emigration begeben und kostet die persönliche Freiheit aus, die sie im Klettern findet – Freiheit gegenüber den ständigen Drangsalierungen, Freiheit aber auch von ihren eigenen Dämonen. „Das Klettern lehrte mich, dass ich nicht beständig kämpfen muss. Bevor ich zu klettern begann, musste ich mich ständig beweisen, mich wehren, zurückschlagen. Jetzt nahm ich Energie auf, vom Fels, vom Berg. Ich verstand, dass es immer mehrere Wege im Leben gibt. Wenn einer versperrt ist, nimmt man eben einen anderen.“
The Power of Pink
Doch leider wirkt sich die jahrzehntelange, staatlich verordnete Gehirnwäsche auch an den Felsen von Bisouton und Baraghoun aus. Eshqi wird mehrfach von der Polizei verhaftet. Einmal, weil sie mit vier Männern beim Zelten ist. Die Begründung: Man wolle sie vor einer Vergewaltigung schützen. Ihr Vater muss sie aus dem Polizeigewahrsam abholen, und natürlich jedes Mal Bestechungsgeld bezahlen. Eshqi lässt sich von diesen Erfahrungen nicht abschrecken. Es ist ihr auch egal, was hinter ihrem Rücken über sie geredet wird. Sobald sie an den Felsen ist, legt sie ihr Kopftuch ab, klettert im Top. „Ich hatte gelernt, dass ich, egal was ich mache, als ,Hure‘ beschimpft werde. Irgendwann sagte ich mir, was soll’s, dann bin ich halt eine, und mache trotzdem weiter.“
Weil den Menschen nichts anderes übrigbleibt, weil sie im engen Korsett des Sitten- und Moralkodex der Islamischen Republik Luft zum Atmen brauchen, hat sich in Iran eine Parallelgesellschaft entwickelt. Nicht nur im öffentlichen, auch im privaten Raum muss man jederzeit mit Übergriffen der Sicherheitskräfte rechnen – es reicht eine Haarsträhne, die unter dem Kopftuch hervorragt. Die vielen Verbote, Einschränkungen und Tabus führen zu einer allumfassenden Unzufriedenheit, die die Menschen wie eine Art öffentliches Geheimnis verbindet. Jeder weiß, dass auch das Gegenüber, die Nachbarin, der Bazaarhändler, die Studentin, der Taxifahrer die Machthabenden gerne zum Teufel wünschen würde – doch der Widerstand äußert sich, wenn überhaupt, nur im engsten Familien- und Freundeskreis, im Geheimen, Vertrauten.
Auf ihre Weise hat sich auch Eshqi mit dem erzwungenen „Leben in der Lüge“ arrangiert – so beschrieb der tschechische Freiheitskämpfer und einstige Präsident Václav Havel das Prin-
92
zip, mit dem Unterdrückungssysteme ihre Macht aufrechterhalten. Allerdings geht sie ein gutes Stück weiter als die Mehrheit ihrer Landsleute, und dazu gibt ihr das Klettern die Kraft. Natürlich könnte sie für sich allein ihrer Leidenschaft frönen. Stattdessen beginnt Eshqi, Kletterkurse zu geben. Für Kinder, um „aus Eichhörnchen Tiger zu machen“. Für Frauen, um ihnen das Selbstvertrauen zu geben, ihre Träume zu realisieren. Und für Frauen und Männer gemischt, was in Iran verboten ist. Eshqi macht es dennoch, denn „es ist egal, ob du reich oder arm bist, schwarz oder weiß, Iraner oder Italiener, Mann oder Frau: Die Schwerkraft zieht jeden nach unten, mit derselben Kraft.“
Eshqi klettert seit knapp zehn Jahren, als 2013 mit Hassan Rouhani ein moderater Konservativer ins Präsidialamt einzieht. Seine pragmatische Politik führt am 14. Juli 2015 zur Unterzeichnung des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Iran muss seine nuklearen Aktivitäten herunterfahren, sein Atomprogramm wird streng überwacht. Das „Internationale Atomabkommen“ zwischen den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien plus Deutschland und dem Iran erlaubt dafür die schrittweise Aufhebung von Handelssanktionen. In der iranischen Bevölkerung keimen zarte Hoffnungen – auf eine Rückkehr in die internationale Gemeinschaft, auf Stärkung der moderaten Kräfte in der Regierung, auf Lockerung der rigiden Moralvorschriften.
Und Eshqi? Bereist inzwischen die Welt: Oman, Armenien, Indien, Georgien und die Türkei, wo die Felsen von Geyikbairi zu ihrem Lieblingssportklettergebiet und „einer zweiten Heimat“ werden. Im Sommer 2015 ist sie auf Einladung von Stefan Glowacz und dessen Unternehmen Red Chili zum ersten Mal in Europa unterwegs. Ihr Visum ist 30 Tage lang gültig. An 27 Tagen klettert sie, angetrieben von unbändiger Lebenslust, Technomusik, einer nie versiegenden Energie und „the power of pink“ – ihre stets rosa lackierten Fingernägel sind zu ihrem Markenzeichen geworden.

Eshqi selbst sind Details unwichtig, doch auch in Zahlen drückt sich eine erfolgreiche Kletterkarriere aus: An die 100 Sportkletter- und Mehrseillängenrouten hat sie erschlossen. Mit „Mrs. Nobody“ (8b+) eröffnet sie 2019 eine Verlängerung zu „Mr. Nobody“ im Klettergebiet Baraghoun; die Namen sind Programm. Zusammen mit ihrem Freund Sina Heidari, einem erfahrenen Allroundalpinisten, kann sie 2021 am Südpfeiler des Alam Kooh im Elburs-Gebirge, mit 4850 Meter zweithöchster Gipfel Irans, die Route „Jangjooyankohestan“ (7b+) erstbegehen. Dass eine Frau und ein Mann eine Seilschaft bilden, wäre in Iran – wüssten die Sittenwächter davon – streng verboten. Dass Nasim und Sina es trotzdem tun, zeugt nicht nur von Liebe und geteilter Bergleidenschaft, sondern auch von Vertrauen und Mut. Und davon, dass es in Iran viele Männer gibt, die den Ruf ihrer Frauen nach Gleichberechtigung unterstützen.
Kletterkurse zu geben, ist für Nasim Eshqi mehr als nur Lebensunterhalt. Ihr Ziel ist es, iranische Frauen zu ermächtigen, ihren eigenen Lebensweg zu finden.
Foto: Archiv Eshqi
93
| scheitern
„Bevor ich zu klettern begann, musste ich mich ständig beweisen, mich wehren, zurückschlagen. Jetzt nahm ich Energie auf, vom Fels, vom Berg. Ich verstand, dass es immer mehrere Wege im Leben gibt.“
Die innere Stärke
Die Zeit des Aufschwungs und der Zuversicht ist leider nur von kurzer Dauer. Unter Präsident Donald Trump steigen die USA am 8. Mai 2018 aus dem Internationalen Atomabkommen aus. Die Wiedereinführung von Handelssanktionen kombiniert mit Misswirtschaft und Korruption führt zu rasant steigenden Lebensmittelpreisen, massivem Währungsverfall, ausbleibenden Lohnzahlungen, wachsender Arbeitslosigkeit. Der Funke Hoffnung, der Iraner und Iranerinnen drei Jahre lang wärmte, ist erloschen. In der Bevölkerung wachsen Enttäuschung, Unzufriedenheit und Wut. Als im November 2019 die Benzinpreise unangekündigt in die Höhe schnellen, kommt es landesweit zu Protesten. Und wieder werden tausende Tote beklagt. Der Vormarsch der Hardliner und Ultrakonservativen erreicht seinen vorläufigen Höhepunkt am 18. Juni 2021 mit der Wahl des neuen Präsidenten Ebrahim Raisi. Der Geistliche hat schon 1988 gezeigt, dass er ein loyaler Gefolgsmann des Revolutionsführers ist, und sei der Preis auch noch so hoch. Die Wahl ist eine Farce, nur 49 Prozent der 58 Millionen Berechtigten beteiligen sich, davon geben zwölf Prozent eine ungültige Stimme ab. Selbst diejenigen, die jahrzehntelang an die Reformierbarkeit der Islamischen Republik von innen glaubten, sind desillusioniert. Revolutionsführer Ayatollah Seyyed Ali Chamenei, bei dem seit 5. Juni 1989 die Fäden der Macht zusammenlaufen, hat ein System geschaffen, das wie eine Membran auf Staat und Gesellschaft liegt.
Geschickt versteht es Chamenei, die Interessen innerhalb der Machtelite auszugleichen, die größtenteils aus über 70-jährigen Klerikern besteht. Seine Herrschaft stützt sich zudem auf die 1979 gegründeten Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Islami, die „Revolutionsgarden“. Sie sind eine zweite Armee im Staat, der laut Verfassungsartikel 150 die Aufgabe zukommt, „über
die Revolution und ihre Errungenschaften zu wachen“. Mit eigener Luftwaffe, Marine, Heer, Geheimdienst und den BasidschMilizen, einer paramilitärischen Schlägertruppe, haben die Revolutionsgarden einen Unterdrückungsapparat aufgebaut, der brutal gegen Oppositionelle und Kritiker vorgeht. Darüber hinaus stellen die Revolutionsgardisten die Mehrheit der Abgeordneten, bekleiden zahlreiche Ministerämter und leitende Rollen in Wirtschaft und Verwaltung. Ihr wichtigstes Werkzeug sind etwa 50 informelle Organisationen, Finanztrusts und Holdings religiös-karitativer Stiftungen, die den Großteil des Staatshaushalts verwalten.
Der Allianz zwischen religiösen, politischen, militärischen und wirtschaftlichen Machtzentren steht die Zivilbevölkerung ohnmächtig gegenüber. Die Angst vor Gewalt, Repressionen, Verfolgung, willkürlichen Bestrafungen und Diskriminierung bestimmt ihren Alltag. Die Strategie des Regimes besteht darin, die Menschen zu isolieren, auseinanderzubringen: Arbeitergegen Mittelschicht, Schiiten gegen die sunnitische Minderheit, Männer gegen Frauen. Alle sollen sich mit ihren Problemen, Sorgen, ihrem Zorn allein fühlen. Dazu ist dem Regime jedes Mittel recht. Nasim Eshqi erlebt dies mehrfach am eigenen Leib. Als sie durch die Straßen Teherans läuft, wird sie von der Sittenpolizei angehalten, in einen Minibus gesperrt, in die berüchtigte Haftanstalt Vozara gebracht, drei Tage lang verhört, beschimpft, angeschrien. „Das ist einige Jahre her, und ich traute mich danach lange nicht mehr aus dem Haus. Und das ist genau das, was das Regime will“, sagt Eshqi. „Ich wurde depressiv und weinte tagelang. Sie rauben dir deine Würde. Sie brechen dich. Und du musst die einzelnen Stücke wieder zusammenfügen.“
Es zeugt von ihrer inneren Stärke, dass Nasim Eshqi immer wieder ganz wurde, immer wieder aufstand und weitermachte. „Iran“, sagt sie, „machte mich zu der Frau, die ich bin.“

94
„Der Iran machte mich zu der Frau, die ich bin.“
Neue Wege

Im September 2022 zieht nach dem Mord an Mahsa Amini eine Protestwelle durch Iran, die bis heute nicht abebbt und die sich zur Revolution entwickelt. Angeführt wird sie von vornehmlich jungen, unerhört mutigen Frauen, die vereint unter dem Slogan „Women – Life – Freedom“ auf die Straße gehen. Unter ihnen sind viele Studentinnen, die inzwischen 57 Prozent der Studierenden stellen. Gleichzeitig wirkt die Frauenbewegung in alle Schichten und Ethnien Irans hinein. Die Chance auf einen radikalen Wandel, auf ein Ende des Regimes, scheint so groß wie nie. Weil er sich auf Frauen stützt, die über Generationen hinweg Opfer brachten, ohne sich einschüchtern zu lassen. Der Preis in der Zivilbevölkerung ist hoch: Nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Activists in Iran“ (HRAI) wurden zwischen September und Dezember des vergangenen Jahres 481 Frauen und Männer von Sicherheitskräften getötet, darunter 68 Minderjährige. Über 18.000 Menschen wurden verhaftet, gefoltert, vergewaltigt, mindestens drei Männer nach Schauprozessen hingerichtet. Ihr angebliches Vergehen: Moharebeh, „Krieg gegen Gott“. All das kann die Revoltierenden nicht aufhalten. Sie gehören mehrheitlich der nach 2000 geborenen Generation Z an, die die Islamische Revolution nur noch vom Hörensagen kennt. Sie hat die Traumata der Studentenunruhen und der „Grünen Bewegung“ nicht erlitten, ist unverwundet und mutig. Und sie weiß dank Internet und sozialen Medien, wie junge Frauen und Männer in anderen Teilen der Welt leben können, leben dürfen.
Im Winter 2017 stieg Vida Movahed, alleinstehende Mutter eines Säuglings, in der Enqelâb-e Islâmi, der „Straße der Islamischen Revolution“, auf einen Verteilerkasten, streifte ihr weißes Kopftuch ab, hing es an einen Holzstab und wedelte damit
Tom Dauer ist Buchautor und Filmemacher. Seitdem er Iran sel bst bereiste, versteht er die O hnmacht seiner Bürgerinnen und Bürge r gegenüber einer autoritären Theokratie noch besser. Er hoff t inständig, dass ihr K ampf für Menschenrechte und Freiheit zu einem erfolgrei chen Ende führt.

95
| scheitern
stumm hin und her, die langen Haare offen. Drei weitere Frauen folgten in den Jahren danach ihrem Beispiel – ihr Fanal endete jeweils mit Verhaftung, Gefängnis und Flucht. In diesen Tagen legen Frauen in den Städten und Dörfern Irans scharenweise ihr Kopftuch ab. Aus einer symbolischen Handlung wird konkreter Widerstand, sagt die Menschenrechtsaktivistin Masih Alinejad: „Der Hidschab-Zwang ist unsere Berliner Mauer, und wenn er fällt, bricht ein ganzes System zusammen.“
Wie die Revolution ausgehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt (1. Januar 2023) ungewiss. Sicher ist dagegen, dass sich Nasim Eshqis Leben grundlegend verändert hat. Die 40-Jährige hat sich zunächst in Europa niedergelassen. Sie fürchtet, dass Iran „noch lange kein demokratischer, liberaler Staat sein wird“.
Zugleich ist sie sicher, dass sich das Regime nicht von selbst verändern wird. „Deshalb muss es verschwinden. Denn wir werden erst dann erfolgreich sein, wenn Staat und Religion voneinander getrennt sind und wenn die Diktatur scheitert.“ Wie lange dies dauern wird, kann niemand vorhersagen. Noch wirkt das Regime stark, doch die machthabenden Eliten sind verängstigt. Sie haben alles, die wütende Mehrheit nichts zu verlieren. Die Angst des Regimes vor Menschen, die sich zusammenschließen, ist seine größte Schwäche. Wenn Iranerinnen und Iraner es schaffen, das öffentliche Geheimnis der Unzufriedenheit zu teilen, das Schweigen zu brechen, Tag für Tag, in Wellen des Protestes, quer durch alle Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten und Altersklassen, dann kann die Revolution erfolgreich sein.
Ihrem neuen Leben in Europa blicken Nasim Eshqi und Sina Heidari mit Zuversicht entgegen. Als Erstbegeher wissen sie, wie man neue Wege öffnet, auch im Leben. Irgendwann wird das Klettern darin wieder eine Hauptrolle spielen. Weil es ihre Leidenschaft ist; die Tätigkeit, bei der sie alles um sich herum vergessen können. Unterdessen wird Eshqi nicht aufhören, die Aufmerksamkeit der internationalen Kletterszene via soziale Medien, ihren Film „Climbing Iran“, Vorträge und Interviews auf die Revolution in Iran zu lenken. Sie macht das, weil für diejenigen, die gegen eine Tyrannei kämpfen, nichts vernichtender ist als das Gefühl, vergessen worden zu sein. Eshqi weiß, wie sich Unfreiheit anfühlt – und wie die Freiheit, die wir für selbstverständlich halten. Und die Iranerinnen und Iraner wie alle Menschen auf der Welt verdient haben. ■
Literatur
y Amiri, Natalie. Zwischen den Welten: Von Macht und Ohnmacht im Iran. Berlin: Aufbau Verlag, 2021.
Kenntnisreich und unterhaltsam berichtet die Deutsch-Iranerin aus ihrer zweiten Heimat Iran. In Reportagen und Porträts lässt die ehemalige Leiterin des ARD-Büros Teheran und „Weltspiegel“-Moderatorin die Geschichte der Islamischen Republik ebenso wie menschliche Schicksale lebendig werden.
y Atai, Golineh. Iran: Die Freiheit ist weiblich. Berlin: Rowohlt Verlag, 2021.
Die in Teheran geborene Autorin, die seit 2022 das ZDF-Studio in Kairo leitet, porträtiert sieben iranische Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen und unter großen Opfern seit langem gegen das islamische Regime kämpfen. Hervorragend recherchiert, liest sich das ein Jahr vor Beginn der aktuellen Kämpfe erschienene Buch wie eine Prophezeiung.
y Hejazi, Arash. The Gaze of the Gazelle: The Story of a Generation. London: Seagull Books, 2011.
Während einer Demonstration der „Grünen Bewegung“ am 20. Juni 2009 wird Neda Agha-Soltan in Teheran von Regierungsmilizen erschossen. Der Arzt und Schriftsteller Arash Hejazi versucht vergeblich, ihr Leben zu retten. Der Tod der jungen Frau, auf Video festgehalten, erschüttert die Welt. Hejazi verlässt Iran – und erzählt in einer Mischung aus Autobiografie, Reportage, Hintergrundbericht und Mythologie die Geschichte seiner Generation.
y Michel, Serge und Paolo Woods. Land des Lachens, Land der Tränen: Die vielen Gesichter des Iran. München: Riemann Verlag, 2011.
In 45 Porträts von Iranerinnen und Iranern – reichen Händlern, jungen Revoltierenden, mächtigen Mullahs, Popstars und Prostituierten – entfalten die beiden erfahrenen Journalisten ein facettenreiches Bild eines ebenso faszinierenden wie widersprüchlichen Landes, seiner Kultur und seiner Menschen.
y Pryce, Lois. Im Iran dürfen Frauen nicht Motorrad fahren … Was passierte, als ich es trotzdem tat. Ostfildern: DuMont Reiseverlag, 2017.
Mit Leichtigkeit und Understatement, stellenweise auch etwas naiv, erzählt die Britin Lois Pryce von ihrer Motorradfahrt, die sie „5000 Kilometer mit Helm und Hidschab“ durch Iran führte. Ein Reisebericht, der wirkt wie aus einer anderen Zeit. Und der zugleich Hoffnung gibt für eine Zukunft, in der solche Abenteuer für Besucherinnen und Iranerinnen möglich sein werden.
Weitere Quellen
y Bundeszentrale für politische Bildung, ; umfangreiches Dossier zu historischen, politischen und gesellschaftlichen Hintergründen. y Human Rights Activists in Iran, A Comprehensive Report on the First 82 Days of Nationwide Protests in Iran (Sept–Dec 2022); eine detailliert recherchierte Analyse der ersten drei Revolutionsmonate.
y Zenith, Dossier Iran; Ausgabe 3/2017, S.42–117; das Magazin für den Nahen und Mittleren Osten beschreibt Iran und unseren Blick auf das Land mit all seinen Widersprüchen.
96
„Der Hidschab-Zwang ist unsere Berliner Mauer, und wenn er fällt, bricht ein ganzes System zusammen.“
/ FEDERICA MINGOLLA

Schlecht gelaufen?
Was der eine als Misserfolg sieht, kann für den anderen ein großartiges Bergerlebnis sein. Scheitern am Berg hat immer auch mit persönlichen Erwartungen und Zielen zu tun. Vier Alpinist*innen, vier Ansichten.
Protokolle von Christian Penning

98 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Pauli Trenkwalder (47) – der Psychologe

Die Berge dienen dem Psychologen und Bergführer Pauli Trenkwalder als Kulisse und Resonanzraum für seine Coachings. Zudem arbeitet der Südtiroler als Referent bei der Schweizer Bergführerausbildung und als Ausbilder in den Bundeslehrteams Bergsteigen und Sportklettern des Deutschen Alpenvereins.
„Die Diskussionen ums
Scheitern am Berg werden meiner Meinung nach zu hoch gehängt. Nicht selten wird im Alpinismus das Scheitern verklärt oder dramatisiert. Dabei ist es ein selbstverständlicher Teil der Entwicklung als Bergsteiger, Kletterin oder Skibergsteigerin – ganz egal, auf welchem Niveau man sich dabei bewegt. Jeder, der in die Berge geht, hat ein Ziel. Ob wir es erreichen, hängt zum einen von äußeren Faktoren ab, wie dem Gelände, dem Wetter, den allgemeinen Verhältnissen der Route vor Ort. Zum anderen spielen individuelle Kompetenzen und Fähigkeiten
eine Rolle: das persönliche Können, Fitness und Kondition, die mentale Entschlossenheit. Scheitern ist eine individuelle Bewertung. Selbst wenn ich den Gipfel nicht erreiche, den ich als Ziel gewählt habe, kann das Resümee positiv sein, wenn es mir vorrangig darum geht, einen schönen Tag in der Natur zu haben. Erst wenn die persönlichen Bewertungsmechanismen ein Ergebnis auswerfen wie: „Ich habe mein Ziel nicht erreicht, deshalb fühle ich mich schlecht!“, kommt es zu einem Gefühl des Scheiterns.
Ein Scheitern ist also eng mit der individuellen Persönlichkeit verbunden. Entscheidend ist, wie ich solche Situationen handhabe. So gesehen ist es ein
Resilienz-Thema. Wie gehe ich mit dem Gefühl, gescheitert zu sein, um? Die einen ziehen daraus neue Motivation und sehen eine Herausforderung. Für andere stellen nicht erreichte Zielen eine Bedrohung dar. Sie sehen ihr Selbstbild in Gefahr. Eine innere Haltung der Akzeptanz zu entwickeln oder zu kultivieren, macht Sinn. Denn Ziele nicht zu erreichen – und damit das Scheitern – gehört zum Bergsteigen nun einmal dazu.“
99
| scheitern
Pauli Trenkwalder beim Abseilen in den Dolomiten. Foto: Pauli Trenkwalder
„Scheitern ist völlig normal“
Tamara Lunger (36) – die Höhenbergsteigerin

70 Meter vor dem Gipfel bricht die Südtirolerin Tamara Lunger 2016 ihre Winterbesteigung des 8125 m hohen Nanga Parbat ab. Sie wäre damit die erste Frau gewesen, die den Achttausender im Winter bestiegen hätte. 2021 sterben bei der Winterbesteigung des K2 (8611 m) die fünf Alpinisten Sergi Mingote, Atanas Skatov, Muhammad Ali Sadpara, John Snorri Sigurjónsson und Juan Pablo Mohr, mit denen Tamara damals am Berg war. Die Tragödie zu verarbeiten, kostet sie mehr Zeit als jede Expeditionsvorbereitung.
Auf den ersten Blick bin ich wohl die Königin des Scheiterns. Gemessen an den Gipfelerfolgen ist die Bilanz meiner AchttausenderBesteigungen nicht umwerfend. Doch meine persönliche Bewertung ist eine andere. Scheitern ist kein Wort, das ich gerne verwende. Man scheitert nicht. Man lernt dazu. Scheitern steht zu sehr für die Gedankenwelt eines oberflächlichen Schneller-Höher-Weiter. Ich suche am Berg aber mehr. Ich will mich selbst spüren. Intensiv. So sehr, wie ich es nur in diesen Extremsituationen kann. Ich habe am Nanga Parbat und am K2 bewusst den Winter für die Besteigung gewählt, weil ich das maximal intensive Erlebnis gesucht habe. Die Erfolgschancen lagen bei fünf bis zehn Prozent. Das

100
Foto: Christian Penning
„Bin ich die Königin des Scheiterns?“
„
war mir egal. Ich war auf keinem der beiden Gipfel. Aber ich habe eine Menge über mich gelernt. Zum Beispiel, wie wichtig Intuition ist – nicht nur am Berg, auch sonst im Leben. Ich versuche, sie permanent zu trainieren. Ich gehe dabei eine innige Partnerschaft mit mir selbst ein. Beim Höhenbergsteigen kann das lebensrettend sein. Ein Scheitern wäre es für mich gewesen, wenn ich am Nanga Parbat oder am K2 ums Leben gekommen wäre. Doch ich hatte die Klarheit, meiner Intuition zu folgen. Das ist für mich kein Scheitern. Im Gegenteil. Die Intuition hat mich dazu gebracht, in den jeweiligen Situationen das Richtige zu tun.
Trotzdem begannen nach den Erlebnissen am K2 für mich die schwierigsten zwei Jahre meines Lebens. Ich brauchte eine Pause – von den hohen Bergen, von den Expeditionen. Ich hatte Panikatta-

cken, weinte. Gleichzeitig wuchs der Druck von außen. Ständig kamen Fragen: ‚Wann gehst du wieder auf einen Gipfel?‘
Die Welt hat ein Image von Tamara kreiert. Sie will mich auf dem Gipfel sehen. Ich war mir lange hundertprozentig sicher, ich würde das Bergsteigen für mich allein machen. Nun erkannte ich, dass ich mich zu sehr mit diesem Image von außen identifiziert hatte, dass ich es zu meinem eigenen gemacht hatte. Ich fand es schlimm, dass die Tamara, die nicht auf den Berg geht, nicht der Mensch ist, den die anderen Menschen sehen wollen. Ich musste mir selbst erst mal bewusst werden, wer ich bin und wohin ich will. Das war ein mühsamer Prozess. Ich hatte immer ein alpinistisches Ziel. Jetzt standen da Fragezeichen. Kann das Bergsteigen meine Zukunft sein? Ich dachte sogar darüber nach, unterzutauchen, mich aus den sozialen
Medien zu löschen. Heute weiß ich, das Leben ist kein geradliniger Aufstieg. Nur glücklich und erfolgreich zu sein, funktioniert nicht. Ich habe erkannt: Nach schlimmen Zeiten kommt wieder etwas Schönes. Die Krise hat mir die Augen geöffnet: Dafür, mir etwas Gutes zu tun. Dafür, meinen Körper nicht nur maximal zu fordern, ihn auch mal zu verwöhnen.
Dafür, auch meine weibliche Seite zu leben. Ich habe verstanden, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss. Das hat mir geholfen, neue Motivation zu finden, die von innen kommt. Ich würde es niemals als Scheitern bezeichnen, wenn man den Mut hat, die Veränderungen, die ein Misserfolg oder eine Krise mit sich bringt, mit offenen Armen anzunehmen.“
Tamara Lunger beim Versuch den K2 im Winter zu besteigen.
Foto: Archiv Lunger
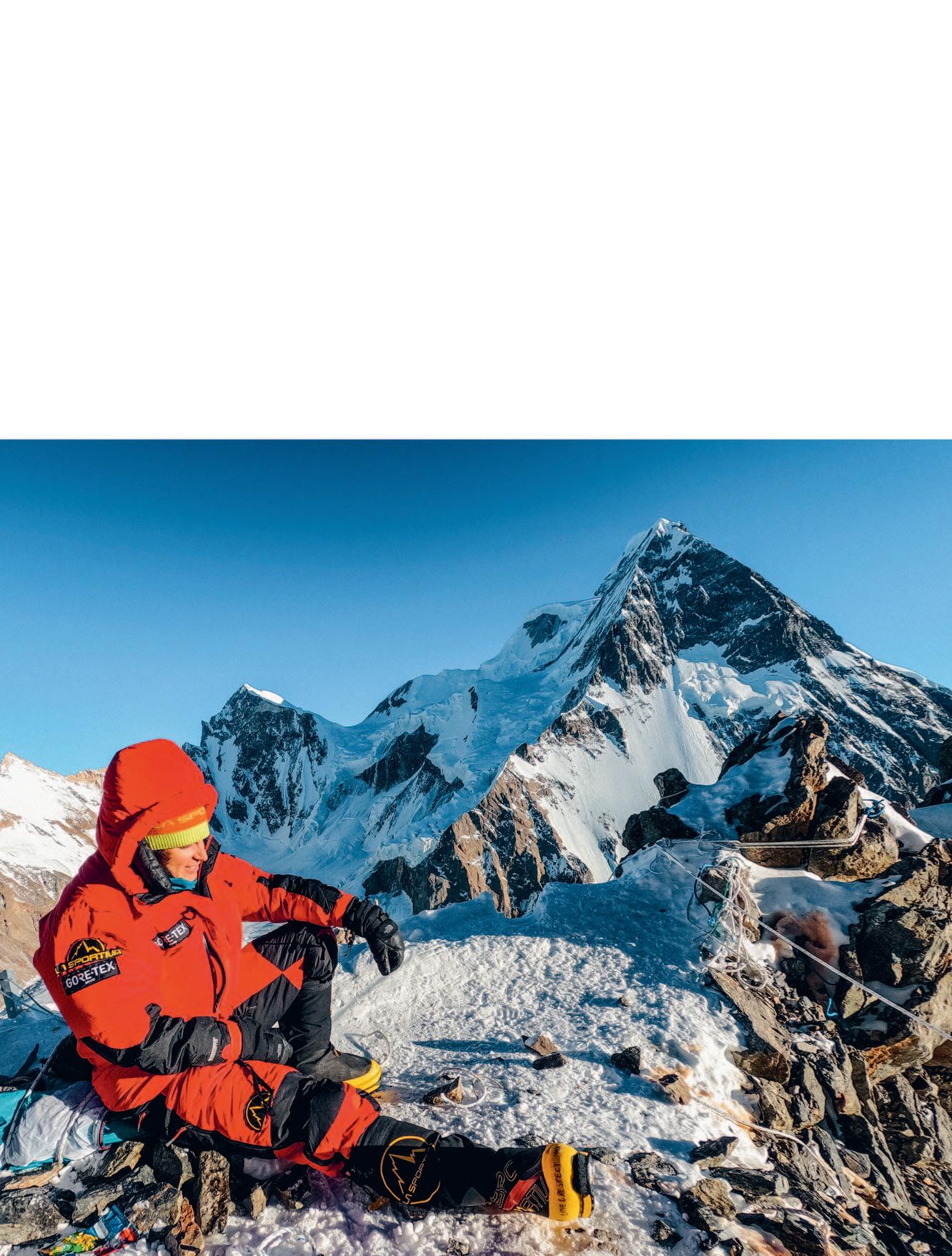
101 | scheitern
Nadine Wallner (33) – Freeriden, Klettern, Guiden
Nadine Wallner hat zwei anstrengende Jahre mit einigen Verletzungen hinter sich. „Ich bin zu früh zu viel und zu schwer geklettert“, sagt sie. Das hat meine Sehnen und Gelenke überfordert. Dies ist nicht die erste Situation, die es der Gewinnerin der Freeride World Tour von 2013 und 2014 nicht leicht macht, ihre sportlichen Ziele zu verfolgen. Bei Dreharbeiten zu einem Ski-Movie in Alaska brach sie sich im April 2014 Schien- und Wadenbein. Ein langer Prozess der Reha begann, in dem sie das Klettern für sich entdeckte.

Nadine Wallner bei ihrer –neben dem Skifahren – zweiten großen Leidenschaft: dem Klettern. Foto: Philipp Platz
Scheitern … das klingt für mich so negativ. So endgültig. Ich denke lieber positiv. Ich sage lieber: ‚Es hat bislang nicht funktioniert.‘ Natürlich gibt es trotzdem so etwas wie ein Scheitern. Aber man sollte differenzieren. Ich sehe verschiedene Stadien des Scheiterns. Ein Beispiel: Wenn ich mich schwer verletze und meine sportlichen Ziele (vorerst) nicht erreichen kann, ist es immer eine Frage, wie ich der Situation emotional entgegentrete. Ob ich die Kraft habe, es wieder zu probieren. Oder etwas anderes zu versuchen, was mir Auftrieb gibt und mich vorwärtsbringt. Scheitern ist immer auch mit Veränderungen verbunden. Beim Klettern ist das Scheitern omnipräsent. Wenn man am Limit klettert, scheitert man ständig. Man probiert, bis es funktioniert. Zumindest bei mir ist das so. Ich bin immer sehr motiviert. Natür-
lich gibt es auch Durchhänger. Da tut ein gesundes, zwischenmenschliches Umfeld gut. Sich dann mit Dingen außerhalb des Sports zu beschäftigen, bringt die Leichtigkeit zurück. Man wächst mit jedem Scheitern. Ich lerne in solchen Phasen viel mehr, als wenn etwas gleich funktioniert. Das motiviert mich. Ganz wichtig ist dabei Geduld. Und dass man nicht aufgibt, dass man flexibel bleibt und neue Situationen positiv annimmt. In unserer Leistungsgesellschaft und im Leistungssport zählen in erster Linie Erfolge. Sehr deutlich wird das auf Social Media. Doch wir sind alle Menschen. Jeder hat seine Grenzen. Wir können nicht 365 Tage im Jahr perfekt funktionieren. Scheitern ist menschlich. Wir können versuchen, das Beste draus zu machen.“

„
„Scheitern ist menschlich“
Foto: Philipp Platz
Bei unseren Projekten bewegen wir Bergsteiger uns oft auf einem schmalen Grat zwischen Scheitern und Erfolg. Ein Test der körperlichen und der mentalen Stärke, bei dem es viel zu lernen gibt – und die Möglichkeit zu wachsen. Wenn ich beim Klettern nie stürze, kann ich daraus nichts lernen. Wenn ich jedoch scheitere, kann ich aus meinen Fehlern lernen und vielleicht sogar Erfolg haben. Ein Beispiel: 2016 versuchte ich, die Route „El Corazón“ am El Capitan frei zu klettern. Bis zum achten Tag war ich erfolgreich, aber am neunten Tag wurde ich zu müde und beendete die Kletterei mit Hilfsmitteln, also nicht frei. Trotz meiner bisher größten Anstrengungen beim Klettern hatte ich das ultimative Ziel nicht erreicht. Fünf Jahre später kehrte ich mit verfeinerter Taktik zurück. Mir gelang es, die Route zu meistern. Mein ursprünglicher Misserfolg führte schließlich zum Erfolg. Neue Herausforderungen bergen immer auch Risiken. Eine Fehlkalkulation kann schwerwiegende Folgen haben. Im Dezember 2020 stiegen ein Partner und ich in eine noch nicht bestiegene Wand in den kanadischen Rockies ein. Wir waren darauf vorbereitet, drei Nächte draußen zu verbringen. In der zweiten Nacht zog ein Sturm auf. Überall um uns herum schossen kleine Lawinen herab. Am nächsten Tag zwang uns der Sturm zum Rückzug. Wir haben zwar unser Ziel verfehlt, waren aber in unserer Entscheidungsfindung erfolgreich. Hätten wir versucht weiterzugehen, wären wir möglicherweise in eine sehr
Brette Harrington bei der freien Begehung von „El Corazón“, 5.13b, am El Capitan im November 2021.

„gefährliche Situation geraten, aus der wir uns nicht mehr hätten zurückziehen können. Scheitern kann also sowohl positiv als auch negativ sein. Die reinste Form des Spiels mit dem Scheitern ist das Free-Solo-Klettern. Es ist unbestreitbar, dass die Folgen eines Scheiterns gefährlich sind. In meinen Augen ist es eher eine Kunst als ein Sport. Es geht dabei nicht darum, mich selbst bis zum Äußersten auszureizen. Ich will mich im Rahmen meiner Fähigkeiten auf einem kontrollierbaren Niveau bewegen. Für mich geht es dabei darum, mich selbst zu erforschen, meiner Intuition, mir selbst zu vertrauen. Bisweilen scheitern auch Lebensträume. Mein Partner Marc-André Leclerc ist 2018 zusammen mit Ryan Johnson bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Ihre Entscheidungen, die zu dem Unglück geführt haben, lassen sich im Nachhinein nicht rekonstruieren. Diese eine Fehleinschätzung brachte jeden aus ihrem Umfeld auf eine Bahn der Trauer, des Verlustes und des Lernens. Nachdem ich Marc in den Bergen verloren hatte, war das Klettern das Einzige, was mich von der Traurigkeit über seine Abwesenheit ablenken konnte.“ ■
Brette Harrington (30) –die Analytikerin
Nach schweren Verletzungen wechselte die amerikanische SlopestyleSkifahrerin Brette Harrington vor rund 15 Jahren die Sportart und zählt mittlerweile zu den besten und vielseitigsten Kletterinnen weltweit. 2019 gelang ihr mit Ines Papert und Luka Lindic die Erstbegehung von „The Sound of Silence“ am Mt. Fay in Alberta, Canada. Zu ihren spektakulärsten Klettereien zählt zweifellos die Free-Solo-Begehung „Chiaro di Luna“ an der Aguja Saint Exupéry bei El Chalten, Patagonien. Brettes langjähriger Lebenspartner MarcAndré Leclerc (Dokumentarfilm „The Alpinist“) kam 2018 mit Kletterpartner Ryan Johnson bei einem Lawinenunglück in Alaska ums Leben.

103
„Kein Erfolg ohne Misserfolge“
Foto: Drew Smith
| scheitern
Foto: Drew Smith
Der norwegische Freeride- und YouTubeStar Nikolai Schirmer spricht über Scheitern und Risiko in den Bergen sowie 22 frische Stiche im Oberschenkel – und lässt dabei für bergundsteigen wortwörtlich die Hosen herunter.
 Interview von Claus Lochbihler
Interview von Claus Lochbihler
104 / bergundsteigen #122 / frühling 23
„Ich habe akzeptiert, dass ich bei dem, was ich tue, sterben kann.“
Nikolai Schirmer am Store Lenangstind (1624m) in den Lyngen Alpen. Foto: Vegard Rye
Wie sagt man eigentlich „Scheitern“ oder „Ich bin gescheitert“ auf Norwegisch?
„Å feile“. Und „jeg feilet“. Es bedeutet das Gleiche wie „failure“ im Englischen.
Es klingt auch ähnlich. Was bedeutet für dich Scheitern in den Bergen?
Wenn ich in den Bergen sterben würde. Oder mich schlimm verletze. Aber Scheitern wäre für mich auch das, was manchen passiert, die die Berge nur noch ernst nehmen: dass sie keinen Spaß mehr daran haben.
Was hast du vom Scheitern gelernt?
Dass es nichts bringt, erfolgreich zu sein, wenn man dabei nicht auch Spaß hat.
Wie definierst du Scheitern bezogen auf das Tourengehen oder das Freeriden?
Wenn ich die Schneedecke – was Lawinen angeht – falsch interpretiere. Aber auch wenn ich das Sluff Management – den nachrutschenden Schnee – falsch kalkuliere. Wenn ich bei dem einen oder anderen falsch liege, meldet sich der Berg sehr unmittelbar zurück. Wenn ich Pech habe so, dass ich sterbe.
Du beantwortest auf YouTube ziemlich viele User-Kommentare zu deinen Videos. Wovon hängt ab, ob du auf Kommentare reagierst oder nicht?
Manchmal geht es einfach nur darum, ein Missverständnis richtigzustellen. Oder eine Frage zu beantworten, die sich für jemanden aus dem Video ergibt. Ziemlich oft schalte ich mich ein, wenn meine Entscheidungsfindung am Berg diskutiert wird. Womit ich prinzipiell kein Problem habe – ganz im Gegenteil. Aber manchmal gibt es Leute, die glauben, dass sie es nur deshalb besser wissen, weil sie im Video fünf Sekunden lang unser Schneeprofil gesehen haben. Dazu muss man wissen, dass meine Videos – selbst wenn sie länger dauern – einen oder mehrere Ski-Tage sehr verdichten. Und dann gibt es noch Kommentare,
die eher politisch sind, weil ich in manchen meiner Filme auch die Klimakrise oder soziale Fragen thematisiere.
Wie gehst du mit kritischen Kommentaren um?
Das sind eh erstaunlich wenige. Ich schätze, dass 98 Prozent aller Kommentare positiv sind. In den meisten heißt es: „Ich liebe deine Videos, Nikolai. Bitte mach weiter.“
Und die kritischen zwei Prozent? Stören mich überhaupt nicht. Viele von ihnen haben ja recht: Ich gehe Risiken ein und muss darüber nachdenken, ob es das wert ist. Ich mache Fehler. Es wäre bei meinem Geschäftsmodell auch lächerlich, wenn ich empfindlich wäre gegenüber Kritik.
Worin besteht denn dein Geschäftsmodell?
Dass ich als Skifahrer eine öffentliche Person bin. Mein Skifahren hat nur deshalb einen finanziellen Wert, weil offensichtlich eine größere Anzahl von Menschen Spaß daran hat, sich mein Skifahren und meine Geschichten rund um das Skifahren anzusehen. Das funktioniert für mich und meine Sponsoren nur deshalb, weil ich damit ziemlich viele Leute erreiche. Dazu gehört auch, dass nicht jeder immer alles gut findet, was ich da mache.
Wie rechtfertigst du für dich das Risiko? Es gibt Untersuchungen, wonach das Skifahren im freien Gelände mit den üblichen Sicherheitsmaßnahmen weniger gefährlich ist als Autofahren.
Aber das bezieht sich ganz sicher nur auf den durchschnittlichen Tourengeher. Nicht auf einen Profi wie dich, der im Winter fast jeden Tag und in viel schwierigerem Gelände unterwegs ist als der Durchschnitt.
Richtig. Mein Risiko ist wahrscheinlich höher – ganz sicher sogar. Ich tue zwar alles,
Claus Lochbihler (geb. 1969), Journalist aus München, fährt Sk i –am liebsten im Pulver und möchte nach dem Nikolai-Schirmer -Interview jetzt endllich auc h einmal nach Norwegen.

105 | scheitern
„Ich gehe Risiken ein und muss darüber nachdenken, ob es das wert ist.“
was ich kann, um es zu minimieren – durch Trainings, Vorsichtsmaßnahmen und meine Tourenplanung. Aber mir ist natürlich klar, dass es immer ein kleines Restrisiko geben wird, das man nicht kontrolliert. Ich habe das für mich akzeptiert.
Das heißt?
Ich habe akzeptiert, dass ich bei dem, was ich tue, sterben kann. Auch wenn ich denke, dass dieses Risiko ziemlich gering ist. Andererseits: Wenn ich sehe, was Hilaree Nelson (im September 2022 am Manaslu verunglückte US-Skibergsteigerin, d. Red.) passiert ist, finde ich das nicht akzeptabel. Wenn so etwas passiert, frage ich mich jedes Mal:
Was machen wir da? Wie kann man das rechtfertigen? Besonders, wenn Kinder davon betroffen sind, weil sie auf einmal keine Mutter oder keinen Vater mehr haben. Für mich ist es ein ungelöster Konflikt, dass ich die Risiken, die ich eingehe, akzeptiere, es aber inakzeptabel finde, wenn so etwas Schlimmes passiert wie mit Hilaree.
In einem deiner Filme fragst du deinen Tourenpartner Kirsten, kurz nachdem ihr einer Lawine entkommen seid und er trotzdem nochmal aufsteigen möchte: „Würdest du das deiner Freundin erzählen?“ Darauf sagt er: „Nein, würde ich nicht.“ Worauf du antwortest: „Okay, dann tu es auch nicht.“ Wir nennen das den Girlfriend-Test, auch wenn die beiden mittlerweile verheiratet sind. Es zeigt auch, dass wir beide bei Weitem nicht so krass drauf sind wie Alex Honnold.
Was meinst du damit?
Es gibt da diese Szene in dem Film Free Solo. Da sagt Honnold, dass er seiner Freundin gegenüber nicht unbedingt die Verpflichtung verspürt, am Leben zu bleiben. Kann sein, dass er das mittlerweile, nachdem er Vater geworden ist, nicht mehr so sagen würde. Das ist doch schließlich DIE grundlegende Verpflichtung in einer Beziehung: Am Leben zu bleiben. Da zu sein. Wenn man sich nicht verpflichtet fühlt, am Leben zu bleiben, wie kann man sich dann verpflichtet fühlen, den Abwasch zu machen oder, ich weiß nicht, ein guter Liebhaber zu sein?
In einem Video über deinen Lawinenabgang im November 2020 sagst du, dass diese Lawine ein tiefes Nachdenken bei dir ausgelöst hat. Wie hat sich dein
Risikomanagement seitdem verändert?
Zum einen ganz praktisch: Ich habe mich noch mehr als früher weitergebildet, was Schnee- und Lawinenkunde angeht. Ich bin etwas vorsichtiger geworden. Aber noch mehr ging es eigentlich um etwas anderes: nämlich zu akzeptieren, dass das Risiko nicht nur theoretisch da ist.
Kannst du das genauer erklären?
Bis zu dieser Lawine hatte ich das Risiko nie wirklich akzeptiert. Das Risiko war für mich nur eine Art abstrakter, lästiger Störfaktor zwischen mir und dem, was ich liebe: das Skifahren. Hinzu kam, dass ich mich plötzlich gegenüber der Familie meiner damaligen Freundin rechtfertigen musste: Die wollten von mir wissen, warum das Risiko, das ich offenkundig eingehe, für mich in Ordnung ist. So wie sie dem Risiko ausgesetzt waren, dass mir etwas passiert, war ich plötzlich ihren Fragen ausgesetzt. Ich musste mich erklären und mit Menschen, die mir nahestehen, darüber reden, was ich tue und weshalb ich glaube, dass es das trotz des Risikos wert ist.
Was hatte das für Auswirkungen auf dich?
Die Gespräche haben mich dazu gezwungen, eine explizitere, ehrlichere Beziehung zu den Risiken meines Berufs zu entwickeln. Ich musste darüber nachdenken, was ich eigentlich mache und ob es wirklich okay ist. Das war neu für mich, denn meine eigene Familie hatte sich ja nach und nach an das gewöhnt, was ich da mache. Ich habe ja nicht damit angefangen, mit 10 Jahren an einem Eispickel über einem Felsabsturz zu hängen.
Deine Familie ist mit dir in das Risiko hineingewachsen.
Ja, man wächst gemeinsam hinein und man gewöhnt sich daran. Für die Familie meiner damaligen Freundin war es ganz anders. Die waren ganz plötzlich mit mir, diesem Freak, konfrontiert – und den Risiken, die ich eingehe. Und dann gleich dieser Lawinenunfall. Ich musste mich also erklären. Und dabei ein paar Gedanken-Runden mit mir selbst drehen.
Und zu welchem Schluss bist du da gekommen?
Wir sind heute als Gesellschaft insgesamt ja sehr risikoscheu. Wir versuchen, das Risiko in jedem Bereich des Lebens zu minimieren.
Den Tod selbst halten wir eigentlich für inakzeptabel. Es ist also ein bisschen schwierig oder widerspricht dem gesellschaftlichen Konsens, wenn jemand sagt: „Okay, ich nehme dieses Risiko für das, was ich liebe, in Kauf. Ich versuche, es so gut wie möglich zu machen.“ Aber man sollte gleichzeitig akzeptieren, dass es trotz allem schiefgehen und man dabei seine Gesundheit und – im schlimmsten Fall – sein Leben verlieren kann. Dass man dabei ganz schlimm und maximal scheitern kann. Man sollte also nicht so tun, als ob das nicht möglich wäre. Das meine ich mit akzeptieren. Natürlich will ich nicht, dass die Leute mehr Risiken eingehen als nötig. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen bis zu einem gewissen Grad mehr Risiken in ihrem Leben eingehen könnten.
Weshalb?
Weil es sich auch lohnt, Risiken einzugehen. Die Möglichkeit zu scheitern: Das ist es, wo das Abenteuer beginnt. Es ist immer gut, risikoscheu zu sein, wenn es um Leben und Tod geht. Aber es gibt eine große Bandbreite zwischen einem vermeintlich komplett risikofreien Leben auf der Couch und dem sicheren oder wahrscheinlichen Tod. Viele der interessantesten Dinge im Leben sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Und wenn das Risiko nicht zu groß ist, bricht man sich maximal die Hand. Ich habe zum Beispiel aktuell 22 Stiche in meinem Oberschenkel.
Wie das?
Von einem Mountainbike-Sturz am vergangenen Samstag. Eine miese Landung. Kannst du Blut sehen?
Ja.
Dann ziehe ich, wenn das okay ist, mal meine Hose herunter. (Schirmer zieht die Hose herunter)
Sieht ganz schön übel aus. Der Reifen war wie eine Säge für meinen Oberschenkel. Aber es schaut schlimmer aus, als es ist. In zwei Wochen ist alles wieder verheilt. Kein Vergleich zu meiner letzten großen Verletzung. Da hatte ich mir etwas im Gesicht und drei Knochen an der Hand gebrochen.
Und eine Achillessehne gerissen. Aber trotzdem geht es mir heute wieder total gut. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gesell-
106
schaften sich zu sehr auf Zäune gegen jedes Risiko konzentrieren und jeden Baum polstern möchten, den das Leben aufstellt. Das Leben selbst ist riskant.
Wie hat deine Lawinenausbildung angefangen?
Im Teenageralter. Da bin ich vom Vater eines Freundes eingeführt worden. Das war, als ich 13 war, und wir beide unsere erste Tourenausrüstung bekommen haben. Sein Vater sagte: „Bevor ihr ins Gelände geht, müsst ihr wissen, wie man das LVS, die Schaufel und die Sonde benutzt.“
Ich frage, weil du in einem Interview mal gesagt hast: „Ich würde heute früher anfangen, mich über Schneekunde und Lawinenkunde zu informieren.“
Damit meinte ich, dass es am Anfang fast nur darum ging, was man macht, wenn es zu einer Lawine gekommen ist – und jemand dabei verschüttet wurde. Erst später ging es darum, wie man dieses Szenario von vornherein vermeidet. Wir wussten in meinen Anfängen als Tourengeher nicht wirklich, unter welchen Bedingungen eine Lawine ausgelöst wird. Was eine Schwachschicht in der Altschneedecke ist, war mir nicht klar, bevor ich 20 war. Und da war ich schon einige Jahre im Gelände unterwegs. Noch fatalistischer war es in den Generationen vorher. Da haben die meisten einfach „Oh“ gesagt, wenn etwas passiert ist, sie hatten nicht mal ein LVS-Gerät dabei und haben einfach nur das Beste gehofft. Lawinen galten als eine Art zufälliger Akt der Natur.
Seitdem ist natürlich sehr viel passiert. Auf allen Ebenen. Ich finde zum Beispiel sehr gut, wie die Lawinenwarndienste – etwa in Norwegen, aber auch in Tirol – von den Tourengehern Beobachtungen zum Schnee und zu Lawinenereignissen per Crowdsourcing sammeln – und das dann verwerten und weitergeben. So beruhen Entscheidungen auf sehr viel mehr Datenpunkten als früher. Je mehr Beobachtungen man kennt, desto besser die Grundlage für die eigenen Entscheidungen.

In deinen Videos geht es regelmäßig um kleine und größere Fehler. Aber vor allem um den Spaß und die Freundschaft auf Skiern. Wie hast du zu diesem Stil gefunden, der offensichtlich sehr gut ankommt?
Nikolai Schirmer
Der Norweger Nikolai Schirmer (geboren am 1. Februar 1991 in Tromsø) verbindet Skifahren und Filmen: Seine Videos – oft witzig, manchmal krass und ganz anders als der Skiporn von anno dazumal – zeigen ihn und seine Freunde beim Tourengehen und Freeriden in den Bergen Norwegens. Er erreicht damit eine Followerschaft, die ihm ein Leben als Skiprofi (seine Hauptsponsoren: Black Crows Skis und Norrøna) ermöglicht. Auf seinem YouTube-Account zählt er 110.000, auf Instagram folgen ihm fast 97.000 Abonnenten. Sein meistgesehenes Video „I've never seen anybody ride that fast!“ (Endless Winter 3) auf YouTube hat 1,2 Millionen Aufrufe. Das Skifahren hat Schirmer als kleiner Junge auf Langlaufskiern gelernt: auf einem Hügel hinter der Kirche, 344 Kilometer nördlich des Polarkreises. Mit dem Film Skisick | European Outdoor Film Tour (eoft.eu) ist Nikolai Schirmer auch bei der diesjährigen EOFT vertreten. Foto: Christof Simon
107
| scheitern
Ich finde den Macho aus den Bergen, der immer den Nagel auf den Kopf trifft, eine ziemlich langweilige und unrealistische Figur. Ich finde so vieles von dem, was in den Bergen passiert, lustig. Auch die kleineren Pannen, Fehler und Situationen, die man meistern muss. Für mich macht das einen großen Teil des Spaßes in den Bergen aus. Es ist wie ein Abenteuer. Man weiß nicht, worauf man sich einlässt, und man scheitert ein bisschen, aber dann schafft man es gemeinsam, und das verleiht der ganzen Erfahrung einen viel größeren Wert.
Hast du von Anfang an versucht, in deinen Videos einen anderen Stil zu finden? Wenn man Skifilme macht, die mit Musik unterlegt sind, findet man es zu Beginn noch ganz, ganz cool, wenn der Skifahrer mit seinem Turn oder seinem Sprung genau auf-
dem Beat landet. Wenn du das zwei-, dreioder viermal gemacht hast, wird das schnell langweilig. So war es jedenfalls bei mir. Für einen Filmemacher ist es viel herausfordernder, eine kleine oder größere Geschichte rund ums Skifahren zu erzählen. Es war also Langeweile mit dem traditionellen SkipornFormat, die mich dazu gebracht hat, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, vom Skifahren zu erzählen. Dazu kommt eine ökologische Komponente.
Welche?
Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich umweltfreundlicher Ski fahren möchte. Auch als Skiprofi. Und dass das nur geht, wenn ich mich auf Norwegen und Europa beschränke. Und dass ich so umweltfreundlich wie möglich reisen möchte. Die meiste Zeit also mit dem E-Auto und per

„Man muss lernen, die Wirkung der Kamera auf sich selbst einschätzen zu können.
Wir nennen das Kodak Courage: Man riskiert mehr, nur weil man gefilmt wird.“
108
Sonnenaufgang am Store Jægervasstindane (1543 m), im Norden der Lyngen-Halbinsel. Foto: Krister Kopala
Zug, manchmal hingegen fliege ich. Gestern bin ich zum Beispiel mit dem Flieger nach München zur E.O.F.T. gekommen, weil ich am Vortag noch eine Veranstaltung in Oslo hatte. Ab hier geht es aber mit dem Zug weiter.
Auf welchen CO2-Abdruck steuerst du zurzeit zu?
Ich hatte ihn vor drei Jahren von mehr als 40 auf 12 Tonnen reduziert – was dem norwegischen Durchschnitt entspricht. Seit 2021 habe ich nicht mehr mitgezählt, aber ich würde annehmen, dass es noch ein bisschen weniger geworden ist. Ich fahre jetzt ausschließlich elektrisch und fliege diesen Winter auch nicht nach Nordamerika –ich hatte zwei Einladungen nach New York und Boulder. Das habe ich abgesagt.
Was hat das für Folgen für dein Filmemachen?
Die Entscheidung, mich auf Europa zu beschränken, hat mich als Skiprofi und Filmemacher von jeder Menge Neuschnee abgeschnitten. In Kanada fällt dreimal so viel Schnee wie in Norwegen. Wenn man einen Skifilm dreht, ist das wichtigste Rohmaterial frischer Schnee. Ich musste mir also auch überlegen, wie ich filmisch damit umgehe.
Zum Beispiel, indem du nicht nur tolle Abfahrten zeigst, sondern auch das ganze Drumherum: Aufstiege, Besprechungen, Zustiege, Bootsfahrten. Zumal das ja alles auch spannend ist. Besonders für Leute, die selber Tourengeher und Freerider sind. Beim Skitourengehen sind der Aufstieg, die Beurteilung der Schneeverhältnisse und die Routenplanung so wichtig und fordernd wie die Abfahrt. Außerdem kontextualisieren sie eine Abfahrt. Sie verleihen ihr einen Wert. Warum fühlt sich eine schwierige Linie so gut an? Weil man so viel dafür gearbeitet hat. Für mich ist das Skitourengehen mittlerweile die lohnendste Form des Skifahrens.
Du hast mal gesagt, dass sich die Skiszene, was guten Stil angeht, am Klettern orientieren sollte.
Beim Skifahren wurde Stil lange Zeit immer nur mit der Skitechnik oder mit Kleidung in Verbindung gebracht. Beim Klettern hat es schon viel früher eine Rolle gespielt, wie man sich dem Berg nähert und was man für Spuren hinterlässt. Wie man sich absichert. Und wie Stil mit Schwierigkeit korreliert.
Beim Skifahren spricht man nicht so viel über solche Fragen. Dazu haben auch die traditionellen Skifilme beigetragen, die viel zu selten den Weg nach oben thematisiert haben. Dabei macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob man sich hochfliegen lässt oder aufsteigt.
Du wirst in Zukunft also nie wieder mit dem Heli fliegen?
Ich bin kein Absolutist in solchen Fragen. Ich möchte auch nicht als jemand rüberkommen, der Helikopter und Schneemobile hasst und prinzipiell ablehnt. Im Gegenteil: Ich mag Helikopter und Schneemobile. Das Problem ist nur, dass sie mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Ich habe einmal sogar bei einem norwegischen Drohnenhersteller angerufen und gefragt: „Hey, könnt ihr mir eine Drohne besorgen, die mich auf den Berg fliegt?“ Aber so etwas gibt es noch nicht.
Wäre das denn überhaupt wünschenswert?
Ich glaube schon an eine technologische Zukunft mit reichlich grüner Energie und all diesen technischen Dingen, mit denen wir Spaß haben können, ohne dem Klima zu schaden. Aber klar: Der beste Stil wird immer der sein, wo man alles aus eigener Kraft bewältigt.
Was ist für dich die ideale Gruppengröße für das extreme Gelände, in dem du dich oft bewegst.
Fünf sind definitiv zu viel. Vier ist machbar. Besser sind drei und am besten ist es, wenn man nur zu zweit unterwegs ist. Die Kameraleute zähle ich dabei nicht mit. Auch weil sie meistens nicht da aufsteigen und abfahren, wo wir uns bewegen.
Glaubst du, dass durch das Filmen ein zusätzliches Risiko entsteht? Auch eine Art Termindruck? Termindruck ist definitiv das Gefährlichste. Anfangs dachte ich auch: „Okay, jetzt sind zwei Wochen Drehzeit ausgemacht, alle stehen bereit, jetzt muss gedreht werden.“ Dann trifft man sehr schnell ziemlich schlechte Entscheidungen. Mittlerweile versuche ich, feste Drehtermine zu meiden, maximal flexibel und schnell zu sein. Gedreht wird, wenn es die Verhältnisse erlauben. Und was die Verhältnisse erlauben.
Hat das Gefilmtwerden eine psychologische Wirkung? Riskierst du mehr, wenn du gefilmt wirst?
Das ist in jedem Fall eine Gefahr. Man muss lernen, die Wirkung der Kamera auf sich selbst einschätzen zu können. Wir nennen das Kodak Courage: Man riskiert mehr, nur weil man gefilmt wird. Und weil vom Skifahren, wenn man gefilmt wird, plötzlich mehr abhängt als nur eine Abfahrt: schöne Bilder, Klickzahlen, Sponsorings. Merrick – eine meiner häufigen Tourenpartnerinnen und Mutter von zwei Kindern – ist beim Filmen gestürzt und wäre vom nachrutschenden Schnee beinahe über einen Abgrund gerissen worden, wenn es ihr nicht im letzten Moment gelungen wäre, sich mit den Stöcken in ein paar Felsen zu verhaken.
Videos erzeugen auch Illusionen und Wunschträume. Hat etwa der Boom in dem norwegischen Skitourenparadies Lyngen etwas mit dir und deinen Videos zu tun?
Vermutlich ein bisschen. Andererseits hat Lyngen eine lange Geschichte im Skisport. Vor mir waren schon andere da, um dort zu drehen. Aber manchmal treffe ich Leute in Lyngen, die mir dann sagen, dass sie auch wegen meiner Videos gekommen sind. Das finde ich cool. Ich mag es, wenn sich Leute von der Freude, die ich am Skifahren habe, inspirieren lassen.
Keine Angst, dass zu viele kommen?
Nein. Mein Gelände-Geschmack beim Skifahren ist für die meisten viel zu eigenartig und extrem. Die meisten wollen das nicht abfahren, was ich abfahre.
Der Chefredakteur von bergundsteigen, Gebi Bendler, hat als Bergführer im vorletzten Winter zwei Wochen lang in Lyngen geführt. Bei Lawinenwarnstufe 4 wollten manche seiner Gruppe die Nikolai-Schirmer-Lines fahren, die sie auf der Karten- und Track-App FATMAP entdeckt hatten. Er musste ihnen dann erklären, dass das bei Lawinenwarnstufe 4 leider nicht möglich ist.
Ich versuche schon zu kommunizieren, dass ich so etwas nicht jeden Tag mache. Und dass ich oft sehr lange auf sichere Bedingungen warte. Und dass ich es nicht machen würde, wenn es nicht einigermaßen sicher ist. Vielleicht muss ich das manchmal noch deutlicher sagen. Tut mir leid für deinen Chefredakteur, dass er der Spielverderber sein musste.
109
■ | scheitern
19 Minuten

Die unheilvolle Verquickung von Unfällen und Psychologie wird auch denen zum Verhängnis, die sich intensiv mit Unfallursachen beschäftigen. bergundsteigen-Redakteur Chris Semmel, der sich seit Jahrzehnten hauptberuflich mit Sicherheit im Bergsport beschäftigt, erzählt von seinem persönlichen Scheitern am Piz Kesch.

110 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Von Thomas Käsbohrer
Chris Semmel im Whiteout im Schneesturm.
„Auch mir passiert es trotz aller Erfahrung, dass ich dem psychologischen Mechanismus auf den Leim gehe. Ich erzähle das, um zu zeigen, wie sehr so simple, altbekannte psychologische Mechanismen, die in jedem von uns stecken – wie die, meine eigenen oder fremde Erwartungshaltungen erfüllen zu wollen –, eine Rolle spielen können, wenn es um Unfallursachen geht“, erzählt Chris Semmel.
„Zum Beispiel als Bergführer. Du hast Gäste, die kommen von weit her. Für sie ist eine Tour vielleicht das Highlight eines ganzen Jahres. Sie kommen und wollen etwas unternehmen. Sie sind voll motiviert. Sie haben ja auch für die Leistung bezahlt. Du willst deinen Gästen etwas bieten. Du weißt, es ist vielleicht eine nicht ganz optimale Wettersituation. Sie bringt dich in eine Zwickmühle. Es schneit. Es ist heikel. Aber wenn wir jetzt nicht aufbrechen, sitzen wir hier fest auf der Hütte am Piz Kesch – vielleicht sogar für Tage. Denn morgen können wir auch nichts machen. Weil das Gelände hier sehr steil und es der erste Tag nach dem Neuschnee ist, werden wir ein erhöhtes Lawinenrisiko haben, das einen Aufbruch nicht erlaubt. Und wir kommen auch nicht über den Pass rüber ...
Aber wenn ich heute während des Schneefalls mit etwas Sichtbehinderung versuchen würde, über dieses andere Joch und das nächste flache Tal hinten rum auf die nächste Hütte zu kommen, wären wir morgen im richtigen Gelände. Wir könnten unsere Tour wie geplant gehen, denn dort ist die Hangneigung unter 30 Grad und entsprechend nicht lawinengefährdet. Da ist es flach genug. Das wäre supergeil. Wir hätten Neuschnee und alles wäre perfekt. Du denkst dir: ‚Das müsste doch eigentlich funktionieren.‘ Eine Teilnehmerin aus der Gruppe ist besonders begeistert. Sie moti-
viert dich. ‚Au ja. Wir ziehen heute los, gehen da hinüber und hängen nicht hier auf der Hütte herum.‘ Also ziehst du los mit den Leuten. Eingepackt. Im Schneesturm. Mit Null-Sicht-Blindflug. Navigierst mit deinem Navigationsgerät.
Ich hatte mich gut vorbereitet. Hatte mir eine genaue Route zurechtgelegt in der ‚White Risk‘-App – das ist die App des Schweizer Instituts für Schnee- und Lawinenforschung und sie ist wirklich hervorragend. Hangneigungs-Layer, Auslaufzonen, Risikokarten – alles drin. Nach der Karte müssten wir den Hang immer nur auf gleicher Höhe queren, um uns außerhalb des gefährdeten Bereichs zu halten.
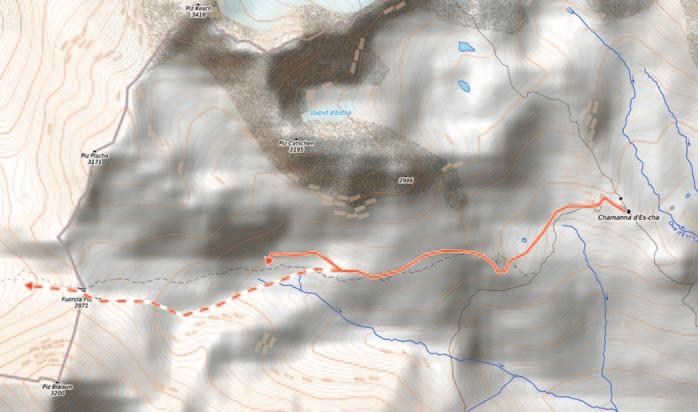
Wegen des starken Schneefalls musste ich öfter das Handy zur Orientierung zücken, mehr als mir lieb war. Das fraß auf dem
kurzen Stück erheblich Zeit. Ich wurde ungeduldig mit mir. ‚Jetzt schau halt nicht alle 20 Meter aufs Handy‘, ermahnte ich mich. ‚Das sind doch nur eineinhalb Kilometer. Steck das mal weg, du kommst ja überhaupt nicht vom Fleck. Du weißt jetzt, du musst anderthalb Kilometer immer die Richtung halten, etwas Höhe abbauen, einfach geradeaus, da bist du im sicheren Korridor. Schau halt erst da vorne wieder drauf, wo du den Durchschlupf finden musst.‘
Instinktiv will ich Höhe halten, will natürlich unsere gewonnene Höhe nicht verschenken. Und dann läufst du und schaust nicht mehr aufs Handy. Plötzlich ist da ein grauer Schatten voraus im Schneetreiben. Du denkst:

‚Ist das ein Felsen? Da kann doch laut Karte keiner sein.‘ Du hast kaum Sicht. Hast die Skibrille auf. Es schneit. Es stürmt. Jeder ist eingepackt.
Die Route auf der White-Risk-App. Die durchgehende rote Linie zeigt die durchgeführte Tour, bei der es am Ende (Pfeil nach unten) zum Lawinenabgang kam. Die strichlierte Linie zeigt die ursprünglich geplante Tour. Chris Semmel kam von seiner geplanten Route ab. Grafik: White Risk, Chris Semmel
111
| scheitern
„Von Lawinentrainings weiß ich, dass du da unten alles hörst. Du hörst den Hund oben scharren. Du hörst das Piepsen der Suchgeräte. Du hörst alles. Aber ich hörte nichts.“

112
Verirrt
Ich hatte längst Abstände zwischen uns angeordnet, damit im Fall einer Lawine nicht alle betroffen sind. Es war kein gefährliches Gelände, die Steilheit betrug etwa 20 Grad. Einzig: Ich wusste nicht mehr genau, wo ich war.
Der Felsen ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Eigentlich dürfte da kein Felsen sein?! Ich holte mein Handy wieder raus und sah: ‚Naja. Da bin ich 20, 30 Höhenmeter zu hoch. Ich bin zu nah dran an der Steilflanke.‘ Also Handy weg. Weiter, und zwar eine 90Grad-Kehre und leicht bergab. Weg von dem Steilhang. Ich habe gerade die 90-GradKehre gemacht, das Gelände ist flach. Auf einmal kommt von hinten eine Riesenwelle an, reißt mich nach vorne, ich merke plötzlich, dass ich mich überschlage, mein Hirn denkt: Oh, Scheiße! Eine Lawine!‘
Sie hat mich einfach mit sich mitgerissen und ein paar Mal ‚durchgewaschen‘, als wär’ ich in der Trommel einer Waschmaschine, wie man so sagt zu den Überschlägen im reißenden Schnee. Ich spüre, wie sie langsamer wird. Ich werde unter den Schneemassen in Rücklage mit dem Kopf nach unten bergab geschoben, mein Hirn sagt: ‚Reiß die Arme hoch vors Gesicht, um dir eine Atemhöhle zu schaffen. Nimm die Hände hoch, vielleicht kannst du rausgreifen aus dem Schnee!‘ Doch in diesem Moment kommt alles mit einem Ruck zum Stehen. Stille. Ich bin wie einzementiert. Ich kann nichts mehr machen, nicht mal meinen kleinen Finger kann ich noch bewegen. Mein rechter Fuß hängt verdreht nach hinten. Ich bekomme kaum Luft – nicht weil ich Schnee im Mund habe, sondern weil der Schnee derart Druck auf meinen Brustkorb ausübt. Mein Hirn fragt: ‚Scheiße. War’s das jetzt?‘ Ich denke an meine beiden Töchter
und meine Frau. ‚Fuck!‘ Aber mein nächster Gedanke ist: ‚Nein. Die anderen holen dich raus. Einer von den Kerlen, der Italiener, der ist echt fit. Die haben die Abstände eingehalten. Die finden dich. Die holen dich hier raus.‘ Der Italiener: Er hat sich voll ausgekannt mit Verschüttetensuche. Das Schlechtwetter am Tag zuvor hatten wir noch genutzt und am Nachmittag mit dem LVS, dem Lawinenverschütteten-Suchgerät, Übungen gemacht. Ich hatte gesehen, dass er das wirklich beherrschte. ‚Die holen dich raus. Horch mal, ob du etwas hörst.‘ Von Lawinentrainings weiß ich, dass du da unten alles hörst. Du hörst den Hund oben scharren. Du hörst das Piepsen der Suchgeräte. Du hörst alles. Aber ich hörte nichts. Ich hatte keine Zeit mehr. Es dauerte keine Minute, da hatte ich das Bewusstsein verloren und war weg. Ich hatte keine Atemhöhle. Aber ich hatte es im letzten Moment geschafft,
den Schnee aus meinem Mund auszuspucken und wenigstens den Kopf nach unten in den Kragen zu ziehen, sodass die Jacke wie eine Membran zwischen mir und dem Schnee funktionierte. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich so schnell ohnmächtig wurde: weil ich zu wenig Sauerstoff bekam, um bei Bewusstsein zu bleiben. Aber es war auch mein Glück, dass meine warme Atemluft nicht meine Atemhöhle vereiste und ich noch Restsauerstoff aus meiner Bekleidung bekam.
Die Suche
Was ich in meiner misslichen Lage nicht mehr mitbekam: Der Letzte in der Gruppe war als Einziger nicht mitgerissen worden. Er war draußen geblieben. Die beiden vor ihm steckten bis zum Bauch im Schnee, er hat ihnen instinktiv zuerst rausgeholfen.
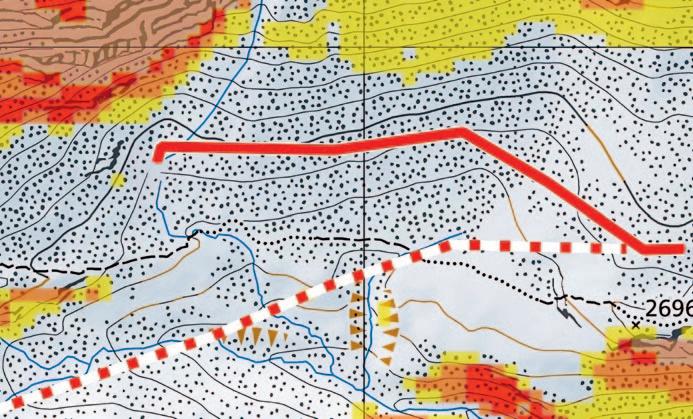
Thomas Käsbohrer ist Journalist und Hi storiker. Der passionierte Segler lebt im bayeri schen Vorarlpenland und folgt in seinen B üchern über Berge und Meere immer wieder der Fährte, wie Gehirn und Psyche uns in die Irre fü hren. Seine Bücher über die Berge entstehen in enger Zusammenarbeit mit der Bergwacht Bayern.
In diesem detaillierten Kartenausschnitt erkennt man den Felsen, den Chris noch vor sich gesehen hatte, bevor er von der Lawine erfasst wurde. Oberhalb von ihm die eingefärbten Steilhänge. Der Fels machte ihm erst bewusst, dass er falsch war –zu spät. Grafik: White Risk

113
| scheitern
Chris Semmel ist einer der Mitbegründer der GKMR-Methode zur Abschätzung des Lawinenrisikos. Der Berg- und Skiführer war langjähriger Mitarbeiter in der Sicherheitsforschung des DAV, Ausbilder und Geschäftsführer im Verband Deutscher Berg- und Skiführer. Inzwischen ist er wieder mehr mit seinen Gästen auf Tour und unterstützt die bergundsteigen-Redaktion. Foto: Julian Bückers
Die beiden hinter mir steckten bis zum Hals im Schnee, wobei einer nur noch mit dem Gesicht aus dem Schnee ragte. Die mussten sie erst ausbuddeln. Und danach fiel jemandem auf, dass der Bergführer weg ist. Der Italiener war es, der nach mir zu suchen begann. Er hatte wohl auch gleich ein Signal. In der Feinsuche zeigte sein Gerät eine Entfernung von 2,8 Metern an, als kleinsten Wert. Jeder weniger Erfahrene hätte sich gesagt: ‚Ich muss die Fläche weiter absuchen, um irgendwie einen kleineren Wert zu finden, um möglichst nah an den Verschütteten ranzukommen.‘ Aber weil er den Umgang mit seinem Gerät trainiert hatte und es deshalb gut kannte, urteilte er in dieser Situation einfach richtig und sagte den anderen: ‚Wir müssen nicht weitersuchen. Wir brauchen auch gar nicht erst zu sondieren. Er liegt hier tief unter uns.‘

Der Mann war echt fit in der Verschüttetensuche. Lebensrettend war auch, dass alle schaufeln konnten. Aber das Wichtigste war, dass einer den Umgang mit seinem Gerät trainiert hatte und es perfekt beherrschte. Ohne das hätten sie mich nicht so schnell gefunden. Ihre GPS-Uhren dokumentierten alles: Wer sich wann wo befand, wer wann wo buddelte und wann sie gemeinsam begannen, nach mir zu graben. 19 Minuten lag ich unter gut anderthalb Metern Schnee begraben. Die Überlebensstatistik weist für 19 Minuten in der Lawine sehr geringe Überlebenschancen aus. Als sie mich rausholten, fehlte mir nichts. Nur kalt war mir und speiübel.
Es war ein Riesenschneebrett gewesen, das uns gerade noch in seinem Auslauf erwischt hatte. Es war flaches Gelände, aber es lag genau in dem Bereich, in den ich nicht hatte kommen wollen. Genau die 20, 30 Höhenmeter, die ich abgewichen und doch zu hoch geraten war.
114
„Mein Fehler steckt in meiner Ungeduld. Und in meinem Wunsch, Erwartungen erfüllen zu wollen.“
Scheitern als Chance
So blöd das auch gelaufen ist: Dieser Fall hat mich weitergebracht. Ausrüstungstechnisch und vom alpinen Gruppenverhalten her hatten wir alles richtig gemacht. Wir waren nicht fahrlässig gewesen, was unsere Ausrüstung und die Ausbildung angeht.

Wir waren alle geschult im Umgang mit dem LVS. Wir hatten das am Vortag geübt. Ich hatte die Route nach der White-Risk-App ausgewählt. Basierend auf den Schweizer Landeskarten zeigt sie hoch aufgelöst, lawinengefährdete Bereiche an – mit Hanglayern für Fernauslösungsbereiche, Auslaufzonen und Hangsteilheiten.
Aber die Learnings waren ebenso unübersehbar: Ein Handy muss man im Schneetreiben immer wieder herausholen. Muss anhalten. Mit nassen Fingern auf das Display tippen. Das Handy schnell wieder ausschalten, um den Akku zu schonen. Ich war getrieben vom ständigen Gedanken: ‚Steck endlich das Handy weg und mach, dass du vorwärts kommst. Marschier halt mal. Es geht immer geradeaus, leicht fallend.’ Du gehst und bist plötzlich unsicher. Du denkst: ‚Bin ich jetzt fallend? Bin ich nicht fallend?‘ ‚Geh ich? Oder steh ich?‘ Das spürst du gar nicht mehr.
Was ich aus dieser Geschichte wirklich lernte: Die Ausrüstung war perfekt. Mein Fehler war rein psychologischer Natur. Ich wollte meiner Gruppe etwas bieten. Und ich habe einmal zu wenig aufs Handy geschaut und dadurch meinen festgelegten Korridor verlassen, weil mir die Zeit im Genick saß. Darum kam ich prompt der heikelsten Stelle zu nahe. Mein Fehler steckte in meiner Ungeduld. Und in meinem Wunsch, Erwartungen erfüllen zu wollen. Es war meine Psychologie, die Gruppe hat nicht den
geringsten Druck auf mich ausgeübt. Ich habe mir selber den Druck gemacht. Ich allein habe das entschieden, mir gesagt: ‚Das ist schon zu schaffen, wenn du aufpasst, hier nicht zu nah und dort nicht zu nah ranzukommen.‘
Eigentlich hätte ich sagen müssen: ‚Leute, das hat keinen Sinn, lasst uns was anderes machen. Das ist mir heute zu heikel. Zeitmäßig. Sichtmäßig. Sturm. Temperaturen.‘ Stattdessen sagte ich mir: ‚Das schaff ich schon. Die sind alle fit.
Und morgen haben wir die Trumpfkarte. Sonne. Neuschnee. Powder. Flaches Gelände.‘ Ich bin heute überzeugt, ich habe diese Lawine selber fernausgelöst. Da muss ich mir nichts vorlügen. Nur ein Prozent der Unfälle sind dem Material geschuldet. Der Rest den objektiven Gefahren, aber
vor allem der Psychologie des Menschen. Und zu welcher Ursachengruppe, die einer Fehleinschätzung aufgesessen sind, gehöre ich? Ich habe bei meinem Unfall nicht die Verhältnisse falsch eingeschätzt. Mir war vollkommen klar, was für ein Lawinenproblem herrscht. Was die Schlüsselstellen sind. Wo es tricky ist. Was ich machen muss. Auch meine Tourenplanung war okay.
Ich habe nur das Risiko in Kauf genommen: ■
Buchempfehlung
Dieser Text erschien erstmals im Buch „Der Einsatz meines Lebens. Bergretter erzählen“ (Verlag Millemari, 2021) von Thomas Käsbohrer. Bitte lassen Sie sich nicht von dem populären Titel abschrecken. Der Inhalt des Buches ist sehr lesenswert und lehrreich für alle Bergsportbegeis-terten. Sollte man gelesen haben!
Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit der Bergwacht Bayern und 25 Prozent des Reinerlöses dieses Buches werden der Bergwacht Bayern gespendet.
115 | scheitern
... und hatte am Ende unverschämtes Glück. Ich war zu frech. Zu überheblich.“
Gescheiter(t)
Das Scheitern gilt in der Gesellschaft wie im Bergsteigen häufig als der ultimative Schiffsbruch. Das muss sich ändern.
Glosse von Dominik Prantl
Der Film hat zwar auf den ersten Blick nichts mit Bergsteigen zu tun, auf den zweiten Blick aber sehr wohl.
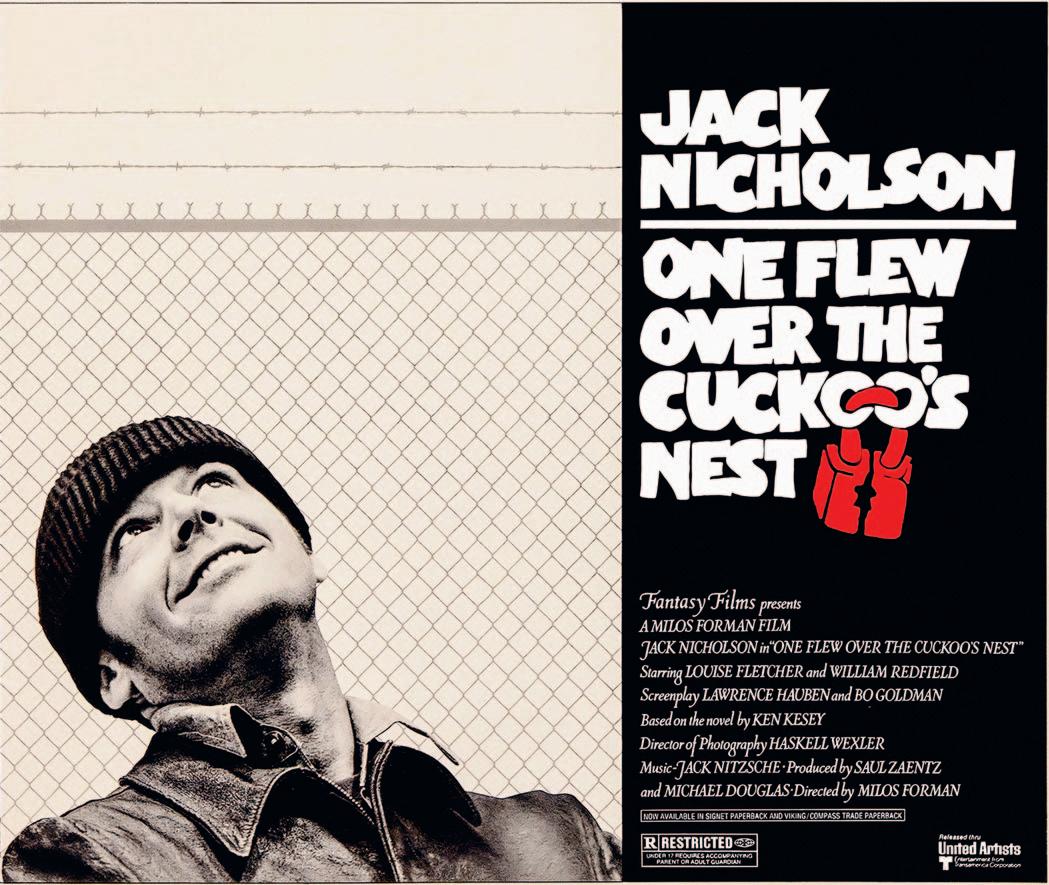
116 / bergundsteigen #122 / frühling 23
In dem wunderbaren Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ ist der noch wunderbarere Jack Nicholson Insasse einer Nervenheilanstalt. Eines Tages behauptet Nicholson alias Randle McMurphy, er werde jetzt diesen riesigen Hydrotherapietisch aus Marmor aus dem Boden reißen, durch die Wand werfen und dann in die Bar gehen, um die Endspiele der Baseballmeisterschaft anzusehen. Natürlich passiert McMurphy das, was man gemeinhin als Scheitern bezeichnen würde. Er kriegt das zentnerschwere Ding keinen Zentimeter vom Boden weg. Am Ende quittiert er seine Mühen mit dem Satz: „Aber wenigstens habe ich es versucht, verdammt nochmal, wenigstens das.“
Wenn heute jemand scheitert, ist das gemeinhin negativ konnotiert, es ist ein Ausdruck für Misserfolg, vor allem im deutschsprachigen Raum. Laut dem Internetlexikon Wikipedia bezeichnet Scheitern bei Schiffen gar das Zerschellen an einem Hindernis, also den ultimativen Crash. Nur die wenigsten kommen auf die Idee zu sagen: „Aber wenigstens hat er es versucht, verdammt nochmal, wenigstens das“, wenn ein selbstbewusster Politiker vor einer Wahl Kanzler werden will und letztlich doch nur Zweiter wird, wenn ein Fußballteam sich den Weltmeistertitel zum Ziel setzt und dann im Achtelfinale hängen bleibt – oder wenn ein junger Bergsteiger für eine Solo-Erstbesteigung an einen großen Berg im Himalaya fährt und schon wenige Meter über dem Basislager umdrehen muss. Dabei begreifen viele das

Scheitern als Lernprozess, nach dem Motto: Nur wer mal gescheitert ist, kann auch gescheiter werden. So gibt es inzwischen etwa etliche Bücher über die Schönheit des Scheiterns oder auch das „Museum of Failure“, welches sich in Ausschnitten sogar im Internet recht leicht besuchen lässt. Vorgestellt werden darin beispielsweise das Taco Phone von Nokia, eine Mischung aus Spielkonsole und Mobiltelefon, auf der allerdings wirklich gute Spiele fehlten. Oder der DeLorean, jener offenbar viel zu lahme Sportwagen, der durch den Film „Zurück in die Zukunft“ Geschichte schrieb. Ebenfalls dabei sind fettfreie Pringles für Chipsgenuss ohne Reue, wobei die Reue letztlich nur anders aussah: Der synthetische Fettersatz Olestra war ein Garant für, nun ja, den ständigen Toilettenbesuch. Das heißt keineswegs, dass all diese Exponate als überflüssig betrachtet werden. Vielmehr lautet die Grundidee des Museums: Innovation needs failure! Innovation braucht das Scheitern.
Insofern wäre es endlich an der Zeit, auch dem Misserfolg am Berg ebenso viel Platz zu widmen wie all den Heldengeschichten über die Hillarys, Habelers und Honnolds, und zwar als Basis für den Coup. Denn am Ende des Films „Einer flog über das Kuckucksnest“ reißt der bis dahin stillste von McMurphys Mitinsassen das Waschbecken übrigens aus dem Boden, wuchtet es durchs nächste Fenster und wandert in die Nacht. Und das nur deshalb, weil es ein anderer vor ihm schon einmal versucht hat. ■
Dominik Prantl hat seine journalist ische Heimat bei der SZ und ist noch nie gescheitert. Noch nie.
Am Berg kennt er inzwisc hen nur ganz viele Wege, die niemals auf einen Gipfel führen.
117
| scheitern
„Nur wer mal gescheitert ist, kann auch gescheiter werden.“
Scheitern Stichwort
„Wer Großes versucht, ist bewundernswert, auch wenn er scheitert.“
Seneca
„Umzukehren und abzusteigen ist eine der schwierigsten Entscheidungen in den Bergen. Vielleicht die schwierigste überhaupt. Ich habe lange gebraucht, bis ich das gelernt habe.“
Hans Kammerlander
„Scheitern heißt für mich: Wenn ich sterbe und nicht heimkomme.“
Ueli Steck
„Der einzige wirkliche Fehler ist der, von dem wir nichts lernen.“
Henry Ford
118 / bergundsteigen #122 / frühling 23
„In einer Welt, die sich sehr schnell verändert, ist die einzige Strategie, die das Scheitern garantiert, keine Risiken einzugehen.“
Mark Zuckerberg
„Ich lerne, wenn ich gescheitert bin, und nicht, wenn ich Erfolg hatte.“
Reinhold Messner
„Wir müssen auch aus den Fehlern anderer lernen, denn wir leben nicht lange genug, um sie alle selbst zu machen.“
Anna Eleanor Roosevelt
„Ohne Misserfolge zu leben ist unmöglich. Es sei denn, du lebst so vorsichtig, dass du genauso gut gar nicht gelebt haben könntest –was einem totalen Scheitern gleichkommt.“
J. K. Rowling
119 119 | scheitern
alpinhacks s
Halbmastwurfsicherung mit Rücklaufsperre
Tuber mit Ösen, also Tuber mit Plattenfunktion wie ATC-Guide, Reverso usw., werden gern in Mehrseillängenrouten verwendet. Denn im Falle eines Nachsteigersturzes wird das Seil blockiert. Statt eines Tubers kann man sich im Notfall aber auch mit Karabinern behelfen. Wir zeigen euch, wie das geht.
Von Gebi Bendler
Die gute alte Halbmastwurfsicherung hat den Nachteil, dass das Bremsseil nie losgelassen werden darf, da sonst der Nachsteiger bei einem Sturz oder beim Ausruhen abstürzt. Doch diese Sicherung kann sehr einfach mit einer Rücklaufsperre ausgestattet werden. Damit entsteht ein ähnlich komfortables Sicherungssystem wie beim Sichern mit Tuber mit Plattenfunktion. Zum Einbau der Rücklaufsperre braucht es nur einen zweiten Karabiner. Wir gehen wie folgt vor:
y Im ersten Schritt hängen wir wie gewohnt einen HMS-Karabiner in die Standplatzsicherung, legen einen Halbmastwurf-Knoten in diesen Karabiner und prüfen ihn durch mehrfaches Ziehen in beide Richtungen.
y Wir ziehen ein wenig Seil ein, sodass der Knoten in „Einhol-Stellung“ umklappt. Dann lockern wir den Knoten, belassen ihn aber in dieser Einhol-Stellung (1).
y Wir hängen den Zusatzkarabiner in den Halbmastwurfknoten wie in (2) dargestellt.
y Wir hängen noch das Nachsteigerseil in den Karabiner und schrauben die Verschlusssicherung zu (3).
y Wir vergewissern uns durch Zug an beiden Seilenden, dass das Seil nur in der gewünschten Richtung eingezogen werden kann.
Natürlich ist ein Tuber mit Plattenfunktion etwas komfortabler in der Bedienung, aber zur Not funktioniert auch dieses System sehr gut. Einfach ausprobieren!
Illustration: Matthias Baudrexl www.bergwerk-gestaltung.de
Lifehacks sind Tipps und Tricks, die das Leben leichter machen. Alpinhacks sollen euch das Bergsteigen erleichtern.
b
■
120 / bergundsteigen #122 / frühling 23
121 | alpinhacks
1 2 3
Anstatt eines Tubers mit Plattenfunktion kann man im Notfall auch zwei Karabiner verwenden und damit eine Nachstiegsicherung mit Rücklaufsperre herstellen.
lehrer lämpel
Didaktische, methodische und sicherheitsrelevante Ideen für die alpine Ausbildung.
How to teach Bergsport?
Auf den folgenden Seiten werden gängige Unterrichtsmethoden für Bergsportkurse dargestellt. Bei der Vermittlung von Lehrinhalten ist grundlegend das lehrerzentrierte vom schülerzentrierten Vorgehen zu unterscheiden. Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Artikel „Unterrichtstipps“, erschienen im Handbuch Ausbildung des DAV 2014.
Von Oliver Reischl und Hans Christian Hocke
Lehrerzentrierter Unterricht im Bergsport. Eine altbekannte Form davon ist der Frontalunterricht.
Foto: Silvan Metz

bs
122 / bergundsteigen #122 / frühling 23
1) Lehrerzentrierter Unterricht
Unter dem lehrerzentrierten Unterricht ist eine Form des Unterrichtens zu verstehen, bei der alle grundlegenden Ideen, Handlungen und Entscheidungen von der Lehrperson initiiert werden. Ein Vorteil dabei ist, dass Inhalte meistens schnell vermittelt werden können und eine klare Struktur geschaffen wird. Als Fachübungsleiter hat man so das Ruder eher in der Hand. Der lehrerzentrierte Unterricht wird vorzugsweise für die Vermittlung von technischen und sicherheitsrelevanten Themen verwendet. Der Aufbau einer lehrerzentrierten Unterrichtseinheit gliedert sich vom Inhalt und Ablauf her in verschiedene Phasen und Schritte, die in den folgenden Abschnitten näher beschrieben werden.
Erklärung und Demonstration
Sowohl die Erklärung als auch die Demonstration eines Sachverhalts stehen im lehrerzentrierten Unterricht in der Regel zu Beginn der Lehreinheit. Sie müssen korrekt sein und sie müssen exakt übereinstimmen. Es nützt wenig, wenn das eine erzählt und etwas anderes gezeigt wird. Kennt der Ausbilder beispielsweise mehrere Möglichkeiten, um einen Flaschenzug zu bauen, muss er sich für eine Variante entscheiden und nur diese vermitteln. Auf keinen Fall sollte der Schüler durch ein Vermischen verschiedener Inhalte oder Methoden verwirrt werden.
Ý Ein kompetenter Ausbilder konzentriert sich auf das Wesentliche. Er erklärt und demonstriert Inhalte nur auf eine Art und Weise.
Üben und Anwenden
Nach der Erklärung und der Demonstration kommt das Üben. Der Ausbilder gibt dazu klare Anweisungen, damit alle wissen, was zu tun ist. Allen Übenden wird genügend Zeit gelassen, um den Ablauf präzise nachzuvollziehen und zu verinnerlichen. Notfalls
wird während des Übens noch einmal jeder Schritt erklärt und demonstriert.
Korrektur und Lob
Zu Beginn der Übungsphase empfiehlt es sich, auf Gruppenschwächen zu achten und diese auf positive Art zu korrigieren. Auf die Fehler der einzelnen Teilnehmer sollte erst später überlegt hingewiesen werden. Denn viele kennen ihre Schwächen genau und reagieren empfindlich, wenn sie immer wieder darauf angesprochen werden. Besser ist es, zu loben und herauszustellen, was schon gut umgesetzt worden ist, um dann noch einen Tipp für das nächste Mal zu geben, wie das folgende Beispiel zeigt: „Das war ja super, alle Maßnahmen laufen ja schon locker von der Hand; schraub’ aber beim nächsten Mal noch den Schraubkarabiner zu.“ Entscheidend für den Lernerfolg ist, dass der Ablauf unmittelbar nach der Korrektur noch einmal geübt wird. So werden Fehler am besten ausgemerzt. Sitzt der Ablauf fehlerlos, folgt die Anwendungsphase. Hier kann das neu Gelernte in unterschiedlichen Situationen, in Spielformen oder Wettkämpfen, ausprobiert werden.
Ý Der Unterricht sollte so organisiert werden, dass möglichst alle Schüler gleichzeitig üben können oder zumindest in die Übung mit eingebunden sind (Übungsintensität).
Ý Eine Korrektur soll immer positiv formuliert werden und aufzeigen, wie man es besser machen kann.
Ý Lob muss authentisch sein.
Methoden des lehrerzentrierten Unterrichts
Im Bergsport gilt es, sehr einfache, aber auch sehr komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Je nachdem, wie anspruchsvoll ein Thema ist, greift man zu unterschiedlichen Methoden. Im Folgenden werden einige Möglichkeiten vorgestellt.
y Ganzheitsmethode
Die Ganzheitsmethode ist ein Verfahren, bei dem man von Beginn an ganzheitlich übt und das Lernziel ohne Umwege direkt angesteuert werden kann. Diese Methode eignet sich für sehr einfache Inhalte, die nicht in Teilschritte gegliedert werden müssen oder können und bei denen man eigentlich nichts falsch machen kann. Nach einmaliger Demonstration sollte der Ablauf von den Teilnehmern nachvollzogen werden können. Einfache Dinge, wie zum Beispiel ein gelegter Sackstich, werden deshalb mit der Ganzheitsmethode vermittelt.
y Teilmethode
Bei diesem Lehrverfahren wird der Inhalt in sinnvolle Teilschritte untergliedert, so dass niemand überfordert wird. Etwas schwierigere Sachverhalte, wie zu Beispiel der gesteckte Achterknoten, können so vermittelt werden. Hier ist es sinnvoll, erst die „Acht“ zu formen und abzuwarten, bis alle Teilnehmer es nachvollzogen haben, um dann mit dem „Nachfahren“ zu beginnen.
y Ganz-Teil-Ganz-Methode
Sehr komplexe Themen, wie zum Beispiel ein Flaschenzugmodell mit mehreren Umlenkungen, müssen in Teilschritte gegliedert und vermittelt werden. Wichtig ist jedoch, dass die Schüler bereits zu Beginn das fertige Modell sehen können, um so eine Vorstellung von der Sache zu bekommen. Es ist nicht zielführend, wenn beliebige Teilschritte aneinandergereiht werden, bevor das fertige Modell gezeigt wurde. Das Modell sollte deshalb vor der Lehreinheit aufgebaut werden, sodass die Teilnehmer es begutachten können und die Funktionsweise demonstriert werden kann. Anschließend wird es Schritt für Schritt auf- und nachgebaut. Zum Schluss hat jeder Teilnehmer sein fertiges Flaschenzugmodell vor sich und kann es testen.
123
| lehrer lämpel
Beim schülerzentrierten Unterricht bekommen die Schüler*innen Aufgaben gestellt und erhalten den nötigen Freiraum, um diese selbständig zu lösen. Der Ansatz des Verfahrens ist immer ganzheitlich. Illustration: Georg Sojer

124
2) Schülerzentrierter Unterricht
Das schülerzentrierte Lehrverfahren stellt den Schüler, seine Interessen, Fragen, Impulse und Aktionen in den Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Er bekommt Aufgaben gestellt und erhält den nötigen Freiraum, um diese selbständig zu lösen. Der Ansatz des Verfahrens ist immer ganzheitlich. Dank dem stärkeren Lernerleben wird das Gelernte langfristig gespeichert. Der schülerzentrierte Unterricht ist eine erfolgreiche Lehrmethode, die jedoch einer genauen Vorplanung bedarf.
Der Knackpunkt bei der Aufgabenstellung ist, dass die Aufgabe gezielt eingegrenzt wird, so dass der Schüler das thematisch richtige Ergebnis auch wirklich erarbeiten kann. Soll zum Beispiel beim Klettern das Eindrehen gelernt werden, so muss ein Boulder auch durch Eindrehen am besten zu lösen sein. Kommen die Schüler mit Dynamos oder frontal zu einem besseren Ergebnis, wird die Aufgabe unglaubwürdig. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Phasen und Schritte des schülerzentrierten Unterrichtens näher erläutert. Lehrerzentriert arbeiten und schülerzentrierte Elemente einbauen, das schafft einen sicheren Rahmen.
Das große Feld der Bewegungsthemen sowie Themen der Umweltbildung im Bergsport können im schülerzentrierten Unterricht gut vermittelt werden.
Zielführende Aufgabenstellungen
Wichtig ist, dass der Schüler die gestellte Aufgabe wirklich versteht. Grundlegend unterscheidet man offene von geschlossenen Aufgabenstellungen. Für das schülerzentrierte Lehr-Lernverfahren kommen offene Fragestellungen zur Anwendung. Die zielführende Aufgabe könnte also lauten: „Geht über das Blockfeld.“ Sie kann ergänzt werden mit einer Wahrnehmungs-
aufgabe („Achtet darauf, wie ihr eure Füße hinstellt“) oder durch Kontrastlernen: „Macht einmal ganz kleine Schritte und dann wieder ganz große.“
Ý In Kleingruppen oder Teams gelingt das Lernen oftmals besser. Man muss dabei den Teilnehmern genügend Zeit lassen, um die gestellte Aufgabe in Ruhe zu lösen. Es lohnt sich, die Schüler zu beobachten –von ihrer Kreativität kann man auch als Kursleiter lernen.
Ý Vor allem beim Lernen von Bewegungen soll das Probieren im Vordergrund stehen.
Präsentation der Lösungen Nach einer angemessenen Zeit demonstrieren die Schüler ihre Lösung(en). Bei mehreren korrekten Lösungen müssen natürlich alle nacheinander vorgestellt und geübt werden. Wird von einem Schüler eine richtige Lösung gezeigt, kann es sinnvoll sein, diese sofort von allen Teilnehmern üben zu lassen und erst danach mit der Präsentation weiterer Lösungen fortzufahren. So ergibt sich mit der Zeit ein reichhaltiges Repertoire an Möglichkeiten.
Ý Gegebenenfalls können sich die Teilnehmer selbst untereinander korrigieren. Ist dies nicht möglich, sollte der Ausbilder den Ablauf im Anschluss noch einmal demonstrieren und versuchen, die Fehler im Rahmen einer neuen Aufgabenstellung auszumerzen. ■
Zu den Autoren
Oliver Reischl ist Bergführer und Pädagoge. Hans Christian Hocke ist Bergführer, systemischer Coach, Trainer und Mitglied des DAV-Lehrteams.
125
| lehrer lämpel
y Ich hab ein Rad in Kathmandu Mein Leben mit den Achttausendern

Billi Bierling arbeitet seit fast zwanzig Jahren für die Himalayan Database, das Archiv der legendären Himalaya-Chronistin Elizabeth Hawley. Billi ist bekannt dafür, mit ihrem Fahrrad durch die lebhaften Straßen von Kathmandu zu kreuzen, um Expeditionsbergsteiger aus aller Welt zu treffen und sie über die Details ihrer Besteigungen zu befragen. In ihrem Buch, das sie gemeinsam mit Karin Steinbach verfasst hat und das im Tyrolia-Verlag erschienen ist, berichtet sie nicht nur von ihren Erfahrungen mit den von ihr interviewten Alpinisten, ihrem Leben mit Miss Hawley oder darüber, wie sich die Rolle der Sherpas in den letzten Jahren verändert hat. Billi spricht auch offen und ehrlich über die Entwicklungen auf den höchsten Bergen der Erde und ihre eigene Arbeit für die humanitäre Hilfe der Schweiz, die sie immer wieder in globale Krisenregionen führt. Ob sie nun von Expeditionen im Himalaya erzählt, dem Leben in Nepal oder von Flüchtlingscamps: Im Mittelpunkt stehen immer die Menschen, denen sie begegnet.
Prädikat: lesenswert!
[Gebi Bendler]


y Buried. Dokumentarfilm über das drittgrößte Lawinenunglück der USA
Am 31. März 1982 ging im Skigebiet Alpine Meadows nahe des Lake Tahoe in den USA eine Lawine ab, die sieben Menschen das Leben kostete. Die dokumentarische Aufarbeitung nach 40 Jahren mit persönlichen Einblicken der Retter und Lawinenwarner der Region ist eine beeindruckende Geschichte. Spannende Erzählungen der Beteiligten über den Verlauf des Sturms vor der Lawine sowie realitätsnahe Filmeffekte bringen dem Zuschauer das Inferno näher. Viele der involvierten Personen kämpften nach dem Extremereignis mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) und waren mit einem Gerichtsprozess konfrontiert, der sich einige Jahre hinzog. Seit dem Beginn der Wintersaison 2022/23 ist der Film in über 100 amerikanischen Städten unterwegs und hilft den amerikanischen Lawinenwarndiensten mit einem Teil des Erlöses, Mittel für ihre wichtige Arbeit zu sammeln. Im November 2022 katapultierte sich die Doku in iTunes und AppleTV an die Chartspitze. In Europa ist sie über AmazonVideo erhältlich. Die Originalaufnahmen im Film erinnern stark an die Katastrophe von Galtür 1999. [Timea Marekova]
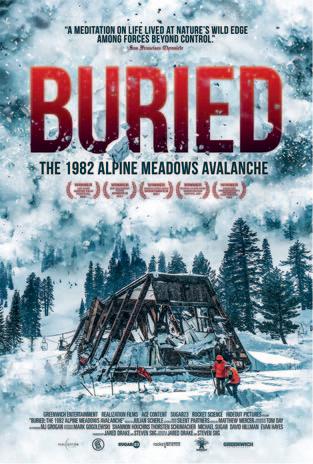
medien bs 126 / bergundsteigen #122 / frühling 23
y Ortovox Safety Academy LAB SNOW

Digitale Ausbildungsplattform für Lawinensicherheit
Das eigene Lawinenwissen erweitern kann man nun mit einer auch für Anfänger verständlich aufgebauten Plattform von Ortovox. Und das kostenfrei, online und interaktiv! Der große Sportartikelhersteller setzt seit mehreren Jahren auf die Ausbildungsmöglichkeiten in den jeweiligen Bergsportarten: Neben LAB ROCK, LAB ICE und PROTACT LAB ist nun das E-Learning für Skitouren dran. Mit anschaulichen Grafiken und Lehrvideos findet man detaillierte Infos: von den Basics über Lawinenentstehung, über Tools fürs Risikomanagement, Erklärungen zu Schneeprofilen und Schneedeckentests bis hin zum Worst-Case-Fall der richtigen Kameradenrettung. Da die digitale Plattform auch am Smartphone äußerst anwenderfreundlich ist, kann sich nun auch ein Schlechtwettertag im Skiurlaub in eine wertvolle Ausbildungssession verwandeln.
[Timea
Marekova]
www.ortovox.com/de/safety-academylab-snow
y Skitourenportal.eu
Bundeslandübergreifendes Skitourenforum von Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten
Das an der ZAMG seit November 2021 entwickelte Tourenforum vereint nun übersichtlich die aktuellen Tourenbedingungen in diesen fünf Bundesländern. Die Lawinenwarndienste nutzen zum Teil ebenfalls die Informationen der Wintersportler für einen besseren Überblick in den Bergen. Die Beiträge können mit Fotos samt GPSPositionierung der Bildaufnahme ergänzt werden. Die Filtereinstellungen machen die Suche in einem jeweiligen Bundesland übersichtlich. Die automatische Menüverlinkung zum jeweiligen Lawinenbericht, Stationsdaten, Lawinenereignisse und Schneeprofile aus LAWIS.at machen die Plattform zu einem bequemen „One-StopShop“. Vor allem, wenn man noch Inspiration oder einen Überblick über sein nächstes Skitourengebiet erfahren möchte und sich nicht durch die endlosen Feeds diverser Social-Media-Gruppen durchwühlen mag. [Timea Marekova]
www.skitourenportal.eu
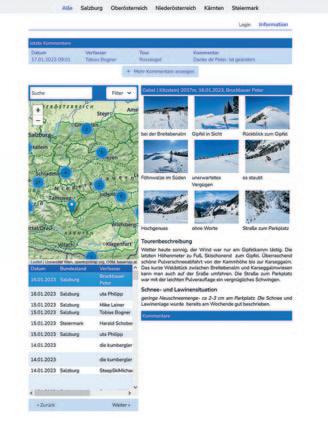
y TopoGuru. Intelligente Kletter-App von theCrag


Wer kennt das nicht, wenn der Zustieg zu einer Route länger dauerte als die Route selbst?! Die erneuerte TopoGuru-App enthält 90.000+ Klettergebiete, 917.000+ Routen und 1.999.000+ Begehungen weltweit, damit man schnell die besten Boulder und Routen finden kann, wo immer man gerade auf der Welt unterwegs ist. Genaue GPS-Koordinaten zu allen Bouldern und Routen der theCrag-Datenbank machen die Navigation nun zum Kinderspiel. Viele nützliche Infos, Fotos mit Routenverläufen und Saisongrafiken sind schon in der kostenlosen Version enthalten. Die Abo-Pakete für mehr (offline) Features kann man monatlich wählen. Eventuell gut investiertes Kleingeld für den nächsten Kletterurlaub?
[Timea Marekova]
www.topoguru.com



127 | medien
Das Ruhezonen-Paradox
In den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für mich. Nicht in den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für andere und die Natur ganz allgemein. Was also soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten – meinen Mitmenschen und der Berg-Natur-KulturLandschaft gegenüber? Tom Dauer sucht Antworten.

Tom Dauer sucht Antworten. #inunsrernatur 9
Jetzt ist schon wieder was passiert. Sagt der Erzähler der Brenner-Krimis, geschrieben von Wolf Haas und äußerst lesenswert, stets zu Beginn seiner Geschichten. Ich finde diesen Satz erstaunlich. Er kommt so einfach daher und ist zugleich komplex. Denn offenbar ist „was“ geschehen, das bemerkenswert zu sein scheint, zugleich aber geschah es „schon wieder“, also nicht zum ersten und vermutlich nicht zum letzten Mal. Damit ist „was“ besonders und gewöhnlich zugleich, und deshalb unserer Aufmerksamkeit wert.
Jetzt also ist schon wieder was passiert. Wo tut nichts zur Sache, denn die Sitzung zum Thema „Skitourenlenkung“ war eine unter vielen und könnte überall im Alpenraum stattgefunden haben. Im Protokoll dieses Treffens heißt es, dass im fraglichen Gebirge neue Schutzzonen ausgewiesen werden sollen, diese aber „keine gesetzlich untermauerten Sperrflächen darstellen“ und ein „freiwilliger Verzicht“ seitens der Skitourengehenden angestrebt werde. Das klingt versöhnlich und nach einem auf Aufklärung und Einsicht beruhenden Kompromiss. Einige Seiten weiter hinten jedoch lautet die Formulierung, ein Skitourenaufstieg „soll verhindert werden“. Das klingt schon wieder ganz anders und ich befürchte, dass
die Sprachwahl nicht nur unglücklich ist, sondern das „was“ offenbart – Verhinderung ist etwas anderes als freiwilliger Verzicht und aus einer Lenkungsmaßnahme wird „schon wieder“ ein Schlag gegen die individuelle Freiheit. Einige Gedanken zu diesem Thema habe ich in Ausgabe #117 bereits geäußert und ich verstehe, wenn man mir vorwirft, mein Verständnis von Freiheit beziehe sich zu sehr auf das Individuelle und lasse die Auswirkungen meiner Handlungen auf andere außer Acht.
Das aber ist in diesem Fall gar nicht der Punkt. Denn genauso wie der mögliche Verlust an Freiheitsgraden ärgert mich die Ungerechtigkeit, mit der ich mich angesichts des beschriebenen Sachverhalts konfrontiert sehe. Und die sich nicht auf dieses eine „was“ beschränkt.
Im Jahr 2019 wurde der Alpinismus von der UNESCO zu einem Teil des Immateriellen Weltkulturerbes erklärt. Das hatte gute Gründe, denn gleichwohl das Bergsteigen eine starke, weltweit ausgeübte Praxis ist, wird es von mindestens zwei Seiten in die Zange genommen. Zum einen vom Tourismus und einer Ermöglichungsindustrie, die den Zugang in die Bergwelt mittels einer raumgreifenden Infrastruktur immer mehr Menschen zu erleichtern trachtet. Zum anderen von einem romantisch verklärten Naturschutz, der Bergsteigende als per se unerwünschte Eindringlinge betrachtet, die einen vermeintlichen Idealzustand gefährden.

Es gibt in dieser Gemengelage verschiedener Interessen keine einfachen Lösungen. Umso wichtiger ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, dass auch Alpinisten – Alpinismus verstehe ich hier als Überbegriff verschiedener Bergsportdisziplinen –einen berechtigten Anspruch darauf haben,
sich in ihrem natürlichen Habitat, den Bergen, zu bewegen. Zumal ihr Anteil an den Belastungen, die auf alpine Regionen ausgeübt wird, verschwindend gering ist. Für das eingangs erwähnte Gebiet, in dem aktuell über Lenkungsmaßnahmen diskutiert wird, stellte eine Interreg-Studie beispielsweise fest, dass „gar nicht unbedingt die vielen Natursportler das Problem“ für Wildtiere darstellen, „sondern die (zunehmende) Erschließung der Landschaft mit Forst-, Almund Wanderwegen“. Okay, diese Einschätzung stammt von 2002. Betrachtet man aber gut 20 Jahre später die sich regelmäßig aktualisierende „Heatmap“ des sozialen Netzwerks „Strava“, das dem Tracking sportlicher Aktivitäten dient, dann stellt man fest, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Aktivitäten auf eben jenen Wegen stattfindet, die der Erschließung dienen. In den Räumen, in denen Schutzzonen errichtet werden sollen, ist dagegen kaum jemand unterwegs.
Ich frage mich deshalb, wer dort tatsächlich vor wem geschützt werden soll. Die Deutsche Wildtier Stiftung, die nicht gerade im Verdacht steht, im Konflikt zwischen Wildtieren und Natursportlern auf Seite der Letzteren zu stehen, fasste ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen kürzlich in den Begriff des „Ruhezonen-Paradox“: Dass in Schutzgebieten keine Skitouren unternommen, dafür aber Gämsen, Rehe und Hirsche oft über die Schonzeit hinaus gejagt werden dürften, sei ein Widerspruch in sich. Und alles in allem ungerecht. ■
128 / bergundsteigen #122 / frühling 23
kolumne
Tom Dauer schreibt an dieser Stelle regelmäßig über seine Gedanken zum komplexen Themenfeld Mensch und Natur.
Tom Dauer Autor, Regisseur, Bergsteiger. Foto: Bruno Wolfsfellner
Ropesolo. Christoph Schranz konnte an der Hohen Munde in Tirol eine Mehrseillängentour im Grad 8c erstbegehen. Die Route erschloss er solo von unten. Christoph erklärt, wie die Technik funktioniert.

Hitze. Die Sommerausgabe spannt im Schwerpunkt den Bogen vom Klimawandel über andere hitzige Debatten bis hin zum bergsteigenden Hitzkopf.

bergundsteigen Jahrgang 32, Auflage: 26.200
Herausgeber Deutscher Alpenverein, Schweizer Alpen-Club SAC, Alpenverein Südtirol, Österreichischer Alpenverein Medieninhaber Österreichischer Alpenverein, ZVR 989190235, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Fon +43 512 59547-30, redaktion@bergundsteigen.at





Redaktion Gebhard Bendler – Chefredakteur, gebhard.bendler@alpenverein.at, Dominik Prantl, Alexandra Schweikart, Birgit Kluibenschädl
Onlineredaktion: Simon Schöpf, www.bergundsteigen.com
Redaktionsbeirat ÖAV – Michael Larcher, Gerhard Mössmer, Markus Schwaiger, Georg Rothwangl / DAV – Andreas Dick, Julia Janotte, Stefan Winter, Markus Fleischmann / SAC – Marcel Kraaz/ AVS – Stefan Steinegger

Anzeigen inserate@bergundsteigen.at
Abonnement € 36,- / Österreich € 32.- / vier Ausgaben (März, Juni, September, Dezember) inkl. Versand und Zugang zum Online-Archiv auf www.bergundsteigen.com
Aboverwaltung Theresa Aichner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.com
Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl, Stefan Heis
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at, A. Brunner Druck Alpina, 6022 Innsbruck
PEFC-zertifiziert DiesesProdukt stammtaus nachhaltig bewirtschafteten Wäldernund kontrolliertenQuellen www.pefc.at
PEFC/06-39-364/31
Titelbild Die iranische Kletterin Elnaz Rekabi bei einem Kletterwettkampf 2019 in Toulouse. Im Oktober 2022 war sie bei der Asienmeisterschaft ohne das obligatorische Kopftuch angetreten. Die Geschichte ging um die Welt. Foto: Vladek Zumr
bergundsteigen fördert Land Tirol
Dialog Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie über Beitragsvorschläge (redaktion@bergundsteigen.at) und bitten um Verständnis, dass wir nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrücklich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen.
Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autor*innen wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Entwicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interessiert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem unten abgebildeten Stempel gekennzeichnet.
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichterstattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemeinsam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigenRedaktion nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil, welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.
bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.
b vorschau & impressum s 129
b schräg s
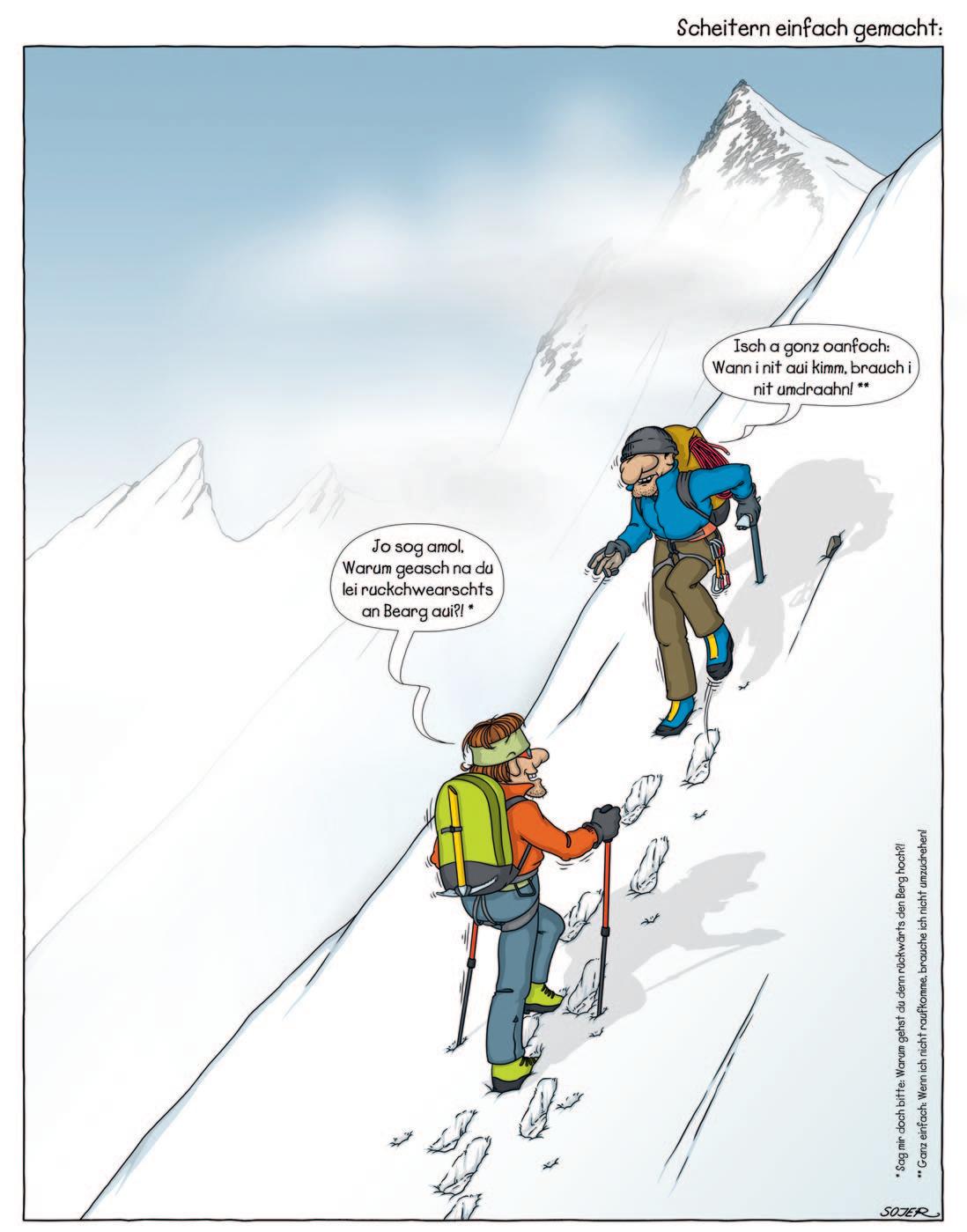
130 / bergundsteigen #122 / frühling 23
Illustration: Georg Sojer
TRUE. ALPINE. FAR & LIGHT


Technischer Minimalist für lange Touren. Der TRAVERSE LIGHT mit seinen 380 g ermöglicht es uns weiter zu gehen, tiefer hinein in die Berge. An Orte, an denen wir abschalten können. LEICHT | VIELSEITIG | REDUZIERT





Skihochtour im Dachsteinmassiv.
© 2023 - Petzl Distribution - Antonia Berger















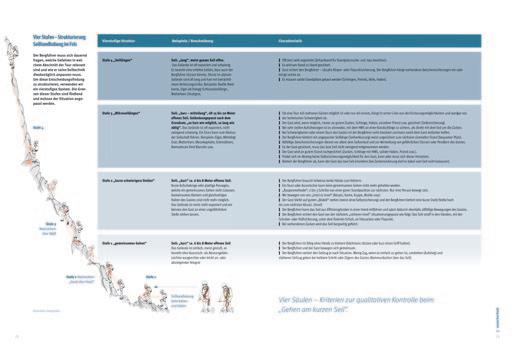

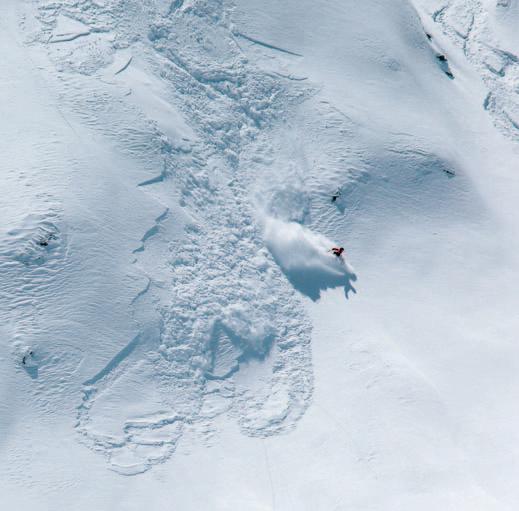


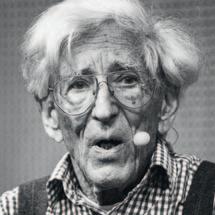


 Dr. Ing. Elmar Knoll Vizepräsident AVS
Dr. Ing. Elmar Knoll Vizepräsident AVS







































 BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
härtesten
Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.
ALTRA MONT BLANC BOA
BOA® FIT SYSTEM
PERFORMANCE POWERED BY THE
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
härtesten
Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.
ALTRA MONT BLANC BOA
BOA® FIT SYSTEM
PERFORMANCE POWERED BY THE


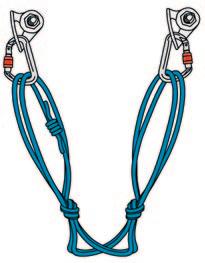

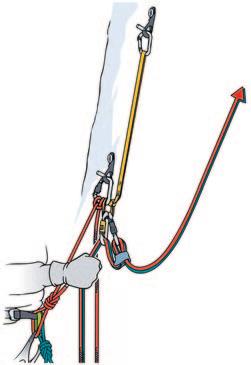


























 LA SPORTIVA JACKAL II BOA
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
Leash von Black Diamond. Foto: Gerhard Mössmer ■
LA SPORTIVA JACKAL II BOA
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
Leash von Black Diamond. Foto: Gerhard Mössmer ■
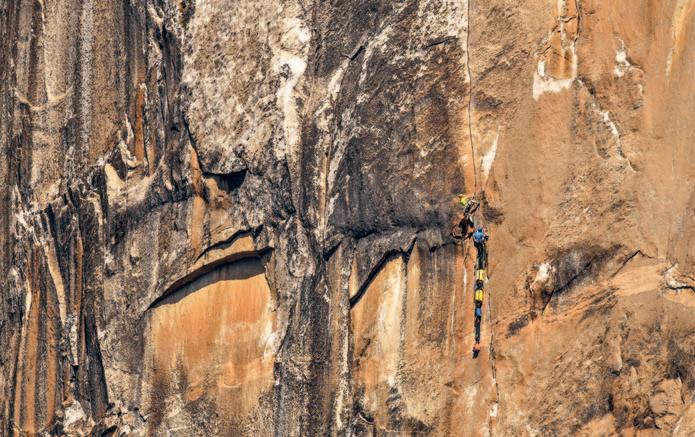



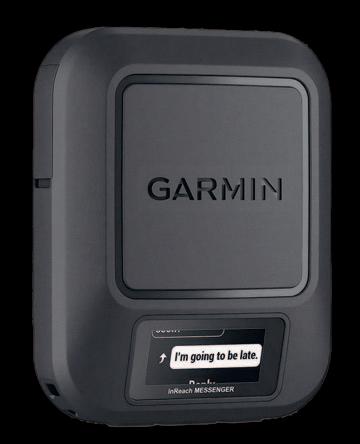


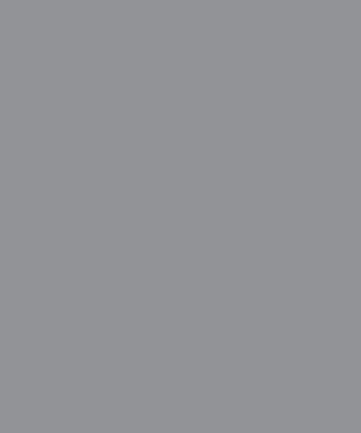


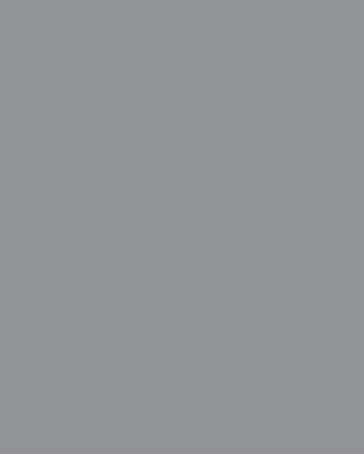


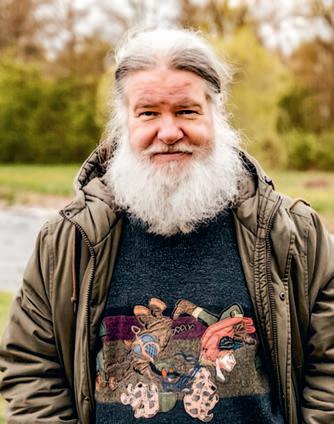



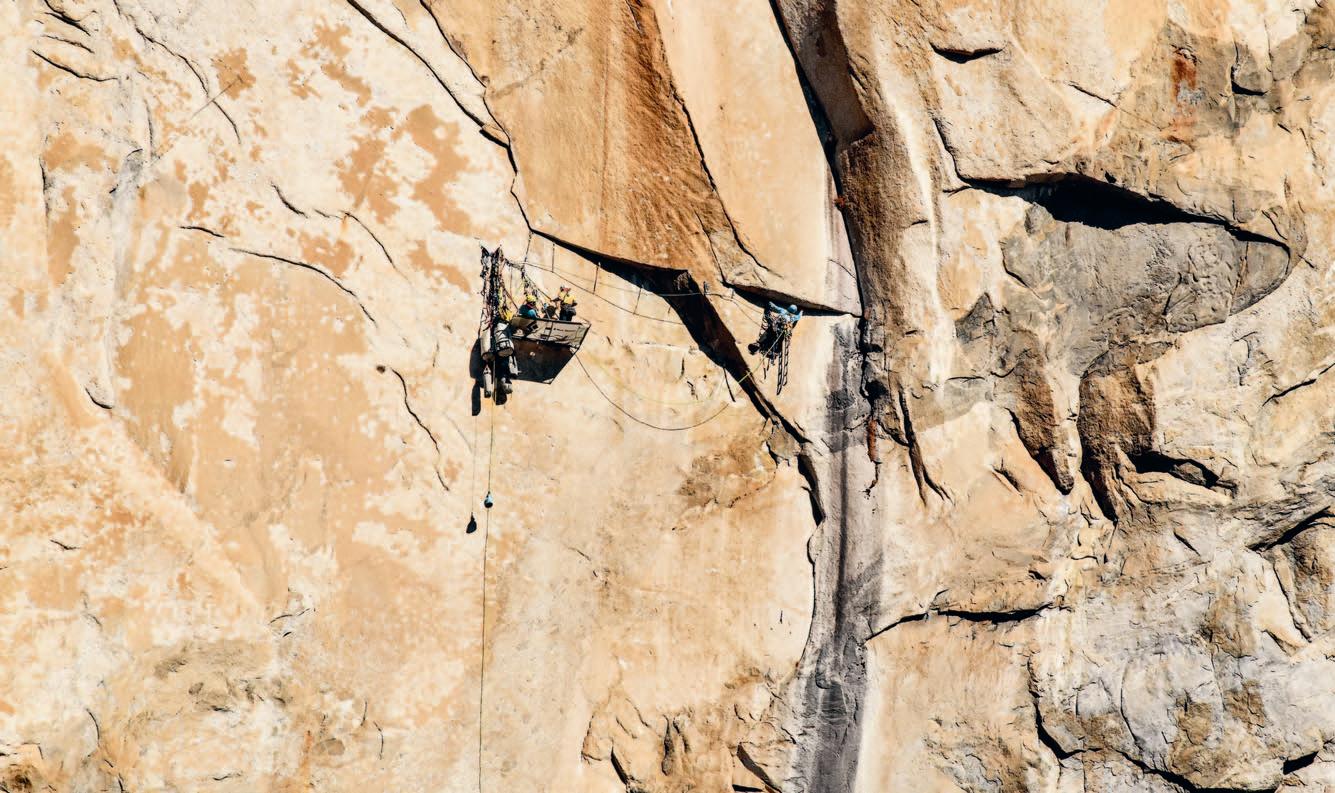
 Bei der Erstbegehung von „The Door“ am Belly Tower, Baffin Island.
Foto: Hansjörg Auer
Bei der Erstbegehung von „The Door“ am Belly Tower, Baffin Island.
Foto: Hansjörg Auer




















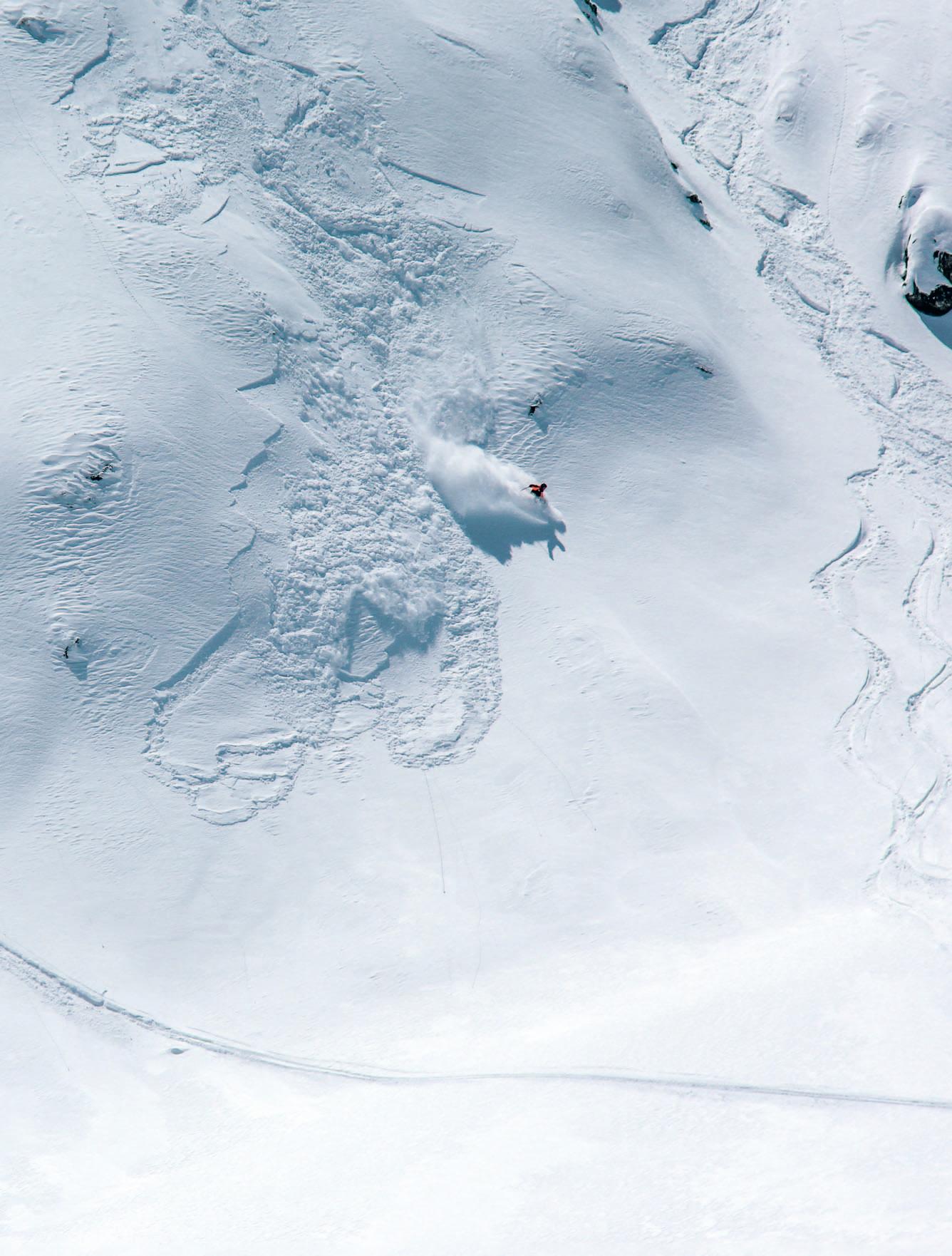


















































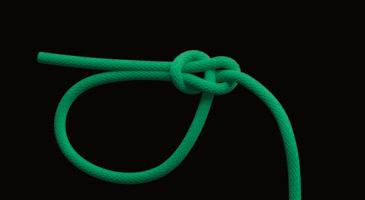



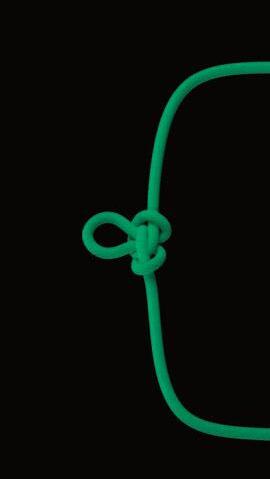








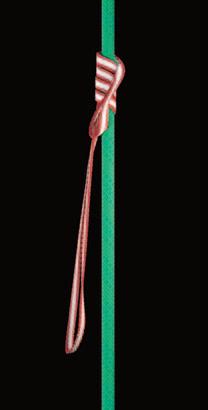




































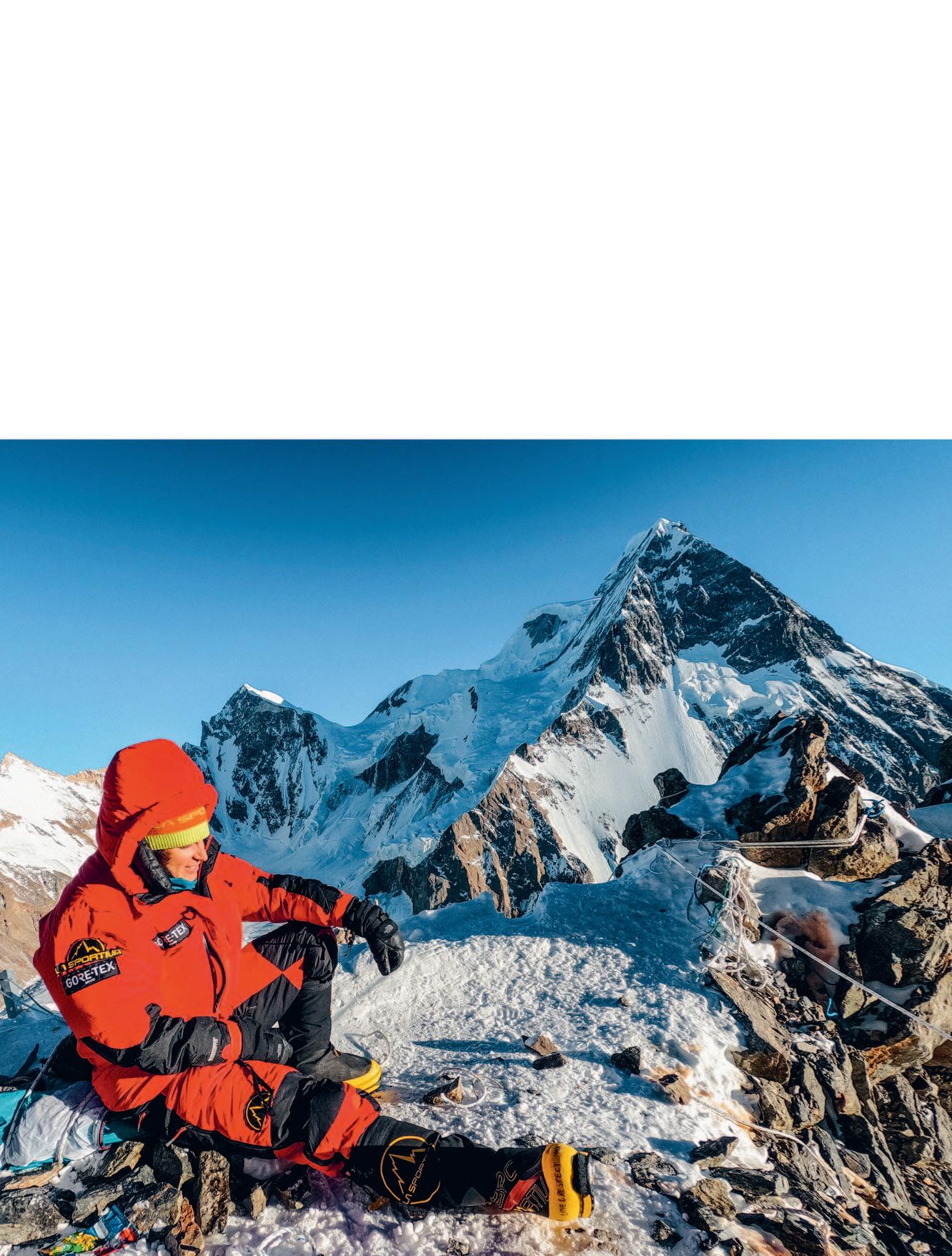




 Interview von Claus Lochbihler
Interview von Claus Lochbihler