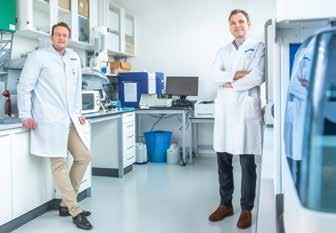12 minute read
Ohne die Hausärzte geht es nicht
Interview · Verbands-Chef Dr. Dietsche über die Lehren der letzten Monate „Ohne die Hausärzte geht es nicht“
Die Coronapandemie hat die Arbeit der Ärzteschaft und insbesondere der Hausärzte vielfach neu definiert, und sicherlich werden auch die Landtagswahlen zu Veränderungen führen. Über den Wandel sprach ÄBW-Chefredakteur Dr. Oliver Erens mit dem Vorsitzenden des baden-württembergischen Hausärzteverbandes, Dr. Berthold Dietsche.
Gerade in der Pandemie hat sich der ambulante Schutzwall bewährt. Was haben Sie aus den letzten Monaten gelernt?
Dr. B. Dietsche: Die letzten Monate haben sehr deutlich gezeigt, wie wichtig die ambulante hausärztliche Versorgung ist. Nicht ohne Grund wird uns Hausärzten von vielen Seiten bestätigt, dass die hausärztliche Versorgung der Grundpfeiler unseres Systems ist. Wir konnten in BadenWürttemberg gerade durch die hausarztzentrierte Versorgung HZV den Teilnehmern auch die notwendige Sicherheit bieten. Über unsere Pauschalen haben die Teilnehmer keine finanziellen Einbußen erlitten. Mein Fazit: Ohne die Hausärzte geht es nicht, und die HZV hat eine harte Bewährungsprobe bestens bestanden.
Der Ärztemangel war zuletzt medial weniger präsent. Wie klappt die Verteilung von Hausärztinnen und -ärzten in Stadt und Land?
Dr. B. Dietsche: Zu diesem Thema haben wir uns in den letzten Jahren immer wieder geäußert und auf die vielen Aktivitäten des Verbandes verwiesen. Leider sind unsere Botschaften nicht immer gehört worden. An der Situation hat sich nichts geändert. Das Landärzteprogramm in Baden-Württemberg wird vielleicht erst in Jahren greifen und hilft in der aktuellen Lage nicht. Dass sich junge Medizininnen und Mediziner nur bedingt auf dem Land niederlassen, hängt mit vielen Faktoren zusammen. Infrastrukturfragen sind genauso ausschlaggebend wie eine ordentliche Bezahlung der erbrachten Leistungen. Nur ein Zusammenspiel der Partner kann hier zu Erfolgen führen. Die Landarztquote wird als politisches Instrument genutzt, anstatt wirkliche Veränderungen in der Hausarztmedizin zu bewirken. Das Problem Hausarztmangel ist nicht mit der Quote zu lösen.
Die Digitalisierung ist in aller Munde – wo hilft sie der Hausarztpraxis?
Dr. B. Dietsche: Wir sind für Digitalisierung, wollen aber mitreden. Die Erfahrungen der letzten Monate haben uns deutlich gezeigt, dass digitale Prozesse eindeutige Vorteile gegenüber dem gegenwärtigen System haben. Ärztliche Leistungen als Fernbehandlung mittels Video und Telefon werden auch in Zukunft einen deutlich höheren Stellenwert haben als vor der Pandemie. Dazu gehört auch die Implantierung weiterer telemedizinscher Anwendungen.
Eine mit uns Hausärzten abgestimmte Digitalisierung wird unseren Praxisalltag erleichtern. Mit der elektronischen Arztvernetzung sind wir im Rahmen des AOK-Hausarztvertrages bereits erfolgreich gestartet. Etwas Vergleichbares brauchen wir natürlich auch in der Regelversorgung. Aber so, wie die TI-Infrastruktur momentan umgesetzt werden soll, ist es nach wie vor nicht akzeptabel, wie allseits bekannt sein dürfte. Wichtig ist, dass die Prozesse abgestimmt sind und die Kolleginnen und Kollegen bei notwendigen Investitionen unterstützt werden.
Ihre Wünsche an die künftige Landesregierung?
Dr. B. Dietsche: Die Hausarztpraxen müssen gerade nach den jüngsten Erfahrungen mehr gefördert werden. Als erste Anlaufstelle bei allen gesundheitlichen Anliegen der Patienten ist die Hausarztpraxis der Grundpfeiler unseres Systems. Die HZV hat sich bestens bewährt und muss weiter ausgebaut werden. Dazu zählt auch eine bessere Anbindung an die stationäre Versorgung, die ebenfalls weiter ausgebaut werden muss, um die Versorgung strukturell effektiver und effizienter zu gestalten. Wir fordern eine äquivalente Vergütung der erbrachten Leistungen nach dem Grundsatz: „Gleiches Geld für gleiche Leistungen“.
Die Freiberuflichkeit muss weiter gefördert werden. Originäre hausärztliche Tätigkeiten dürfen nicht an andere Akteure im Gesundheitsbereich übertragen werden. Die bewährten Strukturen der Delegationsmöglichkeiten wie beispielsweise VERAH sollten hingegen weiter gefördert werden.
Große Teile der Bevölkerung verfügen nach wie vor nur über eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz, was nachweislich zu einer Zunahme der Inanspruchnahme medizinischer Ressourcen führt, gerade bei den Hausärzten. Wir fordern die Verbesserung der Gesundheitskompetenz mit Unterstützung der Hausärzte, beispielsweise durch eine engere Kooperation der Ministerien, Modelltage an Schulen oder Unterrichtsmodulen zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz. Dr. B. Dietsche
Antworten auf drängende Fragen von Ärztinnen und Ärzten
Handreichung zu Gesundheits-Apps
Download Handreichung Medizinische Apps gibt es in Hülle und Fülle. Sie können zum Beispiel den Blutdruck aufzeichnen, an Medikamente erinnern oder Informationen liefern. Seit Oktober 2020 können sich Patientinnen und Patienten geprüfte Apps sogar verschreiben lassen. Doch die digitalen Angebote werfen viele Fragen auf. Die neue Handreichung „Gesundheits-Apps im klinischen Alltag“ von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung liefert Ärztinnen und Ärzten jetzt wichtige Antworten für die tägliche Praxis.
Die Handreichung wird von der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung herausgegeben. Mit der Durchführung, Organisation und methodischen Begleitung wurde das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) beauftragt. Ein Expertenkreis hat das
Ob zur Behandlung von Migräne, Schlafstörungen oder Tinnitus: Seit Oktober können sich Versicherte Gesundheits-Apps für das Tablet oder Smartphone auf Rezept verschreiben lassen. Bei den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland stößt diese Möglichkeit auf großes Interesse: So sagt jeder Vierte (24 Prozent), von nun an digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) verordnen zu wollen. Allerdings haben das erst 2 Prozent bereits getan. Das hat eine Umfrage ergeben, die der Digitalverband Bitkom zusammen mit dem Ärzteverband Hartmannbund durchgeführt hat.
Demnach hält ein Großteil der Ärzte, die bereits eine GesundheitsApp verschrieben haben oder dies tun werden, diese für eine sinnvolle Ergänzung zum medizinischen Standardangebot (68 Prozent). 29 Prozent ÄZQ bei der Erstellung unterstützt. Dort waren Fachleute aus ärztlicher Selbstverwaltung, Medizin, Informatik, Digitalisierung, Selbsthilfe und Medizinjournalismus vertreten.
Die Handreichung gibt einen Überblick über Nutzen und Risiken der digitalen Möglichkeiten und erklärt, was es mit dem „Digitalisierungsgesetz“ und den „DiGAs“ auf sich hat. Sie macht deutlich, woran man gute von schlechten Gesundheits-Apps unterscheiden kann. Wer sich ausführlicher mit einem Thema beschäftigen möchte, findet Hinweise auf weitere Informationsangebote und verlässliche Anlaufstellen.
Außerdem erfahren Ärztinnen und Ärzte anhand von zahlreichen Fallbeispielen unter anderem, was sie beachten sollten, wenn eine Patientin oder ein Patient ihre Meinung zu einer App hören möchte oder ihnen unabgesprochen digitale sind der Meinung, dass digitale Gesundheits-Apps in bestimmten Fällen sogar konventionelle Therapien ersetzen werden. Ebenfalls fast 3 von 10 Ärzten (29 Prozent) fordern, das Angebot an Gesundheits-Apps solle schnell ausgebaut werden. Bei den jüngeren Ärzten zwischen 25 und 44 Jahren, die Gesundheits-Apps verschreiben wollen oder dies bereits getan haben, sagt dies mehr als jeder Zweite (53 Prozent) – und damit deutlich mehr als bei den Ärzten ab 45 Jahren (11 Prozent).
Insgesamt gibt es unter den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland noch einen großen Informationsbedarf, was Nutzen und Indikation der Gesundheits-Apps betrifft. Die Mehrheit von 58 Prozent der Ärzte, die digitale Gesundheitsanwendungen jetzt oder künftig verschreiben, wünscht sich eine zentrale Plattform, Daten übermittelt. GesundheitsApps können jedoch nicht nur Patientinnen und Patienten unterstützen, sondern auch Ärztinnen und Ärzten den Berufsalltag erleichtern. Sie können beispielsweise Leitlinienwissen anbieten oder die Kommunikation im Kollegenkreis erleichtern. Auch hier hilft die Handreichung, Fallstricke zu erkennen und zeigt Lösungen auf.
Die Handreichung beinhaltet auch ein Informationsblatt für Patientinnen und Patienten. Dieses soll das Bewusstsein für Risiken schärfen und gibt Tipps, wie Nutzende Gefahren verringern und Datenmissbrauch vermeiden können, wenn sie eine Gesundheits-App anwenden möchten. Ärztinnen, Ärzte und andere medizinische Fachleute können das zweiseitige Informationsblatt herunterladen, ausdrucken und an Interessierte
Jeder Vierte will Gesundheits-Apps verschreiben Hohe Akzeptanz für DiGAs
Foto: iStock / Getty Images – Prykhodov
weitergeben. auf der sich Ärzte und Patienten über die verfügbaren digitalen Gesundheitsanwendungen informieren können. Zugleich weiß jeder zehnte Mediziner (10 Prozent) generell nicht, was eine digitale Gesundheitsanwendung überhaupt ist. Weitere 15 Prozent antworteten auf die Frage, ob sie eine solche App bereits verschrieben haben oder künftig verschreiben wollen mit „weiß nicht“. 28 Prozent der Ärztinnen und Ärzte wollen auch künftig ihren Patienten keine Gesundheits-App verschreiben. Die Mehrheit aus dieser Gruppe (57 Prozent) führt Datenschutzbedenken als Grund an, weitere 41 Prozent mangelndes Vertrauen in die Technologie (41 Prozent). Mehr als jeder Dritte (37 Prozent) verfügt über zu wenige Informationen über digitale Gesundheitsanwendungen.
Komplettlösung für Video-/Telesprechstunden: Sicher & komfortabel
Die Telemedizin gewinnt gerade in Zeiten von COVID-19 immer mehr an Bedeutung. So bieten sich etwa Telesprechstunden für Patienten an, die einfach nur Fragen abklären möchten, für die nicht unbedingt direkter Kontakt notwendig ist, aber auch um Wegstrecken und Wartezeiten zu sparen oder das Ansteckungsrisiko durch den Patientenandrang in Praxen zu reduzieren. Wichtig ist dabei natürlich nicht nur die komfortable Kommunikation mit den Patienten, sondern auch die Sicherheit des Systems. Das Videokonferenz-Software-Möbel-System „teleCONSULT“ aus dem Medien- und Technikhaus „infoWERK“ mit integrierter Software ermöglicht eine sichere Kommunikation zwischen Arzt und Patient sowie Teamgespräche mit bis zu 12 Teilnehmern. Dabei bedient sich das System keiner Cloudlösung, bei der Signale über unbekannte Wege in unbekannten Rechenzentren geroutet werden, sondern es beinhaltet einen eigenen Videokonferenz-Server und eine Endezu-Ende verschlüsselte Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der Ärztin/dem Arzt und seinen Gesprächspartnern. teleCONSULT ist ein Software-Möbel-System für Telesprechstunden, das sich in die Praxisräumlichkeiten einfügt und durch eine spezielle Kameraposition dem Gesprächspartner beziehungsweise dem Patienten den Eindruck gibt, der Ärztin oder dem Arzt persönlich gegenüberzusitzen. Außerdem kann das System auch für klassische, lokale Präsentationen verwendet werden: Dazu wird das Bild vom Notebook per HDMI oder kabellos per MiraCast auf den Großbildschirm übertragen.
So läuft eine teleCONSULT-Telesprechstunde ab:
• Die Patientin/der Patient erhält einen Link von der Ordination. • Durch einen Klick auf den Link via Handy oder PC öffnet die
Patientin/der Patient den virtuellen Warteraum. • Die Ärztin/der Arzt sieht, wer sich im Warteraum aufhält und kann die Besprechung durch einen Klick starten. • Das Gespräch erfolgt per Audio und Video – fast als würde man sich persönlich gegenübersitzen. • Die Patientin/der Patient sieht die Ärztin/den Arzt aus gewohntem
Blickwinkel und in gewohnter Position hinter dem Schreib- oder
Besprechungstisch.
Man kann Dokumente uploaden, diese gemeinsam anschauen und darin Markierungen vornehmen. Die Vorteile der teleCONSULT-Lösung auf einen Blick: • Neueste Software, schnell und einfach bedienbar • Professionelle Audio- und Video-Technologie: Hohe Tonqualität durch kabelloses Sennheiser Schwanenhalsmikrofon und
FullHD-Kamera mit schwenk- und neigbarem Kamerakopf für gestochen scharfes Bild ermöglichen eine Kommunikation mit
Live-Charakter • Sichere Kommunikation zwischen Ärztin/Arzt und Patient sowie für Teamgespräche mit bis zu 12 Teilnehmern • Nutzbar auch mit jeder anderen Webkonferenz-Software wie
Skype, Teams etc. • Drei vorprogrammierbare Kameraausrichtungs-Presets, wählbar mittels Fernbedienung • Möglichkeit der Verwendung des eigenen Logos und der
Corporate-Design-Farben • Gehäuse von USM Haller Möbel und hohe Verarbeitungsqualität von infoWERK
Sicherheit hat oberste Priorität
Die integrierte Webkonferenz-App bietet eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Ärztin/Arzt und Gesprächspartnern und garantiert Vertraulichkeit auf höchstem Niveau.
Preis für das Komplettsystem
Im Leasing inklusive Softwareservice und Updates um Euro 187,- pro Monat bei fünf Jahren Laufzeit erhältlich.


Die infoWERK Medien & Technik GmbH bietet seit mehr als 20 Jahren Hard- und Software-Lösungen und modulare Kommunikationsmöbel, die das Kommunizieren, Lernen und Präsentieren schneller und effizienter gestalten. infoWERK Medien & Technik GmbH, Egger-Lienz-Straße 130, 6020 Innsbruck, E-Mail: info@infowerk-manufaktur.com, Tel.: +43/5238/52099-0, www.infowerk-manufaktur.com
Dr. Baumgärtner: Entwurf zur Impfverordnung realitätsfern und Zumutung
Keine Patienten-Triage per Attest
Mit dem im November 2020 in Kraft getretenen Dritten Bevölkerungsschutzgesetz wurde das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt, im Falle einer festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite eine Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der der Anspruch auf die Schutzimpfung geregelt wird.
Den ersten Entwurf dieser Impfverordnung sah Mitte Dezember MEDI GENO Deutschland kritisch; Vorstandsvorsitzender Dr. Werner Baumgärtner sagte: „Unsere Teams sind seit Monaten durch die Einhaltung von Hygienestandards, Abstandsregelungen, durch zusätzliche Bürokratie und Aufklärungsarbeit maximal belastet.“ Der Betreuungsaufwand für einzelne Patienten habe sich durch die Coronakrise deutlich erhöht. Wegen
Die Delegiertenversammlung des MEDI Verbundes hat sich im Dezember 2020 in Stuttgart unter anderem mit der Elektronischen Patientenakte und der Telematikinfrastruktur befasst. In einer Entschließung forderten die Delegierten eine sichere digitale Vernetzung der Praxen mit dezentraler Speicherung von Patientendaten und einer Arzt-zu-ArztKommunikation, die von den Verbänden oder Körperschaften gehostet werde. Die ePa als Kommunikationsmedium zwischen Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Apotheken etc. sei ein Irrweg, heißt es in der Entschließung. Nur ein Teil der Bevölkerung werde die ePa aus Gründen des Datenschutzes nutzen. Zudem könnten die medizinischen Inhalte durch Patienten verändert werden, was nach Überzeugung der Delegierten die Behandlungssicherheit gefährden werde.
In einer weiteren Entschließung stellten die Abgeordneten fest, dass Deutschland im Rahmen der Pandemie der Hygieneregeln könnten pro Stunde weniger Patientinnen und Patienten versorgt werden. „Trotzdem haben wir unseren Anteil zur Bewältigung der Pandemie geleistet, ohne Lob der politisch Verantwortlichen für unsere Medizinischen Fachangestellten; von einer Zuwendung aus Steuergeldern wie in anderen Gesundheitsberufen ganz zu schweigen“, so Dr. Baumgärtner weiter.
Der Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sah vor, dass Impfwillige in Arztpraxen ein ärztliches Attest zum Preis von 5 Euro erhalten sollten. Dabei sollte vom behandelnden Arzt oder von der Ärztin „das krankheitsbedingt erhöhte Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019“ attestiert werden. Der Verband lehnte eine Triage der Patienten per Attest so gut gefahren sei, liege auch an seinem gegliederten Gesundheitssystem. Dieses sei weltweit einmalig und hat sich bewährt, obwohl es seit Jahren politisch wenig gefördert, allenfalls dauerreformiert werde. Auch der hohe Einsatz der 500.000 Medizinischen Fachangestellten, die ebenfalls unter schwierigen Bedingungen seit Ausbruch der Pandemie arbeiten müssten, finde politisch wenig Beachtung und Anerkennung. Dankbarkeit zeigten hingegen die Patientinnen und Patienten. Wolle man eine schnelle und sichere Durchimpfung der Bevölkerung, so werde dies ohne die Ärztinnen und Ärzte kaum gelingen, auch wenn politisch über andere Szenarien diskutiert werde. Impfen gehöre in ärztliche Hand, zumal hier auch die Impfkomplikationen behandelt würden. Eine dezentrale Impfung in den Praxen sei nicht nur schnell umsetzbar, sondern auch sicher, was die Behandlung von Komplikationen und die Vermeidung von Neuansteckungen durch funktionierende Hygienekonzepte angehe. klar ab: „Das ist Aufgabe des Staates und muss über ein Einladungssystem umgesetzt werden, wie es das zum Beispiel beim Mammographie-Screening gibt“, erklärte Dr. Baumgärtner. „Wenn wir jetzt noch jeden Tag unsere Arbeitszeit mit der Ausstellung von Attesten und den dafür notwendigen Gesprächen verlieren, geht das zulasten der akut unvd chronisch kranken Patientinnen und Patienten.“
Zudem seien 5 Euro pro Attest nicht kostendeckend und „eine Zumutung“. Dr. Baumgärtner zog einen Vergleich heran: „Die Verlängerung eines Jahresfischereischeins beim Amt für öffentliche Ordnung, die ähnlich aufwendig ist wie das Ausstellen der Covid-Atteste, kostet aktuell 95 Euro.“ An der außerbudgetären Bezahlung von 5 Euro „erkennt man die Wertschätzung unserer Arbeit und
Wegweisende Beschlüsse
die unserer Angestellten.“
Die Förderung von Selektivverträgen war Gegenstand einer weiteren Entschließung. Seit Jahren werde eine gesetzliche Förderung von Facharztverträgen gefordert, was bisher nicht erfolgt sei. Im Gegensatz dazu würden jetzt sogar die bestehenden Versorgungsverträge insbesondere in Baden-Württemberg durch die Auswirkungen des FaireKassenwahl-Gesetzes gefährdet, was zu einer Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung führe. Man entzieht hier den gesetzlichen Krankenkassen die Mittel, die beispielsweise durch den Abschluss von Versorgungsverträgen eingespart wurden, die jetzt aber dringend gebraucht würden, um den Anschub weiterer Versorgungsverträge zu finanzieren. „Hier besteht noch dringender Änderungsbedarf, den Worten der politisch Verantwortlichen, die Versorgungsverträge fördern zu wollen, sollten endlich Taten folgen“, so der Beschluss der Delegierten.