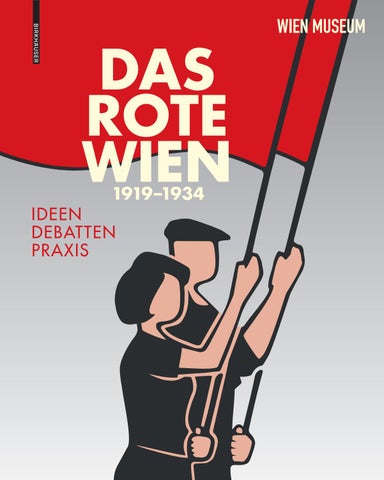WIEN MUSEUM
IDEEN DEBATTEN PRAXIS
DA S R OT E W I E N 1919—19 3 4
DA S R OT E W I E N 1919—19 3 4 Ideen, Debatten, Praxis Herausgegeben von Werner Michael Schwarz Georg Spitaler Elke Wikidal
Birkhäuser Basel
I N H A LT
10 Vorwort
Matti Bunzl
12 Einleitung
Werner Michael Schwarz, Georg Spitaler, Elke Wikidal
Grundlagen und Voraussetzungen 18 Was ist das Rote Wien ?
Debatte Lilli Bauer, Helmut Konrad, Hanna Lichtenberger, Wolfgang Maderthaner, Béla Rásky, Werner Michael Schwarz
24 Das kommunale Experiment
Die » Veralltäglichung « der Utopie ? Wolfgang Maderthaner
30 » Was die Sozialdemokraten von
der Kommune fordern ! « Historischer Text
31 »Eine Kundgebung des geistigen Wien.«
Historischer Text
32 Austromarxismus
Die Ideologie der Einheit der österreichischen Arbeiterbewegung Vrääth Öhner
38 Von der Residenzstadt zum Roten Wien
Die Veränderungen in der Gemeindeverwaltung, 1918 – 1920 Therese Garstenauer, Veronika Helfert
58 Afrika singt
Rotes Wien global Birgit Nemec, Werner Michael Schwarz
62 »An alle arbeitenden Juden!«
Jüdische Stimmen zum Roten Wien Gerhard Milchram
68 Wahlaufruf der jüdischen
sozialdemokratischen Arbeiter organisation Poale Zion Historischer Text
70 Sozialdemokratie und Antisemitismus
Gerhard Milchram
Fürsorge 74 Mutter (Rotes) Wien
Fürsorgepolitik als Erziehungs- und Kontrollinstanz im » Neuen Wien « Katrin Pilz
82 Kinderherberge » A m Tivoli « , 1923
Fotografien von Ludwig Gutmann
84 »Diese vitale Stärke «
Sigmund Freud und die Psychoanalytiker des Roten Wien Elizabeth Ann Danto
90 Obdachlos im Roten Wien
Sigrid Wadauer
Schulreform und Bildung
42 Die Finanzpolitik des Roten Wien
96 Das Rote Wien — eine » M usterschulstadt «
50 »Es lebe drum : Die Frau von heut !«
104 Politiken des Aushandelns
Peter Eigner
Frauenpolitik im Roten Wien Marie-Noëlle Yazdanpanah
Wilfried Göttlicher
Wiener Schulreform, Demokratisierung und der Schulneubau in der Freihofsiedlung, 1930 Christian Dewald
112 Aus meiner Arbeitsklasse
Paula Deutscher Historischer Text
114 Volkshochschulen im Roten Wien
Christian H. Stifter
120 Sich etwas zu sagen haben
Vier Motive der Intelligenz des Roten Wien Gernot Waldner
Architektur, Infrastruktur, Wohnen 158 Architektur und Politik — Lernen vom Roten Wien
Debatte Eve Blau, Gabu Heindl, Monika Platzer
166 First Encounter: Experiencing Red
Vienna In The Early 1980s Eve Blau
126 »Neues Wissen, neue Kultur«!
170 Wilde Siedlungen und rote Kosakendörfer
132 Die Arbeiterbüchereien
176 Siedlungsbau am Rosenhügel 1921
136 Thomas Mann für das Rote Wien
180 »… was den Anbeginn der neuen
Bildungseinrichtungen der SDAP in den Jahren 1918 bis 1933 und ihre AkteurInnen Sabine Lichtenberger Alfred Pfoser Alfred Pfoser
138 Literaturvermittlungen
» Wir haben beim Aufbau unserer Bibliothek die Belletristik wirklich nicht verkürzt. « Sabine Zelger
142 » A us dem Leben des Kindes für das Leben ! «
Franz Cizeks Jugendkunstklasse und die Kunstpädagogik der Wiener Schulreform Elke Wikidal
152 Erinnerung der ehemaligen
Schülerin Bella Vichon an die Jugendkunstklasse Franz Cizek Historischer Text
Zur informellen Stadtentwicklung im Wien der Zwischenkriegszeit Friedrich Hauer, Andre Krammer
Fotografien von Derbolav Machovsky
Gesellschaft bildet«
Die Reformsiedlung Eden als Trojanisches Pferd der Anarchie Andreas Pavlic
184 Die Spülküche von Margarete Lihotzky
Christine Zwingl
188 Leben in der Freihofsiedlung
Romana Pöter
192 » Ein Werk der Kultur, das weiterbestehen
wird in der Geschichte «
Der Karl-Seitz-Hof und das Wohnbauprogramm des Roten Wien Andreas Nierhaus
153 Zeichnen »vom Kinde aus«
198 Der Karl-Marx-Hof
154 Heimatlob ohne Weltbürgertum
204 Manfredo Tafuri und die Ideologie der Form
Richard Rothe Historischer Text
Die Entwicklung des Heimatbegriffs während der Jahre des Roten Wien Elsbeth Wallnöfer
» Schaut ! – , das ist ein Stück Marxismus ! « Lilli Bauer, Werner T. Bauer Johan Frederik Hartle
208 Die Fotografien aus dem Gesellschafts-
Kommunikation und Kunst
224 »Mit dem billigsten Tarif der Welt !«
286 Fotografie, Bildpropaganda
und Wirtschaftsmuseum (GWM)
Die sozialdemokratische Stadt und ihre Mobilität Sándor Békési
230 Warum in Wien auf dem Gasherd gekocht wird
Christian Stadelmann
234 Wohnen und Haushalten im Gemeindebau
Politischer Diskurs, Repräsentation, Praxis, kulturelle Folgen Reinhard J. Sieder
242 Neue Küchen für neue Frauen
Modernisierung der Hauswirtschaft im Roten Wien Susanne Breuss
246 Wohnen lehren
Eva-Maria Orosz
254 Kindgerichtete Architektur
Christoph Freyer
258 Städtischer Montessori-Kindergarten Goethehof
Fotografien aus dem Album von Hedy Schwarz
262 Amerikanismus im Roten Wien
Rob McFarland
266 Kommunaler Wohnbau anderswo
Vorbilder und Gegenbilder Christoph Reinprecht
und visuelle Kommunikation Marion Krammer
296 Arbeiterfotografie 300 Kathederstreithengst
Die vielfältigen Aktivitäten Otto Neuraths im Roten Wien Günther Sandner
306 Moderne Architektur und
Bildstatistik im Roten Wien Eve Blau
316 »Ho-ruck nach links!« oder
Der Mehrwert der Bilder
Plakate, Flugblätter und Handzettel im Roten Wien Christian Maryška
324 Verpasstes Rendezvous im Close Up
Gegenläufige Bewegungen in der Film- und Kinopolitik Joachim Schätz
328 Ein Mittelweg
Das Rote Wien und die bildende Kunst Berthold Ecker
336 Bauplastiken und Denkmäler
Fotografien von Nora Schoeller
274 Mit der Westbahn nach West Yorkshire
348 David Josef Bach
278 Im Goethehof
352 Versuche einer musikalischen Proletariatskultur
Die Wohnbauten von Quarry Hill und der Internationalismus des Roten Wien Sabrina Rahman Ernst Strouhal
282 Expedition zu Stiege 8/Tür 7
Uwe Mauch
Die Vermittlung der Musik der Moderne in der sozialdemokratischen Kulturpolitik Wolfgang Fichna Die Beethoven-Zentenarfeier 1927 Susana Zapke
Arbeiterkultur 358 Ein Match um den Sport
Politische Bewegungskonzepte vs. populäre Massenkultur Georg Spitaler
366 Der Superblock des Sports
Das Praterstadion im Spannungsfeld von Theorie und Praxis des Roten Wien Bernhard Hachleitner
412 Ausblick: Hoffnung auf die egalitäre Stadt
Debatte Yvonne Franz, Raphael Kiczka, Robert Misik, Irina Vana, Paul Werner, Georg Spitaler
420 Katalog 464 Orte des Roten Wien
370 Das Bad im Proletenviertel
»Wer sich sein Lebtag nicht gewaschen hat, der kommt zu uns ins Amalienbad « Michaela Maier
Gewaltsames Ende, Verfolgung und Emigration 374 Album 1934 384 Der Gemeindebau vom Austrofaschismus
bis nach 1938
Ursula Schwarz
388 Das Rote Wien im Exil
Peter Pirker
396 »Mit einem Lächeln und a usgestreckten Händen«
Bill Tandler im Gespräch mit Birgit Nemec
400 Einige Erinnerungen an meine Eltern,
Käthe und Otto Leichter Franz Leichter
402 » W ir haben immer mit dem Roten Wien gelebt «
Helena Lanzer-Sillén im Gespräch mit Georg Spitaler und Patrick Spanbauer
406 » W ien ist eine Stadt, die einem unter die
Haut geht, da will man nicht weg.«
George Czuczka Zusammengestellt von Philipp Rohrbach
466 Autorinnen und Autoren 469 Dank und LeihgeberInnen 470 Impressum
10
VO R WO R T Matti Bunzl
Stadtmuseen nehmen einen besonderen Platz im kulturellen Gefüge einer Gesellschaft ein. Im Gegensatz zu Kunstmuseen – das Genre, für welches das unmodifizierte Wort » Museum « gemeinhin steht – sind sie nicht nach normativen Hierarchien organisiert. Nur bedingt relevant ist die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Gemälden oder die Darstellung eines scheinbaren ästhetischen Fortschritts. Im Gegenteil, die Sammlung eines Stadtmuseums nivelliert. Alles ist potenziell interessant, solange es mit der Stadt zu tun hat. Auf diese Unterscheidung gründen sich radikal unterschiedliche Museumsansätze. Kaum ein Ort ist exemplarischer für diesen Gegensatz als Wien. Auf der einen Seite sind die großen Bundesmuseen, allen voran das Kunsthistorische Museum ( K HM ), kaiserliche Sammlungen, die über Jahrhunderte durch die vermeintlich schönste, beste und wichtigste Kunst der Welt gespeist wurden. Auf der anderen Seite das Wien Museum, das Universalmuseum einer Stadt, das sie selbst abbildet. Das KHM ist mit Wien letztlich nur durch seinen Standort verknüpft ; seine Inhalte reflektieren den globalen Geschmack einer lediglich hier ansässigen Familie. Das Wien Museum versucht dagegen ein Abbild der Stadt selber zu sein, ihrer vielschichtigen Geschichte und ständig sich wandelnden Kultur. Das Museum ist gewissermaßen die Stadt. Diese Maxime bestimmt nicht nur die Sammlung des Wien Museums. Sie strukturiert auch unser Ausstellungsprogramm. Immer geht es dabei um den Versuch, die Spannung und Komplexität der Stadt in die Institution zu holen, unseren Besuchern und Besucherinnen ( eine Mehrzahl aus Wien, auch das ein großer Unterschied zu den anderen großen Museen ) ihre Lebenswelt aus immer neuen Perspektiven zu zeigen. Typischerweise zeigt der Vektor von der Stadt zum Museum. Objekte aus verschiedensten Perioden der Lokalgeschichte – ehedem organische Teile der Stadt, nun Objekte der städtischen Sammlung – kommen ins Wien Museum, um rekontextualisiert zu werden. Der Verweis zurück ist implizit. Fotos bilden Bereiche der Stadt ab ; Pläne lokalisieren sie in der urbanen Topografie. Das Rote Wien. 1919 – 1934 funktioniert anders, radikaler. Ja, auch hier wird die Stadt ins Museum geholt. Im MUSA , unserer Ausstellungsfläche neben dem Rathaus, erzählen die KuratorInnen Werner Michael Schwarz, Georg Spitaler und Elke Wikidal die Geschichte des bemerkenswerten Experiments der Zwischenkriegszeit anhand von Fotos, Karten, Objekten und Dokumenten. Die vorliegende Ausstellung geht aber weit über das Museum hinaus, macht sich in der Stadt selbst fest, musealisiert sie, um sie gleich wieder als ge-
lebte Welt zu verorten. Vielleicht böte sich eine solche Strategie auch für andere Themen an. Die Ringstraßenausstellung im Jahr 2015 ( 150 Jahre nach Eröffnung des Prachtboulevards ) hätte sich in dem einen oder anderen Palais fortsetzen können ; die Reformationsausstellung von 2017 ( 500 Jahre nach den 95 Thesen ) in der einen oder anderen protestantischen Kirche. Aber viel mehr als ein Gimmick wäre das nicht gewesen. Denn von beiden gibt es nicht nur viele, sie fügen sich auch nahtlos in Geschichte und Stadtbild ein. Beim Roten Wien ist das anders. Sein Gegenentwurf zu jahrhundertelang gewachsenen Machtstrukturen war zu markant, politisch wie ästhetisch, um es als reinen Ausbund der Stadtgeschichte zu verstehen. Seine Gebäude sind formal kenntlich, gleichermaßen architektonisches wie ideologisches Programm. Dieses kann im Ausstellungsraum nachgezeichnet werden. Wirklich nachvollziehen kann man es aber nur in situ : in den Gemeindebauten mit modernen Ansätzen zu Versorgung und Hygiene, in den Schwimmbädern für die körperliche Ertüchtigung des » Neuen Menschen « und den Büchereien, die aus unterdrückten Arbeitern und Arbeiterinnen stolze Kulturmenschen machen sollten. Viele dieser Orte existieren weiterhin. Aber das soziale Gefüge, das sie befeuerte, ist nicht mehr vorhanden. Es sind Orte der Vergangenheit, heute nur schwer lesbar, historische Versatzstücke. Dass Das Rote Wien über die Grenzen des MUSA hinauswachsen musste, war deshalb klar. Die Ausstellung musste vor Ort gehen, denn nur in den Gebäuden des Roten Wien kann seine Spezifität und Relevanz empfunden werden. Als Stadtmuseum ist das Wien Museum immer die Stadt ; hier aber wird die Stadt zum eigentlichen Museum. Ich danke den Kollegen und Kolleginnen, die diese so wichtige Ausstellung umgesetzt haben. Neben den KuratorInnen Schwarz, Spitaler und Wikidal waren das vor allem die Mitglieder des erweiterten kuratorischen Teams : Christian Dewald, Veronika Duma, Berthold Ecker, Wolfgang Fichna, Bernhard Hachleitner, Marion Krammer, Katrin Pilz, Georg Vasold, Gernot Waldner, Susanne Winkler und Marie-Noëlle Yazdanpanah. Großartige Unterstützung erhielten sie von Isabelle Exinger-Lang ( Produktion ), Katharina Götschl ( Registrarin ), Thomas Hamann ( Gestaltung ) und Olaf O sten ( Grafik ). Bleibendes Dokument ihrer bedeutenden Arbeit ist der ambitionierte Katalog, den die drei KuratorInnen verantworten und den Katharina Gattermann ( Grafik ) und Sonja Gruber ( Publikationsmanagement ) in vorbildlicher Weise realisiert haben.
rechts: Kat. Nr. 0.7., 13.3.
12
EINLEITUNG Werner Michael Schwarz Georg Spitaler Elke Wikidal
Das Rote Wien ist als Thema einer Ausstellung wie großes Theater, das wieder aufgeführt und neu inszeniert wird. Der Text, die Partitur, steht insbesondere nach 40 Jahren intensiver Forschung und Auseinandersetzung in vielen Teilen fest : die große Architektur, ihre eindrucksvollen fotografischen Repräsentationen, die intensiven Debatten aus der Lese- und Bildungswelt des Roten Wien. Es geht um Wohnen, Schule, Fürsorge, Frauenpolitik, Volksbildung, Arbeiterkultur, Kunst, um die Wahlkämpfe und die harten, mit allen ( visuellen ) Medien geführten unmittelbaren Auseinandersetzungen mit den politischen Gegnern. Jede Aufführung des Roten Wien operiert mit Hervorhebungen, Auslassungen, Wiederentdeckungen und positioniert sich gegenüber ihren Vorgängerinnen. Die Interpretation dieser nur wenig mehr als zehn Jahre dauernden » Veralltäglichung der Utopie « ( Wolfgang Maderthaner ) von 1919 bis 1934, die sich so nachhaltig in die Stadt eingeschrieben hat, reflektiert den gegenwärtigen Kontext und die Interessen der GestalterInnen. Die Großausstellung Traum und Wirklichkeit. Wien 1870 – 1930, die 1985 im Wiener Künstlerhaus gezeigt wurde, war vom Weiterwirken der intellektuellen und künstlerischen Ideen der Zeit um 1900 fasziniert.1 Die Geschichte endete hier programmatisch im Jahr 1930, im Jahr der Eröffnung des Karl-Marx-Hofs, also noch vor dem eigentlichen Ende des Roten Wien, im Sinn des Abschlusses einer Blütezeit Wiener Kultur. In dieser Interpretation war der Architekt Otto Wagner eine der Schlüsselfiguren der auf diese Weise definierten Epoche. Das Interesse lag auf der Fortführung seiner Ideen durch seine Schüler im Roten Wien, nicht zuletzt aufgrund des scheinbaren Paradoxons, dass die sozialistischen Ideale mehrheitlich von bürgerlichen Architekten umgesetzt wurden. Schon in den Jahren vor 1985 hatten mehrere Ausstellungen das Rote Wien auf teilweise große Bühnen gehoben. Den Auftakt machte 1980 eine Ausstellung mit dem fast schüchternen Titel Zwischenkriegszeit – Wiener Kommunalpolitik 1918 – 1938, die im Rahmen der Wiener Festwochen eröff-
net und im Museum des 20. Jahrhunderts im Schweizergarten und anschließend im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum gezeigt wurde.2 Die sepiafarbigen Schwarz-Weiß-Fotos im knapp über 100 Seiten starken Katalog sind mit einem dünnen rosa Schleier überzogen, der auf einen Zugang zwischen Melancholie und vorsichtiger Repolitisierung hindeutet. Ganz anders dann die im Jahr darauf gezeigte Exposition Mit uns zieht die neue Zeit. Arbeiterkultur in Österreich 1918 – 1934, die am Roten Wien vor allem das Kollektiv als handelndes Subjekt interessierte.3 Als Bühne wählten die AusstellungsmacherInnen die Koppreiter-Remise in Meidling, einen theatralen, aber gerade nicht musealen Raum. In der Schau Die Kälte des Februar. Österreich 1933 – 1938, die auf die Niederschlagung des sozialdemokratischen Aufstands fokussierte, fand dieser Zugang 1984 eine Fortsetzung.4 Im Geist der neuen Linken der 1970er Jahre wurden die 1934 zum Kampf Bereiten der Unentschlossenheit ihrer Parteiführung gegenübergestellt. Beide Ausstellungen arbeiteten mit › Texten ‹, die heute nicht mehr unmittelbar zugänglich sind, mit Erinnerungen von Beteiligten. Das Rote Wien war in den 1980er Jahren noch ein glühender Gegenstand, und die Kultur, die es mitgetragen hatte, weitgehend intakt. In dieser Zeit war die Stärke der Sozialdemokratie in Wien scheinbar fest abgesichert, aber die Ausstellungen und die jungen MacherInnen versuchten, sie daran zu erinnern, dass das nicht immer so bleiben müsse. In dieser Zeit kam die Partei vor allem vonseiten der Jungen im Kontext der neuen Umwelt-, Frauen- und Kulturinitiativen unter Druck, die ihr das kämpferische Engagement der » Arbeitermassen « der Vergangenheit vor Augen führten und am Roten Wien kritisierten, was man gerade an der Partei der Gegenwart diagnostizierte : Paternalismus, Selbstgefälligkeit und Unentschlossenheit. In diese Richtung ging auch die Ausstellung einfach bauen, die 1985 im Wiener Künstlerhaus gezeigt wurde und erstmals im großen Rahmen die Siedlerbewegung der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg als eine » Bewegung von
unten « in Erinnerung rief. Die in Deutschland konzipierte Schau tourte als » wachsende Ausstellung « ab 1983 durch die Wiener Siedlungen und sammelte auf diesem Weg Geschichten und Materialien ehemaliger AktivistInnen.5 Der Leitsatz » Gegen den Mythos der Alternativlosigkeit « war sowohl an das gegenwärtige wie das vergangene Rote Wien adressiert. Die Schauen der 1980er Jahre operierten noch in einem Raum, der nicht nur eine linke Dominanz im Denken, sondern auch in der Praxis für möglich hielt. Es ist nicht überraschend, dass die Ausstellungen der 1990er Jahre das Rote Wien tendenziell historisierten und von einer lebendigen und umstrittenen Geschichte in einen Wissenskanon transformierten, der den Weg zurück ins Museum fand.6 Der Fall des Eisernen Vorhangs und das Ende des Realsozialismus rückten das Rote Wien zunächst in eine scheinbar weite Vergangenheit. Seine wohlfahrtsstaatlichen Ansprüche, Fürsorge und Wohnen als öffentliche Aufgabe oder der Abbau von Bildungsprivilegien waren bereits davor sukzessive durch die wachsende Dominanz neoliberalen Denkens unterminiert worden. Ein Denken, das zunächst auch mit Befreiungen aus den Zwängen enger gesellschaftlicher Normierungen punkten konnte. Das Interesse konzentrierte sich nun auf die Architektur und das städtebauliche Erbe des Roten Wien. Noch in den 1980er Jahren befanden sich viele der Bauwerke, obwohl Teil einer lebendigen Partei- und Arbeiterkultur, in großteils desolatem Zustand. Seit den späten 1990er Jahren wurden sie sukzessive renoviert und ikonische Bauten wie der Karl-Marx-Hof in Maßen auch als touristische Attraktionen entdeckt und genutzt.7 Ansonsten wurde es ruhiger um das Rote Wien. Es repräsentierte eher eine Episode großer Erzählungen, wie zuletzt 2009 in der Ausstellung des Wien Museums kampf um die stadt. politik kunst und alltag um 19308 im Wiener Künstlerhaus, die es als nur eine Stimme im Chor der Perspektiven der 1920er und 1930er Jahre vermittelte, wenn es um Stadt und das Städtische als umstrittenen Raum ging. Mit diesem Interesse konnte das Rote Wien zu Recht an den Rand gerückt werden, nicht zuletzt, weil es selbst intensiv daran gearbeitete hatte, dieses nicht-rote, metropolitane Wien von den eigenen AnhängerInnen fernzuhalten, und so zeitgenössisch tiefe Bruchlinien öffnete, etwa in der Ablehnung des auch bei
der Arbeiterschaft attraktiven Profifußballs oder in Bezug auf Kino, Mode, Konsum und Kunst. Diese Phase der Historisierung brachte zugleich eine neue Intensivierung und Qualität der Forschung. Das Abrücken von den unmittelbar politischen Fragen öffnete erst den Weg für eine › kühle ‹, tiefer gehende Analyse und Kontextualisierung der Erinnerungen und Hinterlassenschaften des Roten Wien. Gerade das reiche visuelle Erbe, Plakate, Filme oder Fotografien, und nicht zuletzt die Architektur selbst wurden mit akademisch-musealen Methoden in ihrem eigenständigen künstlerischen, intellektuellen und technischen Herkunftskontext erforscht. Hier konnte auch eine Neuentdeckung des gebauten Roten Wien ansetzen. Partizipative Kulturfestivals wie Soho in Ottakring förderten die lokale Spurensuche vor Ort, etwa 2014 im Rahmen einer Pop-up-Ausstellung im Sandleitenhof.9 Auch 2019 wird der museale Ausstellungsraum erweitert, indem temporär Orte in der Stadt zugänglich gemacht werden, um neben den bekannten Gebäuden und Wohnhausanlagen auch das weniger bekannte, mehr experimentelle Rote Wien zu erkunden. Sie können im Sinn einer » gebauten Utopie « Ideale von Schule, Wohnen oder Kunst vermitteln, bleiben aber in anderer Beziehung vergleichsweise entrückt. Denn die reiche Textur zum Roten Wien besitzt eine auffällige Leerstelle. Gemessen an den Repräsentationen, die eine massenhafte Teilnahme der Menschen am Projekt des Roten Wien vermitteln, wie Fotografien, Filme, Broschüren, Zeitungen, haben sich dazu nur wenige persönliche Zeugnisse erhalten. Im Sommer 2016 erhielt der Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ( VGA ), Kooperationspartner dieser Ausstellung, ein freundliches E-Mail. Die Absenderin schrieb aus einer Kleinstadt in Oberfranken, sie habe die Küchenanrichte ihrer Großmutter renoviert und » unter der Deckplatte zwei Mitgliedsausweise der › Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreich ‹ gefunden «, deren Besitzer ihr völlig unbekannt seien. Die beiden Parteibücher wanderten in das Archiv des VGA . Es zeigte sich, sie gehörten einem Ehepaar,
Spukende Vergangenheit
13
14
eboren 1901 und 1909, Wehrmann und Hausfrau, Mitglieg der der Sektion XIII Kagran der SDAP mit den Eintrittsdaten 1922 bzw. 1932. Und es offenbarte sich ein bezeichnendes Detail : Die Beitragsmarken, bis dahin fein säuberlich in die Büchlein eingeklebt, enden mit dem Jänner 1934. Kurz darauf ging mit den Februarkämpfen 1934 und dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei die Ära des Roten Wien zu Ende. Hatten die beiden Donaustädter Parteimitglieder ihre Bücher danach in der Küchenkredenz versteckt ? Hatten sie später darauf vergessen, oder waren sie nicht mehr am Leben, als die Kredenz ihre Besitzerin wechselte ? Versteckte Objekte, die nach mehr als 80 Jahren wieder auftauchen, deuten auf Brüche hin. Die BetrachterInnen, die mit dem historischen Projekt des Roten Wien sympathisieren, mögen Melancholie empfinden, im Wissen um die verlorenen Jahre des Austrofaschismus und das Grauen, das danach der Nationalsozialismus bedeutete. Objekte aus dem Roten Wien spukten aber auch in einem anderen Sinn in der Gegenwart herum : als Phantome einer Zeit, in der Vorstellungen von einer selbstbestimmten Zukunft noch nicht durch die scheinbare Zwangsläufigkeit neoliberaler Zustände erstickt wurden.10 Das Objekt des Parteibuchs deutet dabei gleichzeitig Distanz an : In der individualisierten Gegenwart scheinen Zeiten, in denen die SDAP in Wien mehr als 400.000 Mitglieder hatte,11 unvorstellbar. Zum Vergleich : Bei den Wiener Gemeinderatswahlen 2015 erreichte die SPÖ 329.773 Stimmen. Schon vor vielen Jahren stellte die SPÖ ihr Beitragssystem von den Marken, die der Sektionskassier direkt bei den Mitgliedern einhob, auf Erlagscheinzahlung um. Die Rolle der Vermittlungsinstanz im Grätzel übernehmen heute eher Einrichtungen wie die städtischen Wohnpartner, die bei Konflikten im Gemeindebau als Mediatoren eingreifen.
Traum und Wirklichkeit. 1870 — 1930, Ansichtskarte, 1985 ; Wien Museum, Inv. Nr. 183.915/1
Eindeutig und unmittelbar über die historischen Brüche und den Einschnitt in persönliche Biografien erzählen die Erinnerungen aus der Emigration. Olga Tandler gelang es, einen Teil des Nachlasses ihres 1936 verstorbenen Mannes Julius Tandler auf ihrer Flucht in die USA im Jahr 1939 mitzunehmen, wo er heute bei ihrem Enkel Bill aufbewahrt und explizit als Erinnerung an das Rote Wien und seinen » Humanismus « ( Bill Tandler ) gepflegt wird. Der Architekt und Einrichtungsberater Fritz Czuczka zeichnete im New Yorker Exil für seinen Sohn George die nach fortschrittlichen Ideen eingerichtete Familienwohnung im Karl-Marx-Hof, die sie 1938 als Juden verloren hatten. Die Zeichnungen sind Dokumente von Vertreibung und Flucht, aber auch eines der seltenen Zeugnisse für die Praxis der Wohnideale im Roten Wien.12 Eine Geschichte der politischen Verfolgung erzählen auch die 1937 ins Wien Museum gelangten mittel- und großformatigen Fotografien aus dem Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum ( G WM ), die in lokalen und internationalen Ausstellungen Ansprüche und Leistungen des Roten Wien repräsentiert hatten. Otto Neurath, der Gründer und langjährige Leiter des GWM , Initiator der Wiener Methode der Bildstatistik ( später ISOTYPE ) und anderer innovativer musealer Vermittlungsideen, musste das Land 1934 verlassen. Er ist einer jener brillanten Köpfe, die das Rote Wien vor allem als intellektuelles Projekt vermitteln. Die großen Namen wie Neurath, die feministische Sozialwissenschaftlerin Käthe Leichter, aber auch bekannte Stadträte wie Hugo Breitner oder Julius Tandler lassen leicht vergessen, dass mit den Wahlen 1919 auch organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen in Spitzenpositionen von Wiens Politik und Verwaltung aufstiegen. Wiens neuer Bürgermeister Jakob Reumann war in seiner Jugend Drechslerlehrling in einer Meerschaumpfeifenfabrik gewesen. In seiner Antrittsrede vor dem Gemeinderat im Mai 1919 hielt er fest, » als Vertreter der Arbeiterschaft, die jahrzehntelang rechtlos und nur ein Objekt der Verwaltung war «, zur Führung der Amtsgeschäfte berufen worden zu sein. » Diesen Zusammenhang werde ich nie vergessen «.13 Der Stadtrat für Technische Angelegenheiten Franz Siegel – in sein Ressort fiel die Errichtung der Gemeindebauten – war zunächst Maurer, dann Obmann im Verband der Bauarbeiter. Sein Nachfolger Karl Richter, auch Stadtrat für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, schrieb in seinem Lebenslauf : » Schon als Lehrling Mitglied des Arbeiterbildungsvereines Apollo, 1896 Obmannstellvertreter, später Obmann des Fachvereines der Vergolder «.14 Mit einigem Stolz verwies Richter auf den Besuch von Bildungseinrichtungen der Arbeiterbewegung, » auch die volkstümlichen Universitätskurse und zwar die ersten, die veranstaltet wurden 1891 oder 1892 «.15 Gleiches galt für die Sporen, die er sich im Konflikt mit der habsburgischen Obrigkeit verdient hatte, der ihm 1911 unter anderem eine Anklage wegen Majes tätsbeleidigung und Beleidigung der Armee einbrachte.16
rechts: Parteibuch der SDAP, 1932 — 1934 ; VGA, L5/M21 K
Eine Ausstellung über das Rote Wien im Jahr 2019, 100 Jahre nach seinem Beginn, kann so auf einen reichen Text zurückgreifen. Welche Interpretationen legt aber die Gegenwart nahe ? Was noch in den 1980er Jahren hinsichtlich seiner tatsächlichen Leistungen und theoretischen Voraussetzungen kritisch hinterfragt und in den 1990er Jahren zur Seite geschoben wurde, erscheint verstärkt wieder aufführungs- und ausstellungswürdig : die Interpretation des Roten Wien als ein Projekt der Emanzipation und Teilhabe, als » eine Idee modernen Ge-
Das Rote Wien 2019
1
2
3
4
5
6
Traum und Wirklichkeit. Wien 1870 – 1930 ( Ausstellungskatalog Historisches Museum der Stadt Wien ), Wien 1985. Gottfried Pirhofer ( Hg.): Zwischenkriegszeit – Wiener Kommunalpolitik 1918 – 1938. Ausstellungskatalog Museum des 20. Jahrhunderts, Wien 1980. Helene Maimann ( Hg.): Mit uns zieht die neue Zeit. Arbeiterkultur in Österreich 1918 – 1934. Ausstellungskatalog der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik und des Meidlinger Kulturkreises ( Straßenbahn-Remise Meidling Koppreitergasse ), Wien 1981. Dies., Siegfried Mattl ( Hg.): Die Kälte des Februar. Österreich 1933 – 1938. Ausstellungskatalog der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik und des Meidlinger Kulturkreises ( StraßenbahnRemise Meidling Koppreitergasse ), Wien 1984. Klaus Novy, Wolfgang Förster ( Hg.): einfach bauen. Katalog zu einer wachsenden Ausstellung. Ein Projekt des Vereins für moderne Kommunalpolitik, Wien 1985, S. 9. Vgl. Walter Öhlinger ( Hg.): Das rote Wien. 1918 – 1934 ( Ausstellungskatalog Historisches Museum der Stadt Wien ), Wien 1993.
7
8
9
10
11
12
meinsinns «,17 wie es der Publizist Robert Misik nennt. Das Rote Wien erscheint so nicht nur als ein Tatsachenraum, wie es insbesondere die Architektur suggeriert, sondern als ein Möglichkeitsraum, in dem die Frage » Wie leben ? « in hoher Intensität diskutiert wurde, wenn es um Wohnen, Schule, Bildung, das Verhältnis von Männern und Frauen, Freizeit oder Kultur ging. Ein Aufruf zur Debatte, zur kritischen Auseinandersetzung, zum Bekenntnis zu Idealen und zum Experiment.
Im Karl-Marx-Hof befinden sich heute im Waschsalon Karl-MarxHof eine Dauerausstellung und Wechselausstellungen zur Geschichte des Roten Wien. http ://dasrotewienwaschsalon.at/startseite/ ( 1. 4. 2019 ). Wolfgang Kos ( Hg.): Kampf um die Stadt. Politik, Kunst und Alltag um 1930 ( Ausstellungskatalog Wien Museum ), Wien 2009. Geschichte willkommen ! Ein Projekt von : Christiane Rainer, Kazuo Kandutsch, Katrin Sippel, http ://www. sohoinottakring.at/2014/04/geschichtewillkommen/ ( 1. 4. 2019 ). Vgl. dazu z. B. Mark Fisher : Kapitalistischer Realismus ohne Alternative ? Eine Flugschrift, Hamburg 2013. Vgl. Everhard Holtmann : Die Organisation der Sozialdemokratie in der Ersten Republik 1918 – 1934, in : Wolfgang Maderthaner, Wolfgang C. Müller ( Hg.): Die Organisation der österreichischen Sozialdemokratie 1889 – 1995, Wien 1996, S. 93 – 167, hier S. 150. Für die Hinweise und Vermittlung dieser besonderen Erinnerungen danken wir Philipp Rohrbach und Niko Wahl.
13
14
15 16 17
Antrittsrede von Bürgermeister Jakob Reumann in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 22. Mai 1919, in : Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ( künftig : VGA ), Plakat 3/92. Lebenslauf Amtsführender Stadtrat Karl Richter, o. D., in : VGA, Sozialdemokratische Parteistellen K77 / M466. Ebd. Vgl. ebd. Robert Misik : » Rotes Wien « – was heißt das im 21. Jahrhundert ?, in : Der Standard, 21. Mai 2018, https ://derstandard. at/2000080115553/Das-Rote-Wien-washeisst-das-im – 21-Jahrhundert ( 20. 3. 2019 ).
Maiabzeichen der SDAP mit Silhouette des Wiener Rathauses, 1929 ; VGA, 10/427 Maiabzeichen der SDAP : Wien als Vorbild für die Welt, 1931 VGA, 10/429
15
Debatte 18
WA S I S T DA S R OT E W I E N ? Lilli Bauer Helmut Konrad Hanna Lichtenberger Wolfgang Maderthaner Béla Rásky Werner Michael Schwarz
Die Kuratorin des Museums Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof Lilli Bauer, der emeritierte Professor für Zeitgeschichte an der Universität Graz Helmut Konrad, die Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien Hanna Lichtenberger, der Historiker und Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs Wolfgang Maderthaner und der Historiker und Geschäftsführer des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocauststudien Béla Rásky im Gespräch über Geschichte und Theorie des Roten Wien am Esstisch des einstigen Wiener Bürgermeisters Karl Seitz im Vorwärts-Haus, dem ehemaligen Sitz der Partei und der Arbeiter-Zeitung an der Wienzeile im fünften Wiener Gemeindebezirk. Moderation : Werner Michael Schwarz.
Schwarz Was ist für Sie das Rote Wien ? Experimentierfeld, Labor, Utopie, Projekt der Spätaufklärung oder Linkspopulismus, um nur einige Begriffe zu nennen, die mit dem Roten Wien assoziiert werden. Rásky Mir fehlt dabei ein Begriff, den Siegfried Mattl geprägt hat : » öffentliche Moralanstalt «. Ich würde für » Projekt der Spätaufklärung « plädieren, wenn es nicht auch diesen fast religiösen Aspekt und hohen Anspruch auf Moral gegeben hätte, der sich in vielen Texten wiederfindet. Bauer War das nicht Teil des Bildungsanspruchs, der darauf abzielte, der Arbeiterschaft zu zeigen, wie man leben soll ? Das hebt für mich
diesen Widerspruch auf, denn man wollte die Arbeiter bilden, und bis das gelungen war, mussten sie glauben. Konrad Ich denke nicht, dass sich dieser Widerspruch so leicht aufhebt. Das Rote Wien hatte zunächst eine sozialpolitische Aufgabe, an die man nur rational herangehen konnte. Ich muss die Mutter-Kind-Betreuung ändern, die Wohnbauten errichten, die Tuberkulose bekämpfen, Schulen, Kindergärten bauen. Das hat alles zunächst keinen religiösen Aspekt. Wolfgang Maderthaner und ich haben deshalb vom Roten Wien als einem » Modell für eine moderne Großstadt « gesprochen. Das ist Spätaufklärung in Reinkultur, das ist Modernisierung : Wir müssen dieses Wien sauberer, sicherer, gesünder, für die Kinder lebenswerter machen. Das ist die eine Seite. Die andere ist der Versuch, dem Roten Wien eine überhöhte Außenwirkung zu verleihen. Wenn man als » Bauvolk der kommenden Welt « 1 auftritt, dann genügt es nicht, zu sagen, in Wien gibt es keine Tuberkulose mehr, da braucht es noch etwas anderes. Aber worauf greift man zurück ? Wenn die Aufklärung die Welt entzaubert, dann hat beispielsweise der Bildungspolitiker des Roten Wien, Luitpold Stern, versucht, sie wieder zu verzaubern und dafür religiöses Vokabular wie » Psalm « verwendet.2 Das hieß, wir sind mehr als eine moderne Großstadt, wir sind die kommende Welt. Dazu brauchen wir nicht nur die religiöse Überhöhung, sondern auch den » Neuen Menschen «. Da wird es dann tatsächlich zum Teil problematisch. Aus Karl Stadlers3 Tagebüchern der Zeit wissen wir, dass er ernsthaft daran gedacht hat,
sich von seiner Frau zu trennen, weil sie ein Zuckerl mit sches Element. Konrad Aber wer ist die Avantgarde ? Ruminhalt gegessen hat. Aus seiner Sicht verletzte das alles, Natürlich ist es die Parteiführung, und die Frage lautet : wofür sie eingetreten sind. Später ist er einem Rumzuckerl Wie dringen die a ustromarxistischen Konzepte zur Parteibadurchaus nicht abgeneigt gewesen. Das zeigt aber, wie sehr sis durch ? Da gab es Widersprüche. Die Avantgarde ist ja oft dieser moralische Anspruch auf die intellektuelle Jugend der öffentlichen Meinung zwei Schritte voraus. Stichwort gewirkt hat. Maderthaner Bevor wir Begrifflich Einküchenhaus : Das konnte nicht funktionieren, weil dafür keiten wie Moral oder Ethik debattieren, die Familienstrukturen noch nicht bereit waren.4 Dieser Widerspruch wurde meines Erachtens die oft einen sehr subjektiven Blick auf Vergandadurch aufgefangen, dass man das genes offenbaren, möchte ich zunächst feststelModell Rotes Wien außer Streit stellte, len : Das Rote Wien ist ein radikales Projekt der Das Rote Wien ist ein radikales Projekt überhöhte und gleichzeitig versuchte, Spätaufklärung. Es ist ein Projekt der Veralltägder Spätaufklärung. so viel Modernisierungspotenzial wie lichung der Utopie. Insofern hat es wahrscheinEs ist ein Projekt der möglich durchsickern zu lassen. Das lich diesen religiösen Charakter. Für mich ist Veralltäglichung ist ein doppelter Prozess. Deswegen das Rote Wien ganz wesentlich eine Parallel der Utopie. nennt man den Wiener Bürgermeisaktion zum tiefenpsychologischen Projekt von Sigmund Freud, wenn es aus dem proletarischen ter Seitz auch » Schöpfer «. Wer würde Wolfgang Maderthaner Kollektiv Objekte zu Subjekten zu formen verheute so einen Begriff verwenden ? Aber zu diesem Zeitpunkt scheint es sucht. Darin besteht für mich die radikal aufnotwendig, zu behaupten, dass es sakklärerische Perspektive. Es geht um ein In-Freiheit-Setzen der Elemente einer künftigen Gesellschaft im rosankt ist, was die da oben sagen. Das ist tatsächlich ein Hier und Heute. Sehr viel mehr Experimente in dieser paternalistischer Zugang. Maderthaner Versuchen Form gab es bislang nicht, die Umsetzung einer konkreten wir vielleicht einmal, die Herkunftskonzepte zu klären. Das Utopie in einem rabiat feindlichen Umfeld. Und mit dieRote Wien ist ja zum ersten ein Projekt der Pädagogisiesem Umfeld meine ich auch die große Depression ab 1929. rung, zum Zweiten ein Projekt der Hygienisierung und Lichtenberger Begriffe wie Labor oder Experizum Dritten ein Projekt der Demokratisierung. Letzteres erscheint mir am nachhaltigsten. Schauen wir uns die thement sind für mich nur teilweise plausibel. Labor setzt ja ideale Bedingungen voraus. Man kann einen Versuch oretische Führungsschicht der Sozialdemokratie an. Diese anordnen und so Theorien überprüfen. Wenn das nicht stammt überwiegend aus dem gehobenen Bürgertum, ist klappt, kann man diesen wiederholen. Das ist die eine oft jüdisch assimiliert und bringt ein ganz bestimmtes Seite. Auf der anderen Seite gab es in den SozialwissenKonzept mit : Bildung. Sehr anschaulich vermittelt das ein Begriff, den man oft bei Otto Bauer lesen kann, der » Kulschaften, der Pädagogik, der Individualpsychologie oder der Psychoanalyse tatsächlich Ansätze, Theorien in die Praturwille «. Aus sozusagen ungebildeten Barbaren muss eine geistig regsame Elite entstehen. Dieser muss der gesamte xis umzusetzen, wofür Begriffe wie Labor oder Experiment Kulturschatz, insbesondere jener der deutschen Aufklärung, wieder zutreffend wären. Veronika Duma und ich verwenzur Verfügung stehen. Diese regsame Elite könnte dann den in unseren Forschungen den Begriff des » Reformprojene Qualitäten herausbilden, die sie jekts « oder des » radikalreformistischen Projekts «. Viele Frazur Führung der sozialen Demokragen, die im Roten Wien gestellt wurden, halten wir nach wie vor für aktuell. Das betrifft Fragen nach der Umvertie befähigt. Das sind Konzepte aus dem Wien um 1900, aus einem deutteilung von gesellschaftlichem Reichtum, der Zugänglichkeit von sozialer und öffentlicher Infrastruktur, der Reorschen Kulturalismus, der von einem assimilierten Judentum getragen wird. ganisation der Produktionsverhältnisse, dem Recht auf Das Rote Wien ist schwer verständWohnen. Rásky Ich komme trotzdem noch einmal auf die Rolle des Religiösen im Roten Wien zurück. Das lich, wenn wir uns nicht seine eigene eine ist das Auftreten nach außen, das andere betrifft aber Herkunftskultur vor Augen führen. die Partei selbst. Diese erlebte nach 1918 einen enormen Wieweit das in die Praxis umgesetzt Zulauf. Da tauchte das Problem des Zusammenhalts auf. wurde, ist aber zu debattieren. Davor hatte die Ratio dominiert ; mit dem starken Wachs Konrad Nur muss man auch die dunklen Punkte dieser Geschichte erzählen. Es ging nicht nur um deutsches, tum der Partei aber, dem Zustrom von Menschen, die sondern auch um deutschnationales Kulturgut. Es gab eine oft aus der Provinz kamen, einen religiösen Hintergrund stark deutschnationale Komponente, die sich später als verhatten, kommt als Methode der Vermittlung zunehmend diese Überhöhung ins Spiel und damit ein paternalistihängnisvoll erweisen sollte, etwa die geringe Abwehr des
Werner Michael Schwarz
Helmut Konrad
19
20
Anschlussgedankens oder die eugenischen Ansätze im chen Debatten mitdenken. Lichtenberger Was ich Bereich der Hygienisierungspolitik. Hier wurden Linien daran interessant finde, ist, wie auf die Krise reagiert wurde, berührt, um nicht zu sagen überschritten, wo wir heute insbesondere die Sparpolitik, und wie viel man daraus für sehr sensibel sind. Rásky Ist es nicht genau dieses heute lernen könnte. Stichwort Griechenland. Man kann kulturalistische Konzept, das scheitert ? Konrad Das an den 1930er Jahren beobachten, wie schnell eine ökonoglaube ich nicht ! Maderthaner Es ist das ökonomische Krise, wenn sie ins Politische hineinwirkt, zu einer strukturellen wird, wie schnell sich eine autoritäre Polimische Konzept, das scheitert, und zwar unter dem großen Druck der Depression. Rásky Diese fast relitik, damals über Notverordnungen, heute über Expertengiöse Überhöhung der Bildungsarbeit regierungen, etabliert. Konrad Wir wurde aber ab einem bestimmten Zeitsind uns da vermutlich einig, dass das Rote Wien in erster Linie erst durch diese punkt nicht mehr akzeptiert. Ein Beibesonderen Rahmenbedingungen zerspiel ist die Zeitschrift Bildungsarbeit, in der es die Rubrik » Abwege « gab. In dieWenn wir danach schlagen werden konnte. Es ist nicht fragen, was alles von innen zerbrochen, es wurde nieder ser wurde das gebrandmarkt, was de facto erreicht wurde, gerungen von einer s pätestens seit der Realität war. Man kann beobachten, wie könnten wir auch Ausschaltung des P arlaments autoritären diese an der deutschen Hochkultur orienfragen, was hätte noch Regierung. Maderthaner tierten Konzepte nicht mehr angenommen alles erreicht werden wurden. Das bricht nach dem JustizpalastUnd am Ende mit militärischen Mitkönnen ? Wenn es um brand im Juli 1927 deutlich auf. Die Junteln. Lichtenberger Allerdie Kinderbetreuung gen, wie Ernst Fischer, hatten ganz neue dings muss man sagen, dass auch geht, um das Wohnen. Ideen, die nicht mehr auf dieses » Nachdie mangelnde Demokratisierung der Ö konomie dafür verantwortlich holen « von Kultur ausgerichtet waren. Da Hanna Lichtenberger war. Konrad Auf städtischer ging es um Themen wie Sexualität, neue Ebene ? Lichtenberger Die KonMedien, neue künstlerische Ideen. Da künzepte waren da, etwa bei Otto Bauer. Die sozialdemokratische Partei hat immer auf digte sich eine Wende die 50 Prozent plus eine Stimme bei den Nationalratswahan. Bauer Ich muss auch bei der Rubrik » Abwege « einhalen gewartet. Aber sie hätte die Demokratisierung der Proken. Da wurde gegeißelt, wie manduktionsverhältnisse auch ohne diese Mehrheit vorantreiche Parteilokale gestaltet sind oder ben können. Dann wären auch in der ökonomischen Krise dass bei einem Fest der Kinderandere M aßnahmen möglich gewesen. freunde ein guter GumpoldskirchSchwarz Es gibt die These, dass dieser Anspruch auf eine ner ausgeschenkt wurde. Dieser umfassende Versorgung im Roten Wien die Arbeiterschaft Versuch, den Leuten beizubringen, wie sie leben sollen, vom politischen Kampf entwöhnt hat, dass die in der Zeit wurde öffentlich ausgetragen. Heute wäre das schwer vorder Opposition so wichtige Straße als politischer Aktionsstellbar, die Arbeit einer Sektion so an den Pranger zu stellen. M aderthaner Es stimmt vieles, was Béla raum sukzessive verloren ging. Ging da politische Kompesagt. Es kündigt sich in den 1930er Jahren eine andere tenz verloren ? Maderthaner Das ist ein sehr schöJugend an, die allerdings genau das Produkt dieser Bilnes intellektuelles Konstrukt. Konrad Das sehe ich ähnlich ! Organisierungs- und Mobilisierungsgrad sind dungskonzepte ist. Aber ein Punkt scheint mir doch zu gestiegen. Die Gemeindebauten ermöglichten einen viel kurz zu kommen, wenn man über ein Scheitern des Roten besseren Zugriff auf die circa 200.000 Menschen, die dort Wien spricht : Das ist der Zusammenbruch des Kultuwohnten. Unter diesen Umständen lassen sich für einen rellen und Sozialen durch den gänzlichen ZusammenMaiaufmarsch wesentlich mehr Menschen auf die Straße bruch des Ökonomischen. Das ist nicht auf das Rote Wien bringen, als wenn Hunger und Elend herrschen. beschränkt, das ist ein globales Phänomen und die Folge der ersten weltweiten Spekulations- und Finanzkrise. Wien Schwarz Eine Szene aus einem Film aus dem Jahr 1925 hält sich bis 1933 noch mit einem ausgeglichenen Budget, würde ich gern als mögliches Bild für das Rote Wien diskuaber die Folgen sind für das Reform- und Kulturprojekt des Roten Wien fatal. Hinzu kommt der finanzielle Vertieren. Dabei geht es um Aufnahmen, die beim Volksfest des Republikanischen Schutzbundes auf dem Wilhelminenberg nichtungsfeldzug der bereits austrofaschistischen Regiegemacht wurden und eine Gruppe Seiltänzer zeigen.5 Der rung gegen das Bundesland Wien. Das muss man bei sol-
Béla Rásky
Seiltanz : hoch attraktiv, spektakulär, riskant, ein ständiges waren 270.000 in unterschiedlichem Ausmaß unterernährt. Bemühen um Gleichgewicht. Das zielt auf die Frage nach Da musste etwas getan werden, auch sozialtechnologisch. den verschiedenen Kräften und insgesamt auf die DynaUnd deswegen bestellte man mit Julius Tandler einen Eugemik im Roten Wien ab, wie in der V erwaltung, der Partei et niker zum Stadtrat für Gesundheit. Er brachte Konzepte cetera. M aderthaner Ich würde sagen, die Dynamik mit, die darauf abzielten, einen besseren Menschen zu proentsteht aus der Notwendigkeit einerseits, aus den unmitduzieren. Er ging von der gesunden Mutter, dem gesuntelbar nach Beginn erreichten Erfolgen andererseits und den Kind aus, von der Präventivmedizin, s ozusagen der Voraus den utopischen Aspekten. Bauer Man hat sich sorge-Fürsorge. Bauer Tandler will die Krankheiten im Roten Wien auch Beispiele aus anderen Ländern angebekämpfen, nicht die Kranken. Maderthaner Aber es gibt unbestritten einen disziplinierenden Charakter der schaut, wie das S iedlungswesen in Deutschland. Nur wurde Fürsorge. Die Kinderübernahmsstelle ist ein gewaltiger Kuldann nicht gekleckert, sondern geklotzt. Oder nehmen wir Wohlfahrtsstadtrat Julius Tandler. Er kam von einem Besuch turfortschritt und zugleich ein Disziplinierungsinstrument. in den USA ganz begeistert von der Prohibition zurück. Sie haben schon auch geklaut. Maderthaner Ich Schwarz Kommt die Dynamik des Roten Wien würde nicht von » Klauen « sprechen. Das waren Manizumindest anfänglich aus dem Krisenmanagefestationen der Zeit. Die urbane Moderne war überment ? Konrad Ja, aber hoch aufgeklärt und hoch sozial. Mir wäre der Begriff Krisenmanagement zu all relativ ähnlich. Rásky Bei der Frage nach der neutral. Es ging um den Versuch, diese Krise so zu manaDynamik fällt mir ein a nderer Film ein : Sonnenstrahl von Paul Fejos. Die Schlussszene spielt im Engelsplatzhof im gen, dass das soziale und aufgeklärte Konzept umge20. Bezirk, wo die s pontane Hilfsbereitschaft der Bewohsetzt werden kann. Es war nicht passiv, sondern sehr aktiv. Bauer Man darf nicht vernerInnen einem jungen Paar dazu verhilft, die Rate für sein Taxi zu bezahlen und gessen, dass die Frage nach der D ynamik so sein Glück als Kleinunternehmer zu nicht nur die Verwaltung betrifft, sonfinden.6 Für mich ist das ein schönes BeiMich erstaunt, wie dern auch die engmaschige Infrastrukwenig das Rote spiel, wie in der Wirtschaftskrise Solidaritur, die von sozialdemokratischen VereiWien in Erinnerung tät neu und undogmatisch aufgefasst wernen zur Verfügung gestellt wurde, wie geblieben ist. den Kinderfreunden, den Naturfreunden konnte. Lichtenberger Man muss natürlich auch immer die innerparden, die auch zahlreiche Angebote im Béla Rásky Bereich Gesundheit und Bildung machteiliche Dynamik sehen. Ein Beispiel sind für mich die Frauenorganisationen, die in ten. L ichtenberger Nicht zu der Zeit der Monarchie dafür gekämpft vergessen der Arbeiter-Bestattungsverhaben, das Frauenwahlrecht durchzusetzen, und dafür, dass ein Die Flamme, der ein Gegenkonzept zum Katholizismus die weibliche Erwerbsarbeit nicht als lästige Lohndrückeentwickelt hatte. Das ist doppelt interessant. Zum einen wegen des sozialpolitischen Aspekts, denn durch die Sterrei betrachtet wird, wie das auch in der Partei von vielen Genossen gesehen wurde. Konrad Seit es die Zeitbeversicherung konnten die hohen Kosten für die Famischrift Der Kampf gab, lagen theoretische Konzepte in gut lien vermieden werden, und zum ausgearbeiteter Form vor. Daran lässt sich beobachten, wie anderen wegen des symbolischen es nach 1918 zu einem starken Themenwechsel kam und Aspekts, um damit der katholischen zu einer Wechselwirkung zwischen den NotwendigkeiErzählung eine andere entgegenzuten des politischen Alltags und der Theorie. Wenn die Kinsetzen. Rásky Aber waren das nicht alles nur Kopien ? Das betrifft der sterben wie die Fliegen und sie nach Dänemark oder für mich die ganze Arbeiterfestkulin die Schweiz geschickt werden müssen, damit sie überleben, dann ist klar, dass man ein radikales Gesundheitstur. Dort, wo die Sozialdemokraten nicht wirklich die neuen gesellschaftkonzept braucht. Das erzeugt die Dynamik. Oder wenn man weiß, wie die Arbeiter in den Randbezirken der lichen Herausforderungen angeStadt leben, dann weiß man, dass etwas getan werden nommen haben, sind sie gescheitert. Das betrifft die Weimuss. M aderthaner In dieser ersten Phase gab es hespiele und andere Festformen. Überzeugender sind für gewaltige Sterblichkeitsraten. Der Überschuss von Todesmich die Aktivitäten gegen Ende des Roten Wien, als mit neuen Formen agiert wurde, etwa dem politischen Kabafällen betrug zu Kriegsende und in der ersten Zeit danach 120.000 Menschen, das ist die Größe eines der Wiener Flärett, wie den Roten Spielern. Das sind für mich erfolgreiche Projekte, die von der Parteispitze aber behindert wurden, chenbezirke. Von 290.000 untersuchten Schulkindern
Hanna Lichtenberger
21
22
arüber reden würden. Lichtenberger Zu den d Erfolgen des Roten Wien zählen für mich die vielen Ideen, die heute noch gültig sind. Diese nur kurze Zeitspanne war unglaublich inspiriert. Überlegen wir uns, was von den letzten zehn Jahren Regierungs- oder Stadtpolitik geblieben ist. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Ich habe mit meinen Studierenden debattiert, was von der rot-grünen Wiener Stadtregierung übrig bleiben wird. Es war erschütternd. Die häufigste Antwort war : die Mariahilfer Straße. Ein paar haben dann noch gemeint, vielleicht die Seestadt. Rásky Mich erstaunt, wie wenig das Rote Wien in Erinnerung geblieben ist. Das gilt auch für den Tourismus. Ich habe einmal versucht, eine Ansichtskarte vom KarlMarx-Hof zu finden. Aber die gab es nicht. Bauer Die gibt es bei Schwarz Von Käthe Leichter gibt uns im Museum ! Rásky Warum aber knüpft man es die faszinierende Industriearbeiheute so wenig an das Rote Wien an ? Das betrifft auch die gegenwärtige Stadtregierung. Bauer Vieles existiert terInnenstudie So leben wir, die auf ja noch : Die Kindergärten, das Fürsorgewesen, da braucht der Grundlage einer umfangreichen es gar keine Erinnerung. Maderthaner TatsächBefragung gezeigt hat, dass arbeitende Frauen 1931 erst wenig oder noch gar nicht von den lich war der Diskurs über das Rote Wien einmal wesentReformprojekten des Roten Wien profitiert hatten.7 Das lich lebendiger. Ich hatte das Glück, in den 1980er Jahren betraf das Wohnen, die Kindererziehung oder die Freizeit. an Ausstellungen über das Rote Wien mitzuarbeiten, und Man kann es aber auch dem Roten Wien anrechnen, dass da waren die Reaktionen gewaltig. Mehrere Hunderttaues die junge Sozialforschung dabei unterstützt hat, genau send BesucherInnen, das ist heute unvorstellbar. Aber ich hinzuschauen und zu überprüfen, was tatsächlich erreicht möchte auch unterstützen, was Lilli gesagt hat. Wir sind wurde. Dazu möchte ich die These diskutieren, wonach jedes Jahr stolz darauf, dass Wien als die lebenswerteste das Rote Wien auch daran gescheitert ist, dass die eigenen Stadt der Welt gilt. Da wirkt vieles vom Roten Wien nach. Medien, die politische Werbung die Welt schon so ideal Andererseits leben wir in einer nicht für möglich gehalfantasiert haben, dass der Abstand zur Wirklichkeit zu groß tenen Hegemonie des Neoliberalismus. Man kann heute geworden ist. Siegfried Mattl hat vom nur spekulieren, was gewesen wäre, wenn Roten Wien als einer » Marke « und einer das Rote Wien starke Partner gehabt hätte. » Politik aus dem Geist der Reklame « Aber es war im Wesentlichen auf sich allein gesprochen.8 Konrad Bitte vergestellt. Wann und wo hat das sonst funktiEs ist schwierig, andere Orte zu finden, wo sich gessen wir nicht, wir sprechen hier von oniert, eine soziale Utopie Wirklichkeit werein soziales Experiment einem Zeitraum von gut einem Jahrden zu lassen ? Vielleicht in der amerikaniso in die Stadt und zehnt. Wenn man das mit anderen utoschen Studentenbewegung der 1960er und die Alltagserinnerung 1970er Jahre. Lichtenberger Wenn pischen Projekten vergleicht, dann ist eingeschrieben hat. wir danach fragen, was alles erreicht wurde, meines Erachtens im Roten Wien viel könnten wir auch fragen, was hätte noch mehr gelungen, als man 1919 erwarten Helmut Konrad alles erreicht werden können ? Wenn es um konnte. Es gibt natürlich diesen Abstand die Kinderbetreuung geht, um das Wohzwischen Utopie und gelebter Wirklichkeit. Und man kann kritisch fragen, wie nen. Es stimmt, dass der kommunale Wohnes tatsächlich in den Waschküchen zugegangen ist, aber sektor in Wien die Mietpreise drückt, dennoch gibt es es gibt das Bemühen, diesen Abstand zu verringern. Deneinen starken Anstieg der Miet- und Wohnungspreise. Desken wir uns die Weltwirtschaftskrise weg und damit den halb muss man immer die Frage stellen : Worauf kann Faschismus, und stellen wir uns vor, das Rote Wien hätte man sich zu Recht berufen ? Worauf kann man stolz sein ? noch ein Jahrzehnt gehabt. Es wäre interessant, wie wir Was muss man verteidigen ? Wenn man bedenkt, was
weil sie linksradikal waren und die AktivistInnen mit den Kommunisten Kontakt hatten. Bauer Den Begriff der » Kopie « finde ich etwas unfair. Das Bürgertum hatte spätestens seit dem Biedermeier Gelegenheit, Landpartien zu machen. Bis auch die ArbeiterInnen am Wochenende in diesen Genuss kamen, ist doch sehr viel Zeit vergangen. Konrad In den Strukturen wird tatsächlich kopiert. Es ist richtig, die Naturfreunde bauen Hütten wie der Alpenverein. Aber sollen sie einen Gemeindebau auf die Rax stellen ? Maderthaner Ist das nicht immer Ausdruck von Zeitgeistigkeit ? Das Rote Wien errichtet 1923 ein Krematorium. Das ist ein Kulturbruch sondergleichen. Was aber wirklich radikal neu war, ist die öffentliche Repräsentation von Frauen. Die Turnerinnen am ersten Mai, mit kurzen Hosen und Leiberln, mit Bubikopf, da ist für mich ein qualitativer Sprung.
Wolfgang Maderthaner
Lilli Bauer
in diesen zehn Jahren unter so schwierigen Bedingungen möglich war, könnte heute noch viel mehr möglich sein. Rásky Das Rote Wien ist zwar stark ins Stadtbild eingeschrieben, aber es hat dennoch nicht den Stellenwert im kollektiven Gedächtnis wie andere Epochen der Stadtgeschichte. Maderthaner Ja, aber man darf dabei nicht auf die Zivilisationsbrüche 1934 und 1938 vergessen. Konrad Als Nicht-Wiener in dieser Runde finde ich ja, dass das historische Bewusstsein, die Erinnerung in Wien im Gegensatz zu anderen Städten doch sehr lebendig ist. Es ist schwierig, andere Orte zu finden, wo sich ein soziales Experiment so in die Stadt und die Alltagserinnerung eingeschrieben hat. Allein dass es dieses Haus noch gibt, in dem wir hier debattieren, ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit.
1
2
3
4
5
6 7
8
Erste Zeile des Lieds Die Arbeiter von Wien. Der Text stammt von Fritz Brügel, gesungen wurde es zur Melodie des Roten Armeemarschs ( 1920 ). Die Entstehungszeit ist nicht ganz geklärt. Am 7. August 1926 wurde es im sozialdemokratischen Wochenblatt Volkspost abgedruckt. Die neue Stadt, Berlin 1927. Das Werk erschien in der Büchergilde Gutenberg. Die Texte verfasste Josef Luitpold Stern. Otto Rudolf Schatz gestaltete die 74 Schriftund Bildseiten in Holzschnitttechnik. Karl R. Stadler ( 1913–1987 ), Historiker und Professor für Zeitgeschichte an der Universität Linz. Dem Einküchenhaus lag die Idee zugrunde, die Hausarbeit zu zentralisieren und dadurch insbesondere die erwerbstätigen Frauen zu entlasten. Das Wiener Einküchenhaus wurde als Heimhof ( Pilgerimgasse im 15. Bezirk ) in den Jahren 1921 bis 1923 nach Plänen von Otto Polak-Hellwig errichtet und bot ursprünglich 25 Kleinstwohnungen. Es verfügte über eine Zentralküche und einen Speisesaal. Das Reinigen der Wohnungen war ebenfalls zentral organisiert. Siehe die Beiträge von Susanne Breuss und Marie-Noëlle Yazdanpanah in diesem Katalog. Das dritte Volksfest des Republikanischen Schutzbundes der Ortsgruppe XVI ( AT 1925 ). http ://stadtfilm-wien.at/film/134/ ( 13. 3. 2019 ). Sonnenstrahl (AT 1933, R: Paul Fejos). Käthe Leichter : So leben wir … 1320 Industriearbeiterinnen berichten über ihr Leben. Eine Erhebung, Wien 1932. Vgl. Siegfried Mattl : Die Marke » Rotes Wien «. Politik aus dem Geist der Reklame, in : Wolfgang Kos ( Hg.): Kampf um die Stadt. Politik, Kunst und Alltag um 1930 ( Ausstellungskatalog Wien Museum ), Wien 2009, S. 54 – 63.
23
24
DA S KO M M U N A L E E X P E R I M E N T Die » Veralltäglichung « der Utopie ? Wolfgang Maderthaner
Wenige Tage vor den Gemeinderatswahlen am 24. April 1927 erschien in der Arbeiter- Zeitung eine in dieser Form bis dahin einmalige Kundgebung des geistigen Wien.1 Der geistig wirkende Mensch, hieß es darin, stehe zwischen und über den Klassen und könne sich keinem politischen Dogma beugen, » denn der Geist allein ist es, der die neuen Wirklichkeiten schafft, deren sich die Politik erst später bemächtigt «. Man wolle demnach keineswegs in den » Kampf der Wirtschaftsauffassungen « eingreifen oder Steuerfragen kommentieren. Allerdings gelte es, das » überpolitische Werk « der großen sozialen und kulturellen Leistung der Wiener Stadtverwaltung anzuerkennen, zu erhalten und zu fördern. Dieses Werk betreue die Bedürftigen, erziehe und entwickle die Jugend nach besten Prinzipien und leite den Strom der Kultur in die Tiefe. » Das Ringen um eine höhere Menschheit und der Kampf gegen Trägheit und Verödung wird uns immer bereit finden. Er findet uns auch jetzt bereit. « Unterzeichnet war die aufsehenerregende Stellungnahme unter anderen von Alfred Adler, Wilhelm Börner, Karl Bühler, Sigmund Freud, Max Graf, Fritz G rünbaum, A nton Hanak, Albert Heine, Josef Jarno, Hans Kelsen, Wilhelm Kienzl, R udolf Kraus, Ernst Lichtblau, Alma Maria Mahler, Georg Merkel, Margarete Minor, Robert Musil, Ferdinand Onno, Alfred Polgar, Helene Rauchberg, Oskar Strnad, Anton Webern, Egon Wellesz, Franz Werfel.2 Damit hatten hervorragende Exponenten des Wiener Kultur- und Geisteslebens ein nicht zu übersehendes und keineswegs selbstverständliches Zeichen ihrer Solidarisierung und Übereinstimmung mit einem der außergewöhnlichsten, kreativsten und mutigsten kommunalen Experimente der neueren europäischen Geschichte kundgetan. Es war dies ein zuvorderst pädagogisches Experiment, das auf Zivilisierung,
Antizipatorischer Sozialismus
Kulturalisierung und Hygienisierung der Massen, also auf die umfassende Hebung ihrer lebensweltlichen und sozialen, vor allem aber kulturellen Standards abzielte. Die politische und ökonomische Modernisierung des » Neuen Wien « kann in diesem Kontext als Versuch verstanden werden, die Stadt als einen Ort der Emanzipation, der Vorwegnahme einer besseren Zukunft, der Konkretisierung einer kulturellen Utopie zu definieren. Und gerade in seinen kulturpolitischen Dimensionen weist dieses Experiment weit über seinen ursprünglichen, pragmatischen Charakter eines wohlfahrtsstaatlichen und sozialpolitisch inspirierten kommunalen Modells hinaus und sicherte sich so die Loyalitäten auch und gerade der Intellektuellen. Als exemplarisches Unternehmen der Spätaufklärung kann es, in seinem radikal aufklärerischen Gestus, mit gutem Grund als Parallel aktion zum tiefenpsychologischen Projekt Freuds gelten – insofern, als es, ähnlich der Psychoanalyse, die Massenobjekte in selbstbewusste Individuen und ( proletarische wie bürgerliche ) Subjekte zu transformieren suchte.3 Die zu diesem Zweck von den Sozialdemokraten unternommene strukturelle Umformung einer gesamten großstädtischen Infrastruktur findet ihre hinreichende Erklärung nur in den spezifischen Umständen und Charakteristika der historischen
Die historische Entwicklung der Wiener Arbeiterbewegung
25
Entwicklung der österreichischen, speziell der Wiener Arbeiterbewegung. Mitte der 1880er Jahre hatte in den Industrie enklaven der Habsburgermonarchie, undspeziell in der Hauptstadt, ein überaus dynamischer Industrialisierungsschub eingesetzt, der den freien Lohnarbeiter zum dominierenden Arbeitertypus werden ließ. Vor allem erlangten die » respektablen «, qualifizierten Arbeiterschichten mit stabilisierten sozialen Beziehungen, unmittelbar politischen Interessen und der Fähigkeit zur Entwicklung langfristiger Strategien eine zunehmend hegemoniale Position und wurden zur wesentlichen sozialen Basis einer sich neu formierenden Arbeiterbewegung. Zudem trat um den Psychiater und Armenarzt Victor Adler eine neue Führungsgarnitur mit neuen politischen Konzepten auf : Massenorganisation und Massenpartei, demokratisch-konstitutionelle Strategie, gesellschaftliche Modernisierung. Auf dem zur Jahreswende 1888/89 abgehaltenen Einigungsparteitag in Hainfeld wurden jenes ( äußerst lose ) Organisationsgeflecht und jene inhaltlichen Positionen festgeschrieben, die von einer Majorität der sich formierenden Arbeiterpartei akzeptiert werden konnten. Ein schnelles quantitatives Wachstum ebenso wie eine erstaunlich zurückhaltende und von offensichtlichen Opportunitätsüberlegungen geleitete behördliche Praxis ließen Victor Adler in Briefen an Friedrich Engels und August Bebel bereits nach wenigen Jahren eine überaus positive Bilanz ziehen. Man sei von einer » Sekte « oder » Horde von Radaumachern « zu einer politischen Partei avanciert, die sich Anerkennung erzwungen habe.4 Ihr Erfolg sei geradezu überraschend, und alle Gegner, Behörden wie Kapitalisten, ließen allen Gesetzen
Massendemonstration für das allgemeine Wahlrecht, Wien 1905 ; Foto : R. Lechner ; Kat. Nr. 1.7.
zum Trotz » ganz unmögliche Dinge wie den Ausbau unserer Organisation « widerstandslos gewähren.5 Als einziges realpolitisches Wirkungsfeld stand der bis dahin noch immer schwach und in vielerlei Hinsicht provisorisch organisierten Bewegung das Instrumentarium der Politik der Straße offen : Aufmärsche, Demonstrationen, Kundgebungen. Dies eröffnete allerdings – gleichsam ironischerweise – der jungen Sozialdemokratie die Möglichkeit, ihre Politik zu einer Art Gesamtkunstwerk zu erweitern. Volksbildungseinrichtungen, Sportvereine, Kultur- und Bildungsorganisationen, lebensreformerische Vereinigungen etc. eröffneten der Arbeiterschaft den Zugang zu den Erkenntnissen der modernen Wissenschaften, der Literatur und der durchgehend hochgehaltenen Tradition der ( deutschen ) Aufklärung im Allgemeinen. Es sei die » Revolutionierung der Gehirne «, so Victor Adler, die die eigentliche Aufgabe, das nächste Ziel der Sozialdemokratie darstelle.6 Aber nicht der Revolutionierung der Gehirne allein, auch der gefühlsmäßigen, der emotionalen Bindung breiter Massen an die Bewegung kam ein entscheidender Stellenwert in diesem Organisationskonzept zu. Über einen fest umschriebenen, ritualisierten Kanon von Feiern und Festen wurde eine regelrechte Liturgie politischen Handelns entworfen – eine Ästhetisierung der Politik, für die die alljährlichen Feiern des Ersten Mai das wohl bekannteste Beispiel darstellen und die sich, vor allem in Zeiten realpolitischer Stagnation, als
Rote Rodel aus dem Nachlass von Friedrich Adler, Sohn Victor Adlers, Politiker und Physiker ; VGA, Kat. Nr. 1.11.
26
probates Mittel für den Aufbau einer Massenpartei erweisen sollte. Eine Konzeption, die vor allem in der Richard-Wagner- Verehrung und in einer bestimmten Nietzsche- und Schopenhauer-Rezeption einer in der Tradition der 1848er-Revolution stehenden, radikaldemokratischen, deutschnationalen und jüdisch assimilierten Führungsschicht begründet ist und die sich am deutlichsten in der Person Victor Adlers – einer paradigmatischen Figur sowohl der Arbeiter- als auch der W iener Stadtgeschichte – manifestiert. Es war Victor Adler, der eine im Rahmen der jungen politischen Bewegung entstehende egalitäre Utopie als eine Konzeption der Modernisierung und Zivilisierung der Massen entwarf. Diese Massen wurden als eine politisch bewusste und disziplinierte Arbeiterklasse verstanden, die unter Anleitung und Erziehung der Avantgarde der Arbeiterbewegung sich selbst schafft und dieserart überhaupt erst Geschichte machen kann. So verstand sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich von Anbeginn – und in teilweise konfliktgeladener Spannung zu den übrigen Parteien der Zweiten Internationale – vor allem auch als eine ( gegen- )kulturelle Bewegung. Man formulierte eine egalitäre Utopie : Es war ein komplex amalgamierter Machtentwurf aus nietzscheanischer Zivilisationskritik, Fabianismus und undogmatisch interpretiertem Marxismus, dessen Ziel über die Herausbildung einer modernen Arbeiterklasse europä ischen Zuschnitts hinaus auf die Modernisierung der gesamten Gesellschaft gerichtet war.
Victor Adler : Massen und Moderne
Porträt von Victor Adler ( 1852 — 1918 ) , Mitgründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, um 1900 ; Kat. Nr. 1.1.
Aber die Sozialdemokratie verstand sich nicht bloß als Anwältin und Motor anstehender oder überfälliger Modernisierungsprozesse, sie machte vielmehr die ästhetische, wissenschaftliche und politische Moderne zu ihrem Programm und definierte sich so als legitime Nachfolgerin eines gescheiterten bürgerlichen Liberalismus. Über das breit gefächerte Netz von Kulturorganisationen und lebensreformerischen Vereinen, das einerseits der Bildung der proletarischen Massen dienen sollte, traten andererseits Wissenschaftler wie der Philosoph Wilhelm Jerusalem, die Ökonomen Anton Menger und Eugen Böhm-Bawerk, der Historiker und Volksbildner Ludo Moritz Hartmann, der Musiker Arnold Schönberg oder Schauspieler und Schauspielerinnen wie Max Devrient und Hansi Niese in Kontakt mit der organisierten Arbeiterschaft. Dieses gegenkulturelle Netzwerk wurde von der nachfolgenden Generation austromarxistischer Theoretiker zum zentralen Angelpunkt ihrer politischen Konzeption eines antizipatorischen Sozialismus ausgebaut. Während es aber der Gründergeneration des Austrosozialismus weniger um wissenschaftliche Ansprüche, sondern vielmehr – und hier standen sie ganz in einer Wagnerianischen und Nietzschea nischen Tradition – um die Schaffung politischer Symbole zur emotionalen Bindung breiter Volksmassen gegangen war, zielten die Austromarxisten eine Generation später auf Verwissenschaftlichung, Rationalisierung und Entemotionalisierung – Konzepte, die das aufklärerische Projekt der Moderne paradigmatisch definieren.7 Ende der 1890er Jahre war aus
Austromarxismus
Victor Adler ( M itte ) bei einem Wiesenfest in Favoriten, dem Heimatbezirk vieler Wiener ZiegelarbeiterInnen, ca. 1898 ; Kat. Nr. 1.2.
der Wiener sozialistischen Studentenbewegung eine junge marxistische Schule hervorgegangen, deren bekannteste Vertreter Max Adler, Karl Renner und Rudolf Hilferding waren ; etwas später schlossen sich Gustav Eckstein, Fritz Adler und Otto Bauer an. Gelegentlich besuchte auch Leo Trotzki während seines sieben Jahre andauernden Wiener Exils die Diskussionsrunden, die im legendären Café Central stattfanden. » Das waren sehr gebildete Menschen «, sollte Trotzki in seinen Memoiren schreiben, » die auf verschiedenen Gebieten mehr wußten als ich. Ich habe mit lebhaftestem, man kann schon sagen mit ehrfurchtsvollem Interesse ihrer ersten Unterhaltung im Cafe › Zentral ‹ zugehört. Doch schon sehr bald gesellte sich zu meiner Aufmerksamkeit ein Erstaunen. Diese Menschen waren keine Revolutionäre. « 8 Trotzki trifft damit den Sachverhalt überaus präzise : Die austromarxistische Schule entstand um die Jahrhundertwende, in permanenter Auseinandersetzung mit der literarischen Avantgarde, der österreichischen Schule der Nationalökonomie, der naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre Ernst Machs, dem Empiriokritizismus, der Neubegründung der Psychologie ( Freud und Alfred Adler ) und der reinen Rechtslehre Hans Kelsens. Die Austromarxisten standen daher, wie Otto Bauer in einem Nachruf auf Max Adler schrieb, von
Streikende Schneiderinnen im Arbeiterheim Favoriten, 1907 ; Foto : R. Lechner ; Kat. Nr. 1.8.
vornherein auf » akademischem Boden, in der Auseinandersetzung mit den Geistesströmungen der akademischen Welt dieser Jahre «.9 Sie lehnten die Vorstellung eines starren Systems ab, anstatt dessen ging es den Austromarxisten um die bewusste Verknüpfung der marxistischen Denkresultate mit dem gesamten modernen Geistesleben, also mit den Inhalten der philosophischen und sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer Zeit. Für sie stellte sich der Marxismus weniger als Weltanschauung dar, sondern vielmehr als Tatsachenwissenschaft, anzustreben war die Kulturbeziehung mit der modernen Intelligenz. In Anknüpfung an den Neokantianismus kam es ihnen in erster Linie darauf an, eine Erkenntnislehre oder Wissenschaftstheorie zu entwickeln, die den Marxismus als positive Sozialwissenschaft begriff und für neue empirische Erkenntnisse offenstand. Die Ablehnung eines einseitigen ökonomischen Determinismus ( also der ausschließlichen Ableitung alles Sozialen und Kulturellen aus den Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftslebens ) führte die Austromarxisten in mehrere Richtungen : zunächst der Versuch, gesellschaftliche Prozesse in ihrer Gesamtheit zu erklären, also unter expliziter Einbeziehung der sogenannten Überbauphänomene. Wie immer dominant die ökonomische Komponente auch bleiben mochte, so wurde doch der menschlichen S ubjektivität und
27
28
Intentionalität im historischen Prozess eine zentrale Rolle zugeschrieben. Max Adlers Werk illustriert dies in geradezu herausragender Weise. Ein in der Tat universaler Geist, nahm er buchstäblich jegliches aktuelle gesellschaftliche Geschehen, jede neuere Geistesströmung, alle neuere, für relevant erachtete Literatur auf, um sie in sein spezifisches Denksystem zu integrieren. Dessen Grundannahme ist die Existenz eines Sozial- Apriori – mithin der gesellschaftliche Charakter der Aktion des erkennenden Bewusstseins –, in dem Adler gleichsam eine Lösung der kritischen Philosophie Kants von ihrer individualistischen Form, eine Weiterführung der kantischen Erkenntniskritik erblickte. Eben diese erkenntnistheoretische Methode ermöglichte ihm die Darstellung einer den Willen des Menschen durchdringenden sozialen Kausalität – so etwa, wenn er in Abgrenzung zu den Grenznutzentheoretikern das marxistische Ökonomieverständnis nicht als » Katallaktik «, also als Lehre der Güterabschätzung, der Tauschbeziehungen, des Marktes definierte, sondern vielmehr das Erkenntnisinteresse nach jenen verborgenen Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen den sozialen Klassen richtete, in denen sich die Tauschbeziehungen des Marktes zu ihrem Ausdruck bringen. Gleichwohl ist Adlers kantianisierendem Marxismus eine unzweifelhaft idealistische, wenn nicht metaphysische Dimension eigen ; er verstand den Sozialismus als universale Weltanschauung, als den Aufstieg der Menschheit zu » unerhörter Kultur « und » unerhörter Freiheit «, als historische, das ganze Gebäude der menschlichen Kultur umwälzende ( und in diesem Sinne revolutionäre ) gesellschaftliche Praxis.10
Delegierte des Internationalen Sozialistenkongresses in Amsterdam, 1904 ; Kat. Nr. 1.3.
Ein Leitmotiv nachgerade des austromarxistischen Denkens : So spricht Otto Bauer in einer jener überaus raren konkreten Darlegungen einer als ideal imaginierten sozialistischen Zukunft von einer » vollen und wahren «, sich selbst bestimmenden » Kulturgemeinschaft « als Produkt gesellschaftlichen Schaffens, Erzeugnis sowohl der Erziehung wie der solidarischen Kooperation in der gesellschaftlichen Arbeit. Der Sohn aus großbürgerlichem, jüdisch assimiliertem und paradigmatisch liberalem Hause, Protegé Victor Adlers, hatte im Alter von 26 Jahren eine monumentale Studie zur Nationalitätenfrage vorgelegt und war mit einem Schlag zu einem der wichtigsten Theoretiker der internationalen Sozialdemokratie aufgestiegen.11 Im Kapitel über die Verwirklichung der nationalen Kulturgemeinschaft durch den Sozialismus entwirft er die Vision einer qualitativ neuartigen Kultur aller » Glieder der künftigen Gesellschaft «, der Identität von » Arbeitenden « und » Genießenden «, die gänzlich neue Persönlichkeiten, » Neue Menschen « entstehen lassen werde. Eine authentische, inte grale, hybride Kultur, geschaffen im bewussten Willensakt der Gesamtheit des Volkes, in ihrer » Wesenheit « durch das Alte mitbestimmt, Erbin aller früheren Kulturen. » Was je Menschen erdacht und ersonnen, gedichtet und gesungen haben, wird nun zum Erbe der Massen. « 12 War Max Adler der Philosoph, Karl Renner der Staatsund Rechtstheoretiker, so war der praktische Arzt Rudolf Hilferding der Ökonom des Austromarxismus ( Hilferding war zweimaliger Finanzminister der Weimarer Republik, am 12. Februar 1941 wurde er in einem Pariser Gestapo-Gefängnis ermordet ). Endgültig in die erste Reihe der Theoretiker des internationalen Sozialismus stieg er mit dem 1910 veröffentlichten Finanzkapital auf, das er im Wesentlichen bereits als 28-jähriger vollendet hatte und das von Karl Kautsky als der » vierte Band des Kapitals « bezeichnet wurde.13 Hilferdings Auffassung, dass es in der kapitalistischen Entwicklung objektive Tendenzen zu einem gleichsam quantitativen » Hineinwachsen « in den Sozialismus gäbe, findet sich – wenn auch mit differenter politischer Implikation – in den politisch-ökonomischen Schriften Bauers und Renners immer wieder ; eine Auffassung, die zu einem weiteren, zentralen Leitmotiv austromarxistischer Politik der Zwischenkriegszeit wurde. Einen bedeutenden Stellenwert nahm zudem die Analyse sozialer Schichtung in entwickelten industriell-kapitalistischen Gesellschaften ein, die soziale Zusammensetzung der Arbeiterschaft selbst und die Formierung eines entsprechenden » Klassenbewusstseins « als Voraussetzung für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Denn dies blieb die
rämisse austromarxistischen Politikverständnisses : GleichP sam als Erbe der liberalen Tradition blieb die Sozialdemokratie dem Prinzip einer graduellen Machterlangung durch demokratische Wahlen prinzipiell verbunden. Diktatur und Anwendung von Gewalt allerdings zur Erreichung dieses Ziels lehnte sie prinzipiell ab. Unter der Führung Otto Bauers, dessen historisch- politisches Werk eine hohe Affinität zu den Theorien Antonio Gramscis aufweist, versuchte die österreichische Sozialdemokratie jedenfalls ein Konzept der kulturellen Hegemonie zu entwickeln, das sich sowohl vom passiven Reformismus der Zweiten Internationale wie auch vom putschistischen Bolschewismus strikt abgrenzte. Nur die geschulte und disziplinierte Arbeiterschaft, die eine geistige und kulturelle Hegemonie über eine von ihr geführte Volksmehrheit erlangt hatte, konnte demnach Garant für die Eroberung der Demokratie sein. Dem Feld der Bildung wurde somit prioritäre Signifikanz zugeordnet. Man müsse die Arbeiterschaft in den Stand setzen, » in sich selbst « jene moralischen und intellektuellen Qualitäten zu entwickeln, ohne die der Sozialismus nicht zu verwirklichen sei.14 Machtwille und Kulturwille wären derart zu synthetisieren, aus dem » Zustand der Kulturlosigkeit « würde sich eine » geistig regsame «, » nach immer größerem Kulturbesitz ringende Elite « entwickeln. Die Umgestaltung der Gesellschaft war somit an die Veränderung, die umfassende Kulturalisierung des Individuums, an die Vorwegnahme eines, wie er pathetisch apostrophiert wurde, » Neuen Menschen « ( Max Adler ) im Rahmen der Strategie eines anti zipatorischen Sozialismus,15 eines » Infreiheitsetzen[s] der Ele-
1
2 3
4
5
6
Dieser Beitrag ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung von Wolfgang Maderthaner : Das kommunale Experiment des Roten Wien – die » Veralltäglichung « der Utopie ?, In : Alexander Amberger, Thomas Möbius ( Hg.): Auf Utopias Spuren. Utopie und Utopieforschung. Festschrift für Richard Saage zum 75. Geburtstag, Wiesbaden 2017, S. 207 – 227. Arbeiter-Zeitung, 20. April 1927, S. 1. Vgl. Wolfgang Maderthaner, Lutz Musner : Wiener Beiträge zur historischen Metropolenforschung, in : Historische Anthropologie 10 ( 2002 ) 3, S. 436 – 448, hier S. 443. Victor Adlers Aufsätze, Reden und Briefe, Bd. 1 : Victor Adler und Friedrich Engels, hg. v. Parteivorstand der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs, Wien 1922, S. 25 ; Victor Adler/Friedrich Engels Briefwechsel, hg. v. Gerd Callesen u. Wolfgang Maderthaner, Berlin 2011, S. 17. Victor Adler, Briefwechsel mit August Bebel und Karl Kautsky, gesammelt und erläutert v. Friedrich Adler, Wien 1954, S. 117. Victor Adlers Aufsätze, Reden und Briefe, Bd. 6 : Victor Adler, der Parteimann, Wien 1929, S. 27f.
7
8 9
10
11
12
mente der neuen Gesellschaft « 16 innerhalb der bestehenden Verhältnisse gebunden. Dieses Konzept hat im Wien der Zwischenkriegszeit für eineinhalb Jahrzehnte eine erstaunlich adäquate Umsetzung erfahren. Es sollte dabei nicht übersehen werden, dass das kommunale Experiment des Roten Wien eigentlich auf einer doppelten Ironie gründet : Erst der Machtverlust auf Bundesebene 1920 und die damit verbundene Verhinderung der Realisierung weiterer Sozialisierungen oder sozialstaatlicher Maßnahmen brachten die Sozialdemokratie dazu, ihr gesamtes politisches Potenzial auf Wien zu konzentrieren. Und erst dieses Scheitern einer von sozialdemokratischer Seite in den Verfassungsverhandlungen stark forcierten zentralstaatlichen Lösung zugunsten einer stärkeren Autonomie der Bundesländer ermöglichte es dem Bundesland Wien ab 1922, mittels partieller finanzpolitischer Souveränität eine über die Notstandsmaßnahmen und pragmatischen Notwendigkeiten der unmittelbaren Nachkriegszeit hinausweisende Politik der qualitativen kommunalen Reformen zu entwickeln. Die Politik der Gemeinde konzentrierte sich in der Folge vor allem auf den Reproduktionsbereich und hatte eine gänzliche Reorganisation der administrativen wie technischen Funktionen der Stadt zur Voraussetzung. Zu einem wesentlichen Teil ruhte die angestrebte Politik einer Veralltäglichung der Revolution durch Evolution auf den Säulen der sozialen Fürsorgepolitik und, dies vor allem, des kommunalen Wohnbaus.17
Das Rote Wien
Vgl. Wolfgang Maderthaner : Austro-Marxism : Mass Culture and Anticipatory Socialism, in : Austrian Studies 14 ( 2006 ), S. 21 – 36. Leo Trotzki : Mein Leben. Versuch einer Autobiographie, Berlin 1930, S. 198. Otto Bauer, Max Adler. Ein Beitrag zur Geschichte des » Austromarxismus «, in : Der Kampf. Internationale Revue 4 ( 1937 ), S. 297ff. Wolfgang Abendroth : Adler, Max, in : Wilhelm Bernsdorf, Horst Knospe ( Hg.): Internationales Soziologenlexikon, Bd. 1 : Beiträge über bis Ende 1969 verstorbene Soziologen, Stuttgart 1980, S. 2f. ; Herbert Marcuse : Transzendentaler Marxismus ?, in : Die Gesellschaft 7 ( 1930 ) 10, S. 304 – 326. Vgl. Otto Bauer : Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie ( Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus, Bd. 2 ), Wien 1907. Ebd., S. 103. Siehe v. a. auch Richard Saage : Im Schatten Utopias. Utopische und kontraktualistische Elemente im Austromarxismus bei Max Adler und Otto Bauer, in : ders. : Utopische Horizonte. Zwischen historischer Entwicklung und aktuellem Geltungsanspruch, Berlin 2010, S. 107 – 122.
13
14
15
16 17
Rudolf Hilferding : Das Finanzkapital ( Marx Studien. Blätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus, Bd. 3 ), Wien 1910. Protokoll des Sozialdemokratischen Parteitages 1926. Abgehalten in Linz vom 30. Oktober bis 3. November 1926, Wien 1926, S. 273. Vgl. Anson Rabinbach : Vom Roten Wien zum Bürgerkrieg, Wien 1989, S. 44ff. [ amerikanische Originalausgabe : The Crisis of Austrian Socialism. From Red Vienna to Civil War, Chicago 1983 ]. Protokoll des Parteitages 1926. Vgl. Helmut Gruber : Red Vienna. Experiment in Working-Class Culture 1919 – 1934, New York/Oxford 1991.
29
Historischer Text 30
» Was die Sozialdemokraten von der Kommune fordern ! « Aus: Arbeiter-Zeitung, 2. Februar 1896, S. 1
Historischer Text
» Eine Kundgebung des geistigen Wien.«
31
Aus: Arbeiter-Zeitung, 20. April 1927, S. 1
Ein Zeugnis für die große soziale und kulturelle Leistung der Wiener Gemeinde. Angesichts des politischen Kampfes in dieser Stadt fühlen wir uns vor unserem Gewissen verpflichtet, folgende Erklärung abzugeben : Der geistig wirkende Mensch steht zwischen und über den Klassen. Er kann sich keinem politischen Dogma beugen, denn der Geist allein ist es, der die neuen Wirklichkeiten schafft, deren sich die Politik erst später bemächtigt. Ein Augenblick aber wie dieser verlangt von uns Entscheidungen, die im geistigen Sinne getroffen werden müssen. Es ist nicht unsere Absicht, in den Kampf der Wirtschaftsauffassungen einzugreifen und zu Steuerfragen etwa das Wort zu nehmen. Nach unserer Meinung haben Staat und Gesellschaft die Pflicht, dem einzelnen Menschen das Leben zu erleichtern und nicht zu erschweren. Wir verwerfen daher alle unbillige Härte obrigkeitlicher Forderungen. Es wäre aber ein wahres Versäumnis, wenn man im Abwehrkampf gegen Steuerlasten die große soziale und kulturelle Leistung der Wiener Stadtverwaltung übersähe. Diese große und fruchtbare Leistung, welche die Bedürftigen leiblich betreut, die Jugend nach den besten Prinzipien erzieht und entwickelt, den Strom der Kultur in die Tiefe leitet, diese Taten wollen gerade wir anerkennen, dieses überpolitische Werk möchten gerade wir erhalten und gefördert wissen. Geist und Humanität sind ein und dasselbe. Sie vermögen die lauten und gierigen Gegensätze des materiellen Lebens zu mildern. Mögen auch die ökonomischen Bewegungen und politischen Schlagworte schreiend den Vordergrund behaupten, wir werden uns nicht betäuben lassen. Wir können das Opfer des beseelten Intellekts nicht bringen. Wir müssen daher dem Versuch entgegentreten, die Oeffentlichkeit durch eine wirtschaftliche Kampfparole zu blenden, die aber in Wirklichkeit nur auf den Stillstand, ja auf den Rückschritt abzielt. Wesen des Geistes ist vor allem Freiheit, die jetzt gefährdet ist, und die zu schützen wir uns verpflichtet fühlen. Das Ringen um eine höhere Menschlichkeit und der Kampf gegen Trägheit und Verödung wird uns immer bereit finden. Er findet uns auch jetzt bereit.
Dr. Alfred Adler. Wilhelm Börner, Schriftsteller. Artur Brusenbauch, akademischer Maler. Professor Karl Bühler, Vorstand des Psychologischen Instituts
der Universität Wien.
Franz Cizek, Professor der Kunstgewerbeschule. Leo Delitz, akademischer Maler. Josef Dobrovsky, akademischer Maler. Karl Forest, Schauspieler und Regisseur des Deutschen Volkstheaters. Dr. Siegmund Freud, Professor an der Universität Wien. Dr. Max Graf, Schriftsteller, Professor an der Akademie für Musik
und darstellende Kunst.
Fritz Grünbaum, Schriftsteller, Direktor des Stadttheaters. Dr. Fanina Halle, Schriftstellerin. Anton Hanak, akademischer Bildhauer, Professor an der Kunstgewerbeschule. Albert Heine, Hofrat, Direktor des Burgtheaters a. D., Regisseur und Schauspieler,
Professor an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst.
Josef Jarno, Direktor der Renaissancebühne. Dr. Hans Kelsen, Professor an der Universität Wien. Dr. Wilhelm Kienzl, Komponist. Theodor Klotz-Dürenbach, akademischer Maler. Dr. Rudolf Kraus, Professor an der Universität Wien. Professor Ernst Lichtblau, Architekt. Primarius Dr. Robert Lichtenstern. Alma Maria Mahler. Maria Mayer, Burgschauspielerin. Georg Merkel, akademischer Maler. Margarete Minor. Dr. Robert Musil, Schriftsteller. Dr. Wilhelm Neubauer, Professor an der Hochschule für Bodenkultur. Ferdinand Onno, Schauspieler am Deutschen Volkstheater. Alfred Polgar, Schriftsteller. Professor Otto Prutscher, Architekt. Professor Helene Rauchberg. Franz Salmhofer, Komponist. Karl Schneller, Schriftsteller. Dr. Oskar Strnad, Architekt, Professor an der Kunstgewerbeschule. Dr. Anton Webern, Tonkünstler. Dr. Egon Wellesz, Dozent an der Universität Wien. Franz Werfel, Schriftsteller. Professor Karl Witzmann, Architekt. Franz Zülow, akademischer Maler.
Kat. Nr. 6.12.
32
AU S T R O M A R X I S M U S Die Ideologie der Einheit der österreichischen Arbeiterbewegung Vrääth Öhner
Was ist Austromarxismus ? Am 3. November 1927 nimmt kein Geringerer als Otto Bauer, stellvertretender Vorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ( S DAP ) und zugleich deren führender Theoretiker, zu dieser Frage Stellung. In einem namentlich nicht gekennzeichneten Leitartikel in der Arbeiter-Zeitung unterscheidet Bauer drei miteinander konkurrierende Bedeutungen des Begriffs : Austromarxismus sei zum einen » seit einiger Zeit ein Lieblingsschlagwort im bürgerlichen Sprachgebrauch « geworden und bezeichne dort » eine ganz besonders bösartige Spielart des Sozialismus «. Diesem bürgerlichen Missverständnis widerspreche zum anderen die wahre Geschichte des Begriffs, der von Louis B. Boudin, einem amerikanischen Sozialisten, noch vor dem Ersten Weltkrieg geprägt wurde, um eine Gruppe junger österreichischer Sozialdemokraten zu beschreiben ( unter ihnen Max Adler, Friedrich Adler, Karl R enner, Rudolf Hilferding und Otto Bauer ), die versuchten, » die marxistische Geschichtsauffassung auf komplizierte, aller oberflächlichen, schematischen Anwendung der Marx’schen Methode spottende Erscheinungen anzuwenden «. Weil sich die » austromarxistische Schule « nach dem Ersten Weltkrieg allerdings aufgelöst hatte, bezeichne der Begriff drittens » heute nichts anderes als die Ideologie der Einheit der Arbeiterbewegung «: Im Gegensatz zu den » Arbeiterparteien der meisten anderen Länder « sei es der österreichischen Sozialdemokratie nämlich gelungen, » in all den Stürmen der Nachkriegszeit ihre Einheit zu bewahren « – das heißt, sie konnte den Einfluss kommunistischer Agitation weitgehend unterbinden. Und zwar nicht zuletzt aufgrund einer politischen Strategie, die » nüchterne Realpolitik und revolutionären Enthusiasmus in einem Geist vereinigt «. Gegenwärtig sei der Austromarxismus daher beides, sowohl das Produkt der Einheit der österreichischen Arbeiterbewegung als auch » die geistige Kraft, die die Einheit erhält «.1
Viel prägnanter als Otto Bauer das getan hat, kann man den schillernden Begriff des Austromarxismus kaum auf den Punkt bringen, zumal seine Darstellung im Kern die wesentlichen Konfliktlinien umreißt, die das zeitgenössische Verständnis bestimmten. Da ist zum einen das Verhältnis zum politischen Gegner, der Christlichsozialen Partei, und namentlich zu Ignaz Seipel, deren Vorsitzendem und zu diesem Zeitpunkt auch Bundeskanzler, der während des Wahlkampfs zur Nationalratswahl am 24. April 1927 den Begriff Austromarxismus als negativ besetzten Kampfbegriff ins Spiel gebracht hatte. Während seiner zweiten Amtszeit von 1926 bis 1929 stärkte Seipel die Rolle der austrofaschistischen Heimwehr ( insbesondere nach dem Justizpalastbrand 1927 ),
Schlagwort der Rechten
für die bereits angesprochene Nationalratswahl formte er aus Christlichsozialen, Großdeutscher Volkspartei, der natio nalsozialistischen Riehl- und Schulzgruppe sowie anderen Gruppierungen eine nicht bloß antisozialistische, sondern damit auch antidemokratische Einheitsliste.2 Für den politischen Gegner stellte der Begriff Austromarxismus ein nicht näher bestimmtes Schlagwort dar, das die » Steuertyrannei « der Sozialdemokraten in Wien ebenso bezeichnete wie die drohende Errichtung einer Diktatur des Proletariats, die es mit allen Mitteln, und seien es die des Faschismus, zu verhindern gelte. Zum anderen verweist Bauer auf das Verhältnis zur eigenen Vergangenheit und also zur Bedeutung, die der Austromarxismus als Spielart marxistischer Theoriebildung vor dem Ersten Weltkrieg und im Rahmen der Zweiten Internationale gehabt hat : Diese Ebene des Begriffsverständnisses ist Bauer zufolge 1927 bereits historisch. Allerdings informierte sie weiterhin das Denken und auch die Politik der österreichischen Sozialdemokratie. Max Adler, Otto Bauer und Karl Renner, die auch die Theoriebildung in der Zwischenkriegszeit dominierten, hatten allesamt bereits vor dem Ersten Weltkrieg ihre ersten großen Publikationen vorgelegt : Max Adler 1904 über Kausalität und Teleologie im Streite um die Wissenschaft, Otto Bauer 1907 über Die Natio nalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Karl R enner 1899 über Staat und Nation. Die Publikationen von Adler und Bauer waren in der von Max Adler und Rudolf H ilferding 1904 gegründeten und bis 1925 herausgegebenen Schriftenreihe Marx-Studien erschienen. Darüber hinaus gründeten Otto Bauer, Adolf Braun und Karl Renner 1907 mit der sozialdemokratischen Monatsschrift Der Kampf jenes Zen tralorgan politischer Theoriebildung, in dem bis zum Verbot der SDAP 1934 ( und darüber hinaus auch noch im Exil bis 1938 ) praktisch alle für die Sozialdemokratie wesentlichen Fragen durchaus kontrovers diskutiert wurden. Wenn Bauer trotz dieser offenkundigen Kontinuitäten dennoch von einer Auflösung der » austromarxistischen Schule « spricht, so sind damit in erster Linie der Zerfall der Zweiten Internationale am Beginn des Ersten Weltkriegs gemeint sowie der Bedeutungsverlust, den die auch vom Austromarxismus vertretenen Positionen des » marxistischen Zentrums « nach der Oktoberrevolution 1917 erfahren hatten. Was vor 1914 eine bedeutende linkssozialistische Strömung innerhalb der marxistischen Arbeiterbewegung gewesen war, die zwischen revolutionärer und reformorientierter Politik zu vermitteln suchte, geriet nach 1917 in den Verdacht, die proletarischen Interessen denen des Bürgertums unterzuordnen.
Spielart marxistischer Theoriebildung
Otto Bauer ; Foto, ca. 1930 ; VGA, V3 /41
Aus der österreichischen Binnenperspektive betrachtet, fällt es allerdings schwer, die Rede von einer Auflösung der » austromarxistischen Schule « nachzuvollziehen. Wie Raimund Löw festgestellt hat, erhob die österreichische Sozialdemokratie erst ab 1917 den Anspruch, » einen gegenüber Reformismus und Bolschewismus › dritten ‹, marxistischen, Weg zu gehen «, nachdem » die Parteilinke unter der Leitung Otto Bauers die faktische Führung der Partei « übernommen hatte.3 Erst ab diesem Zeitpunkt unterschieden sich Politik und Ideologie der österreichischen Sozialdemokratie von jener anderer Bruderparteien der Zweiten Internationale, erst ab diesem Zeitpunkt ergibt die Bezeichnung » Austromarxismus « in politischer Hinsicht überhaupt Sinn. Als » Schule « mag sich der Austromarxismus nach dem Ersten Weltkrieg aufgelöst haben, als dialektische Einheit von politischer Theorie und politischer Praxis aber begann er erst mit Kriegsende die Politik der Partei zu bestimmen. Was freilich mit der Übernahme des politischen Führungsanspruchs deutlicher zutage trat als in der Vorkriegszeit, waren die Differenzen, die zwischen den einzelnen Positionen innerhalb des Austromarxismus ( und damit der Partei ) bestanden : Während Karl Renner als Vertreter des rechten Flügels der Partei bereits im wachsenden Einfluss der Sozialdemokratie auf die Gesetzgebung und die Verwaltung des Staates und in der Schaffung von Institutionen wie den Gewerkschaften, den Konsumgenossenschaften oder den Mieter vereinigungen die geeigneten Hebel für die Durchsetzung des Sozialismus erkannte, hielten Otto Bauer und Max Adler als Vertreter des linken Flügels an der zentristischen Unterscheidung zwischen » bürgerlicher « und » sozialer « ( Adler ) bzw. » funktionaler « ( Bauer ) Demokratie fest. Weil die parlamentarische Demokratie nur die politische, nicht aber die soziale und wirtschaftliche Gleichheit der Menschen garantieren kann, galt sie beiden als notwendiger und zugleich unzureichender erster Schritt auf dem Weg zur angestrebten sozialistischen Ordnung.4 Während die vom Austromarxismus entworfene politische Theorie sich aus durchaus heterogenen und zum Teil widersprüchlichen Elementen zusammensetzte, stellte seine politische Realität eine verbindende Klammer dar.5 Unter anderem darauf spielt schließlich Bauers dritte Bedeutungsebene des Begriffs an, auf den Austromarxismus als » Ideologie der Einheit der Arbeiterbewegung «. Es ist dies jene Ebene, die sowohl zeitgenössisch als auch im Rückblick die meiste Aufmerksamkeit erregt hat – im positiven wie im negativen Sinn. Dabei entsprang sie historischen Erfahrungen, die vor den Einigungsparteitag in Hainfeld 1888/89 zurückreichten. Sie stellte somit ein Erbe der Parteigründung durch Victor Adler dar,
Ideologie der Einheit
33
34
das auch nach dem linkssozialistischen Kurswechsel 1917 vom Austromarxismus nicht infrage gestellt wurde. Gegenstand der Auseinandersetzung war aber ohnehin nicht der Einheitsgedanke als solcher, sondern Bauers politische Strategie, die Einheit der Partei durch eine Synthese von nüchterner Realpolitik und revolutionärem Enthusiasmus zu erhalten. Die daraus resultierende Entscheidung, den bürgerlichen Staat zu retten, um ihn als Grundlage für den Aufbau eines sozialistischen Staats verwenden zu können, wurde zum Dreh- und Angelpunkt der Kritik – sowohl von rechts als auch von links. Während der reaktionären Rechten bereits die reformistische Politik der Sozialdemokratie zu weit ging, die sie aus diesem Grund als Vorgeschmack auf die drohende Diktatur des Proletariats denunzierte, stellte die kommunistische Linke stets die Glaubwürdigkeit des revolutionären Enthusiasmus der Sozialdemokratie infrage. Insbesondere drei Gesichtspunkte waren dabei ausschlaggebend : Erstens habe die Sozialdemokratie mit ihrer politischen Strategie eine proletarische Revolution in Österreich verhindert, und zwar zu einem Zeitpunkt ( nämlich 1918/19 ), als die Chancen für einen Erfolg überaus günstig gewesen wären. Aus diesem Umstand folge zweitens, dass es sich beim revolutionären Enthusiasmus der Sozialdemokratie um nichts weiter gehandelt habe als um eine Art Verbalradikalismus, dass die politische Strategie also gar keine Synthese von nüchterner Realpolitik und revolutionärem Enthusiasmus war, sondern bloß die Verschleierung reformistischer Politik durch radikale Phrasen. Für diesen Befund spräche drittens die abwartende Haltung der Sozialdemokratie – ihr oft getadelter Attentismus – gegenüber einem politischen Gegner, der spätestens nach den Ereignissen des 15. Juli 1927 den faschistischen Umbau des Staates konsequent vorantrieb. Vieles von dieser Kritik gehört heute bereits einem vergangenen Zeitalter an, nämlich jenem der bolschewistischen Reformismuskritik. Unter dem Gesichtspunkt der versäumten oder gar verhinderten Revolution erscheint der revolutionäre Enthusiasmus des Austromarxismus tatsächlich als leere Phrase. Was die linke Kritik dabei allerdings geflissentlich übersah, ist der Umstand, dass es die erklärte Absicht des Austromarxismus war, die Staatsmacht auf demokratischem Weg zu erobern. Wie Otto Bauer und andere führende Persönlichkeiten der Partei nicht müde wurden zu betonen, wäre es für die Sozialdemokratie 1918/19 » jeden Tag « möglich gewesen, die Diktatur des Proletariats aufzurichten. Was sie davon abhielt, war die nur schwer von der Hand zu weisende Überzeugung, dass die
auf demokratischem Weg errungene Macht sehr viel leichter auf Dauer zu stellen ist als die im gewaltsamen Umsturz eroberte. Nicht umsonst hob Bauer in seiner Rechtfertigung der österreichischen Revolution die » Selbstbeschränkung des Proletariats «, das heißt den Verzicht auf die Revolution und die Verteidigung der Republik, als das » eigentliche, schwierigste Problem der Revolution « hervor : » hungernde, verzweifelnde, von allen Leidenschaften, die der Krieg und die Revolution aufgewühlt hatten, bewegte Massen nicht mit Gewaltmitteln niederzuhalten, sondern mit geistigen Mitteln dazu zu bestimmen, daß sie aus freiem, aus eigener Erkenntnis stammenden Entschlusse die Grenzen nicht überschreiten, die das wirtschaftliche Elend und die wirtschaftliche und militärische Ohnmacht des Landes der Revolution setzten. « 6 Klingt in Bauers Rechtfertigung bereits der Stellenwert an, den Bildung und Erziehung im Kampf um die Staatsmacht und beim Fortschreiten zum Sozialismus für die
Max Adler, ca. 1930; Foto; Kat. Nr. 1.16.
ozialdemokratie besaßen, erkannte Hans Kelsen, der ArchiS tekt der österreichischen Bundesverfassung, in Bauers Darstellung einen Kurswechsel in der » politischen Ideologie der sozialistischen Bewegung von Marx zu Lassalle «. Kelsen zufolge unterschied sich das vom Willen zu umfassenden politischen und sozialen Reformen bestimmte Handeln der Sozialdemokratie während der Revolutionszeit nur durch die veränderten Machtverhältnisse von dem der Vorkriegszeit. Wenn Bauer nun die auf freiem Entschluss beruhende Übereinstimmung der Regierten mit der Regierung als besonderes Charakteristikum der Koalitionsregierung hervorgehoben hatte, dann liege der Schluss nahe, dass auch ein » dem sozialistischen Ideal ganz entsprechendes soziales Gebilde […] durch zielbewußte Reform erfüllt werden kann, nicht durch Revolution übersprungen werden muß. « 7 Auch wenn Bauer Kelsens Einwand von einer bloß graduellen Differenz zwischen vor- und nachrevolutionärem Staat mit dem Argument zurückwies, dass eine solche Anschauung » den Glauben an zukünftige Wesensänderungen des Staates erschüttern will «,8 traf Kelsens staatsrechtliche Analyse einen entscheidenden Punkt : Der revolutionäre En thusiasmus des Austromarxismus entzündete sich tatsächlich nicht am Gedanken an eine gewaltsame Revolution, sondern
Karl Renner auf einer Genossenschaftstagung ; Foto, um 1930 ; VGA V3 / 31
an der Aussicht auf die demokratische Eroberung der Macht. Bis zuletzt, das heißt bis zum Februaraufstand 1934, verteidigte die zunehmend in die Defensive gedrängte Sozialdemokratie die demokratische Staatsform als das einzig legitime Werkzeug zur Durchsetzung des Sozialismus. Ihre klassisch gewordene Formulierung erhielt diese Verteidigungsbereitschaft im zentralen Dokument des Austromarxismus, dem Linzer Programm von 1926. Unter dem Titel » Der Kampf um die Staatsmacht « hieß es in dem der politischen Strategie gewidmeten Abschnitt : » Wenn sich aber die Bourgeoisie gegen die gesellschaftliche Umwälzung, die die Aufgabe der Staatsmacht der Arbeiterklasse sein wird, durch planmäßige Unterbindung des Wirtschaftslebens, durch gewaltsame Auflehnung, durch Verschwörung mit ausländischen gegenrevolutionären Mächten widersetzen sollte, dann wäre die Arbeiterklasse gezwungen, den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu brechen. « 9 Als Regulativ reformistischer Politik und als Aussicht auf die Eroberung der Macht, die nicht zuletzt durch die dominierende Stellung der Sozialdemokratie im Roten Wien gestützt wurde, war der revolutionäre Enthusiasmus des Austromarxismus mehr als eine bloße Parole, um die revolutionären Energien der Massen zu zügeln. Er war, wie Raimund
35
36
Löw ausgeführt hat, Ausdruck einer bereits vor dem Ersten Weltkrieg gewachsenen Vorstellung » von einem ununterbrochenen › natürlichen ‹ Wachstum der Macht der Arbeiterklasse, die weder von der Politik der Arbeiterparteien noch jener der Bourgeoisie beeinträchtigt werden könnte «.10 Der Glaube an eine solche dem Geschichtsprozess zugrunde liegende Teleologie, die notwendig zur Überwindung des Kapitalismus führt, bestimmte die politische Strategie des Austromarxismus und damit auch die abwartende Haltung der Sozialdemokratie im Hinblick auf den politischen Gegner. Nicht einmal die von Käthe Leichter 1933 konstatierte » Dynamik der demokratischen Entwicklung «, die in der Folge von Rationalisierung und Weltwirtschaftskrise zur » ökonomischen Zerklüftung des Proletariats « geführt hatte,11 konnte dieser Vorstellung etwas anhaben. Selbst nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 setzte die Sozialdemokratie auf eine Politik des Abwartens und des kleineren
Max Adler : Kausalität und Teleologie, Wien 1904, Bibliotheksexemplar der Gewerkschaft der Arbeiter im Baugewerbe, Ortsgruppe der Gipser ; Kat. Nr. 1.15.
Übels. Im Rückblick wurde diese Politik vielfach als Anzeichen für die Lähmung der Parteiführung und für die beginnende Auflösung der Partei gewertet. Es ist aber ebenso gut möglich, das Abwarten der Parteiführung als Konsequenz jener nüchternen Realpolitik zu betrachten, die innerhalb der austromarxistischen Ideologie der Einheit das Gegenstück zum revolutionären Enthusiasmus bildete. Dafür spricht unter anderem, dass es der Sozialdemokratie bei den letzten demokratischen Landtagswahlen in Wien am 24. April 1932 gelungen war, sich zu behaupten, während die Christlich soziale Partei eine schwere Niederlage erlitten hatte und die Anhänger und Anhängerinnen der Großdeutschen Volkspartei geschlossen zu den Nationalsozialisten übergelaufen waren. In seiner Wahlanalyse im Kampf erklärte Otto Bauer, dass die politische Konfrontation von nun an durch den Gegensatz zwischen Sozialdemokratie und Nationalsozialismus bestimmt sein werde, und rief insbesondere die Parteijugend zu entschlossenem Handeln auf.12 Mit einigem Erfolg : Wie Kurt Bauer festgestellt hat, konnten die Sozialdemokraten in den folgenden Monaten das Eindringen der Nationalsozialisten in sozialdemokratische Milieus verhindern.13 So aussichtsreich es war, einem Gegner entschlossenen Widerstand entgegenzusetzen, der die außerhalb der Legalität stehende Gewalt der Straße zum bevorzugten Kampfmittel erklärt hatte, so aussichtslos musste es erscheinen, die bewaffnete Konfrontation mit einem Gegner zu suchen, dem auf der Basis des Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes Polizei und Militär unterstanden. Erst recht für einen Austromarxismus, der die demokratischen Garantien zur Grundlage seiner Politik gemacht hatte.
1 2
3
4
5
Otto Bauer : Austromarxismus, in : ArbeiterZeitung, 3. November 1927, S. 1f. Vgl. Robert Kriechbaumer : Die großen Erzählungen der Politik. Politische Kultur und Parteien in Österreich von der Jahrhundertwende bis 1945, Wien/Köln/ Weimar 2001, S. 264 – 273. Raimund Löw : Theorie und Praxis des Austromarxismus, in : ders., Siegfried Mattl, Alfred Pfabigan ( Hg.): Der Austromarxismus. Eine Autopsie, Frankf. a. M. 1986, S. 11. Vgl. Karl Renner : Was ist Klassenkampf ?, Berlin 1919 ; Otto Bauer : Der Staat und die Arbeiterklasse, in : ders. : Die österreichische Revolution, Wien 1923, S. 182 – 195 ; Max Adler : Demokratie und Rätesystem, Wien 1919. Vgl. Norbert Leser : Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis, Wien/Frankf. a. M./ Zürich 1968.
6 7 8
9
10 11 12 13
Bauer, Staat und Arbeiterklasse, S. 183. Hans Kelsen : Otto Bauers politische Theorien, in : Der Kampf 17 ( 1924 ) 1, S. 55. Otto Bauer : Das Gleichgewicht der Klassenkräfte, in : Der Kampf 17 ( 1924 ) 2, S. 66. Programm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs, in : Otto Bauer : Werkausgabe, Bd. 3, Wien 1976, S. 1024. Löw, Theorie und Praxis, S. 40. Käthe Leichter : Die beste Abwehr, in : Der Kampf 26 ( 1933 ) 11, S. 449. Vgl. Otto Bauer : Der 24. April, in : Der Kampf 25 ( 1932 ) 5, S. 189 – 193. Vgl. Kurt Bauer : »… jüdisch aussehende Passanten «. Nationalsozialistische Gewalt und sozialdemokratische Gegengewalt in Wien 1932/33, in : Das jüdische Echo 54 ( Oktober 2005 ), S. 125 – 139.
Otto Bauer : Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Wien 1907, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Iganz Brand ; Kat. Nr. 1.18.
Synopticus [Karl Renner] : Staat und Nation. Staatsrechtliche Untersuchung über die möglichen Principien einer Lösung und die juristischen Voraussetzungen eines Nationalitätengesetzes, Wien 1899 ; Kat. Nr. 1.12.
37
38
VO N D E R R E S I D E N Z S TA DT Z U M R OT E N W I E N Die Veränderungen in der Gemeindeverwaltung, 1918 – 1920 Therese Garstenauer Veronika Helfert
» Wien hat aufgehört ein Herrschaftszentrum zu sein. […] Das Gedränge der Exzellenzen in Wien löst sich, die feinsten Hofräte sind über Nacht schäbig, faillit und grau geworden, die große Karrière der Reichsbeherrschung gehört einer romantischen Vergangenheit an. « 1 Am 12. November 1918 wurde im Amtsblatt der bisherigen Reichshaupt- und Residenzstadt Wien die Kundgebung Kaiser Karls I. veröffentlicht, mit der er tags zuvor seine Regierungsgeschäfte zurückgelegt hatte. Wien verlor mit der Gründung der Repu blik seinen Status als Hauptstadt eines mächtigen Imperiums : Nunmehr erschien auch das Amtsblatt nur mehr als Amtsblatt der Stadt Wien. Damit ist eine Entwicklung angedeutet, die unter den Schlagworten der Demokratisierung und Modernisierung die Gemeindeverwaltung Wiens in der Nachkriegszeit nachhaltig verändern sollte. In diesem Sinne hielt der christlichsoziale Bürgermeister Richard Weiskirchner am Tag nach der Ausrufung der Republik eine Ansprache, in der er » im Geiste der Eintracht « ankündigte, » ohne Verzug die Verwaltung der Stadt auf eine breite demokratische Grundlage [zu] stellen «.2 Eine dieser Maßnahmen war eine Neuzusammensetzung des provisorischen Gemeinderats, da der bestehende nach dem Kurienwahlsystem gebildet worden war und die Stimmen der ( männlichen ) Wähler ungleich gewichtet hatte. In diesem Gemeinderat verschoben sich die Machtverhältnisse deutlich. Die Partei des Bürgermeisters war auf Kooperation angewiesen, da sie nur mehr eine knappe Mehrheit hatte. Unter den neuen Gemeinderäten waren auch erstmals zwölf Frauen, die – nicht immer entlang parteipolitischer Zugehörigkeiten3 – in der Folge frauenspezifische Belange von Gemeindebediensteten einbrachten.4 Der politische Umbruch führte zu einigen wichtigen Veränderungen, die von den verantwortlichen BeamtInnen
Von der Residenzs tadt zur Bundesh auptstadt
und GemeinderätInnen in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Richtung Demokratisierung und Modernisierung angestoßen wurden. Dazu zählten : die Abänderung der Gelöbnis formel, Personalveränderungen, die Einführung einer Dienst ordnung und die umfangreiche Wiener Verfassungs- und Verwaltungsreform. Eines der ersten Dinge, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit geändert wurden, war die Gelöbnisformel für neu eingestellte Gemeindebedienstete. Der Diensteid wurde durch ein » eidesstättiges Gelöbnis « ersetzt,5 das der » gegenwärtigen Verfassung des deutsch- österreichischen Staates « entsprang, wie es in einem Erlass an alle Leiter und Direktoren der städtischen Ämter und Unternehmungen im Jänner 1919 hieß.6 Diese Formel musste in den ersten Monaten immer wieder angepasst werden. In der Gelöbnisformel, die im April 1919 im Rahmen der neuen
Gelöbnis
Dienstordnung beschlossen wurde, gelobten die BeamtInnen » bei ihrer Treue und Ehre «, sich an die Gesetze und Verordnungen sowie die Verfassung der deutschösterreichischen Republik und an die Dienstordnung der Gemeinde Wien zu halten. Sie gelobten, ihre Amtsgeschäfte treu und gewissenhaft zu besorgen, Amtsgeheimnisse zu wahren und dem Bürgermeister sowie ihren direkten Vorgesetzten Gehorsam zu leisten. Alle Gemeinderäte mussten einen neuen Eid leisten, was nach der ersten Wahl am 4. Mai 1919 7 zum Gemeinderat in der neuen Republik zu einem kleinen Eklat führte. Die Republik war im November als ein » Bestandteil der Deutschen Republik « ausgerufen worden : In der Folge wurde auch im Wiener Gemeinderat über den » Deutschen Charakter Wiens « gestritten. Diese Debatten hatten kaum verhüllte antitschechische und antisemitische Züge, wie etwa die Gemeinderätin Anitta Müller-Cohen aufzeigte.8 In einer Gemeinderatssitzung am 23. Mai 1919 verlangten christlich soziale Abgeordnete die Absetzung jener acht Gemeinderäte der Tschechoslowakischen Partei, die bei ihrer Angelobung nicht nur Deutsch, sondern auch Tschechisch gesprochen hatten : Sie verwendeten den Satz » Slibuji, ich gelobe « statt » Ich gelobe «. Sie hätten damit den » deutschen Charakter Wiens « und die deutsche Verhandlungssprache im Gemeinderat verletzt. Auch wenn die Gemeinderäte letztendlich nicht ihr Amt verloren, zeigt diese Debatte deutlich, dass die Nationalitätenfrage nach dem Ende der Monarchie auch in der Stadtpolitik eine Rolle spielte.9
bei gleicher Leistung in den neuen Kollektivverträgen 1919 und 1920. Frauen wurden bei der Gemeinde Wien erst während des Kriegs angestellt, weswegen sie auch bis Ende der 1920er Jahre kaum in leitende Positionen gelangten.15 Angesichts des » Sturz des alten Systems «,16 wie es der spätere Wiener Vizebürgermeister Georg Emmerling ausdrückte, nach den Gemeinderatswahlen 1919 stellt sich die Frage, ob es zu parteipolitischen Umfärbungen des Personals gekommen ist. Das Quellenmaterial ist hier lückenhaft – Personalakten aus diesen Jahren sind vielfach nicht mehr vorhanden.17 In der Biografie des sozialdemokratischen Gemeinderats Paul Speiser heißt es aber : » Die ranghohen Magistratsbeamten waren […] natürlich Christlichsoziale. Viele mußten durch Beamte ersetzt werden, die bereit waren, der neuen demokratischen Gemeindeverwaltung ehrlich zu dienen. « 18 Alfred Billmaier, in der Zwischenkriegszeit freier Gewerkschafter, schätzte in einem Interview im Jahr 1962, dass 75 Prozent der städtischen Angestellten dem sozial demokratischen und 25 Prozent dem christlichsozialen Verband angehörten.19 Abgeordnete der christlichsozialen Partei warfen der sozialdemokratischen Gemeindeverwaltung regelmäßig vor, dass in städtischen Unternehmungen ( wie
Generell brachten die Gründung der Republik und der Machtwechsel keine großen personellen Veränderungen mit sich.10 Im Unterschied zum Bundesdienst kam es bei der Stadt Wien zu keinem Zwangsabbau. Im Jahr 1919 waren 54.777 Personen bei der Stadt Wien beschäftigt, und es wurde ein allgemeiner Aufnahmestopp ausgerufen.11 Von den Kriegsaushilfskräften – darunter viele Frauen – waren einige auf frei gewordene systemisierte Stellen nachgerückt.12 Etwa 1.000 von ihnen machten von dem Angebot Gebrauch, gegen Gewährung einer Abfertigung bis April 1919 freiwillig aus dem städtischen Dienst auszuscheiden.13 Dies entsprach dem allgemeinen Trend von Frauenarbeit, den Käthe Leichter nachgezeichnet hat : Viele Frauen wurden 1919 von heimkehrenden Soldaten aus ihren Stellen verdrängt, wobei sich bei der Beschäftigung von Frauen dennoch eine Verschiebung von sogenannten Frauengewerben in Richtung allgemeiner Berufszweige ergab.14 Zu den » frauenspezifischen « Themen, die die Gemeindeverwaltung nach dem Krieg beschäftigten, gehörten auch die Aufhebung des Eheverbots für Beamtinnen und die Festlegung von gleicher Bezahlung
Personalveränderungen
Die vom provisorischen Gemeinderat der Stadt Wien beschlossene Dienstordnung, 24. April 1919
Ludwig Wieden : Porträt von Jakob Reumann, erster sozialdemokratischer Bürgermeister von Wien, um 1920 ; Kat. Nr. 2.13.
39
40
etwa den Straßenbahnen ) jene Arbeiter, die in c hristlichen Gewerkschaften organisiert waren, schlechter behandelt und deren Versammlungen gestört würden.20 In welcher Form die Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit von städtischen Bediensteten Konsequenzen hatte, lässt sich mit dem Quellenmaterial nicht feststellen. Ein Beispiel für einen Personalwechsel, der mit dem politischen Machtwechsel korrelierte, ist aber der Posten des Magistratsdirektors. Karl Pawelka hatte diesen seit 1. November 1918 nur in der kurzen Übergangs periode inne. Er zog sich mit 30. Juni 1919 in den Ruhestand zurück, und Dr. Karl Hartl übernahm seine Funktion bis 1934.21 Eine deutliche Zäsur bedeutete die Allgemeine Dienstordnung für die Angestellten der Gemeinde Wien, die am 24. April 1919 – also bereits vor den Wahlen – vom Gemeinderat beschlossen wurde und die Dienstpragmatik aus dem Jahr 1911 ablöste. Bemerkenswert ist die enge Zusammenarbeit zwischen sozialdemokratischen und christlich sozialen Gemeinderäten, aber auch die Einbindung von VertreterInnen von Organisationen der städtischen Angestellten in das Komitee zur Beratung von Maßnahmen zugunsten
Die Dienstordnung von 1919
der Angestellten. Dieses bestand aus sieben Gemeinderäten und sieben VertreterInnen des Verbands der Angestellten der Stadt Wien. Präsident des Verbands war der Beamte des Rechnungsamts Hermann Schulz, der von 1920 bis 1926 auch sozialdemokratischer Nationalratsabgeordneter war. Der Gemeinderat, der die Dienstordnung beschlossen hatte, war in seiner Zusammensetzung allerdings bereits erheblich verändert, und die christlichsoziale Partei war bei einer Mehrheit von nur zwei Stimmen auf Kooperationen angewiesen. Die Angestellten der Stadt wurden nunmehr in neun Gruppen unterteilt, in Verbindung damit gab es neun Bezugsklassen. Den Angestellten wurden Teuerungszulagen gewährt, und die Ruhegenüsse wurden um 50 bis 100 Prozent erhöht. Das in weiterer Folge als » Wiener Schema « bezeichnete Gehaltssystem war im Vergleich mit der Besoldung der Bundesbediensteten großzügiger bemessen, auch in Bezug auf die Ruhegenüsse.22 Eine wichtige Neuerung war das ausdrückliche Recht der Angestellten auf Vertretung durch frei gewählte Personalvertretungen und die Standesorganisation, auf Koalitionsfreiheit und auf politische Betätigung außerhalb des Dienstes. Der Einfluss der Personalvertretung wurde durch die neue Dienstordnung – ein » neuzeitliches, dem gewerkschaftlichen Gedanken Rechnung tragendes Dienstrecht « 23 – gestärkt : Abänderungen der Dienstordnung konnten nur einvernehmlich mit der gemeinderätlichen Personalkommission beschlossen werden. Verhandlungen in Personalangelegenheiten wurden mit Gewerkschaftern geführt, namentlich mit jenen, » die die Mehrheit der in Betracht kommenden Angestellten « vertraten.24 In den ersten Jahren der Ersten Republik erlebte die Stadt Wien – auch infolge der geänderten politischen Machtverhältnisse – eine Verwaltungs- und Verfassungs reform. Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 26. Juni 1919 kündigte der sozialdemokratische Vizebürgermeister Emmerling im Zuge der Budgetdebatte eine umfassende Verwaltungsreform an. Die wesentlichen Änderungen, die mit dem Gemeindestatut vom April 1920 festgelegt wurden, betrafen die Organisation der Gemeindeverwaltung. Die einzelnen Magistratsabteilungen wurden jeweils in Verwaltungs gruppen zusammengefasst und einem vom Gemeinderat gewählten amtsführenden Stadtrat unterstellt.25 Die Zahl der Magistratsabteilungen wurde ( vor allem durch die Umwandlung von Bauämtern in solche ) von 22 auf 54 erhöht. Der bisherige Stadtrat wurde aufgelöst und durch einen Stadtsenat, zusammengesetzt aus acht amtsführenden Stadträten, ersetzt.26 Zwei von ihnen wurden zu Vizebürgermeistern bestimmt ( einer von der stärksten, der andere von
Verwaltungs- und Verfassungsreform
Plakat mit der Antrittsrede von Bürgermeister Jakob Reumann, 1919 ; Kat. Nr. 2.10.
der zweitstärksten Fraktion ). Der Stadtsenat hatte weniger Einfluss als der frühere Stadtrat, die nicht auf den Stadtsenat übergegangenen Funktionen übernahmen nun die zuständigen Gemeinderatsausschüsse. An diesen Ausschüssen waren nicht nur gewählte VertreterInnen beteiligt, sondern auch leitende Beamte, die das Recht hatten, zu den in Verhandlung stehenden Gegenständen Anträge zu stellen.27 Mit der Trennung Wiens von Niederösterreich, die 1920 beschlossen wurde und Anfang 1922 in Kraft trat, erhielt » die politische Majorität noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten «.28 Die Strategie der sozialdemokratischen Partei, durch die Einführung günstiger dienst- und besoldungsrechtlicher Bedingungen die BeamtInnenschaft auf ihre Seite zu bringen, dürfte im Wesentlichen aufgegangen
Resümee
1 2
3
4
5
6
7
8
9
Walther Rode : Wien und die Republik, Wien/Leipzig 1920, S. 6f. Die deutschösterreichische Republik. Ansprache des Bürgermeisters Dr. Richard Weiskirchner in der Sitzung des Wiener Gemeinderates vom 13. November 1918, in : Amtsblatt der Stadt Wien 27 ( 19. 11. 1918 ) 93, S. 2211. Siehe etwa den Redebeitrag der christlichsozialen Gemeinderätin Alma Seitz ( Motzko ): Gemeinderat. Stenographischer Bericht über die öffentliche Sitzung vom 6. Februar 1920. 18. Kollektivverträge, in : Amtsblatt der Stadt Wien 29 ( 18. 2. 1920 ) 14, S. 430 – 438. Vgl. Frauenbüro der Stadt Wien ( Hg.): Politikerinnen in Wien, 1848 – 2000, Bd. 1 : Einblicke, Texte von Susanne Feigl, Wien 2000, S. 46. Zum Unterschied zwischen Eid und Gelöbnis, speziell am Beispiel des Umbruchs von 1918, vgl. Therese Garstenauer : Diensteide und Gelöbnisse ehemaliger Bediensteter der Habsburgermonarchie 1918 – 1921, in : Hervé Bismuth, Fritz Taubert ( Hg.): Der Eid in der öffentlichen Verwaltung, Dijon ( erscheint 2019 ). Vgl. » Eidesstättiges Gelöbnis der Gemeindeangestellten «, in : Wiener Stadtund Landesarchiv, Magistratsdirektion A1 – Allgemeine Registratur 1. 5. 3, 417/1919. Bei dieser Wahl konnte die SDAP 100 von 165 Mandaten erreichen, Jakob Reumann übernahm das Bürgermeisteramt von Richard Weiskirchner. Vgl. Gemeinderat. Stenographischer Bericht über die Sitzung vom 6. März 1919. Punkt 24 Gemeindeverfassung, in : Amtsblatt der Stadt Wien 28 ( 15. 3. 1919 ) 22, S. 645 – 667. Vgl. Gemeinderat. Stenographischer Bericht über die Sitzung vom 23. Mai 1919. Anfrage der GR Dr. Kienböck, Kunschak und Vaugoin, in : Amtsblatt der Stadt Wien 28 ( 31. 5. 1919 ) 44, S. 1230f.
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
sein. Die nachhaltigen Verfassungs- und Verwaltungsreformen der unmittelbaren Nachkriegszeit haben in der ehemaligen Residenzstadt Erfolg gezeigt. Rückblickend befand Robert Danneberg im Jahr 1928 : » Die Art der Behandlung des Personals, das zunächst in seiner Mehrheit der neuen Verwaltung feindselig oder gleichgültig gegenüberstand, hat bewirkt, daß eine im allgemeinen arbeitsfreudige und gewissenhafte Angestelltenschaft herangezogen wurde, die auch eine Reihe von Reformen im inneren Verwaltungsdienst ermöglicht hat. « 29 Auch wenn diese Loyalität nicht in a llen Beschäftigtengruppen gleich stark war – im selben Bericht räumte Danneberg ein, dass etwa die LehrerInnen der sozialdemokratischen Verwaltung eher feindlich gegenüberstanden30 – , hatte das Rote Wien in seinen Angestellten doch eine wichtige Stütze.
Vgl. Brigitte Rigele : Beamtenelite im Wiener Magistrat zwischen 1918 und 1938, in : Wolfgang Weber, Walter Schuster ( Hg.): Biographien und Zäsuren. Österreich und seine Länder 1918 – 1933 – 1938, Linz 2011, S. 271 – 294, hier S. 292. Vgl. Robert Danneberg : Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien, Wien 1928, S. 29. Vgl. Die Gemeindeverwaltung der Bundeshauptstadt Wien in der Zeit vom 1. Juli 1919 bis zum 31. Dezember 1922, Wien 1927, S. 39. Vgl. Maren Seliger : Zu einigen Fragen der Verwaltungsorganisation der Stadt Wien in der 1. Republik, Vortragsmanuskript, Beiträge zur Verwaltungsgeschichte der Ersten Republik, Wien, 22.–23. 10. 1985, S. 25. Siehe dazu Käthe Leichter : Die Entwicklung der Frauenarbeit nach dem Krieg, in : dies., Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien (Hg.): Handbuch der Frauenarbeit in Österreich, Wien 1930, S. 28 – 42. Vgl. Anna Rabenseifner : Die Frau im öffentlichen Dienst, in : Handbuch der Frauenarbeit, S. 226 – 241, hier S. 237. Protokoll der Sitzung des Klub der Sozialdemokratischen Gemeinderäte, 21. 1. 1919, in : Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ( künftig : VGA ), Sozialdemokratische Parteistellen, Kt. 77, M. 459, S. 261. Auch Listen der zahlenden Parteimitglieder der Sozialdemokraten liegen nicht mehr vor. Vgl. Rigele, Beamtenelite, S. 272. Wolfgang Speiser : Paul Speiser und das Rote Wien, Wien/München 1979, S. 52. Vgl. Margareth Feiler : The Viennese Municipal Service, 1933 – 1950 : A Case Study in Bureaucratic Resiliency, New York 1964, S. 102. Siehe etwa : Gemeinderat. Stenographischer Bericht über die öffentliche Sitzung vom 13. Februar 1920. 13. Anfrage des GR Haider, in : Amtsblatt der Stadt Wien 29 ( 21. 2. 1920 ) 15, S. 480.
21
22
23 24 25 26
27
28
29 30
Vgl. Die Gemeindeverwaltung der Stadt Wien vom 1. Jänner 1914 bis 30. Juni 1919 unter den Bürgermeistern Dr. Richard Weiskirchner und Jakob Reumann, hg. v. Wiener Magistrate, Wien 1923, S. 17. Dieses Schema wurde in den folgenden Jahren auch in einigen größeren österreichischen Städten eingeführt. Vgl. Erich Pfaundler, Richard Gruber : Die Besoldungsverhältnisse der Beamtenschaft und die neue Entwicklung der Besoldungspolitik in Österreich, in : Wilhelm Gerloff ( Hg.): Die Beamtenbesoldung im modernen Staat, 2. Teil ( Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 184/2 ), München/Leipzig 1934, S. 111 – 183, hier S. 167f. Gemeindeverwaltung Bundeshauptstadt Wien ( 1919 – 1922 ), S. 128. Danneberg, Gemeinde-Verwaltung, S. 30. Vgl. Rigele, Beamtenelite, S. 274. Gab es 1919/20 noch zwei Stadträtinnen, die Sozialdemokratin Amalie Seidel und die Christlichsoziale Alma Seitz ( Motzko ), war nach der Wiener Gemeindeverwaltungsreform keine Frau mehr in der Position einer amtsführenden Stadträtin. Vgl. Anna Grünwald : Die Frau in der Gemeindeverwaltung, in : Handbuch der Frauenarbeit, S. 649 – 653. Vgl. Maren Seliger, Karl Ucakar : Wien. Politische Geschichte 1740 – 1934. Entwicklung und Bestimmungskräfte großstädtischer Politik, Teil 2 : 1896 – 1934, Wien/München 1985, S. 1037f. Karl Megner : Beamtenmetropole Wien 1500 – 1938. Bausteine zu einer Sozialgeschichte der Beamten vorwiegend im neuzeitlichen Wien, Wien 2010, S. 405. Danneberg, Gemeinde-Verwaltung, S. 36. Vgl. ebd., S. 31.
41
42
DIE FINANZP OLITIK D E S R OT E N W I E N Peter Eigner
Das Rote Wien erlangte internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung durch seine kommunale Wohnbautätigkeit und durch umfangreiche Reformen in der Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik. Ermöglicht wurde dies durch ein neues Finanzsystem, dessen Architekt der langjährige Finanzstadtrat der Gemeinde Wien Hugo Breitner1 war. Breitners Finanzpolitik, an » deflationistischen Maßnahmen und dem Prinzip des Budgetgleichgewichts orientiert « und stark von den Überlegungen Rudolf Goldscheids über eine durch umfängliche Steuerleistungen ermöglichte Finanzautarkie beeinflusst,2 basierte auf einer Reform des Steuerwesens, wobei die Umwandlung von indirekten, alle gleich belastenden Steuern in stark progressive direkte Steuern im Vordergrund stand. Des Weiteren beinhaltete sie die Einführung von Luxussteuern und den Verzicht auf Kreditaufnahme bzw. auf Gewinne der städtischen Unternehmungen.3 Die Ausgangssituation Wiens, Große Aufgaben, große Ausgaben : der nach 1918 übergroßen HauptDie Finanzgrundlagen stadt eines Kleinstaats, schien des Roten Wien verheerend. Die Zerstörung des
einheitlichen Wirtschaftsgebiets und seiner Arbeitsteilungen, der in Wien konzentrierte, aufgeblähte Verwaltungsapparat, die auf die Kriegsbedürfnisse eingestellte Produktion erwiesen sich als schwere Bürde, wobei diese ökonomischen Strukturprobleme in der unmittelbaren Nachkriegszeit von einer katastrophalen Versorgungslage und sozialem Elend überschattet wurden, begleitet von einer sich verstärkenden Inflation. Die Finanzverhältnisse Wiens waren desaströs, die Stadt » an einem Tiefpunkt ihrer bisherigen Entwicklung « – keine leichte Aufgabe für die im Mai 1919 mit absoluter Mehrheit gewählte neue sozialdemokratische Stadtverwaltung.4 Im Bund konnten den politischen Kräfteverhältnissen der Ersten Republik entspre-
chend5 nicht alle sozialdemokratischen Forderungen realisiert werden, doch was im Roten Wien kommen sollte, war, so Klaus Novy, eine » Revolution in der Finanzierung «.6 Bereits in seiner Antrittsrede vor dem Wiener Gemeinderat am 22. Mai 1919 hatte der neu gewählte Bürgermeister Jakob Reumann klargemacht, dass die großen s ozialpolitischen Aufgaben der Gemeinde große Ausgaben nach sich ziehen müssten.7 Finanziert werden sollte nicht mehr über den üblichen Anleiheweg, sondern sämtliche Ausgaben der Gemeinde sollten aus den laufenden Einnahmen eines stark progressiven Steuersystems gedeckt werden, wobei man von der Einhebung von Massensteuern, die Arme und Reiche gleichermaßen belasteten, abgehen wollte.8 Am 23. Juni 1919 legte Hugo Breitner sein erstes Budget als F inanzstadtrat vor.9 Zunächst hieß die dringlichste Aufgabe Budgetsanierung, und dazu musste man neue Steuerquellen erschließen, aber auch die in der Vorkriegszeit so scharf kritisierte Einnahmenpolitik der Christlichsozialen fortsetzen.10 Im Jahr 1913 stammten 50 Prozent der Einnahmen aus der Umlage auf die staatliche Mietzinssteuer, rund 30 Prozent aus dem Reingewinn der städtischen Monopolbetriebe, weitere zehn Prozent aus der Verzehrungssteuer.11 Diese Einnahmeposten hatten inflationsbedingt mehr und mehr an Bedeutung verloren, etwa die Mietzinssteuer, die 1923 abgeschafft wurde, bis 1922 aber noch einen beträchtlichen Teil der Budgeteinnahmen der Stadt ausmachte, während die Verzehrungssteuer 1921 nur mehr ein Prozent der Einnahmen einbrachte. Die großen städtischen Monopolunternehmen schließlich wiesen nach Kriegsende allesamt Defizite auf.12 Hatten Gas- und E-Werk, Straßenbahn usw. ihre Reingewinne bislang alljährlich der Gemeinde überweisen müssen, galt für die zukünftige Preispolitik das Prinzip der Kostendeckung, wobei dies zunächst mit deutlichen Tariferhöhungen einherging. Bei Gas- und E-Werken wurden schon relativ früh Überschüsse erzielt, die Straßenbahnen konnten zumindest ihr Defizit verringern.13
43
Somit war klar, dass neue Einnahmen erschlossen werden mussten. Zwischen 1919 und 1923 gestaltete Breitner das Wiener Finanz- und Steuersystem grundlegend um, nur in wenigen Fällen konnte auf bestehende Gesetze zurückgegriffen werden. Die Voraussetzung für die eigenständige Finanz- bzw. Steuerpolitik der Wiener Sozialdemokraten war die Stellung Wiens als unabhängiges Bundesland, die durch die Trennung von Niederösterreich am 1. Jänner 1922 erreicht wurde und wesentliche Vorteile mit sich brachte, so das Recht auf Anteile an den Bundessteuern als Land und als Stadt, das Recht, eigene Steuern einzuheben, und die Finanzhoheit über die Landeseinnahmen.14 Die öffentlichen Abgaben wurden ab 1923 in ausschließliche Bundesabgaben, zwischen Bund und Ländern ( Gemeinden ) geteilte Abgaben sowie in ausschließliche Landes- bzw. Gemeindeabgaben unterteilt, die Kompetenzen geregelt und nicht zuletzt die Grundlagen für einen Lastenausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gelegt.15 Ein großer Teil der wichtigsten Steuern wurde per Bundesgesetz zu Bundessteuern erklärt. Die Verteilung erfolgte nach den jeweiligen Steuererträgnissen. Erst
» A us den Mitteln der Wohnbausteuer « , Inschrift auf dem 1924/25 errichteten Gallhof in der Heiligenstädterstraße im 19. Bezirk, 2019 ; Foto : Nora Schoeller, Kat. Nr. 2.15.
das Finanzausgleichsgesetz von 1931 brach mit diesem Verteilungsprinzip, um das immer wieder heftige Kämpfe gefochten worden waren, und führte einen Lastenausgleich auf Kosten Wiens ein, der das Ende des Roten Wien ankündigte. Die Einnahmen Wiens bestanden nunmehr aus den Ertragsanteilen an bestimmten Bundessteuern, aus Zuschlägen zu einigen Bundesgebühren und schließlich aus jenen Steuern, die die Gemeinde Wien aufgrund ihrer eigenen Finanzhoheit als Bundesland einheben konnte.16 Auf Wien mit weniger als einem Drittel, 28,5 Prozent, der österreichischen Gesamtbevölkerung entfielen zunächst etwas mehr als die Hälfte aller Ertragsanteile, die an Länder und Gemeinden insgesamt gingen. In Wien wurden jedoch andererseits über 60 Prozent der an Bund, Länder und Gemeinden aufzuteilenden gemeinschaftlichen Bundesabgaben aufgebracht.17 Die eigenen Landes- und Gemeindesteuern bildeten zusammen mit den Bundesanteilen das neue Rückgrat der städtischen Finanzverwaltung. Als besonders dringlich erwies sich die Frage der Wohnungsversorgung, trotz einer starken Bevölkerungsabnahme
44
von rund 190.000 EinwohnerInnen war ein Zuwachs von rund 40.000 Haushalten festzustellen.18 Dieses scheinbare Paradoxon war auf die gestiegene Zahl an Eheschließungen bzw. Hausstandgründungen zurückzuführen oder da rauf, dass viele Abwanderer und Abwanderinnen Untermieter gewesen waren und sich die Zahl freier Wohnungen damit nicht erhöhte. Die gravierendste Ursache für den Wohnungsmangel bestand jedoch in der ökonomischen Krisensituation. Bereits während des Kriegs war es zu einem fast völligen Erliegen der Wohnbautätigkeit gekommen, die sich auch danach nicht zu erholen vermochte. Dafür mitverantwortlich war die 1917 kriegsbedingt beschlossene Mieterschutzverordnung, die vor willkürlicher Kündigung und Zinserhöhung schützte und zunächst lediglich eine Ausweitung der Verzin sung des Hausbesitzerkapitals verhindern sollte, nach Kriegsende inflationsbedingt aber zum beinahe vollständigen Verschwinden der Hausbesitzerrente führte. Deshalb hatte sich auch der Anteil der Aufwendungen für den Mietzins, den ein Arbeiterhaushalt zu entrichten hatte, von 25 bis 30 Prozent vor dem Krieg auf ein halbes Prozent seines Einkommens reduziert.19 Die Mieterschutzverordnung fand mit dem Mietengesetz vom 7. Dezember 1922 ihre Fortsetzung.20 Das Gesetz wurde in der Folge Gegenstand heftiger innenpolitischer Auseinandersetzungen und Wahlkämpfe, war aber bis zum Jahr 1929 unverändert in Kraft. Kardinalproblem blieb die Finanzierung des Wohnbaus. Auch hier sollte eine Steuer die Lösung bieten. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20. Jänner 1923 über die Einführung einer zweckgebundenen, stark progressiv gestaffelten Wohnbausteuer wurde in der Folge die hauptsächliche Finanzierungsquelle für die Errichtung der Gemeindebauten geschaffen.21 Das anfängliche Budgetchaos und -defizit konnte mittels des geldwertstabilen Steuersystems beseitigt und saniert werden. Die Gemeindefinanzen wiesen ab Juli 1921 eine aktive Gebarung aus. Oberstes finanzpolitisches Ziel war die Herstellung, später die Bewahrung eines Haushaltsgleichgewichts. Breitners Finanzpolitik begann notgedrungen als Sparpolitik, blieb dies aber auch danach. Der Anteil der Gemeindeabgaben an den Budgeteinnahmen entwickelte sich stark steigend auf ein Niveau von über 50 Prozent an den Steuereinnahmen der Gemeinde im Jahr 1922, auf dem es sich dann konsolidierte.22 Es waren die sogenannten Breitner-Steuern, die die Gemüter erhitzten und parteipolitisches Streitthema waren – und dies, obwohl etliche Breitner-Steuern ( wie die Fürsorgeabgabe ) auch in den Bundesländern eingeführt wurden. Im Folgenden soll insbeson-
Die Steuerpolitik — ein Eckpfeiler im » B reitnerSystem « : Versuch einer Neubewertung
dere dem Aspekt der Verteilungswirkung der Abgaben nachgegangen werden, der Frage der spezifischen Belastung der Wirtschaft und verschiedener Bevölkerungsschichten. Wen traf das Steuersystem besonders ? Kann man von sozialer Umverteilung sprechen ? Drei Arten von Steuern können unterschieden werden :23 1. Luxussteuern ( Steuern auf Luxus und besonderen Aufwand ) Pferdeabgabe Hauspersonalabgabe Luxuswarenabgabe ( nach Einführung der alle gleich belastenden Warenumsatzsteuer 1923 aufgelassen ) Nahrungs- und Genussmittelabgabe ( durch Novellierung Umschichtung der Steuerbelastung zugunsten von » Nobelbetrieben «) Abgabe auf den Verbrauch von Bier ( ab 1926 ) Kraftwagenabgabe ( bis 1931, danach Kompetenz des Bundes ) Hundeabgabe Lustbarkeitsabgabe 2. B oden- und Mietsteuern Wertzuwachsabgabe Wohnbausteuer Grundsteuer 3. Betriebs- und Verkehrssteuern Fürsorgeabgabe Konzessionsabgabe Fremdenzimmerabgabe Ankündigungsabgabe Anzeigenabgabe Abgabe von freiwilligen Feilbietungen Wasserkraftabgabe Feuerwehrbeitrag
Luxussteuern statt Massensteuern, lautete die sozialdemokratische Maxime, die einzige Massensteuer, so wurde propagiert, war die neue Wohnbausteuer. Benedikt Kautsky sprach von der » Besteuerung des Luxus in all seinen Formen «, Ziel dieser Politik war die Entlastung der breiten Masse.24 Dem entsprach, dass die meisten Steuern, wie die Wohnbausteuer, stark progressiv gestaffelt waren. Die Hauspersonalabgabe betraf aus sozialen Erwägungen nur Haushalte mit zwei und mehr Hausangestellten, rund 7.000 Haushalte, von denen 5.000 nur zwei Bedienstete hatten ( was sie jährlich vier Schilling kostete ).25 Auch die einfachen Wirts- und Kaffeehäuser wurden nicht besteuert. Strittig blieb die Frage, was Luxus war. Bier zu trinken, war beispielsweise sicher kein Luxus. Die Christlichsozialen beklagten die Luxussteuern und beschworen den
Untergang der Wirtschaft, die Sozialdemokraten brüsteten sich damit und schürten übertrieben den Klassenkampf. Die Luxussteuern wurden zum Symbol beider politischer Lager – verglichen mit ihrer eigentlichen ökonomischen Bedeutung bzw. ihre Umverteilungswirkung weit überhöht. Die mit den steuerlichen Maßnahmen verbundene soziale Umverteilung, auch wenn sie tatsächlich eher gering ausfiel, machte Finanzstadtrat Hugo Breitner zum meistgehassten Politiker der Ersten Republik, gegen den » antisemitische Kampagnen sondergleichen « lanciert wurden.26 Sein Steuersystem wurde als » Steuerbolschewismus « oder » Steuersadismus « bezeichnet, die Gemeinde bzw. das Wiener Finanzreferat als » Steuervampire «. Von einer » wirtschaftsmordenden Steuerpolitik des Stadtrats Breitner « sprach Leopold Kunschak.27
» B reitner Steuern « , Wahlplakat der SDAP, 1927 ; Entwurf : Victor Theodor Slama, Kat. Nr. 2.14.
Mit eindrucksvollen, aber zweifellos dick aufgetragenen Vergleichen beschrieb hingegen Finanzstadtrat Breitner selbst seine Steuerpolitik – sozialdemokratische Propaganda par excellence : » Die Steuer der Nachtlokale und Bars ist so groß, daß wir damit die Kosten der Schülerausspeisung decken können. […] Die Betriebskosten der Kinderspitäler decken die Steuern aus den Fußballspielen, die Betriebskosten der Schulzahnkliniken liefern die vier größten Wiener Konditoreien, Demel, Gerstner, Sluka und Lehmann. Die Schul ärzte zahlt die Nahrungs- und Genußmittelabgabe des Sacher. […] Das städtische Entbindungsheim wurde aus den Steuern der Stundenhotels erbaut und seine Betriebskosten deckt der Jockey-Klub mit den Steuern aus den Pferderennen […]. « 28 Dem politischen Usus der Zeit entsprechend schürte B reitner damit auch den Kampf von Arm gegen Reich, den der Besitzlosen gegen die Besitzenden, etwas, was dem bürgerlichen Lager Angst machte bzw. es in seinen Befürchtungen bestärkte. Radikale Rhetorik stand gegen gemäßigte Praxis. Wie sah es nun realiter aus, was brachten die Steuern für Erträge, wer bezahlte die Steuern ? In der geschichtswissenschaftlichen Literatur überwiegt die Einschätzung einer deutlichen Entlastung der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums, die vor 1919 besonders hart von der hohen Mietsteuer und hohen Preisen für Wasser, Gas usw. betroffen waren. Diese Kosten waren jetzt deutlich geringer. Wer nun aber in welchem Ausmaß belastet wurde, ist schwer zu beurteilen, sogar die einfache Einteilung in Besitz- bzw. direkte Steuern und in Massen- bzw. indirekte Steuern ergibt nur bedingt Sinn : Die Wohnbausteuer und die Wasserkraftabgabe hatten alle zu entrichten, Erstere war aber stark progressiv gestaffelt und demzufolge eine Besitz- und Massensteuer. 82 Prozent der Mietobjekte zahlten nur 22 Prozent des Wohnbausteueraufkommens, 0,55 der Mietobjekte ( 4 82 Wohnungen und 2.944 Geschäftslokale ) mussten 45 Prozent aufbringen, wobei selbst die teuersten Wohnungen nur 37 Prozent der Vorkriegsmiete bezahlen mussten.29 Trotz Wohnbausteuer machte die Mietbelastung eines Arbeiterhaushalts im kommunalen Wohnbau im Schnitt nur vier Prozent seines Einkommens aus.30 Insgesamt trugen die eigentlichen Luxus steuern im Durchschnitt der Jahre 1926 bis 1929 wie die Boden- und Mietsteuern ungefähr ein Viertel der Steuereinnahmen bei, die Betriebsund Verkehrssteuern die H älfte.31 Ertragreich
45
46
war die gestaffelte Lustbarkeitsabgabe auf Theater, Konzerte, sportliche Vorführungen, Kinos bzw. Lichtspieltheater, die ihren Höhepunkt 1928 mit 17,2 Millionen Schilling erreichte, ab 1931 drastisch fiel, bis 1933 auf zehn Millionen. Hier zahlte das › einfache Volk ‹ sicherlich mit, der Kinobesuch ( die Hälfte der Lustbarkeitsabgabe entfiel allein darauf)32 war sogar höher besteuert als das Theater oder Konzerte, nicht zuletzt um ArbeiterInnen zu dieser › höheren ‹ Art des Kulturkonsums zu bewegen. Die Nahrungs- und Genussmittelabgabe galt für » Luxusbetriebe « mit höheren Preisen, besserer Ausstattung und hohem Komfort. Sie betraf 1928 rund 18 Prozent der Gasthäuser, 25 Prozent der Kaffeehäuser, 27 Prozent der Zuckerbäcker, aber nur 0,5 Prozent der Lebensmittel- und Delikatessenhändler bzw. der Fleischhauer, ein kleiner Bruchteil bezahlte den Höchstsatz von 15 Prozent.33 Sie erreichte ihren Höhepunkt 1928 mit 16,2 und 1929 mit 17,1 Millionen Schilling, erbrachte 1933 nur mehr 4,7 Millionen Schilling und wurde 1934 aufgehoben. Die Biersteuer fuhr trotz Einnahmen von rund zehn Millionen Schilling jährlich seit ihrer Einführung im Jahr 1927 bis 1930 defizitäre Ergebnisse
» A us den Mitteln der Wohnbausteuer « , Inschrift auf dem 1926 errichteten Gemeindebau in der Thaliastraße im 16. Bezirk, 2010 nach dem ehemaligen Ottakringer Bezirksvorsteher Josef Srp benannt, 2019 ; Foto : Nora Schoeller, Kat. Nr. 2.15.
ein. Die Kraftwagenabgabe kam auf Erträge zwischen vier und fünf Millionen jährlich, sie wurde – ohnehin von sinkender Bedeutung – im Mai 1931 der Gemeinde vom Bund entzogen. Die Hauspersonalabgabe erbrachte um die zwei Millionen Schilling jährlich, mit ab 1926 sinkender Tendenz, und wurde 1934 aufgelassen. Kaum Bedeutung erlangten die Pferdeabgabe, die Hundeabgabe ( rund eine Million jährlich ) und die nur kurze Zeit bestehende Luxuswarenabgabe. Ein annähernd gleicher Anteil an den Gemeindeabgaben wie auf die Luxussteuern entfiel auf die Boden- und Mietsteuern ( mit Ausnahme von 1923 und 1933 ), wobei rund drei Viertel der Einnahmen aus der Anfang 1923 beschlossenen Wohnbausteuer stammten. Ihr Ertrag ( Einnahmen von jährlich 35 Millionen Schilling ) wurde zur Gänze dem Wohnbau gewidmet, und die Wohnbausteuer wurde neben der Fürsorgeabgabe zur zweitstärksten Einnahmequelle der Gemeinde ( infolge der Wirtschaftskrise zuletzt sogar die wichtigste ). Nennenswerten Ertrag sicherten auch die Wertzuwachssteuer ( zwischen sechs und elf Millionen Schilling jährlich ; sie behinderte die Spekulation und drückte die Bodenpreise und wurde von eher
vermögenderen Bevölkerungsteilen entrichtet ) und die 1929 eingeführten Bodenwertabgaben von verbautem und unverbautem Grund.34 Auf die Betriebs- und Verkehrssteuern entfiel bis auf das Jahr 1933 der höchste Anteil an den Einnahmen. Bis auf die Wasserkraftabgabe waren alle diese Steuern von den Betrieben zu entrichten.35 Die Fürsorgeabgabe war eine Lohnsummensteuer, Industrie und Gewerbe mussten vier, Banken acht Prozent ihres Lohnaufkommens an die Gemeinde abführen. Sie entwickelte sich zur stärksten Einnahmeart der Steuereinnahmen der Gemeinde, 1920/21 entfielen auf sie zunächst nur 8,5 Prozent, 1922 bereits 25 Prozent.36 Ab 1923 entfielen auf die Fürsorgeabgabe im Durchschnitt 37 Prozent der Gemeindeabgaben bzw. 80 Prozent der Betriebs- und Verkehrssteuern.37 Ihre Erträge beliefen sich zwischen 1924 und 1931 auf 65 bis 69 Millionen Schilling. Ob die Vorschrift, die von den Unternehmern zu entrichtende Abgabe nicht auf die ArbeitnehmerInnen zu überwälzen, eingehalten wurde, ist schwer nachweisbar. Nach Charles A. Gulick versuchten die Unternehmer, » wenn immer möglich «, die Abgabe auf die Konsumenten abzuwälzen.38 Felix Czeike bezeichnet die Fürsorgeabgabe als » keine ideale Steuer, aber unentbehrlich «.39 Sie wurde von der Opposition für die steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht, hätte » produktionsverwüstende Wirkungen «.40 Die Erträge der sonstigen Betriebs- und Verkehrssteuern beliefen sich im Fall der Fremdenzimmerabgabe anfangs auf sechs, dann auf vier bis fünf Millionen Schilling jährlich, die Anzeigenabgabe erbrachte drei bis fünf Millionen jährlich, die heftig bekämpfte Wasserkraftabgabe zwei bis vier Millionen, der Feuerwehrbeitrag zwei bis 3,8 Millionen. Drei der genannten Steuern – Wasserkraftabgabe, Wohnbausteuer und Biersteuer – wurden zweckgebunden eingehoben, dienten dem Bau von Wasserkraftwerken zur Versorgung Wiens mit elektrischem Strom, dem Wohnbau bzw. wurden der Arbeitslosennotstandsunterstützung zugeführt. Die Wasserkraftabgabe verstieß als indirekte Steuer gegen die sozialdemokratischen Prinzipien, aufgrund des begrenzten Abnehmerkreises von Gas und Strom dürften die unteren Sozialschichten jedoch kaum stärker belastet worden sein.41 Die Fürsorgeabgabe, die Nahrungs- und Genuss mittelabgabe, die Hauspersonal-, Kraftwagen- und Pferde abgabe, besonders aber die Wasserkraftabgabe und die Wohnbausteuer bildeten die Hauptangriffspunkte der Opposition. Zahlreiche Novellierungen, die einerseits soziale Härten milderten, andererseits Entgegenkommen signalisieren sollten, prägten die Jahre bis 1929. Danach wirkten sich die Weltwirtschaftskrise und die hausgemachte Krise deutlich auf die Erträgnisse der Gemeinde aus. 1934 wurde dann auf die Hauspersonal-, Nahrungs- und Genussmittel- und Pferdeabgabe verzichtet, die Kraftwagenabgabe war inzwischen vom Bund
in Anspruch genommen worden, die Fürsorgeabgabe wurde jedoch weiter eingehoben und die Wohnbausteuer lediglich dem Namen nach verändert, allerdings unter Aufhebung ihrer Zweckbestimmung.42 Eine von Maren Seliger und Karl Ucakar durchgeführte Budgetanalyse von 1923 bis 1933 43 zeigt auf der Einnahmenseite ein Sinken der Einnahmen bereits ab 1929, verstärkt ab 1931 als Folge der Weltwirtschaftskrise und der Reduktion der Ertragsanteile Wiens im Rahmen des Finanz ausgleichs44 . Der Rückgang der Wiener Ertragsanteile von über 50 auf 37,3 Prozent 1931 und schließlich 30,2 Prozent 1933 stellte für die Stadt eine schwere Benachteiligung dar. 1933 beliefen sich die Ertragsanteile nur mehr auf ein Drittel des Werts von 1929. Auf die eigenen Landes- und Gemeindeabgaben entfielen jährlich zwischen 42 und 45 Prozent der Bruttoeinnahmen, auf die Einnahmen aus Ertragsanteilen zwischen 23 und 33 Prozent ( mit einem starken Rückgang bis 1933 auf 13 Prozent ). Die Summe aller Steuereinnahmen bewegte sich bis 1931 zwischen 71 und 75 Prozent der Gesamteinnahmen und verringerte sich bis 1933 auf 54 Prozent. Bei den christlichsozialen Vorgängern hatte der Steuereinnahmenanteil an den Einnahmen insgesamt nur zwischen 30 und 40 Prozent betragen. Unter den Steuereinnahmen › überrascht ‹ ein relativ geringer Anteil der sogenannten Luxussteuern an den Gemeindesteuern insgesamt, so entfielen auf Luxussteuern zwischen einem Fünftel und einem Viertel der Steuereinnahmen, 1933 nur mehr 15,7 Prozent.45 An den Bruttoeinnahmen der Gemeinde machte der Anteil der Luxussteuern rund zehn Prozent aus und würde bei strengerer Definition auf sieben Prozent sinken. Seliger und Ucakar versuchten auch eine Schätzung der sozialen Verteilungswirkung der Gemeindesteuern, wobei das Problem der Steuerüberwälzung so berücksichtigt wurde, dass die Fürsorgeabgabe je zur Hälfte als Massenbesteuerung bzw. als Besteuerung von Besitz oder eines höheren Lebensstandards gewertet wurde, die anderen Betriebs- und Verkehrssteuern mit Ausnahme der Fremdenzimmerabgabe jedoch zur Gänze als Massensteuern angesehen wurden.46 Demnach erfassten etwas mehr als die Hälfte der Gemeindesteuern Besitz, überdurchschnittliche Lebensführung und Unternehmergewinne. Bezogen auf die Bruttoeinnahmen der Gemeinde waren dies ungefähr 25 Prozent. Als oberstes Ziel der Steuerpolitik, so das Wiener Wahlhandbuch der Sozialdemokratie 1932, galt die » Erfassung der Besitzenden der Stadt « bei » möglichste[r] Schonung der Arbeiter und Angestellten «.47 War dieses Ziel erreicht worden ? Etwas mehr als die Hälfte der Steuerlast der eigenen Steuern war den Besitzenden auferlegt worden, den Rest hatte die Mehrheit der Bevölkerung zu tragen. Im Vergleich zur christlichsozialen Einnahmenpolitik war es den Sozialdemokraten gelungen, eine Umschichtung der Steuerlasten ( von
47
48
Massen- zu Besitzsteuern, im Gegensatz zum Bund ) durchzusetzen. Vielen ging diese Umverteilung zu weit, andere kritisierten den zu geringen Umfang der Reformen. Der Kritik des bürgerlichen Lagers an der Steuerpolitik der Gemeinde, an » Steuersadismus « und » Steuerbolschewismus « kann entgegengehalten werden, dass die Steuerbelastung nicht höher als vor dem Krieg 1913 war.48 Dennoch waren die Klagen über den zunehmenden Steuerdruck nach dem Krieg weit größer, waren auch Ausdruck der parteipolitischen Polarisierung von Sozialdemokraten und Christlichsozialen. Radikale Rhetorik war das eine, die Praxis jedoch oft eine andere. So wurde die vom Bund der Gemeinde zuerkannte Höchstgrenze der Belastung bei der Fürsorgeabgabe bei Weitem nicht ausgeschöpft, bei einigen Abgaben waren im Fall von getätigten Investitionen Steuernachlässe vorgesehen, auch aus Anlass der Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre kam es zu Steuerermäßigungen.49 Es ist zudem auffällig, dass die steuerliche Belastung der Besitzenden nicht in dem Ausmaß erfolgte, wie die Selbstdarstellung der Partei es nahelegen möchte.50 Auch hier übertünchte radikale Rhetorik eine mildere Praxis. Die Wirtschaftspolitik Breitners war eher konservativ und am Sparen orientiert als keynesianisch oder gar radikal. Unter Berücksichtigung der objektiven Gegebenheiten bzw. Möglichkeiten war das Resultat – das, was die Gemeinde mit den Einnahmen machte – beeindruckend. Der kommunale Wohnbau und die sozialpolitischen Maßnahmen des Roten Wien hatten internationales Auf sehen erregt. Der Ausgabenschwerpunkt der sozialdemokratischen Kommunalverwaltung lag eindeutig im Bereich der sozialen Infrastruktur, auf dem Wohnhaus- und Siedlungsbau und den Ausgaben für Bildung und Fürsorge.51 Insgesamt lagen die Ausgaben für die soziale Infrastruktur zwischen 1924 und 1932 bei rund 60 Prozent der Gesamtausgaben. Dieser Budgetschwerpunkt verdeutlicht den politischen Anspruch der sozialdemokratischen Verwaltung, das Lebensniveau der Mehrheit der StadtbewohnerInnen verbessern zu wollen.52 Folge der kommunalen Bautätigkeit war vor allem eine Verbesserung des Wiener Wohnungsstandards. Aus meiner Sicht ist Wolfgang M aderthaner bei zupflichten, wenn er vom Roten Wien als » einem der außergewöhnlichsten, kreativsten und mutigsten kommunalen Experimente der neueren europäischen Geschichte « spricht,53 trotz aller berechtigten Kritik, die in den letzten Jahrzehnten zu einzelnen Aspekten geäußert wurde. Ermöglicht wurde dieses Experiment durch eine neu konzipierte kommunale Finanz- und Steuerpolitik. Auch an dieser können einzelne Maßnahmen kritisiert, kann an einzelnen Pfeilern gerüttelt werden, gescheitert ist sie nicht an sich selbst, sondern am Einsetzen der Weltwirtschaftskrise ab 1929, an der verschärf-
Fazit
ten parteipolitischen Polarisierung, die für Wien eine empfindliche Niederlage im Verteilungsschlüssel brachte und dem kommunalen Wohnbau ein Ende bereitete, und an den neuen ( innen )politischen Gegebenheiten nach 1934.54 Finanzstadtrat Breitner war im Herbst 1932 aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 und der Suspendierung der Demokratie nahmen eine Reihe von Notverordnungen, die auf die finanzielle Austrocknung der Stadt abzielten, » definitiv den Charakter eines bewussten und strategisch angelegten finanziellen Vernichtungsfeldzuges gegenüber Wien an «.55 Die Rhetorik war nunmehr auch auf bürgerlicher Seite radikal und unmissverständlich : » Wir müssen der Gemeinde Wien, die auf Kosten der Allgemeinheit sich fettgefüttert hat, wir müssen ihr die ungerechten Mittel entziehen. Sie muss die Suppe auslöffeln, wenn sie nicht mehr können, werden wir zur Stelle sein. « 56 Und sie konnte bald nicht mehr : Einige Steuer- und Tariferhöhungen ( Gas- und Strom bzw. Bodenwertabgabe ), Kürzungen und Einsparungen konnten vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise nur den absoluten Zusammenbruch der Gemeindefinanzen verhindern, vor allem die Investitionsausgaben waren drastisch reduziert worden, an eine Weiterführung des kommunalen Wohnbaus war nicht zu denken, die Wohnbausteuer wurde ihrer Zweckgebundenheit enthoben und zu circa 50 Prozent zur Abwendung des Zusammenbruchs der Gemeindefinanzen herangezogen. Das Experiment Rotes Wien war an ein Ende gelangt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Hugo Breitner ( 1873 – 1946 ) wurde 1919 als Stadtrat führender Finanzpolitiker der Gemeinde Wien und war ab Juni 1920 amtsführender Stadtrat für das Finanzwesen. 1932 trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück. Eine Biografie Breitners liegt von Wolfgang Fritz vor : Wolfgang Fritz : Der Kopf des Asiaten Breitner. Politik und Ökonomie im Roten Wien. Hugo Breitner – Leben und Werk, Wien 2000. Zu Breitner vgl. auch Wolfgang Maderthaner : Hugo Breitner, Julius Tandler – Architekten des Roten Wien, in : VGA Dokumentation ( 1997 ) 2. Wolfgang Maderthaner : Von der Zeit um 1860 bis zum Jahr 1945, in : Peter Csendes, Ferdinand Opll ( Hg.): Wien. Geschichte einer Stadt, Bd. 3 : Von 1790 bis zur Gegenwart, Wien/Köln/Weimar 2006, S. 353. Vgl. Hans Hautmann, Rudolf Hautmann : Die Gemeindebauten des Roten Wien, Wien 1980, S. 39 ; Maderthaner, Von der Zeit, S. 353. Dazu insgesamt Gerhard Reisinger : Die Finanzpolitik Hugo Breitners. Entstehung und Ausformung des neuen Wiener Steuersystems in der Ersten Republik, Diss. WU Wien 1990. Zur Steuerpolitik von Hugo Breitner selbst : Kapitalistische oder sozialistische Steuerpolitik – wer soll die Steuern bezahlen ?, Wien 1926 ; SeipelSteuern oder Breitner-Steuern ? Die Wahrheit über die Steuerpolitik der Gemeinde Wien, Wien 1927. Maren Seliger, Karl Ucakar : Wien. Politische Geschichte. Entwicklung und Bestimmungskräfte großstädtischer Politik, Teil 2 : 1896 – 1934, Wien 1985, S. 1057. Die Republik wurde zunächst von einer Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten ( SDAP ) und Christlichsozialen ( CS ) regiert, den Wahlen im Oktober 1920 folgte eine bürgerliche Koalitionsregierung, die SDAP war danach nie mehr Mitglied einer Regierung in der Ersten Republik. Klaus Novy : Der Wiener Gemeinde wohnungsbau: » Sozialisierung von unten «, in : Arch+ ( Juli 1979 ) 45, S. 9 – 25, hier S. 15 ; Alfred Georg Frei : Austromarxismus und Arbeiterkultur. Sozialdemokratische Wohnungs- und Kommunalpolitik im » roten « Wien 1919 – 1934, Konstanz 1981, S. 58. Dazu und im Folgenden : Franz Patzer : Streiflichter auf die Wiener Kommunalpolitik 1919 – 1934 ( Wiener Schriften, H. 40 ), Wien/München 1978, S. 11f. Vgl. ebd., S. 16. Zu den Anleihen im Detail vgl. Felix Czeike : Wirtschaftsund Sozialpolitik der Gemeinde Wien in der Ersten Republik ( 1919 – 1934 ), Teil 1 ( Wiener Schriften, H. 6 ), Wien 1958, S. 127 – 142. Vgl. Fritz, Der Kopf des Asiaten Breitner, S. 119 – 121. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1058. Vgl. Czeike, Wirtschafts- und Sozialpolitik 1, S. 15. Dazu und im Folgenden : Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1059.
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22 23
24 25
26
27 28 29
30 31
32 33 34 35 36 37
Die übrigen Gemeindebetriebe ( z. B. städtische Bäckereien, Friedhofsgärtnereien ) wurden kommerziell, also auf Gewinn abzielend, geführt und standen teilweise in Konkurrenz zu Privatunternehmen. Vgl. Hautmann, Hautmann, Gemeindebauten, S. 34 – 37, S. 1060 ; Patzer, Streiflichter, S. 19. Vgl. im Folgenden : Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1063 – 1065. Vgl. Patzer, Streiflichter, S. 18. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1065 ; Frei, Austromarxismus, S. 70. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1067. Dazu ausführlich: Rainer Bauböck : Zur sozialdemokratischen Wohnungspolitik 1919 – 1934, Wien 1976. Vgl. Robert Danneberg : Der Kampf gegen die Wohnungsnot, Wien 1921, S. 13. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1068. Doch deckte die Wohnbausteuer nur etwa 40 Prozent der gesamten Baukosten. Vgl. Charles A. Gulick : Österreich von Habsburg zu Hitler, Bd. 2, Wien 1938, S. 134. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1060. Diese Dreiteilung findet sich ursprünglich bereits bei Robert Danneberg : Steuersadismus ? Streiflichter auf die rote Rathauswirtschaft, Wien 1925, zit. n. Reisinger, Die Finanzpolitik, S. 20. Benedikt Kautsky : Volkswirtschaft, in : Arbeit und Wirtschaft 2 ( 1924 ), Sp. 70. Vgl. Fritz, Der Kopf des Asiaten Breitner, S. 154. Bei den Rothschilds belief sich die Hauspersonalabgabe im Jahr 1931 hingegen auf fast 300.000 Schilling. Vgl. Patzer, Streiflichter, S. 20. Maderthaner, Von der Zeit, S. 354f. Berühmt etwa die Forderung des Innenministers und Heimwehrführers Ernst Rüdiger Starhemberg, erst wenn der » Kopf des Asiaten « in den » Sand rollen « würde, wäre » der Sieg unser «. Fritz, Der Kopf des Asiaten Breitner, S. 313. Leopold Kunschak : Der Wirtschaftsmord des Wiener Rathauses, Wien 1930, S. 2. Breitner, Seipel-Steuern, S. 12f. Vgl. Frei, Austromarxismus, S. 93. Nach Robert Danneberg : Zehn Jahre Neues Wien, Wien 1929, S. 21 ( zit. n. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1086 ), machte die allgemeine Wohnbausteuer bei den Luxuswohnungen 11,3 bis 26,6 Prozent des Vorkriegszinses aus. Vgl. Frei, Austromarxismus, S. 94. Vgl. Reisinger, Die Finanzpolitik, S. 20. Die jährlichen Erträge der einzelnen Steuern finden sich u. a. bei Czeike, Wirtschafts- und Sozialpolitik 1, S. 60 – 106. Vgl. Fritz, Der Kopf des Asiaten Breitner, S. 290. Vgl. Czeike, Wirtschafts- und Sozialpolitik 1, S. 68. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1087. Vgl. ebd., S. 1087f. Vgl. ebd., S. 1061. Vgl. ebd., S. 1088.
38 39 40 41 42 43 44 45
46
47
48
49 50 51 52
53 54
55
56
Gulick, Österreich 2, S. 22. Czeike, Wirtschafts- und Sozialpolitik 1, S. 86. Stenographische Berichte über die Sitzungen des Gemeinderates 1927, 6671, zit. n. ebd. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1062. Vgl. Czeike, Wirtschafts- und Sozialpolitik 1, S. 61. Dazu und im Folgenden : Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1082 – 1095. Vgl. Czeike, Wirtschafts- und Sozialpolitik 1, S. 107 – 125. Dazu und im Folgenden : Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1084f. Eine Beurteilung von Breitners Finanzpolitik und ein Überblick über die in der Literatur unterschiedlichen Schätzungen der Anteile von Besitz- bzw. Massensteuern findet sich bei Reisinger, Die Finanzpolitik, S. 392 – 404, bes. S. 402f. Dazu und im Folgenden : Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1089. Gulick, Österreich 2, S. 24, kommt auf einen höheren Wert von 60 Prozent, da er die Luxussteuern zur Gänze als solche gelten lässt. Wiener Wahlhandbuch 1932, H. B, S. 71, zit. n. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1253. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1095 ; Czeike, Wirtschaftsund Sozialpolitik 1, S. 23. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1088. Vgl. ebd., S. 1121. Dazu und im Folgenden : ebd., S. 1096. Vgl. ebd., S. 1221. Diese Schwerpunktsetzung wurde durch die bereits von den Christlichsozialen stark ausgebaute Infrastruktur ( Schulen, Kanalisation, Wasserversorgung ) erleichtert, zugleich › ersparte ‹ die nicht vorhandene Wachstumsdynamik Ausgaben in der technischen Infrastruktur. Vgl. Maderthaner, Von der Zeit, S. 361. Das neue Regime unterzog das Breitner’sche Steuersystem einer Totalrevision, schaffte etliche Steuern ab bzw. modifizierte sie drastisch. Vgl. Wien im Aufbau. Drei Jahre Neues Wien, Wien 1937, S. 23, zit. n. Maderthaner, Von der Zeit, S. 478f. Maderthaner, Von der Zeit, S. 446. Vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1093. Walter Goldinger ( Hg.): Engelbert Dollfuß. Protokolle des Klubvorstandes der Christlichsozialen Partei 1932 – 1934 ( Studien und Quellen zur österreichischen Zeitgeschichte, Bd. 2 ), Wien 1980, S. 280. Zu den Auswirkungen einzelner Notverordnungen vgl. Seliger, Ucakar, Wien. Politische Geschichte, S. 1093f.
49
50
» ES LEBE DRUM : D I E FR AU VO N H E U T ! « Frauenpolitik im Roten Wien Marie-Noëlle Yazdanpanah
» Sie kennt den Weg und auch das Ziel / Und ist kein Püppchen mehr zum Spiel ! / Sagt frei heraus, was ihr nicht paßt, / Macht sie darob sich auch verhaßt. // Ist lebensfroh und ungeniert, / Verlangt ganz keck, was ihr gebührt ! / Und kennt das Leben und die Leut. / Es lebe drum : Die Frau von heut ! «1 In seinem 1930 in der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift Die Unzufriedene erschienenen Gedicht entwirft Hans H aidenbauer die neue Frau als unabhängig, mutig und modern. Die Illustrationen, die dem Text beigefügt sind, visualisieren das Idealbild : Ob als Mutter, Sportlerin, Abenteurerin oder am Schreibtisch Arbeitende – ihre Erscheinung ist charakterisiert durch jugendliches Auftreten, Bubikopf und praktische, bewegungsfreundliche Kleidung. Diese moderne ( meist junge ) Frau nahm innerhalb der Vermarktungsstrategien und des Selbstverständnisses des Roten Wien eine wichtige Rolle ein : Sie diente als Symbol für die zu schaffende sozialistische Gesellschaft. Dies verdeutlicht auch ein Wahlplakat der SDAP , das ein egalitäres Geschlechterverhältnis propagiert. Es zeigt ein junges Paar, beide etwa gleich groß, das Seite an Seite und, so suggeriert die Bildsprache, gleichberechtigt für die Realisierung der gerechten zukünftigen Gesellschaft kämpft. Die ideale Sozialdemokratin lebte ein selbstbestimmtes Leben, sie war berufstätig und autonom. Zugleich wurde sie als verheiratete Mutter einer Kleinfamilie imaginiert, die ihrem Ehemann eine Kameradin und ihren Kindern eine Freundin sein sollte.2 Die Propagierung eines egalitäre( re )n Geschlechterverhältnisses und die Stilisierung von ( jungen, » neuen « ) Frauen zum Inbegriff der » neuen Zeit « waren nicht auf die
politischen Kampagnen des Roten Wien beschränkt. Frauen gestalteten das Rote Wien maßgeblich mit : Sie wurden nicht nur als Wählerinnen umworben und agierten als Unterstützende, sondern waren auch als Aktivistinnen, Funktionärinnen und Theoretikerinnen aktiv in die Reformen involviert. Die Stadtpolitik funktionierte dabei als Experimentierfeld, in dem sich neue politische Räume eröffneten. Doch bereits Zeitgenossinnen kritisierten die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit und die Hindernisse, mit denen Frauen, vor allem politisch aktive, dennoch konfrontiert waren.3 Mit der Ausrufung der Republik am 12. November 1918 wurde
das aktive und passive Wahlrecht für alle StaatsbürgerInnen proklamiert, und im am 18. Dezember desselben Jahres verabschiedeten Wahlgesetz das Frauenwahlrecht schließlich durchgesetzt ( Sexarbeiterinnen blieben allerdings bis 1923 ausgeschlossen ). Dies war nicht nur den sozialen und politischen Umbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg geschuldet – während der Unruhen im Herbst 1918 hatte sich die Sozialdemokratie als Ordnungsfaktor etabliert und konnte so das Wahlrecht für Frauen durchsetzen –, sondern Ergebnis des langen Kampfs der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung um politische Partizipation. Nach den Wahlen im Februar 1919 zur konstituierenden Nationalversammlung, die insgesamt 170 Abgeordnete umfasste, zogen acht Frauen – sieben von ihnen Sozialdemokratinnen – in das österreichische Parlament ein. Im Anfang Mai 1919 gewählten Wiener Gemeinderat waren bereits 22 von 165 Mitgliedern Frauen, darunter 16 Sozialdemokratinnen und sechs Christlichsoziale.4 Die Einführung des Frauenwahlrechts verunsicherte sowohl
die Konservativen als auch die SozialdemokratInnen nicht nur hinsichtlich der Auswirkungen auf die politische Landschaft durch die Verdoppelung der Wahlberechtigten. Vor allem die Frage, wem die Frauen ihre Stimme geben würden, beunruhigte viele. Trotzdem die SDAP sich als erste Partei für das Frauenwahlrecht eingesetzt hatte, wählten Frauen seltener sozialdemokratisch als Männer und gaben ihre Stimme überdurchschnittlich oft den Christlichsozialen.5 Therese Schlesinger erklärte dies mit dem mangelnden Angebot der Sozialdemokratie für Frauen.6 Diese Tendenz setzte sich fort, erst nach 1927 lässt sich eine Verringerung der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den SDAP -WählerInnen feststellen, und 1932 schließlich glichen sie die Stimmenverluste der SDAP bei Männern aus.7 Die Möglichkeit der politischen Selbstrepräsentation bildete den Auftakt zu einer Reihe von weiteren Kämpfen zur Erlangung umfassender politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Teilhabe. Austragungsorte dieser Auseinandersetzungen waren neben politischen Institutionen, Vereinen und Parteiveranstaltungen insbesondere die ( Print- )Medien der SDAP wie die Arbeiter-Zeitung, der Kuckuck, die Arbeiterinnen-Zeitung ( ab 1924 Die Frau ) und Die Unzufriedene. Frauen waren auch im öffentlichen Raum präsent : Auf zahlreichen Kundgebungen, besonders aber beim Internationalen Frauentag machten sie ihre Anliegen sichtbar. Ziel des als kollektiver Festtag inszenierten Frauentags war neben der öffentlichkeitswirksamen Propagierung frauenpolitischer Themen vielmehr noch die Förderung des Selbstbewusstseins der Frauen.8 Neben den Forderungen nach » gleichem Lohn für gleiche Arbeit « 9 und gleichem Zugang zu Bildungs- und Berufsmöglichkeiten stand das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper im Fokus : Die Frauen- und Arbeiterinnenbewegung setzte sich für die Änderung der Paragrafen 144 bis 148 ein, die den Schwangerschaftsabbruch kriminalisierten, und brachte – erfolglos – mehrere Initiativen für eine Gesetzesänderung im Parlament ein. Die SozialdemokratInnen vertraten bei dieser Frage unterschiedliche Positionen : Sie führten bevölkerungspolitische, neomal thusianische und eugenische Begründungen ebenso ins Feld wie die Forderung nach individuellen ( Frauen- ) Rechten. Übereinstimmend bezeichneten sie den Paragrafen 144 als » Mord- « und » Klassenparagraphen «, der vor allem proletarische Frauen betreffe, da diese meist nicht genügend Geld für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch aufbringen konnten.10 In das Parteiprogramm von 1926 wurde
oben: Das Wahlplakat der SDAP spricht Männer und Frauen als gleichberechtigte PartnerInnen im Kampf gegen die Wirtschaftskrise an, 1930 ; Kat. Nr. 0.4. links: Hans Haidenbauer entwirft das Ideal der sozialdemokratischen, neuen Frau als das einer selbstbewussten Gefährtin, die es schafft, Beruf, Familie und Freizeit zu vereinen. Aus : Hans Haidenbauer : » D ie Frau von heut’ « , in : Die Unzufriedene 8 ( 1930 ) 26, S. 1
51
52
jedoch nicht die von der SDAP -Bezirksrätin, Ärztin und Individualpsychologin Margarete Hilferding befürwortete bedingungslose Legalisierung der Abtreibung aufgenommen,11 sondern die » Indikationslösung «, die Möglichkeit zum Abbruch der Schwangerschaft unter Einbeziehung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Schwangeren, für die sich beispielsweise Julius Tandler, Stadtrat für das Wohlfahrtsund Gesundheitswesen, aussprach. Umstrukturierungen in allen Lebensbereichen sollten die gesellschaftliche Erneuerung ermöglichen und egalitäre ( re ) Formen des ( Zusammen- ) Lebens schaffen : So forderte Marianne Pollak anlässlich des Frauentags 1932 die » Vermenschlichung der Politik « und die gesellschaftliche Gleichstellung von ledigen und verheirateten Müttern sowie die gemeinschaftliche Erziehung von Kindern außerhalb der Kleinfamilie.12 Dementsprechend war die Gestaltung der Trias » Arbeiten – Wohnen – Leben « Kernthema der sozialdemokratischen Reformerinnen. Dabei knüpften sie an frühere Debatten der bürgerlichen und sozialistischen Frauenbewegung über alternative Formen des Lebens und Wohnens an. Sie traten dafür ein, dass Hausfrauen als die einzigen gänzlich rechtlosen Arbeiterinnen sich ähnlich den Fabrikarbeiterinnen organisieren sollten, und setzten sich dafür ein, dass
Arbeiten — Wohnen — Leben
Weibliche Mitglieder des bis Mai 1919 tätigen provisorischen Wiener Gemeinderats, in den 12 Frauen entsandt wurden, davon 5 Sozialdemokratinnen; 1918; Kat. Nr. 7.4.
Hausarbeit als Arbeit anerkannt und entlohnt werden müsse. Der Haushalt sollte rationalisiert, zentral verwaltet oder gemeinschaftlich besorgt und so die Mehrfachbelastung arbeitender Frauen – Lohn-, Haus- und Reproduktionsarbeit – verringert werden.13 Emmy Freundlich beispielsweise, eine der wenigen leitenden Funktionärinnen bei den Konsumgenossenschaften, schlug eine » Arbeitsgemeinschaft der Hausfrauen « vor.14 Die Frauen traten für die Auslagerung von als weiblich geltenden Arbeiten an öffentliche Einrichtungen und für den Ausbau von Kindergärten und -horten sowie von Fürsorge- und Freizeiteinrichtungen ein. Diese Forderungen schrieben sich in Form von genossenschaftlichen Wäschereien, Zentralküchen und Kindergärten in die Architektur des Roten Wien ein. Die geschlechterspezifische Arbeitsteilung, die Frauen Haus- und Care-Arbeit zuschrieb, wurde zwar kritisiert,15 stand jedoch nicht grundsätzlich infrage. Ein alternatives Konzept, das Frauen vom Haushalt freispielen sollte, war das um 1900 entwickelte Kollektiv modell Einküchenhaus. Die zugrunde liegende Idee war dabei, durch die Einrichtung zentral organisierter Services ( Kochen, Aufräumen, Wäschewaschen ) berufstätige Frauen von der hauswirtschaftlichen Reproduktionsarbeit zu entlasten. In Wien wurde das Modell zunächst von bürgerlich-liberalen Frauenrechtlerinnen wie Auguste F ickert als Genossenschaft verwirklicht : 1911 eröffnete der erste Heimhof für ledige und erwerbstätige Frauen in der P eter-Jordan-Straße im 19. Bezirk ; 1922 folgte ein weiterer in der Pilgerimgasse im 15. Bezirk für berufstätige Paare und Familien. In finanzielle Schwierigkeiten geraten, wurde dieser fünf Jahre später von der Gemeinde übernommen und um Wohnungen sowie einen Kindergarten erweitert, jedoch weiterhin demokratisch selbstverwaltet. Die Wohnungen waren mit Kochgelegenheiten, Wasseranschluss etc. modern ausgestattet ; eine Zentralküche, die mit Speisenaufzug und Telefon mit den Wohnungen verbunden war, ersetzte die einzelnen Küchen.16 Therese Schlesinger befürwortete das Einküchenhaus, in dem Frauen sich ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter und ihren Aufgaben in Politik und Gewerkschaft widmen könnten, als Alternative zum » jämmerlichen Zwerghaushalt «.17 Das Modell war hinsichtlich seiner möglichen Auswirkungen umstritten: So äußerte beispielsweise eine christlichsoziale Gemeinderätin, das Einküchenhaus sei » aus sittlichen Gründen
abzulehnen « , besonders weil junge Frauen hier nicht lernen würden, sparsam zu haushalten.18 Die Debatten, die am Beispiel dieses Konzepts um das Für und Wider der Auslagerung von Hausarbeit geführt wurden, repräsentieren auch die geschlechtsspezifischen Bruchlinien im Roten Wien. Ein zentrales Thema der S DAP Frauen war die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse von Arbeiterinnen und Angestellten. Eine Gruppe, auf die sich ihr Augenmerk besonders richtete, waren Hausbedienstete ( fast ausschließlich handelte es sich dabei um Frauen ). Das Engagement für die Rechte dieser sehr prekarisierten Berufsgruppe war eng verbunden mit den Kämpfen der Frauen- und ArbeiterInnenbewegung im 19. Jahrhundert und deren Akteurinnen wie Adelheid Popp, Antonie Platzer oder G abriele Proft. 1920 wurde das Hausgehilfengesetz verabschiedet, um der Willkür der DienstgeberInnen Einhalt zu gebieten : Das Dienstbotenbuch wurde abgeschafft, und Hausbedienstete wurden rechtlich nicht mehr der Polizei, sondern den Gerichten unterstellt. Neben einem bezahlten Urlaub und dem Recht auf Sonntagsausgang waren Ruhezeiten sowie der Anspruch auf gesundes Essen und einen verschließbaren Schlafraum festgeschrieben. Doch viele DienstgeberInnen hielten die Vorschriften nicht ein, Hausbedienstete gehörten deshalb um 1930 neben den HeimarbeiterInnen zu den am stärksten prekär lebenden ArbeiterInnen. Antonie Platzer kritisierte die ungenügende Rechtssicherheit im Handbuch der Frauenarbeit : » Da Hausgehilfinnen auch von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen sind, mit der Arbeitsstelle gleichzeitig auch ihr Obdach verlieren, bekommen sie die ganze Härte der Arbeitslosigkeit zu fühlen. «19 Herausgegeben wurde das Handbuch, das sich der Darstellung der Frauenarbeit in verschiedenen Berufen widmete und anlässlich des Internationalen Frauenkongresses20 1930 erschien, von Käthe Leichter – kritische Sozialistin, Wissenschaftlerin und Pionierin der Sozialforschung in Österreich. In ihrer Funktion als Leiterin des 1925 in der Arbeiterkammer eingerichteten Frauenreferats führte Leichter gemeinsam mit dem um sie entstandenen Frauennetzwerk – darunter Marie Jahoda und Rosa Jochmann – soziologische Erhebungen zur Analyse der Lebensverhältnisse arbeitender Frauen durch und entwickelte dabei neue, innovative sozialwissenschaftliche Methoden.21 Für das Handbuch werteten sie statistisches Datenmate-
Arbeitsverhältnisse und Mehrfachbelastung
rial aus, sammelten Erfahrungsberichte berufstätiger Frauen und kombinierten Zustandsbeschreibungen mit politischen Forderungen. Auch Leichters 1932 publizierte empirische Untersuchung So leben wir von Lebens- und Arbeitsverhältnissen von Industriearbeiterinnen verbindet Analysen mit Forderungen nach konkreten Maßnahmen.22 Leichter und ihr Team führten dafür ( Leit- )Frageninterviews, werteten 1.320 Fragebögen aus, die sie um Erzählungen von Arbeiterinnen der unterschiedlichen Branchen ergänzten, und visualisierten die Geschlechterverhältnisse in der Arbeitswelt mit Bildstatistiken des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums. Wie in der Studie Die Arbeitslosen von Marienthal, bei der Marie Jahoda eine Schlüsselrolle einnahm, wurde nicht nur nach Arbeitsverhältnissen, sondern auch nach Alltags- und Freizeitgestaltung gefragt und die Mehrfachbelastung der Frauen hervorgehoben.23 So leben wir funktioniert auch als Korrektiv der Erfolgserzählung des Roten Wien : beispielsweise indem auf die – trotz des Wohnbauprogramms – b eengten
Titelblatt des » Kuckuck « anlässlich des Frauentags, 23. März 1930; VGA
53
54
ohnverhältnisse vieler Arbeiterinnen und das zu geringe W Angebot an a ußerhäuslicher Kinderbetreuung verwiesen wird. Die in diesen Arbeiten geleistete Verknüpfung von feministischer und sozialistischer Wissensproduktion war für das damalige Europa einzigartig. Als feministisch charakterisierte diesen Zugang ein integrales Verständnis von Produktion und Reproduktion, von Ökonomie, Staat und Politik, demzufolge die Ökonomie immer bezahlte und unbezahlte
Plakat für die Abschaffung der Paragrafen 144 — 148, 1927; Kat. Nr. 7.7.
( Re- )Produktionsarbeiten umfasste : von Hausarbeit über Erziehung und Bildung bis zu Pflege und Versorgung. Die Anliegen der Frauen- und Arbeiterinnenbewegung fanden also Eingang in die wissenschaftlichen Arbeiten, während diese wiederum die politischen Debatten vorantrieben.24 Seit Ende der 1920er Jahre befassten sich die sozialdemokratischen Akteurinnen auch mit den unterschiedlichen Auswirkungen der konservativ-autoritären Krisenpolitik der christlichsozialen Regierung auf Frauen und Männer.25 Sie wiesen darauf hin, dass Frauen von der staatlichen Kürzungspolitik besonders betroffen waren : Diese waren ohnehin häufiger als ungelernte Arbeiterinnen in ungesicherten und schlechter bezahlten Berufen tätig und wurden oft als Erste entlassen. Vielfach geschah dies mit der Begründung, sie seien nur » Zuverdienerinnen « und der Wegfall ihres Lohns sei nicht existenzbedrohend. Dem widerspricht jedoch Leichter in So leben wir : 82,3 Prozent der befragten Frauen waren als Selbst- bzw. Familienerhalterinnen dringend auf den Lohn angewiesen.26 Mit dem Abbau des Sozialstaats und der sozialen Infrastruktur stieg zudem die Mehrfachbelastung, da die Frauen aufgrund des geringeren Haushaltsbudgets mehr Eigenleistungen im Haushalt übernehmen mussten. Zentraler Kritikpunkt der Sozialdemokratinnen war die politische Förderung traditionell-konservativer Geschlechterbilder, die sich exemplarisch an der umstrittenen Doppelverdienerverordnung, die 1933 in Kraft trat, zeigte. Mit einer Regierungsverordnung durchgesetzt, zielte sie auf den Abbau der weiblichen Erwerbstätigkeit : Verheiratete Frauen wurden aus dem Staatsdienst entlassen, pensioniert oder gar nicht eingestellt und damit wieder verstärkt in die Sphäre der unbezahlten Haus- bzw. Reproduktionsarbeit verwiesen.27 Kritik an den geschlechterspezifischen Auswirkungen dieser Maßnahmen übte auch der von den Gewerkschafterinnen Anna Boschek und Wilhelmine Moik mit Unterstützung von Käthe Leichter realisierte semidokumentarische Film Frauenleben – Frauenlos. Über das Leben arbeitender Frauen ( A 1931/32 ), der Leichters So leben wir in filmische Bilder übersetzt. Er wurde bis Mitte 1933 österreichweit mehr als hundert Mal aufgeführt und gilt als eines der wichtigsten Filmdokumente zur Frauenarbeit im Europa der 1930er Jahre.28 Die Austeritätspolitik der christlichsozialen Regierung und die zunehmende Entdemokratisierung verdrängten Frauen sukzessive aus der öffentlichen Sphäre. Parteien und Gewerkschaften w urden
55
Küche und Speisesaal des Kollektivmodells Einküchenhaus, um 1925 ; Foto : Faber ; VGA, V2/166, Kat. Nr. 7.30.
56
verboten, das Wahlrecht abgeschafft und die Gleichheit von Mann und Frau in der Verfassung aufgehoben. Spätestens 1934 wurde die Reetablierung konservativer Frauenbilder offizielle Staatspolitik. Wesentliche Errungenschaften der Frauen im Roten Wien wurden von der ständestaatlichen Diktatur und im Nationalsozialismus zunichtegemacht ; viele Akteurinnen wurden verfolgt, vertrieben oder ermordet. Erst Jahrzehnte später wurden frauenpolitische Themen wieder ähnlich öffentlichkeitswirksam diskutiert wie im sozialdemokratischen Wien der Zwischenkriegszeit : Feministinnen knüpften sukzessive an die Forderungen, Debatten und Aktivitäten der Frauen im Roten Wien an und noch bis heute sind diese – auch im internationalen Vergleich – wegweisend.
Die Bildstatistiken des Gesellschafts- und Wirtschaftsm useums visualisieren die Lebensverhältnisse von Arbeiterinnen, die Käthe Leichter in ihrer Studie » S o leben wir « untersuchte. Aus : Käthe Leichter : » S o leben wir … 1320 Industriearbeiterinnen erzählen « , Wien 1932; Kat. Nr. 7.9. — 7 .10.
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Hans Haidenbauer : Die Frau von heut’, in : Die Unzufriedene 8 ( 1930 ) 26, S. 1. Das Konzept des Beitrags beruht auf dem von Veronika Duma und MarieNoëlle Yazdanpanah verfassten Kapitel The New Woman and Womens’ Rights, in : Rob McFarland, Georg Spitaler, Ingo Zechner ( Hg. ) : The Red Vienna Sourcebook, Rochester, NY ( im Erscheinen ). Vgl. z. B. Brigitte Lichtenberger-Fenz : » Sklavin Frau « und » Junges Weib der Gegenwart «, in : Doris Ingrisch, Ilse Korotin, Charlotte Zwieauer ( Hg. ) : Die Revolutionierung des Alltags, Frankf. a. M. 2004, S. 121 – 150 ; Helmut Gruber : The » New Woman «. Realities and Illusions of Gender Equality in Red Vienna, in : ders., Pamela M. Graves ( Hg. ) : Women and Socialism – Socialism and Women, New York 1998, S. 56 – 94. Vgl. z. B. Marianne Pollak : Die Frau in der Partei, in : Die Frau 40 ( 1931 ) 1, S. 11. Zu den Mitgliedern des Gemeinderats vgl. N. N. : Der Wiener Gemeinderat, in : Neuigkeits-Welt-Blatt, 6. Mai 1919, S. 2f. Frauen waren auch im provisorischen Gemeinderat vertreten. Vgl. Maren Seliger, Karl Ucakar : Wahlrecht und Wahlverhalten in Wien 1848 – 1932, Wien 1984. Vgl. Therese Schlesinger : Die Frauen und die Revolution, in : Der Kampf. Sozialdemokratische Monatsschrift 14 ( 1921 ) 3, S. 73 – 76. Vgl. Robert Danneberg : Die Wiener Gemeinderatswahlen im Lichte der Zahlen, in : Der Kampf 25 ( 1932 ) 7, S. 312 – 325. Vgl. Gabriella Hauch : » Eins fühlen mit den GenossInnen der Welt «. Kampf- und Feiertage der Differenz : Internationale Frauentage in der ersten Republik Österreich, in : Heidi Niederkofler, Maria Mesner, Johanna Zechner ( Hg. ) : Frauentag, Wien 2011, S. 60 – 105, hier S. 81. Der Durchschnittslohn einer Arbeiterin betrug 1926 nur etwas mehr als die Hälfte dessen, was ein Arbeiter im Schnitt verdiente. Vgl. Käthe Leichter : Die Entwicklung der Frauenarbeit nach dem Krieg, in : dies., Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien ( Hg. ) : Handbuch der Frauenarbeit in Österreich, Wien 1930, S. 28 – 42, hier S. 40.
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vgl. Adelheid Popp : Der Paragraph 144, in : Die Unzufriedene 5 ( 1927 ) 41, S. 1 – 3 ; N. N. : Massenproteste gegen den Mordparagraphen 144, in : Die Unzufriedene 5 ( 1927 ) 41, S. 3f. Vgl. Margret Hilferding : Geburtenregelung, Wien 1926. Marianne Pollak : Gedanken zum internationalen Frauentag, in : Frauentag ( 1932 ), S. 15f. Vgl. Else Stiaßny : Rationalisierung im Haushalt, in : Die Frau 38 ( 1929 ) 12, S. 5f. ; Grete Lihotzky : Rationalisierung im Haushalt, in : Das neue Frankfurt. Monatsschrift für die Fragen der Großstadt-Gestaltung 1 ( 1926/27 ) 5, S. 120 – 123. Emmy Freundlich : Arbeitsgemeinschaft der Hausfrauen, in : Arbeiter-Zeitung, 11. April 1925, S. 9. Vgl. Therese Schlesinger : Wie will und wie soll das Proletariat seine Kinder erziehen ?, Wien 1921. Der Film Das Einküchenhaus von Leopold Niernberger ( A 1922 ) zeigt die Ausstattung der Wohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen. Vgl. Marie-Noëlle Yazdanpanah : » Die Wohnung ist nur eine Schutzdecke … «. Wohnungslosigkeit von Frauen in Wien, in : Frauen Wissen Wien 3 ( 2015 ), S. 48 – 51. Therese Schlesinger : Frauenarbeit und proletarische Lebenshaltung, in : ArbeiterZeitung, 3. Februar 1925, S. 8. Vgl. Stenographischer Bericht über die Sitzung des Gemeinderats vom 9. März 1923, in: Wiener Stadt- und Landesarchiv, B. 29/1. Ex., S. 854f. Vgl. auch Bettina Hirschs Artikel im Kleinen Blatt, in dem sie von Leserinnen geäußerte Vorbehalte zu widerlegen sucht . Vgl. Das Kleine Blatt, 20. August 1927, S. 11f., bis 24. September 1927, S. 11. Antonie Platzer : Die Hausgehilfin, in : Leichter, Handbuch der Frauenarbeit, S. 159 – 169, hier S. 163. Zeitgleich gab der Bund österreichischer Frauenvereine einen Sammelband zu diesen Themen heraus : BÖVF, Martha Stephanie Braun ( Hg. ) : Frauenbewegung, Frauenbildung und Frauenarbeit in Österreich, Wien 1930.
21
22
23
24
25
26 27
28
Vgl. Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz in Österreich, Wien 1927 ; Wie leben die Wiener Heimarbeiter. Eine Erhebung über die Arbeits- und Lebensverhältnisse von tausend Wiener Heimarbeitern, Wien 1928. Käthe Leichter : So leben wir … 1320 Industriearbeiterinnen berichten über ihr Leben, Wien 1932. Vgl. Leichter, So leben wir, S. 52 – 57, S. 108 – 111 ; Marie Jahoda, Paul Felix Lazarsfeld, Hans Zeisel : Die Arbeitslosen von Marienthal, Leipzig 1933. Vgl. Veronika Duma : Engagierte Wissenschaft. Die Sozialwissenschaftlerin Käthe Leichter, in : Christoph Reinprecht, Andreas Kranebitter ( Hg. ) : Die Soziologie und der Nationalsozialismus in Österreich, Bielefeld ( erscheint 2019 ). Vgl. G. P. [Gabriele Proft] : Nein ! Aus dem Finanz- und Budgetausschuß des Nationalrates, in : Die Frau 40 ( 1931 ) 3, S. 4f. ; Käthe Leichter : Die » Sozialreform « der Regierung entrechtet die Frauen, in : Die Frau 40 ( 1931 ) 5, S. 4 – 6. Vgl. Leichter, So leben wir, S. 103 – 107. Vgl. z. B. Adelheid Popp : Verdrängung der Frauenarbeit, in : Die Frau 42 ( 1934 ) 2, S. 2 – 4 ; Veronika Duma, Katharina Hajek : Haushaltspolitiken. Feministische Perspektiven auf die Weltwirtschaftskrisen von 1929 und 2008, in : ÖZG 16 ( 2015 ) 1, S. 46 – 74. Vgl. Elisabeth Büttner, Christian Dewald : Proletarisches Kino in Österreich, in : Filmhimmel 29 ( 2006 ), S. 10. Der Film ist auf You Tube abrufbar : https ://www.youtube.com/watch ?v=0_ xwXTpSEnU&t=701s ( 2.2.2019 ).
57
58
A FR I K A S I N G T Rotes Wien global Birgit Nemec Werner Michael Schwarz
In der Festbroschüre zur Internationalen Frauenkonferenz, die am 23. Juli 1931 in Wien eröffnet wurde, findet sich neben Berichten zur Rolle der Frau in Politik und Wirtschaft in unterschiedlichen Ländern, neben Neuigkeiten zur internationalen Frauenbewegung und kämpferischen Parolen unauffällig eingestreut eine Auswahl von Gedichten mit in diesem Kontext bemerkenswerten Motiven. » Ist’s, weil ich schwarz bin ? «, fragte beispielsweise Joseph S. Cotter Jr. in einem Achtzeiler, und weiter konnte man lesen : » Warum lachen die Menschen, wenn ich rede, Und nennen meine Rede Eines Säuglings Stammeln ? Der schreit und nicht weiß, was er will ? Ist’s, weil ich schwarz bin ? Warum höhnen sie, wenn ich aufstehe Und dastehe in ihrem Rat, Ihnen ins Auge sehe Und ihre Zunge spreche ? Nur weil ich schwarz bin ? « 1 Die Gedichte sind teils mit großformatigen Abbildungen illustriert, einer afrikanischen Frau in traditioneller Kleidung im Fall von Ist’s, weil ich schwarz bin ? oder einer Knienden, die ein Kind im Arm hält im Fall von Maria. Angaben zu den Übersetzungen fehlen, nur ein klein gedruckter Hinweis verrät, dass diese dem » ergreifend schönen Gedichtband › Afrika singt ‹« entnommen wurden. Der Band mit dem Untertitel » Eine Auslese neuer afro-amerikanischer Lyrik « erschien 1929 in Wien und war, so die Herausgeberin Anna Nußbaum ( 1897 – 1931 ) im Vorwort, die erste Anthologie afro amerikanischer Lyrik im deutschsprachigen Raum.2 Warum aber wurden diese Gedichte, die über die Rassendiskriminierung in den USA, Sklaverei und die Hoffnung auf Befreiung erzählen, so prominent in einer Broschüre für den Internationalen Frauentag in Wien platziert,
und warum war so wenig von den Errungenschaften des Sozialismus, dem » Neuen Menschen « und den Leistungen des Roten Wien die Rede ? Im internationalen Ansehen befand sich die sozialdemokratisch verwaltete Stadt gerade im Juli 1931 auf ihrem Zenit. Zeitgleich fanden die zweite Arbeiterolympiade im neuen, hochmodernen Praterstadion und der vierte Internationale Sozialistenkongress statt, in dessen Rahmen die Frauenkonferenz abgehalten wurde. Über Tage wurde mit Massenfestspielen und Kundgebungen in der ganzen Stadt Stärke und Einheit demonstriert, wenngleich die sich dramatisch zuspitzende Wirtschaftskrise ( kurz davor war mit der Bodencreditanstalt die wichtigste österreichische Bank zusammengebrochen ) die Euphorie deutlich trübte.
Der auf hochwertigem Papier gedruckte und in schwarzem Leinen mit goldfarbenen grafischen Applikationen gebundene Band erschien bei der F.G. Speidel’schen Verlagsbuchhandlung ( Wien/Leipzig ) und versammelte 100 Gedichte afroamerikanischer AutorInnen der sogenannten Harlem Renaissance.3 Genau genommen waren es Nachdichtungen bzw. Übertragungen ins Deutsche durch vier anerkannte, der Sozialdemokratie nahestehende AutorInnen : die Expertin für amerikanische Lite ratur und Übersetzerin Anna Nußbaum, den Schriftsteller, Volksbildner und ehemaligen Leiter der sozialistischen Bildungszentrale in Wien Josef Luitpold Stern, den deutschen Schriftsteller und Dichter Hermann Kesser und die sozialdemokratische Pädagogin, Politikerin und Journalistin Anna Siemsen. Die Auswahl, Zusammenstellung und Kontextualisierung der Gedichte in elf Kapiteln stammte vermutlich von Nußbaum selbst, sie war auf Beispiele politischer Lyrik fokussiert, nahm aber auch Liebesgedichte auf. Zu den Motiven zählten Selbst- und Fremdbild, Ausgrenzung und Verfolgung, Geschlecht, Religion sowie Orte der kulturellen und politischen Identifikation wie der New Yorker Stadtteil H arlem oder der Blues. Der Anhang erhielt kleine Porträts der 19 im Band vertretenen LyrikerInnen – unter anderen Joseph S. Cotter Jr., Georgia Douglas Johnson und Thekla Merwin sowie Countee Cullen, Langston Hughes, Fenton Johnson und Jean Toomer. Über das Zustandekommen von Afrika singt, wohl einer der ersten Kulturtransfers von afroamerikanischer Literatur in den deutschsprachigen Raum,4 wie über die Initiatorin und Herausgeberin Anna Nußbaum ist bislang wenig bekannt, wenngleich zahlreiche Spuren darauf hinweisen, dass sie im intellektuellen und literarischen Wien dieser Zeit fest verankert war. Afrika singt war das zweite große Buchprojekt der 1887 in Galizien geborenen und 1907 an der Universität Wien promovierten Romanistin und eng mit ihrem pazifistischen Engagement verbunden. » Übersetzung als Welthilfe proletarischer Welterhebung, das war Wille und Tagwerk dieser körperlich zierlichen, dieser geistig starken Frau «, schrieb Josef Luitpold Stern in einem Nachruf über sie.5 In diesem Zusammenhang ist das 1921 beim Wiener Gloriette-Verlag gemeinsam mit Else Feldmann herausgegebene Reisetagebuch des Wiener Kindes zu nennen, in dem Aufsätze, Briefe und Zeichnungen von Schulkindern, die während der dramatischen Notlage nach dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen europäischen Ländern Aufnahme fanden, zu einer Anthologie zusammengestellt sind. Diese vermittelte die Auslandserfahrungen der Wiener Kinder als wichtigen Beitrag internationaler » Völkerverständigung «.6 Zu dieser Zeit war Anna Nußbaum auch bei der Reformpädagogin, Schulgründerin und Frauenrechtsaktivistin Eugenie Schwarzwald, ihrer Tante, beschäftigt und übersetzte französische Literatur für deutsche
» A frika singt «
Cover von » A frika singt « , 1929 ; Kat. Nr. 11.6.
Schulausgaben im Sesam-Verlag von Helene S cheu-Riesz. Zudem verfasste sie zahlreiche Rezensionen und Übersetzungen für Wiener Tageszeitungen, beispielsweise Arbeiten des pazifistischen Schriftstellers und Politikers Henri Barbusse,7 und war Mitbegründerin der Wiener Gruppe der pazifistischen ( von Barbusse initiierten ) Clarté-Vereinigung, der auch Josef Luitpold Stern, Else Feldmann, der Individualpsychologe Alfred Adler, der Schriftsteller Leonhard Frank, der Filmkritiker und Regisseur Béla Balázs, der Soziologe Rudolf Goldscheid, die Politikerin Rosa Mayreder oder der Ökonom und Philosoph Otto Neurath angehörten. Afrika singt erschien ein Jahr nach der Premiere von Ernst Kreneks Welterfolg Jonny spielt auf am 31. Dezember 1927 in der Wiener Staatsoper und reiht sich auf den ersten Blick in die ambivalente Faszination für Amerika und insbesondere die afroamerikanische ( Musik- ) Kultur in diesen Jahren ein.8 Von diesem » Modewohlwollen « 9 sollte sich Anna Nußbaum allerdings explizit distanzieren und ihren Zugang mit einem » sozialen Interesse « erklären.10 » Diese Stimmen – so verschieden sie seien – wären alle wert gehört zu werden «, erklärte sie, denn sie seien » erschütternde Hilferufe nach Befreiung und verheißungsvolles Zeugnis zum Licht aufstrebender Menschheit. « 11 Der Gedichtband wurde zu seiner Entstehungszeit stark beachtet. Hilde Spiel erinnerte sich an » Schockwellen «, die das Buch in ihren literarischen Zirkeln in Österreich ausgelöst habe.12 In der rechten Presse gab es heftige Kritik, in der linken durchwegs Zustimmung. Kurt Tucholsky lobte das » schöne Buch «, fügte allerdings ironisch hinzu, dass einige durch die Übersetzung entstandene » Gedankenverbindungen […] sicherlich nicht schwarzfarbig « seien, womit er das generelle Problem der Übersetzbarkeit von Lyrik und den ( mitunter starken ) Eingriff durch die ÜbersetzerInnen ansprach.13 Der Philosoph, Pazifist und Bürgerrechtsaktivist W. E. B. Du Bois, der in einem der Gedichte neben [Victor] Adler genannt wird,14 lobte das Buch und hob den geschmackvollen Einband hervor.15 Mit ihm stand Nußbaum in engem Briefwechsel.16 Der in Wien promovierte afroamerikanische Chemiker und Bürgerrechtler Percy L. Julian meinte, das Buch habe sich in fast jedem Buchregal eines gebildeten deutschen Haushalts befunden.17 Auch in den Medien der Sozialdemokratie finden sich zahlreiche Belege für die große Resonanz des Buches. Wenn es etwa in der Arbeiter-Zeitung in den Jahren nach dessen Veröffentlichung um den » Blick auf Afrika « ging, wurde regelmäßig aus den Gedichten zitiert, wie aus Countee Cullens Der schwarze Kellner oder aus Langston Hughes’ Ich bin ein Neger. 18 Nußbaum wurde zu Beiträgen in den Arbeiter- Kalendern 1929 und 1930 eingeladen und entschied sich unter anderem für eine Übersetzung von Michael Golds Bühnenstück Life of John Brown, die bekannte Geschichte des 1859
59
60
ingerichteten Abolitionisten, der Sklaven in Harpers Ferry h zu einem Aufstand aufgefordert hatte.19 Der Text wurde im Kalender durch einen Linolschnitt von Otto Rudolf Schatz illustriert. Einen Anteil an der positiven Resonanz von A frika singt in der deutschsprachigen Sozialdemokratie hatte wohl auch die Beteiligung des prominenten Bildungsfunktionärs und Schriftstellers Josef Luitpold Stern, der einen Großteil der politischen Gedichte übersetzte.20 Entsprechend betonte ein Rezensent in der Arbeiter-Zeitung die Bedeutung der Gedichtsammlung für die Sozialdemokratie : Sie sei » ein für Europa völlig neuer Einblick in das erschütternde dichterische Schaffen der schwarzen Proletarier im weißen Amerika «, denn gerade der Blick auf » das ganze schwarze Proletariat Neuyorks in seiner Sehnsucht nach einem freien Afrika « würde Parallelen zwischen dem » Rassenproblem « und dem » Klassenproblem « erlauben.21 Nußbaum habe mit ihrer Auswahl von Gedichten Themen angesprochen, die zur kritischen Reflexion der Lage in Europa beitragen würden. Afrika singt war für viele Monate auf der Liste der empfohlenen » Frauenbücher « der Arbeiterinnen-Zeitung sowie der Zeitschrift Die Frau, in der in Auszügen Gedichte wie Die Schwarze Frau spricht von Georgia Douglas Johnson oder Weißer Bruder, was wirst du sagen von Joseph Cotter Jr. erschienen. 1931 wurde eine Tonfassung der Anthologie von Wilhelm Grosz beim Arbeiter-Sinfoniekonzert im Großen Musikvereinssaal gespielt.22 Bereits 1929 hatte Alexander von Zemlinsky Gedichte aus der Sammlung vertont, die 1935 uraufgeführt wurden.23 In Nußbaums politischem Denken, das sie im Vorwort von Afrika singt und in anderen Texten der Zeit darlegt, war ein Begriff von zentraler Bedeutung : » Rassenbewusstsein «.24 Das » Bekenntnis zu einer Rasse «, schreibt sie etwa in einer Rezension über afroamerikanische Literatur in der österreichischen Tageszeitung Neue Freie Presse, sei ein » fruchtbares, schöpferisches Gefühl «, und sie sei beeindruckt von der » Ursprünglichkeit einer Rasse […] die sich nicht versklaven lässt «.25 Die zunächst befremdliche Idee von » Rasse « als einer » vorwärtstreibenden Kraft «, die ausgerechnet von einer sozialdemokratisch orientierten Jüdin formuliert wird, legt im Wien der späten 1920er Jahre einen Zusammenhang mit den politischen Auseinandersetzungen mit völkischen Rassen theorien, Faschismus und Antisemitismus nahe.26 Auch andere Hinweise in Nußbaums Vorwort weisen darauf hin, dass sie auf eine parallele ( historische ) Erfahrung von AfroamerikanerInnen und Juden und Jüdinnen anspielte, wenn von » Urheimat «, dem » Glauben an Errettung «, » kraftvoller Selbstbehauptung « oder der » Erkenntnis eigenen Wertes « die Rede ist. In diese Richtung zielte wohl auch der Titel
» R assenbewusstsein «
der Anthologie, Afrika singt, in dem es ausschließlich um US-amerikanische Stimmen ging. Das spielte auf die Idee der » Urheimat « an, der dichterischen Sehnsucht nach Rückkehr, spekulierte wohl mit der Afrika-Faszination der Zeit und war explizit auch politisches Programm. Denn in den USA, so Nußbaum, wäre die » geistige und künstlerische Wieder geburt der Farbigen « bislang am » entschiedensten « verwirklicht.27 Dies Idee der » Urheimat « wurde mit dem Cover von Karl Stratil eindrucksvoll unterstrichen, das ein idealtypisches schwarzes Gesicht zeigte, in dem die Umrisse des afrikanischen Kontinents zu erkennen sind. Wie Sander L. Gilman herausgearbeitet hat, operierte der völkische Rassismus mit denselben Stereotypen für Schwarze und Juden, um sie als » minderwertige Rassen « darzustellen, etwa mit der Zuschreibung mangelnder Männlichkeit. Anna Nußbaum wendet in ihrem Konzept von Afrika singt die rassistischen Konstrukte in ihr Gegenteil und erklärt das gemeinsame Erleiden zur Voraussetzung für Solidarität und Befreiung. Darauf deutet auch das idealtypische Gesicht auf dem Titelblatt hin, das kein eindeutiges Geschlecht erkennen lässt und so als Nachhall dieser ursprünglich rassistischen und hier ästhetisch gewendeten Perspektive erscheint. Wenngleich der » Rasse «-Begriff in Nußbaums Arbeiten teils unscharf bleibt, wird doch zweierlei deutlich : zum einen, dass sie, wie auch andere jüdisch-sozialdemokratische Intellektuelle ihrer Zeit, den zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich völkisch konnotierten Kampfbegriff klar auf die politisch linke Seite sowie auf die Seite der Frauenbewegung zu ziehen versucht ;28 zum anderen, dass sie diesen im Einklang mit ihren pazifistischen Weltkriegserfahrungen scharf vom Nationalismus abgrenzt. Die Idee vom » Rassenbewusstsein «, wie sie es formulierte und wofür sie große Zustimmung erhielt, muss gerade im politischen Kontext des Erscheinens der Anthologie auch als tiefe Skepsis gegenüber der integrativen Kraft des Sozialismus und dem Konzept des » Neuen Menschen « gelesen werden. Gegenüber einer rassistisch begründeten Diskriminierung, so konnten Gedichte wie Ist’s, weil ich schwarz bin ? oder Glaube aufgefasst werden, konnte Klassenbewusstsein allein nicht helfen, sondern nur eine Solidarität, die auf eine Inkorporierung und eine positive Wendung der rassistischen Stereotype baute. Anstelle des eingeübten revolutionären Pathos, wie es in Wien während der Arbeiterolympiade zum Ausdruck kam, trat in Anlehnung an Nußbaums Konzept auch bei der Internationalen Frauenkonferenz die Beschwörung der ( ewigen ) Geschichte des Leidens und der Zuversicht auf Befreiung.29 Afrika singt und seine Verwendung für die Festbroschüre 1931 veränderten und erweiterten die Perspektive : Es ging nicht mehr um
Frauenkonferenz 1931
das Rote Wien und um dessen Selbstbehauptung, wohl auch nicht mehr um Europa, das möglicherweise bereits ebenfalls als an den Faschismus verloren betrachtet wurde, es ging um die Welt und um eine ganz neue, quantitative und qualitative Dimension der Geschichte von Unterdrückung und Befreiung. » Die Klage der Schwarzen war zugleich Spiegel ihres eigenen Inneren : Bestürzung über die Gegenwart, Schrei nach Veränderung «, so Josef Luitpold Stern über Nußbaums Anliegen.30 Das männlich und weiß konnotierte Klassenbewusstsein, könnte man Anna Nußbaums politische Vision paraphrasieren, musste durch ein weibliches, schwarzes und jüdisches » Rassenbewusstsein « erweitert werden. So erklärt sich auch die Zusammenführung von globalen Frauenanliegen und afroamerikanischer Lyrik. Die Dringlichkeit dieser politischen Vision konnte aus konkreten Erfahrungen im Roten Wien abgeleitet werden, wie das die Landtags- und Gemeinderatswahlen 1932 deutlich zum Vorschein brachten, als die Sozialdemokratie ihre führende Position der großen Zustimmung der Frauen zu verdanken hatte, während bei
1
2 3
4
5
6
7
8
9 10
Festbroschüre der Internationalen Frauenkonferenz, Wien 1931, Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ( VGA ), Frauentagsbroschüren. Vgl. Anna Nußbaum : Vorwort, in : dies. ( Hg.): Afrika singt, Wien/Leipzig, S. 8. Vgl. George Hutchinson ( Hg ): The Cambridge Companion to the Harlem Renaissance, Cambridge 2007. Vgl. Christopher Meid : Afrika singt. Zur Rezeption afroamerikanischer Lyrik in den 1920er Jahren, in : Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik 18 ( 2017 ), S. 167 – 185. Nachruf von Josef Luitpold Stern auf Anna Nußbaum, in : Arbeiter-Zeitung, 28. Juni 1931, S. 11. Vgl. Anna Nußbaum, Else Feldmann ( Hg.): Reisetagebuch des Wiener Kindes, Wien 1921. Zu Anna Nußbaums pazifistischem Engagement vgl. auch den Nachruf von Helene Scheu-Riesz, in : Österreicherin 4 ( 1931 ) 7, S. 2. Vgl. Susanne Blumesberger : Handbuch der österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, Bd. 2 : LZ, Wien u. a. 2014, S. 829f., hier S. 830 ; Elisabeth H. Debazi : Nußbaum Anna, in : https ://litkult1920er.aau. at/litkult-lexikon/ nussbaum-anna/ ( 13. 3. 2019 ). Vgl. Charlotte Szilagyi, Sabrina K. Rahman, Michael Saman ( Hg.): Imagining Blackness in Germany and Austria, Cambridge 2013 ; Manuel Menrath ( Hg.): Afrika im Blick. Afrikabilder im deutschsprachigen Raum, 1870 – 1970, Zürich 2012 ; Earl R. Beck : German Views of Negro Life in the United States, 1919 – 1933, in : The Journal of Negro History 48 ( 1963 ) 1, S. 22 – 32 ; Werner Michael Schwarz : Das Konsumieren der Anderen. Schaustellungen » exotischer « Menschen in Wien, in : Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft ( 2001 ) 3, S. 15 – 29. Nußbaum, Afrika singt, S. 9. Zit. n. Christa Schwarz : New Negro
11 12 13
14
15 16
17
18 19 20
21 22
den Männern die Nationalsozialisten bereits große Erfolge erzielten. Das deutet darauf hin, dass das Klassenbewusstsein in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit nicht stabil genug war. Diese Ausweitung der Perspektive zu einer globalen lässt sich vielfach in den sozialdemokratischen Medien dieser Zeit beobachten. In den Theorieschriften wie Der Kampf wurden Befreiungsbewegungen wie jene von Mahatma Gandhi in Indien noch mit Ambivalenz hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit dem Sozialismus betrachtet, in den populären Medien wie dem Kuckuck hingegen war die Faszination und Sympathie bereits uneingeschränkt. Anna Nußbaum hatte in ihrem Bericht über die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit bereits 1921 eindrücklich darauf hingewiesen, dass der Weltkrieg hätte verhindert werden können, wenn die Frauen sich ihrer Stärke bewusst gewesen wären : » An der Natur selbst [Anm. : damit meinte sie den organisierten Widerstand von Frauen] hätten die geschicktesten diplomatischen und strategischen Pläne scheitern müssen. « 31
Renaissance – › Neger-Renaissance ‹: Crossovers between African America and Germany during the Era of the Harlem Renaissance, in : Maria Diedrich, Jürgen Heinrichs ( Hg.): From Black to Schwarz. Cultural Crossovers between African America and Germany, Berlin 2010, S. 49 – 75, hier S. 63. Nußbaum, Afrika singt, S. 11. Christa Schwarz, New Negro Renaissance, S. 63. Kurt Tucholsky : » Afrika singt «, in : ders. : Gesammelte Schriften ( 1907 – 1935 ), online : http ://www.textlog.de/tucholskyafrika-singt.html ( 13. 3. 2019 ). Zur Frage der Übersetzung bzw. Übersetzbarkeit vgl. detailliert : Meid, Afrika singt, sowie Helga Eßmann : Weltliteratur in deutschen Versanthologien des 19. und 20. Jahrhunderts, in : Armin P. Frank, Horst Turk ( Hg.): Die literarische Übersetzung in Deutschland. Studien zu ihrer Kulturgeschichte in der Neuzeit, Berlin 2004, S. 273 – 307, hier S. 297. Vgl. Nußbaum, Afrika singt, S. 126f. ( Jessie Fausets Erleuchtung, übersetzt von Josef Luitpold Stern ). Vgl. die Rezension von W. E. B. Du Bois, in : The Crisis ( März 1929 ), S. 87, S. 98. Vgl. W. E. B. Du Bois Papers, in : Univ. of Massachusetts Amherst Libraries, Special Collections and University Archives, MS 312, online : http ://credo.library.umass.edu/ search ?q=Nussbaum ( 15. 3. 2019 ). Vgl. Percy L. Julian : Negro Prose and Poetry, in : The Crisis ( November 1933 ), S. 53, zit. n. Meid, Afrika singt, S. 180. Arbeiter-Zeitung, 29. Dezember 1929, S. 13. Vgl. Österreichischer ArbeiterKalender ( 1930 ), S. 51. Zu Luitpold Sterns früheren Übersetzungen vgl. Christa Schwarz, New Negro Renaissance, S. 62. » Schatten über Harlem «, in : ArbeiterZeitung, 30. Oktober 1930, S. 8. Vgl. Arbeiter-Zeitung, 1. Februar 1931, S. 15.
23
24 25
26
27 28
29
30
31
Annoncen in Tageszeitungen belegen die große Verbreitung unterschiedlicher Interpretationen ( Chorwerke, Orchesterlieder, Klavierlieder etc.) von Erich Zeisl, Wilhelm Grosz, Fritz Kramer, Edmund Nick, Kurt Pahlen und Alexander von Zemlinsky in Radiosendungen und Konzerten in Österreich und Deutschland. Zu musikwissenschaftlichen Aspekten vgl. Malcolm S. Cole : Afrika singt. AustroGerman Echoes of the Harlem Renaissance, in : Journal of the American Musicological Society 30 ( 1977 ), S. 72 – 95. Vgl. Nußbaum, Afrika singt, S. 8. Dies. : Besprechung von Claire Golls » Die Neue Welt «, in : Neue Freie Presse, 2. April 1922, S. 32. Nußbaum war offenbar zum Protestantismus konvertiert ( vgl. die Todesanzeige in der Arbeiter-Zeitung, 23. Juni 1931, in der ihre Beisetzung in der evangelischen Abteilung des Zentralfriedhofs vermerkt ist ). Nußbaum, Afrika singt, S. 10. Zu jüdischen Wissenschaftlern über » Rasse « im frühen 20. Jahrhundert vgl. Veronika Lipphardt : Die Biologie der Juden, Göttingen 2008. Weniger in Afrika singt als in Nußbaums Zeitungspublikationen wird deutlich, welch hohen Stellenwert Geschichtlichkeit in ihrem Kampf gegen Formen der Unterdrückung ( rassische, geschlechterspezifische, politische ) einnimmt. Vgl. beispielsweise Harlem, in : Arbeiter-Zeitung, Tag 1930. Nachruf von Josef Luitpold Stern auf Anna Nußbaum, in : Arbeiter-Zeitung, 28. Juni 1931, S. 11. Anna Nußbaum : Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, in : Neues Wiener Tagblatt, 20. Juni 1921, S. 3.
61
62
»AN ALLE ARBEITENDEN JUDEN ! « Jüdische Stimmen zum Roten Wien Gerhard Milchram
Die Juden Wiens waren alles andere als eine einheitliche Bevölkerungsgruppe mit gleichartigen Interessen, dementsprechend unterschiedlich fielen auch die Reaktionen auf die Politik der Sozialdemokratie aus. Das Israelitengesetz von 1890 hatte zwar alle Juden der österreichischen Reichshälfte ohne Rücksicht auf die verschiedenen religiösen Ausrichtungen in die Einheit der Israelitischen Kultusgemeinden gezwängt. In sich selbst konnten diese Gemeinden allerdings tief gespalten sein. So stellten sich zum Beispiel die Orthodoxen zwar zur Wahl innerhalb der Wiener Kultusgemeinde, ließen aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass nur eine selbstständige, eigene orthodoxe Gemeinde die Möglichkeit böte, » eine Gemeinde nach dem Schulchan Aruch1 zu führen «, und bezeichneten es als einen entwürdigenden Zustand, » von einer modernistisch orientierten Gemeinde « abhängig sein zu müssen.2 Gemeint waren damit vor allem die Liberalen, die noch bei den Kultusgemeindewahlen 1920 56 Prozent der Stimmen erreichten,3 in der österreichischen und Wiener Politik aber vollkommen marginalisiert waren. Doch auch zwischen den orthodoxen Gruppierungen selbst kam es immer wieder zu unterschiedlichen Auffassungen. Besonders in Wien, wo mehr als neunzig Prozent der österreichischen Juden lebten, waren Spannungen zwischen den jüdischen Gruppierungen am deutlichsten zu spüren. Diese beschränkten sich aber nicht nur auf religiöse Differenzen, sondern wurzelten auch stark in soziokulturellen Unterschieden. So verlangte zum Beispiel Samuel Klinger, Warenhändler am Getreidemarkt 17 in Wien, in einer 1892 errichteten testamentarischen Stiftung für jüdische Wöchnerinnen » Frauen, welche in Galizien […] geboren sind, […] von der Betheilung unbedingt « auszuschließen.4 Dies zeigt auf eindringliche Weise einen der wichtigsten trennenden Fakto-
ren innerhalb der Wiener Juden, nämlich die Differenz zwischen sogenannten » Ost-« und » Westjuden «. Die galizischen Juden und Jüdinnen waren nicht nur ein beliebtes Angriffsziel der Antisemiten, sondern sahen sich auch den Anfeindungen ihrer schon länger in Wien ansässigen GlaubensgenossInnen ausgesetzt. Die » Wiener « empfanden Auftreten und Verhalten der » Galizianer « als Peinlichkeit und hielten sich nach Möglichkeit von ihnen fern. Sie waren getrieben von der Furcht, die Bevölkerung könnte nicht zwischen modernen » deutschen Juden « und rückständigen » polnischen Juden « unterscheiden. Gleichzeitig fürchtete man um die
e igene Assimilation und dass die Anwesenheit der » Galizianer « den Antisemitismus durch scheinbar rationale Gründe noch weiter befeuern würde.5 Trotz der prekären wirtschaftlichen Situation der galizianischen Zuwanderinnen und Zuwanderer entstand unter ihnen keine wesentliche jüdische Arbeiterbewegung. Dies war einerseits der Berufsstruktur geschuldet, waren von ihnen doch nur 3,3 Prozent ArbeiterInnen. Andererseits wurden jüdische Lehrlinge, die später vielleicht Träger sozialistischer Ideen werden hätten können, von solchem Gedankengut abgeschirmt. So wurde es ihnen zum Beispiel vom Verein zur Hebung des Handwerkes unter den inländischen Israeliten, einem liberalen jüdischen Hilfsverein, unter Androhung des Ausschlusses verboten, die Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins jüdischer jugendlicher Arbeiter zu besuchen.6 Aber auch die österreichischen Sozialdemokraten sprachen sich gegen eine eigenständige jüdische Arbeiterbewegung aus und lehnten eine solche aus ideologischen Gründen ab. Unter diesen Bedingungen konnten sich nur kleine Zirkel einer jüdischen Arbeiterbewegung in der Leopoldstadt und in der Brigittenau entwickeln, die ideologisch am linken Rand der Sozialdemokratie angesiedelt waren.7 Größere Bedeutung erlangte in Wien nur der Poale-Zionismus ( Arbeiter Zions ), dessen Gründer Ber Borochow aus politischen Gründen aus Russland flüchten musste und der von 1907 bis 1914 im Exil in Wien lebte. Hier gab er das Parteiblatt Dos fraye vort heraus und traf sich mit einer kleinen Gruppe von russisch-jüdischen EmigrantInnen im Café Arkaden in der Reichsratsstraße.8 Kern der Poale-Zion-Ideologie war die Annahme, dass die kapitalistische Entwicklung Osteuropas eine jüdische Massenauswanderung der proletarisierten Juden auslösen werde, deren Ziel Palästina sein werde. Der Poale komme dabei die Aufgabe zu, das palästinensische Proletariat politisch zu organisieren, » den Klassenkampf gegen die Ausbeuter zu führen und die Bildung eines sozialistischen Gemeinwesens in Palästina zu erreichen «.9 Nach dem Krieg verstrickte sich die Poale Zion in heftige Flügelkämpfe zwischen einem rechten, sozialdemokratisch orientierten und einem linken, revolutionär marxistischen Lager. Beim Weltkongress der Poale 1920 in Wien spaltete sich die Partei dann in einen linken und einen rechten Flügel.10 Ein Problem, an dem alle Juden und Jüdinnen, egal ob orthodox, liberal, assimiliert, sozial deklassiert oder der Oberschicht angehörig, litten, war die antisemitische Politik der christlichsozialen Partei, die, gestützt auf das Kurien wahlrecht, seit 1895 im Wiener Gemeinderat die Mehrheit hatte. Entsprechend groß war daher die Erleichterung, als bei den ersten freien und gleichen demokratischen Wahlen zum Wiener Gemeinderat am 4. Mai 1919 die Macht der Christlichsozialen gebrochen war. Jetzt, so konnte man glauben, zeigten sich die wahren politischen Präferenzen der Bevöl-
Titelblatt der Zeitung » D er Jüdische Arbeiter « , 20. April 1927; Goethe-Universität Frankfurt a. M.
kerung. Die SDAP erreichte 54,2 Prozent, die Christlichsozialen stürzten auf 27,1 Prozent ab, drittstärkste Kraft wurden die » Sozialistischen und demokratischen Tschechoslowaken « mit 8,4 Prozent, die Deutschnationalen erreichten 5,2 Prozent und die Vereinigte demokratische Partei 2,6 Prozent. Die Jüdischnationale Partei, die allerdings nur in den Bezirken II, VI, VII, IX und XX kandidiert hatte, erreichte einen Achtungserfolg mit 1,9 Prozent der Stimmen.11 Das Wichtigste für die jüdische Bevölkerung Wiens war die Entmachtung der antisemitischen Christlichsozialen. Das offizielle Organ der Wiener Kultusgemeinde, Dr. Blochs österreichische Wochenschrift. Centralorgan für die gesamten Interessen des Judentums, sprach in diesem Fall wohl tatsächlich für alle jüdischen WienerInnen : » Keine andere politische Partei […] hat mit soviel Brutalität geherrscht, wie die Christlichsozialen in der Wiener Gemeindestube […]. [D]ie Sozialdemokraten und die bürgerlichen Demokraten […] verfolgte er [Lueger] politisch und wirtschaftlich mit leidenschaftlichem Hasse. Nach dem Schlagworte : Nieder mit den Juden ! […] Wir Juden in der Diaspora sind nirgends in der Welt verwöhnt worden, […] aber die Art und Weise, wie die Christlichsozialen Wiens uns gegenüber ihr Programm ein Vierteljahrhundert hindurch ausführten, steht einzigartig in
Postkarte : Ber Borochow, um 1910; Jüdisches Museum Wien, Inv. Nr. 4.880
63
64
der modernen Weltgeschichte da. «12 Bedauerlich fand man, dass nur vier Mandatare gewählt worden waren, die sich für die Interessen der jüdischen Bevölkerung einsetzen würden. Zu diesen zählte die Zeitschrift den für die Vereinigte demokratische Partei angetretenen Rudolf Schwarz-Hiller und die für die Jüdischnationale Partei gewählten Bruno Pollack- Parnau, Jakob Ehrlich und Leopold Plaschkes. Von der Sozialdemokratie, die von nun an die Politik der Stadt bestimmen würde, erhoffte sich Blochs Wochenschrift nur, » dass sie sich von den manchmal zu sehr verlockenden Rufen ihres Zen tralorgans der Arbeiter Zeitung emanzipieren und den Juden gegenüber einen gerechten Standpunkt einnehmen wird «.13 Gründe für eine distanzierte Haltung zur Sozialdemokratie hatte man durchaus. Die galizianischen Juden, die während und nach dem Ersten Weltkrieg nach Wien geflüchtet waren, wurden von Antisemiten zu einer beispiellosen Hetzkampagne genutzt. Pauschal wurde ihnen vorgeworfen, sie seien Spekulanten, Kriegsgewinnler, Geschäftemacher, linke Umstürzler, und überdies würden sie auch noch Krankheiten einschleppen. Die Sozialdemokratische Partei nahm dabei einen ambivalenten Standpunkt ein. Einerseits warnte man vor » Pogromen « und versuchte, konkrete Hilfe zu leisten, andererseits wollte man nicht als » Judenschutztruppe « wahrgenommen werden. Damit reihte man sich aber alles in allem » in den allgemeinen Konsens der gegen die › Ostjuden ‹ gerichteten antisemitischen Stimmung und Politik nach dem Ersten Weltkrieg « ein.14 Höhepunkt dieser Haltung war der Erlass des sozialdemokratischen niederösterreichischen Landeshauptmanns Albert Sever im September 1919, der damit die Ausweisung von jüdischen Kriegsflüchtlingen amtlich verordnen wollte. Der Erlass wurde nur in Ansätzen ausgeführt, aber auch nie aufgehoben, und verunsicherte die Flüchtlinge, und nicht nur sie, zutiefst. Auch das Parteiorgan der Poale Zion, die Freie Tribüne, die bei den Wahlen zur deutsch österreichischen Nationalversammlung die sozial demokratischen Kandidaten unterstützt hatte, zeigte sich über antisemitische Anwandlungen der Sozialdemokraten irritiert. Die Poale hatte am 1. Mai 1919 an der von den Kommunisten organisierten Maidemonstration teilgenommen, was die Arbeiter-Zeitung dazu veranlasst hatte, die Veranstaltung als eine mit einem » sehr starken galizischen Einschlag « 15 zu kritisieren. In Antwort darauf schrieb die Freie Tribüne, dass dieser » brüderliche Maiengruß der AZ « sie jedenfalls davon überzeuge, » dass sie mit dem d.[eutsch]-ö.[sterreichischen] Flügel der Internationale nichts, aber schon gar nichts
gemeinsames habe. […] Das Wiener antisemitische Lokal kolorit hat eine neue Note erhalten und nennt man die Namen der Judenverächter, so darf der Redakteure der Arbeiterzeitung nicht vergessen werden. « 16 Von dem Sieg der Sozialdemokraten bei den Gemeinderatswahlen zeigte man sich wenig beeindruckt : » Aber all das ist jetzt dem erwachten Proletariat zu wenig. […] Für diese schwere Aufgabe ( den Aufbau einer neuen Welt ) genügt nicht mehr die vom arbeitenden Volk und Leben losgelöste parlamentarische Redemaschinerie […]. Das Prinzip des bürgerlichen Parlamentarismus ist überholt. Der Grundsatz bürokratischer Gesetzgebung und Verwaltung – und nenne sie sich auch sozialistisch und demokratisch – ist im Absterben und erledigt. « 17 Den Sozialdemokraten schlug also nach ihrem ersten Wahlerfolg Skepsis sowohl von offizieller Seite der Kultusgemeinde (IKG) als auch von jüdischen Sozialisten entgegen. Ein Blick auf das Ergebnis der Kultusgemeindewahlen von 1920 zeigt ein dem Ergebnis der Gemeinderatswahlen vollkommen entgegengesetztes Bild. In der IKG erreichten
Fotografie einer Mitgliedskarte der Poale Zion, um 1920; Jüdisches Museum Wien, Inv. Nr. 25.499
die Liberalen 56 Prozent, die Zionisten 35,2 Prozent und die Orthodoxen 8,4 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten kamen nur auf 0,5 Prozent.18 Obwohl es in der IKG kein allgemeines Wahlrecht gab – Frauen waren von den Wahlen ausgeschlossen und bis 1924 ebenso nichtösterreichische Staatsbürger und Kultusgemeindebeamte –, erscheint das Ergebnis nicht unrepräsentativ für die jüdische Bevölkerung Wiens. Schon allein deren berufliche Zusammensetzung legt dies nahe. So waren rund 46,8 Prozent aller erwerbstätigen Juden in Wien Selbstständige, 26,2 Prozent Angestellte und 21,2 Prozent Arbeiter und Tagelöhner.19 Man kann also davon ausgehen, dass innerhalb des Wiener Judentums die politische Einstellung mehrheitlich den Liberalen zuneigte, da
man von den Sozialdemokraten nicht erwarten konnte, dass sie die Interessen von Selbstständigen und Angestellten vertreten würden. Gleiches gilt für die AnhängerInnen der Poale Zion, in der zu diesem Zeitpunkt noch der linke Flügel, der sich an Marxismus und Kommunismus orientierte und von der Weltrevolution träumte, die Oberhand hatte und der Sozialdemokratie vorwarf, die Ziele des Sozialismus zu verraten. In den folgenden Jahren sollten sich die Kräfteverhältnisse verschieben, wie die Ergebnisse der Kultusgemeindewahlen von 1924, 1928 und 1932 zeigen. 1924 stellten sich die Liberalen gemeinsam mit den Zionisten zur Wahl und erreichten 75,4 Prozent der Stimmen, die Sozialdemokraten konnten ihren Anteil auf 15,2 Prozent steigern. Bei den folgenden Wahlen sank der Anteil der Liberalen, und die Zionisten konnten Gewinne einfahren, während die Sozialdemokraten mit 15 Prozent ( 1928 ) und 12,4 Prozent ( 1932 ) nur relativ leichte Verluste hinnehmen mussten.20 Dass die Wahlen in der Kultusgemeinde aber nicht einmal die komplexe gesellschaftliche Realität innerhalb der jüdischen Gemeinde widerspiegelten, mussten insbesondere die Österreichisch-Israelitische Union sowie die bürgerlichen zionistischen Organisationen, die immer wieder den Anspruch stellten, alle österreichischen Jüdinnen und Juden zu vertreten, schmerzlich zur Kenntnis nehmen. Es herrschte Uneinigkeit in politischen Fragen, und man war geradezu empört, dass die Angestellten der Wiener Kultusgemeinde » beinahe geschlossen für die sozialdemokratische Liste « agitierten.21 Dies wiederum nahm die Arbeiter-Zeitung mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis : » Den größten Verdruß haben den Jüdischnationalen die Angestellten der Kultusgemeinde bereitet, deren überwiegende Mehrheit offen und mutig für die Sozialdemokraten wirbt. Viel zu viel haben die Angestellten unter der Herrschaft der organisierten Großkapitalisten in der Kultusstube gelitten, die den Angestellten die primitivsten sozialen Menschenrechte vorenthalten. « 22 Es wird angenommen, dass die Hälfte der Wiener Juden und Jüdinnen bei den Nachkriegswahlen bis 1923 sozialdemokratisch wählte und danach bis zu 70 und 90 Prozent.23 Dies war aber nicht den tatsächlichen politischen Präferenzen geschuldet. Gemessen am hohen Anteil der Selbstständigen wäre es viel wahrscheinlicher gewesen, hätten Juden konservativ oder liberal gewählt. Die Liberalen, die in der Ersten Republik jedwede Relevanz verloren hatten, standen als politische A lternative nicht mehr zur Verfügung, und die Christlichsozialen waren mit ihren wirtschafts politischen Programmen ständisch, r eaktionär und
Wahlaufruf der Poale Zion für die sozialdemokratische Partei : » J üdische Wähler und Wählerinnen ! / schwester un brider ! « , 1930; ÖNB Wien PLA16316177
65
66
polemisierten gegen den Handel und die marktwirtschaftliche Ordnung.24 Auch waren die Christlichsozialen noch immer zutiefst antisemitisch, und die Juden hatten die L ueger-Jahre nicht vergessen. Dies traf ebenso auf die Großdeutschen und den Landbund zu, die aus den gleichen Gründen unwählbar waren. Als einzige wählbare Alternative blieben die Sozialdemokraten und die zionistische Jüdischnationale Partei. Der Zionismus erschien aber dem Großteil des liberalen und assimilationsbereiten Wiener Bürgertums als eine politische Option für die armen galizianischen Brüder und Schwestern, nicht aber für sie selbst. So erreichte die Jüdischnationale Partei bei der Wiener Gemeinderatswahl von 1923 zwar das beste Ergebnis ihrer Geschichte, hatte aber dennoch nur 24.253 WählerInnen, was zwölf Prozent der Wiener jüdischen Bevölkerung entsprach. Gegenüber der sozialdemokratischen Gemeinde politik legte die Jüdischnationale Partei eine ambivalente Haltung an den Tag. Bis 1923 stimmte sie für das von den Sozialdemokraten vorgelegte Budget, 1924 lehnte der Mandatar der Partei, Leopold Plaschke, gemeinsam mit den Christlichsozialen den Etat ab und griff in der Budgetdebatte 1925 die Sozialdemokraten und insbesondere Hugo Breitner wegen seiner kommunalen Kredit- und Steuerpolitik an.25 Diese antisozialdemokratische Haltung, die sich schon im Wahlkampf angekündigt hatte, wird im Organ der Partei, der Wiener Morgenzeitung, so artikuliert : » Die Menschheit ist nicht dazu erschaffen, um nur schwarz oder rot zu sein, und ein von Juden gewählter Jude wird das Judentum, aber auch die Freiheit schützen und nie für die Reaktion eintreten. Aber wenn wir so freiheitlich sind, wie es uns das Judentum diktiert, brauchen wir kein sozialdemokratisches Rezept für die Freiheitlichen und die Freiheit wird dabei nicht schlechter fahren. « 26 Bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen im April 1927 wuchs der Frust der Jüdischnationalen Partei über die offensichtliche Unmöglichkeit, ein größeres jüdisches Elektorat anzusprechen, und über die Attraktivität,
Visitenkarte des Kabarettisten Fritz Grünbaum mit der Aufschrift : » b ittet Sie, verehrter Kollege, Ihr Wahlrecht im Sinne der sozialdemokratischen Partei auszuüben « , 1927; Jüdisches Museum Wien, Inv. Nr. 13.545
die die Sozialdemokratische Partei auf jüdische WählerInnen ausübte. Nachdem man bei den Wahlen nur noch 7.172 Stimmen erreichte, blieb nur mehr die nüchterne Erkenntnis : » Von den 120.000 jüdischen Wählern Wiens mag vielleicht die Hälfte der Sozialdemokratie verfallen oder in irgend einer Art wirtschaftlich von ihr abhängig sein. « 27 Bezeichnend dafür wahrscheinlich die Haltung von Felix Salten und Fritz Grünbaum. Salten publizierte in der Wiener Sonn- und Montagszeitung vom 4. April 1927 einen Wahlaufruf für die Sozialdemokratie,28 während Grünbaum privat auf seinen Visitkarten aufforderte : » bitte verehrter Kollege, Ihr Wahlrecht im Sinne der sozialdemokratischen Partei auszuüben « 29. Anders als die Wiener Morgenzeitung beurteilte naturgemäß der Jüdische Arbeiter, Organ der Poale Zion, die Arbeit und die Erfolge der Sozialdemokratie. Im Vorfeld der Gemeinderatswahlen 1927 veröffentlichte die Zeitung einen Aufruf » An alle arbeitenden Juden ! «, in dem die rhetorische Frage » Wo ist nun der Platz der jüdischen Wähler ? « gestellt und auch beantwortet wurde. Nämlich dass sowohl die jüdischen ArbeiterInnen als auch die Angestellten gemeinsam » mit dem ganzen Proletariat Oesterreichs « einen Kampf für » bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen, für soziale- und Schulgesetze, für eine neue Gesellschaft auf sozialistischer Grundlage « führen würden und dass man sich in den Kampf stürzen werde » für die Rechte der Beraubten und Verelendeten, in den Kampf für den Sieg des Sozialismus ! «.30 Gleichzeitig warnte man vor dem Rechtsruck, zu dessen Zweck sich die Christlichsozialen mit den Großdeutschen und den » Hakenkreuzlern « verbündet hätten. Wie die sozialdemokratische Propaganda warnte der Jüdische Arbeiter vor dem Antisemitismus, der vor allem die » kleinen, die armen Juden « treffe und nicht die » großen Finanzjuden «, mit denen die Christlichsozialen gemeinsame Sache machen würden.31 Auch bei den Gemeinderatswahlen 1932 sah die Poale Zion in der Sozialdemokratie die einzige jüdische Wahlmöglichkeit und forderte die Wiener Juden und Jüdinnen auf, sozialdemokratisch zu wählen. Denn neben all den Errungenschaften wie Wohnungsbau etc. hätte sich die » sozialdemokratische Stadtverwaltung […] als unüberwindlicher Wall gegen Reaktion und Judenhaß erwiesen «.32 Man fügte zwar an, dass keine » besonderen Schutzmaßnahmen für die Juden « getroffen worden wären, aber » ihre Treue zur Idee des völkerbefreienden internationalen Sozialismus « biete » die sicherste Gewähr, daß sie Reaktion und Judenhaß nicht dulde «. Viele jüdische Wählerinnen und Wähler dürften das ähnlich gesehen haben, auch wenn sie mit der Ideologie der Sozialdemokraten nicht übereinstimmten. Weil es für die jüdische Bevölkerung jenseits der Jüdischnationalen Partei keine politische Alternative gab, konnte sich die Sozialdemokratie der
jüdischen Stimmen sicher sein. Zwar verwendeten auch die Sozialdemokraten in ihrer Rhetorik immer wieder antisemitische Stereotype, hatten aber im Gegensatz zu ihren politischen Mitbewerbern zu keinem einzigen Zeitpunkt den Antisemitismus in ihrem Programm. Zentrale Persönlichkeiten der österreichischen Sozialdemokratie waren jüdischer Abstammung – dies hatte zwar kaum Bedeutung für sie, dennoch waren viele Nichtjuden und Antisemiten besessen von deren Hintergrund. Zumeist waren die sozialdemokratischen Führer aber konfessionslos, Atheisten oder Freidenker und orientierten sich an der deutsch-österreichischen Kultur.33 Für viele jüdische WählerInnen traf sicherlich dasselbe zu, und die Sozialdemokratie war für sie eine charismatische Bewegung, die den Glauben der Väter ersetzte und ihnen eine politische Heimat gab. Sie bot die Möglichkeit, dem Ghetto, dem Judentum und der sozialen Marginalisierung zu entkommen.34 Für traditionelle Juden musste es allerdings schwierig gewesen sein, einer antireligiösen sozialistischen Partei ihre Stimme zu geben, die zudem die Hoffnung auf
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Schulchan Aruch, wörtlich » gedeckter Tisch «, eine seit dem 16. Jahrhundert immer wieder überarbeitete autoritative Zusammenfassung religiöser Vorschriften. Jüdische Presse. Organ für die Interessen des orthodoxen Judentums 14 ( 1928 ) 31, S. 1. Vgl. Harriet Pass Freidenreich : Jewish Politics in Vienna, 1918 – 1938, Bloomington 1991, S. 219. Niederösterreichisches Landesarchiv ( NÖLA ), Stiftbriefe, Samuel Klinger Stiftung für jüdische Wöchnerinnen, zit. n. Gerhard Milchram : Bilder des Elends. Die Fotografien zu Bruno Freis Buch » Jüdisches Elend in Wien «, in : Juden in Mitteleuropa ( 2007 ), S. 26 – 32, hier S. 30. Almut Meyer : »… der Osten Europas schüttet sie aus …«. Zur Migration osteuropäischer Juden bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, in : Gabriele KohlbauerFritz ( Hg.): Zwischen Ost und West. Galizische Juden und Wien, Wien 2000, S. 29. Vgl. Klaus Hödl : Als Bettler in der Leopoldstadt. Galizische Juden auf dem Weg nach Wien, Wien/Köln/Weimar 1994, S. 172f. Vgl. Thomas Soxberger : Revolution am Donaukanal. Jiddische Kultur und Politik in Wien 1904 bis 1938, Wien 2013, S. 115. Vgl. Gabriele Kohlbauer-Fritz : Die jiddische Subkultur in Wien und die jüdische Arbeiterbewegung, in : Markus Börner, Anja Jungfer, Jakob Stürmann ( Hg.): Judentum und Arbeiterbewegung. Das Ringen um Emanzipation in der Ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Berlin/Boston 2018, S. 53. Soxberger, Revolution, S. 114. Einen genauen Überblick über die komplizierten inneren Dynamiken und Widersprüche innerhalb der österreichischen Poale Zion bei : Soxberger, Revolution, S. 112 – 139.
11
12
13 14
15 16
17 18 19
20 21 22
die Verteidigung gegen antisemitische Angriffe immer wieder aus taktischen Erwägungen nicht erfüllte. Und so blieb der liberalen Wahrheit nach den Wahlen von 1932 nur enttäuscht zu konstatieren, dass die Sozialdemokratie im Kampf der Nationalsozialisten allein » den Haß des bürgerlichen Spießertums gegen die Arbeiter « sehe und keine Worte fände, » um der verdammenden Abscheu vor dem demagogischen Antisemitismus der Nationalsozialisten Ausdruck zu geben «. Abschließend stellte man noch resignierend fest : » Wir sind überzeugt, Herr Abgeordneter Leuthner35 wird durch seine Äußerungen über › jüdisch-kapitalistische Verbrechen ‹ und über › die schmutzigen Hände jüdischer Bankiers ‹ sich sicherlich Wohlgefallen gar vieler seiner Parteigenossen erworben haben, in deren Reihen es auch nicht an gelehrigen Antisemiten fehlt. « 36
Vgl. Albert Lichtblau : Jüdische Politik im » Roten Wien «: Das Wirken zionistischer Mandatare im Wiener Gemeinderat, in : Jahrbuch des Simon-DubnowInstituts. Simon Dubnow Institute Yearbook 10 ( 2011 ), S. 283 – 306, hier S. 290. J. Grobtuch : Nach den Wahlen, in : Dr. Blochs österreichische Wochenschrift. Centralorgan für die gesamten Interessen des Judentums, 9. Mai 1919, S. 282. Ebd., S. 283. Margit Reiter : Die österreichische Sozialdemokratie und Antisemitismus. Politische Kampfansage mit Ambivalenzen, in : Thomas Albrich, Gertrude EnderleBurcel, Ilse Reiter-Zatloukal ( Hg.): Antisemitismus in Österreich 1933 – 1938, Wien/Köln/Weimar 2018, S. 361 – 380, hier S. 365. Arbeiter-Zeitung, 2. Mai 1919, S. 4. Der Maiengruß der Arbeiterzeitung, in : Freie Tribüne. Organ der jüdischen sozialistischen Arbeiterpartei » Poale Zion « 1 ( 1919 ) 17, S. 1. Die Macht in Stadt und Land erobert, in : Freie Tribüne 1 ( 1919 ) 17, S. 2. Vgl. Lichtblau, Jüdische Politik im » Roten Wien «, S. 289. Vgl. Albert Lichtblau : Partizipation und Isolation. Juden in Österreich in den » langen « 1920er Jahren, in : Archiv für Sozialgeschichte 37 ( 1997 ), S. 232 – 253, hier S. 246. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 1910, danach gab es keine Auswertungen der Berufsstatistik nach Konfession, Annahmen von Änderungen in dieser Zusammensetzung können nur spekulativ sein. Vgl. ders., Jüdische Politik im » Roten Wien «, S. 289. Die Wahrheit. Unabhängige Zeitschrift für jüdische Interessen 39 ( 1923 ) 22, S. 4. Arbeiter-Zeitung, 3. Oktober 1923, S. 9.
23
24 25 26 27 28
29 30
31 32
33
34 35
36
Vgl. Walter B. Simon : The Jewish Vote in Austria, in : Leo Baeck Institute, Year Book 16 ( 1971 ), S. 97 – 121, hier S. 117. Vgl. Lichtblau, Partizipation und Isolation, S. 241. Vgl. ders., Jüdische Politik im » Roten Wien «, S. 296f. Wiener Morgenzeitung, 19. Oktober 1923, S. 3. Wiener Morgenzeitung, 26. April 1927, S. 2. Vgl. Siegfried Mattl, Werner Michael Schwarz : Felix Salten. Annäherung an eine Biografie, in : dies. ( Hg.): Felix Salten. Schriftsteller – Journalist – Exilant, Wien 2006, S. 14 – 73, hier S. 56. Visitenkarte von Fritz Grünbaum, Jüdisches Museum Wien, Inv. Nr. 13.545. Der Jüdische Arbeiter. Organ der jüdischen sozialdemokratischen Arbeiterorganisation Poale Zion, Wien 4 ( 1927 ) 4, S. 1. Ebd. Der Jüdische Arbeiter. Organ der Vereinigten zionistisch-sozialistischen Arbeiterorganisation Poale ZionHitachduth in Österreich 9 ( 1932 ) 8, S. 1. Vgl. Robert S. Wistrich : Socialism and the Jews. The Dilemmas of Assimilation in Germany and Austria-Hungary, Rutherford, N.J. 1982, S. 333. Vgl. ebd. Karl Leuthner ( 1869 – 1944 ), Nationalratsabgeordneter der SDAP und Redakteur der Arbeiter-Zeitung. Die Wahrheit. Jüdische Wochenschrift mit den Veröffentlichungen der » Union österreichischer Juden « und den Amtlichen Verlautbarungen der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 18 ( 1932 ) 19, S. 1.
67
Historischer Text 68
Wahlaufruf der jüdischen s ozialdemokratischen Arbeitero rganisation Poale Zion Aus : Der Jüdische Arbeiter. Organ der jüdischen sozialdemokratischen Arbeiterorganisation Poale Zion, Wien, 20. April 1927, S. 1
An alle arbeitenden Juden ! Jüdische Wähler und Wählerinnen ! Am 24. April finden die Wahlen zum österreichischen Nationalrat und Wiener Gemeinderat statt. Mehr denn je bedeuten diesmal die Wahlen im Wesen den Kampf zwischen der vereinigten Reaktion auf der einen und der sozialdemokratischen Partei auf der anderen Seite. Wo ist nun der Platz der jüdischen Wähler ? Die jüdischen Arbeiter und Angestellten werden die Frage kurz beantworten. Gemeinsam mit dem ganzen Proletariat Österreichs führen sie nicht nur während der Wahlen, sondern während ihres ganzen Lebens den Kampf für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen, für soziale- und Schutzgesetze, für eine neue Gesellschaft auf sozialistischer Grundlage. Sie, besonders die jüdischen Angestellten, die durch die Krise namentlich durch das Zugrundegehen so vieler Banken massenhaft Arbeit und Erwerb verloren haben, werden alle Gefühle von Verzweiflung und Kleinmut unterdrücken und mit ihrer ganzen Leidenschaft sich in den Kampf stürzen für die Rechte der Beraubten und Verelendeten, in den Kampf für den Sieg des Sozialismus. Wohin aber gehören die jüdischen Handwerker, Kleinkaufleute, die Hausierer und Agenten, die breiten jüdischen Massen überhaupt ? In der Hauptsache gilt der Kampf der Frage des Mieterschutzes. Die jüdischen Kaufleute und Handwerker, die jüdischen Ärzte und Anwälte haben dasselbe Interesse wie die Arbeiter, daß der Mieterschutz erhalten wird, daß die Sozialdemokratie siegt ! Ebenso haben die Massen der selbständigen Handelund Gewerbetreibenden in den Fragen der Zoll- und Handelspolitik dieselben Interessen wie die Arbeiter. Insbesondere müssen sie den Kampf der Sozialdemokraten gegen das neue Zollattentat auf die wichtigsten Lebensmittel unterstützen, da dasselbe nur den großen Grundbesitzern zum Vorteile der ganzen städtischen Bevölkerung zum Nachteile gereicht. Überhaupt bedürfen die Massen der kleinen Kaufleute und
Handwerker kaufkräftiger Arbeitermassen, ihr Interesse erfordert es daher, daß die Arbeitslosigkeit, wenn nicht beseitigt, so doch verringert wird, denn ein höheres Lebensniveau der Arbeiter bedeutet auch leichteren Erwerb, bessere Lebensmöglichkeit der breiten Massen der selbständigen H andelsund Gewerbetreibenden. Unterstützet deshalb die Sozialdemokratie nicht bloß im Kampfe um den Mieterschutz, sondern auch in der Steuer- und Finanzpolitik, ebenso wie in der Sozialpolitik ! Deshalb sind auch alle, welche erklären, daß sie wohl Freunde des Mieterschutzes, zugleich aber Gegner der Gemeindebauten, der » Breitner-Steuern « sind, in Wirklichkeit Feinde der breiten Massen. Wenn man jeder Familie die Wohnung, dem Geschäftsmann seinen Laden, seine Werkstätte oder sein Bureau sichern will, dann muß man der Gemeinde die Mittel und die Steuern geben, damit sie bauen kann, schön und behaglich bauen kann. Aber abgesehen von den Bauten : Sieht man denn nicht, daß die sozialistisch verwaltete Gemeinde das Geld für produktive und soziale Zwecke verwendet, während der Bund es für bankerotte Banken verschwendet ? In ökonomischen Fragen muß man ganz für die Sozialdemokratie sein, denn sonst ist man gegen sie und notwendigerweise für die christlichsoziale Einheitsfront. Dies ist auch die erste, wenn auch nicht die einzige Sünde der Herren der » Jüd. Liste «. Aus Angst, daß die jüdischen Wähler sie von vornherein beiseite schieben sollten, erklären sie sich für den Mieterschutz, aber im selben Atemzug schleudern sie ihre Angriffe gegen die Gemeindebauten, gegen die Breitner-Steuern, gegen die Sozialdemokratie überhaupt. Schon deshalb allein verdienen sie kein Vertrauen. Doch nicht bloß um den Mieterschutz gehen die Kämpfe. Der Kampf wird auch darum geführt, ob die Reaktion überhaupt siegen, ob, wie der Prälat Seipel erklärt hat, » ein Ruck
nach rechts « kommen soll. Zu diesem Zwecke haben sich die Christlichsozialen nicht nur mit den Großdeutschen, sondern auch mit den Hakenkreuzlern verbunden. Schon der Antisemitismus der Christlichsozialen schlägt der Ehre der jüdischen Bevölkerung ins Gesicht und drangsaliert sie, wo er nur kann. Freilich nicht die großen Finanzjuden, mit denen sie gemeinsame Sache machen, sondern die kleinen, die armen Juden treffen sie. Aber dieser Antisemitismus ist noch eine Spielerei dem wilden, bestialischen Antisemitismus der Hakenkreuzler gegenüber. Mit Ihnen aber hat sich Seipel verbunden. Denn jedes Mittel erscheint gut im Kampfe gegen die Sozialdemokratie, für die Reaktion. Aber wir, die breiten jüdischen Massen, wissen, daß die mit den Hakenkreuzlern gewürzte Reaktion eine große Gefahr für uns bedeutet. Die Reaktion ist der größte Feind der jüdischen Masse. Deshalb alle Kräfte gegen die Reaktion, gegen die Einheitsliste, alle Stimmen für die Sozialdemokratie. Deshalb treten wir auch gegen die » Jüdische Liste « auf, die nur die Sozialdemokratie schwächen, die Reaktion stärken kann. Diesmal zeigen die Herren der » Jüdischen Liste « besonders deutlich, daß ihre Arbeit gegen das Inte resse der breiten jüdischen Massen ist. Erstens weil sie es für gut finden, zusammen mit den erklärten Reaktionären und Antisemiten, zusammen mit den großen Finanzjuden, den schon-getauften und noch-nicht-getauften Beherrschern der Banken den Kampf gegen die Breitner-Steuer, gegen die Verwaltung der Wiener Gemeinde zu führen. Zweitens aber treiben die Herren der » Jüdischen Liste « die bürgerlichen Zionisten eine falsche Politik überhaupt, indem sie einen geistigen Abgrund zwischen den jüdischen Massen einerseits und der Sozialdemokratie andererseits schaffen wollen. Hiebei darf nicht übersehen werden, daß von nationalen Forderungen keine Rede ist. Die Vertreter der » Jüdischen Liste « versuchen wohl die Frage zu verdunkeln, indem sie nationale Phrasen gebrauchen, doch sie meinen es selbst nicht ernst. Es genügt darauf hinzuweisen, daß sie bei den Wahlen im Jahr 1923 sich mit den Leuten von der » Israelitischen Union « verbunden und sich damals ausdrücklich verpflichtet haben, keine nationalen Forderungen zu erheben. Nun, von 1923 bis 1927 ist doch in dieser Hinsicht nichts anders geworden : Der Ehekontrakt zwischen den bürgerlichen Zionisten und der Israelitischen Union ist zwar gelöst worden, aber nicht etwa deshalb, weil die bürgerlichen Zionisten sich eines anderen besonnen und plötzlich nationale Forderungen an den österreichischen Staat haben stellen wollen, sondern deshalb die » Israelitische Union « einfach keine Lust mehr hatte, ihnen mit Geld für die Agitation und mit Stimmen für Dr. Plaschkes zu helfen. Mögen also die Herren von der jüdischen Liste mit den bloßen Phrasen wegen der » nationalen Interessen « ihrer Zuhörer nicht betäuben.
Eine solche Arbeit wäre nur geeignet, die jüdischen Volksmassen dort, wo es wirklich lebendige jüdische Volksinte ressen gibt, von der natürlichen Hilfe, von dem internationalen Sozialismus zu isolieren. Doch daß dies nicht geschehe, dafür sorgen wir jüdischen Sozialisten ständig, dafür mögen die jüdischen Wähler bei den Wahlen sorgen. Brandmarkt als Verräter jene Finanzjuden und Presse juden, die dem jüdischen Volke ins Gesicht speien und für die Antisemiten der christlichsozial-hakenkreuzlerischen Einheitsliste agitieren ! Kämpft auch gegen die Kandidaten der sogenannten Demoratischen und der » Jüdischen Liste «, denn bewußt oder unbewußt stärken sie die Kraft der antisemitischen Reaktion, des ärgsten Feindes der jüdischen Volksmassen. Stimmt für die Kämpfer für ein besseres und freieres L eben, für eine Gesellschaft ohne soziale und natzionale Unterdrückung, für die völkerbefreiende Sozialdemokratie ! Die arbeitende jüdische Bevölkerung kann und darf wohl von der österreichischen Sozialdemokratie verlangen, daß sie ihren lebenswichtigen Wünschen und Forderungen Rechnung trage. Wir verlangen von der Sozialdemokratie, daß sie der antisemitischen Verseuchung der Massen energisch an den Leib rücke, daß sie uns ermögliche, der Entfremdung unserer jungen Generation vom jüdischen Volke entgegenzuwirken, daß sie das große Werk des Aufbaues eines arbeitenden Palästina fördere. Diese Forderungen befinden sich im Einklange mit den Grundsätzen der wahrhaften Demokratie, des völker befreienden Sozialismus, sie sind Gemeingut des internationalen Sozialismus. In Kampfbereitschaft mit der österreichischen Arbeiterschaft wollen wir für diese Forderungen eintreten und die ihr zur Kenntnis bringen. Unterfertigt die von unserer Organisation ausge gebenen Erklärungen ! Die Regeneration unseres Volkes ist eine Tat des Fortschrittes, der nationalen und sozialen Befreiung, sie gebietet uns deshalb Schulter an Schulter mit den verläßlichsten Kämpfern der Freiheit zu marschieren. Arbeitende Juden ! Bekennet euch zu unseren Forderungen ! Stimmet geschlossen und werbet für die Sozialdemokratie !
69
70
S OZ I A L D E M O K R AT I E UND ANTISEMITISMUS Gerhard Milchram
In der Prinzipienerklärung des Hainfelder Programms der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs von 1888/89 wurde unmissverständlich festgehalten, dass die Partei » für das gesamte Volk ohne Unterschied der Nation, der Rasse und des Geschlechtes die Befreiung aus den Fesseln der ökonomischen Abhängigkeit, die Beseitigung der politischen Rechtlosigkeit und die Erhebung aus der geistigen Verkümmerung « anstrebt.1 Friedrich Engels, Mitbegründer der marxistischen Theorien, und August Bebel, einer der Gründer der deutschen Sozialdemokratie, verurteilten in den 1890er Jahren jegliche Feindschaft gegenüber Juden und setzten sie erstmals nicht mit dem Kapitalismus gleich, sondern sahen sie als mögliche Verbündete im Kampf für den Sozialismus.2 Auch trat man durchaus der Hetze gegen Juden entgegen. So sagte Jakob Reumann auf einer Versammlung in den 1890er Jahren : » Die Sozialdemokraten sind den Antisemiten gegenüber auf einem vorgeschritteneren Standpunkt, weil sie das internationale, interconfessionelle Capital bekämpfen. Die Sozialdemokraten bekämpfen jüdisches und christliches Kapital, die Antisemiten nur das jüdische, um es einstecken zu können. « 3 Diese theoretische, im sozialistischen Denken und dem sozialdemokratischen Programm begründete Ablehnung von Rassismus und Antisemitismus war eine Sache, sie in der täglichen politischen Praxis umzusetzen eine andere. Bereits 1884 musste Karl Kautsky, der führende marxistische Theoretiker seiner Zeit, feststellen : »[…] wir haben Mühe, unsere eigenen Leute zu hindern, daß sie nicht mit den Anti semiten fraternisiren. « 4 Besonders im deutschsprachigen Teil der Monarchie und in Wien fasste der Antisemitismus als politisches Programm immer stärker Fuß. Mit den Wahlerfolgen der Christlichsozialen unter Karl Lueger erreichte er einen ersten Höhepunkt und gewann gesellschaftliche und politische Legitimation. Immer größere Teile der Bevölkerung wurden davon erfasst.5 Davon blieb die Sozialdemokratie nicht unberührt, und sie war vor allem auch nicht immun dagegen.
Zu den populärsten Führern der österreichischen ArbeiterIn nenbewegung zählten Intellektuelle aus einem jüdisch- bürgerlichen und deutsch assimilierten Milieu. Führende Funktionen in der Sozialdemokratie setzten ein hohes Maß an Assimilation voraus und führten in der Auseinandersetzung mit den antisemitischen Parteien zu starken inneren und äußeren Widersprüchen.6 In ihrer theoretischen Haltung zur » Judenfrage « und zum Antisemitismus war man in Übereinstimmung mit anderen SozialistInnen der Zeit der Meinung, der Antisemitismus sei ein reaktionäres, zum Untergang verurteiltes gesellschaftliches Phänomen. Die Assimilation der Juden in der propagierten sozialistischen Revolution würde das Problem lösen.7 Für die meisten der führenden jüdischen Persönlichkeiten der Partei hatte das eigene Judentum deshalb auch keine besondere Bedeutung mehr. Dennoch w aren
sie wegen ihres Judentums immer wieder Angriffen aller anderen Parteien ausgesetzt. Die Antisemiten sahen darin eine Möglichkeit, die Sozialdemokratie als » verjudet « zu denunzieren und ihre Wahnfantasien einer jüdischen Weltverschwörung zu propagieren. In den Anfangsjahren der Ersten Republik wurden die vielen osteuropäischen Juden, die zu einem nicht unbedeutenden Teil während des Ersten Weltkriegs als Flüchtlinge nach Wien gekommen waren, zur Zielscheibe der antisemitischen Angriffe. Sie dienten allen Parteien als Projektionsfläche für ihre jeweiligen Vorurteile. Treffend charakterisierte Joseph Roth deren Situation : » Niemand nimmt sich ihrer an. Ihre Vettern und Glaubens genossen, die im ersten Bezirk in den Redaktionen sitzen, sind › schon ‹ Wiener, und wollen nicht mit Ostjuden verwandt sein oder gar verwechselt werden. Die Christlichsozialen und Deutschnationalen haben den Antisemitismus als wichtigen Programmpunkt. Die Sozialdemokraten fürchten den Ruf einer › jüdischen Partei ‹. « 8 Zerrissen zwischen den eigenen universalistischen, humanistischen und antirassistischen Ansprüchen und den Forderungen der antisemitischen Parteien, bot die sozialdemokratische Wiener Stadtverwaltung einerseits den ostjüdischen Flüchtlingen konkrete Hilfestellungen an, versuchte, sie zu integrieren, und warnte vor Pogromen, beteiligte sich andererseits aber auch an Gedankenspielen über eine mögliche Abschiebung.9 So versuchte zum Beispiel der sozialdemokratische Landeshauptmann von Niederösterreich und Wien, Albert Sever, 1919 die Ausweisung von jüdischen Kriegsflüchtlingen amtlich zu verordnen. Damit reihte sich auch die Sozialdemokratie in den allgemeinen antisemitischen Konsens gegen die » Ostjuden « in der Zeit der Entstehung der österreichischen Demokratie ein.10 Ein anderes › Hindernis ‹ dabei, sich mit dem Antisemitismus auseinanderzusetzen, war der Kampf gegen den Kapitalismus und dessen Protagonisten, den ausbeuterischen Kapitalisten. Victor Adler hielt zwar den Tatsachen entsprechend fest, dass die große Mehrheit der Juden weder Industrielle noch Bankiers seien, kam aber überraschenderweise zu dem Schluss, die Sozialdemokratie dürfe sich nicht von » den Juden « ausnützen lassen.11 In der antisemitisch aufgeheizten Stimmung übernahm man fatalerweise die christlichsoziale Vorstellung, die nach dem Ideologen der Bewegung, Karl Freiherr von Vogelsang, Kapitalismus und Judentum gleichsetzte, dem zu-
Nach 1918
» S ollen die Banken Euch regieren ? « , sozialdemokratisches Wahlplakat, 1923 ; Entwurf : Josef Pollak ; Wienbibliothek im Rathaus, P — 3 42
folge der » Judengeist « mit dem » Geist des Kapitalismus « identisch sei.12 Daraus schlussfolgerte man, dass ein konsequenter Antisemit jene Partei wählen müsse, die entschlossen war, den Kapitalismus als Ganzes und somit die gesonderte wirtschaftliche Existenz des Judentums zu vernichten. So sollte eine antisemitische Massenwählerschaft angesprochen werden, indem man sich als entschlossener Gegner sowohl » jüdischen « als auch » nichtjüdischen « Kapitals darstellte.13 Um die kapitalistische Ausbeutung zu bekämpfen, stattete auch die Sozialdemokratie den » Kapitalisten «, den » Schieber « oder » Spekulanten « mit jüdischen « Attributen aus und benutzte Juden als Feindbild. Auf diese Weise wurde eine gesellschaftliche Gruppe als Feind der Arbeiterklasse herausgehoben.14 Mit der aus dem Parteiverlag Wiener Volksbuchhandlung stammenden Schrift Der Judenschwindel von Christoph H interegger aus dem Jahr 1923 erreichte diese Form der antisemitischen Agitation der Sozialdemokratie ihren unrühmlichen Höhepunkt.15 Im Bemühen, den Klassengeist des Antisemitismus herauszustreichen, verwendete Hinteregger antijüdische Klischees und griff dabei nicht nur jüdische Kapitalisten, sondern Juden allgemein an und bezeichnete gleichzeitig Christlichsoziale und Großdeutsche als » Schutzgarde des jüdischen Kapitals «.16 Spätestens als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht ergriffen, verschärfte sich das sozialdemokratische Dilemma den Antisemitismus betreffend. Zahlreiche Broschüren sollten über die wahren Verhältnisse in Deutschland aufklären, verwendeten dabei aber selbst antisemitische Stereotype und
» S anierung « , sozialdemokratisches Wahlplakat, 1923 ; Entwurf : Mihály Biró ; ÖNB Wien, PLA16333101
71
72
v ersuchten, wie zuvor bei den Deutschnationalen und Christlichsozialen, den » Judenschwindel « der Nationalsozialisten aufzudecken. Absurderweise behaupteten diese Schriften, dass Letztere mit dem » jüdischen Kapital « und der » jüdischen Intelligenz « kooperieren würden.17 Ein Vorwurf, der sich wohl von selbst richtete. Gleichzeitig war die Vorstellung, das sozialdemokratische Wien wäre eine » jüdische « Schöpfung, weitverbreitet.18 Sie wurde von den Gegnern entsprechend politisch instrumentalisiert, indem man die Arbeiterpartei als » Judenpartei « und » Judenschutztruppe « angriff. Die Partei konnte sich in dem Bestreben, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten, nie zu einem entscheidenden Kampf gegen den Anti semitismus durchringen.
» D er Judenschwindel « , 1923, aus dem Verlag Wiener Volksbuchhandlung, der die sozialdemokratischen Schriften herausgab
Nichtsdestotrotz blieb die SDAP die einzige größere Partei der Ersten Republik, die den Antisemitismus nicht im Parteiprogramm führte. Auch unterschied sich ihr Antisemitismus grundsätzlich von jenem der Deutschnationalen, Christlichsozialen oder der Nationalsozialisten und war nicht gegen » die Juden « als solche gerichtet. So bestand niemals die politische Absicht, Juden und Jüdinnen zu diskriminieren oder zu verfolgen.19 Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen wandten sich hingegen auch aktiv gegen den Antisemitismus. Mitglieder der SDAP wurden schon im austrofaschistischen Ständestaat vom Regime wegen ihrer politischen Einstellung verfolgt. Nach dem » Anschluss « Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland kam für viele noch die rassische Verfolgung aufgrund der » Nürnberger Gesetze « mit all ihren tödlichen Konsequenzen hinzu.
1
2
3
4
5
https ://rotbewegt.at/epoche/einstjetzt/artikel/das-programm-vonhainfeld – 1888 – 1889 ( 10. 3. 2019 ). Vgl. Margit Reiter : Die österreichische Sozialdemokratie und Antisemitismus. Politische Kampfansage mit Ambivalenzen, in : Gertrude Enderle-Burcel, Ilse Reiter-Zatloukal ( Hg.): Antisemitismus in Österreich 1933 – 1938, Wien 2018, S. 361 – 380, hier S. 362. John Bunzl : Arbeiterbewegung und Antisemitismus in Österreich vor und nach dem Ersten Weltkrieg, in : Zeitgeschichte 4 ( 1977 ) 5, S. 161 – 171, hier S. 166. Kautsky an Engels, 23. Juni 1884, in : Benedikt Kautsky ( Hg.): Friedrich Engels’ Briefwechsel mit Karl Kautsky, Wien 1955, S. 122. Vgl. Robert S. Wistrich : Sozialdemokratie, Antisemitismus und die Wiener Juden, in : Gerhard Botz, Ivar Oxaal, Michael Pollak ( Hg.): Eine zerstörte Kultur. Jüdisches Leben und Antisemitismus in Wien seit dem 19. Jahrhundert, Buchloe 1990, S. 169 – 180, hier S. 170.
6
7 8 9 10 11 12 13 14
Vgl. Leopold Spira : Feindbild » Jud «. 100 Jahre politischer Antisemitismus in Österreich, Wien/München 1981, S. 35. Vgl. Reiter, Sozialdemokratie und Antisemitismus, S. 363. Joseph Roth : Juden auf Wanderschaft, Köln 1985 [1927], S. 40. Vgl. Reiter, Sozialdemokratie und Antisemitismus, S. 364. Vgl. ebd. Spira, Feindbild » Jud «, S. 38. Bunzl, Arbeiterbewegung und Antisemitismus, S. 168. Wistrich, Sozialdemokratie, Antisemitismus, S. 177. Vgl. Dieter A. Binder : Der » reiche Jude «. Zur sozialdemokratischen Kapitalismuskritik und zu deren antisemitischen Feindbildern in der Ersten Republik, in : Geschichte und Gegenwart. Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte, Gesellschaftsanalyse und politische Bildung 4 ( 1985 ) 1, S. 43 – 53, hier S. 45.
15
16 17
18 19
Vgl. Jonny Moser : Die Katastrophe der Juden in Österreich 1938 – 1945. Ihre Voraussetzungen und ihre Überwindung, in : Kurt Schubert ( Hg.): Der gelbe Stern in Österreich. Katalog und Einführung zu seiner Dokumentation. Ausstellungskatalog Österreichisches Jüdisches Museum Eisenstadt ( Studia Judaica Austriaca, Bd. 5 ), Eisenstadt 1977, S. 67 – 133, hier S. 97. Ebd., S. 97. Susanne Böck : » Kühl bis ans Herz hinan «? Das ambivalente Verhältnis der österreichischen Sozialdemokratie zu den Juden 1880 – 1950, in : Elisabeth Klamper ( Hg.): Die Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile und Mythen, Wien 1995, S. 272 – 283, hier S. 277. Vgl. Wistrich, Sozialdemokratie, Antisemitismus, S. 174. Vgl. Reiter, Sozialdemokratie und Antisemitismus, S. 376.
» C hristliche Berichtigung « , Karikatur für den sozialdemokratischen Nationalratswahlkampf, 1923 ; » E s ist eine ganz gemeine Lüge, wenn jemand sagt, daß sich der Herr Bundeskanzler beim Kongreß der Ostjuden hat beschneiden lassen. Er ist nur hingegangen, um zu kontrollieren, daß nicht alles Geld den Hakenkreuzlern gegeben wird « , 21. Oktober 1923 ; VGA, Lade 6 / Mappe 31 B
73
74
M U T T E R (R OT E S) W I E N Fürsorgepolitik als Erziehungs- und Kontrollinstanz im » Neuen Wien « Katrin Pilz
Die Wiener Zentralstelle für Bildungswesen organisierte ab 1927 Rundfahrten durch das » Neue Wien «.1 Ein roter Autobus brachte internationale BesucherInnen und Gäste aus den Bundesländern – neben TouristInnen waren darunter speziell WissenschaftlerInnen und in der medizinischen Praxis Tätige – zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Man besuchte die Wahrzeichen des alten Wien – Schloss Schönbrunn, Oper, Stephansdom und Hofburg – wie auch die neuen Attraktionen : städtische Wohnanlagen, etwa auf der Schmelz und Sandleiten, und Fürsorgeeinrichtungen, darunter die sogenannte Kinderübernahmsstelle ( K ÜST ). Unter dem Motto » Lasset die Kinder zu mir kommen « war das im Juni 1925 eröffnete » Kinderparadies « 2 meist der erste Programmpunkt auf den Rundfahrten. Als Schaltstelle der Wiener Fürsorge für kranke, heimatlose, verwaiste oder verwahrloste Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr galt die KÜST als Aushängeschild des sozialdemokratischen Wohlfahrtssystems.3 Zusammen mit dem benachbarten Karolinen-Kinderspital, das wie viele zuvor private Kinderspitäler in Wien ab 1925 unter städtischer Leitung stand, lag die KÜST im medizinischen Zentrum der Stadt, im neunten W iener Gemeindebezirk. Der Ausbau der kommunalen Wohlfahrt war stark von der sozialdemokratischen Stadtverwaltung gefördert
worden : 1923 hatten die Ausgaben dafür etwa ein Drittel der Sozialausgaben der Stadt betragen.4 Die Stadttouren waren nur ein kleiner Teil jener werbewirksamen Programme, die dazu dienten, die von Siegfried Mattl beschriebene politische Marke » Rotes « bzw. » Neues Wien « zu bewerben – und das mit Erfolg.5 Der L-förmige, vom Architekten Adolf Stöckl ( 1884 – 1944 ) entworfene Bau für die KÜST , dessen Arkadenhof mit Sonnenterrassen, einem großzügigen Garten und einem Spielplatz versehen war, erschien im Inneren als » Glaspalast «.6 Zudem fiel ein im Zentrum des Gartens platzierter, von Anton Hanak ( 1875 – 1934 ) gestalteter » Stadtratbrunnen « 7 ins Auge, den der Anatom, Universitätsprofessor und amtsführende Stadtrat für das Wohlfahrts- und Gesundheitswesen Julius Tandler ( 1869 – 1936 ) in Auftrag gegeben hatte. Zur Darstellung der Magna Mater, der großen Mutter Fürsorge, hatte Hanak eine Figurengruppe entworfen : die lebensgroße Marmorgestalt einer Frau, die die Kinder schützend in ihren Armen hält, umgeben von bronzenen, wasserspeienden Schlangen, die sich ihr entgegenrecken. Sie symbolisieren die bedrohlichen Infektionskrankheiten der Großstadt, vor denen die Kinder zu bewahren sind. Entsprechend wurde die Frauenfigur als » visionäre hingebungsvolle Mütterlichkeit « der Wiener Fürsorge beschrieben.8 Dass der Brunnen im Sommer auch als Kinderplanschbad genutzt wurde, entsprach ganz den Hygienedebatten der Zeit, die den Leitsatz » Wasser und Luft für die Kleinen ! « formulierten.9 Nicht nur in der KÜST , auch in den Höfen der neuen Gemeindebauanlagen, in Kindergärten, in Parks sowie anderen zentralen Freibereichen wurden Kinderfreibäder eingerichtet. Bis 1929 waren 18 dieser Bäder in der Stadt verteilt.
Der Grund für die systematische Etablierung der kommunalen Kinder- und Jugendfürsorge waren der soziale Notstand, die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit sowie die Verbreitung von Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und Syphilis, die bereits während des Kriegs 1917 die Errichtung von öffentlichen Volksgesundheits- und Fürsorgeämtern und somit eine grundlegende soziale Versorgung als staatliche Pflicht notwendig erscheinen ließen.10 Bis dahin hatte ein System aus karitativer, kirchlicher und privater Wohlfahrt die Fürsorgepolitik Wiens bestimmt. Die von Julius Tandler entworfenen Pläne zur Novellierung der Gesundheits- und Fürsorgeverwaltung sollten als sozialpolitisches Experiment die traditionelle Fürsorge ablösen. Ziel war es, mit dem Ausbau von Fürsorgebehörden und -einrichtungen eine Hebung der sozialen Lebensverhältnisse insbesondere kinderreicher Arbeiterfamilien zu erwirken. Die städtische Verwaltung der sozialen Fürsorge, Volkswohlfahrt und öffentlichen Gesundheitspflege sah vor, Hilfsbedürftige zu versorgen, bestehende Volkskrankheiten einzudämmen und mit präventiven Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit künftiger Generationen, ganz im Sinne eugenischer und bevölkerungspolitischer Ziele, beizutragen.11 Das sozialpolitische Fürsorgeexperiment schuf nach dem Prinzip » aufbauende Wohlfahrtspflege ist vorbeugende Fürsorge « 12 eine Reihe von vernetzten Einrichtungen, die die neue Wohlfahrtsstruktur bestimmten : städtische Mutter-, Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Berufsberatungsstellen,
Sozialdemokratische Wohlfahrt statt christlicher Wohltätigkeit
die Kinderübernahmsstelle, Jugendämter und -heime, Kinderheime ( Kinderherbergen ), Kindergärten, Krankenhäuser, Schulzahnkliniken, Heilanstalten für Tuberkulose- und Geschlechtskranke, Sport- und Freizeiteinrichtungen wie Freibäder, Erholungs- und Ferienheime. Darüber hinaus boten zahlreiche Parteiorganisationen wie der Verein Kinderfreunde und die Roten Falken ein umfangreiches Programm an Freizeitund Sportaktivitäten, die zur » Ertüchtigung « und » Gesundung « des Körpers, aber auch des » Geistes « beitragen sollten. Die städtische Sozialpolitik nahm im Roten Wien eine zentrale Rolle ein, sie prägte neben der Bildungs- und Wohnbaupolitik das Selbstverständnis der sozialdemokratischen
Die » M agna Mater « von Anton Hanak wurde 1927 zum Coversujet der » B lätter für das Wohlfahrtswesen « ; privat
Aus: » D ie Kunst im neuen Wien. › M utter Fürsorge ‹ von Anton Hannak « , in: Das Kleine Blatt, 16. April 1927, S. 5
links: Kinderübernahmsstelle im 9. Bezirk, aus : » S onntagsfahrten durchs Neue Wien « , in : Das kleine Blatt, 14. Mai 1927, S. 2
Innenhof der Kinderübernahmsstelle mit der Brunnenskulptur » M agna Mater « von Anton Hanak, ca. 1926 ; Foto: Carl Zapletal ; Wien Museum, Inv. Nr. 57.962/82
75
76
Stadtverwaltung. Entsprechend wurden die Tandler zugeschriebenen Leitsprüche des » Wiener Systems « 13 nicht nur in programmatischen Schriften, Reden und Filmen propagiert, sondern waren auch auf den neu errichteten Gebäuden selbst zu lesen. » Krankheiten verhüten ist besser und wirtschaftlicher, als ausgebrochene Krankheiten heilen «,14 » Die Kinder haben ein Anrecht auf Fürsorge, und die Gesellschaft ist ihr Sachwalter « 15 und » Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder « 16 zählen zu den bekanntesten. Diese Rhetorik zielte auf die Schaffung des von Theoretikern wie Max Adler beschriebenen » Neuen Menschen « 17 ab und basierte nicht nur auf der Grundidee von sozialem Pflichtgefühl und Gewissen als zentralen Attributen einer neuen sozialistischen Gesellschaft, sondern auch auf der Überzeugung von der Entwicklungsfähigkeit Jugendlicher, im sozialen wie im biologisch-körperlichen Sinn. Hanaks Skulptur Mutter Fürsorge wurde zur visuellen Ikone der fürsorgenden, bemutternden Stadtverwaltung erhoben und wurde in zahlreichen Publikationen zur Wiener Fürsorgepolitik abgebildet.18 Der neuen Generation, die » dem Licht entgegen « 19 streben sollte, standen die VerliererInnen im Fürsorgeapparat gegenüber : alte, obdachlose und physisch sowie psychisch kranke Menschen, die nicht in das bevölkerungspolitische und sozialhygienische Programm der sich zur » Politik der Integration « 20 bekennenden Stadtverwaltung passten. Im Sinne der Berechnung des » wirtschaftlichen Werts « 21 des Menschen sah die Stadtverwaltung im Geiste der generativen Ethik 22 eine noch vor der Zeugung einsetzende städ-
Mutterberatung der Stadt Wien, 1920er Jahre ; Kat. Nr. 4.4.
tische Familien- und Jugendfürsorge als » Fundament jeder Fürsorge « 23 vor und investierte vor allem in den Ausbau derselben.24 Schließlich würde die Jugendfürsorge – so konstatierten der Soziologe Rudolf Goldscheid und zeitgenössische Sozialhygieniker – » produktive Kosten « verursachen, während die sogenannte Alters- und Irrenfürsorge lediglich unproduktive Kosten nach sich ziehen würde.25 Soziale Fürsorgemaßnahmen sollten in Form von sozialen Abgaben ( Fürsorgeabgaben ) 27 und unter Einhaltung bestimmter Regeln geleistet werden. Vor allem die Frau und Mutter war hier angesprochen, die » Fürsorgeregeln « zu befolgen und als Trägerin der Hygiene 28 und Obsorge die Sorge um die Gesundheit der Familie, die Einhaltung der empfohlenen Schwangerschaftshygiene, die Pflege und Erziehung von Säuglingen und Kindern, eine hygienische Haushaltsführung sowie die Bereitschaft zu gewährleisten, sich vom kommunalen Fürsorgeapparat kontrollieren und » befürsorgen « zu lassen. Das zentrale Motiv der Mutter Fürsorge als » weltliche Heilige « 29 diente als Sinnbild und » symbolisches Denkmal « 30 der Wiener Fürsorge. Paradoxerweise konnte die professionelle Fürsorgerin zunächst nie selbst Mutter sein,31 galt doch dieser Berufsstand lange als unvereinbar mit der eigenen Mutterschaft. Aufgrund dieser Diskrepanz hatten die Fürsorgerinnen in ihrem Arbeitsalltag mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Die widersprüchliche Stellung der Für-
Mutter Fürsorge – Mutter Wien 26
sorgerin führte oftmals zu konfliktreichen Beziehungen zwischen der geschulten, meist bürgerlichen Fürsorgerin und der zu » befürsorgenden Proletariermutter «. Julius Tandler sah den Umstand, dass die Fürsorgerinnen aus bürgerlichen Kleinfamilien stammten, als vorteilhaft an, da diese geeigneter erschienen, das Modell der Kleinfamilie zu vermitteln als die Vertreterinnen aus dem kinderreichen Industriearbeitermilieu.32 Erst in den späten 1920er Jahren wurden zunehmend » proletarische Fürsorgerinnen « und sogenannte Hilfsfürsorgerinnen eingestellt. Die Historikerin Gudrun Wolfgruber sieht dies unter anderem im Personalmangel und weniger im strukturellen Sinneswandel in Hinblick auf Kontrolle und Bewertung potenziell verwahrloster Kinder begründet.33 Die Fürsorgerin war beauftragt, die Bewertung von » körperlicher, geistiger und sittlicher « Vernachlässigung, also » Verwahrlosung «, im Elternhaus vorzunehmen und festzustellen, ob Kinder ihren Müttern abgenommen und in die Kinderübernahmsstelle überstellt werden sollten.34 Fürsorgerinnen durften heiraten, konnte ihre Tätigkeit aber lange Zeit lediglich ausführen, wenn sie kinderlos waren. Dies zeigt die Ambivalenz des Roten Wien in frauenpolitischen Belangen : 35 Die neue, ideale Frau wurde als selbstbestimmte und erwerbstätige Frau inszeniert,36 das städtische Programm der Fürsorgeverwaltung plädierte aber für ein Ideal der Frau als Hausfrau und Mutter, das eher einem bürgerlich inspirierten als emanzipatorischen Familienbild entsprach.37 Erziehungsberatungsstellen sollten die Mütter bei Fürsorge- und Erziehungsfragen unterstützen. Psychologi-
Karolinen-Kinderspital, 1920er Jahre ; Kat. Nr. 4.5.
sche und psychoanalytische Beratung wurde nicht nur in den 14 Jugendämtern der Stadt angeboten, auch in der KÜST hielten Psychologinnen Sprechstunden ab, um Rat suchenden Müttern zu Hilfe zu kommen : » An ihnen liegt es, daß ihrige [sic !] zum Ausbau einer so wertvollen Einrichtung [der KÜST, Anm.] zu tun. Jede Mutter, der ihr Kind › über den Kopf zu wachsen ‹ droht, soll deshalb den Kopf nicht hängen lassen. Die Erziehungsberatungsstelle in der Lustkandlgasse weiß auch für sie einen Rat. Sie muß nur kommen, um ihn zu holen ! « 38 Während in den Erziehungsberatungsstellen der Jugendämter der Pädagoge und Psychoanalytiker August Aichhorn ( 1878 – 1949 ) 39 Mütter und Väter in Fragen der Fürsorgeerziehung beriet, zielte die im Kontext der KÜST angebotene Hygiene-, Mutter- und Schwangerenberatung auf die Mütter ab.40 Das sozialdemokratische Fürsorgeprogramm sah sich immer wieder mit Kritik aus der politischen Opposition konfrontiert, die auf die nicht eingelösten Versprechungen und Probleme der Wohlfahrt im Roten Wien abzielte. Die Frage der Befürsorgung und wem diese in welcher Form zukommen sollte, tauchte regelmäßig in öffentlichen Debatten auf. 41 Die christlichsoziale Opposition trat weiterhin für ehrenamtliche und private Individualfürsorge ein, die von kirchlichen Organisationen getragen werden sollte. Sie kritisierte die städtische Politik als maßlos bürokratisch, als » Fürsorgewahn «
Kritik an der Wiener Fürsorge
» H ausbesuch der Fürsorgerin in der Proletarierfamilie « , 1920er Jahre ; Kat. Nr. 4.8.
77
78
und die Verantwortlichen als » Fürsorgetiger «.42 VertreterInnen aus dem kommunistischen/linksoppositionellen Lager hingegen bewerteten die sozialen Fürsorgemaßnahmen der roten Stadtverwaltung als nicht radikal genug.43 Kritik kam jedoch auch aus den eigenen Reihen : Insbesondere Sozialdemokratinnen wie Adelheid Popp ( 1869 – 1939 ) wiesen auf die paternalistische Haltung vonseiten der städtischen Fürsorgeverwaltung hin und kritisierten etwa Julius Tandler für seine ablehnende und passive Haltung in Bezug auf die generelle Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und mangelhafte Fürsorgebestrebungen für die Frau, die sich nicht gegen eine ( erneute ) Mutterschaft entscheiden konnte.44 Retrospektiv schildern ZeitzeugInnen, die als Kinder das städtische Fürsorgesystem der Kinderübernahmsstelle, zugeteilter Pflegefamilien und Kinderheime durchliefen, das in der KÜST erfahrene psychische Trauma. Negativ erwähnt wurde in diesem Zusammenhang auch die Verwendung als Forschungs- und Fürsorgeobjekt, die sich vor allem durch die engmaschige Zusammenarbeit der Kinderpflegerinnen mit KinderpsychologInnen des Psychologischen Instituts der Universität Wien und AmtsärztInnen ergab.45 Die Kinder übernahmsstelle wurde hier nicht als Kinderparadies, sondern vielmehr als » furchtbarer Glaspalast « 46 beschrieben, der als Observations- und Experimentalraum rückwirkend fragwürdige Vorstellungen von Familie und Erziehung offenbart.47 Fürsorgemaßnahmen wie die vor den Kommunalwahlen 1927 initiierte Aktion Säuglingswäschepaket, die mit dem Slogan » Kein Wiener Kind darf auf Zeitungspapier geboren werden « beworben und am 15. März 1927 im Gemeinderat beschlossen wurde, sollten dafür sorgen, das sozialdemokratische Ideal einer Fürsorge für alle einzuleiten. Die Erstausstattung für Säuglinge konnte von allen in Wien wohnhaften und entbindenden Frauen nach Anmeldung erworben werden. Als städtische Zuwendung und erste Fürsorgemaßnahme sollte das Wäschepaket Müttern und ihren Neugeborenen aller Schichten, unabhängig von Status und Hilfsbedürftigkeit, zur Verfügung stehen.48 Die Opposition bezeichnete diese als » Wahlwindeln « und behauptete einen Widerspruch zur sozialdemokratischen Forderung nach Abschaffung des sogenannten Abtrei-
bungsparagrafen.49 Ab 1930 war die Vergabe des Säuglings wäschepakets unabhängig vom finanziellen Status zunehmender Kritik ausgesetzt und wurde daher ab 1933 nur noch eingeschränkt durchgeführt und nach dem Februar 1934 schließlich gänzlich eingestellt.50 Der » Anschluss « 1938 führte letztendlich zur Schließung einschlägiger Beratungsstellen wie der städtischen Eheberatungsstelle. Laut der Historikerin Maria Mesner passte die » › Beratung ‹, mit welcher Ausrichtung auch immer, […] nicht mehr ins Zwangskonzept des › Gesetzes zur Verhütung von erbkrankem Nachwuchs ‹ «.51 Im » Dritten Reich « wurde die Leitung der Fürsorgeeinrichtungen wie der KÜST , der Kinderheilanstalten und -heime der Stadt vollständig ausgetauscht und eine rassistisch bestimmte Fürsorgepraxis eingeführt. Um die Sozialausgaben drastisch zu kürzen, wurden rassenhygienische sowie erbbiologische Ansätze mit Zwangsmaßnahmen verbunden. Diese betrafen bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Jüdinnen und Juden und physisch sowie psychisch Kranke.52 Nach dem Krieg wurde eine Wiederbelebung der Sozialpolitik des Roten Wien der 1920er und 1930er Jahre initiiert.53
» D er Fürsorgeweg « , aus : Anstaltsfürsorge der Stadt Wien für das Kind. Tagung der Stadt Wien am 3. und 4. Mai 1930 in Wien, in : Sondernummer Eos. Zeitschrift für Heilpädagogik, S. 15; Kat. Nr. 4.2.
Im Rahmen des Umbaus der Kinderübernahmsstelle 1964 ( ab 1965 umbenannt in Julius-Tandler-Heim ) wurde der Magna Mater-Brunnen aus dem Hof entfernt und am südlichen Stadtrand Wiens vor einer Schule für körperbehinderte Kinder wiederaufgestellt. Die einstige visuelle Ikone der W iener Mutter Fürsorge schien keinen Platz mehr in prominenter Lage in der Stadt gehabt zu haben. Die Miniaturskulptur der Magna Mater von Hanak, die Julius Tandler zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 1929 von den Wiener Fürsorgerinnen des Städtischen Jugendamts überreicht wurde und 1939 mit Tandlers Witwe Olga Wien verließ, befindet sich heute im Besitz von Tandlers Enkel Bill Tandler und ist in seinem Haus in den USA aufgestellt.54 2016 wurde die Erinnerungstafel an der Fassade der ehemaligen Kinderübernahmsstelle – sie trägt Tandlers Leitspruch » Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder « – durch eine weitere Tafel ergänzt, die mit folgendem Text mahnt : » In Anerkennung der Opfer von Gewalt in Einrichtungen der Wiener Jugendwohlfahrt der Nachkriegszeit. Von diesem Standort, der ehemaligen Kinderübernahmestelle, wurden Kinder in Heime und Pflegefamilien gebracht, in denen sie erschütternden alltäglichen Erziehungspraktiken und institutioneller Gewalt ausgesetzt waren. Diese dunkle Seite der Geschichte ist uns Mahnung in der Gegenwart und Auftrag für die Zukunft. « 55
Säuglingswäschepaket der Stadt Wien, ca. 1927 ; Kat. Nr. 4.24.
79
» M agna Mater « , Bronze von Anton Hanak, angefertigt zum 60. Geburtstag von Julius Tandler, 1929 ; Kat. Nr. 4.18.
1
80 2 3
4
5
6
7
8
9
10
Einige Passagen des Beitrags beruhen auf dem von der Autorin verfassten Kapitel Welfare, in : Ingo Zechner, Georg Spitaler, Rob McFarland ( Hg.): The Red Vienna Sourcebook, Rochester, NY ( erscheint 2019 ). Sonntagfahrten durchs Neue Wien, in : Das Kleine Blatt, 14. Mai 1927, S. 3. Vgl. Ladislaus Frank : Christbäume in der Kinderübernahmestelle, in : Die Stunde, 23. Dezember 1927, S. 5f. ; Die Wirksamkeit der Kinderübernahmsstelle der Gemeinde, in : Die Stunde, 7. Juli 1927, S. 3 ; Stella Grundler : Die Gemeinde Wien als Helferin der Jugend, in : Die Frau 38 ( 1929 ) 8, S. 16f. ; Drei Wochen Glück. Die Kinderübernahmestelle der Gemeinde Wien, in : Die Bühne ( 1930 ) 286, S. 26 – 28. Vgl. Das neue Wien. Städtewerk, Bd. 2, hg. unter offizieller Mitwirkung der Gemeinde Wien, Wien 1926 – 1928, S. 457. Vgl. Siegfried Mattl : Die Marke » Rotes Wien «. Politik aus dem Geist der Reklame, in : Wolfgang Kos ( Hg.): Kampf um die Stadt. Politik, Kunst und Alltag um 1930 ( Ausstellungskatalog Wien Museum ), Wien 2009, S. 54 – 63. Karl Honay : Das neue Wien für seine Jugend, in : Moderne Welt 13 ( 1932 ) 7, S. 19 – 23, hier S. 21. Anton Hanak Tagebücher : Eintrag August 1924, in : Graphische Sammlung Albertina, Inv. Nr. 36.080/1, S. 218, zit. n. Friedrich Grassegger : Anton Hanak und » Das Rote Wien «. Der Wille zum » neuen Menschen « und Hanaks Denkmäler und Bauplastiken für sozialdemokratische Auftraggeber, in : ders., Wolfgang Krug ( Hg.): Anton Hanak ( 1875 – 1934 ), Wien/Köln/Weimar 1997, S. 306 – 371, hier S. 324 – 342. Ein Hanak-Brunnen in Wien, in : Der Tag, 26. Juli 1924, S. 4 ; Das neue Wien – Eine Brunnenfigur auf dem Alsergrund, in : Arbeiter-Zeitung, 29. Juli 1924, S. 6 ; Die Kunst im neuen Wien. » Mutter Fürsorge « von Anton Hannak [sic !], in : Das kleine Blatt, 16. April 1927, S. 5. Wasser und Luft für die Kleinen ! Neue Kinderfreibäder, neue Spielplätze – Wie die Gemeinde für den Sommer rüstet, in : Der Morgen, 10. April 1928, S. 6. Vgl. Die Schaffung des Ministerium für Volksgesundheit, städtisches Volksgesundheitsamt und Staatsamt für Volksgesundheit und soziale Fürsorge Wien 1917, in : Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Arbeit und Soziales, Bundesministerium für Soziale Verwaltung, Volksgesundheit/Präsidium, 1917 – 1922 ; Leopold Moll : 1915 – 1925 Zehn Jahre Kinderfürsorge der Reichsanstalt für Mutter- und Säuglingsfürsorge in Wien und der ihr angeschlossenen Fürsorgeaktionen, Wien 1926.
11
12 13 14
15
16 17 18
19
20
21
22
23 24
25
Vgl. Julius Tandler : Sozialdemokratische Wohlfahrtspflege, in : Arbeiter-Zeitung, 20. Mai 1924, S. 9. Zur kritischen Einordnung des Eugenikdiskurses und von Julius Tandlers Positionen siehe : Peter Schwarz : Julius Tandler. Zwischen Humanismus und Eugenik, Wien 2017 ; Doris Byer : Rassenhygiene und Wohlfahrtspflege. Zur Entstehung eines sozialdemokratischen Machtdispositivs bis 1934, Frankf. a. M. 1987. Franz Karner : Aufbau der Wohlfahrtspflege der Stadt Wien, Wien 1926, S. 5. Karl Kautsky jr. : Der Kampf gegen den Geburtenrückgang, Wien 1924, S. 31. Karl Kautsky jr. : Brief Karl Kautsky an Redakteur L. E. / G. Tagblatt, in : Tagblatt, 10. Juni 1923, S. 8. Gemeinde Wien ( Hg.): Die Kinderübernahmsstelle der Gemeinde Wien, Vorwort von Julius Tandler, Wien 1925 /26, S. 7. Ebd., S. 26. Max Adler : Neue Menschen. Gedanken über sozialistische Erziehung, Berlin 1924. Vgl. z. B. Blätter für das Wohlfahrtswesen ( ab 1927 als Titelbild ); Karner, Aufbau der Wohlfahrtspflege ; Gemeinde Wien ( Hg.): Die Kinderübernahmsstelle der Gemeinde Wien, Wien 1925 und 1927 ; dies. ( Hg.): Die Wohlfahrtspflege der Stadt Wien, Wien 1928 ; dies. ( Hg.): Einführung in die soziale Hygiene, Sonderabdruck aus den Nummern 279 – 283 aus den Blättern für das Wohlfahrtswesen, Wien 1930 ; Anstaltsfürsorge der Stadt Wien für das Kind. Tagung der Stadt Wien am 3. und 4. Mai 1930 in Wien, in : Sonderdruck Eos. Zeitschrift für Heilpädagogik, Wien 1930 ; Franz X. Friedrich : Mutter Wien, in : Bettauers Wochenschrift 4 ( 1927 ) 33, S. 4f. ; Die Kunst im neuen Wien, S. 5. Die Lithografie von Victor Slama ( 1890 – 1973 ): Dem Lichte entgegen, in : Karner, Aufbau der Wohlfahrtspflege, S. 31. Mehrere originale Zeichnungen und Radierungen des gleichen Sujets befinden sich in der Wienbibliothek im Rathaus unter dem Werktitel Zum Licht empor, Sign. : AC13090269. Doris Byer : Sexualität – Macht – Wohlfahrt. Zeitgemäße Erinnerungen an das » Rote Wien «, in : Zeitgeschichte 14 ( 1987 ) 11 – 12, S. 442 – 463, hier S. 459. Rudolf Goldscheid : Die Pflanzstätten der Wissenschaft als Brutstätten der Reaktion, in : Die Wage, 3. März 1923, S. 137 – 143. Vgl. Julius Tandler : Zur Psychologie der Fürsorge. Aus einem Vortrag des amtsführenden Stadtrates Professor Dr. Julius Tandler in einer Arbeitsgemeinschaft städtischer Fürsorgerinnen am 20. Februar 1927, Sonderdruck aus dem Jahrbuch 1926 des Wiener Hilfswerks, Wien 1927. Ders.: Wohltätigkeit oder Fürsorge, Wien 1925, S. 5. Vgl. Karl Kautsky jr. : Die Eheberatung im Dienste der Wohlfahrtspflege, in : Blätter für das Wohlfahrtswesen der Stadt Wien 23 ( 1925 ) 245, S. 9. Vgl. Goldscheid, Die Pflanzstätten der Wissenschaft.
26 27
28
29
30 31
32
33
34 35 36
37
38
39
Franz X. Friedrich, Mutter Wien. Eine Form von Lohnsummensteuer, die für öffentliche Fürsorgezwecke eingeholt wurde. Vgl. Felix Czeike : Wirtschafts- und Sozialpolitik der Gemeinde Wien in der ersten Republik ( 1919 – 1934 ), Wien 1956, S. 84f. Vgl. Julius Tandler : Die Frau in der Fürsorge, in : Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und Berufsfürsorge 18 ( 1926 ) 3, S. 44f., hier S. 44. Der zeitgenössische Begriff der Hygiene wurde üblicherweise als Überbegriff für präventive Medizin und Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit verwendet. Vgl. Viktor Gegenbauer : Über soziale Hygiene, in : Gemeinde Wien, Einführung in die soziale Hygiene, S. 3 – 13. Wolfgang Born : Die steinerne Hymne. Anton Hanaks neue Bildwerke, in : Die Bühne ( 1927 ) 125, S. 20 – 22, hier S. 22. Hans Riemer ( Hg.): Album vom Roten Wien ( mit 100 Abbildungen ), Wien 1947. Vgl. Hilda Lunzer : Mutter oder Fürsorgerin ?, in : Die Unzufriedene 4 ( 1926 ) 32, S. 2. Vgl. Julius Tandler : Wohlfahrtspflege, Sonderdruck aus : Österreichische Blätter für Krankenpflege, Wien 1929, S. 6. Vgl. Gudrun Wolfgruber : Messbares Glück. Sozialdemokratische Konzeptionen zu Fürsorge und Familie im Wien der 1920er Jahre, in : L’Homme 10 ( 1999 ) 2, S. 277 – 294, hier S. 279 ; dies. : Von der Fürsorge zur Sozialarbeit. Wiener Jugendwohlfahrt im 20. Jahrhundert, Wien 2013, S. 38. Adele Bruckner : Fürsorgearbeit, in : Die Mutter 1 ( 1925 ) 17, S. 5f. Vgl. Lunzer, Mutter oder Fürsorgerin ?, S. 2. Vgl. Hans Haidenbauer : Die Frau von heut, in : Die Unzufriedene 8 ( 1930 ) 26, S. 1. Siehe auch den Beitrag von Marie Yazdanpanah in diesem Band. Vgl. Maria Mesner : Geburten/Kontrolle. Reproduktionspolitik im 20. Jahrhundert, Wien/Köln 2010, S. 196, S. 200. Gerda Kautsky-Brunn : Erziehungsarbeit in der Kinderübernahmsstelle, in : ArbeiterZeitung, 6. Jänner 1928, S. 10. Zum Begriff der Fürsorgeerziehung und Verwahrlosung siehe : August Aichhorn : Verwahrloste Jugend. Die Psychoanalyse in der Fürsorgeerziehung. Zehn Vorträge zur ersten Einführung, Wien 1925 ; Therese Schlesinger : Wie will und soll das Proletariat seine Kinder erziehen, Wien 1928, S. 32.
40
41 42
43 44
45 46
47
48
49
Uneheliche Kinder zählten zur Kategorie sozialer Verwahrlosung, die Vormundschaft lag bei der Stadt Wien, sie konnten daher jederzeit von Fürsorgerinnen ihren alleinerziehenden Müttern weggenommen werden, auch wenn sie weder physisch noch psychisch unter- oder fehlversorgt waren. Vgl. Jugendamt der Stadt Wien ( Hg.): Aufgaben und Organisation der Wiener städtischen Jugendfürsorge, Wien 1922, S. 1f. ; Reinhard Sieder, Gottfried Pirhofer : Zur Konstitution der Arbeiterfamilie im Roten Wien. Familienpolitik, Kulturreform, Alltag und Ästhetik, in : Michael Mitterauer, Reinhard Sieder ( Hg.): Historische Familienforschung, Frankf. a. M. 1982, S. 326 – 368, hier S. 332f. Vgl. Byer, Rassenhygiene und Wohlfahrtspflege. Berichte aus den wissenschaftlichen Vereinen. Gesellschaft der Ärzte Wien. Sitzung vom 19. Mai 1933, in : Wiener Medizinische Wochenschrift 83 ( 1933 ) 24, S. 674 – 678, hier S. 675. Vgl. Moskau – Wien. Zwei Städte, zwei Welten, Hamburg/Berlin 1932, S. 60 – 69. Vgl. Unsere Forderungen im Parlament, in : Arbeiterinnen-Zeitung, 15. März 1921, S. 2 ; Adelheid Popp : Der Paragraph 144, in : Die Unzufriedene 5 ( 1927 ) 41, S. 1 – 3 ; Massenproteste gegen den Mordparagraphen 144, in : Die Unzufriedene 5 ( 1927 ) 41, S. 3f. Vgl. Wolfgruber, Von der Fürsorge zur Sozialarbeit, S. 36. Charlotte Bühler, Hildegard Hetzer: Kleinkindertests. Entwicklungstests vom 1. bis 6. Lebensjahr, Leipzig 1932; Wer ist klüger: Affe oder Kleinkind? 700 Kinder » getestet « – gewaltige Leistungen der Wiener Kinderpsychologischen Untersuchungsstelle, in: Der Abend, 22. September 1930, S. 4. Z. n. Wolfgruber, Von der Fürsorge zur Sozialarbeit, S. 36. Siehe auch: Reinhard Sieder: Wissenschaftliche Diskurse, Jugendfürsorge und Heimerziehung in Wien im 20. Jahrhundert, in: Virus. Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin (2018) 17, S. 29 – 56 Vgl. Hildegard Hetzer: Kinder- und jugendpsychologische Forschung im Wiener psychologischen Institut von 1922 – 1938, in: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (1982) 14, S. 175 – 224. Rosa Dworschak: Dorfgeschichten aus der Großstadt, Wien 2014. Hans Paradeiser: Die Säuglingswäsche aktion der Gemeinde Wien, in: Blätter für Wohlfahrtswesen 26 (1927) 259, S. 38 f.
»Zum Licht empor«, Lithografie von Victor Theodor Slama, ca. 1930; Kat. Nr. 4.3.
50 51 52
53
54 55
Die Wahlwindeln, in: Reichspost, 17. März 1927, S. 4. Mesner, Geburten/Kontrolle, S. 74. Vgl. Reinhard Sieder, Andrea Smioski : Der Kindheit beraubt. Gewalt in den Erziehungsheimen der Stadt Wien ( 1950er bis 1980er Jahre ), Innsbruck/Wien/ Bozen 2012, S. 43 – 47. Vgl. Matthew Paul Berg : Reinventing » Red Vienna « after 1945 : Habitus, Patronage, and the Foundations of Municipal Social Democratic Dominance, in : The Journal of Modern History 86 ( 2014 ) 3, S. 603 – 632. Vgl. das Interview von Birgit Nemec mit Bill Tandler in diesem Band. Die Mahntafel ist signiert vom damals amtierenden Bürgermeister Wiens, Michael Häupl. Zu den Missbrauchsfällen in Wiener Kinderheimen und Fürsorgeeinrichtungen und der Reformierung der Wiener Sozialarbeit und Heimpolitik siehe : Sieder, Smioski, Der Kindheit beraubt.
81
KINDERHERBERGE »A M T I VO L I «, 19 23
82
Fotografien von Ludwig Gutmann
In auffälliger Anlehnung an die Bildgestaltung und Lichtregie der Malerei des Biedermeiers, insbesondere jene Ferdinand Georg Waldmüllers, vermittelt die Fotoserie des Theaterfotografen Ludwig Gutmann die Kinder herberge Am Tivoli als einen idyllischen und idealen Ort, an dem die Schrecken der Vergangenheit gebannt sind. Jede der hochinszenierten Szenen zeigt programmatisch die Grundsätze einer neuen Fürsorgepolitik, wie die sauberen und lichtdurchfluteten Räume oder die medizinische Versorgung, aber auch eines neuen, respektvollen Umgangs zwischen Erwachsenen und Kindern. Die Kinderherbergen, wie jene Am Tivoli, wurden nach Kriegsende eingerichtet und dienten einem vorübergehenden Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen. Hier wurde über ihre weitere Betreuung entschieden. Ab 1925 übernahm diese Aufgabe die neu errichtete Kinderübernahmsstelle in der Lustkandlgasse im neunten Bezirk. → Kat. Nr. 4.10.
› Bad ‹ › S chlafsaal für Mädchen ‹ links: › R einigung des Speisesaales ‹
oben : › K inder beim Gemüseputzen ‹ links : › K leine Künstler ‹ ; › K rankenvisite ‹ rechts : ›Ein in Familienpflege abgehendes Kind ‹
84
» D I E S E V I TA L E S TÄ R K E « 1 Sigmund Freud und die Psychoanalytiker des Roten Wien Elizabeth Ann Danto
Als Sigmund Freud den für September 1918 geplanten fünften Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung einberief, wagte er eine Voraussage, wie sich die Psycho analyse im 20. Jahrhundert ausbreiten werde. Anna Freud und Siegfried Bernfeld waren anwesend, ebenso Theodor Reik, Hanns Sachs und Isidor Sadger. Die Wiener Analytiker hörten, wie Freud prophezeite, » [i]gend einmal wird das Gewissen der Gesellschaft erwachen « 2 und eine neue psychoanalytische Sichtweise werde mehr soziale Verantwortung einfordern. » [D]er Arme « hat, so Freud weiter, » ein ebensolches Anrecht auf seelische Hilfeleistung […] wie bereits jetzt auf lebensrettende chirurgische. « 3 Wie ihre KollegInnen in den Schulen, der Verwaltung und in den Kulturinstitutionen trieb ein Bewusstsein für größere soziale und ökonomische Kräfte auch die PsychoanalytikerInnen dazu, sich den Bemühungen des Roten Wien anzuschließen, die Stadt nach dem Krieg neu zu gestalten. Die regierenden Sozialdemokraten erwiderten diese Wertschätzung. 1927 schrieb die Nationalratsabgeordnete
Therese Schlesinger, dass es » natürlich erstrebenswert sei, dass Arbeiter mit dem grundlegenden Konzept von Freuds Psychologie und Therapiemethode vertraut gemacht werden «.4 Doch stellt das Wien der Zwischenkriegszeit aufgrund seiner Ambivalenz die Forschung seit langer Zeit vor ein Problem : Zwar entwickelte sich die Psychoanalyse mit bemerkenswerter Kreativität weiter, aber die gleichzeitige Ausbreitung des Faschismus und der Zwang des Exils machen die 1930er Jahre zu einer nicht leicht nachvollziehbaren Zeit. » Damals in Wien waren wir alle so aufgeregt – voller Energie «, sagt Anna Freud. » Es war, als würde ein neuer Kontinent entdeckt werden. Wir waren die Entdecker, und wir hatten jetzt die Chance, alles zu verändern. « 5 Rudolf Ekstein erinnert sich an das Rote Wien als eine » Bewegung … eine Ethik. Anna Freud [und] August Aichhorn waren nicht nur mit theoretischen Problemen beschäftigt, sondern auch mit praktischen Fragen der Erziehung, etwa damit, Delinquenz oder Lernprobleme zu verstehen «.6 Wilhelm Reich spricht in seinen Memoiren davon, dass » alles vermischt [wurde]: Sozialismus, das intellektuelle Bürgertum Wiens und die Psychoanalyse «, um traditionelle Vorstellungen von der Rolle der Regierung, der Individuen und der Gesellschaft zu hinterfragen.7 Während » die Lebensbedingungen im Wien der Nachkriegszeit schrecklich waren «,8 so Richard Sterba, » gab uns die Nähe zu Freuds Werk in statu nascendi das Gefühl, an einem großen, die Zukunft gestaltenden wissenschaftlichen und kulturellen Prozess beteiligt zu sein «.9 Manche Analytiker wie Paul Federn und Josef Friedjung arbeiteten direkt in der Stadtregierung des Roten Wien mit ; andere wie August Aichhorn, Siegfried Bernfeld und Anna Freud unterstützten die Schulreform und gründeten neue Schulen ; Helene Deutsch, Hermann Nunberg und
Paul Schilder arbeiteten in einer psychiatrischen Klinik der Stadt. Wieder andere – Wilhelm Reich, Grete und Eduard Bibring, Otto Fenichel – bewegten sich an der Grenze zwischen Medizin und Psychoanalyse : Das Wiener Psychoanalytische Ambulatorium, ihre unentgeltliche Klinik in der Pelikangasse, hatte unerwarteten Erfolg. Sie forderten die Einführung der Sexualerziehung. Alfred Adlers Verein für Individual psychologie versorgte die Erziehungsberatungsstellen mit Personal. PsychoanalytikerInnen arbeiteten bei Gericht, in Spitälern, in der Erziehung und als JournalistInnen.10 » Ideologisch waren die meisten Analytiker liberal «, sagt Sterba. » Ihre Sympathien, wie die der meisten Wiener Intellektuellen, lagen bei den Sozialdemokraten. « 11 Ebenso wie Julius Tandler versuchte, » den durch Krieg und Revolution tief herabgedrückten Gesundheitszustand der Bevölkerung unserer Republik nach Möglichkeit zu heben «,12 sah auch Sigmund Freud den Zugang sowohl zu körperlicher als auch geistiger Gesundheitsfürsorge als ein allgemeines Recht an. In dem Rechtsfall von 1920 der Staat gegen Julius Wagner-Jauregg ließ Freud die Untersuchungskommission, in der auch Tandler saß, wissen, dass Soldaten auch andere Formen der Zuwendung benötigten als Bestrafung. » Einige Ärzte haben ihrem Machtwillen erlaubt, auf brutale Weise zum Vorschein zu kommen und darüber ihre menschlichen Pflichten vergessen. « 13 Tandler vergaß diese mahnenden Worte nicht : Im Mai 1924 ernannte er Freud zum Bürger der Stadt Wien. » Diese Ehre erweist mir die sozialdemokratische Partei «, schrieb Freud,14 und die Arbeiter- Zeitung fügte hinzu : » Was uns Sozialisten besonders zu Dank verpflichtet, sind die neuen Wege, die er der Erziehung der Kinder und der Massen weist. « 15 Von diesen Sozialdemokraten waren Paul Federn und Josef Friedjung sowohl Mitglieder von Freuds Kreis als auch der Stadtregierung. Friedjungs Schriften, etwa Soziale Aspekte der Kindererziehung, verteidigten diejenigen, die die Bürgerlichen als moralisch unwürdig oder ökonomisch verantwortungslos brandmarkten : verarmte Familien, einsame und suizidale Menschen, Arbeitslose – all jene, die den Zugang zu psychoanalytischer Behandlung verlieren würden, wäre sie kein allgemeines Recht.16 Die sozialdemokratisch- psychoanalytische Wechselwirkung spiegelt sich auch in seinem Aufsatz von 1930 Zur Frage des Kinderselbstmordes wider, der zeigt, wie Kinder ihre » eigenen Feinde werden können «.17 Friedjung war ein Unterstützer von Anna Freuds Forderung, das » freie und eigenverantwortliche menschliche Wesen « in jedem Kind zu fördern.18 Hochwertige Erziehung und Gesundheitsversorgung würden » die Seele des Kindes gegen die Härten des Lebens wappnen «,19 während eine von Stigmata befreite soziale Wohlfahrt » zum Zwecke des Humanitarismus « 20 die Nation erneuern würde. Die PsychoanalytikerInnen waren dafür bereit.
links : Anna und Sigmund Freud, ca. 1931 ; Fotos: Bob Burlingham ; Collection of Michael J. Burlingham, New York rechts : Mädchen im Garten des » I sraelitischen Blindeninstituts Wien « , ca. 1930 ; Leo Baeck Institute, New York, Siegfried Altmann Papers
Für Anna Freud, August Aichhorn, Alfred Adler, S iegfried Bernfeld und Willi Hoffer begann Kinderfürsorge im frühesten Alter mit psychoanalytisch versierten Kindergärten. 1919 änderte Alfred Adler seine berufliche Ausrichtung mit der Frage : » Warum sollte man keine Kinderberatungsstelle gründen zum Wohle der Kinder als auch der Eltern ? « 21 Im selben Jahr gründete Bernfeld das Kinderheim Baumgarten, ein Erziehungsheim für jüdische Kriegswaisen und Flüchtlingskinder, viele von ihnen jünger als fünf Jahre.22 Die Psychoanalyse sei eine Theorie der Emanzipation, glaubte Bernfeld, und Triebunterdrückung eine frühzeitige Hemmung der kindlichen Entwicklung. In seinen Schriften verband er Sozialismus und Psychoanalyse, etwa in Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung mit einem Vorwort von Anna Freud. Er stellte Anna Freud und Eva Rosenfeld einander vor, die beiden Frauen taten sich 1927 mit Dorothy Tiffany Burlingham zusammen, um die Hietzinger Schule im 13. Wiener Gemeindebezirk zu gründen. Währenddessen schafften es Anna Freud, August Aichhorn, Wilhelm Hoffer und Hedwig S chaxel, zahlreiche Grundschul- und GymnasiallehrerInnen mit ihrem psychoanalytischen Seminar Lehrkurs für Pädagogen an der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung zu erreichen.23 Nachdem das Format der Erziehungshilfe in Schulen, Erziehungsund anderen Einrichtungen etabliert worden war, konnten LehrerInnen und ÄrztInnen unterstützungsbedürftige Kinder » aus jeder sozialen Gruppe, die an psychischer Not litten «, direkt in
Das » W iener Psychoanalytische Ambulatorium «
85
86
das Ambulatorium der Psychoanalytischen Gesellschaft Wiens einweisen. Hunderte von » Angestellten, Ladenbesitzern und Regierungsbeauftragten fanden zwischen 1922 und 1927 rasche Hilfe und unentbehrliche seelische Heilung im Ambulatorium für Mittellose «.24 Eduard Hitschmann, selbst Psychoanalytiker und Unterstützer der Kommunalpolitik, eröffnete die Klinik im Jahr 1922. Trotz der Anfeindungen der bürgerlichen Gesellschaft kam die Ärztekammer letztlich überein, dass » das Ambulatorium für psychische Behandlungen im weitesten Sinn des Wortes « für alle zuständig sei.25 Zeitschriften wie Bettauers Wochenschrift bewarben die Klinik in ihren Ratgeberkolumnen. » Ein Einsamer. Sie sind 29 Jahre alt, intelligent, gebildet, in guter Stellung und sehnen sich nach einer Lebensgefährtin, die mit ihnen Leid und Freude teilen würde. Aber ihr Gefühlsleben hat einen seltsamen Sprung : Sie glauben, nur mit einem Mädchen leben zu können, das einen Fuß verloren hat. Ich rathe Ihnen unbedingt, gegen diese abnorme Einstellung anzukämpfen. Es handelt sich zweifellos um einen Fall, der der psychoanalytischen Behandlung bedarf. Wenden Sie sich an das Psychoanalytische Ambulatorium, Wien 9 Bez., P elikangasse 18, Or26 dination von 6 bis 7 Uhr Abends. « Die PsychoanalytikerInnen teilten sich im Keller des Allgemeinen Krankenhauses eine Station mit der Herzabteilung ( diese Aufteilung wurde von Felix Deutsch arrangiert ),
jeden Abend wurden Behandlungen und Besprechungen terminlich fixiert. 1925 gründete Helene Deutsch ein Ausbildungszentrum. August Aichhorn leitete die Kinderbetreuungsklinik. 1929 kam durch Paul Schilder und Paul Federn eine formale Psychiatrie hinzu, wodurch auch schwere Störungen behandelt werden konnten. Und bis zum Jahr 1930, in dem er nach Berlin ging, leitete Wilhelm Reich, der seit 1924 der Assistent des Direktors der Klinik war, das einfluss reiche technische Seminar.27 In seiner auf Gruppenarbeit basierenden psychiatrischen Praxis, die später » Sozialarbeit « genannt wurde, ging es Reich um den sozialen Subtext des menschlichen Lebens. Analog zu einer Analyse, die das Individuum von inneren Zwängen befreit, glaubte Reich, die politische Linke würde alle Unterdrückten befreien und deren angeborene Fähigkeit zur Selbstbeherrschung freisetzen. Während Tandler im Wohnbau einen Anreiz für familiäre Fortpflanzung sah ( eine Politik, die als » maternalistisch « und » eugenisch « kritisiert wurde 28), war Reichs Ideal des Wohnens von der Vorstellung einer befreiten Sexualität geprägt.
Praxiszulassung von Eduard Bibring ; Privatsammlung Briefkopf des Ambulatoriums der Psychoanalytischen Vereinigung ; U.S. Library of Congress, Washington, D. C., Manuscript Division, Siegfried Bernfeld Papers Box 8
Wilhelm Reich in Wien ; Privatsammlung, Kat. Nr. 4.15.
Freuds 1925 verfasstes Geleitwort zu Aichhorns Verwahrloste Jugend spricht von den verbesserten Möglichkeiten für die Kinder in dieser Zeit : » Von allen Anwendungen der Psychoanalyse hat keine soviel Interesse gefunden, soviel Hoffnungen erweckt und demzufolge soviele tüchtige Mitarbeiter herangezogen wie die […] Theorie und Praxis der Kindererziehung. « 29 Tatsächlich wurde die Bewegung immer populärer. Als zunehmend mehr LehrerInnen wie Anna Freud, Aichhorn und Hoffer als KinderanalytikerInnen praktizierten, betrat ihre psychoanalytische Pädagogik » mit revolutionärem Geist die Szene «.30 Ab 1926 erschien die Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik, in der das Wechselspiel von Schulreform, Kinderanalyse und den Ideen von Maria Montessori, Lili Roubiczek-Peller und Eugenie Schwarzwald diskutiert wurde. Auch Paul Federn, der Mitherausgeber der Zeitschrift, trug seinen Teil dazu bei, um, wie Rudolf Ekstein anmerkte, » gemeinsam, basierend auf einem neuen Verständnis von Kindern und Jugendlichen, ein autoritäres Erziehungssystem durch ein humaneres zu ersetzen «.31 Federn forderte, soziale Beziehungen in psychoanalytischen Begriffen
Psychoanalytische Pädagogik
Der Durchsichtige Mensch, Postkarte, 1925 ; Privatsammlung
neu zu denken. Seine Theorie der » Angst vor dem Zwang « 32 wurde von Freud 1920 wieder aufgenommen, als er an einer Kriegsneurose leidende Soldaten verteidigte. Politikern erklärte Federn die psychologische Natur der Revolution und Gegenrevolution, den PsychoanalytikerInnen stellte er mit Zur Psychologie der Revolution : Die vaterlose Gesellschaft ein grundlegendes Werk der Sozialpsychologie zur Verfügung. Unter den BeiträgerInnen der Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik war der ehemalige Lehrer August Aichhorn. Er war einer der Organisatoren der Erziehungsberatungsstelle des Roten Wien und auch in anderen Kinderfürsorgeeinrichtungen der Stadt tätig und bekannt für seine weitreichenden Einsichten in das Innenleben beeinträchtigter oder straffälliger Jugendlicher. In Oberhollabrunn gründete er ein großes Erziehungsheim für Not leidende Jungen und Mädchen, das für viele Arten von sozialer Therapie geeignet war. Später setzte er dieses Konzept in St. Andrä erneut um. Dort, so Anna Freud, » war es ihm nicht nur möglich, Kinder zu erreichen, die ansonsten nicht erreicht hätten werden können. Dort prägte er auch viele von uns «.33 Aichhorn wurde zwar aus Tandlers Beratungsstellen34 ausgeschlossen, erhielt
87
88
aber viel Zuspruch für seine Arbeit in der Wiener Psycho analytischen Vereinigung, im Ambulatorium und, etwas später, in der Hietzinger Schule. Von 1927 bis 1932 erlaubte es diese Schule Anna Freud, Dorothy Tiffany Burlingham, Erik Erikson und Peter Blos, eine im Roten Wien einzigartige pädagogische Kombination zu praktizieren : Eine psychoanalytische Grundausrichtung wurde dort mit der Erziehung zur Selbstständigkeit, Aichhorns grundlegender Empathieforschung und Bernfelds Forderung nach Freiheit von Unterdrückung kombiniert. Wie bei allen zeitgenössischen PsychoanalytikerInnen wies auch ihre Arbeit weit über den Horizont der eigenen Zeit hinaus. Das Rote Wien bleibt der feste und fruchtbare Boden ihres Erbes.
Leopold Birstinger: Porträt von August Aichhorn, 1948 ; Öl auf Karton ; Wien Museum, Inv. Nr. 78.870
Foto der » H ietzinger Schule « mit Erik H. Erikson (erste Reihe links), Peter Blos (erste Reihe, Dritter von links) und Esther Menaker (hintere Reihe, Zweite von rechts); Sigmund Freud Privatstiftung, Wien, Peter Heller Album
1
2
3 4
5
6
7
8 9 10
11 12
13
Julius Tandler, in : Michael Molnar ( Hg.): The Diary of Sigmund Freud 1929 – 1939. A Record of the Final Decade, New York u. a. 1992, S. 284. Kommentar zu Freuds Eintrag vom 29. November 1931, S. 113. Sigmund Freud : Wege der psychoanalytischen Therapie, in : ders. : Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet, Bd. 12 : Werke aus den Jahren 1917 – 1920, hg. v. Anna Freud, London 1947, S. 192. Ebd. Karl Fallend, Johannes Reichmayr : Das » Psychologische Wien «, in : Helene Maimann ( Hg.): Die ersten 100 Jahre. Österreichische Sozialdemokratie 1888 – 1988, Wien/München 1988, S. 142. Robert Coles : Anna Freud – The Dream of Psychoanalysis, Reading, Mass. u. a. 1991, S. 9. Rudolf Ekstein : Foreword, in : Sheldon Gardner, Gwendolyn Stevens : Red Vienna and the Golden Age of Psychology, 1918 – 1938, New York u. a. 1992. Wilhelm Reich : Passion of Youth – An Autobiography, 1897 – 1922, New York 1990, S. 74. Richard Sterba : Reminiscences of a Viennese Psychoanalyst, Detroit 1982, S. 21f. Ebd., S. 81. Einen guten Überblick inklusive einzelner Porträts liefert : Andrea Bronner ( Hg.): Vienna Psychoanalytic Society – The First 100 Years, Wien 2008. Sterba, Reminiscences, S. 81. Amtsmitteilung vom 23. Oktober 1920, Wien. Präsidium des Volksgesundheitsamtes im Staatsamt für soziale Verwaltung. Verabschiedung des Herrn Unterstaatssekretärs Prof. Tandler, in : Josephinum, Dokument # 4027/16. Kurt R. Eissler : Freud as an Expert Witness. The Discussion of War Neuroses Between Freud and Wagner-Jauregg, Madison, Conn. 1986, S. 60f. Erstveröffentlichung : Kurt R. Eissler : Freud und WagnerJauregg vor der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen ( Veröffentlichungen des LudwigBoltzmann-Institutes für Geschichte der Gesellschaftswissenschaften ), Wien 1979.
14
15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
Sigmund Freud to Oliver and Henny Freud, letter of May 7, 1924, papers of Sigmund Freud, Collections of the Manuscript Division, in : U.S. Library of Congress, zit. n. Ernst Falzeder ( Hg.): The correspondence of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi, Bd. 3 : 1920 – 1933, Cambridge, Mass. u. a. 2000, S. 152. Zwei neue Bürger der Stadt Wien, in : Arbeiter-Zeitung, 7. Mai 1924, S. 8. Vgl. Wolfgang Maderthaner, Lutz Musner : Outcast Vienna : The Politics of Transgression, in : International Labor and Working Class History ( 2003 ) 64, S. 25 – 37. Josef Karl Friedjung : Zur Frage des Kinderselbstmordes, in : Zeitschrift für Kinderforschung 36 ( 1930 ), S. 502 – 520. Anna Freud : Four Lectures on Psychoanalysis for Teachers and Parents ( 1930 ), in : dies. : The Writings of Anna Freud, Bd. 1 : Introduction to Psychoanalysis : Lectures for Child Analysts and Teachers, 1922 – 1935, New York 1974, S. 127. Josef Karl Friedjung : Report on the First International Congress of Child Psychiatry, Paris, France, July 24 to Aug. 1, 1937, in : Archives of Neurology and Psychiatry 37 ( 1937 ) 5, S. 1171. Julius Tandler : Kranker und Krankenhaus, in : Blätter für Krankenpflege und Fürsorge 3 ( 1936 ) 9 – 10, S. 70. Hilde Kramer : The First Child Guidance Center and Its First Patient, in : Individual Psychology Bulletin ( 1942 ) 2, S. 34. Vgl. Elisabeth Young-Bruehl : Anna Freud : A Biography, New York 1988, S. 100. Vgl. Anna Freud : A short history of child analysis, in : The Psychoanalytic Study of the Child 21 ( 1966 ) 1, S. 7 – 14. Eduard Hitschmann : A Ten Years ’ Report of the Vienna Psycho-Analytical Clinic, in : International Journal of PsychoAnalysis 13 ( 1932 ), S. 245 – 255. Karl Fallend : Sonderlinge, Träumer, Sensitive. Psychoanalyse auf dem Weg zur Institution und Profession. Protokolle der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung und biographische Studien, Wien 1995, S. 114. Beth Noveck : Hugo Bettauer and the Political Culture of the First Republic, in : Contemporary Austrian Studies 3 ( 1995 ), S. 145.
27
28
29
30
31
32 33 34
Vgl. Christine Diercks : The Vienna Psychoanalytic Polyclinic (› Ambulatorium ‹): Wilhelm Reich and the Technical Seminar, in : Psychoanalysis and History 4 ( 2002 ) 1, S. 67 – 84. Vgl. Britta I. McEwen : Welfare and Eugenics : Julius Tandler ’s Rassenhygienische Vision for Interwar Vienna, in : Austrian History Yearbook 41 ( 2010 ), S. 170 – 190. Sigmund Freud : Geleitwort, in : August Aichhorn : Verwahrloste Jugend. Die Psychoanalyse in der Fürsorgeerziehung. Zehn Vorträge zur ersten Einführung, Leipzig/Wien/Zürich 1925, S. 3. Anna Freud : Child Analysis as a SubSpecialty of Psychoanalysis, in : dies., The Writings of Anna Freud, Bd. 7 : Problems of Psychoanalytic Training, Diagnosis, and the Technique of Therapy, 1966 – 1970, New York 1971. Rudolf Ekstein : Reflections on and Translation of Paul Federn ’s › The Fatherless Society ‹, in : The Reiss-Davis Clinic Bulletin 8 ( 1971 ), S. 28. Ebd., S. 7. Coles, Anna Freud, S. 46. Vgl. Thomas Aichhorn : August Aichhorn. Der Beginn psychoanalytischer Sozialarbeit, in : Soziales Kapital. Wissenschaftliches Journal österreichischer FachhochschulStudiengänge Soziale Arbeit ( 2014 ) 12, S. 203 – 221.
89
90
O B DAC H LO S I M R OT E N W I E N Sigrid Wadauer
Die Bekämpfung von Wohnungsnot und Wohnungselend, die Lösung der Wohnungsfrage galt im Roten Wien als » Angel punkt der ganzen Sozialpolitik «.1 Obdachlosigkeit blieb jedoch ein kaum zu leugnendes Problem, das – nicht zuletzt, weil es von der Opposition zum Symbol des Versagens dieser Politik gemacht wurde – eine enorme Präsenz in den Medien und politischen Auseinandersetzungen hatte.
Zahlen, Hilfseinrichtungen Das Ausmaß der Wohnungsund Problemlagen not und Obdachlosigkeit zu
messen, die Situation vor und nach dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen, ist schwierig. Zur Verfügung stehende Statistiken verdeutlichen das Entstehen einer städtischen Obdachlosenfürsorge seit dem späten 19. Jahrhundert, die Verschiebung von privater Wohlfahrt zur ( nicht immer eindeutig abgrenzbaren ) öffentlichen Fürsorge.2 Die Veränderung der Besucherfrequenz von Hilfseinrichtungen und Anstalten veranschaulichte dabei stets auch die Veränderungen dieser Einrichtungen, ihrer Kapazitäten und Statuten. So verzeichnete das 1883 gegründete städtische Asyl- und Werkhaus 1913 119.490 Verpflegungstage, Einrichtungen des privaten Asylvereins für Obdachlose hingegen mehr als 420.000. Die von privaten Stiftungen und Vereinen betriebenen Heime für obdachlose Familien wiesen in diesem Jahr
zusätzlich mehr als 100.000 Nächtigungen auf.3 Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das städtische Asyl- und Werkhaus 4 ( ab 1925 : Obdachlosenheim ), das, eher abgelegen, in einem ehemaligen Fabrikgebäude in der Arsenalstraße untergebracht war, zur wichtigsten und größten Einrichtung ausgebaut. 1925 wurde ein einstiges Pferdeschlachthaus zum Obdachlosenheim II umgewandelt, 1931/32 wurde ein ehemaliges Wachegebäude hinzugefügt, sodass der Anstalt, die 1900 lediglich 77 und 1911 300 Schlafgelegenheiten bot, nun insgesamt 3.000 Schlafplätze zur Verfügung standen 5 – genügend, wie die Stadtverwaltung immer wieder betonte. Auch die zulässige Aufenthaltsdauer im Asyl – ursprünglich war sie auf sieben Tage pro Quartal begrenzt – wurde nun › großherzig ‹ gehandhabt und auf bis zu drei Monate pro Jahr erweitert. Das städtische Werkhaus, eine Arbeitsanstalt, in der man sich selbst melden oder in die man von der Polizei aufgrund des Vagabundengesetzes eingewiesen werden konnte, wurde in ein » Dauerheim « umgewandelt, in dem mehr oder minder arbeitsfähige, mittel- und arbeitslose Obdachlose mit Heimatrecht in Wien bis zu zwei Monate gegen Leistung von Arbeit Unterkunft finden konnten. Daneben gab es ( abgesehen von den Versorgungshäusern der Stadt für Alte, Kranke und Arbeitsunfähige ) eine Reihe anderer öffentlicher und auch privater Einrichtungen, die etwa Minderjährigen ( die ab 1925 nicht mehr mit ihren Familien im stätischen Asyl nächtigen durften ), Familien, Mädchen und Frauen, Lehrlingen oder Hausgehilfinnen ( die mit dem Posten auch ihr Quartier verloren ) kostenlos oder gegen geringe Gebühr Unterkunft boten. In den Wintermonaten gaben Wärmestuben Obdach. Darüber hinaus wurden nach dem Krieg diverse Notmaßnahmen ergriffen, die oft jahrelang fortbestanden. So beherbergte die Roßauer Kaserne obdachlose Familien. Es wurden Baracken
adaptiert und verschiedene Räumlichkeiten umgewidmet. Auch wenn das Bettgehertum der Vorkriegszeit nun selten geworden war, so gab es doch nach wie vor viele, die unter Raumnot oder gesundheitsschädlichen Wohnverhältnissen litten, erwerbslos ihre Miete nicht mehr zahlen konnten oder in prekären, ungeschützten Untermietverhältnisse wohnten und kaum Mittel gegen Kündigung und Delogierung in der Hand hatten. Manche, die keine Unterkunft hatten und/oder sich nicht an öffentliche Einrichtungen wenden wollten oder – mangels Anspruchs – konnten, schliefen unter freiem Himmel, am Donaukanal, in den Auen, errichteten mehr oder minder notdürftige Quartiere in Bretteldörfern oder hausten in Erdlöchern. An der Vielfalt der Einrichtungen und Unterkünfte wird auch die Heterogenität der Situationen und Problemlagen deutlich. Die Klientel der Obdachlosenfürsorge bestand – den Statistiken der Einrichtungen entsprechend – vorwiegend aus jüngeren, ledigen, mittellosen, erwerbslosen Männern und ArbeiterInnen. Darüber hinaus jedoch traf Obdachlosigkeit, wie immer wieder von verschiedensten Seiten betont wurde, Personen aller Schichten, BürgerInnen, abgebaute BeamtInnen und Gebildete. Sie traf, wie es hieß, aus dem Wirtschaftsleben Ausgeschiedene, » Gestrandete «, Gestrauchelte, AlkoholikerInnen, VerbrecherInnen und » Berufsobdachlose « und ging mit den Demoralisierten und Deklassierten also über die zentralen AdressatInnen der Sozialdemokratie hinaus. Obdachlosigkeit markierte » die Grenze zwischen Arbeiterschaft und Lumpenproletariat «.6 Letzteres wurde zwar als Produkt des kapitalistischen Systems betrachtet,7 es zu unterstützen, war aber nicht vorrangiges Anliegen der kommunalen Sozial- und Wohnungspolitik, denn diese wollte vor allem » schuldlos « obdachlos Gewordenen helfen. In politischen Debatten wurde Obdachlosigkeit dementsprechend höchst ambivalent als strukturelles Problem und sozialpolitische Frage, deren Lösung freilich nicht allein in der Hand der Stadt lag, wie als individuelles, moralisches Problem diskutiert. In Expertendiskursen ( und dazu zählte ja auch der zuständige Stadtrat und Arzt Julius Tandler ) kam es zugleich zu einer Pathologisierung und Medikalisierung des Phänomens. So betonte Tandler immer wieder, dass es sich bei den Insassen des Obdachlosenheims um verantwortungslose Elemente 8 und
Die ambivalente Haltung der Sozialdemokratie
Aufnahmeraum für das Obdachlosenheim der Stadt Wien in der Gänsbachergasse im 3. Bezirk, ca. 1926 ; Foto : Fritz Sauer ; Wien Museum, Inv. Nr. 98.695/1
91
nicht um die » allerbesten Menschen « handelte, dass man es hier mit den » Schlacken « des Großstadtlebens zu tun hätte.9 Obdachlosigkeit blieb eine Frage der Differenz von würdigen und unwürdigen Armen,10 von produktiven und unproduktiven Ausgaben. Dieser Zwiespalt wird auch in der Berichterstattung der Arbeiter-Zeitung deutlich. Man bemühte sich hier, die Verdienste der Gemeinde in der Bekämpfung oder gar Beseitigung11 von Obdachlosigkeit hervorzuheben12 und Anschuldigungen der Opposition zu widerlegen. Berichte schwankten zwischen Mitleid und Diffamierung der Betroffenen : Eine Reportage etwa schilderte » arme Teufel «, die unter der Reichsbrücke nächtigten. Diese würden von der Opposition zu » Kronzeugen gegen die rote Gemeinde und gegen den Mieterschutz « gemacht, könnten jedoch das böse Spiel, das mit ihnen getrieben wurde, nicht begreifen.13 Es wurde auf den fehlenden Anspruch der einen und auf die selbst verschuldete Obdachlosigkeit der anderen verwiesen. Manchen wurde unterstellt, dass sie lieber unter freiem Himmel als im Obdachlosenheim nächtigten. Heinrich Holek beschrieb in einer Reportage, wem er in einer Wärmestube begegnet war : verschiedenen Arbeitslosen und Delogierten, einem Alkoholiker, einem wegen » widernatürlichem Verkehr « abgebauten Beamten, einem Okkultisten, einem gänzlich verwahrlosten Jugendlichen und einem Ukrainer, der sich seiner guten Verbindungen zu Frontkämpfern und » Hakenkreuzlern « rühmte.14 Wenig einnehmend charakterisierte auch Oda Olberg die Insassen der Frauenabteilung des städtischen Obdach losenheims als unsolidarisch, diebisch, verwahrlost. Sie erfuhr aber auch Hilfsbereitschaft und problematisierte den Umgang mit den Frauen : »[I]n meinen Ohren summt es von preußischem Unteroffizierston, ohne daß mir das gerade anheimelnd klänge. Warum dieser harte Ton für die von so hartem Schicksal Betroffenen ? « 15 Ihre Reportage wurde von der Opposition hämisch als Eingeständnis des Versagens sozialdemokratischer Fürsorgepolitik aufgegriffen.
Werkstätte im Obdachenlosenheim der Stadt Wien in der Gänsbachergasse im 3. Bezirk, ca. 1926 ; Foto : Fritz Sauer ; Wien Museum, Inv. Nr. 57.962/104
Des Mittels der Sozialreportage – in Anlehnung an Max Winter und Emil Kläger – bedienten sich jedoch nicht nur Sozialdemokraten. Auch in der Reichspost, dem Neuen Wiener Journal, der Christlich-sozialen Arbeiter-Zeitung, der Freiheit ! und der kommunistischen Roten Fahne erschienen immer wieder Berichte über das » dunkelste Wien «, in denen vielfältige Missstände des städtischen Obdachlosenheims angeprangert wurden.16 Neben der statutarisch begrenzten Aufenthaltsdauer ( die von der Gemeinde Wien als Erbe der Vorkriegszeit gerechtfertigt, aber auch liberal gehandhabt wurde ) und den Öffnungszeiten ( die Obdachlosen mussten tagsüber das Heim verlassen ) galt die Kritik vor allem der Ausstattung der Heime : die riesigen Säle, der Mangel an Bettzeug und Matratzen. Die Betten bestanden aus Drahtgitter, Strohmatratzen wurden aus Hygienegründen gar nicht oder nur für zahlende Gäste verwendet. Es wurden der Schmutz, die mangelnde Reinlichkeit der Insassen und der Gestank bemängelt, aber auch, dass die Desinfektion die Kleidung der Obdachlosen vollends zerstören würde. Die Verpflegung wurde als » Hundefraß «, die medizinische Versorgung als mangelhaft beschrieben. Auch der Umgang mit den Obdachlosen wurde, ähnlich wie in Olbergs Reportage, als entwürdigend betrachtet, Menschen würden wie Tiere behandelt, die Anstalt würde eher einer Strafanstalt, einem » Sibirien der Obdachlosen «,17 gleichen. Kritisiert wurde, dass die Insassen des Dauerheims, die mit Arbeiten im Heim selbst, mit Reparaturen, aber vor allem auch mit Säckekleben beschäftigt waren, zwangsbeschäftigt und ausgebeutet würden. Der christ-
Die Kritik der Opposition
92
Obdachlosenheim der Stadt Wien in der Gänsbachergasse im 3. Bezirk, um 1934 ; Foto : Fritz Zvacek ; ÖNB Wien / Zvacek, 141.068A(B)
lichsoziale Gemeinderat Stöger, der 1931, ohne seine Identität preiszugeben, im städtischen Obdachlosenheim nächtigte, befand, das Heim wäre möglicherweise für den » Abschaum des Volkes « ausreichend, nicht aber für jene, die unfreiwillig arbeits- und wohnungslos wären. Er bemängelte die grenzenlose » Gleichmacherei « der Anstalt, Verbrecher und Mörder würden nicht von den würdigen Armen getrennt. Man habe ihn, der als Beruf » Beamter « angegeben habe, neben einem übel riechenden » Bierdippler «, der sich von Bierresten ernährte, einquartiert.18 Auch die Schilderungen der Opposition zeugten nicht von vorbehaltloser Solidarität. Obdachlose wurden jedoch nicht nur für die parteipolitische Ausei nandersetzung instrumentalisiert, sie waren nicht bloß Objekt linker wie rechter Mobilisierungsversuche,19 sie wurden auch als aktiver Teil der Auseinandersetzungen greifbar.20 Die Forderungen der Pfleglingsräte, Aktionskomitees und Vertrauensleute der Obdachlosen21 wurden in verschiedenen Zeitungen aufgegriffen und publik gemacht. Es finden sich zahlreiche – mehr oder minder – positive Berichte über politische Kundgebungen, Protestversammlungen und Aktionen. Vor allem in der Illustrierten Kronen-Zeitung erschienen immer wieder Leserbriefe einzelner BewohnerInnen des Obdachlosenheims. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen standen der Anspruch auf und die Verfügungsgewalt über die neu gebauten Gemeindewohnungen. Der Gemeinde wurde Protektionismus unterstellt, es wurde kritisiert, dass Wohnungen nicht den » wahren « Obdachlosen zugeteilt würden. Anfang der 1920er Jahre erhob die Wohnungsliga den Anspruch, Obdachlose, Wohnungssuchende und wohnungslose Untermieter zu sammeln und » unpolitisch « zu repräsentieren.22 Man organisierte Beratung und Kundgebungen. Neben der Einrichtung von Wohnungsräten, der Abschaffung von Ablösen, Vermittlungsbüros und Wohnungsluxus, drakonischen Strafen für Missbräuche und Ähnlichem verlangte die Wohnungsliga, die sogar in der Wohnungs- und Siedlungskommission des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vertreten war, auch die » rücksichtslose « Vertreibung aller » Ostjuden «. Die Wohnungsnot wurde den Fremden und Flüchtlingen angelastet.23 Die Wohnungsvergabe sollte nur mehr eine Sache zwischen Wohnungssuchenden und HausbesitzerInnen sein, man forderte die Abschaffung des Wohnungsamts. Nachdem bekannt wurde, dass die Hausbesitzerorganisationen die Wohnungsliga finanziell unterstützten, löste sich diese Bewegung auf.
Streitpunkte und politische Aktionen
93
Einige Obdachlose griffen auch zur Selbsthilfe, indem sie versuchten, sich Wohnraum direkt anzueignen : So etwa besetzten 1925 in der Roßauer Kaserne untergebrachte Familien einen noch nicht fertiggestellten Gemeindebau in der Gussenbauergasse. Nachdem sie von der Polizei vertrieben worden waren, zogen sie zum Rathaus, um die Zuteilung von Wohnungen zu erreichen. 1927 besetzten Obdachlose die Baracke 27, die nach dem Weltkrieg als Unterkunft genutzt wurde, dann aber von der Gemeinde verkauft werden sollte.24 1931 wurde ein weiterer Versuch, einen Wohnbau in Simmering zu besetzen, vereitelt, es blieb bei Demonstrationen.25 Die Gemeinde wollte die Vergabe von Wohnungen freilich nicht aus der Hand geben, man wollte nach Anspruch und Bedürftigkeit im Verwaltungsverfahren ( » bürokratisch «, wie die Opposition kritisierte ) entscheiden. In diesem Sinn verwehrte sich die Gemeinde gegen kollektive, aber auch gegen individuelle » Erpressungsversuche «, wie etwa jene Menschen, die demonstrativ in der Öffentlichkeit ihre Quartiere errichteten. Ein Zeltlager an der Donaulände war mit Transparenten versehen, auf denen » Schmücke dein Heim mit Blumen « und » Volkswohnhäuser der Gemeinde Wien, errichtet aus der Wohnbausteuer « zu lesen war.26 Ein anderes Mal stellten Wohnungslose Möbel unter einem Stadtbahnbogen auf oder nächtigten vor den Toren des Rathauses. Als ö ffentliche
Der obdachlose Georg Ziegler wohnt mit seiner Familie in einer Höhle an der Tiergartenmauer bei Lainz, 1931 ; Foto : Albert Hilscher ; ÖNB Wien / Hilscher, H 821 B
» Rothschildsanierer — die Obdachlosigkeit in Wien « , Plakat der KPÖ, 1932 ; ÖNB Wien, PLA16317488
94
rovokation galt auch, dass einige Familien in nächster Nähe P des städtischen Obdachlosenheims in Erdhöhlen hausten. Vielleicht, wie die Opposition vermutete, weil ihnen alles besser erschien als das Obdachlosenheim und weil sie vermeiden wollten, dass die Kinder von den Eltern getrennt an die Kinderübernahmsstelle überstellt wurden. Die Stadt ließ diese Ansiedlung vermeintlich Fürsorgeunwilliger mit Verweis auf sanitäre Mängel räumen, die Menschen wurden an das Obdachlosenheim übergeben. » Die Romantiker und Abenteurer « wurden » also wieder in die Ordnung der menschlichen Gesellschaft richtig eingefügt «, wie die Arbeiter-Zeitung berichtete.27 Nicht immer blieben solche Konflikte gewaltlos, gelegentlich wurde von Tumulten vor dem Wohnungsamt berichtet. 1927 kam es, anlässlich eines gegen Insassen ausgesprochenen Hausverbots, zu einer » Revolte «, in der die BewohnerInnen des Obdachlosenheims mit Messern und Gabeln auf die Wachen losgingen und zahlreiche Personen verletzt wurden.28 Die Gemeinde schrieb zwar solche Vorfälle gerne der Verhetzung durch » Radaubrüder «, » gewissenlose kommunistische Agitatoren « oder die Wohnungsliga zu, sie zeigte sich aber – wie Tandler stets betonte – in manchen Fällen durchaus bereit, auf Forderungen der Obdachlosen ein-
» D ie Delogierung der Höhlenbewohner von Simmering « , aus : Illustrierte Kronen-Zeitung, 11. Jänner 1930, S. 3
zugehen.29 Zugleich verfügte die Gemeinde auch über Sanktionsmöglichkeiten, wie etwa eben den Ausschluss aus dem Heim, der, wie die Opposition meinte, Kritik zum Schweigen bringen sollte, oder, wie im Fall dieser Revolte, die Schließung der Fürsorgestelle im Heim.30 Die Gewalt richtete sich nicht nur gegen die Behör den. Häufig wurde auch von Selbstmord oder anderen Verzweiflungstaten berichtet. Für die sozialdemokratische Berichterstattung bestätigte dies die Dringlichkeit ihrer Wohnungspolitik. Die Opposition und Presse stilisierten solche Fälle gern zu Opfern sozialdemokratischer Politik. Das Elend nahm jedoch nicht immer mitleiderregende, sondern auch bedrohliche Formen an. Linke wie rechte Zeitungen berichteten regelmäßig über im Obdachlosenheim wohnhafte Mörder, Verbrecher, Prostituierte, Bettler31 oder Betrüger. Obdachlosigkeit verdeutlichte somit das Entstehen einer neuen Sozialpolitik in all ihrer Widersprüchlichkeit und Ambivalenz. Sie wurde auf neuartige Weise zu einem sozialpolitischen Problem und zur öffentlichen Aufgabe gemacht, sie wurde Gegenstand neuer Regulierungen und der Fürsorge, wurde dabei aber – auch weiterhin – als Abweichung und Verfehlung wahrgenommen, der Disziplinierung und moralisierenden Ausgrenzung unterworfen.
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
Die Wohnungspolitik der Gemeinde Wien. Ein Überblick über die Tätigkeit der Stadt Wien seit dem Kriegsende zur Bekämpfung der Wohnungsnot und zur Hebung der Wohnkultur, Wien 1926, S. 10. Vgl. Britta-Marie Schenk : Die Grenzen der Disziplinierung. Devianzvorstellungen und Pathologisierungen in der Obdachlosenfürsorge des Deutschen Kaiserreichs, in : WerkstattGeschichte 27 ( 2018 ) 78, S. 25 – 37. Vgl. Michael John : Obdachlosigkeit – Massenerscheinung und Unruheherd im Wien der Spätgründerzeit, in : Hubert Ch. Ehalt, Gernot Heiß, Hannes Stekl ( Hg.): Glücklich ist, wer vergißt …? Das andere Wien um 1900, Wien/Köln/ Graz 1986, S. 173 – 194, hier S. 176 ; ders. : Hausherrenmacht und Mieterelend. Wohnverhältnisse und Wohnerfahrung der Unterschichten in Wien 1890 – 1923, Wien 1982 ; Albert Lichtblau : Wiener Wohnungspolitik 1892 – 1919, Wien 1984. Vgl. Das Asyl- und Werkhaus der Stadt Wien, hg. v. d. Magistratsabteilung XI, Wien 1913 ; August Decker : Das Asylund Werkhaus der Stadt Wien 1885 – 1925, ungedr. Diss. Univ. Innsbruck 1949 ; Asyl und Werkhaus. Um- bzw. Neugestaltung, in : Blätter für das Wohlfahrts- und Armenwesen der Stadt Wien 21 ( 1922 ) 233, S. 20 – 22 ; August Decker : Das Asyl und Werkhaus, in : Blätter für das Wohlfahrts- und Armenwesen der Stadt Wien 24 ( 1925 ) 47, S. 4f. ; Julius Tandler : Die Fürsorgeaufgaben der Gemeinde, in : Das Neue Wien. Städtewerk, Bd. 2, hg. unter offizieller Mitwirkung der Gemeinde Wien, Wien 1927, S. 337 – 645. Vgl. Decker, Asyl- und Werkhaus, S. 258, S. 263. Obdachlosigkeit und Wohnungsnot, in : Arbeiter-Zeitung, 7. Mai 1923, S. 2. Vgl. Der Bau der neuen dreißigtausend Wohnungen vom Gemeinderat beschlossen. Das große Aufbauprogramm im Gemeinderat, in : Arbeiter-Zeitung, 28. Mai 1927, S. 6. Vgl. Stenographischer Bericht über die Sitzung des Gemeinderates vom 29. 4. 1921, S. 461, in : Wiener Stadt- und Landesarchiv ( künftig : WStLA ), B29/5/1921. » Jede Großstadt wirft ihre Schlacken aus, das weiß man und daß daneben hoch achtbare Menschen sich finden, ist eben-so klar. « Stenographischer Bericht über die Sitzung des Gemeinderates vom 14. 6. 1927, S. 3111, in : WStLA, B29/62/1927. Zu Tandler vgl. Doris Byer : Rassenhygiene und Wohlfahrtspflege. Zur Entstehung eines sozialdemokratischen Machtdispositivs in Österreich bis 1934, Frankfurt a. M./New York 1988 ; Karl Sablik : Julius Tandler. Mediziner und Sozialreformer. Eine Biographie, Wien 1983 ; Peter Schwarz : Julius Tandler. Zwischen Humanismus und Eugenik, Wien 2017. Vgl. Karl Seitz : » Es gibt in Wien keinen Obdachlosen, es gibt in Wien kein hungerndes Schulkind. « Die Verhandlung im Nationalrat, in : Arbeiter-Zeitung, 22. Februar 1929, S. 3 – 5, hier S. 4.
12
13
14 15 16
17
18
19
20
Vgl. Was die Gemeinde für die Obdachlosen macht, in : Arbeiter-Zeitung, 7. April 1927, S. 9. Müssen Menschen unter der Reichsbrücke wohnen ?, in : Arbeiter-Zeitung, 26. August 1928, S. 9. Heinrich Holek : In der Wärmestube, in : Arbeiter-Zeitung, 25. Dezember 1923, S. 11f. Oda Olberg : Im Obdachlosenheim, in : Arbeiter-Zeitung, 8. April 1931, S. 5. Nur einige Beispiele : Streifzüge durchs rote Wien. Das städtische Obdachlosenasyl, in : Die Rote Fahne, 3. April 1927, S. 5f . ; » Wien, Wien, nur du allein …«. Eine Nacht im Obdachlosenheim des » roten Wien «, in : Die Rote Fahne, 27. Jänner 1929, S. 5f. ; Eine Nacht im Obdachlosenasyl, in : Christlichsoziale Arbeiter-Zeitung, 4. April 1931, S. 5f. ; Sträflingsarbeit in einem städtischen Fürsorgehaus, in : Freiheit !, 8. August 1930, S. 1f. ; Die Verlorenen vom Geiselberg. Bilder aus dem städtischen Obdachlosenheim, in : Freiheit !, 23. August 1927, S. 3 ; Franz Steiner : Im Obdachlosenasyl der Gemeinde Wien, in : Reichspost, 27. Februar 1927, S. 9f. ; Im Asyl für Obdachlose. Bei den Ärmsten der Armen, in : Neues Wiener Journal, 23. September 1927, S. 5f. ; Erik : Im Quartier der Quartierlosen. Gast im Wiener Obdachlosenheim, in : Neues Wiener Journal, 6. September 1928, S. 7 ; Wiener Quartiere des Elends und der Not, in : Wiener Montagsblatt, 22. Oktober 1928, S. 4. Revolte im Obdachlosen-Asyl, in : Illustrierte Kronen-Zeitung, 27. Februar 1927, S. 4 ; Das Obdachlosenheim wird geräumt, in : Die Rote Fahne, 28. Mai 1931, S. 5. Stenographischer Bericht über die Sitzung des Gemeinderates vom 3. 2. 1931, S. 330 – 335, in : WStLA, Gemeinderat, B29/103/1931. Zu vergleichbaren Mobilisierungsversuchen der Nationalsozialisten in Deutschland vgl. Wolfgang Ayaß : Vom » Pik As « ins » Kola-Fu «: Die Verfolgung der Bettler und Obdachlosen durch die Hamburger Sozialverwaltung, in : Projektgruppe für vergessene Opfer des NSRegimes in Hamburg e. V. ( Hg.): Verachtet – verfolgt – vernichtet – zu den › vergessenen ‹ Opfern des NSRegimes, Hamburg 1986, S. 152 – 171. Zu anarchistischer Propaganda etwa : Erich Mühsam : Generalstreik das Leben lang. Vagabundentreffen in Stuttgart 1929, in : Künstlerhaus Bethanien, Christian Chruxin ( Hg.): Wohnsitz : Nirgendwo. Vom Leben und Vom Überleben auf der Straße, Berlin 1982, S. 211 – 222 ; Roger A. Bruns : The Damndest Radical. The Life and World of Dr. Ben Reitman, Chicago’s Celebrated Hobo King, Social Reformer, and Whorehouse Physician, Urbana/Chicago 1987. Vgl. dazu auch Alfred Georg Frei : Die Arbeiterbewegung und die » Graswurzeln « am Beispiel der Wiener Wohnungspolitik 1919 – 1934, Wien 1991.
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
In den städtischen Fürsorgeanstalten und Versorgungshäusern sollten gewählte Pfleglingsräte die Interessen der InsassInnen vertreten. Vgl dazu etwa : Nicht mucken ! Maßregelung der Vertrauensmänner im Obdachlosenasyl, in : Die Reichspost 5. Jänner 1926, S. 6. Vgl. Die Wohnungsliga. Unpolitisches Kampforgan der Wohnungsliga, 15. September 1921. Vgl. z. B. Die Verzweiflung der Wohnungslosen, in : Der Morgen, 5. Dezember 1921, S. 2. Vgl. Nicht Gefängnis, sondern Wohnungen für Obdachlose !, in : Die Rote Fahne, 22. Jänner 1927, S. 3 ; Baracke 27, in : Illustrierte Kronen-Zeitung, 27. Jänner 1927, S. 2. Vgl. Obdachlose beziehen einen Neubau, in : Kleine Volks-Zeitung, 11. Juli 1928, S. 7. Vgl. Wie es den Obdachlosen im Polizeigefangenenhaus erging, in : Die Rote Fahne, 25. August 1925, S. 4 ; Jahrbuch der Bundespolizeidirektion Wien. Mit statistischen Daten aus dem Jahr 1925, Wien 1927, S. 130. Romantik des Menschenelends, in : ArbeiterZeitung, 11. Jänner 1930, S. 6. Allerdings finden sich – anders als in zahlreichen Berichten über arbeitsloses Wandern und Vagabundieren, das sich nicht nur als elend, sondern doch immer auch als ( männliches ) Abenteuer und jugendliche Bewährungsprobe deuten ließ – kaum Belege, die auf eine solche Idealisierung städtischer Obdachlosigkeit schließen lassen. Vgl. Sigrid Wadauer : Tramping in Search of Work. Practices of Wayfarers and of Authorities ( Austria 1880 – 1938 ), in : dies., Thomas Buchner, Alexander Mejstrik ( Hg.): The History of Labour Intermediation. Institutions and Finding Employment in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, New York/Oxford 2015, S. 286 – 334. Revolte im Obdachlosen-Asyl, S. 4 ; Die Schlacht im Obdachlosen-Asyl, in : Die Rote Fahne, 27. Februar 1927, S. 3 ; Tumult im Obdachlosenheim, in : Arbeiter-Zeitung, 26. Februar 1927, S. 5. Vgl. Was die Gemeinde für die Obdachlosen macht, S. 9 ; 135 obdachlose Familien erhalten Wohnung, in : ArbeiterZeitung, 19. September 1925, S. 6. Vgl. Eine Massenversammlung der Asylbewohner, in : Die Rote Fahne, 10. März 1927, S. 3. Vgl. dazu Sigrid Wadauer : Betteln – Arbeit – Arbeitsscheu ( Wien 1918 – 1938 ), in : Beate Althammer ( Hg.): Bettler in der europäischen Stadt der Moderne. Zwischen Barmherzigkeit, Repression und Sozialreform, Frankfurt a. M. u. a. 2007, S. 257 – 300.
95
DIESER KATALOG INTERESSIERT SIE? KLICKEN SIE HIER, UM ONLINE ODER TELEFONISCH ZU BESTELLEN.