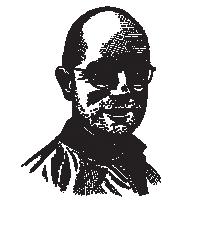4 minute read
Anders Hillborg im Gespräch
«BEIM KOMPONIEREN MUSS ES UM LEBEN UND TOD GEHEN»
VON CORINA KOLBE Anders Hillborg zählt zu den führenden zeitgenössischen Komponist*innen Schwedens. In dieser Saison ist er ‹Composer in Residence› beim Sinfonieorchester Basel. Im Interview spricht er über seine Vorbilder Bach und Ligeti, Prinzipientreue und den Dialog mit Solist*innen.
CK Wann haben Sie entdeckt, dass Sie
Musik schreiben wollten? AH Ziemlich spät. Als Jugendlicher spielte ich in Schweden erst in einer Popband, danach sang ich in einem Kirchenchor. Das Singen hat meinen Horizont erweitert und mich zum Komponieren geführt. Man bekommt ein Gefühl für die Linie, die Melodie. Den Unterschied zwischen einem Schritt und einem Sprung in der Musik spürt man physisch, ganz anders als beim Klavierspielen. Anfangs schrieb ich viele Chorstücke und fing dann an, Kontrapunkt zu studieren. Die vertikale Verbindung von Melodielinien mit ihren Gegenstimmen ist für mich die Essenz des Komponierens.
CK Welche Vorbilder haben Sie geprägt? AH Johann Sebastian Bach verdanke ich wichtige Grundlagen, er ist sozusagen mein Fundament. Als Student habe ich Fugen und andere Stücke im Stil von Bach geschrieben. Auch jetzt kehre ich noch häufig zu ihm zurück. Unter den Komponist*innen des 20. Jahrhunderts hatte György Ligeti schon früh grossen Einfluss auf mich. Ich denke, das hört man meiner Musik auch an. Ligeti hat mir eigentlich erst die Tür zur zeitgenössischen Musik geöffnet. Als ich in Stockholm Komposition studierte, habe ich mich ein Jahr lang intensiv mit seinem Requiem befasst. Ich war die ganze Zeit in diese Partitur vertieft.
CK Seit vierzig Jahren arbeiten Sie hauptberuflich als freischaffender Komponist. Haben Sie auch Durststrecken erlebt? AH Ich habe mir früh geschworen, niemals Professor an einer Musikhochschule zu werden oder sonst eine feste Position anzunehmen. Beim Komponieren muss es um Leben und Tod gehen. Wenn man ein sicheres Einkommen hat, findet man immer wieder Ausreden, um das Komponieren zu verschieben. Zumindest in den ersten zehn Jahren habe ich mich strikt an meinen Vorsatz gehalten, auch wenn ich zeitweise kaum Geld verdiente. Inzwischen unterrichte ich zwar auch, allerdings nur sporadisch. Wenn man sich zu lange im akademischen Umfeld bewegt, verliert man das Gefühl, dass alles auf Messers Schneide steht.
CK War es für Sie eine Herausforderung, eine eigene musikalische Sprache zu finden? AH Für mich ist das eine zwiespältige Sache. Zum einen ist es mir völlig gleichgültig, ob ich einen persönlichen Stil habe. Andererseits freue ich mich, wenn mir andere Leute sagen, dass sie meine Werke rasch identifizieren können. Originalität kann man nicht selbst beeinflussen. Entweder man ist originell, oder man ist es nicht. Ich lasse mich vor allem von meiner Neugier leiten. Deshalb kann man meine Musik kaum unter einem einzigen Begriff fassen.
CK Gab es Momente, in denen Sie an einem Wendepunkt standen? AH In den 80erJahren habe ich viel Zeit in Studios für elektronische Musik verbracht. Ich schrieb verrückte Stücke wie etwa Clang and Fury, das ist kaum spielbar. Selbst ein gutes Orchester stösst da an seine Grenzen. Um 1990 hatte ich genug von solchen Experimenten. Es war sehr schwierig, diese Musik mit Leben zu füllen. Meine Art zu komponieren hat sich seitdem stark verändert. Wenn ich etwa mit einem Geiger arbeite, merke ich sofort, dass jeder Ton, den er spielt, voller Bedeutung ist. Das ist das wahre Leben.
CK Stehen Sie während der Arbeit im
Dialog mit Solist*innen, denen die neuen Stücke gewidmet sind? AH In einigen Fällen ist es Teamwork. Manche Künstler*innen schlagen Änderungen vor, doch andere wollen sich lieber nicht einmischen. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass Musiker*innen mit unnötigen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Als Komponist kann ich unmöglich die Spieltechniken aller Instrumente kennen. Das ist unter Umständen aber auch von Vorteil. Man wird nicht durch sein Wissen blockiert und kann frei und unbelastet ungewöhnliche Ideen einbringen.
CK Als ‹Composer in Residence› beim
Sinfonieorchester Basel zeigen Sie unterschiedliche Facetten Ihres Œuvres. Das Konzert für Violoncello, das
Konzert für Viola und Sound Atlas sind als Schweizer Erstaufführungen zu erleben. AH Eine solche Residenz ist wunderbar. Wenn ein Orchester in einer Saison verschiedene Werke von mir aufführt, lernen die Musiker*innen und das Publikum meine musikalische Sprache umso besser kennen. Die beiden Konzerte sind während der Pandemie entstanden. Für uns alle war es eine schreckliche Zeit, aber immerhin konnte ich mich ungestört auf die Arbeit konzentrieren. Nach vielen einsamen Stunden ist es dann eine grosse Belohnung, wenn diese
Stücke von so hervorragenden Solisten wie dem Cellisten Nicolas Altstaedt und dem Bratscher Lawrence Power aufgeführt werden. In dem Orchesterstück Sound Atlas ist übrigens auch eine Glasharmonika zu hören. Ich liebe den Klang von Glas – er füllt den Saal, aber man weiss nie genau, wo er herkommt.
CK Der Geiger Pekka Kuusisto wird unter anderem Ihr Arrangement von
Bachs Choralvorspiel Ich ruf zu dir,
Herr Jesu Christ aufführen. Haben
Sie beim Komponieren auch an den
Film Solaris des russischen Regisseurs Andrei Tarkowski gedacht? AH Ja, Tarkowski ist mein grosses Idol. Tatsächlich hat mich Solaris, wo das Choralvorspiel an mehreren Stellen zu hören ist, zu dieser Bearbeitung inspiriert. Die Idee hatte ich vierzig Jahre lang im Kopf, bevor ich sie realisieren konnte. Bei Tarkowski gibt es immer wieder Momente, in denen sich der Erzählfluss verlangsamt, bis auf einmal nichts mehr passiert. Das versuche auch ich oft in meiner Musik zu erreichen.
Dieses Interview entstand für das Saisonprogramm 2022/23 des Sinfonieorchesters Basel.