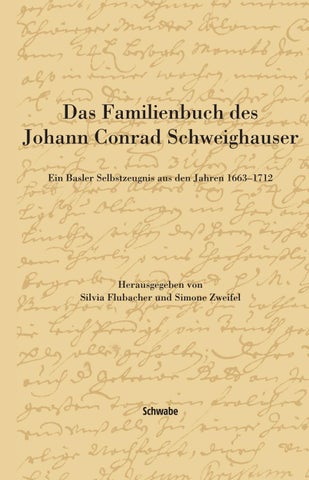9 minute read
Einleitung
I. Wissenschaftlicher Kommentar
Einleitung
Advertisement
von Silvia Flubacher und Simone Zweifel
Johann Conrad Schweighauser (1648–1713) wurde als Sohn eines Notars in Basel geboren. Mit 15 Jahren wurde er in die Geschäfte seines Vaters eingeführt und 1673 zum Notar gewählt. Seine politische Karriere führte 1691 als Sechser1 der Rebleutenzunft in den Grossen Rat. Ein Jahr später wurde er zum Schaffner2 gewählt und erhielt 1710 schliesslich einen Sitz im Kleinen Rat. Mit seiner Frau, der Pfarrerstochter Valeria Stöcklin (1649–1720/29), hatte Schweighauser zwölf Kinder, wovon sechs das Kindesalter überlebten. 1713 starb Schweighauser im Alter von 65 Jahren. Von ihm ist ein Familienbuch überliefert, das an dieser Stelle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.3 Die Transkription dieses im Original rund hundert Seiten umfassenden Büchleins im Oktavformat nimmt den grössten Teil dieser Publikation ein, die aus einer studentischen Gruppenarbeit entstanden ist, an der Arlette Birrer, Matthias Boos, Silvia Flubacher, Marina Peterhans, Suzanne Rupp, Elijah Strub, Cyril Werndli und Simone Zweifel beteiligt waren.4 Ergänzt wird die Transkription durch thematische Beiträge sowie durch einen editorischen Kommentar.
1 Das Amt des Sechsers berechtigte zu einem Sitz im Grossen Rat. Vgl. Müller, Alfred. Die Ratsverfassung der Stadt Basel von 1521 bis 1798, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 53 (1954), S. 5–98, hier S. 11. 2 Der Schaffner verwaltete die Güter der Stifte und Klöster, in Basel blieben auch nach der Reformation die klösterlichen Verwaltungsstrukturen in grossen Teilen erhalten. Vgl. Tremp, Ernst. «Schaffner», in: Historisches Lexikon der Schweiz.
Online unter: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D26448.php [Stand: 8. Dezember 2011]. 3 Staatsarchiv Basel Stadt (StABS), PA 199 1. Tagebuch von Johann Konrad
Schweighauser, [S. 43]. Im Folgenden als Familienbuch bezeichnet. 4 Für die Transkription wurden keine Vorlagen benutzt. Es existiert jedoch eine unveröffentlichte Teiltranskription des Schweighauserischen Familienbuches,
10
Wissenschaftlicher Kommentar
Wie viele andere frühneuzeitliche Autoren versah Johann Conrad Schweighauser seinen Text nicht mit einem Titel. Dennoch haben wir uns entschieden, diesen als Familienbuch zu bezeichnen, wobei wir uns dabei auf die Form und den Inhalt des Textes beziehen. Denn darin spielt die Familie eine bedeutende Rolle, was ein charakteristisches Merkmal von Familienbüchern darstellt.5 Das Genre des Familienbuchs ist äusserst vielschichtig und nicht durch «klare gattungstypologische Abgrenzungen, sondern durch offene Affinitäten zum weiten Feld der häuslichen Aufzeichnungen, zum Rechnungsbuch, Handelsbuch, Hausbuch, Wappenbuch, Tagebuch, zur Chronik und zum rechtfertigenden oder vermächtnishaften Selbstzeugnis» gekennzeichnet.6 Dass in einem frühneuzeitlichen Selbstzeugnis wie dem Familienbuch von Schweighauser auch politische Ereignisse Platz finden, ist nicht aussergewöhnlich. Laut Gudrun Piller schrieben «Frauen und Männer über sogenannt ‹Privates› wie Geburten, Krankhei-
die von Frank Faessler und Martin Mattmüller 1997 im Rahmen eines Archivseminars von Kaspar von Greyerz erstellt wurde. 5 Studt, Birgit. Erinnerung und Identität, in: Dies. (Hg.). Haus und Familienbücher in der städtischen Gesellschaft des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Köln/Weimar/Wien 2007, S. 1–31, hier S. 5. Siehe auch Tersch, Harald.
Vielfalt der Formen. Selbstzeugnisse der Frühen Neuzeit als historische Quellen, in: Thomas Winkelbauer (Hg.). Vom Lebenslauf zur Biographie. Geschichte,
Quellen und Probleme der historischen Biographik und Autobiographik. Waidhofen/Thaya 2000, S. 69–98, hier S. 70. Wir verwenden «Familie» als einen analytischen Begriff, der nicht nur Blutsverwandte, sondern auch so genannt «soziale Verwandte» miteinbezieht. Zur biologischen und sozialen Verwandtschaft siehe u.a. Seidel, Kerstin. Freunde und Verwandte. Soziale Beziehungen in einer spätmittelalterlichen Stadt. Frankfurt/New York 2009; Teuscher, Simon. Bekannte – Klienten – Verwandte. Soziabilität und Politik in der Stadt Bern um 1500. Köln/Weimar/Wien 1998; Signori, Gabriela. Pflegekinder, Stiefkinder,
Morgengabskinder: Formen sozialer Eltern bzw. Kindschaft in der Gesellschaft des Spätmittelalters, in: Schmidt, Johannes F.K./Martine Guichard/Peter Schuster/Fritz Trillmich (Hg.). Freundschaft und Verwandtschaft. Zur Unterscheidung und Verflechtung zweier Beziehungssysteme. Konstanz 2007, S. 165–180. 6 Rohmann, Georg. Mit seer grosser muhe und schreiben an ferre Ort. Wissensproduktion und Wissensvernetzung in der deutschsprachigen Familienbuchschreibung des 16. Jahrhunderts, in: Birgit Studt (Hg.). Haus und Familienbücher in der städtischen Gesellschaft des Spätmittelalters und der Frühen
Neuzeit. Köln/Weimar/Wien 2007, S. 87–120, hier S. 95.
Einleitung 11
ten oder Todesfälle ebenso wie über öffentlichkeitsrelevante Themen wie Patenschaften, Geschäftliches und Politisches».7 Auch das Schweighauserische Famillienbuch enthält nicht nur Informationen zur Familie: Vielmehr kann von einer sich im Verlaufe des Textes bemerkbaren inhaltlichen Verschiebung von der Aufzeichnung eher allgemeiner Ereignisse zur Aufzeichnung von Ereignissen rund um die Familie gesprochen werden, wobei hier nicht nur die biologische, sondern auch die soziale Familie mitgemeint ist.8 Die Angaben rund um die Familie werden nach Schweighausers Tod von einem uns unbekannten Nachfahren in den «Schweighauserische Familie-Nachrichten» fortgesetzt.9 Dies ist nicht unüblich für ein frühneuzeitliches Familienbuch: Viele dieser Texte wurden von den ältesten (meist männlichen) Nachkommen übernommen und weitergeführt.10
Welche Motive Johann Conrad Schweighauser dazu veranlassten, ein Familienbuch zu verfassen, ist nicht bekannt. Auch findet sich in seinem Familienbuch nirgendwo eine Bemerkung über allfällige Adressaten, wie dies in anderen vormodernen Familien-
7 Piller, Gudrun. Private Körper. Schreiben über den Körper in Selbstzeugnissen des 18. Jahrhunderts, in: Kaspar von Greyerz (Hg.). Selbstzeugnisse in der frühen Neuzeit, Individualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive. München 2007, S. 45–60, hier S. 47. 8 Siehe Zahnd, Urs Martin. Die autobiographischen Aufzeichnungen Ludwig von
Diesbachs. Bern 1986, S. 310; Zahnd, Urs Martin. Einige Bemerkungen zu spätmittelalterlichen Familienbüchern aus Nürnberg und Bern, in: Rudolf Endres (Hg.). Nürnberg und Bern. Zwei Reichsstädte und ihre Landgebiete. Erlangen 1990, S. 7–38, hier S. 9f. 9 StABS, PA 199 2. Schweighauser’sche Papiere 1765 und Familiennachrichten.
Dieses Dokument wird von uns im Folgenden aufgrund der Bezeichnung des
Autoren als «Schweighauserische Familie-Nachrichten» bezeichnet. 10 Studt, Birgit. Haus- und Familienbücher, in: Pauser, Josef/Martin Scheutz/Thomas Winkelbauer (Hg.). Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch (=Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergbd. 44). Wien/München 2004, S. 753–766, hier S. 757f.; Zahnd, Aufzeichnungen Ludwig von Diesbachs, S. 311; Zotz, Thomas. Der Stadtadel im spätmittelalterlichen Deutschland und seine Erinnerungskultur, in: Werner Rösener (Hg.). Adelige und Bürgerliche Erinnerungskulturen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (=Formen der Erinnerung,
Bd. 8). Göttingen 2000, S. 145–161, hier S. 151.
12
Wissenschaftlicher Kommentar
büchern der Fall ist.11 Ein Hinweis auf Schweighausers Schreibmotivation könnte jedoch der Zeitpunkt des ersten Eintrages liefern, der auf das Jahr 1663 datiert ist. In diesem Jahr war Schweighauser nach einer Reise nach Frankreich in die Notariats-Geschäfte seines Vaters eingestiegen – und damit auch in einen neuen Lebensabschnitt.12
Wie Schweighauser entschied, was er in seinem Familienbuch aufzeichnete und was nicht, lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil er Ereignisse nicht erwähnte, die uns aus heutiger Sicht bezüglich seiner Biographie als bedeutsam erscheinen. In Bezug auf die Aufzeichnung seiner eigenen Wahlen war er zum Beispiel nicht konsequent: Während er die Wahl zum Sechser beschrieb, findet sich kein Eintrag zu seiner Wahl in den Kleinen Rat, der in dieser Zeit – bis auf den Dreizehnerrat – das bedeutendste politische
11 Siehe z.B. Diesbach, Ludwig von. Herr Ludwigs von Diesbach Cronick, hg. von
Urs Martin Zahnd, in: Ders. Die autobiographischen Aufzeichnungen Ludwig von Diesbachs. Bern 1986, S. 26–115, hier S. 26; Schürstab, Erasmus. Erasmus
Schürstabs Geschlechtsbuch, hg. von Friedrich Weech, in: Jahresbericht des historischen Vereins für Mittelfranken 31 (1863), S. 39–84, hier S. 45; Muffel,
Nikolaus. Das Gedenkbuch von Nikolaus Muffel, hg. von Karl Hegel, in: Die
Chroniken der Deutschen Städte 11 (1874), S. 737–751, hier S. 746. 12 «Schweighauserische Familie-Nachrichten», S. 7; Universitätsbibliothek Basel-
Stadt (UB BS), KiAr G X 47 Nr. 23. Die Gewißheit Göttl. Gnade in Christo JESU für alle bußfertige Sünder/Gezeiget Jn einer Christlichen LeichPredigt […] Jo.
Conr. Schweighausers des Rahts/Durch Friederich Battier/Pfarrern bey
St. Alban, [15. Mai 1713], S. 29. Die «PERSONALIA» hat Schweighauser
«schon vor etlichen Jahren […] auffgesetzt und schrifftlich hinderlassen», also selber verfasst. Ebd., S. 28, im Folgenden zitiert als «Personalia» vgl. Jenny,
Beat R. Humanismus und städtische Eliten in Basel im 16. Jahrhundert, in:
Meyer, Werner/Kaspar von Greyerz (Hg.). Platteriana. Beiträge zum 500. Geburtstag des Thomas Platter (1499?–1582) (=Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 175). Basel 2002, S. 77–121, hier S. 117. Zur Motivation, nach einer Rückkehr mit dem Schreiben zu beginnen, siehe Monnet, Pierre. Reale und ideale Stadt. Die oberdeutschen Städte im Spiegel autobiographischer Zeugnisse des Spätmittelalters, in: Greyerz, Kaspar von/Hans Medick/Patrice Veit (Hg.). Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500–1850). Köln/Weimar/Wien 2001,
S. 395–430, hier S. 406.
Einleitung 13
Gremium Basels darstellte.13 Auch die Unruhen von 1691 finden in seinem Familienbuch keine Erwähnung, obwohl dieses Ereignis sehr wahrscheinlich grosse Auswirkungen auf sein Leben hatte: Schweighauser wurde noch im selben Jahr, kurz nach den Unruhen, erstmals in den Grossen Rat gewählt.14 Dies deutet darauf hin, dass er vermutlich von einem während der Unruhen frei gewordenen Ratssitze profitiert hat. Auch seine Wahl zum «directore der alhiesigen geistlichen gefällen»,15 d.h. zum Schaffner, hängt mit den Unruhen von 1691 zusammen. Dieses Amt des Direktors war nämlich eine Folge der Umstrukturierung des Verwaltungs- und Aufsichtswesens nach den Unruhen.16
Um Schweighausers Familienbuch besser verorten zu können, werden im ersten Teil dieser Publikation der historische Kontext sowie inhaltliche Themen aufgearbeitet. Simone Zweifel vermittelt zunächst einen kurzen Überblick über den historischen Kontext dieser Quelle. Nach einer Einführung in die wirtschaftliche und politische Lage Basels um 1700 setzt sie den Schwerpunkt auf die Unruhen von 1691. Dies ist dadurch zu erklären, dass sich dieses Ereignis, wie eben erwähnt, sehr wahrscheinlich direkt auf das Leben Schweighausers ausgewirkt hat. Von derselben Autorin stammt auch der zweite Beitrag, der die Biographie von Johann Conrad Schweighauser sowie dessen Familiengeschichte thematisiert.
Aufzeichnungen über politische Ereignisse, Schilderungen von Personen aus der eigenen Umgebung und aussergewöhnliche Vorkommnisse finden sich vor allem im ersten Teil von Schweighausers Familienbuch. So berichtet der Notar beispielsweise von einem Mann, der im Rhein ertrunken ist, oder aber von einem «zwerg von zwen schuehen hoch», welcher «jm Junio dieß jahres
13 Zu den politischen Gremien Basels im 17. Jahrhundert siehe den Beitrag «Basel zu Zeiten Johann Conrad Schweighausers» in diesem Band. 14 Familienbuch, [S. 73]. 15 Ebd., [S. 74]. 16 Vettori, Arthur. Finanzhaushalt und Wirtschaftsverwaltung Basels (1689–1798).
Wirtschafts- und Lebensverhältnisse einer Gesellschaft zwischen Tradition und
Umbruch. Dissertation (=Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 149).
Basel 1984, S. 91.
14
Wissenschaftlicher Kommentar
war allhier kommen vnd gesehen worden».17 Auch Todesfälle von ihm bekannten Personen oder aber von für die Stadt Basel bedeutenden Persönlichkeiten wurden vermerkt, manchmal sogar mit Angabe der Todesursache. Auf solche Ereignisse geht Matthias Boos in seinem Beitrag genauer ein, wobei er einen Schwerpunkt auf Schweighausers Aufzeichnung von Kometenbeobachtungen setzt. Diese sind mit Skizzen versehen und wurden in den Jahren 1664 und 1665 festgehalten.
Solche ereignishaften Schilderungen werden im Verlaufe des Textes immer seltener und werden von Erwähnungen familiärer Ereignisse wie etwa Geburten, Taufen oder Hochzeiten abgelöst. Taufen nehmen dabei den grössten Teil ein: Schweighauser notierte neben den Taufen seiner Kinder 116 Patenschaften, wobei er selber 55 Kindern, seine Frau Valeria Stöcklin 21 und seine Kinder 40 Täuflingen Pate standen. Die Aufzeichnung der Paten und Patinnen erlauben einen Einblick in die sozialen und familiären Vernetzungen des Autors. Schweighauser verzeichnete diese Taufen wohl, «um sich überhaupt an die Vielzahl seiner Patenkinder zu erinnern, andererseits demonstriert er dadurch seine Integration in die Basler Bürgerschaft».18 Denn Patenschaften stellten in der frühen Neuzeit nicht nur eine spirituelle Vater- oder Mutterschaft dar, sondern sie waren auch Bestandteil einer sozialen Patronagebeziehung.19 Das Patenschaftswesen des frühneuzeitlichen Basels thematisieren Elijah Strub und Silvia Flubacher.
Der zweite Teil dieser Publikation ist der Transkription sowie dem editorischen Kommentar derselben gewidmet. Cyril Werndli befasst sich mit der Kodikologie des Familienbuchs, Simone Zweifel und Silvia Flubacher erläutern die Transkriptionsprinzi-
17 Familienbuch, [S. 10]. 18 Greyerz, Kaspar von/Fabian Brändle. Basler Selbstzeugnisse des 16./17. Jahrhunderts, in: Werner, Meyer/Kaspar von Greyerz. Platteriana. Beiträge zum 500. Geburtstag des Thomas Platter (1499?–1582) (=Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 175). Basel 2002, S. 59–75, hier S. 62. 19 Vgl. Greyerz/Brändle, Basler Selbstzeugnisse des 16./17. Jahrhunderts, S. 62f;
Jancke, Gabriele. Patronagebeziehungen in autobiographischen Schriften – Individualisierungsweisen?, in: Kaspar von Greyerz. Selbstzeugnisse in der frühen
Neuzeit, individualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive. München 2007, S. 13–31, hier S. 21–25.
Einleitung 15
pien und Suzanne Rupp legt die Methodik des Personenverzeichnisses dar.
Die Beiträge dienen der historischen Kontextualisierung oder beziehen sich auf inhaltlich ausgewählte Aspekte, die sowohl den chronikalischen Charakter des Familienbuches als auch dessen Verschiebung hin zum Familienverzeichnis berücksichtigen; sie können jedoch keine umfassende Auswertung des Textes bieten. Die Einordnung des Familienbuchs innerhalb der Selbstzeugnisforschung oder ein Vergleich mit weiteren zeitgenössischen Dokumenten kann in diesem Rahmen nicht geleistet werden. Dafür steht mit der Edition des Familienbuchs nun ein weiteres Selbstzeugnis der Forschung zur Verfügung.