Das plastische Werk 1960 – 2016

Richard Heß
Bildhauer
Das plastische Werk
1960 - 2016
Mit einer Einführung von Helmut Börsch-Supan
Verfasst und herausgegeben von Ilka und Jürgen Heß
Berlin 2016/2023
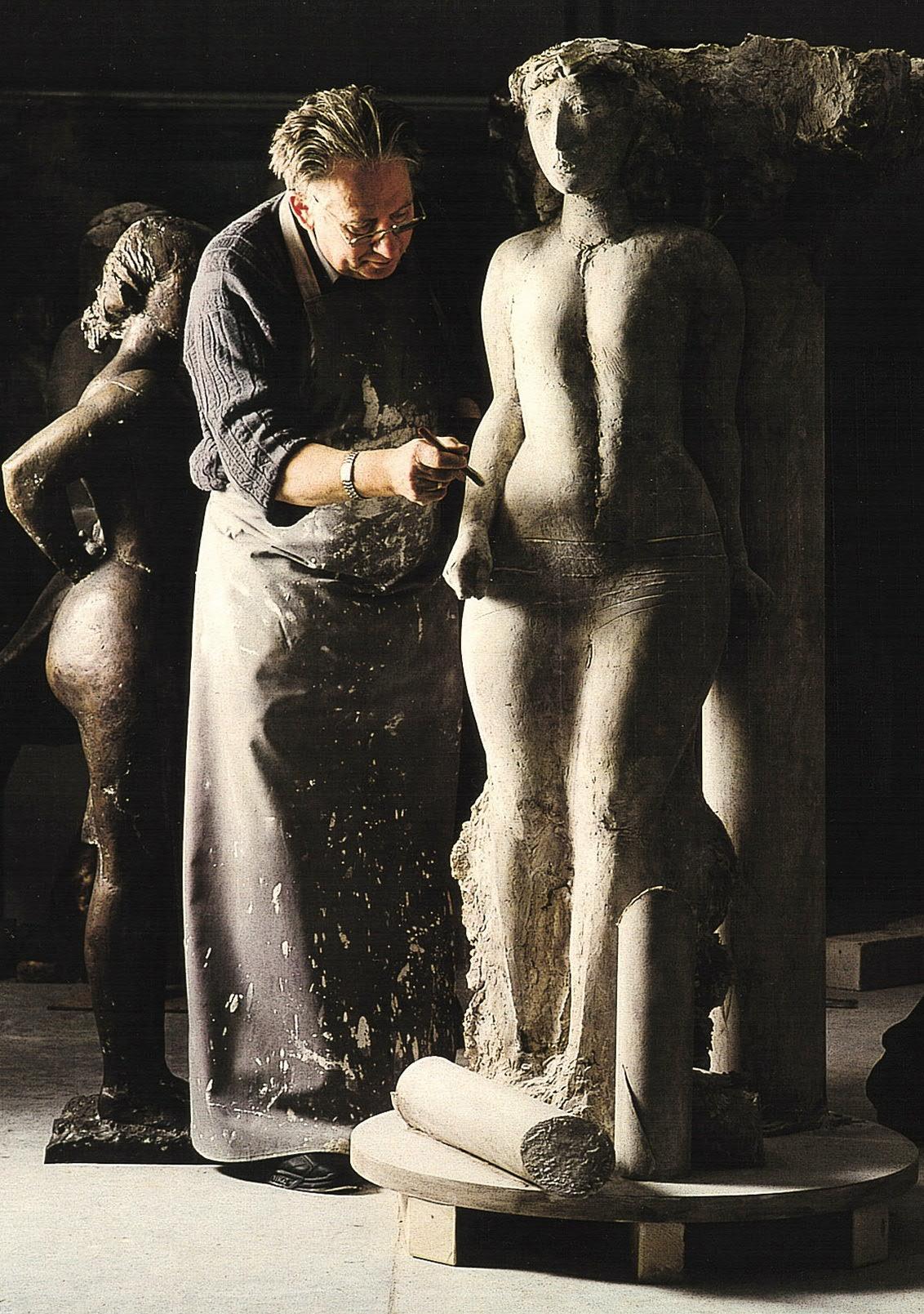 Richard Heß im Atelier, 2002 · Foto: Ferdinando Cioffi
Richard Heß im Atelier, 2002 · Foto: Ferdinando Cioffi
Richard Heß hat in den fünfzig Schaffensjahren als Bildhauer, die das Werkverzeichnis mit mehr als 700 Arbeiten dokumentiert, eine gewaltige Lebensleistung vollbracht. In ihm begegnet uns ein Typus von Künstler, für den das Übertragen von Gesehenem in gültige Form wie das Atmen zum Dasein gehört. Die Vitalität, die aus seinen Werken spricht, hat hier ihre Wurzel.
Nicht nur die Zahl der Arbeiten überrascht, sondern auch die der Ausstellungen. Mit seinen Werken Anteil am öffentlichen Leben zu haben, mehr noch als durch Ausstellungen durch Skulptur in oder an Gebäuden oder im Stadtraum, aber auch in privaten Lebensbereichen, ist ihm ein Bedürfnis. Seine Kunst stellt nicht nur ganz überwiegend Menschen dar, sondern sie ist auch als Kommunikation mit Menschen geschaffen. Sie ist gesellig und zielt auf Verständlichkeit. Deshalb erzählt Heß in seinen Skulpturen, namentlich in seinen Reliefs, mit denen er sich der Malerei annähert, ja die Grenzen zu ihr bisweilen überschreitet. Das Erzählen jedoch war in der offiziellen Kunst der westdeutschen Nachkriegskunst verpönt. Man duldete es in der Literatur, und es schmeckte ein wenig nach DDR. Tatsächlich standen manche Autoren, die über Heß geschrieben haben, diesem Staat nahe.
Heute, wo alte Mauern eingerissen sind und neue errichtet werden, ist die Zeit reif, über Geschichte Gewordenes mit Gelassenheit und Neugier auf andere Standorte nachzudenken. Dem Bildhauer, liegt angesichts allen Unrechts, das geschieht, das Menschliche einschließlich des AllzuMenschlichen am Herzen.
Das Werkverzeichnis ist etwas grundsächlich anderes als ein Ausstellungskatalog. In seiner Vollständigkeit nimmt man es zur Kenntnis wie eine Biographie. Die Menge der Kataloge seiner Einzelausstellungen kann das Brett eines Bücherregals füllen. In ihnen kann, auch wenn sie als Querschnitte angelegt sind, immer nur eine Auswahl unter einem bestimmten Aspekt gegeben werden, und wegen der Vergänglichkeit einer solchen Veranstaltung wird sie immer nur Gipfel vorzeigen, nicht aber die Breite, zu der auch Nebenwerke gehören. Ein Werkverzeichnis beinhaltet etwas Ganzes, das gewiss noch die eine oder andere Fortsetzung gestattet, aber weitgehend abgeschlossen ist und den Anspruch auf Dauer erhebt. Es dient dem Gedächtnis, ohne das Kultur nicht bestehen kann. Im Rückblick auf ein halbes Jahrhundert ist dieses Ganze Geschichte, die im Wandel des Individuellen etwas von den Umbrüchen, Wachstums- und Verfallprozessen im Allgemeinen spiegelt. Heß muss als Vertreter seiner Generation gesehen werden, die im tiefdunklen Schatten des Zweiten Weltkrieges aufgewachsen ist.
Richard Heß wuchs ohne Vater auf, denn dieser starb 1941 früh als Soldat. Die Mutter hat er als eine der ersten Arbeiten als Bildhauer 1960 porträtiert (Abb. 002). Sie wirkt streng mit fest am Kopf anliegendem Haar und entschlossen nach vorn gerichtetem Blick. West-Berlin, wo Mutter und Sohn lebten, war damals eine gefährdete, aber sehr lebendige Stadt, in der die Kriegszerstörungen noch an vielen Orten zu sehen waren. Ein Jahr später wurde die Mauer gebaut.
Richard Heß ist Berliner und er verleugnet in seinem Werk nicht die Herkunft aus der von Johann Gottfried Schadow am Ende des 18. Jahrhunderts begründeten Bildhauertradition, die erst in neuerer Zeit versiegt. Die Verhältnisse haben ihn genötigt, seit 1965 in Westdeutschland zu wirken, und erst 1999 hat er als 62jähriger seinen Wohnsitz wieder in Berlin genommen. So sind die Spuren seines Wirkens hier gering im Verhältnis zu der beeindruckenden Zahl von Werken in öffentlichem und privatem Besitz außerhalb Berlins. Besonders in Italien ist er hoch angesehen, wie etwa 250 seiner Skulpturen in Sammlungen dieses Landes und eine rege Ausstellungstätigkeit seit 1988, so u. a. in Verona, Bolzano, Vicenza, Mantova, Cesena, Milano oder Padova belegen.
1962 bis 1963 war er Meisterschüler von Bernhard Heiliger, was man den frühen Porträtköpfen ansieht, aber bald schlug er eine ganz andere Richtung ein. Während der Lehrer sich immer weiter vom Menschenbild entfernte, suchte Heß es auszuloten, gerade auch in den Untiefen des Humanen, wie sie in der Zeit vor dem »Dritten Reich« etwa Heinrich Zille eher versöhnlich als anklagend in den Blick genommen hatte. Der ätzenden, den Hass schürenden Kunst des jüngeren George Grosz hat er sich fern gehalten. Seine enorme Produktivität entsprang einer im Grunde bejahenden Vitalität.
Nicht unwichtig ist in seiner auf Beobachtung fußenden Kunst der Humor, der in der Skulptur immer einen schweren Stand hat, weil alles Statuarische, das mit Mühe erstellt ist, auf Ernst und Dauer abzielt. Vor allem in der reiferen Phase seines Schaffens entdeckte Heß zum Beispiel das notwendig transitorische Essen für die Themenwelt der Skulptur, etwa in der »Spaghettiesserin« von 1993 (Abb. 474 ) oder der Bronzenen »Essende II« von 1990 (Abb. 406), der er eine benutzbare Gabel in die Hand gegeben hat. Bei der Figur »Sitzende mit durchsichtiger Bluse« aus dem gleichen Jahr (Abb. 417) ist diese so durchsichtig, dass sie überhaupt nicht mehr vorhanden ist.
Gesellschaftskritisches im Frühwerk entsprach einem seit den sechziger Jahren starken Trend auch der West-Berliner Kunst, die nicht unbeeinflusst von der Spaltung der Stadt und den Polarisierungen in fast allen Bereichen bleiben konnte. Beide Hälften neigten zur Erstarrung im Ideologischen, der Osten freilich weit mehr als der Westen. Der Zwanghaftigkeit, mit der das SEDRegime den Westen als Feind begriff und Unterordnung auch der Kunst unter sozialistische Gesellschaftsprojekte verlangte, setzte dieser den Wert der Freiheit entgegen und das Recht des Individuums, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten, wobei allerdings auch Unduldsamkeit im Verfechten von sogenannter abstrakter oder konkreter Kunst vor allem von »Kunstpäpsten« vorkam.
Heß wurde 1965 Assistent des Braunschweiger Bildhauers Jürgen Weber, der dort eine Professur an der Architekturfakultät der Technischen Universität innehatte, also Skulptur im Zusammenhang mit Städtebau begriff. Die barocke, kämpferische und zum Drastischen neigende Persönlichkeit sah sich in einer Tradition und griff bei kirchlichen Aufträgen auch biblische Themen auf. Verhasst war ihm alles Modernistische und Kopflastige. Auf seinem Braunschweiger Ringerbrunnen von 1974/5 vermerkte er die Namen führender Kunstkritiker auf der Hose des Besiegten. Weber sah sich als Sieger. Er hat den elf Jahre jüngeren Berliner zu ähnlich allgemeinverständlicher Erzählweise ermutigt, dieser hat Weber indessen nicht imitiert. Für den Unterschied der beiden Temperamente ist bezeichnend, dass auch Heß das Thema Ringkampf behandelt hat, allerdings erst 2004 und auf eine Weise, die nur dem Gebildeten verständlich ist. Auf dem Sockel eines Torsos mit dem Titel »Antaios« (Abb. 607) ist ein Ringkampf dieses Riesen mit Herkules dargestellt. Antaios war ein Sohn des Poseidon und der Gea, der Mutter Erde, und im Ringkampf blieb er stets Sieger, solange er mit der Erde in Berührung blieb. Herkules aber konnte ihn töten, als er ihn vom Boden hochhob. Man geht wohl nicht fehl, wenn der Bildhauer sich hier mit Antaios identifiziert hat, weil auch er seine Schaffenskraft aus der Erdverbundenheit bezieht.
Näher stand
Heß dem Gerhard Marcks-Schüler Waldemar Grzimek, der 1968 auf den Lehrstuhl für Plastisches Gestalten an der Technischen Hochschule in Darmstadt berufen worden war. Er holte sich Heß als Assistent. Heute noch spricht dieser mit größter Hochachtung von Grzimek als Künstler mit weitem Horizont, der über dem erbitterten Parteienstreit stand. Ein Porträt des Freundes hatte er bereits 1963 geschaffen. Grzimeks Einfluss auf Heß ist unübersehbar. 1971 erhielt dieser einen Lehrauftrag an der Hochschule, der er bis zu seinem Weggang nach Bielefeld 1980 verbunden blieb. Trotz der starken Kriegszerstörungen war Darmstadt eine höchst lebendige Stadt mit einer ungebrochenen Tradition der Kunstpflege in einem in Deutschland einzigartigen Ballungsgebiet von Städten sehr unterschiedlicher Prägung. Das ebenfalls schwer zerstörte Braunschweig war dagegen durch die nahe Grenze zur DDR zu einem Randgebiet herabgesunken. In Darmstadt konnte Heß Wurzeln schlagen und nirgends sind so viele Werke von ihm zu finden wie in dieser Stadt.
Das Städtische Museum besitzt zwölf Skulpturen, das Hessische Landesmuseum drei und auch in anderen Museen werden Werke von ihm bewahrt. Für eine Nische im als Rathaus genutzten Teil des Luisencenters am Luisenplatz hat er 1978 ein Relief geschaffen, ein in Bronze gegossenes Hauptwerk mit dem Titel »Proklamation« (Abb. 178). Neben Figurengruppen und architektonischen Einzelheiten, so einer aufwärts führenden Treppe und zwei Säulen, bei denen die Basen, nicht wie sonst die Kapitelle, verziert sind. Bei der einen ist eine Schrifttafel mit Worten des Grundgesetzes angebracht, die als Motto über dem gesamten Schaffen von Richard Heß stehen könnten: »Die Würde des Menschen ist unantastbar ….«, denn seine Absicht ist es, allem Menschlichen durch künstlerische Darstellung eine Würde zu geben, auch provozierend.
Besonders fruchtbar war die Zusammenarbeit mit dem Bauverein Darmstadt, der bestrebt war, seine Bauten durch Skulpturen zu beleben und auf diese Weise Orte in der Stadtlandschaft herauszuheben.
Auch von den Kirchen erhielt er Aufträge, so 1992 von der Katholischen St. Elisabeth-Kirche für eine Bronzetür der Sozialstation (Abb. 461) mit Szenen aus dem Leben des Heiligen Franziskus und den törichten und klugen Jungfrauen auf dem Türsturz. Die Betonung des Sozialen entsprach der Einstellung des Künstlers. Eng war dessen Verbindung zu der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg in Mainz-Bretzenheim, für die er zwischen 1976 und 1993 zwölf Skulpturen schuf, darunter sieben Kreuzwegstationen als Reliefs (Abb. 191, 210, 228, 229, 248, 249 und 250), einen Wasser-Brunnen (Abb. 151), eine Marien- und eine Auferstehungssäule (Abb. 414 und 247). Aus der näheren und weiteren Umgebung von Darmstadt kamen noch lange nach seiner Verlegung der Lehrtätigkeit nach Bielefeld bis in die Mitte der 1990er Jahre Aufträge und Ankäufe. Es waren dies auch Denkmäler und Brunnen. Die Liste der Städte ist lang, u. a. Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Nauheim, Bensheim, Friedberg, Frankfurt am Main, Gießen, Gernsheim, Hofheim, Idstein, Offenbach, Pfungstadt und Wiesbaden. In Baden-Württemberg war es neben Mannheim und Güglingen besonders die Stadt Heilbronn, die zwischen 1972 und 1983 sechs Skulpturen erwarb und den Bildhauer 1980 in einer großen Ausstellung würdigte.
Bei dem Rückgang der öffentlichen Aufträge wirkten sich nicht nur das fortschreitende Alter, sondern auch ein allgemein wachsendes Desinteresse an Kunst am Bau und im freien städtischen Raum aus. Ästhetische Kultur tritt vor wirtschaftlichen Erwägungen zurück. Ein Nachzügler war ein Brunnen mit den vier Evangelisten 2012 (Abb. 700) für den neuen Bischofssitz von Limburg an der Lahn. Das zwanzigjährige Wirken von Richard Heß als Professor in Bielefeld hatte bei weitem nicht die Resonanz außerhalb der Fachhochschule wie in Südwestdeutschland. Die Mentalität in den deutschen Landschaften ist sehr verschieden.
Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt Berlin 1999 hat Heß in ihr nur noch einmal einen monumentalen Auftrag von der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte für ihre Zentrale in der Dircksenstraße 9 erhalten: fünf das Dach bekrönende Bronzefiguren (Abb. 215, 532, 538, 540 und 543) als eine Erinnerung an den Schmuck barocker Bauten und an die Bevölkerungsstruktur der ehemaligen alten Spandauer Vorstadt. Man kann sie gut nur von der Stammstrecke der S-Bahn aus sehen. Davor schuf Richard Heß im Auftrag des damaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, eine Thorarolle, 1986 (Abb. 343). Sie steht vor dem Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße 79/80. Und ebenfalls fertigte Richard Heß 1986/1987 eine Gedenktafel für die Pfarrer der Bekennenden Kirche Berlin (Abb. 345). Sie ist an dem Haus in der Wilhelmstraße 36 angebracht.
Der Lehrer Richard Heß musste ein etwas anderer Mensch sein als der von oft kämpferischer, ungestümer Schaffenskraft erfüllte freie Künstler, und natürlich veränderte auch der gesellschaftliche Wandel sein Denken, ohne dass er sich ihm um des Erfolge willens angepasst hätte.
Im Unterschied zu Jürgen Weber und Waldemar Grzimek hat er sich nur selten schriftlich geäußert. In einem Katalog von 1997 findet sich ein lapidarer Text, der hier als Äußerung des Lehrers zitiert zu werden verdient. Die Überschrift »Skulptur ist Form!« überrascht, weil in der Frühzeit gedankliche Inhalte eine große Rolle gespielt haben. Ist es ein an seine Schüler gerichteter Zuruf? »Volumen und Raum sind die einzigen Mittel, mit denen sich der Bildhauer ausdrücken kann. Jeder Bildhauer muss zwischen Natur und Geometrie seinen nur für ihn gültigen Platz finden. Geht er zu nahe an die Natur, wird das Werk formlos, geht er zu nahe an die Geometrie, wird es starr. Der Platz zwischen den beiden Polen muss für jeden woanders liegen. Nicht zu vergessen ist der tektonische Aufbau der Skulptur, der ihr Halt und Überschaubarkeit gibt.« Ein individueller Stil innerhalb fester Grenzen wird gefordert. Hieraus spricht eine Warnung vor modischer Beliebigkeit, die zu Haltlosigkeit und Zerfall führt.
Das Erzähltalent des Bildhauers beschert im Werkverzeichnis eine Fülle von Inhalten, die bei einem sich nur allmählich wandelnden Stil Einblicke in seine Phantasie und Themenwelt bieten. Biblisches und Mythologisches, für andere Künstler etwas Abgestandenes, werden in die Erinnerung gerufen und ganz neu dargestellt. Das Spektrum der Alltagsszenen ist nur schwer zu ermessen, weil der Künstler besonders im munteren Frühwerk bestrebt war, bisher nie als Skulptur Dargestelltes zu behandeln, was oft auf eine frappierende Weise geschah.
Es fällt auf, dass es bei ihm keine auf Repräsentation bedachten Selbstbildnisse gibt, obgleich das Porträt, mit wenigen Ausnahmen als Kopf, bei ihm nicht selten ist. Nur eine kleine selbstironische Sitzfigur »Selbst mit Bein im Gips« (Abb. 617) hat er 2004 aus konkretem Anlass geschaffen. Hinzu kommen vier Arbeiten mit dem Titel »Bildhauer« (Abb. 140, 440, 532 und 629), bei denen er sich selbst meint, ohne dass eine Porträtähnlichkeit zu erkennen ist. Bei einer lebensgroßen Figur (Abb. 532) hält der Bildhauer eine Statuette einer Frau in der Hand und lässt so an Prometheus als den Urkünstler denken, der Menschen aus Ton formt und durch himmlisches Feuer beseelt. Ein Relief »Bildhauer bei der Arbeit« von 1992 (Abb. 440) ist eine Aussage über die Grundregel beim Aufbau einer Skulptur und zugleich ein Memento mori. Auf einem Sockel steht ein kleines, stark vereinfachtes Skelett. Wie es beim Menschen von Fleisch umhüllt ist, bildet es für die Tonfigur das Halt gebende Gerüst.
Die Reihe der etwa 40 Porträts endet 1991 mit einem Bildnis der nach dem Leben modellierten Prinzessin Margaret von Hessen und bei Rhein (Abb. 431), einer bodenständigen und sozial engagierten Persönlichkeit. Das war wohl die Brücke, die von ihr zu dem der Aristokratie eher fernstehenden Künstler. Seine Frau Ilka hat er viermal porträtiert, zuerst 1961 als lebensgroßen Kopf in Terrakotta (Abb. 003). Ilka Heß ist für ihren Mann eine unentbehrliche Wesensergänzung. Ohne sie wäre auch dieses Werkverzeichnis nicht entstanden. Den Sohn Jürgen lernen wir als kleinen kauernden Knaben von 1971 kennen (Abb. 084). Sonst spielen Kinder kaum eine Rolle. Das Motiv Mutter mit Kind, als Maria mit dem Christuskind ein zentrales Thema der abendländischen Skulptur, kommt bei Heß mehrfach vor, seit 2004 auch deutlich als Madonna mit Kind oder als Heilige Familie, aber es gelangt innerhalb der Fülle von Frauendarstellungen nur vereinzelt zu einer ausgeprägten Aussage.
Für die männliche Vitalität des Bildhauers ist der kraftvoll entwickelte Frauenkörper die wichtigste Inspirationsquelle und der Inbegriff des Lebendigen und Leben spendenden, steckt doch im Begriff »Genie« das lateinische Wort »genus«, das Geschlecht, Abkunft, Familie und Nachkommenschaft, ja Volk bedeutet. Sehen ist oft ein voyeuristisches Hinschauen. Weiblichkeit kommt nicht selten als Straßenmädchen daher. Richard Heß selber äußert sich: »Das gleiche Mädchen – verschiedene Sichten, Liebe aus unterschiedlichen Gründen. Das ist der Sinn, eine Plastik zu machen. Mein persönliches Bild von Welt. Das Interesse am Anderssehen der Menschen.«
In der Reihe der männlichen Einzelfiguren, die erst 1970 beginnt, ist es unmittelbar nachzuvollziehen, dass die Darstellungen des Alters, zuerst in dem Torso »Alter Mann mit verletztem Arm« von 1990 (Abb. 405), des Künstlers eigene Erfahrung mit dem Altern widerspiegelt. Es fällt auf, dass der Jünglingsakt, seit der Antike ein bevorzugtes Motiv der Skulptur, bei Heß kaum vorkommt. Sein von Grzimek beeinflusster »Adam« von 1973 (Abb. 104) ist kein Ephebe mehr.
Die Darstellung von Gewalt – sei es bei den Tätern oder bei den Opfern –, in der das Elend des Weltkrieges und das des Dritten Reiches nachwirkt oder gegenwärtiges Geschehen angeklagt wird, bestimmt im Schaffen von Heß nicht unwesentlich das Bild des Mannes. Zu einer Harmonie der Geschlechter kommt es hauptsächlich bei den vielen Bildern von Liebespaaren, zumeist im Relief. Die Kriegserfahrung wird vor allem in dem »Fragment eines Reiterdenkmals – Das Ende des Krieges« von 1990 (Abb. 408) für das Kreiswehrersatzamt in Oldenburg als Mahnmal reflektiert. Reiterstandbilder mit Siegern sollten einst an militärische Triumphe erinnern und die Unterlegenen demütigen. Daraus entstanden neue Kriege. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, war eine Lehre des Zweiten Weltkrieges. Heß fordert mit seiner Skulptur eine Ächtung des Krieges.
Schwer zu verstehen ist die große in Frankfurt am Main 1982 aufgestellte Skulptur »David und Goliath« (Abb. 232). Hier wird die alttestamentarische Geschichte vom Sieg des Hirtenknaben David über den Riesen Goliath anders als in der Bildtradition erzählt, wo David, nachdem er Goliath mit seiner Steinschleuder getötet hat, diesem den Kopf abschlägt, ihn auf das Schwert des Riesen aufspießt und so triumphierend heimkehrt. Bei Heß sitzt der siegreiche junge Mann nackt auf dem Kopf und den Trümmern der Rüstung seines Gegners. Er trägt einen Helm, der den Zeitgenossen, denen Bilder von Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten vor Augen standen, an solche Szenen erinnern mussten. Das Frankfurter Bildwerk steht nicht isoliert im Oeuvre des Bildhauers. Wie David zu verstehen ist, hatte Heß 1973 in der Skulptur »Sieger und Opfer« (Abb. 113) unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Das Opfer liegt zusammengeschlagen und gekrümmt am Boden. Der Sieger mit Helm ist ein Schläger. Das Werk gelangte früh in die Kunsthalle Rostock und sollte dort sicher nicht an die Mauertoten erinnern
Überzeugt von der sozialen Verpflichtung des Künstlers sind viele Wortmeldungen des Bildhauers zum politischen Geschehen durch ein Mitfühlen mit den Unterdrückten und Gequälten, mit den Gefesselten und den Märtyrern nicht nur im eigenen Land, sondern auf der ganzen Welt motiviert. So modellierte er 1974 einen »Chilenischen Minenarbeiter« (Abb. 118) oder 1992 mit dem Titel »Somalia« (Abb. 459) zwei Verhungernde.
Von diesen Appellen aus erschließen sich die Darstellungen der Passion Christi etwa in den Kreuzwegstationen für St. Georg in Mainz-Bretzenheim. Wie die christliche Bildwelt mit ihren tief reichenden historischen Wurzeln sich mit dem Zeitgenössischen verzahnt, wird zum Beispiel in dem Relief der Kreuzwegstation »Jesus wird seiner Kleider beraubt« (Abb. 228) von 1981 deutlich. Es konnte zu einer Darstellung der »Habgier« von 2004 (Abb. 258) modifiziert werden. Kühner noch ist die Transformation des Motivs der Umarmung in dem Relief »Jesus begegnet seiner Mutter« von 1982 (Abb. 249) in der Darstellung eines Liebespaares mit dem Titel »Paravent« von 1984 (Abb. 256).
Wenn Richard Heß sagt: »Volumen und Raum sind die einzigen Mittel, mit denen sich der Bildhauer ausdrücken kann«, so leitet sich daraus auch die Bedeutung des Reliefs als eines besonderen Bereiches der Skulptur für ihn ab. Denn im Relief hat er die Möglichkeit, den Raum im Bild darzustellen und ihn nicht nur, wie bei der raumgreifenden plastischen Figur nur zu beeinflussen. So bewegt er sich gern in einem Grenzbereich zwischen Skulptur und Malerei und nimmt dabei auch die Farbe, ja sogar die Schrift als Ausdrucksmittel in Anspruch.
Das erste, leider zerstörte Relief mit den bedeutenden Maßen 145 × 130 cm »Paar (sitzender Mann, liegende Frau)« entstand schon 1965 (Abb. 023) und deutet mit einem schweren Vorhang an, dass der umgebende Raum ein Interieur ist. Reliefs sind wichtig, weil sich hier selbstverständlicher als in der Freiplastik Beziehungen zwischen zwei und mehr Menschen und diese wiederum in einer bestimmten Umgebung darstellen lassen. Für die Begegnung der Geschlechter, das eigentliche Zentralthema von Heß, kommt dem Relief daher eine wichtige Funktion zu. Namentlich in den Jahren von 1968 an, also in Braunschweig unter dem Einfluss von Jürgen Weber, suchte er durch immer neue Einfälle auszuprobieren, was im Relief möglich ist, inhaltlich erzählen – oft tabuverletzend –und formal gestaltend. Das entsprach der politisch sehr bewegten Zeit. Interieurs konnten zu Orten des Verbrechens, aber auch zu intimen Räumen, manchmal mit sanitären Anlagen, werden. 1974 gestaltete er die Eingangssituation des Hauses Schöck (Abb. 122) in Darmstadt, wo neben der Haustür als Willkommensgruß ein Relief mit einer nackten Frau erscheint, die einen Vorhang beiseite zieht. Gern erweiterte Heß in diesen Jahren den Raum durch Abbildungen im Spiegel, so etwa in dem Relief »Paare« von 1975 (Abb. 135). Aus einem geöffneten Fensterflügel schaut ein widerwärtiger Männerkopf neugierig auf die Straße, während sich hinter ihm im Zimmer eine Frau entkleidet. In der Fensterscheibe spiegelt sich, was der Mann auf der Straße beobachtet: Ein behelmter Polizist packt sein Opfer bei den Haaren.
Die Gewaltszenen verschwinden allmählich in den achtziger Jahren. Im Auftrag der Hessischen Lotterie Treuhandgesellschaft entstanden 1982/1983 zwei Reliefs mit dem Titel »Das Tor zum Glück« (Abb. 253 und 254). Das Glück ist eine gepflegte Häuslichkeit, dargeboten in einer vergleichsweise strengen Sprache. In knapperer Ausprägung trifft man auf diese Sprache, angemessen dem Ort des Chemischen Instituts der Universität Frankfurt, in einer Wandgestaltung, wo man sieht, wie drei Studenten durch eine Tür einen Hörsaal betreten. Hier sitzen in drei gekrümmten Bankreihen andere Studenten, und tiefer im Raum beugt sich ein Dozent über sein Katheder (Abb. 308). Bei Aufträgen hat Heß eine besondere Fähigkeit entwickelt, Idee und Stil der Ausführung dem bestimmten Ort anzupassen, ohne dabei seine Eigenart zu verleugnen. In manchen Werken überrascht eine kühle Abstraktion, so etwa in der »Frau im Wasser II« von 1986 (Abb. 327). Alltagsleben werden gestaltet wie »Hochzeit« (Abb. 350) und als Gegenstück »Trauerzug« (Abb. 361) 1987. In dem flachen Bronzerelief »Heiliger Franziskus und die drei Frauen« von 1992 (Abb. 446) steht links der Mönch mit lehrender Geste und einem für Heß typischen Blick aus kleinen Loch-Augen, vor ihm Frauen, in denen die weiblichen Formen denkbar sparsam angedeutet sind, in langen Gewändern. Der Bildhauer ist nun 55 Jahre alt.
Dieser strenge Stil entwickelt sich weiter. Einen Gemeinschaftsraum im Wohnpark DarmstadtKranichstein schmückt ein Fries »Lebensalter II«, 1995 (Abb. 494) in ruhiger Tektonik. Ein solcher Rück- und Überblick wäre im Frühwerk kaum denkbar. Mit dem Titel »Die Stadt« entstanden 20092010 fünf Reliefs (Abb. 664, 676, 677, 678 und 679) mit einer fast schmerzhaft starken Spannung zwischen warm empfundenen menschlichen Figuren in Terrakotta vor Platten aus Edelstahl mit eingeschnittenen Architekturformen von äußerster Strenge und Kälte. In dem Titel wird das Grundmotiv der Bildhauerexistenz von Richard Heß angedeutet: Der Mensch trägt Verantwortung für seinen Lebensraum. Zwei stilistisch zugehörige Reliefs »Stürzende I« von 2008 (Abb. 658) und »Explosion« von 2010 (Abb. 680) sind Katastrophenahnungen. Hier deutet ein Vorhang links an, dass wir aus einem Fenster sehen, wie eine Frau sich aus einem höheren Fenster kopfüber in die Tiefe stürzt. Dort beherrscht die Mitte der Fläche eine weiße Wolke, die zwischen zwei Hauswänden hervorschießt. Ein Mann flieht entsetzt und in einem Fenster über ihm erscheint eine Frau. Ein Gebilde, das auf den ersten Blick wie ein archäologisches Fundstück, ein Topf, aussieht, gibt sich dann als hohler Schädel zu erkennen mit zwei Augenlöchern und der Zahnreihe des Oberkiefers.
Der Titel ist »Studie zu Salome« (Abb. 687) Der Kopf ist also der Johannes des Täufers. »Archäologie« (Abb. 674) ist eine kleine Gipsskulptur von 2010 betitelt: Ein Schädel, neben dem ein amorpher Klumpen Erde liegt.
Der Trauer und Sorge, die aus diesen aphoristischen späten Werken spricht, liegt nicht nur ein persönliches Befinden zugrunde. Sie resultieren auch aus einem Blick auf den Zeitgeist. In einem kurzen Text aus dem Jahr 2005 schreibt Richard Heß: »Die Bildhauerei war in Deutschland nie so gefährdet wie heute, da das Menschenbild immer mehr verloren geht. In unserem technischen Zeitalter haben viele Künstler Zuflucht zu missverstandenen Einflüssen primitiver Kulturen und banalen Kopien von Maschinenteilen genommen. Es ist eine Zeit der Verwirrung, in der das Hässliche für schön und das Abstruse allein als wertvoll gelten.«
Dem ist schwer zu widersprechen. Aber die Reaktion darauf muss sein, zu bewahren, was wert ist, bewahrt zu werden. Und dazu gehört auch das hier dokumentierte Lebenswerk. Wenn es auch zur Zeit scheint, dass die Kunst sich selber marginalisiert – trotz großen Spektakels in der Finanzwelt – und sie wie eine abgekuppelte Lokomotive keine Wagen mehr zieht, davonfährt und in einem Leerlauf Selbstzweck wird – so bleibt doch Menschlichkeit erhalten und wächst nach. Und die Notwendigkeit, sie nicht nur zu bewahren, sondern weiter zu befördern, wird immer dringender. Daraus kann ein neues Menschenbild wie ein Pflanzenkeim nach einem Winter wieder erwachsen.
001
Kopf »Dieter«, 1960


Gips lebensgroß
Besitzer: Privatbesitz Berlin
002
Kopf »Frau H. I« (Mutter des Künstlers), 1960
Bronze, 1 (Unikat)
28 × 17 × 25 cm
Gießerei: H. Noack
Besitzer: Künstler
003
Kopf »Ilka I«, 1961
Terrakotta lebensgroß
Besitzer: Privatbesitz Bielefeld
004
Kleine Fußwaschende, 1962
Bronze, 5/5 17 × 17 × 11 cm


Gießerei: W. Füssel
Besitzer: alle in Privatbesitz Deutschland
005
Kleine Schreitende I, 1962
Bronze, 2/2

o. Ma.
Gießerei: W. Füssel
Besitzer:
• Städtische Sammlung Berlin
• Privatbesitz Lampertheim
006
Kopf »Frau von Ohlen«, 1962

Terrakotta
lebensgroß
Besitzer: Künstler
007
Kopf »R. Ullrich«, 1962

Beton, 1 (Unikat) lebensgroß
Besitzer: Künstler
008
Kopf »Santos«, 1962 Gips lebensgroß
Besitzer: Künstler

010
Kopf »Ilka II«, 1963
Gips, Zement lebensgroß
Besitzer: Künstler
011
Kopf »Paul Esser«, 1963


Gips, Zement, 2/2 überlebensgroß
Besitzer:
• Privatbesitz Berlin
• Hansa-Theater Berlin
012
Kopf »Prof. Waldemar Grzimek«, 1963

Gips
H: 29 cm
Besitzer: Künstler
013
Sitzende I, 1963

Gips o. Ma.
Besitzer: Künstler
Bemerkung: zerstört
709
Herrschaft, 2014
Mischtechnik getönt
35 × 51 × 41 cm
Besitzer: Künstler
710
Im Wind IV, 2014
Terrakotta 43 × 13 × 12 cm

Besitzer: Künstler

711
Kleine Eule II (3/4-Relief), 2014

Terrakotta, geplant: 5 Güsse 19 × 13 × 2,5 cm

Besitzer: Privatbesitz Berlin
713
Seherin, 2014
Terrakotta, geplant: 5 Güsse 43 × 11 × 9 cm
Besitzer: Künstler
714 [Erratum: doppelter Eintrag=WVZ 668]
Hemdanziehende, 2009
Terrakotta bemalt
83 × 26 × 24 cm

Besitzer: Künstler
715
Stehende IV, 2014

Terrakotta
48 × 17 × 8 cm
Besitzer: Künstler
716
Stillleben III (Relief), 2014
Mischtechnik bemalt 39 × 48 cm
Besitzer: Künstler
717
Stillleben IV (Relief), 2014




Terrakotta, Holz 49,5 × 51 × 25 cm
Besitzer: Künstler
718
Tänzerische Figur II (Relief), 2014


Mischtechnik getönt 120 × 40 × 30 cm
Besitzer: Künstler
719
Wartende III, 2014
Terrakotta bemalt 77 × 32 × 26 cm
Besitzer: Künstler
720
Kauernde II, 2015
Bronze, 1/5
22 × 18,5 × 17 cm
Besitzer: Privatbesitz Italien
721
Ölbaum, 2015
Terrakotta
44,5 × 39,5 × 46,5 cm

Besitzer: Künstler

722
Stillleben V (Relief), 2015



Terrakotta, Holz bemalt 45 × 50 × 28,5 cm
Besitzer: Künstler
723
Totem, 2015
Terrakotta, Holz bemalt 39 × 15,5 × 6 cm, Plinthe: 29,5 × 35 cm
Besitzer: Künstler
724
Widder III, 2015
Terrakotta
18 × 21 × 6 cm
Besitzer: Privatbesitz Berlin

1937 geboreninBerlin
1952-1955 HolzbildhauerlehreinBerlin
1957-1962 BildhauerstudiumanderHochschulefürBildendeKünste(HfBK)Berlin
1958 KunstpreisfürGrafikdesMaisondeFrance,Berlin
1962-1963 MeisterschüleranderHfBKBerlin(beiProfessorB.Heiliger)
1963-1965 freischaffendinBerlin
1965-1968 AssistentanderTechnischenUniversitätBraunschweig(Architekturfakultätbei ProfessorJ.Weber)
1968-1971 AssistentanderTechnischenHochschuleDarmstadt(Architekturfakultätbei ProfessorW.Grzimek)
1971 LehrauftraganderTHDarmstadt
MitgliedderNeuenDarmstädterSezession
1972-1980 DozentanderTHDarmstadt
1974-1976 MitgliedimVorstandderNeuenDarmstädterSezession
1980-2001 ProfessuranderFachhochschuleBielefeld
1980 DarmstädterKunstpreis
1991 Gastdozent–SchwäbischerKunstsommer–UniversitätAugsburg/ SchwabenakademieIrrsee
1995 TeilnahmeanderBiennaleVenedig(conilpatrociniodellaBiennalediVeneziaXLVI, EsposizioneInternazionaled'Arte),AußenstelleVicenza
1997 Preisder1.SkulpturenbiennaleBadHomburgv.d.Höhe
1999 UmzugnachBerlin
2005 KorrespondierendesMitgliedderAccademiaNazionalediSanLuca,Roma
2017 gestorbeninBerlin
ZahlreicheEinzelausstellungenundAusstellungsbeteiligungensowieWerkeimöffentlichenBesitzim In-undAusland.
Einzelausstellungen
1966 GalerieVereinBerlinerKünstlere.V.,Berlin
1969 ebenda
1970 NassauischerKunstverein,Wiesbaden
1971 NeueMünchnerGalerie,München
1973 StadthalleGernsbach
1974 GalerieGombert&Meyer,Berlin
KunsthalleDarmstadt,»DiemenschlicheGestalt«–FünfBildhauer
KatholischesGemeindehausSt.Georg,Mainz-Bretzenheim
1975 KunstamtMainz,StädtischeGalerie
GalerieVereinBerlinerKünstlere.V.,Berlin
1976 Galerie»K«,Darmstadt
1977 KunstvereinHameln
1978 NassauischerKunstverein,Wiesbaden
1979 GalerieRehberg,Mainz
1980 KölnerKunstmarkt(vertretendurchdieGalerieHartmann,München)
StädtischeMuseen,Heilbronn
1982 Mathildenhöhe,Darmstadt
1983 DominikanerKloster,FrankfurtamMain
Galerie»InderRemise«,SchlossFeldkirch,Hartheim2/Baden
1984
GalerieJesse,amSchwarzenHaus,Bielefeld
GalerieinderWendelinskapelle,MarbachamNeckar
VereinzurKunstförderung,Darmstadt
1985 BildhauergaleriePlinthe,Berlin
Galerie»InderRemise«,SchlossFeldkirch,Hartheim2/Baden
Wallgalerie,Braunschweig
Galerie5,HausGeiselhart,Reutlingen
Freiluftgalerie,Reutlingen
GalerieimKörnerpark,KunstamtBerlin-Neukölln
1986
GalerieSTUDIOR,RuthRödel-Neubert,Mannheim
1986/1987 BildhauergalerieMesser-Ladwig,Berlin
1987 Saalbau-Galerie,ClausK.Netuschil,Darmstadt
Galeriecontact,KulturamtBöblingen
Freiluftgalerie,Böblingen
KunstkreisHamm
BildhauergaleriePlinthe,Berlin
VillaClementine,KunstamtWiesbaden
1988 CentroculturaleSanGiorgetto,ComunediVerona,Verona SchlossLichtenberg,Sommergalerie
1989 PräsidialamtderUniversitätdesSaarlandes,Saarbrücken
1990 Galleriad'Arte,»PIAZZAERBE«diGiorgioGhelfi,Verona
Galleriad'Arte,GiorgioGhelfi,MontecatiniTerme
LandratsamtWetteraukreis,Friedberg
Saalbau-Galerie,ClausK.Netuschil,Darmstadt
1991 RassegnaInternazionalediScultura,CittàdiAbanoTerme
1991/1992 CasadiGiulietta,Verona
1992 Museod'ArteModerna,Bolzano
GalerieSTUDIOR,RuthRödel-Neubert,Mannheim
VereinzurKunstförderung,Darmstadt
NassauischerKunstverein,Wiesbaden
1993 GalerieV7,Lampertheim
Galleriad'Arte,»PIAZZAERBE«diGiorgioGhelfi,Verona
GalerieMichaelBlaszczyk,BadHomburgv.d.Höhe
1994 KatholischesGemeindehausSt.Georg,Mainz-Bretzenheim
Museod'ArteModerna,Bolzano
OberhessischesMuseum,Gießen
1995 ConilpatrociniodellaBiennalediVeneziaXLVI
CentenariodellaBiennalediVenezia
EsposizioneInternazionaled'Arte1995,AußenstelleVicenza: TeatroOlimpico,MuseoCivico,PalazzoTrissino
GalerieMichaelSteiner,SchlossBabstadt,BadRappenau
GalerieMichaelBlaszczyk,BadHomburgv.d.Höhe
1996 CasadelMantegna,Mantova
Kunst-undAuktionshausPoorhosaini,Seeheim-Jugenheim
Bildhauergalerie,Berlin
GaleriederStadtTuttlingen
1997 Galeriemesse,KunsthalleMannheim(vertretendurchdieGalerieRödel,Mannheim)
GalerieMichaelBlaszczyk,BadHomburgv.d.Höhe
Cesena:RoccaMalatestiana,GalleriaComunaleExPescheria, ChiostrodiSanFrancesco,CentroStorico,IlVicolo–InteriorDesign
EnglischeKirche,BadHomburgv.d.Höhe
GalerieNetuschil,Darmstadt(mitdemMalerWolfgangLeber)
1998 FieradelLevante,Bari(vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona)
Galleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona
1999 GalerieARTIS,Darmstadt
KunstmesseMailand(vertretendurchdieGalleriaGabrieleCappelletti,Mailand)
KunstforumSeligenstadt–10.FreiluftausstellungimPrälaturgartenderehemaligen Benediktiner-AbteiinSeligenstadt
1999/2000 GalleriaGabrieleCappelletti,Mailand
2000 ArtMiami2000,InternationalArtExposition,MiamiBeachConventionCenter (vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona)
GaleriemesseMilano(vertretendurchdieGalleriaGabrieleCappelletti,Milano)
J.Gallery,HongKong
TermeTamerici,MontecatiniTerme
GalleriaTaras,Toronto
2001 Galleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona
ArteFieraBologna(vertretendurchdieGalleriaGabrieleCappelletti,Milano)
Galleriad'ArteBorromeo,Padova
ExpoArteBari(vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Verona)
RoccaSforcesca,Imola
GalerieCarolaWeber,Wiesbaden
ExpoArteTreviso(vertretendurchdieGalleriad'Arte,GiorgioGhelfi,Montecatini Terme)
2002 GalerieamWasserturm,Berlin
2002/2003 GalerieARTIS,Darmstadt(mitdemMalerJ.Grützke)
2003 VIVANTES, Klinikum Spandau, Berlin
2005 Galerie ARTIS, Darmstadt
Polnisches Nationalmuseum, Poznan, Republik Polen (Muzeum Narodowego w Poznaniu)
Bildhauer-Sommerakademie, Kunstparkhaus, Strausberg
Galerie der Moderne, Potsdam (mit dem Maler W. Wellenstein)
2006 Palazzo Fantini, Comune di Tredozio
Galerie der Moderne, Berlin
2007 Kommunale Galerie Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
Schlosskirche, Neustrelitz
DASA-Galerie, Dortmund
Baker & McKenzie, Frankfurt am Main
2007/2008 Fasanengalerie, Berlin
2008 Galerie am Gendarmenmarkt, Berlin
Galleria d'Arte, Giorgio Ghelfi, Verona
Rössle Galerie, Berlin-Buch (mit dem Maler Charles Crodel)
2009/2010 Il Vicolo, Cesena, Lungo Via Carbonari (mit den Bildhauern L. Minguzzi und A. Bimbi)
Galerie der Moderne, Berlin (mit dem Maler S. Butturini)
2010/2011 Galerie kunstprojektberlin, Berlin (mit den Malern H. van Riesen und Gertraud Christ)
2011 Galerie Michael Nolte, Münster
Galleria d'Arte, Giorgio Ghelfi, Verona
2011/2012 Il Vicolo – Arte Contemporanea, Cesena
2012 Gutshaus Steglitz (Wrangelschlösschen), Berlin
Kunsthandel Dr. Wilfried Karger (stilwerk), Berlin
2016 Polnisches Nationalmuseum (Schlossmuseum), Stettin
Galerie der Moderne, Berlin
2017 Kunsthandel Dr. Wilfried Karger (stilwerk), Berlin
Kommunale Galerie Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
Werke im öffentlichen Raum
Alsfeld
SchlossRomrod/SammlungHeinzSchöffler
PaarvormSpiegel(Relief),1975
Bad Homburg v. d. Höhe
Kurpark
MuseumimGotischenHaus
BadHomburgerBrunnenmädchen,1994
BadHomburgerBrunnenmädchenI(Modell),1993
OmaggioàMantegna(Ausstellungsmodell),1996
Bad Nauheim
Kurpark/Europaplatz
Bega (Dörentrup 2)
Gemeindekirchhof
BaumderErkenntnis(Wasserbrunnen),1980
Grabgestaltung»AnniWegner«(Relief),1996 (VariationderKreuzwegstation»DasSchweißtuchder HeiligenVeronika«,1982)
Bensheim
DeutschePostAG/ Postamt,SchwantalerStraße LaBella,1982
Berlin
AlterLuisenstadt-Friedhof
BerlinerKunstverein(Artothek)
Kopf»FrauH.II«(MutterdesKünstlers),1967
KleineStehendeI,1984
BerlinischeGalerie Mannequin,1978
Hansa-Theater
Kopf»PaulEsser«,1963
JüdischeGemeindezuBerlin,Fasanenstraße ThoraI(Wettbewerbs-Modell),1985
ThoraII,1986
KunstamtBerlin-Kreuzberg,Wilhelmstraße36 GedenktafelfürdiePfarrerderBekennendenKirche (Relief),1987
KunstamtBerlin-Kreuzberg
NeuerHackescherMarkt,Dircksenstraße9
FraumitKind(Relief),1983
Wächter,1980
GroßeDameimAbendkleid,1988
BildhauerI,1998
SenatorfürBauen,WohnenundVerkehr
StädtischeSammlung
StiftungPreußischerKulturbesitz/ Philharmonie
StiftungStadtmuseumBerlin
VereinBerlinerKaufleuteundIndustrieller/ Ludwig-Erhard-Haus
KaryatideIII,1998
Theater,1998
Philosophie,1999
SchreienderI,1975
KleineSchreitendeI,1962
Kopf»HansvonBülow«,1968
Frierende,1988
Kopf»Dr.Dichter«,1968
Bielefeld
Sennestadtring
Blomberg
PhoenixContact
GroßerMinotaurosI,1984
GroßerPhoenixI,1967
KleinerPhoenixI,1967
Kopf»DirektorEisert«,1967
Frühschicht(Relief),1968
VeduteBlomberg(Relief),1973
Böblingen
StädtischeSammlung/VorderZehntscheuer GroßeSchreitende,1981
Bonn
DeutscheStiftungDenkmalschutz
PaarvormSpiegel(Relief),1975
Kopf»ImProfil«(Relief),1982
KleinerMinotaurosII,1996
HotelKönigshof
Bolzano
Museod'ArteModerna
HotelLaurin,Camera215
FigurenimRaum,1982/1984
FrauimWasserI,1984
Bildhauer(Radierung)
Bremen
Gerhard-Marcks-Haus
GeschundenerII,1982
GefesselteI,1976
HommageàAvramidisI,1981
PèreJoseph,1984
Cesena
ComunediCesena
ComunediCesena/PalazzoCapitano
Coburg/Rödental
KunstsammlungenderVesteCoburg
ToscanaI(Relief),2005
FraumitKindI,1984
FrauimWasserII,1986
Darmstadt
Bauverein Mannequin,1978
WartendeI(3/4Relief–Detailaus»Proklamation«), 1979
GeschundenerI(DetailausFrauenlob-Brunnen), 1980/81
GroßeSchreitende,1981
FraumitKindI,1984
KleineDameimAbendkleidI,1988
GroßesPaarI(Detail),1990
EberstädterSzenen(Reliefwand),1992
ImWindII,2000
Ev.KircheinHessenundNassau
HEAGHessischeElektrizitäts-AG
HessischeBrandversicherungskammer
HessischesLandesmuseum
Martin-NiemöllerMedaille(Edition),1997
FensterguckerII,1976
Solidarität(Wasserbrunnen),1977
Knabenakt,sitzend,1976(Zeichnung)
Opfer,1976(Zeichnung)
ProklamationII(Entwurf),1978
JüdischesMuseum
ThoraI(Wettbewerbs-Modell),1985
KatholischePfarrgemeindeSt.Elisabeth
Landgericht
PosttechnischesZentralamt
StädtischeKunstsammlung
Türgestaltung(Hl.Franziskus)fürdieSozialstationSt. Elisabeth,Darmstadt,1992
Justitia(Wettbewerbs-Modellfür LandesgerichtsgebäudeinDarmstadt),2004
LiegendemitWeintrauben,1987
KleineEvaI,1967
SchrägerTorso,1968
Straßenarbeiter,1972
Adam,1973
FrauvormSpiegelI(Relief),1974
Tina,1976
ProklamationI(Entwurf),1978
SchöneVeroneserinI,1978
ProklamationIII(3/4Relief),1978/1979
GroßeDameimAbendkleid,1988
Johann-Heinrich-MerckMedaille,1988
Kopf»LudwigPrinzvonHessenundbeiRhein«,1988
Kopf»MargaretPrinzessinvonHessenundbei Rhein«,1991
Schlossmuseum
SüdhessischeGas-undWasserAG
TechnischeUniversitätDarmstadt
TelekomTechnologiezentrum(FTZ)
Kopf»LudwigPrinzvonHessenundbeiRhein«,1988 (2.Guss)
Kopf»MargaretPrinzessinvonHessenundbei Rhein«,1991(2.Guss)
GasundWasser(Großplastik),1989/1990
DemEhrensenator(Medaille,Edition),1970
MenscheninBeziehung(Figurengruppe),1989
Vivarium Kopf»Dr.Ackermann«,1989
WohnparkDarmstadt-Kranichstein
LebensalterII(Relief),1995
Frankfurt am Main
Johann-Wolfgang-GoetheUniversität
StädtischeSammlungFrankfurtamMain
U-BahnStationBockenheimerWarte
Universität(Reliefwand),1984
DavidundGoliathIII,1981(Modell)
DavidundGoliathIV(Großplastik),1981/1982
Säulenabschluss»Bronzekissen/Kapitell«,1985
Forlì
OratorioSanSebastiano/PinacotecadiForlì Trauerzug(Relief),1987
PinacotecadiForlì (FondazioneCassaRuraleedArtigianadiForlì) Heidelberg(Relief),1978
Friedberg (Hessen)
WetteraukreisFriedberg
ImCaféII,1988
EuropabrunnenII,1988/1989
Arbeitsszenen(3Reliefs),1989
Europatafel(Bodenrelief),1990
Gernsheim
DeutschePost FrauWelt,1980
Gießen
ElektrotechnischesInformations-Institut derFHGießen
OberhessischesMuseum
DerMathematiker,1982
Mannequin,1978
MädchenmitOhrring(Büste),1988
FragmenteinesReiterdenkmalsIII(Modell),1990
Güglingen
StädtischeSammlungen/ Standort:HotelHerzogskelter
Wächter,1980
Heilbronn
StädtischeMuseen
SolidaritätI,1971
Adam,1973
Berlin,Straßedes17.Juni,1975(Zeichnung)
HeiligerSebastianI,1977
ProklamationI,1978
DavidundGoliathI,1979
Johannes,1983
Hofheim (Main-Taunus-Kreis)
Kreishaus DerBürgeralsSouveränII,1987
Idstein (Taunus)
Pestalozzischule GroßerPhoenixII,1991
Kassel
ReinhardswaldschuleFuldatale.V. FrauvormSpiegelI(Relief),1974
Köln
Baukunst-Galerie SatyrundNympheII(Relief),1970
DeutscheEisenbahnversicherung Raumteiler-Promenade,1984/85
Leipzig
HochschulefürTechnik,WirtschaftundKultur Mensch,Natur,TechnikIII,2002 Mensch,Natur,TechnikIV,2002
Limburg an der Lahn
BistumLimburg/KreuzgangimNeubauHaus derBischöfe DievierEvangelisten(Wasserbrunnen),2012
Mainz
KatholischePfarrgemeindeSt.Georg, Mainz-Bretzenheim VertreibungausdemParadiesII(Wasserbrunnen), 1976/1977
Taufbecken(BrennenderDornbusch),1978
Kreuzwegstation»Geißelung«(Relief) ,1979
Kreuzwegstation»Pietà«(Relief),1980
Kreuzwegstation»JesuswirdseinerKleiderberaubt« (Relief),1981
Kreuzwegstation»Kreuzigung«(3/4-Relief),1981
Auferstehungssäule(Vollplastik),1982
Kreuzwegstation»DasSchweißtuchderHeiligen Veronika«(Relief),1982
Kreuzwegstation»JesusbegegnetseinerMutter« (Relief),1982
Rheinuferpromenade
Kreuzwegstation »Verurteilung« (Relief), 1982
Mariensäule, 1990
Mann mit Besen, 1993
Frauenlob-Barke (Wasserbrunnen), 1980/1981
Mannheim
Kunsthalle Geschundener II, 1982
Offenbach am Main
Städtische Kliniken, Eingangsbereich Frau mit Kind I, 1984
Oldenburg
Bundeswehrverwaltungszentrum/ Kreiswehrersatzamt Oldenburg Fragment eines Reiterdenkmals II – Das Ende des Krieges, 1990
Pfungstadt
Bauverein Darmstadt/Wohnsiedlung
Pfungstadt Geschundener I, 1980/1981
Rostock
Kunsthalle Sieger und Opfer I, 1973
San Lazzaro di Savena (BO)
Fondazione Cardinale Lercaro Frau, 1985
San Gimignano
Museo Civico Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea »Raffaele De Grada« , San Gimignano L'Ebbrezza di Noé, 2003
Sarsina
Museo Archeologico Nazionale Sarsina Papessa, 2008
Stettin
Polnisches Nationalmuseum (Schlossmuseum) Giordano Bruno, 1996
Tuttlingen
Städtische Galerie Lachende, 1971
Verona
Associazione Italiana Amici del Presepio/ Chiesa S. Francesco Schwester Mond (Sorella Luna), 1995
Vicenza
Museo Civico Bildhauer bei der Arbeit (Relief), 1992
Wiesbaden
Hessische Lotterie Treuhandgesellschaft Das Tor zum Glück I (Relief), 1982/1983
Das Tor zum Glück II (Relief), 1982/1983
Städtisches Museum Wiesbaden Frau im Raum (Relief), 1971
Begegnungen (Relief), 1973
Für die Unterstützung bei der Erstellung des Werkverzeichnisses bedanken sich die Herausgeber bei:
Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan
Dr. Hermann Büchner
Bernd Moll
Dr. Angelika U. Schmid
Jürgen Stanicki
Impressum
Herausgeber: Ilka und Jürgen Heß
Konzeption und Redaktion: Ilka Heß, Jürgen Heß
Redaktionelle Mitarbeit und Einrichtung: Hermann Büchner
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Abbildung Titelseite: David und Goliath IV, 1981/1982 (WVZ 323) · Foto: Christa Jäger, Schöneck
© Richard und Ilka Heß, Berlin 2016/2018 (2. Auflage)
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Herausgeber.
Verlag/Druck: Selbstverlag
ISBN 978-3-00-053031-9
