
2 minute read
Struktureller Rassismus: Racial Profiling & Polizeigewalt
from Tayos Weg
Mit Racial Profiling wird die diskriminierende Praxis von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei beschrieben, bei der eine Person aufgrund ihrer tatsächlichen oder zugeschriebenen ›ethnischen‹ Zugehörigkeit, Religion oder Herkunft im Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben.
In der Regel finden solche Personalkontrollen im Rahmen von bestehenden Gesetzen oder polizeilichen Befugnissen statt, weshalb Racial Profiling als eine Form des institutionellen bzw. strukturellen Rassismus verstanden
Advertisement
wird. Allzu oft kommt es hierbei zur übermäßigen Anwendung von Polizeigewalt, die immer wieder auch tödliche Folgen hat. Beispiele dafür sind die Schicksale von Mareame N’deye Sarr (2001), Oury Jalloh (2005), Christy Schwundeck (2011) und vielen anderen. In Deutschland wird für das Racial Profiling von Schwarzen Menschen unter anderem die Rechtskonstruktion ei-
nes sogenannten kriminalitätsbelasteten Orts (kbO) verwendet, welche die Polizei dazu ermächtigt, sogenannte verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Regelmäßig treten bei solchen Eingriffen rassistische Klassifizierungen in den Vordergrund. Schwarzsein wird somit im öffentlichen Raum von der Polizei kriminalisiert und
als ausreichender Anlass zur Festnahme missbraucht.
Darüber hinaus finden Racial Profiling und polizeiliche Gewalt auch außerhalb von kbOs in Grenzgebieten, Flughäfen und Bahnhöfen statt. Hierfür greifen Polizeibeamt*innen auf die Befugnis zur Durchführung verdachtsunabhängiger Kontrollen im grenznahen Raum zurück (auch bekannt als Schleierfahndung). Das Anhalten von Schwarzen Menschen als potenziell »illegale Personen« reproduziert die Vorstellung einer weißen Norm in der Bevölkerung und stellt eine öffentliche Schikane dar, welche für viele Betroffene physische und psychische Folgen hat. Schwarze Selbstorganisationen fordern daher vehement, dass die rechtliche Festlegung von kriminalitätsbelasteten Orten ersatzlos gestrichen wird – nicht zuletzt, da internationale Studien die fehlende Effizienz, die rassistische Diskriminierung und Polizeigewalt solcher Formen der Polizeikontrollen belegen.
Ich habe einen grünen Pass mit ‚nem goldenen Adler drauf (...) All das Gerede von europäischem Zusammenschluss/ Fahr‘ ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus / Frag‘ ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss /Identität beweisen muss!
Advanced Chemistry
Die Black Lives Matter Demonstration 2019 in Berlin: Schwarze Menschen begehren gegen Polizeigewalt und Racial Profiling auf.

Foto: (c) 2019 Elia Fushi Bekene Oury Jalloh (1968–2005) wurde in Sierra Leone geboren und lebte seit 2001 als Asylsuchender in Dessau. Am 7. Januar 2005 wurde er dort von der Polizei in Gewahrsam genommen und verbrannte Stunden später, an Händen und Füßen gefesselt, in einer Zelle im Polizeirevier Dessau. In der Folge forderten und fordern seine Familie und zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh die vollständige Aufklärung seines gewaltvollen Todes. Nach wie vor behauptet die Polizei, Jalloh habe sich trotz Handschellen und einer brandschutzsicheren Matratze selbst angezündet. Der Fall Oury Jalloh bleibt bis heute juristisch umkämpft und ist eines der bekanntesten Beispiele für institutionellen Rassismus
in Deutschland.
Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt [Hrsg.] (2016). Alltäglicher Ausnahmezustand: Institutioneller Rassismus in deutschen Strafverfolgungsbehörden. Münster: edition assemblage.
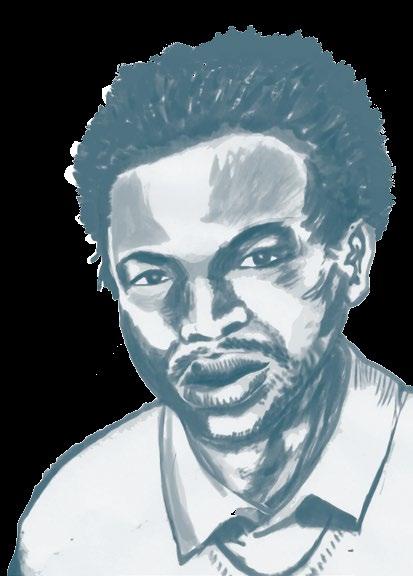
EOTO-Bibliothekssignatur: WSRA 00271
»Wir möchten Aufklärung und Gerechtigkeit. Die Polizei will alles vertuschen, doch wir wissen: Oury Jalloh – das war Mord!«
Matondo











