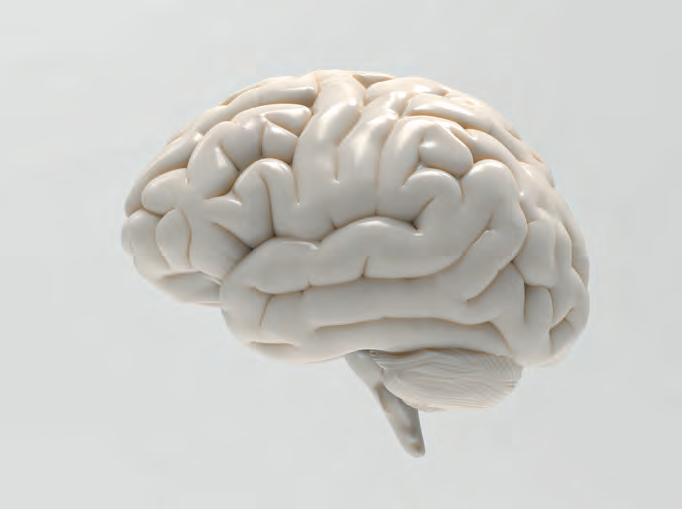
6 minute read
Die Psyche ins rechte Lot bringen
Neue Ansätze für Therapie- und Nebenwirkungsmanagement
+++ Subsyndromale generalisierte Angststörung rund doppelt so häufig wie syndromale +++ Angstpatienten reagieren besonders empfindlich auf Nebenwirkungen +++ Lavendelölextrakt und Tianeptin als nebenwirkungsarme Alternativen +++ Esketamin stellt neue Therapieoption bei therapieresistenter Depression dar +++
Sowohl Ängste als auch Depressionen können ein breites Spektrum von Ausprägungen umfassen – mit der Behandlung vieler Manifestationen hat sich Prof. Dr. Siegfried Kasper, emeritierter Vorstand der Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, MedUni Wien, in seiner Karriere auseinandergesetzt. „Angst und Depression können fast als Geißel der Menschheit bezeichnet werden – zumindest was die Psyche betrifft. Beide psychischen Störungen kommen extrem häufig vor und müssen rasch behandelt werden, weil ansonsten eine Chronifizierung eintritt“, unterstreicht der Experte.
Subsyndromale Angst ist weit verbreitet
Bis zu einem gewissen Grad haben Ängste ihre Berechtigung. „Angst ist ein uns innewohnendes physiologisches System, das wir alle haben und brauchen. Entwicklungsgeschichtlich formuliert: Von den Urahnen, die keine Angst hatten, stammen wir nicht ab, da die Angst überlebensnotwendig ist“, illustriert Prof. Kasper den Stellenwert jenes Gefühls, das für viele Patienten im Lauf ihres Lebens zur Last wird. Allerdings erfüllen nicht alle von ihnen die diagnostischen Kriterien einer Angststörung – eine rasche Behandlung hat trotzdem eine große Bedeutung, weil sich ansonsten eine generalisierte Angststörung (GAD) oder eine andere psychische Störung daraus entwickeln kann. Die subsyndromale GAD scheint einer Metaanalyse zufolge etwa doppelt so oft aufzutreten wie die syndromale GAD. Die Lebenszeitprävalenz beträgt rund 12 %.1 Wenn man die Kriterien für die subsyndromale GAD weiter fasste, wie eine aktuelle Publikation2 unter Mitarbeit von Prof. Kasper vorschlägt (siehe Infobox), stiege die Lebenszeitprävalenz auf 13,7 %. „Insgesamt ist die subsyndromale GAD sehr häufig, führt aber selten zu einer Behandlung, da die Patientinnen und Patienten sich oft mit ihren Symptomen abfinden und sie als schicksalhaft betrachten“, hebt Prof. Kasper hervor.
Experte zum Thema: Prof. Dr. Siegfried Kasper
Em. Vorstand der Univ.Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, MedUni Wien
Adäquater Umgang mit Nebenwirkungen
„Prinzipiell zeigen Patienten mit Angsterkrankungen eine erhöhte Empfindlichkeit in Bezug auf Nebenwirkungen“, so der Psychiater und Psychotherapeut. Diese äußern sich sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene, etwa durch ein inneres Unwohlsein und Angespanntheit. „Bei einer subsyndromalen GAD haben sich pflanzliche Präparate sehr gut bewährt. Das einzige davon, das unter Einhaltung internationaler Standards untersucht wurde – nämlich referenz- und placebokontrolliert –, ist das Lavendelölextrakt Silexan“, fügt Prof. Kasper an. Eine Metaanalyse mit fast 700 Teilnehmern demonstriert die Effektivität des Phytopharmakons in der Indikation subsyndromale GAD.3
Besonnener Einsatz von Benzodiazepinen
Handelt es sich bereits um eine syndromale GAD, ist zu beachten, dass klassische Antidepressiva wie SSRI zu Beginn >
Foto: © Siegfried Kasper, privat
der Behandlung das Level der Angst steigern. „Die Patienten sind nicht begeistert davon, wenn sich ihre Symptomatik durch die Therapie verschlimmert. Meist behilft man sich mit der zusätzlichen Verordnung von Benzodiazepinen für die ersten zwei bis drei Wochen, welche die Angst dämpfen“, betont Prof. Kasper. Benzodiazepine würden gerne auch von Nichtpsychiatern verschrieben. „Dadurch geht es den Patienten zwar besser, jedoch verlangen sie nach einiger Zeit eine Dosiserhöhung. Wenn man Benzodiazepine einsetzt, dann muss man auf alle Fälle nach zwei bis drei Wochen nochmals die Medikation überprüfen und die Patienten darauf hinweisen, dass diese Substanzklasse maximal drei Monate lang – zuletzt in absteigender Dosierung – eingenommen werden sollte.“
Angst und Depression in Kombination
Das Auftreten von Angst- wie auch depressiven Symptomen stellt ebenfalls ein verbreitetes Problem in der klinischen Praxis dar. In der ICD-10 ist jenem Krankheitsbild eine eigene Diagnose gewidmet: „Angst und depressive Störung, gemischt“ (F41.2). Beide Anteile der psychischen Störung beeinträchtigen den Patienten gleichermaßen, sind aber noch als subsyndromal einzustufen.4 „Die Pathophysiologie ist bei Angst und Depression ganz ähnlich“, verdeutlicht Prof. Kasper. „Prinzipiell kann man auch die Depression als etwas Physiologisches bezeichnen, denn jedes Gehirn kann depressiv werden. Bei Foltermethoden macht man sich diesen Umstand z. B. zunutze, wenn man die Menschen in Isolation gefangen hält. Irgendwann gibt der Mensch bzw. dessen Gehirn auf und entwickelt depressive Symptome, man sieht alles schwarz, das Leben hat keinen Sinn mehr etc. Wenn Depression und Angst gemischt auftreten, ist das insgesamt eine bedrohliche Situation, weil jene Kombination häufig auch mit Suizidalität verbunden sein kann.“
Empfehlungen für das Therapiemanagement
Wiederum müssen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte hier großes Augenmerk auf etwaige Nebenwirkungen der verordneten Medikation legen. „Wenn SSRI oder SNRI eingenommen werden, kann der Fall eintreten, dass sich die Unruhe verstärkt. Zudem können die Patienten vermehrt zu schwitzen beginnen – und auch die Angstsymptome nehmen paradoxerweise manchmal zu“, berichtet der Psychiater und Psychotherapeut. Dann müsse man das Medikament wechseln – oder der Patient sei bereits so enttäuscht, dass er die Behandlung abbreche und die Arztpraxis nicht mehr aufsuche. „Es gibt Medikamente, die deutlich weniger Nebenwirkungen haben – dazu gehören u. a. die pflanzlichen. Das Lavendelölextrakt ist z. B. in dieser Indikation untersucht worden. Außerdem stehen einige synthetische Arzneimittel zur Verfügung, die einen anderen Wirkmechanismus aufweisen, etwa Tianeptin. Man muss beim Management der Nebenwirkungen wirklich sehr vorsichtig sein, wenn Angst und Depression in Kombination auftreten.“
X Infobox: Definition der subsyndromalen GAD
In der 2021 erschienenen Publikation2 von Volz et al. wird folgende Definition der diagnostischen Kriterien für eine subsyndromale GAD (auf Basis des DSM-5) vorgeschlagen: Ängste und Sorgen ≥ 3 Monate, wobei Schwierigkeiten in Bezug auf die Kontrolle der Sorgen nicht obligatorisch sind, Vorliegen von ≥ 2 (statt ≥ 3 bei der syndromalen GAD) der folgenden Symptome: Unruhe bzw.
Gefühl der Überreiztheit bzw. Nervosität, leichte Ermüdbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten,
Reizbarkeit, Muskelverspannungen, Schlafstörungen, Erreichen von ≥ 5 Punkten auf der GAD-7-Skala.
Neue Optionen bei Therapieresistenz
Des Weiteren forscht und publiziert Prof. Kasper bereits seit etwa 20 Jahren im Bereich der therapieresistenten Depression (TRD). „Wenn Antidepressiva in ausreichender Dosierung in zwei Therapiezyklen und über einen ausreichend langen Zeitraum – rund drei bis vier Wochen – verabreicht werden, aber die Patienten nicht darauf ansprechen, bezeichnet man dies als TRD“, erinnert der Experte. Ungefähr ein Drittel der depressiven Patienten sei davon betroffen und müsse daher in einer (Universitäts-)Klinik oder in einem Schwerpunktkrankenhaus behandelt werden. „Klassische Behandlungsansätze umfassen die Kombination zweier Antidepressiva oder die Gabe eines Antidepressivums plus einer Substanz aus der Gruppe der atypischen Antipsychotika oder plus Lithium“, erklärt der Psychiater und Psychotherapeut.
Nasenspray als Add-on-Therapie
In den letzten zehn Jahren stand jedoch eine weitere Wirkstoffklasse im Mittelpunkt des Forschungsinteresses von Prof. Kasper: „Dabei handelt es sich um einen neuen Wirkmechanismus: Die Substanz Ketamin kommt auch in der Anästhesie zum Einsatz. In der Psychiatrie benötigen wir vom entsprechenden S-Enantiomer des Wirkstoffs – Esketamin – nur ein Zehntel der in der Anästhesie üblichen Dosierung, was einen sehr guten und raschen Effekt auf die TRD hat.“ Das als Nasenspray erhältliche Esketamin verabreiche man als Add-on zu einem Antidepressivum. Das Nebenwirkungsprofil stelle sich dabei – bis auf einen möglichen sedativen Effekt – anders dar, als man es von den Antidepressiva kenne. Eine Steigerung der Angst stehe jedenfalls nicht im Vordergrund. „Stattdessen kann es zu einer Derealisation kommen. Zudem muss man den Blutdruck regelmäßig kontrollieren bzw. auf eine gute Einstellung mit Hypertonika bei Patienten mit kardiovaskulären Beschwerden achten“, so der Wissenschaftler abschließend.
Mag.a Marie-Thérèse Fleischer, BSc
Quellen: 1 Haller H et al., BMC Psychiatry 2014; 14: 128. 2 Volz H-P et al., Int J Psychiatr Clin Pract 2021; ahead of print. 3 Möller H-J et al., Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2019; 269(2): 183-193. 4 Kasper S et al., European Neuropsychopharmacology 2016; 26: 331-340.

