
16 minute read
Spuren der Armut: Beginenkultur in Köln
Das Haus, in dem sich ab 1869 das Beginenkonvent befand, ist noch gut erhalten. Heute ist es ein normales Wohnhaus.
SPUREN DER ARMUT
Advertisement
Sophien-Convent – Beginenkultur in Köln
VON IRENE FRANKEN
ingemeißelt in Stein kann man noch heute „SophienConvent“ über dem Eingang des Hauses in der Brunostraße 18 lesen. Das Haus in der Kölner Südstadt wurde im Jahre 1869 vom Kölner Rentner Johann Caspar Kneutzgen als Frauengemeinschaft erworben, um ausschließlich älteren Frauen ohne Altersabsicherung, verarmten Witwen und ehemaligen Dienstmägden einen Ort zu schaffen, in dem sie gut leben konnten. Die gesellschaftlichen Gruppen, die heute am stärksten von Armut betroffen sind – alleinerziehende Mütter und alte Frauen – sind letztlich seit dem Mittelalter die gleichen geblieben. Anlass der Gründung war, dass die Mutter des Stifters in einer Notzeit Aufnahme in einem Haus mit Beginentradition erhalten hatte. Im Jahr 1872 konnte das Konvent bezogen werden.
Köln gilt übrigens als erste Stadt, in der in einer Urkunde das Wort ‚Begine’ auftauchte – im Jahr 1223, und es ist der Ort, an dem Sela Jude, eine Kölner Patrizierin, 1230 den ersten Beginenkonvent Deutschlands gründete, in der Stolkgasse nahe Kolpingplatz. Es folgten viele weitere Gründungen und 1320 gab es bereits 89 Beginenkonvente in Köln. Die Beginen waren eine christliche, spirituelle und auch ethische Bewegung, u.a. gegen die Korruption der Geistlichkeit gerichtet. Die Zahl der Insassinnenvariierte, meist waren es zwölf, die Zahl der Apostel, aber es konnten auch bis zu 50 Bewohnerinnen sein.
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Beginen-Idee sehr verändert; der spiritu

elle Aspekt trat immer stärker in den Hintergrund, der karitative nach vorn. Die Beginenhäuser wurden bessere Altenheime für Frauen. Aber die ursprünglichen Stiftungen von reichen Kölnerinnen und Kölnern reichten bis ins 19. Jahrhundert. So konnte auch die Mutter von Kneutzgen davon profitieren.
Heute ist das einstige „Möhnehaus“ ein normales Wohnhaus. Doch der Beginengedanke lebt seit 1230 weiter fort: In Deutschland gibt es an die 20 Beginenhäuser, darunter der Beginenhof – ein kollektives, selbstverwaltetes Frauenwohnprojekt in KölnWiddersdorf. Und wegen der großen Nachfrage ist ein zweites Haus in Planung. Irene Franken, geboren 1952 in Düsseldorf, ist Historikerin, Publizistin und Mitbegründerin des Kölner Frauengeschichtsvereins. Im Jahre 2017 wurde sie mit der Alternativen Ehrenbürgerschaft in Köln ausgezeichnet.

guillaume Musso: „Ein Wort, um dich zu retten“
Ein Werk, das sich auf jeder Seite neu erfi ndet. Und jedesmal, wenn man glaubt, nun habe es seine perfekte Wellenlage gefunden, gerät wieder alles außer Kontrolle, muss neu geordnet, neu justiert werden. Und damit auch die Seele der Leser*innen, die an den Bordwänden anecken, vom Meer verschaukelt werden. nathan Fawles war einst ein erfolgreicher nathan Fawles war einst ein erfolgreicher Schriftsteller. Doch von einem Tag auf den anderen schmiss er seinen Griffel hin, zog sich auf eine Mittelmeerinsel zurück und hat seither kein Wort mehr zurück und hat seither kein Wort mehr geschrieben. Zurückgezogen lebt er auf geschrieben. Zurückgezogen lebt er auf der Ile Beaumont (übrigens reine Fiktider Ile Beaumont (übrigens reine Fiktion) in einem wunderschönen Felsenhaus mit Meerblick, einsam, als einzigen haus mit Meerblick, einsam, als einzigen Begleiter seinen Hund Bronco. Journalist*innen scheut er wie der Teufel das Weihwasser. Und nur die Inselbewohner*innen bekommen ihn hin und wieder zu Gesicht, wenn er ein Gläschen Sancerre im örtlichen Bistro trinkt. Kein Mensch weiß, warum er sich zurückzog, was seinem Entschluss, das Schreiben aufzugeben, vorausging. Doch plötzlich ist es um die Ruhe auf Beaumont vorbei. Die Leiche einer Frau wird, an einen Baum festgehämmert, gefunden. Die Polizei schottet die Insel ab. Der Täter muss sich noch auf Beaumont befi nden. Parallel hierzu wird die Ruhe des Schriftstellers empfi ndlich gestört. Mathilde, eine junge Frau, drängt auf Fawles Grundstück, ein junger Mann, mit einem Manuskript in der Hand, lässt sich nicht abwimmeln. Und so nach und nach wird klar, dass Fawles und Mathilde mehr verbindet, als nur die pure neugierde der jungen Journalistin. Und dass es ein für allemal vorbei ist mit der Ruhe des bis dahin so zurückgezogen lebenden Schriftstellers. Denn das Geheimnis, das beide mit sich tragen, ist so grauenhaft, so abscheulich, so menschenverachtend und lebenszerstörend, dass sie nur gemeinsam – wenn überhaupt – überleben können. Ein Meisterwerk des derzeit meistgelesenen Autors Frankreichs. Dessen Thema schon mehrfach das Innenleben von Schriftsteller*innen war, ihre undurchsichtigen Motive und der Umgang mit Fiktion und Realität. Eine Gratwanderung, die sich hier mal wieder heftig vermischt und zu einer außergewöhnlich genussvollen Lektüre führt. Ingrid Müller-Münch


Guillaume Musso: Ein Wort, um dich zu retten. Pendo / Piper 2020, ISBN 978-3866124837, 16,99 Euro
James Sallis: „Willnot“

Lamar Hale ist Arzt in Willnot, einer Kleinstadt an der amerikanischen Westküste. An einem verregneten Tag wird er vom örtlichen Sheriff zu einer alten Kiesgrube gerufen. In dieser haben Jäger ein Massengrab gefunden. Kurz darauf taucht Bobby Lowndes auf, ein traumatisierter Marine und Scharfschütze, der in Willnot aufwuchs und von Lamar als Kind behandelt wurde. Ihm auf den Fersen: eine wortkarge FBI- Agentin. Hat Lowndes etwas mit den Toten in der Kiesgrube zu tun? Was wie ein klassischer noir-Krimi klingt und beginnt, dunkel und brutal – und so auch fälschlicherweise auf dem Klappentext angepriesen wird –, entpuppt sich als Psychogramm einer Stadt und eines Mannes, der von den Toten verfolgt wird. Denn Lamar lag als Kind ein Jahr im Koma, besucht von Gespenstern, die ihn nicht mehr loslassen. Wenn der Arzt jetzt von sich, seinem Partner, Bobby Lowndes und seinen Patienten erzählt, lösen sich die Vorstellungen von festen Persönlichkeiten auf. Ebenen, Szenarien und Zeiten springen im schnellen Rhythmus. Dabei wechselt der Blickwinkel des Arztes vom Realen ins Mystische, von der Gegenwart in die Vergangenheit und Zukunft, vom Krankenhaus ins Zuhause. Als Leser ist hohe Aufmerksamkeit gefordert. James Sallis gilt als Philosoph und Metaphysiker unter den amerikanischen Kriminalautoren. Immer wieder zitiert er im Roman explizit Philosophen wie Kierkegaard. So behandelt das Buch keinen Kriminalfall, der – Spoileralarm – auch nicht gelöst wird, sondern das Verhältnis zwischen Leben und Tod, von innerer Einheit und Zerrissenheit, von Heimat und Fremdheit. Wer einen dunklen Krimi erwartet, mag enttäuscht werden. Wer spannende Literatur liebt, die sich mit den existenziellen Fragen des Seins beschäftigt, wird begeistert sein. Jens Hüttenberger
James Sallis: Willnot. Liebeskind, 2019, ISBN 978-3954381029, 20,00 Euro.
Andrea Camilleri: „Kilometer 123“
Ein Krimi wie ein Tanz auf Messers Schneide. Eine Geschichte, die die Leser*innen an der nase herumführt, um zu guter Letzt eine brillante und ja, tatsächlich unerwartete Lösung zu präsentieren. Das Ganze kurzweilig in Form von Emails, SMS, Zeitungsmeldungen oder knapp gefassten Dialogen erzählt. Von dem 2019 verstorbenen Großmeister italienischer Krimikunst, Andrea Camilleri, der mit seinem sizilianischen Commissario Montalbano einen Welterfolg errang. Der Ausgangspunkt dieser wunderbar verschnörkelten Kriminalgeschichte verspricht schon einiges: Ester Russo sehnt sich nach ihrem Geliebten. Doch der Baulöwe antwortet nicht. Sie schickt ihm eine nachricht nach der anderen auf sein Handy - „Bitte, bitte, wo steckst du?“ - und weiß nicht, dass er gar nicht antworten kann. Denn Guilio Davoli hatte einen Autounfall. Bei Kilometer 123 der Via Aurelia Richtung Rom wurde bei regennasser Straße sein Panda von einem auffahrenden Auto gerammt. Davoli verlor die Kontrolle und stürzte die Böschung hinunter. nun liegt er im Krankenhaus, mit gebrochenem Kiefer. Kann nicht sprechen. Sein Handy, auf das all die verzweifelten nachrichten seiner Geliebten Ester eingehen, hat seine Frau
DIE BESTEN NEUERSCHEINUNGEN –EMPFOHLEN VON DEN DRAUSSENSEITER-KRIMIKRITIKER*INNEN

vom Krankenhauspersonal überreicht bekommen. Und die liest nun, mit anschwellendem Zorn, so Sätze wie: „Du fehlst mir, ohne dich bleibt mir keine Luft zum Atmen.“ Wie sich nun die zornigen Reaktionen all der an dieser Affäre beteiligten Freundinnen und Freunde, Ehemänner und Ehefrauen verheddern, wieder entwirren, um zu guter Letzt eine Intrige von ganz besonders ausgefeilter Bösartigkeit zu entlarven – das hinzubekommen bedarf eines Künstlers wie Andrea Camilleri. Ingrid Müller-Münch

Andrea Camilleri: Kilometer 123. Kindler 2020, ISBN 978-3463000107, 22,00 Euro
Maggie Nelson: „Die roten Stellen“
Jane Mixer wurde tatsächlich ermordet. 1969, als junge Studentin, suchte sie eine Mitfahrgelegenheit von der Uni nach Hause. Am daraufUni nach Hause. Am darauffolgenden Tag fand man ihre Leiche. Sie wurde erschossen und erdrosselt, wie einiwurde erschossen und erdrosselt, wie einige andere junge Frauen zu dieser Zeit in dieser Gegend. Die amerikanische Lyrikerin und Autorin Maggie nelson ist Janes nichte. Schon vor Jahren hat sie das Schicksal ihrer Tante in einem Roman verarbeitet. Sie hätte es dabei belassen können. Aber nein, stattdessen schrieb sie 2007, knapp 40 Jahre nach dem Mord, einen authentischen, autobiographischen Roman, der gleichzeitig eine ungewöhnliche Form der Gerichtsreportage und des Krimis ist. Dem Hanser-Verlag ist es zu verdanken, dass dieses literarische Kleinod nun auf Deutsch erschienen ist. Der Grund für die erneute Beschäftigung der Autorin mit dem Tod ihrer Tante: 35 Jahre nach dem Mord wird 2005 plötzlich alles wieder aktuell. Die Polizei hatte sich den Cold Case noch einmal vorgenommen und mithilfe einer DnA-Spur einen Verdächtigen gefunden. Einen Familienvater, bieder, ältlich, unscheinbar. Es kommt zum Prozess gegen ihn. Und obwohl Maggie nelson erst nach dem Tod ihrer Tante zur Welt kam, lässt sie deren Schicksal nicht los. Von Beginn des Prozesses an wird sie Woche für Woche der juristischen Aufarbeitung von Janes Tod im Gerichtssaal folgen. Diesmal mit anderem Blick auf die Dinge. Einem Blick, der die Frage aufwirft: Was bringt dieser Prozess nach all den Jahren? Rache? Gerechtigkeit? Auf jeden Fall keine Klarheit - wie sich zeigen wird.Ein poetischer Umgang mit der juristischen Aufarbeitung eines Kriminalfalles. Maggie nelson stellt Fakten und Zeugenaussagen ihren Empfi ndungen und Erinnerungen gegenüber. Lässt mitfühlen, wie unerbittlich grausam Leben sein kann. Ein Buch, das mit seinen stillen Abschweifungen tief berührt. Ingrid Müller-Münch

Maggie Nelson: Die roten Stellen – Autobiographie eines Prozesses. Hanser-Berlin 2020, ISBN 978-3446265912, 23,00 Euro.
Michael robotham: „Schweige still“
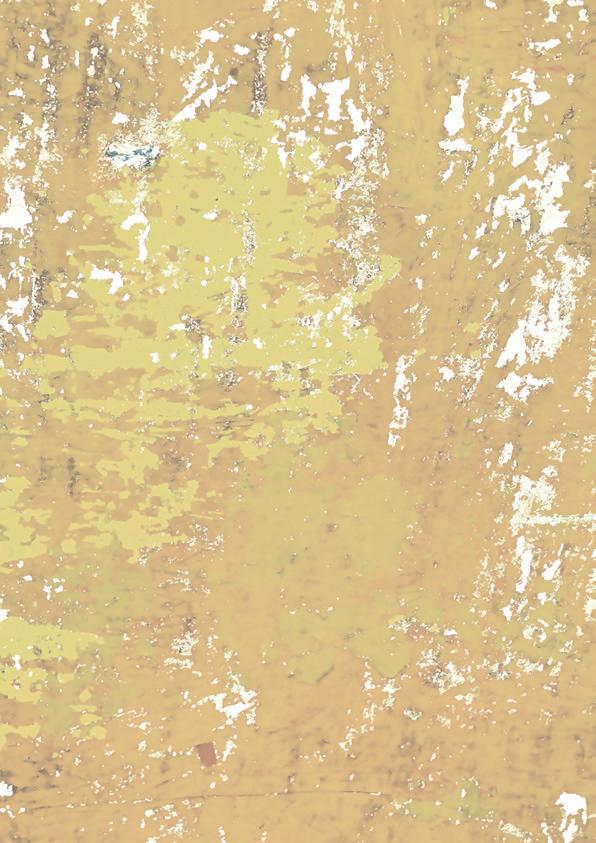

Beide sind gleichermaßen geschädigt. Er, Cyrus Haven, der neue Protagonist des australisch-englischen Erfolgsautors Robotham, musste vor Jahren mitansehen, wie sein Bruder seine Eltern und seine Schwester tötete. nun ist er ein erwachsener Mann, ein Außenseiter, der Psychologe wurde, die Polizei berät, von Albträumen geplagt. Dieser beschädigte Mann trifft auf eine Jugendliche mit einer undurchsichtigen Vergangenheit und so gut wie keiner Zukunft. Einspieler: Ich erinnere mich an die Geschichte. Ein Mädchen, das in einem Geheimzimmer eines Hauses im norden von London gefunden worden war, geschätzt elf oder zwölf Jahre alt, obwohl sie weniger wog als ein halb so altes Kind. Eine Kreatur mit wilder Mähne und wirrem Blick, mehr Tier als Mensch, die auch unter Wölfen groß geworden sein könnte. Ihr Versteck war nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo die Polizei die verwesende Leiche eines Mannes gefunden hatte, der aufrecht auf einem Stuhl sitzend zu Tode gefoltert worden war. Das Mädchen hatte Monate lang mit der Leiche gelebt und sich nur aus dem Haus geschlichen, um nahrung zu stehlen. Die teilte sie sich dann mit den beiden Hunden, die in einem Zwinger im Garten lebten. Evie Cormac, wie die Kleine angeblich heißt, schläft jede nacht mit einem Messer unter dem Kopfkissen und hat eine seltene Fähigkeit: Sie ist ein Truth-Wizzard, jemand, der erkennen kann, ob sein Gegenüber lügt oder die Wahrheit sagt. Evie Cormac und Cyrus Haven sind gleichermaßen voneinander fasziniert. Durch besondere Umstände zusammengeschweißt, ermittelt Cyrus im Fall eines Mädchenmordes. Doch immer wieder stößt auch Evie auf Spuren, wird in die Sache involviert, muss um ihr Leben fürchten. Zwei an Wahnsinn grenzende neue Protagonisten des Autors, der jahrelang die Bestsellerlisten mit einem von Parkinson heimgesuchten Ermittler führte. Eine über 500 Seiten anhaltende Höllenfahrt durch die Seelen von zwei schwerst verletzten Menschen. Die sich irgendwie am Leben entlanghangeln. Und wenig von dem verstehen, was normalität ist; dafür umso mehr von Abgründen und Höllenfeuern. Ingrid Müller-Münch


Michael Robotham: Schweige still. Goldmann 2019, ISBN 978-3442315055, 15,90 Euro.
„Mit Musik geht alles besser“
VON CHRISTINA BACHER

onstantin träumt schon lange von einer eigenen kleinen Wohnung und einer richtigen Arbeit. Doch wirklich auf der Suche ist er zurzeit nicht, was vor allem daran liegt, dass es ihm nicht besonders gut geht. Inzwischen hinterlässt das jahrelange Leben auf der Straße sichtbare Spuren an seiner Gesundheit. Die CoronaPandemie tut ihr Übrigens, um ihm die wenigen Kontakte, die er zuvor hatte, zu nehmen und auch die Hoffnung auf bessere Zeiten: Er vermisst seine Kinder. Und er weiß, dass er sich ganz besonders schützen muss vor dem gefährlichen Coronavirus, weil er zur Risikogruppe gehört. Doch wie soll das gehen, wenn man keinen Rückzugsraum hat? Das Einzige, was ihn zurzeit noch oben hält, sind die Erinnerungen an vergangene Zeiten, in denen es ihm besser ging. Aber lassen wir ihn die Geschichte – mit gebührendem Abstand bei einem Treffen auf den Poller Wiesen – von vorne erzählen.
Der 48jährige Rumäne aus der Stadt Brasov kommt im Frühjahr 2006 mit großen Erwartungen nach Deutschland, um zunächst in Duisburg, Düsseldorf, Mainz und Stuttgart in unterschiedlichen Jobs Geld zu verdienen. An manchen Tagen wird er morgens als Tagelöhner in ein Auto geladen und irgendwo zum Arbeiten hingefahren – „keine Ahnung, wo wir da waren und wer uns beauftragt hat“ –, der Lohn wird am Abend bar ausgezahlt. Eine Absicherung gibt es nicht, an Rente ist so natürlich nicht zu denken. Dennoch verdient er mehr als zuhause. Eine Weile geht das gut. In Köln angekommen, schöpft er Hoffnung. „Die Stadt hat mir sofort gefallen.“ Er holt seine Frau und die beiden Töchter nach, um ihnen endlich eine bessere Zukunft ermöglichen zu können. Für seine Kinder, so sagt er, würde er alles tun. In Rumänien hätten sie keinerlei Chance auf eine gute Ausbildung gehabt, nicht mal die Miete habe er zeitweise bezahlen können. „In Rumänien konnte ich meine Familie einfach nicht mehr ernähren“, erzählt der gelernte Koch, der zeitweise mehrere Jobs gleichzeitig hatte. Doch obwohl er oft täglich von 7 bis 22 Uhr gearbeitet hat, kam er nie auf mehr als 18 Euro am Tag – zum Leben für eine vierköpfige Familie zu wenig, zum Sterben zu viel.
Nur deshalb sei er losgezogen, um sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. „Meine Heimatstadt Brasov gilt als eine der schönsten und kulturell interessantesten Städte Europas – für Touristen und die vielen Studierenden aus aller Welt sicher ein Traum. Doch die Einwohner*innen leiden unter extremer Armut und der herrschenden Korruption des Landes“, erklärt er in seiner Muttersprache Rumänisch. Er ist dankbar, dass es auch in Deutschland immer mehr Menschen gibt, die seine Sprache sprechen und ihm Kompliziertes übersetzen können, auch in den Einrichtungen. Inzwischen hat er auch Deutsch gelernt, wenigstens ein bisschen.
Heute ist Friederike Bender dabei, die Streetworkerin ist in der OASE für den Bereich Humanitäre Hilfen zuständig. Geduldig hört sie Konstantin zu und übersetzt, was er sagt. Der schlanke Mann erzählt ihr, wie die instabile Gesetzeslage und die Unterbezahlung der Arbeitnehmer*innen sein geliebtes Heimatland beuteln und dadurch die Selbstbereicherungsmentalität der Eliten gefördert würde – Geschichten, die die Sozialarbeiterin zwar Tag für Tag hört und doch weiß, dass jeder Mensch anders damit umgeht und sein ganz persönliches Schicksal zu tragen hat.
Konstantin erinnert sich ungern an die Anfangsjahre in Deutschland, in denen er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, bis man ihn eines Tages erwischt und verwarnt, denn nicht jeder Job war angemeldet. Fast zeitgleich, als ihm die Verdienstmöglichkeiten wegbrechen, verlässt ihn auch seine Frau und nimmt die 4 und 6jährigen Mädchen mit sich – sie bezieht eine eigene Wohnung am Rande Kölns. Das Leben des 48Jährigen liegt nun in Scherben und er landet auf der Straße. Einzig sein AkkordeonSpiel gibt ihm Halt. Das Instrument erinnert ihn an seinen Großvater, der es ihm beibrachte, als er noch ein kleiner Junge war. So vermittelt ihm der Klang sofort eine gewisse Geborgenheit.
Das Akkordeonspiel läßt Konstantin für eine kurze Weile seinen schweren Alltag vergessen. Streetworkerin Bender freut sich mit ihm über das neue Instrument.

Foto: Christina Bacher In unserer Reihe „Begrenzt – Entgrenzt – Ausgegrenzt?“ geht die Journalistin Christina Bacher der Frage nach, wie obdachlose in Köln die Corona-Krise erlebt haben, denn zeitweise waren nach dem Shut-Down nur noch die Ärmsten der Armen im Stadtbild zu sehen. Einerseits waren sie endlich überhaupt mal sichtbar, andererseits hatten sie keinerlei Möglichkeiten, sich in einen geschützten Raum zurückzuziehen, obwohl sie häufig zur Risikogruppe gehören. Was ist aus ihnen geworden? Haben sie „überlebt“? Mussten sie abwandern und haben sie gar ihre letzte Hoffnung verloren? oder schöpften sie Kraft aus ganz neuen Quellen? Sind manche auf der Platte gar kreativ geworden? Und hat ihnen ein künstlerischer Schaffensprozess sogar geholfen, weiter zu leben? Die Autorin, ausgezeichnet mit dem Sonderfonds der Kunststiftung nRW, möchte den Menschen auf der Straße mit dieser Kolumne eine Stimme (zurück) geben.
Als die Stadt Köln dann im Oktober 2018 sehr. Konstantins Stimme wird ganz ein Wohnheim für Menschen aus Staa leise und sanft, wenn er über seine ten der EUOsterweiterung in der Vorge Mädchen spricht. Dann holt er ein paar birgstraße eröffnet, hat Konstantin – von Fotos aus dem Rucksack und streicht einigen Nächten in der Notschlafstelle liebevoll über ihre Gesichter. Wie sehr mal abgesehen – endlich wieder ein Bett würde er sich wünschen, eine eigene zum Schlafen. In dem vom SKM verwal kleine Wohnung zu haben, in der die teten Haus kann er beiden ihn auch mal zwar auch essen, besuchen können. duschen und die Vor Kurzem hat FrieKleiderkammer »Es kommen sicher wieder derike Bender erfahren, nutzen – ein eige bessere Zeiten. Wenn ich nur dass Konstantins geliebnes Zimmer hat er in Köln bleiben kann. tes Akkordeon nicht hier aber nicht. So Ich liebe diese Stadt, den FC mehr funktioniert. Ausdankbar er für all und die Menschen hier.« gerechnet in Zeiten des dies ist, fühlt er Lockdowns, in denen sich nach wie vor der Rumäne wenig Konals Getriebener takte zu anderen pfleohne Zuhause. So ist er tagsüber – trotz gen kann, fällt ihm auch noch das kleine Corona – nach wie vor viel mit seinem Zubrot durch die Straßenmusik weg. Sie Gepäck auf der Straße unterwegs, wenn ahnt, wie schlimm das für ihn sein muss er gerade nicht bei Freunden unter und beschließt, einen Aufruf auf der kommt. Seine Töchter darf er deshalb FacebookSeite des Straßenmagazins nur sporadisch sehen, das Sorgerecht DRAUSSENSEITER zu schalten. Keine liegt bei der Mutter. Darunter leidet er Woche später meldet sich der Kölner Musiker Christian Hecker und spendet kurzerhand eins seiner Instrumente – ein Wunder für den Obdachlosen und ein Grund zu großer Freude.
Feierlich nimmt er heute auf den Poller Wiesen das dunkelrote Instrument entgegen. Er legt es um, schließt die Augen und beginnt – plötzlich ganz versunken – mit dem Spiel melancholischer Weisen und alter Volkslieder, die ihn an die Schönheit Brasovs erinnern und an schönere Zeiten, in denen die Welt noch in Ordnung war. Er hat an seinen inzwischen verstorbenen Großvater gedacht, erzählt er später, der ihm früher immer Mut zugesprochen hat. Und dann macht er eine Pause und sagt in nahezu fehlerfreiem Deutsch: „Es kommen sichere wieder bessere Zeiten. Wenn ich nur in Köln bleiben kann. Ich liebe diese Stadt, den FC und die Menschen hier. Schenkt mir einfach einer ein Akkordeon! So etwas passiert sonst nirgends.“ Und dabei leuchten seine Augen vor Dankbarkeit. Und auch vor Hoffnung.




