IMPFEN KOMPAKT
Risikopersonen
Impfen bei Grunderkrankungen
Reiseimpfungen
Den Arboviren geht es an den Kragen
Impfstoffentwicklung
Es tut sich was in Sachen RSV
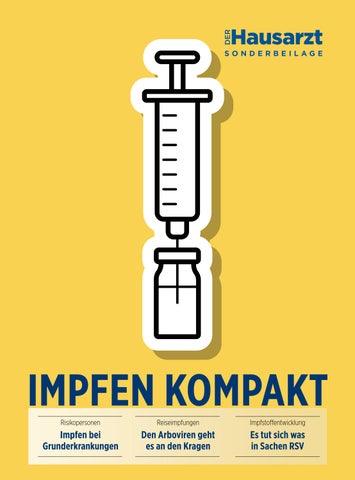
Risikopersonen
Impfen bei Grunderkrankungen
Reiseimpfungen
Den Arboviren geht es an den Kragen
Impfstoffentwicklung
Es tut sich was in Sachen RSV
• Enthält 5 azelluläre Pertussiskomponenten1
• Hohe Hib-Seroprotektion einen Monat nach Grundimmunisierung und Auffrischimpfung (OMPC-Konjugat)1,2
• Injektionssuspension in einer Fertigspritze1 mit Luer-Lock-System

• Stabil für 228 Std. bei Lagerung außerhalb des Kühlschranks bis 25 °C1
• Hohe Immunogenität im 2+1-Schema1










Referenzen:










































































1. Fachinformation Vaxelis®, Stand Januar 2023. 2. Silfverdal SA et al. A Phase III randomized, double-blind, clinical trial of an investigational hexavalent vaccine given at 2, 4, and 11 – 12 months. Vaccine 2016;34:3810–3816.



Vaxelis® Injektionssuspension in einer Fertigspritze
Wirkstoff: Diphtherie-Tetanus-Pertussis(azellulär, aus Komponenten)-Hepatitis-B(rDNA)-Poliomyelitis(inaktiviert)-Haemophilus-Typ-b(konjugiert)-Adsorbat-Impfstoff. Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Dosis (0,5 ml) enthält: Diphtherie-Toxoid1 mind. 20 I.E.6; Tetanus-Toxoid1 mind. 40 I.E.6; Bordetella-pertussis-Antigene1: Pertussis-Toxoid (PT) 20 Mikrogramm, Filamentöses Hämagglutinin (FHA) 20 Mikrogramm, Pertactin (PRN) 3 Mikrogramm, Fimbrien Typen 2 u. 3 (FIM) 5 Mikrogramm; Hepatitis-B-Oberflächenantigen2, 3 10 Mikrogramm; Inaktivierte Polioviren4: Typ 1 (Mahoney) 40 D-Antigen-Einheiten5, Typ 2 (MEF-1) 8 D-Antigen-Einheiten5, Typ 3 (Saukett) 32 D-Antigen-Einheiten5; Haemophilus-influenzae-Typ-b-Polysaccharid (Polyribosylribitolphosphat) 3 Mikrogramm, konjugiert an Meningokokken-Protein2 50 Mikrogramm.

1 adsorbiert an Aluminiumphosphat (0,17 mg Al3+)

2 adsorbiert an amorphes Aluminiumhydroxyphosphatsulfat (0,15 mg Al3+)

3 hergest. in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie
4 gezüchtet in Vero-Zellen
5 od. äquivalente Antigenmenge, bestimmt durch e. geeignete immunchem. Methode














6 od. äquivalente Aktivität, bestimmt durch e. Immunogenitätsbewertung
Sonst. Bestandt.: Natriumphosphat, Wasser für Injekt.-zwecke. Kann Spuren von Glutaraldehyd, Formaldehyd, Neomycin, Streptomycin, Polymyxin B u. Rinderserumalbumin enth.



Anw.: Zur Grundimmunisierung u. Auffrischimpf. bei Sgln. u. Kleinkdrn. ab 6 Wochen gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis u. durch Haemophilus influenzae Typ b (Hib) verursachte invasive Krankheiten. Vaxelis® sollte entspr. den offiziellen Impfempf. angewendet werden. Gegenanz.: Auftreten e. anaphylaktischen Reakt. nach vorheriger Verabr. von Vaxelis® od. e. Impfstoffs, der die gleichen Komponenten od. Bestandt. enth. Überempf.-keit gg. die Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt. od. gg. Spuren herstellungsbed. Verunreinig. (Glutaraldehyd, Formaldehyd, Neomycin, Streptomycin, Polymyxin B u. Rinderserumalbumin). Enzephalopathie unbek. Ätiologie, die innerh. von 7 Tagen nach e. früh. Verabr. e. pertussishalt. Impfstoffs auftrat. Unter diesen Umständen sollte die Pertussis-Impf. nicht weitergeführt u. die Impfserie mit Diphtherie-, Tetanus-, Hepatitis-B-, Poliomyelitis- u. Hib-Impfstoffen fortgeführt werden. Nicht eingestellte neurolog. Erkrank. od. nicht eingestellte Epilepsie: E. Pertussis-Impfstoff sollte nicht verabr. werden, bis die Behandl. der vorliegenden Erkrank. eingeleitet wurde, sich der Zustand stabilisiert hat u. der Nutzen der Impf. das Risiko deutlich überwiegt. Vorsicht bei: Mittelschwerer od. schwerer akuter Erkrank. mit od. ohne Fieber. Auftreten e. der folg. Ereignisse nach Anw. von pertussishalt. Impfstoff: Temperatur ≥ 40,5 °C innerh. von 48 Stunden, die nicht auf e. andere erkennbare Ursache zurückzuführen war; Kollaps od. schockähnl. Zustand (hypoton-hyporesponsive Episode [HHE]) innerh. von 48 Stunden nach der Impf.; anhaltendes Schreien mit e. Dauer von ≥ 3 Stunden, das innerh. von 48 Stunden nach der Impf. einsetzte; Krampfanfälle mit od. ohne Fieber, die innerh. von 3 Tagen nach der Impf. auftraten. Auftreten e. Guillain-Barré-Syndroms innerh. von 6 Wochen nach e. früheren Verabr. e. Tetanus-Toxoid-haltigen Impfstoffs. Fieberkrämpfen in der Anamnese. Sehr unreifen Frühgeborenen (Geburt ≤ 28. SSW), insbes. mit Lungenunreife in der Vorgeschichte. Genetischem Polymorphismus. Immunsuppressiver Therapie od. Immundefizienz. Kdrn. mit Thrombozytopenie od. Blutgerinnungsstör. Nebenw.: Sehr häufig: Verminderter Appetit. Somnolenz. Erbrechen. Weinen; Reizbarkeit; Erythem/Schmerz/Schwellung an der Injekt.-stelle; Fieber. Häufig: Diarrhoe. Blauer Fleck/Verhärtung/Knötchen an der Injekt.-stelle. Gelegentlich: Rhinitis. Lymphadenopathie. Appetitsteigerung. Schlafstörungen einschl. Schlaflosigkeit; Unruhe. Erniedrigter Muskeltonus. Blässe. Husten. Abdominalschmerz. Ausschlag; Hyperhidrosis. Ausschlag/Wärme an der Injekt.-stelle; Ermüdung. Selten: Überempf.-keit; anaphylaktische Reaktion. Nicht bekannt: Konvulsionen mit od. ohne Fieber; hypotonisch-hyporesponsive Episode (HHE). Im Zusammenhang mit and. Impfstoffen, die dieselben Komponenten od. Bestandt. enth., ungeachtet d. Kausalität od. Häufigk.: Starke Schwellung der geimpften Extremität, die sich von der Injekt.-stelle über ein od. beide benachbarten Gelenke ausdehnt (beginnen innerh. von 24 bis 72 Stunden nach der Impf. u. können mit Erythem, Erwärmung, Druckempf.keit od. Schmerz an der Injekt.-stelle einhergehen). Frühgeborene: Apnoe bei sehr unreifen Frühgeborenen (≤ 28. SSW). Warnhinw.: Für den Fall von selt. anaphylaktischen Reakt. geeignete medizin. Behandlungsmaßn. bereitstellen. Hinw.: Empfindl. Urintests auf Hib können innerh. von mind. 30 Tagen nach der Impf. falsch positiv ausfallen. Zu Kdrn. > 15 Mon. keine Daten. Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Vaxelis® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unternehmer: MCM Vaccine B.V., Robert Boyleweg 4, 2333 CG Leiden, Niederlande; Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstr. 4a, 81673 München MSD Infocenter: Tel. 0800 673 673 673, Fax 0800 673 673 329, E-Mail: infocenter@msd.de Stand: 01/2023 (RCN: 000024527-DE)



Liebe Leserinnen und Leser,

Klimawandel, die zunehmende Ausbreitung von Krankheitsüberträgern wie der Anopheles-Mücke, Antibiotikaresistenzen und ein wachsender Anteil älterer und vorerkrankter Menschen: Infektionskrankheiten werden wohl deutlich zunehmen, der Schutz vor ihnen wird daher immer wichtiger. Das Gute: Viele neue Impfstoffe werden entwickelt (Seite 14), viel getan hat sich etwa bei der RSVPrävention (Seite 18). Das Respiratorische Synzytial-Virus tritt in allen Altersklassen auf, gerade bei Säuglingen ist es ein relevanter Erreger, wie die vergangene Saison einmal mehr gezeigt hat. Schwer verlaufen kann eine RSV-Infektion aber auch bei Älteren - für diese Gruppe wurde kürzlich ein Impfstoff zugelassen. Und auch für Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthma stellt RSV ein Risiko dar. Grundsätzlich ist die Gruppe der Menschen mit Grunderkrankung groß, und natürlich gehören auch viele Jüngere dazu, etwa solche mit Diabetes. Welche Impfungen für sie relevant sein können, lesen Sie auf Seite 4. ▪
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihre Anne Bäurle


Gender-Hinweis: Die Redaktion legt Wert darauf, dass sich alle Menschen durch die publizierten Inhalte angesprochen fühlen. Aus Gründen der Lesbarkeit wird jedoch auf eine konsequente, gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Dies stellt in keiner Weise eine Wertung dar.
12 FSME: Zecken-Speichel im Visier
14 Reiseimpfungen: Was ist in der Pipeline?
18 Es tut sich was in Sachen RSV
22 Impfen bei Kindern: Gut vorbereitet auf Kita und Schule
27 Wie lässt sich mit Impfskeptikern umgehen?
32 Berichte aus der Industrie
Diese Beilage finden Sie auch als E-Paper unter: hausarzt.link/ impfenkompakt2023
Impressum Sonderbeilage in „Der Hausarzt“ 14/2023.
Berichte: Ute Arndt, Anne Bäurle, Sigrid Ley-Köllstadt, Redaktion: Anne Bäurle
Layout: Gabi Kellner
V.i.S.d.P.: Johanna Dielmann-von Berg
Coverillustration: iStock.com/bgblue
Die Herausgeber der Zeitschrift übernehmen keine Verantwortung für diese Inhalte. © mm medizin + medien Verlag GmbH
Gegen Impfungen bei Personen mit chronischen Vorerkrankungen wie Diabetes bestehen immer noch Vorbehalte, und zwar oftmals bei den Patientinnen und Patienten selbst.


Die Bedenken mancher chronisch kranker Personen sind meist darauf zurückzuführen, dass früher einige neurologische Erkrankungen eine Kontraindikation gegen bestimmte Impfstoffe darstellten, beispielsweise für eine Pockenimpfung oder auch für eine Impfung gegen Pertussis mit Ganzkeimimpfstoff. Während der Corona Pandemie wurden wir häufiger von Erwachsenen um Rat wegen einer Covid 19 Impfung gebeten, die aufgrund von Erkrankungen in der Kindheit bisher nicht eine der empfohlenen Standardimpfungen erhalten hatten mit allen daraus resultierenden Risiken für die Betroffenen.
Die Stiko äußert sich in den aktuellen Empfehlungen 2023 unter dem Punkt „Falsche Kontraindikationen“ zu Impfungen bei Personen mit chronischen Krankheiten: „Indizierte Impfungen sollen auch bei Personen mit chronischen Krankheiten – einschließlich neurologischer Krankheiten – durchgeführt werden, da diese Personen durch schwere Verläufe und Komplikationen impfpräventabler Krankheiten besonders gefährdet sind. Personen mit chronischen Krankheiten sollen über den Nutzen der Impfung im Vergleich zum Risiko der Krankheit aufgeklärt werden.

Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, dass eventuell zeitgleich mit der Impfung auftretende Krankheitsschübe ursächlich durch eine Impfung bedingt sein können.“ [1]
Im Folgenden sollen einige Impfungen bei chronischen Erkrankungen und die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorgestellt werden.
Autoimmunerkrankungen und chronisch entzündliche Erkrankungen Autoimmunerkrankungen (z. B. Myasthenia gravis, Multiple Sklerose) sind ebenso wie chronisch entzündliche Erkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen) per se keine Kontraindikation für Impfungen, auch nicht mit Lebendimpfstoffen. Da diese Patientinnen und Patienten jedoch häufig mit immunsupprimierenden Medikamenten therapiert werden, ist diese Medikation eine Kontraindikation für attenuierte Viruslebendimpfstoffe. Der Masern-Mumps-Röteln- und VarizellenImpfstatus sollte daher unbedingt vor Therapiebeginn geprüft und fehlende Impfungen sollten ergänzt werden. Inaktivierte Impfstoffe können auch unter der Gabe von Immunsuppressiva verabreicht wer-

Ley-Köllstadt
Deutsches Grünes
Kreuz e. V., Marburg
E-Mail: sigrid. ley-koellstadt@dgk.de
den, allerdings ist die Immunantwort gegebenenfalls vermindert.
Während Studien bisher keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen einer Impfung und einer neu aufgetretenen Autoimmunkrankheit bzw. einer chronischentzündlichen Erkrankung oder einem Schub einer bereits bestehenden Erkrankung belegen, besteht kein Zweifel daran, dass die entsprechenden Infektionen bei nicht Geimpften zu schweren Verläufen führen, Morbidität und Mortalität erhöhen oder einen Schub auslösen können. Impfungen können somit das Risiko für symptomatische Erkrankungen durch die jeweiligen Erreger und für infektionsgetriggerte Schübe der Grunderkrankung verringern [2].
Die Stiko empfiehlt schon seit vielen Jahren explizit eine Influenza-Impfung für Personen mit chronischen neurologischen Erkrankungen, z. B. Multiple Sklerose mit durch Infektionen getriggerten Schüben. Auch die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) sieht Impfungen als wichtig für die Patientinnen und Patienten an: „Durch Impfungen vermeidbare Infektionen können einerseits schwerwiegende Erkrankungen verursachen, andererseits bei MS-Erkrankten darüber hinaus Schübe
Totimpfstoffe können jederzeit verabreicht werden. Wenn wegen der MS oder einer anderen demyelisierenden Erkrankung eine immunsuppressive Therapie gegeben wird, ist grundsätzlich zu beachten, dass das Impfansprechen auf Totimpfstoffe reduziert sein kann. Lebendimpfstoffe können grundsätzlich auch bei MS gegeben werden, wenn keine Immunsuppression besteht. Während eines Schubs oder unter einer immunsuppressiven Therapie sind Lebendimpfstoffe allerdings kontraindiziert [4].

auslösen und zur Krankheitsverschlechterung beitragen. Dieses Risiko ist in den meisten Fällen höher einzuschätzen als potenzielle Risiken durch Impfungen. MSErkrankte sollten daher entsprechend den von der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts (RKI) empfohlenen Impfungen im Erwachsenenalter geimpft werden“ [3].
Eine immunsuppressive Therapie muss dabei natürlich berücksichtigt werden. Im Raum steht auch immer die Sorge, dass durch Viruslebendimpfstoffe (MasernMumps-Röteln, Varizellen, Gelbfieber) eventuell ein Schub ausgelöst werden könnte, wie dies durch verschiedene Wildviren ja definitiv der Fall ist. Theoretisch ist es denkbar, dass Impfungen einen Schub einer MS auslösen könnten, da sie immunmodulatorisch wirken.


In systematischen Studien und Übersichtsarbeiten konnten aber weder Zusammenhänge zwischen Impfungen (z. B. gegen Hepatitis B, Influenza, Tetanus) und einer Erkrankung an MS noch mit einer Schubauslösung bei bereits diagnostizierter MS beobachtet werden. Nach der GelbfieberImpfung wurden Einzelfälle eines MSSchubes berichtet, allerdings handelte es sich um eine Fallserie mit nur sieben Fäl-

IMPFUNGEN BEI CHRONISCHEN NEUROLOGISCHEN ERKRANKUNGEN, BEI LUPUS ERYTHEMATODES, RHEUMATOIDER ARTHRITIS, CHRONISCHENTZÜNDLICHEN DARMERKRANKUNGEN, DIABETES MELLITUS, COPD UND ASTHMA BRONCHIALE SOWIE CHRONISCHER NIERENINSUFFIZIENZ*
• Tetanus-Diphtherie: alle 5 bis 10 Jahre,
• Pertussis: zumindest einmalig, bei Kontakt zu Neugeborenen oder beruflichem Risiko alle 10 Jahre,
• Poliomyelitis: Grundimmunisierung plus mindestens eine Auffrischimpfung, ggf. Nachholimpfungen ergänzen,
• Influenza: jährlich mit aktuellem quadrivalenten Impfstoff,
• Pneumokokken: mit Polysaccharidimpfstoff, Auffrischimpfungen nach 6 Jahren (bei chronischer Niereninsuffizienz sequenzielles
Schema: Konjugatimpfstoff gefolgt von Polysaccharidimpfstoff nach sechs bis zwölf Monaten),
• Zoster (Totimpfstoff): Stiko-Empfehlung seit Dezember 2018, zwei Impfdosen im Abstand von 2 bis 6 Monaten,
• Covid-19: Grundimmunisierung und jährliche Auffrischimpfung mit angepasstem Impfstoff.
*Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Indikation muss stets individuell gestellt werden und kann auch über die Vorschläge der Stiko hinausgehen (sog. Öffnungsklausel).
len und methodischen Schwächen. Darauf wies das RKI hin, ein kausaler Zusammenhang konnte nicht hergestellt werden [4].
Diabetes mellitus und andere chronische Erkrankungen Diabetiker haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe von Infektionskrankheiten, das hat sich auch während der Covid-19-Pandemie gezeigt. Auch bei Ausbrüchen von anderen Viruserkrankungen wie Influenza waren Zusammenhänge der Glykämielage und der Krankheitsschwere offensichtlich, Diabetespatienten hatten häufiger Komplikationen oder einen schwereren Verlauf [5]. Ein guter Impfschutz ist daher essenziell für diese Patientengruppe: Nicht weniger, sondern mehr Impfschutz lautet die Devise! Daher empfiehlt die Stiko neben
den Standardimpfungen zusätzlich die Impfungen gegen Influenza, Pneumokokken und Herpes zoster (ab 50 Jahren). Auch bei anderen chronischen Erkrankungen, die nicht mit einer Immundefizienz einhergehen, z. B. den chronischen Lungenerkrankungen COPD und Asthma bronchiale, werden zu den empfohlenen Standardimpfungen zusätzlich die Impfungen gegen Influenza, Pneumokokken und Herpes zoster empfohlen.
Die Impfung gegen Zoster mit dem ajduvantierten Totimpfstoff (zwei Dosen im Abstand von zwei bis sechs Monaten) wird als Indikationsimpfung ab 50 Jahren von der Stiko empfohlen. Ab einem Alter von 60 Jahren ist sie eine Standardimpfung. Laut Fachinfo kann die Impfung bereits ab 18 Jahren verabreicht werden, etwa bei schwerer Immundefizienz.
Aktuell wird die Pneumokokken-Impfung von der Stiko bei chronischen Erkrankungen ohne Immundefizienz mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff (PPSV23) empfohlen, mit Auffrischimpfungen im Abstand von sechs Jahren. Da inzwischen auch zwei höhervalente Konjugatimpfstoffe (15- bzw. 20-valent) zugelassen sind, wird diese Stiko-Empfehlung möglicherweise den neuen verfügbaren Impfstoffen angepasst werden.
Eine jährliche Influenza-Impfung mit quadrivalenten Impfstoffen ist für eine große Gruppe von Patientinnen und Patienten mit chronischen Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten empfohlen. Für die Generation 60 + empfiehlt die Stiko die Impfung mit einem HochdosisImpfstoff (4-fache Dosierung), da dadurch die im Alter oft abgeschwächte Immunantwort verbessert werden kann.
Bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfiehlt die Impfkommission neben den Standardimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Poliomyelitis die jährliche Influenza-Impfung und die Impfung mit PPSV23. ▪ Sigrid Ley-Köllstadt
Literatur:
1. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2023, Epid. Bulletin 4/2023.
2. Robert Koch-Institut, “Stellen Autoimmunerkrankungen oder chronisch-entzündliche Erkrankungen Kontraindikationen gegen Impfungen dar?“, Stand 16.7.2020, www.hausarzt.link/JdESb
3. Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), www.hausarzt.link/omc5S sowie www.hausarzt.link/jx9VD
4. Robert Koch-Institut, „Was ist bei Multipler Sklerose (MS) und anderen demyelisierenden Erkrankungen in Bezug auf Impfungen zu beachten?“,Stand 16.7.2020, www.hausarzt.link/4Kv3M
5. Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), Covid-19-Impfung und Diabetes, Stand 15.12.2020.
6. Mitteilung der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim RKI: Wissenschaftliche Begründung zur Empfehlung einer Impfung mit dem Herpes zoster-Subunit-Totimpfstoff, Epid Bull 50/2018.
Mögliche Interessenkonflikte: Die Autorin hat keine deklariert.
FSME *-Impfung – keine Frage des Geschmacks! Zuverlässig LIEFERBAR
Patient:innen in Risikogebieten** jetzt gegen FSME impfen.
Jahre ab16 Jahre
Bei (geplanten) Aufenthalten in deutschen Risikogebieten mit möglicher Zeckenexposition erfolgt die Verordnung von FSME-Impfstoffen auf Sprechstundenbedarf.
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze Wirkstoff: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)-Impfstoff (Ganzvirus, inaktiviert) Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 Impfdosis (0,25 ml) enth. 1,2 µg FSME-Virus (Stamm Neudörfl), adsorb. a. hydratis. Aluminiumhydroxid (0,17 mg Al3+), Wirtssystem f. d. Virusvermehrung: Hühnerembryonal-Fibroblastenzellen (CEF-Zellen). Sonst. Bestandteile: Humanalbumin, Natriumchlorid, Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Sucrose, Wasser f. Inj.-zwecke, hydratis. Aluminiumhydroxid. Anwendungsgebiete: Aktive Immunis. gg. FSME b. Kdrn. u. Jugendl. i. Alter v. 1 - 15 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindl. gg. d. Wirkstoff, e. d. sonst. Bestandt. od. e. d. Produktionsrückstände (Formaldehyd, Neomycin, Gentamycin, Protaminsulfat); weitere Kreuzallergien m. and. Aminoglykosiden mögl. Schwere Überempf. gg. Eiprotein, Hühnereiweiß. Bei moderaten od. schweren akuten Erkrank. (m. od. o. Fieber) FSME-Impfung verschieben. Nebenwirkungen: NW in klin. Studien: Sehr häufig: Reakt. a. d. Inj.-stelle: z. B. Schmerzen a. d. Inj.-stelle. Häufig: vermind. Appetit, Unruhe, Schlafstör., Kopfschmerz, Übelk., Erbr., Myalgie, Pyrexie, Müdigk., Krankheitsgefühl, Reakt. a. d. Inj.-stelle wie: Schwell., Verhärt., Rötung. Gelegentlich: Lymphadenopathie, Bauchschmerzen, Arthralgie, Schüttelfrost. Selten: Wahrnehmungsstör., Benommenh., Schwindel, Diarhrhoe, Dyspepsie, Urtikaria, Juckreiz a. d. Inj.-stelle. Weitere NW n. Markteinf.: Selten: anaphylaktische Reakt., Überempfindlichkeitsreakt., Enzephalitis, Krämpfe (einschl. Fieberkrämpfe), Meningismus, Polyneuropathie, Bewegungsstör. (Halbseitenlähm., halbseit. Gesichtslähm., vollständ. Lähmung, Neuritis), Guillain-Barré-Syndr., Sehverschlechter., Photophobie, Augenschmerzen, Tinnitus, Dyspnoe, Hautausschlag (erythematös, makulär-papulär, vesikulär), Erythem, Juckreiz, Hyperhidrosis, Nackenschmerzen, muskuloskelettale Steifigk. (einschl. Nackensteifigk.), Schmerzen i. d. Extremitäten, Gangstör., grippeähnl. Sympt., Asthenie, Ödeme. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. Stand: Juni 2017
FSME-IMMUN 0,5 ml Erwachsene, Suspension zur Injektion in einer Fertigspritze Wirkstoff: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)-Impfstoff (Ganzvirus, inaktiviert) Zusammensetzung: Wirkstoff: 1 Impfdosis (0,5 ml) enth. 2,4 µg FSME-Virus (Stamm Neudörfl), adsorb. a. hydratis. Aluminiumhydroxid (0,35 mg Al3+) u. hergest. i. Hühnerembryonal-Fibroblastenzellen (CEF-Zellen). Sonst. Bestandteile: Humanalbumin, Natriumchlorid, Di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Sucrose, Wasser f. Inj.-zwecke, hydratis. Aluminiumhydroxid. Anwendungsgebiete: Aktive Immunis. gg. FSME b. Pers. ab 16 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindl. gg. d. Wirkstoff, e. d. sonst. Bestandt. od. e. d. Produktionsrückstände (Formaldehyd, Neomycin, Gentamycin, Protaminsulfat); weitere Kreuzallergien m. and. Aminoglykosiden mögl. Schwere Überempf. gg. Eiprotein, Hühnereiweiß. Bei moderaten od. schweren akuten Erkrank. (m. od. o. Fieber) FSME-Impfung verschieben. Nebenwirkungen: NW in klin. Studien: Sehr häufig: Reakt. a. d. Inj.-stelle: z. B. Schmerzen. Häufig: Kopfschmerz, Übelk., Myalgie, Arthralgie, Müdigk., Krankheitsgefühl. Gelegentlich: Lymphadenopathie, Erbr., Pyrexie, Blutungen a. d. Inj.-stelle. Selten: Überempf., Schläfrigk., Schwindel (nach 1. Impfung), Durchfall, Bauchschmerzen, Reakt. a. d. Inj.stelle wie: Rötung, Verhärt., Schwell., Juckreiz, Missempfind., Wärmegefühl. Weitere NW n. Markteinf.: Selten: Herpes zoster (b. präexpon. Pat.), Auftreten od. Verschlimmer. v. Autoimmunerkrank. (z. B. MS), anaphylaktische Reakt., demyelinis. Erkrank. (akute dissemin. Enzephalomyelitis, GuillainBarré-Syndr., Myelitis, Myelitis transversa), Enzephalitis, Krämpfe, asept. Meningitis, Meningismus, Stör. d. Sinnesempfind. u. Bewegungsstör. (Gesichtslähm., Lähmung/Parese, Neuritis, Hypästhesie, Parästhesie), Neuralgie, Sehnerventzünd., Benommenheit, Sehverschlechter., Lichtscheu, Augenschmerzen, Tinnitus, Tachykardie, Dyspnoe, Urtikaria, Hautausschlag (erythematös, makulo-papulös), Juckreiz, Dermatitis, Erythem, Hyperhidrosis, Rückenschmerzen, Gelenkschwell., Nackenschmerzen, muskuloskelettale Steifigk. (einschl. Nackensteifigk., Schmerzen i. d. Extremitäten, Gangstör., Schüttelfrost, grippeähnl. Sympt., Asthenie, Ödeme, Bewegungseinschränk. e. Gelenks a. d. Inj.-stelle wie Gelenkschmerz, Knötchen u. Entzünd. Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. Stand: Januar 2020



Seit der Covid-19-Pandemie hat sich gezeigt, wie viele offene Fragen es bei immunsupprimierten Patientinnen und Patienten nicht nur in Bezug auf die innovativen Covid-19-Impfstoffe gibt. Auch in der Ärzteschaft bestehen Fragen nach dem korrekten Vorgehen.
Man könnte fast meinen, bei diesem Thema wird nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ gehandelt, diesen Schluss jedenfalls lassen im Allgemeinen die Impfraten bei chronisch Kranken zu. Die Verunsicherung in Bezug auf Impfungen ist speziell in der Patientengruppe mit Immunstörungen von jeher besonders hoch. Aber gerade sie – mit primärer oder sekundärer Immundefizienz – benötigen nicht weniger, sondern mehr Impfschutz. Denn es besteht häufig eine erhöhte Infektionsgefährdung, und dabei auch durch impfpräventable Erkrankungen und deren Komplikationen, allen voran Pneumokokken und Influenza oder auch Covid19. Grundsätzlich bedarf es der Kenntnis der zugrunde liegenden Immunstörung oder bei einer iatrogenen Immunsuppression der Einschätzung des Grades der Immunsuppression durch das jeweilige immunsuppressive Medikament. Denn nicht jeder Immundefekt bzw. jede immunsupprimierende Therapie stellen für jegliche Impfung eine Kontraindikation dar. Man denke etwa an Patienten mit HyperIgESyndrom, bei denen sogar die MMR und Varizellenimpfung möglich und empfohlen ist, und auch bei reinen Komplementdefekten sind Lebendimpfstoffe möglich [1].
Dasselbe gilt für eine niedrigdosierte oder eine topische Kortikoidtherapie (siehe Info-Kasten rechts) oder Therapeutika, die bei Autoimmunerkrankungen Anwendung finden, beispielsweise Hydroxychloroquin oder Sulfasalazin, die keine relevante Immunsuppression bewirken.
Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
In vier im Bundesgesundheitsblatt (BGBl) zwischen den Jahren 2017 und 2020 veröffentlichten Papieren [1] haben Expertinnen und Experten die medizinwissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema recherchiert und auf Basis der geltenden Stiko-Empfehlungen Anwendungshinweise erstellt, die eine ausgezeichnete Basis für die Impf-Entscheidungsfindung bilden (Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um Stiko-Empfehlungen gemäß §20 Abs. 2 Infektionsschutzgesetzt).
In den Papieren II bis IV finden sich auch Hinweise zu Reiseimpfstoffen bei den einzelnen Patientengruppen; diese werden ergänzt durch die Empfehlungen der Stiko und der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globalen Gesundheit (DTG) zu Reiseimpfungen [2]. Hierin werden auch Abweichungen vom Standardvorgehen vorgeschlagen, beispielsweise zur Hepatitis A-Impfung bei Immundefizienz: „Bei der Impfung gegen Hepatitis A wird bei der Gabe der 1. monovalenten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung eine zusätzliche Impfstoffdo -
1. Therapien bzw. Grunderkrankungen mit erwartbar geringer Einschränkung der Impfantwort:
a. Dimethylfumarat; Typ I Interferon (IFN- β )
b. Systemische, kurzzeitige (< 2 Wochen) Glukokortikoidtherapie mit geringer Dosierung (Erwachsene < 10 mg Prednisolonäquivalent/Tag)
c. Niedrigpotente Immunsuppressiva wie MTX (Erwachsene ≤ 20 mg/Wo)
d. Niedrigpotente Biologika wie z.B. anti-TNF- α (Infliximab) in geringer Dosierung ( ≤ 3 mg/kg alle 8 Wochen)
2. Erkrankungen mit erwartbar relevanter Einschränkung der Impfantwort:
a. Autoimmunkrankheiten (ohne Therapie) wie rheumatoide Arthritis, SLE, MS; chronisch entzündliche Darmerkrankungen
3. Therapien mit relevanter Einschränkung der Impfantwort:
a. Systemische Glukokortikoidtherapie mit intermediärer Dosierung (10 – 20 mg Prednisolonäquivalent/Tag > 2 Wochen) oder hoher Dosierung (> 1 mg Prednisolonäquivalent/kg/Tag > 2 Wochen) oder i.v.-Stoßtherapie mit sehr hohen Dosen (z. B. 10 – 20 mg/kg/Tag Prednisolonäquivalent über 3 – 5 Tage in monatlicher Wiederholung)
b. MTX: Erwachsene > 20 mg/Woche; Azathioprin ≥ 3 mg/kg/Tag
c. Biologika mit schwerer immunsuppressiver Wirkung wie anti-CD-20-Antikörper (B-Zell-Depletierung); CTLA4-Ig, Fingolimod

4. Erkrankungen, die direkt oder infolge der notwendigen Therapie mit einer relevanten Einschränkung der Impfantwort einhergehen:
a. Z. n. Organtransplantation
b. Hämodialysepatienten
c. Krebserkrankungen unter immunsuppressiver, antineoplastischer Therapie
sis eines monovalenten Impfstoffs vor Abreise empfohlen. Die zwei Impfstoffdosen können sowohl am gleichen Tag als auch im Abstand von einem Monat gegeben werden. In beiden Fällen ist zur Vervollständigung der Grundimmunisierung eine 3. Impfstoffdosis im Mindestabstand von sechs Monaten empfohlen."
Darüber hinaus hat die Stiko im September 2021 erstmals Empfehlungen [3] zum Vorgehen bezüglich der Covid-19-Impfung gegeben, die sich an den o.g. vier Veröffentlichungen des BGBl orientieren; die Covid-Impfempfehlungen wurden anschließend immer wieder aufgrund neuer Erkenntnisse aktualisiert [4].
Nachfolgend können nur einige besondere Aspekte zur Impfung Erwachsener aus diesem sehr umfangreichen Themenkomplex angesprochen werden, die in der hausärztlichen Praxis aber von Relevanz sein dürften. Gerade bei Tumorpatienten sollten Impfungen in Absprache mit den onkologisch betreuenden Ärzten und Zentren erfolgen [5].
Impfungen bei antineoplastischer Therapie Notwendige Impfungen zum Schließen von Impflücken noch vor Beginn einer antineoplastischen Therapie [5] zu geben wäre sinnvoll, oft aber sind die Impfpläne
zumindest nicht mehr vollständig umzusetzen. Falls möglich, sollten Totimpfstoffe spätestens zwei Wochen, Lebendimpfstoffe (wie MMR) sechs Wochen vor Therapiebeginn erfolgen. Hierbei sind fällige Auffrischimpfungen oder die Impfungen gegen Pneumokokken, Influenza (saisonal) oder Herpes zoster zu nennen. Indiziert ist die Hib-Impfung auch bei Erwachsenen, die in der Regel nicht dagegen geimpft sind, denn es tritt unter antineoplastischer Therapie häufiger eine Hibassoziierte Pneumonie auf. Besteht aufgrund häufiger Bluttransfusionen oder durch andere erkrankungsbedingte Faktoren ein erhöhtes Infektionsrisiko, sind auch die Impfungen gegen Hepatitis B und Hepatitis A sinnvoll. Impfungen unter einer antineoplastischen Therapie sind mit inaktivierten Impfstoffen bei entsprechender Indikation möglich, allerdings ist hierbei die reduzierte Impfantwort zu berücksichtigen. Beispiele sind die sequenzielle PneumokokkkenImpfung (Konjugatimpfstoff + PPSV23 im Abstand von sechs bis zwölf Monaten) oder die Influenza-Impfung. Nach Expertenkonsens sollen nach antineoplastischer Therapie einmalige Wiederholungsimpfungen erfolgen [4]. Frühestens drei Monate nach Therapieende ist dies mit Totimpfstoffen möglich. Dabei können ggf. auch Fünf- oder Sechsfach-Kombinationsimpfstoffe, also TDaP-IPV-Hib oder TDaP-IPV-Hib-HB, nach ausführlicher Aufklärung im Off-Label-Use erfolgen, um Patienten mehrfache Impfungen zu ersparen (zumal auch ein Hib-Einzelimpfstoff nur über die Auslandsapotheke beschafft werden kann). Diese Wiederholungsimpfungen sollen unabhängig von möglicherweise gemessenen Antikörperkonzentrationen oder vorausgegangenen Auffrischimpfungen erfolgen. Eine Hepatitis-B-Wiederholungsimpfung sollte bei Indikation erfolgen und vier bis acht Wochen später auch der Titer kontrolliert werden. Eine Serologie zur Überprüfung des Erfolgs einer Covid-19-Impfung wird zwar
Empfehlung aus den Anwendungshinweisen: Pertussis-Impfung bei Kontakpersonen nach zehn Jahren wiederholen.
nicht grundsätzlich empfohlen, da bisher kein Korrelat existiert. Aber bei immundefizienten Personen können die Ergebnisse der Antikörperkinetik für das Vorgehen hilfreich sein, um gegebenenfalls weitere Impfungen (höhere Dosis eines mRNAImpfstoffs, Wechsel zu anderen Impfstofftypen) in Erwägung zu ziehen [3, 4].
Wenn nicht vor der Therapie gegen Zoster geimpft wurde, können zwei Impfstoffdosen wie üblich verabreicht werden, zudem ist die Meningokokken-B- und -ACWY-Impfung für die therapierten Patientinnen und Patienten empfohlen. Abweichend von der Fachinformation sollte die MenACWY aber zweimal im Abstand von vier bis acht Wochen geimpft werden, wenn zuvor nicht dagegen geimpft wurde. Da eine antineoplastische Therapie zu einer anhaltenden Immunsuppression führt, ist die Gabe von Lebendimpfstoffen erst frühestens sechs Monate nach Ende der Therapie erlaubt. Auch wenn eine Grundimmunisierung gegen Masern, Mumps und Röteln vorliegt, soll nach Expertenmeinung eine einmalige Wiederholungsimpfung erfolgen. Das Gleiche gilt auch für den Varizellenschutz: eine Wiederholungsimpfung für vollständig geimpfte Personen als auch bei anamnestisch dokumentierter Varizellen-Erkrankung.
Umgebungsprophylaxe wird oft vergessen!
Ein Aspekt, der leicht in Vergessenheit gerät, aber zusätzliches Potenzial bietet, ist
Dr. Ute Arndt

Deutsches Grünes
Kreuz e.V., Marburg E-Mail: Ute.Arndt@dgk.de
die Impfung von Kontaktpersonen. Dies findet auch stets in den verschiedenen Stiko-Empfehlungen Erwähnung, allen voran bei der Influenza-Impfung. Der indirekte Schutz für die Betroffenen, die in ihrem Umfeld auf ein optimal geimpftes Gegenüber treffen, bedeutet zusätzliche Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. Dies gilt insbesondere für die Immunität gegen Masern, Mumps, Röteln und Varizellen. Außerdem wird – abweichend von den Stiko-Empfehlungen – für Kontaktpersonen die Pertussis-Auffrischimpfung in zehnjähriger Wiederholung empfohlen [4; 5]. ▪ Ute Arndt

Literatur:
1. Ständige Impfkommission www.stiko.de. Empfehlungen der Stiko, weitere Mitteilungen der Stiko unter Stichwort „Immundefizienz“ www.hausarzt.link/RVi5b
2. Empfehlungen der Stiko und der DTG zu Reiseimpfungen, Epid Bull 14/2023, www.hausarzt.link/Nxwui
3. Stiko-Empfehlung zur Covid-19-Impfung bei Personen mit Immundefizienz und die dazugehörige wissenschaftliche Begründung. Epid Bull 39/2021
4. Siehe dazu die Übersichtseite zu Covid-19 beim RKI, www.hausarzt.link/95SK9
5. Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (III) Impfen bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen (neoplastische Therapie, Stammzelltransplantation), Organtransplantation und Asplenie. Bundesgesundheitsblatt 5/2020 www.hausarzt.link/vd82G und Erratum, Juli 2020, unter www.hausarzt.link/GtEbw
Mögliche Interessenkonflikte: Die Autorin hat keine deklariert.
GARDASIL® 9 kann (Mädchen und Jungen) Impfschutz vor HPV-assoziierten Vorstufen maligner Läsionen und Karzinomen an der Zervix, Vulva, Vagina und Anus sowie vor Genitalwarzen bieten.1











Die STIKO emp ehlt die HPV-Impfung als Standardimpfung im Alter von 9 –14 Jahren für alle Mädchen und Jungen sowie die Nachholimpfung vor dem 18. Geburtstag.2




Informationen zu GARDASIL® 9 nden Sie hier: https://m.msd.de/gardasil9







GARDASIL® 9 Injektionssuspension




GARDASIL® 9 Injektionssuspension in einer Fertigspritze
Wirkstoff: 9-valenter Humaner Papillomvirus-Impfstoff (rekombinant, adsorbiert) Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Dosis (0,5 ml) enthält ca.: 30 μg HPV-Typ 6 L1-Protein, 40 μg HPV-Typ 11 L1-Protein, 60 μg HPV-Typ 16 L1-Protein, 40 μg HPV-Typ 18 L1-Protein, 20 μg HPV-Typ 31 L1-Protein, 20 μg HPV-Typ 33 L1-Protein, 20 μg HPV-Typ 45 L1-Protein, 20 μg HPV-Typ 52 L1-Protein, 20 μg HPV-Typ 58 L1-Protein, adsorbiert an amorphes Aluminiumhydroxyphosphatsulfat-Adjuvans (0,5 mg Al); L1-Proteine in Form von virusähnlichen Partikeln, hergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 [Stamm 1895]) mittels rekombinanter DNA-Technologie. Sonst. Bestandt.: Natriumchlorid, Histidin, Polysorbat 80, Natriumtetraborat x 10 H2O, Wasser für Injektionszwecke. Anw.: Aktive Immunisierung von Pers. ab 9 J. gg. folg. HPV-Erkrank.: Vorstufen malig. Läsionen u. Karzinome, die d. Zervix, Vulva, Vagina u. d. Anus betreffen u. d. durch d. ImpfstoffHPV-Typen verursacht werden; Genitalwarzen (Condylomata acuminata), d. durch spezifische HPV-Typen verurs. werden. GARDASIL® 9 sollte entspr. den offiziellen Impfempf. angew. werden. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. die Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt.; Überempf. nach e. früh. Gabe von GARDASIL®/SILGARD® oder GARDASIL® 9. Vorsicht bei: Akute, schwere, fieberhafte Erkrankung (Impfung sollte verschoben werden). Eingeschr. Immunantwort (aufgr. einer Ther. mit stark wirks. Immunsuppressiva, e. genet. Defekts, e. HIV-Infekt. od. and. Ursachen). Thrombozytopenie od. and. Blutgerinnungsstör. Pers., d. innerh. 3 Mon. vor Impfung Immunglobuline od. Blutprod. erh. haben. Geimpfte Pers. (bes. Jugendl.) f. ca. 15 min nach Impf. beobachten. Auftreten v. Synkopen, manchmal m. Stürzen verbunden mgl., i. der Erholungsphase neurolog. Sympt. (wie vorübergehende Sehstör., Parästhesie u. ton.-klon. Beweg. d. Gliedmaßen) mgl. Vorsichtsmaßn. gg. Verletzungen d. Ohnmacht ergreifen. Nebenw.: Sehr häufig: Kopfschmerzen. An der Injekt.-stelle: Schmerzen, Schwellung, Erythem. Häufig: Schwindel. Übelk. Fieber; Abgeschlagenh.; an der Injekt.-stelle: Pruritus, Einblutung. Gelegentlich: Lymphadenopathie. Synkope, manchmal begleitet von tonisch-klonischen Bewegungen. Erbrechen. Urtikaria. Arthralgie; Myalgie. Asthenie; Schüttelfrost; Unwohlsein. Selten: Überempf.-keit. Nicht bekannt: Anaphylaktische Reakt. Nach Markteinführung d. 4v-HPV-Impfstoffs (Häufigk. nicht bekannt): Zellulitis a. d. Injekt.-stelle. Idiopathische thrombozytopen. Purpura. Anaphylaktoide Reakt.; Bronchospasmus. Akute dissem. Enzephalomyelitis; Guillain-Barré-Syndrom. Hinw.: Nicht intravasal, subkutan od. intradermal verabr. Keine Daten zur Austauschbark. mit bivalenten od. tetravalenten HPV-Impfstoffen. Hinw. zu Schwangerschaft beachten. Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von GARDASIL® 9 die Fachinformation! Pharmazeutischer Unternehmer: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Niederlande; Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstr. 4a, 81673 München


Zecken können jede Menge Viren und Bakterien übertragen. Um nicht für jeden Erreger eine einzelne Impfung entwickeln zu müssen, haben Forscherinnen und Forscher den Zecken-Speichel ins Auge gefasst – als eine Art „Universal-Antigen“.
All diesen Erregern macht es die Zecke leicht. Denn im Speichel der Spinnentiere befinden sich Inhaltsstoffe, die die menschliche Immunantwort unterdrücken – Bakterien und Viren können sich so leichter ausbreiten. Und hier kommt die Idee eines „Anti-Zecken-Impfstoffs“ ins Spiel - eine Vakzine mit Bestandteilen des Zeckenspeichels als Antigen. Nach einer Immunisierung mit einem solchen Impfstoff soll das Immun system bei einem Zeckenstich schnell Alarm schlagen und den Erreger (egal ob es sich um das FSME-Virus oder

Borrelia burgdorferi, den Erreger der LymeBorreliose, handelt) eliminieren. Ein Beispiel für eine solche Vakzine ist der experimentelle mRNA-Impfstoff „19ISP“, der bisher allerdings nur an Meerschweinchen erprobt wurde [2]. Entwickelt wurde er an der Universität Yale. 19ISP enthält die Bauanleitung für 19 Proteine im Speichel von Ixodes scapularis (die in den USA beheimatete Hirschzecke, dort ein häufiger Überträger der Lyme-Borreliose).
Idee scheint zu funktionieren
In Versuchen mit Meerschweinchen, die zuvor mit 19ISP immunisiert worden waren, zeigte sich schon kurz nach dem Zeckenstich eine Immunreaktion in Form eines Erythems – für das Team ein Hinweis auf eine erworbene Zecken-Immunität (eine solche ist auch von Menschen bekannt, die mehrfach von einer Zecke gestochen wurden, vgl. [3]). Die Zecken beendeten ihre Blutmahlzeit vorzeitig und fielen schneller wieder ab als bei den Kontrolltieren. Ein weiteres positives Ergebnis zeigten Versuche, bei denen mit B. burgdorferi infizierte Zecken eingesetzt wurden. Da Menschen häufig eine Zecke entfernen, sobald der Stich Rötungen oder Juckreiz verursacht, entfernte auch das Team die Zecken, sobald bei den Meerschweinchen nach dem Stich eine Rötung auftrat. Drei Wochen später wurde bei fast der Hälfte (46 Prozent) der nicht mit 19ISP immunisierten Tiere eine Borreliose-Infektion per PCR-Test nachgewiesen. Im Gegensatz dazu war keines der immunisierten Tiere PCR-positiv. Der Ansatz scheint also zu funktionieren – sein Vorteil ist, dass er einen breiteren Schutz bieten könnte als eine Vakzine, die gegen einen bestimmten Erreger gerichtet ist. Das ist etwa der Fall bei dem Impfstoffkandidaten „VLA15“, der gezielt B. burgdorferi ins Visier nimmt. Die Subunit-Vakzine ist gegen sechs Serotypen des Erregers gerichtet, die in den USA und Europa am häufigsten vorkommen. Derzeit wird sie in einer Phase-III-Studie geprüft, laut der beiden Hersteller Pfizer und Valneva könnte 2025
• Ansatz: Die Vakzine enthält Bestandteile des Zeckenspeichels als Antigen. Bei einem Zeckenstich kommt es zu einer raschen Immunreaktion, Erreger werden schnell erkannt und eliminiert.
• Vorteil: Impfung wirkt unabhängig vom Erreger. Eine solche Vakzine könnte zudem künftige FSME- und Borreliose-Impfstoffe verstärken und die Schutzwirkung verbessern.
• Entwicklungsstand: Bisher nur im Tierversuch erprobt, aber mit positiven Ergebnissen.
ein Zulassungsantrag gestellt werden. Zuletzt musste allerdings die Hälfte der bereits rekrutierten Probanden von der Phase-IIIStudie ausgeschlossen werden. Grund seien Verstöße gegen den Good Clinical PracticeStandard an bestimmten klinischen Prüfzentren, berichteten die Hersteller.
Schlechte Impfquote in FSMERisikogebieten
Viel Erfahrung hat man in Deutschland dagegen mit der seit über 30 Jahren verfügbaren FSME-Impfung. Die Impfquoten sind aber eher schlecht. Wie das Robert KochInstitut (RKI) Anfang des Jahres gemeldet hat, schwankte 2020 die kreisbezogene Impfquote innerhalb der Risikogebiete zwischen lediglich 7,5 und 39,1 Prozent bei Erwachsenen und bei Kindern zwischen 14,1 und 52,4 Prozent [4]. Besonders niedrig war die Quote bei den über 60-Jährigen, bei denen FSME oft schwerer verläuft. Das mag auch an den vergleichsweise eher niedrigen Fallzahlen liegen (2022 wurden 546 FSME-Erkrankungen berichtet). Dennoch handelt es sich um eine impfpräventable Erkrankung, die zudem schwer oder tödlich verlaufen kann. Das verdeutlichen auch RKI-Zahlen aus dem vergangenen Jahr: 98 Prozent der FSME-Patientinnen und -Patienten waren gar nicht oder nur unzureichend geimpft. Die Hälfte der an das RKI gemeldeten Fälle zeigte ein klinisches Bild mit neurologischen Manifestationen einer Meningitis, Enzephalitis oder
Myelitis. Zwei Menschen starben, einer war über 80, der zweite über 60 Jahre alt. Zudem nimmt die Zahl der FSME-Risikogebiete weiter zu. Will man auf der Karte etwa in Baden-Württemberg und Bayern Regionen finden, die kein Risikogebiet sind, muss man tatsächlich mit der Lupe suchen. In Baden-Württemberg gibt es nur noch einen einzigen Stadtkreis, der nicht als Risikogebiet gilt (Heilbronn), in Bayern sind es zwei (Augsburg und Schweinfurt). Kürzlich hat das RKI drei neue Risikogebiete benannt: Den Stadtkreis München und den Landkreis Fürstenfeldbruck in Bayern sowie den Landkreis Anhalt-Bitterfeld in SachsenAnhalt. Wer hier wohnt oder arbeitet und zecken exponiert ist, dem empfiehlt die Stiko die FSME-Impfung. Der Klimawandel führt zudem dazu, dass einige Zecken schon im Februar wieder aktiv werden. Damit wird auch der Zeitraum größer, in dem FSME als meldepflichtiges Ereignis im Blick behalten werden sollte. Grundsätzlich tritt die Mehrheit der Infektionen zwischen Mai und Oktober auf. Frühjahr und Sommer sind also immer gute Zeitpunkte, um die FSME-Impfung zu überprüfen. ▪
Anne BäurleQuellen:
1. Versorgungsatlas-Bericht Nr. 21/06; DOI: 10.20364/VA-21.06
2. Sci Transl Med 2021;13:620; DOI: 10.1126/scitranslmed.abj9827
3. Parasite Immunol. 2021;43(5):e12808; DOI: 10.1111/pim.12808
4. Epid Bull 9/23

Dengue-, Chikungunya- oder Zika-Virus: Bei der Prävention von Arbovirus-Infektionen zeigen sich in der Reisemedizin echte Lichtblicke. Auch für die Beratung von älteren Reisenden gibt es Neuerungen.
Oben: Das Dengue-Virus gehört zur Gruppe der Arboviren, und in dieser Gruppe zur Familie der Flaviviren; Links: Die Tigermücke ist ursprünglich in Süd- und Südostasien beheimatet.

Als eine vom Westen weitgehend ignorierte Pandemie bezeichnete Professor Tomas Jelinek das Dengue-Fieber. „Uns betrifft Dengue-Fieber eigentlich nur, wenn wir in den Urlaub fliegen“, sagte der Reisemediziner beim diesjährigen Forum Reisen und Gesundheit. Ganz anders sieht die Situation für Menschen in den Tropen und Subtropen aus: Seit Jahren nehmen Infektionen mit dem Dengue-Virus zu, allein in Brasilien wurden im vergangenen Jahr mehr als 2,2 Millionen Fälle gemeldet. Für Reisende gab es bisher keinen Impfstoff gegen das Dengue-Virus. Das hat sich Ende 2022 geändert – für Jelinek „ein echter Lichtblick“. Im Dezember wurde die lebend-attenuierte Vakzine Qdenga® gegen
alle vier Virus-Serotypen für Menschen ab vier Jahren zugelassen. In den zulassungsrelevanten Studien lag die Schutzwirkung des Impfstoffs vor einer Infektion bei 80,2 Prozent über zwölf Monate. Noch höher lag der Schutz vor Hospitalisierung, nämlich bei rund 90 Prozent. „Wichtig ist, dass die Schutzwirkung sowohl für Seronegative als auch Seropositive nachgewiesen wurde“, so Jelinek. Bei Dengvaxia®, dem bisher in der EU zugelassenen Impfstoff gegen Dengue-Fieber (der allerdings nur an Menschen verimpft werden kann, die in europäischen Endemiegebieten leben, und daher für die Reisemedizin keine Bedeutung hat) lag die Schutzwirkung laut Jelinek bei Seronegativen bei lediglich 20 Prozent, bei Seropositiven bei 60 Prozent. „Man muss es einfach sagen: Diese Antikörper sind nicht protektiv.“
Womöglich lebenslanger Schutz vor Dengue
Bei der neuen Vakzine Qdenga® zeige sich jedoch ein kleines Problem, wenn
man auf die Schutzwirkung bei den jeweiligen Virus-Serotypen schaue, gab Jelinek zu. Zum einen habe in den Studien (noch) keine Schutzwirkung gegen den Serotyp DENV-4 nachgewiesen werden können –allerdings nur, weil es im Studienzeitraum zu wenig DENV-4-Infektionen gab. Der Trend sei da, aber er sei bisher nicht signifikant. „Beim Serotyp DENV-3 dagegen wurde bei Nicht-Immunen tatsächlich keine Schutzwirkung nachgewiesen. Woran das liegt, wissen wir nicht.“ Würde er trotzdem jemanden impfen, der in ein DENV-3-Ausbruchsgebiet reist? „Auf jeden Fall, es gibt ja auch die anderen Serotypen, und hier schützt die Vakzine.“ Grundsätzlich bespreche er mit allen Reisenden, die in Dengue-Endemiegebiete reisen, die Impfung. Ein weiterer kleiner Minuspunkt: Daten für ältere Erwachsene und Immunsupprimierte liegen noch nicht vor. Auf der Positivseite hob Jelinek hervor, dass es bei einer Nachbeobachtung über fünf Jahre bisher kein Sicherheitssignal gegeben habe, das Nebenwirkungspro-
Pneumokokken-
Enthält 20 Pneumokokken-Serotypen1

Aktive Immunisierung zur Prävention von invasiven Erkrankungen und Pneumonie
bei Erwachsenen1,a
Ein Konjugatimpfstoff ermöglicht die Bildung eines immunologischen Gedächtnisses und kann damit eine verstärkte Immunantwort hervorrufen.
APEXXNAR ® STEHT FÜR EINE BREITE SEROTYPENABDECKUNG IN KOMBINATION MIT DEN EIGENSCHAFTEN EINES KONJUGATIMPFSTOFFS.
a Verursacht durch die enthaltenen Pneumokokken-Serotypen.
1 Fachinformation Apexxnar®, Stand 12/2022.
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

Apexxnar® Injektionssuspension in einer Fertigspritze Pneumokokkenpolysaccharid-Konjugatimpfstoff (20-valent, adsorbiert)
Zusammensetzung: Wirkstoffe: 1 Dosis (0,5 ml) enth.: Pneumokokkenpolysaccharid, Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F: je 2,2 µg; Serotyp 6B: 4,4 µg; jeweils konjugiert an CRM197-Trägerprotein (ca. 51 µg pro Dosis) und adsorbiert an Aluminiumphosphat (0,125 mg Aluminium pro Dosis). Sonst. Bestandteile: Natriumchlorid, Bernsteinsäure, Polysorbat 80, Wasser f. Inj.-zwecke. Anwendungsgebiete: Aktive Immunisierung z. Prävention v. invasiven Erkrank. u. Pneumonie, d. durch S. pneumoniae verursacht werden, b. Personen ab e. Alter v. 18 Jahren. Die Anwend. v. Apexxnar® sollte gemäß offiziellen Empfehl. erfolgen. Gegenanzeigen: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoffe, gg. e.d. sonstigen Bestandteile od. gg. Diphtherie-Toxoid. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen; Gelenkschmerz, Muskelschmerz; Schmerzen/Druckempfindlichk. an d. Impfstelle, Ermüd. Häufig: Induration/Schwell. an d. Impfstelle, Erythem an d. Impfstelle, Fieber. Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreakt., einschl. Gesichtsödem, Dyspnoe, Bronchospasmus; Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen; Ausschlag, Angioödem; Pruritus an d. Impfstelle, Lymphadenopathie, Urtikaria an d. Impfstelle, Schüttelfrost. Häufigkeit nicht bekannt: Vermind. Appetit; eingeschränkte Beweglichk. d. Arms. Nebenw. die auch b. Apexxnar® auftreten könnten: Anaphylaktische/anaphylaktoide Reakt., einschl. Schock; Erythema multiforme; Dermatitis an der Impfstelle. Bei gleichz. Gabe mit COVID-19-mRNA-Impfst.: zusätzl. Schwindelgefühl (gelegentlich). Weitere Informationen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. Abgabestatus: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgien. Repräsentant in Deutschland: PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. Stand: Dezember 2022. b-3v2pv20-sui-0
Mögliche Symptome einer DenguevirusInfektion, die bei einem Teil der Infizierten schwer verlaufen kann. Die meisten Menschen erkranken allerdings ohne Symptome oder haben einen milden Krankheitsverlauf.
FEBRILE PHASE
Kopfschmerz
Fieber
Schmerzen hinter den Augen
Blutungen aus Mund und Nase
Muskel- und Gelenkschmerzen
fil liege auf Placeboniveau. Jelinek: „Bei Dengvaxia® gab es ja zum Teil schwere Nebenwirkungen bei Nicht-Immunen, das gibt es bei Qdenga® schlichtweg nicht.“ Für den vollständigen Impfschutz muss Qdenga® laut Zulassung zweimal im Abstand von drei Monaten verimpft werden. „Wobei explorative Daten zeigen, dass der Impfabstand auch verlängert werden kann. Ob die zweite Dosis nach drei oder zwölf Monaten verimpft wird, macht offenbar keinen Unterschied“, erklärte der Reisemediziner. Zu möglicherweise nötigen Booster-Impfungen liefen derzeit Studien. Jelinek: „Ein Schutz über fünf Jahre ist belegt, einen Schutz über zehn Jahre kann man – würde ich sagen – versprechen, und ich glaube, die Schutzwirkung hält sogar lebenslang.“
Lichtblick bei Chikungunya und Zika
Einen positiven Lichtblick für die Reisemedizin sieht Jelinek auch in zwei Impfstoffkandidaten gegen das ChikungunyaFieber. Der Impfstoffhersteller Valneva hat eine lebend-attenuierte Vakzine („VLA1553“) entwickelt, die nur einmal verimpft werden muss und in Studien eine Immunogenität von 98 Prozent (Serokonversionsrate) gezeigt hat, so der Medizinische Direktors des BCRT Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin. Protektive Effektivitätsdaten liegen derzeit noch nicht vor – „Das ist bei Chikungunya aber auch schwer, weil Infektionen
Erbrechen Diarrhö
Hautausschlag
eher in Ausbrüchen stattfinden. Vermutlich sind die Daten zur Immunogenität für die Behörden bei diesem eher einfachen Virus aber ausreichend.“ Die Vakzine könnte daher schon Anfang 2024 zugelassen werden, ein Zulassungsantrag liegt der europäischen Arzneimittelbehörde EMA bereits vor. Auch der zweite Kandidat "CHIKV-VLP/PXVX0317" – ein Totimpfstoff, der virus-like particles (VLP) enthält – muss nur einmal verimpft werden. „Einer von beiden, vielleicht auch beide werden in der nächsten Zeit kommen. Dann müssen wir über die Indikation reden.“ Daneben befindet sich auch ein Bündel von Impfstoffkandidaten gegen das ZikaVirus in der Pipeline, einer wohl bereits in Phase-III, berichtete Jelinek weiter. Mit der Zulassung rechnet er allerdings frühestens 2026/2027. „Damit stehen uns dann wirklich so einige Impfstoffe gegen Arbo-
KRITISCHE PHASE
Hypotonie
Pleuraerguss
Gastrointestinale Blutungen
Aszites
ERHOLUNGSPHASE
Krampfanfall
Bewusstseinsveränderung
Bradykardie
Juckreiz
viren zur Verfügung, die uns in der Reisemedizin ja so umtreiben.“
Neue Stiko-Empfehlung zu Gelbfieber Bei der Gelbfieber-Impfung habe es eine anhaltende Diskussion darum gegeben, ob man die Vakzine an Menschen über 60 Jahren verimpfen kann oder nicht. „Mittlerweile ist die Datenlage relativ klar: Es gibt keine Assoziation zwischen der sehr wohl möglichen Komplikation eines Impfgelbfiebers und dem Alter.“ Neu im StikoImpfkalender 2023 erfasst ist die Empfehlung, vor erneuter oder bei fortgesetzter Exposition den Impfschutz nach frühestens zehn Jahren aufzufrischen. Jelinek: „Grund für die Empfehlung waren Studiendaten, die abnehmende Antikörper-Spiegel gezeigt haben. Das ist aber gar nicht der Punkt, sondern die Frage, ob Geimpfte genug Gedächtniszellen haben und ob
die Gedächtniszellen boosterfähig sind. Und da haben wir überhaupt keinen Grund für die Annahme, dass Immunkompetente, die einmal geimpft sind, nicht geschützt sind.“ Die Empfehlung habe daher nur unnötig Unsicherheiten geschürt, kritisierte der Reisemediziner.
Neues zu Hepatitis B und Tollwut
Der neue adjuvantierte HepB-Impfstoff Heplisav-B® sei mittlerweile auf dem Markt verfügbar. Sein Vorteil: Er muss nur zweimal verimpft werden, wobei schon nach der ersten Impfung eine gute Immunantwort erreicht wird – ein großer

zur Verfügung stehen, die uns in der Reisemedizin ja so umtreiben.
Vorteil in der Reisemedizin. Zudem erreiche die Vakzine im Vergleich mit EngerixB® eine deutlich bessere Immunogenität, fasste Jelinek zusammen. Ein dritter Punkt: Der Verlauf der Antikörper-Titer spreche für einen lebenslangen Schutz. Allerdings empfahl das arznei-telegramm Anfang Juli, die Vakzine "aufgrund nicht zufriedenstellend ausgeräumter Risikosignale beim derzeitigen Kenntnisstand eher zurückhaltend einzusetzen."
Bei den Tollwut-Vakzinen werde der HDC-Impfstoff wohl noch in diesem Jahr durch Verorab® ersetzt werden, so Jelinek. Es handle sich um dasselbe Antigen wie im HDC-Impfstoff, das bei Verorab® nur in Vero-Zellen produziert wird. Die Vakzine sei schon länger in Europa zugelassen und werde etwa in Frankreich schon einige Jahre verimpft. Bisher sei er hierzulande aber nicht verfügbar gewesen. Wie oft soll man Reisende optimalerweise gegen Tollwut impfen? Jelinek: „Dreimal
ist mit Sicherheit am besten. Wer zweimal geimpft ist, der ist lediglich geprimt und hat nicht unbedingt protektive Antikörper. Vorteil ist: Man benötigt bei einer Infektion keine Immunglobuline. Aber man braucht unmittelbar eine aktive Immunisierung. Ist man gar nicht geimpft, braucht man eine Aktiv-Impfung und Immunglobuline, das ist der größte Aufwand.“ Viele Länder hätten den Impfstoff zudem nicht vorrätig. Das Problem lösen könnte die einmalig zu verabreichende Vakzine „ChAdOx2 RabG“, an der in einer PhaseI-Studie geforscht wird. Es handelt sich um einen Adenovirus-basierten Impfstoff, der bisher gute Ergebnisse gezeigt habe.
Wichtiges für die Beratung Älterer Eine wichtige Änderung für die Beratung älterer und chronisch kranker Reisender gibt es durch die Zulassung der 15- und 20-valenten Konjugatimpfstoffe gegen
Pneumokokken (Vaxneuvance® und Apexxnar®). „Die Studiendaten sind sehr gut und die ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), also die USamerikanische Stiko, hat innerhalb von nicht einmal vier Wochen die Impfempfehlungen zu Pneumokokken angepasst“, berichtete Jelinek. „Das heißt: In der Indikationsgruppe, also über 60 oder chronisch krank, wird entweder Apexxnar® oder alternativ Vaxneuvance® empfohlen und dann sequenziell die 23-valente Pneumovax® hinterher.“ In den StikoEmpfehlungen für 2023 gebe es zu den Pneumokokken-Impfungen dagegen keine Änderung.
Für die Zielgruppe der älteren Reisenden ist zudem die Vakzine gegen Herpes zoster relevant, ebenso die Influenza-Impfung. Letztere könnte durch die mRNATechnologie einen deutlichen Schub erhalten, weil Impfstoffe viel schneller produziert werden können und damit näher am tatsächlichen Infektionsgeschehen sind, warf Jelinek einen Blick in die Zukunft. Im Herbst 2023 kommt in dieser Altersgruppe noch eine weitere relevante Vakzine hinzu: Der erste Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytial-Virus ist kürzlich zugelassen worden, zur nächsten RSV-Saison soll er verfügbar sein. ▪
• Unseren Reiseimpfspicker finden Sie unter www.hausarzt.link/jDVfu
Anne Bäurle• Die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin hat die Studiendaten zu Qdenga in einer detaillierten Stellungnahme aufbereitet: www.hausarzt.link/fpAC7 Sie bietet außerdem einen Aufklärungsbogen zur Impfung für Patienten zum Herunterladen an: www.hausarzt.link/TY9QZ .
• Die StikoEmpfehlungen zu Reiseimpfungen 2023 inklusive aktuellen epidemiologischen Daten aus Ländern von A bis Z gibt es hier: www.hausarzt.link/Nxwui
Uns könnten künftig einige Impfstoffe gegen Arboviren
Seit kurzem ist der erste Impfstoff gegen das respiratorische Synzytial-Virus in der EU zugelassen. Weitere könnten demnächst folgen – denn die Impfstoffentwicklung hat rasant an Fahrt aufgenommen.
Während sich lange nur sehr wenig in Sachen RSV-Prävention getan hat - die letzte Neuerung war die Zulassung des monoklonalen Antikörpers Palivizumab (Synagis® von AstraZeneca) für Frühchen und Kinder unter zwei Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen im Jahr 1999 - hat die Entwicklung in jüngster Zeit rasant an Fahrt auf-
genommen. Im Juni 2023 wurde der erste RSV-Impfstoff für Senioren zugelassen – die proteinbasierte Vakzine Arexvy® von GSK. Kurz zuvor, im November 2022, war in der EU der monoklonale Antikörper Nirsevimab (Beyfortus® von Sanofi und AstraZeneca) für Säuglinge, darunter auch Frühgeborene und Neugeborene mit bestimmten Grunderkrankungen, zugelassen worden. Zudem befinden sich mehrere Impfstoffkandidaten in der klinischen Prüfung, beispielsweise:

• der proteinbasierte Impfstoffkandidat „PF-06928316“ (auch: „RSV-preF“) von Pfizer für Schwangere und Senioren,
• der mRNA-basierte Impfstoffkandidat „mRNA-1345“ für Menschen ab 60 Jahre von Moderna,
• der Vektorimpfstoff „MVA-BN RSV“ für Menschen ab 60 Jahre von Bavarian Nordisc sowie
• die proteinbasierte Vakzine „ResVax“ für Schwangere von Novavax [1].
Es könnte also schon bald weitere Impfstoffe gegen RSV geben. Aber aus welchem
Grund hat die Entwicklung einer RSVVakzine so lange gedauert?
1965 kam es zum Desaster
Ein erster Versuch mit einem RSV-Impfstoff hatte vor 50 Jahren zu einem Desaster geführt [2]: 1965 war ein experimenteller RSV-Impfstoffkandidat mit Hitze- und Formalin-inaktivierten Viren entwickelt worden. 31 Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Monaten, meist afroamerikanischer Herkunft, erhielten die experimentelle Vakzine. Das Problem: Der Impfstoff erzielte nicht nur keine Schutzwirkung – er machte die Kinder tatsächlich sogar vulnerabler. 23 der 31 Impflinge infizierten sich mit RSV, 18 von ihnen mussten stationär behandelt werden, und zwei Kinder starben. In der Kontrollgruppe infizierten sich 21 Kinder, von denen allerdings nur eines stationär behandelt werden musste. Zudem trat in dieser Gruppe kein Todesfall auf. Es dauerte viele Jahre, bis ein weiterer Versuch eines RSV-Impfstoffs unternommen wurde. „2013 wurde entdeckt, dass das Prä-Fusionsprotein die immundominante Zielstruktur des Erregers ist“, berichtete Tino Schwarz. „Dann begann die Entwicklung monoklonaler Antikörper und aktiver Impfstoffe.“ Auch viele der Kandidaten, die sich aktuell in der klinischen Prüfung befinden, haben das Prä-Fusionsprotein zum Ziel, ebenso der bereits zugelassene RSVImpfstoff für Senioren, Arexvy®.

Vaxneuvance® ist ein Pneumokokken-Konjugatimpfstoff mit einer starken Immunantwort gegenüber relevanten Pneumokokken-Serotypen – auch schon im ersten Lebensjahr
Vaxneuvance® wird bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 Wochen bis < 18 Jahren für die aktive Immunisierung zur Prävention von invasiven Erkrankungen, Pneumonien und akuter Otitis media angewendet, die durch Streptococcus pneumoniae verursacht werden.

Für die Grundimmunisierung von Säuglingen und Kleinkindern empfiehlt die STIKO mit einem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff zu impfen,1 wie z. B. Vaxneuvance®. Die Impfung für Säuglinge und Kleinkinder bis 24 Monate mit einem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff ist Bestandteil der Schutzimpfungsrichtlinie und somit eine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen.

Referenzen: 1. Ständige Impfkommission: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut 2023. Epid Bull 2023;4:3–68.
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.

Vaxneuvance® Injektionssuspension in einer Fertigspritze

u. 4 Mikrogramm des Pneumokokken-Polysaccharid-Serotyps 6B, alle konjugiert an CRM197-Trägerprotein (nicht-toxische Mutante d. Diphtherie-Toxins aus Corynebacterium diphtheriae C7, rekombinant exprimiert in Pseudomonas fluorescens) u. adsorbiert an Aluminiumphosphat-Adjuvans. 1 Dosis (0,5 ml) enth.: 125 Mikrogramm Aluminium (Al3+) u. etwa 30 Mikrogramm CRM197-Trägerprotein. Sonst. Bestandt.: Natriumchlorid (NaCl), L-Histidin, Polysorbat 20, Wasser für Injekt.zwecke. Anw.: B. Kleinkdrn., Kdrn. u. Jugendl. im Alter von 6 Wochen bis < 18 J. für d. aktive Immunisierung zur Prävention v. invasiven Erkrank., Pneumonien u. akuter Otitis media, die durch Streptococcus pneumoniae verursacht werden. B. Pers. ab 18 J. für d. aktive Immunisierung zur Prävention v. invasiven Erkrank. u. Pneumonien, d. durch Streptococcus pneumoniae verursacht werden. Vaxneuvance® sollte entsprechend den offiziellen Impfempfehlungen angewendet werden. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. d. Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt. od. gg. andere Diphtherie-Toxoid-enthalt. Impfstoffe. Vorsicht bei: Akuter schwerer febriler Erkrank. od. akuter Infektion. Pers., d. Antikoagulanzien erhalten. Thrombozytopenie. And. Gerinnungsstör., wie Hämophilie. Frühgeb. (≤ 28 Schwangerschaftswoche b. Geburt). Immunsuppr. Ther., genet. Defekt, HIV-Infektion od. and. Gründen f. Immunschwäche. Nebenw.: Kleinkdr./Kdr. (6 Wo. bis < 2 J.): Sehr häufig: Vermind. Appetit. Reizbark. Somnolenz. Fieber; Fieber (≥ 39 °C); Schmerzen a. d. Injekt.-stelle; Erythem a. d. Injekt.-stelle; Schwellung a. d. Injekt.-stelle; Verhärtung a. d. Injekt.-stelle. Häufig: Urtikaria; Ausschl. Erbr. Fieber (≥ 40 °C); blauer Fleck/Hämatom a. d. Injekt.-stelle. Gelegentl.: Urtikaria a. d. Injekt.-stelle. Kdr./Jugendl. (2 bis < 18 J.): Sehr häufig: Kopfschmerzen. Myalgie. Schmerzen a. d. Injekt.-stelle; Erythem a. d. Injekt.-stelle; Schwellung a. d. Injekt.-stelle; Ermüdung. Häufig: Vermind. Appetit. Reizbark. Somnolenz. Urtikaria. Übelk. Fieber; Verhärtung a. d. Injekt.-stelle; blauer Fleck/Hämatom a. d. Injekt.-stelle. Gelegentl.: Erbr. Nicht bekannt: Ausschlag. Erw.: Sehr häufig: Kopfschmerzen. Myalgie. Schmerzen a. d. Injekt.-stelle; Erythem a. d. Injekt.-stelle; Schwellung a. d. Injekt.-stelle; Ermüd. Häufig: Arthralgie. Jucken a. d. Injekt.-stelle. Gelegentl: Schwindelgefühl. Ausschlag. Übelk.; Erbr. Fieber; Wärme a. d. Injekt.-stelle; blauer Fleck/Hämatom a. d. Injekt.-stelle; Schüttelfrost. Selten: Überempf.-keitsreakt. einschl. Zungenödem, Flush u. Engegefühl d. Halses. Urtikaria. Warnhinw.: Nicht intravasal verabreichen. Für den Fall e. akuten anaphylaktischen Ereignisses angemessene med. Behandlungsmöglichk. u. Überwachung bereithalten. Hinw. zu Schwangersch. u. Stillz. beachten. Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Vaxneuvance® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unternehmer: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Niederlande; Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstr. 4a, 81673 München MSD Infocenter: Tel. 0800 673 673 673, Fax 0800 673 673 329, E-Mail: infocenter@msd.de Stand: 10/2022 (RCN: 000021575-DE; 000024472-DE)


Wirkstoff: Pneumokokken-Polysaccharid-Konjugatimpfstoff (15-valent, adsorbiert) Zus.: 1 Dosis (0,5 ml) enth.: Je 2 Mikrogramm der Pneumokokken-Polysaccharid-Serotypen




• RSV-Infekte betreffen alle Altersgruppen.
• Ein Risiko für einen schweren Verlauf besteht z.B. bei Frühgeborenen, Kindern mit Vorerkankungen, bei Immunschwäche oder bei Erwachsenen mit Herz- oder Lungenerkrankungen.
• Es gibt keine wirksame kausale Behandlung.
Für diesen sowie für die beiden Kandidaten „PF-06928316“ und „mRNA-1345“ stellte Schwarz aktuelle Daten aus den jeweiligen Phase-III-Studien vor.
In der zulassungsrelevanten Phase-III Studie habe die Vakzine von GSK bei Menschen über 60 Jahren eine Schutzwirkung vor RSV-bedingten Erkrankungen der unteren Atemwege von 82,6 Prozent erzielt [3]. Die Schutzwirkung vor schwer verlaufenden RSV-bedingten Erkrankungen der unteren Atemwege lag sogar bei 94,1 Prozent. „In der Studie wurde nach einmaliger Impfung bis Monat 7 eine gute Immunantwort detektiert“, berichtete Schwarz. Damit sei eine Schutzdauer über eine gesamte RSVSaison wahrscheinlich.
Der Hersteller will die ersten Impfstoffdosen noch vor der RSV-Saison 2023/2024 im kommenden Herbst ausliefern.
Bei dem Kandidaten des Unternehmens Pfizer handelt es sich um eine Vakzine, die zum einen für Schwangere im zweiten und dritten Trimenon erprobt wurde. Durch die Impfung der Mütter soll ein Nestschutz für neugeborene Kinder induziert werden. In
einer Phase-III-Studie konnte 90 Tage nach der Geburt eine Wirksamkeit des Impfstoffs gegen schwere RSV-assoziierte Erkrankungen der unteren Atemwege beim Kind von 81,8 Prozent ermittelt werden; 180 Tagen nach der Geburt betrug die Wirksamkeit des Impfstoffs 69,4 Prozent [4]. Wurden nicht nur die schweren RSV-assoziierten Erkrankungen betrachtet, sondern die Gesamtheit aller RSV-bedingten Atemwegserkrankungen (sekundärer Endpunkt), lag die Schutzwirkung aber lediglich bei 57,1 Prozent innerhalb von 90 Tagen nach Impfung. Dieser Wert erreichte damit nicht das statistische Erfolgskriterium der Studie. Auch bei Senioren liegen für diesen Impfstoffkandidaten Phase-III-Daten vor [5]: Demnach liegt die Schutzwirkung gegen RSV-bedingte Erkrankungen der unteren Atemwege mit mindestens zwei Symptomen bei 66,7 Prozent. Bei besonders schwer verlaufenden Erkrankungen mit mehr als drei Symptomen liegt die Schutzwirkung bei 85,7 Prozent.
Auch für den experimentellen mRNA-Impfstoff von Moderna für Menschen ab 60 Jahre stellte Schwarz Phase-III-Studiendaten vor: „Hier wurde eine Impfstoffwirksamkeit von 83,7 Prozent gegen RSV-bedingte Erkrankungen der unteren Atemwege mit zwei oder mehr Symptomen festgestellt.“ Grundsätzlich gebe es in Bezug auf RSV-
RSV ist einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, insbesondere bei Frühgeborenen und Kleinkindern.

Impfstoffe allerdings noch einige Fragen zu klären, resümierte Schwarz abschließend. „Wie lange hält die Schutzwirkung nach einmaliger Impfung an? Wann ist der beste Zeitpunkt für die Impfung? Sind Kombinationsimpfstoffe, etwa RSV plus Influenza plus Sars-CoV-2, sinnvoll? Aber auch: Wer sollte geimpft werden – damit muss sich jetzt die Stiko beschäftigen“, so Schwarz. Denn von der Stiko gibt es derzeit noch keine Empfehlung, für wen eine RSV-Impfung in Frage kommt. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC rät, alle über 60-Jährigen gegen RSV zu impfen [6]. In Deutschland läuft dazu derzeit die Studie Viper, berichtete Schwarz: Ein Team des Robert Koch-Instituts berechnet die Auswirkungen einer RSV-Impfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen und vergleicht diese miteinander. Ziel ist, die Krankheitslast durch RSV-Infektionen und die Kosten für das Gesundheitssystem vorherzusagen. So soll die effektivste und kostengünstigste Impfstrategie bestimmt werden.
Anne BäurleQuellen:
1. Auflistung des vfa, Stand 27. April 2023
2. JAMA 2022; 327(3):204-206;
DOI: 10.1001/jama.2021.23772
3. NEJM 2023; 388:595-608;
DOI: 10.1056/NEJMoa2209604
4. NEJM 2023; 388:1451-1464
DOI: 10.1056/NEJMoa2216480
5. NEJM 2023; 388(16):1465-1477
DOI: 10.1056/NEJMoa2213836
6. Mitteilung des CDC, online 29. Juni
• 4-fach hochdosiert, zugelassen ab 60 Jahren1
• Für alle Personen ab 60 Jahren in der GKV erstattungsfähig2
STIKO-Empfehlung: Hochdosis-Influenza-Impfung für alle ab 60 Jahren3
am
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.
Efluelda® Injektionssuspension in einer Fertigspritze. Wirkstoffe / Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Tetravalenter Influenza-Spaltimpfstoff (inaktiviert), 60 Mikrogramm HA/Stamm. Saison 2022/2023. Influenza-Viren (inaktiviert, gespalten) der folgenden Stämme*: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Victoria/2570/2019, IVR-215) 60 Mikrogramm HA**, A/Darwin/9/2021 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Darwin/9/2021, SAN-010) 60 Mikrogramm HA**, B/Austria/1359417/2021 – ähnlicher Stamm (B/Michigan/01/2021, Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, B/ Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp) 60 Mikrogramm HA**, Pro Dosis zu 0,7 ml, * gezüchtet in befruchteten Hühnereiern, ** Hämagglutinin. Dieser Impfstoff entspricht den Empfehlungen der WHO (nördliche Hemisphäre) und der EU-Entscheidung für die Saison 2022/2023. Efluelda kann Spuren von Eibestandteilen, wie z. B. Ovalbumin, sowie Formaldehyd enthalten, die während des Herstellungsprozesses verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3 der Fachinformation). Liste der sonstigen Bestandteile: Natriumphosphat-gepufferte isotonische Kochsalzlösung, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke, Octoxinol-9. Anwendungsgebiete: Efluelda ist indiziert für die aktive Immunisierung von Erwachsenen ab 60 Jahren zur Prävention einer Influenza-Erkrankung. Die Anwendung von Efluelda sollte gemäß den offiziellen Impfempfehlungen für Influenza erfolgen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile oder gegen andere Komponenten, von denen möglicherweise Spuren enthalten sind, wie z. B. Eibestandteile (Ovalbumin, Hühnereiweiß) und Formaldehyd. Nebenw.: Allgem./Beschw. a. Verabreichungsort: Sehr häufig: Schm. a. d. Injekt.-stelle, Erythem a. d. Injekt.-stelle, Unwohlsein; häufig: Schwellung, Verhärt. u. blauer Fleck a. d. Injekt.-stelle, Fieber (≥ 37,5 °C), Schüttelfrost; gelegentl.: Jucken a. d. Injekt.-stelle, Ermüdung; selten: Asthenie; nicht bek.: Brustkorbschm. Skelettmskl, Bindegew., Knochen: Sehr häufig: Myalgie; gelegentl.: Mskl-schwäche; selten: Arthralgie, Schm. i. d. Extremitäten. Nerven: Sehr häufig: Kopfschm.; gelegentl.: Lethargie; selten: Schwindelgefühl, Parästhesie; nicht bek.: Guillain-Barré-Syndrom, Konvulsionen, Fieberkrämpfe, Myelitis (einschl. Enzephalomyelitis u. Myelitis transversa), Fazialislähmung (Bell-Parese), Optikusneuritis/Neuropathie d. Nervus opticus, Brachial-Neuritis, Synkope (unmittelb. n. Impf.). Blut- u. Lymphsyst.: Nicht bek.: Thrombozytopenie, Lymphadenopathie. Atemw., Brustr., Mediastinum: Gelegentl.: Husten, Schm. i. Oropharynx; selten: Rhinorrhö. nicht bek.: Atemnot, Giemen, Engegefühl i. Hals. GIT: Gelegentl.: Diarrhö, Erbrechen, Übelk., Dyspepsie. Immunsyst.: Selten: Pruritus, Urtikaria, nächtl. Schweißausbrüche, Ausschlag; nicht bek.: Anaphylaxie, and. allerg. Reakt./ Überempf.-reakt. (einschl. Angioödem). Gefäße: Selten: Flush; nicht bek.: Vaskulitis, Vasodilatation. Ohr u. Labyrinth: Selten: Vertigo. Augen: Selten: Augenhyperämie. Abgabe/Verschreibungspflicht: Deutschland: Verschreibungspflichtig. Österreich: Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Influenzaimpfstoff, ATC-Code: J07BB02
Pharmazeutischer Unternehmer/Zulassungsinhaber: Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Frankreich. Örtlicher Vertreter d. Zulassungsinhabers: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main, Deutschland. sanofi-aventis GmbH, 1100 Wien, Österreich.
Stand der Information: Mai 2023
Weitere Angaben zu den besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie ggf. Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Für gesunde Kinder empfiehlt die Stiko die Corona-Impfung mittlerweile nicht mehr. Es gibt aber jede Menge andere Impfungen, die vor dem EIntritt in Kita und Schule überprüft werden sollten.
Seit 2020 müssen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bei Eintritt in Kita, Kindergarten oder Schule eine vollständige Masernimpfung oder -immunität nachweisen.

Für viele Kinder startet das Abenteuer Kita oder Schule. Kontakte zu vielen Kindern bedeuten aber natürlich auch Kontakte zu vielen Viren und Bakterien - und damit ein höheres Infektionsrisiko.
Laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollten Kinder gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Polio und Hepatitis B geimpft werden. Hier steht eine 6-fachVakzine zur Verfügung, für die seit 2020 ein vereinfachtes 2+1-Impfschema im Alter von zwei, vier und elf Monaten empfohlen wird. Insbesondere für den Langzeitschutz ist es wichtig, zwischen der zweiten und dritten Impfstoffdosis einen Mindestabstand von sechs Monaten einzuhalten. Die Impfserie sollte um den ersten Geburtstag abgeschlossen sein, damit Kinder auch bei einem frühen Kita-Eintritt gut vor Infektionen geschützt sind. Frühgeborene, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren sind, sollten nach dem 3+1 Schema im Alter zwei, drei, vier und elf Monaten geimpft werden. Die Stiko bemerkt dazu: „Oftmals möchten Eltern ihre jungen Säuglinge aus Sorge vor einer Überforderung des Immunsystems möglichst spät impfen. Sie bedenken dabei nicht, dass gerade diese Erkrankungen im jungen Säuglingsalter besonders gefährlich sind und Impfungen die einzige sichere Schutzmöglichkeit bieten.“ Die 6-fach-Impfung gilt als gut verträglich.
Masernschutzgesetz zeigt Wirkung
Eine weitere wichtige Impfung ist die Masernimpfung. Seit Einführung des Masernschutzgesetzes im Jahr 2020 müssen in Deutschland alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bei Eintritt in Kindergarten, Kita oder Schule eine vollständige Masernimpfung oder eine Masernimmunität vorweisen. Für die Grundimmunisierung empfohlen wird von der Stiko eine erste Impfung im Alter zwischen elf und 14 Monaten, die zweite Impfung sollte frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung im Alter von 15
bis 23 Monaten durchgeführt werden. Zeitgleich ist auch die Impfung gegen Mumps, Röteln und Varizellen empfohlen. Bei bevorstehender Aufnahme bzw. bei Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Kita) kann die Masern-Impfung laut Robert Koch-Institut bereits ab einem Alter von neun Monaten gegeben werden. Für die Masernimpfung stehen zwei Impfstofftypen zur Verfügung: Die MMR-Vakzine gegen Masern, Mumps und Röteln sowie die MMR-V-Vakzine, die zusätzlich vor Varizellen schützt. Zu beachten ist: Bei Verabreichung der ersten Impfdosis mit einem MMR-V-Impfstoff haben Kinder im Alter von elf bis 23 Monaten ein etwa doppelt so hohes Risiko für einen Fieberkrampf im Vergleich zu Kindern, die gleichzeitig einen MMR- und einen Varizellen-Impfstoff an getrennten Injektionsstellen erhalten. Die Stiko empfiehlt deshalb die getrennte Gabe von MMR- und Varizellen-Impfstoff bei der ersten Impfung. Bei der zweiten Impfung kann ein MMR-V-Impfstoff verwendet werden. Bisher ist in Deutschland kein Einzelimpfstoff gegen das Masernvirus verfügbar.
• 6-fach-Impfung gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Hib, Polio und Hepatitis B,
• MMR-/MMR-V,
• Meningokokken,
• Pneumokokken,
• HPV.
Die Einführung des Masernschutzgesetztes hat mittlerweile zu einem Rückgang der Masernfälle geführt: 2018 und 2019, vor Einführung des Gesetzes, gab es jeweils rund 600 Fälle, 2020 waren es nur noch 150, in den Jahren 2021 und 2022 gab es jeweils etwa 60 Fälle [1]. Zur Erinnerung: In Jahren mit sehr vielen Masernfällen lag die Zahl bisweilen im vierstelligen Bereich - 2015 etwa gab es in Deutschland mehr als 2.600 Masernfälle.
Meningo- und Pneumokokken-Impfung überprüfen!
Zwei weitere wichtige Einzelimpfungen, die vor Eintritt in die Kita oder Schule überprüft werden sollten, sind die Impfungen gegen Meningokokken und Pneumokokken. Laut Stiko sollten alle Kinder im zweiten Lebensjahr mit einer Konjugatvakzine einmalig gegen Meningokokken vom Typ C (MenC) geimpft werden. Die Impfung kann dabei noch bis zum vollendeten 17. Lebensjahr nachgeholt werden. Nur bei einem erhöhten Risiko für Meningokokken-Erkrankungen (zum Beispiel angeborene oder erworbene Immundefekte)

sollten Kinder zusätzlich gegen Meningokokken vom Typ ACWY (MenACWY) sowie Meningokokken vom Typ B (MenB) geimpft werden.
Die Meningokokken-Impfempfehlung wird schon länger diskutiert, denn in Deutschland ist der häufigste Erreger von Meningokokken-Erkrankungen mittlerweile MenB (60 Prozent der Erkrankungen werden laut RKI durch MenB ausgelöst). Daran hat die von der Stiko empfohlene Impfung gegen MenC einen großen Anteil - sie hat nämlich genau das erreicht, was man von einer Impfung erhofft: Die Zahl der durch MenC ausgelösten Meningokokken-Erkrankungen hat seit Einführung der Empfehlung deutlich abgenommen. Wenn also Meningokokken vom Typ B die meisten Meningokokken-Erkrankungen auslösen und es einen auch für Kinder zugelassenen Impfstoff gegen MenB gibt –warum gibt es dann keine Impfempfehlung seitens der Stiko? Zum einen sind Meningokokken-Erkrankungen in Deutschland
grundsätzlich sehr selten geworden. Laut RKI-Angaben liegt die bundesweite jährliche Inzidenz aktuell bei unter 0,4 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Sie können aber nichtdestotrotz schwer verlaufen. Zum anderen reicht für die Stiko die Datenlage für eine abschließende Beurteilung noch nicht aus [2]. Hier wartet die Impfkommission insbesondere auf Daten aus dem Vereinigten Königreich, wo seit 2015 alle Säuglinge gegen MenB geimpft werden. Sobald robustere Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung vorliegen,
werde die Stiko die Einführung einer MenB-Impfempfehlung neu bewerten, heißt es. Eine Impfung gegen MenB kann aber auch abseits der Stiko-Empfehlungen erwogen werden, einige Krankenkassen übernehmen oder bezuschussen die MenB-Impfung auch. Übrigens: Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt für Kinder seit 2018 bei einer MenC-Impfung vorzugsweise einen MenACWY-Impfstoff entsprechend der Alterszulassung, zudem rät sie seit 2014 für Kinder ab dem dritten Monat (bis zum 26. Lebensjahr) zu einer MenB-Impfung [3].
Die zweite wichtige Einzelimpfung, die Ärztinnen und Ärzte bei Kleinkindern im Blick haben sollten, ist die Pneumokokken-Impfung. Für die Grundimmunisierung im Säuglingsalter (ab zwei Monaten bis zum Alter von zwei Jahren) empfiehlt die Stiko wegen des noch nicht ausgereiften Immunsystems nur Konjugatimpfstoffe. Die Grundimmunisierung erfolgt in drei Dosen im Alter von zwei, vier und elf Monaten. Bisher gab es für Kinder einen 10und einen 13-valenten Konjugatimpfstoff, seit Ende 2021 ist auch ein 15-valenter Konjugatimpfstoff zugelassen, der Ende 2022 eine Zulassungserweiterung für Kinder ab sechs Wochen erhalten hat. Erst kürzlich hat die Stiko dazu eine Stellungnahme veröffentlicht [4]. Die Impfkommission betont darin, dass für die Standardimpfung gegen Pneumokokken im Säuglingsalter lediglich ein Konjugatimpfstoff empfohlen wird und kein bestimmtes Impfstoffprodukt. „Hingegen wird für die Indikationsimpfung von Kindern ab zwei Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen bisher eine sequenzielle Impfung mit PCV13 gefolgt von PPSV23 empfohlen. Da der zusätzliche Nutzen des

Die CoronaImpfung für gesunde Kinder bis 18 Jahre wurde aus den Impfempfehlungen gestrichen.

in Deutschland zugelassenen 15-valenten PCV (PCV15) im Vergleich zu PCV13 unter Berücksichtigung der aktuellen Serotypenverteilung gering ist, können für die Grundimmunisierung bei Säuglingen beide Impfstoffe zur Anwendung kommen.“
Neben dem 15-valenten Pneumokokkenimpfstoff ist seit kurzem auch ein 20-valenter Pneumokokkenimpfstoff zugelassen, allerdings erst ab 18 Jahren. Die Stiko schreibt dazu: „Von dem 20-valenten PCV (PCV20) ist im Vergleich zu PCV13 und PCV15 durch die breitere Serotypenabdeckung ein deutlicher Zusatznutzen zu erwarten. Der Impfstoff sollte jedoch im Kindesalter noch nicht eingesetzt werden, solange er hierfür nicht zugelassen ist.“
Für Schulkinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren rät die Impfkommission zudem zur HPV-Impfung. Für die Grund -
immunisierung sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten nötig. Jugendliche, die bis zum Alter von 15 Jahren noch nicht gegen HPV geimpft worden sind, sollten die Impfung möglichst bald und bis zum 18. Geburtstag nachholen. Bei Nachholimpfungen ist für die Grundimmunisierung dann eine dritte Dosis empfohlen, und zwar im Abstand 0 - 1 bzw. 2 (je nach Impfstoff) – 6 Monate. Eine Auffrischimpfung ist nach bisherigen Daten möglicherweise nicht nötig: „In den bisher durchgeführten Studien bei Mädchen bzw. Frauen zeigen sich bis zwölf Jahre nach Impfung keine Hinweise auf eine Abnahme des HPV-Impfschutzes gegen die Typen 16 und 18 über die Zeit“, schreibt das RKI dazu [5]. Trotz einer seit mittlerweile 16 Jahren bestehenden Impfempfehlung für Mädchen ist die HPVImpfquote nach wie vor gering: Die bundesweite Quote für 15-jährige Mädchen

Für die Grundimmunisierung gegen Pneumokokken im Säuglingsalter empfiehlt die STIKO ausschließlich Konjugatimpfstoffe.
Den Stiko-Impfkalender 2023 im praktischen PDF-Format finden Sie unter www.hausarzt.link/Bi23t
lag Angaben des RKI zufolge 2020 bei 51 Prozent. Für Jungen wird die Impfung erst seit 2018 empfohlen, hier liegt die Impfquote noch deutlich geringer: für 15-jährige Jungen lag sie 2020 bei lediglich 17 Prozent [6].
Von den Impfempfehlungen gestrichen ist mittlerweile die Corona-Impfung für gesunde Kinder bis 18 Jahre. Der Grund: Die Pandemie hat sich abgeschwächt - und das für Kinder ohnehin schon geringe Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hat sich noch weiter minimiert. ▪
Anne BäurleQuellen:
1. Robert Koch-Institut, SurvStat, www.survstat.rki.de
2. FAQ zu Meningokokken-Impfung, www.rki.de

3. Impfempfehlungen der SIKO, Stand 15.9.22
4. Epid Bull 20/23
5. FAQ zur HPV-Impfung, www.rki.de
6. Epid Bull 48/22
Impfskeptiker und Impfgegner sind keine neue Gruppierung: Seit dem 18. Jahrhundert, seit es die Pockenimpfung gibt, existieren auch Impfgegner. So können Sie in Ihrer Praxis die Impfakzeptanz fördern.
Die Covid-19-Pandemie und die daraufhin startende weltweite Impfkampagne hat verdeutlicht, dass auch heute die Impfskepsis noch groß ist und die Zahl der impfkritischen, vor allem aber der verunsicherten Menschen größer als angenommen. In den Anfangszeiten der Pockenimpfung wurde eine „Verkuhung“ des Menschen durch die Impfung befürchtet, da der Impfstoff Kuhpockenvirus enthielt. Und wie ist es heute? Vorstellungen, dass
Das Robert Koch-Institut (RKI) bietet unter www.rki.de einige hilfreiche Tools an:
• Antworten des Robert Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts zu den 20 häufigsten Einwänden gegen das Impfen [7].
• Gesprächskarten „Impfen“, die auch dem Praxisteam bei der Gesprächsführung mit praktischen Tipps nützlich sein können [8].
• Informationsmaterial zur Impfaufklärung, z. B. zu Covid-19, das ständig aktualisiert wird [9].
Auch in ihren aktuellen Empfehlungen weist die Ständige Impfkommission (Stiko) darauf hin, dass die Aufklärung ein wichtiger Teil der ärztlichen Impfleistung ist. Im Einzelnen sollte die Aufklärung folgende Punkte umfassen [10]:
• Die zu verhütende Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten,
• den Nutzen der Impfung,
• die Kontraindikationen der Impfung,
• die Durchführung der Impfung,
• den Beginn und die Dauer des Impfschutzes,
• das Verhalten nach der Impfung,
• mögliche UAW und Impfkomplikationen und
• die Notwendigkeit und die Termine von Folge und Auffrischimpfungen.
Ein wesentlicher Grund für die Ablehnung von Impfungen ist die Angst vor schweren Nebenwirkungen [11]. Diese können bei jeder Impfung vorkommen; meist äußern sie sich jedoch lediglich als Schmerzen, Rötung und Schwellung an der Impfstelle, leichtem Fieber oder Unwohlsein. Dies ist Ausdruck der Auseinandersetzung des Immunsystems mit den Impfstoffen. Mit ca. 10 Prozent sind diese Reaktionen jedoch relativ häufig. Darüber und auch über die seltenen Komplikationen aufzuklären, trägt dazu bei, Vertrauen zu schaffen.
ein mRNA-Impfstoff das Erbgut verändern könne oder mit der Injektion Chips „eingepflanzt“ werden können, zeigen die großen Befürchtungen und Verunsicherungen in der Gesellschaft.
Umfrage der BZgA zu Impfungen aus dem Jahr 2021
Seit 2012 führt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in mehrjährigen Abständen eine Repräsentativbefragung bei 16- bis 85-Jährigen in der Bevölkerung (computergestützte Telefoninterviews) durch. Ein thematischer Schwerpunkt der Befragung 2021 war die Einschätzung der individuellen Gefährdung durch Covid-19 sowie insbesondere die Bewertung und Inanspruchnahme der
Corona-Schutzimpfung im Erwachsenen-, Jugend- und Kindesalter und die Identifikation möglicher fördernder und hemmender Faktoren zur Wahrnehmung der Impfung.
Laut dieser Umfrage ist die Zahl der Impfgegner nicht sehr groß, nur etwa zwei Prozent der Befragten lehnten Impfungen strikt ab. Zwei Prozent gaben an, Impfungen eher abzulehnen, 15 Prozent waren unentschieden. Aber auch die eher Befürwortenden (22 Prozent) kommen oftmals mit Fragen und Zweifeln in die Praxis und sind – meistens durch Internetseiten – bereits „vorinformiert“. Die Mehrheit, 59 Prozent, gab an, Impfungen zu befürworten [1]. Insgesamt ist die Zahl der Befürwortenden seit 2019 leicht gestiegen.
Doch der Einfluss der kleinen Gruppe der Impfgegner auf die Impfakzeptanz der Bevölkerung ist erheblich. Und leider scheint es seit einiger Zeit nicht mehr nur bei verbalen Angriffen zu bleiben, wie das tragische Beispiel der österreichischen Impfärztin Dr. Lisa-Maria Kellermayr zeigt [2].
Dramatischer Rückgang der Kinderimpfungen auf der ganzen Welt Bereits 2019, also noch vor der CoronaPandemie, erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Ablehnung von Impfungen zu einer der zehn größten Gesundheitsbedrohungen. Sie wird in einem Atemzug mit Hungersnot, Ebola, Luftverschmutzung und Klimawandel oder Antibiotikaresistenzen genannt [3].
Zuletzt wurde der stärkste anhaltende Rückgang von Routine-Impfungen bei Kindern in 30 Jahren verzeichnet, wie Erhebungen von UNICEF und der WHO zeigen: Der Anteil der geimpften Kinder sank zwischen 2019 und 2021 von 86 auf 81 Prozent. Gemessen wird die Impfrate an der Zahl der Kinder, die alle drei Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTP-Kombinationsimpfstoff) erhielten.


• Das Respiratorische SynzytialVirus (RSV) ist verbreitet und infektiös.1

• Weltweit werden jährlich hunderttausende ältere Erwachsene mit RSV im Krankenhaus behandelt.2
• Die Sterblichkeit bei diesen Personen liegt bei 4 – 8 %.3–6



• Ein erhöhtes Risiko einer RSV-Infektion besteht für ältere Erwachsene (60+ Jahre; auch ohne Grunderkrankung), insbesondere bei geschwächtem Immunsystem, sowie chronischen Atemwegsoder Herzerkrankungen.3, 7, 8, 9
Erfahren Sie mehr auf www.impfakademie.de/rsv



Verschiedene Faktoren tragen UNICEF zufolge zu dieser Entwicklung bei. Zum Beispiel leben immer mehr Kinder in Konfliktund Krisengebieten, in denen der Zugang zu Impfungen häufig schwierig ist. Als weitere Gründe werden auch hier die Fehlinformationen über Impfungen genannt. Und natürlich spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle, denn in der Pandemie wurden Impfprogramme und Lieferketten unterbrochen und Mittel für Impfkampagnen für den Kampf gegen SarsCoV-2 eingesetzt. Die Folge: Es sind wieder deutlich mehr Kinder durch impfpräventable Infektionskrankheiten gefährdet [4].
Warum werden Impfungen negativ wahrgenommen?
Professorin Cornelia Betsch, Inhaberin der Professur für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, nennt fünf typische Gründe, warum Menschen Impfungen ablehnen [5]:


• Das fehlende Vertrauen in die Sicherheit von Impfungen,
• ein nicht wahrgenommenes Krankheitsrisiko, daher werden Impfungen als überflüssig betrachtet,
• das Problem, Impfungen in einem gefüll -
ten und durchgeplanten Alltag „unterzubringen" (Alltagsstress),
• Informationssuche: das Bedürfnis, aktiv selbst Informationen zu suchen und Nutzen und Risiko sorgfältig abzuwägen und
• die Motivation, die Herdenimmunität auszunutzen, sich also indirekt durch die Impfungen der anderen schützen zu lassen.
Ergebnisse aus dem Covid-19-SnapshotMonitoring (COSMO*) zeigen interessante Aspekte der Informationssuche:
• Personen ohne Corona-Impfung geben insgesamt an, dass Informationsquellen (jeder Art) zum Thema Impfen ihnen weniger wichtig sind als Personen mit mindestens einer Corona-Impfung.
• Die Gruppen unterscheiden sich darin, welche Medienarten ihnen mehr oder weniger wichtig sind. Geimpften sind eher öffentlich-rechtliche oder private Medien sowie Zeitungen wichtig. Ungeimpfte nutzen eher Videoformate, soziale Medien und alternative Medienangebote. Suchmaschinen sind beiden Gruppen ähnlich wichtig.
Außerdem ist eindeutig, welch große Rolle bei der Impfakzeptanz die Hausärztin bzw. der Hausarzt spielen: Personen zeigen eine
Ley-Köllstadt
Deutsches Grünes
Kreuz e. V., Marburg sigrid.leykoellstadt@dgk.de
niedrigere Bereitschaft, sich mit einem Omikron-angepassten Covid-19-Impfstoff impfen zu lassen, wenn ihr Arzt bzw. ihre Ärztin von der Impfung aktiv abrät, keine Empfehlung ausspricht oder gar nicht über das Thema gesprochen wurde, im Vergleich zu Personen, deren Ärztinnen und Ärzte eine Booster-Impfung mit angepasstem Impfstoff empfehlen, heißt es in den Ergebnissen der Studie [6].
Diese Erkenntnisse bieten die Chance, die Kommunikation mit zweifelnden Patientinnen und Patienten in der Praxis besser zu planen. Es ist immer wichtig, Ängste ernst zu nehmen und möglichst auch die impfkritischen Argumente zu kennen. Mit einem respektvollen Gespräch kann man viel erreichen, unter anderem gegenseitiges Verständnis, neue Perspektiven, Denkanstöße - und vor allem Vertrauen [8]. ▪
Sigrid Ley-Köllstadt
*COSMO ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Erfurt (UE), des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (BNITM), des Robert Koch-Instituts (RKI), der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), des Leibniz-Instituts für Psychologie (ZPID) und des Science Media Center (SMC). Die letzte Aktualisierung des Monitorings stammt vom 29.11.2022.
Mögliche Interessenkonflikte: Die Autorin hat keine deklariert.
Literatur unter www.hausarzt.digital
Weltweit sind ca. 4 Milliarden Menschen dem Risiko ausgesetzt, sich mit dem Dengue-Virus zu infizieren [1]. Für Reisende in endemische Regionen steht in der EU seit Dezember 2022 der erste Reiseimpfstoff (TAK-003) zur Prävention von Dengue-Fieber bei Personen ab 4 Jahren zur Verfügung [2]. Unabhängig vom Serostatus zum Zeitpunkt der ersten Impfung beträgt die Gesamtwirksamkeit in der Prävention von Dengue-Fieber 80,2% [2-4].

Dengue-Fieber ist eine der häufigsten Ursachen für Fieber bei Reiserückkehrenden aus den Tropen und Subtropen [5]. „Am höchsten sind die Inzidenzen in Südostasien und Südamerika. Aber auch in Afrika sind sie wahrscheinlich höher als vermutet“, gab Prof. emerit. Dr. Christoph Hatz, Basel, am 15. Juni 2023 auf dem 16. Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (KIT) in Leipzig zu bedenken. Genau an diesem Tag weist der Welt-Dengue-Tag alljährlich auf die von der Infektion ausgehenden Risiken hin [6]. Dengue gewinnt deshalb in der Reisemedizin zunehmend an Bedeutung. „Symptomatische Infektionen beginnen üblicherweise mit hohem Fieber, heftigen Kopfschmerzen und sehr starken Gliederund Gelenkschmerzen. Nach etwa einer Woche fiebern die Patientinnen und Patienten ab, was aber kein Anlass zur Entwarnung ist“, erläuterte Univ. Doz. Dr. Ursula Hollenstein, Wien. Denn in der Phase des Abfieberns sei die Gefahr des Übergangs in eine Schocksymptomatik am größten. Für Reisende in Endemiegebiete bot der Schutz vor Mückenstichen lange Zeit die einzige Möglichkeit der Prophylaxe. „Wir
haben lange auf einen Impfstoff gewartet, der uns nun zur Verfügung steht“, sagte Prof. Dr. Tomas Jelinek, Berlin. Der im Dezember 2022 in der EU zugelassene Dengue-Impfstoff TAK-003 (Qdenga®) wird angewendet zur Prävention von Dengue-Fieber bei Personen ab vier Jahren im Rahmen eines 2-Dosen-Impfschemas (Monat 0 und 3) [2]. Die Zulassung stützt sich u.a. auf die Daten der Phase-III-Studie TIDES, die in acht Dengue endemischen Regionen Asiens und Lateinamerikas durchgeführt wurde und über 20.000 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren einschloss [3]. Gegenüber Placebo zeigte der tetravalente Lebendimpfstoff im Zeitraum von 30 Tagen bis 12 Monate nach der zweiten Impfung hinsichtlich der Reduktion bestätigter Fälle von Dengue-Fieber (Virologically Confirmed Dengue, VCD) eine Gesamtwirksamkeit von 80,2% (p<0,001; primärer Endpunkt) [3]. Schon von der ersten bis zur zweiten Impfung wurde eine explorative Gesamtwirksamkeit gegen VCD-Fieber von 81,1% beobachtet [2]. Bis 54 Monate nach der zweiten Impfung war TAK-003 unabhängig vom Serostatus wirksam [2,7].
Qdenga Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung [in einer Fertigspritze]
Dengue-Fieber tetravalenter Impfstoff (lebend, attenuiert)
Bei der Reduktion der VCD-bedingten Hospitalisierungsrate ergab sich nach 18 Monaten eine Wirksamkeit von 90,4%, hauptsekundärer Endpunkt (p<0,001) [4]. Nach Daten einer serologischen Studie ist die bei Kindern und Jugendlichen ermittelte Schutzwirkung auf Erwachsene übertragbar [2,8]. ▪
Quelle: Paneldiskussion „Let´s Talk About Dengue“,
16. Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (KIT), Leipzig 15.06.2023
Literatur:
1. Brady OJ et al. PLoS Negl Trop Dis 2012;6:e1760
2. Fachinformation Qdenga®, Stand Dezember 2022
3. Biswal S et al. N Engl J Med 2019;381:2009–2019
4. Biswal S et al. Lancet 2020;395:1423-1433
5. Halstead S Wilder-Smith A. J Travel Med 2019; 26:taz062
6. www.breakdengue.org/world-dengue-day/; letzter Zugriff: 05.07.2023
7. Tricou V et al. 44th ICMM world congress 2022 on military medicine September 2022, Brussels
8. LeFevre I et al. npj Vaccines 2023;8:7
Impressum
Report in „IMPFEN-Beilage“ 14/2023
Bericht: Dr. Matthias Herrmann, Berlin V.i.S.d.P.: J. Dielmann-von Berg
Die Herausgeber der Zeitschrift übernehmen keine Verantwortung für diese Inhalte Mit freundlicher Unterstützung der Takeda Pharma, Berlin
▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.
Wirkstoff: Dengue-Virus-Serotypen 1,2,3 und 4 (lebend, attenuiert). Zusammensetzung: Nach der Rekonstitution enthält eine Dosis (0,5 ml): Dengue-Virus-Serotyp 1 (lebend, attenuiert): ≥ 3,3 log10 PBE**/Dosis; Dengue-Virus-Serotyp 2 (lebend, attenuiert): ≥ 2,7 log10 PBE**/Dosis; Dengue-Virus-Serotyp 3 (lebend, attenuiert): ≥ 4,0 log10 PBE**/Dosis; Dengue-Virus-Serotyp 4 (lebend, attenuiert): ≥ 4,5 log10 PBE**/Dosis. **PBE = Plaque-bildende Einheiten. Sonstige Bestandteile: Pulver: α , α -Trehalose-Dihydrat, Poloxamer 407, Humanalbumin, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid Lösungsmittel: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete: Qdenga wird angewendet zur Prävention von Dengue-Fieber bei Personen ab 4 Jahren. Qdenga sollte gemäß den offiziellen Empfehlungen angewendet werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder die sonstigen Bestandteile oder Überempfindlichkeit gegen eine frühere Dosis von Qdenga. Personen mit angeborener oder erworbener Immundefizienz, einschließlich Personen, die in den 4 Wochen vor der Impfung immunsuppressive Therapien wie Chemotherapie oder hoch dosierte systemische Kortikosteroide erhalten haben, wie bei anderen attenuierten Lebendimpfstoffen. Personen mit symptomatischer HIV-Infektion oder einer asymptomatischen HIV-Infektion, bei der Hinweise auf eine eingeschränkte Immunfunktion vorliegen. Schwangere. Stillende Frauen. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Infektion der oberen Atemwege, Verminderter Appetit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Somnolenz, Myalgie, Schmerzen und Erythem an der Injektionsstelle, Unwohlsein, Asthenie, Fieber; Häufig: Nasopharyngitis, Pharyngotonsillitis, Arthralgie, Schwellung und blaue Flecken und Jucken an der Injektionsstelle; Grippeähnliche Erkrankung; Gelegentlich: Bronchitis, Rhinitis, Schwindelgefühl, Diarrhoe, Übelkeit, Abdominalschmerz, Erbrechen, Ausschlag, Pruritus, Urtikaria, Blutung an der Injektionsstelle, Ermüdung, Verfärbung an der Injektionsstelle; Sehr selten: Angioödem. Verkaufsabgrenzung: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Takeda GmbH, Deutschland. Stand der Information: Dezember 2022
In Deutschland stehen aktuell drei hexavalente Impfstoffe für die Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (Hib) und Hepatitis B (DTaP/ IPV/Hib/HepB) nach dem 2+1 Schema für Reifgeborene bzw. 3+1 Schema für Frühgeborene zur Verfügung. Von diesen drei Impfstoffen verwendet nur Vaxelis® (Hex-V) einen Meningokokken-Membranproteinkomplex (OMPC) als

Trägerprotein für Hib. Der Frage, ob sich bei KoAdministration von Vaxelis® mit dem Impfstoff gegen Meningokokken Serotyp B (MenB), der ebenfalls Meningokokken-Membranproteine enthält, potenzielle Wechselwirkungen ergeben können, gingen die Autoren einer Nichtunterlegenheitsstudie aus dem Vereinigten Königreich (United Kingdom; UK) nach (1). Sie kommen u. a. zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse für die Flexibilität bei der Verwendung entweder von Vaxelis® oder Infanrix Hexa (Hex-IH) im Rahmen des Kinder-Impfplans sprechen, der auch MenB enthält. ▪

Quelle: Nach einer Pressemitteilung von MSD
Literatur:
1. Rajan M et al. A Randomized Trial Assessing the Immunogenicity and Reactogenicity of Two Hexavalent Infant Vaccines Concomitantly Administered With Group B Meningococcal Vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2023;42(1):66-73. DOI: 10.1097/ INF.0000000000003753
Ab 60 wächst das Risiko einer Erkrankung aufgrund einer Pneumokokken-Infektion. Um die teilweise erheblichen Risiken für diese breite Bevölkerungsgruppe zu reduzieren, möchte MSD mit der Kampagne „Gegen Pneumokokken Impfen 60+“, diese Altersgruppe sensibilisieren und zur Pneumokokken-Impfung motivieren.
Obwohl die Pneumokokken-Impfung in Deutschland eine von der STIKO empfohlene Standardimpfung für Personen ab 60 Jahren ist, erkranken jährlich ca. 38.400 Personen über 60 Jahren an einer durch Pneumokokken bedingten Pneumonie. Ungefähr jeder achte Erkrankte stirbt daran. In Europa zählen Pneumokokken als häufigster Auslöser für Lungenentzündungen, die nicht im Krankenaus erworben wurden. Das Risiko für eine schwer verlaufende Pneumokokken-Erkrankung
ist unter anderem abhängig vom Lebensalter. Vielen Patientinnen und Patienten ist nicht bewusst, dass eine Impfung gegen Pneumokokken für ab 60-Jährige als Standard empfohlen wird. Informationen zur Impfung finden sich auf www.pneumokokken-impfen.de Ärzte und Ärztinnen können sich auf dem bereits bekannten Portal www.msdconnect.de über Risikozielgruppen und Impfschemata informieren. ▪
Seit nunmehr zwei Jahren ist Efluelda® als erster und einziger hochdosierter tetravalenter Influenza-Impfstoff in Deutschland für Personen ab 60 Jahren zugelassen. Der Impfstoff wurde speziell für ältere Menschen entwickelt, um ihnen einen im Vergleich zu standarddosierten konventionellen tetravalenten InfluenzaVakzinen verbesserten Influenza-Schutz zu gewähren.
Daten einer randomisierten, kontrollierten Studie zeigen für den hochdosierten trivalenten Vorläufer von Efluelda® im Vergleich zu einem konventionellen, trivalenten standarddosierten InfluenzaImpfstoff eine um 24% höhere relative Wirksamkeit (rVE) bei Menschen ab 65 Jahren (1).
Prof. Ralf Dechend aus Berlin wies in diesem Zusammenhang auf die besondere Krankheitslast bei älteren Menschen hin. Alle Personen können sich mit Influenza infizieren, so Prof. Dechend. Ältere Menschen trügen aufgrund von altersbedingter Immunseneszenz, vorliegenden Grunderkrankungen oder Gebrechlichkeit ein höheres Risiko für influenzabedingte Komplikationen. „Als systemische Erkrankung erhöht die Influenza selbst bei Erwachsenen ohne Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Vorgeschichte das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse in der Zeit unmittelbar nach einer Influenza-Infektion deutlich: In den ersten drei Tagen nach einer laborbestätigten Infektion steigt das Risiko für Herzinfarkte bis um das 10-Fache“, betonte der Experte (2). ▪
Quelle: Nach einer Presseinformation von Sanofi
Literatur:
Quelle: Nach einer Presseinformation von MSD Pneumokokken
1. DiazGranados CA. et al. N Engl J Med. 2014 Aug 14;371(7):635-45. doi: 10.1056/NEJMoa1315727
2. Warren-Gash C. et al. Eur Respir J. 2018 Mar 29;51(3):1701794. doi: 10.1183/13993003.01794-2017
Immunogenität und Reaktogenität von zwei hexavalenten Impfstoffen
Fotos: stock.adobe.com/Diana_Drubig (oben), stock.adobe.com/crevis (unten r.)
Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ein weit verbreitetes und ansteckendes Virus, das zu den häufigsten Ursachen von Atemwegsinfektionen in den Wintermonaten zählt. Während eine RSV-Infektion in der Mehrzahl der Fälle nur milde Symptome hervorruft, kann es auch zu schweren Verläufen mit Hospitalisierung und Todesfällen kommen. Risikopatienten sind neben Frühgeborenen und Kindern mit pulmonalen Vorerkrankungen vor allem ältere Erwachsene (60+). Insbesondere bei bestehenden Grunderkrankungen wie beispielsweise COPD, Herz- oder terminalen Nierenerkrankungen sowie bei immundefizienten oder immunsupprimierten Personen besteht ein noch höheres Risiko für schwere RSV-Infektionen und Komplikationen.

Erstmals steht mit Arexvy von GSK ein Impfstoff gegen RSV zur Verfügung. Arexvy ist indiziert zur aktiven Immunisierung älterer Erwachsener zur Prävention RSV-bedingter Erkrankungen der unteren Atemwege und damit das erste hierzulande zugelassene RSV-Vakzin für Erwachsene ab
60 Jahren. So können durch RSV besonders gefährdete Menschen rechtzeitig vor der nächsten RSV-Saison, die üblicherweise im Herbst beginnt, vor der Infektion und ihren Folgen geschützt werden. ▪
Quelle: Nach einer Presseinformation von GSK
In den Sommermonaten werden jedes Jahr die meisten Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) gemeldet (1). Doch die Gefahr ist danach nicht gebannt: Im Jahr 2022 wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) für Oktober und November zusammen
82 FSME-Fälle gemeldet (2,3). Entsprechend sollten sich Menschen, die in einem FSME-Risikogebiet mit Zecken in Kontakt kommen können, auch noch im Herbst gegen das Virus impfen lassen – denn für die Zeckenaktivität sind
Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad ausreichend (4,5). Durch die Schnellimmunisierung kann bei Kindern ab einem Jahr und Erwachsenen je
nach verwendetem Impfstoff auch noch kurzfristig mit zwei bzw. drei Impfdosen innerhalb weniger Wochen ein ausreichender Impfschutz für die laufende Zeckensaison aufgebaut werden (6). ▪
Quelle: Nach einer Presseinformation von Pfizer
Literatur:
1. RKI. Epid Bull 2023;9:3–22
2. RKI. Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten. Epid Bull 2022;40:48
3. RKI. Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten. Epid Bull 2022;48:28
4. www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/ Merkblaetter/Ratgeber_FSME.html; Abrufda-tum: 07.08.2023
5. Gray JS et al. Ticks Tick-Borne Dis 2016;7(5):992–1003
6. STIKO und DTG. Epid Bull 2023;14:1–194

Rötungen auf der Haut, Abgeschlagenheit, manchmal auch Fieber: Die Symptome eines Herpes zoster (HZ) im Anfangsstadium sind oft unspezifisch –und erschweren Allgemeinärzten damit die Diagnose. Dabei ist der schnelle Befund gerade bei einem HZ entscheidend, da die Zeit drängt. Gemäß
S2k-Leitlinie sollte der Patient innerhalb der ersten Tage nach Symptombeginn einen Arzt aufsuchen, der die beginnende Gürtelrose erkennt und sofort eine antivirale Therapie einleitet. Verzögerungen könnten den Therapieerfolg beeinträchtigen und schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.
Denn gerade bei zu später Diagnose besteht ein erhöhtes Risiko für Langzeitfolgen wie die Post-Zoster-Neuralgie: Bis zu 30% der Betroffenen entwickeln im Nachgang zur HZ-Episode chronische Nervenschmerzen. Zudem ist auch das Risiko für Gefäßerkrankungen wie ein Schlaganfall oder Herzinfarkt sowie für Lähmungen nach einem HZ höher.
Die HZ-Impfung mit dem Totimpfstoff kann wirksam und mindestens 10 Jahre vor einer Gürtelrose, Schmerzen und Langzeitfolgen schützen. Die STIKO empfiehlt sie allen Personen ab 60 Jahren, bei Patienten mit chronischen Grunderkrankungen gilt die Empfehlung bereits ab 50 Jahren. Klären Sie Ihre Patienten jetzt über Herpes zoster und den möglichen Schutz davor auf. ▪
Quelle: Nach einer Presseinformation von GSK
Humane Papillomviren sind so verbreitet, dass sich die meisten Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens anstecken (1). Dabei erkranken jährlich etwa 7.850 Menschen in Deutschland an Krebs, der auf eine Infektion mit HPV zurückzuführen ist (2). In Deutschland sterben täglich 4 Frauen an Gebärmutterhalskrebs (3). Aber HPV-Infektionen sind nicht nur für Frauen ein Risiko, sondern betreffen auch Männer. Jungen bzw. Männer können sich nicht nur mit HPV anstecken und möglicherweise schwer daran erkranken, sondern können die Viren auch weitergeben. Mit einer Impfung kann nicht nur bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen vorgebeugt werden, sondern auch die Übertragung auf Partnerinnen unterbrochen werden, womit auch Männer einen Beitrag zur Bekämpfung des Zervixkarzinoms leisten können (4). Eine Impfquoten zugrunde liegende Modellberechnung ermittelte, dass durch die HPV-Impfung von Mädchen die Häufigkeit
von Gebärmutterhalskrebs im Verlauf der nächsten 100 Jahre in Deutschland um mehr als die Hälfte gesenkt werden kann, was 163.000 weniger Erkrankungen bedeuten würde (5). Würde man bei Jungen eine vergleichbare Impfquote erreichen, könnten zusätzlich mehr als 76.000 weitere HPV-bedingte Krebsfälle bei Frauen und Männern in Deutschland verhindert werden (5). Gardasil® 9 ist zugelassen zur aktiven Immunisierung von Personen ab einem Alter von 9 Jahren gegen Vorstufen
maligner Läsionen und Karzinome der Zervix, Vulva, Vagina und des Anus, die mit den HPV-Typen 16, 18, 31, 33, 45, 52 und 58 assoziiert sind und gegen Genitalwarzen (Condylomata acuminata), die durch die HPV-Typen 6 und 11 verursacht werden (6). ▪
Quelle: Nach einer Presseinformation von MSD
Literatur:
1. Gesundheitsinformation.de. IQWiG HPV 2021: Gebärmutterhalskrebs, HPV [eingesehen am 01.03.23]. www.gesundheitsinformation.de/ humane-papillomviren-hpv.html
2. Zentrum für Krebsregisterdaten. Häufigkeit HPV-bedingter Krebsarten in Deutschland; 2018 [eingesehen am 15.02.23]. www.krebsdaten.de/ Krebs/DE/Content/Publikationen/Kurzbeitraege/ Archiv2018/2018_3_Thema_des_Monats_inhalt.html
3. Zentrum für Krebsregisterdaten. Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) [eingesehen am 20.02.23]. www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/ Gebaermutterhalskrebs/gebaermutterhalskrebs_ node.html
4. RKI. Epid Bull 2018; (26):233-250
5. Robert Koch-Institut (RKI). Kurz & Knapp: Faktenblätter zum Impfen: HPV-Impfung; 2019 [eingesehen am 15.02.23]. www.rki.de/DE/Content/ Infekt/Impfen/Materialien/Faktenblaetter/HPV. pdf?__blob=publicationFile
6. Fachinformation Gardasil® 9. Stand März 2023
Bei Temperaturen oberhalb von 8° Celsius gibt es überall Zecken, ob im eigenen Garten, im Park oder im Wald. Bedingt durch den Klimawandel besteht somit bis in den Spätherbst hinein und auch im Winter bei milden Temperaturen ein reelles Infektionsrisiko für Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSME). Das hauptsächlich durch Zecken übertragene FSME-Virus kann schwere neurologische Schädigungen verursachen und in seltenen Fällen zum Tod führen (1). In der Regel verläuft die FSME biphasisch und ist mit grippeähnlichen Beschwerden in der ersten Phase schwer zu diagnostizieren (2). Es gibt keine kausale Therapie. Einen bestmöglichen Immunschutz kann nur eine Impfung erreichen (3).
Eine Impfung gegen FSME ist von der STIKO empfohlen für Personen, die in vom RKI ausgewiesenen Risikogebieten wohnen, dort arbeiten oder hinreisen und dabei ein Risiko für Zeckenstiche haben (3). Beispiels-
weise können die Impfstoffe Encepur für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren und Encepur für Kinder im Alter 1 bis 11 Jahre eingesetzt werden (4,5). Ein Schnellschema ermöglicht eine vollständige Grundimmunisierung innerhalb von drei Wochen mit einer ersten Auffrischimpfung nach 12 bis 18 Monaten. ▪
Quelle: Nach einer Presseinformation von Bavarian Nordic. DE-TDA-2300020
Literatur:
1. ECDC. Fact sheet about tick-borne encephalitis (TBE) www.ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet.Letzter Zugriff: Juli 2023
2. RKI Ratgeber für Ärzte „Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)“ www.rki.de/DE/Content/Infekt/ EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_FSME.html, April 2022
3. Epidemiologisches Bulletin Nr. 9 2023, März 2023
4. Encepur® Erwachsene Fachinformation
5. Encepur® Kinder Fachinformation
Impfen bei Jungen würde HPV-bedingte Todesfälle
bei Frauen und Männern reduzieren



Derzeit ist PNEUMOVAX® 23 der einzige Impfstoff in Deutschland, der die Voraussetzungen der STIKO-Empfehlung für die PneumokokkenStandardimpfung 60+ erfüllt.1



Für Patient:innen mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko, aufgrund einer Grunderkrankung, empfiehlt die STIKO altersunabhängig eine Pneumokokken-Impfung. Abhängig von Indikation und Alter wird entweder eine Impfung mit PPSV23 oder eine sequenzielle Impfung mit PCV13 gefolgt von PPSV23 von der STIKO empfohlen.1







PNEUMOVAX® 23







Weitere Informationen zu PNEUMOVAX® 23 und allen geeigneten Patient:innen finden Sie hier https://m.msd.de/schema






PNEUMOVAX® 23 ist vollumfänglich lieferbar.














PCV13: 13-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff | PPSV23: 23-valenter Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff 1 Ständige Impfkommission: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut 2023 Epid Bull 2023;4:3-68
Wirkstoff: Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Impfdosis (0,5 ml) enth. jeweils 25 Mikrogramm der folg. 23 Pneumokokken-Polysaccharid-Serotypen: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. Sonst. Bestandt.: Phenol, Natriumchlorid, Wasser für Injekt.-zwecke Anw.: Empf. f. Kdr. ab 2 J., Jugendl. und Erw. zur aktiven Immunisierung gg. Krankh., die durch Pneumokokken hervorgerufen werden. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. die Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt. Vorsicht bei: Elektiver Splenektomie. Geplanter od. abgeschloss. Chemo- od. Strahlenther., od. and. immunsuppr. Behandl. Pat. m. krankheits- od. therapiebedingter Immunsuppression. Ältere Pat. ≥ 65 J. Bes. gefährdeten Pat. (z. B. bei Asplenie od. nach immunsuppressiver Therapie). Pers. m. Schädelbasisbruch od. off. Verletz. d. Liquorraumes. Nicht empf.: Impf. während Chemo- od. Strahlenther. Wiederholungsimpf. nach weniger als 3 J. od. v. gesund. Erw. od. Kdrn. Vorliegen e. schweren, mit Fieber einhergeh. od. e. and. akuten Erkrankung od. wenn eine systemische Reaktion ein signifikantes Risiko darstellen würde. Schwangerschaft. Stillzeit. Nebenw.: Sehr häufig: Fieber (≤ 38,8 °C); Lokalreaktionen an der Injekt.-stelle (Erythem, Verhärtung, Schmerz, Schmerzhaftigkeit, Schwellung, Überwärmung). Selten: Starke Schwellung der geimpften Gliedmaße (in kurzem zeitl. Abstand zur Impf.). Nicht bekannt: Hämolytische Anämie (bei Pat., die früher hämatologische Erkrank. hatten); Leukozytose; Lymphadenitis; Lymphadenopathie; Thrombozytopenie (bei Pat. mit stabilisiert. idiopathischer thrombozytopenischer Purpura). Anaphylaktoide Reakt.; Angioödem; Serumkrankheit. Fieberkrämpfe; Guillain-Barré-Syndrom; Kopfschmerzen; Parästhesie; Radikuloneuropathie. Übelkeit; Erbrechen. Ausschlag; Urtikaria. Arthralgie; Arthritis; Myalgie. Abgeschlagenheit; Schüttelfrost; Fieber; Bewegungseinschränkung (in der Extremität, in die der Impfstoff verabreicht wurde); Unwohlsein; Peripheres Ödem (in der Extremität, in die der Impfstoff verabreicht wurde). Erhöhtes C-reaktives Protein. Zusätzlich: Müdigkeit. Warnhinw.: Nicht intravasal verabreichen. Intradermale Inj. vermeiden. Für den Fall e. akuten anaphylaktischen Reakt. geeignete medizin. Behandlungsmaßn. (inkl. Adrenalin) bereitstell. Frühest. 3 Monate nach Abschluss einer Chemo- u./od. Strahlentherapie verabr. Bei hoch dosierter od. längerer immunsuppressiver Behandlung evtl. noch größerer Abstand angemessen. Hinw.: Notwendige Antibiotika-Prophylaxe gg. Pneumokokken-Infekt. sollte nach Impf. fortgeführt werden. Impfschemata sind den offiziellen Impfempf. zu entnehmen. Der Impfstoff schützt nicht gg. akute Otitis media, Sinusitis od. and. weit verbreitete Infekt. d. oberen Atemwege.











NICHT GEGEN HERPES ZOSTER ZU IMPFEN, KANN INS AUGE GEHEN. ANSPRECHEN. AUFKLÄREN. IMPFEN.

Für eine vollständige Auflistung der Kontraindikation, Warnhinweise und Nebenwirkungen siehe Fachinformation.
Jetzt
scannen und mehr erfahren:
SHINGRIX. Wirkstoff: Shingrix Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension, Herpes-Zoster-Impfstoff (rekombinant, adjuvantiert). Zusammensetzung: Nach der Rekonstitution enthält eine Dosis (0,5 ml): 50μg Varizella Zoster Virus Glykoprotein-E-Antigen, hergestellt in immortalisierten Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO); adjuvantiert mit AS01B, dieses enthält: 50 μg Pflanzenextrakt aus Quillaja saponaria Molina, Fraktion 21 (QS-21) und 50 μg 3-O-Desacyl-4’-monophosphoryl-Lipid A (MPL) aus Salmonella minnesota. Sonstige Bestandteile: Saccharose, Polysorbat 80, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Kaliummonohydrogenphosphat, Colfosceriloleat (DOPC), Cholesterol, Natriumchlorid, wasserfreies Natriummonohydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.
Anwendungsgebiete: Aktive Immunisierung zur Vorbeugung von Herpes Zoster (HZ) und postzosterischer Neuralgie (PZN) bei Erwachsenen im Alter von 50 Jahren und älter und bei Erwachsenen ab 18 Jahren mit erhöhtem Risiko für einen Herpes zoster. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder sonstige Bestandteile des Impfstoffes. Akute, schwere, fiebrige Erkrankung. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen, gastrointestinalen Beschwerden (einschließlich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und/oder Bauchschmerzen), Myalgie, Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Rötung, Schwellung), Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber. Häufig: Pruritus an der Injektionsstelle, Unwohlsein. Gelegentlich: Lymphadenopathie, Arthralgie. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen einschließlich Hautausschlag, Urtikaria, Angioödem. Verschreibungspflichtig. Stand: Dezember 2022. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München. de.gsk.com
WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DAS ARZNEIMITTEL: Dosierung: Als i.m. Injektion: 2x1 Dosis (0,5 ml) mit einem Abstand von 2 Monaten. Falls erforderlich, kann die zweite Dosis im Abstand von 2 bis 6 Monaten nach der ersten Dosis verabreicht werden. Bei Personen, die krankheitsbedingt oder durch eine Therapie immundefizient oder immunsupprimiert sind oder werden könnten und die von einem kürzeren Impfschema profitieren würden, kann die zweite Dosis 1 bis 2 Monate nach der ersten Dosis verabreicht werden. Warnhinweise laut Fachinformation: Der Impfstoff darf nicht intravasal oder intradermal verabreicht werden. Es kann als psychogene Reaktion auf die Nadelinjektion nach oder sogar vor einer Impfung zu einer Synkope (Ohnmacht) kommen. Weitere Informationen siehe Fachinformation. Nebenwirkungen melden Sie bitte ggf. bei der GSK-Hotline: 0800-1223355 Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51–59, 63225 Langen, Tel: +49 6103 77 0, Fax: +49 6103 77 1234, Website: www.pei.de zu melden. Shingrix ist eine eingetragene Marke oder lizenziert unter der GSK Unternehmensgruppe.