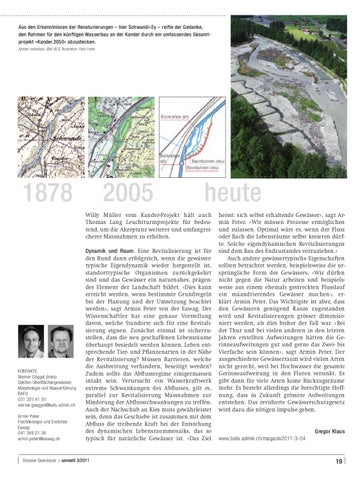Aus den Erkenntnissen der Renaturierungen – hier Schwandi-Ey – reifte der Gedanke, den Rahmen für den künftigen Wasserbau an der Kander durch ein umfassendes Gesamtprojekt «Kander.2050» abzustecken. Karten: swisstopo; Bild: BLS; Illustration: Felix Frank
Blockrampe (alt)
Blockrampe (alt)
1878
2005
Baumbuhnen (neu) Blockbuhnen (neu)
heute
Willy Müller vom Kander-Projekt hält auch Thomas Lang Leuchtturmprojekte für bedeutend, um die Akzeptanz weiterer und umfangreicherer Massnahmen zu erhöhen.
KONTAKTE Werner Göggel (links) Sektion Oberflächengewässer, Morphologie und Wasserführung BAFU 031 325 41 35 werner.goeggel@bafu.admin.ch Armin Peter Fischökologie und Evolution Eawag 041 349 21 36 armin.peter@eawag.ch
Dynamik und Raum. Eine Revitalisierung ist für den Bund dann erfolgreich, wenn die gewässertypische Eigendynamik wieder hergestellt ist, standorttypische Organismen zurückgekehrt sind und das Gewässer ein naturnahes, prägendes Element der Landschaft bildet. «Dies kann erreicht werden, wenn bestimmte Grundregeln bei der Planung und der Umsetzung beachtet werden», sagt Armin Peter von der Eawag. Der Wissenschaftler hat eine genaue Vorstellung davon, welche Standorte sich für eine Revitalisierung eignen. Zunächst einmal ist sicherzustellen, dass die neu geschaffenen Lebensräume überhaupt besiedelt werden können. Leben entsprechende Tier- und Pflanzenarten in der Nähe der Revitalisierung? Müssen Barrieren, welche die Ausbreitung verhindern, beseitigt werden? Zudem sollte das Abflussregime einigermassen intakt sein. Verursacht ein Wasserkraftwerk extreme Schwankungen des Abflusses, gilt es, parallel zur Revitalisierung Massnahmen zur Minderung der Abflussschwankungen zu treffen. Auch der Nachschub an Kies muss gewährleistet sein, denn das Geschiebe ist zusammen mit dem Abfluss die treibende Kraft bei der Entstehung des dynamischen Lebensraummosaiks, das so typisch für natürliche Gewässer ist. «Das Ziel
Dossier Gewässer > umwelt 3/2011
heisst: sich selbst erhaltende Gewässer», sagt Armin Peter. «Wir müssen Prozesse ermöglichen und zulassen. Optimal wäre es, wenn der Fluss oder Bach die Lebensräume selbst kreieren dürfte. Solche eigendynamischen Revitalisierungen sind dem Bau des Endzustandes vorzuziehen.» Auch andere gewässertypische Eigenschaften sollten betrachtet werden, beispielsweise die ursprüngliche Form des Gewässers. «Wir dürfen nicht gegen die Natur arbeiten und beispielsweise aus einem ehemals gestreckten Flusslauf ein mäandrierendes Gewässer machen», erklärt Armin Peter. Das Wichtigste ist aber, dass den Gewässern genügend Raum zugestanden wird und Revitalisierungen grösser dimensioniert werden, als dies bisher der Fall war. «Bei der Thur und bei vielen anderen in den letzten Jahren erstellten Aufweitungen hätten die Gerinneaufweitungen gut und gerne das Zwei- bis Vierfache sein können», sagt Armin Peter. Der ausgeschiedene Gewässerraum wird vielen Arten nicht gerecht, weil bei Hochwasser die gesamte Gerinneaufweitung in den Fluten versinkt. Es gibt dann für viele Arten keine Rückzugsräume mehr. Es besteht allerdings die berechtigte Hoffnung, dass in Zukunft grössere Aufweitungen entstehen. Das revidierte Gewässerschutzgesetz wird dazu die nötigen Impulse geben. Gregor Klaus www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-04
19