
12 minute read
Florian Arlt Herausforderungen an die Qualifizierung von Fachkräften in der Offenen Jugendarbeit
Florian Arlt
HERAUSFORDERUNGEN AN DIE QUALIFIZIERUNG VON FACHKRÄFTEN IN DER OFFENEN JUGENDARBEIT
Advertisement
Die Offene Jugendarbeit stellt einen bedeutenden Sozialisationsort für Jugendliche dar. Jugendliche benötigen Experimentierfelder und Gestaltungsräume, welche auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und in denen sie sich frei entwickeln können. Sie müssen als gleichwertige Partner*innen von Erwachsenen anerkannt werden und an der Entwicklung der Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen sowie im Hinblick auf lokale, regionale und überregionale Fragestellungen beteiligt werden. Jugendliche brauchen Zugang zu jenen Informationen, die sie für die Mitgestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft benötigen und sie müssen die Möglichkeit von der Erwachsenenwelt bekommen, sich in die anstehenden Entscheidungen einbringen zu können (vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung 2016, S. 5f.).
Die Modernisierung der Gesellschaft geht auch mit erheblichen Veränderungen der Lebenswelten von Jugendlichen einher. Diese Entwicklung wird unter anderem durch einen Bedeutungswandel der traditionellen Familie beschleunigt, der dazu geführt hat, dass immer mehr Aufgabenbereiche von Erziehung und Bildung außerhalb des Elternhauses erworben werden. Diese gesellschaftliche Entwicklung dürfte nachhaltig und tatsächlich erst der Anfang sein. Demgegenüber scheint der zunehmende Leistungsdruck in der Gesellschaft für viele Jugendliche nur mehr schwer zu bewältigen. In Anbetracht der weitreichenden Änderungen der Lebenswelten von Jugendlichen werden wir uns von der Idee verabschieden müssen, dass die etablierten Sozialisationsinstanzen in den traditionellen Formen noch Gültigkeit haben (vgl. ebd.).
Woraus lässt sich nun die spezifische Bedeutung der Offenen Jugendarbeit als Sozialisationsinstanz für Jugendliche erklären? Sie liegt in der Lebensphase Jugend begründet, die mit ihren Entwicklungsaufgaben und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine besondere Herausforderung für Jugendliche darstellt. Die Offene Jugendarbeit als eigenständiges Feld der Sozialen Arbeit leitet daraus einen spezifischen Erziehungs- und Bildungsauftrag ab, der mit bestimmten Mandaten, Zielgruppen, Zielen, Leistungen und Wirkungen sowie Rahmenbedingungen verbunden ist. Eine Haltung nach menschenrechtsbasierten ethischen Grundprinzipien sowie die Orientierung an fachlich-konzeptionellen und methodischen Standards der Sozialen Arbeit fließen als Merkmale einer professionellen Offenen Jugendarbeit in die Angebote ein. Ein solches Professionsverständnis führt zu individuell und gesellschaftlich relevanten Potenzialen einer zukunftsorientierten Offenen Jugendarbeit und ihrer Fachkräfte.
Die Lebensphase Jugend
Die Lebensphase Jugend ist durch eine besonders dichte Staffelung von Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet, von deren Bewältigung der gesamte weitere Lebenslauf abhängt. Im Jugendalter stellt sich die grundlegende Aufgabe der Verbindung von persönlicher Individuation und sozialer Integration lebensgeschichtlich zum ersten Mal. Deren Lösung ist die Voraussetzung für die Ausbildung einer Ich-Identität, die ein wesentlicher Schritt für das Finden der eigenen Rolle in der Gesellschaft ist. Gelingt dieser Schritt nicht, kommt es – laut Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erikson (1950) – zur Identitätsdiffusion, einer entwicklungsspezifischen Krise, die den weiteren Entwicklungsverlauf eines Individuums beeinflusst. Deshalb läuft die Auseinandersetzung mit der körperlichen und psychischen Innenwelt und mit der sozialen und gegenständlichen Außenwelt meist in einer besonders intensiven und oft auch turbulenten Form ab, die sich nur wenig mit der in anderen Lebensphasen vergleichen lässt.
Die Lebensphase Jugend hat in den letzten drei Generationen ihren Charakter deutlich verändert. Sie ist heute nicht mehr nur eine Übergangsphase zwischen dem abhängigen Kindheits- und dem unabhängigen Erwachsenenstatus, sondern ein Lebensabschnitt mit eigenen Rechten und Pflichten. Sie hat
auch in den letzten 50 Jahren ihren Zeitumfang noch einmal stark ausgedehnt. In den hoch entwickelten Ländern umfasst die Lebensphase Jugend inzwischen eine Spanne von im Durchschnitt etwa 15 Lebensjahren. Die Pubertät setzt immer früher ein, und der Übergang ins Erwachsenenleben – mit der Erlangung der ökonomischen Selbstständigkeit und der Gründung einer eigenen Familie – erfolgt immer später. Die Lebensphase Jugend bietet dadurch auf der einen Seite große Freiräume für die Gestaltung der Lebensführung, verlangt auf der anderen Seite aber außerordentlich hohe Kompetenzen, um diese Freiräume produktiv nutzen zu können. Die Mehrheit der Angehörigen der jungen Generation ist in der Lage, mit diesen gestiegenen Anforderungen an die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben erfolgreich umzugehen, aber eine Minderheit von etwa einem Fünftel eines jeden Jahrgangs zeigt mehr oder weniger deutliche Überforderungssymptome. Zu den Überforderten gehören besonders viele Jugendliche aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und auffällig viele männliche Jugendliche (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012).
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
Das Konzept der Entwicklungsaufgaben, erstmals entwickelt von Robert J. Havighurst (1948), geht von spezifischen, altersentsprechenden Aufgaben aus, die sich in den jeweiligen Lebensperioden des Individuums stellen. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu Zufriedenheit, während eine Nichtbewältigung nicht nur individuelle Unzufriedenheit hervorruft, sondern auch auf Ablehnung durch die Gesellschaft stößt und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer Aufgaben führt. Die aufeinander einwirkenden Faktoren, die über die Bewältigung der Aufgaben entscheiden, liegen in den biologischen Anlagen des Individuums, in den Anforderungen seitens der Gesellschaft und in allgemeinen Werten bzw. in Zielen, das sich das entwickelnde Individuum selbst setzt (vgl. Havighurst 1953).
Der Soziologe Klaus Hurrelmann (2012) hat Havighursts Konzept weiterentwickelt und für das Jugendalter vier wichtige Entwicklungsaufgaben benannt:
1. Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz, um selbstverantwortlich schulischen und beruflichen Anforderungen nachkommen und so die Voraussetzung für eine selbstständige Existenz als Erwachsener sichern zu können;
2. Entwicklung der eigenen Geschlechtsrolle und des sozialen Bindungsverhaltens zu Gleichaltrigen des anderen sowie des eigenen Geschlechts, Aufbau einer Partnerbeziehung als langfristige Voraussetzung für die Erziehung eigener Kinder;
3. Entwicklung eines eigenen Werte- und Normensystems sowie eines ethnischen und politischen Bewusstseins, dem mit dem eigenen Verhalten und Handeln Rechnung getragen wird;
4. Entwicklung eigener Handlungsmuster für den Umgang mit Konsumwaren und des kulturellen Freizeitmarktes (einschließlich Medien und Genussmittel), um einen eigenen Lebensstil zu entwickeln und autonom sowie bedürfnisorientiert mit entsprechenden Angeboten umgehen zu können (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2012).
Diese Entwicklungsaufgaben zeigen, wie weitreichend die Anforderungen an Jugendliche in dieser Lebensphase sind. Sie müssen bewältigt werden, damit sich der/die Jugendliche als Erwachsene/r im sozialen und gesellschaftlichen Leben gut zurechtfinden kann. Bewältigung kann hierbei als stetiges Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit gesehen werden, das im Spannungsfeld zwischen Selbstwert, Anerkennung und Selbstwirksamkeit (vgl. Böhnisch 2016) einen wichtigen Aspekt der jugendlichen Sozialisation darstellt.
Aufgabenstellungen für eine Qualifizierung von Fachkräften
Um die Qualität der Offenen Jugendarbeit weiterzuentwickeln, ist es ein Anliegen, die Ausbildung für die Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit weiterzuentwickeln und den Bedarfen österreichweit gerecht zu werden. Durchaus besteht der Anspruch, für Österreich innovativ zu sein. Abgeleitet aus der Studie von Gspurning und Heimgartner (2016) können die folgenden Aufgabenstellungen benannt werden:
Regulär oder weiterbildungsorientiert: Organisatorisch außer Reichweite, aber grundsätzlich interessant ist die Frage, inwieweit die in der Jugendarbeit in Österreich Tätigen und die Jugendlichen es verdienen würden, ein reguläres Studium zu besitzen. Realisierbar ist eine akademische Ausbildung derzeit über Lehrgänge zur Weiterbildung.
Durchlässigkeit: Wenn Studierende zwei, drei oder
mehr Jahre in einen Lehrgang investieren und Gefallen am Studieren finden, dann soll eine tertiäre Fortsetzung möglich und nicht ein Neubeginn bei einem Bachelorstudium nötig sein.
Ausmaß: Die Ausbildung soll intensiv und so umfangreich sein, dass sie die Fachkräfte ausreichend kompetent für die komplexe Aufgabe macht, sie soll auch so schlank und bewältigbar sein, dass sie ein berufsbegleitendes Studium ermöglicht.
Spezifität: Die Ausbildung soll die Offene Jugendarbeit in das Zentrum rücken. Zugleich soll sie so offen sein, dass sie benachbarte Handlungsfelder mitdenkt, u. a. Schulsozialarbeit, Jugendcoaching, Streetwork, Kinder- und Jugendhilfe. Die Breite ist für einen etwaigen späteren Berufswechsel dienlich.
Allzuständigkeit: Die Offene Jugendarbeit trägt in sich eine hohe Komplexität und Vielfalt. So ist die Wichtigkeit der Jugendarbeit aus vielen Richtungen zu begründen: Bildung, Gesundheit, Alltagsgestaltung, Knüpfen und Pflegen von Freundschaften, Beratung und Case Management, Finden von Beruf und Ausbildung, Gestaltung von intimen und familiären Beziehungen, jugendkulturelle Selbstfindung, Politik, Breitensport oder soziokulturelle Entwicklung.
Angewandtheit: Zum einen sollen fachliche Grundlagen und Theorien zu Jugend und Menschsein, Gesellschaft und Wissenschaft vermittelt werden, zum anderen ist es wichtig, möglichst angewandt und konkret auf das Berufsfeld vorzubereiten. Es geht neben einer Wissensebene vor allem um eine Reflexion der Praxis in der Offenen Jugendarbeit und um die Ebenen der persönlichen berufsbezogenen ethischen Haltungen und des professionellen Könnens.
Heterogenität der Studierenden: Die Ausbildung soll es ermöglichen, dass erfahrene Mitarbeiter*innen aus dem Praxisfeld an ihr teilnehmen können und Neueinsteiger*innen damit einen guten, fachlich fundierten Einstieg schaffen. Bei den Neueinsteiger*innen ist zudem zwischen Personen mit und ohne Matura zu unterscheiden. Für Absolvent*innen von tertiären Studien kann eine Teilnahme sinnvoll sein, weil sich dadurch eine spezifische Hinführung zur Jugendarbeit ergeben kann.
Modulaufbau: Es stellt sich die Frage, inwieweit man den unterschiedlichen Interessen von möglichen Zielgruppen und Bedarfen eines dynamischen Handlungsfeldes nachkommen kann und verschiedene Module anbietet, die partiell belegt werden können. Dies ist insbesondere von der finanziellen Abwicklung und der Logistik her eine Herausforderung.
Anerkennung im Berufsfeld: Die Anerkennung einer Ausbildung im Berufsfeld ist nur in Ansätzen von einer Ausbildung selbst zu beeinflussen. Die Zugänge werden in der Regel seitens des Handlungsfeldes bestimmt. Eine neu geschaffene Ausbildung muss sich demnach erst um Anerkennung bemühen. Das Handlungsfeld kann allerdings in ihrem Einflussbereich die Akzeptanz mitgestalten (vgl. Gspurning/Heimgartner 2016).
Ausblick
Die Offene Jugendarbeit bietet mit ihren spezifischen Angeboten vielfältige Erziehungs- und Bildungschancen, insbesondere für soziale und personale Kompetenzen, die an anderen Sozialisationsorten, auch im formalen Bildungssystem nicht ausreichend vermittelt werden können. Sie orientiert sich an einem subjektorientierten, demokratischen Bildungsbegriff, der zudem durch die Berücksichtigung von Diversität unter Jugendlichen ein hohes Integrationspotenzial aufweist. Darin liegen entscheidende individuelle wie auch gesellschaftliche Chancen und Ressourcen für die Zukunft die von den zukünftigen Fachkräften begleitet und bewältigt werden müssen.
Das setzt im Sinne einer Profession der Offenen Jugendarbeit für Österreich einheitliche Ausbildungsstandards für das Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit voraus, die den Fachkräften die notwendigen Kompetenzen für ihre tägliche Arbeit und Ressourcen für die Begleitung im Interesse von den Jugendlichen Bedarfen gewährleistet und gerecht werden kann. Ziel ist es, dass alle Akteur*innen der Offenen Jugendarbeit also das Bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit bOJA, die österreichische Jugendpolitik sowie die unterschiedlichen Landesstrukturen von Offener Jugendarbeit gemeinsam mit den etablierten Bildungseinrichtungen sich für eine vergleichbare, anerkannte und durchlässige Ausbildung für die Offene Jugendarbeit einsetzen und als Grundlage verankern.
Literatur
Amt der Steiermärkischen Landesregierung - Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft; Fachabteilung Gesellschaft - Referat Jugend (2016): Strategische Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit des Landes Steiermark - 2017-2022. Graz.
Böhnisch, L. (2016): Lebensbewältigung. Ein Konzept für die Soziale Arbeit. Weinheim/Basel: Beltz Juventa
Erikson, E. H. (1950): Childhood and Society. New York: Norton & Company. Gspurning, Waltraud/ Heimgartner, Arno (2016). Offene Jugendarbeit in Österreich. Forschungsbericht. Universität Graz: Eigenverlag. Download: http://sozialeforschung.at/Of-fene_Jugendarbeit_digital.pdf [11.8.2017].
Havighurst, R. J. (1953): Human development and education. New York: David McKay.
Hurrelmann, K./Quenzel, G. (2012): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung. 11., vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
FLORIAN ARLT
Akad. Sozial- und Kulturpädagoge, Dipl. Mediator, 1998 bis 2006 Leitung des Jugendund Kulturzentrums HOUSE in Mureck, seit 2006 Geschäftsführer des Steirischen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit, seit 2009 Vorstandsmitglied des bundesweiten Netzwerks Offene Jugendarbeit – bOJA. Langjährige Praxis als Referent für Themen der Jugendarbeit und der Jugendpolitik.
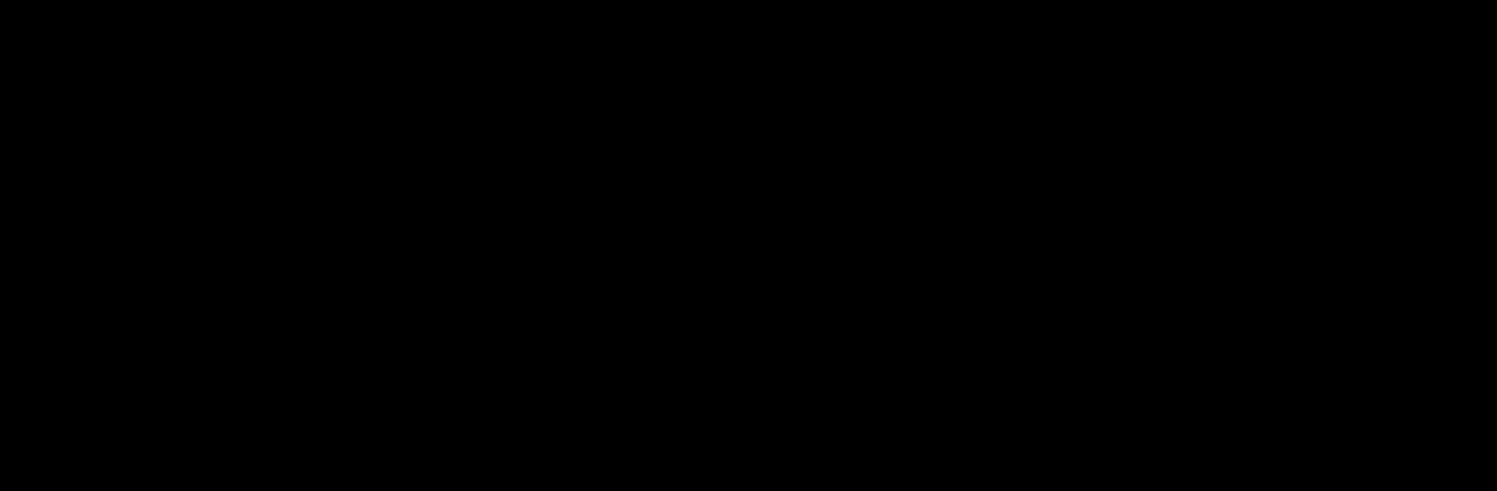
DIE ARGE PARTIZIPATION
Die „Arbeitsgemeinschaft Partizipation Österreich“, kurz ARGE Partizipation, setzt sich seit 1991 im Auftrag der Landesjugendreferent_innenkonferenz für Kinder- und Jugendbeteiligung ein.
Die Mitgliedsorganisationen der ARGE Partizipation sind: alle neun österreichischen Landesjugendreferate, das Amt für Jugendarbeit der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol, das Bundeskanzleramt – Kompetenzzentrum Jugend, die Bundesjugendvertretung, das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit sowie das Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos.
Die Arbeitsziele der ARGE Partizipation sind:
Die ARGE versteht sich als Schnittstelle und Dialogforum. Um qualitätsvolle Kinder- und Jugendbeteiligung zu fördern, koordiniert sie Aktivitäten, bündelt Kräfte und vernetzt Informationen. Im Interesse junger Menschen setzt sie Impulse und Qualitätsstandards, bietet Weiterbildungsmöglichkeiten und wirkt auf Rahmenbedingungen ein. Sie regt Entwicklungsprozesse an und fördert den Dialog zwischen PolitikerInnen und Jugendlichen sowie ExpertInnen, öffentlicher Verwaltung und Entscheidungsträger_innen auf allen Ebenen.
Dies verfolgt die ARGE unter anderem durch Veranstaltungen und Kooperationen sowie durch die Veröffentlichung von Leitfäden und Dokumentationen. Diese und weitere Informationen stehen auf www.jugendbeteiligung.at zur Verfügung. Die Ansprechpersonen der ARGE freuen sich über Ergänzungen und Kritik.
Partizipation als Recht
Diese Grundhaltung prägt einerseits die tägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, andererseits aber auch Projekte, die gezielt zur Beteiligung von jungen Menschen umgesetzt werden. Mehr dazu unter www.jugendbeteiligung.at/beteiligung-als-recht.
Kinder- und Jugendbeteiligung ist Querschnittsthema
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für junge Menschen, sich auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene in Jugendpolitik einzubringen. Erste Anknüpfungspunkte bietet jedenfalls das unmittelbare Lebensumfeld von jungen Menschen: in der Familie, Freizeit, Schule und Ausbildung.
Jugendarbeit und Partizipation
Jugendarbeit bietet vielfältige Gelegenheiten der aktiven Beteiligung und Demokratiebildung, bei denen junge Menschen Handlungsfähigkeiten entwickeln sowie Anerkennung und Selbstwirksamkeit erleben. Sie unterstützt Jugendliche in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, ihre persönlichen, lebensweltspezifischen, gesellschaftlichen und politischen Interessen zu artikulieren oder vertritt diese stellvertretend, wo dies notwendig erscheint. Dadurch trägt sie dazu bei, dass jeweils individuelle Formen der Beteiligung anerkannt und wertgeschätzt werden. Jugendarbeit initiiert und gestaltet Beteiligungsprozesse zielgruppen-, diversitäts- und gendergerecht mit dem Ziel, allen Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. (vgl. www.jugendarbeitinoesterreich.at/thema-partizipation)
Qualitätskriterien für Kinder- und Jugendbeteiligung
Alle Leitfäden der ARGE Partizipation finden sich unter www.jugendbeteiligung.at/materialien. Sie sind als Orientierung und Argumentationshilfe für die Umsetzung von Beteiligung gedacht. Wesentliche Kriterien für ein qualitätsvolle Beteiligung sind: verschiedenen Generationen.
Begleitung Erwachsene, die über entsprechende pädagogische und methodische Ausbildung oder Erfahrung verfügen, stehen beratend und unterstützend zur Seite. Sie stellen die Verbindung zu den Entscheidungsstrukturen (Politik, Verwaltung, Schulen usw.) sicher und sorgen für kinder- und jugendgerechte Prozesse.
Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit Kinder und Jugendliche beteiligen sich freiwillig und selbstbestimmt. Sie überlegen selbst, welchen Themen sie sich widmen wollen und welche Schwerpunkte sie sich setzen.
Wertschätzung Kinder und Jugendliche sind ExpertInnen ihrer Lebenswelten. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten findet respektvoll und wertschätzend statt.
Aktivität und Selbstwirksamkeit
Kinder und Jugendliche sind in möglichst allen Phasen der Projekte aktiv beteiligt und erleben bewusst, wie sie Prozesse und Veränderungen mitgestalten können.
Gemeinsame Zielformulierung Die EntscheidungsträgerInnen klären vorab die zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen und legen den Projektrahmen fest. Innerhalb dieses Rahmens definieren Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den Erwachsenen ihre Projektziele. Evaluierung
Verbindlichkeit
Gemeinsame Vereinbarungen werden verbindlich umgesetzt. Die dafür notwendigen Ressourcen liegen in der Verantwortung der EntscheidungsträgerInnen.
Überparteilichkeit Kinder und Jugendliche werden im selbstbestimmten politischen Denken gefördert und nicht für politische Richtungen vereinnahmt. Im Hinblick auf politische Parteien, Konfessionen bzw. weltanschauliche Positionen besteht Überparteilich-keit. Junge Menschen werden unterstützt, indem für ihre lichkeit eingenommen wird.
Soziale Gerechtigkeit Die Beteiligungsangebote sind gender- und diversitätsgerecht gestaltet. Zum Beteiligungsprozess wird offen eingeladen. Die unterschiedlichen Arbeitsformen sind auf die Bedürfnisse von Mädchen und Burschen abgestimmt und sprechen junge Menschen in ihrer Vielfalt an.
Intergenerativer Dialog Im Laufe des Mitbestimmungsprozesses findet ein Austausch zwischen jungen Menschen und Erwachsenen verschiedenen Alters statt. Dieser Dialog fördert das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche Bedürfnisse und Sichtweisen der
Dokumentation und Transparenz Die Schritte und Ergebnisse des Partizipationsprozesses werden laufend dokumentiert und allen Beteiligten in verständlicher Form transparent gemacht.
Öffentlichkeitsarbeit Die Öffentlichkeit (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) wird durch verschiedene, den Zielgruppen entsprechende Kanäle über den Mitbestimmungsprozess informiert. Erwachsene werden dabei für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen und das Recht junger Menschen auf Mitbestimmung sensibilisiert.
Bedürfnisse und Interessen eine (reflektierte) ParteiRahmenbedingungen, Verlauf und Ergebnisse werden gemeinsam mit allen Beteiligten reflektiert. Alle Erfahrungen (Probleme, Herausforderungen, Erfolge, Scheitern, …) sind wertvoll und fließen in zukünftige Beteiligungsprozesse ein.
Einbindung des Umfelds Im Partizipationsprozess wird das gesamte Umfeld mitgedacht und einbezogen. Dies bedeutet Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse anderer Beteiligter sowie gegebenenfalls das Erkennen und Einladen von Expert_innen aus dem Umfeld.

DAS IZ-VIELFALT, DIALOG, BILDUNG
In seiner Funktion als Nationalagentur für die EU-Jugendförderprogramme informierte das IZ Jugendarbeiter*innen auf der bOJA-Fachtagung über Fördermöglichkeiten. Dabei wurden die Programme "Erasmus+ Jugend in Aktion" und das "Europäische Solidaritätskorps" vorgestellt. Auch wurde Feedback für eine neue Broschüre eingeholt, die explizit für die Zielgruppe "Jugendarbeiter*innen" entwickelt wurde. Diese gibt einen Überblick über alle für diese Zielgruppe relevanten Fördermöglichkeiten. Von Unterstützung durch Freiwillige im eigenen Jugendzentrum über Förderung für Beteiligungs- oder Austauschprojekte für Jugendliche, bis hin zu Fortbildungen für Jugendarbeiter*innen in ganz Europa - die EU-Jugendförderprogramme bieten für Jede*n ein passendes Angebot.








