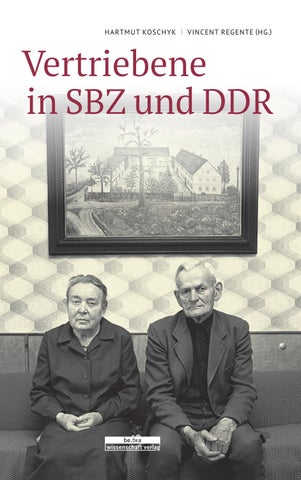3 minute read
Heimlich im Zoo – Flüchtlinge und Vertriebene in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR
Heimlich im Zoo – Flüchtlinge und Vertriebene in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR1
Gundula Bavendamm und Carl Bethke
Advertisement
Gegenstände des Alltags, im Laufe der Zeit zu musealen Objekten geworden, machen Zeitgeschichte oftmals in staunenswerter Weise lebendig. Das gilt auch für das abgebildete Tonbandgerät der Marke Kometa aus den 1970er Jahren. Es ist sowjetischen Ursprungs und gehört zur Sammlung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Der Schenker, Rudolf Arndt, hielt damit vermutlich im Dezember 1976 in der DDR heimlich Gespräche mit seiner 1900 in Romankowa (Wolhynien) geborenen Mutter fest. Das Aufnahmegerät und die Tonbänder hatte er sich seinerzeit über Kontakte zur Roten Armee besorgt.
Ganz besonders interessierte ihn, was seiner ursprünglich aus Wolhynien stammenden Mutter im Laufe ihres Lebens widerfahren war. 1915 wurde das Mädchen aus ihrem Heimatdorf hinter den Ural evakuiert beziehungsweise durch die russische Armee dorthin deportiert. 1940 folgte die sogenannte Umsiedlung aus Wolhynien in das von der Deutschen Wehrmacht besetzte »Warthegau« in Polen durch NS-Behörden. 1945 musste die nunmehr Dreißigjährige von dort vor der Roten Armee nach Deutschland fliehen. Arndt selbst war bei der Flucht drei Jahre alt und eines von zwölf Kindern. Der Stiftung überließ er 2017 nicht nur das Aufnahmegerät, sondern auch die Tonbänder. Wenn man sie abspielt, ist seine Mutter zu hören, wie sie über ihre bewegte und leidvolle Lebensgeschichte spricht. Das Gerät wird in der Dauerausstellung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung zu sehen sein.
Dieses auf den ersten Blick unscheinbare Tonbandgerät steht durch seine gleichsam verborgene Geschichte für das Thema dieses Bandes: der Umgang mit der millionenfachen Erfahrung von Flucht und Ver-
27
Das Aufnahmegerät von Rudolf Arndt, mit dem dieser die Lebensgeschichte seiner Mutter aufzeichnete.
treibung in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) beziehungsweise in der ehemaligen DDR. Obwohl eine schwerwiegende Erfahrung von Millionen Menschen, wurde ihr Schicksal in der Öffentlichkeit weitgehend beschwiegen, dadurch marginalisiert und teilweise auch tabuisiert. Vor 1990 war über diesen Teil der Geschichte der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen auch in der Bundesrepublik nur sehr wenig bekannt. Das entspricht dem bis heute häufig anzutreffenden und gerade in letzter Zeit stark diskutierten Unwissen, ja, einer mangelnden Vorstellung vom Leben in der DDR.
Im Folgenden fokussiert sich dieser Beitrag auf soziale und ökonomische Aspekte der Ankunft und Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen in Ostdeutschland bis etwa zur Zeit des Mauerbaus.
Quellenlage und Forschungsstand
Seit 1990 hat sich die Geschichte der Flüchtlinge und Vertriebenen im östlichen Teil Deutschlands als Forschungsfeld neu etabliert. Über die DDR-Zeit hat insbesondere Heike Amos geforscht. Auf Grundlage von Dokumenten der SED und Quellen des Ministeriums für Staatssicherheit veröffentlichte sie 2009 und 2011 zwei wegweisende Monographien.2 Viele andere Autoren jedoch beschränkten sich vornehmlich
28
auf die 1940er und 1950er Jahre. Zu den bekanntesten Arbeiten zählen die Habilitationsschrift von Michael Schwartz3, sowie die als Vergleich zwischen der SBZ und Polen angelegte Dissertation von Philipp Ther4 .
Diese durchaus etwas einseitige zeitliche Schwerpunktsetzung ist das Resultat einer besonderen Quellenlage: In der SBZ widmeten sich anfänglich mehrere sowjetische und deutsche Behörden auf unterschiedlichen Ebenen den Flüchtlingen und Vertriebenen, insbesondere die Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler (ZVU). Dann aber, nach Gründung der DDR 1949 und dem Görlitzer Abkommen mit Polen im darauf folgenden Jahr, verschwanden die euphemistisch als Umsiedler bezeichneten Menschen als Kategorie aus den Strukturen und Statistiken ebenso rasch wie fast vollständig. Folglich liegen viele der zur Geschichte der Vertriebenen in Westdeutschland existierenden Editionen und Quellen für Ostdeutschland nicht vor. Besondere Bedeutung haben daher andere Zeugnisse erlangt, etwa aus kirchlicher Provenienz. Eine wichtige Rolle spielen Zeitzeugeninterviews, Literatur und Film, Methoden ethnologischer Feldforschung sowie Untersuchungen zu Lebensläufen und Kollektiv-Biografien.5 Hinzu kommt, dass viele Darstellungen zur SBZ die Aufnahme von Flüchtlingen in der letzten Phase des Krieges meist nur streifen. Dabei stellen Flucht einerseits und Vertreibung andererseits eng miteinander verbundene Forschungsfelder dar. Den Mehrwert einer vergleichenden Betrachtung zeigt etwa die Studie von Martin Holz über die Insel Rügen.6
Die Situation bei Kriegsende
500.000 bis 600.000 deutsche Flüchtlinge aus Südosteuropa erreichten Deutschland bis Ende 1944, teils zu Fuß, mit Pferden und Leiterwagen in sogenannten Trecks, teils auch per Bahn. Neben Österreich und Schlesien nahmen auch Bayern, Thüringen und Sachsen Menschen auf. Beispielsweise kamen von 90.000 deutschen Flüchtlingen aus Kroatien etwa 20.000 in Thüringen unter.7 Während man zunächst noch von Evakuierung sprach, setzte sich im Grunde zeitgleich mit dem Abmarsch der Trecks aus den deutschen Siedlungsgebieten in Südosteuropa im Oktober 1944 auch bei den Behörden immer mehr der Begriff Flüchtlinge für diese Menschen durch.8 In Deutschland wurden viele dieser Entwurzelten mit Unterstützung des Volksbunds für das Deutschtum
29