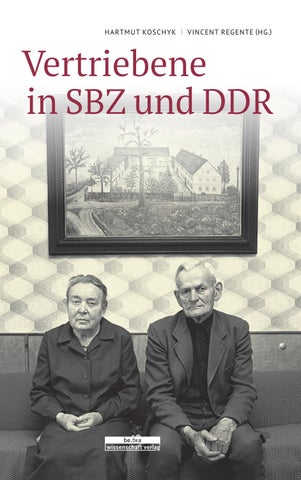6 minute read
Die Vertreibung als europäische Verflechtungsgeschichte – Ein persönliches Geleitwort
Die Vertreibung als europäische Verflechtungsgeschichte – Ein persönliches Geleitwort1
Hartmut Koschyk
Advertisement
Ich bin 1959 in der fränkischen Königstadt Forchheim als Kind heimatvertriebener Oberschlesier geboren. Ein Teil meiner Verwandten verblieb nach 1949 in Oberschlesien, einen Teil verschlug es in die Sowjetische Besatzungszone und spätere DDR, der größte Teil gelangte in die westlichen Besatzungszonen, die spätere Bundesrepublik Deutschland. Auch bei der Familie meiner Frau verhält es sich so: Ihre Eltern stammen aus Böhmen, Familienangehörige sind nach West- und Mitteldeutschland vertrieben worden oder verblieben in der angestammten Heimat.
Die Bewahrung der familiären Einheit im geteilten Deutschland war für mich von Kindheit an eine wichtige Erfahrung, legten meine Eltern doch größten Wert darauf, die familiären Bande sowohl in die DDR als auch nach Oberschlesien lebendig zu erhalten. Ab den 1970er Jahren war es auch möglich, dass Verwandte aus der DDR und aus Oberschlesien an Familienfeiern in der Bundesrepublik teilnehmen konnten. So war ein gesamtdeutsches Bewusstsein in unserer Familie kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Wirklichkeit.
In meiner Funktion als Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen (BdV) in den Jahren 1987 bis 1991 und als Vorsitzender der Arbeitsgruppe »Vertriebene und Flüchtlinge« der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von 1990 bis 2002 war ich intensiv mit dem Aufbau von Verbandsstrukturen der Heimatvertriebenen in der DDR im Zeitraum vor der deutschen Einheit befasst. Meine ersten diesbezüglichen Besuche in der DDR erfolgten unmittelbar nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989.
Überall in der im Umbruch befindlichen DDR war damals der starke Wille vieler Heimatvertriebener und ihrer Nachkommen spürbar, sich endlich offen zur angestammten Heimat, zur landsmannschaftlichen Zu-
21
gehörigkeit und zu dem erlittenen Vertreibungsschicksal zu bekennen und in entsprechenden Organisationen zusammenschließen zu dürfen.
Man wollte die neu gewonnene Freiheit dazu nutzen, um endlich gemeinsam und öffentlich über Erlebtes und Erlittenes, Heimat und Herkunft, Geschichte und Gebräuche sprechen und sich zur schicksalsgeprägten Identität bekennen zu können. Sehr schnell fanden sich in den wieder- oder neu entstehenden mitteldeutschen Bundesländern bis hinunter auf die kommunale Ebene Persönlichkeiten bereit, für die ehrenamtliche Führungsstruktur von landsmannschaftlichen Gliederungen oder des BdV zur Verfügung zu stehen. Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 gab es bereits eine stabile Verbandsstruktur des BdV und der ostdeutschen, sudetendeutschen und südostdeutschen Landsmannschaften im Beitrittsgebiet, die von unten nach oben gewachsen war.
In Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl und dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble gelang es uns als BdV-Führung, im Einigungsvertrag die Überführung des Bundesvertrieben- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) auf das Beitrittsgebiet zu übertragen, vor allem auch dessen »Kulturparagraphen« 96 mit seiner Förderverpflichtung des Bundes und der Länder für die Bewahrung des Geschichts- und Kulturerbes der Heimatvertriebenen. Aufgrund der sehr schnell gewachsenen Verbandsstrukturen des BdV und der Landsmannschaften erkannten auch die Verantwortlichen der frei gewählten DDR-Regierung unter Ministerpräsident Lothar de Maizière die Notwendigkeit, den dortigen Vertriebenen eine gesetzliche Anerkennung zu gewähren.
Zeitgleich erfolgte übrigens auch die Unterstützung des BdV für den Aufbau oder den Umbau von Organisationen der deutschen Minderheiten in den sich im Umbruch befindlichen Staaten des sogenannten »Ostblocks« und bei der Entwicklung von Förderprogrammen der Bundesregierung für diejenigen Deutschen, welche nicht in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen, sondern in ihrer angestammten Heimat in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie in der damaligen Sowjetunion verbleiben wollten.
Im Sommer 1990 lud mich Professor Manfred Wille, Historiker an der Pädagogischen Hochschule Magdeburg, zusammen mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, zu einer Tagung in die alte Kaiserstadt ein, um mir als BdV-Generalsekretär sowie Vertretern der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung die in Magdeburg bis dato erfolgten Forschungen über die Aufnahme und Eingliederung der »Umsiedler« genannten Vertriebenen in die Sowjetischen Be-
22
satzungszone und spätere DDR vorzustellen. Wir waren tief beeindruckt, wie es ihm und seinen Mitarbeitern gelungen war, noch zu DDR-Zeiten dieses »Tabu-Thema« wissenschaftlich zu bearbeiten und dabei wichtige Forschungsergebnisse zu erzielen. Wir unterstützten Professor Wille fortan bei seinen Bemühungen, mit der Forschungslandschaft hinsichtlich der Aufnahme und Eingliederung von Heimatvertriebenen in der damaligen Bundesrepublik Deutschland in Kooperation zu treten und von Seiten des Bundesministeriums des Innern auch finanzielle Unterstützung für seine weitergehende Forschung zu erhalten.
Es gelang Professor Wille, in den Jahren 1996 bis 2003 insgesamt drei wissenschaftliche Bände über die Vertriebenen in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR zu erarbeiten. Seine Tätigkeit in Forschung und Lehre konnte er nach der Fusion der Pädagogischen Hochschule mit der Otto von Guericke-Universität Magdeburg bis zu seiner Emeritierung 1999 fortsetzen. Der 2014 verstorbene Historiker hat sich um die wissenschaftliche Enttabuisierung des Schicksals der Heimatvertriebenen in der Sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR bleibende Verdienste erworben und somit einen wichtigen Beitrag für die innere Einheit Deutschlands geleistet.
In meiner Funktion als Vorsitzender der Arbeitsgruppe »Vertriebene und Flüchtlinge« der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war es mir ein wichtiges Anliegen, die Förderverpflichtung des Paragraphen 96 BVFG auch für Projekte und Einrichtungen in den damaligen neuen Bundesländern mit Leben zu erfüllen. Dies ist durch die Errichtung des Schlesischen Landesmuseums in Görlitz oder des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald sowie durch vom Bund geförderte Stiftungslehrstühle an Universitäten in den neuen Bundesländern gelungen.
Auch hat mich in dieser Parlaments-Funktion ein sozialpolitisches Thema zu Beginn der 1990er Jahre sehr stark in Anspruch genommen: die sogenannte »Einmalleistung« für Vertriebene als Anerkennung des erlittenen Vertreibungsschicksals. Dadurch wurde auch der Tatsache Rechnung getragen, dass die Vertriebenen in der damaligen Bundesrepublik Deutschland den sogenannten »Lastenausgleich« erhalten hatten.
In nicht einfachen Gesprächen konnte ich den damaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel davon überzeugen, dass unbeschadet der hohen Transferleistungen aus dem Bundeshaushalt für das Beitrittsgebiet diese personengebundene Zuwendung nicht allein aufgrund ihrer materiellen Bedeutung, sondern gleichsam als staatliche Würdigung des
23
erlittenen Vertreibungsschicksals für die innere Einheit Deutschlands politisch unverzichtbar war.
Das wiedervereinigte Deutschland sollte und musste sich dazu bereitfinden, gegenüber den in die Sowjetische Besatzungszone und die spätere DDR vertriebenen Ost-, Sudeten- und Südostdeutschen offiziell und formell die Anerkennung ihres schweren Schicksals durch diese Einmalleistung als staatlichen Akt vorzunehmen, den die DDR-Führung aus ideologischen Gründen und aus Rücksicht auf die sozialistischen Bruderstaaten jahrzehntelang verweigert hatte. Viele Heimatvertriebene in den neuen Bundesländern haben die Gewährung dieser staatlichen Leistung in Anerkennung des erlittenen Vertreibungsschicksals zuallererst als eine Art »moralische Rehabilitierung« empfunden. 30 Jahre nach der Erlangung der staatlichen Einheit Deutschlands ist das Bewusstsein für das Schicksal von Flucht und Vertreibung Millionen Deutscher infolge des von Hitler entfesselten Zweiten Weltkrieges und der Barbarei des Nationalsozialismus in ganz Deutschland gleichermaßen ausgeprägt. Die politische, zeitgeschichtliche, künstlerische und gesellschaftliche Aufarbeitung dieses Themas erfolgt in West und Ost gleichermaßen. Der Austausch darüber mit unseren östlichen Nachbarn erscheint im Osten des geeinten Deutschlands manchmal sogar intensiver als im westlichen Teil, was an der unmittelbaren Nähe zu Polen und der Tschechischen Republik, aber auch an einer größeren kulturellen Affinität im Osten Deutschlands zu Mittel- und Osteuropa liegen mag.
So war es sicher nicht nur der Symbolik geschuldet, dass am 3. Oktober 2020 in Dresden eine Tagung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung mit Vertretern des BdV und der Landsmannschaften einerseits und Vertretern der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten aus Mittel-, Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion stattfand, die neben dem Bundesministerium des Innern, für Heimat und Bau auch vom Beauftragten des Freistaates Sachsen für Heimatvertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten unterstützt wurde.
Anmerkungen 1 Es handelt sich hier um das überarbeitete Geleitwort zur Konferenz »Vertriebene in der DDR – Zum Umgang mit einem Tabu« der Deutschen Gesellschaft e. V. am 14. November 2019 im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.
24