Hitze


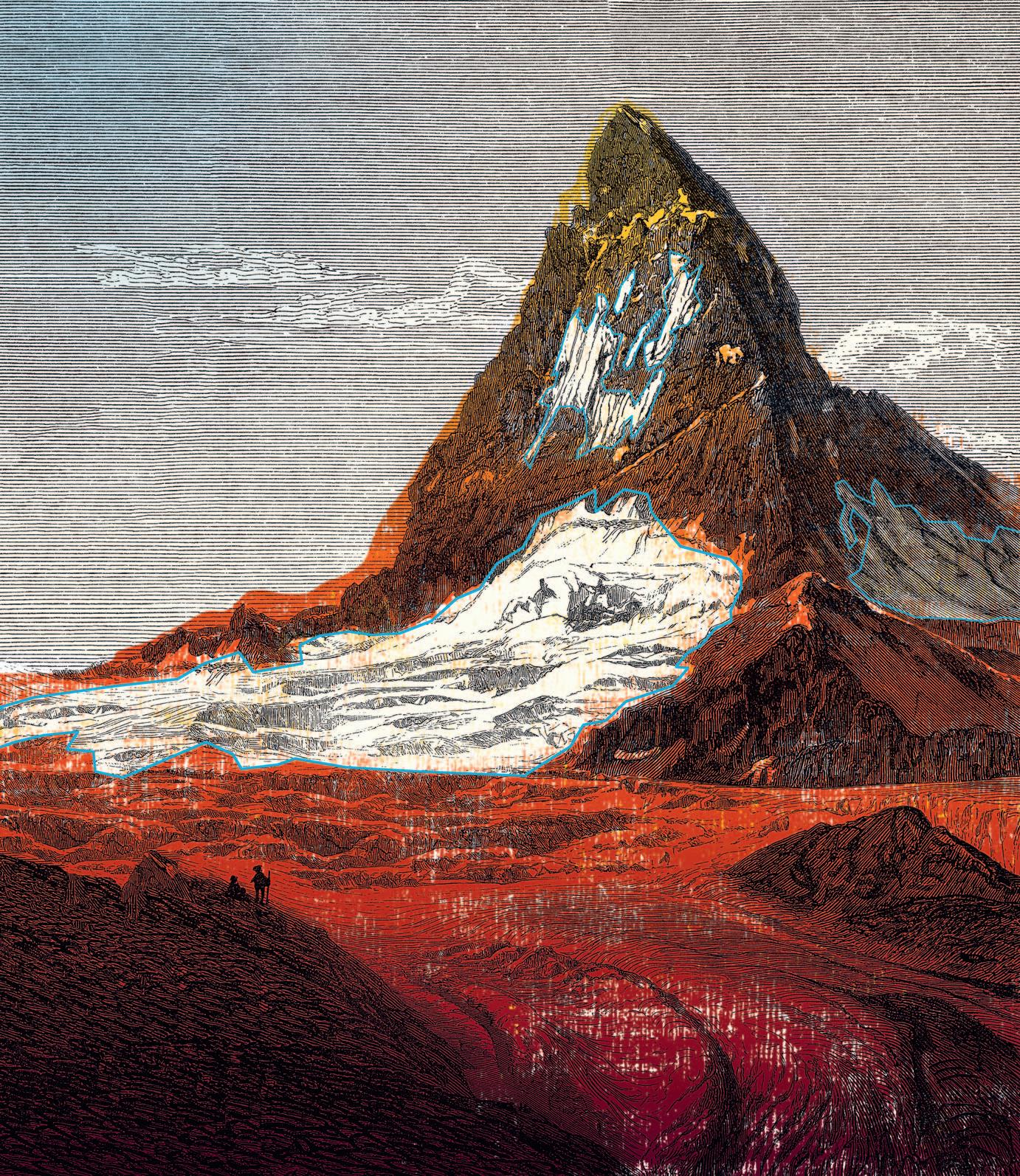
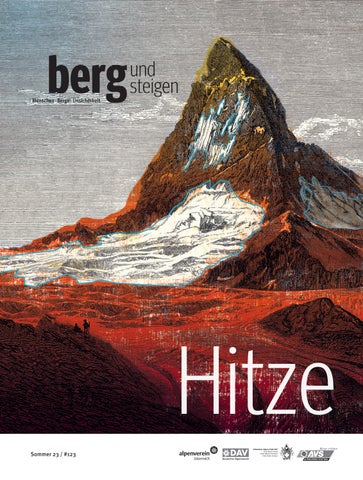


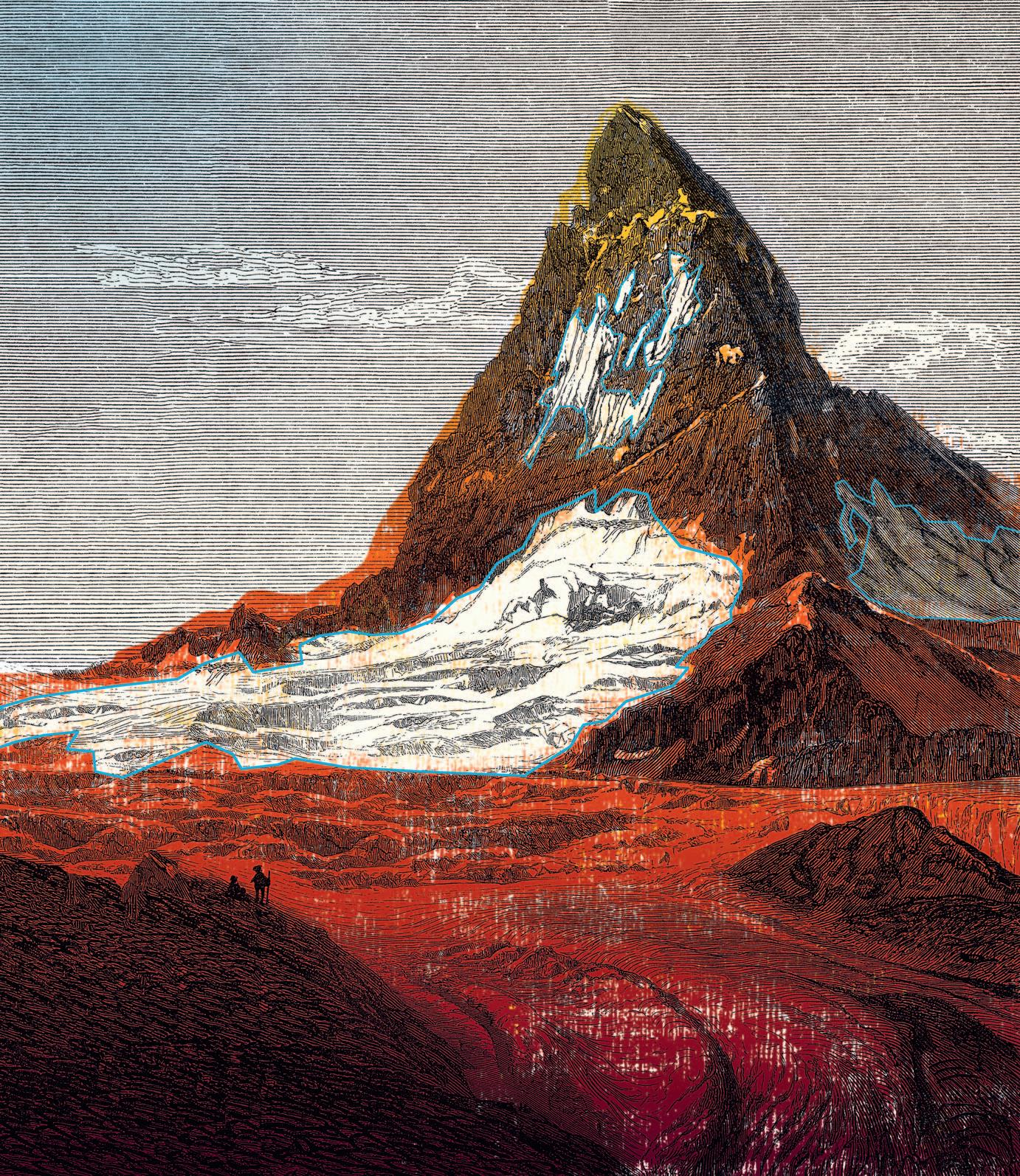
100 Jahre LOWA – das sind 100 Jahre Präzision. Innovative Technologien und hochwertige Materialien, gepaart mit dem Wissen aus einem Jahrhundert Schuhhandwerk, lassen Produkte entstehen, die einzigartig sind. Wir danken allen, die Teil unserer Erfolgsgeschichte waren.
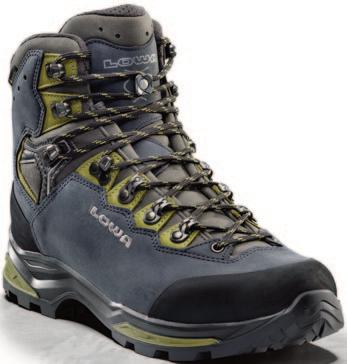




Liebe Leserin, lieber Leser!
2022 war es in Österreich 2,3 Grad wärmer als im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990, gegenüber dem Mittel 1991 bis 2020 beträgt die Abweichung 1,1 Grad. Damit landet das Jahr 2022 im Tiefland auf Platz drei in der 256-jährigen Messreihe Österreichs, heißt es von der Zentralanstalt für Meteorologie (GeosSphere Austria).
An der Spitze liegt unverändert das Jahr 2018 vor 2014. Auf den Bergen war 2022 aber das wärmste Jahr der Messgeschichte. Der Trend zu einem immer wärmeren Klima ist ungebrochen. Die sechs wärmsten Jahre der Geschichte Österreichs waren alle in den vergangenen zehn Jahren.
In der Schweiz war der Sommer 2022 mit verschiedenen Hitzeperioden der zweitwärmste Sommer (nach dem Sommer 2003) seit 1864. „Als Folge hielten sich vermutlich so viele Personen wie noch nie in den Bergen auf, was eine deutliche Zunahme der Notfälle auf Hochtouren, auf Klettersteigen und beim Trailrunning hatte“, heißt es in der Bergnotfallstatistik des SAC. Weiters sei die Anzahl der Spaltenstürze auf Gletschern mit 70 Personen beinahe doppelt so hoch gewesen als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (38). Es gab sechs Stürze mit Todesfolgen (der 10-Jahresdurchschnitt liegt bei weniger als zwei). Dies sei auf die schlecht eingeschneiten Gletscher zurückzuführen.
Überall in den Alpen war die Ausaperung auch in hohen Lagen deutlich früher als normal. Weitere Folgen des Klimawandels beim Bergsteigen sind die zunehmende Gefahr von Eisund Felsschlag oder die Absturzgefahr auf steilen Blankeisfeldern. Klassische Hochtouren verschieben sich in Zukunft immer weiter in Richtung Frühjahr, weil man noch mehr Schnee auf den Gletschern vorfindet und die Eis- und Steinschlaggefahr geringer ist.
Letzten Juli verlautbarten dann sogar die Zermatter Berführer: „Gerade im Bereich des Hörnligrates haben wir viele Steinschläge bemerkt, deshalb führen wir bis auf Weiteres keine Touren mehr aufs Matterhorn durch.” Alpenweit haben sich zahlreiche Normalanstiege auf bekannte Gipfel bereits stark verändert und sind mittelfristig schwieriger oder womöglich gar nicht mehr zu begehen. Dieser Trend ist weltweit zu beobachten. Als wir im Januar, also im südamerikanischen Hochsommer, in Patagonien eine Route auf den Cerro Pollone klettern wollten, mussten wir feststellen, dass die erste Seillänge nicht mehr wie angegeben 6a, sondern inzwischen eher 7a+ und kaum mehr absicherbar ist. Der Gletscher am Fuß ist nämlich in den letzten fünf Jahren um mindestens 20 Meter abgeschmolzen und hat steilen, brüchigen Fels zu Tage gefördert.
Solche Beispiele können viele von uns aufzählen. Alles ist in Bewegung. Was uns diesen Sommer in den Bergen erwartet, wird sich erst zeigen. Jedenfalls wünsche ich euch schöne und vor allem unfallfreie Touren – trotz Klimawandels und Hitze.
Gebi Bendler, Chefredakteur bergundsteigen


„Always look on the bright side of life ...“Markus Schwaiger bei der Erstbegehung des Boulders „The Will to Live“ (7C) an der Klausenalm im Zillertal. Foto: Rainer Eder
Dieses Mal stellen wir euch ein Mitglied unseres Redaktionsbeirates vor, und zwar Markus Schwaiger. Er arbeitet seit 2009 beim Österreichischen Alpenverein und ist dort für den Bereich Sportklettern zuständig. Manche von euch kennen Markus als kompetenten Ratgeber für persönliche Fachfragen an die Redaktion und als eifrigen Leserbriefbeantworter. Routinierte und erfahrene Klettermagazinleser:innen unter euch – also eher die Generation Ü40 – kennen das Konterfei von Markus möglicherweise auch aus einschlägigen Gazetten. Darin war er Anfang der 2000er-Jahre öfter zu bewundern.
Alter? 44
Ausbildung? Psychologiestudium (angefangen), Spengler (Metallverarbeitung), Klettertrainer
Kletterstart? 1994
Härteste Kletterroute? „Love 2.1.“ (8c+), Ewige Jagdgründe, Zillertal. Härtester Boulder: „Incubator“ (8b), Zillertal
Eindrücklichste Alpinkletterei? Die „Ottovolante“ am Bruneckerturm in den Dolomiten zusammen mit meiner Frau bei einem Wettersturz. Da wurde das vermeintlich entspannte Klettern schnell spannend.
Ungefähre Zahl der Erstbegehungen beim Sportklettern und Bouldern? Sicher mehrere hundert Boulder und über 100 Sportkletterrouten.
Markus, Bouldern oder Seilklettern? Beides gerne; mal das eine mehr, mal das andere und zwischendurch auch gerne mal ins Alpine.
Kalymnos oder Korsika? Jeder schwärmt von Kalymnos, zu meiner Schande war ich dort noch nie. Korsika ist mit der Familie perfekt.
Skitour oder Eisklettern? Eindeutig Skitour, ich bin ja eher der Schönwetter-
kletterer. Eisklettern ist mir zu kalt und/ oder zu nass, also nicht so ganz mein Sport.
Ötztal oder Zillertal? Gemeine Frage (lacht). Ich bin im Zillertal aufgewachsen, vor allem hinten die Gründe finde ich unglaublich schön und sie sind ein Paradies zum Klettern. Jetzt lebe ich mit meiner Familie im Ötztal und auch da geht mir nichts ab. Ich muss eindeutig sagen: beides.
Achter oder Bulin? Komischerweise habe ich immer den Achter gemacht, obwohl fast alle meine Freunde den Bulin machen. Manchmal klettere ich bewusst mit dem Bulin, damit auch ich etwas cooler rüberkomme (lacht).
Welches Sicherungsgerät verwendest du meist? Früher immer den Grigri, seit einiger Zeit meistens den Lifeguard von Madrock. Im alpinen Gelände den Reverso.
Glücklichster Moment in deiner Kletterkarriere? Ist ganz schwer zu sagen, aber ich kann mich noch wie heute daran erinnern, als ich das erste Mal vor der Wand an der Bergstation im Zillertal stand – kein einziger Bohrhaken drinnen – und ich nicht wusste, wo ich anfangen soll. Ich bin der Meinung, für einen Kletterer, der gerne selber Routen einrichtet, gibt es nichts Schöneres als eine so perfekte Wand zum „Spielen“. Ich glaube, da war ich richtig glücklich.
Gefährlichste Situation in deiner Kletterkarriere? Ich war alleine beim Einbohren und wollte eine lose Schuppe hinunterwerfen. Sie hat sich verkeilt und hätte mir beinahe das Bein eingeklemmt, vielleicht sogar abgerissen. Das Handy war unten am Boden. Da war mehr Glück als Verstand dabei. Ich musste gleich zum Boden abseilen und hab einige Zeit gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt hatte und weitermachen konnte.
Schönste Erstbegehung von dir? Auf welche bist du am meisten stolz und warum? Mir gefallen ganz viele meiner Erstbegehungen. Ist vielleicht manchmal eine nicht ganz objektive Wahrnehmung (lacht).
Es gibt aber zwei Crashpads einer Firma, die heißen „Moonwalk“ und „Incubator“, benannt nach zwei Bouldern im Zillertal, die ich erstbegangen habe. Das hat mich dann schon ein bisschen stolz gemacht. Vielleicht bilde ich mir aber auch nur ein, dass die wegen der Boulder so heißen; hab’s nie nachgeprüft, aber bitte lasst mir meine Illusion (lacht).
Für welche Dinge hast du dich als Kind begeistert und dir diese Begeisterung bis heute erhalten? Ich bastle gerne.
Bei welchem Film musst du lauthals lachen, auch wenn du ihn alleine schaust? Bei allen Monty-Python-Filmen.
Für welche Konzertkarte würdest du richtig viel Geld hinblättern? Ich gebe schon sehr viel Geld für Konzerte aus. Ich schau mir gerne neue gute Sachen an, aber auch die alten Legenden. Für den Eric Clapton habe ich zuletzt tief in die Tasche gegriffen, weil ich ihn unbedingt mal live sehen wollte. Wenn’s mal eine Reunion von Led Zeppelin geben würde, müsst’ ich unbedingt hin. Die haben so einen speziellen Sound gemacht und das Gitarrenspiel vom Jimmy Page ist einfach unglaublich …
Glücklichster Moment in deinem Leben? Gibt es schon einige, aber die beiden prägendsten waren sicher die, als ich meine beiden Söhne nach der Geburt das erste Mal an mich drückte.
Angst befällt mich, wenn … ich über die Zukunft meiner Kinder nachdenke und sehe, wie sich die Welt gerade jetzt verändert.
In 10 Jahren möchte ich … noch gesund sein und hoffentlich wieder mehr als jetzt zum Klettern kommen.
Welchen Rat möchtest du der jungen Klettergeneration geben? Das klingt nach weiser alter Mann (lacht). Wenn, dann vielleicht: Nehmt Rücksicht, habt Respekt und seid freundlich! Man darf andere Leute, auch wenn man sie nicht kennt, ruhig grüßen (lacht). ■
In den höheren Alpen, in denen bereits der Permafrost als „Kitt der Alpen“ wegschmilzt, droht eine Vielzahl von Felsstürzen. Besonders Berge über 2800 Meter seien davon betroffen. Zusätzlich setzen intensive Niederschläge Steinschläge und Rutschungen in Gang. Der Hochvogel im Allgäu ist zwar nur 2592 m hoch und unterhalb der Permafrostgrenze, bricht aber trotzdem auseinander. Felsstürze ereigneten sich 1935, 2005, 2007 und 2016, letzterer in einer Größenordnung von mehreren tausend Kubikmetern Gestein. Die seit über 50 Jahren bekannte Spalte im Gipfelbereich dehnt sich weiter aus. Alles eine Folge des Klimawandels oder nur ein „normaler“ Felssturz, wie es ihn seit Jahrmillionen in den Bergen gibt? Mehr dazu auf S. 94 ff.











































Die Selbstrettung ermöglicht das selbstständige Aussteigen aus einer Gletscherspalte nach einem Spaltensturz. Doch wie komme ich über die Bremsknoten?
126
Prusikknoten lockern und über den Bremsknoten schieben
Christoph Schranz konnte mit „Ocha- Schau-Schuich“ (8c) eine der schwersten Mehrseillängenrouten der Ostalpen klettern. Das Einrichten der Route erfolgte im Alleingang von unten.
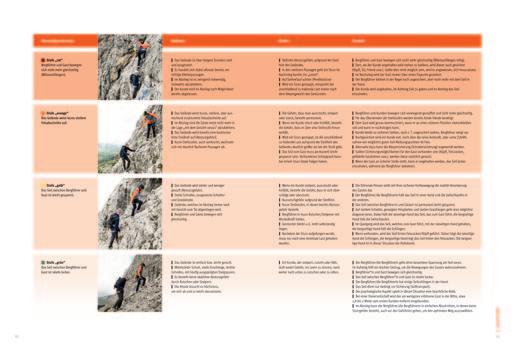

40

Münchhausentechnik bis zum Bremsknoten
Die Dolomiten und ihre Felstouren sind einzigartig. Dies führt zu Besonderheiten bei der Anwendung der Kurzseiltechnik.
Meldungen über Fels- und Bergsturzereignisse, über geschlossene Hütten, gesperrte Wege, nicht mehr gangbare Anstiege und steiler und damit schwieriger werdende Touren in den Bergen scheinen sich in letzter Zeit zu häufen.

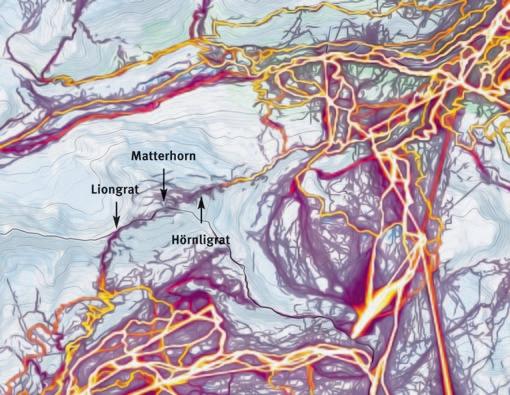
Heatmaps auf Routenplaner-Portalen und Fitness-Tracking-Apps geben einen guten Eindruck wieder, welche Routen bei der großen Masse gerade angesagt sind. Das birgt aber auch Gefahren.
12 kommentar
14 dialog
18 dies & das
20 pro & contra
22 Bindungsprobleme
Florian Hellberg
30 Kalte Schnauzen in Bergnot
Klaus (Nik) Burger
40 Solo-Seilschaft
Christoph Schranz
50 Die feinen Unterschiede Susi Kriemler
58 Kurzschluss 2.0 Erwin Steiner
66 verhauer Achtung Seilende!
68 bergsönlichkeit
In Memoriam Robert Renzler
80 Heiße Liebe, kaltes Herz
Andi Dick
88 Brennpunkt: Kochen unter Extrembedingungen Alexandra Schweikart
94 Wenn’s wärmer wird, sollten wir vielleicht die Taktik ändern
Christina Schwann
104 Alles im blauen Bereich
Franziska Haack
112 Heiße Karten
Dominik Prantl
118 Überhitzt Protokolle von Gebi Bendler
124 lehrer lämpel T-Anker
126 alpinhacks Bremsknoten: Selbstrettung Gletschersspalte
130 medien
132 kolumne
n rubrik n unsicherheit n hitze
RespektAmBerg. So heißt die Initiative des Österreichischen Alpenvereins, mit der für ein natur- und umweltverträgliches Miteinander am Berg geworben wird. Auch Verhaltensempfehlungen zur klimabewussten Anreise, zum Dauerbrenner Müll am Berg oder zum Thema Wildtierstörungen sind Teil davon. Wie gelingt die Kommunikation derartiger Empfehlungen, ohne moralisierend an den Nerven der Zielgruppe zu sägen?
„Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen.“ Damit lieferte der legendäre Kabarettist Helmut Qualtinger eine mögliche Erklärung dafür, warum der erhobene Zeigefinger als Wegweiser im Nebel der Bevormundung gerne übersehen wird und deshalb als Kommunikationsmittel erster Wahl selten taugt. Wer kennt nicht die hitzigen Social-Media-Diskussionen, in denen vermeintliches Fehlverhalten anderer leidenschaftlich und schnell angeprangert wird? Allzu oft entpuppt sich diese Empörung aber als Selbstzweck. Es geht primär nicht um die gute Sache, sondern darum, sich in selbstgerechter Weise als moralisch erhaben darzustellen. Christian Seidel, Professor für Philosophische Anthropologie, sieht darin die Gefahr, dass sich die moralische Kritik selbst konterkariert und psychologische Abwehrreflexe hervorruft. Strenge Maßstäbe an das eigene Verhalten anzulegen sei löblich, man solle andere aber nicht mit diesen bedrängen oder bloßstellen.
Auch Vereine sollten sich vor moralischer Selbsterhöhung in Acht nehmen und zuerst vor der eigenen Tür kehren. Verhaltensempfehlungen müssen umsichtig kommuniziert werden, vor allem aber braucht es überzeugende Erklärungen. Denn häufig ist nicht mutwilliger Sittenverfall, sondern Unwissenheit die Ursache für konfliktträchtiges Verhalten und überhitzte Gemüter. Mit dem Booklet „Natur und Umwelt“, dem Sommer- und Winterquiz für Kurse und einem eLearning-Angebot ist RespektAmBerg vor allem eine Bildungsinitiative. Aufklären statt moralisieren! Auch das geschieht idealerweise mit Respekt.
Benjamin Stern, Mitarbeiter Abteilung Raumplanung und Naturschutz, Berg- und Skiführer

Risikomanagement?
Risikokompetenz!
Seit über 30 Jahren gehen wir zusammen skibergsteigen und haben aus kritischen Ereignissen gelernt, unsere Touren sauber zu planen, regelmäßig Informationen abzugleichen und Entscheidungen zu besprechen. In den letzten Tagen haben wir im anspruchsvollen Gelände unsere Wahrnehmung verfeinert und uns Stück für Stück ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Schneeund Lawinensituation erarbeitet. Wir wollen schließlich nicht (mehr) ohne bewusste Entscheidung in gefährliche Situationen geraten.
Aber jetzt im steilen Gipfelhang ist es schlagartig und unvorhersehbar hart geworden – optisch kein erkennbarer Unterschied zum bisherigen Teil des Hanges. Wir bekommen die Harscheisen gerade noch ein paar Millimeter in den Schnee. Die potenzielle Sturzbahn ist an dieser Stelle mit Steinen durchsetzt. An Ski aus- und Steigeisen anziehen ist nicht zu denken. Ganz offensichtlich keine gute Situation mehr. Unser Risikomanagement hat versagt.
Oder doch nicht? Was wäre denn gutes Risikomanagement nach der gültigen ISO-Norm gewesen? Das Risiko im Gipfelhang vorab identifizieren und analysieren – haben wir gemacht. Wir haben es auch bewertet und uns beratschlagt. Und das für uns vorab identifizierbare Risiko haben wir bewusst akzeptiert. Aber das Absturzrisiko, dem wir uns schließlich aussetzten, mit sicher eintretenden ernsthaften Verletzungen als Konsequenz hätten wir vorab nicht akzeptiert. Dann wäre der Beginn des Gipfelhangs unser Umkehrpunkt gewesen. Waren wir deshalb leichtsinnig und unvernünftig?
Oder ist es vielleicht eher so, dass die Idee eines systematischen Vorab-Quantifizierens von Risiken nicht immer zu bergsteigerischen Situationen passt, weil wir häufig weder Eintrittswahrscheinlichkeiten noch Schadensausmaß ausreichend genau kennen? Und manchmal erkennt man die Gefahr erst, wenn man schon mittendrin steckt. Die Ideen des Risikomanagements sollten ein Baustein in unserem Umgang mit Risiken und Unsicherheiten sein. Aber sie passen nicht für alle Situationen. Wissen, Erfahrung, Selbstwahrnehmung und –reflexion, gepaart mit Demut, Selbstverantwortung und der Freiheit, für die eigene Person auch unvorhergesehene Risiken eingehen zu können, sind weitere Zutaten, um im Gebirge gut zu bewussten Entscheidungen zu kommen. Alles zusammen ergibt Risikokompetenz.
Vielleicht war unser Risikomanagement des Gipfelhangs mangelhaft, aber risikokompetent waren wir durchaus – und darauf kommt es beim Bergsteigen an.
Dr. Bernhard Streicher, DAV-Kommission Sicherheitsforschung, Psychologe, Risikoforscher
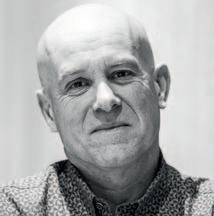
Wie man (nicht) stark bleibt am Berg
Echte Bergsportler sind harte Kerle. Sie trotzen Kälte und Sturm, ertragen zwölfstündige Touren mit 0,5 Dezilitern kaltem Wasser aus der Petflasche, ernähren sich von gesalzenen Erdnüssen und Käse, kippen nach der Eistour ihr eiskaltes
Getränk und dehnen nie, niemals ihre Muskeln in der Sichtweite anderer Hüttengäste. Als erfahrene Therapeutin für traditionelle chinesische Medizin, langjährige SAC- Tourenchefin und Ehepartnerin eines Bergführers läuten bei solchen Bildern regelmäßig die Alarmglocken. Denn spätestens wenn die gleichen Protagonistinnen mit chronischen Rückenschmerzen, Knie- oder Nierenbeschwerden in der Praxis auftauchen, wünschte ich mir mehr Bekenntnis zur Gesundheitsvorsorge im Bergsport. Gesunden Ernährungsgrundsätzen sind im Outdoor-Alltag gewisse Grenzen gesetzt, besonders wenn dieser beruflich ausgeübt wird. Dementsprechend gilt es, dem wichtigsten Hightech-Material, seinem Körper, vorbeugend die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken.
Lösungsansätze, um Bergsport lange und gesund betreiben zu können, finden sich diesmal nicht in der Pharmaindustrie, sondern beispielsweise in der Lehre der gesunden Lebensführung, einem festen Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). Dieses jahrtausendealte und umfassende Medizinsystem bietet nicht nur Abhilfe mittels Akupunktur bei chronisch kalten Händen. Das Wissen um Ernährungsgrundsätze und der Einsatz von Kräutern sind ebenso von großem Nutzen im Bergsport. Frischer Ingwer etwa vertreibt Kälte im Inneren des Körpers. Warum im Winter nicht mal ein paar Scheiben Ingwer in den heißen Marschtee werfen? Leicht gesüßt und mit Zitronensaft ergänzt ergibt dies den perfekten immunstärkenden Durstlöscher. Oder wie wäre es mit einer Bouillon auf der Hütte – und dann erst das Bier? Wer länger stark bleiben will, sorgt morgens am besten mit Porridge vor. Gekochter Hafer ist eine langsam fließende Kohlenhydratquelle und füllt den Tank exzellent den ganzen Tag zudem ohne Verdauungsstörungen. Wir konsumieren ohnehin zu viel Brot, was die Muskeln übersäuert und müde macht.
Wer oft friert oder sich erschöpft fühlt, muss an seiner Ernährungsund Lebensweise zwischen den Touren schrauben: Gekochte und ausgewogene Kost dreimal pro Tag, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, weniger Stress und regelmäßig acht bis neun Stunden Schlaf beugen mancher Unbill vor.
Ein fernöstliches Sprichwort sagt außerdem: Man soll alles im Maß üben, sogar die Mäßigung.
Iris Kraaz, SAC-Tourenleiterin und Therapeutin für TCM und Akupunktur

Neues aus Südtirol
Liebe AVS-Funktionärinnen und -Funktionäre!
Viele von euch lesen bergundsteigen, weshalb wir diese Zeilen auch immer wieder nutzen, um euch über aktuelle alpine Themen des AVS zu informieren.
So stand Ende April die Diskussion rund um die Weiterführung des AVS-Projektes ALPINIST auf dem Programm. Gemeinsam mit jungen Südtirolern, ehemaligen und aktiven Teilnehmern sowie Bergführern wollen wir am zukünftigen Konzept arbeiten. Es wird spannend, was sich die nächste Bergsteigergeneration vom Alpenverein erwartet und wie sich die Jugend die Entwicklungen im Alpinismus vorstellt. Wir erhoffen uns, schon im Sommer der Landesleitung die Idee des ALPINIST-Projektes für die kommenden Jahre präsentieren zu können.

Das Referat Alpine Führungskräfte beheimatet Tourenleiter, AVSWanderführer und Gruppenleiter Mountainbike. Alle drei Gruppen haben nun ihren eigenständigen Ausschuss gebildet und kümmern sich um ihre spezifische Aus- und Weiterbildung. So wurde bereits die Ausbildung zum Gruppenleiter Mountainbike für dieses Jahr überarbeitet und erweitert. Die Abschluss-Ausbildung zum Tourenleiter wird diesen Sommer leider nicht organisiert, weil sich zu wenige Teilnehmer gemeldet haben. Es wurde entschieden, 2024 zwei Abschluss-Jahrgänge zusammenzulegen.
Eine der großen Herausforderungen war und bleibt die Weiterbildung, welche für alle alpinen Führungskräfte verpflichtend ist. Auch wenn die ehrenamtliche Tätigkeit in den Sektionen Vorrang hat und die persönliche freie Zeit beschränkt ist: Eine ständige Auseinandersetzung mit aktuellen Lehrmeinungen, alpinen Themen und Führungsmethoden sowie der Austausch mit Gleichgesinnten ist für jeden Einzelnen wichtig. Alle unsere Referate sind bemüht, jährlich ein attraktives Weiterbildungsangebot für ihre ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre auszuarbeiten. Der gemeinsame Appell richtet sich an jeden Einzelnen! Nutzt die Chance und klickt online das Kursangebot durch! Für jeden ist was dabei!
Wenn ihr dieses Heft in den Händen haltet, sind wir bereits voll in der Planung für 2024! Ihr habt eine gute Idee oder einen speziellen Wunsch für das Weiterbildungsprogramm? Wir freuen uns auf jede Anregung, die uns hilft, für euch das Richtige umzusetzen!
Stefan Steinegger, Mitarbeiter Referat Bergsport & HG und Ausbildung
bergundsteigen #123 / sommer

[FB-Kreuzklemmknoten] Im aktuellen Frühlingsheft 2023, #122, habt ihr unter „Sicher am Berg“ den Link zu den „Lernvideos Knoten“ des Österreichischen Alpenvereins veröffentlicht, dem ich sofort und mit großer Begeisterung für die didaktisch saubere Darstellung und das sympathische Auftreten der Akteure folgte, bis ich bei dem von euch so bezeichneten „Bandschlingen Klemmknoten“ ankam. Dort wird nach dem Prusikknoten und seinem umfangreichen Anwendungsspektrum ein „Kreuzklemmknoten“ mit Bandschlingen gezeigt, meilenweit weg in Machart und Effizienz von dem euch bestens bekannten „FB-Kreuzklemm“ des Franz Bachmann (siehe bergundsteigen #108/Herbst 19, S. 24–25). Das entscheidende „Bauteil“ des FB-Kreuzklemm, die doppelte und dadurch steife und offene Nahtschlinge wird leider nicht genutzt. Sie aber y erleichtert das schnelle Durchschlaufen und bewirkt, dass y bei Belastung die Klemmwirkung des Knotens voll zur Geltung kommt, y bei Entlastung der Knoten sofort gelöst ist und leicht verschoben werden kann.
2019 ereigneten sich bei Kursen von DAV-Sektionen zwei Abseilunfälle (ein Unfall tödlich). 2020 analysierte die DAV-Sicherheitsforschung unter Christoph Hummel mit seinem Team die beiden Unfälle und führte im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung (ZSA) der Bergwacht Bayern mit deren Unterstützung weitergehende Untersuchungen durch. Die Ergebnisse hinsichtlich der Effizienz von verschiedenen Klemmknoten bei unterschiedlichstem Seil-, Schnurund Bandmaterial wurden in DAV-Panorama 4/2020 veröffentlicht. Kurz gefasst zeigte „die Dyneema-Bandschlinge mit 2,5-fachem FBKreuzklemmknoten das beste Ansprechverhalten“ als Hintersicherung sogar bei dünnen Seilen (dünne Zwillingsseile oder Hilfsleinen). Eine alte Erkenntnis wurde bei den Versuchsreihen bestätigt: Der Prusikknoten muss sauber gelegt sein, um seine optimale Wirkung zu erzielen. Wenn diese Sorgfalt fehlt, rauscht der Prusik durch. Diese peinliche Sorgfalt ist nach nun mehrjähriger Erfahrung der Bergwacht Bayern beim FB-Kreuzklemm nicht erforderlich; 1,5- oder 2,5-mal (je nach Seilstärke und Gewicht der möglichen Last) ohne besonderen Aufwand gewickelt hält der FB-Kreuzklemm zuverlässig. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass der FB-Kreuzklemm einmal geknüpft wie der Prusik in beide Richtungen hält.

Zusammengefasst: Der FB-Kreuzklemm ist sicher, leicht zu knüpfen und schnell zu lösen; er erfüllt das gleiche Anwendungsspektrum wie der Prusik. Darüber hinaus haben sich in der Kletterszene und der Bergrettung Bandschlingen weitgehend durchgesetzt und die Reepschnüre abgelöst. Somit gehört dem „heiß geliebten“ Prusikknoten sicher ein ehrenvoller Platz in der alpinen Geschichte, nicht aber im aktuellen alpinen Geschehen. Das sollte jedenfalls das Ziel von bergundsteigen sein. Empfehlung: Der Österreichische Alpenverein möge seine wertvollen „Lernvideos Knoten“ bei den Klemmknoten aktualisieren und dem FB-Kreuzklemm (endlich) den angemessenen ersten Platz in der Reihe der Klemmknoten zugestehen. Jost Gudelius, Oberst a. D., Berg- und Skiführer, Jachenau (D)
[Welches Seil wofür? #120] Herzlichen Dank für die super Berichte zum Thema Material und zu den Seiltechniken. Das ist jedes Mal spannend zu lesen. Im bergundsteigen #120 wurden im Artikel „Welches Seil wofür?“ die Empfehlungen






der österreichischen Bergführerausbildung für das Führungswesen u. a. für das Nachsichern von zwei Personen im Fels (Dreierseilschaft) dargestellt: „Für das Nachsichern in der Dreierseilschaft wird die Verwendung von Einfachseilen für beide Nachsteiger empfohlen“ bzw. „Seile mit Dreifach-Zertifizierung“. Die Verwendung von Halbseilen ist nur „in Ausnahmen möglich, keine Kanten, wenn Pendelgefahr unwahrscheinlich, Risikoabwägung Pro/Contra“. Zusätzlich wird erwähnt, dass laut Kenntnisstand des DAVSicherheitskreises „der Durchmesser zu den Seiltypen eine untergeordnete Rolle spielt.“ Also ein allgemeines NEIN für die Verwendung von Halbseilen in der Dreierseilschaft. In unserer ÖAV-Sektion verwenden wir das Buch „Seiltechnik“ von Michael Larcher und Heinz Zak (ÖAV) als Lehrmeinung in den Kletterkursen sowie beim Tourenführen. Aktuell die 8. Auflage 2019 –meines Wissens nach die neueste Auflage (Anmerkung der Redaktion: Es gibt inzwischen die 9. überarbeitete Ausgabe, 2022). Auch persönlich wende ich großteils die darin dargestellten Methoden an. Dort heißt es im Kapitel „Sichern in Mehrseillängenrouten“, S. 90: „Eine Dreierseilschaft wird mit zwei Halbseilen (...) gebildet. Dadurch können beide Nachsteiger unabhängig klettern und optimal gesichert werden“ sowie im Kapitel „Seilkunde“, S. 153: „Halbseile Anwendung: Dreierseilschaft“. Also ein unmissverständliches


JA für die Verwendung von Halbseilen in der Dreierseilschaft (Anm. d. Redaktion: Auch in der neuen Auflage von „Seiltechnik“ wurden diese Aussagen nicht verändert und sind weiterhin gültig.).
Auch im ÖAV Booklet „Alpinklettern“, 2. Auflage 2022, wird dies thematisiert. So heißt es im Kapitel „Seiltechnik, Seilschaft – Organisation & Kommunikation“, S. 181: „Die Dreierseilschaft klettert mit zwei Halbseilen, keinesfalls mit Zwillingsseilen. Dadurch können beide Nachsteigerinnen bzw. Nachsteiger unabhängig voneinander klettern und sind stets optimal gesichert.“ Allerdings wird im Kapitel „Ausrüstung – Dynamische Bergseile“, S. 55, Folgendes erwähnt: „Sind wir als Dreierseilschaft unterwegs, ist es nicht von Vorteil, extrem dünne Halbseile zu verwenden, da an jedem Strang eine Person hängt und diese nicht redundant über einen zweiten Strang gesichert ist. Deshalb greifen wir in diesem Fall zu robusteren Halbseilen mit Durchmessern ab 8,2 bis 8,5 Millimeter oder –noch besser – zu dreifach zertifizierten Einfachseilen, deren Durchmesser mittlerweile schon bei 8,5 Millimeter beginnen.“ Also ein JA für die Verwendung von dickeren Halbseilen in der Dreierseilschaft. Summa summarum ist es für mich nicht klar, ob eine Dreierseilschaft mit Halbseilen okay ist oder nicht? Was sollen wir nun nächstes Jahr im Kletterkurs lehren bzw. wie sollen wir bei geführten Touren sichern? Und kann/soll ich meine privaten 8.1-mmHalbseile weiterhin in einer Dreierseilschaft verwenden?


 Florian Kulmer, ÖAV Sektion Anger
Florian Kulmer, ÖAV Sektion Anger
Vielen Dank für dein Nachfragen. Die Sache mit den Halbseilen ist grundsätzlich völlig klar und unmissverständlich: Ja, die EN 892 erlaubt das Nachsichern von einer Person an einem Halbseilstrang! Dass Verbände zusätzliche Empfehlungen für ihre eigenen Kurse abgeben, ist dabei völlig legitim. So kann selbstverständlich der österreichische Bergführerverband vorgeben, dass bei seinen Ausbildungskursen nur dreifach zertifizierte Seile zum Nachsichern einer Person zum Einsatz kommen; im Artikel wird auch begründet, warum. Wir vom Österreichischen Alpenverein verlangen hingegen bei unseren Kursen keine dreifach zertifizierten Seile (wenn jemand welche mitbringt, wird das zwar begrüßt, weil die Seile einfach viel

















DIALED IN Perfekt eingestellt – BOA Dual Dial ermöglicht eine zonale Anpassung für einen präzisen Fit.
LOCKED IN Fest umschlossen –PerformFit™ Wrap erhöht die Laufgeschwindigkeit und Stabilität –wissenschaftlich erwiesen.

Zuverlässig – Performt selbst unter härtesten Bedingungen.
Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.
Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
BOA® JACKAL II BOA® FLORIAN GRASEL BOA Pioneeruniverseller einsetzbar sind: eben als Einfach-, Halb- oder Zwillingsseile). In der Empfehlung, keine extrem dünnen Halbseile (zwischen 7,1 und 7,5 mm) für das Nachsichern einer Person zu verwenden, sondern stattdessen dafür zu robusteren Halbseilen mit einem Durchmesser zwischen 8,2 und 8,5 mm zu greifen (8,5 mm entspricht im Durchmesser den dünnsten dreifach zertifizierten Seilen, wobei auch die dynamische Dehnung mit ca. 30 % ziemlich ident ist), sehen wir keinen Widerspruch. Letztlich ist es ja nicht nur die scharfe Kante (da spielt tatsächlich die Vorspannung – also das Gewicht, das unten dranhängt – eine größere Rolle als der Durchmesser; vgl. Artikel „Schnittfestigkeit von Seilen“, https://edelrid.com/chde/ wissen/ knowledge-base/schnittfestigkeit-von-seilen), sondern sind es auch Faktoren wie Steinschlag, Beschädigung durch Eisgeräte etc. und letztendlich auch vor allem die psychologische Komponente, die uns für einen Nachsteiger zu einem robusteren Seil greifen lassen.
Gerhard Mössmer, Berg- und Skiführer, ÖAV Abteilung Bergsport[Zum Leserbrief von Peter Harlacher in #122 bezugnehmend auf Kolumne: Verschämt –unverschämt, #120] Lieber Peter, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir für das Lesen des Textes und deine differenzierte Antwort genommen hast. Ich hoffe, dass ich mit meiner Replik wiederum einen Beitrag zu einem fruchtbaren Dialog leisten kann. Dazu würde ich gerne auf einen Unterschied hinweisen, den ich in meiner Kolumne vielleicht nicht deutlich genug herausgearbeitet habe: den Unterschied zwischen moralisch motiviertem Handeln und moralisierendem Denken. Ersteres stelle ich keineswegs in Frage, im Gegenteil. So habe ich zum Beispiel in meiner ersten Kolumne, die ich für bergundsteigen schreiben durfte (#114), darauf hingewiesen, dass „moralische Tatsachen“ (Markus Gabriel) eine Orientierungshilfe bieten können, wenn wir Handlungen nach richtig und falsch oder irgendwo dazwischen beurteilen wollen. Und in dem Text „Verschämt – unverschämt“, den du ansprichst, beurteile ich die Reisen von „Grüppchen gesponserter Athleten an irgendein Ende der Welt“ ja selbst nach moralischen Maßstäben, indem ich „das Argument, sie wollten Aufmerksamkeit erregen für die Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt“, als „Witz“ bezeichne. Was ich also kritisiere, ist das moralisierende Denken und Sprechen derjenigen, die übertrieben nachdrücklich darauf hinweisen, was angesichts vielfältiger bedrohlicher Entwicklungen zu tun wäre, diese Maßstäbe aber nicht zu Leitfäden ihres eigenen Tuns machen. Ich bin überzeugt davon, dass dies kontraproduktiv, weil durchschaubar ist. Und eben gerade nicht moralisch motiviertes Handeln, sondern lediglich gepredigte Moral. Was ich dagegen keinesfalls kritisieren wollte, ist „moralisches Denken in Verbindung mit klimaschädigendem Verhalten“, wie du schreibst. Ich hoffe, dass meine Position jetzt deutlicher geworden ist. Und natürlich verstehe ich deine Zeilen nicht als Moralpredigt, weil sie die Übereinstimmung deines Handelns und Denkens zeigen. In diesem Sinne bedanke ich mich auch für dein Angebot, zusammen durch das Ybbstal zu radeln. Sollte ich einmal in der Gegend sein, nehme ich es gerne an.
bin ich heil froh und erleichtert, dass dieses Unglück glimpflich endete und wünsche allen weiterhin tolle Touren und gesunde Heimkehr. Aufgefallen ist mir zunächst eine Art Airbag-Effekt: Vom Airbag wird vermutet, dass er dazu verleiten kann, härter an die Grenzen zu gehen und allenfalls mehr zu riskieren. Gilt Gleiches auch für das GPS? Neigt der Alpinist dazu, bei Bedingungen zu Touren aufzubrechen, die ohne dieses Gerät nicht zu bewältigen wären und somit (zu) hart an die Grenzen des Möglichen zu gehen? So richtig hängen geblieben bin ich aber am Satz: „Die Ausrüstung war perfekt.“ Da steht doch „...das Handy zur Orientierung zücken...“. Das Handy zur Navigation?
Wir lesen in diesem Heft oft über die Grenzen dieser eierlegenden Wollmilchsau-Geräte, konzipiert zum Telefonieren, Filme-Gucken, Gamen, Nachrichten-Checken und ganz neben bei noch zur Standortbestimmung. Sie leeren ihren Akku in Windeseile, schalten um null Grad auch bei vollem Akku aus, stören das LVS und dann noch dieser unsägliche Touchscreen: Jede Schneeflocke und jeder Wassertropfen kann als Fingertouch interpretiert werden und die Bedienung bei Niederschlag unmöglich machen. Und sie haben einfachste Satelliten-Empfangssysteme. „Keine Satelliten sichtbar –befinden Sie sich in einem Gebäude?“, musste ich mal auf dem Claridengletscher im dichten Schneegestöber bei einem (sehr alten) Markengerät lesen – das hätte ein Handy bestimmt nicht besser gemacht. Ein richtiges Outdoorgerät namhafter Hersteller ist auch mit Handschuhen und bei Niederschlag zu bedienen, hat optimierte Antennen und Elektronik, läuft bei minus 20 Grad Stunden oder gar tagelang und ist mit zwei einfachen Reservebatterien gut zu retten und stört nebenbei das LVS nicht. So ein Gerät schaltet man nicht ständig aus, um es zu schonen, ärgert sich nicht an der zeitraubenden Bedienung, sondern man hängt es bei kritischer Orientierung vor und lässt es laufen, so dass eine Kursabweichung auch sofort bemerkt wird (wie auch die Höhenabweichung).
Nein, das Handy als Navigationsgerät ist bestimmt keine perfekte Ausrüstung – siehe auch Pigne d'Arolla. Und damit es auch noch geschrieben steht: Natürlich sind immer Karte, Kompass, unabhängiger Höhenmesser sowie die gedruckte Karte dabei (Backup, „Fluchtwege“ finden). Dem Autor gebühren auf jeden Fall Dank und Anerkennung für den lehrreichen Artikel und den Mut, so offen zu schreiben und uns an seiner Erfahrung teilhaben und mitdenken zu lassen.
Fabio Vassalli, Brugg (CH) Tom Dauerz m
[19 Minuten] Als qualifizierter Experte für Tastatur- und Sofa-Alpinismus sei es mir vergönnt, Gedanken zum eindrücklichen Artikel „19 Minuten“ (#122) zu äußern. Erst mal
Danke für deine umfassende Analyse. Wir teilen deine Einschätzung nur teilweise. Mag deine Kritik, was Handy betrifft, in vielen Situationen zutreffen, so war die Wahl des Handys als Navigationsmittel in diesem Fall aber nicht unfallkausal, wie der Verunfallte Chris Semmel bestätigt. Das Handy als Navigationsmittel hat Vor- und Nachteile, auf die in Ausgabe #119 detailliert eingegangen wurde. Die Akkuund Navigationsleistung von Handys hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Nicht jedes Handy schaltet bei null Grad sofort aus und im Flugmodus lässt sich mit den meisten Geräten auch problemlos einen Tag lang navigieren (und dann gäbe es noch zusätzliche Powerbanks/Akkuhüllen). Diesbezüglich bilden deine Aussagen nicht mehr den letzten Stand der Technik ab. Zudem hat inzwischen sowieso jede:r immer ein Handy zum Telefonieren als Notfallausrüstung dabei und durch die sehr einfach zu bedienenden Karten- und Tourenplanungsapps wird es sich deshalb auch mehr und mehr als Navigationsgerät durchsetzen. Klar, das, was du zur
Bedienbarkeit mit Handschuhen und bei Regen und Schneefall schreibst, ist völlig richtig und da stimmen wir vollinhaltlich zu. Unter Extrembedingungen ist ein GPS-Gerät das Mittel der Wahl. Wir selbst führen bei anspruchsvolleren Führungstouren immer ein herkömmliches GPS-Gerät als Backup im Rucksack mit. Tatsächlich gebraucht haben wir es in letzter Zeit aber – ehrlich gesagt – nicht oft. Gebi Bendler und Gerhard Mössmer, Berg- und Skiführer
k[Kletterausrüstung recyceln] Mangels besserer Idee, wer dazu Informationen hat, und da ich mir vorstellen kann, dass auch andere Kletter- und Bergsportbegeisterte sich für die Thematik interessieren und es damit ggf. ein Artikel wert wäre: Wie kann ich als Einzelperson, aber auch z. B. als Materialwart einer Sektionsklettergruppe ausgesondertes Material (von Seilen, über Reepschnurstücke bis zur Hardware, ob Karabiner oder Helme und Klettergurte) einem Recyclingprozess zuführen? Eine Entsorgung in der gelben Tonne in Deutschland dürfte ja mangels „Grünem Punkt“ kaum das Richtige sein. Im Bereich Bekleidung hat sich ja sehr viel in den letzten Jahrzehnten getan. Auch bei den Produktionsstandards. Bei der Ausrüstung vermisse ich dies aber sehr. Ich weiß, dass es früher in einer meiner Stammkletterhallen zumindest eine „Recycling-Tonne“ für Seile gab, aber auch das ist Geschichte. Das einzige, was ich derzeit finde, ist folgende Initiative: www.newseed.de. Was für die Nordlichter aber auch nur über Versand geht. Die Hardware bleibt da leider vollkommen außen vor. Übersehe ich da was? Gibt es da Entwicklungen? Oder Bestrebungen der Hersteller und/oder der Verbände, da was voranzubringen? Steffen Arns (D)


Gemeinsam mit der panorama-Redaktion sind wir dran, den Status quo zu diesem Thema zu recherchieren und in einem Artikel zusammenzufassen. Welche Initiativen gibt es? Welche Firmen machen konkret was? Ideen, was wir als alpine Vereine tun könnten, bitte an uns schicken (redaktion@bergundsteigen.com). Mehr dazu demnächst auf www.bergundsteigen.com
 Gebi Bendler
Gebi Bendler
s[Südtiroler-Stand statt Quad-Anchor] Ich habe gesehen, dass Gerhard Mössmers Antwort auf meine Frage zum Quad Anchor abgedruckt wurde (#122, S. 12), was mich sehr gefreut hat! Ich muss trotzdem eine kleine Anmerkung nachschieben: Ich glaube das Bild „Der Quad-Anchor in der Anwendung“ auf Seite 12 zeigt eher einen Südtiroler Stand mit 2 Schnappern :-). Paul (D)

DIALED IN Perfekt eingestellt – Fein anpassbar für eine präzise Passform.





LOCKED IN Fest umschlossen – Eine eng anliegende, sichere Passform bietet mehr Stabilität im Fußgelenk.
CONFIDENT
Zuverlässig – Performt selbst unter härtesten Bedingungen.
Da ist uns leider im letzten Layoutschritt ein falsches Bild hineingerutscht. Du hast natürlich völlig Recht. Entschuldige bitte den Fehler!
Erfahre auf BOAfit.com wie das BOA® Fit System Passform neu definiert.
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.
BOA® FIT SYSTEM MAX BERGER BOA Pioneer G-TECHVom 1. bis zum 12. August 2023 trifft sich die internationale Sportkletterelite in der Schweiz, um bei den Weltmeisterschaften ihre neuen Titelträger:innen zu küren. Rund 750 Athlet:innen aus mehr als 50 Nationen werden sich dabei in der PostFinance-Arena und der Curlinghalle Bern in den Disziplinen Boulder, Lead, Speed und Boulder & Lead messen – mittendrin werden auch die Weltmeisterschaften im Paraklettern, dem Klettern für Menschen mit Behinderungen, ausgetragen.
Zusätzlich zum WM-Spektakel, zu dem mehr als 55.000 Zuschauende erwartet werden, gibt es eine ganz besondere sportliche Würze: Neben den Medaillen für die WM-Titel werden die ersten Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben. Es steht dementsprechend viel auf dem Spiel und spannende Wettkämpfe sind garantiert!
Info: www.bern2023.org oder auf Social Media über den Hashtag #berntoclimb.
Die gefälschten Schnallen sind von den originalen Cobra-Schnallen kaum zu unterscheiden, da sie sämtliche Original-Kennzeichnungen aufweisen (Firmenlogo, Chargennummer, europäisches Prüfzeichen). Allerdings brechen sie schon bei geringen Belastungen und stellen ein immenses Risiko dar. AustriAlpin bittet darum, Cobra-Schnallen nur von vertrauenswürdigen Quellen zu beziehen.
Info: nopiracy@austrialpin.com





Wild Country Superlight Rocks, die vor Januar 2023 hergestellt wurden, können an der Quetschverbindung des Kabels, das sich unter der Banderole mit der Kennzeichnung befindet, korrodieren. Vor allem dann, wenn sie über längere Zeit maritimer Umgebung oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch die Korrosion verringert sich die Bruchlast des Kabels erheblich. Wild Country bittet darum, diese Keile ab sofort nicht mehr zu benutzen und sich mit der Firma in Verbindung zu setzen, um einen Austausch der Keile zu organisieren. Betroffene Produkte: „Superlight Rocks“ (Code 40-RSL) und „Rocks Set 1-6“ (Code 40-RSLSET).
Seriennummern: 01A1117, 01A1217, 01A1219, 03A1219, 02A0221 (steht auf der Banderole) Kontakt zur Einsendung des Produktes unter:


SuperlightRockRecall@wildcountry.com

Ortovox ist auf ein technisches Problem aufmerksam geworden. In seltenen Fällen wirkt sich dieses Problem auf das Aufblassystem des Airbags aus und verringert dessen Schutzwirkung. Von dem LiTRIC-System selbst geht keine Gefahr aus. Aus Sicherheitsgründen bittet Ortovox, den AVABAG LiTRIC in lawinengefährdetem Gelände nicht mehr zu benutzen und ihn zurückzusenden.
Betroffene Produkte: AVABAG LiTRIC TOUR, AVABAG LiTRIC FREERIDE, AVABAG LiTRIC ZERO inklusive Zip-ons.


Einsendung des Produktes: Käufer:innen bei Ortovox online werden automatisch kontaktiert. Wer im Fachhandel gekauft hat, kann den Rucksack direkt in den Laden zurückbringen (mit Kaufbeleg).
Aufgrund eines Materialfehlers kann bei einzelnen Lawinenschaufeln das Schaufelblatt nicht korrekt in den Schaft eingerastet werden. Vom Mangel betroffene Lawinenschaufeln können bei einer Lawinenrettung nicht als Rettungsgerät eingesetzt werden. Betroffene Lawinenschaufeln werden kostenlos repariert. Es handelt sich ausschließlich um Produkte, die ab November 2021 produziert wurden. Mammut bittet, diese nicht mehr zu verwenden und die Schaufel gemäß Anweisungen auf die Fehlfunktion zu überprüfen. Bei einer Fehlfunktion ist die Schaufel zur Reparatur an die Mammut Sports Group AG zurückzusenden oder in einem Mammut-Shop abzugeben. Die Portokosten werden zurückerstattet.
Betroffene Produkte: „Alugator Ride 3.0 Hoe“ sowie „Alugator Ride SE“. Letztere ist Bestandteil des Barryvox Package, des Barryvox S Package und des Barryvox Package Tour.
Seriennummern: 1121, 1221, 0322
Info: customerservice@mammut.ch
Anleitung zur Kontrolle: https://mammut.prezly.com/ vorsorglicher-kontrollaufruf-schaufel-verschluss-arretierung
Rückruf Ortovox „Avabag Litric“

Rückruf Mammut-Lawinenschaufeln
Seriennummer: 0322 (links)
Seriennummer: 1221 (rechts)
Weniger fliegen, mehr Freiheit. Wer den Leuten ihr Leben lässt, wie es ist, wer sich gegen „Verbote“ ausspricht und für die „Freiheit“ starkmacht, entledigt sich jedes Ideologie-Verdachts. Er ist schließlich nicht der Sauertopf, der anderen was vorschreiben will, auch nicht für den Klimaschutz. Es gehört zur Rhetorik unseres Konsum- und Lebensstils, diesen als zeitlose Normalität auszugeben. Jeder Ruf nach Regelung und Beschränkung darf indes als „öko-radikal“ etikettiert werden. Diese Logik ist unbewusst in viele Köpfe eingesickert. Sie versteckt sich verbrämt auch in dieser Behauptung: „Wir ältere Bergsteiger können doch jetzt den jüngeren das Fliegen nicht verwehren.“ Doch ökologische Grenzen lassen sich nicht durch Sprache aus der Welt schaffen. Physik lässt sich nicht überrumpeln. Die Folgen der Erderwärmung mit Hitzewellen,
in jeden Winkel und jede Ritze unseres Lebens eindringen. DAV, ÖAV, AVS und SAC sind in der Gesellschaft wichtige Player und Multiplikatoren. Sie haben zusammen mehr als 2,3 Millionen Mitglieder. Alle vier Vereine haben Strategien zum Klimaschutz entwickelt – oder sind dabei –, was die Treibhausgas-Bilanzen der Vereine selbst angeht. Den ambitioniertesten, weil messbaren Plan hat der DAV, der Klimaneutralität bis 2030 erreichen will. Natürlich, Alpenvereine können ihre Mitglieder damit nicht hindern, privat ins Flugzeug zu steigen. Aber sie können auf deren Bild vom Bergsteigen Einfluss nehmen. Als Naturschutzverbände stehen sie sogar in der Pflicht, auf ihre Mitglieder einzuwirken, weniger zu fliegen. In den Satzungen aller Alpenvereine sind Natur- und Umweltschutz als Ziel und Zweck verankert. So steht in den Statuten des DAV, dass Schutz und Pflege der Natur in den Alpen „insbesondere bei der Ausübung des Bergsteigens“ zu erfolgen hat. Der ÖAV versteht sich gar als „Anwalt der Alpen“. Und der AVS verpflichtet sich zu „Natur- und Landschaftsschutz im Sinne von Sensibilisierung, Vorbild und aktiver Betätigung“. Kleine Erinnerung: Jeder, der Mitglied in einem Alpenverein ist, hat der jeweiligen Satzung zugestimmt und sie damit unterschrieben.

Bei ihren Tourenprogrammen sollten die Vereine Flugreisen reduzieren. An die Stelle müssen Destinationen rücken, die per Zug erreichbar sind. Der Orient-Express war übrigens nicht nur ein berühmter, sondern auch ein erfolgreicher Zug. Natürlich, eine Schienenreise dauert länger. Na und? Es gibt kein
auch aus der Identität „Alpinist“ lassen sich nicht einfach Privilegien ableiten. Die Selbstverständlichkeit, mit der Bergsteiger:innen ins Flugzeug steigen, muss verschwinden. Eine Rechtfertigung für Fernreisen ist, sie würden Menschen Augen und Herzen öffnen für andere Kulturen. Stimmt, die Begegnung mit fremden Lebensweisen und Landschaften kann Reisende tief berühren. Im besten Falle ist das Erlebte ein Anstoß, den eigenen Lebensstil in Frage zu stellen und sich in der Völkerverständigung zu engagieren. Das wäre aber mehr, als über dem Balkon eine Gebetsfahne zu drapieren. Gegen die Erfüllung ein, zwei solcher Herzenswunsch-Reisen oder einen internationalen Austausch ist nichts einzuwenden. Es darf nur nicht zur Wiederholungstat werden. Mit der Klimakrise steht alles auf dem Spiel. Alles. Noch können wir die schlimmsten Folgen abmildern. Einschränkung bedeutet daher nicht Gängelung, sondern die Bewahrung von Freiheit für all jene, die nach uns kommen. Politik ohne Physik ist Fantasiepolitik. Das gilt auch für Vereinspolitik.
Margarete Moulin ist freie Journalistin und lebt südlich von München. Sie schreibt unter anderem für die „Zeit“ und die „taz“ und war Redakteurin bei der von Michael Pause geleiteten Zeitschrift „Berge“. Sie ist Autorin des Handbuches „Schreiben über die Klimakrise. Berichterstattung in einer heißer werdenden Welt“, welches Journalist:innen dabei unterstützen soll, kompetent und verständlich über das Thema zu informieren.
Margarete Moulin ist freie Journalistin und lebt südlich von München. Sie schreibt unter anderem für die „Zeit“ und die „taz“ und war Redakteurin bei der von Michael Pause geleiteten
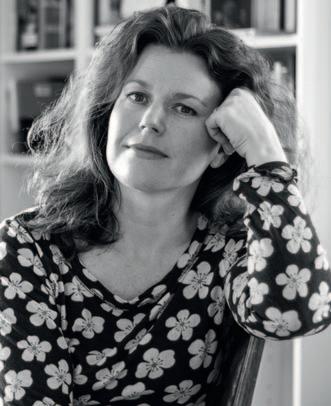
Wschmalen Grat. Es ist schwierig, über ein so stark polarisierendes Thema zu schreiben. Auch ich habe mit dem Thema zu hadern und kann mich nicht kategorisch auf eine Position festlegen. Der Klimawandel ist real, die Situation ist dramatisch. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, um die Katastrophe doch noch zu verhindern bzw. den Schaden einzudämmen!
Die Alpenvereine, die in erster Linie ja Bergsteigervereine sind, sitzen hier zwischen den Stühlen. So haben sie doch auch den Naturschutz als wichtigen Baustein in ihren Leitlinien fest verankert. Die Vereine haben hier einen massiven Interessenkonflikt, der diskutiert werden muss.
Trotz fortwährender Warnungen des Weltklimarats hat das Thema Klimaschutz jahrzehntelang wenig Beachtung gefunden. Jetzt, um fünf nach Zwölf, wird wieder einmal verlangt, dass es die jungen Generationen richten, indem sie Flugreisen in die weite Welt kategorisch ausschließen sollen. Karawanen von Autos wälzen sich am Wochenende in die Berge, Hubschrauber beliefern die Hütten für die Gäste, Wanderwochen werden auf fernen Inseln organisiert. Komfort wie warme Duschen und üppige Menüs sind auf Schutzhütten zum Standard geworden. Alles klimaschädlich. Mehr oder weniger Notwendigkeiten, das ist klar. Doch weil wir jetzt das Klima retten müssen, verdonnern wir einfach die Jugend dazu, darauf zu verzichten, sich die Welt anzusehen. Sie sollen diese Handvoll an Flugreisen einsparen und wir tun so, als wäre damit das Problem gelöst.
möchten das Klima schützen. Aber sollen wir deswegen unser Leben stoppen? Wollen wir einen der Gründe der Existenz der Vereine beschneiden? Wir sind eben auch Alpinist:innen. Wir suchen die Herausforderung am Berg, wir suchen Wege, die unmöglich erscheinen, die noch niemand gegangen ist, fernab jeglicher künstlich geschaffener Illusion von Sicherheit. Manchmal führt uns diese Suche in die weite Welt, auch deswegen, weil manches bei uns nicht mehr möglich ist und weil viele große Herausforderungen nur anderswo zu finden sind.
Fliegen wir deswegen ständig? Nein. Aber manchmal geht es nicht anders. Diese Reisen erweitern unseren Horizont – besonders durch das Kennenlernen fremder Kulturen und Lebensweisen, die oft einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben. Besonders für junge Menschen ist dieses Eintauchen in das Fremde, diese Lebensschule, wichtig. Nicht zuletzt bauen die Menschen, die durch unseren Tourismus leben, auf unsere Besuche. Klar, das Zeigen mit Fingern auf andere wird keine Probleme lösen. Was für die eine Bevölkerungsgruppe entbehrlich ist, ist für die andere wichtig und Teil ihres Lebens. Die Erzählungen über die Berge dieser Welt mit ihren Abenteuern haben bereits Generationen vor uns beeinflusst. Die Menschen werden ihre eigenen Ziele und Abenteuer auch in der weiten Welt suchen. Ob mit oder ohne Alpenvereine.
Die Vereine sollten mit ihren Aktionen Multiplikatoren für die Gesellschaft schaffen. Geben wir hier die Möglichkeit aus der

nistischen Aktionen in der Ferne mitzugeben? Sollten wir nicht viel mehr alles umfassend betrachten? Jede Aktion auf ihre Klimafreundlichkeit untersuchen, um klimabewusste Entscheidungen zu treffen und dort zu sparen, wo es geht und sinnvoll ist?
Vielleicht sollten wir die Frage für uns klären: Wenn wir schon wissen, dass Flugreisen den Klimawandel antreiben, warum glauben wir sie trotzdem unternehmen zu dürfen und was tun wir dafür, um den Schaden in Grenzen zu halten und ihn auszugleichen?
Peter Warasin ist Alpenvereinsfunktionär in Südtirol (Mitglied der Fachgruppe Tourenleiter, der Arbeitsgruppe IKT, des Fachausschusses Ausbildung und der Arbeitsgruppe Klimaschutz), Informatiker und begeisterter Alpinist. ■


Seilverbindungsknoten beim Abseilen. Es gibt diverse Szenarien beim Abseilen, in denen zwei Seile verbunden werden müssen: erstens, um die ganze Länge von Doppelseilen nutzen zu können. Zweitens für eine Seilverlängerung bei Bergemanövern. Oder drittens, wenn im Aufstieg mit Einfachseil geklettert und in Kombination mit einer dünnen Hilfsleine abgeseilt wird. Die Diskussion, welcher Knoten sich dafür am besten eignet, ist alt und wird in verschiedenen Ländern, verschiedenen Verbänden, verschiedenen Bergsportdisziplinen und der professionellen Höhenarbeit jeweils anders beantwortet. Im Folgenden werden die Festigkeiten sowie Vor- und Nachteile der meistverbreiteten Seilverbindungsknoten beleuchtet und es wird auf das Verbinden von Seilen unterschiedlicher Durchmesser eingegangen.

Lasten beim Abseilen
Um die Eignung eines Knotens zum Verbinden von Seilen bewerten zu können, stellt sich zunächst die Frage, welche Kräfte beim Abseilen auftreten. Die exakte Kraft hängt vom Gewicht der oder des Abseilenden, der Art des Seils und vom Verhalten beim Abseilen ab.
In Versuchen wurden die Kräfte gemessen, die auf die Umlenkung wirken, wenn eine 86 kg schwere Person abseilt. Ein exemplarischer Kraft-Zeit-Verlauf ist in Abb. 1 dargestellt. Kurze Kraftspitzen entstehen, wenn man sich ruckartig in das Abseilgerät fallen lässt oder bei einem heftigen Ruck beim Abseilen („Durchsacken“). Diese Kraftspitzen erreichen maximal 2,6 kN, also etwa das Dreifache des Körpergewichts der oder des Abseilenden. Höhere Werte sind fast nur
Kräfte am Fixpunkt beim Abseilen einer 86 kg schweren Person
durch einen Sturz in das Abseilgerät möglich. Die Versuche wurden mit verschiedenen Sicherungsgeräten und Seilen wiederholt und die Kräfte wurden auch mit einem Seil mit geringer Dehnung nach EN 1892 nicht überschritten.
Beim gleichmäßigen Abseilen bewegen sich die Kräfte um das Körpergewicht, also ca. 0,9 kN. Diese Unterscheidung macht deshalb Sinn, da Seilverbindungsknoten zum Teil die Eigenschaft haben, bei einer konstant wirkenden Kraft zu rollen und sich dagegen bei nur kurz wirkenden Kraftspitzen zuzuziehen, ohne zu rollen. Umgerechnet auf eine 120-kg-Person sollten beim freihängenden Abseilen auf die Umlenkung maximal 3,6 kN und eine Dauerlast von 1,2 kN wirken. Im Einzelstrang wirkt die gesamte Last auch auf den Seilverbindungsknoten. Wird im Doppelstrang abgeseilt, wirkt auf den Seilverbindungsknoten nur die halbe Last.
ruppiges Durchsacken beim Abseilen
Florian Hellberg ist Physik-Ingenieur, B ergund Skiführer und arbeitet bei Edelrid im Bereich Forschung und Ausbildung. Er ist Mitglied im VDBS Bergführerlehrteam und w ar langjähriger Mitarbeiter bei der Sicherheitsforschung des DAV.

Fallenlassen ins Abseilgerät
dauerhafte Last, die beim Abseilen wirkt
Last am Ankerpunkt beim Abseilen einer 86-kg-Person mit einem MEGA JUL im Doppelstrang mit einem Seil mit 8,9 mm Durchmesser nach EN 892. An jedem Seilstrang wirken 50 % der Kraft.
Diese Seilverbindungsknoten wurden auf ihre Festigkeit hin getestet.
Sackstich Achter doppelter Spierenstich zwei Sackstiche Paketknoten
Dass der Seilverbindungsknoten hält, ist Grundvoraussetzung. Darüber hinaus ist es für die Praxis wichtig, dass der Knoten beim Abziehen des Seils und am Umlenker möglichst wenig zum Verklemmen neigt. Asymmetrische Knoten, wie Sackstich, Achter und Paketknoten, können auf die Seite mit weniger Struktur rollen und neigen deshalb weniger dazu, an Felskanten hängen zu bleiben. Je kleiner der Knoten ist, desto engere Risse kann er durchrutschen.
Folgende Knoten zum Verbinden von Seilen wurden überprüft: Sackstich, Achter, doppelter Spierenstich, zwei Sackstiche hintereinander und Paketknoten.
Methode. Die Knoten wurden mit min. 30 cm langen Seilenden sauber gelegt (ohne Kreuzungen) und an allen vier Enden festgezogen. Die Belastung der Knoten erfolgte zwischen zwei Schlingscheiben mit 180 mm Durchmesser und einer Geschwindigkeit von 1000 mm/min. Bestimmt wurde die Kraft, bei der es zu einem ersten Rollen des Knotens kam („1. Rollen“). Wenn der Knoten über die Enden hinausrollte, wurde die höchste Kraft ermittelt, die beim Rollen des Knotens auftrat („Rollen“). Wenn es zu einem Bruch des Seils kam, wurde die höchste Zugkraft vor dem Bruch angegeben („HZK“). Die angegebenen Werte sind die Mittelwerte aus drei Versuchen.
Sackstich (links) versus doppelter Spierenstich (rechts) – der Sackstich rollt leichter über Felskanten. Asymmetrische Knoten neigen weniger dazu, an Felsvorsprüngen und -kanten hängen zu bleiben.
Je kleiner der Knoten ist, desto leichter kann er durch enge Risse rutschen. Sackstich (links) versus Achter (rechts) – der kleinere Sackstich rutscht leichter durch enge Risse als ein Achter oder Paketknoten.
SWIFT 48 PRO DRY 8,9 mm Durchmesser
Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 18,1 kN:
Rollen, dann Bruch
Bruch ohne Rollen
erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch
Zuziehen/Rollen, dann Bruch
SWIFT 48 PRO DRY 8,9 mm
Knotenfestigkeiten SWIFT 48 PRO DRY 8,9 mm Durchmesser; Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 18,1 kN.
CANARY PRO DRY 8,6 mm Durchmesser
Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 16,8 kN:
dann Bruch Bruch ohne Rollen
erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch Zuziehen/Rollen, dann Bruch
Gebrauchtes CANARY PRO DRY 8,6 mm Durchmesser
Einfach-, Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 17,6 kN:
Rollen/Zuziehen, dann Bruch im Knoten
einmaliges Rollen, dann Zuziehen bis Bruch
Zuziehen bis Bruch
erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch
Zuziehen/Rollen, dann Bruch
APUS PRO DRY 7,9 mm Durchmesser
Nach EN 892; Halb- und Zwillingsseil mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 15,1 kN:
rausgerollt Rollen, dann Bruch Bruch ohne Rollen
erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch
dann Bruch
Gebrauchtes APUS PRO DRY 7,9 mm Durchmesser
Nach EN 892; Halb- und Zwillingsseil mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 14,7 kN:
Rollen/Zuziehen, dann Bruch im Knoten
einmaliges Rollen, dann Zuziehen bis Bruch
Zuziehen bis Bruch
erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch
Zuziehen/Rollen, dann Bruch
SKIMMER PRO DRY 7,1 mm Durchmesser
Halb- und Zwillingsseil nach EN 892 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 13,3 kN:
Sackstich
RAPLINE PROTECT PRO DRY 6,0 mm Durchmesser
Nach EN 564 mit einer Ausgangsfestigkeit (ohne Knoten) von 11,0 kN:
Rollen, dann Bruch
Bruch ohne Rollen
erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch
Zuziehen/Rollen, dann Bruch
rausgerollt
Rollen, dann Bruch
Bruch ohne Rollen
erster Knoten rollt auf zweiten, dann Bruch
Zuziehen/Rollen, dann Bruch
PROSTATIC SYNC TEC 10,5 mm Durchmesser
Nach EN 1891 Typ A mit einer Ausgangsfestigkeit (Knoten) von 34,5 kN:
In Bezug auf die Festigkeit erreicht der doppelte Spierenstich die höchsten Werte; selbst beim Verbinden von zwei RAPLINES noch 6,9 kN. Der Achterknoten fängt bei den niedrigsten Kräften an zu rollen, was nicht optimal ist. Der Sackstich rollt aus den meisten Materialien heraus, ist aber der kleinste und ein asymmetrischer Knoten und bietet damit die kleinste Verhängungsgefahr. Der Paketknoten rollt wenig und liegt von der Festigkeit zwischen Achter und Spierenstich, ist aber relativ groß.
Einfluss vom Gebrauch: Die im Versuch gebrauchten Seile waren etwa fünf Jahre mittelhäufig beim Klettern am Felsen im Einsatz. Durch den Gebrauch ist der Seilmantel rauer im Vergleich zu neuen Seilen, denn die Imprägnierung ist abgenutzt und der Mantel leicht aufgepelzt. Knoten neigen weniger stark zum Rollen. Dieser Effekt wird bei Seilen im Gebrauch für gewöhnlich eintreten. Die Festigkeit der Knoten war bei diesen Seilen nicht nennenswert reduziert. Die Festigkeitsreduktion hängt aber von der Art des Gebrauchs sowie vom genauen Zustand eines Seils ab und die Ergebnisse lassen keine allgemeingültigen Rückschlüsse zu.
Für eine Bewertung stellt sich die Frage, wie viel ein Seilverbindungsknoten halten muss. Mit den Ergebnissen aus den Abseilversuchen lassen sich folgende Anforderungen ableiten: Seilverbindungsknoten, die bei 2 kN noch nicht zu rollen anfangen und bei 5 kN noch nicht reißen, bieten für das Abseilen/Ablassen einer 120-kgPerson im Einfachstrang immer noch einen Sicherheitspuffer von etwa Faktor 1,5 für den Fall einer „worst case“-Anwendung. Im Doppelstrang wird die Last auf den Knoten halbiert und Seilverbindungsknoten, die bei 1 kN noch nicht zu rollen anfangen und bei 2,5 kN noch nicht reißen, bieten ebenso einen Sicherheitspuffer von etwa Faktor 1,5 für den Fall einer „worst case“-Anwendung.
Alle Seilverbindungsknoten mit Einfachseilen erreichten bei den Versuchen die Anforderungen für eine 120-kg-Person im Einzelstrang. Bei einer Seilverbindung mit Einfachseil und RAPLINE PROTECT werden die Anforderungen knapp erreicht. Mit den Halbseilen werden mit dem Sackstich die Anforderungen fürs Abseilen im Doppelstrang erreicht, für das Arbeiten im Einfachstrang bieten sie zu wenig Puffer.
Mit dem doppelten Spierenstich ist man in puncto Festigkeit auf der sicheren Seite. Allerdings birgt das Verhängen des Seils in der Gesamtbetrachtung des Abseilvorgangs enorme Gefahren und Nachteile. Deshalb hat der Sackstich seine Berechtigung als Seilverbindungsknoten. Er bietet für das Abseilen/Ablassen im Doppelstrang genügend Festigkeit und neigt weniger zum Verhängen. Beim Abseilen/Ablassen im Einzelstrang mit dünnen, glatten Halbseilen macht es Sinn, den Sackstich durch einen zweiten vor dem Herausrollen zu sichern.

Extrem wichtig bei allen Seilverbindungsknoten ist es, die Seilenden ausreichend lang zu lassen (ca. 30 cm) und den Knoten an allen vier Seilenden ordentlich zuzuziehen. ■
Der Sackstich bietet für das Abseilen im Doppelstrang genügend Festigkeit. Mit dünnen und glatten Seilen macht es Sinn, den Sackstich mit einem zweiten gegen das Herausrollen zu sichern.

 Foto: Bergwacht Berchtesgarden
Foto: Bergwacht Berchtesgarden
Hundewanderführer1 , Hundekurse für Bergsteiger2 und omnipräsente, allumfassende mediale Tipps für bergbegeisterte Hundebesitzer3. Notrufe über kalte Schnauzen in Bergnot bleiben da nicht aus, allein im Berchtesgadener Land mehrmals jährlich. Meldebild: hilfloser Hund, ungesicherte Pfoten!4 Hunderettungen sind im Bergrettungsdienst keine Seltenheit mehr.
Über 10 Millionen Hunde leben in Deutschland5, in über 21 Prozent der deutschen Haushalte. Im Jahr 2021 gab es in Österreich insgesamt rund 837.000 Hunde6, in der Schweiz 544.000 Hunde als Haustier (im Jahr 2022)7 , in Südtirol mehr als 42.000 (Stand 2021).8 Tendenz jeweils steigend. Medien lieben Hunderettungen, Updates eingeschlossen; gerettete Tiere sind nahezu immer Nachrichten wert, und nicht nur lokal: „Hund Hardy nach einer Woche wieder aufgetaucht“ – eine deutschlandweite Schlagzeile!9 Die Bergwacht suchte mit Drohne und Wärmebildkamera. Aber es gab und gibt kritische Stimmen. Hunderettungen und Hundesuchen polarisieren. Die einen erheben primär Vorwürfe gegen die wandernden Hundebesitzer, andere betonen überdeutlich den Stellenwert der Bergrettung als Menschenrettung und wieder andere setzen die Not von Tier und Mensch absolut gleich. Wichtig ist, sachlich zu bleiben: Ein Tier ist kein Mensch. Aber es ist ein Mitgeschöpf, und niemand soll und darf, wie schon das Gesetz formuliert, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen, weder durch aktives Tun noch durch Unterlassen.10 Und die Erfahrung vieler Bergretter lehrt: Hunderettung ist fast immer mit einem menschlichen Schicksal verknüpft, und der Hundenotfall entwickelt sich schnell zu einem menschlichen Notfall, da kein Hundebesitzer ohne seinen Liebling vom Berg absteigen, ihn in einer Notlage zurücklassen und bei Rettungsversuchen mitunter selbst in Gefahr geraten wird.
Ristfeuchthorn 2018 – viereinhalbstündige Hunderettung.11
Ein Ehepaar aus Brandenburg steigt mit Gebirgsschweißhund Zorro Richtung Ristfeuchthorn auf, als der Rüde gegen 12.00 Uhr in rund 1.100 Metern Höhe plötzlich aus seinem Leder-Halsband schlüpft und bergab durch steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände und eine Felsrinne einer Gamsen-Fährte folgt. Der Mann versucht über eine
Rinne den Hund zu erreichen und verletzt sich leicht. In seiner hilflosen Lage setzt das Ehepaar gegen 14.20 Uhr den Notruf 112 ab. Zwei Fußmannschaften der Bergretter queren jeweils in rund 920 und 1.050 Metern Höhe über steile Grashänge und durch Rinnen zu Felswänden, wo sie Zorro bellen und winseln hören. Die genaue Ortung des Hundes ist bedingt durch die steilen, gestuften und auf den Bändern dicht bewachsenen Felswände aufwändig. Ein Retter seilt in 1.050 Metern Höhe rund 50 Meter tief durch die Rinne auf das Grasband oberhalb der Felswand ab und sichert das Tier notdürftig mit einer Bandschlinge. Ein zweiter Retter seilt sich ab. Die beiden Einsatzkräfte bergen das Tier seilgesichert durch steile, felsdurchsetzte Grasleiten. Gegen 18.45 Uhr können die überglücklichen Urlauber Zorro“wieder in Empfang nehmen.
Hochstaufen 2019 – Hund und Besitzerin mit Heli ausgeflogen.12 Gegen 14.55 Uhr ging ein Notruf wegen eines rund 40 Kilo schweren Retrievers mit Lähmungserscheinungen in rund 1.300 Metern Höhe am Goldtropfsteig auf der Südseite des Hochstaufen ein. Zwei 21-jährige Frauen brachen den weiteren Aufstieg ab und versuchten den Hund zunächst noch selbst talwärts zu bringen, wobei die Besitzerin nach über zwei Stunden und etwa 100 Höhenmetern körperlich und psychisch völlig am Ende war. Gegen 17.15 Uhr ließ der von der Bergrettung nachgeforderte Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ seinen Notarzt und einen Reichenhaller Bergwacht-Hundeführer im Schwebeflug auf einem Felskopf in 1.250 Metern Höhe aussteigen. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die 21-jährige Patientin und flogen sie, ihre Begleiterin und den Hund in zwei Anflügen ins Tal.
Lattengebirge 2021 – Personenrettung nach eigenmächtiger Hundesuche.13 Am Freitagabend gegen 17 Uhr musste die Reichenhaller Bergwacht eine 32-jährige Münchnerin retten, der beim Wandern im Lattengebirge am Toni-Michl-Steig zunächst ihr Hund abgestürzt war. Noch bevor die Bergwacht deswegen ausrücken konnte, meldete sich die Frau erneut, dass der Hund mittlerweile von selbst wieder zu ihrer auf dem Weg warteten Begleiterin zurückgekommen sei; gegen 18.30 Uhr folgte dann der zweite Notruf, da sich die 32-Jährige bei der Suche nach dem Hund im Steilgelände verstiegen hatte und in der Dunkelheit den Weg nicht mehr finden konnte. Fünf Bergretter rückten aus und retteten die verstiegene Hundebesitzerin aufwändig.
Dr. Klaus (Nik) Burger ist nicht nur Ju rist, sondern auch Bergretter, Flugretter und Eins atzleiter der Bergwacht Bayern sowie L eiter des Zentralmoduls

Eins atzleiterausbildung Bayern. Als Hundebesitzer verlor er 2011 selbst einen Hund bei einem Absturz am Berg. Als Ei nsatzleiter ist der Autor mit vielfältigen Hunde-Rettungsersuchen betraut, sei es privat oder über den Notruf
Untersberg 2021 – Abgestürzter Hund am Drachenloch, grenzüberschreitende Rettung.14 Gegen 15.20 Uhr ging der Notruf ein. In rund 1.200 Metern Höhe ließen zwei Wanderer ihren Hund kurz von der Leine, der aber dann im Gelände verschwand. Die Urlauber stiegen dann wegen der Dämmerung ins Tal ab, setzten am nächsten Tag zunächst selbst die Suche fort, alarmierten die Bergwacht, da sie das Tier im steilen Absturzgelände zwar bellen hörten, aber selbst nicht erreichen konnten. Die Bergwacht Marktschellenberg und die Bergrettung Grödig konnten den Hund im Grenzgebiet orten, aber wegen der einsetzenden Dunkelheit nicht retten. Der Einsatz eines Hundeführers und eines Polizeihubschraubers musste wegen der Dunkelheit abgebrochen werden. Am darauffolgenden Tag stiegen dann Retter aus Marktschellenberg und Grödig mit den Besitzern auf, zogen das Tier rund 130 Meter aus einem Absturzgelände mit dem Seil nach oben und trugen den Hund ins Tal, wo er operiert werden musste.
Jettenberger Forst 2022 – Wärmebilddrohne sucht nach Hund Hardy.15 Hund Hardy bewegte die Nation. Das Team des Technikbusses der Bergwacht-Region Chiemgau und ein Einsatzleiter suchten mit einer hochleistungsfähigen Wärmebild-Drohne die Aschauer Klamm und das umliegende Steilgelände ab, erfolglos. Er blieb vermisst, ließ sich erst nach Tagen wieder blicken. Die „Bild Zeitung“ beruhigte Deutschland zeitnah: Hund Hardy ist wieder aufgetaucht, die Hundegeschichte hat ein gutes Ende.
Diese Fälle aus jüngerer Zeit sind nur beispielhaft und nur aus dem Berchtesgadener Land. Beinahe alle Ansätze in der Ethik stimmen darin überein, dass der Mensch und damit auch die Bergretter moralische Verpflichtungen gegenüber (empfindungsfähigen) Tieren haben.16 Tieren zu helfen, gehört sich. Diese Ethik in der professionellen Bergrettung umzusetzen, ist aber durchaus komplex:
Gemeinsam und im Ergebnis notwendig ist den organisierten Tierrettungs-Szenarien eines, nämlich die Notlage des Tieres, also eine Situation, in der eine drohende Gefährdung für ein Tier besteht.17 Als begriffliche Konkretisierung einer Notlage ist die Generalnorm des Tierschutzgesetzes (TierSchG) gut verwertbar: „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“18, aktiv oder passiv. Der Begriff des Leidens umfasst u. a. Empfindungen wie Panik, starke Aufregung oder starke Erschöpfung, negativen Stress über längere Dauer, Hunger, Durst oder Hitzequalen.19 Einschlägige Fälle sind aus der Presse bekannt, in denen die Polizei oder Feuerwehr Hunde aus überhitzten Autos rettet.20 Besonders im Gebirge lässt – für Hundewanderer wichtig – zusätzlich eine bußgeldbewehrte Spezialnorm, nämlich § 3 Nr. 1 TierSchG, aufhorchen: Danach ist es verboten, einem Tier, außer in Notfällen, Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen.21
Die Indikation eines Bergrettungseinsatzes ergibt sich mithin aus der hinreichenden Wahrscheinlichkeit einer Notlage von Tieren, nicht aber daraus, dass ein Tier entlaufen und (nur) einzufangen ist.22 Begrifflich und damit auch journalistisch spreche ich von Tierrettungen und nicht von Tierbergungen. Der wohl überkommene Begriff der Tierbergung geht darauf zurück, dass Tiere ehemals Sachen im rechtlichen Sinne waren. Im Jahre 1990 folgte aber bereits die begriffliche Wende im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB): Tiere sind keine Sachen.23 Der Tierschutz selbst fand in der Folge im Jahr 2002 als Staatszielbestimmung sogar Aufnahme in das Grundgesetz.24

Zunächst besteht eine sogenannte „Jedermann“-Zuständigkeit gemäß der genannten gesetzlichen Vorgabe, dass niemand „einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“ darf. Wer dies nicht beherzigt, aktiv oder auch durch Unterlassen, kann sich strafbar machen oder wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden, §§ 17, 18 Tierschutzgesetz (TierSchG). Auch kann sich jedermann – allerdings sehr strittig – wegen unterlassener Hilfeleistung gem. § 323c StGB strafbar machen, wenn ein Tier in Lebensgefahr schwebt bez. dem Tier vermeidbare Schmerzen oder Leiden drohen, und er nicht hilft.25 Aber: Die Hilfe für ein Tier in Notlage muss zumutbar sein. Unzumutbar ist die Tierrettung bei erheblicher Eigengefährdung, so z. B. im absturzgefährlichen Gelände. Diese Prämisse gilt auch für den Eigentümer oder Inhaber der tatsächlichen Gewalt von Hunden, der explizit und besonders die Pflicht hat, Leiden von Tieren zu verhindern und entstehende Gefahren für das Tier oder andere Personen oder Sachen selbst zu beseitigen.26 Jedenfalls bei erheblicher Eigengefährdung ist aber auch für Eigentümer oder Besitzer die Rettung des Tieres aus einer alpinen Notlage weder anzuraten noch zumutbar.
Schafft nun der Eigentümer oder Besitzer keine Abhilfe und ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit einem (weiteren) Leiden, einer Verletzung oder dem Tod des Tieres zu rechnen, so wird – außerhalb von Gefahrenlagen im Gebirge oder im unwegsamen Gelände – eine Zuständigkeit der Feuerwehr begründet.27 Denn Feuerwehren leisten neben der Brandbekämpfung auch technische Hilfe bei Unglücksfällen oder Notständen im öffentlichen Interesse.28 Hierzu zählen Maßnahmen gegenüber Tieren, die entweder selbst eine Gefahr darstellen oder sich in hilfloser Lage befinden.29 Die Einsatzkräfte werden entsprechend geschult. Das öffentliche Interesse an der Hilfeleistung besteht aber nur, wenn die sofortige Hilfe zur Gefahrenabwehr notwendig ist.
Wie dargelegt, darf „niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“. Da dieses Gebot bußgeldbewehrt ist, § 18 Abs. 1 Nr. 1 TierSchG, eröffnet sich ein Tatbestand der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der zu einem Einschreiten der zuständigen Behörden oder auch der Polizei zwingen kann.30 Freilich ist die polizeiliche Hilfeleistung subsidiär, und zwar gegenüber der Feuerwehr und den allgemeinen Sicherheitsbehörden sowie letztlich gegenüber der Bergwacht oder der Wasserwacht.31
„Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“
§ 1 Satz 2 TierSchGFoto: Archiv Burger
Nach Alarmierung ist oftmals zu beobachten, dass Hundebesitzer ihren zunächst sicheren Standort verlassen und vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits eigenständig suchen oder retten wollen und dabei erhebliche eigene alpine Risiken eingehen. Dies gilt es vorrangig zu verhindern.

Im Gebirge und im unwegsamen Gelände stößt die Feuerwehr an die Grenzen ihrer Einsatzfähgkeit. Und die Polizei wird regelmäßig zu Recht auf ihre subsidiäre Zuständigkeit verweisen. Ist ein Hund in diesem Gelände in einer Notlage, ist daher die Bergrettung gefordert, sofern eine Hilfe für Eigentümer oder tatsächlichen Begleiter nicht zumutbar oder möglich ist, aus welchen Gründen auch immer.32 Es fragt sich unter welchen Voraussetzungen?
1. „Isolierte“ Rettung eines Tieres in Notlage Rettungsgesetzlich ist die Bergwacht in Bayern explizit (nur) für die Personenrettung zuständig, so Art. 2 Abs. 12 Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG). Die reine Tierrettung ist, man kann es drehen und wenden, wie man will, begrifflich und isoliert betrachtet keine Personenrettung. Eine rechtliche Analogie „Person ist gleich Tier“ verbietet sich.33 Die „isolierte“ Tierrettung findet mithin keine Anspruchsgrundlage im Rettungsdienstgesetz, es gelten nicht die dortigen klaren Vorgaben. „Isolierte“ Tierrettungen sind aber als Aufgabe nach dem satzungseigenen Ordnungsrecht der Bergwacht Bayern34 gut begründbar. Da die Bergwachtbereitschaften mit den jeweiligen Zweckverbänden für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (öffentlich-rechtliche) Verträge über die Durchführung der Berg- und Höhlenrettung abschließen, wird die Tierrettung insofern auch vertragliche Aufgabe der Bergrettung, allerdings, was wichtig ist, nur „nach ihren personellen und strukturellen Möglichkeiten“35 Tiernotfall-Rettung im alpinen und unwegsamen Gelände ist also im Aufgabenspektrum der Bergwacht vertraglich und satzungsgemäß verankert. Auch die Alarmierungsbekanntmachung Bayern36 verwendet unter dem Stichwort RD Bergrettung und nachfolgend unter dem Schlagwort „fachliche Unterstützung für Andere“ explizit den Begriff „Rettung von Tieren“37. Entsprechende Tierrettungen sind in der Bergrettung ständige Praxis und werden in Bayern gebührenbegrifflich unter „Sondereinsätze“ abgerechnet, mit Tarifen je nach Aufwand bis zu aktuell € 1.125,- (ohne Hubschrauberkosten!).38
2. Der „tierische“ Notfall entwickelt sich zu einem menschlichen Rettungsfall Tierrettungen können aber, so lehrt die Einsatzleiter-Erfahrung, gleichzeitig oder sogar vorrangig Personenrettungen sein. Tiere und insbesondere Hunde sind Familienmitglieder mit „Kinderstatus“. Hundebesitzer versuchen verständlicherweise, ihre entlaufenen Tiere zu finden oder/und aus misslicher Lage zu retten, und begeben sich zur Rettung ihrer Lieblinge oftmals selbst in (große) Gefahr, da sie brauchbare Pfade verlassen, auch Wildwechseln folgen, und
sich in absturzgefährliches Gelände wagen. Darüber hinaus sind Herrchen und Frauchen bisweilen wegen der tatsächlichen oder auch vermeintlichen Tiernotlage in einer psychischen Ausnahmesituation mit eingeschränktem aktuellen Urteils- und damit Handlungsvermögen, mithin „hilflos“. Damit eröffnet sich die rechtliche Schnittstelle zum Rettungsdienstgesetz (Personenrettung): „Bergund Höhlenrettung ist nämlich gesetzlich definiert als Rettung nicht nur verletzter, erkrankter, sondern auch hilfloser Personen aus Gefahrenlagen im Gebirge und im unwegsamen Gelände.39
Wichtig: Nach Alarmierung ist oftmals zu beobachten, dass Hundebesitzer ihren zunächst sicheren Standort verlassen und vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits eigenständig suchen oder retten wollen und dabei erhebliche eigene alpine Risiken eingehen. Dies gilt es vorrangig zu verhindern. Die Tierrettung findet allerdings regelmäßig dann als Rettung einer hilflosen Person keine Grundlage im Rettungsdienstgesetz, wenn entsprechende Hilfeersuchen aus geschützter Position der alarmierenden Person erfolgen (z. B. vom Tal oder von einer Hütte aus) oder die hilflose Lage der Begleiter nicht ernsthaft droht, weil diese an dem sicheren Ort verbleiben.
3. Der streunende Hund – Jagdschutz
Streunende Hunde begründen ohne Notlage zunächst kein vertragliches oder gesetzliches Bergrettungsszenario, auch wenn privat oder über Notruf „Suchbitten“ eingehen. Eine besondere Dynamik und bisweilen Dramatik des Geschehens für Tier und Mensch entsteht i n diesen Fällen, wenn der Hund eine Tierfährte aufgenommen hat oder bereits einem Wild nachstellt und sich somit die Gefahr beziehungsweise Sachlage eines wildernden Hundes entwickelt. Denn Berge und Bergwälder sind regelmäßig Jagdbezirke bez. Jagdreviere, und hier erlauben die Jagdgesetze unter bestimmten Voraussetzungen, einen im Jagdrevier wildernden Hund unschädlich zu machen und zu töten.40 So formuliert Art. 42 Abs. 1 Nr. 2 BayJagdG: Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und Katzen zu töten. Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.41 Der Jagdschutz ist tierschutzrechtlich im Grundsatz ein erlaubter („vernünftiger“) Grund der Hundetötung.42 Die Tötungsbefugnis verlangt aber, dass der Hund eine reale Gefahr für das Wild darstellt und ein schonenderes Mittel nicht zur Verfügung steht.43 Für den Bergretter besteht grundsätzlich auch unter diesen Bedingungen keine Pflicht zur Rettung des Hundes aus der Gefahrenlage und auch keine Pflicht, einen Hund, der einer Tierfährte gefolgt ist, zu suchen und einzufangen. Hier käme es überdies sogar zu einem Zielkonflikt der Bergrettung mit dem Jagdschutz. Völlig entkräftete oder verunglückte Hunde durchstreifen aber regelmäßig nicht mehr „fangbereit“ den Jagdbezirk und entwickeln (indiziell) keinen Jagd-
trieb (mehr). Ist der Hund insofern erkennbar in einer Notlage und ist keine Gefahr des Wilderns zu besorgen, löst sich dieser Zielkonflikt auf und es ist an eine isolierte Tierrettung wegen der Notlage des Hundes zu denken. Es empfiehlt sich grundsätzlich für den Einsatzleiter Bergrettung bei entsprechender Sachlage, sich (gegebenenfalls über die zuständige Polizeidienststelle) mit dem für das einschlägige Revier zuständigen Jagdausübungsberechtigten in Verbindung zu setzen und das Weitere abzusprechen.
y Allen Pflichten zur Hilfeleistung ist gemeinsam, dass sich der Hund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in einer Notlage befinden muss.44 Das bloße Einfangen eines streunenden Tieres gehört ohne Hinzutreten weiterer Umstände weder zu den Aufgaben der Feuerwehr und der Sicherheitsbehörden noch zu den Aufgaben der Bergrettung.45 So ist es nicht notwendig, Katzen von Bäumen zu bergen, weder zur Gefahrenabwehr noch zur medizinischen Tierrettung, sofern die Katze nicht tagelang auf dem Baum verbringt und dabei leidet. Auch das bloße Suchen eines abgängigen Hundes ohne hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Notlage begründet keine Einsatzverpflichtung. In entsprechenden Fällen wird es meist schon an einer Alarmierung über die Integrierte Leitstelle (Notruf 112) fehlen.
y Bei Bitten aus dem privaten (inoffiziellen) Bereich empfiehlt sich schon aus Versicherungsgründen, die Leitstelle zu informieren, einen Einsatz anzumelden und den Einsatz mit der erforderlichen und hinreichenden Wahrscheinlichkeit einer Gefahren- und Notlage des Tieres zu begründen.
y Tierrettung ist in der Bergrettung gegenüber der Personenrettung nachrangig. Gesetzliche Pflichtaufgabe ist die Personenrettung. §§ 3 Abs. 3 und Abs. 4 der Ordnung der Bergwacht Bayern vom 30. September 2020 stellen klar: Die Bergwacht erfüllt (primär) die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben des Rettungsdienstes, also des BayRG (Personenrettung) und des Katastrophenschutzes. Erst „nach ihren personellen und strukturellen Möglichkeiten“ erfüllt sie weitere Aufgaben, darunter fallen die Tierrettungen und Sachbergungen wie auch der Sanitätsdienst. Es ist insofern die Pflicht des Einsatzleiters, vorrangig Kräfte für die Personenrettung vorzuhalten und nicht die verfügbaren Kräfte bei einer möglicherweise sehr aufwändigen „isolierten“ Tierrettung zu binden.
y Das Risikomanagement und die Gefährdungsbeurteilung erfordern bei einer Tierrettung besondere Beachtung. Im Rahmen des Risikomanagements in der Tierrettung gelten andere Grundsätze und Beurteilungsgrundlagen, zumal nicht die Rechtsgüter von Menschen (Einsatzkräften und zu Rettenden) kollidieren, sondern die Rechtsgüter von Mensch und Tier abzuwägen sind. Auch wird dabei zwischen Bergungen hilfloser, tatsächlich erkrankter oder verletzter Tiere und bloßen Suchaktionen (drohenden Notlagen) zu unterscheiden sein.
y Tierrettung setzt Sachkunde voraus. Mit Panikverhalten der Tiere ist zu rechnen, und die Rettung kann mit unvertretbar hohen Risiken verbunden sein.46 Es sollten immer tiererfahrene Personen und speziell ausgebildete Rettungseinheiten wie beispielsweise Hundeführer oder Hundestaffeln federführend mit eingesetzt werden. Bei der Risikobewertung für den Retter ist neben der eigenen Absturzgefahr zu berücksichtigen, dass Hunde beißen können, ihr Revier verteidigen, auch ihren vermeintlich nahen Besitzer verteidigen. Überdies sind allgemeine Verhaltensweisen zu beachten.47 Auch gilt es, Zugriff zumindest auf und für schmerzstillende und damit den Abtransport sichernde Medikamente zu haben.

Faustregeln also:
1. Kein Anspruch auf Tierrettung, wenn das Tier sich nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in einer Notlage (verletzt, erkrankt, hilflos) befindet.
2. Ein Anspruch auf Tierrettung besteht bei gemeldeter Notlage des Tieres nur dann, wenn zum einen die Tierrettung im Rahmen des Risikomanagements und der Gefährdungsbeurteilung verantwortet werden kann48 und zum anderen ausreichend Retter und Rettungsmittel für Personenrettungen (als gesetzliche Pflichtaufgabe) vorgehalten werden.
3. Eine Tierrettung löst dann immer einen Rettungsdiensteinsatz aus, wenn damit zu rechnen ist, dass sich (Begleit-)Personen konkret vorhersehbar oder tatsächlich gesundheitlich erheblich gefährden oder hilflos sind beziehungsweise hilflos werden.
Quellen
1 U. a. Locher/Rettstatt, Wandern mit Hund Bayerische Alpen, 2021; Obele, Wandern mit Hund, Rother Wanderbuch, 2021; Reimer/Baur
Die schönsten Wanderungen mit Hunden: Oberbayern, 2021; Knobling, Wandern mit Hund Allgäu, Rother, 2023; Hlatky/Eggenberger, Wandern mit Hund in Oberösterreich, 2016; Ali, Wandern mit dem Hund, 2009: Rößner, Wandern mit Hund Südtirol, 2018. Marmsaler, Zonter, Schwärzer, Mit Hunden unterwegs in Südtirol, 2019. Wandern mit Hund Erlebnis Schweiz, Kümmerly +Frey, 2023.
2 www.br.de/mediathek/video/auf-gesicherten-pfoten-mit-dem-hund-in-dieberge-av:5f4ab52463457f001438ada0
3 Bergwandern-Mit-Hund.de ; doggy-fitness.de/warm-up/ ; www.bergwelten.com/lp/4-pfoten-am-berg-wandern-mit-hund
4 Vgl. www.mein-wanderbuch.de/vierbeiner-in-bergnot-rettung-bergwacht/
5 www.zzf.de/marktdaten/heimtiere-in-deutschland.
6 de.statista.com/statistik/daten/studie/1098254/umfrage/hunde-in-oesterreich/
7 de.statista.com/statistik/daten/studie/283734/umfrage/hunde-in-der-schweiz/
8 www.tageszeitung.it/2018/11/11/auf-den-hund-gekommen-2/ www.news.provinz.bz.it/de/news/landesregierung-dna-datenbank-fur-hunde-ab-1-janner-2022
9 www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/in-alpen-ausgerissenhund-hardy-nach-einer-woche-wieder-aufgetaucht-80904374.bild.html
10 § 1 Satz 2 TierSchG.
11 BRK BGL 14.07.18
12 www.salzburg24.at/news/salzburg/grenznah/hochstaufen-gelaehmter-hundin-bergnot-gerettet-70903369
13 BRK BGL 12.03.21
14 BRK BGL 03.10.21
15 BRK BGL 02.08.22
16 www.uni-muenster.de/imperia/md/content/wwu/wwu_leitbild_tierversuche.pdf
17 Vgl. alte Fassung VollzBekBayFwG zu Art. 4 BayFwG, 4.2.2. (gültig bis 30.06.2013)
18 § 1 Satz 2 TierSchG.
19 Erbs/Kohlhaas/Metzger, Strafrechtliche Nebengesetze, 243. EL August 2022, TierSchG § 1 Rn 22.
20 www.deine-tierwelt.de/magazin/herrchen-hatte-termine-polizei-befreit-hundaus-ueberhitztem-auto. Dazu OLG Nürnberg BeckRS 2019, 30089 – kein Anspruch des Tierhalters für Rettungsschäden am Auto.
21 Überforderung setzt ein Missverhältnis zwischen dem Zustand oder den Kräften des Tieres und der geforderten Leistung voraus, Erbs/Kohlhaas/Metzger, Strafrechtliche Nebengesetze, 243. EL August 2022, TierSchG § 3 Rn 3-6. Insofern ist die Tourenplanung mit Hund entsprechend zu gestalten, und bei bereits erkennbarer Überforderung des Tieres sollte man umkehren.
22 Sofern keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht!
23 § 90a BGB: 1Tiere sind keine Sachen. 2Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. 3Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
24 Art. 20a GG [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen] Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
Weichenstellung: Handelt es sich um eine (bloße) Tiersuche, um eine „isolierte“ Tierrettung wegen Notlage des Tieres oder um eine mit der Tierrettung verbundene erforderliche Personenrettung (hilflose, sich selbst gefährdende Besitzer/ Begleiter des Tieres)?
Polizei informieren. Einsatzbereich der Feuerwehr eröffnet? Wenn Bergrettungseinsatz:
Besonders fachkundige Retter anfordern (Hundeführer; gegebenenfalls Tierarzt (wegen Medikamentengabe). Kein Vorrücken zur Einsatzstelle bei erheblicher Eigengefährdung der Retter (Arbeitsschutzvorgaben).

Tiersuche ohne konkrete Notlage des Tieres
y Keine Verpflichtung bei fehlender Notlage des Tieres.
y Aber: Vermeidung der Selbstgefährdung von (suchenden) Angehörigen! Wenn Einsatz insofern vertretbar:
- Einsatzanmeldung bei Leitstelle.
- Vorhalt ausreichender Kräfte für mögliche Personenrettungen (gesetzliche Kernaufgabe der Bergrettung).
- Besondere Gefährdungsbeurteilung notwendig (Rechtsgüterabwägung Retter – Tier ohne konkrete Notlage).
y Notlage des Tieres.
y Besondere Gefährdungsbeurteilung notwendig (Rechtsgüterabwägung Retter – Tier).

y Insbesondere bei verletztem Tier: Erhöhte Rettergefährdung; Einbindung Fachpersonal.
y Vorhalt ausreichender Kräfte für mögliche Personenrettungen (gesetzliche Kernaufgabe der Bergrettung).
Tierrettung erfordert Begleiterrettung (hilflose Person)
y Personenrettung (Vorrang).
y Tierrettung parallel oder nach Personenrettung unter Maßgabe „isolierte“ Tierrettung.
25 Auf den Wert des Tieres und darauf, ob es in jemandes Eigentum steht oder herrenlos ist, kommt es dabei nicht an. Vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, 3. Auflage 2016, Einführung Rn 141. Zur Frage, ob der Begriff des Unglücksfalls iSd § 323c StGB auch den Tiernotfall umfasst, bejahend Erbs/Kohlhaas/Metzger 243. EL August 2022, TierSchG § 17 Rn 40/41 mwN. Tierschutz, mithin das Tierwohl, gilt unter bestimmten Voraussetzungen als notstandsfähiges Rechtsgut im Sinne des § 34 StGB, OLG Naumburg, NJW 2018, 2064.
26 § 903 S. 2 BGB. Vgl. Brückner, in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Auflage 2023, § 903 Rn 66. Vgl. § 18 Abs. 1 S. 1 BPolG. Huzel in Möllers, Wörterbuch der Polizei, 3. Auflage 2018, unter Tiere.
27 Vgl. OLG Nürnberg becklink 2014073- beck-online; BeckRS 2019, 30089-beckonline (Hunderettung bei 35 Grad aus Wohnmobil).
28 Art. 1 Abs. 1, Abs. 2 BayFwG.
29 So explizit alte Fassung VollzBekBayFwG zu Art. 4 BayFwG, 4.2.2., aktuell in VollzBekBayFwG vom 28.09.2020 zu Art 4, 4.2 nicht mehr ausgeführt: 1Die Feuerwehren haben technische Hilfe bei Unglücksfällen oder Notständen zu leisten. 2Unglücksfall ist jedes unvermittelt eintretende Ereignis, das einen nicht nur unbedeutenden Schaden verursacht oder erhebliche Gefahren für Menschen oder Sachen bedeutet. Aber in Art 28 Abs. 2 Nr. 2 BayFwG (Ersatz von Kosten) wird ausdrücklich der Begriff „Retten oder Bergen von Menschen oder Tieren“ erwähnt. 30 Vgl. Art 2 PAG. Zum vernünftigen Grund vgl. Erbs/Kohlhaas/Metzger, 243, EL August 2022, TierSchG, § 1 Rn 33 ff; BayObLG NJW 1993, 2760. Vernünftig ist dabei ein Grund, wenn er als triftig, einsichtig und von einem schutzwürdigen Interesse getragen anzuerkennen ist und unter den konkreten Umständen schwerer wiegt als das Interesse des Tieres an seiner Unversehrtheit uns an seinem Wohlbefinden. Letztlich geht es darum, was billigenswert und sozial akzeptiert ist und dem Interesse der billig und gerecht Denkenden entspricht. Vgl. auch die polizeiliche Befugnis gem. Art. 8 PAG, VollzBek 8.2 zu Art. 8 PAG, wonach die Polizei auch gegen den Zustandsverantwortlichen einschreiten kann, wenn von einem Tier eine Gefahr ausgeht.
31 Vgl. Art 3 PAG, hierzu Schmidbauer/Steiner/Schmidbauer PAG, 6. Auflage 2023, Art. 3 Rn 8. Vgl. auch Art. 6 LStVG. Im Falle der Unaufschiebbarkeit einer Tierbergung durch Feuerwehr oder Bergrettung räumt Art. 5 PAG der Polizei insofern ein Ermessen ein, ob sie selbst und wie sie tätig wird. Ein Anspruch auf polizeiliches Handeln besteht allerdings nur dann, wenn kein Ermessensspielraum besteht, der Beurteilungsspielraum insofern „auf Null“ reduziert“ ist, dazu Schmidbauer/Steiner/Schmidbauer, PAG, aaO, Art. 11 Rn 187 mwN.
32 Vgl. BRK BGL 30.07.18 - Berchtesgadener-bergwacht-rettet-diva-aus-absturzgelaende-am-schneibstein.html
33 Vgl. FG München BeckRS 2002, 21011725 zu § 3 Nr. 5 KraftStG.
34 Ordnung der Bergwacht Bayern im BRK (OBW) vom 30.09.2020, dort § 3 Abs. 4 OBW.
35 § 3 Abs. 4 OBW. Zu den gesetzlichen Grundlagen insbesondere der Bergwacht Bayern vgl. Burger, Recht auf Bergrettung? in: bergundsteigen Winter 19/20, S. 40 (43 ff).
36 www.gesetze-bayern.de
37 Anlage zu Nr. 2.1.4 ABek, Lfd. Nr. RD 46.
38 Es empfiehlt sich, mit den Eigentümern (Haltern) vorab Gespräche zu führen und auf die möglichen Gebühren hinzuweisen.
39 Art. 2 Abs. 11 BayRDG. Vgl. beispielhaft: www.pnp.de/lokales/berchtesgadener-land/Wanderin-geraet-wegen-Hund-in-Notlage-und-muss-gerettet-werden3937420.html

40 Art. 42 Abs. 1 Nr. 2 BayJG, § 23 BJagdG.
41 Vgl. Hirt/Maisack/Moritz, § 17 TierSchG, 3. Auflage 2016, Rn 34-36 unter Bezugnahme auf OLG München Urt. v. 15.11.1983, 5 U 2511/83.
42 Vgl. aber den Appell Stand 2029 NABU Nordrhein-Westfalen, die Gesetzeslage zu ändern: Wildernde Hunde - NABU NRW
43 Erbs/Kohlhaas/Metzger, 243. EL August 2022, BJagdG § 23 Rn 7. Vgl. auch BayObLG BeckRS 1993, 2555. OLG Brandenburg, 11.05.2009, BeckRS 2009, 15960.
44 BRK BGL 23.11.19 - bergwacht-rettet-frierendes-und-orientierungsloses-paerchen-vom-hochschlegel-chihuahua-mit-herausgerissenem-auge-vom-jenner.
45 Vgl. BRK BGL 09.03.2019: Teddy taucht nach drei Wochen am Ristfeuchthorn abgemagert aber unverletzt wieder auf
46 Zu unvertretbar hohen Risiken bei Rettung von Tieren aus Gebäuden im Brandfall vgl. BeckOK BauordnungsR BW/Kukk BWLBO § 15 Rn 32,33).
47 Nie direkt dem Tier in die Augen schauen; sich von der Seite nähern, Hund an der Hand schnuppern lassen, und mit fester, bestimmender Stimme nein oder aus rufen.
48 Vgl. Burger, Recht auf Bergrettung, in: bergundsteigen Winter 19/20, S. 40 ff. ■
Bei ASI gibt es für dich keine unangenehmen Überraschungen. Unsere Guides erhalten stets ein ausführliches digitales Briefing im Guide-Net.
Werde Teil unseres weltoffenen Guideteams und übernimm Aufträge als Bergführer:in (bis € 400) oder Wanderführer:in (bis € 200).
Jetzt bewerben:
jobs@asi.at
Kann man alleine eine Seilschaft bilden? Christoph Schranz konnte mit der Route „Ocha- SchauSchuich“1 (8c) eine der schwersten Mehrseillängenrouten der Ostalpen klettern. Das Einrichten der Route erfolgte im Alleingang von unten. Alles um die Erstbegehung und wie seine Rope-Solo-Technik im Detail funktioniert, erklärt er hier.
 Von Christoph Schranz
Christoph Schranz klettert „Ocha-Schau-Schuich“ (8c) frei.
Von Christoph Schranz
Christoph Schranz klettert „Ocha-Schau-Schuich“ (8c) frei.
Oktober 2018. Vor Kurzem haben Roli Striemitzer und ich einen Flug nach El Calafate in Argentinien gebucht und blicken dieser Reise nach Patagonien voller Vorfreude entgegen. In der Alpinszene wird Bergsteigen in Patagonien häufig mit weiten Zustiegen und noch gigantischeren Rucksäcken verbunden. Um mich entsprechend vorzubereiten, habe ich an meinem Hausberg in Telfs in Tirol ein Projekt ins Auge gefasst.
Mit dem E-Bike trete ich die steile Straße hinauf in Richtung Hohe Munde. Unter der Last des Haulbags habe ich bereits in der ersten Kehre Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Ich muss an die Träger in Nepal denken, welche unfassbare Lasten schultern und diese über 5000 Meter hohe Pässe schleppen. Dann wirst du das wohl auf mickrigen 1900 Metern Meereshöhe schaffen, rede ich mir ein … Nach dreieinhalb anstrengenden Stunden stehe ich am Wandfuß des sogenannten Kolosseums. Mit einem dumpfen „Rums“ sinkt der Haulbag in den weichen Sand. Es überrascht mich sehr, noch eine weitere Seilschaft hier oben anzutreffen. Dario und Martin haben gerade die Schlüsselseillänge der „Alten Telfer“ (8b) gepunktet und sind dabei, sich die erste Eintages-Rotpunkt-Wiederholung dieser genialen Route zu holen.
Bei meinen bisherigen Besuchen im Kolosseum blickte ich immer fasziniert in den tiefen Einschnitt der großen Kathedrale. Eine bizarre Formation gleich dem Gewölbe eines überdimensionalen Doms. Am linken und rechten Rand hatte Benni Hangl senior bereits mit „Romulus“ und „Alte Telfer“ zwei extreme Touren mit sehr hohem Anspruch an Kletterkönnen und Psyche eröffnet. Immer mit kompromissloser Erschließung von unten. Der zentrale, steilste Teil dieses Bereiches ist bisher unberührt. Hausmeister Benni meinte einmal, dass er die Eröffnung dieses Bereiches der jungen Generation überlasse ...
Anstatt jemanden zum stundenlangen Sichern zu verdonnern, versuche ich diesmal das ganze Spiel allein. Etwas skeptisch, ob es das Richtige für mich ist, von früh bis spät ohne Gesellschaft in der Wand zu hängen, bereite ich das Material vor und klettere los. Die Spielregeln sind klar: Gefährlich soll es nicht sein, schließlich bin ich alleine unterwegs. Aufgrund eines Sturzes das Bewusstsein zu verlieren,
1 „Ocha-Schau-Schuich“ ist Mundart aus dem Tiroler Oberland und bedeutet übersetzt „hinab-schau-scheu“. Das Adjektiv bezieht sich auf Personen, die Scheu davor haben, in die Tiefe zu blicken, also höhenängstlich sind.
wäre in dieser einsamen Gegend nicht wünschenswert. Trotzdem ist für mich wichtig, mich nicht von Haken zu Haken hochzuarbeiten, mobile Sicherungen wann immer möglich zu verwenden und die einzelnen Kletterstellen frei zu klettern. Das extrem steile Gelände fordert mich gleich von Beginn an. Ich klettere mit so wenig Ballast wie möglich von der letzten Zwischensicherung weg. So habe ich meist nur einen Cliff und ein dünnes Materialseil am Gurt. Kann ich eine Stelle nicht entschlüsseln, lande ich einige Meter tiefer pendelnd im Seil. Schaffe ich sie, suche ich nach einer Möglichkeit, meine Hände zu entlasten und ziehe die Bohrmaschine hoch, um einen Haken zu setzen. Finde ich jedoch nichts oder überschätze die Haltekraft der provisorischen Sicherungen, werden die wertvollen Meter rasant vernichtet und ich hänge wiederum baumelnd im Seil. Auf diesem Weg sammle ich im Laufe der Stunden unzählige Flugmeter.
Als sich die Kulisse im abendlichen Rot einfärbt, ist mein ernüchterndes Resümee des ersten Tages eine erreichte Höhe von nur 25 Metern. Das Steigen ins Ungewisse, der jungfräuliche, etwas bröselige Fels, die labilen Sicherungen und der viele Flugwind haben mich körperlich und vor allem psychisch ziemlich ramponiert. Ich fixiere ein Seil, setze mich erschöpft an den Einstieg der Route und genieße das hart erarbeitete Feierabendbier. Obwohl meine tatsächliche Tagesleistung in Anbetracht der gesamten Wandhöhe sehr bescheiden scheint, habe ich das Gefühl, heute etwas wirklich Großartiges geleistet zu haben. Da ich den ganzen Tag beschäftigt war, hatte ich von der Einsamkeit gar nichts mitbekommen. Um ehrlich zu sein, genoss ich die Ruhe sogar ein wenig. Zufrieden betrachte ich die überwältigende Bergkulisse hoch über dem Inntal. Der Grundstein für ein kleines Abenteuer vor meiner Haustüre, das mir über die nächsten Jahre immer wieder alles abverlangen wird, ist gelegt ...

Die Jahre ziehen ins Land. Wie auch am ersten Tag lässt der Fortschritt in der Tour in den Folgesommern zu wünschen übrig. An manchen Tagen schaffe ich es lediglich, einen einzigen Bohrhaken zu setzen oder nur etwa fünf Meter über den Highpoint des vorangegangenen Tages hinauszuklettern. Es ist ernüchternd, doch ich schaffe es, mich davon zu überzeugen, dass solche Tage die lehrreichsten und zugleich wertvollsten sind. Man kann sich alles einreden, sage ich mir mit ein bisschen Selbstironie. So komplex, unübersichtlich und schwierig die Abschnitte auch sind, einfach von Haken zu Haken zu bohren, ist keine Option.
Christoph Schranz aus Tirol zählt zu den stärksten Allr oundalpinisten Österreichs. Er arbeitet hauptberuflich als Bergund Skiführer und betreibt gemeinsam mit seinen beiden Brüdern die Alpinschule „Sc hranzbuaba“
Ocha-schau-schuich
Mieminger Kette Hohe Munde Kolosseum
Länge: 300 m 7 SL
ERSTBEGEHUNG:
Christoph Schranz Solo von unten an über 20 Tagen vom Okt. 2018 bis Mai 2020 eingerichtet. Rotpunkt am 08.05.2021 mit Michaela Koller.
Anhaltend fordernde und abwechslungsreiche alpine Sportkletterroute. Im unteren Teil athletische, ausgesetzte Kletterei, im oberen Teil technisch und alpin. Die Felsqualität ist gut bis sehr gut.
Die Standplätze und einige Zwischensicherungen sind gebohrt. 60m Doppelseil, Fixseil, 10 Expresschlingen, 1 Satz Camalots 0.3-2
ZUSTIEG:
50 m vor dem Parkplatz Straßberg (Schranken) einem Forstweg (Fahrverbotstafel) 300 m folgen. Noch im Wald zweigt rechts ein Weg zu einem Stadel u. Wochenendhäuschen ab. Rechter Hand beginnt ein Bachbett, das bis zum Einstieg führt. Zuerst klettert man über einen Zaun und folgt dann dem Bachbett bis zu einer Gabelung. Dort nimmt man den rechten Ast. Über Klettereien (u.a. eine 15 m Wandstelle im 3. Grad - beim Abstieg ev. Abseilen: Schlinge an Latsche vorhanden) gelangt man in 1h15 zum Einstieg, der sich im steilsten Wandbereich befindet.
!!! Bei Gewitter ist das Bachbett unbedingt zu verlassen.
ABSTIEG:
Abseilen über die Route. Für die Seillängen 3 und 4 sollte für den Rückzug ein Fixseil angebracht werden.
BESTE JAHRESZEIT:
spätes Frühjahr, Sommer und Herbst
bequemer Stand (kl. Portaledge)
8a | 40 m
design by haasimo
Platte zum Stand
schöne Platten graue Verschneidungen
8c (8a obl.)
Das lässt mich mein Stolz nicht. Eine stilistisch anspruchsvolle und psychisch herausfordernde Route soll es werden. Im Frühsommer 2020 stehe ich dann endlich, nach über zwanzig Tagen Arbeit in der Tour, am höchsten Punkt der Wand. Doch noch kommt keine Erleichterung in mir auf. Der abenteuerliche Teil mag zwar abgeschlossen und alle Kletterstellen frei geklettert sein, aber der Sportkletterer in mir fühlt sich bei dem Gedanken an die noch ausstehende und obligatorische saubere Rotpunkt-Begehung mächtig überfordert. Die Kletterbewegungen in der Route sind für mich komplex und enorm schwierig. In einigen Abschnitten reihen sich viele extrem harte Passagen aneinander, welche sich oft zwischen den teils auch mobilen Sicherungspunkten befinden. Eine freie Begehung ohne Sturz ist in meinem derzeitigen Trainingszustand nicht vorstellbar. Hierfür müsste ich viel mehr Zeit mit Klettern verbringen und meinen Fokus von den hohen Bergen und großen Wänden auf Klettergärten und Boulderhallen verschieben.
COVID-19 nimmt mir diese Entscheidung mehr oder weniger unfreiwillig ab. Mit der Absage sämtlicher beruflicher und privater Reisen bekomme ich einen Motivationsschub beim Klettern. Es sind nun beinahe dreißig „Arbeits“-Tage in der Tour vergangen. Trotz meiner vermutlich besten Kletterform bisher und perfekt einstudierter Lösung konnte ich immer noch keine einzige schwere Seillänge ohne Sturz bewältigen. Erneut stehe ich mit Micha, meiner Freundin, am Einstieg und habe mir das Tagesziel gesetzt, die zweite Seillänge durchzusteigen. Um warm zu werden, „raste“ ich mich die erste Seillänge
hoch. Als Micha zum Stand kommt, steige ich ein. Nach 25 technischen Metern klettert man über einen perfekten Riss in ein Dach. Ich platziere zwei Camalots und setze zum Boulder an. Zum ersten Mal klettere ich ohne Sturz bis zur Dachkante und kann auch den Haken überraschenderweise klippen, bevor ich in das flachere Gelände „mantle“. Mit einem lauten Freudenschrei fixiere ich mich am Stand. Der Durchstieg von Seillänge 3 gelingt mir ebenso, woraufhin ich ohne Erwartungen in Seillänge 4 einsteige – die Hauptschwierigkeiten der Tour liegen schließlich noch vor mir! Nun führt ein Arsenal an genialen, aber schweren Zügen, unterbrochen durch einen äußerst schlechten Rastpunkt, durch ein zehn Meter ausladendes Dach. Danach geht’s in eine Verschneidung und hinaus auf einen kleinen ausgesetzten Vorsprung. Ich fühle mich stärker als sonst und kämpfe mich, ohne die sonst so saugende Tiefe wahrzunehmen, Meter für Meter hoch. Fassungslos vor Freude und mit einem unglaublichen Pump stehe ich plötzlich über den Schlüsselstellen. Als Micha am Stand ankommt, werde ich etwas nervös. Sollte mir die nächste Seillänge aufgehen, wäre ein Durchstieg des Projektes realistisch. Doch schon wenige Meter nach dem Stand wirft mich das technische Gelände ab. Ich trinke eine Cola. Der Zuckerschub hilft und bzw. oder die motivierenden Worte von Micha, die mich dann irgendwie über die schweren Meter tragen. Das etwas leichtere Gelände lässt in meinem Zustand keine Entspannung aufkommen. Zu weit sind die Sicherungspunkte entfernt, zu sehr schmerzen die Zehen. Am Ausstieg der Tour angekommen realisiere ich den Abschluss dieses für mich doch kolossalen Projektes anfangs nicht. Hatte ich doch heute Morgen nicht in meinen kühnsten Träumen einen Durchstieg erwartet. Müde und überglücklich freue ich mich jetzt nur noch auf eine Pizza und einen Aperol a la Micha im Tal.

Abb. 1. Originales Grigri 1 (links) versus modifiziertes Grigri 1 (rechts) mit u-förmig ausgeschliffenen Seilauslauf. Das Seil läuft dadurch in einem wesentlich flacheren Winkel in das Grigri ein. Der linke Steg der U-Form dient als Führung, um im Falle eines Sturzes das Abgleiten des Seils in die scharfe Stahl kante unterhalb des Ablasshebels zu verhindern.

Klettert man alleine, jedoch mit Seilsicherung, wird dies als Rope Solo bezeichnet. Dies kann mittels einer Seilklemme entlang eines fixierten Seils, aber auch im Vorstieg praktiziert werden. Die Anwendung im Vorstieg ist eine Sonderform, für welche es keine „Lehrmeinung“ gibt. Für diese Variante werden die Sicherungsgeräte abseits der vom Hersteller empfohlenen Einsatzbereiche gebraucht und nicht zuletzt mechanisch modifiziert (vergleiche dazu auch den Artikel von Heinz Zak: Gesichertes Soloklettern, in: bergundsteigen 1/10, S. 50–54). Bei der im Folgenden beschriebenen Technik handelt es sich lediglich um eine Sammlung von eigenen Erfahrungen bei praktischen Versuchen. Das Sicherungsgerät wird vom Hersteller nicht für diese Anwendung gebaut. Es wird zweckentfremdet und alle beschriebenen Anwendungen erfolgen auf eigene Gefahr!


Nach einigen ernüchternden Versuchen mit verschiedensten Klemmgeräten griff ich auf ein modifiziertes Grigri von Petzl zurück, da es mir am benutzerfreundlichsten und sichersten erschien.

Für den Umbau überlegte ich mir als gelernter Maschinenbauer eine Methode, die möglichst viel Sicherheit bietet. Verwendet wird vorzugsweise ein Grigri der ersten Generation (Grigri 1). Dieses ist etwas größer konzipiert als die nachfolgenden Modelle, was das Durchlaufen des Seils nach dem Umbau erheblich erleichtert (Abb. 1 und 2).
Abb. 2. Bohrlöcher (3 mm) mit Prusikschnur. Achtung: ausrei-
Das Grigri wird vertikal – Ablasshebel zeigt nach vorne und oben –mittels ovalen Safelock-Karabiners im Gurt eingehängt. Um das Grigri in dieser Position zu halten, wird die „Prusikschlaufe“ für die Befestigung nach oben an der Halsschlinge (umgebaute Leash) eingehängt (Abb. 3). Das Seil wird an einem Ende mittels Achterknotens in einen Standplatz eingebunden. Man beachte die Belastungsrichtung nach oben! Dieses Seilende bildet meine Lastseite und wird als solche in das Grigri eingelegt (eingraviertes Icon „Kletterer“ am Grigri). Das oben einlaufende Seil bildet das Restseil (eingraviertes Icon „Hand“), dessen Ende per Sackstich abgeknotet und an den Gurt gehängt wird. Dadurch wird ein Durchlaufen des Seilendes durch das Sicherungsgerät vermieden (Abb. 3). Für einen möglichst reibungslosen Ablauf ist essentiell, dass das Restseil leicht durch das Grigri läuft. Hierfür sollte die herunterhängende Seilschlaufe möglichst klein gehalten werden. Lange Seilschlaufen verhängen leicht, haben zu viel Eigengewicht und können das System blockieren. Deshalb stopft man das Restseil in einen Rucksack/Ropebag. In steilem Gelände, in dem geringe Gefahr eines Seilverhängers besteht, knotet man stattdessen das Restseil mittels fünf Meter langer Schlingen mit Sackstichen an die Materialschlaufen. Diese Methode bietet den Vorteil, dass alle zehn Meter Knoten vorhanden sind, welche im Fall eines Sturzes ein unvorhergesehenes, nicht blockierendes Grigri stoppen würden (Abb. 4). Bei der Anwendung des Ropebags sind diese Backupknoten ebenso ratsam. Nach einem umfangreichen Selbstcheck kann nun losgeklettert werden.

Abb. 3. Das rechte Seil führt nach unten zum Standplatz, wo es fixiert wurde. Dieses Seil wird beim Sturz belastet.
Achtung beim Einlegen: Das eingravierte Icon mit dem Kletterer schaut nach unten, wo das Seil nach unten zum Standplatz läuft. Das Icon mit der Hand ist oben, wo das Restseil (in Schlaufen aufgenommen und mit Sackstichknoten an den Materialschlaufen des Gurts befestigt) einläuft.

Abb. 4. In steilem Gelände, in dem geringe Gefahr eines Seilverhängers besteht, knotet man das Restseil mittels fünf Meter langer Schlingen mit Sackstichen an die Materialschlaufen. Mit den fünf Meter langen Schlingen am Gurt wird dann vorgestiegen.



belastetes
Seil bei Sturz
einlaufendes Seil
Abb. 5. Christoph hängt im Seil. Das System nach einem Sturz. Detailaufnahme: belastetes Seil bei Icon „Kletterer“, einlaufendes Seil bei Icon „Hand“.
Bin ich in der Lage, das Gelände mit Zusatzgewicht zu bewältigen und aus der Kletterposition zu bohren, sprich, mich zwei bis drei Minuten lang an einer Hand festzuhalten, schreitet die Erschließung recht zügig voran. Die benötigte Ausrüstung, um einen Haken zu setzen, befindet sich am Gurt, während man ins Neuland klettert. Stürze sind nicht sonderlich angenehm, doch dank der gemäßigten Schwierigkeiten auch nicht so wahrscheinlich. In „Ocha-SchauSchuich“ war diese Taktik bis auf ganz wenige Meter nicht umsetzbar. Demzufolge kletterte ich mit minimalstem Ballast – meist nur einem Cliff und einem dünnen Materialseil am Gurt – von der letzten Sicherung weg. Abstriche im Stil wie etwa das Bohren von Haken zu Haken waren aus meiner Sicht keine Option. Dies hatte zur Folge, dass die Entschlüsselung so mancher Kletterstelle zwischen den Sicherungspunkten mehrere Stunden an Zeit und unzählige Flugmeter forderte (Abb. 5).
Der Schlüsselfaktor beim regelmäßigen „Abtropfen“ ist, die Intensität des Fangstoßes zu kontrollieren. Habe ich einen exzellenten Sicherungspartner, der in der Lage ist, den Fangstoß selbst bei großem Sturzfaktor (siehe Kasten) durch Nach-oben-Springen (körper-
dynamisch) oder „Durchlaufenlassen“ des Seils durch den Tuber (gerätedynamisch) relativ gering zu halten. Beim Rope-Solo hängt der auf mich wirkende Impact in erster Linie vom Sturzfaktor ab. Je größer die Sturzhöhe, umso mehr Seil muss zwischen Fixierpunkt (Standplatz) und meinem Anseilpunkt vorhanden sein, um einen weichen Sturz zu erzielen. Zu viel ausgegebenes Seil wirkt sich wiederum negativ auf die Handhabung aus. Durch umfangreiche Sturzpraxis kam ich zum Ergebnis, dass der Fangstoß bei einer Sturzhöhe von 5 bis 15 Metern einen akzeptablen Wert annimmt, wenn sich der Fixierpunkt (Standplatz) meines Kletterseiles mindestens 12 Meter unterhalb der Zwischensicherung befindet, welche die Sturzenergie aufnimmt. Natürlich ergab sich so manche Schlüsselstelle fernab vom idealen Abstand zum Standplatz. Um den idealen Abstand zwischen Fixierpunkt und Anseilpunkt dennoch zu gewährleisten, fixierte ich das Seil zusätzlich an einer soliden Zwischensicherung per Mastwurf (Abb. 6)


Tipp: Um nach einem Sturz im überhängenden Gelände wieder in Position zu kommen, ist eine Micro Traxion/Jumar am Gurt sehr hilfreich.
Ist eine Seillänge geschafft, richte ich den Stand ein, fixiere das Seil und seile zurück, um die Zwischensicherungen abzubauen. Durch nachfolgendes Jumaren erreiche ich wieder den Stand. Dann beginnt das ganze Spiel von Neuem …
Abb. 6. Der Fixierpunkt soll mindestens zwölf Meter unter der letzten Zwischensicherung sein.
Zwischensicherung
Fazit
Mastwurf an solider Zwischensicherung zur Optimierung des Fangstoßes und gleichzeitig der Benutzerfreundlichkeit
erster Fixpunkt (Standplatz), Fixierung mit Achterknoten
Der zeitliche Aufwand für die Erschließung der sieben Seillängen (7b+; 8b+; 7c; 8c; 8b; 7a; 8a) summierte sich auf mehr als 20 Tage in der Tour. Trotz der Tatsache, dass ich während der Erschließung bereits sämtliche Schlüsselstellen frei geklettert war, benötigte ich noch etwa zehn weitere Projekttage für den Roten Punkt.

Weitere Herausforderungen des Rope Solo
Die schweren Lasten zum Einstieg zu bringen, ist gerade bei mühsamen Zustiegen wie jenem ins Kolosseum nicht zu unterschätzen. Erheblich anspruchsvolleres Seilmanagement wie etwa die unzähligen Seilschlaufen am Gurt: Sicherungsseil plus Seilschlaufen, Tagline für Bohrmaterial, Tagline für Haulbag, Tagline für Fixseil … Haulen ohne Partner, welcher die Fixierung löst und das Verkeilen des Haulbags am Fels verhindert. Und natürlich unzählige JumarMeter.
Solo? Christophs Partnerin Michaela klettert selbst im zehnten Grad. In anderen gemeinsamen Projekten ist auch Christoph mal das klischeehafte „Belay Bunny“.
Fangstoß und Sturzfaktor sind zwei wichtige physikalische Faktoren bei Kletterstürzen. Um einen Klettersturz richtig zu verstehen, müssen wir uns ein Grundprinzip der Physik in Erinnerung rufen: Wenn ein Gegenstand fällt, nimmt er Energie auf.
Fangstoß
Beim Halten eines Sturzes wird diese Energie durch die Dehnung des Seils, die Bewegung des Sichernden, den Körper des Kletterers usw. aufgenommen. Die Energie wird als Kraft auf die Sicherungskette übertragen. Dies ist der Fangstoß. Für den Kletterer ist es der Ruck, dem er beim Halten des Sturzes ausgesetzt ist. Wir befassen uns häufig mit dem Fangstoß, der auf den Kletterer, den Sichernden und auf die Umlenkung ausgeübt wird. Dieser Wert hat den Vorteil, alle wesentlichen bei der Aufnahme der Sturzenergie mitwirkenden Faktoren zu berücksichtigen: Seildehnung, Bewegung des Sichernden, Körper des Sichernden, Durchlauf des Seils durch das Gerät usw. Der auf den Seilen angegebene Fangstoß entspricht dem bei standardisierten Testbedingungen mit einer Metallmasse (Kletterer) gemessenen maximalen Wert.
Theoretischer Sturzfaktor
Der Sturzfaktor wird häufig verwendet, um die Härte eines Klettersturzes zu definieren. Er liegt beim Klettern zwischen 0 und 2. Der Sturzfaktor entspricht dem Verhältnis zwischen der Sturzhöhe und der Länge des ausgegebenen Seils.
fth =
fth = theoretischer Sturzfaktor
Sturzhöhe = Sturzhöhe des Kletterers ausgegebenes Seil = Länge des Seils zwischen dem Sichernden und dem Kletterer
Beim Klettern ist die Härte des Sturzes nicht von der Sturzhöhe abhängig, denn je länger das Seil ist, desto größer ist die aufgenommene Sturzenergie. In diesen beiden Beispielen erhöht sich die Härte des Sturzes. Die freie Sturzhöhe ist in beiden Fällen gleich. Die aufzunehmende Sturzenergie ist identisch, aber das System ist weniger dynamisch.
Beispiel 1. Ausgegebenes Seil = 10 m, Sturzhöhe = 4 m, daraus ergibt sich ein Sturzfaktor = 4/10 = 0,4. Das ausgegebene Seil ist lang, die Energieaufnahme ist hoch. Die Sturz ist nicht sehr hart, der Fangstoß ist niedrig.
Beispiel 2. Ausgegebenes Seil = 2 m, Sturzhöhe = 4 m, daraus ergibt sich ein Sturzfaktor = 4/2 = 2. Das ausgegebene Seil ist kurz, die Energieaufnahme ist gering. Der Sturz ist hart.
Zusatzinformationen
Die Theorie sagt, je höher der Sturzfaktor ist, desto höher sind die auftretenden Kräfte. Das Verhältnis zwischen Härte des Sturzes und Sturzfaktor ist nur für dynamische Seile zutreffend. Je länger das Seil ist, desto mehr Energie kann es aufnehmen. Das Sturzfaktormodell ist eine vereinfachte Betrachtung, bei der wichtige Faktoren wie Seilreibung, Art des Sicherungsgeräts, Bewegung des Sichernden usw. nicht berücksichtigt werden. ■

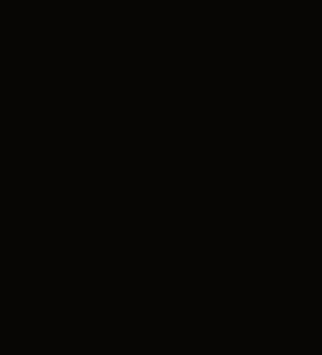

Frauen in den Bergen aus medizinischer Sicht. Immer mehr Frauen entdecken ihre Leidenschaft für die Berge, und zwar nicht nur fürs Bergwandern in moderaten Höhen, sondern auch für das Besteigen der höchsten Gipfel der Welt. So versuchten rund fünf Prozent Frauen zwischen 1953 und 1989 den Mount Everest zu erklimmen, in den Jahren 2006 bis 2019 waren es bereits 15 Prozent. Der vorliegende Artikel basiert sowohl auf wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch auf pragmatischen Erfahrungen routinierter Bergsteigerinnen. Er liefert einen Überblick über biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau am Berg und gibt praktische Tipps für Bergsteigerinnen.
Von Susi KriemlerIch werde initial auf Geschlechtsunterschiede im Gewöhnen an die Höhe und in der Entstehung von Höhenkrankheiten eingehen, dann auf spezifisch weibliche Charakteristika, welche in der Höhe potentiell einen Einfluss auf Akklimatisation, Leistungsfähigkeit oder Höhenkrankheiten haben können (Menstruation, Menopause), und schließlich auf die schwangere Frau in der Höhe.
Unterschiede zwischen Frauen und Männern in extremen Umgebungen
Adaptation an die Höhe und Höhen- y krankheiten
Die Gewöhnung (= Akklimatisation) an große Höhen kann bei Frauen und Männern als gleich gut bezeichnet werden. Da viele Frauen an einem Eisenmangel mit oder ohne Blutarmut leiden, welcher die Akklimatisation an die Höhe beeinträchtigen kann, sollte dieser durch eine Eiseneinnahme über zirka 3 bis 6 Monate vor einer Expedition ausgeglichen werden. Die akute Bergkrankheit (ABK) kommt bei Frauen und Männern gleich häufig vor. Es treten aber bei Frauen vermehrt Schwellungen an Händen, Füßen und im Gesicht auf, was wahrscheinlich mit der unterschiedlichen Zusammensetzung des Unterhautgewebes zusammenhängt. Der Menstruationszyklus der Frau scheint die Häufigkeit der Höhenkrankheit nicht zu beeinflussen, auch nicht die Einnahme von hormonhaltigen Verhütungsmitteln. Das Höhenlungenödem (HLÖ) tritt bei Frauen seltener auf. Es ist jedoch nicht klar, ob dies mit der geringeren Exposition der Frauen generell zu tun hat oder ob physiologische Unterschiede bestehen, welche die Frauen vor einem HLÖ schützen. Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Angaben zur Frage, ob Frauen und Männer für das Höhenhirnödem (HHÖ) gleich anfällig sind. Da es einen Mangel an präventiven und therapeutischen Interventionsstudien gibt, die geschlechtsspezifische Unterschiede herausgearbeitet haben, sollten allgemeine Präventions- und Behandlungsstrategien für die ABK und das HHÖ unabhängig vom Geschlecht angewendet werden:
Bei Reisen, Trekking und Bergsteigen y über 3000 m wird eine Aufstiegsgeschwindigkeit von 300 bis 500 Höhenmetern pro Tag empfohlen mit einem Ruhetag alle 3 bis 4 Tage, um allen Formen der akuten Höhenkrankheit vorzubeugen.
Bei der Behandlung der leichten ABK y reicht oft ein Pausentag, bei der moderaten ABK die Einnahme von Analgetika und/oder Antiemetika.
Die Behandlung einer schweren ABK y und eines HHÖ umfasst einen schnellen Abstieg und, wenn dies nicht möglich ist, die Anwendung von tragbaren Überdruckkammern, zusätzlichem Sauerstoff, Acetazolamid und Dexamethason.
Die Behandlung eines HLÖ besteht aus y einem schnellen und unterstützten Abstieg von mindestens 1000 m und – falls vorhanden – Sauerstoffzufuhr über eine Gesichtsmaske sowie bei medizinischer Betreuung dem Einsatz von Nifedipin oder Sildenafil. Wann immer möglich, sollte der Abstieg avorisiert werden.
Mehr über Dosierungen und Details kann y folgenden Übersichtsarbeiten entnommen werden1,2 und findet sich in der bergundsteigen-Ausgabe Frühling 22/#118 (Seite 56–61).
Menstruation – Verhütungsmittel y Auf Expeditionen kommt es häufig zu Veränderungen des Menstruationszyklus. Vermutlich spielt die Reise per se mit all ihren Begleiterscheinungen wie veränderter Hygiene, Kälte, Essverhalten, Gewichtsverlust usw. als Paradebeispiel einer körperlichen Stresssituation dabei eine entscheidende Rolle, vermutlich mehr als die Höhe selbst. Am häufigsten bleibt die Regelblutung ganz oder teilweise weg oder der Zyklus wird unregelmäßig. Das Ausbleiben der Menstruation bedeutet nicht, vor einer Schwangerschaft geschützt zu sein.
Jede Frau sollte sich vor der Abreise überlegen, ob sie bereit ist, die Unannehmlichkeiten der Menstruation zu ertragen oder ob sie eher zu einer üblichen Antikonzeption (orale Antikonzeption bzw. die Antibabypille, Östrogenring, Östrogenpatches, Diaphragma, Spirale) greifen will. Die Wirksamkeit der pharmakologischen und mechanischen Verhütungsmittel wird durch
y Weder die Menstruation noch der Einsatz von Verhütungsmitteln hat einen nennenswerten Einfluss auf das Entstehen von Höhenkrankheiten.
y Die Anwendung von Verhütungsmitteln während längerer Höhenaufenthalte sollte sorgfältig überlegt werden:
· Werden orale Antikonzeptiva bereits eingenommen, sind die Gesundheitsrisiken gering und es überwiegen wahrscheinlich die Vorteile, die derzeitige Form der Empfängnisverhütung fortzusetzen.
· Beginnt eine Frau mit einer neuen Form der hormonellen Verhütung, sollte sie ermutigt werden, die Umstellung bereits einige Monate vor der Höhenexposition vorzunehmen. Wegen eines verminderten Thromboserisikos und dem sicheren Schwangerschaftsschutz gerade auch bei Zeitverschiebungen ist in erster Linie eine Progesteron-absondernde Spirale empfohlen.
Bei Geschlechtsverkehr sollten stets zusätzlich Kondome verwendet werden, um eine sexuell übertragbare Krankheit zu verhindern.
die Höhe nicht beeinflusst. Entscheidet sich die Frau gegen die Anwendung von oralen Antikonzeptiva, sind genügend Hygieneutensilien (Reinigungstücher, Tampons, Binden) situationsrettend. Jede Bergsteigerin, die über längere Zeit mit prekären hygienischen Verhältnissen konfrontiert ist, kann sich auch überlegen, das Genitalhaar vor der Abreise zu rasieren, um die Reinigung des Genitals zu erleichtern.
Der Gebrauch von oralen Antikonzeptiva verändert die Anpassungsfähigkeit an die Höhe nicht, kann aber zusammen mit einem Wasserverlust (Dehydratation), mit Kälte und längerem Höhenaufenthalt die Bildung von Blutgerinnseln (Thrombosen) und Embolien begünstigen. Auch wenn die Kombination dieser Faktoren die Thromboseneigung in der Höhe klar zu steigern scheint, gibt es keine wissenschaftlich fundierten Studien dazu, sondern nur einzelne Fallbeispiele von Frauen, die in der Höhe eine Thrombose entwickelten, bei denen die Bedeutung des Faktors Höhe jedoch unklar blieb.
Die Einnahme oraler Antikonzeptiva bietet neben dem bekannt sehr guten Schutz vor Schwangerschaft weitere Vorteile für das
14. Tag
~ 50 Jahre
Höhenbergsteigen: Neben dem Verhindern der Menstruation reduzieren sie auch die Menstruationsbeschwerden. Zusätzlich kann die Pille über mehrere Monate kontinuierlich genommen werden, was die Blutungstage auf ein Minimum reduziert oder die Blutungen ganz sistieren lässt. Trotzdem kann das theoretische Risiko einer erhöhten Thromboseneigung in der Höhe nicht negiert werden. Die unregelmäßigen Essund Schlafzeiten auf Expeditionen erschweren unter Umständen die regelmäßige Einnahme der oralen Antikonzeptiva, was die Sicherheit der Verhütung vermindert. Außerdem können Antibiotika (vor allem Breitspektrum-Penizilline, Baktrim und Tetrazykline), welche zum Beispiel wegen einer Bronchitis oder Durchfallerkrankung eingenommen werden, die Wirkung der Pille während der Einnahme und bis 7 Tage später abschwächen. Die Spirale mit einer Progesteronsekretion ist eine gute Alternative. Bei dieser Methode besteht kein erhöhtes Thromboserisiko. Insbesondere rauchende Frauen sollten keine oralen Verhütungsmittel anwenden, da bei ihnen durch das Rauchen schon im Tiefland ein erhöhtes Risiko für Thrombosen existiert (Referenzen zu diesem Kapitel 3, 4). Susi Kriemler ist Sportmedizinerin und Fachär ztin für Pädiatrie. Die leid enschaftliche Alpinistin arbeitet als Professorin am I nstitut für Epid emiologie, Biostatistik und Prävention an der Universität Zürich. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf körperlic her Aktivität im Allgemeinen und Gesundh eit bei Kindern.

Mehr und mehr ältere Frauen in der Menopause erfreuen sich einer exzellenten Gesundheit und Fitness. Wen erstaunt es, dass diese Frauen auch in fortgeschrittenem Alter auf die höchsten Berge der Welt steigen. Die japanische Bergsteigerin Tamae Watanabe stand mit 73 Jahren auf dem Mount Everest und Anne Lorimor mit 89 Jahren auf dem Kilimanjaro. Die Menopause, also das Ende der Reproduktionsfähigkeit aufgrund hormoneller Veränderungen, die mit dem Sistieren der Regelblutung einhergeht, tritt im Alter zwischen 47 und 55 Jahren ein. Während einige Frauen diese Hormonumstellungen nicht einmal bemerken, leiden andere unter erheblichen Symptomen, typischerweise Hitzewallungen, Nachtschweiß, vaginale Trockenheit, Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit. Frauen in den Wechseljahren sollten deshalb darauf vorbereitet sein, die Symptome, die potenziell auch in größeren Höhen auftreten können, mit effektiven Strategien zu behandeln, die sie auch im Tiefland anwenden. Postmenopausale Frauen sind anfälliger für Harnwegsinfektionen aufgrund von urogenitaler Atrophie, die durch Östrogenmangel verursacht wird. Darüber hinaus entwickeln ältere Menschen häufiger Harnwegsinfektionen während ihrer Reisen. Obwohl es keine spezifischen Daten zum Auftreten von Harnwegsinfektionen bei postmenopausalen Frauen gibt, die in die Berge reisen, könnte schlechte Hygiene während Bergreisen das Risiko von Harnwegsinfektionen erhöhen. Daher sollten Antibiotika in Reiseapotheken enthalten sein und eingenommen werden, wenn Symptome von Harnwegsinfektionen auftreten. Auch lokal angewendete vaginale Östrogene mindern das Risiko von Harnwegsinfektionen und verbessern die Dranginkontinenz bei postmenopausalen Frauen mit häufigen Harnwegsinfektionen unabhängig von der Höhe. Die Osteoporose mit einem einhergehenden zusätzlichen Risiko von Frakturen ist ein Problem bei Frauen in den Wechseljahren, die Aktivitäten in den Bergen ausüben. Dieses Risiko sollte gegen die potenziellen gesundheitlichen Vorteile von Bergaufenthalten abgewogen werden. Gewöhnliche Aktivitäten in den Bergen, wie Gehen und Wandern, werden als Übungen zur Gewichtsbelastung empfohlen, die einer Osteoporose vorbeugen und die Knochenmasse und -dichte erhalten können. Darüber hinaus hat die Exposition gegenüber der Natur für Menschen jeden Alters Vorteile für die psychische Gesundheit (Referenzen zu diesem Kapitel 5–9).
y Der Menopausenstatus sollte bei der Beurteilung der Fitness für Reisen in große Höhen keine Rolle spielen.
Die Menopause erhöht das Risiko für Höhenerkrankungen nicht.
y Postmenopausale Frauen mit Osteoporose sollten wegen des erhöhten Frakturrisikos beim Bergsport vorsichtig sein. Sie können als Vorbereitung Maßnahmen ergreifen, um Verletzungen und Stürzen vorzubeugen (Gleichgewichts- und Krafttraining).
y Frauen nach der Menopause sollten die Vorteile von Bergsport für die Knochendichte und die psychische Gesundheit berücksichtigen.
y Postmenopausale Frauen mit häufigen Harnwegsinfektionen sollten eine Behandlung mit topischem Östrogen in Betracht ziehen und geeignete Antibiotika mit sich führen, falls sich während einer Bergreise Symptome eines Harnwegsinfekts entwickeln.
in der Schwangerschaft
Reisen generell y

Wer schwanger auf Reisen geht, muss daran denken, dass es oft schwierig ist, einen fachspezifischen Rat im Zusammenhang mit der Schwangerschaft zu erhalten. Gewisse Infektionskrankheiten wie Malaria, Hepatitis E oder Durchfall können während der Schwangerschaft einen schwereren Verlauf nehmen und auch das ungeborene Kind gefährden. Viele Medikamente, die zur Vorbeugung von Tropen- und Reisekrankheiten (Antimalariamittel, Antibiotika wie Quinolone oder Sulfonamide) eingenommen werden, dürfen während der Schwangerschaft nicht verwendet werden, da sie das Kind im Mutterleib potenziell gefährden können. Sowohl die Schwangerschaft als auch die Höhe stimulieren die Atmung, wodurch dem Körper mehr Wasser entzogen wird. Dies ist gerade in der Höhe enorm wichtig, da dort zum einen eine geringere Luftfeuchtigkeit herrscht und zum anderen das Durstgefühl oft unterdrückt ist. Deshalb muss auf eine genügende Flüssigkeitsaufnahme speziell geachtet werden.
Komplikationen für die Mutter y und/oder das ungeborene Kind
Die meisten wissenschaftlichen Studien zu Komplikationen eines Höhenaufenthalts für die Mutter und das ungeborene Kind wurden an Müttern erhoben, die in der Höhe leben. Über das Verhalten des ungeborenen Kindes und ihrer Mutter, die im Tiefland leben und sich kurzfristig über Tage bis Wochen in größere Höhen begeben, ist wesentlich weniger bekannt. Deshalb beruhen die Empfehlungen auf inkompletten Daten. Vermutlich besteht bei akuter Höhenexposition ein vermehrtes Risiko eines Frühaborts während des ersten Schwangerschaftsdrittels. Frauen, die schon einmal ein Kind während der Frühschwangerschaft verloren haben oder ein erhöhtes Risiko für einen Frühabort haben, sollten sich während dieser Zeit nicht in die Höhe begeben. Kurze Aufenthalte ohne große körperliche Anstrengung über Stunden bis Tage in Höhen bis 2500 m für Mütter mit bis dahin komplikationslos verlaufener Schwangerschaft und ohne bekannte Risikofaktoren in der zweiten Schwangerschaftshälfte sind unproblematisch. Über einen solchen Aufenthalt auf Höhen über 2500 m gibt es bisher keine Angaben. Mütter mit Risikofaktoren für Fehlgeburten, Wachstumsstörungen des Kindes, Bluthochdruck, Blutarmut, Herz- oder Lungenerkrankungen
sowie starke Raucherinnen sollten während der Schwangerschaft hingegen auch kurze Höhenaufenthalte über 2500 m meiden. Bei Müttern, die längere Zeit (Wochen bis Monate) über 2500 m leben, ist die Anfälligkeit für Schwangerschaftskomplikationen erhöht. Deshalb lauten die Empfehlungen, dass sich werdende Mütter, wenn ein längerer Höhenaufenthalt nicht vermeidbar ist, häufigen fachspezifischen Untersuchungen unterziehen sollten, um mögliche Komplikationen früh genug erfassen und reagieren zu können. Weil körperliche Anstrengungen in der Höhe theoretisch zu einer vorzeitigen Wehentätigkeit und zu Sauerstoffmangel beim Kind durch den Eigenverbrauch der Mutter führen können, wird Schwangeren empfohlen, sich in Höhen über 2500 m während der ersten zwei bis drei Tage nicht anzustrengen und für intensivere körperliche Aktivitäten die weitestgehend vollständige Akklimatisation von zwei Wochen abzuwarten. Generell abzuraten ist von sehr anstrengenden Aktivitäten in extremer Höhe, da dort der extreme Sauerstoffmangel im mütterlichen und kindlichen Organismus schädlich sein kann.
Höhenkrankheiten y
So weit wir dies wissen, hat die Schwangerschaft keinen Einfluss auf die Häufigkeit des
Auftretens von Höhenkrankheiten. Treten sie jedoch auf, können sie das Kind gefährden. Medikamente zur Vorbeugung und/oder Therapie der Höhenkrankheit wie Azetazolamid (Diamox®) und andere Sulfonamide sind während des ersten Schwangerschaftsdrittels wegen potentieller Schädigung des ungeborenen Kindes und während des letzten Schwangerschaftsdrittels wegen eines erhöhten Risikos der Neugeborenen-Gelbsucht verboten. In der Tabelle findet sich eine Übersicht zu Medikamenten, die häufig in der Höhe eingesetzt werden, hinsichtlich möglicher Schäden für das ungeborene Kind.
Klettern und Skifahren y Es gibt keine geschlechtsspezifischen Studien zu dieser Thematik. Generell kann angenommen werden, dass diese Aktivitäten während der ersten zwei Schwangerschaftsdrittel unproblematisch sind. Der Klettergurt darf zu keinem Zeitpunkt auf den Bauch drücken. Später muss beachtet werden, dass die Gewichtszunahme, die größere Überdehnbarkeit der Gelenkbänder und die Verlagerung des Körperschwerpunkts mit Zunahme des Bauchumfangs zu Unfällen und Stürzen mit potentieller Gefährdung des ungeborenen Kindes führen können (Referenzen zu diesem Kapitel 4, 10, 11, 12).
Medikament Teratogener Effekt
Wirksubstanz
Azetazolamid
Nifedipin
Dexamethason
Paracetamol
Nicht steriodale
Antirheumatika
Acetylsalicylsäure
Opioide
Metoclopramid
Domperidon
y Schwangere sollten zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft eine sorgfältige Risikoabwägung vornehmen, ob es sich lohnt, die Gesundheit des ungeborenen Kindes, insbesondere durch persönlich erstrebenswerte Freizeitbeschäftigungen auf Höhen über 2500 m, zu gefährden.
y Ist eine Höhenexposition nicht vermeidbar oder trotzdem gewünscht, sollte die Schwangerschaft gut medizinisch betreut sein und nur bei Fehlen von Schwangerschaftsrisiken mit größter Vorsicht stattfinden.
Markenname
Diamox
Nifedipin, Adalat
Fortecortin
Panadol
Brufen, Ifen, Ponstan,Olfen
Aspirin
Tramadol
Paspertin
Domperidon, Motilium
beim Tier
bei Nagetieren, nicht bei Affen
nein nein nein nein nein nein ja
beim Menschen
in kleinen Fallstudien bis 1000 mg ohne schädigende Wirkung
Bemerkung
nur wenn unvermeidbar, vor allem nicht im 1. Trimenon
keine sublinguale Anwendungwegen ausgeprägten Blutdruckabfällen
soll nicht im 3. Trimenon angewendet werden Õ Risiko eines vorzeitigen Verschlusses des Ductus arteriosus Botalli und Nierenfunktionsstörungen der Mutter
soll nicht im 3. Trimenon angewendet werden wegen Risiko eines vorzeitigen Verschlusses des Ductus arteriosus Botalli und möglicher Hirnblutungen des Fet bei Einnahme kurz vor der Geburt -
keine Anwendung kurz vor der Geburt wegen potentiell extrapyramidalen Symptomen beim Säugling -
Diese Serie organisieren und betreuen Dr. Nicole Slupetzky (Vizepräsidentin des ÖAV und Präsidentin des Clubs Arc Alpin) und Prof. Dr. Marc Moritz Berger (Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Essen, Deutschland; Präsidiumsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin). Der Experte für Prävention und Therapie der akuten Höhenkrankheiten und für alpine Notfallmedizin ist Mitinitiator des Symposiums für Alpin- und Höhenmedizin Salzburg, das gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein organisiert wird.
Literatur
1. Bartsch P, Swenson ER. Acute high-altitude illnesses. The New England journal of medicine 2013;369(17):1666-7. doi: 10.1056/NEJMc1309747 [published Online First: 2013/10/25]
2. Schommer K, Bartsch P. Basiswissen für die höhenmedizinische Beratung. Deutsches Aerzteblatt 2011;49:1-9.
3. Keyes LE. Hormonal contraceptives and travel to high altitude. High Alt Med Biol 2015;16(1):7-10.
4. Jean D, Leal C, Kriemler S, et al. Medical recommendations for women going to altitude. 2005;6(1):22-31.
5. Lhuissier FJ, Canoui-Poitrine F, Richalet JP. Ageing and cardiorespiratory response to hypoxia. The Journal of physiology 2012;590(21):5461-74.
6. Richalet JP, Lhuissier F, Jean D. Ventilatory Response to Hypoxia and Tolerance to High Altitude in Women: Influence of Menstrual Cycle, Oral Contraception, and Menopause. High Alt Med Biol 2020;21(1):12-19.
7. Woods NF, Mitchell ES. Symptoms during the perimenopause: prevalence, severity, trajectory, and significance in women's lives. Am J Med 2005;118 Suppl 12B:14-24.
8. Hunter MS, Gupta P, Chedraui P, et al. The International Menopause Study of Climate, Altitude, Temperature (IMS-CAT) and vasomotor symptoms. Climacteric 2013;16(1):8-16.
9. Keyes LE, Mather L, Duke C, et al. Older age, chronic medical conditions and polypharmacy in Himalayan trekkers in Nepal: an epidemiologic survey and case series. J Travel Med 2016;23(6): taw052.
10. Keyes LE, Armaza JF, Niermeyer S, et al. Intrauterine growth restriction, preeclampsia, and intrauterine mortality at high altitude in Bolivia. Pediatric research 2003;54(1):20-5.
11. Keyes LE, Hackett PH, Luks AM. Outdoor Activity and High Altitude Exposure During Pregnancy: A Survey of 459 Pregnancies. Wilderness Environ Med 2016;27(2):227-35.
12. Jean D, Moore LG. Travel to high altitude during pregnancy: frequently asked questions and recommendations for clinicians. High Alt Med Biol 2012;13(2):73-81. ■
Über die Schlüsselstelle hinaus. Sich besprechen, Probleme lösen, deiner Sicherung vertrauen. Die Verbindung, die beim Klettern entsteht, ist die stärkste von allen. Diese Partnerschaft begann vor 160 Jahren mit den ersten Mammut Kletterseilen. Daraus hat sich eine komplette Kletterkollektion entwickelt, die höchste Ansprüche an Sicherheit, Robustheit und Bewegungsfreiheit erfüllt. Wir halten dir den Rücken frei – durch die Schlüsselstelle und darüber hinaus.


Die Dolomiten und ihre Felstouren sind einzigartig. Dies führt zu Besonderheiten bei der Anwendung klassischer Führungstechniken. Im Gegensatz zu den Westalpen-4000ern liegt der Schwerpunkt im Fels. Hier ein kurzer Überblick.
Von Erwin SteinerAls Allererstes gilt es, den Begriff „Gehen am kurzen Seil“ zu definieren. Handelt es sich dabei um die klassische verkürzte Seilschaft beim Begehen eines Gletschers, wobei die Hauptgefahr der Spaltensturz ist, oder um gemeinsames Gehen in kurzen Abständen im einfachen Gelände zum Seiltransport, wobei keine Absturzgefahr besteht?
Nein, beim Bergführen handelt es sich definitiv um etwas anderes, und zwar um eine Sicherungstechnik, welche den Absturz einzelner Mitglieder der Seilschaft verhindern soll!
Dementsprechend gehört diese Methode seit eh und je zu den wichtigsten Inhalten der Ausbildung zum Berg- und Skiführer in Südtirol. Dies auch deshalb, weil das „Gehen am kurzen Seil“ vom Bergführer als Sicherungsmethode angewandt wird, was ihn vor allem im Fels von einer selbständig agierenden Seilschaft klar unterscheidet. Teilnehmer, die die Zugangstests zur Bergführerausbildung bei uns in Südtirol bestanden haben, sind in der Regel gestandene Alpinisten in den Disziplinen Skitouren, alpines Felsklettern und Hochtouren, haben aber meist wenig Ahnung vom Gehen am kurzen Seil. Die Sicherungstechnik „Gehen am kurzen Seil“ wird dementsprechend in den verschiedenen Ausbildungsmodulen von der Pike auf gelernt. Der nötige zeitliche Raum dafür wird bereits bei der Erstellung des Ausbildungsplanes geschaffen. Es wird viel Wert auf eine progressive Herangehensweise gelegt, um die Thematik vollinhaltlich zu lehren. So wird bereits beim Vorbereitungskurs Fels, welcher zwar im Gelände abgehalten wird, aber größtenteils aus „Trockenübungen“ besteht, die Thematik „kurzes Seil“ in den Vordergrund gerückt. Dementsprechend viel Aufmerksamkeit und Energie wurde seit Beginn der Ausbildung in Südtirol in die Weiterentwicklung dieser Technik gelegt. So entstand bereits im Jahre 2008 unter der Federführung von Maurizio Lutzenberger, Adam Holzknecht und Diego Zanesco eine ausführliche Ausbildungsunterlage. In dieser wurden die bis dahin gesammelten Erkenntnisse zu Papier gebracht und vor allem die Geländeschwierigkeit über verschiedene Farben definiert, um besser vermittelbare Kategorien für die Ausbildung zu schaffen.
Dass der oder die Führende (Bergführer:in) beim Gehen am kurzen Seil den zu erwartenden Schwierigkeiten mit einem hohen Maß an Reserven gewachsen sein muss, versteht sich von selbst. Gerade im
„Das Gehen am kurzen Seil ist die Königsdisziplin beim Bergführen. Dementsprechend wird es in allen Ausbildungsmodulen konsequent gelehrt.“
„Gehen am kurzen Seil“ in der Südtiroler Bergführerausbildung Kurzschluss 2.0
Fels ist es an der Tagesordnung, dass der Vorsteiger kurze Kletterpassagen im III. Schwierigkeitsgrad und mehr absolut ungesichert bewältigen muss, während die Nachsteiger durch das Vorhandensein von natürlichen Sicherungspunkten optimal gesichert werden. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, dass sich der Bergführer sicher und souverän in diesem Gelände bewegt. Das Gehen am kurzen Seil ist eine komplexe Angelegenheit und erfordert viel Übung und Erfahrung. Essentiell ist es, innerhalb dieser Sicherungstechnik die der Situation und dem Gelände angepasste Technik anzuwenden. Dabei muss die Technik entsprechend den Verhältnissen, der Anzahl der Gäste, dem Gewichtsverhältnis Bergführer-Kunde situationsbedingt immer wieder neu angepasst werden. Es muss abgewogen werden, welche Methode an dieser Stelle zur Anwendung kommt, um für sich selbst und den Geführten die optimale Sicherheit im Verhältnis zum Zeitaufwand zu gewährleisten. Der psychologische Aspekt beim Gehen am kurzen Seil darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Viele Menschen bewegen sich deutlich selbstverständlicher und damit auch sicherer im Absturzgelände, wenn sie in ein Seil eingebunden sind. Dies allein darf natürlich nicht als Sicherungstechnik anerkannt werden, fließt aber als risikoreduzierender Faktor in das große Ganze mit ein. Der Bergführer „spürt“ den Geführten über das mit der Haltehand leicht gespannte Seil und ist somit permanent über dessen physische und psychische Gefühlslage informiert.
Neben den klassischen Hochtouren im gesamten Alpenraum sind es vor allem die Normalwege in den Dolomiten, bei denen das kurze Seil als Sicherungstechnik zur Anwendung kommt. In diesem permanent wechselnden Gelände bietet die richtige Anwendung des kurzen Seiles immer noch den besten Kompromiss zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit, um Kunden sicher und effizient auf den Gipfel und auch wieder hinunter führen zu können. Außerdem kann der Bergführer positiv auf den Kunden einwirken, indem er das Gelände optimal ausnutzt und evtl. unangenehme Stellen umgeht, welche ein Geführter in der Regel gar nicht als solche erkennen würde. Allein das Steigen knapp hintereinander und eine einfache Kommunika-

tion sind sehr förderlich für ein reibungsloses Funktionieren der Seilschaft. Es gibt noch einen Aspekt, der für die Anwendung des kurzen Seils auf Routen mit dem Charakter der Normalwege in den Dolomiten spricht. Immer öfter beobachtet man bei selbständig agierenden Seilschaften, dass auch im gestuften Schrofengelände Seillängen von Standplatz zu Standplatz von beträchtlicher Länge gemacht werden. Die auf Absätzen und Bänder lose liegenden Steine werden dabei unweigerlich durch das Nachziehen des Seiles gelöst und stellen oftmals eine erhebliche Gefahr für nachkommende Seilschaften dar. Dieses Risiko kann durch die korrekte Anwendung des kurzen Seiles fast zur Gänze eliminiert werden.
In der oben erwähnten Ausbildungsunterlage von Maurizio Lutzenberger, Adam Holzknecht und Diego Zanesco von 2009 zum Gehen am kurzen Seil wurden vier Farben verwendet. Dabei wird die Einstufung des Geländes und der daraus resultierenden Schwierigkeiten und Techniken in die Farben Grün, Gelb, Orange und Rot unterteilt. Die Farben sollen primär für ein besseres Verständnis bei der Vermittlung der Lehrinhalte in der Ausbildung dienen. In den vergangenen Jahren wurden mehrere praxisnahe Halteversuche im Gelände durchgeführt. Letzthin vorwiegend im Fels.
Wir wissen schon länger, dass die Belastung, welche beim gleichzeitigen Gehen nur über die Armkraft gehalten werden kann, nicht besonders groß ist (max. 50 kg). Trotzdem kommt man zur Erkenntnis, dass bei guter Reaktionsfähigkeit des Bergführers und einem Gelände, das noch geneigt ist, nur über die reine Muskelkraft Beachtliches gehalten wird. Absolute Voraussetzung dafür: Das Seil zum Geführten muss leicht gespannt sein, damit bei einem Sturz sofort reagiert werden kann, noch bevor wirkliche Fallenergie entsteht. Die einfache Lehre daraus: Wenn die Umstände es verlangen (steileres Gelände, mehrere Geführte, Gewichtsunterschied, Sturz in senkrechten Passagen möglich), muss auch beim Gehen am kurzen Seil über Fixpunkte gesichert werden. Schlussendlich ist es der Bergführer, der permanent entscheiden muss, welche Technik er für die gegebene Situation anwendet.
Innerhalb der Sicherungstechniken beim Gehen am kurzen Seil werden unterschiedliche Vorgangsweisen angewandt. Bewusst verzichtet wird auf eine Angabe der Länge des Seiles zwischen Führer und Gast, da dies weniger von der Stufe (Farbe) abhängig ist, sondern vielmehr vom Gelände. Zudem muss die Länge des zur Verfügung stehenden Seiles im Fels sowieso permanent nachjustiert werden.
Als Empfehlung für die Gesamtlänge des Kletterseiles gelten bei uns nach wie vor mindestens 50 Meter bei Einfachseilen für klassische Normalwege. Bei der Verwendung des doppelt genommenen Halbseiles ist auch die 60-Meter-Länge oft angenehm. Die gesamte Länge des Seiles wird beim Gehen am kurzen Seil im Aufstieg natürlich so gut wie nie benötigt. Für die Abseilstellen im Abstieg ist dann die volle Länge des Seiles oftmals zwingend nötig. Ausschlaggebend für die Anwendung sind folgende Faktoren:
y Art der Route
y Steilheit und Exponiertheit des Geländes
y Felsstruktur und Sicherungsmöglichkeiten
y Anzahl der Geführten
y Gewichtsunterschied
y Routenverlauf (senkrechte Linienführung, Quergänge usw.)
y technische Fähigkeiten von Kunden und Führer
y Umwelteinflüsse (Reibung, Nässe, Gesteinsqualität etc.)
„Schlussendlich ist es der Bergführer, der permanent entscheiden muss, welche Technik er für die gegebene Situation anwendet.“
Vierstufige Struktur Gelände
n Stufe „rot“
Bergführer und Gast bewegen sich nicht mehr gleichzeitig (Mikroseillängen).
y Das Gelände ist über längere Strecken steil und ausgesetzt.
y Es handelt sich dabei oftmals bereits um richtige Kletterpassagen.
y Im Abstieg ist es zwingend notwendig, rückwärts abzuklettern.
y Der Kunde wird im Abstieg nach Möglichkeit bereits abgelassen.
n Stufe „orange“
Das Gelände weist kurze steilere Felsabschnitte auf.
y Das Gelände weist kurze steilere, aber ausreichend strukturierte Felsabschnitte auf.
y Im Abstieg sind die Gäste meist nicht mehr in der Lage „mit dem Gesicht voraus“ abzuklettern.
y Das Gelände weist bereits eine kontinuierliche Steilheit auf (Absturzgefahr).
y Kurze Steilstufen, auch senkrecht, wechseln sich mit deutlich flacheren Passagen ab.
n Stufe „gelb“
Das Seil zwischen Bergführer und Gast ist leicht gespannt.




y Das Gelände wird steiler und weniger gestuft (Absturzgefahr).
y Steile Schrofen, ausgesetzte Schotterund Grasbänder.
y Gelände, welches im Abstieg immer noch mit Gesicht zum Tal abgestiegen wird.
y Bergführer und Gäste bewegen sich gleichzeitig.
n Stufe „grün“
Das Seil zwischen Bergführer und Gast ist relativ locker.
y Das Gelände ist einfach bzw. leicht gestuft. y Mittelsteiler Schutt, steile Grashänge, leichte Schrofen, mit häufig ausgeprägten Steigspuren. y Es besteht keine objektive Absturzgefahr durch Rutschen oder Stolpern.
y Die Hände braucht es höchstens, um sich ab und zu leicht abzustützen.
Risiko
y Definitiv Absturzgefahr, aufgrund der Steilheit des Geländes.
y In den steilsten Passagen geht ein Sturz im Nachstieg bereits ins „Leere“.
y Auf Seilverlauf achten (Pendelstürze).
y Wird ein Sturz gestoppt, entspricht die anschließend zu haltende Last immer noch dem Körpergewicht des Gestürzten.
Technik
y Dort, wo der Kunde angehalten wird stehen zu bleiben, wird dieser auch gesichert (Köpfl, SU, Friend usw.). Sollte dies nicht möglich sein, wird er angewiesen, sich hinzusetzen.
y Im Nachstieg wird der Gast immer über einen Fixpunkt gesichert.
y Der Bergführer klettert in der Regel noch ungesichert, aber nicht mehr mit dem Seil in der Hand.
y Der Kunde wird angehalten, im Aufstieg Seil zu geben und im Abstieg das Seil einzuholen.
y Die Gefahr, dass man ausrutscht, stolpert oder stürzt, besteht permanent.
y Wenn ein Kunde stürzt oder hinfällt, besteht die Gefahr, dass er über eine Steilstufe hinunterfällt.
y Wird ein Sturz gestoppt, ist die anschließend zu haltende Last aufgrund der Steilheit des Geländes deutlich größer als bei der Stufe gelb.
y Das Seil zum Gast muss permanent leicht gespannt sein. Vorhandenes Schlappseil kann bei einem Sturz fatale Folgen haben.
y Bergführer und Kunden bewegen sich vorwiegend gestaffelt und nicht mehr gleichzeitig.
y Für das Überwinden der Steilstufen werden bereits beide Hände benötigt.
y Dem Gast wird genau kommuniziert, wann er an einer sicheren Position stehen bleiben soll und wann er nachsteigen kann.
y Kunde bleibt an sicheren Stellen noch z. T. ungesichert stehen, Bergführer steigt vor.
y Nachgesichert wird ein Kunde evtl. noch über die reine Armkraft, aber unter Zuhilfenahme von möglichst guten Seil-Reibungspunkten im Fels.
y Alternativ dazu kann die Körpersicherung (Schultersicherung) angewandt werden.
y Sollten Sicherungsmöglichkeiten für den Gast vorhanden sein (Köpfl, Felszacken, gefädelte Sanduhren usw.), werden diese natürlich genutzt.
y Wenn der Gast an sicherer Stelle steht, kann er angehalten werden, das Seil locker einzuholen, während der Bergführer abklettert.
y Wenn ein Kunde stolpert, ausrutscht oder hinfällt, besteht die Gefahr, dass er sich überschlägt oder abrutscht.
y Ausrutschgefahr aufgrund der Steilheit.
y Kurze Steilstufen, in denen bereits Absturzgefahr besteht.
y Bergführer muss Rutscher/Stolperer mit Muskelkraft halten.
y Gestürzter bleibt u. U. nicht selbständig liegen.
y Nachdem der Sturz aufgefangen wurde, muss nur noch eine minimale Last gehalten werden.
y Die führende Person stellt mit ihrer sicheren Fortbewegung die mobile Verankerung des Gastes dar.
y Der Bergführer hält das Seil in einer Hand und die Seilschlaufen in der anderen.
y Das Seil zwischen Bergführer und Gästen ist permanent leicht gespannt.
y Auf steilem Schotter, geneigten Felsplatten und steilen Grashängen geht man möglichst diagonal voran. Dabei hält die talseitige Hand das Seil, das zum Gast führt, die bergseitige Hand hält die Seilschlaufen.
y Im Quergang wird das Seil, welches zum Gast führt, mit der talseitigen Hand gehalten, die bergseitige Hand hält die Schlingen.
y Wenn vorhanden, wird das Seil hinter Felszacken/Köpfl geführt. Dabei trägt die talseitige Hand die Schlingen, die bergseitige Hand legt das Seil hinter den Felszacken. Die bergseitige Hand ist in dieser Situation die Haltehand.
y Ein Kunde, der stolpert, rutscht oder fällt, läuft weder Gefahr, ins Leere zu stürzen noch weiter nach unten zu rutschen oder zu rollen.
y Der Bergführer geht ohne besondere Spannung am Seil voran.
Im Aufstieg hilft ein leichter Seilzug, um die Bewegungen des Gastes wahrzunehmen.
y Bergführer und Gast bewegen sich gleichzeitig.
y Das Seil zwischen Bergführer und Gast ist relativ locker.
y Der Bergführer hat einige Seilschlingen in der Hand.
y Das Seil dient nur bedingt zur Sicherung (Seiltransport).
y Der psychologische Aspekt spielt in dieser Situation eine beachtliche Rolle.
y Bei einer Dreierseilschaft wird der am wenigsten erfahrene Gast in der Mitte, etwa 1,8 bis 2 Meter vom ersten Kunden entfernt eingebunden.
Wird das kurze Seil (Einfachseil) im reinen Fels eingesetzt, gibt es einige kleine Unterschiede zur Anwendung am Gletscher. So bindet sich der Bergführer im Fels prinzipiell direkt mit Anseilknoten, genau wie beim Seillängenklettern, in das Seil ein und nimmt den größten Teil des Seiles über den Körper auf. Am Gletscher bzw. auf Hochtour wird das Restseil häufig im Seilsack im Rucksack verstaut und so mitgetragen. Aufgenommen wird das Seil im Fels relativ straff, damit es beim Klettern nicht stört und damit sich nicht einzelne Seilschlingen am Fels einhängen können. Die Bewegungsfreiheit beim Klettern sollte jedoch nicht eingeschränkt sein. Das Seil wird so über die Schultern aufgenommen, dass das Zugseil von oben kommend unter der Schulter heraus in Richtung Anseilpunkt läuft. Am Anseilpunkt des Klettergurtes fixiert wird das Seil nun mit einem Mastwurf in einem HMS-Schraubkarabiner mit Drahtbügel (Positionierungssicherung). Twistlock-Karabiner mit Drahtbügel oder Safelock-Karabiner eignen sich hierfür am besten. Der einfache Schrauber wird auch akzeptiert, da es damit möglich ist, den Mastwurf mit nur einer Hand zu lösen und auch zu legen. Wichtig ist, dass sich der Karabiner nicht drehen kann und dementsprechend bei einer möglichen Belastung immer in Hauptachsenrichtung belastet wird. Diese Methode wird bei uns seit Jahrzehnten hinterfragt und diskutiert. Die Erfahrung zeigt aber immer wieder, dass die Sicherheit beim Gehen am kurzen Seil im Fels vor allem aus der richtigen Länge des Seiles zwischen Bergführer und Gast resultiert. Diese muss permanent angepasst werden. Um dies auch zu machen, benötigt es ein einfach und schnell bedienbares Instrument. Nach wie vor eignet sich der Mastwurf im Verschlusskarabiner mit Verdrehsicherung dafür am besten, gleich ob Twistlock, Schrauber oder Safelock.
Der Gast am Seilende wird immer, gleich wie beim Seilschaftsklettern, direkt mittels Anseilknoten eingebunden. Kommt ein weiterer Gast hinzu, so wird dieser entweder mit einem Safelock-Karabiner und Sackstich im Seil oder direkt mit gestecktem Sackstich kurz vor dem ersten Gast am Seilende eingebunden. Je geringer der Abstand zwischen den zwei Geführten ist, desto sicherer ist man unterwegs. Die Empfehlung dazu sind 1,8 bis 2 Meter. Für die Gäste ist das nicht immer angenehm, es minimiert aber das Risiko, zu viel Schlappseil zu erzeugen. Im Fels wird bewusst auf die Weiche verzichtet, eben auch um die Schlappseilbildung möglichst gering zu halten. Auch mobile Seilklemmen, wie Shunt usw., zum Einbinden in der Seilmitte werden nicht mehr verwendet. Die Erfahrungen damit in der realen Anwendung haben gezeigt, dass ihr Einsatz unter Umständen zu einem beachtlichen Sicherheitsverlust führen kann, vor allem für den Geführten, welcher am Seilende eingebunden ist. Das Knapp-hintereinander-Einbinden der Gäste beim Gehen am kurzen Seil im Fels erhöht definitiv die Sicherheit für die gesamte Seilschaft. Im Gelände, wo Bergführer und Gäste sich noch gleichzeitig fortbewegen können, funktioniert diese Vorgangsweise hervorragend. Wird das Gelände allerdings schwieriger – gestaffeltes Klet- tern, oder kurze Seillängen – dann kann es für die Nachsteiger hin und wieder etwas unangenehm sein. Durch das Fix-eingebunden-Sein ist die Bewegungsfreiheit des Mittelmannes doch stark eingeschränkt, was zwar kein erhöhtes Risiko bedeutet, den Spaßfaktor und die Qualität des Höhersteigens allerdings deutlich einschränkt. Dem kann unter Umständen durch ein doppelt genommenes Halbseil entgegengewirkt werden.
Hier muss etwas ausgeholt werden. Wie in den wahrscheinlich meisten Bergführerausbildungen im Alpenraum ist auch bei uns die Schnittfestigkeit der Kletterseile jene Diskussion, die zurzeit mit am häufigsten geführt wird. Die Erkenntnisse dazu, welche in den letzten Jahren an die Oberfläche gekommen sind, beschäftigen auch uns sehr und fließen laufend in die Führungs- und Sicherungstechnik unserer Ausbildung ein. Natürlich haben auch wir festgestellt, wie angenehm leicht und dünn die dreifach zertifizierten Seile geworden sind. Trotz alledem sind wir bei unserer Lehrmeinung geblieben, in klassischen Felstouren als Dreierseilschaft weiterhin mit Halbseilen unterwegs zu sein. Vorausgeschickt: Die Empfehlung bzw. Lehrmeinung ist, keine Halbseile zum Bergführen zu verwenden, welche weniger als 7,9 mm Durchmesser haben. Geschuldet ist das Ganze der Realität unserer täglichen Arbeit. Beim Nachsichern von zwei gleichzeitig kletternden Gästen mittels Platte (AlpinTuber – immer noch das empfohlene und am häufigsten verwendete Sicherungsgerät) durch eine 500 m lange Dolomitentour macht es am Ende des Tages einen beträchtlichen Unterschied, ob mit zwei Halbseilen oder mit zwei dreifach zertifizierten Seilen gesichert wird. Auch wenn auf dem Papier nur wenige Millimeter Unterschied festzustellen sind, so ist der gefühlte Unterschied ungleich größer zu bewerten.
Ein weiteres Argument aus technischer Sicht: Aufwändige Tests, welche von unterschiedlichen Institutionen, aber vor allem von Seilherstellern zu dieser Problematik gemacht wurden, haben klar gezeigt, dass der Seildurchmesser nur eine untergeordnete Rolle in Bezug auf die Schnittfestigkeit spielt. Es ist bekanntlich das Gewicht, mit dem das Seil belastet wird, das den Unterschied macht. Nachdem bei der klassischen Dreierseilschaft nur ein Gast an jeweils einem Seilende hängt, befindet man sich noch klar im Bereich der Norm.
Meist muss auch im Abstieg nach den Klettertouren noch gesichert werden. Häufig kommt wiederum das kurze Seil als vernünftige Sicherungstechnik zum Tragen. Wenn nun zwei Halbseile zur Verfügung stehen, gehen wir folgendermaßen vor: Eines der beiden Seile wird im Rucksack verstaut und kommt nicht mehr zum Einsatz. In das verbleibende bindet sich der Bergführer in der Seilmitte entweder mit Bulinknoten oder mit gestecktem Sackstich ein. Am besten ist es, sich gleich etwa einen Meter versetzt zur Seilmitte einzubinden, so haben die Seilenden gleich eine Distanz von etwa zwei Metern, was dem idealen Abstand der Geführten beim Gehen am kurzen Seil entspricht. Für beide Gäste steht jetzt ein freies Seilende zur Verfügung, in das sie eingebunden werden. Der Bergführer nimmt nun das Halbseil doppelt über die Schultern auf, bis der gewünschte Abstand zwischen ihm und den Geführten erreicht ist. Abbinden mit Verschlusskarabiner und Mastwurf wird genauso gemacht wie mit dem Einfachseil, nur mit gedoppeltem Halbseil. Wichtig noch: Beim gleichzeitigen Gehen/Klettern werden die beiden Einzelstränge knapp vor dem Gast, der sich als Erster hinter dem Bergführer befindet, mit einem Sackstich verbunden. Somit kann das gedoppelte Halbseil gehandhabt werden wie ein Einzelstrang, was für sicheres Halten zwingend notwendig ist. Wird allerdings gestaffelt geklettert und über Fixpunkte gesichert, so wird der Knoten vor dem ersten Nachsteiger gelöst und beide Gäste haben
einen Einzelstrang zur Verfügung, über welchen sie unabhängig voneinander gesichert werden. Diese Methode des gedoppelten Halbseiles ist nicht nur als Kompromiss für den Abstieg zu sehen, sondern zeigt ihre Vorteile besonders auf klassischen DolomitenNormalwegen, wo sich Gehpassagen abwechseln mit Steilstufen, welche ansprechende Kletterei bieten.
Durch das doppelt genommene Halbseil ist der Bergführer im Vorstieg immer der Norm entsprechend angeseilt. Beim gleichzeitigen Steigen ist die Seilhandhabung durch die Verbindung der beiden Stränge mit dem Sackstich praktisch identisch mit der beim Einfachseil. Beim etwas schwierigeren Klettern, wo die Nachsteiger unabhängig voneinander über den Einzelstrang gesichert werden, erhöht sich nicht nur die Sicherheit, sondern vor allem die Qualität des Geführt-Werdens. Gäste von heute wollen nicht nur irgendwie auf den Gipfel und wieder nach unten gebracht werden, sondern möchten die schönen Kletterstellen auch genießen. ■
Seit Herbst 2022 sind die Bergführerverbände der Schweiz, von Österreich, Deutschland und Südtirol als Redaktionsbeiräte bei bergundsteigen mit an Bord. Daher erscheint seither in jeder Ausgabe ein Beitrag dieser Verbände. Die Serie soll informieren und zugleich zu einem konstruktiven Austausch zwischen den Verbänden anregen und dadurch auch indirekt die Bergführerausbildung weiterentwickeln.
Anseilen mit Halbseil bei der Kurzseiltechnik.
...oder so!
Bulinknoten
Mit Bulinknoten eingebunden, Schlaufenende zur zusätzlichen Sicherung gemeinsam mit Drahtbügel eingehängt
Beide Seile mit Sackstich verbunden
Ohne Abbund hat jeder Kunde seinen eigenen Strang (wie Dreierseilschaft)
Fragen wie: Wo ist der nächste Stand? Reicht das Seil? Welches Seil zieht? Lässt sich das Seil abziehen? Löst man Steinschlag beim Abziehen aus und, und, und. Aber inzwischen ist das ja alles Routine, und bei einem eingespielten Team flutscht die ganze Sache natürlich umso besser.
Es ist schon etliche Jahre her, dass ich mit Benedikt, einem Bergführerkollegen, die Cassin am Preußturm im Drei-Zinnen-Massiv geklettert bin. Dennoch wird mir die Tour ewig in Erinnerung bleiben. Ja, klar, solche Klassiker vergisst man nicht, aber der wahre Grund, warum ich immer wieder an diesen Klettertag in den Zinnen denke, ist ein anderer. Es lief alles wie am Schnürchen, an diesem wunderschönen Spätherbsttag: Die Nordseiten der Zinnen waren schon mit Schnee bedeckt, die Touristen fort und die Tour trotz der ein oder anderen polierten Stelle sehr schön zu klettern. Am Ausstieg genossen wir die Ruhe und die wunderbare Aussicht, bevor wir uns an den Abstieg –oder besser gesagt ans Abseilen machten. Jetzt noch mal konzentrieren, und in einer Stunde sind wir beim Bierchen.
Obwohl, oder vielleicht gerade weil man in seinem Kletterleben Hunderte Male abgeseilt hat, birgt dieser triviale Vorgang immer noch ein gewisses Restrisiko: Passt der Abseilstand? Passt der Verbindungsknoten?
Ist das Abseilgerät richtig eingelegt? Ist der Kurzprusik eingelegt? Sind alle Karabiner zu? Sind Knoten in den Seilenden? Neben diesen Standardfragen, die man vor dem Abseilen ohnehin noch einmal gewissenhaft checkt, beschäftigt man sich mit weiteren
Zurück zur Kleinen Zinne, zurück zum vorerst letzten Abseiler ca. 30 Meter oberhalb der großen Schlucht. Alles ist vorbereitet und ich schmeiß die beiden Seile hinunter. Nein, ich hab die Knoten im Seilende nicht vergessen, ich hab bewusst keine hineingemacht, da die Seile ganz locker bis zum Boden reichen, was mir mein Blick nach unten auch bestätigt. Ein letzter Check am Stand und dahin geht’s. Ich seile als Erster bis auf den Schluchtgrund ab, gehe die Schlucht mitsamt den Seilen im Abseilgerät – mehr abseilend als gehend – weiter und entdecke den nächsten Stand: „A bissl alt die Haggl, aber passt schon, ist ja nix Außergewöhnliches in den Dolos! Alles gut!“ Gerade will ich meine Selbstsicherungsschlinge in den Stand einhängen, da entdecke ich einige Meter weiter vorne, direkt an der Schluchtkante, einen besseren Stand mit fettem Ring.
„Super, den nimm i!“ Gesagt, getan. Ich gehe – weit nach hinten gelehnt, meinen Reverso wieder belastend – rückwärts weiter an die Kante. In dem Moment, wo ich meine Selbstsicherung in den Abseilring einhänge, flutschen auch schon die gespannten Seile durch mein Abseilgerät. Dass keine Knoten in den Seilenden waren, hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr am Radar. Warum auch, war doch meine volle Aufmerksamkeit ganz und gar auf den Abseilring gerichtet! Wäre der Stand einen Meter weiter hinten gewesen, wäre dieser Klettertag wohl nicht so gut ausgegangen … ■
 Gerhard Mössmer über eine Abseilaktion, die beinahe zum Absturz führte.
Gerhard Mössmer über eine Abseilaktion, die beinahe zum Absturz führte.
Abseilstand Abseiler in Schlucht ca. 30 Meter
Schluchtgrund Gehgelände ca. 25 Meter alter Abseilstand
massiver Abseilring Kante
Illustrationen: Gerhard Mössmer
Gerhard Mössmer ist Bergführer, Sachverständiger und arbeitet beim ÖAV in der Abteilung Bergsport, wo er für Publikationen, Lehrmeinung und das ÖAV-Lehrteam verantwortlich ist. Darüber hinaus kümmert er sich um die Beantwortung eurer Fragen in der Rubrik Dialog in bergundsteigen.
„Mein Fazit: Beim Abseilen gibt es nichts, was es nicht gibt, und die Fehlertoleranz ist einfach verdammt klein. Deshalb machen gewisse Standards und Partnerchecks einfach Sinn.“ Gerhard Mössmer
bergsönlichkeit Mensch, der beruflich oder ehrenamtlich mit Risiko im Bergsport in Verbindung steht.
Am 20. Mai 2023 verunglückte Robert Renzler, langjähriger Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins, bei einem Kletterunfall tödlich. Der 67-Jährige stürzte beim Abseilen an der Stafflachwand in Schmirn in Tirol über 60 Meter ab.
Am 20. Mai 2023 verunglückte Robert Renzler, langjähriger Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins, bei einem Kletterunfall tödlich. Der 67-Jährige stürzte beim Abseilen an der Stafflachwand in Schmirn in Tirol über 60 Meter ab.
Die Nachricht vom Tod Roberts – er war aufgrund eines Fehlers beim Abseilen nach der Begehung der Route „Leckerbissen“ gestorben – löste tiefe Betroffenheit in der bergundsteigen-Redaktion aus. Denn ohne Robert Renzler gäbe es dieses Magazin vielleicht gar nicht. Robert Renzler hatte als Leiter des Alpinreferats im Österreichischen Alpenverein 1992 den Wunsch geäußert, für die ehrenamtlichen alpinen Führungskräfte im Verein einen regelmäßigen Rundbrief herauszubringen, um diese wichtige Funktionärsgruppe in den Sektionen mit Informationen aus dem Alpenvereinshaus in Innsbruck zu versorgen. Sein Mitarbeiter Michael Larcher griff dieses Ansinnen auf und entwickelte daraus das Magazin bergundsteigen.
Der Schock sitzt tief: Man konnte als Bergsteiger gar nicht erfahrener sein als Robert Renzler. Robert war Berg- und Skiführer und hatte im Laufe seiner Kletterkarriere unzählige schwierige Alpintouren in den Ost- und Westalpen sowie im Yosemite absolviert. Außerdem gelang ihm 1982 die Besteigung des 8035 m hohen Gasherbrum II im Karakorum im Alpinstil ohne Sauerstoff und 1985 die Besteigung des 7821 Meter hohen Masherbrum über eine großteils neue Route. 1988 glückte die Erstbesteigung des 6170 Meter hohen Kohinoor in Pakistan. Beim Sportklettern kletterte Robert Routen bis zum unteren neunten Grad. Als Veranstalter der ersten Kletterweltmeisterschaft in Innsbruck trug er wesentlich zur Entwicklung des Sportkletterns bei, Anfang der 1990er-Jahre hatte er das Amt des geschäftsführenden Präsidenten des Weltkletterverbandes inne.
Später wirkte er als Präsident der UIAA Mountaineering Commission und war von 2002 bis zu seiner Pensionierung 2020 Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins. Sein Engagement und Eintreten für die Ideale des Alpenvereins waren prägend für die so erfolgreiche Entwicklung des Vereins. Robert hat beispielsweise als Generalsekretär mit der „Tirol Deklaration“ weltweit gültige Ethikgrundsätze für das Bergsteigen maßgeblich mitgestaltet (ausführlich dazu in bergundsteigen #121: „Und Friede auf den Bergen: 20 Jahre Tirol Deklaration“) und sich Zeit seines Lebens – inner- und außerhalb seiner Funktion im Alpenverein – für den Naturschutz und den Erhalt alpiner Landschaften engagiert.
Unter seiner Führung wurde auch die Geschichte des Alpenvereins wissenschaftlich aufgearbeitet: 2011 hat der Österreichische Alpenverein gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein und dem Alpenverein Südtirol das Buch „Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen 1919–1945“ herausgegeben, in dem die Alpenvereine ihre Geschichte während der NS-Zeit hinterfragen. Ich durfte damals als junger Historiker bei diesem Projekt mitarbeiten und Robert als großen aufgeklärten Humanisten kennen- und schätzen lernen –kritisch, liberal und vor allem gradlinig. Anlässlich Roberts Verabschiedung in die Pension hatte unser Redaktionsmitglied Simon Schöpf die Idee, die „Edelfeder Robert Renzler“ – Zitat eines bekannten österreichischen Journalisten – als Kolumnist für bergundsteigen zu gewinnen. Roberts Antwort: „Jetzt muss ich erst einmal als Bergsteiger all das nachholen, was ich als Generalsekretär versäumt habe. Vom theoretischen Alpinismus brauche ich erstmal eine Pause. Aber Burschen, fragt’s mich in einem guten Jahr nochmal!“ Leider wurde daraus nichts mehr. [Gebi Bendler]
„Die Welt zu durchschauen, zu erklären, sie zu verachten, mag großer Denker Sache sein. Mir liegt einzig daran, die Welt lieben zu können!“

H. Hesse, Siddhartha
In Erinnerung an Robert drucken wir hier noch eines der letzten Interviews mit ihm (31. 07. 2021) ab:
Der Extrembergsteiger und Philosoph Robert Renzler erzählt im Interview, was ihn die Berge gelehrt haben, von seinem Zugang zum Leben, seinen Gedanken zur Demokratie in Zeiten der Digitalisierung und über das Spannungsverhältnis zwischen Risiko und Freiheit.
Von Larissa BreiteneggerEine Befreiung?
Reinhard Fahl war ein bekannter deutscher Bergsteiger und Fotograf, der sagte: Mit dem Sportklettern ist die Angst abgestürzt. Weil man Sicherungen gesetzt hat, Bohrhaken, man hat die Klettergärten geschaffen. Das Klettern ist viel sicherer geworden. Insofern war es eine Befreiung von der Angst im Klettern. Während umgekehrt ja die Angst beim Bergsteigen wiederum ein ganz wichtiges Element ist, vor allem beim Durchklettern hoher Wände. Das Risiko ist ja auch was sehr Positives: Der Umgang mit Risiko, der Umgang mit der eigenen Angst, der kann ja auch letztlich sehr befreiend sein.
Sie sind passionierter und extremer Bergsteiger, waren 20 Jahre lang Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins und haben den Alpinismus wie wir ihn heute kennen mitgeprägt. Welche Veränderungen haben Sie beispielsweise mitgestaltet, worauf sind Sie stolz? Ich war im Gründungskomitee des KletterWeltcups: Das war damals völlig neu. Wir haben damals die ersten Kletterwände gebaut und Wettbewerbe organisiert. Jetzt hatten wir erstmals Olympia – und das war letztlich auch unser Ziel, dass der Sport olympisch wird. Wenn man die Sportkletterbewegung von der Pieke auf entscheidend mitgestalten kann, ist das im Rückblick schon etwas, wo wir sehr stolz drauf sind. Dass es jetzt Olympia gibt oder mehr Leute in die Berge gehen – das ist nicht nur positiv besetzt, das sehe ich auch kritisch. Aber insgesamt war die Sportkletterbewegung eine Befreiung des Bergsteigens – vor allem für die Jugend.
Sie haben wegen Ihrer Leidenschaft fürs Bergsteigen auch Ihr Studium der Philosophie und griechischen sowie lateinischen Philologie an den Nagel gehängt, was in der Außenwahrnehmung mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Welche Bedeutung hat für Sie dieses Spannungsfeld zwischen Risiko und Angst? Ich bin immer noch ein klassischer und leidenschaftlicher Bergsteiger. Zum Bergsteigen gehört die Begegnung von Mensch und Berg, und in dieser Begegnung liegt der Umgang mit Risiko und der Angst vor dem Absturz: Die begleitet einen die ganze Tour, wenn man auf große Berge steigt. Das Bergsteigen ist für mich auch eine ganz wichtige Lebensschule gewesen: Man wächst mit dem Risiko und der Angst mit. Dieses Element des Risikos ist für mich immer noch ein ganz zentrales Element beim Bergsteigen: Das Erleben wird intensiviert und die Zurückgeworfenheit auf das eigene Können, auf sich allein und den Partner, das ist etwas, was man im normalen Leben ja nicht mehr findet.

Das Risiko als Mittel, das einen auf sich selbst zurückwirft also?
Ja, sozusagen. Dieses Erleben im Gefahrenraum Berg wird ja durch die Möglichkeit des Risikos, durch das Erleben von Angst, sehr intensiviert. Die Sinne sind ganz anders geschärft, wenn ich eine schwierige Tour klettere oder einen ausgesetzten Grat begehe. Dann ist man viel mehr fokussiert, und ist gleichzeitig ganz bei sich, eben, weil man so fokussiert ist.
Wird die Angst weniger?
Mit der Routine. Je mehr und öfter man in schwierigen Wänden unterwegs ist, umso weniger wird die Angst. Aber sie ist letztlich immer da – wer keine Angst hat, wird sicher irgendwann abstürzen. Das ist so. Felsklettern im Gebirge, das ist Himmel und Hölle zugleich. Da gehört Mut dazu, und da gehört Angst dazu. Wenn ich über einen exponierten Grat gehe – man erschrickt, man geht vorsichtig, und wenn man drüber ist, atmet man auf, atmet man durch. Und diese Gegensätze: Himmel-Hölle, Mut-Angst, Erschrecken-Aufatmen, das ist ein Teil von einem unteilbaren Ganzen. Das ist für mich auch, was das Bergsteigen so besonders macht. Ohne das abwertend zu meinen, es ist nicht nur Sport – es ist einfach mehr.
Was ist das Mehr?
Wenn ich unterwegs bin, setze ich ja letztlich auch mein Leben ein, wenn man es auf die Spitze gedacht sieht. Ich habe in meinem Bergsteigerleben sehr viele Freunde sterben gesehen. Ich habe eine Erstbesteigung mit sieben Gefährten gemacht, von denen leben heute noch drei. Die anderen sind am Berg gestorben. Das ist ein Teil vom Ganzen. Was oft unterstellt wird, dass Bergsteiger todessehnsüchtig sind – es ist genau das Gegenteil der Fall. Man geht eigentlich in die Berge nicht, weil man den Tod sucht, sondern weil man leben will, weil man das Leben sucht. Damals haben wir gesagt, wir steigen aus, aus der Norm der Gesellschaft, und steigen ins wirkliche Leben ein. Das war unser Schlagwort damals, als junge Bergsteiger.


Das wirkliche Leben ist das im Angesicht des Todes also?
Ja, das klingt jetzt dramatisch, aber letztlich ist ein bewusstes Leben ein Leben, das sich bewusst ist, dass wir alle sterblich sind. Unsere Gesellschaft hat in den letzten Jahrzehnten den Tod aus dem Leben eliminiert. Es wird anonym gestorben, das ist alles organisiert. Der Tod ist eigentlich kein Thema in der Gesellschaft, dabei sollten wir wissen,
dass wir begrenzte Leben haben und alle sterben werden – und dass die Zeit kostbar ist. Aber wenn ich schaue, wie wir unser Leben aufbauen – global, wirtschaftlich, dann tun wir so, als hätten wir ewig Ressourcen und würden ewig leben. Wir haben einfach jedes Maß verloren. Die Maßlosigkeit, die Hybris, ist schon bei den alten griechischen Philosophen ein großes Thema: Wer das Maß verliert, das war eine der größten Vergehungen am Menschsein. Und mit dem sind wir jetzt konfrontiert.
Woher nehmen Sie Ihr Maß?
Dass das Leben nicht nur Konsum ist, das nehme ich aus der Begrenztheit des Lebens: Wir können alle nichts mitnehmen. Das Maß ist für mich das, was die Erde an Ressourcen zur Verfügung stellt, und wir leben ja schon seit Jahrzehnten auf Pump. Der „Global Overshoot Day“ ist gerade erst gewesen: Wir leben das halbe Jahr von Ressourcen und Energieverbrauch auf Kosten der künftigen Generationen oder eigentlich schon unserer Kinder. Wir tun so, als hätten wir mehrere Erden zur Verfügung. Wir in der westlichen Welt verbrauchen im Schnitt zweieinhalb- bis dreimal mehr Ressourcen, als uns eigentlich zustehen würden. Das war bisher nur möglich, weil die Dritte Welt entsprechend wenig verbraucht.
Ihr Beitrag „Die letzte Bergfahrt. Eine Reise zum Ende der Welt”, erschienen im Alpenvereinsjahrbuch „Berg“ 2020, beschreibt die Tour eines Bergsteigers, der nach einem Absturz eine Vision hat. Dabei zeichnen Sie ein kritisches und zugleich düsteres Bild der Gesellschaft. Es geht um die Gefährdung der Demokratie, um Risiko und Freiheit, Recht und Gerechtigkeit, Verantwortung, Wahrheit und Lüge, um das Spiel mit der Angst. Sie haben da viel hineingepackt. Was waren Ihre Beweggründe?

Das ist meine Sicht der Dinge, wie sie sich entwickelt haben, und wie ich die Welt erlebe. Ich beobachte viele negative Entwicklungen; beispielsweise durch die Digitalisierung, die auf der anderen Seite auch eine ungemeine Chance bietet, zum Beispiel
im Angesicht des Klimawandels global zu agieren und sich zu vernetzen. Umgekehrt ist natürlich die totale Digitalisierung auch die totale Überwachung. Was uns die Geschichte mehrfach gelehrt hat: Alles, was theoretisch möglich ist, wurde auch letztlich umgesetzt. Das muss uns klar sein. Ob das jetzt die Atombombe war oder das Kernkraftwerk mit Supergau. So wie China jetzt angefangen hat, mittels Algorithmen ein Bestrafungs- und Belohnungssystem einzuführen, das ist viel weiter gedacht, als was sich George Orwell in seinem Buch „1984“ vorgestellt hat.
Damit einher geht auch eine massive Einschränkung der persönlichen Freiheiten, durch die Überwachung … Ja, es muss uns klar sein, solange wir in einer „Noch-Demokratie“ – für mich ist die Demokratie im Wandel zu einer postdemokratischen, das war schon vor Corona so, und Corona hat es noch zugespitzt –, solange wir noch in einer funktionierenden Demokratie leben, ist das ja im Griff zu behalten. Nur die Gefahr, dass das rasch umschlägt, ist vorhanden. Da ist China das große Beispiel. Dort hat das autoritäre System in Verbindung mit einem starken wirtschaftlichen Aufschwung und Konsummöglichkeiten für breite Gesellschaftsschichten funktioniert. Da hat man gesehen, dass das, was wir als Grundrechte verstehen, gewachsen in der Aufklärung und dann nach dem Zweiten Weltkrieg gipfelnd in den Menschenrechten, dass das, solange die Leute genügend konsumieren können, gar nicht so wichtig ist. Ich sehe da eine Gefahr, dass diese Systeme die Demokratien ablösen. Und dann ist das Element der Überwachung ein totales. In den Autos haben wir mittlerweile verpflichtend GPS drinnen, mit der Begründung, wenn irgendwo ein Unfall ist, kann Hilfe kommen und das Auto orten. Damit kann ich sämtliche Bewegungen aufzeichnen. Genauso mit unseren Handys. Wenn ich Bargeld abschaffe, schließt sich der Kreis: Dann weiß ich, was die Leute kaufen, was sie essen, für was sie Geld ausgeben, was sie machen, wo sie sind – das ist dann eigentlich eine Rundumüberwachung.
„Freiheit fordert Verantwortung.“
Robert Renzler
Im Juli 1985 erreichen

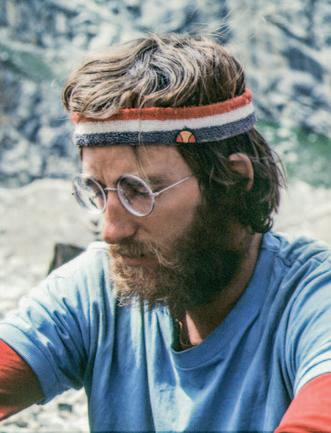



„Ich bin zutiefst überzeugt, dass nur die Liebe zur Welt, wie wir sie oft in unserer Bergheimat spüren, diesen geschundenen und gebeutelten Planeten lebenswert erhalten kann.“ Robert Renzler
Einerseits, sagen Sie, stecken da große Chancen drin, was die globale Vernetzung betrifft; andererseits, was Kontrolle und Überwachung betrifft, große Gefahren. Es geht bei der Digitalisierung –ebenso beim GPS-Beispiel – auch um Sicherheit. Man argumentiert, dass das GPS im Auto Sicherheit im Falle eines Unfalls bringt. Ich würde gern aufs Risiko zurückkommen: Sie sagten, dass das Risiko mit der Möglichkeit des Todes einhergeht. Das Risiko ist das, was eigentlich zum Leben führt, ich sehe da dieses Spannungsfeld – Sicherheit versus Risiko bzw. Freiheit. Ja, Sicherheit ist oft ein Totschlagargument. Mit Sicherheit kann ich so ziemlich alles begründen. Das ist eben immer die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, sagte ja schon: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und das bringt es auf den Punkt. Wenn ich nur sicher sein will, dann habe ich auch keine Freiheit mehr. Es ist immer ein Abwiegen, wie viel Sicherheit brauche ich, und wie viel Freiheit brauche ich im Leben. Ich kann nicht beides zugleich in vollem Umfang haben, das geht nicht. Und ich muss mir im Klaren sein: Freiheit ist nicht umsonst.
Nochmal zum Thema Wahrheit: Sie haben in Ihrem Beitrag „Die letzte Bergfahrt“ auch die vielzitierte Unschuldsvermutung kritisiert, die die Wahrheit „verwäscht“. Der Mut zur Wahrheit ist uns verlorengegangen, lese ich das richtig heraus? Nein, da spiele ich schon mehr auf den Sensationsjournalismus an, der gleich etwas rauslässt, ohne recherchiert zu haben, ob da mehr dahinter ist – danach steht dann unten, es gelte die Unschuldsvermutung. Wenn nach einem Jahr herauskommt, es war doch nichts, dann interessiert das niemanden mehr – real ist die Person trotzdem schuldig gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir gerade diese ständigen Angriffe von politischer Seite, von den Türkisen, auf unser Gewaltentrennungssystem. Wenn ich ständig die Judikatur angreife, dann hat
das Auswirkungen auch auf den Durchschnittsbürger. Das Vertrauen leidet da ja automatisch unbewusst mit. Vorm Kurz wars der Kickl, als er sagte, das Recht müsse dem Gesetz folgen. Ich habe damals ein Vorwort geschrieben dazu: Die drei großen Player im Staat – Exekutive, Legislative und Judikative – sind ja nicht nachgeordert, sondern das ist ein Gleichgewicht. Natürlich macht das Parlament die Gesetze, die die anderen dann vollziehen, aber im Vollziehen und Interpretieren müssen die anderen wieder unabhängig sein, sonst funktioniert das Gleichgewicht nicht. Es muss auch eine Instanz geben wie den Verfassungsgerichtshof, der sagt, liebe Freunde, das Gesetz ist gegen unsere fundamentalen Grundwerte, die in der Verfassung festgeschrieben sind, daher geht das nicht. Und wenn ich sage, ich ordne die Judikative nach, dann unterlaufe ich das. Wir haben ja endlos Beispiele in der Geschichte, wo alles nach Gesetz unter Anführungszeichen gelaufen ist, und trotzdem waren das Unrechtsstaaten. Im Kommunismus vom Stalin oder im Hitlerstaat wurden auch immer Urteile im Namen des Volkes gesprochen. Und sie haben sich die Gesetze so zurechtgemacht, dass es dem auch entspricht. Wenn dieses Gleichgewicht zwischen Exekutive, Legislative und Judikative nicht gewahrt und ständig von höchster Seite unterminiert wird, also vom Bundeskanzler, dann ist das demokratiepolitisch zutiefst bedenklich. Wenn er eine Beschwerde machen möchte – wie Sie und ich, wenn wir eine Hausdurchsuchung hätten, die aus unserer Sicht völlig ungerechtfertigt war –, dann gibt es ja Instanzen, da können wir zum Verfassungsgerichtshof gehen, das ist der Weg, aber nicht öffentlich die grundlegenden Institutionen schlechtmachen. Das unterläuft die Demokratie. Genauso wenn ich Lügen verbreite – ungestraft. Auch das unterminiert die Demokratie. Wenn jeder ohne Faktenprüfung seine Thesen rauslässt, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, und das ist dann gleichrangig mit geprüftem Faktenwissen im Netz zu finden und der, der dann diese Lügen liest und sich dem zugewandt fühlt, nimmt das dann für wahr – das unterläuft unser System.

Ich möchte gerne noch einmal auf die Vision in Ihrem Artikel, zurückkommen –die ist zunächst einmal recht düster. Ich bin von meinem Grundsatz her ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich sehe es halt so. Wenn ich heute die Fakten zusammenzähle, wenn ich schau, wo wir mit dem Klima stehen, wenn ich schau, wo wir mit dem Artensterben, mit dem Ressourcenverbrauch stehen, und wohin die Tendenzen jetzt wieder gehen: Wachstum, Wachstum, Wachstum – dann hat sich nichts geändert, wir werden uns wieder überbieten in den Wachstumsziffern. Dann bleibt wenig, und wenn man schaut, wie sich die demokratischen Verhältnisse und die Demokratien in ihren Strukturen verändern, dann ist es schwierig, dem positive Aspekte abzugewinnen. Das sind Fakten, die kann man nicht schönreden. Aktuell ist ein heißes Thema der Bodenverbrauch: Da habe ich schon vor 20 Jahren mit dem WWF Pressekonferenzen zu dem Thema gemacht. Das läuft jetzt 20 Jahre, und nichts ändert sich. Dann kommen ein paar Artikel, wir betonieren alles zu und so weiter, ein kurzer Aufschrei – und morgen geht’s gleich weiter wie vorher, die Raten sind in den letzten sechs Jahren sogar immer weiter nach oben gegangen. Wo bleibt da der Glaube an die Vernunft? Letztlich versuchen wir auch beim Klimawandel, immer nur die Symptome zu bekämpfen, aber nie die Systeme.

Das kritisieren immer mehr Leute, auch wenn es um erneuerbare Energien usw. geht: Es fehlt die Systemfrage, der Ansatz an der Wurzel …
Ich bekämpfe jetzt den Klimawandel, indem ich Elektro- oder Wasserstoffmobilität zur Verfügung stelle. Brauche aber deswegen gleich viele Ressourcen, habe genau das gleiche Problem mit der Entsorgung der Batterien, muss das Auto genau gleich bauen wie bisher, das ist ja nicht CO2-frei gebaut, die Leute rechnen immer, wenn das Auto dasteht, und ich fahre, dann bin ich klimaneutral. Aber alles, was vorher und nachher ist, wird ausgeblendet. Die Antwort kann nur ein gewisser freudvoller Verzicht bei uns in der westlichen Welt sein. Ohne dem wird es
nicht gehen – dass wir einfach mit ein bisschen weniger zufrieden sind, und ein bisschen weniger kreuz und quer durch die Gegend fahren, den Verkehr auf den öffentlichen Verkehr umrüsten – das wird anders nicht gehen. Ich sage, es wird wie immer sein: Die Veränderungen kommen dann, wenn sie wahrscheinlich nicht mehr konfliktfrei sind. Wir werden die Migration erleben. Wir werden mit Leuten konfrontiert sein, die durch den Klimawandel ihre Nahrung verlieren – da geht es wirklich ums Essen und ums Überleben. Die werden wir nicht aufhalten können auf Dauer. Und wenn wir sie aufhalten, dann werden wir an den Grenzen Krieg führen müssen. Und das ist die große Gefahr bei dem Ganzen, dass wir so lange weitermachen, bis sich das Gemisch in gewaltsamen Konflikten auflöst.
Zum Schluss würde ich gerne noch auf die Verantwortung kommen, mit der Sie in Ihrem Text „Die letzte Bergfahrt“ ja auch schließen. Da kommt dann schon das Positive heraus: „Die Menschen erhoben sich und begannen stumm und unerbittlich, ihre Verantwortung gegenüber sich und der Welt zu übernehmen, indem sie ihre gekrümmten Rücken geradestreckten und ihre Augen und Ohren öffneten um zu sehen, was wahr ist.“ Genau, da sind wir wieder beim Thema Wahrheit. Letztlich – solange es demokratische Systeme gibt – liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, und die Möglichkeiten haben wir immer noch, dass wir die Verantwortung für uns und für die nächste Generation und letztlich auch für die Welt, in dem Bereich, in dem wir wirksam werden können, wahrnehmen. Und es braucht, das ist schlecht und genauso gut, es braucht für die positiven großen Änderungen in der Gesellschaft nicht mehr als 15 Prozent, die aktiv werden, die können den Rest bewegen – das zeigt die Geschichte, und umgekehrt war es leider auch so, dass 15 Prozent die Geschichte ins Negative gedreht haben.
Danke für das Gespräch!
„Der Mensch ist sterblich, und wenn er sich dessen bewusst ist, bietet genau dieses Momentum Chancen für ein bewusstes Erleben der Welt.“ Robert Renzler
Bewirb dich vom 01.04. bis 06.09.2023


für das nächste




















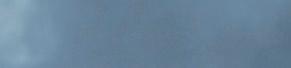





























80 Heiße Liebe, kaltes Herz
Die ganzjährige Sperrung der Badener Wand am Battert im Schwarzwald erhitzt die Gemüter. Andi Dick vom Kampf der feurigen Kletterer gegen die Eiskönigin der Naturschutzbehörde.
88 Brennpunkt: Kochen unter Extrembedingungen
Wer sich unter freiem Himmel abseits der Zivilisation sein Süppchen kochen möchte, braucht dazu die passsende Ausrüstung. Alexandra Schweikart stellt euch Kochsysteme für alle Situationen vor.
94 Wenn’s wärmer wird, sollten wir vielleicht die Taktik ändern
Das Verständnis der Prozesse rund um den Klimawandel in den Bergen hilft, Gefahren zu erkennen und Anpassungsstrategien zu finden, die letztendlich auch dazu führen sollten, eingeschlagene Wege zu verlassen und neue Ziele zu definieren, meint Autorin Christina Schwann.
104 Alles im blauen Bereich
Wer unter körperlicher Belastung bei Hitze nicht genug trinkt, riskiert Dehydrierung. Was dann mit dem Organismus passiert, versucht Franziska Haack zu klären.
112 Heiße Karten
Heatmaps auf Fitness-Tracking-Apps geben einen guten Eindruck darüber, welche Routen bei der großen Masse gerade angesagt sind. Dominik Prantl über die Gefahren und Chancen.
118 Überhitzt
Gebi Bendler war in El Chaltén und hat mit vier ausgewiesenen Patagonienkenner:innen über die Folgen des Klimawandels und wachsenden Tourismus in Patagonien gesprochen.
Auch in Patagonien macht sich der Gletscherrückgang stark bemerkbar. Wo vor wenigen Jahren noch komplett weiße Gletscherflächen zu sehen waren, kommt nackter Fels zum Vorschein. Der auftauende Permafrost führt zu vermehrtem Steinschlag. Zugänge wie zum Paso Marconi, um auf das Südliche Patagonische Eisfeld, das größte Gletschergebiet auf der Südhalbkugel außerhalb der Antarktis, zu gelangen, mussten inzwischen aufgrund massiven Eisschlags verlegt werden. Im Bild Tomas Odell und Pol Domenech am Gran Gendarme in der Pollone Gruppe. Links vom Gendarme im Hintergrund die Cordón Marconi und rechts vom Gendarme im Hintergrund die Cordón Gaea, im Vordergrund der Paso Marconi. Foto: Tad McCrea

Fadenscheinige, manipulative Argumentation, Ignoranz gegenüber konstruktiven Vorschlägen: Die ganzjährige Sperrung der Badener Wand am Battert im Schwarzwald erinnert fatal an ein dunkles Kapitel der deutschen Klettergeschichte – und könnte künftigem, ähnlichem Machtmissbrauch die Tore öffnen. Vom Kampf der feurigen Kletterer gegen die Eiskönigin der Naturschutzbehörde.
Von Andi Dick

Frühsommer 1982: Mit zehn Leuten aus der DAV-Jungmannschaft schleppen wir ein zentnerschweres Stromaggregat auf den Felskopf, seilen mit der 50-Meter-Kabeltrommel ab und bohren mit der schweren Hilti 25-Millimeter-Löcher für Bühlerhaken – endlich werden die großartigen Routen an der Badener Wand im Traditionsklettergebiet Battert saniert. Die Wand meiner ersten Schritte im Fels, immer wieder gut für einen ganz besonderen Erlebnistag in meiner Felsheimat.
Januar 2023: „Es tut weh, Haken abzuflexen, wenn man selber Kletterer ist“, lässt sich ein Vertikalarbeiter zitieren. Trotzdem haben sie’s getan: Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP KA), der obersten Naturschutzbehörde, entfernte die Firma der ehemaligen DAV-Kader-Kletterer Timo Preußler und Max Wörner alle Haken an der Badener Wand. Und sie demontierten die über hundert Jahre alten hölzernen „Felsenbrücken“, besonders charmante Aussichtspunkte für den Blick über die Kurstadt Baden-Baden auf Schwarzwald und Rheinebene. Diese destruktive Maßnahme, rigide und rasant durchgeboxt trotz laufender Beschwerden, ist ein trauriger Tiefpunkt nach einem heißen Kampf, in dem sich die Kletter-Vertreter einem übermächtigen und kalten Gegner gegenübersahen. Wie die Behörde Fakten manipulativ zurechtbog und wohlbegründete Argumente abschmetterte, erinnerte schmerzhaft an das dunkelste Kapitel des Mittelgebirgskletterns in Deutsch-
Das waren noch Zeiten: Eine halbjährige Sperrung des linken Wandteils der Badener Wand (links der bewachsenen Kante) reichte für den Bruterfolg des Wanderfalkens aus – die großartigen Routen des rechten Wandteils blieben ganzjährig bekletterbar. Nun ist die gesamte Wand gesperrt, die Haken abgeflext.
Foto: Andi Dick
land: Mit Schlagzeilen wie „Kletterer bohren die Felsen kaputt“ machte damals in den 1980-/90er-Jahren ein absolutistischer Naturschutz Front gegen den Natursport. Viele Felsen sind heute noch ohne nachvollziehbaren Grund gesperrt; noch mehr wären es, hätten sich die Kletterer nicht gewehrt. Nun ist die nächste Runde eingeläutet.

Für Bewohner seliger Inseln, die von Behördenwillkür und Kletterverboten weitgehend verschont sind, ein kurzer Blick auf deutsche Naturschutz-Gründlichkeit und deren Auswüchse in der Vergangenheit. Im Land von Wolfgang Güllich, Kurt Albert und Alex Megos gilt das „freie Betretungsrecht der Landschaft“ inklusive Sport als Grundrecht, das nur zugunsten höherer Rechtsgüter eingeschränkt werden darf. Also etwa aus Notwendigkeiten des Naturschutzes.

1981 wurde der Battert – Porphyrtürme umwuchert von hundertjährigen Baumriesen –zum Naturschutzgebiet. Würde nun das Klettern verboten? Mein Vater Georg Dick schaffte es damals, alle Interessengruppen – behördlichen wie privaten Naturschutz, Forst und Natursport – an einem runden Tisch auf Augenhöhe zu vereinen und im „Arbeitskreis Battert“ gute Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse von „Natur“ und „Sport“ verbanden. Zugangswege wurden befestigt und markiert, das für Pionierpflanzen wertvolle Schuttfeld unter der Badener Wand ganzjährig gesperrt, der linke Teil der Wand halbjährlich bis zum Ende bestehender Vogelbrutversuche. Das Modell Battert wurde beispielgebend für die bundesweiten „Arbeitskreise Klettern und Naturschutz“, die der Deutsche Alpenverein koordiniert.
Zentnerschweres Stromaggregat, 50-Meter-Kabeltrommel, kiloschwere Bohrmaschine für 25-Millimeter-Löcher: Das Setzen der Bühlerhaken an der Badener Wand 1982 war Schwerarbeit. Das Abflexen 2023 ging deutlich einfacher. Foto: Andi Dick
Andi Dick, Dipl.-Ing. (FH) für Umweltund Verfahrenstechnik und staatlich geprüfter Bergund Skiführer, hat 2022 einen Felsen im Frankenjura verlassen, weil sich dort ein Turmfalke nicht an sein Nest traute.
Heute umfasst die Sperrzone die gesamte Badener Wand; die Bohrhaken und die Felsenbrücken wurden entfernt. Die begrenzte Sperrung betraf den linken Wandteil ab der baumbewachsenen Schluchtrinne, der Brutplatz der Falken ist ganz links auf dem grasbewachsenen „Alpinen Band“. Foto: Jonas Heck, Freigabe: RP KA
Ein „kletterfreies Baden-Württemberg“ forderten damals übermotivierte Naturschützer, und dafür schreckten sie vor Verleumdungskampagnen nicht zurück, in denen Kletterer mit Steigeisen Falkennester zertraten. Der DAV ging damals in die Verhandlungen mit den Behörden mit ausgewogenen Kompromissvorschlägen – fair, aber naiv, denn der Naturschutz kam mit Maximalforderungen, und so lag das Ergebnis meist im Abseits. Behörden machen Druckausgleich, lernte man damals schmerzhaft. Gut, dass sich ab 1991 in den Regionen IGs (Interessengemeinschaften) Klettern bildeten, die voll fürs Klettern eintreten konnten –dadurch wurde der DAV, der ja auch Naturschutzverband ist, zum Kompromiss-Gestalter. Für ihr Engagement, das Klettern in den deutschen Mittelgebirgen naturverträglich zu organisieren, erhielten DAV und IG Klettern 2000 den Bayerischen Umweltpreis. Nicht überall leider waren sie so erfolgreich für Lösungen auf Augenhöhe und mit Menschenverstand wie etwa im Frankenjura –dort kommen heute die Hauptprobleme aus

dem Besucherandrang; viele sind „Vertriebene“ aus nördlicheren Regionen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa wurden die meisten Felsen gesperrt oder mit hanebüchenen Nutzungseinschränkungen überzogen. An den großartigen Bruchhauser Steinen steht heute noch ein Schild, das behauptet, am Beinahe-Aussterben der Wanderfalken sei das Klettern Schuld gewesen – wissenschaftliche Tatsache ist, dass das Insektengift DDT aus der Landwirtschaft über die Nahrungskette die Eierschalen brüchig machte.
In Schwaben machten die Kletterer mobil: 1993 bildeten rund 3000 Menschen eine 16 Kilometer lange „Seilschaftskette“ durchs sperrungsgebeutelte Donautal; bei einer Kundgebung und auch ein Jahr später in Stuttgart redete der prominente CDU-Politiker Heiner Geißler auf dem Podium. Mit dieser Hilfe, viel ehrenamtlichem Engagement und Unterstützung durch DAV-Landes- und Bundesverband besserte sich die Situation allmählich – heute arbeitet der DAV für ein „Kletterland Baden-Württemberg“.
Dann kam der Rückschlag: Die Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, seit 2019 Chefin der Naturschutzbehörde in Karlsruhe, plante die ganzjährige Vollsperrung der Badener Wand, eines 50 Meter hohen und fast 100 Meter breiten Massivs im Westen des Battert, wegen zurückgehender Bruterfolge der Wanderfalken und deren „abstrakter Gefährdung“ durch Menschen. Dieses Wort hatte man seit den Verleumdungskampagnen vor dreißig Jahren nicht mehr gehört; es findet sich auch nicht in den offiziellen Pressemitteilungen. Und wie vor dreißig Jahren gab es eine Demo: In BadenBaden redete Roland Stierle, einst im Donautal Mitorganisator des Widerstands, jetzt DAV-Präsident, gegen „pauschale Vollsperrungen ohne Beweise für die Ursachen mangelnder Bruterfolge“. Leider umsonst: Eiskalt vollstreckte die Regierungspräsidentin die Sperrung samt Zerstörung der Infrastruktur und trat das Ideal von kooperativem Naturschutz in die Tonne.
10 Jahre: ø = 1,0 FJV/a
6 Jahre: ø = 1,0 FJV/a
3 Jahre: ø = 1,0 FJV/a
anders gewählte Statistik-Ausschnitte
0 erfolgreiche Bruten in 2 Jahren ▸ 0
1 erfolgreiche Brut in 5 Jahren ▸ 0,6
4 erfolgreiche Bruten in 10 Jahren ▸ 1,0
3 2 1 0 2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0,7–0,8 flügge Jungvögel (FJV) pro Jahr sind für den Arterhalt nötig
wWie viel Schutz braucht der Wanderfalke? Fakten und Lehren
„Die armen, schönen Vögel – für sie wird man doch wohl Verzicht üben können!“, mögen Laien sagen, die die Pressemitteilungen des RP lesen. In ihnen wird sehr geschickt die Wanderfalken-Situation am Battert dramatisiert und als Scheitern des Schutzzwecks des Naturschutzgebietes dargestellt. Wer jeden einzelnen Vogel als Heiligtum betrachtet, kann das so sehen. Man könnte aber auch eine neutrale Perspektive einnehmen, die eine faktenbasierte Abwägung für einen sinnvollen Natur- (und nicht nur Falken-) Schutz im dicht besiedelten Industrieland Baden-Württemberg anstrebt.
Dann ließe sich zuerst einmal feststellen: Im Gegensatz zu „43 % der 259 regelmäßig in Deutschland brütenden heimischen Vogelarten“
(Quelle: Naturschutzbund Deutschland) steht der Wanderfalke nicht auf der
Roten Liste der bedrohten Arten von 2021, seine (auch am Battert präsenten) Revierkonkurrenten Uhu und Kolkrabe auch nicht. Im Bundesland Hessen wurden 2022 Wanderfalke und Uhu explizit aus einer Vogelschutzverordnung herausgenommen (die auch Kletterfelsen bedroht hätte), weil die Bestände als gesichert gelten.
Lehre 1: Falken brauchen keinen verstärkten Schutz; Rücksicht und Verzicht bei Brutversuchen sind trotzdem aus Respekt selbstverständlich.
neuerdings vermehrt auch Strommaste“ ausweichen müssten; ein Rückfall in die Rote Liste scheint da in weiter Ferne. Das RP aber schreibt in seinen Pressemitteilungen zuletzt nur noch von „einer erfolgreichen Brut in den letzten fünf Jahren“ – und lässt dabei die Corona-Outdoorwelle genauso außer Acht wie die Tatsache, dass diese eine Brut drei Jungvögel umfasste und im sechsten Jahr auch drei Vögel durchkamen … Lehre 2: Auch am Battert belegen die Zahlen keine dringende Notwendigkeit für verstärkte Schutzmaßnahmen.
Aussagen Regierungspräsidium 1
Als Maß für den Arterhalt nennt das RP ein einziges Mal den Wert von 0,7 flüggen Jungvögeln pro Brutpaar und Jahr. In den letzten zehn Jahren lag diese Zahl in der Region durchschnittlich bei 1,2, im Regierungsbezirk bei 1,5 und im Bundesland bei 1,3 – und am Battert bei 1,0. Ausreichend also, bis hin zum Doppelten des Gewünschten. Sogar die „Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz“ (AGW) schreibt, dass Falken schon auf „sekundäre Standorte wie Gebäude oder
2 3
Besonders interessant ist die Argumentation des RP, dass der Bruterfolg am Battert „unterdurchschnittlich“ sei. Folgt man solcher Logik, findet man nach jedem SperrungsErfolg ein neues Statistik-Schlusslicht, so dass ein Felsen nach dem anderen dichtgemacht werden muss.
Der Wanderfalke war 1971 der erste „Vogel des Jahres“ in Deutschland. Nach Verbot des Insektengiftes DDT erholten sich die Bestände, heute gilt die Art als stabil und steht nicht mehr auf der Roten Liste. Während der Brutzeiten haben sich in deutschen Klettergebieten räumlich und zeitlich (bis Ende des Brutversuchs) befristete Kletterverbote jahrzehntelang bewährt.

Foto: Wikipedia/Georges Lignier
Die Reproduktionszahlen liegen zwar noch deutlich über dem Notwendigen, aber sie gehen tatsächlich zurück. Woran das liegt, wäre natürlich interessant zu wissen, um angemessene Maßnahmen zu setzen. Der Brutplatz liegt auf dem „Alpinen Band“, das aus der benachbarten Schutthalde für klettergewandte Nesträuber wie Marder leicht zu erreichen ist und bei Starkregen von Überschwemmung bedroht wird, der Konkurrent Kolkrabe ist am Battert seit Jahren unterwegs. Uhus lieben Falkeneier und -küken; der ortsansässige Bergführer Thomas Stephan hat in den letzten Jahren regelmäßig Uhus am Battert gesehen und gehört und weist darauf hin, dass bei den zuletzt gescheiterten Bruten die Jungen aus dem Nest verschwunden seien – das spricht für einen Fressfeind, denn wenn sie in Folge menschlicher Störung verhungert oder verdurstet wären, hätten Überreste zu sehen sein müssen. Statt eines Monitorings aber bezahlte das RP (es bezeichnet den Brutplatz sukzessive als „eigentlich günstig“, „ideal geeignet“ und zuletzt als „optimal“) die Stellungnahme eines Vogelkundlers, der denn auch attestierte, dass die „wahrscheinlichste Ursache für den niedrigen Bruterfolg die Störung durch Freizeitnutzung ist“. Eine wissenschaftlich nachvollziehbare Beweiskette sucht man in seiner Darstellung vergeblich, und die Sperrungsverfügung ist ähnlich überzeugend begründet: „Daraus, dass das Wanderfalkenpaar … Störungen [durch Klettern, Sport und Freizeit] … ausgesetzt ist,
lässt sich schließen, dass diese Faktoren auch tatsächlich die ausschlaggebenden für den schlechten Bruterfolg … sind.“
Lehre 4: Solche „Wissenschaft“ ist ungefähr ähnlich ernst zu nehmen wie die Aussage: „Dadurch, dass die Zahl der Störche abnimmt, lässt sich schließen, dass dies ursächlich für den Geburtenrückgang bei Menschen ist.“ Gleichzeitigkeit ist nicht Ursächlichkeit.
Um neben der Gefährdung durch Fressfeinde und Unwetter zumindest menschliche Störungen auszuschließen, haben sich bundesweit jahrzehntelang an Kletterfelsen räumlich und zeitlich befristete Sperrungen bewährt: vom 1. Januar bis Ende Juni oder Juli oder bis zum (erfolgreichen oder erfolglosen) Ende des Brutversuchs. An der Zeller Wand im Chiemgau brütet seit Jahren erfolgreich ein Falke in der zweiten Seillänge einer Route –zur Beruhigung reicht es ihm, dass die zwölf benachbarten Routen oben gesperrt werden; die ersten Seillängen darf man sogar klettern. Für den Battert schlugen die DAV-Vertreter vor, die zeitliche Sperrung auf die gesamte Wand auszudehnen – „wir wurden nicht ernsthaft gehört“, klagt Präsident Stierle. Stattdessen werden (schlecht bis gar nicht dokumentierte) Verstöße gegen die Sperrungen als Grund genommen, dass nur ein kompletter Infrastruktur-Abbau ausreichenden Schutz auch während der Brutzeit bringe. Lehre 5: Wer als Werkzeug nur eine Holzkeule kennt, kann nur draufhauen.
Nur mit einer extremen Offen-Ohrigkeit des RP für die Einflüsterungen der AG Wanderfalken erklärbar ist, dass in der Sperrungsverfügung eine Fluchtdistanz des Wanderfalken von 200 Meter genannt ist – weit über den wissenschaftlich belegten Erfahrungswerten. Dazu kommt ein ganz spezielles Argument: Die „Störanfälligkeit …[ist] ganzjährig vorhanden und darüber hinaus von der Persönlichkeit der Individuen abhängig“. Kann es Ziel eines gesellschaftstauglichen Naturschutzes sein, die „natürliche Zuchtwahl“ (Darwin) hin zu störungsresilienten Individuen zu sabotieren? Immerhin gibt es in der Region viele künstlich angelegte Brutstätten mit optimalen Schutzbedingungen, wo empfindlichere Falkenseelen es im nächsten Jahr probieren könnten … „Wanderfalken über alles“ scheint die Parole der AGW zu sein: Als wir bei einem Spaziergang am Battert zwei AGW-Ehrenamtliche treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen, sagt die Frau: „Am liebsten wäre mir, der gesamte Battert würde für alle Menschen gesperrt – man muss auch Verzicht üben können für die Natur.“ Und es sei ja kaum ein Prozent der Stadtfläche, die da gesperrt würde. Noch weniger Anteil hat der Rasen der Allianz-Arena an der Fläche von München … Kurz und schlecht: Kaltschnäuzig lässt das Regierungspräsidium sämtliche konstruktiven Vorschläge an sich abprallen; auch den,

die ersten zwei, drei Haken der Kletterrouten während der Sperrfrist durch Verschraubungen unbenutzbar zu machen, um so illegales Klettern zu verhindern. In der Sperrungsverordnung wird den Kletterern krimineller Vorsatz unterstellt: „Die Verschraubungen sind mit Werkzeug leicht zu öffnen.“ (hat ja jeder im Rucksack …) Die Methode sei – ähnlich wie die ebenfalls angebotene Unterstützung bei der Horstbewachung –nicht „gleich geeignet“ wie die komplette Demontage von Haken und Felsenbrücke. Warum eine ausreichende Maßnahme, wenn man auch maximal dreinhauen kann? Mit der gleichen Logik könnte man eine Straße umpflügen, wenn das Tempolimit nicht beachtet wird (nur ist die Auto-Lobby stärker als die der Kletterer).
Die Demontage ist nun vollstreckt, wer trotzdem klettert oder auf den Felskopf steigt, wird mit einem Bußgeld bis 50.000 Euro bedroht, die Regierungspräsidentin feiert sich selbst: „Hier wird Artenschutz konkret!“ Und ein sportliches Ziel wird beerdigt: „Das Todesurteil des Kletterns an der Badener Wand“ sieht Ralf Dujmovits in dem Vorgehen. Der Bühler Achttausendermann lernte das Klettern am Battert und nennt die „Vorschlaghammer-Politik des Regierungspräsidiums … völlig unangemessen, unsensibel und bürgerfeindlich“.
Wer die Pressemitteilungen und die Sperrungsverfügung liest, wo es von Formulierungen wie „wahrscheinlich“, „ist geeignet“
Das Ende eines schönen Aussichtspunktes mit Historie. Schilder, die auf die Sperrung des Felskopfes hinweisen würden, suchte man Anfang März vergeblich. Foto: Andi Dick
Der Spalt, über den die erste Felsenbrücke zum Felskopf der Badener Wand und zur dortigen zweiten Felsenbrücke führte; beide sind nur noch ein Stapel Altholz, ihre Wiederrichtung mehr als fraglich. Foto: Andi Dick

Wie auch bei der Donautal-Demo redete 1994 bei den „Aktionstagen" in Stuttgart der populäre Politiker Heiner Geißler für naturverträgliches Klettern und gegen überzogene Sperrungen.

Foto:s Andi Dick
und „kann nicht ausgeschlossen werden“ wimmelt, fühlt sich schmerzhaft an das Atombomben-Schlagwort von der „abstrakten Gefährdung“ der Natur durch den Menschen aus den 1990er-Zeiten erinnert – im Zweifel gegen den Angeklagten.
wWar das schon alles?
Das Zerstörungswerk des RP wurde knallhart, rücksichtslos und effizient durchgeführt, die begleitenden Maßnahmen mit deutlich weniger Energie. Bei einer Begehung Anfang März war Information über die neue Sperrungssituation nur auf einem Schild unter der Badener Wand zu finden; wer vorher einen Weg nach links nimmt, konnte über das Schuttfeld den Wandfuß erreichen, ohne gewarnt worden zu sein. Und wo früher die erste Felsenbrücke auf den Felskopf führte, lag jetzt nur ein Haufen Altholz – aber kein Schild wies darauf hin, dass die Exploration der „freien Landschaft“ hier eingeschränkt ist. Immerhin: Die Pressestelle – professionell und freundlich – teilt mit, die Beschilderung werde noch optimiert. Das geschah dann durch
Vollsperrung dieser beiden Wanderwege bei der Badener Wand – mit dem Argument, dass im „Bannwald“ zu große Gefahr durch abbrechende Äste bestehe. Wie gut das nun endlich zugesagte Brut-Monitoring aufgesetzt ist, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen; der Bergführer Thomas Stephan äußert Zweifel, dass der Brutplatz von den mittlerweile installierten Kameras ständig erfasst wird. Man kann nur hoffen auf professionelles Vorgehen – und dass sich das unfreiwillige Opfer der Kletterer und Wanderer wenigstens in steigenden Bruterfolgen auszahlt.
Leider ist fraglich, ob das Ergebnis überhaupt eine Rolle spielt: Die Allgemeinverfügung zur Totalsperrung sollte laut RP nur probeweise für fünf Jahre gelten: „Die „Badener Wand“… wird … – zunächst für die nächsten fünf Jahre – zum Klettern gesperrt werden.“ Im rechtlich verbindlichen Text findet sich aber keine solche Befristung: „Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung [12.12.2022] in Kraft.“ Formfehler oder Vorsatz? Wenn man so genasführt wird, fällt es schwer, Reste von Vertrauen aufrechtzuerhalten. Man steckt ohnehin im „Hexentest“ – so wie einst der Hexerei beschuldigte Frauen gefesselt ins
Wasser geworfen wurden: Trieben sie oben, war bewiesen, dass sie mit dem Teufel im Bund steckten; gingen sie unter, war das Problem auch gelöst. Ähnlich geht es den Kletterern: Verbessert sich der Bruterfolg, war die Sperrung offensichtlich wirksam und muss dann wohl beibehalten werden; bleibt er schlecht, war sie womöglich noch nicht einmal ausreichend. Kann es Zufall sein, dass in der Sperrungsverfügung mit der Holzkeule gewunken wird? „Die bisherige und künftige Nutzung der Battertfelsen zum Klettern in einem zum Schutz der Felsen mit ihren Habitaten ausgewiesenen Naturschutzgebiet ist bereits eine besondere Privilegierung und Anerkennung dieses Natursports.“ Heißt das etwa „wir können auch anders, wenn ihr nicht kuscht“?
Mit über 50 Jahren Klettern am Battert im Herzen fällt es mir als Autor schwer, journalistische Neutralität zu wahren; der Schmerz über prinzipienreitende Machtausübung lässt mich zum Zynismus greifen. Es tut auch weh, lesen zu müssen von ignoranten Vollidioten, die das Tor an der Badener Wand während der Sperrzeit aufbrachen – so, wie mir jeder rücksichtslose Umgang mit der Natur wehtut. Aber weit über 99 % der Kletterer achten auf die Natur und sind bereit zu Verzicht und Rücksicht, wo nötig und wie sinnvoll. Natürlich gönnt man jedem Tier (außer dem Wiener Schnitzel) seine Lebenschancen; ich habe auch schon ein Projekt aufgegeben, als sich ein Vogel im Griffloch einnistete (und es war kein Falke). Aber das Wesen der Natur ist, dass jedes Individuum irgendwann sterben muss – wer fordert, hinzunehmen, dass Bruten mal erfolgreich sind und mal nicht (natürlich bei befristeten Kletterverboten), ist noch lange kein Falkenfeind. Das Schicksal der Welt wird nicht an der Badener Wand entschieden. Sie geht nicht zugrunde, selbst wenn der Falke nur in anderen Revieren überleben würde. Und der Klettersport ist nicht am Ende, wenn die Badener Wand nicht wieder geöffnet wird. Trotzdem fühlen viele Kletterer derzeit kalte Trauer über den Verlust und heiße Wut angesichts der behördlichen Kaltstirnigkeit. Sie könnten sich fragen, ob sie opferbereiter hätten sein sollen, beispielsweise schon frühzeitiger eine flächige Sperrung der Wand
während der Brutzeit hätten anbieten sollen? Oder ob sie eher zu weich waren? Das Beispiel Hessen zeigt, dass man die Absolutheit des Wanderfalkenschutzes erfolgreich in Frage stellen kann. Letztlich kommt es wohl eher darauf an, wem man in Gesprächen gegenübersitzt: Ob die Behörden ihrem demokratischen Auftrag zum Interessenausgleich nachkommen und mehr Seiten hören (und ernst nehmen) als nur eine Gruppe, die nur für eine einzige Tierart spricht. Wie sagt der DAV-Präsident Roland Stierle? „Ich bin der Ansicht, dass fachlich starke Ministerien oder Behörden auf Vollsperrungen verzichten können, so wie dies in anderen Bundesländern praktiziert wird.“ Stattdessen sieht er in dieser „Abkehr von der allgemein akzeptierten, fundierten und funktionierenden Regelung … [einen] Blick in einen bodenlosen Abgrund“.

Die Fakten sind geschaffen; für die Kletterer geht es nun um die Zukunft. Über 200 Menschen haben über eine Crowdfunding-Plattform die Kletterer-Initiative „100 % Battert“ (battert100.de) unterstützt, die juristisch gegen die Sperrungsverfügung vorgehen will. DAV-Landes- wie Bundesverband engagieren sich, sogar das Wort „Klage“ ist zu hören. „Damit dürfen sie nicht durchkom-
Vögel sind nicht blöd und erkennen, dass Kletterer keine Gefahr für sie sind. In diesem Kolkrabennest unter der für Wanderer zugänglichen Falkenwand wuchsen etliche Jungvögel heran. Mittlerweile brütet der Rabe allerdings im Wald und nutzt den Battert nur als Flugund Jagdrevier – er ist ein Konkurrent des Wanderfalken. Foto: Andi Dick
men!“ könnte ihr Motto sein – denn was der Badener Wand passiert, kann künftig jedem Kletterfelsen passieren, wenn solches „Recht“ erfolgreich durchgepeitscht wird. Die Causa Battert ist kein Einzelfall. Sie ist mehr als ein Präzedenzfall, sie ist ein Testfall – für die Widerstandskraft der Kletter-Community. Hier können die alte und die junge Generation gemeinsam beweisen, dass Klettern für sie mehr ist als ein Fitnesssport in der Halle, dass Felsen Heimat sein können und wie viel Energie sie für diese Quelle von Freude investieren wollen. Und selbst wenn die Badener Wand dauerhaft unzugänglich bleiben sollte, können Kletterinnen und Kletterer an sämtlichen anderen Felsen beweisen, dass mit gutem Willen von allen Seiten und mit ausgewogenen Regelungen ein gutes Miteinander von Klettern und Naturschutz möglich ist. ■
Ohne Mampf kein Dampf! Das gilt besonders beim Bergsteigen und Klettern. Wer sich unter freiem Himmel abseits der Zivilisation sein Süppchen

kochen möchte, braucht dazu die passsende Ausrüstung. Wir stellen euch Kochsysteme für alle Situationen vor.
Von Alexandra SchweikartEine winzige Biwakhöhle, ein Portaledge in einer Bigwall, ein Camp auf dem Gletscher in extremer Höhe. Diese Situationen stellen Sportler:innen vor große Herausforderungen, auch beim Kochen. Hierbei sollte ein Kocher möglichst unkompliziert funktionieren und uns nicht beim leichtesten Windstoß hungrig zurücklassen.
Brennstoffe
Die meisten Outdoor-Kocher funktionieren mit Gas oder Benzin. Handelsübliche Schraubkartuschen enthalten eine Mischung aus Butan, Isopropan und Propan, die unter Druck verflüssigt wurden. Gas ist einfach in der Handhabung, verbrennt sauber und sparsam und muss nicht vorgeheizt werden. Bis etwa -15 °C funktionieren diese Gaskartuschen problemlos. Bei tieferen Temperaturen nimmt der Druck in der Kartusche ab, das flüssige Gas verdampft schlechter und kann nicht mehr aus der Kartusche als verbrennbares Gas austreten. Bei Kochern mit externer Zuleitung (bei denen der Kocher neben der Kartusche steht) kann man die Kartusche auf den Kopf drehen. Warmhalten der Kartusche im Schlafsack hilft außerdem. Es gibt auch noch spezielles „Wintergas“, bestehend aus Propan und Isobutan, das bei niedrigeren Temperaturen (ab etwa -5 °C) besser funktioniert als handelsübliches Gas. Auf Expeditionen und beim Bigwallen setzen sich mehr und mehr Systemkocher durch, bei denen Kartusche, Kocher und Topf eine Einheit bilden, die sehr gut windgeschützt ist. Das spart Gas und Zeit beim Kochen oder Schneeschmelzen. Diese Kocher werden auch bei tiefen Temperatu-

Fabian Buhl und Jeff Shapiro beim Biwakieren im Mont-Blanc-Gebiet. Im Einsatz ein Systemkocher. Foto: Stefan Schlumpf
ren eingesetzt und in großen Höhen. Abzuraten ist von wiederbefüllten Schraubkartuschen, die in manchen Expeditionsländern angeboten werden. Ausgelaufene Gaskartuschen haben schon so manchen Gipfeltraum platzen lassen. Wenn man dauerhaft niedrigere Temperaturen erwartet, kann man auf einen Benzinkocher setzen. Benzin brennt unabhängig von der Außentemperatur und hat einen hohen Brennwert. Im Gegensatz zu Schraubkartuschen ist Benzin weltweit verfügbar. Am saubersten verbrennt Reinbenzin (englisch „White Spirit“), das man in Supermärkten und Outdoorläden bekommt. Benzin aus der Zapfsäule enthält Schmierstoffe und andere Zusätze, die den Kocher verunreinigen: Man muss den Kocher dann regelmäßig reinigen. Das flüssige Benzin muss in einer Flasche mit einem Pumpsystem unter Druck gesetzt werden, der Brenner selbst muss vorgeheizt werden. Die Gefahr einer Stichflamme beim Anzünden des Kochers sollte nicht unterschätzt werden. Benzin stinkt und rußt auch manchmal, ab und an muss man einen schwarzen Topf reinigen. Nichtsdestotrotz punktet Benzin in den arktischen Regionen und auf längeren Reisen mit mehreren Personen, da der Brennstoff günstig ist und bei tiefen Temperaturen verbrennt. Weitere Brennstoffe wie Esbit, Spiritus oder Holz sind bei extremen Unternehmungen nicht zu empfehlen, da der Brennwert zu gering ist. Kerosin verbietet sich wegen der starken Verschmutzung von selber.
Kochen im Zelt
Ganz generell muss vom Kochen im Zelt abgeraten werden. Eine offene Flamme birgt immer ein Brandrisiko. Das Zelt besteht aus Plastik, Funktionsbekleidung ebenso. Plastik brennt und schmilzt innerhalb von Sekun-
Bei feuchten Bedingungen hilft immer ein Zündstahl. Foto Primus
den! Die Verbrennung von Gas oder Benzin verbraucht außerdem Sauerstoff, den wir zur lebensnotwendigen Atmung brauchen. Über tödliche Kohlenmonoxidvergiftungen berichtete bereits Franziska Haack in bergundsteigen, Ausgabe #116: „Erstickt im Zelt: Was ist passiert?“ Wer kurz vor dem Verdursten im Schneesturm trotzdem im Zelt sitzend Schnee schmelzen möchte, sollte dies im belüfteten Vorzelt machen oder mit einem aufgehängten Systemkocher bei zusätzlicher Belüftung des Hauptzeltes.
Kochen auf Expedition Expeditionen nach Argentinien, Nepal oder in Polregionen stellen kochtechnisch besondere Herausforderungen dar. Große Höhen,
tiefe Temperaturen und schwierige Logistik sind hier die Hauptgegner. Erst einmal gilt es, an den passenden Brennstoff zu kommen. Schraubkartuschen findet man auch in Expeditionsländern im Fachhandel, sie sind jedoch teuer. Organisierte Expeditionen haben mittlerweile Lager in Städten wie Kathmandu, in denen die passende Ausrüstung einfach abgeholt wird. Winterbesteigungen wären ohne speziell angefertigte Kochausrüstung wie Gaskartuschen mit speziellen Wänden kaum möglich. Gaskartuschen nehmen ein großes Volumen im Rucksack ein, selbst wenn sie leer sind. Aktuelle Systemkocher mit integriertem Windschutz sind hier die gassparende Variante. Bei Kälte setzen viele Expeditionen immer
noch auf Benzin, da Benzin ein besseres Volumen-zu-Brennwert-Verhältnis hat als Gas. Der Bedarf an Benzin lässt sich leicht errechnen. So benötigt man für fünf Liter kochendes Wasser bei kalten Temperaturen (ein Liter Frühstück, drei Liter Trinkwasser schmelzen, ein Liter Abendessen) etwa 250 Milliliter Benzin. Kocht man sparsam mit Windschutz und Wärmetauschtopf reichen 10 Prozent weniger, als Backup rechnet man 10 Prozent mehr.
Auf www.winterfjell.de gibt es einen Rechner, mit dem man sich seine Benzinmengen ausrechnen kann. Benzinkocher sind allerdings wartungsintensiv und man muss unbedingt alles zur Reparatur und zum Reinigen des Kochers mitnehmen.
Lukas Furtenbach, Expeditionsveranstalter Furtenbach Adventures: Auf unseren Expeditionen kommen unterschiedliche Kochersysteme zum Einsatz, je nach Gebiet, Berg und logistischen Möglichkeiten. Am Denali und in der Antarktis beispielsweise verwenden wir Benzinkocher mit reinem „White Gas“ als Brennstoff – vor allem wegen der Brennstofflogistik. Es wäre nicht möglich, Gaskartuschen in so großer Anzahl zu transportieren und zudem können sie in die Antarktis nur als Gefahrengut geflogen werden, was einen enormen logistischen Aufwand bedeutet. Nicht zuletzt würden die leeren Gaskartuschen auch eine erhebliche Abfallproblematik nach sich ziehen, da ja selbstverständlich alles wieder abtransportiert wird. Kochen im Zelt ist mit Benzinkochern wegen der Stichflammengefahr eigentlich auszuschließen. Außerdem brennen sie nicht immer sauber, können rußen und Schadstoffe freisetzen. Bei den hohen Bergen im Himalaya und Karakorum verwenden wir für die Hochlager ausschließlich kleine, leichte und hocheffieziente Gaskocher des koreanische Herstellers Soto mit „Primus Powergas“-Kartuschen, die ein speziell für Kälte und Sauerstoffarmut optimiertes Gasgemisch aus Butan, Isobutan und Propan enhalten. Sie sind für den Einsatz in großer Höhe und in Hochlagern die effizienteste, sauberste und sicherste Möglichkeit, Schnee zu schmelzen und zu kochen. Wichtig ist immer die Sicherheit, insbesondere die Belüftung beim Kochen in den Apsiden des Zeltes. Dies gilt vor allem für den seltenen Fall, wenn wegen eines Sturms im Zelt gekocht werden muss. In den Basislagern kommen meist große Kerosinkocher zum Einsatz.

Welcher Kocher passt zu dir?
Systemkocher. Du spülst nicht gerne ab, damit deine Hornhaut durchhält in der Bigwall. Dein Traumberuf wäre Astronaut gewesen. Du lebst gerne von Instant-Kaffee, Tee und Tütennahrung. Im Hochlager schaust du gerne dem Schnee beim Schmelzen zu, während dein Kocher an einer Hängevorrichtung baumelt. Dein Kocher ist der Systemkocher. Er hat durch seine Verbindung von Gaskartusche mit aufgeschraubtem
Kocher und Topf den Windschutz integriert: Das spart enorm viel Gas. Das muss auch so sein, denn das hohe Gewicht des Kochers wird dadurch kompensiert, dass man weniger Gaskartuschen schleppen muss.
Systemkocher kann man nur auf ebenem Untergrund abstellen, durch den schmalen, fix aufgeschraubten Topf haben sie einen hohen Schwerpunkt. Im unwegsamen Biwak oder im Portaledge kann dieser Kocher auch mitsamt Topf aufgehängt werden. Theoretisch kann man in dem Topf auch andere Dinge außer Wasser kochen, in der Praxis hat man jedoch meist nicht genug Wasser dabei, um den Topf zu spülen, und nutzt ihn daher lieber als gassparenden Wasserkocher.
Primus Lite+, 402 g, 150 € y
MSR Reactor, 360 g, 292–325 €, y je nach Gefäßgröße

Jetboil Flash Carbon, 371 g, 160 € y
Aufsetzkocher. Du bist gerne mehrere Tage unterwegs mit Rucksack, Zelt oder Fahrrad. Morgens stellst du eine Mokkakanne auf und abends bist du kulinarisch genügsam: Nudeln mit Soße, die in einen kleinen Topf passen, sind dir gerade recht. Multitasking liegt dir nicht, am liebsten sitzt du neben deinem Kocher und hältst den Topf fest, damit das Essen nicht umkippt. Dann ist ein kleiner Aufsetzkocher genau das Richtige. Er wiegt oft unter 100 Gramm, ist handlich und klein. Allerdings sind diese Kocher windanfällig: Mit einer hohen, stabilen Folie aus Alu lässt sich ein Windschutz bauen, vor allem wenn man kleine Gaskartuschen verwendet. Mit einem kleinen Topf, in den idealerweise die Kartusche verpackt werden kann, einer nicht zu großen Pfanne und einer Kaffeekanne hast du hier alles, was es zum Biwakieren braucht.
Primus Fire Stick Stove, 83 g, 121 € y Optimus Crux, 85 g, 60 € y MSR Pocket Rocket, 75 g, 60 € y
Gaskocher mit Zuleitung. Werte wie Stabilität und Ruhe sind dir wichtiger als leichtes Gewicht. Du suchst einen Kocher fürs Leben, mit dem du deine Zeit auf dem Campingplatz genauso genießen kannst wie eine längere Reise oder ein alpines Biwak. Nicht zu teuer, nicht zu schwer, du magst die goldene Mitte. Gaskocher mit externer Zuleitung stehen dank ihres niedrigen Schwerpunktes stabil auf dem Boden neben der Gaskartusche. Auch größere Pfannen und Töpfe können hier wackelfrei stehen. Zusätzlich kann man den Brenner vor Wind schützen mit einem faltbaren Alublech. Kocher dieser Kategorie wiegen um die 200 Gramm.
Primus Express Spider II, 200 g, 80 € y

MSR Wind Pro II, 185 g, 115 € y
Soto Fusion Trek, 182 g, 116 € y
Gaskocher mit Zuleitung
Primus Express Spider II

Systemkocher
MSR Reactor mit 1-Liter-Topf
Aufsetzkochker
Primus Fire Stick Stove
Benzinkocher und Multi-Fuel-Kocher Gerne kochst du mehrere Gänge, dein Kochgeschirr kann nicht groß genug sein. Du redest nicht gerne beim Kochen, dir kommt die Lautstärke dieser Kocher gerade recht. Außerdem liebst du den Geruch von Benzin, das dir beim Umfüllen in die Brennstoffflasche über die Finger tröpfelt. Pumpen für den Druck in der Flasche ist für dich will-


kommenes Unterarmtraining. Als routinierte:r Heimwerker:in hast du Nadeln, Zangen und Bürsten zur Reinigung des Kochers und der Düse sowieso dabei. MultiFuel-Kocher sind in der Lage, verschiedene Brennstoffe zu verheizen, wobei man bei manchen Brennern dafür die Düse wechseln muss. Da sie alle neben der Brennstoffflasche stehen, sind sie stabil und können mit einem Alublech oder Ähnlichem vor Wind geschützt werden. Benzin brennt unabhängig von Höhe und Temperatur, der Brenner muss jedoch vorgeheizt werden.
Soto Stormbreaker, 448 g, 230 €, Gas, y Benzin

Optimus Polaris, 475 g, 240 €, Gas, Benzin y MSR Whisperlite International V2, 310 g, y 175 €, alle Brennstoffe
Multifuelkocher SOTO Stormbreaker
Primus Omnifuel, 450 g, 189 €, y alle Brennstoffe
Bigwall-Alltag. Tütennahrung und kaum Platz Foto: Alexandra Schweikart
Obwohl Kartuschen „Gas“-Kartuschen heißen, beinhalten sie einen flüssigen und einen gasförmigen Anteil. Sie stehen unter Druck, man hört die flüssige Phase beim Schütteln. Bei Standard-Gasmischungen (z. B. Propan/Butan/Isobutan) ist die Gasphase reicher am niedrigsiedenden Bestandteil Propan (C3H8, Siedepunkt -42 °C). Betreibt man nun den Brenner, entnimmt man Gas aus der Gasphase. Dadurch reichert sich der höhersiedende Bestandteil Butan C4H10 (Siedepunkt -1 °C) in der Flüssigphase immer weiter an. Bei kälterer Umgebung ist diese Anreicherung noch stärker und sie bewirkt eine Abnahme des Gasdrucks in der Kartusche, was zu weniger Leistung am Gasbrenner führt. Ist der letzte Rest Flüssigkeit verschwunden, verbrennt nur noch das restliche Gas, danach herrscht in der Kartusche der Umgebungsdruck. Ist es zu kalt, verbleibt das Butan einfach in der flüssigen Phase und verbrennt nicht mehr. Sogenanntes Wintergas hat oft einen höheren Anteil an Propan kombiniert mit Isobutan (Siedepunkt -11,7 °C). Der Druck in diesen Kartuschen ist höher, üblicherweise bekommt man reines Propangas aber nur in stärkerwandigen Gasflaschen. Reines Propan hat auch einen höheren Brennwert als Gasmischungen, noch höhere Werte haben Benzin und Petroleum. Allerdings benutzen Expeditionen mittlerweile auch in großen Höhen noch Gas-Systemkocher und nehmen den Verbleib von Rest-Flüssiggas in der Kartusche lieber in Kauf als einen Benzinkocher mitzunehmen. ■

ist Ökologin und war mehrere
Inzwischen leitet sie die Firm a „ökoalpin“, die sich mit Re gionalentwicklung beschäftigt.
Meldungen über Fels- und Bergsturzereignisse, über geschlossene Hütten, gesperrte Wege, nicht mehr gangbare Anstiege und steiler und damit schwieriger werdende Touren in den Bergen scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Dass der Klimawandel dabei eine zentrale Rolle spielt, ist unbestritten, auch wenn Natur immer in Bewegung ist. Das Verständnis über tatsächliche Prozesse und Zusammenhänge hilft, Gefahren zu erkennen und adäquate Anpassungsstrategien zu finden, die letztendlich auch dazu führen sollten, eingeschlagene Wege zu verlassen und neue Ziele zu definieren.
 Von Christina Schwann
Von Christina Schwann

Eines der größten Abenteuer von Caroline North.
100 Tage auf stürmischer See auf dem Weg nach Grönland anstelle von 3 Stunden bequemen Flugzeug.
Alpine Gefahren wie Steinschlag, Lawinen, Muren und Hochwasser sind nichts Neues. Schon im Buch „Die Gefahren der Alpen“ aus dem Jahr 1908 gehen Emil Zsigmondy und Wilhelm Paulcke detailliert auf die Gefahren durch Steinschlag und Lawinen ein. Ganze Kapitel widmen sie den Gesteinsarten, dem Gebirgsaufbau, der Bergform und der Verwitterung. Genauso wie im „Gefahrenbuch des Bergsteigers und Skiläufers“ von Wilhelm Paulke aus dem Jahr 1942. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf dem „Erkennen von Steinschlaggelände“ und der Anwendung entsprechender Taktik.
Wer die Ausbildung zum Bergführer machte, musste sich durch das „Lehrbuch für Bergführer“ des damaligen D.u.Oe. Alpenvereins aus dem Jahr 1930 arbeiten. Die Anwärter erhielten zusätzlich zu den heute bekannten Schwerpunkten eine fundierte Ausbildung in Erdund Naturkunde sowie den Gebirgsgruppen.
Eine besonders unberechenbare Gefahr nicht nur für den Bergsteiger, sondern für ganze Täler stellen um 1885 die Gletscher dar. Im Büchlein „Alpingeschichte kurz und bündig – Bergsteigerdorf Vent“ hat Autor Hannes Schlosser die Ortschroniken durchforstet und fasst zusammen: „Ab Oktober 1844 rückte die Zunge des Vernagtferners den ganzen Winter über kontinuierlich vor und erreichte am 1. Juni 1845 die Rofenache. Während der folgenden zwei Wochen waren es zwölf Meter täglich, bisweilen zwei Meter in der Stunde – die Bewegung des Gletschers war mit freiem Auge erkennbar! Am 14. Juni entleerte sich der riesige aufgestaute See innerhalb einer Stunde. Von den 21 Brücken bis ins rund 40 km entfernte Umhausen im mittleren Ötztal blieben nur drei stehen. Die Schadenssumme machte 400.000 Gulden aus.(…) Danach (Anm. nach 1847) stauten die Eismassen erneut einen riesigen See auf (…). Am 13. Juni 1848 brach der Damm und die Flutwelle erreichte Innsbruck in neun Stunden (…). Die letzten Eisreste in der Rofenschlucht waren erst 35 Jahre später geschmolzen.“
In den letzten 150 Jahren haben wir die Berge „erobert“ und glauben, sie zumindest teilweise gezähmt zu haben. Dort, wo der Schutzwald nicht ausreicht oder nicht vorhanden ist, schützen wir unsere Infrastrukturen durch Steinschlagnetze, Lawinenverbauungen, Galerien, Tunnels und aufwändige Wildbachverbauungen. Durch das Gebirge zieht sich ein Netz an Wegen und Hütten, Almen, Materialseilbahnen, Klettersteigen, Aussichtsplattformen und Thementafeln, für den Wintersport wurden ganze Gebirgsgruppen industrialisiert und so gut wie jeder Bach wird für die Energiegewinnung genutzt. Die Statistik Austria spricht von jährlich rund 226 Millionen Übernachtungsgästen im Alpenraum. Natur aber ist in stetem Wandel und lässt sich nur bedingt in Bahnen leiten. Aktuell scheint es zudem, als würden sich Naturereignisse nicht nur häufen, sondern auch verstärken. Dass der Klimawandel hier eine bedeutende Rolle spielt, kann heute durchaus mit Gewissheit gesagt werden, auch wenn nicht jedes Einzelereignis automatisch mit der Erderwärmung zu tun hat. Relativiert werden muss unser Eindruck zudem dadurch, dass die Medien uns jedes Ereignis, im Besonderen mit Sach- oder Personenschäden, fast in Echtzeit kundtun, egal wo auf der Welt es stattfindet.
„In Patagonien wird es immer trockener, die Gletscher sind immer früher blank und es wird viel wärmer. Teilweise sind wir im November im T-Shirt geklettert. Unfälle mit Steinschlägen häufen sich, Zustiege und Abstiege werden gefährlicher bzw. durch Umwege deutlich länger. Der klassische Abstieg vom Fiz Roy etwa ist stark dem Steinschlag ausgesetzt und daher sehr gefährlich. Touren werden schon in der Planung anspruchsvoller, weil man schwieriges Moränengelände umgehen, die Spaltenproblematik berücksichtigen und vor allem auch das Wetter mit den Temperaturen streng im Auge behalten muss. Es gibt Zeitfenster, die sind extrem gefährlich, im Besonderen, wenn es warm ist. Auch ist es traurig zu sehen, wie sich die Gletscher selbst in Patagonien immer weiter zurückziehen. Diese Veränderungen beschäftigen mich sehr und ich frage mich, ob ich in einigen Jahren überhaupt noch bergführen werde können. Ich hinterfrage zunehmend meinen eigenen Lebensstil, reduziere die Flüge zwischen der Schweiz und Patagonien auf ein Minimum und suche alternative Reisemöglichkeiten für meine Expeditionen. Um eine Erstbesteigung in Grönland zu machen, habe ich mich im letzten Jahr auf ein großes Abenteuer eingelassen: Wir sind nach Grönland gesegelt. Das bedeutete 100 Tage auf stürmischer See – wir wussten nicht, ob wir es überhaupt schaffen würden – und 10 Tage Grönland. Die Erstbesteigung der 700-Meter-Wand glückte, aber der Segelturn wird mir wohl am längsten in Erinnerung bleiben.“
Caroline North, 32 Jahre, ist Bergführerin und Profialpinistin, die je ein halbes Jahr in der Schweiz und ein halbes Jahr in Patagonien verbringt.

Seit 1950 nehmen die Veränderungen im globalen Klimasystem deutlich zu. Ein Zusammenhang mit durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen ist durch das verbesserte Verstehen von Klimaprozessen und paläoklimatische Nachweise eindeutig. Es kommt zu einer Erwärmung der Atmosphäre, der Landmassen und der Ozeane, die weitreichende Veränderungen nach sich zieht. Längst spüren auch wir in Europa und ganz besonders in den Alpen, dass der Klimawandel begonnen hat. Während die globale Mitteltemperatur im Vergleich mit 1850–1900 um 1,1 °C gestiegen ist, steigt sie in Gebirgsregionen zwei- bis dreimal so schnell. Die wärmsten Jahre seit Beginn der Messgeschichte liegen alle in den 2000erJahren. Und ja, die oben erwähnten Beispiele stehen nicht immer, aber sehr oft in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Klimawandel. Meist ist es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die zur Verstärkung einzelner Prozesse führen:
Das „World Glacier Monitoring Service“ sammelt seit mehr als einem Jahrhundert standardisierte Daten zu Gletscherschwankungen in mehr als 30 Ländern. Auch die Daten des Gletschermessdienstes des Alpenvereins, der seit 1891 besteht, fließen hier ein. Die Trendlinie geht drastisch nach unten, der Gletscherrückgang ist ein weltweites Phänomen. Gletscher sind allerdings kein Frühwarnsystem, sondern bilden das ab, was sich in der Atmosphäre abspielt. Die Massenbilanz ergibt sich aus der Formel: Akkumulation minus Ablation. Ein Gletscher befindet sich mit dem Klima im Gleichgewicht, wenn die Akkumulation (der Schnee- und Eiszuwachs) auf der Gletscheroberfläche gleich groß ist wie die Ablation (Abschmelzen).
Ist die Ablation höher, verliert der Gletscher an Masse. Der „Glacier Loss Day“ ist jener Tag im Jahr, an dem die Massenbilanz ins Minus rutscht. Dieser Tag rückt kontinuierlich weiter nach vorne. Im Jahr 2022 war er mit dem 22. Juni, also noch vor dem Sommer, erreicht. „Der Hintereisferner im Ötztal wird in den kommenden 15 Jahren rund 50 % seines heutigen Volumens verlieren, bis zum Ende des Jahrhunderts wird er verschwunden sein“, so Rainer Prinz vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Universität Innsbruck.
Durch den Rückgang der Gletscher wird neues Land „frei“. Die Natur erobert sich dieses sukzessive zurück und trägt damit langsam zu einer Stabilisierung des losen Materials bei. Es wird grüner in den Bergen und in den Mulden entstehen neue Seen. Allerdings geht auch von diesen eine Gefahr aus, denn meistens besteht der Damm aus Moränenmaterial. Bricht der Damm, kommt es zu heftigen Murabgängen, die bis weit in die Täler dringen können.
Der Anstieg der Temperaturen wirkt sich auch auf den Gebirgspermafrost aus. „Während die Permafrostgebiete in den nördlichen Breitengraden gut erforscht sind, ist der Gebirgspermafrost wenig bekannt. Es gibt keine ‚Wissenshistorie‘, wie das in anderen Gebieten der Glaziologie der Fall ist. Gerade einmal 25 bis 30 Topexperten weltweit, davon keiner aus den USA, beschäftigen sich mit dem Gebirgspermafrost“, so Jan Beutel von der Technischen Universität
Innsbruck, Informatiker und Bergführer. Sein Freiluftlaboratorium ist vor allem das Matterhorn in der Schweiz. „Heute wissen wir zumindest, dass die Häufigkeit für Felssturzereignisse im Hochgebirge zunimmt, flächendeckend belastbare Zahlen gibt es aber noch nicht. Der Rückgang von Eis und saisonaler Schneebedeckung sind neben dem auftauenden Permafrost maßgebliche Faktoren für die vermehrt beobachtete Steinschlagaktivität, unter anderem, da mehr Boden direkt der Witterung ausgesetzt ist.“
Aber nicht immer ist der tauende Permafrost schuld, denn wo kein Permafrost ist, kann dieser auch nicht für den Verlust von Stabilität verantwortlich sein. „Der Riss im Hochvogel wurde nicht durch den Klimawandel ausgelöst. Die aktuell rasche Vergrößerung kann aber als ‚climate change related‘ bezeichnet werden. Das heißt, Starkniederschlagsereignisse sowie rasche Frost-Tauwechsel tragen dazu bei, dass der Riss immer größer wird“, so Johannes Leinauer vom Lehrstuhl für Hangbewegungen der Technischen Universität München und Mitarbeiter im Projekt AlpSenseRely rund um Projektleiter Michael Krautblatter.
Tatsächlich kann man heute mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Extremwetterereignisse gehäuft auftreten und sich dieser Trend in Zukunft deutlich verstärken wird, mit all seinen negativen Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft, die Funktionsfähigkeit des Schutzwaldes, die Lebensmittelsicherheit und die Trinkwasserversorgung.
Warum Extremwetterereignisse aber zunehmen und Gewitterzellen oder auch Hitzeperioden mitunter länger an einem Ort „stehen“ bleiben, erklärt Klimaforscher Georg Kaser im bergundsteigen-Interview in der Ausgabe #121 folgendermaßen: „In der Arktis ist es bereits um 4–6 Grad wärmer geworden, in den mittleren Breiten aber im Mittel erst um 1 bis 1,5 Grad. Das heißt, der Temperaturgradient ist kleiner geworden und damit verliert die Antriebsfeder für die Westwinde ihre Kraft. Gleichzeitig sind aber mehr Wasser und mehr Energie in der Atmosphäre. Das Zusammenspiel von verstärkten vertikalen und abgeschwächten horizontalen Effekten nimmt also aktuell eine unglückselige Entwicklung.“
All diese einzelnen Faktoren spielen zusammen. Der Gletscher hinterlässt viel loses Material, das bei Starkniederschlägen mitgerissen wird. Wo früher Eis ganze Felsflanken stützte, ist heute kein entsprechendes Widerlager mehr vorhanden. Zudem erwärmt sich der blanke Fels bei Sonneneinstrahlung stark und Temperaturrekorde selbst in hohen Lagen führen nicht einmal mehr in der Nacht zu einer richtigen Abkühlung. Der Permafrost taut, Wasser dringt tief in die Ritzen und Spalten ein und sprengt den Felsen. Weniger Schnee und Eis bedeutet mehr unbedeckter Boden. Heftige Niederschläge und rasche Frost-Tau-Wechsel begünstigen die Verwitterung zusätzlich. Die Schüttung von Quellen geht durch eine geringe Schneebedeckung im Winter zurück. Fällt Regen zudem als Starkniederschlag, fließt das Wasser so rasch oberflächlich aus dem Gebiet ab, dass es vom Boden nicht gehalten werden kann.
bruck, Informatiker und Bergführer. Sein FreiluftlaboratoMassenbilanz des Hintereisferners in kg/m2 seit 1952. Das jeweilige Haushaltsjahr wird vom 1.10. bis 30.9. gewertet. 1984 konnte das letzte Mal eine kleine positive Bilanz von 32 kg/m2 verzeichnet werden. Quelle der Daten: Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften, Universität Innsbruck
Wissenschaftler Jan Beutel in seinem Freiluftlabor am Matterhorn. Seit 2006 wird es mit verschiedenen Methoden streng überwacht. Foto: PermaSense project


y Am 7.2.2021 wird von einem Gletscherbruch in Indien berichtet, bei dem zwischen 150 und 200 Menschen ums Leben kommen. Im Himalaya-Gebirge hatte sich offenbar ein gewaltiger Eis- und Felssturz ereignet, der in den Dhauliganga-Fluss stürzte und eine massive Flutwelle aus Eis und Geröll auslöste, durch die ein Kraftwerk und mehrere Siedlungen zerstört wurden.
y Besonders betroffen macht uns immer noch der Gletscherbruch in der Marmolata am 3. Juli 2022, bei dem sich ein riesiger Eisblock vom Gletscher löste, mehrere Seilschaften erfasste und 11 Bergsteiger in den Tod riss.

y In Zusammenhang mit immer höher werdenden Temperaturen steht wohl auch der Felssturz am Piz Cengalo bei Bondo in Graubünden am 23. August 2017. Vier Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial donnerten ins Tal, womit er einer der größten Felsstürze in der Schweiz seit 100 Jahren ist und acht Todesopfer forderte. Dem aber nicht genug, löste der Felssturz eine Reihe von Murabgängen aus, die durch das Val Bondasca bis in den Ort Bondo reichten, obwohl in den Tagen davor kein Niederschlag fiel. Das dort schon seit Jahren aktive Frühwarnsystem schlug an und setzte die Evakuierungsketten rechtzeitig in Gang. Alle Bergwege im Val Bondasca sind aber seither gesperrt, die Capanna Sciora ist geschlossen.
y Auch am viel bestiegenen Matterhorn ereignete sich neben kleineren Steinschlägen 2003 ein Felssturz, bei dem rund 2.500 Kubikmeter Gestein am Hörnligrat abbrachen. Seit 2006 wird das Matterhorn daher mittels verschiedener Sensoren streng überwacht.
y Ähnlich geht es am Hochvogel im Allgäu zu. Hier hat sich bereits vor 50 Jahren ein Riss im Gipfelbereich aufgetan, der kontinuierlich größer wird. 200.000 bis 600.000 Kubikmeter Fels drohen nach und nach in die Tiefe zu stürzen. Ein Klettersteig, der von Tiroler Seite aus auf den Hochvogel führt, ist seit 2014 gesperrt.
y Ein Felssturz im Ausmaß von 35.000 Kubikmetern zerstörte am 14.5.2013 eine Galerie der Felbertauernstraße, der wichtigsten NordSüd-Verbindung zwischen Salzburg und Tirol. Und als „Weihnachtswunder“ wird der Felssturz in Vals, in einem Seitental des Tiroler Wipptals, bezeichnet, bei dem am Heiligen Abend 2017 130.000 Kubikmeter Gestein ins Tal donnerten. Wie durch ein Wunder wurde bei beiden Ereignissen niemand verletzt.
y Unter permanenter Überwachung steht das Dorf Brienz in Graubünden. Nicht nur, dass das Dorf selbst rund einen Meter pro Jahr talwärts rutscht, was große Risse an den Gebäuden verursacht, Mitte Mai 2023 mussten die 85 Bewohner und Bewohnerinnen ihre Häuser verlassen. Es gilt Alarmstufe Rot, denn es drohen bis zu zwei Millionen Kubikmeter Fels abzubrechen.
y Wegen akuter Felssturzgefahr geschlossen sind zudem die TuoiHütte in Graubünden und die Mutthornhütte im Kanton Bern des SAC. Hüttenwirt der Tuoi-Hütte, Christian Wittwer, sieht es vorerst entspannt: „Ich denke, es ist ein vorsichtiger Entscheid, weil in diesem Gebiet viele Tourengeher unterwegs sind, selbstverantwortlich. Mir blieb in dieser Saison erspart, ihnen zuzusehen, wie sie sich im Gefahrenbereich bewegen.“ Angst hätte er keine, selbst nicht, wenn er ab Juni 2023 die Hütte unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes wieder betreiben wird können.
Die Mutthornhütte, wie sie hier 2007 steht, ist Geschichte. Aufgrund der akuten Steinschlaggefahr wird sie an einem anderen Standort neu errichtet.
Foto: SAC
Die Tuoi-Hütte könnte bei einem Felssturz am Piz Buin Pitschen vor allem in Kombination mit winterlichen Verhältnissen durch die Druckwelle beschädigt werden.
Foto: Dominik Täuber, Scuol Tourismus

Simone Bürgler bei der Traverse der Grandes Jorasses. Aufgrund der hohen Temperaturen hat sie anstatt im Bivacco Canzio erst auf der Pointe Whymper biwakiert, um den steinschlägigen Abstieg frühmorgens bei tiefen Temperaturen in Angriff nehmen zu können.

„Die aktuellen Veränderungen am Berg sind so massiv, dass man sie innerhalb der eigenen Tourenkarriere beobachten kann. Bekannte Touren sind nicht mehr dieselben, ihr Charakter verändert sich. Zudem hatten wir jetzt den zweiten Winter in Folge mit sehr wenig Schnee.
Skitouren und Hochtouren sind nicht mehr wie früher. Generell werden die meisten Touren schwieriger, weil etwa Randspalten größer werden, Sicherungspunkte am Fels können nicht mehr erreicht werden, Firnfelder verschwinden und legen oft brüchigen Fels frei oder werden eisig.
Leichter wird hingegen die Besteigung des Piz Scerscen im Engadin, da die Eisnase flacher wird. Andere Touren werden einfacher, weil der Gletscher schwindet und man keine Gletscherausrüstung mehr braucht.
Ob eine Tour machbar ist oder nicht, hängt unter anderem von den aktuellen Wetterbedingungen ab. Skihochtouren lasse ich aktuell wegen der akuten Spaltengefahr aus. Bei lang anhaltenden Hitzeperioden gehe ich keine Tour, die als steinschlagge-
fährdet bekannt ist. Auch auf die Mutthornhütte wäre ich gerne mal gegangen, aber sie ist aktuell wegen Felssturzgefahr geschlossen.
Der Klimawandel beschäftigt mich natürlich. Ich habe das Glück, dass ich sehr nahe an den Bergen wohne. Für mich selbst habe ich beschlossen, keine Langstreckenflüge und höchstens einmal im Jahr einen Kurzstreckenflug zu machen und, wo immer es möglich ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
Ich schränke meinen Konsum ein, gehe auf OutdoorFlohmärkte und repariere lieber, als neu zu kaufen. Außerdem habe ich gelernt, dass es mich nicht glücklich macht, stur ein Ziel zu verfolgen. Heute bin ich viel flexibler. Ich reserviere ein Zeitfenster, entscheide dann aber spontan, was möglich ist.“
Simone Bürgler, 42 Jahre, ambitionierte Hobbyalpinistin (keine Sponsoren) aus der Schweiz. Früher im Skilanglauf wettkampfmäßig unterwegs, hat sie sich erst mit Ende 20 ganz dem Bergsport mit all seinen Disziplinen verschrieben. Auf ihr Ziel, alle 82 Viertausender der Alpen zu besteigen, fehlen ihr nur noch 12.
Die alte Seethaler Hütte stand 86 Jahre auf solidem Untergrund, bis sich 2015 unter ihr drei Dolinen auftaten. Die alte Hütte wurde gänzlich abgetragen und ein moderner, funktionaler Ersatzbau errichtet. Fotos: Christina Schwann
y Permafrostböden sind eigentlich ein guter Baugrund, weil sie fest wie Beton sind. Tauen sie allerdings, geraten sie in Bewegung. Eines der bekanntesten Beispiele für Gebäude und tauenden Permafrost ist das Sonnblick Observatorium. Schon in den Jahren 2003 und 2004 musste der Gipfelaufbau, auf dem sich die Wetterstation und das Zittel-Haus des ÖAV befinden, mit massiven Betonklammern gesichert werden.

y Aber es gibt noch weitere Beispiele: Unter der 1929 auf 2.740 m errichteten Seethaler-Hütte am Dachstein taten sich um das Jahr 2015 drei Dolinen auf. Eine davon war fünf Meter breit und 30 Meter tief – die gesamte Hütte drohte in dieses Loch zu stürzen. In den Jahren 2016 und 2017 wurde ein Ersatzbau nur wenige Meter neben der alten Hütte errichtet.
y Ähnliches passiert gerade mit dem Hochwildehaus im Ötztal auf 2.883 m. Die Hütte stand Jahrzehntelang auf gefrorenem Moränenschutt, der bombenfest zusammenhielt. 2014 war auf der Website der Sektion Karlsruhe des DAV dann zu lesen: „Karlsruhes höchstes Gebäude stürzt ein – Hochwildehaus fällt dem Klimawandel zum Opfer.“ Tatsächlich taut der Boden unter der Hütte und bewegt sich, was zu massiven Schäden am altehrwürdigen Haus führt. „Aktuell ist die Hütte geschlossen, kann aber möglichweise am selben Standort erhalten werden“, wie Robert Kolbitsch vom DAV hofft.

y Gleiches Schicksal, anderer Standort: Landshuter-Europahütte in den Zillertaler Alpen. Auch sie bricht langsam auseinander. Ein Ersatzbau ist in Diskussion.
Das Hochwildehaus muss mit einer massiven Holzkonstruktion gestützt werden. Einem Abriss könnte sie aber entgehen. Foto: Robert Kolbitsch, DAV
Es mag überraschend klingen, aber auch in den Bergen kann es zu Wassermangel kommen. Die Schlagzeile: „Schutzhütte ohne Wasser: Neue Prager Hütte musste schließen“ (Der Standard, 23.08.2022) machte letzten Sommer aber nur auf ein vermeintlich neues Problem im Alpenraum aufmerksam. „Wassersparen war und ist immer schon oberstes Gebot auf den Hütten der Alpenvereine“, sind sich Georg Unterberger, ÖAV, und Robert Kolbitsch, DAV, einig. Besonders im Karst sei die Wasserversorgung immer schwierig. Im letzten Sommer zeigte sich aber, dass auch Hütten im Urgestein, wie eben die Neue Prager Hütte oder die Bonn-Matreier Hütte im Venedigergebiet sowie auch die Wangenitzsee-Hütte in der Schobergruppe, Probleme mit der Trinkwasserversorgung hatten. Da viele Hütten über eigene kleine Wasserkraftwerke verfügen, bedeutet Wasserknappheit übrigens sehr oft auch Engpässe in der Energieversorgung. Im Sommer 2023 dürfte sich die Situation aufgrund der geringen Schneebedeckung im Winter verschärfen. Martin Niedrist vom AVS schließt nicht aus, dass auch Hütten in Südtirol betroffen sein werden.
Die Neue Prager Hütte am Großvenediger musste die Sommersaison 2022 wegen Wassermangel frühzeitig beenden.
Foto: Jens Klatt, DAV
Unerwartet große Lawinenabgänge zerstörten im Jänner 2019 die Totalp-Hütte in Vorarlberg und 2021 die Trifthütte im Kanton Bern. Die Totalphütte wurde bereits wieder neu und stabiler aufgebaut, die Trifthütte soll an einem neuen Platz neu errichtet werden.

Gewitter, Stürme und Starkniederschläge
Auch die Trifthütte – hier auf dem Bild – gibt es so nicht mehr, nachdem 2021 eine Lawine die Hütte stark beschädigt hat. Der Sommerweg zur Trifthütte wird zurzeit nicht gewartet und ist daher gesperrt. Foto: Elio Stettler, SAC
Durch Murabgänge weggerissene Materialseilbahnen wie jene der Geraer Hütte im Jahr 2012 in den Zillertaler Alpen oder unpassierbare Zustiege und Anfahrtswege wie zur Franz-Senn-Hütte im Stubaital im Jahr 2022 haben Versorgungsengpässe zur Folge, abgesehen von den hohen Kosten des Wiederaufbaus. „Bei uns wird der Sommer zunehmend zur schwierigeren Saison“, so Thomas Fankhauser, Hüttenwirt der Franz-Senn-Hütte. In den Sextner Dolomiten verlegte eine Mure den Zustieg zur Dreischusterhütte.


Außergewöhnlich viel Gesteinsmaterial wurde 2012 durch ein Unwetter im hinteren Valsertal, Zillertaler Alpen, talwärts geschoben und zerstörte die Materialseilbahn der Geraer Hütte.
Foto: DAV-Sektion Landshut
Eigens eingerichtete Forschungsstellen wie das Institut für Naturgefahren in Innsbruck, Landesgeologen, die Wildbach- und Lawinenverbauung, der Lehrstuhl für Hangbewegungen der TU-München oder das SLF in der Schweiz unter anderem mit den Schwerpunkten Naturgefahren und Permafrost und viele mehr haben alle ein Ziel vor Augen: „Unsere Aufgabe ist es, die Grundlagenforschung voranzutreiben und Methoden zu entwickeln, mit denen wir zuverlässige Aussagen treffen können“, so Jan Beutel. Es gilt, kritische Bereiche zu erkennen und geeignete Maßnahmen abhängig vom Schutzziel zu setzen. Neben Felswänden oberhalb von Verkehrswegen und Siedlungsraum stehen vor allem auch die großen Stauseen der Wasserkraftwerke unter strenger Beobachtung. Die Ängste der Bevölkerung vor Hangrutschungen und dadurch ausgelösten Flutwellen ist zurzeit im Kaunertal in Tirol besonders präsent, da an den Flanken des bestehenden Speichers Gepatsch vermehrt kleine Rutschungen zu beobachten sind. Auf Anfrage versichert der Energieversorger TIWAG, dass die Flächen rund um das Kraftwerk Kaunertal zu den am besten überwachten Regionen in Tirol gehören, um mögliche Hangrutschungen frühzeitig zu erkennen. Aktuell gebe es aber auf Basis der Beobachtungen sowie entsprechender Gutachten keinen Grund, von einer aktuten Gefahr auszugehen. Aber auch begehbare Klammen, Freizeitparks, Aussichtsplattformen und Skigebiete haben die Geologen im Auge und die massiven Veränderungen im Hochgebirge setzen nicht zuletzt Gletscherskigebieten zu: „Das Gelände wird nicht insgesamt instabil, aber im Bereich der Grate kommt es durch das fehlende Widerlager und das Abschmelzen des Permafrosts zu erhöhter Felssturzgefahr. Die Grate stehen daher unter ständiger Beobachtung und wir müssen auch regelmäßig kleinräumige Stabilisierungsmaßnahmen setzen“, so Reinhard Klier, Vorstand der Wintersport AG, zur Situation im Skigebiet Stubaier Gletscher. Neben vielen anderen Projekten soll hier noch das Projekt RAGNAR genannt sein. Es stellt ein praktisches und einfach zu handhabendes Tool für die „Risikoanalyse von gravitativen Naturgefahren im alpinen Raum“ dar und gibt Wegerhaltern ein Werkzeug in die Hand, mit dem sie selbst Risiken beurteilen und entsprechend angepasste Maßnahmen setzen können.
Die Berge können aber nicht zu 100 % sicher gemacht werden. Auch nicht jene, die gut vermarktet werden – wie etwa das Matterhorn. Eigenverantwortung und der Umgang mit einem gewissen Restrisiko gehören zum Bergsport dazu. Wer abseits des Mainstreams unterwegs ist, weiß aber ohnehin, dass alpine Gefahren jeden Tag neu beurteilt werden müssen. Wie schon Zsigmondy und Paulcke in ihren Büchern schreiben, sollten der Bergsteiger und die Bergsteigerin in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und einzuschätzen. Eine Tour kann gefährlich sein oder auch nicht. Gefährlicher wird sie nur durch den Vergleich, was aber für diesen Tag, hier und jetzt, irrelevant ist. Erscheint das Risiko zu hoch, muss eine andere Variante, eine andere Tour gewählt werden – oder man bleibt einfach entspannt zu Hause, dann ist das Risiko – zumindest am Berg zu verunglücken – gleich null.
Für Caroline North und Simone Bürgler ist klar, wenn die Bedingungen nicht gut sind, dann wählen sie eine andere Tour, nehmen einen längeren An- oder Abstieg in Kauf oder ändern die Sportart – sprich, gehen klettern, wenn Hochtouren zurzeit keine gute Wahl sind. Auch Bergführer und Bergsteigerschulen kommen in Zugzwang und müssen ihr Angebot zum Teil an neue Gegebenheiten anpassen. „Der Normalweg auf den Großglockner verändert sich. Es wird steiler und schwieriger, es muss mehr geklettert werden. In der kommenden Saison werden wir bei ungünstigen Bedingungen nur noch mit zwei Gästen am Seil gehen“, so Vittorio Messini, Bergführer in Kals am Großglockner. Durch den Bau von Klettersteigen auf solidem Fels gebe es aber immer mehrere Optionen, sodass die Besteigung des Großglockners selbst nicht gefährdet sei.
Etwas anders ist es im Stubaital: „Die Besteigung des Zuckerhütls ist im Sommer aufgrund von vermehrtem Steinschlag einfach zu gefährlich. Wir stellen unser Tourenprogramm gemäß den aktuellen Bedingungen um und wollen das Gesamterlebnis Berg wieder mehr in den Mittelpunkt rücken“, so Matthias Knaus, Stubaier Bergführer, der damit auch versucht, gängige Marketingstrategien wie etwa die „Seven Summits“, die man unbedingt besteigen muss, zu durchbrechen. Eine Rückkehr zu alten Tugenden wie Geduld und Achtsamkeit wäre in vielen Bereichen nicht von Nachteil.
Umdenken in der Hüttenbewirtschaftung
Allein ÖAV, DAV und SAC sind gemeinsam im Besitz von 704 Hütten und Biwaks, in Südtirol befinden sich weitere 96 Schutzhütten, wovon 11 der AVS betreibt. Dazu kommen zahlreiche Hütten anderer alpiner Vereine, unzählige private Almen und Gasthäuser. Im Laufe der Jahre wurden nicht nur die behördlichen Auflagen hinsichtlich Hygiene, Brandschutz und Arbeitsrecht immer strenger, auch die Hüttenbetreiber, sprich die Sektionen bzw. private Eigner, gaben einer gestiegenen Nachfrage nach immer mehr Luxus nach. Warme Duschen, 3-Gänge-Menü mit Salatbuffet, Bettwäsche und Ladestationen für Mobiltelefon, Laptop und E-Bike sind auf vielen Hütten Standard. Wasser- und Energieverbrauch sind also vielerorts massiv gestiegen. „60 bis 70 % des Wassers laufen die Toilette hi-nunter“, sagt Robert Kolbitsch und setzt noch eines drauf:
„Der Luxuswahnsinn auf den Hütten muss aufhören.“
„Die Erschließung neuer Quellen, der Bau von größeren Zisternen, die Sammlung von Regenwasser sowie die vermehrte Aufrüstung mit Photovoltaik wird überall dort gemacht, wo es unbedingt notwendig, möglich und finanzierbar ist. Die Bewusstseinsbildung für einen sparsamen Umgang mit Wasser und Energie ist aber oberste Prämisse“, so Georg Unterberger.
Mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen sei man bereits seit über einem Jahrzehnt „gewohnt“. Die Kosten für die Instandhaltung von Wegen und Hütten würden aber kontinuierlich steigen. „Allein die Mittel für den ÖAV-Katastrophenfonds mussten in den letzten fünf Jahren vervierfacht werden.“
Höchste Zeit umzudenken. Eine gemeinsame Hüttenstrategie von ÖAV und DAV soll in Zukunft zu einer deutlichen Reduktion des Angebotes führen. Der SAC geht sogar noch einen Schritt weiter und überprüft mit der eben angelaufenen Studie „Hütten 2050“ jeden einzelnen Hüttenstandort auf Attraktivität, Sicherheit und Rentabilität. „Die Studie soll als Grundlage der zukünftigen Beratung unserer Sektionen in Bezug auf sinnvolle und nicht mehr sinnvolle Investitionen dienen“, so Bruno Lüthi vom SAC.
Der Klimawandel stellt eine ernste Bedrohung für die gesamte Menschheit dar. Es geht um Lebensmittelsicherheit, Trinkwasser, Lebensraum – also um die essentiellen Grundlagen unserer Existenz. Wir können uns nicht länger in den Bergen verstecken. Das funktioniert in einer globalisierten Welt sowieso nicht und zunehmend auch nicht mehr in unseren Bergen, die mit vermehrter Dyna- mik auf eine immer wärmer werdende Erde reagieren. Schneller, besser, größer hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Aber anstatt nach links und rechts zu schauen, um einen besseren Weg zu finden, halten wir stur an der vorgegebenen Route fest, selbst wenn uns die Steine schon auf den Kopf fallen. Schließlich geht es um die vermeintlichen „Must-haves“, komme, was wolle. Wie war das noch mal bei Zsigmondy und Paulcke mit der Beurteilung des Geländes, der Einschätzung von Gefahren, Selbstreflexion und Eigenverantwortung? Im Bergsport sind wir gefordert, unsere Umgebung so wahrzunehmen, wie sie ist, und nicht, wie sie vielleicht einmal war. Jede Route für sich muss auf ihre Machbarkeit überprüft werden, und ist sie objektiv zu gefährlich, muss man eben die Taktik ändern, Alternativen finden, umkehren oder schlicht darauf verzichten. Im echten Leben ist es nicht anders. Wenn es zu gefährlich wird, sollten wir unseren Verstand einschalten und mit Neugierde neue, alternative Wege beschreiten. „Vielleicht ist das die Jahrhundertchance“, Jan Beutel glaubt daran, dass jetzt die Zeit reif ist, um Stakeholder aus Wissenschaft und Politik zusammenzubringen und einen gesellschaftlichen Wandel einzuleiten. Letztendlich liegt es an uns allen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und Verzicht und Reduktion nicht primär negativ zu werten, sondern – im Gegenteil – darauf zu vertrauen, dass gerade ein „Weniger“ das Leben bereichert.
Nachhaltigkeit im und auf dem Kopf.
Von der Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen sind kaum noch Gletscher zu sehen. Dafür wird das Tal zunehmend grüner. Foto: Christina Schwann ■

Mit dem Zodiac 3R bringt EDELRID den ersten recycelten Kletterhelm auf den Markt und beweist ein weiteres Mal, dass Nachhaltigkeit auch bei sicherheitsrelevanter Kletterausrüstung möglich ist. Denn sowohl die robuste Außenschale aus Polyamid als auch die dämpfende EPS-Innenschale bestehen aus recyceltem Kunststoff. Das spart Energie und Ressourcen und reduziert den Ausstoß von Treibhausgasen. Natürlich schützt auch der Zodiac 3R – wie alle EDELRID Bergsporthelme – den Kopf zuverlässig gegen Aufprall oder vor herabfallenden Steinen.
www.edelrid.com



Wer bei körperlicher Belastung in der Hitze nicht ausreichend trinkt, riskiert Dehydrierung, die wiederum einen Hitzekollaps fördert. Was und wie viel man trinken sollte, variiert je nach Person und Umständen. Und auch in Kälte und Höhe ist ein ausgeglichener Wasserhaushalt wichtig.
Von Franziska Haack
Maßgeschneidert bis ins letzte Elektrolyt: Ultraläufer Jeff Browning trinkt perfekt abgestimmt auf seinen persönlichen Schweißverlust nach einer Bestimmung des Natriumanteils im Schweiß. Foto: Vasily Samoylov

„Ausreichend hydriert zu sein, ist wichtig für die sportliche Leistung und die Regeneration, davon bin ich überzeugt. Das Problem ist nur: Wasser ist schwer. Also gehe ich meistens einen Kompromiss ein und trinke ein bisschen weniger, als ideal wäre. Einfach weil es so anstrengend ist, so viel Flüssigkeit mitzuschleppen.“
Colin Haley
Das Dilemma, das der amerikanische Alpinist Colin Haley beschreibt, dürften die meisten Bergsportler:innen kennen. Und womöglich auch die Folgen des Wassersparens: Dehydrierung. Aber warum ist trinken – beim Sport und besonders beim Bergsport – eigentlich so wichtig? Was passiert bei Wassermangel? Und mit welcher Trinkstrategie lässt er sich am besten verhindern?

1Der Hintergrund: Warum trinken?
Der menschliche Körper besteht mit etwa 60 Prozent zu einem großen Teil aus Wasser, wobei der Wassergehalt bei Männern höher ist als bei Frauen. Das Wasser erfüllt zwei Hauptaufgaben: Transport von Nährstoffen und Abbauprodukten sowie Temperaturregulation. Bei freiem Zugang zu Essen und Trinken steuert der Körper seine Wasserbilanz normalerweise automatisch mithilfe von
Durstgefühl und verminderter oder verstärkter Flüssigkeitsausscheidung über die Nieren. Ist allerdings zu wenig Wasser verfügbar und/oder verliert der Körper durch starkes Schwitzen zu viel davon, kommt es zu Dehydrierung. „Da wichtige Organe wie das Gehirn und auch die Muskeln einen Wasseranteil von 70 Prozent aufweisen, sind körperliche und geistige Leistung bereits bei einem geringfügig scheinenden Wasserdefizit von zwei Prozent des Körpergewichts eingeschränkt“, sagt Prof. Wolfgang Schobersberger, Leiter des Instituts für Sport- und Alpinmedizin & Gesundheitstourismus der Tirol Kliniken Innsbruck und UMIT TIROL/Hall und Gründer der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin. Bei einer 70 Kilogramm schweren Person wären das etwa 1,4 Liter Wasser. Um diese Menge auszuschwitzen, müsste die Person etwa eine Stunde in warmer Umgebung (28 °C) in schnellem Tempo (15 km/h) laufen, so dieKalkulationen der Arbeitsgruppe Sporternährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Wie viel Schweiß ein Mensch abgibt, variiert allerdings sowohl inter- als auch intraindividuell stark: Die Schweißrate kann zwischen 0,3 und 2,5 Litern pro Stunde betragen und hängt unter anderem von Temperatur, Intensität und Trainingszustand ab.
Wenig unterschiedlich sind hingegen die Auswirkungen einer Dehydrierung. Es kommt zu Konzentrations- und Koordinationsschwierigkeiten sowie zu Gleichgewichtsstörungen. Kraft- und Ausdauerleistung verringern sich und der Appetit nimmt ab. Mit dem Wassermangel sinkt das Volumen des Blutplasmas, wodurch sich die Fließeigenschaften verschlechtern.
Pro Schlag transportiert das Herz nun weniger Blut und muss schneller schlagen; die Durchblutung verschlechtert sich. Da der Körper die Schweißausschüttung reduziert, um Wasser zu sparen, steigt die Körpertemperatur. Dies ist insbesondere bei körperlicher Aktivität in warmer oder heißer Umgebung gefährlich, da (im schlimmsten Fall) ein Hitzekollaps droht. Aber auch bei Kälte kann eine negative Wasserbilanz gefährlich werden. „Bei Dehydrierung ist das Wasservolumen in den Blutgefäßen zu gering und die Kapillaren sind schlechter durchblutet, außerdem sinkt der Blutdruck. Dadurch sind Finger, Zehen oder Nasenspitze anfälliger für Erfrierungen“, erklärt Wolfgang Schobersberger. „Hinzu kommen die Sekundärfolgen: Durch die verminderte Leistung bewegt man sich langsamer vorwärts, muss sich länger als geplant in der Kälte, vielleicht auch in der Höhe aufhalten und ist gegebenenfalls länger der Hypoxie, dem Sauerstoffmangel ausgesetzt.“
Franziska Haack ist freie Journalistin mit Basislager in München und beschäftigt si ch beruflich wie privat am liebsten mit bzw. in den Bergen.
Die Schweißrate kann zwischen 0,3 und 2,5 Litern pro Stunde betragen und hängt unter anderem von Temperatur, Intensität und Trainingszustand ab.
„Trinken ist wichtig. Das Problem ist nur: Wasser ist schwer.“ Colin Haley
Wer schnelles Bergsteigen in schwierigen Touren betreibt wie Colin Haley, will nicht allzu viel Flüssigkeit mitschleppen. Vier Liter sind es bei Colin trotzdem oft. Foto: Fabi Buhl

Minimum
250 Milliliter pro Stunde sind
bei moderater
Geschwindigkeit ein guter Richtwert. Bei Hitze oder schnellem Tempo können es auch
500 Milliliter oder mehr sein.
Der Zeitpunkt: Wann trinken?
„Für einen wirklich langen Bergtag mit 20 oder mehr Stunden nehme ich oft vier Liter Wasser mit. Wenn ich viel Wasser dabei habe, versuche ich nicht, es aufzusparen, sondern trinke so viel, wie ich gerade das Bedürfnis habe. Ich komme lieber gut hydriert und mit leichtem Rucksack an, als dehydriert und mit schwerem Gepäck. Mitunter geht mir am Ende des Tages das Wasser aus und ich beginne zu dehydrieren, aber das ist immer noch besser, als bereits früh am Tag dehydriert zu sein. Wenn ich unterwegs zu wenig getrunken habe, versuche ich im Biwak viel zu trinken und meinen Wasserhaushalt wieder aufzufüllen.“
Colin HaleyAd libitum, also nach Durst, trinken wie Colin Haley? Oder besser nach Plan? Bezüglich der Frage, welche Trinkstrategie die bessere ist, scheiden sich nicht nur die Geister, sondern auch die Wissenschaft. Verschiedene Studien bei Marathon- und Ultraläufen kamen zu verschiedenen Ergebnissen, die sich aber schon wegen der Verfügbarkeit von Wasser oder gar isotonischen Sportgetränken unterwegs nur bedingt auf das Bergsteigen übertragen lassen.
Wolfgang Schobersberger empfiehlt, am Berg „bewusst zu trinken und nicht erst, wenn der Körper danach verlangt. Man sollte wirklich darauf achten, ein bis zwei Trinkpausen pro Stunde zu machen und dabei mehrere Schluck Wasser zu sich zu nehmen.“ Denn: Generell bei Aktivität und vor allem auch in der Höhe reagieren die Sensoren für Flüssigkeits- wie auch Kalorienmangel verzögert. „Früher war es ja eine Zeitlang in Mode, kaum zu trinken, als Zeichen dafür, wie fit man doch ist. Das ist physiologisch falsch und es kann sogar fatal sein, wenn man sich darauf verlässt, dass man ohne Durst keine Flüssigkeit braucht“, so der Medizinier. „Minimum 250 Milliliter pro Stunde sind bei moderater Geschwindigkeit ein guter Richtwert. Bei Hitze oder schnellem Tempo können es auch 500 Milliliter oder mehr sein.“ Einen guten Anhaltspunkt könne auch der Kalorienverbrauch geben, die Kilokalorien pro Stunde werden einfach auf Milliliter pro Stunde umgelegt. „Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 300 Kilokalorien pro Stunde Wandern wären das 300 Milliliter.“ Generell seien Faustregeln aber mit Vorsicht zu betrachten, weil jeder Körper anders bilanziere. Das indivi-duelle Hormonsystem, die Nierentätigkeit und die Schweißabgabe beeinflussen den Flüssigkeitsbedarf.
Was Bergsteiger:innen zudem beachten sollten: In der Höhe ist der Flüssigkeitsbedarf erhöht. Durch den Sauerstoffmangel dickt der Körper das Blut ein, die Nieren arbeiten verstärkt. Außerdem geht wegen der beschleunigten Atmung mehr Wasser über die Lungen verloren. „Die Hyperventilation, also die Mehratmung macht sich
bereits auf 3000 Metern bemerkbar, das können in Ruhe drei bis fünf Liter Atemluft zusätzlich pro Minute sein, also fast doppelt so viel im Tal“, sagt Wolfgang Schobersberger. Zusätzlich ist auch bei körperlicher Anstrengung bei vergleichbarer Intensität die Mehratmung am Berg stärker als im Tal. In einer Höhe um 4000 m kann die Atemtätigkeit während kürzerer, intensiver Belastungen pro Minute durchaus 100 Liter erreichen. Das würde grob einem maximalen Wasserverlust von 250 Milliliter pro Stunde entsprechen. Bei gemütlicheren Wanderungen reduziert sich der Wasserverlust über die Atemwege dementsprechend deutlich.
„Nicht nur das Trinken während der Tour ist wichtig, sondern auch, dass man gut ernährt und hydriert startet“, so Wolfgang Schobersberger. Normovolämie ist hier das Stichwort: Ein ausgeglichener Flüssigkeitszustand
bedeutet, dass die zirkulierende Blutmenge dem Normalwert entspricht. Vor allem bei mehrtägiger Belastung ist es daher wichtig, „rasch nach der Aktivität mit der Rehydrierung zu beginnen“. Internationale Arbeitsgruppen wie das ACSM (American College of Sports Medicine) empfehlen beispielsweise, jene Menge an Flüssigkeit aufzunehmen, die man gewichtsmäßig verloren hat. Bei einem Verlust eines Kilogramms sollte man also mindestens einen Liter trinken. Am Berg ist der Flüssigkeitsverlust ohne Waage freilich schwieriger zu messen. Wenig zuverlässig ist das Durstgefühl, denn das verschwindet schon vor der vollständigen Rehydrierung wieder. Ein guter Anhaltspunkt ist aber die Farbe des Urins, der sollte hellgelb sein. Auch die Haut am Handrücken kann einen Hinweis geben: Bleibt eine hochgezogene Hautfalte länger stehen, ist zu wenig Wasser im System.
Ein kurzer Trainingslauf bei kühlen Temperaturen geht auch mal ohne. Sonst trinkt Trailläuferin Katharina Hartmuth aber regelmäßig, um Wasser- und Kohlenhydrathaushalt ausgeglichen zu halten.
Foto: Katharina Hartmuth

Vor allem bei mehrtägiger Belastung ist es daher wichtig, rasch nach der Aktivität mit der Rehydrierung zu beginnen.Illustrationen: Sarah Krug, grafi sche auseinandersetzung
Das Rezept: Was trinken? 3
„Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber ich füge meinem Wasser normalerweise Elektrolyt-Tabletten zu, mit Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium. Allerdings immer weniger als empfohlen. Ich setze dem Wasser nichts mit Kalorien zu, weil ich eine Trinkblase nutze, die sich nicht ordentlich reinigen lässt. Um die Energiezufuhr aufrechtzuerhalten, esse ich regelmäßig, hauptsächlich Energieriegel – außer mir geht unterwegs das Essen aus.“
ColinHaley
Durch das Schwitzen (und vermehrte Atmen) beim Bergsport kommt es in der Regel zu einer hypotonen Dehydration: Es geht anteilig mehr Wasser als Natrium verloren, dadurch steigt die Plasma-Osmolarität. Das heißt, die Summe der im Plasma gelösten Teilchen nimmt auf den Liter Plasma gesehen zu. Dadurch ist das erste Ziel beim Trinken, mehr Volumen zu gewinnen und die normale Blutmenge wiederherzustellen (Normovolämie). Das geht auch mit Elektrolyte-armem Wasser, zum Beispiel Schmelzwasser. Allerdings wird nicht jede Flüssigkeit vom Körper gleich gut absorbiert. Die Frage nach dem besten Getränk auf Tour hängt daher – neben geschmacklichen Vorlieben – auch davon ab, wie schnell die Flüssigkeit vom Körper aufgenommen wird und ob sie gleichzeitig auch Energie liefern soll. Beides ist allerdings erst bei einer Belastung von über 90 Minuten relevant. Bei kürzerer Aktivität sind Wasser oder ungesüßter Tee daher ausreichend.
Wasser und ungesüßter Tee sind hypoton, weisen also weniger gelöste Teilchen auf als Blut (und andere Körperflüssigkeiten), ihr osmotischer Druck ist geringer. Etwas schneller aufgenommen werden isotone Getränke wie spezielle Sportdrinks, Saftschorlen oder gesüßter Tee, die eine ähnliche Menge an gelösten Teilchen wie Blut haben. Die beste Absorption wird laut DGE mit einer Kohlenhydratkonzentration von vier bis acht Prozent und 400 bis 1100 Milligramm Natrium pro Liter erreicht. Solche Mischungen passieren den Magen schnell und werden vom Darm gut aufgenommen. Ganz anders hypertone (teilchenreiche)
Getränke: „Gefährlich können Softdrinks
oder unverdünnter Saft werden, die lange im Magen bleiben und somit nicht zur Hydrierung beitragen. Die sollte man auf keinen Fall während des Sports und nicht zu schnell danach zu sich nehmen“, warnt Wolfgang Schobersberger. Statt zu hydrieren, entziehen diese Getränke dem Körper sogar innerlich Wasser, durch Osmose drängt Wasser aus den Zellen in den Darm zur „dicken“ Flüssigkeit hinein. „Unter Belastung kann bei solchen sehr mineralstoff- und zuckerhaltigen Getränken außerdem die Verträglichkeit ein Problem sein. Vor Wettkämpfen oder anspruchsvollen Unternehmungen sollte man im Training ausprobieren, was man verträgt.“ Es gilt: Je hypertoner, umso schwerer verträglich, und je extremer die Beanspruchung, umso empfindlicher Magen und Darm. Ein Durchschütteln des Verdauungstraktes wie beim Trailrunning kann zusätzlich zur Reizung beitragen.
Das Richtige zu trinken, ist also wichtig. Aber kann man auch zu viel trinken?
Im Zusammenhang mit Ausdauersport wird häufig vor der sogenannten Wasservergiftung gewarnt: Durch exzessives Trinken von mineralienarmem Wasser entsteht bei starkem Schwitzen ein Natriummangel, infolgedessen es zu Ausfallserscheinungen bis zum Hirnödem kommen kann. „Hyponatriämie entsteht eigentlich nur bei extremer Ausdauerbelastung in der Hitze, etwa bei Ultramarathons. Beim Bergsteigen sollte sie keine Rolle spielen, weil ja auch gegessen wird“, gibt Wolfgang Schobersberger Entwarnung. Über die Nahrung gewinne der Körper genug Natrium. Anders kann es bei Ultra-Trailläufer:innen sein, diese sollten
Es gilt: Je hypertoner, umso schwerer verträglich, und je extremer die Beanspruchung, umso empfindlicher Magen und Darm.
fachliche Expertise einholen und sich einen Trink- und Ernährungsplan erstellen lassen.
Und wie steht es um sonstige Elektrolyte?
Schließlich benötigt der Körper für die Regulierung der Nerven- und Muskelfunktion sowie des Wasserhaushalts neben Natrium auch andere Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphat und Bikarbonat. „Unter Belastung sind Kohlenhydrate sehr viel wichtiger als Spurenelemente, denn ein Kohlenhydratmangel (Unterzucker) tritt sehr viel schneller auf als der von vielen gefürchtete Kalium- oder Magnesiummangel“, sagt Wolfgang Schobersberger. Viele Bergsteiger:innen hätten ihre eigenen

Ergänzungsroutinen von Elektrolyte über Vitamine bis Energiedrinks im Basislager. Bezüglich Nahrungsergänzungsmittel rät der Mediziner allerdings zur Umsicht, die seien nur nötig, wenn über einen längeren Zeitraum keine ausgewogene Ernährung möglich sei.
Beim normalen Bergwandern würden die verlorenen Elektrolyte in der Regel über die feste und flüssige Nahrung ausreichend wieder aufgenommen. Eine „Überdosierung“ von Elektrolyten wie Natrium kann u. a. zu Übelkeit, Unwohlsein und Durchfall und bei Anwendung über mehrere Tage auch zur Wassereinlagerung im Gewebe führen („fluid loading“).
(Mehr als nur im Arsch:) Leistungsabfall, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen können Anzeichen einer Dehydrierung sein.
Eine „Überdosierung“ von Elektrolyten wie Natrium kann u. a. zu Übelkeit, Unwohlsein und Durchfall und bei Anwendung über mehrere Tage auch zur Wassereinlagerung im Gewebe führen („fluid loading“).
Trügerisch: Der Bergsee mag noch so klar sein, trinken sollte man das Wasser trotzdem nicht einfach so.
Der Sonderfall: Gletscherwasser trinken? 4
„Ich schmelze sehr oft Schnee oder Eis. Bei Schnee mache ich mir nie die Mühe, das Wasser abzukochen oder auf andere Weise zu behandeln. An manchen Orten wie in Peru, Pakistan oder Nepal behandle ich fließendes Wasser, das ich in niedrigeren Höhen entnehme, aber auf jeden Fall mit einem Steripen. Der sterilisiert das Wasser mit ultravioletter Strahlung.“
 Colin Haley
Colin Haley
Selten steht am hohen, unerschlossenen Berg Mineralwasser oder zertifiziertes Trinkwasser zur Verfügung, dafür mitunter viel Schnee und Gletschereis. Aber kann man das Schmelzwasser bedenkenlos trinken?
„Klares Wasser heißt nicht ohne Mikroorganismen“, so Wolfgang Schobersberger.
Gletscherbäche können ebenso wie das Eis mit Algen und Kot von Tier oder Mensch verunreinigt sein. Dazu kommt: „Durch die sogenannte globale Destillation reichern sich langlebige Schadstoffe dort an, wo es besonders kalt ist, also in den Polarregionen oder in hochalpinen Gebieten“, wie Ralf Ebinghaus erklärt, der Direktor am Institut für Coastal Environmental Chemistry des Helmholtz-Zentrums Hereon ist. „Da die Schadstoffe dort nur extrem langsam abge-
baut werden, gelangen sie mit der Schnee-/ Eisschmelze ins Schmelzwasser. Außerdem sammeln sich dort auch pathogene Keime, Mikroplastik aus der Atmosphäre und so manches andere an.“ Nicht gerade gesund sind auch die Schwebstoffe in der Gletschermilch. „Das fein geriebene Gestein kann Magen-Darm-Probleme verursachen, etwas, was man am Berg am allerwenigsten braucht“, sagt Wolfgang Schobersberger. Allerdings: „Wenn ich sonst nichts habe, trinke ich vielleicht lieber dieses Wasser als gar keines. Denn stark dehydriert zu sein, ist gegebenenfalls gefährlicher als das Bachwasser. Das muss aber jeder selbst entscheiden.“ Wer plant, (über längere Zeit) Schmelzwasser zu trinken, sollte einen Filter mitnehmen und das Wasser je nach Filter zusätzlich abkochen.
Ganz unabhängig davon, ob man an hohen Bergen unterwegs ist oder mit der Familie beim Wandern, hat Wolfgang Schobersberger noch einen abschließenden Rat: „In Gruppen sollte man unterwegs aufeinander achten. Ähnlich wie bei der Höhenkrankheit kann es sein, dass kollaptisches Verhalten anderen früher auffällt. Wenn jemand schwankt oder plötzlich ganz unsicher geht, ist das ein Alarmzeichen.“
Wer plant, (über längere Zeit) Schmelzwasser zu trinken, sollte einen Filter mitnehmen und das Wasser je nach Filter zusätzlich abkochen.Foto: Franziska Haack


-Ltd. Edition Pro verkau昀em Set spenden wir 5,00 € an die Kinderkrebshilfe

Heatmaps auf Routenplaner-Portalen und Fitness-Tracking-Apps geben einen recht guten Eindruck, welche Routen bei der großen Masse gerade angesagt sind. Das birgt Gefahren – und Chancen.
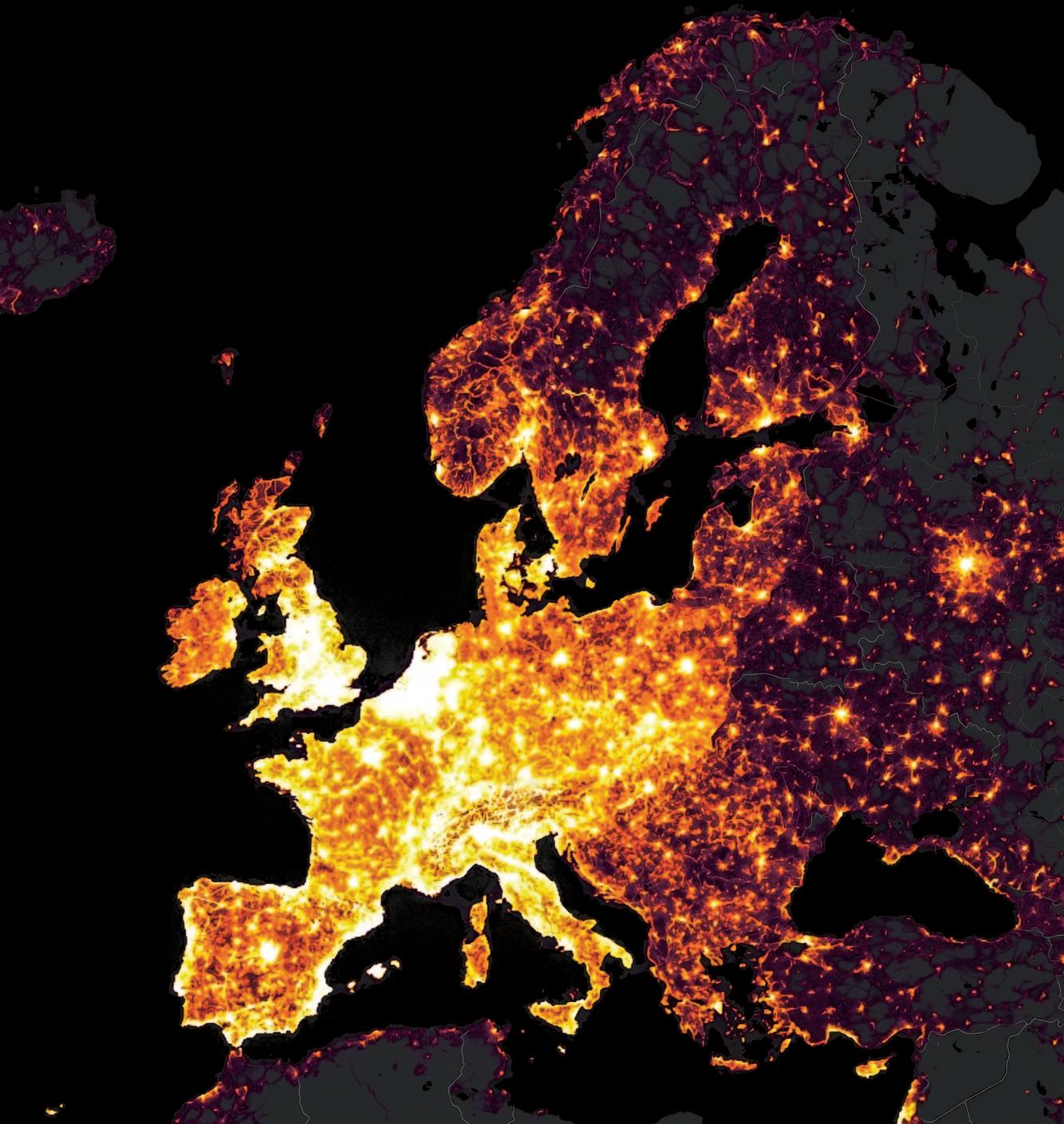
Wahrlich rasend war in der jüngeren Vergangenheit die Entwicklung bei den GPS-Uhren und Routenplaner-Apps; längst dokumentieren viele Berggeher ihre Touren mit den digitalen Gehilfen. Seit einigen Jahren bieten diverse Tracking- und Fitness-Apps zudem sogenannte Heatmaps über ihre Portale an. Aber was hat es damit auf sich? Wo liegen ihre Möglichkeiten und Grenzen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.
Der Begriff Heatmap ist relativ weit gefasst und damit ziemlich unscharf, denn im Grunde geht es dabei generell um nicht mehr als eine grafische Visualisierung von Daten, also etwa die Darstellung von Temperaturen im Jahresverlauf. Wie bei einer Wärmebildkamera zeigen dabei häufig hellere, meist mit warmen Temperaturen assoziierte Farben wie rot oder orange höhere Werte an und kühlere, dunkle Farben niedrigere Werte. Gelegentlich werden inzwischen sogar thematische Karten wie Chloroplethen-
karten, auf denen durch farbige Abstufungen Informationen vermittelt werden, als Heatmaps bezeichnet. Typische Beispiele dafür sind Klima- oder Hitzekarten, mit denen sich die – durchschnittliche –Temperaturverteilungen darstellen lässt, aber auch Karten zum Fahrradaufkommen einer Stadt oder der Dichte von Arztpraxen. Im Normalfall geben Heatmaps auch dem Laien einen schnellen Eindruck von einem Sachverhalt – oft schon auf den ersten Blick.

Seit einiger Zeit veröffentlichen zudem Navigations-, Routenplaner- und Trackingportale eine ganz andere Form der Heatmaps: Mittels der Mitgliederdaten solcher Netzwerke lässt sich das Besucher-Aufkommen auf gewissen Strecken und Routen auf Karten darstellen. Simon Bergmann, ContentSpezialist des Bergsportportals alpenvereinaktiv.com, nennt es eine „Darstellung der Frequentierung von Aktivitäten“.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass möglichst viele Mitglieder ihr Einverständnis geben, dass ihre Daten für diesen Zweck genutzt werden dürfen.
Auf der Strava-Heatmap von Innsbruck kann man die Skiaktivitäten rund um die Nordkettenbahnen (links im Bild) gut erkennen und die Skitourenaktivitäten im Karwendel zwischen Hafelekar und Halltal.
Dominik Prantl hat auch eine dieser unheim lich schlauen GPS-Multisport-Watc hes, ist damit jedoch recht unsozial unterwegs: Er nutzt die Touren der U ser-Gemeinde als Anregung, teilt seine aber nicht mit.

„Mittels der Mitgliederdaten solcher Netzwerke lässt sich das Besucher-Aufkommen auf gewissen Strecken und Routen auf Karten darstellen.“
Zischgeles



Auf dem Internetportal von Strava, das Fitness-Tracking, soziales Netzwerk und vor allem den Wettkampf-Gedanken vereint, lässt sich neben einer persönlichen Heatmap der eigenen Aktivitäten beispielsweise auch eine „Globale Heatmap“ abrufen.
Laut Unternehmensangaben ist sie die größte ihrer Art. Dabei werden die gesammelten GPS-Tracks des globalen Netzwerks an Mitgliedern – Strava selbst schreibt von „Athleten“ – der vergangenen zwei Jahre visualisiert.

Im Jahr 2017 waren dies nach Angaben von Strava 700 Millionen aufgezeichnete Aktivitäten, bei denen 16 Milliarden Kilometer zurückgelegt wurden. Fünf Jahre später hat sich die Zahl bereits auf eine Milliarde Aktivitäten und 27 Milliarden Kilometer erhöht. Bei Strava ist der Heatmap-Gedanke zudem in den Details der Routenbeschreibungen enthalten, wo besonders beliebte Tageszeiten und Monate in Diagrammen dargestellt werden.
Auch die Uhrenhersteller Garmin oder Suunto – die sich beide zudem mit Strava koppeln lassen – stellen solche Frequentierungs-Heatmaps zur Verfügung. Bei Garmin Connect ist die sogenannte Popularity Heatmap über den Webbrowser abrufbar, die Heatmap von Suunto sogar über die App.
Die Outdoorplattformen Fatmaps und Komoot dagegen teilen auf Anfrage mit, dass man aktuell noch keine für Nutzer sichtbare Heatmaps biete. Bergmann wiederum sagt, dass man bei alpenvereinaktiv.com und dem Plattformbetreiber outdooractive.com daran arbeite, aber noch nichts spruchreif sei: „Es gibt noch keine Timeline.“

Zuallererst sind diese Heatmaps derzeit eine nette Spielerei. So lässt sich auf der globalen Heatmap von Strava erkennen, dass sich um Innsbruck herum beispielsweise Trailrunner wie Mountainbiker offenbar besonders gerne hoch Richtung Seegrube bewegen. Schön zu sehen ist auch, wie heiß es in Sachen Wassersport im Norden des Gardasees bei Torbole zugeht – als wären da tatsächlich ein paar Surfer unterwegs.
Generell zeigen die Heatmaps von Strava jedoch eine starke Konzentration auf die Ballungszentren. Heißt: Dort, wo viele Menschen wohnen, ist auch viel Aktivität. Das hat zum Teil damit zu tun, dass Strava bislang noch mehr als Wettkampf-App unter Radfahrern und Läufern einen guten Ruf genießt, denn als NavigationsHilfe unter Bergsteigern. In den Bergen dünnt das fein ziselierte Netz – abseits der Skigebiete – auf der Globalen Heatmap daher zwar zusehends aus. Doch lassen sich auch hier bei den Winteraktivitäten durchaus gewisse Moderouten erkennen wie etwa die Lampsenspitze und der Zischgeles im Sellrain oder die Watzmannkinder im Berchtesgadener Land.
Auch auf der App von Suunto sind diese beiden Linien ziemlich grell, also viele begangene Touren. Alleine wird man dort folglich nicht sein, was manchen Alleingehern oder Gebietsneulingen eine gewisse Sicherheit geben kann.
Wer wiederum die Einsamkeit sucht, erhält mittels solcher Heatmaps eine gute Orientierungshilfe, wo wenig los ist. Da mit den Daten allerdings keine EchtzeitDarstellung möglich ist – bei Strava werden sie beispielsweise einmal pro Monat aktualisiert – und diese daher nur mittel-
fristig das Userverhalten widerspiegeln, kann man sich darauf nicht hundertprozentig verlassen. Wird beispielsweise eine Tour in der lokalen Presse oder in den sozialen Medien empfohlen, ist die Einsamkeit schnell dahin.
Das wahre Potenzial ist derzeit gar nicht absehbar. „Das Ganze ist noch in der Anfangsphase“, meint beispielsweise der Content-Spezialist des Alpenvereins, Simon Bergmann. Eine Prognose will er jedoch wagen: „Die Möglichkeiten sind unendlich.“ Für outdooractive.com und alpenvereinaktiv.com sehe er durchaus die Option, „etwas in Richtung Besucherlenkung zu tun“.
So lasse sich beispielsweise mit derartigen Heatmaps erkennen, welche Lenkungsmaßnahmen funktionieren, wo der Nutzungsdruck auf Anwohner womöglich zunimmt, wie stark eventuell Schutzgebiete von Skitourengehern oder eigentlich verbotene Pfade von Mountainbikern frequentiert werden. Auch aus Sicherheitsaspekten kann die Anwendung relevant sein. Laut Bergmann zeigt sich am vergletscherten Zuckerhütl beispielsweise, dass viele Leute einen Aufstiegsweg nutzen, den Bergführer im Sommer nicht mehr empfehlen.
Günter Schmudlach von skitourenguru.ch verwendet die Frequentierung der Toureals „Trainingsdatensatz zur Entwicklung des Lawinenrisiko-Modells“. Auch würden auf seinem Portal – anders als bei der klassischen Führerliteratur – die Routenverläufe dem Verhalten der Nutzer angepasst werden. „Man beugt sich bis zu einem gewissen Grade der Macht der Masse“, sagt Schmudlach. Dies sei seiner Meinung nach auch sinnvoll: „Die Routen sollen ja repräsentativ sein.“
Statt der Wegfindung eines einzelnen Autors zu vertrauen, wird der Aufstiegs-
„So lasse sich beispielsweise mit derartigen Heatmaps erkennen, welche Lenkungsmaßnahmen funktionieren [...].“
Statt der Wegfindung eines einzelnen Autors zu vertrauen, wird der Aufstiegskorridor gewissermaßen demokratisch bestimmt. Um Heatmaps auf seiner Seite jedoch zuverlässig darzustellen, fehlt ihm trotz der gesammelten GPSTracks von insgesamt mehr als 60.000Skitourenkilometern schlicht eines: „Ich habe dafür nicht genügend Daten.“

Die Vertrauenswürdigkeit von Frequentierungs-Heatmaps hängt von der Datenmenge ab. Rennt beispielsweise eine größere Gruppe Suunto-Jünger dreimal die Woche auf den gleichen, sonst kaum begangenen Berg, kann das durchaus zu Verzerrungen führen. Aber auch – oder gerade – wenn die Datenmenge ausreichend groß ist, äußern Experten Bedenken.
So wurden im Jahr 2018 durch Fitnesstracking-Apps geheime Militärstützpunkte etwa in Syrien, Afghanistan oder Taiwan verraten, weil dort trainierende Soldaten ihre Trainingsrunden in den Netzwerken öffentlich gemacht hatten. Ähnliches, wenn auch im Wortsinne weniger Kriegsentscheidendes, kann beim Bergsteigen passieren. Oder wie Schmudlach sagt: „Mit Heatmaps mache ich Geheimtipps einem größeren Publikum zugänglich.“ Das kann nicht nur für die Liebhaber eher unbekannter Touren ärgerlich sein, sondern auch aus Sicht der Naturschützer ein Problem für ökologisch sensible Räume bedeuten.
Hinzu kommen durchaus sicherheitsrelevante Bedenken. Schmudlach sagt: „Ich sehe in Heatmaps, was möglich ist und was die Leute machen. Ich sehe aber nicht: Ist das in meiner Liga?“ Über Schwierigkeitsgrade, Lawinengefährdung oder Absturzgelände geben solche Karten
„Mit Heatmaps mache ich Geheimtipps einem größeren Publikum zugänglich.“ Günter Schmudlach
keine Auskunft. „Heatmaps machen einen Möglichkeitsraum auf, wo man hingehen könnte“, so Schmudlach. Man müsse die Informationen dann aber auch kritisch einordnen können.
Das Tourenportal Komoot verzichtet noch aus einem anderen Grund auf Heatmaps. Denn diese zeigen zwar die am häufigsten begangenen Strecken. „Das ist aber nicht immer der schönste oder für die individuellen Ansprüche eines Nutzers oder einer Nutzerin der am besten geeignete Weg“, sagt Isabel Riffel, Kommunikations-Managerin bei Komoot.
Zudem würden aktuelle Informationen wie gesperrte oder mittlerweile nicht mehr begehbare Wege nicht oder erst verspätet berücksichtigt. Bei Komoot setze man deshalb mit Smarttours auf
Tourenvorschläge, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen zugeschnitten sind. Wie auch andere Anbieter greift Komoot dabei auf fortlaufend aktualisierte Informationen im Kartenmaterial von OpenStreetMap zurück.
Und dann ist da offenbar auch noch eine gewisse Trägheit der Masse bei der Angabe der korrekten Aktivität – oder einfach das Problem des unterschiedlichen Schwierigkeits-Maßstabs. So eignet sich der 3606 Meter hohe Similaun laut der Suunto-Heatmap zum Trailrunning, und laut Strava ist der Mount Everest gar bis auf rund 7000 Meter ein durchaus öfter gemachter „Spaziergang“. Vielleicht wäre es da als unbedarfter Nutzer nicht von Nachteil, zuvor einmal einen einheimischen Bergführer zu fragen. ■
Bei Wintersportlern beliebt sind die bayerischen Voralpen, besonders rund um den Spitzingsee. Heatmap zwischen Tegernsee im Westen und Wendelstein/Sudelfeld bei Bayrischzell im Osten.

„Ich sehe in Heatmaps, was möglich ist und was die Leute machen. Ich sehe aber nicht: Ist das in meiner Liga?“
Günter SchmudlachKarten: Strava
Steigende Temperaturen und wachsender Tourismus. Wie sich das Bergsteigen in Patagonien verändert? Vier Patagonien-Kenner:innen und ihre Sicht der Dinge.
Protokolle von Gebi Bendler
Der Torre-Gletscher am Fuße des Cerro Torre in Patagonien im März 2023. Allein zwischen Februar und März, also innerhalb eines Monats, ging die Gletscherrzunge um 40 Meter zurück. Foto: Tomás Roy Aguiló

Als Bergführer sind wir Zeugen des Klimawandels und somit Zeugen der Veränderungen und Folgen, die dieser für die Umwelt mit sich bringt. Manchmal sind die Veränderungen von Jahr zu Jahr sehr subtil, aber in der Summe haben sie einen großen Einfluss auf unsere Entwicklung als Bergführer und auch als Kletterer. Viele Gletscher weichen in riesigen Schritten zurück, wie etwa der Viedma-Gletscher, der größte in Argentinien, der jedes Jahr Hunderte Meter an Länge verliert. Für mich besteht kein Zweifel, dass es weltweit zu einem Temperaturanstieg kommt – das ist mehr als bewiesen. Wir können es auch an den klassischen Alpinrouten um El Chaltén sehen, wo es früher üblich war, sie mit Eisgeräten und Steigeisen zu erklettern. Heutzutage verschwindet das Eis dort bereits zu Beginn des Sommers und bei manchen Routen bildet sich selbst im Frühling und Winter kein Eis mehr. Auch wir hier in Patagonien erleben dieselben Veränderungen, die ihr in den Alpen erlebt. Der Permafrost schmilzt und Felsstürze mit hochhausgroßen Wänden bedrohen die Täler. Dennoch ist es für mich schwierig zu bestätigen, dass die Zunahme der Unfälle in Patagonien hauptsächlich auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist, da ja auch die Zahl der Kletterer zunimmt, die die Fitz-Roy- und Cerro-Torre-Ketten besuchen, und letztendlich ist es auch einfach eine Frage der Statistik. Ich glaube, dass Unfälle Hand in Hand gehen mit unserer Besessenheit von kurzfristigen Erfolgen und einer unbändigen Ungeduld, welche uns die Gesellschaft aufbürdet. Wir überspringen nämlich schnell wichtige Phasen des Lernprozesses, und dazu fehlt es uns oft noch an Ausbildung und Bewusstsein. Bei unserem Unfall auf dem Cerro Torre bei der Erstbegehung der Nordwand im Februar 2022 beispielsweise, bei dem mein Freund Korra Pesce starb und ich nur durch eine selbstlose Rettungsaktion überlebte, weiß ich bis heute noch nicht, was dort genau heruntergefallen ist. Es war Nacht, die Nordwand war in perfektem Zustand, um sie zu durchsteigen. Selbstverständlich erwartete uns dort
das typische patagonische Mixedgelände mit vereisten Rissen, Reif und vertikalen Eispilzen. Tatsächlich ist das der Normalzustand in dieser Wand. Ich glaube also in dem Fall nicht, dass der Unfall eine Folge des Klimawandels war. Es ist ganz einfach ein Berg mit extremer Ausgesetztheit, der immer schon größtmöglichen Einsatz abverlangt hat. Der Unfall war das Ergebnis falscher Entscheidungen, wie zum Beispiel das Abseilen über die Aufstiegsroute und nicht über die sicherste Route, die der Südostgrat gewesen wäre. Der Unfall hat mein Leben komplett verändert. Das Leben gab mir eine zweite Chance, die ich nicht verpassen darf. Eine zweite Chance, meinen Sohn aufwachsen zu sehen und das Leben mit den Menschen zu teilen, die ich am meisten liebe. Nach dem Unfall war es sehr schwierig für mich, wieder als Bergführer zu arbeiten. Angst und Unsicherheit plagten mich und ich musste hart arbeiten, um allmählich wieder Vertrauen zu gewinnen. Der Ort El Chaltén, an dem ich als Guide arbeite, hilft dabei auch nicht wirklich, weil die Berge rundherum zu den schwierigsten der Welt zählen und das Gelände zum Bergführen extrem anspruchsvoll und gefährlich ist. Heute bin ich sehr defensiv unterwegs, gehe an keine Grenzen mehr, genieße die einfachsten Aktivitäten, und an den größeren Bergen führen wir einen Kunden immer mit zwei Bergführern.

Mitautorin des Kletterführers
Patagonia Vertical, Bergführerin, Diplomphysikerin
Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich in El Chaltén schon seit Längerem bemerkbar. Man kommt gar nicht drum herum, sie zu bemerken, Gletscher ziehen sich rasant zurück, Zustiege wechseln die Talseiten, ganze Seillängen fallen vom Berg herab. Und diejenigen, die schon seit Jahrzehnten dort leben und/oder bergsteigen, betonen immer wieder, dass das Wetter heutzutage viel besser – aus Bergsteigersicht trockener und weniger windig – sei. Für meine Untersuchung habe ich mangels langfristiger Wetter-Aufzeichnungen die Daten des „Reanalysis“-Projektes der US-amerikanischen Institute für Klimaprognosen und Atmosphärenforschung herangezogen, die rückwirkend mit Hilfe von Beobachtungsdaten und numerischen Modellen berechnet werden. Ich habe den Luftdruck (gemittelter Luftdruck, reduziert auf Meereshöhe = MSLP) als Parameter gewählt, da dieser eine ausreichend große räumliche Skala aufweist, um vom Modell gut abgebildet zu werden, aber trotzdem ein zuverlässiger Indikator des regionalen Wetters ist, und mich auf die Sommermonate Dezember, Januar, Februar beschränkt. Ich habe sowohl Langzeittrends mittels Zeitreihenanalysen als auch Extremereignisse analysiert, Letztere sind aufschlussreicher.

Im Beobachtungszeitraum 1948 bis 2016 habe ich 19 Extremsommer identifiziert, acht „schlechteste“ (unterhalb des ersten Dezils) und elf „beste“ (oberhalb des neunten Dezils). Von den elf „besten“ Sommern sind neun in den letzten 30 Jahren aufgetreten und nur zwei in den 30 Jahren davor. Andersherum ist nur einer der acht „schlechtesten“ Sommer in den letzten 30 Jahren aufgetreten und sieben in den 30 Jahren davor. Das weist auf einen markanten Trend zu häufigeren „besten“ und weniger häufigen „schlechtesten“ Sommern hin. Kurz gesagt: Es stimmt, das Klima hat sich verändert. Insbesondere in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist in den Sommermonaten eine Anhäufung langer Schönwetterperioden – Anomalien hohen Luftdrucks – zu beobachten, charakterisiert durch weniger Wind, weniger Niederschlag und höhere Temperaturen als im langjährigen Mittel.
Ursache hierfür ist eine Verschiebung des polaren Jetstreams Richtung Süden. Mit ihm verschiebt sich auch der polare Tiefdruckgürtel, der in El Chaltén das Wetter diktiert. Moderne Klimamodelle prognostizieren, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Bis etwa Mitte des Jahrhunderts wird diese Tendenz durch den gegensätzlichen Effekt der Heilung des Ozonlochs teilweise unterdrückt. Danach werden im Süden Patagoniens dramatische, klimatische Veränderungen erwartet, wenn die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre weiter zunimmt.
„In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist in den Sommermonaten eine Anhäufung langer Schönwetterperioden – Anomalien hohen Luftdrucks – zu beobachten.“Foto: Daniel Gebel
Ärztin, Leiterin der Bergrettung (Comisión de Auxilio) in El Chaltén
In der Sommersaison 2023 (Dezember bis Februar) gab es im Vergleich zu anderen Jahren mehr Unfälle. Zwei davon können mit dem Klimawandel und den hohen Temperaturen in Patagonien in Verbindung gebracht werden. Die hohen Temperaturen begünstigen Sommerlawinen und Steinschlag, zugleich bemerken wir aber auch eine deutliche Zunahme an Touristen und Kletterern in der Gegend, was zu mehr Unfällen und Waldbränden führt. Unsere Regierung fördert zwar den Tourismus, aber es wird wenig Wert auf Präventionsarbeit gelegt. Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Infrastruktur und Personal, um die negativen Folgen des wachsenden Tourismus in den Griff zu bekommen, steht nicht an
erster Stelle. Genauso wie alle anderen Berg- und Gletscherregionen der Welt kann sich auch Patagonien der Erderwärmung nicht entziehen und leidet unter den Folgen steigender Temperaturen – mit Gletscherschwund, größerer Lawinengefahr im Sommer, Überschwemmungen, Muren und Schlammlawinen sowie hoher Brandgefahr in unseren Wäldern. Es handelt sich hier um ein sehr fragiles Ökosystem, um das wir uns besonders kümmern müssen. Weltweit wird viel über den Klimawandel gesprochen, aber viel zu wenig getan, um ihn zu verhindern. Hinzu kommt, dass Argentinien gerade eine sehr heftige soziale und wirtschaftliche Krise durchlebt, die andere Prioritäten in den Vordergrund rückt.
Zusammenfassend glaube ich, dass das Klettern in Patagonien in den Sommermonaten gefährlicher wird und man Besteigungen auf kältere Zeiträume im Jahr verlegen muss.

Ich war 2003 zum ersten Mal in Chaltén. Die Berge haben sich seitdem in vielerlei Hinsicht verändert. Der offensichtlichste Unterschied besteht darin, dass die Gletscher in den letzten 20 Jahren unglaublich stark zurückgegangen sind. Zudem ist es deutlich wärmer geworden, was die Bedingungen auf den Gletschern, in den Couloirs und auf den Kletterrouten verändert hat. Früher war es nahezu undenkbar, dass jemand den Cerro Chaltén (alias Fitz Roy) in Zustiegsschuhen besteigt – heute ist es fast normal. Früher war es üblich, am Paso Superior eine Schneehöhle zu graben – heute gibt es am Paso Superior fast nie genug Schnee, um überhaupt eine Schneehöhle graben zu können. Die andere große Veränderung besteht darin, dass inzwischen viel mehr Kletterer in den Bergen Patagoniens unterwegs sind und die Abseilstände viel besser eingerichtet sind als früher. Ob die Folgen des Klimawandels in Patagonien größer sind als in anderen Bergregionen? Die Gebirgsketten, die ich am besten kenne, sind die Cascades, die Berge um El Chaltén, das Mont-BlancMassiv, die Central Alaska Range und die kanadischen Rocky Mountains. In den letzten 20 Jahren waren die Auswirkungen der globalen Erwärmung an all diesen Orten offensichtlich und überwältigend, aber ich denke, dass die Auswirkungen in Chaltén extremer waren als in den anderen Regionen. In allen Gebieten passiert das Gleiche – Gletscher gehen zurück, permanente Eiswände und Couloirs verschwinden, es kommt zu mehr Steinschlägen usw. Nur der Unterschied in Chaltén ist größer als in den anderen Gebirgsketten. Die größte und offensichtlichste Folge der globalen Erwär-
mung beim Bergsteigen in Chaltén ist die Schwierigkeit der Zustiege. Insbesondere der Torre-Gletscher hat in den letzten 20 Jahren immens viel Eismasse verloren und die Zugänge zu den Klettereien im Torre-Tal sind viel länger und schwieriger geworden. Die Zeit, die man für die Wanderung von Campo dʼAgostini nach Niponino benötigt, ist heute mindestens doppelt so lang wie vor 20 Jahren. Der zweite große Unterschied besteht in der Wahl der Kletterrouten. Routen wie die „Exocet“ auf die Aguja Standhardt und die „Supercanaleta“ auf den Cerro Chaltén (Fitz Roy) wurden früher während der gesamten Sommersaison geklettert. Mittlerweile werden sie üblicherweise im Frühling gemacht, weil im Sommer nur selten sichere Bedingungen herrschen. Oft kommt die Frage, ob es wegen des Klimawandels auch einen langfristigen Trend zur Wetterbesserung in Patagonien gibt? Insgesamt ist es schwer zu sagen, ob das Wetter zum Klettern besser wird oder nicht, wenn man bedenkt, dass Wind und Niederschlag die bestimmenden Faktoren für gutes Kletterwetter sind. Sicherlich gab es Perioden mit viel besserem Wetter als normal (insbesondere 2008 und 2015/2016), aber es gibt auch immer noch Saisonen mit viel schlechterem Wetter als gewöhnlich, einschließlich der vergangenen Saison. Allerdings ist es deutlich wärmer geworden. Ich kenne die genauen Daten nicht, aber es gibt in Patagonien genügend Wetterstationen, sodass dieser Erwärmungstrend in den aufgezeichneten Daten sicherlich deutlich sichtbar ist. Hinzu kommt noch eine weitere Entwicklung, die sich neben dem Klimawandel auf das Bergsteigen und Unfallgeschehen auswirkt. Als ich in Chaltén mit dem Klettern begann, waren fast alle Kletterer dort sehr erfahrene Alpinisten. Mittlerweile sind erfahrene Alpinisten in der Chaltén-Kletterszene fast eine Seltenheit. Die meisten Kletterer in Chaltén sind engagierte Felskletterer, die fast keine Erfahrung im alpinen Klettern haben. Ich denke, dass diese Tatsache zumindest teilweise mit der Zunahme schwerer Kletterunfälle zusammenhängt. Dieser Trend hat auch nichts mit der Nationalität zu tun – er trifft auf die Mehrheit der Kletterer zu, die aus Nordamerika, aus Europa und aus anderen Teilen Argentiniens und Südamerikas kommen.

Eine Folge der Erwärmung sind neue bzw. größere Gletscherseen.

Ein T-Anker ist die zuverlässigste Verankerung im Firn, essentiell für Spaltenbergungen und Standardinhalt bei Hochtourenkursen. Belastungstests zeigen, wie dieser Fixpunkt tatsächlich funktioniert, helfen die neuralgischen Punkte kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Es gilt jedoch, einen sicheren Übungsrahmen zu schaffen, wie ein Unfall zeigt.
Von Christoph Pirchmoser
Im Sommer 2022 wurde bei einem Hochtourenkurs eine Teilnehmerin bei einem Belastungstest eines T-Ankers durch einen ausgerissenen Pickel verletzt. Der Pickel hatte sich gelöst und wurde durch den Zug mehrerer Personen und die Dehnung des Seiles stark beschleunigt und flog trotz Sicherheitsabstand bis zur Gruppe. Die Teilnehmerin zog sich glücklicherweise „nur“ eine Platzwunde zu. Um ähnliche Unfälle zu vermeiden, hier die Beschreibung eines Übungs- aufbaus, bei dem so etwas nicht passieren kann.
Das Übungsgelände für Belastungstests von T-Ankern kann ein Firnfeld oder ein nicht zu steiler Firnhang mit mindestens 25 bis 30 Metern Länge sein. Der Auslauf muss in Bezug auf Absturz oder andere Gefahren, z. B. einen Anprall an Felsen oder herumliegende Pickel und Steigeisen, sicher sein (Abb. 1 blau schraffierter Bereich). Die Teilnehmer stellen jeweils einen T-Anker her, wobei der Schacht, in dem der Pickel versenkt wird, offen bleibt – so kann später beim Belastungstest die Wirkungsweise beobachtet werden. Um einen T-Anker zu testen, verbinden sich zwei Teilnehmer im Abstand von drei Metern jeweils mit Karabiner und Mastwurf mit einem Seil (auf genügend Überstand am Seilende achten). Zwei Personen reichen aus, um die zu erwarteten Kräfte zu simulieren. Beide Teilnehmer haben sicherheitshalber keine weiteren harten Materialgegenstände am Gurt und tragen keine Steigeisen an den Füßen, haben aber Helme auf. Im Abstand von zehn Metern wird ein weiterer Karabiner mit Mastwurf am
Seil eingelegt und mit der Bandschlinge des T-Ankers verbunden. Es wird an diesen drei Punkten ein Mastwurf verwendet, weil dieser auch nach starken Belastungen gut zu öffnen ist. Die Kursleiterin oder der Kursleiter stellt circa vier bis fünf Meter oberhalb des T-Ankers einen Fixpunkt zur Hintersicherung her.
Ein Stehpickel (wie in Abb. 1) oder ein Steckpickel bieten sich dafür an, weil sie schnell auf- und abzubauen sind und die zu erwartenden Kräfte allemal aushalten. Das freie Seilstück wird vom T-Anker nach oben zur Hintersicherung geführt, dort entsprechend in die HMS eingelegt und bleibt während des Belastungstests unbelastet, wobei das Schlappseil auf ein Minimum reduziert wird. Einerseits gewährleistet dieser Aufbau, dass der Zug ausschließlich am T-Anker wirkt, und andererseits kann ein Ausreißen des Pickels nicht zu dessen unkontrollierter Beschleunigung führen. Die beiden Teilnehmer können jetzt langsam Zug aufbauen und diesen stetig erhöhen. Sie sollten dabei seitlich stehen und möglichst geradlinig in eine Richtung ziehen. Sollte sich der T-Anker tatsächlich lösen, wird der Pickel zwar herausgerissen und kurz beschleunigt, durch die Hintersicherung jedoch sofort wieder ab- gebremst. Die Zone zwischen den ziehenden Teilnehmern und dem T-Anker und ein Bereich mit einem Radius von circa drei Metern um den T-Anker werden aus Sicherheitsgründen frei gehalten (Abb. 1 rot schraffierter Bereich). Die beiden Teilnehmer werden dabei seitlich umfallen, was auf einem Firnfeld mit einem sicheren Auslauf aber kein Problem darstellt.
Wenn der T-Anker zum Geschoss wird
Didaktische, methodische und sicherheitsrelevante Ideen für die alpine Ausbildung.
Die restlichen Teilnehmer können seitlich oder oberhalb des T-Ankers (außerhalb der „roten Zone“) beobachten, wie sich der Pickel in dem Schacht verhält. Der Pickel wird meistens leicht nach vorne-oben gezogen, an der Vorderseite des Schachtes anstehen und bei erhöhtem Zug sich leicht durchbiegen. Pickel mit einem gebogenen Schaft werden oft etwas gedreht und nicht ganz so plan aufliegen, wie Pickel mit geradem Schaft, wodurch klar wird, dass damit noch sauberer gearbeitet werden muss. Löst sich der T-Anker, ist deutlich zu erkennen, woran es lag – meistens wurde der Schaft in Zugrichtung nicht flach genug gegraben und der Pickel nach oben aus dem Schacht gezogen oder die Schneehärte war zu gering und der Pickel fährt durch eine Schwachschicht in der Vorderwand des Schachtes hindurch. Nach einem Belastungstest können die Karabiner im Seil bleiben und der ganze Aufbau kann zum nächsten T-Anker weiterwandern, wo der Kursleiter oberhalb wieder einen Fixpunkt zur Hintersicherung herstellt. Die T-Anker aller Teilnehmenden können so mit wenig Aufwand und ohne ein erhöhtes Risiko getestet werden. Dadurch bekommen sie ein besseres Verständnis für die Wirkungsweise des T-Ankers, lernen, auf welche Details bei der Herstellung zu achten ist, und bekommen Vertrauen in diese wichtige Verankerungsmethode.
Text: Christoph Pirchmoser hat Sportwissenschaften studiert und ist Berg- und Skiführer. Beim ÖAV ist er für das Programm SicherAmBerg-Kurs zuständig.
1 Wir möchten betonen, dass dieser Übungsaufbau nur ein Vorschlag ist und eine von vielen Möglichkeiten darstellt. Wir sind uns durchaus bewusst, dass es noch andere funktionierende Methoden zur Hintersicherung von Pickeln gibt und auch viele weitere sinnvolle Übungsszenarien durchgeführt werden können. ■
Hintersicherung mittels Stehpickel: Sicherer steht auf dem Pickel und das Seil wird durch einen Karabiner am Pickel Richtung HMS-Körpersicherung umgelenkt.
Mastwürfe an den belasteten Punkten, weil sich diese nach Belastung wieder lösen lassen.
Abb. 1 Aufbau eines Belastungstests für T-Anker. Rote Zone: Gefahrenbereich, wo sich niemand aufhalten darf. Grüne Zone: sicherer Auslauf ohne Absturz- oder Anprallgefahr.

Selbstrettung aus der Gletscherspalte. Die Selbstrettung ermöglicht das selbstständige Aussteigen aus einer Gletscherspalte nach einem Spaltensturz. Die Technik wird in zwei Phasen unterteilt: Prusiktechnik und Münchhausentechnik – benannt nach dem Lügenbaron Münchhausen, der sich samt Pferd beim eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Sind dabei Bremsknoten im Spiel, wird es kompliziert – selbst mit den neuen Seilklemmen. Wir zeigen euch eine Möglichkeit, wie ihr klassisch mit Reepschnüren und mit Klemmen über die Knoten kommt.

Von Gerhard Mössmer und Michael Larcher
Steigschlinge belasten und Kurzprusik als Selbstsicherung einhängen
Selbstsicherungsprusik lösen und über dem Bremsknoten wieder einknüpfen
Steigschlinge belasten und Selbstsicherungsprusik hochschieben
Selbstsicherung „Kurzprusik“ aushängen
Bremsknoten öffnen und Steigschlinge hochschieben
Phase 1. Prusiktechnik – klassisch mit Reepschnüren bis zum Spaltenrand
Lifehacks sind Tipps und Tricks, die uns das Leben leichter machen. Alpinhacks sollen euch das Bergsteigen erleichtern.
Prusikknoten lockern und über den Bremsknoten schieben
Münchhausentechnik bis zum Bremsknoten
In die Steigschlinge treten, Prusik so hoch wie möglich schieben und belasten
Steigschlinge in den Bremsknoten einhängen
Bremsknoten lösen
Steigschlinge belasten und Kurzprusik als Selbstsicherung einhängen
Shit!
Tibloc lösen und über dem Bremsknoten wieder einklinken
Steigschlinge belasten und Tibloc hochschieben
Selbstsicherung „Kurzprusik“ aushängen
Bremsknoten öffnen und Micro Traxion hochschieben
Tibloc öffnen und über dem Bremsknoten wieder einlegen
Steigschlinge in den Bremsknoten einhängen
Münchhausentechnik bis zum Bremsknoten
In die Steigschlinge treten, Tibloc so hoch wie möglich schieben und belasten
Bremsknoten lösen
Gerhard Mössmer ist Bergführer, Sachverständiger und arbeitet beim ÖAV in der Abteilung Bergsport, wo er für Publikationen, Lehrmeinung und das ÖAV-Lehrteam verantwortlich ist. Darüber hinaus kümmert er sich um die Beantwortung eurer Fragen in der Rubrik Dialog in bergundsteigen. Michael Larcher ist Bergführer und Leiter der Bersportabteilung im ÖAV. Dieses Kapitel erscheint im Booklet Hochtouren des ÖAV, das in Kürze neu aufgelegt wird.
Diese praktische App der WetterOnline GmbH hat neben den üblichen Wetterfeatures eine gute Regenradaranzeige sowie eine Unwetterwarnung. Geographisch funktioniert sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz (und ragt auch nach Südtirol hinein). Praktisch ist die Kombination von zurückliegenden und zukünftigen Regenentwicklungen. Durch die anschauliche graphische Darstellung ist schnell ersichtlich, ob und vor allem wann die nächste Regenfront (oder auch der nächste Schneefall) kommt.
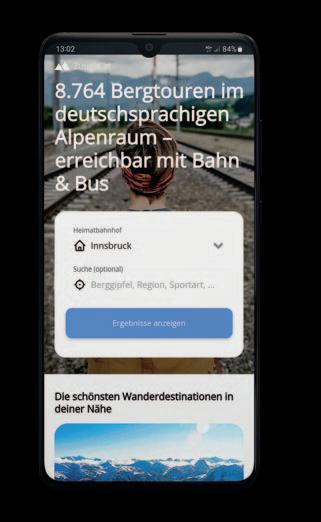
 [Georg Rothwangl]
[Georg Rothwangl]
Zum
Die Webseite zuugle.at bietet ÖffiVerbindungen zu über 10.000 Touren im deutschsprachigen Alpenraum an. Alle angezeigten Touren sind mit den Öffis einfach zu erreichen. Mit der Plattform lässt sich sehr einfach planen, welche Touren vom eigenen Wohnort aus einfach zu erreichen sind. Es handelt sich dabei nicht um ein eigenes Tourenportal, sondern es dienen die Tourenbeschreibungen von zehn Plattformen (inkl. alpenvereinaktiv.com) als Basis. Die Seite selbst ist genau für einen Zweck optimiert: möglichst rasch die aktuellen ÖPNVVerbindungen anzuzeigen und Touren zu finden, die unkompliziert mit Bus und Bahn erreichbar sind.
[Georg
Rothwangl]Zum


Touren- und Infoportale zur öffentlichen Anreise bei
www.alpenvereinaktiv.com
y Fit für die Berge. Das Trainingsprogramm, mit dem du jeden Gipfel erklimmst
Die Sportwissenschaftlerin und Berg-Bloggerin Susanne Kraft liefert mit diesem Buch ein spezialisiertes Trainingsprogramm für Bergsportler. Ihre Anleitungen für gezieltes Ausdauertraining und über 40 bebilderte Übungen, um Kraft und Stabilität zu trainieren, verbessern nicht nur die Kondition, sondern beugen auch Verletzungen am Sprunggelenk oder Knie vor. Die Trainingspläne, die auf Bergtouren mit unterschiedlichen Höhenmetern vorbereiten, sind sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Besonders hervorzuheben ist die übersichtliche Gliederung des Buches mit den klar strukturierten und einfach nachvollziehbaren Übungsreihen. Auch das Kapitel über High-Intensity- und PolarizedTraining, das bei Profiathleten sehr beliebt ist, liefert eine gute Zusammenfassung und einen perfekten Einstieg in dieses Spezialgebiet. Gefällt!


[Gebi Bendler]
y Stärker Klettern. Klettertraining leben, Leistungsplateaus überwinden
Markus Lemcke, Autor des Trainingsratgebers „Stärker Klettern“ aus dem tmms-Verlag, hat sich hingesetzt und alle relevanten Dinge um Trainingslehre zusammengetragen und daraus dieses leicht verständliche, aber fundierte Trainingsbuch entwickelt. In den Kapiteln „Krafttraining“ und „Techniktraining“ findet man Grund- und Fachwissen sowie jede Menge praktische Tipps, um ein Leistungsplateau zu überwinden. Das Kapitel „Mentales Training“ soll die Augen öffnen, um das eigene Verhalten, die eigenen Einstellungen und Herangehensweisen an den Klettersport zu reflektieren. Was grafische Gestaltung und Layout betrifft, ist noch Luft nach oben. Abgesehen von dieser Kritik an der Form gibt es aber – was weit wichtiger ist – inhaltlich nichts zu bemängeln.



[Gebi Bendler]
y Innsbruck Rock. Sportklettergebiete in und um Innsbruck im geographischen Dreieck Hall – Brenner – Silz

Da die bergundsteigen-Redaktion bekanntlich in Innsbruck sitzt, sei uns folgender Lokalpatriotismus verziehen. Auch wenn die Klettergebiete rund um die Welthauptstadt aller Kletterinnen und Kletterer von manchen als abgetakelt, abgewrackt, hart und „schiach“ beschimpft werden, wir lieben Innsbruck. Zeit wurde es also, dass jemand wie Blocmaster-Erfinder und Kletterzentrum-Innsbruck-Hintergrund-Mastermind Andreas Wür tele dieses längst überfällige Pilgerhandbuch für Vertikalwallfahrer:innen herausbringt. In der neuen Erbauungsliteratur werden nicht nur die schönsten und beliebtesten Klettergärten rund um die Tiroler Landeshauptstadt vorgestellt, sondern das Werk soll vielmehr eine Dokumentation des Ist-Standes an Klettergebieten sein – mit neuen Gebieten oder jenen, für die es seit Jahren schon kein aktuelles Topo mehr gibt. Die bergundsteigenRedaktion ist überzeugt: Wichtigstes und wegweisendstes Kletterbuch überhaupt nach Werner Gürtlers und Günter Durners Führerwerk „Sportklettern Innsbruck“ –zumindest für Campanilist:innen!
[bergundsteigen]
In den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für mich. Nicht in den Bergen unterwegs zu sein, ist gut für andere und die Natur ganz allgemein. Was also soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten – meinen Mitmenschen und der Berg-Natur-Kultur-Landschaft gegenüber?

Tom Dauer sucht Antworten. #inunsrernatur 10

Jeden Sommer, wenn das Jungvieh auf die Alm kommt, nimmt sich der Briefträger aus dem Nachbardorf frei. Seit über 30 Jahren macht er das, und auch schon davor, als er noch nicht „der Postler“ war, sondern ein Bub und dann ein junger Mann. Er kennt die Wiesen und Wälder, die Wege und Steige in seinem Tal wie kein Zweiter, und auch die alten Flurnamen, die auf keiner Karte stehen, aber von Generation zu Generation mündlich überliefert wurden, hat er nicht vergessen.
Dass am unteren Ende seiner Alm, wo die Wiese an den Wald grenzt, im vergangenen Frühjahr Birkhähne gebalzt haben, weiß er natürlich, ihre gluckernden Rufe waren nicht zu überhören. Und er weiß auch, dass eine Henne in den Wochen danach ihr Gelege bebrütet hat. Erzählt hat der Postler das keinem. Den Bauern der Almgenossenschaft nicht und auch nicht einem seiner besten Freunde, der beim Landesbund für Vogelund Naturschutz aktiv ist. Beide Seiten, befürchtete er, würden „ein Aufhebens“ um die Bodenbrüter machen. Die einen, weil sie um ihr Weideland fürchteten, die anderen, weil sie sich um Alpenhühner und -vögel ganz generell sorgten. „Im Endeffekt aber hat das
Huhn nix davon, wenn alle umeinandergschafteln.“ Stattdessen hat der Postler den Weidezaun heuer anders gesteckt, damit niemand in die Nähe des Nests kommt, weder das Almvieh noch die Wanderer noch die Vogelschützer. So haben die Birkhenne und ihre Kücken ihre Ruhe, solange sie Ruhe brauchen. Und im nächsten Jahr wird weitergeschaut.
Ich vermute, dass der Postler die verschiedenen Konzepte nicht kennt, die derzeit unter Umweltschützern en vogue sind.
„Nature Needs Half“ fordert zum Beispiel eine internationale Gemeinde engagierter Aktivisten, die bis 2030 rund 50 Prozent des Planeten Erde unter Naturschutz stellen will.
Gut 3,5 Millionen Menschen haben bisher den „Global Deal for Nature“ unterschrieben, der die „Half-Earth-These“ des Biologen und Naturschutzvisionärs Edward Osborne Wilson (1929–2021) unterstützt. Und mit ihrer Biodiversitätsstrategie „Bringing nature back to our lives“ hat auch die Europäische Union das Ziel ausgegeben, mindestens 30 Prozent von Land und See zu protegieren.
Interessant finde ich, dass sich diese globalen Ansätze stets auch auf eine Form des Wissens stützen, die „indigen“ genannt wird, zurückgehend auf das Lateinische „indigenus“, also „eingeboren“ oder „einheimisch“. Entstehen kann aber gerade dieses Wissen nur dann, wenn der Mensch sich nicht als ein der Natur gegenüber- und damit außerhalb von ihr stehendes Subjekt begreift, sondern als ein Teil von ihr, eingebettet in kleine wie große Zyklen, verwoben im Werden und Sterben anderer Lebensformen. Eine Wahrnehmung, die nicht nur in Denktraditionen wie dem Taoismus oder in bäuerlichem Erfahrungswissen verankert ist, sondern auch von naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen jüngeren Datums gestützt wird. Diese führen die Vorstellung, Evolution beruhe auf Konkurrenz und Konflikt, anhand vielfältiger Beispiele von zellulärer bis gesellschaftlicher Ebene ad absurdum. Und legen stattdessen dar, dass Symbiose, Kooperation, Unterstützung und Hilfe viel stärker zu Entwicklung und Erhalt von Leben beitragen.
Meiner Ansicht nach führen Initiativen, die auf eine Trennung zwischen menschlichem und natürlichem Lebensraum setzen, daher auf den falschen Weg. 30 oder 50 Prozent geschützte Natur bringen weder Flora und Fauna noch dem Menschen etwas, wenn nicht das Ganze, das Miteinander, die Verflechtung alles Lebenden im Zentrum des Denkens und Handelns steht. So wie die Indigenen, die Einheimischen, eben schon immer gedacht und gemacht haben. Als ich den Postler vor kurzem auf seiner Alm besuchte, fragte ich ihn, wem diese eigentlich gehöre. Der Postler sinnierte eine Zeit lang, wie es seine Art ist, dann zuckte er mit den Schultern und sagte: „Mei, wem gehört schon eine Alm? Immer dem, der grad da wohnt und arbeitet.“ Ich finde, dass in diesen Worten mehr drinsteckt als in vielen der Essays, Pamphlete und Analysen, die ich zum Thema Naturschutz gelesen habe. Weil sie ausdrücken, wie alles zusammenhängt: die anderen und ich. Gestern, heute, morgen. Mensch und Mitwelt. Und ein Postler, der Verantwortung übernimmt. ■
Notruf. Gerhard Mössmer liefert einen aktuellen Überblick zu diesem Dauerthema. Wie sieht der Status quo aus?
Inklusion. Die nächste Ausgabe widmet sich diesem Thema. Was können wir alle im Bergsport von Menschen mit Beeinträchtigung lernen?
bergundsteigen Jahrgang 32, Auflage: 26.800
Herausgeber Deutscher Alpenverein, Schweizer Alpen-Club SAC, Alpenverein Südtirol, Österreichischer Alpenverein Medieninhaber Österreichischer Alpenverein, ZVR 989190235, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Fon +43 512 59547-30, redaktion@bergundsteigen.at Redaktion Gebhard Bendler – Chefredakteur, gebhard.bendler@alpenverein.at, Dominik Prantl, Alexandra Schweikart, Chris Semmel, Birgit Kluibenschädl






Onlineredaktion: Simon Schöpf, www.bergundsteigen.com
Redaktionsbeirat Herausgeber Michael Larcher, Gerhard Mössmer, Markus Schwaiger, Georg Rothwangl (alle ÖAV); Julia Janotte, Stefan Winter, Markus Fleischmann (alle DAV); Marcel Kraaz (SAC); Stefan Steinegger (AVS) Redaktionsbeirat Bergführerverbände Albert Leichtfried (VÖBS), Reto Schild (SBV), Erwin Steiner ( Berg- und Skiführer Südtirol), Michael Schott (VDBS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.com
Abonnement € 36,- / Österreich € 32.- / vier Ausgaben (März, Juni, September, Dezember) inkl. Versand und Zugang zum Online-Archiv auf www.bergundsteigen.com
Aboverwaltung Theresa Aichner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.com
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at, Anna Brunner Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl, Stefan Heis Druck Alpina, 6022 Innsbruck
PEFC-zertifiziert DiesesProdukt stammtaus nachhaltig bewirtschafteten Wäldernund kontrolliertenQuellen www.pefc.at
PEFC/06-39-364/31
Titelbild „Das Matterhorn“, Radierung um 1850. Grafische Bearbeitung: grafische auseinandersetzung – Christine Brandmaier, Anna Brunner, Sarah Krug
bergundsteigen fördert Land Tirol
Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie über Beitragsvorschläge (redaktion@bergundsteigen.com) und bitten um Verständnis, dass wir nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrücklich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.com in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen.

Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autor:innen wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Entwicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interessiert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem unten abgebildeten Stempel gekennzeichnet.
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichterstattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemeinsam Messungen/Feldtests o. Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigenRedaktion nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil, welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.
bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.

In Wolle gepackt – die PEAK Rucksack-Serie ist die weltweit erste mit 360° SWISSWOOL an allen Kontaktpunkten. Für noch mehr Komfort auf Hochtour.

NATÜRLICH | KOMFORTABEL | TECHNISCH

Überhängende Wände, Löcher und Sintersäulen, kompakter grauer Fels bis hin zu zerklüfteten ockerfarbenen Abschnitten, der Fels in Manikia (Griechenland) bietet endloses Potential für unglaubliche Routen. Federica Mingolla bringt dort ihr ganzes Können zum Ausdruck, sie klettert flüssig und elegant. Ihre Ausrüstung: SIROCCO-Helm, HIRUNDOSGurt und SPIRIT EXPRESS-Schlingen aus der PERFORMANCE-Reihe.


