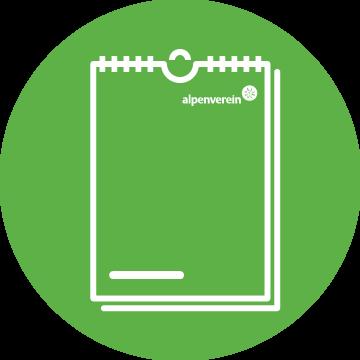heft #3.2025 — September/Okt Ober/NOvember
Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875
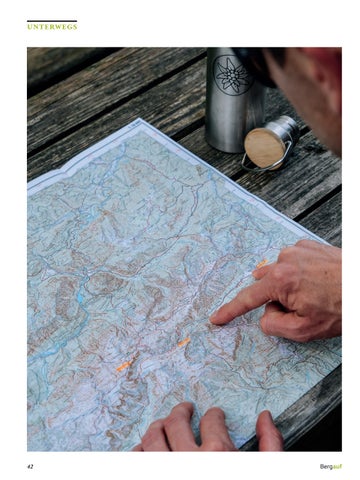
heft #3.2025 — September/Okt Ober/NOvember
Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875

t hema
Wie die Alpenvereinsjugend Berge versetzt – mit Motivation, Haltung und in Gemeinschaft. Ein Blick auf Projekte, Persönlichkeiten und Perspektiven einer Bewegung, die die Zukunft des Alpenvereins mitgestaltet.

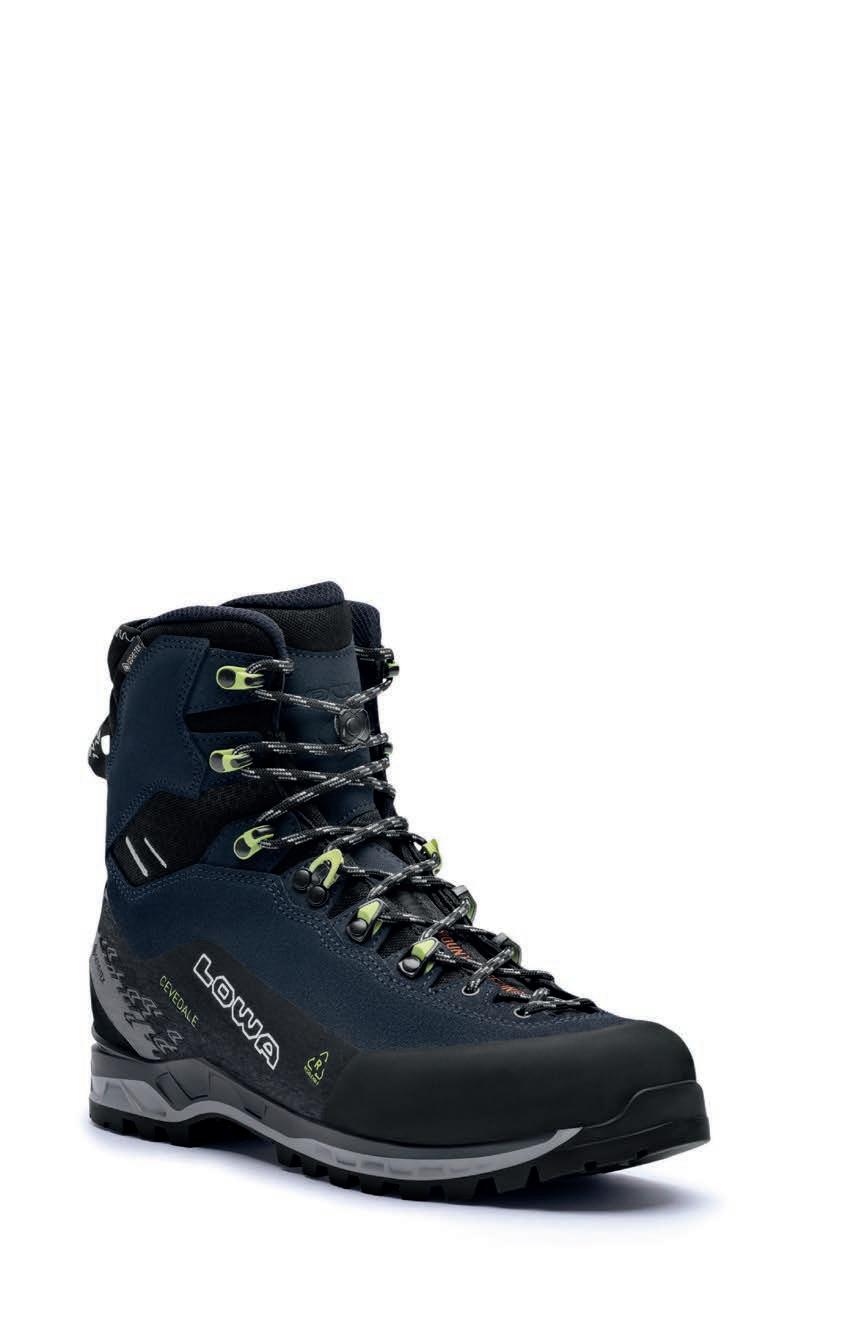
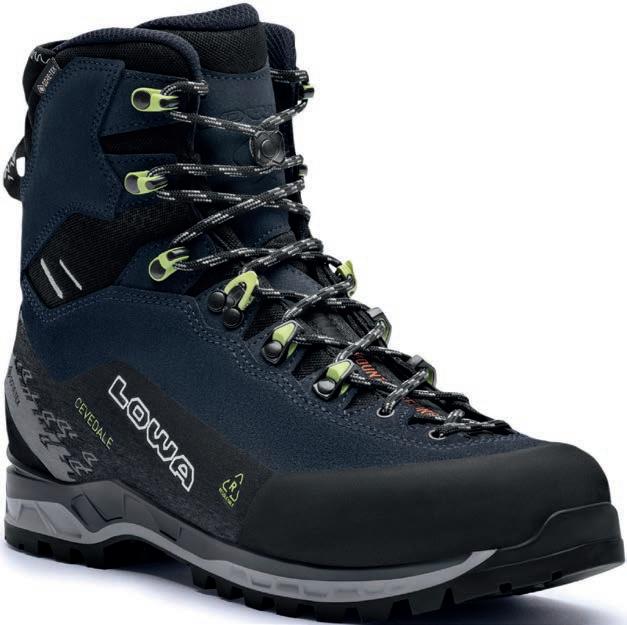

Laura Neuhäuser ist Illustratorin und Designerin aus München, sie visualisiert nachhaltige und komplexe Themen mit einem Augenzwinkern und hat dieses Bergauf illustrativ unterstützt (S. 16, 61). Dabei hat sie viel über die Alpenvereinsjugend gelernt und findet es fast ein bisschen schade, inzwischen zu alt dafür zu sein.

Anna Praxmarer ist im Österreichischen Alpenverein im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Die Welt des Journalismus und der Publikation hat es ihr besonders angetan. Umso mehr freut es sie, seit dieser Ausgabe im Redaktionsteam Bergauf mitzuarbeiten.

Simone Hütter ist Chefredakteurin des Jugendleiter*innen-Magazins DREI D und für die Kommunikation der Alpenvereinsjugend Österreich verantwortlich. Privat verbringt sie ihre Zeit am liebsten fernab von Bildschirmen – beim Klettern am Fels und auf den Bergen vor der Haustüre. Fotos:

evelin stark
Chefredakteurin Bergauf
hinter uns liegt ein Sommer, der vieles abverlangt hat. Der Blick in die Wetterkarten ließ oft keine Bergfreuden aufkommen – zu nass, zu unbeständig. Und leider: auch zu viele Unfälle, die uns einmal mehr zeigen, wie wichtig gute Vorbereitung, realistische Selbsteinschätzung und Verzicht im Gebirge sind.
Und dennoch – oder gerade deshalb – tut es gut, in dieser BergaufAusgabe eine andere Seite der Bergwelt zu zeigen: die sonnige, lebendige, zukunftsgewandte. Denn wir widmen diese Ausgabe der Alpenvereinsjugend (ab S. 10) – jenen jungen Menschen, die mit Begeisterung, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein die Zukunft unseres Vereins und letztendlich unserer Gesellschaft mitgestalten. Wir geben Einblicke in ihre vielfältige Arbeit, ihre Werte, ihre Haltung zur Welt.
Daneben feiern wir ein stolzes Jubiläum: Das 150. Alpenvereinsjahrbuch (S. 88), das mit dem Großvenediger erneut jenen Berg in den Mittelpunkt stellt, der schon 1869 die erste Ausgabe prägte – eine schöne Verbindung von Tradition und Gegenwart. Und wir werfen einen Blick nach Graz (S. 46) und in die umliegende Region, wo im Oktober die Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins stattfindet. Auch hier: viel Neues, viel Bewegung, viele gute Ideen.
Wir wünschen eine inspirierende Lektüre des neuen Bergauf!
Aktuelle Informationen: www.alpenverein.at f facebook.com/alpenverein I instagram.com/alpenverein
September/Okt Ober/NOvember

10 Gemeinschaft erleben
16 Wimmelbild: Die Alpenvereinsjugend
18 Edelweiß Island 2025: Ein Fest der Jugend
22 Orientierung für Tage draußen! Ein pädagogischer Kompass als Wegweiser für die Jugendarbeit.
26 Klettern und Jugendarbeit
28 Kletterhallenheldinnen
32 Top oder Flop? Leitfaden für den Familienausflug am Klettersteig.
34 Tipps vom Bergsport: Kinder sicher sichern am Klettersteig
36 Mountainbiken: Wie Ottensheim das Rad neu erfindet
3 editorial 7 ausgangspunkt
40 paragraph
41 b ergspitzen
61 Wegetation
62 Wege und h ütten im b lick
64 a lpenvereinsshop
Das Titelbild entstammt einer Illustration von Laura Neuhäuser über die Alpenvereinsjugend (S. 16).
77 r espekta m b erg
78 g ood n eWs
87 v ereinsintern
92 auslese
94 150 Jahre b ergauf
98 vorschau/ i mpressum
42 Immer der Karte nach Wer liefert die Daten, die uns den Weg weisen?
46 Graz: Zu Gast im Süden
52 Tourentipp: Schöckl-Überschreitung
56 Planen wie die Profis Tipps zur Tourenplanung mit alpenvereinaktiv.
58 Das Bergsteigerlied und der alpenländische Jodler
63 Öffi-Kolume: Zügig ins Gesäuse
66 Wie geht’s den Alpen? Lebensqualität im Spiegel des Alpenzustandsberichts der Alpenkonvention.
69 Fragenbaum: Wie viel Alpenkonvention steckt in dir?
70 Die Alpen unter Strom Naturverträgliche Entwicklung beim Ausbau der Photovoltaik in der Steiermark.
74 Almen und Nachhaltigkeit: Die unterschätzte Kraft der Almen
79 Pflanzenraritäten der Kalkalpen
80 Hörenswert – wo weniger mehr ist
82 Campo Vallemaggia ist neues Bergsteigerdorf
85 eLearning im Alpenverein
88 Analoges Langzeitgedächtnis
95 Schaukasten: Alpen-Diorama
96 Bildgeschichten: Alpinist spielen
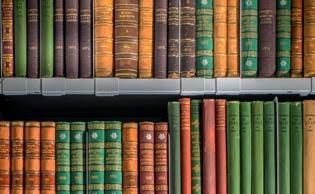
150 ausgaben Jahrbuch Wie wurde das Alpenvereinsjahrbuch zum Traditionswerk der Bergwelt? Bergauf blättert zurück und entdeckt seine Geschichte. Foto: Alpenverein/P. Neuner-Knabl
Je mehr wir sind, desto mehr können wir bewegen. Begeistere deine Freunde von den Vorteilen der Alpenvereinsmitgliedschaft und hole dir dein persönliches Dankeschön!

1 neues Mitglied
Du bekommst eine unserer Alpenvereinskarten* deiner Wahl und zusätzlich einen Alpenvereins-Kuli.
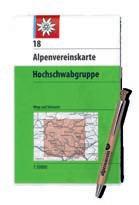
Du bekommst ein Jahresabo PRO für die App alpenvereinaktiv.com im Wert von € 30,–.

Du bekommst einen Gutschein im Wert von € 100,–von SPORTLER**.

* Expeditions- und Sportkletterkarten sind von dieser Aktion ausgenommen.
** Der Warengutschein von Sportler kann im Onlineshop www.sportler.com, in allen Sportler-Filialen oder telefonisch unter +39/0471/208202 eingelöst werden.

SPORTLER Alpine Flagship Store Innsbruck SPORTLER Alpin Kufstein
Als ÖAV-Mitglied bekommst du 5% Rabatt plus Bonuspunkte.
Einfach deine SPORTLER Card und den ÖAV-Mitgliedsausweis bei der Kassa vorlegen.



















































































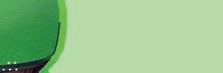
















e lke b ernhard Alpenvereins-Vizepräsidentin
Die Alpenvereinsjugend ist viel mehr als ein Nachwuchsprogramm –sie ist innovativer Impulsgeber, geschützter Erlebnisraum und zentrale Identifikationsquelle für junge Menschen im Verein.
Warum gibt es die Jugend im Alpenverein und was macht uns aus? Die Alpenvereinsjugend ist ein eigenständiger, aber integraler Teil des Vereins. Wir haben unsere eigenen Richtlinien, Ziele und Werte, die sich harmonisch in die Gesamtphilosophie des Alpenvereins einfügen. Unsere Eigenständigkeit erlaubt uns, flexibel zu agieren – stets im Einklang mit den Zielen des gesamten Alpenvereins. Die Alpenvereinsjugend ist „experimentierfreudig“ und mutig, Neues auszuprobieren.
In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie unseren Ehrenamtlichen legen wir großen Wert auf Wertschätzung und Augenhöhe.
Wir entwickeln innovative Methoden zur Vermittlung von Bergsportwissen und setzen uns aktiv mit Themen wie Gewaltprävention und Klimaschutz auseinander. Vieles, was die Jugend mutig ausprobiert hat, fließt später in den gesamten Verein ein und wird zu einem Gewinn für alle. In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie unseren Ehrenamtlichen legen wir großen Wert auf Wertschätzung und Augenhöhe. Wir vermitteln nicht nur Skills in verschiedenen Bergsportarten, sondern auch den Bezug zu unserer Umwelt und die Wichtigkeit einer intakten Natur.
Der sorgsame Umgang mit unseren Ressourcen wird bei unseren „Tagen draußen“ thematisiert und gelebt. Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht auf Ruhe, Freizeit und aktive Erholung. Im Alpenverein schaffen wir Räume, in denen Kinder sicher und frei spielen können. Diese Freiräume sind essenziell für ihre körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Spielen bedeutet lernen, entdecken und wachsen – Werte, die wir hochhalten.
Bei der Ausbildung unserer Ehrenamtlichen legen wir besonderen Wert auf eine ganzheitliche Herangehensweise. Eine rein fachsportliche Ausbildung reicht nicht aus, um Kinder und Jugendliche in der heutigen schnelllebigen Welt gut zu begleiten. Pädagogisch geschulte Funktionär*innen erkennen die individuellen Bedürfnisse der Menschen, mit denen sie arbeiten, und passen ihre Methoden entsprechend an. Diese hochwertige Mischung aus fachsportlicher Ausbildung und praktischen pädagogischen Methoden kommt nicht nur den Teilnehmenden und ihren Eltern zugute, sondern auch den Ehrenamtlichen, die beruflich und privat von ihrem Wissen profitieren.
In diesem Bergauf erfahrt ihr mehr über die Themen, die uns aktuell beschäftigen, und von tollen Aktivitäten. Ich bedanke mich herzlich bei den vielen Ehrenamtlichen, die Kinder, Jugendliche und Familien bei ihren Tagen draußen begleiten, und ich freue mich besonders auf das bevorstehende Klettersteigcamp – denn dort erlebe ich immer wieder, wie viel Potenzial in unseren jungen Mitgliedern steckt. Bis bald, Eure Elke Bernhard
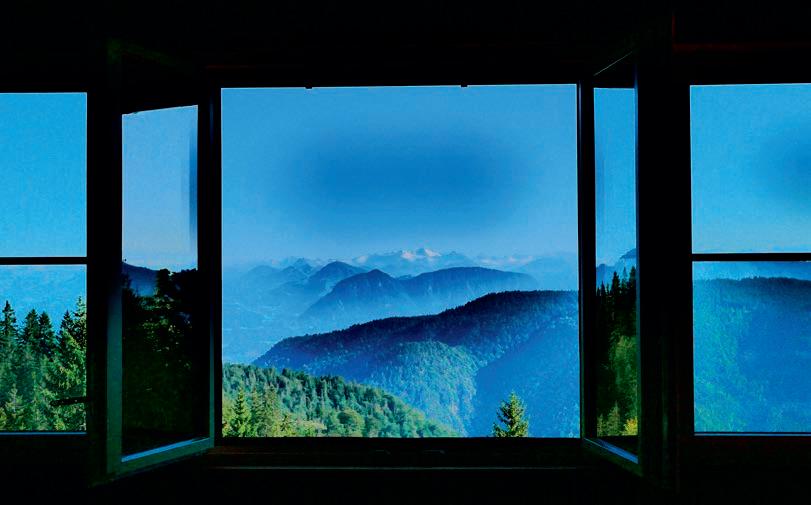
IDas Foto stammt von Yvonne Tremml. Sie hat es beim Fotowettbewerb „Mein BERGfoto“ zum 150. Jubiläum des Alpenvereinsjahrbuches eingereicht. Das Foto zeigt den Blick aus dem Fenster vom Brünnsteinhaus (DAV) Richtung Großvenediger. Yvonnes Titel: „Der schlafende (Pölven-)Elefant und sein Großvenediger“.
Das Bild wurde vor wenigen Wochen auf unserem Instagram-Kanal veröffentlicht. Wir haben einige FollowerKommentare für euch: »Alltag raus – Berge rein.« I »Das Leben ist viel gnädiger mit Blick auf den Venediger.« I »Mountain View.« I »Into the blue.« I »Freiheit beginnt mit dem Blick nach draußen.« I »Unendlichkeit.« I »Fensterblick.« I »Ein Meer aus Bergen.« I »Das Fenster zum Glück.« I »Hol dir die Berge rein!« I »Lasst uns die Perspektive wechseln.« I »Wunsch und Aussicht sind deckungsgleich.« I »Windows 95.« I »Mein Herz geht auf, wenn ich die Berge sehe.« I »Unendlichkeit.« I
aufgestöbert
Bergauf online lesen


Umfrage: Was bewegt dich?
Abenteuerkino: Mountainfilm Graz
Auf der Suche nach spektakulären Naturfilmen, mitreißenden alpinen Abenteuern oder packenden Geschichten über sportliche Ausnahmetalente?
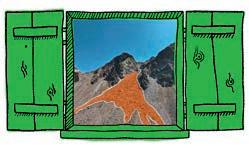
Bergauf ist DAS Medium, das alle Mitglieder über die Themen des Alpenvereins informiert. Für diejenigen, die ihr Magazin lieber online lesen wollen, statt es in Papierform aus dem Briefkasten zu holen, gibt es nun die Möglichkeit, dies unter mein. alpenverein.at > „meine Services“ festzulegen.


Was bewegt die Alpenvereinsmitglieder? Die AlpenvereinAkademie will es wissen – und dafür brauchen wir deine Stimme! In einer kurzen, anonymen Umfrage geht es um Motivation, Sport, Umwelt und Natur. Gemeinsam die Zukunft des Vereins gestalten: www.businessbeat.com/av-befragung

Von 11.–15.11.2025 präsentiert das internationale Berg- und Abenteuerfilmfestival Mountainfilm Graz die neuesten Outdoorfilme. Infos: mountainfilm.com


„Brechen die Berge durch den Klimawandel auseinander?“ Um diese Frage geht es im Alpenvereinspodcast #54. Zu hören sind Wissenschaftlerin Christine Fey und Alpenvereins-Bergsportexperte Gerhard Mössmer. Das alpenverein basecamp entsteht mit Unterstützung der Generali Versicherung. Hier zu hören: alpenverein. at/basecamp

… Jahre lang ist der Österreichische Alpenverein bereits als anerkannte Umweltorganisation gemäß dem österreichischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) gelistet. Diese Anerkennung verleiht dem Hauptverein bundesweit Partei- und Beschwerderechte bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Eine
Umweltorganisation im Sinne des § 19 Abs. 6 UVP-G 2000 ist ein seit mindestens drei Jahren bestehender gemeinnütziger Verein, dessen vorrangiger Zweck laut Statuten der Schutz der Umwelt ist.
Mehr über den Naturschutz im Österreichischen Alpenverein, seine Aktivitäten und Ausbildungsangebote unter www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt


inff.eu
Das Innsbruck Nature Film Festival (inff) präsentiert vom 8. bis 12. Oktober 2025 rund 60 herausragende Filme zu Natur, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit – von Dokumentation über Animation bis Green Fiction, als Kurz- oder Feature-Film. Ziel des Festivals ist es, die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur über die Leinwand erlebbar zu machen. Anlässlich des Internationalen Gletscherjahres 2025 vergibt der Österreichische Alpenverein dieses Jahr den „Glaciers & Mountains Award“ für den besten Film über Gletscher und Berge – dotiert mit 2.000 Euro!

o céane l aunay ehem. Praktikantin beim Alpenverein
Als ich mein Praktikum beim Österreichischen Alpenverein begann, wollte ich lernen, wie ein solcher Verein funktioniert und arbeitet. Dabei ging es mir auch darum, meine persönliche Liebe zu den Bergen mit meinem Berufsleben zu verbinden. Dort habe ich nicht nur über einen Einblick in Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation bekommen, sondern auch Menschen kennengelernt, die zutiefst von ihrer Arbeit und den Werten des Alpenvereins überzeugt sind, sowohl hauptamtliche Mitarbeitende als auch Ehrenamtliche. Ob durch Pressekonferenzen, Publikationen oder Social Media, alle arbeiten gemeinsam an einem Ziel: den Bergsport zugänglicher zu machen und dabei gleichzeitig die Natur zu schützen. Dieses Wissen, dass sich ein Beruf mit einer Leidenschaft – dem Sport –verbinden lässt, nehme ich für meinen weiteren Weg mit. —
Océane ist inzwischen für das Olympische Komitee in Lausanne tätig. Wir wünschen ihr alles Gute weiterhin!

Ein zentrales Element der UN-Kinderrechtskonvention ist das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel. Dieses stellt sicher, dass Kinder nicht nur Schutz und Förderung genießen, sondern auch ausreichend Gelegenheit haben, sich zu erholen, zu spielen und an kulturellen sowie künstlerischen Aktivitäten teilzunehmen.



Spielende Kinder am Sommercamp der Alpenvereinsjugend.
Foto: Anna Repple
In der Alpenvereinsjugend wird Gemeinschaft lebendig – egal ob beim Wandern, Klettern oder Spielen, ob zu Fuß, am Fahrrad, auf den Skiern oder baumelnd in der Hängematte beim Nichtstun, denn: Echtes Miteinander braucht keinen Anlass.
Johanna g rassegger
Gemeinschaft ist ein verbindendes Miteinander, das von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen getragen wird. Es geht der Alpenvereinsjugend darum, Tage draußen gemeinsam zu erleben: füreinander da zu sein, miteinander zu wachsen und Vielfalt als Stärke zu erkennen. Das ist nicht nur in unseren Angeboten erlebbar, sondern auch als zentraler Wert in unserem Leitbild festgeschrieben: „Gemeinschaft: Freunde und Freundinnen finden, miteinander Spaß haben! Kinder und Jugendliche brauchen ein soziales Netz, positive Erlebnisse und freudvolle Erfahrungen.“ Die Förderung von Gemeinschaft ist im pädagogischen Kompass (S. 22) und den Bildungszielen der Alpenvereinsjugend verankert: „Wir ermöglichen Gemeinschaft, Abenteuer und außergewöhnliche Erlebnisse.“
Gemeinsam wachsen
Gemeinschaft prägt die kindliche Entwicklung und ist essenziell für die psychische Gesundheit. Beides liegt uns als Alpenvereinsjugend sehr am Herzen. Sich mit anderen verbunden und zu etwas zugehörig zu fühlen, gehört zum Menschsein und stärkt unser Selbstwertgefühl. Lernen in Gemeinschaft ist ein „Erfolgsmodell“, auch aus neurobiologischer Sicht1 , wie Studien zeigen. Gemeinsames Spielen, Erkunden und Erleben fördert nicht nur soziale Fähigkeiten, sondern auch die kognitive Entwicklung – ein Wissen, das Eltern intuitiv oft schon spüren.
>
1 Vgl. Heckmair, Bernd & Michl, Werner (2012). Erleben und Lernen. Einführung in die Erlebnispädagogik, 7. Auflage, Ernst Reinhardt, S. 84.

Das kindliche gemeinsame Spiel ermöglicht effektives Lernen und bringt Kinder dazu, „das zu tun, was sie für ihre Entwicklung brauchen“.2 Für ihr Wachstum brauchen Kinder jedoch auch ein Fundament aus tragfähigen Beziehungen zu ihren erwachsenen Begleiter*innen – sei es in der Familie, im Freundeskreis, in Bildungs- oder Betreuungseinrichtungen oder bei Angeboten wie jenen der Alpenvereinsjugend. Sie ermöglichen Erfahrungen von Sicherheit, Anerkennung sowie Zugehörigkeit, die wiederum ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Durch diese Erfahrungen und die Möglichkeit zur Mitgestaltung wachsen junge Menschen in Gemeinschaften hinein, lernen kooperatives Verhalten und entwickeln sich zu starken Persönlichkeiten. Kinder bekommen Orientierung, wie ein gutes Zusammenleben gelingen kann.3 Im Zusammensein schließen Kinder und Jugendliche nicht nur Freundschaften, sondern entwickeln soziale Kompetenzen, erleben demokratisches Handeln und wachsen in ihrer Persönlichkeit. Gemeinschaft schafft ein tragfähiges Fundament für ein solidarisches und respektvolles Miteinander – innerhalb der Gruppe und darüber hinaus.
Auch im Familienalltag lässt sich Gemeinschaft bewusst fördern: eine gemeinsam geplante Wanderung, ein regelmäßiger
Gemeinschaft schafft ein tragfähiges Fundament für ein solidarisches und respekt-
volles Miteinander – innerhalb der Gruppe und darüber hinaus.

^ Als Gemeinschaft schöne Momente teilen. Foto: Heli Düringer
‹ Team ROL IT Inklusive Transalp der Alpenvereinsjugend am BrennerGrenzkamm. Foto: Mel Presslaber
Naturnachmittag mit anderen Familien oder einfach das bewusste Teilen von Aufgaben und Erlebnissen – all das stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit. Es muss nicht immer ein großes Abenteuer sein: Oft reicht es, gemeinsam ein Feuer zu machen, ein Zelt im Garten aufzubauen oder nach einem Regentag durch Pfützen zu springen.
Zusammenfinden
Verbundenheit und Zugehörigkeit entstehen durch gemeinsame Visionen, Erlebnisse und Erfahrungen und gemeinsames Tun sowie das Gefühl, dazuzugehören –
unabhängig von individuellen Eigenschaften oder Fähigkeiten. Sie stärkt jede*n Einzelne*n und schafft Zusammenhalt. Gemeinschaft ist kein Zufall und mehr als bloßes Zusammensein – sie entsteht als Prozess, indem wir sie aktiv zusammen gestalten!
Beim Zusammenkommen, Zusammenwachsen, Zusammenhalten und hin und wieder auch beim wertschätzenden „Zusammenraufen“, denn auch Konflikte und deren konstruktive Lösung gehören dazu. Besonders Kinder und Jugendliche sollen in allen Angeboten der Alpenvereinsjugend das Gefühl haben: „Hier bin ich sicher, hier kann ich vertrauen, hier habe ich Wert und Namen, hier fühle ich mich als Teil einer Gemeinschaft.“ 4 Sie sollen die stärkende Erfahrung machen, dass sich jemand auf sie einlässt, das Zusammensein genießt und schöne Momente mit ihnen teilt.5 Ich bin überzeugt davon, dass wir alle zu diesem Erleben von Gemeinschaft beitragen können. Bergauf-Chefredakteurin Evelin Stark, die regelmäßig mit ihrem Sohn an Alpenvereinsaktionen teilnimmt, beschreibt es so: „Ich sehe, wie er dort aufblüht – wie er Verantwortung übernimmt, Freundschaften schließt, sich selbst etwas zutraut. Und ich spüre, wie gut ihm das gemeinschaftliche Draußensein tut.“
Bedürfnisse, die uns im praktischen Tun leiten können:
„Ich bin sicher“
Um gut zu begleiten und die Gemeinschaft zu stärken, ist es wichtig, Vertrauen und Sicherheit zu schaffen. Dazu brauchen wir eine klare, empathische Haltung und die Möglichkeiten zur Beteiligung und Reflexion. Um aktiv die verschiedenen Phasen der Gruppendynamik zu unterstützen, helfen zusätzlich kooperative oder kreative Methoden und Spiele, beispielsweise zum Kennenlernen der Gruppe.
„Ich werde gehört“
Echte Teilhabe entsteht, wenn gemeinsame Entscheidungsprozesse ermöglicht werden. So können sich alle aktiv z. B. bei der gemeinsamen Planung einer Tour einbringen. Dies fördert gegenseitigen Respekt und stärkt das Selbstbewusstsein. Eine wertschätzende Feedbackkultur ist ebenso wichtig. Herausragende Gruppen zeichnen sich nach Daniel Coyle durch ihre Feedbackkultur aus: indem sie sich sehr offen und direkt Feedback geben, es dabei aber gleichzeitig schaffen, ein Klima der Sicherheit, Unterstützung, Verbundenheit und Zugehörigkeit aufzubauen.6
„Wir unterstützen uns gegenseitig“
Etwas gemeinsam zu tragen wird im wörtlichen und übertragenen Sinne erlebt, wenn Aufgaben und Verantwortungen wie Kochen oder das Tragen von Gruppenmaterial gemeinsam übernommen werden. Echte Gemeinschaft zeigt sich besonders in schwierigen Momenten. „Wenn wir einen Misserfolg einstecken mussten, wollen wir vor allem eines: Menschen um uns herum, die uns vermitteln, dass sie zu uns stehen und für uns da sind.“ 7 So wird das Gefühl von Zusammenhalt und Solidarität gestärkt.
„Ich gehöre dazu“
Jede Person bringt als wichtiger Teil der Gruppe individuelle Eigenschaften und Hintergründe wie Herkunft, Kultur, Alter und Geschlecht sowie eigene Fähigkeiten, Stärken und Interessen mit. Diese machen
Es muss nicht immer ein großes Abenteuer sein: Oft reicht es, gemeinsam ein Feuer zu machen, ein Zelt im Garten aufzubauen oder nach einem Regentag durch Pfützen zu springen.
Gemeinschaft lebendig und so können wir gemeinsam verschieden sein. In einer wertschätzenden Gruppe haben alle Platz und ergänzen sich gegenseitig. Als Alpenvereinsjugend sehen wir Vielfalt als Chance oder, um es in den Worten eines Elfjährigen zu sagen, der bei einem unserer Schulprogramme seine Klasse beschrieb: „Wir sind so bunt wie die Herbstblätter im Wald und unsere Unterschiede machen uns gemeinsam stark.“ Gemeinschaft und Inklusion leben heißt für uns auch: gemeinsam schaffen, was man allein für unmöglich hält.
Johanna Grassegger ist pädagogische Mitarbeiterin in der Abteilung Jugend des Österreichischen Alpenvereins und beschäftigt sich als Psychologin, Erlebnispädagogin und Bergwanderführerin gerne mit Gemeinschaft.
2 Renz-Polster, Herbert (2024), Mit Herz und Klarheit, Piper, S. 50.
3 ebd., S. 40 ff.
4 ebd., S. 41.
5 Vgl. Grolimund, Fabian & Rietzler, Stefanie (2019). Geborgen, mutig, frei, Herder, S. 21.
6 ebd., S. 29.
7 ebd., S. 30.
¡ nfo
Wer sich für die Aktivitäten der Alpenvereinsjugend interessiert, wendet sich am besten direkt an die eigene Alpenvereinssektion. Hier geht's zu einer Übersicht der Sektionen und Jugendteams: www.alpenvereinsjugend.at/ueber-uns/ bundesgeschaeftstelle.php
Tage draußen! für Kinder: Begleiter*innen geben Sicherheit. Foto: Franz Walter

Freiräume
Gemeinschaft
Prävention
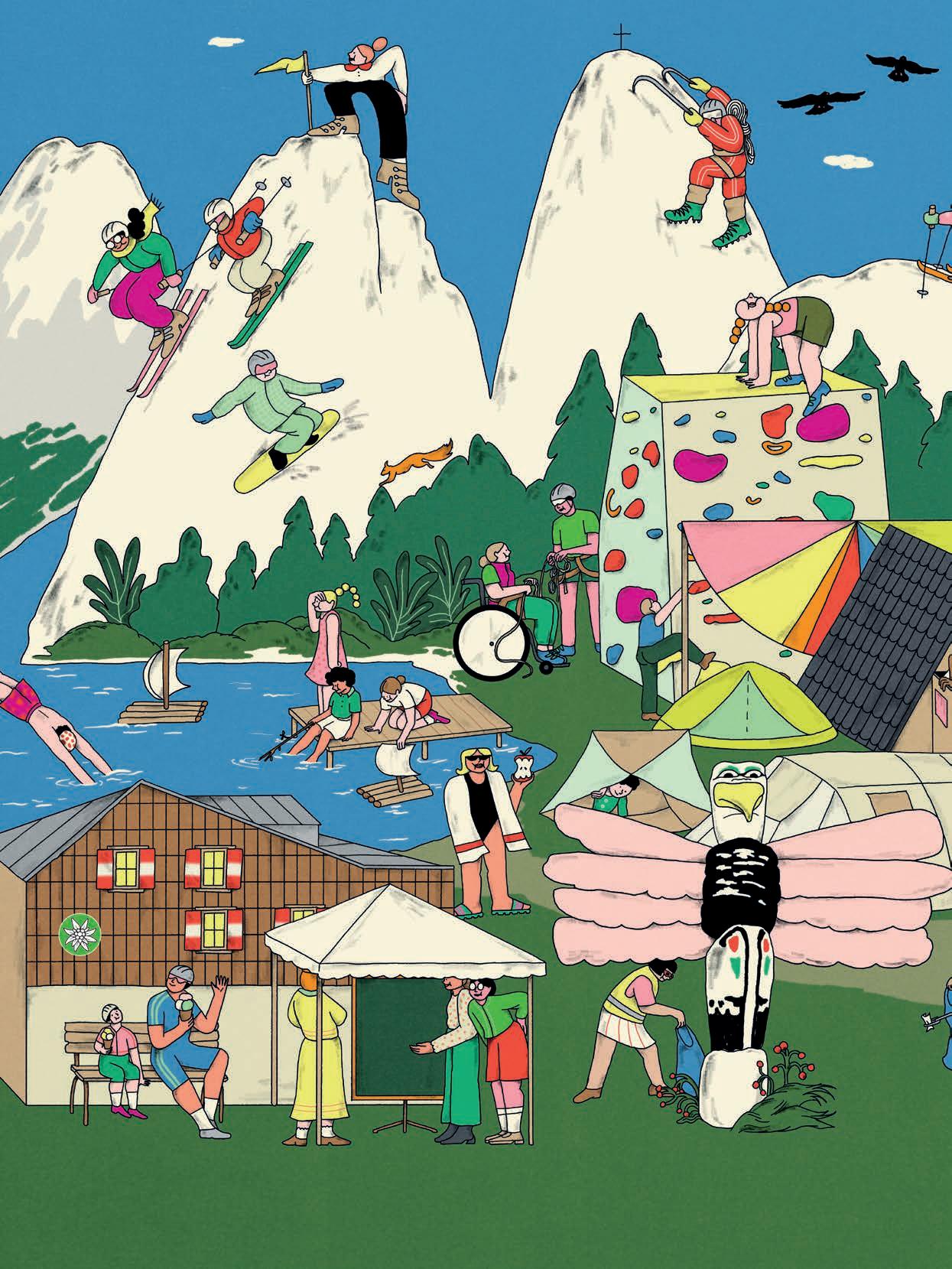
Risiko
Beteiligung & Inklusion
Ehrenamt
Lernen & Beziehung
Mehr als 3.460 Ehrenamtliche sind in 193 Jugendteams in den Alpenvereinssektionen und Ortsgruppen des Österreichischen Alpenvereins für die Alpenvereinsjugend ehrenamtlich unterwegs und ermöglichen Tage draußen für Kinder, Jugendliche und Familien. Dabei werden sie von acht Landesjugendteams, dem Bundesjugendausschuss und dem Bundesjugendteam unterstützt.

Wir begleiten junge Menschen und Familien bei ihren Tagen draußen.

200 Jugendleiter*innen, 4 Tage, 1 Insel: Gemeinschaft, Kreativität und Inspiration beim bundesweiten Treffen der Alpenvereinsjugend am Attersee.
Alle drei Jahre trommelt die Alpenvereinsjugend ihre Ehrenamtlichen zusammen und lädt am Pfingstwochenende zum bundesweiten Treffen Edelweiß Island ein: gemeinsam draußen sein, klettern, sich austauschen, am Lagerfeuer sitzen und eine Auszeit vom Alltag erleben: all das ist Edelweiß Island und noch viel mehr. Über 200 Jugendleiter*innen aus ganz Österreich haben sich von 6. bis 9. Juni in Weißenbach am Attersee (OÖ) getroffen, ihre Zelte aufgeschlagen und vier wunderbare Tage erlebt. „Für mich ist diese Insel ein Ort fernab von den Konventionen des Alltags, mit einer Atmosphäre der Offenheit – perfekte Voraussetzungen, um sein inneres Kind wieder ans Licht zu lassen und aus einer neuen (oder teils vergessenen) Perspektive auf die Jugendarbeit zu blicken“, erzählt Viktoria Vojtech, Jugendleiterin beim Alpenverein Edelweiß.
Explore the Island
„Der Summa ist koa Wetter! Er ist da, wo die Leut sind und die Freud passiert!“, singt der Musiker Beda mit Palme bei seinem Konzert auf Edelweiß Island. Und genau so war es. Die dunklen Wolken am Himmel taten der Stimmung zu keinem Zeitpunkt einen Abbruch. Mit Live-Band, Inseltänzen und „Aloha-ich-bin-auch-da“-Rufen haben wir das Wochenende am Freitag offiziell eröffnet. Besonders gefreut hat uns der Besuch von Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl und Generalsekretär Clemens Matt.
Gipfel, Gumpen, Wasserfälle – Kletterwände, Boulder, der Attersee. Das am See liegende Bergsteigerdorf Steinbach hielt unzählige schöne Spots bereit, die von uns entdeckt werden wollten. Bei verschiedenen Aktivitäten waren alle Teilnehmer*innen am zweiten Tag rund um Weißenbach unterwegs und lernten sich bei kleinen Challenges besser kennen. Während einige nach ihrer Rückkehr erst einmal Siesta machten, erkundeten andere die „offenen Zelte“, in denen man nach Lust und Laune kreativ werden konnte: Neue Freundschaften wurden mit Freundschaftsbändern besiegelt, Arme und Beine mit Tattoos verziert, Inselkostüme gebastelt, Taschen bemalt und Boote gebaut. „Mit dem vielseitigen Pro-
»Für mich ist diese Insel ein Ort fernab von den Konventionen des Alltags, mit einer Atmosphäre der Offenheit – perfekte Voraussetzungen, um sein inneres Kind wieder ans Licht zu lassen und aus einer neuen (oder teils vergessenen) Perspektive auf die Jugendarbeit zu blicken. «
Viktoria Vojtech, Jugendleiterin beim Alpenverein Edelweiß
Gemeinsam unterwegs beim Klettern im Gebiet Forstamt Brennerriese am Attersee.

gramm auf Edelweiß Island wollen wir unseren Ehrenamtlichen für ihr Engagement in der Alpenvereinsjugend Danke sagen, sie inspirieren und Raum für Austausch und Vernetzung schaffen“, sagt Elke Bernhard, Bundesjugendleiterin der Alpenvereinsjugend.
Ideenschmiede: Edelweiß Island
Wenn so viele Jugendfunktionär*innen zusammenkommen, wollen wir die Chance nutzen, um als Jugendorganisation zu verschiedenen Themen ins Gespräch zu kommen. Bei den Workshops zum pädagogischen Kompass (siehe S. 22) tauchten wir in eine große Neuentwicklung der Alpenvereinsjugend ein: In Kleingruppen wurden die neuen pädagogischen Grundlagen vorgestellt und reflektiert.
Inspiration gab es an dem Wochenende auch zu Spielideen: Bei den „Island Games“ mussten sich die Jugendleiter*innen beim Bobby-Car-Rennen, Papierflieger-Weitwurf oder Big-Bag-Sackhüpfen beweisen.
Attersee. Abtauchen und abschalten auf Edelweiß Island.

» Das Gemeinschaftsgefühl, das in diesen Tagen zu spüren war, hat mich als Bundesjugendleiterin besonders gefreut!«
Elke Bernhard, Bundesjugendleiterin der Alpenvereinsjugend
» Besonders schön fand ich, dass das Programm fast durchgängig für Erwachsene und Kinder gleichermaßen konzipiert war. So konnten wir als Familie teilnehmen und meine 9-jährige Tochter und ich sowohl gemeinsam Spaß haben als auch eigenständig unterwegs sein, was uns beiden total getaugt hat!«
Sebastian Howorka, Familiengruppenleiter Alpenverein Austria

Und was wäre Edelweiß Island, ohne gemeinsam zu feiern? Der oberösterreichische Künstler Beda mit Palme sorgte mit seinen Austro-Reggae-Songs beim großen Inselfest für karibisches Flair und ausgelassene Stimmung.
Alle in einem Boot
Ob man am letzten Tag einfach nach Hause fahren darf? Auf keinen Fall. Nur wer sich beim „Escape the Island“-Spiel innerhalb von 60 Minuten ein Ticket für das Boot nach Hause erspielte, durfte abreisen. Mit vereinten Kräften musste ein Boot gebaut werden, das nach 56 Spielminuten erfolg-
^ Finale: Teamwork beim Bootbau, um Edelweiß Island auch wieder verlassen zu dürfen.
› Am Lagerfeuer ist die Welt in Ordnung.
reich im Weißenbach zu Wasser gelassen wurde. Der Inselgeist händigte allen ein Ticket für die Heimreise aus und Edelweiß Island verschwindet nun wieder im großen Alpenvereinsmeer.
Das Bundesjugendteam bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen, die uns bei der

Veranstaltung unterstützt haben, und bei allen Jugendfunktionär*innen da draußen, die in den Sektionen, Ortsgruppen und Bezirken mit Kindern, Jugendlichen und Familien unterwegs sind. Edelweiß Island 2025 ist Geschichte – danke an alle, die ein Teil davon waren und es zu einem unvergesslichen Wochenende gemacht haben.
Pia Payer ist im Österreichischen Alpenverein für Ehrenamtsbetreuung und -kommunikation zuständig.
» Was mir gefallen hat?
Die Gemeinschaft von so vielen Menschen, die sich eigentlich nicht kennen.«
Moritz Loske (13 J.)
» Man lernt viele tolle Leute kennen und es war eine super Motivation, jetzt selbst die Jugendleiterausbildung zu machen!«
Stefan Obereder (15 J.), Alpenvereinsjugend Bad Hall, OÖ

» Von allen vier Edelweiß Islands war dieses für mich das beste! Die Lage war perfekt, denn sie vereinte Badespaß mit alpinen Aktivitäten. Die Mischung aus wertvoller Zeit mit Gleichgesinnten draußen und gleichzeitiger Arbeit an der Zukunft der Alpenvereinsjugend war wieder super! Und, dass es für mich in guter Entfernung mit dem Reiserad erreichbar war, war klasse!«
Robert Delleske, Jugendleiter Alpenvereinsjugend Salzburg

» Ich blicke zurück auf eine in mehrerlei Hinsicht feuchte (Regen, See und Schweiß) und dennoch oder gerade deshalb gelungene Veranstaltung, bei der ich wieder überrascht war, wie divers die Alpenvereinsjugend aufgestellt ist.«
Stefan Bicherl, Obmann Alpenverein Leibnitz
» Als Highlight würde ich das Lagerfeuer nehmen.«
Florian Obereder (13 J.), Alpenvereinsjugend Bad Hall, OÖ
» Klare Nummer 1:
Die Island Games! Dann das Boot bauen. Und wir lieben die Edelweiß-Island-Shirts!«
Silas Loske (10 J.), Alpenvereinsjugend Jenbach
Tage draußen in einer lebenswerten Umwelt:
Wie die Alpenvereinsjugend mit dem neuen pädagogischen Kompass junge Menschen auf ihren Wegen begleitet.
v ictoria k anduth
Ein Lagerfeuer knistert, irgendwo lacht jemand, eine Stirnlampe huscht durch die Dämmerung. Es riecht nach nasser Erde, Stockbrot und Abenteuer. Für viele Kinder und Jugendliche sind solche „Tage draußen“ prägende Erlebnisse – Momente voller Freiheit, Gemeinschaft, Mut und Neugier. Diese besonderen Tage stehen im Zentrum der Arbeit der Alpenvereinsjugend. Sie verbinden Naturerfahrung mit Bildung, Selbstwirksamkeit mit Spaß –und schaffen einen Raum, in dem junge Menschen wachsen können. Damit das gelingt, braucht es mehr als gute Laune und schönes Wetter. Es braucht Wissen,
Erfahrung und ein gemeinsames Verständnis davon, was gute Jugendarbeit im Alpenverein ausmacht.
Unser Leitbild bildet das Fundament: Es beschreibt unseren Auftrag, unsere Werte und unsere Bildungsziele in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Doch wie lässt sich dieser Anspruch in einer großen, überwiegend ehrenamtlich getragenen Organisation wie der Alpenvereinsjugend umsetzen? Mit dieser Frage haben sich Jugendleiter*innen und Kursleiter*innen intensiv auseinandergesetzt – und gemeinsam etwas entwickelt, das Orientierung bietet: den pädagogischen Kompass der Alpenvereinsjugend.
Tage draußen!
Wir alle, die gern in der Natur unterwegs sind, wissen: Tage draußen sind besonders. Wir hängen ein Rufzeichen an, um aufzuzeigen, wie wichtig und notwendig die Erlebnisse an Tagen draußen für Kinder und Jugendliche sind. Das „!“ steht aber auch für das, wie Tage draußen auf uns wirken: Es kann sein, dass wir vor riskanten Situationen stehen, eine intensive Naturbeziehung spüren oder durch die Gruppe Gemeinschaft und Zusammenhalt erleben. Beim Sitzen am Lagerfeuer, Spielen am Fluss, bei Sonne oder Regen. Egal, ob wir sie mit guten Freund*innen erleben, mit der Alpenvereinsjugend – oder ganz für uns allein. Tage draußen! sind für jede*n anders. Sie sind genau diese Tage, die nachwirken und uns noch lange in Erinnerung bleiben. Sie sind das Herzstück unserer Tätigkeit in der Alpenvereinsjugend.
Tage draußen! sind für jede*n anders. Sie sind genau diese Tage, die nachwirken und uns noch lange in Erinnerung bleiben. Sie sind das Herzstück unserer Tätigkeit in der Alpenvereinsjugend.
Es ist unser Auftrag, junge Menschen zu begeistern, zu bilden und sie für Bergsport, Naturerfahrung und Umweltschutz zu sensibilisieren. Dabei begleiten wir Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Weg in die Selbstständigkeit draußen. Unsere Bildungsziele geben uns die Richtung dafür vor:
• Wir unterstützen die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen.
• Wir ermöglichen Gemeinschaft, Abenteuer und außergewöhnliche Erlebnisse.
• Wir fördern risikobewussten und eigenverantwortlichen Bergsport.
• Wir stärken Naturbeziehung, Umweltschutz und nachhaltiges Handeln.
• Wir ermöglichen Mitgestaltung, Engagement und Beteiligung.
Gemeinsam mit den Werten der Alpenvereinsjugend wie Ehrenamt, Prävention, Inklusion und respektvolles Miteinander bilden sie die Grundlage für die Arbeit mit jungen Menschen im Alpenverein.
Der Kompass
Tage draußen!
Die Tage draußen!-Website gibt Einblicke, wie die Alpenvereinsjugend junge Menschen auf ihren Wegen begleitet.

Mehr Infos: www.tagedraussen.at
Wie kann es unseren Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit gelingen, den Bogen zwischen Auftrag, Werten, Bildungszielen und ihrem Alltag in den Alpenvereinssektionen zu spannen? Welche Fragen stellen sich dabei? Wie können Kinder und Jugendliche gut begleitet werden? Wie wird eine Umgebung geschaffen, in der sie sich entfalten können?
Eine Arbeitsgruppe aus Jugend leiter*innen und Kursleiter*innen hat genau das erarbeitet – mit Fachwissen,
Praxiserfahrung und pädagogischem Anspruch. Das Ergebnis sind neun pädagogische Grundlagen, die Orientierung geben und in der konkreten Arbeit mit jungen Menschen als Kompass dienen:
1. Beziehung aufbauen Stabile, wertschätzende und respektvolle Beziehungen sind die Basis, mit der wir junge Menschen in ihrer persönlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung begleiten und fördern können. Eine vertrauensvolle Beziehung zu einer Bezugsperson kann eine wichtige Stütze beim Entdecken der eigenen Interessen und Stärken sein. Funktionär*innen haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion.
2. Gemeinschaft fördern
In einer starken Gemeinschaft lernen wir, Verantwortung zu übernehmen, uns gegenseitig zu unterstützen und Unterschiede als Bereicherung zu sehen. Das kann gelingen, indem wir Verantwortung teilen, füreinander einstehen und gemeinsame Entscheidungsprozesse ermöglichen.
3. Naturbeziehung stärken
Eine starke Naturbeziehung ist wichtig, weil sie nicht nur Gesundheit und Achtsamkeit fördert, sondern auch Kreativität, Umweltbewusstsein und ökologisches Verantwortungsgefühl stärkt. Kinder und Jugendliche sollen Natur hautnah, auch ohne feste Vorgaben, erleben können. Auch das Vermitteln von Naturwissen und die Planung von ökologisch nachhaltigen Angeboten können die Naturbeziehung stärken.

In den vielfältigen Angeboten der Alpenvereinsjugend werden Kinder und Jugendliche dabei unterstützt, ihre eigene Risikokompetenz zu entwickeln. Foto: Heli Düringer

Freiräume zu schaffen – ohne feste Vorgaben und Leistungsdruck - bietet Möglichkeit zur Selbstbestimmung und fördert die Eigenverantwortung. Foto: Anna Repple
4. Lernen ermöglichen
Wir wollen junge Menschen dabei unterstützen, sich selbst, ihre Umwelt und ihre Möglichkeiten aktiv und selbstbestimmt zu entdecken und zu gestalten. Erlebnisorientiertes Lernen, etwa durch Fördern von Neugier und Wecken von Emotionen, ist dafür entscheidend.
5. Freiraum schaffen
Freiräume sind gestaltbare Räume, in denen man sich ohne feste Vorgaben ausprobieren kann. Sie bieten Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und fördern die Eigenverantwortung. In einer geeigneten Umgebung und innerhalb eines sicheren Rahmens kann Kindern und Jugendlichen Zeit gegeben werden, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und ihr eigenes Tempo zu bestimmen.
Eine
starke Naturbeziehung ist wichtig, weil sie nicht nur Gesundheit und Achtsamkeit fördert, sondern auch Kreativität, Umweltbewusstsein und ökologisches Verantwortungsgefühl stärkt. Kinder und Jugendliche sollen Natur hautnah, auch ohne feste Vorgaben, erleben können.
6. Risiko wählen
Risikokompetenz ist lernbar. Wer Grenzen spüren darf, entwickelt Urteilsfähigkeit. Wichtig sind hier Wissen über Risiken, Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung und ein Rahmen, in dem kontrolliertes Ausprobieren möglich ist.
7. Beteiligung leben
Beteiligung bedeutet Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitverantwortung. Damit ist gemeint, dass Kinder und Jugendliche nicht nur angehört, sondern wirklich einbezogen werden. Mit der Möglichkeit, sich in Entscheidungen einzubringen, einer offenen Fehlerkultur und Feedbackmöglichkeiten soll dazu motiviert werden, sich engagiert und aktiv einzubringen.
8. Präventiv arbeiten
Prävention in der Jugendarbeit ist wichtig, um jungen Menschen ein sicheres, gesundes und chancenreiches Aufwach-
sen zu ermöglichen. Ein vorausschauender Rahmen hilft, körperliches und mentales Wohlbefinden zu beachten, Risiken zu erkennen und die Widerstandsfähigkeit junger Menschen zu fördern.
9. Inklusiv handeln
Unter Inklusion verstehen wir einen gleichberechtigten und selbstbestimmten Zugang aller Menschen zu allen Lebensbereichen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten oder Hintergründen. Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der Vielfalt als Bereicherung gesehen wird und jede*r die gleichen Chancen auf Entwicklung, Bildung und Teilhabe erhält.
Der pädagogische Kompass ist dabei kein starres Regelwerk, sondern eine Orientierungshilfe für die Praxis. So bietet er nicht nur den Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, sondern auch Eltern, die mit ihren Kindern und Jugendlichen Tage draußen verbringen, viele konkrete Umsetzungstipps.
Die Tage-draußen!-Plattform
Auf der Tage-draußen!-Website finden sich Filme, Gespräche und weitere Beiträge zum Thema. Die Seite wird in den nächsten Monaten zur Tage-draußen!Plattform weiterentwickelt. So entsteht ein digitaler Ort, der alles, was in der pädagogischen Jugendarbeit im Alpenverein wichtig ist, bündelt. Neben dem pädagogischen Kompass werden hier auch Methoden und kreative Ideen für die Praxis zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte werden ergänzt durch ein Wiki mit vertiefenden Beiträgen sowie einen Blog mit Ideen aus der Sektionsarbeit. So entsteht eine lebendige Sammlung von Wissen, Werkzeugen und Erfahrungen – für eine Jugendarbeit, die wirkt, begeistert und weiterwächst.
Victoria Kanduth ist in der Abteilung Jugend für den Bereich Kinderschutz und Gewaltprävention zuständig.

TOP-ANGEBOT:
Geprüfte*r Bergwanderführer*in • 4 × Hostel • Halbpension • Öffentliche Bustransfers lt. Detailprogramm (Vinschgau Card) • Versicherungen
5 Tage | 8 – 15 Teilnehmer*innen
Termine: 11.10. bis 15.10. | 15.10. bis 19.10. | 19.10. bis 23.10. | 23.10. bis 27.10. | 27.10. bis 31.10. | 31.10. bis 04.11. | 04.11. bis 08.11.2025

Deutsch sprechende*r Bergwanderführer*in • Interrail Bahnticket 2. Klasse • ab/bis beliebigem Bahnhof in Deutschland • 4 × Hotel****, 4 × Hotel/ Gästehaus jeweils im DZ • Frühstück • Busfahrten und Transfers lt. Detailprogramm • Versicherungen
9 Tage | 8 – 12 Teilnehmer*innen
Termine: 20.05. bis 28.05. | 24.06. bis 02.07. | 12.08. bis 20.08.2026
www.davsc.de/ HHTOPVIN www.davsc.de/ UKRAIL
Der Fuß steht etwas wackelig auf einem kleinen Tritt. Die zwölfjährige Eva setzt immer wieder zum nächsten Zug in der Schlüsselstelle an, geht dann doch zurück in die Rastposition und schüttelt die Arme aus. Die ganze Jugendgruppe sitzt am Fuß des Klettergartens und feuert sie an. „Allez Eva! Du schaffst das!“ Sie und ihr Sicherungspartner Tobi tauschen noch einmal Blicke, dann nimmt sie all ihren Mut zusammen und zieht durch. Geschafft! Alle sind aus dem Häuschen. Dieser Moment steckt voller Lernchancen und Entwicklungsmöglichkeiten: Risiko einschätzen, Grenzen überwinden, Vertrauen spüren und gemeinsam freuen.
Für viele Kinder und Jugendliche ist Sportklettern der erste Kontaktpunkt mit dem Alpenverein. Zahlreiche Angebote der Alpenvereinssektionen bieten einen niederschwelligen Zugang, um erste Höhenluft zu schnuppern. Viele Kids sind begeistert und nehmen an Klettergruppen, Kursen oder unseren Aktivitäten im Freien teil.
Bildungsauftrag als Jugendorganisation
Mit rund 200.000 Mitgliedern ist die Alpenvereinsjugend eine der größten verbandlichen Jugendorganisationen in Österreich. Daraus ergibt sich ein umfassender Bildungsauftrag:
„Organisationen der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit verfolgen einen ganzheitlichen und partizipativen Bildungsansatz und verstehen sich als gesellschaftlicher Gestaltungsraum, in dem junge Menschen ihre Talente entfalten können …“ (Bundeskanzleramt zur verbandlichen Jugendarbeit).
Im Leitbild der Alpenvereinsjugend heißt es: „Wir begleiten junge Menschen und Familien bei ihren Tagen draußen und befähigen sie, selbstständig unterwegs zu sein.“ Unsere fünf Bildungsziele sind für uns richtungsweisende Aussagen darüber, was junge Menschen durch unsere Begleitung lernen, erleben und entwickeln können. Sportklettern ist dafür ein starker Lernraum. Der pädagogische Kompass der Alpenvereinsjugend gibt Orientierung fürs praktische Tun (siehe Artikel „Orientierung für Tage draußen!“ auf Seite 22).

Griff für Griff: Sportklettern und die Bildungsziele der Alpenvereinsjugend

Egal ob 4a oder 7c, beim Klettern wächst jede*r an den Herausforderungen. Foto:
Dieser Moment steckt voller
Lernchancen und Entwicklungsmöglichkeiten: Risiko einschätzen, Grenzen überwinden, Vertrauen spüren und gemeinsam freuen.
Wie Klettern pädagogisch wirkt
Mit Klettern unterstützen wir die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen. Ganzheitliche Entwicklung meint die Förderung der körperlichen, emotionalen, sozialen, kognitiven und wertebezogenen Dimension. In unserem Beispiel: Eva löst die Schlüsselstelle (kognitiv), spürt Selbstvertrauen (emotional), vertraut Tobi (sozial), trainiert Bewegungsabläufe (körperlich) und erlebt Sinn (wertebezogen).
Mit Klettern ermöglichen wir Gemeinschaft, Abenteuer und außergewöhnliche Erlebnisse. Die ganze Gruppe fiebert mit. Der Erfolg wird gemeinsam gefeiert, das Erlebnis bleibt lange im Gespräch. Ob am Lagerfeuer oder beim Heimweg – solche gemeinsamen Erfahrungen stiften Zugehörigkeit und bleibende Erinnerungen.
Mit Klettern fördern wir risikobewussten und eigenverantwortlichen Bergsport. Sportklettern erfordert Entscheidungen unter Unsicherheit. Eva hat das Risiko abgewogen, ihre Fähigkeiten eingeschätzt und bewusst entschieden, es zu versuchen. Wir begleiten solche Prozesse mit Austausch, Reflexion und Verantwortung.
Mit Klettern fördern wir Naturbeziehung, Umweltschutz und nachhaltiges Handeln. Viele Klettergärten bieten beeindruckende Naturerlebnisse – am Berg, am Fluss oder im Wald. Wir thematisieren naturschonendes Verhalten, Schutzzeiten, respektvollen Umgang mit Lebensräumen – und machen nachhaltiges Handeln konkret erlebbar.
Mit Klettern ermöglichen wir Mitgestaltung, Engagement und Beteiligung. Ziel, Ort und Ablauf des Ausflugs wurden gemeinsam mit der Gruppe geplant. Vor Ort kön-
nen alle frei wählen, welche Routen sie klettern wollen. Beteiligung schafft Motivation, Verantwortung und Selbstvertrauen.
Fazit: Erlebnisorientiertes Lernen
Sportklettern bietet uns vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung unserer Bildungsziele. Neben technischem Knowhow braucht es dafür vor allem eine bewusste Begleitung. Unterstützt werden kann diese durch den pädagogischen Kompass der Alpenvereinsjugend. Unsere Ausbildungen zur/zum Jugendleiter*in oder Familiengruppenleiter*in bereiten darauf vor. So werden Tage draußen! zu echten Bildungserlebnissen – und das funktioniert nicht nur am Felsen, sondern auch in der Kletter- oder Boulderhalle. Mit einem strahlenden Lächeln wird Eva von ihrem Sicherungspartner abgelassen. Die Jugendgruppe empfängt sie mit High-Fives. Ihr Blick zur Jugendleiterin verrät: Da ist gerade viel passiert. Bildung eben.
David Kupsa ist als pädagogischer Mitarbeiter in der Abteilung Jugend des Österreichischen Alpenvereins für die Funktionär*innenausbildung mitverantwortlich. Im Alpenverein Wattens war er Sportkletterreferent und ist jetzt als stellvertretender Jugendteamleiter aktiv.


Sie fordern, fördern, fangen auf – Herta Gauster und Katharina Bacher stehen sinnbildlich für engagierte Nachwuchsarbeit im Klettersport. Was sie verbindet: viel Erfahrung, wenig Sichtbarkeit – und eine große Leidenschaft.
c hristoph iglhauser
Kletterschuhe schnüren, Chalk drauf, ab an die Wand – so sieht für viele Kinder und Jugendliche ein perfekter Nachmittag aus. Doch damit das klappt, braucht es mehr als bunte Griffe und gute Laune. Es braucht Menschen, die sie begleiten, motivieren, auffangen, fordern – und fördern. Menschen wie Herta Gauster und Katharina Bacher. Zwei Trainerinnen aus unterschiedlichen Generationen, beide verwurzelt im Sportklettern und in der Vereinsarbeit. Was sie verbindet, ist nicht nur die Leidenschaft fürs Klettern, sondern auch ein klarer Blick auf das, was es braucht, damit Nachwuchsarbeit im Verein gelingt – und zukünftig noch besser gelingen kann.
Dranbleiben mit Herz und Haltung
Herta Gauster trainiert seit über 30 Jahren Kinder und Jugendliche beim Alpenverein Gebirgsverein in Wien. Neben vielen Talenten hat sie vor allem eines aufgebaut: eine Trainingskultur, die über die Kletterwand hinausreicht. „Ich glaube, ich werde mein Leben lang beim Klettern bleiben, weil ich die Bewegung einfach an sich super finde. Meine Begeisterung will ich weitergeben“, sagt sie. Katharina Bacher ist
^ Salzburger Landesmeisterschaft Vorstieg Saalfelden. Foto: Marleen Huber
zwar wesentlich jünger, verfolgt in ihrer Arbeit beim Alpenverein Kuchl (Salzburg) aber eine ganz ähnliche Herangehensweise. Sie trainiert die Wettkampfgruppe – mit viel Struktur und noch mehr Gespür. „Mich reizt die Vielfalt – im Sport und in den Persönlichkeiten. Jeder braucht etwas anderes, und das muss man erkennen.“
Beide wissen, dass Trainer*innen heute weit mehr leisten müssen als nur den Klettersport zu vermitteln. Und die Herausforderungen wachsen. Die Anforderungen im Nachwuchsleistungssport sind hoch,

»Wenn sie das Gefühl haben, wir wissen nicht, was los ist, dann funktioniert das Training nicht –Kinder merken das sofort. Chaos
ist vorprogrammiert. «
die Wege zum Erfolg sind komplexer geworden: „Heute hat ein Späteinsteiger mit 15 schon acht Jahre Trainingsrückstand“, erklärt Gauster. Und gleichzeitig will sie keines der Kinder verlieren – weder die besonders Talentierten noch die, die „einfach gern kommen, weil sie Spaß am Sport haben“.
Fair für alle
Ähnliche Gedanken macht sich Bacher. Ihre Motivation? „Ich finde es total spannend, mit einer Gruppe von ganz unterschiedlichen Charakteren zu arbeiten. Jede und jeder bringt etwas anderes mit, und ich versuche, diese Stärken zu entdecken und zu fördern.“ Für Bacher ist die größte Herausforderung, allen das Gefühl zu geben, gleich wichtig zu sein. „Gerade in einer Leistungsgruppe kann es schnell passieren, dass Kinder sich vergleichen und glauben, sie seien ‚nicht gut genug‘. Dagegen arbeite ich aktiv an“, sagt sie überzeugt.
Struktur hilft ihr dabei: Jedes Training wird detailliert geplant, abgestimmt, dokumentiert. Auch für die Co-Trainer*innen, die sie unterstützen. „Wenn sie das Gefühl haben, wir wissen nicht, was los ist, dann funktioniert das Training nicht –Kinder merken das sofort. Chaos ist vorprogrammiert.“
‹ Salzburger Landesmeisterschaft Bouldern Stadt Salzburg. Foto: Thomas Kössl > Foto: Heiko Wilhelm
Katharina Bacher
Trotzdem bleibt viel „Learning by Doing“, wie beide betonen. Erfahrung, Fingerspitzengefühl, die Fähigkeit zuzuhören – das alles kann man nicht in einem Kurs lernen. Aber es hilft, wenn man Teil eines Teams ist.
So wie bei Gauster, die mit bis zu fünf Trainer*innen gemeinsam arbeitet: „weil man sich absprechen, auffangen und vertreten kann“. Oder wie bei Bacher, die in einem eingespielten Team mitarbeitet –„auch wenn der Zuwachs an neuen Trainer*innen leider sehr spärlich ist.“
Nachsatz: „Wer als junge Trainerin anfängt, sollte wissen: Es geht nicht nur ums Klettern. Es geht um Organisation, Kommunikation, Beziehungspflege. Und vor allem: Man muss lernen, loszulassen. Die Kinder gehen ihren eigenen Weg – wir können sie begleiten, aber nicht lenken.“
Zwischen Ehrenamt und Realität
Zeitaufwand, Entschädigung, Motivation. Für beide ist klar: Ehrenamt allein reicht nicht. Es gehört neben den Aufwandsentschädigungen viel mehr dazu. „Ich habe das nie komplett unbezahlt gemacht“, sagt Gauster offen. „Es sind einfach viele Aufgaben, die erledigt werden müssen, nach außen hin aber nicht sichtbar sind. Das ist das Fundament für unser Schaffen. Je genauer wir unsere Dinge vorbereiten, umso leichter und angenehmer laufen dann viele Dinge.“
Auch Bacher sieht die Problematik. „Ihrer Meinung nach braucht es mehr geteilte Verantwortung: „Oft übernehmen Trainer*innen zehn Aufgaben auf einmal. Wenn man das auf mehrere Schultern aufteilen könnte, würde der Einstieg viel leichter und sicherlich die Qualität noch steigen.“
Ohne den Alpenverein läuft vieles nicht –da sind sich Herta Gauster und Katharina Bacher einig. Für Gauster ist der Alpenverein Gebirgsverein seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner: Trainingsmöglichkeiten in der vereinseigenen Halle, finanzielle Unterstützung, keine Eintrittskosten für die Kinder und regelmäßige Präsenz in der Vereinszeitung. „Ohne diese Rückendeckung gäbe es unsere Gruppe in der Form nicht“, ist sie überzeugt.
Auch Katharina Bacher sieht im Alpenverein weit mehr als nur einen Dachverband: „Wir spüren schon, dass wir Teil von etwas Größerem sind – das gibt Sicherheit.
Aber es braucht auch Strukturen, damit wir vor Ort arbeiten können.“ Gerade in kleineren Gemeinden sei es wichtig, dass Verein und Hallenbetreiber am gleichen Strang ziehen. Auch der Kletterverband Österreich spielt dabei eine wichtige Rolle, wenn es um strukturelle Unterstützung und gezielte Nachwuchsförderung geht. Was Gauster hervorhebt: „Unterstützung ist keine Einbahnstraße. Damit Förderungen, Trainingszeiten oder Berichte entstehen, muss jemand aus dem Trainer*innenteam dranbleiben – organisieren, kommunizieren, nachhaken.“ Sichtbarkeit fällt nicht vom Himmel. Und die Basis dafür ist oft ehrenamtlich organisiert – mit viel persönlichem Einsatz.
Wunsch nach Sichtbarkeit
Was in kleinen Vereinsgruppen geleistet wird, bleibt oft unsichtbar – trotz zahlreicher Erfolge, trotz engagierter Menschen. Dabei brauchen die Vereine und die Lan-

» Unterstützung ist keine Einbahnstraße. Damit Förderungen, Trainingszeiten oder Berichte entstehen, muss jemand aus dem Trainer*innenteam dranbleiben – organisieren, kommunizieren, nachhaken. « Herta Gauster
desverbände die Breite, um auch zukünftig Spitzensport zu ermöglichen. „Die Arbeit in den kleinen Gruppen ist das Fundament“, sagt Gauster. „Ohne sie gäbe es keine Weltcupsieger.“
Und Bacher ergänzt: „Ich wünsche mir, dass mehr gemeinsam gedacht und gearbeitet wird – nicht nur wirtschaftlich, sondern im Sinne einer echten Vereinsentwicklung.“ Sie sieht viele Vereine, die noch in alten Strukturen stecken – mit wenig Raum für neue Ideen oder flexible Modelle. „Die Gesellschaft verändert sich. Da muss auch das Ehrenamt neue Wege finden. Wenn das gelingt, können wir alle mit viel positiver Energie in die Zukunft schauen und neue Impulse einbringen.“
Und der schönste Moment?
Herta Gauster muss nicht lange überlegen: „Anna Bolius stand vor ihrem zweiten Jugend-Europacup, dem ersten außerhalb von Österreich. Kurz vor der Abreise sind wir noch ins Plaudern gekommen: ‚Herta, du hast einen schönen Rucksack.‘ Ich habe dann nur geantwortet: ‚Wenn du am Stockerl stehst, gehört er dir.‘ Wir haben beide gelacht – und dann hat sie tatsächlich gewonnen.“ Der Rucksack wechselte die Besitzerin – und das Vertrauen gleich mit. Eine dieser Geschichten, die zeigen, was möglich ist – wenn jemand da ist, der an dich glaubt!
In dieselbe Kerbe schlägt auch Bacher: „Es waren nie die größten Talente, die mir am meisten bedeutet haben, sondern jene, bei denen man merkt: Da kämpft jemand, da wächst jemand. Wenn so ein Kind plötzlich aufblüht, weil du fest daran geglaubt hast – das sind für mich die schönsten Momente. Die bleiben einfach im Kopf hängen und geben so viel Motivation. Und genau dafür opfern wir so viel Zeit.“
Klettern ist nicht nur eine Sportart – es ist ein Raum für Entwicklung, Herausforderung, Beziehung. Und gute Trainerpersönlichkeiten sind mehr als Technikprofis –sie begleiten junge Menschen auf ihrem Weg durchs Leben. Dass es sie braucht, ist klar. Dass man sie unterstützen muss, noch viel mehr.
Christoph Iglhauser ist für die Medienarbeit im Kletterverband Österreich zuständig.

Klettergruppe oder Trainingsgruppe?
Der Fokus im Alpenverein liegt auf der Durchführung von Klettergruppen, die Kindern und Jugendlichen die Freude am Klettern und Bewegung vermitteln sowie Gemeinschaft erleben lassen. Die Werte und Bildungsziele der Alpenvereinsjugend (siehe Artikel in diesem Heft) sowie Kinderschutz sind uns in allen Angeboten wichtig, sowohl in den Klettergruppen als auch den Trainingsgruppen. Die Klettergruppen sollen regelmäßig stattfinden und von qualifizierten Übungsleiter*innen oder Jugendleiter*innen geleitet werden.
Die leistungsorientierte Trainingsgruppe kann motivierte Kinder ab etwa 7 Jahren gezielt auf Wettkämpfe vorbereiten. Mehrmals pro Woche wird strukturiert an Technik, Kraft, Koordination und mentaler Stärke gearbeitet – mit enger Einbindung der Eltern. Außerdem wird regelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen. Trainer*innen sollten mindestens die Instruktorausbildung, idealerweise die Leistungssport- oder Trainerausbildung haben.
Ausbildungen für Trainer*innen im Sportklettern
Der Österreichische Alpenverein, die Bundessportakademie (BSPA) und der Kletterverband Österreich (KVÖ) bieten gemeinsam ein abgestuftes und aufeinander aufbauendes Ausbildungssystem:
• Übungsleiter*in Sportklettern (5 Tage, Alpenverein-Akademie): Einstieg in Kinder- und Anfängerkurse, Mitarbeit in Trainingsgruppen.
• Jugendleiter*innenausbildung mit Modul Klettern (8,5 Tage, Alpenvereinsjugend): Erlebnisreiche Jugendarbeit beim Klettern gestalten, Pädagogische Grundlagen
• Instruktor*in Sportklettern Breitensport (21 Tage, BSPA & alpine Vereine): Leitung von Kursen für alle Altersgruppen, Grundlagentraining auch für ambitionierte Hobbykletternde.
• Instruktor*in Sportklettern Leistungssport (14 Tage, BSPA & KVÖ): Planung und Durchführung leistungsorientierter Trainings für junge Talente.
• Trainer*in Sportklettern (staatlich geprüft) (3 Semester, BSPA & KVÖ): Coaching von Spitzensportler*innen, Trainingssteuerung, Wettkampfbetreuung.

Herta Gauster in ihrem Element: Unterwegs mit ihrer Klettergruppe und beim Training in der Halle.
Fotos: (oben) Archiv Alpenverein Gebirgsverein, (links) Archiv H. Gauster
Alpenverein & Kletterverband: ein starkes Team
Der Österreichische Alpenverein und der Kletterverband Österreich (KVÖ) sind starke Partner und arbeiten im Bereich des Wettkampfkletterns eng zusammen. Während der Alpenverein vor allem in der Nachwuchsarbeit aktiv ist – sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport – liegt der Fokus des Kletterverbands auf dem Spitzen- und Wettkampfsport auf nationaler und internationaler Ebene. Der Alpenverein bietet Kindern und Jugendlichen ein breites Spektrum an Möglichkeiten: von regelmäßigen Trainingsgruppen über gezielte Wettkampfbetreuung bis hin zur Organisation regionaler und nationaler Nachwuchswettkämpfe.
Im Unterschied zu anderen Ländern wie etwa Deutschland gibt es in Österreich seit 2005 einen eigenständigen Kletterverband. Der Kletterverband Österreich wurde gegründet, um das Sportklettern als Leistungsund Wettkampfsport konsequent weiterzuentwickeln und zu fördern. Dabei orientiert sich der KVÖ an den Werten der olympischen Bewegung und setzt sich gezielt für die Weiterverbreitung und Professionalisierung des Klettersports ein.

Klettersteige bieten eine großartige Möglichkeit eines unvergesslichen Bergabenteuers für die ganze Familie. Damit aus dem gemeinsamen Klettersteigausflug in den steilen Fels aber ein Top-Erlebnis und kein Flop-Erlebnis wird, gilt es einige Dinge zu beachten. g erhard mössmer
Ab wann macht es Sinn, mit Kindern Klettersteige zu begehen? Hierfür ist weniger das Alter als vielmehr die Entwicklungsstufe des Kindes entscheidend. Das Schöne am Klettersteiggehen ist, dass die meisten Kinder die dafür erforderlichen Voraussetzungen wie Beweglichkeit und die Freude an der kletternden Fortbewegung mit Armen und Beinen von Haus aus mitbringen. Zusätzlich sind ein gewisses Maß an Kraft, Kondition und Trittsicherheit sowie Schwindelfreiheit notwendig. In der Regel bringen Kinder diese Fähigkeiten ab ca. sechs Jahren mit, um mit ihren Eltern gemeinsam einfache (Übungs-)Klettersteige zu begehen. Allerdings gilt es zu bedenken, dass die meisten Klettersteige nicht explizit für Kinder gebaut wurden. Dies kann an manchen Stellen – besonders ungut sind dann Quergänge – dazu führen, dass Kinder das Stahlseil bzw. die Trittklammern gar nicht oder nur schwerlich erreichen.
Welche Ausrüstung ist notwendig?
Die 2017 novellierte EN 958 für Klettersteigsets bietet leichten Personen ab 40 kg einen deutlich besseren Schutz vor schwersten Verletzungen durch einen geringeren Fangstoß1. Können Kinder ihr Klettersteigset bereits selbstständig und zuverlässig bedienen und sind sie sicher genug am Klettersteig unterwegs, dass sie nicht mehr mit einem Kletterseil hintersichert werden müssen, ist es wichtig, dass sie auch ein Set der „neuen“ Norm entsprechend verwenden (… und nicht das „alte“ von Mama oder Papa). Zudem muss auf eine gute Bedienbarkeit der Verschlusskarabiner geachtet werden. Für kleine Kinderhände eignen sich dafür Karabiner mit sogenannter BallenDaumen-Öffnung besonders gut.
1
Sind die Kinder noch zu klein, um selbst ein Klettersteigset zu bedienen, und zudem zu leicht (also unter 40 kg), dass wir davon ausgehen müssen, dass das Klettersteigset auch nach der neuen Norm seine volle Dämpfungsfunktion nicht entfalten kann, müssen wir sie permanent mit einem Kletterseil gegen Absturz sichern. In diesem Fall hängt das Kind dann nur einen Lastarm des Klettersteigsets in das Stahlseil ein, da die eigentliche Sicherung über
das Kletterseil erfolgt. Der zweite Lastarm wird in der Materialschlaufe versorgt.
Wie beim Klettern auch eignen sich für kleine Kinder spezielle Kinderklettergurte mit Hüft-Brustgurt-Kombi sehr gut. Sind die Kinder größer, reicht ein einfacher Kinderklettergurt ohne Brustgeschirr. Wichtig ist, dass der Gurt gut über der Hüfte sitzt. Den Helm betreffend verwenden wir bitte Steinschlaghelme und keine Radhelme – weder für uns noch für unsere Kinder.
Die Tourenplanung ist der Schlüsselfaktor.
Kindergerechte Klettersteige mit moderatem Zu- und Abstieg vermeiden Überforderung. Ist es der erste Klettersteig für die Kinder, darf dieser auf keinen Fall zu schwer und/oder zu lange sein. Überforderung muss unbedingt vermieden und der eigene Ehrgeiz hintenangestellt werden, denn sonst ist das Thema Klettersteig für die nächsten Jahre bei den Kids ad acta gelegt.
Ausgezeichnet geeignet für den Beginn der Klettersteigkarriere – vor allem für die Kleineren – sind spezielle Kinderund Übungsklettersteige. Sie sind meist leicht erreichbar im Tal, im Bereich von Hütten oder von Seilbahnstationen angesiedelt. Zudem verlaufen sie oft wenig exponiert in Bodennähe oder an großen Blöcken, von wo aus man die Kinder gut betreuen und den Klettersteig auch jederzeit abbrechen kann. Gespickt mit Erlebniselementen wie geschnitzten Tieren, Holzplattformen und Brücken etc. erlernen die Kinder spielerisch den Umgang mit der Materie Klettersteig.
Für etwas größere Kinder gibt es inzwischen eine gute Auswahl an „richtigen“, aber kindergerecht gebauten Klettersteigen, bei denen Trittstufen und Sicherungsseile in entsprechend nahen Abständen angebracht sind. Zusätzlich steigern Seilbrücken über Wasserfälle oder Seilrollen über Schluchten etc. Begeisterung und Erlebnisfaktor.
Zustieg und Klettersteig sollen eine überschaubare Länge haben, möglichst frei von objektiven Gefahren wie Steinschlag sein und eventuell auch Ausweichoder Abbruchmöglichkeiten bieten, denn Kinder ermüden schneller und können von einer Minute auf die andere die Lust verlie-
ren. Im Idealfall wartet am Ende des Klettersteiges eine „Belohnung“ wie die Knödelsuppe auf der Hütte oder die Jause an einem gemütlichen Platzerl, wo die Kinder gefahrlos rasten bzw. herumsausen können. Da bei Kindern die Konzentration mit Fortdauer der Zeit nachlässt, ist es wichtig, dass wir auch Augenmerk auf den Abstieg legen: Dieser soll möglichst einfach und nicht absturzgefährdet sein und wiederum eine überschaubare Länge haben.
Da man mit Kindern immer mehr Zeit braucht, ist auf Wetterbericht und Wetterentwicklung im Tagesverlauf besonders zu achten. Drohen am Nachmittag Gewitter, verzichten wir von vornherein auf die Tour. Im Hochsommer sind kühle, schattige Ziele – z. B. Klettersteige in Schluchten – jenen in prallen Südwänden vorzuziehen. Kinder haben zudem einen höheren Flüssigkeitsbedarf als Erwachsene und dehydrieren in der Hitze schneller, weshalb wir auch ausreichend zu trinken mit dabeihaben.
Bei Kindern, die selbst noch kein Klettersteigset bedienen können, ist der Betreu-
ungsschlüssel „eins zu eins“, das heißt, auf ein Elternteil kommt ein Kind. Sind wir mit zwei Kindern unterwegs, muss eines der beiden Kinder ein Klettersteigset sicher selbst bedienen können. Dass das Eigenkönnen des betreuenden Elternteils weit über den Anforderungen des Klettersteigs steht, versteht sich von selbst.
Bevor der ganze Spaß losgeht, zeigen wir den Kindern kurz anhand des Topos und des Geländes, wo’s langgeht, wie lange die Gaudi in etwa dauert und dass sie darauf achten, keine Steine loszutreten. Trinken, Pinkelpause und Einschmieren am Start ist zwar nicht elementar, erleichtert uns das Leben am Klettersteig aber ungemein. Viel wichtiger hingegen ist ein steinschlag- und absturzsicherer Ort, an dem wir die Klettersteigausrüstung anlegen und abschließend bei den Kids noch einmal im Sinne eines Partnerchecks Gurt, Klettersteigset, Helm und Seil checken. Zu guter Letzt instruieren wir die Kinder noch am Einstieg, wie sie mit dem Klettersteigset umgehen.
Gerhard Mössmer ist Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.
Klettersteigkarabiner mit „BallenDaumen-Öffnung“ eignen sich für Kinder besonders gut: Sie sind leicht zu bedienen und die Finger sind beim Einhängen ins Stahlseil nicht im Weg.

Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit sowie Schwindelfreiheit und Mut sind ausschlaggebend, ob und welche Klettersteige man mit seinen Kindern begehen kann.

Damit wir mit unseren Kindern sicher am Klettersteig unterwegs sein können, stehen uns je nach Alter und Können der Kinder unterschiedliche Sicherungstechniken zur Verfügung. Dabei bedarf es ein hohes Maß an seiltechnischem Know-how für den Elternteil. 5 Tipps vom Bergsport, Teil 13.
g erhard mössmer
Je nach Können, entscheiden wir uns für unterschiedliche Sicherungstechniken:
a) Unser Kind ist noch zu klein, um ein Klettersteigset zu bedienen (links) und
b) Das Kind kann das Klettersteigset bereits selbst bedienen (rechts).

1Abschleppen
Ist unser Kind noch zu klein, um ein Klettersteigset zuverlässig selbst zu bedienen, hintersichern wir es mittels Kletterseil. Dafür binden wir das Kind direkt mittels Achterknoten und nicht mit Karabiner in den Anseilring des Klettergurtes ein. Im leichteren, meist flachen Gelände (bis Schwierigkeitsgrad B) können wir das Kind straff „abschleppen“, indem es in einem Abstand von ca. eineinhalb Metern unmittelbar mit dem Elternteil verbunden ist.
Solange das Kind leicht2 genug ist, kann die Technik ohne ausführliche Unterweisung in das Halten von Stürzen am „kurzen Seil“ angewandt werden. Achtung: Der erwachsene Begleiter muss dabei jederzeit selbst mit dem Klettersteigset gegen einen Absturz durch Mitreißen gesichert sein. Durch den geringen Abstand zum Kind kann man auch jederzeit beim Umhängen behilflich sein, es durch Zug am Seil in etwas steileren Passagen unterstützen und ihm die Hand reichen. Zudem hat man immer direkten Kontakt zum Kind und kann es auch psychologisch gut betreuen. Wichtig ist, dass das Seil zwischen
In Quergängen wird das Sicherungsseil mittels Karabiner nach oben umgelenkt. Diese Technik bietet sich auch bei Zweiseilbrücken sehr gut an.

Kind und Elternteil immer gespannt bleibt, um einen echten Sturz des Kindes von vornherein zu unterbinden.
2
Umlenken bringt’s
In Quergängen oder auf Seilbrücken wird das Sicherungsseil mittels mitlaufendem Karabiner am Stahlseil umgelenkt, sodass für das Kind eine Zugrichtung nach oben gewährleistet ist. Zusätzlich ist das Kind ohnehin noch mit seinem Klettersteigset gegen Wegpendeln gesichert.
3
Alles Gute kommt von oben
In längeren, senkrechten Passagen (ab B/C) kann es Sinn machen, das Kind mittels HMS vom Fixpunkt aus nachzusichern. Der Erwachsene klettert die Passage vor, während das Kind gesichert an einer bequemen Stelle wartet. Von oben über die HMS gesichert, klettert das Kind schließlich nach. Wichtig ist, dass sich der zu kletternde Abschnitt in Falllinie befindet, um ein Wegpendeln des Kindes zu vermeiden. So kann das Kind auch auf das Ein- und Aushängen seines Klettersteigkarabiners verzichten, was die Sache
In steileren Passagen (ab Schwierigkeitsgrat B/C) können wir vom Fixpunkt mittels HMS nachsichern. Wichtig ist, dass sich das Kind in Falllinie befindet und nicht wegpendeln kann. Auf das Einhängen des Klettersteigkarabiners des Kindes kann verzichtet werden.

gerade in steileren, anspruchsvolleren Passagen erheblich erleichtert.
4
Schub von hinten
Ist das Kind im Umgang mit dem Klettersteigset fit, kann dieses ohne zusätzliche Hintersicherung durch ein Kletterseil in Begleitung eines Erwachsenen – nun auch im Rahmen einer geführten Tour – Klettersteige seines Könnens meistern. Dabei befindet sich die Begleitperson in der Regel direkt hinter dem Kind. So kann sie dem Kind Tritte ansagen, am Stahlseil heruntergerutschte Karabiner wieder nach oben reichen oder eventuell einmal Schub geben. Zusätzlich kann man durch die Nähe zum Kind psychologisch gut unterstützen.
5
Backup im Rucksack
Sind die Kinder fit und geübt im Klettersteiggehen, kann in weiterer Folge ein Erwachsener auch mehrere Kinder (bis 4) noch gut betreuen. In diesem Fall klettert der Erwachsene dann als Erstes und für etwaige Hilfestellungen führt die Begleitperson redundant immer noch ein Sicherungsseil im Rucksack mit.
Ist das Kind fit in der Bedienung des Klettersteigsets und den Schwierigkeiten des Klettersteigs gewachsen, kann es diesen ohne Hintersicherung begehen. Die Begleitperson befindet sich für moralische und klettertechnische Unterstützung knapp hinter dem Kind. Für Notfälle ist das Seil im Rucksack.


SAB Booklet Klettersteig Mit dieser Lehrschrift reagiert der Alpenverein auf die anhaltende Klettersteig-Begeisterung. Anschaulich, prägnant und umfassend werden die praxisrelevanten Aspekte des Klettersteiggehens dargestellt. 12,90 €

KOHLA Kinderrucksack Stuhleck 15 l Wasserabweisender und farbechter Rucksack für Kids mit ausreichend Stauraum für Wanderungen und Ausflüge. Highlight: Murmele-Anhänger mit Karabiner und buntes Edelweiß. 49,90 €
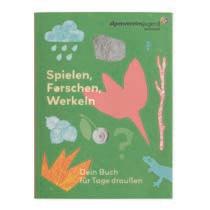
Spielen, Forschen, Werkeln … das Buch als kleiner Begleiter für Tage draußen, mit Anregungen zum Forschen, Werkeln und Spielen. Jeder, der sich mit Kindern draußen bewegt, wird eine Fülle von Ideen finden. 7,90 €

Vorsprung durch Fahrtechnik: In Ottensheim (OÖ) hat die Alpenvereins-Ortsgruppe gemeinsam mit der Gemeinde einen Mountainbike Skill Park geschaffen, der Kindern und Jugendlichen sicheres und spaßbetontes Radfahren ermöglicht – fernab von Leistungsdruck, aber nah an der Praxis. Ein Leuchtturmprojekt, das zeigt, wie niederschwellige Infrastruktur Bewegung, Selbstvertrauen und Gemeinschaft fördern kann. h einz z echner, r ené s endlhofer- s chag

Mountainbiken ist mehr als nur Radfahren: Um auch wieder heil vom Berg herunterzukommen, ist die richtige Fahrtechnik entscheidend. Diese erlernt man bei Profis in einem Kurs und durch ständiges Üben: an der Kreuzung mal versuchen, den Fuß nicht abzustellen, sondern zu balancieren. Oder die Stufe zuhause in den Garten nicht schiebend, sondern im Sattel zu bewältigen. Wer weder Stufen noch Kreuzungen vor der Haustüre hat, begibt sich am besten in einen Skill Park – ein Areal mit unterschiedlichen Trails und Hindernissen für alle Könnerstufen.
Besonders für unsere Kinder und Jugendlichen sind Skill Parks und Pumptracks eine einzigartige Möglichkeit, im
Der Mountainbike Skill Park Ottensheim eingebettet ins Rodlgelände, im Hintergrund das Schloss Ottensheim.
sicheren Rahmen ihr Können am Rad zu erweitern. Das sorgt nicht nur für mehr Spaß am Trail, sondern auch für erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr. In Österreich hat nahezu jedes Dorf einen Fußballplatz, aber legale Infrastruktur zum Mountainbiken fehlt. Dabei ist Mountainbiken die zweithäufigste Sportart im Österreichischen Alpenverein und findet nicht nur am Berg statt.
Das Rad erweitert den Bewegungsradius unserer Jüngsten, gibt ihnen Selbstvertrauen und stärkt die Eigenverantwortung. Niederschwellige Angebote wie Übungsplätze wirken daher wie ein Magnet und entwickeln sich rasch zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. Was in den 1990ern die Skateparks waren, sind nun Pumptracks und Skill Parks.
Gut eingebettet in das „Dorfleben“ und die bestehende Infrastruktur rundherum, sind sie kein Spielplatz für eine Trendsportart, sondern Motor gesunder Bewegung. Ein Pumptrack ist darüber hinaus, je nach Untergrund (Schotter, Asphalt, …), nicht nur Biker*innen vorbehalten, sondern eignet sich auch zum Befahren mit Skateboards und Scootern. >

Einen großen Skill Park hat die Ortsgruppe Ottensheim (Alpenverein Linz) in Oberösterreich gemeinsam mit der Gemeinde entwickelt. 2015 entstand die Idee, Kindern das Radfahren spielerisch und ohne Leistungsdruck näherzubringen – bei einer Veranstaltung des Alpenvereins. Anders als in den meisten konventionellen Radclubs sollten nicht das verbissene Training und der Wettkampf im Vordergrund stehen, sondern der Spaß daran, den Sport in Gemeinschaft zu erleben.
Anfangs wurde der wöchentliche Biketreff auf einer Wiese abgehalten – mit Wasserflaschen als improvisierte Trainingsgeräte. Später entstanden aus Europaletten und Schaltafeln die ersten Parcours. Stetig kamen neue Kinder, um mitzumachen, und gleichzeitig formierte sich ein kleines Team an Trainer*innen. Um die jungen Biker*innen bestmöglich betreuen zu können, wurden die Ausbildungen der Alpenverein-Akademie in Anspruch genommen. Vom Übungsleiter MTB bis zu den Updates „New Kids on the Bike“, „Technische Trails“ und „Enduro“ haben die Trainer*innen alles besucht.
Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde konnte 2022 schließlich im Rahmen eines LEADER-Projektes im Freizeitpark Rodlgelände auf 5.000 m² ein MTB Skill Park verwirklicht werden.
Die Sportanlage wurde mit finanzieller Unterstützung von Bund, Land und aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums errichtet.
Nachhaltig und natürlich
Bei der Planung wurde darauf Wert gelegt, dass ausschließlich Naturmaterialien wie Steine, Holz und Granitbruch verwendet werden. Die Anlage teilt sich in eine Skill Area und einen Skill Trail auf. Dadurch bietet sie für alle Könnerstufen die nötige Abwechslung und kann auch von mehreren Gruppen gleichzeitig genutzt werden. Entlang der Skill Area sind einzelne Stationen wie Bodenwellen, kleine Stufen, Steinfelder und Stege zum Erlernen der Balance aufgebaut, die hintereinander oder auch einzeln befahren wer-

den können. Auf den Skill Trails kann das Gelernte gleich im Gelände weiter geübt und verfeinert werden. Die Trails ziehen sich entlang der Böschung, und auch dort sind einige Hindernisse wie Steine, Stufen und Kehren eingebaut.
Die Sportanlage wird mittlerweile auch sehr gerne von anderen Vereinen und MTB-Trainer*innen der Umgebung für Kurse und Schulungen genutzt. Am Skill Park kann die Geschicklichkeit am Rad verbessert und Grundfertigkeiten wie Balance, Fahren über unebenen Untergrund und zum Beispiel Wenden auf engem Raum trainiert werden.
Das MTB-Team der Ortsgruppe Ottensheim ist neben den Trainings und Touren (die von Ostern bis Oktober immer mehrmals die Woche stattfinden) auch sehr intensiv mit der Pflege und Weiterentwicklung des Skill Parks beschäftigt.
Das Rad erweitert den Bewegungsradius unserer Jüngsten, gibt ihnen Selbstvertrauen und stärkt die Eigenverantwortung. Niederschwellige Angebote wie Übungsplätze wirken daher wie ein Magnet und entwickeln sich rasch zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.
‹ ‹ Aufstellung zum beliebten Schneckenrennen, das (fast) zu jedem Trainingsabschluss gehört, 2025.
‹ Die Kids shapen sehr gerne selbst auf der Trailstrecke, hier beim Tabletop, 2024.
› Balanceübung auf einem gefinkelten Kurvenkurs, 2024.

Mit Unterstützung der regionalen Gewerbebetriebe, des Bauhofs und den vielen fleißigen Händen einer großartigen Community werden ständig neue Hindernisse wie Anlegerkurven, kleine und größere Tables sowie ganz aktuell drei Drops aus Holz realisiert.
Bei den Arbeitseinsätzen helfen alle mit – vom Kindergartenkind bis zu den Großeltern – und im Anschluss sitzt man gemütlich am Lagerfeuer beisammen und ist gedanklich bereits bei den nächsten
Projekten. In Ottensheim werden laufend neue Ideen verwirklicht, damit der kleine Bike Park dazu beiträgt, junge Biker*innen zu motivieren und bestmöglich für die großen Abenteuer auf den Trails dieser Welt vorzubereiten.
Heinz Zechner ist ehrenamtlicher Mountainbike-Referent der Ortsgruppe Ottensheim.
René Sendlhofer-Schag ist hauptamtlicher Mitarbeiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein.
Neugierig geworden? Alle Termine, Touren und Angebote der Ortsgruppe Linz-Ottensheim gibt es online.
Mehr Infos www.alpenverein.at/ linz-ottensheim
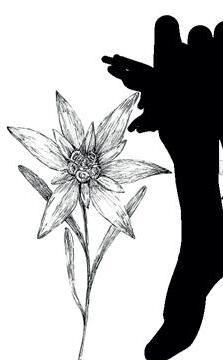

Mit der Sonderbriefmarke „Edelweiß reloaded“ legt die Post nach 20 Jahren ein ganz besonderes Sammelstück als 3D-Druck wieder auf. Damit wird die Symbolkraft der Alpenblume, die für Mut, Liebe, Erfolg und Naturverbundenheit steht, auf einzigartige Weise spürbar. Pflück auch du dir dein persönliches Exemplar – jetzt in deiner Postfiliale oder auf post.at/onlineshop
Was sind Kinderrechte?
Kinderrechte sind besondere Menschenrechte, die für Menschen unter 18 Jahren gelten. Sie wurden 1989 in der UNKinderrechtskonvention festgelegt, welche Österreich 1992 ratifizierte und sich somit zur Einhaltung der Kinderrechte bekannte. Dazu gehören beispielsweise das Recht auf Bildung, Freizeit und Spiel, Gesundheitsversorgung oder Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Seit 2011 sind einzelne Kinderrechte auch in der österreichischen Verfassung verankert – etwa das Recht auf Schutz vor Gewalt, das Kindeswohlprinzip und das Recht auf Entwicklung und Beteiligung.
Was sagt Art. 31 der UN-Kinderrechtskonvention?
Ein zentrales Element ist auch das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel. Dieses ist in Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention verankert und stellt sicher, dass Kinder nicht nur Schutz und Förderung genießen, sondern auch ausreichend Gelegenheit haben, sich zu erholen, zu spielen und an kulturellen sowie künstlerischen Aktivitäten teilzunehmen. Für viele von uns mag dieses Kinderrecht selbstverständlich klingen. Jedoch haben weltweit betrachtet zahlreiche Kinder aufgrund von Krisen, Kriegen oder Naturkatastrophen keinen adäquaten Zugang zu angemessener Freizeit oder sicheren Spielbereichen. Ein weiterer Hauptgrund, warum Kinderrechte verletzt werden, ist Armut. In Österreich sind rund 344.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet, das entspricht 21 Prozent. Dadurch verringert sich nicht nur der Zugang zu angemessener Bildung und entsprechender Gesundheitsversorgung. Sie führt auch dazu, dass viele Kinder nicht an Freizeitangeboten teilnehmen können und somit weniger Chancen auf soziale Teilhabe haben.
Wie sieht es konkret mit der „Frei-Zeit“ aus?
Wir erleben gleichzeitig eine gesteigerte Leistungsorientierung und den Trend, die Freizeit der Kinder und Jugendlichen durchzutakten. Häufig mit dem gut gemeinten Ziel, Kinder bereits früh zu fördern, entstehen so Tage, an denen sich eine Aktivität an die nächste reiht und Kindern und Jugendlichen Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Zwischen Gitarrenunterricht, Hausaufgaben, Kinderturnen und Kletterkurs bleibt dann häufig wenig Zeit für Pause und Erholung. Auch das freie Spiel, ohne feste Vorgaben, kommt häufig zu kurz oder wird als vertane Zeit angesehen. Dabei bietet es wichtige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten und fördert die Kreativität.
Und was macht die Alpenvereinsjugend?
Das freie Spiel in der Natur hat in der Familienarbeit und in den Kindergruppen der Alpenvereinsjugend einen hohen Stellenwert. Zudem wollen wir weiterhin möglichst einfach zugängliche und kostengünstige Angebote schaffen, die Kindern und Jugendlichen sowohl einfache Teilhabe an unseren Aktivitäten ermöglichen als auch Freiräume schaffen, in denen sie bedingungslos, ohne Leistungsdruck, ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen können.

v ictoria k anduth ist als Mitarbeiterin in der Alpenvereinsjugend für den Bereich Kinderschutz und Gewaltprävention zuständig.
Quellen: www.kinderhabenrechte.at/ die-un-kinderrechtskonvention/ bjv.at/wp-content/uploads/2019/09/ un_konvention_ueber_die_rechte_des_kindes.pdf bjv.at/kinder-jugend/kinderrechte/ www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer= 20007136 www.worldvision.de/aktuell/ 2023/04/so-werden-kinderrechte-verletzt www.volkshilfe.at/armut-kinderarmut/

Wolfgang s chnabl Alpenvereinspräsident
Die Alpenvereinsjugend Österreich ist kein Anhängsel des Alpenvereins –sie ist Impulsgeberin und Mitgestalterin. Warum sie dafür Freiräume braucht und wie sie diese mit Leben füllt.
Wenn wir vom Alpenverein sprechen, denken viele zuerst an Hütten, Wege, Karten. Wir denken an das, was wir über Generationen hinweg aufgebaut haben. Doch was wären all diese Errungenschaften ohne jene, die heute beginnen, ihre eigenen Spuren im Gebirge zu hinterlassen?
Unsere Alpenvereinsjugend ist nicht schmückendes Beiwerk des Alpenvereins, sondern sein tragendes Fundament für die Zukunft.
Neue gesellschaftliche Themen werden im Verein oft von jungen Menschen als Erste aufgegriffen. Sie thematisieren den Klimawandel nicht abstrakt, sondern fordern konkrete Veränderungen – sei es bei Anreise, Tourenplanung oder Hüttenversorgung. Sie sprechen Diskriminierung offen an, setzen sich für Inklusion und Gleichberechtigung ein, fordern Kinderschutz und hinterfragen tradierte Rollenbilder. Das hat Tradition im Alpenverein: Bereits in den 1920er-Jahren entstand eine eigenständige Jugendbewegung im Verein, die auf Selbstverantwortung und Naturerlebnis setzte.
Auch heute sind es dieselben Grundwerte, die unsere Jugend prägen – doch sie füllt sie mit aktuellem Inhalt: Freiheit, verstanden als selbstbestimmtes Handeln im Einklang mit Natur und Gemeinschaft. Verantwortung, nicht nur für das eigene Tun, sondern für das größere Ganze. Solidarität, gelebt im Team, auf Tour, im Verein. Es ist eine konsequente Weiterführung und Vertiefung dessen, wofür der Alpenverein seit jeher steht.
In einer Welt, die oft von Fremdbestimmung geprägt ist, müssen wir unserer Jugend Räume schaf-
fen, in denen junge Menschen Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und daraus lernen können. Denn solche Freiräume braucht es, um Ideen weiterzuentwickeln und mit Leben zu erfüllen. Unsere Jugend hat dazu eigene Richtlinien ausgearbeitet, an denen sie sich orientiert, an denen sie testet, wie vorgeschlagene Neuerungen in der Praxis funktionieren – den pädagogischen Kompass.
» In einer Welt, die oft von Fremdbestimmung geprägt ist, müssen wir unserer Jugend Räume schaffen, in denen junge Menschen Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und daraus lernen können. «
Diese Eigenständigkeit ist kein Widerspruch zur Einheit des Vereins, sondern Ausdruck lebendiger Verantwortung. Denn nur wer selbst gestalten darf, wächst auch hinein in Verantwortung – für sich, für andere und für die Bergwelt, die uns alle verbindet. Indem unsere Jugend ihre eigenen Wege entwickelt, trägt sie aktiv zur Gestaltung unserer Zukunft bei.

Ein kurzer Blick aufs Smartphone – schon wissen wir, wo wir sind.
Doch wer liefert eigentlich die Daten, die uns den Weg weisen?
Werner b eer
Schon die Bildergalerie auf meinem Smartphone zeigt mir unaufgeregt auf einer Karte, wo meine Fotos aufgenommen wurden. Ist mir der Wegverlauf am Berg unklar, erwarte ich beim Blick auf die digitale Karte sofortige Aufklärung, bestenfalls samt Informationen über die aktuellen Wetterbedingungen am Standort. Ganz selbstverständlich verlassen wir uns auf verschiedenste digitale Karten, doch denken selten darüber nach, woher diese Daten eigentlich stammen. Die vergangene Ausgabe von Bergauf #2.2025 gab Einblicke in die Entstehung der einschlägigen Grundlagendaten. Doch was genau passiert draußen im Gelände bei den jährlichen Einsätzen der Kartographie des Alpenvereins im Außendienst? Werfen wir einen Blick hinaus ins Freie und erfahren, was hinter den Karten steckt, die uns so selbstverständlich den Weg weisen.
Neustart des Kartenwerks
Das Kartenwerk des Österreichischen Alpenvereins ist über die vergangenen 160 Jahre laufend gewachsen. Es umfasst
große Gebiete der Ostalpen. Weil es keine genauen Informationen über das Gelände gab, wurde jedes Gebiet nach und nach mit der jeweils besten verfügbaren Technik vermessen und in Karten gezeichnet. Über 100 Jahre später – natürlich inhaltlich laufend aktualisiert – werden diese Karten immer noch verwendet, vor allem aber in digitaler Form. Dabei fällt erstmals auf, dass es teilweise ernste geometrische Abweichungen gibt, die Echtzeitpositionierung mittels Satelliten ist hier gnadenlos. Dazu kommt, dass die Karten, welche historisch bedingt rasterbasiert vorliegen, nur mit einem enormen Aufwand aktualisiert werden können. Zu guter Letzt hat die Verfügbarkeit hochgenauer Geodaten die Kartographie komplett revolutioniert. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Das gesamte Kartenwerk muss komplett neu aufgebaut werden und das möglichst schön, möglichst genau und möglichst rasch.
Ein stiller Kraftakt
Man kann sich überlegen, was es bedeutet, binnen kurzer Zeit – selbstredend mit beschränkten Ressourcen – über 40 Blätter komplett neu und eigenständig erstellen zu müssen, mit dem hohen Eigenanspruch aufgrund der langen kartographischen Tradition im Nacken.
Dazu musste von den Kartographen im Alpenverein einerseits eine Methode entwickelt werden, um Karten hochwertig und rasch aktualisierbar herstellen zu können. Dies ist erfolgreich gelungen. Anderseits musste ein Partner gefunden werden, auf dessen Grundlagedaten man das Ganze aufbauen kann. Dieser wurde mit dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) in Form einer Kooperation gefunden.
‹ Eine gute Tourenplanung beginnt mit verlässlichen Informationen.
»Die Verfügbarkeit hochgenauer Geodaten hat die Kartographie komplett revolutioniert. «
Das BEV erhält zunächst maßstabsfreie topographische Basisdaten. Es erstellt u. a. daraus die amtlichen österreichischen Karten im Maßstab 1:50.000, auch als ÖK50 bekannt. Diese Basisdaten, genauer das zugrunde liegende digitale Landschaftsmodell (DLM), werden laufend und flächendeckend durch Mitarbeiter des BEV auf den neuesten Stand gebracht.
An dieser Stelle setzt die Zusammenarbeit an: Der Alpenverein übernimmt den topographischen Außendienst im schwer zugänglichen alpinen Gelände. Dieser Bereich ist für das BEV besonders aufwändig zu erfassen. Gerade im alpinen Gelände
Foto: Alpenverein/S. Schöpf >
stellen wir höchste Ansprüche an die Genauigkeit der Daten. Und eben hier greift der Österreichische Alpenverein auf sein großes Netzwerk aus Alpenvereinssektionen, Hütten und Ehrenamtlichen zurück.
Die jährliche, flächenhafte Aktualisierung des digitalen Landschaftsmodells beginnt zunächst im BEV selbst. Dort werden die betreffenden Gebiete anhand aktueller Orthofotos und Laserscandaten überprüft. Soweit möglich, erfolgt die Bearbeitung direkt im Büro. Dabei findet viel Recherche statt. Veränderungen, die sich nicht eindeutig klären lassen, werden für den Außendienst als sogenannte Verifikationspunkte vorgemerkt.
Nun beginnt die Arbeit des Alpenvereins – draußen im Gelände, bei Wind und Wetter. Wir übernehmen in Absprache mit dem BEV bestimmte Teilgebiete. Damit widmen wir uns auch den unklaren oder zu überprüfenden Stellen im Gelände –sogenannten Verifikationspunkten. Existiert ein Weg überhaupt noch, und ist er sicher begehbar? Wir klären Fragen wie diese oder haben die Aufgabe, einen Weg präzise zu erfassen, weil die Informationen über seine aktuelle Lage noch der historischen Landesaufnahme entstammen. Solche Erhebungen erfolgen mit-
hilfe hochpräziser GNSS-Geräte. Diese weisen in der Regel Abweichungen von weniger als einem Meter auf. Im Gelände arbeiten wir mit denselben Geräten und Softwareprodukten, mit denen auch die BEV-Topographen unterwegs sind. Diese garantieren im Anschluss eine nahtlose Zusammenarbeit und einen reibungslosen Datenrückfluss an das BEV. Am Ende des Jahres werden alle Daten gesammelt und nach umfassenden Prüfungen in das österreichweite DLM überspielt. Jährlich wird etwa ein Drittel der Staatsfläche aktualisiert. Somit bleibt ganz Österreich im Dreijahresrhythmus kartographisch auf dem neuesten Stand.
Drehscheibe für Geodaten
Die Alpenvereinskartographie übernimmt in der Folge die Daten des aktualisierten DLM. Sie ergänzt die eigenen Inhalte und produziert daraus die neuen Karten. Ist dieser Ablauf gut koordiniert, bleiben auch die Karten möglichst aktuell. Nicht nur die Alpenvereinskartographie, sondern auch die Allgemeinheit profitiert von diesem Datenschatz. Große Teile des DLM sind im Rahmen der Regelungen zu Open Government Data öffentlich verfügbar und grundsätzlich nutzbar. Der Außendienst des Alpenvereins leistet somit einen Beitrag zur Sicherheit aller Men-
»Jährlich wird etwa ein Drittel der Staatsfläche aktualisiert.
Somit bleibt ganz Österreich im Dreijahresrhythmus kartographisch auf dem neuesten Stand. «


^ Anders als bei OpenStreetMap bestimmen nicht die jeweiligen Interessen, welche Daten erfasst werden: Es zählt allein, was baulich ausgeprägt ist. Foto: Alpenverein-Archiv
‹ Dieser Weg wurde wohl lange nicht mehr begangen und muss gelöscht werden. Foto: Alpenverein/W. Beer

schen, die in den Bergen unterwegs sind. Im Rahmen unserer Möglichkeiten tragen wir nämlich dafür Sorge, die amtlichen topographischen Basisdaten auch im Gebirge korrekt und aktuell zu halten. Andere Projekte des Alpenvereins – etwa die Wegedatenbank – stützen und erweitern diesen Anspruch. Auch das Engagement der Graphenintegrations-Plattform und der Partnervereine stärkt uns in unserem Tun. Das ganze Jahr über stehen wir im regen Austausch mit unseren Partnern und informieren über Wege, Hütten, die alpine Infrastruktur, Bergsport, Naturschutz und viele weitere Themen des Alpenvereins.
Die Vernetzung von Projekten zeigt: Die Alpenvereinskartographie hat sich von der reinen Papierkartenproduktion längst zu einer bedeutenden Drehscheibe für Geodaten entwickelt. Mit der Bereitstellung von hochwertigen Geodaten könnte der Alpenverein seine Rolle als verlässliche Anlaufstelle festigen. —
Werner Beer ist Geograph, Kartograph und Mitarbeiter der Digitalen Services im Österreichischen Alpenverein.
Jeder Kartenverlag ist bemüht, aktuelle und korrekte Karten zu produzieren. Es gibt jedoch meist kaum Ressourcen, ein Gebiet umfassend zu recherchieren oder gar jeden Weg selbst vor Ort zu überprüfen. Umso wichtiger ist es, Fehler in den Karten oder Veränderungen im Gelände aktiv zu melden.
Euch fallen landschaftliche Veränderungen, Kartenfehler oder andere Besonderheiten auf? Wir freuen uns über jede Benachrichtigung: kartographie@alpenverein.at

Podcast zum Thema „Handy-App führt Bergsteiger in den Tod“ – Wie sicher ist digitale Tourenplanung?
Exklusiver Vorteilspreis für Funktionäre und Bergretter


Bestellen & sparen
Unser Angebot:
6 Ausgaben Bergwelten für nur € 19,00 statt € 33,90. Alpenvereinsfunktionäre und Bergretter sind eingeladen, das vergünstigte BergweltenAbo zu bestellen.
Gleich bestellen unter:
bergwelten.com/vorzugsabo

Das denkmalgeschützte
Der Alpenverein Graz ist Gastgeber der diesjährigen Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins.
Eine rührige Sektion im Süden Österreichs, die auf eine lange Geschichte zurückblickt und heute im Besitz von fünf Hütten, zwei Klammen und zwei Aussichtswarten ist.
c hristina s ch Wann
Wenn Günter Riegler von seiner Arbeit als erster Vorsitzender des Alpenverein Graz erzählt, merkt man schnell: Da geht was weiter. Egal ob es ums Stubenberg-Haus, die Kesselfallklamm, das Wegeteam, die Stefanienwarte oder eben die Planung für die Hauptversammlung geht – immer hat man das Gefühl, hier wird strategisch geplant, angepackt und umgesetzt. Aber der Reihe nach.
Pionierarbeit in den Bergen
Stubenberg-Haus am Schöckl ist von der Stadt Graz aus sichtbar. Foto: Alpenverein Graz >
1870 ins Leben gerufen – und damit nur acht Jahre nach der Gründung des Gesamtvereins – war die Sektion Graz schon damals dafür bekannt, Menschen die Begeisterung für die Berge zu vermitteln. Besonders die verschiedenen Aktivitäten wie Wandern, Klettern und Bergsteigen spielen dabei eine große Rolle. Der parallel dazu entstandene Steirische Gebirgsverein war hingegen vor allem für die Infrastruktur verantwortlich: Die Errichtung eines Wanderwegenetzes, die Hütten und Aussichtswarten vom Dachstein bis in die damalige Untersteiermark gehen auf sein Konto.
Vom Pioniergeist des Gesamtvereins getragen, waren sowohl die Sektion Graz
als auch der Steirische Gebirgsverein bis zum Ersten Weltkrieg kaum zu bremsen. In diese Zeit fallen die Eröffnung des ersten Schutzhauses auf dem Schöckl (1872) – die heutige Semriacherhütte –, der Hochschober-Hütte (heute Alpenverein Edelweiss), der Rudolfs- und der Stefanienwarte (1874), die Erschließung des Kesselfalls (1875), die Errichtung des GrafMeran-Hauses auf der Hohen Veitsch (1881, heute ÖTK), der Bau des StubenbergHauses (1889–90), der Bau der Grazer Hütte am Preber (1894) und des Arthur-vonSchmid-Hauses (1911). Bis 1912 umfasste das Wegenetz bereits 121 Wege und es gab mehrere steirische Wanderbücher. Am Schöckl fanden das Bergturnfest und ein erster Skiwettkampf statt und Peter Rosegger wurde Ehrenmitglied des Steirischen Gebirgsvereins.
Kriegszeit und Neuanfang
Der Ausbruch und vor allem die lange Fortdauer des Ersten Weltkrieges bremsten die Entwicklung ab 1914 aber drastisch. 1917 mussten sogar einige Hütten geschlossen werden. In der Zwischenkriegszeit erholten sich Alpenverein und Gebirgsverein zumindest ein wenig. Die Vereine schlossen sich 1935 zusammen. Seither trägt der Alpenverein Graz den Zusatz „St.G.V.“ (Steirischer Gebirgsverein) im Namen, hat aus dieser Geschichte heraus fünf Ortsgruppen und ist heute auch für Arbeitsgebiete und Hütten in Salzburg und Kärnten sowie der Süd- und Obersteiermark zuständig.
Lange währte der Frieden aber nicht und der Zweite Weltkrieg führte zu Vereinsauflösungen und Enteignungen.
» Alles, was man sich in den rund 70 Jahren zuvor aufgebaut hatte, schien verloren zu sein. «

Alles, was man sich in den rund 70 Jahren zuvor aufgebaut hatte, schien verloren zu sein. Aber auch dieser Krieg hatte ein Ende: Danach erlebte der 1947 neu gegründete Österreichische Alpenverein wieder einen Aufschwung. Der Alpenverein Graz profitierte vom Bau der Schöcklseilbahn, erwarb die Rotgüldensee-Hütte und die Stickler-Hütte im Lungau. Er trennte sich von der Brendlhütte und der Mörsbachhütte und sanierte die bestehenden Hütten.
Ganz linear stellt sich die Geschichte des Vereins seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs freilich nicht dar. Als Günter Riegler den Sektionsvorsitz im Jahr 2019 (seit 2011 im Vorstand in verschiedenen Funktionen) übernahm, war der Verein mit gut einer Million Euro aus vorhergegangenen Hüttensanierungen verschuldet. Die Ehrenamtlichen, die sich um die Instandhaltung der Wanderwege kümmerten, waren altersbedingt nur mehr eingeschränkt aktiv. Die Mitgliederzahlen stagnierten bei rund 13.000.
„Seit Ende 2024 dürfen wir durchaus ein wenig stolz behaupten: Wir sind schuldenfrei“, so Günter Riegler. Wie man das geschafft hat? Nun, das könne man nicht an einem Punkt festmachen. Sicherlich hätte aber eine vorausschauende stra-
tegische Planung maßgeblich dazu beigetragen. Abgesehen davon ist es offenbar gelungen, den Verein grundlegend zu verjüngen. Das Team ist heute zwischen 40 und 60 Jahren alt, voll motiviert und engagiert. Für die dringend notwendige Dachsanierung des denkmalgeschützten Stubenberg-Hauses wurde eine „SchindelSpenden-Aktion“ gestartet. Vier von fünf Hütten haben neue Hüttenwirtsleute. Es gibt einen Chor und fünf Gymnastikgruppen. 50 Prozent der Touren werden mit Öffis angeboten. Und die Mitgliederzahl ist auf satte 23.000 Personen gestiegen. Allein die 150-Jahr-Feier im Jahr 2020 ging in der Corona-Pandemie leider ziemlich unter.
Dafür konnte im September 2024 die neue Geschäftsstelle in der Annenstraße

^ Am Schöckl waren nach Unwettern im letzten Jahr intensive Baggerarbeiten auf den Wegen notwendig, um die bis zu einem Meter tiefen Wasserfurchen zu beheben. Foto: Alpenverein Graz
‹ Die barrierefreien Wege am Schöckl werden vom Alpenverein Graz gewartet. Erst kürzlich wurden die Rampen saniert. Foto: Alpenverein Graz
bezogen werden. 350 Quadratmeter stehen der Sektion, dem Landesverband Steiermark und der Akademischen Sektion Graz zur Verfügung. Die Alpenvereinsjugend hat einen eigenen Bereich, die umfassende Bibliothek wird von drei Ehrenamtlichen betreut und die Geschäftsstelle ist perfekt öffentlich erreichbar.
Ehrenamtlich auf der Wegebaustelle
Menschen für ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen, wird in allen Bereichen immer schwieriger. Außer offensichtlich im Alpenverein Graz. Gerald Grabner ist seit drei Jahren oberster Wegereferent der Sektion. Auf der Webseite sind 48 Wegewarte gelistet. Eine ganze Menge also, die sich
» 50 Prozent der Touren werden mit Öffis angeboten. Und die Mitgliederzahl ist auf satte 23.000 Personen gestiegen. «

seit 2011 aufgebaut hat. „Nein, die Zahl stimmt nicht mehr ganz, wir haben aktuell schon rund 100 Wegewarte im Team.“ Wie bitte geht das? Das wisse Gerald Grabner auch nicht so genau – viel Werbung sei jedenfalls nicht aktiv gemacht worden. Praktisch ist das aber durchaus, denn bei 1.200 Kilometer Wege kommt faktisch ein Wegewart auf 12 Kilometer. Zu tun gibt es genug!
Der Alpenverein Graz betreut mit seinen Ortsgruppen gemeinsam fünf Arbeitsgebiete, unter ihnen auch hochalpine wie etwa in der Ankogelgruppe. Besonders arbeitsintensiv ist vor allem die Kesselfallklamm, die mit über 50 Brücken und Stegen erschlossen ist. Eintritt wird, hauptsächlich aus Haftungsgründen, keiner verlangt, aber eine freiwillige Spende sichert zumindest die Materialkosten.
An warmen Tagen zieht es die Grazer auch besonders in die Rettenbachklamm. Sie wurde vor einigen Jahren behutsam renaturiert und Brücken, die ohnehin sehr wartungsintensiv waren, durch Steinschlichtungen ersetzt. Dennoch, beide Klammen sind vor allem mit häufigeren Starkniederschlagsereignissen und Windwurf infolge der Klimakrise in Wartung und Instandhal-
tung sehr aufwändig. Im Juni 2024 wurde gar ein Pkw in die Kesselfallklamm gespült. Im September desselben Jahres zerstörten umfallende Bäume wieder Teile der Steiganlage.
Starkniederschläge und Stürme sorgten auch am Schöckl für Wegsperren. Es folgten intensive Aufräumarbeiten, die teilweise nur unter Einsatz schwerer Maschinen und der jeweiligen Forstbetriebe durchgeführt werden konnten. Eine Zunahme an Wegschäden durch Extremwetterereignisse sei anzunehmen und Gerald Grabner appelliert an die Eigenverantwortung beim Wandern. Insbesondere nach Unwettern sei erhöhte Vorsicht geboten.
Inklusion mit Weitsicht
Alpenverein, Holding Graz und ORF sind seit den 1980er-Jahren am Schöckl ein gutes Team. Alpenvereins-Schutzhaus, Seilbahn und Sendemast werden mit Strom und Wasser versorgt, wobei der Alpenverein Eigentümer der Wasserleitung ist. Als Naherholungsgebiet ist der Schöckl für die Grazer von unschätzbarem Wert. Zahlreiche Wege führen das ganze Jahr über auf den karstigen Ost- und West-
Die neue Geschäftsstelle des Alpenverein Graz in der Annenstraße.
Foto: Alpenverein Graz
gipfel, der Mariazellerweg und der Grazer Umlandweg tangieren den Aussichtsberg. Allein das Skigebiet am Schöckl wurde 2014 stillgelegt. Aber die Seilbahn von St. Radegund fährt noch und bringt Menschen aller Altersgruppen barrierefrei auf den Berg.
Damit man mit Rolli und Kinderwagen aber ebenso barrierefrei zum Ost- und Westgipfel gelangt, hat der Alpenverein Graz – namentlich initiiert von Ursula und Klaus Vennemann – gemeinsam mit der Lebenshilfe 2012 ein bewegendes Projekt ins Leben gerufen: „Wege für Alle“. Rampen und Stege überbrücken felsige Abschnitte und entschärfen steile Passagen. Auch die drei Gasthäuser am Weg wurden barrierefrei umgebaut und ein Mobilitätspark nahe des ORF-Sendemasten sorgt für regen Zulauf. Damit ist der Schöckl heute ein Berg, der es allen ermöglicht, die Aussicht zu genießen –nicht selten über einem Meer aus Nebel.
Erfolgsgeheimnis gelüftet
Eines kann man klar sagen: Zum Erfolgsgeheimnis des Alpenverein Graz gehören sein gesellschaftlich hoher Stellenwert innerhalb der Stadtbevölkerung Graz

sowie seine tragfähigen Kooperationen mit wichtigenPartnern. Die Arbeit der Menschen im Alpenverein, zu einem großen Teil auch ehrenamtlich, ist an allen Ecken und Enden sichtbar – ob am Hausberg Schöckl, an den beiden Aussichtswarten am Bruchkogel und am Rosenberg oder in der Kesselfall- oder Rettenbachklamm. Darüber hinaus zeigt der Alpenverein Graz auch Präsenz und Verantwortung in seinen Arbeitsgebieten in der Ankogelgruppe, rund um den Preber, bei Donnersbachwald, in der Soboth und in den Windischen Bühel.
Spätestens im Oktober 2025 wird der Alpenverein Graz mit der Ausrichtung der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins wieder einen starken Auftritt in der Steiermärkischen Landeshauptstadt hinlegen. Stark vor allem auch deswegen, weil gepflegte Partnerschaften greifen: Die Stadt Graz sowie das Land Steiermark unterstützen den Verein finanziell und übernehmen die Miete für die Helmut-List-Halle in der Smart-City. Logistisch bleibt für den Verein noch viel zu tun, aber wie könnte es anders sein, hat er auch hierfür ein strategisches Planungsteam ins Leben gerufen.
Weiter in die Zukunft geblickt, wird bereits an diversen Projekten gefeilt: Die Kraftwerksanlage des Arthur-von-SchmidHauses muss adaptiert werden, am Stubenberg-Haus wird über eine nachhaltige Energieversorgung sowie ein neues Kühlhaus nachgedacht. „Die Aufgaben allein im Pflichtbereich gehen uns nicht aus“, so Günter Riegler.
Was sonst noch kommt? Die Präsenz in der Stadt soll durch den geplanten, von außen einsehbaren Klettertrainingsbereich in der neuen Geschäftsstelle gestärkt werden. Der Verein möchte für Kinder und Jugendliche an Attraktivität gewinnen. Auch wird man weiter an der Klimastrategie zur Reduktion der CO2-Emissionen arbeiten, das Tourenprogramm noch umweltfreundlicher gestalten und jederzeit mit einem motivierten Team bereitstehen, wenn es wieder gilt, Unwetterschäden an Wegen und Infrastrukturen zu beseitigen –ganz nach dem Motto: „Gemeinsam für unseren Naturraum“.
Christina Schwann ist selbstständige Ökologin (Firma ökoalpin) mit den Schwerpunktthemen nachhaltige Regionalentwicklung, Tourismus, Besucherlenkung und Bewusstseinsbildung.
Der Alpenverein Graz ist ein dynamischer Verein mit einem engagierten Team. V. l.: Clemens Hagenbucher (3. Vorsitzender), Gudrun Kreuzwirth (2. Vorsitzende) und Günter Riegler (1. Vorsitzender).
Foto: Alpenverein Graz
Hütten: Stubenberg-Haus (1.445 m), Rotgüldensee-Hütte (1.740 m), Stickler-Hütte (1.750 m), Grazer Hütte (1.897 m), Arthur-von-Schmid-Haus (2.281 m)
Biwak: Kaponik-Biwak (2.537 m)
Aussichtswarten: Stefanienwarte, Rudolfswarte
Klammen: Kesselfallklamm, Rettenbachklamm
Wegenetz: ca. 1.200 km
Mitglieder: ca. 23.000
Ortsgruppen: Eibiswald, Mureck, Übelbachtal, Semriach, Nestelbach-Laßnitzhöhe

Elke Kahr
Bürgermeisterin der Stadt Graz
Ich freue mich sehr, dass die bundesweite Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins am 18. Oktober in Graz stattfindet. Der Alpenverein ist eine traditionsreiche Institution, die nicht nur über sehr viele Mitglieder verfügt, sondern weit darüber hinaus hohes Ansehen und größte Wertschätzung genießt. Der sorgsame Umgang mit der Natur, die Pflege der Berg- und Wanderwege, die Schutzhütten, die Wanderkarten, eine kaum überschaubare Vielzahl an Bildungs- und Sportangeboten und vieles mehr machen den Alpenverein zu einer Institution, die unser ganzes Land geprägt hat und dabei nicht auf Erreichtem verharrt, sondern ihr Angebot und ihre Aktivitäten stets entlang neuer Entwicklungen und Notwendigkeiten weiterentwickelt. In Graz hat der Alpenverein eine sehr lange Geschichte, in der mit dem Umzug in das neue Alpenvereinshaus in der Annenstraße ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde. Das historische Zentrum von Graz, liebe Leserinnen und Leser, ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, und in diesen Zusammenhang passt gut, dass das Stubenberghaus der Grazer Sektion am Schöckl, eines der beliebtesten Wander- und Ausflugsziele der Grazerinnen und Grazer, seit 1990 unter Denkmalschutz steht. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine inspirierende Hauptversammlung und hoffe, dass Sie viele gute Eindrücke aus unserer Stadt mit nach Hause nehmen können.

1. Vorsitzender Alpenverein Graz-St.G.V.
Der Alpenverein Graz-St.G.V. ist sehr stolz, nach mehr als 30 Jahren wieder Gastgeber der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins sein zu dürfen. Wir konnten erfreulicherweise die Unterstützung vom Land Steiermark und der Stadt Graz erwirken, was die Anmietung der Grazer Helmut-List-Halle und die Bewirtung anbelangt. Der Alpenverein Graz-St.G.V. wurde 1870 gegründet, wir erhalten mehr als 1.000 Kilometer an Wegen und sind Eigentümer von fünf Hütten, darunter das österreichweit bekannte Arthur-von-Schmid-Haus und das von den Grazerinnen und Grazern geliebte Stubenberg-Haus am Grazer Hausberg, dem Schöckl. Unsere Investitionen in Hütten und Wege betragen mehrere hundert Tausend Euro pro Jahr und wir sind sehr froh, dass wir in diesen finanziell herausfordernden Zeiten erfreulicherweise schuldenfrei sind und mit unseren 23.000 Mitgliedern eine starke Stimme im Alpenverein bilden. Wir freuen uns, allen österreichischen Funktionär*innen die Stadt Graz bestmöglich präsentieren zu können. Die Sektion Graz war stets ein starker Partner, große Bergsteiger und Sportkletterer haben in Graz gestartet, legendär waren die Touren unseres ehemaligen Vorsitzenden Hanns Schell im Karakorum in den 1980er-Jahren. Wir haben erfreulicherweise einen sehr starken und jugendlichen Sektionsvorstand, sämtliche Vorstandsfunktionen sind stark besetzt. Gemeinsam mit meinen Vorsitzendenkolleg*innen Gudrun Kreuzwirth und Clemens Hagenbuchner darf ich Euch willkommen heißen.

Alpenvereinspräsident
Graz steht in vielerlei Hinsicht exemplarisch für das, wofür auch der Alpenverein eintritt: nachhaltiges Denken, regionale Verwurzelung, Innovationskraft und ein offener Dialog. Deshalb freut es uns besonders, dass wir die Hauptversammlung 2025 als „Green Event“ durchführen können. Damit setzen wir ein klares Zeichen für unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft. Unsere Hauptversammlung bietet wie jedes Jahr den Raum für Austausch, Mitgestaltung und Weichenstellungen. Sie ist nicht nur ein zentrales Organ der Vereinsdemokratie, sondern auch Ausdruck unseres Selbstverständnisses als offene, partizipative Organisation. Ich freue mich auf konstruktive Diskussionen, neue Impulse und ein Wiedersehen mit vielen engagierten Menschen, die den Alpenverein mit ihrem Eifer und ihrer Tatkraft tragen. In diesem Sinne lade ich Sie herzlich nach Graz ein – zu einer Hauptversammlung, die nachhaltig, zukunftsorientiert und gemeinschaftlich sein wird. Lassen wir uns von der Atmosphäre dieser besonderen Stadt inspirieren und gestalten wir gemeinsam den Weg unseres Vereins weiter.
Klassische, technisch unschwierige Wanderung von Fuß der Leber auf den Grazer Hausberg Schöckl, kombiniert mit einem kurzen Abstieg zum Schöcklkreuz. Die Tour ist perfekt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.


Von der Bushaltestelle Stattegg Fuß der Leber, der Endstation der Stadtbuslinie 53, geht’s Richtung Norden auf der asphaltierten Leberstraße bergauf (nicht in die Privatstraße nach rechts einbiegen, diese wird umgangen). Nach ca. 200 m biegt rechts ein Feldweg ab. Diesem ca. 60 m folgen und erneut rechts bergab, bis man nach ca. 140 m zum markierten Weg Nr. 20a gelangt, der an den Privatweg anschließt. Hier nach links abzweigen und weiter aufwärts auf einer Forststraße durch die Bergflanke, die sich später zu einem Wanderweg verjüngt, hinauf zur Kalkleitenstraße. Dieser entlang nach links und nach ca. 300 m rechts in einen markierten Wanderweg einbiegen (20a). Bei einer Wegkreuzung führt der Weg rechts am Hochbehälter vorbei und weiter nach oben (Langer Weg, 20a).
Bei einer weiteren Wegkreuzung rechts und auf Wiesenflächen hinaus, lässt man das Göstinger-Forsthaus links liegen. Wieder in den Wald hinein, erreicht man rechtshaltend die am Rand einer Wiese liegende Johann-Waller-Hütte. Am Schutzhaus vorbei und durch Waldgelände zum Schöcklsattel hinauf, zuletzt am Rand einer Bergwiese. Im Sattel nach links auf einem unmarkierten Steig zum Niederschöckl mit Kreuz und Buch.
Zurück in den Sattel, wieder der markierten Route folgend, am linken Wiesen-
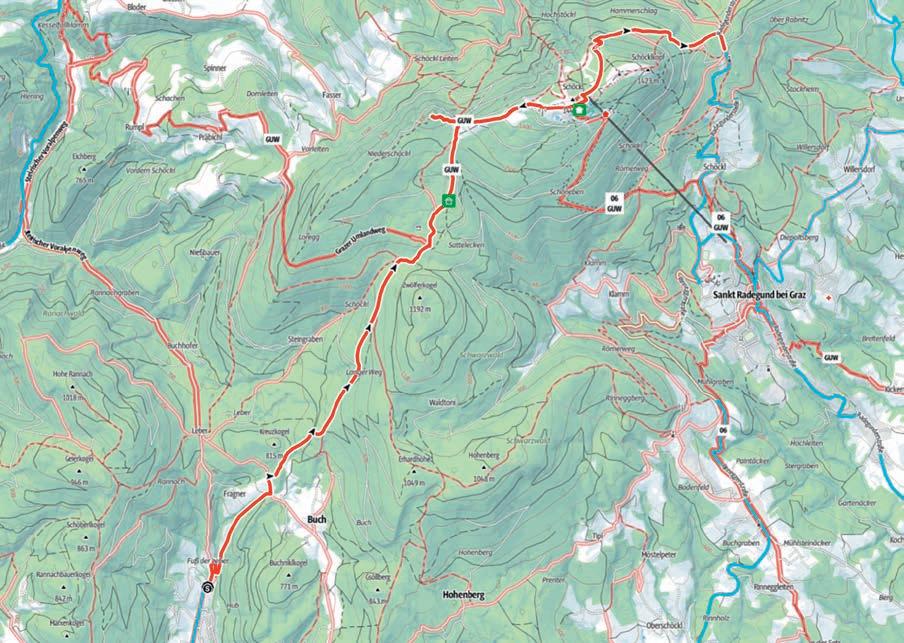
rand auf das Schöckl-Plateau hinauf und linker Hand am Schöckl-Westgipfel zum Kreuz.Weiter auf der Hochfläche zum Hauptgipfel (Sendeturm, alter Vermessungsstein, links vom Stubenberg-Haus). Unmittelbar vor der Bergstation der nahen Schöckl-Seilbahn nach links und auf einem Güterweg durch die Schöckl-Nordwest-, dann Nordflanke bis auf etwa 1200 m Höhe hinunter. Hier halblinks und auf einem Ziehweg in den Wald hinunter. Bei einer Verzweigung auf dem linken Wegast weiter bergab und in wenigen Minuten zum Schöcklkreuz (kleine Kapelle). Hier rechts in die Schöcklstraße und nun noch etwa 200 m an der Straße entlang zur Bushaltestelle Schöckl Schöcklkreuz.
Anreise von Graz mit dem Grazer Stadtbus 53, der von Graz Hauptbahnhof nach Stattegg Fuß der Leber verkehrt. Rückfahrt mit dem Regionalbus 250, der nach Graz Rosarium (nahe Jakominiplatz) fährt; weiter mit den Graz Linien (zum Hauptbahnhof mit der Straßenbahn). Unter der Woche deutlich besser angebunden ist die oberhalb von St. Radegund gelegene Bushaltestelle bei der Talstation der Schöckl-Seilbahn, die wir vom Schöcklkreuz in etwa 45 bis 50 zusätzlichen Gehminuten erreichen können.

Aufstieg: 1.070 Hm
Abstieg: 440 Hm, 10,9 km
Dauer: 4:30 h
Leichte, der Jahreszeit angepasste Wanderausrüstung.
Peter Backé, Alpenverein Austria
Kartenausschnitt
Outdooractive-Kartographie
Mehr Details zu dieser Tour auf alpenvereinaktiv: www.alpenvereinaktiv.com/

Qualitätsvoll, spannend, facettenreich.
Bildung gibt Sicherheit, Bildung macht Spaß, Bildung ist nachhaltig.
Dafür steht die Alpenverein-Akademie auch in ihrem 15. Jahr.
Als zentral fungierende Bildungsstelle des Alpenvereins bietet sie über 500 qualitätsvolle Veranstaltungen: von offenen Seminaren und Workshops für alle Interessierten, anschaulichen eLearning-Kursen über renommierte Ausbildungen zu Jugend- und Familiengruppenleiter*innen, sportalpinen Basis- und Fortbildungen bis hin zu zertifizierten Lehrgängen für Alpin-, Erlebnispädagogik und Naturschutz.
Immer mit dabei: die Freude in, an und mit der Natur.


Österreichischer Alpenverein Alpenverein-Akademie Olympiastraße 37 6020 Innsbruck
T +43 / 512 / 59 547-45
M akademie@alpenverein.at
W alpenverein-akademie.at
Wie unterschiedlich das Bildungsangebot des Alpenvereins ist, zeigt der Blick auf neue, neu arrangierte und attraktive Veranstaltungen im Jahresprogramm 2026:
Wintererlebnis inklusiv
09.–11.01.2026
Steinach am Brenner (T)
Übungsleiter*in Ski Mountaineering
12.–17.01.2026
Kaprun (S)
Übungsleiter*in Freeride
14.–18.01.2026
Huben (T)
Schneeschuhwandern & Yoga
23.–25.01.2026
Donnersbachwald (ST)
Update Freetouring
12.–15.02.2026
Saalbach (S)
Update Skitouren Fokus Jugendarbeit
13.–15.02.2026
Hallstatt (OÖ)
Klimakommunikation & Storytelling
07.–08.03.2026 online Webinar
Science goes Alpenverein
15.04.2026 online Vortrag
Übungsleiter*in Plaisirklettern Jugend
12.–17.05.2026
Bruck an der Mur (ST)
Update Klettersteig Fokus Jugendarbeit
29.–31.05.2026
Bergsteigerdorf Weißbach bei Lofer (S)

Übungsleiter*n Trailrunning
10.–14.06.2026
Wildermieming (T)
Lebensraum Wasser entdecken
19.–21.06.2026
Bergsteigerdorf Grünau im Almtal (OÖ)
Kursleiter*in Bergwandern SicherAmBerg
19.–21.06.2026
Altenmarkt (S)
Klettertraining für Kinder
25.–26.07.2026, Altenmarkt (S) 26.–27.09.2026, Wien (W) 03.–04.10.2026, Linz (OÖ)
Mental stark am Berg
13.–15.11.2026, Salzburg (S)
eLearning Erste Hilfe
Immer und jederzeit 2026
eLearning.alpenverein-akademie.at







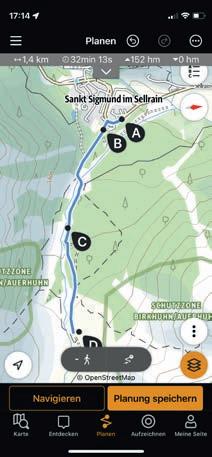


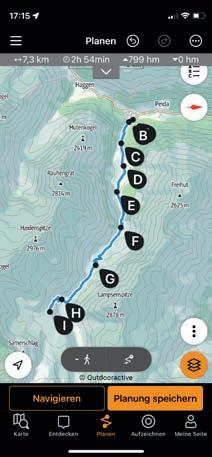

Auf dem Tourenportal alpenvereinaktiv sind tausende Tourenbeschreibungen veröffentlicht, die direkt übernommen und genutzt werden können. Die eigenen Routen von vornherein selbst zu planen, bietet dennoch oft Vorteile. Mit dem Tourenplaner gelingt das schon in wenigen Schritten.
Serie alpenvereinaktiv-Tipp, Teil 6.
Wolfgang Warmuth Team alpenvereinaktiv
Wer bei der Tourenplanung selbst Hand anlegt, kann die eigenen Vorlieben bestens einfließen lassen. Es geht ganz leicht: Der Tourenplaner ist in der App im Menüpunkt „Planen“ 1 a zu finden. Grundsätzlich lässt sich der Planer entweder in der Kartenansicht
1 – 6 oder in der Listenansicht der Wegpunkte 7 verwenden. Für die Planung empfiehlt sich die Kartenansicht. Umschalten lässt sich die Ansicht über den „ABC-“ 1 d bzw. „KartenButton“ 7 c
1. So geht’s los
Bevor die Planung starten kann, sollte man die gewünschte Aktivität auswählen 1 b und entweder das automatische Routing auf dem Wegenetz oder die freie Eingabe (Luftlinie) aktivieren 1 c . Im Folgenden kommt das automatische Rou-
ting zum Einsatz. Plant man eine Tour am Smartphone, lautet die klare Empfehlung: Am besten wählt man eine Karte, bei der ein weites Hineinzoomen möglich ist! Dies ist bei den beiden Vektorkarten OpenStreetMap und Outdooractive-Karte der Fall. Auf diese Weise erwischt man exakt

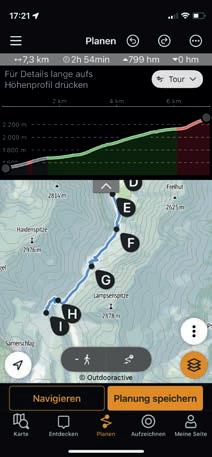





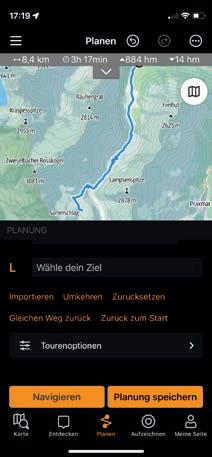

Kommt das automatische Routing zum Einsatz, wird auf zwei verschiedene Wegedatenbanken zugegriffen. Entweder handelt es sich dabei um die Wegedaten der Community-Karte OpenStreetMap (OSM) oder um die Wegedaten der OutdooractiveKarte, die möglichst offizielle Landesdaten (BEV, Swisstopo, etc.) verwendet. Plant man mit Hilfe der OSM, wird auf OSM-Daten zugegriffen. Plant man aber z. B. anhand der AVoder der Kompass-Karte, ist das auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Man sollte sich dann immer vergewissern, auf welchen Wegen man tatsächlich unterwegs ist.
jene Wege, die man auch wirklich benutzen möchte. Die Kartenauswahl ist immer rechts unten zu finden 2 a .
2. Punkte setzen
Wir beginnen: Jetzt bitte weit hineinzoomen und durch längeres Tippen mit dem Finger den ersten Punkt dort setzen, wo sich der Start befinden soll 2 b
Tipp: Setze Zwischenpunkte in kurzen Abständen anstatt in weiten Wegabschnitten – so bleibt deine Route auf dem gewünschten Weg. 3
Schon mal vom automatischen Routing auf unerwünschte Wege oder Umwege geschickt worden? Die Zwischenpunkte helfen, solche Fälle zu vermeiden. Gerade auf MountainbikeTouren oder beim Wandern besteht diese Gefahr, wenn die Stecke einer längeren Teerstraße entlang verläuft.
QR-Code scannen und zu den Funktionstipps gelangen 5 6 a b
Der Tourenplaner schlägt etwas Falsches vor oder man vertippt sich? Kein Problem: Der „Zurück-Pfeil“ 3 a macht das wieder rückgängig.
Während der Planung sind über der Karte immer die wichtigsten Daten zur Route 4 a sichtbar. Beim Tippen auf das Häkchen öffnet sich das Höhenprofil 5 . Berührt man das Profil mit dem Finger, werden die Art des Weges bzw. der Untergrund, die Steigung und die Schneehöhe im Profil ersichtlich.
Anhand dieser Beispieltour geht’s nun zur Umschaltung vom automatischen Routing zur freien Eingabe 6 a
3. Der Feinschliff
Jetzt heißt es raus aus dem Wegenetz und rein in die weitere Planung des Routenverlaufs. Einfach mithilfe vieler Zwischenpunkte und gerader
Linien den Routenverlauf weiter planen – fertig.
Dieser Schritt ist besonders auf Gletschern, im Winter auf Skitouren oder bei Fehlern im Wegenetz hilfreich. Das Routing und die freie Eingabe lassen sich gut miteinander kombinieren. Mehrmals zwischen den beiden Optionen zu wechseln ist ebenfalls möglich.
Weitere interessante Funktionen bietet die Wegpunktansicht 7 a . Man erreicht sie über den „ABC“-Button 6 b Auch rechts oben unter den drei Punkten 7 b verbergen sich je nach Bedarf ein paar zusätzliche Möglichkeiten. Am besten einfach ausprobieren!
Das Projekt ist abgeschlossen oder bereit zum Zwischenspeichern? Dann einfach auf „Planung speichern“ tippen. Sämtliche eigene Planungen sind auf „Meine Seite“ unter „Planungen“ zu finden. Viel Spaß beim Planen!
¡ nfo alpenvereinaktiv-Tipps
Alle bisher in Bergauf erschienenen Funktionstipps von alpenvereinaktiv sind hier zu finden: www.alpenverein.at/ portal/bergsporttipps

Ob am Gipfel, auf der Alm oder bei einer Rast –einst gehörte das gemeinsame Singen zum Bergerlebnis einfach dazu. Heute ist es stiller geworden auf den Wanderwegen. Doch es gibt sie noch, die Momente, in denen ein Jodler über die Hänge klingt und alte Lieder neue Kraft schenken. Eine persönliche Erinnerung – und ein Plädoyer für das Lied als Ausdruck von Gemeinschaft und Naturverbundenheit.
g ertrude m ader
In meiner Jugendzeit wurde bei unseren Wanderungen stets gemeinsam gesungen. Berührende Bergsteigerlieder erklangen unterwegs, auf dem Gipfel, stolz, ihn erreicht zu haben, oder abends in der Hütte bei lustigen Hüttenspielen. Da wurden Geschichten erzählt, Sehnsüchte nach fernen Zielen geweckt, Erinnerungen an Vergangenes geteilt. Das gemeinsame Singen berührte unsere Herzen und stärkte Freundschaft und Verbundenheit.
Heute hat sich vieles verändert. Internet, Konsumdenken und Technik haben auch die Berge erreicht. Darum frage ich mich: Wo wird heute noch spontan gesungen? Wer kennt noch unsere wunderbaren Bergsteigerlieder?
Aus diesem Grund hatte ich mir vorgenommen, einen Ausflug musikalisch und lyrisch, mit Rückbesinnung auf die Ein-
» Trialeiho! Scheane Stundn, a guats Gmiad, und mitnanda a Liad, wia a Almbrunn so rein, kinnan Wegliachtla sein .«
Marie von Ebner-Eschenbach

fachheit, zu gestalten. „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“ – dieses Goethe-Zitat war unser Leitspruch. Und das Lied, das wir beherzt sangen: „Wann i auf die Alma geh’, lass’ i mei Sorg’ dahoam.“
Unterwegs hielten wir an Marterln und Wegkreuzen inne, sangen oder genossen einfach die Stille: Vogelgezwitscher, das Rauschen eines Baches, das Säuseln des Windes. Am Ziel wurde gesungen und gejodelt. Die Tour endete in einem Kreisritual: „Fein sein, beinanda bleibn! Mag’s regnan oder windn oder obaschneibn.“
Es war ein besonderer Bergtag, bewusst gestaltet, um die Natur intensiver zu erleben, selbst wieder musikalisch aktiv zu werden und dem Tag eine besondere Tiefe zu verleihen. Und siehe da: Fremde Wanderer blieben stehen, summten mit. Selbst die Tiere auf der Alm spitzten
Bei Eröffnung bitte angeben: 25ALPENV

die Ohren. Es gab Tränen der Rührung und Freude. Die Sehnsucht nach einem gefühlvollen Miteinander war deutlich spürbar. Seitdem wird bei all unseren Touren zwischendurch gesungen. Manchmal tragen wir auch Tracht – das macht den Almaufenthalt noch gemütlicher. „Herrgott, du hast mir a Hoamatl gschenkt, voll Liab, voll Treu, voll Pracht.“
So wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Berglieder und Jodler wiederbelebt:
„Wo die Edelweiß blühn und die Gipfel erglühn“,
„In die Berg bin i gern“,
„Wann da Schnee von da Alma weggageht“,
„Wenn wir erklimmen, sonnige Höhen, steigen dem Gipfelkreuz zu“,
„Pulverschnee und Gipfelwind“,
„In unseren Haaren hängt noch der Wind von den sonnenseligen Höhn“, >

Exklusiv für Vereinsmitglieder: Jetzt KontoBox Large eröffnen und als Vereinsmitglied den exklusiven 100 Euro Gipfelbonus* sichern – ganz einfach durch:
• Nutzung des Kontowechsel-Service mit Information von mindestens vier Zahlungspartnern
• Aktivierung und Verwendung der BAWAG Banking App
Für junge Vereinsmitglieder:
Bei Eröffnung eines B4-19 Kontos gibt es 20 Euro Startbonus*
Der Startbonus von 20 Euro wird nach Eingang einer Mindestgutschrift von 25 Euro und mindestens einmaligem Login in der BAWAG Banking App auf das neueröffnete Jugendkonto gutgeschrieben.
*Gültig bei Kontoeröffnung bis 31.12.2025. Die Gutschrift des Gipfelbonus bzw. Startbonus erfolgt automatisch innerhalb von 6 Wochen. Barablöse ausgeschlossen. Der Gipfelbonus und Startbonus sind nicht mit anderen Boni oder Aktionen kombinierbar. Dies gilt insbesondere für Empfehlungsprogramme sowie sonstige gleichzeitig laufende Werbeaktionen.
„Da Summa, der is aussi, i muaß obi ins Tal“, „Franzl kimm, heit gehn ma klettern!“, „Drei hoe über d’Alm her, drei hoe über d’Schneid“ u. a.
Praktische Hilfe bietet inzwischen auch das Handy: Per WhatsApp werden Liedtexte samt Noten verschickt und sind überall dabei – zum Nachsingen und Teilen. „Wenn auf Bergeshöhn die Alpenrosen blühn und am Firmament die Bergesgipfel glühn, ja, das ist eine schöne Zeit, so gern denk ich zurück, an Sonne, an Firnschnee und Glück.“
Es wäre schön, wenn unsere tief ins Herz und in die Seele gehenden Berglieder, Heimatlieder und Jodler nicht in Vergessenheit geraten. Wenn sie von Jung und Alt bei Wanderungen, Pilgerwegen, Bergtouren oder beim Bergsteigerstammtisch wieder gesungen würden –aus Dankbarkeit für die Schöpfung unserer herrlichen Bergwelt. So bleibt dieses kostbare Kulturgut lebendig und erfährt neue Pflege.
Allen Bergbegeisterten ein herzliches: „Trialeiho! Scheane Stundn, a guats Gmiad, und mitnanda a Liad, wia a Almbrunn so rein, kinnan Wegliachtla sein.“
» Es wäre schön, wenn unsere tief ins Herz und in die Seele gehenden Berglieder, Heimatlieder und Jodler nicht in Vergessenheit geraten. «


z ur p erson Gertrude Mader (Leoben, Steiermark) ist Lehrerin in Pension und Mitglied im Alpenverein Leoben, wo sie zweimal als Schriftführerin ehrenamtlich tätig war. Sie ist begeisterte Bergsteigerin mit Wanderführerausbildung, bietet Tourenführungen – unter anderem „Musikalisches Pilgern“ –und hat eine Vorliebe für Bergsteiger- und Volkslieder, besonders für die alpenländischen Jodler und Lyrik. Außerdem organisiert sie regelmäßig einen „musikalischen Bergsteigerstammtisch“ unter dem Motto: „Gmiadlich gsessn – gsungan – gspüt – gredt“, wo Geschichten erzählt, gesungen, gejodelt und Fotos vom Bergsteigen angeschaut werden – und vor allem viel gelacht wird.

^ Im Almenland – Plankogel.
Foto: Gertrude Mader
‹ Verschiedene Generationen singen miteinander.
Foto: Gertrude Mader
Während die Natur sich langsam auf den Winter vorbereitet, zeigen sich manche Pflanzen noch einmal von ihrer farbenprächtigsten Seite. Gleichzeitig laufen die Arbeiten an den Wanderwegen auf Hochtouren.
t eam naturschutz, h ütten und Wege
Der Herbst gilt vielfach als die goldene Zeit für Wanderungen: Die Blätter der Bäume leuchten in warmen Farben, die Lufttemperatur ist angenehm und die Wege sind nicht mehr so stark frequentiert wie im Sommer. Eine wohltuende Ruhe hält Einzug in die Natur.
Für die Wegebautrupps der Alpinen Vereine bedeutet diese Zeit jedoch alles andere als Ruhe. Im Gegenteil: Bevor der Winter Einzug hält, ist noch einmal Hochbetrieb angesagt – vor allem dann, wenn im Sommer heftige Unwetter gewütet haben. Murenabgänge, Hangrutschungen und Überschwemmungen haben vielerorts Schäden an den Wegen hinterlassen, die noch dringend behoben werden müssen. Doch auch botanisch hat der Herbst einiges zu bieten. Sogenannte Spätblüher sind jetzt noch in den Bergen in voller Blüte zu entdecken.
Die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) etwa blüht von August bis in den November hinein. Ihre zartrosa bis blasslila Blüten sind ein hübscher Anblick – doch Vorsicht ist geboten: Alle Teile der Pflanze, von der Wurzel bis zu den Samen, sind stark giftig. Bereits geringe Mengen können tödlich sein. Besonders tückisch ist, dass ihre Blätter im Frühjahr leicht mit denen des Bärlauchs verwechselt werden können. Feuchtere, nicht zu intensiv bewirtschaftete Wiesen und lichte Auwälder sind ihr bevorzugter Lebensraum.
Die Silberdistel (Carlina acaulis) präsentiert ihre markanten silbrig-weißen Blüten bis in den Spätsommer hinein.

Im Volksmund wird sie auch „Jägerbrot“ genannt, da ihre fleischigen Blütenböden früher von Jägern und Almhirten gegessen wurden – ihr Geschmack erinnert an Artischocken. Beim Wandern sieht man sie häufig auf sonnigen, mageren Almweiden bis in die subalpine Stufe (1.500 m NN bis 2.400 m NN) hinauf.
Und schließlich ist auch die Gemeine Wegwarte (Cichorium intybus) noch zu sehen – nicht zu verwechseln mit den fleißigen Wegewarten der Alpenvereine. Mit ihren leuchtend blauen Blüten ist sie ein wahrer Blickfang am Wegesrand. Die Pflanze wird auch Zichorie genannt, abgeleitet von ihrem lateinischen Namen. Ihre Wurzeln wurden früher getrocknet, geröstet und gemahlen als Kaffeeersatz verwendet – ein beliebtes Getränk in Zeiten, in denen echter Kaffee schwer erhältlich war. Die Gemeine Wegwarte ist, wie ihr Name schon sagt, oft in der Nähe von Wegrändern zu finden.
Die Serie Wegetation ist eine Zusammenarbeit zwischen Birgit Kantner (Naturschutz) sowie Marco Gabl und Esther Röthlingsdorfer (Hütten und Wege).
Wege

Nach der Hitze und den Gewittern im Sommer bietet der Herbst oft bestes Bergwetter. Doch Achtung: Bei der Tourenplanung sollte man auch die Öffnungszeiten der Hütten im Auge behalten. Die meisten Hütten im Hochgebirge beenden Ende September ihre Saison. Selbst wenn das Wetter vielleicht noch für eine Saisonverlängerung spricht, gehen die Vorräte zur Neige und das Hüttenteam wechselt den Job oder freut sich
Neben Gewitter und Sturm hinterlässt auch der Winter Schäden an den Wegen. Im Hochgebirge müssen vor Wintereinbruch Einbauten wie Seilversicherungen und Brücken vorsorglich abgebaut werden, damit sie keinen Schaden aufgrund von Schneedruck und Lawinen nehmen.
über den wohlverdienten Urlaub. Außerhalb der Bewirtschaftungszeit steht für den Notfall auf jeder Hütte der Kategorie I ein unversperrter Schutzraum zur Verfügung. Dieser ist mindestens drei Quadratmeter groß, allseitig umschlossen und mit Decken ausgestattet.
Einen Überblick über Hütten und ihre Öffnungszeiten bietet der Hüttenfinder des Alpenvereins: www.alpenverein.at/ huetten/finder.php
Regeln auf dem Berg scheinen das Freiheitsgefühl, zunächst etwas zu dämpfen. Besonders bei der Ankunft auf Hütten begegnet man so manchen davon. Wer aber denkt, dass diese Hinweise, Bitten und Verbote einem gehörig den Spaß verderben, irrt. Von einem achtsamen Miteinander profitieren nicht nur alle Beteiligten, sondern auch die Umwelt. Wie das gelingt, zeigt der Hüttenknigge des Österreichischen Alpenvereins, des Deutschen Alpenvereins und des Alpenvereins Südtirol in zehn Punkten.

Hier geht’s zum neuen Hüttenknigge: t1p.de/huettenknigge
Auf entsprechende Hinweise ist zu achten. Lawinen zählen zu den sogenannten naturtypischen Gefahren. Warnschilder oder Sperrungen findet man bei allgemeinen Naturgefahren nicht immer vor. Es liegt an der Eigenverantwortung des Wanderers, sich über typische Gefahren wie Lawinen zu informieren und sie zu berücksichtigen. Während vielerorts eine mächtige Schneedecke die Wege bedeckt, finden in dieser stillen Zeit schon die Planungen für Sanierungsarbeiten im kommenden Frühling statt.
Strom ist ein kostbares Gut, besonders auf Hütten. Meist wird er vor Ort mittels Photovoltaik oder Wasserkraft erzeugt, denn nur wenige Hütten sind an das Stromnetz angeschlossen. Autarke Inselanlagen mit einer Kombination aus verschiedenen Stromerzeugern liefern die nötige Energie für Kochen, Waschen, Wärme und Licht. Was aber, wenn ein System ausfällt, zum Beispiel durch eine längere Schlechtwetterperiode ohne Sonne? Dann müssen die Hütten mit dem Strom gut haushalten. WLAN gibt es kaum –und wenn, dann meist aufgrund der Satelliten-Internet-Verbindung mit eingeschränkter Kapazität.
Der Strompreis liegt auf Hütten etwa zehnmal höher als im Tal, daher steht er den Gästen nur begrenzt zur Verfügung. Vor allem das Aufladen von Handys belastet das System zusätzlich. Vielleicht ein willkommener Anlass, das Hüttenleben einmal ganz analog zu genießen –ohne Handy.
Das Wochenende naht, die Berge rufen. Oft zieht es mich da in die Wachau, auf die Hohe Wand, ins Mürzer Oberland, ins mittlere Murtal, zu den Bergen rund um den Präbichl, in die Dachstein-Tauern-Region oder ins Salzkammergut … All das sind herrliche Tourengebiete, vor allem aber sind sie von Wien, wo ich wohne, öffentlich gut erreichbar – und das ist entscheidend für mich, denn ich bin fast immer mit Bahn und Bus unterwegs.
Am liebsten aber fahre ich am Wochenende ins Gesäuse, dessen einzigartig wilde und alpine Landschaft mich besonders berührt und seit 2002 in großen Teilen als Nationalpark besonders geschützt ist. Glücklicherweise gibt es an Wochenenden (nicht aber unter der Woche) attraktive Zugverbindungen von Wien in diese grandiose Bergwelt: direkt, flott und zu gut passenden Zeiten. Am Freitagnachmittag und am Sonntagabend verkehrt ein Schnellzug, dazwischen wird die Strecke von flinken Regionalzügen bedient. Vor Ort runden Linien- und Rufbusse sowie das Gesäuse-Sammeltaxi das ÖV-Angebot ab.
Die Anreise führt durch das Donautal, dann in die Voralpen und schließlich entlang der Enns Richtung Hochgebirge. Unter den Reisenden sind Wochenpendler, Ausflüg-
p eter backé

Peter Backé, Jahrgang 1960 und Mitglied im Alpenverein seit 1971, wohnhaft in Wien, passionierter Öffi-Nutzer, Wanderer, Bergsteiger und Skitourengeher. Autor mehrerer Bücher, u. a. „Mit Bahn und Bus zum Berg: Österreich –Die 75 schönsten Wandertouren“, Freytag & Berndt, 2023 und „Wandern mit Öffis: Wiener Hausberge – 55 Touren mit Bahn & Bus“, Rother Verlag, 3. Auflage, 2024. Ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Verein „Bahn zum Berg“ und im Alpenverein Austria.
ler und Bergfexe, in den Regionalzügen auch etliche Radfahrer. Kein Wunder, dass sich da bald Gespräche ergeben: Tourentipps werden ausgetauscht, Equipment-Fragen diskutiert, Öffi-Abenteuer geteilt … Attraktive WochenendBergtouren gibt es im Gesäuse viele. So ist es beispielsweise sehr lohnend, klassische Routen in der Hochtorgruppe zu kombinieren. Am besten reisen wir dafür am Freitagnachmittag zum Bahnhof Johnsbach und steigen zur Haindlkarhütte auf. Am Samstag geht es via Peternpfad (I-II) und Dachlgrat (II) aufs Hochtor. Unser Tagesziel ist die Hesshütte, die wir über den Josefinensteig erreichen. Am Sonntag ersteigen wir die Planspitze; die
Tour klingt mit dem Abstieg über den Wasserfallweg (B) zur Kummerbrücke (Bus) bzw. nach Gstatterboden (Zug) aus –ebenso gut können wir auf das Hochzinödl wandern und anschließend ins Bergsteigerdorf Johnsbach hinuntergehen, von wo uns das Sammeltaxi zum Zug bringt.
Wer nur einen Tag Zeit hat, kann den Tamischbachturm überschreiten oder die Tieflimauer ersteigen. Auch der Kleine Buchstein (Bus ab Weißenbach-St. Gallen) und die Lugauer-Traverse aus dem Radmertal (Rufbus ab Hieflau) sind als Öffi-Tagestouren gut machbar. Eine wunderschöne Halbtagswanderung ist die Gsengscharten-Runde ab Bahnhof Johnsbach. Für die
ebenfalls sehr ansprechenden Touren auf den Großen Buchstein plant man am besten anderthalb Tage ein.
Besonders angenehm: ÖffiTouren enden fast immer mit einer erholsam- entspannten Rückfahrt. So auch GesäuseTouren. Und während draußen die Landschaft vorbeizieht, werden im Zug oft schon die ersten Ideen gewälzt, wo es denn am nächsten Wochenende hingehen könnte. Vielleicht gleich noch einmal ins Gesäuse?
PS: Auch von Graz und Linz ist das Gesäuse gut erreichbar –mit der Wochenend-Frühverbindung von Graz über Selzthal in der Wandersaison sogar schon vor 8 Uhr!
Literaturt ¡pp
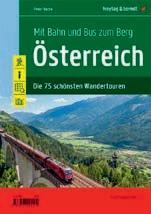
Peter Backé
Mit Bahn und Bus zum Berg –Österreich
Die 75 schönsten Wandertouren
T-Shirts
CHILLAZ
Sportlich-urbane T-Shirts für Damen und Herren.
Material: 100 % Baumwolle
Damenshirt „Drautal“
36,90 €
Herrenshirt „Mallnitztal“ 36,90 €

Ultraleichte und robuste e+lite-Stirnlampe. Mit einer Leuchtdauer von bis zu 45 Stunden.
Leuchtkraft: 30 Lumen, Gewicht: 27 28,90 €



Unsere Alpenvereinssocken mit unverwechselbarem Höhenlinien-Design. Tolles Doppelpack mit roten und grünen Socken.
Material: 77 % Bio-Baumwolle, 20 % Polyamid, 3 % Elasthan.
Größen: 36–40 (M), 41–46 (L) 32,90 €

Ein leichter, komfortabler und gut belüfteter 25-LiterRucksack für Wanderungen, Radtouren und Klettersteige.
In Blau oder Grau erhältlich.
143,90 €

Gemütliche Jacke für Damen. Die große Kapuze schützt deinen Kopf an kalten Tagen.
Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan 79,90 €

Bestellungen und weitere Artikel online, per Mail oder telefonisch: www.alpenverein.shop shop@alpenverein.at +43/512/59547-18
Alle Preise sind Mitgliederpreise, inkl. UST, zzgl. Porto.


Das gewobene, leicht aufgeraute Denimgarn ist angenehm zu tragen und passt in jeder Alltagssituation. Das Alpenverein-Patch aus Kunstleder bringt einen zusätzlichen Akzent.
Material: 100 % Baumwolle
Damen-Hemd „Pongau“ 69,90 €
Herren-Hemd „Pinzgau“ 69,90 €


Ein einzigartiges, nachfüllbares Deo, das den Plastikmüll reduziert und Schweißbakterien bekämpft.

Lieferumfang: 2 x Deo-Stick + 2 x Refill Pack, Duft: Bergamotte Minze – sommerlich frisch, Alpenkräuter – belebend herb. 23,90 €

Schicke Schildkappen aus Produktions resten. Mit großem Schild sind sie perfekt für sonnige Tage.
Hergestellt in Europa.
Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Schildkappe „Tauerntal“ 29,90 €
Schildkappe „Alpeiner Ferner“ 29,90 €



„Memoreis“ ist mehr als ein klassisches Memo-Spiel. Es fördert nicht nur das Gedächtnis, sondern auch unser kollektives Erinnern an das vermeintlich „ewige Eis“, das vor unseren Augen rasant davonschmilzt.
Wer findet die meisten Bildpaare? Historische und aktuelle Aufnahmen von 24 Alpengletschern zeigen eindrucksvoll, wie stark sich unsere Hochgebirgslandschaft bereits verändert hat. Besonders spannend ist das beiliegende Booklet: Es enthält wissenschaftliche Hintergründe zu den Auswirkungen des Klimawandels auf das Hochgebirge, porträtiert die einzelnen Gletscher und zeigt, welche vielleicht noch zu retten sind.


9,90 €
Benjamin Stern ist Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein und für die Initiative RespektAmBerg zuständig.
Lebensqualität im Spiegel des Alpenzustandsberichts
v erena s tahl
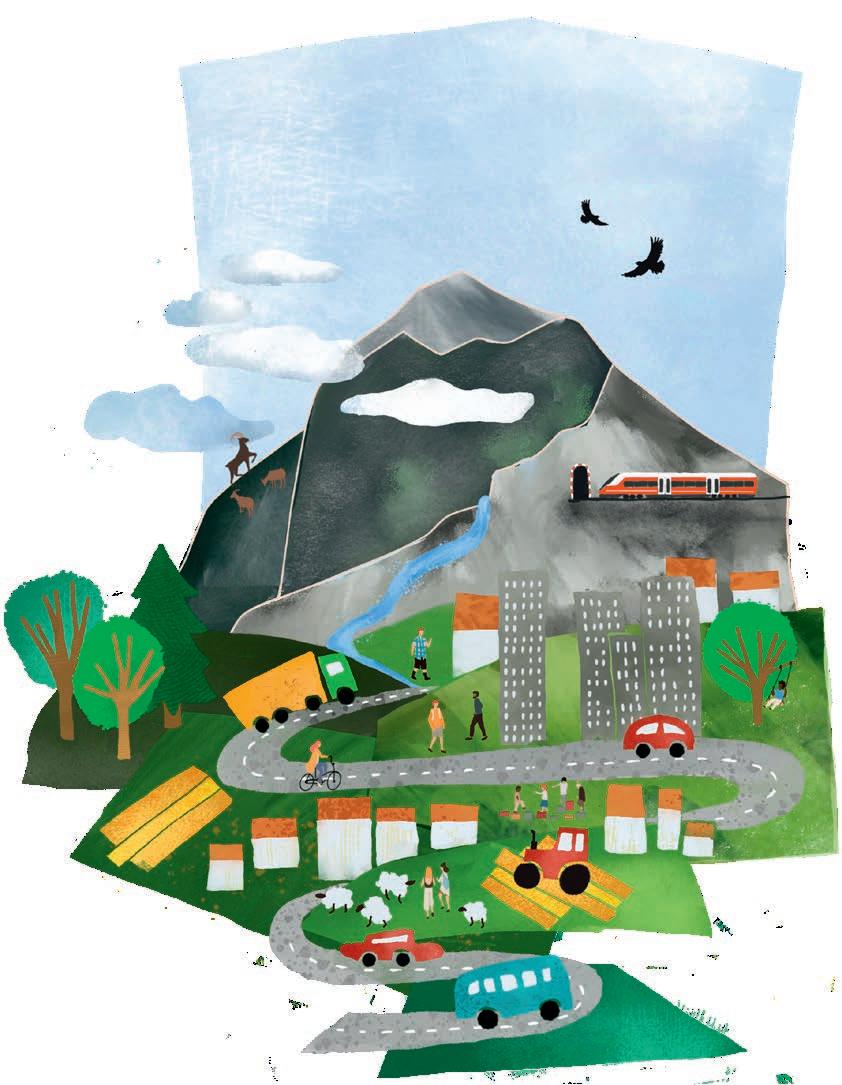
Wie lebt es sich in den Alpen? Der aktuelle Alpenzustandsbericht gibt darauf fundierte Antworten. Regelmäßig erhebt die Alpenkonvention den Zustand der Alpen –in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Analysen, Vergleiche und
Bewertungen liefern nicht nur ein klares Bild der Lage, sondern schaffen auch die Basis für politische Weichenstellungen. Die zehnte Ausgabe dieses Berichts entstand unter dem Vorsitz Sloweniens im Jahr 2023/24 – und stellt die Lebensqualität ins Zentrum der Betrachtung.
Und was ist die Alpenkonvention? Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den acht Alpenstaaten und der EU. Ihr Ziel: den Alpenraum als Lebens-, Natur- und Wirtschaftsraum nachhaltig zu entwickeln und zu schützen. Als erster internationaler Vertrag für nachhaltige Entwicklung
und den Schutz eines gesamten Gebirgszuges ist sie eine Pionierin ihrer Art. Seit 1991 arbeiten die Vertragsparteien gemeinsam an Lösungen für Herausforderungen wie Klimawandel, Tourismus, Verkehr und Biodiversität – über Grenzen hinweg. Die Sicherung einer guten Lebensqualität ist eine der obersten Prioritäten der Alpenkonvention.
Ruhe. Natur. Luft
Die Menschen betrachten die Natur als einen der größten Vorteile am Leben in den Alpen. Zu den größten Schwächen zählen hohe Lebenserhaltungskosten, Entfernung zu Dienstleistungen und Overtourism. >
Einflussfaktoren auf die Lebensqualität in den nächsten 10 Jahren
Erreichbarkeit von Infrastruktur und Dienstleistungen
Zu den am höchsten bewerteten Faktoren den Einfluss auf die Lebensqualität betreffend gehören einige, die völlig individuell und außerhalb der Reichweite öffentlicher Maßnahmen zu liegen scheinen. Aber auch die persönliche Gesundheit kann indirekt durch ein gesundes Lebensumfeld und eine hochwertige, zugängliche Gesundheitsversorgung beeinflusst werden.
Landschaft
sauberes Wasser
Umwelt gutes Essen
Sicherheit
Lebensraum
Artenvielfalt
geringe Bevölkerungsdichte weniger Umweltverschmutzung
Wandern
Berge
(Substantiv, feminin)
zugängliche Dienstleistungen
Lebensstil
Bedeutung: … ist alles, was wir wertschätzen und was wichtig ist, damit wir als Gesellschaft gedeihen können. Dazu gehören wirtschaftliche, soziale und ökologische Lebensbedingungen –aber auch subjektive Zufriedenheit. Lebensqualität wird individuell unterschiedlich wahrgenommen und ist je nach Region verschieden ausgeprägt.
Fazit: Lebensqualität sichern heißt Verantwortung übernehmen
Die Alpen stehen sinnbildlich für Lebensqualität: intakte Natur, regionale Verwurzelung, kulturelle Vielfalt. Doch diese Qualitäten geraten zunehmend unter Druck – durch Klimawandel, demografische Veränderungen, touristische Übernutzung und infrastrukturelle Defizite. Der Alpenzustandsbericht macht deutlich: Die Herausforderungen sind komplex, aber nicht unlösbar.
Was es braucht, ist ein Zusammenspiel aus internationaler Zusammenarbeit, politischem Willen und regionalem Engagement. Gerade auf kommunaler Ebene wird das Potenzial der Alpenkonvention bislang noch nicht ausreichend ausgeschöpft: Nachhaltige Mobilität, leistbares Wohnen, gute Versorgung und der Schutz der natürlichen Ressourcen müssen zusammengedacht werden. Denn die Lebensqualität in den Alpen ist kein Selbstläufer – sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen.
Und du?
Was bedeutet Lebensqualität für dich – in deinem Alltag, in deiner Gemeinde, in deiner Umgebung? Lebst du in den Alpen –oder mit den Alpen?
Der Alpenzustandsbericht lädt nicht nur zum Lesen ein, sondern auch zum Nachdenken: Wo erlebst du Lebensqualität ganz konkret – und was bist du bereit zu tun, um sie zu erhalten?
So kommen die Menschen in den Alpen von A nach B
Zu den größten Herausforderungen bei der Sicherstellung einer guten Lebensqualität zählt die schlechte öffentliche Verkehrsanbindung. Da ist es nicht verwunderlich, dass Menschen auf ihr Auto angewiesen sind.
» Ich bin froh, dass ich hier aufgewachsen bin –aber zum Arbeiten zieht es viele weg.«
» Wenn man das Glück hat, von den Alpen aus im Homeoffice arbeiten zu können … dann ist das Leben hier einfach unbezahlbar.«
» Nach 50 Jahren Leben in der Großstadt bin ich vor drei Jahren in meine alte Heimatstadt, eine Bezirkshauptstadt, zurückgezogen und habe diese Rückkehr als Gewinn an Lebensqualität erlebt. Soziale Einbindung, ein großes Angebot an naturnahen Freizeitaktivitäten und die fußläufige Erreichbarkeit aller Dienstleistungen, die man im Normalfall braucht, sind die Stärken einer Kleinstadt im alpinen ländlichen Raum.«
Weiterführende Informationen zur Alpenkonvention und ihren Themen inklusive dem Alpenzustandsbericht sind unter alpenconv.org zu finden.

wichtigsten Informationen gelangen.
Was hat ein internationales Abkommen mit deiner nächsten Bergtour zu tun? Mehr, als du denkst! Die Alpenkonvention schützt nicht nur Natur und Kultur im Alpenraum, sondern beeinflusst auch, wie wir uns in den Bergen bewegen, wohnen und wirtschaften. Finde heraus, wie viel Alpenkonvention in dir steckt!
Davon habe ich noch nie gehört.
Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den acht Alpenstaaten und der EU zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums.
Spannend – darüber möchte ich mehr wissen!
Inhalt
Sie regelt, wie Natur geschützt und Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr und Leben in den Alpen nachhaltig gestaltet werden sollen.
Ihre Protokolle sind verbindlich – die Länder müssen sich also daran halten. In Österreich gelten sie direkt wie Gesetze.
Schon mal was von der Alpenkonvention gehört?
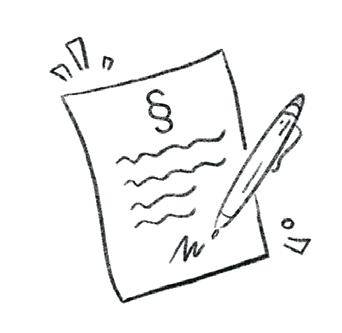
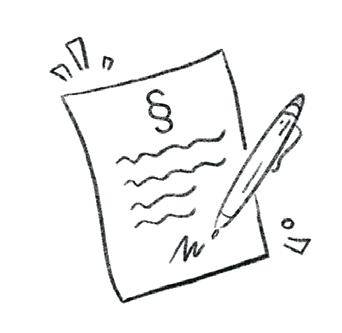
Super! Was kann ich für meine Bergabenteuer davon mitnehmen?
Die Alpenkonvention wurde 1991 als erster internationaler Vertrag unterzeichnet, der für eine gesamte Gebirgskette gilt –die Alpen.
Schütze, was du liebst –durch Respekt für die Menschen vor Ort, Genuss von Regionalem und achtsames Verhalten in der Natur.
Puh, wenn diese schon so alt ist, warum soll ich mich damit jetzt beschäftigen?
Bis heute wird an der Umsetzung der Alpenkonvention gearbeitet – denn die Alpen sind besonders stark von der Klimakrise betroffen: durch Felsstürze, Starkregen und mehr Hitzetage. Das verändert nicht nur den Bergsport, sondern auch das Leben in den Alpen. Deshalb ist die Alpenkonvention heute besonders wichtig.
Ja, aber was hat das mit mir zu tun?
Die Alpenkonvention schützt die einzigartige Bergwelt der Alpen.
Die Alpenkonvention stellt sicher, dass die Alpen auch in Zukunft ein guter Ort für dich zum Leben, Arbeiten und Erholen bleiben.
Was hat das mit dem Alpenverein zu tun?

Als Naturschutzorganisation setzt sich der Alpenverein aktiv für die Umsetzung der Alpenkonvention ein.
Ok, das klingt gut. Was heißt das genau?
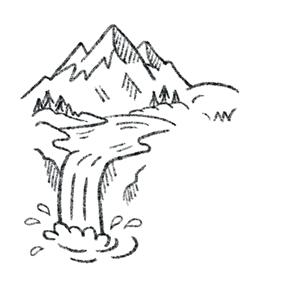
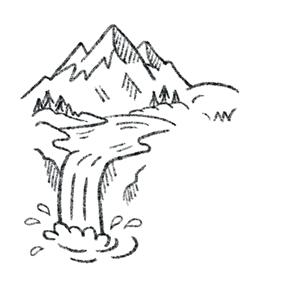
Du willst doch sicher auch in einem Ort mit hoher Lebensqualität wohnen, oder? Eine gute Öffi-Anbindung, eine nachhaltige Energieversorgung oder saubere Luft sind Beispiele, die uns alle betreffen.
Großartig! Was sind konkrete Projekte des Alpenvereins?
Die Bergsteigerdörfer sind ein Umsetzungsprojekt der Alpenkonvention, weil sie nachhaltigen Tourismus und den Erhalt alpiner Kulturlandschaften verbinden.
Die Bergwaldprojekte und Umweltbaustellen, die Klimastrategie oder das strenge Umweltgütesiegel für Hütten gehen Hand in Hand mit der Alpenkonvention.




Glitzernde Paneele an Berghängen, dahinter schroffe Gipfel – ein Bild wie aus dem Lehrbuch des Klimaschutzes. Doch im sensiblen alpinen Raum ist der Ausbau erneuerbarer Energien alles andere als trivial. Wie viel Eingriff verträgt das Hochgebirge?
Das Sachprogramm Photovoltaik der Steiermark zeigt, wie Raumplanung klare Rahmenbedingungen für eine naturverträgliche Entwicklung schaffen kann.
f lorian k ress
Es ist unbestritten, dass angesichts der Klimakrise der Ausbau der erneuerbaren Energien voranschreiten muss. Photovoltaikanlagen genießen eine breite Zustimmung in der Bevölkerung und sind quasi der Liebling unter den erneuerbaren Energien. Dies liegt vermutlich daran, dass die Solarenergie im Vergleich zur Wind- oder Wasserkraft weniger Konflikte mit sich bringt, da für sie kaum Grünflächen oder gar naturnahe Räume angegriffen werden müssen – zumindest bis dato. Der Photovoltaik-Ausbau konzentriert sich bisher auf Dachflächen und auf Anlagen an bestehenden Gebäuden. Dies wird sich in naher Zukunft ändern. Denn die Ausbaupläne in Österreich sehen eine enorme Steigerung der Stromproduktion aus Sonnenenergie vor
(von 2 auf 13 Terawattstunden pro Jahr zwischen 2020 und 2030). Etwa die Hälfte der Kapazität wird auf Freiflächen entstehen müssen, da das Potenzial von Dachflächen, Fassaden oder sonstigen verbauten Flächen wie Parkplätzen für den angestrebten Ausbau bei weitem nicht ausreicht. Dieser Umstand wird den Druck auf Freiflächen ab sofort stark ansteigen lassen. Damit dies nicht ungeordnet passiert, ist es wichtig, dieser Entwicklung raumplanerische Instrumente zur Seite zu stellen. Derzeit gibt es mit Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten vier Bundesländer, die über eigene Raumordnungsprogramme zum
Thema Photovoltaik im Freiland verfügen. In den ersteren drei erfolgte zudem eine systematische Analyse der Landesfläche sowohl nach Eignungs- als auch Ausschlusskriterien, um Vorranggebiete für die Photovoltaiknutzung auszuweisen.
Sachprogramm Photovoltaik Steiermark
Das Sachprogramm Photovoltaik der Steiermark, offiziell „Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie –Solarenergie“ genannt, ist nicht nur aufgrund des räumlichen Schwerpunkts dieser Bergauf-Ausgabe auf das Gastgeberland der diesjährigen Hauptversammlung einen näheren Blick wert. Es stellt derzeit auch die einzige gesetzliche Grundlage in Österreich dar, die den alpinen Raum1 gesamthaft für die Nutzung von Solarenergie im größeren Maßstab ausnimmt. Dies gilt für Anlagen mit einer Fläche von über 400 m². Begründet wird dieser Ausschluss mit der „naturräumlichen, landschaftlichen und ökologischen Sensibilität“ des Bereichs oberhalb der Waldgrenze. Auch vorbelastete Areale um Skigebiete unterliegen aufgrund ihres hohen Flächenverbrauchs und der damit einhergehenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes diesem Ausschlusskriterium. Zwei Ausnahmen gibt es allerdings: zum einen für die Eigenversorgung bestehender Gebäude, wenn der Bedarf über bauwerksintegrierte Anlagen nicht gedeckt werden kann. Dies könnte beispielsweise bei Hütten oder Almen der Fall sein.
Zum anderen für Anlagen im unmittelbaren Zusammenhang mit bestehenden Windkraftanlagen. Dabei können die Synergiepotentiale angesichts der baulichen Vorbelastung und vor allem im Hinblick auf die vorhandene Erschließung (Verkehr, Leitungen) ausgenutzt werden. Das heißt nicht, dass Photovoltaikanlagen in Kombination mit Windkraftanlagen grundsätzlich möglich sind, der Sensibilität des Landschaftsraumes ist in jedem Fall Rechnung zu tragen.
Bauwerksintegrierte Photovoltaikanlagen sind konfliktarm und auch auf Alpenvereinshütten bereits weit verbreitet wie hier an der HeinrichHueter-Hütte im Rätikon. Foto: Marc Obrist
Der Photovoltaik-Ausbau konzentriert sich bisher auf Dachflächen und auf Anlagen an bestehenden Gebäuden. Dies wird sich in naher Zukunft ändern. >
1 Der Einfachheit halber ist in diesem Artikel die subalpine Höhenstufe als Übergangsbereich zwischen geschlossener Waldgrenze und dem baumfreien, alpinen Gelände mitgemeint.

Besonderheiten des alpinen Raums
Welche konkreten Merkmale machen das Hochgebirge gegenüber baulichen Eingriffen im Allgemeinen so sensibel? Was ist dort im Vergleich zu niedrigeren Lagen anders? In der Höhe laufen jegliche biologische Prozesse von Boden und Vegetation verlangsamt ab. Zudem sind die Vegetationsperioden sehr kurz. Beide Faktoren sorgen dafür, dass eine Renaturierung der genutzten Bereiche kaum möglich ist. Flächen für Bau und Lagerung sowie für den Rückbau am Ende der Lebensdauer von Photovoltaikanlagen vergrößern das beanspruchte Gelände dabei erheblich.
Vor allen Dingen zeichnen sich alpine Standorte durch ihre Abgeschiedenheit aus, weswegen die Flächeninanspruchnahme für deren Erschließung in der Regel unverhältnismäßig hoch ausfällt. Der (Aus-)Bau der Zufahrtswege führt auch zu

^ Test neuartiger Photovoltaikanlagen am Tiefenbachferner (Sölden) auf 2.850 m: die vertikale Kreuzstruktur hält die Module schneefrei, sorgt für weniger Errichtungs- und Wartungsaufwand sowie ist platzsparend und flexibel positionierbar. Foto: HELIOPLANT®
‹ Photovoltaikanlagen am Pitztaler Gletscher auf rund 3.000 m wurden bereits 2015 installiert. Foto: ehoch2.
einer Zerschneidung und Verkleinerung der Lebensräume. Diese beherbergen in den alpinen Höhenstufen eine überproportionale Zahl an seltenen Arten. Bodenund Vegetationszerstörungen wirken sich daher umso gravierender auf die lokalen Ökosysteme aus.
Im Vergleich zu den ökologischen Aspekten sind die Eingriffe in das Landschaftsbild angesichts des offenen, sichtexponierten Geländes besonders offensichtlich. Bauliche Vorhaben stellen daher in der Regel einen erheblichen Eingriff in das weitgehend naturnahe, teils identitätsstiftende Landschaftsbild dar. Aufgrund dieser Merkmale steht der Österreichische Alpenverein der Neubeanspruchung alpiner Flächen grundsätzlich kritisch gegenüber.
Mit Windkraftanlagen in Gebirgsregionen hat sich der Alpenverein bereits intensiver beschäftigt und im gleichnamigen Positionspapier den Raum oberhalb der Waldgrenze für die gewerbli-
Im Vergleich zu den ökologischen Aspekten sind die Eingriffe in das Landschaftsbild angesichts des offenen, sichtexponierten Geländes besonders offensichtlich. Bauliche Vorhaben stellen daher in der Regel einen erheblichen Eingriff in das weitgehend naturnahe, teils identitätsstiftende Landschaftsbild dar.
che Windkraftnutzung ausgeschlossen (siehe Bergauf #4.2022). Moderne Windräder sind um die 200 bis 250 Meter hoch, verlangen ein mehr als tausend Tonnen schweres Beton- und Stahlfundament im Durchmesser von 20 bis 30 Metern und müssten aufgrund von Abstandsregelungen zu Gebäuden und der Eiswurfgefahr eine Distanz von mehreren hundert Metern zu Seilbahnen und Skipisten einhalten. Letzterer Umstand würde eine Konzentration auf vorbelastete alpine Räume quasi unmöglich machen. Photovoltaikanlagen lassen sich dagegen in ihrer Größe skalieren, sind in unmittelbarem Nahbereich bestehender Nutzungen realisierbar und damit weitaus natur- und landschaftsverträglicher. Die entscheidende Fragestellung in Bezug auf die Photovoltaiknutzung im alpinen Raum ist, welche Anlagengrößen als vertretbar angesehen werden können. So schließt das Sachprogramm der Steiermark die Nutzung der Solarenergie oberhalb der Waldgrenze auch nicht vollständig aus, sondern nur Anlagen ab einer gewissen Flächenausdehnung.
Status quo: alpine Anlagen
In Österreich spielen Freiflächen-Photovoltaikanlagen in höheren Lagen aktuell so gut wie keine Rolle. Ausnahmen stellen beispielsweise Anlagen in der Wildkogel Arena (Pinzgau), am Pitztaler Gletscher oder in Sölden dar, die im Nahbereich
der jeweiligen Skigebiete angesiedelt sind und diese mit erneuerbarem Strom versorgen. Die Anlagen haben allesamt den Charakter von Pilotprojekten.
Ganz anders zeigt sich die Entwicklung in der Schweiz. Unter dem Titel „Solarexpress“ wird seit 2022 der Bau von Großanlagen im alpinen Raum durch beschleunigte Bewilligungsverfahren und großzügige Fördergelder massiv vorangetrieben, eine Reaktion auf den Ukrainekrieg und die Sorge um Stromknappheit. Die negativen Aspekte für Natur und Landschaft nimmt man in Kauf. Grund dafür ist, dass die Schweiz kaum über Windkraft verfügt, die im Winter Strom aus erneuerbaren Quellen liefern könnte. Photovoltaikanlagen in alpinen Lagen sollen im Winter im Vergleich zu Anlagen im Flachland höhere Erträge bringen, wobei sich weniger Nebeltage, das vom Schnee reflektierte Sonnenlicht und niedrigere Temperaturen positiv auswirken. Derzeit stockt der Ausbau in der Schweiz,
noch keines der 22 geplanten Projekte ist in Betrieb. Der Bau der Anlagen im alpinen Gelände ist teurer als erwartet und die Prognosen für die erhofften Erträge mussten nach unten korrigiert werden. Trotz hoher Subventionen wird davon ausgegangen, dass die Anlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden können.
Der Österreichische Alpenverein unterstützt grundlegend Anstrengungen und Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Dabei sollen zunächst Energieeinsparpotenziale ausgeschöpft werden, bevor neue Räume für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen in Anspruch genommen werden. In diesem Sinn sollte der Ausbau der Solarenergie auf Gebäuden und bereits versiegelten Flächen höchste Priorität haben. Ein wachsender Druck auch auf Flächen oberhalb der Waldgrenze ist allerdings abzusehen.
Der Alpenverein begrüßt, dass das Sachprogramm Photovoltaik der Steiermark die besonderen Gegebenheiten des alpinen Raums anerkennt und einen entsprechenden Schutz vorsieht. Vergleichbare gesetzliche Rahmenbedingungen wären österreichweit wünschenswert. Alpine Photovoltaikanlagen können in Kombination mit bestehenden Nutzungen, insbesondere in Skigebieten, als eine sinnvolle Ergänzung für einen nachhaltigeren Betrieb angesehen werden, sofern sie sich in einem natur- und landschaftsverträglichen Rahmen bewegen. Dies ist abgesehen von der Wertigkeit des konkreten Standorts vor allem von der Dimension der Anlagen abhängig. Der Alpenverein könnte seine alpine Expertise in die Ausarbeitung raumplanerischer Sachprogramme einbringen.
Florian Kreß ist in der Abteilung Raumplanung und Naturschutz des Österreichischen Alpenvereins für Mobilitätsthemen und alpine Raumplanung zuständig.

Der Österreichische Alpenverein präsentier t
− Fotografie und bewegte Bilder
Mariya Nesterovska − V ioline
Huber t Mittermayer Nesterovskiy − Fagott
Heinz Zak Percussion
Tobias Steinberger

Nächste Termine, veranstaltet von den Alpenvereinssektionen:
Mi. 15. Oktober – Klagenfurt
Do. 16. Oktober – Lienz
Di. 4. November – Götzis
Mit freundlicher Unterstützung
Mi. 26. November – St. Leonhard am Forst
Do. 27. November – Mödling
So. 30. November – Salzburg
Weitere Infos

Almen sind weit mehr als idyllische Postkartenmotive: Sie sind artenreiche Lebensräume, naturnahe Wirtschaftsflächen und Erholungsorte mit jahrtausendealter Geschichte. Ihre Ökosystemleistungen wirken oft im Verborgenen, sind aber von unschätzbarem Wert für Mensch und Natur. a ndreas b ohner

Almen nehmen in Österreich derzeit 326.280 Hektar ein, das entspricht 13 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Doch diese Fläche schrumpft: Seit Jahrzehnten gehen Almen, gealpte Tiere und Almbetriebe zurück. Damit geraten auch ihre vielfältigen Leistungen für Umwelt und Gesellschaft in Gefahr.
Was die Alm für uns tut
Almen bieten eine Vielzahl an Versorgungsleistungen: Sie liefern Futterpflanzen für Nutz- und Wildtiere und versorgen uns mit hochwertigen Nahrungsmitteln wie Milch, Käse, Topfen, Butter und Fleisch. Sie beherbergen eine große Vielfalt an Pflanzen, darunter Wildkräuter, Wildobst sowie Arznei-, Volksarznei-, Likör-, Gewürz-, Duft-, Kosmetik- und Färberpflanzen. Auch genetische Ressourcen wie zum Beispiel Saatgut werden auf Almen bewahrt. Darüber hinaus tragen sie durch ihre hohe Grundwasserneubildungsrate zur Trinkwasserversorgung bei.
Auch ihre Regulationsleistungen sind beachtlich: Die hohe Biodiversität ergibt sich aus einem kleinflächigen Lebens-

Das vielseitige Futterangebot und ein besonders hohes Tierwohl sind die Basis für die hochwertige Qualität von Lebensmitteln gealpter Tiere.
Foto: Andreas Bohner
» Die naturnahe Bewirtschaftung fördert regionale
Wirtschafts-
kreisläufe, erhält hand
werkliches
Wissen und schafft Arbeitsplätze. «
raummosaik. Tiefgründige, steinarme Almböden speichern viel Kohlenstoff. Ihre nachhaltige Nutzung fördert die Bodenqualität und verhindert Versauerung. Zudem schützen Almen vor Plaikenerosion. Dank geringer Interzeptionsverluste (Verdunstung von Pflanzenoberflächen) können Almen viel Wasser in der Landschaft speichern.
Die soziokulturellen Leistungen der Almen reichen vom prägenden Landschaftsbild – mit Offenheit, Fernsicht und ästhetischer Vielfalt – über ihre Bedeutung für Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden bis hin zu Kulinarik, Brauchtum, traditionellem Handwerk und dem Erhalt alten Wissens wie Rezepten oder volksheilkundlichen Anwendungen. Almen dienen als Orte für Bildung und Wissenschaft, etwa durch Lehrpfade, Kräuterkurse, Exkursionen und Forschungsprojekte. Sie beherbergen religiöse und kulturelle Elemente wie Almkreuze, Kapellen oder Natur- und Kulturdenkmäler. Von der durch die Almbewirtschaftung geschaffenen Infrastruktur
wie Wegen, Almstraßen, Sitzbänken, Brunnen, Orientierungspunkten und Unterständen profitiert auch die Freizeitnutzung. Nicht zuletzt ermöglichen sie medizinische Hilfeleistung in entlegenen Gebieten.
Wirtschafts- und Kulturraum Alm
Almen sind ein jahrtausendealtes Kulturgut – in den Ostalpen wird seit der Bronzezeit Almwirtschaft betrieben. Die naturnahe Bewirtschaftung fördert regionale Wirtschaftskreisläufe, erhält handwerkliches Wissen und schafft Arbeitsplätze. Bei nachhaltiger Nutzung werden auch negative Effekte wie Überdüngung oder Trittschäden minimiert.
Die Leistungen der Almen kommen vielen zugute: Auf privater Ebene profitieren beispielsweise Bauern/Bäuerinnen (gesunde Nutztiere), Wandernde (Wildobst, Erholung) und Naturliebhaber*innen (vielfältige Alpenflora und -fauna). Regional tragen sie zu Bauernmärkten und zum


» Anhaltende Hitze und Trockenperioden in Tal und Beckenlagen könnten die Almen als Futterquelle und Erholungsraum noch wichtiger machen. «
Tourismus bei, während national und international Aspekte wie die Erhaltung der Biodiversität oder der Handel mit Schafkäse ins Gewicht fallen.
Der Klimawandel kann in Bezug auf Almen als Herausforderung und Chance gesehen werden: Anhaltende Hitze- und Trockenperioden in Tal- und Beckenlagen könnten die Almen als Futterquelle und Erholungsraum noch wichtiger machen. Aufgabe oder Extensivierung fördern jedoch die Verbreitung von Rohhumus- und Tangelhumusbildnern wie Alpenrose und Latsche, was die Bodenfruchtbarkeit mindert. Der Verlust an Offenflächen beeinträchtigt sowohl die Biodiversität als auch das Landschaftsbild.
Fazit: Almen schützen heißt Zukunft sichern
Almen erbringen vielfältige Ökosystemleistungen, die unentgeltlich für die Gesellschaft bereitgestellt werden. Diese „Gratisleistungen der Natur“ benötigen menschliche Arbeit und nachhaltige Pflege. Gesellschaft und Agrarpolitik müssen diesen Beitrag anerkennen und unterstützen. Nur dann können Almen auch künftig als naturnaher Wirtschafts-, Erholungs- und Lebensraum erhalten bleiben.
Dr. Andreas Bohner, HBLFA RaumbergGumpenstein.
¡ nfo
Wer profitiert von Almen?
Einzelpersonen (z. B. Almbäuerinnen, Wanderer) Lokale Gemeinschaften (Nahversorgung, Freizeit) Regionale Wirtschaft (Tourismus, Märkte) Gesundheits- und Sozialwesen (psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden) Gesellschaft (Klimaschutz, Biodiversität, Bildung)
¡ nfo
Sicher miteinander auf Almen
Damit auch in Zukunft Österreichs einzigartige Kulturlandschaft frei zugänglich bleibt, setzt der Österreichische Alpenverein gemeinsam mit dem BMLUK und der Landwirtschaftskammer Österreich auf ein gutes Miteinander auf Almen und Weiden. Die „10 Regeln für den richtigen Umgang mit Weidevieh“ dienen einem friedlichen Miteinander auf den Almen.

… oder warum es sich lohnt, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dritter Teil einer vierteiligen
RespektAmBerg-Serie zum Thema Besucherlenkung.
g eorg roth Wangl

In Österreich gibt es zahlreiche freiwillige Lenkungsmaßnahmen für Bergsportund Naturinteressierte. Das ist gut und sinnvoll, denn wann immer etwas freiwillig gelöst wird, braucht es keine Gesetze und Verordnungen. Freiwillige Schutzzonen für Tiere und Pflanzen helfen, den Nutzungsdruck durch Freizeitaktivitä-
ten in sensiblen Gebieten zu reduzieren. Wichtig bei der Auswahl solcher Gebiete ist, dass alle beteiligten Lebensraumpartner an einem Tisch sitzen. Nur gemeinsam kann es zu einem stimmigen Ausgleich der Interessen von Forst, Jagd, Naturschutz, Tourismus und Bergsport kommen. Dieser Ausgleich garantiert auch
die höchstmögliche Akzeptanz der beschlossenen Lenkungen. Hier ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Maßnahmen in Österreich von West nach Ost: „Respektiere deine Grenzen“ in Vorarlberg und „Bergwelt gemeinsam erleben“ in Tirol sind die Paradebeispiele, wie es richtig gemacht wird. In Salzburg wird gerade
die bestehende Kampagne „Respektiere deine Grenzen“ mit allen Beteiligten überarbeitet. In Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und Niederösterreich gibt es lokale freiwillige Schutzzonen, wie z. B. in Hohentauern, am Warscheneck und am Göller. Eine Recherche, ob es freiwillige Lenkungsmaßnahmen gibt – z. B. unter alpenverein.at/portal/naturumwelt/av-naturschutz/besucherlenkung oder alpenvereinaktiv.com – gehört übrigens zu jeder guten Tourenplanung mit dazu.
Georg Rothwangl ist Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung und Naturschutz im Österreichischen Alpenverein.
¡
Dieser Artikel ist der dritte Teil einer vierteiligen Serie zu RespektAmBerg. Bisher war ein wichtiges Bewertungskriterium für eine erfolgreiche Tour, ob alle Teilnehmer*innen wohlbehalten am Abend zu Hause angekommen sind. Dabei lag der Fokus auf der Gruppe bzw. auf der Person, welche die Tour unternommen hat. Mit Fokus auf die Menschen wurden Gefahren beurteilt, Alternativen analysiert und nach einer gewissenhaften Tourenplanung die Tour möglichst gut umgesetzt. Die Auswirkung der Tour auf Wildtiere und -pflanzen ist manchmal in den Hintergrund gerückt. Dieses Jahr wollen wir gemeinsam Touren machen, die gut für uns und gut für die Natur sind. Wir als Alpenvereinsmitglieder wollen Vorbild für alle bergsportbegeisterten Menschen sein und zeigen, dass wir bei unseren Touren auch an die Wildtiere und Pflanzen in den Bergen denken und auf sie Rücksicht nehmen.

Mehr Infos: www.alpenverein.at/ portal/natur-umwelt/ respektamberg
Die Klimakrise verändert die Alpen rasant: Gletscher schmelzen, Bäche graben neue Rinnen, Geröll gerät ins Rutschen und auf den neuen Flächen, die die Gletscher freigeben, breitet sich Vegetation aus. Was bedeutet das für die Sicherheit am Berg, für die Pflanzenwelt und für unsere Zukunft? Um Antworten darauf zu finden, braucht die Forschung mehr Daten. An dieser Stelle kommen wir alle ins Spiel – und die App myALPICS.
Ständig tragen wir das perfekte Messgerät mit uns – auch auf Bergtouren: das Smartphone. Was gewöhnlich per Foto die Erinnerungen an Bergtouren festhält, kann jetzt auch die Forschung mit wertvollen Daten unterstützen. Mit der App myALPICS können alle Personen, die mithelfen möchten, ihre Beobachtungen in der Landschaft dokumentieren und teilen.
Besonders spannend: myALPICS umfasst auch hunderte historische Fotos, welche die teilweise dramatischen Veränderungen in den Alpen durch einen Vergleich von früher und heute aufzeigen. Auf einer interaktiven Karte können die Aufnahmeorte der Fotos gefunden, die historischen Fotos visualisiert und erneut fotografiert werden. myALPICS wird von der Technischen Universität Wien und der EURAC Research in Bozen entwickelt.

(Substantiv, feminin)
Bedeutung: Die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) ist eine zarte Pflanze, die im Herbst blassviolette, krokusähnliche Blüten trägt, während die anderen Pflanzen ihre Blüten schon verloren haben. Der Wiesenbewohner mit dem romantisch anmutenden Namen ist hochgiftig, doch hat auch nützliche Kräfte. Das Gift der Herbstzeitlose namens Colchicin wird in der Medizin zur Behandlung der Gicht eingesetzt.
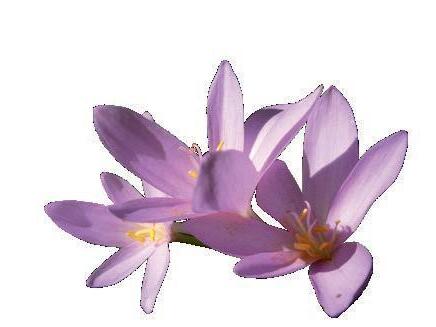

Lange bevor sich viele tierische Bewohner der Alpen zur Winterruhe oder in den Winterschlaf zurückziehen, läuft bei zahlreichen Arten das Fettaufbauprogramm auf Hochtouren. Gramm für Gramm beginnt das Murmeltier schon Ende August, sich seinen Winterspeck anzufressen. Dieser kleine Meister der Vorbereitung nimmt so viel Nahrung auf, bis sich sein Körpergewicht fast verdoppelt. Seine Fettreserven sind für das emsige Tier lebensnotwendig, um die langen Monate ganz ohne Nahrung zu überstehen.
Alle Informationen zum Projekt und zum App-Download unter: www.myalpics.com
Die Klimakrise macht dem Murmeltier zu schaffen, denn sie führt zu mehr heißen Tagen in den Bergen: Murmeltiere können nicht schwitzen und ziehen sich deshalb bei Hitze in ihren Bau zurück. In
dieser Zeit können sie nicht fressen und somit auch keinen Speck für den Winter zulegen – was fatale Folgen haben kann. Im Spätherbst beginnen die Arbeiten im Murmeltierbau. Nestkammern werden mit trockenem Gras weich ausgepolstert. Den Eingang zum Bau verschließt das Murmeltier mit Gras, Erde, Kot und Steinen. Wenn im Oktober der eigentliche Winterschlaf beginnt, schlägt das Herz des Murmeltiers ca. 20-mal pro Minute. Etwa zwei Atemzüge in der Minute genügen ihm und seine Körpertemperatur sinkt auf wenige Grad über dem Gefrierpunkt. Sechs bis sieben Monate verbringt das Murmeltier in seinem Bau und übersteht den harten Winter im Gebirge mit seiner beeindruckenden Strategie tief im Verborgenen.
In den Nordöstlichen Kalkalpen wachsen Pflanzen, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Ein Forschungsteam der Universität Innsbruck will diese endemischen Arten besser verstehen – und damit ihren Schutz gezielt verbessern. Denn nur wer ihre genetische Vielfalt kennt, kann sie langfristig erhalten.
Die Nördlichen Kalkalpen sind ein über 500 km langer Gebirgszug, der sich von Vorarlberg über ganz Österreich bis an den Alpenostrand erstreckt. Dieses Gebiet ist landschaftlich äußerst vielfältig und beherbergt eine große Artenvielfalt. Aus botanischer Sicht sind vor allem die Nordöstlichen Kalkalpen, das Gebiet zwischen dem Traunsee und Wien, von besonderer Bedeutung. Hier findet man zahlreiche endemische Arten – das bedeutet Arten, die es weltweit nur hier gibt!
Forschung im Gelände
Botaniker*innen der Universität Innsbruck unter der Leitung von Peter Schönswetter und Philipp Kirschner erforschen in einem aktuellen Projekt die Herkunft und Vielfalt von acht ausgewählten endemischen Pflanzen. Dafür wurden im Sommer 2024 über 2.000 Blattproben aus den Nordöstlichen Kalkalpen gesammelt. Die Sammler*innen legten dabei rund 60.000 Höhenmeter und 700 km zurück.
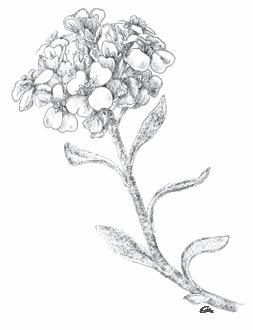

Oben: Alyssum neglectum (Hochschwab-Steinkraut) Unten: Campanula pulla (Dunkle Glockenblume). Illustration: Elke Huber
Die Proben wurden anschließend mit modernsten molekularbiologischen Methoden untersucht, um die biologische Vielfalt auf der grundlegendsten Ebene – der Ebene der Gene – zu erfassen. Eine hohe genetische Vielfalt ist eine Voraussetzung, die es Tierund Pflanzenarten ermöglicht, sich laufend an Veränderungen – wie etwa klimatische Herausforderungen – anzupassen. Die Ergebnisse dieses Projekts bilden eine wichtige Basis für einen zielgerichteten und wissenschaftlich fundierten Schutz dieser einzigartigen heimischen Pflanzenschätze. Mehr Infos zum Forschungsprojekt: t1p.de/feu4v
Endemiten & Eiszeitrelikte
Als Endemiten bezeichnet man Organismen, die weltweit ausschließlich in einem bestimmten Gebiet vorkommen – beispielsweise einer einzelnen Bergkette. Ein Beispiel wäre das Hochschwab-Steinkraut (Alyssum neglectum), das weltweit nur in alpinen Rasen des steirischen Hoch -
schwabs wächst und erst 2017 von Forscher*innen der Universität Innsbruck als neue Art beschrieben wurde.
Ungefähr 4.500 Pflanzenarten zählt man in den Alpen, davon kommen etwa 500 ausschließlich dort vor –sie sind also hier endemisch. Insgesamt 50 dieser AlpenEndemiten kommen wiederum ausschließlich in Österreich vor. Die meisten Endemiten findet man in der Nähe bekannter Eiszeitrefugien am Alpensüd- und Alpenostrand. Das sind Gebiete mit fehlender oder geringer eiszeitlicher Vergletscherung.
Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Landund Forstwirtschaft, Klimaund Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und NextGenerationEU gefördert.
p hilipp k irschner & e lke h uber

Die Podcastreihe der österreichischen
Bergsteigerdörfer ist komplett. Eine Bilanz.
Jörg Wunram
Dörfer, 23 Podcasts, rund 17 Stunden Gesamtdauer und Tausende Hörer. Eine stolze Bilanz für das Audioprojekt der Bergsteigerdörfer: „Wo weniger mehr ist.“ Großer Aufwand war dafür nötig. „Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Auch weil wir in jedem der 22 österreichischen Dörfer Menschen getroffen haben, die ihre Zukunft anpacken“, bilanzieren die Podcast-Produzenten Christof Schett und Jörg Wunram. Etwas anders drückt es Liliana Dagostin vom Österreichischen Alpenverein aus. Sie leitet die Abteilung Raumplanung und Naturschutz: „Die Dörfer sind eben Orte guten Lebens, die vieles anders und aus meiner Sicht richtig machen. Schön, dass das Wie nun auf www.bergsteigerdoerfer.org nachhörbar ist.“
Eine wichtige Rolle in dem Projekt haben die prominenten Alpinist*innen gespielt. Sie haben als Interviewer*innen kluge und einfühlsame Fragen gestellt. „Das war eine spannende Aufgabe“, sagt der blinde Profibergsteiger Andy Holzer aus Lienz, der unter anderem in Mauthen dabei und von dem breiten Engagement der Leute fasziniert war. „Die gesamte Podcastreihe ist Kino im Kopf“, so Holzer. Überraschend war vieles auch für die Vorarlbergerin und Profikletterin Barbara „Babsi“ Zangerl. „Obwohl ich das Große Walsertal gut kenne, weiß ich jetzt, was den Biosphärenpark so einzigartig macht. Neben der Natur sind es die Walser mit ihrer besonderen Geschichte und Kultur.“ Lob gibt es auch von Reinhold Scherer, Kletterpionier, Trainer und Geschäfts-


führer des Kletterzentrums Innsbruck, der seine Heimat – das Tiroler Gailtal –noch einmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt hat: „Nicht nur deswegen sind alle Folgen unerhört hörenswert.“
Der deutsche Extremkletterer Alexander Huber hat von seiner Rolle als Reporter im Villgratental sogar im Wortsinn profitiert. „Durch das Gespräch mit Rebecca und Josef Schett von der Villgrater Natur habe ich einen Abnehmer für die Wolle meiner Schafe gefunden. Die bringe ich jetzt immer vorbei, wenn ich dort wieder Skitouren mache.“ Der Podcast mit Alexander Huber war einer der reichweitenstärksten. Im innerfamiliären Vergleich
allerdings schnitt Thomas, der ältere der Huberbuam – Stand jetzt – etwas besser ab. Vielleicht, weil Thomas eine seiner ersten großen Alpentouren vor mehr als 40 Jahren im Ötztal sehr emotional Revue passieren ließ. „Hoffentlich bewahrt sich das Bergsteigerdorf Vent seinen Charme und wird nicht zum touristischen Hotspot. Mir hat die Rolle als Reporter jedenfalls großen Spaß gemacht.“
Fast 17.000 Mal wurden die insgesamt 23 Folgen bislang heruntergeladen. „Nummer eins im Ranking der Folgen nimmt Alpinist und Biobauer Simon Messner ein. Er hat mit der Ausgabe 1 und Ginzling das Eis gebrochen. Eine Begegnung


ist dem Südtiroler besonders gut in Erinnerung geblieben: „Durch das Gespräch mit Heimatforscher Alfred Kröll habe ich tiefe Einblicke in die Alpingeschichte des gesamten Zillertals bekommen.“
Auch Walter Laserer, der Bergsteiger aus Gosau, hat Impulse von seinem Einsatz mit heimgenommen. Er war in Grünau im Almtal und in Lunz am See in Niederösterreich mit von der Partie. Als er in Lunz an einem verregneten Tag ankam, dachte er zunächst etwas ernüchtert: „Wieder ein Ende der Welt.“ Und nach dem Besuch? „Lunz hat sich auf seine Stärken besonnen und konsequent ausgebaut. Das Haus der Wildnis und das Weltnaturerbe Dürrenstein-Lassingtal haben mich begeistert.“
„Von diesem Engagement in allen Bergsteigerdörfern könnten andere Orte lernen“, bilanziert Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner nach ihrem Besuch in Steinbach am Attersee. Fast ein Heimspiel für sie. „Es war nicht einfach, immer die richtigen Fragen zu stellen. Normalerweise werde ja ich interviewt. Was die Steinbacher*innen mit dem Sternenpark und dem Gustav-Mahler-Festival gesellschaftlich und kulturell auf die Beine stellen, belegt, wie kleine Orte große Herausforderungen meistern.“
Klar scheint zu sein: Die Expertise der einheimischen Bevölkerung ist ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft. „Niemand kennt die Heimat besser als die Leute, die dort leben“, sagt Roland Kals, einer der Mitbegründer der Bergsteigerdörfer-Initiative. In Weißbach bei Lofer hat er als Reporter sein Fazit gezogen. „Noch gibt es nicht auf alle Fragen eine Antwort. Aber daran arbeiten wir.“
Jörg Wunram lebt in Hamburg, ist Journalist und seit gut 40 Jahren in den Alpen unterwegs. Er liefert regelmäßig Beiträge für das Basecamp, den Podcast des Österreichischen Alpenvereins.

¡ Hier geht’s zu allen Podcastfolgen.
Von links oben nach rechts unten Alpinist*innen mit Interviewpartner*innen: Andy Holzer und Ingo Ortner in Mauthen, Babsi Zangerl und Monika Bischof (Biosphärenpark Großes Walsertal), Alex Huber mit Rebecca und Josef Schett (Villgrater Natur) und Simon Messner mit Willi Seifert (HochgebirgsNaturpark Zillertaler Alpen) in Ginzling. Fotos: eventoplena

Am Ende des Rovanatals, umrahmt von den hohen Gipfeln der Tessiner (genauer Lepontinischen) Alpen in der Schweiz, liegt das neue Bergsteigerdorf Campo Vallemaggia – ein guter Ort, um zur Ruhe zu kommen und neue Kraft inmitten unberührter Natur zu schöpfen.
t imo c adlolo
Die schmale Bergstraße windet sich in zahlreichen Serpentinen die steile Flanke des Maggiatals hinauf. Immer wieder geben die Bäume des dichten Laubmischwalds Ausblicke auf das Tal des Flusses Rovana frei. Hinter den Weilern Niva (955 m) und Piano di Campo (1.187 m) öffnet sich das Tal: Umgeben von Wiesen, Bergahorn- und Lärchenwäldern liegen der Hauptort Campo (1.320 m) und das kleine Dorf Cimalmotto (1.405 m).
Campo Vallemaggia zeichnet eine besondere landschaftliche Charakteristik aus, die durch zahlreiche Elemente der südalpinen Kultur geprägt ist. Von den vier Dörfern aus führen kleine Wege durch grüne Weiden und gepflegte Wälder zu alten Steinhäusern und bizarren Felsformationen. Das dichte Wegenetz zeugt von der intensiven Nutzung und Pflege des Gebiets durch die lokale Gemeinschaft. Ein Erbe, das mit dem Einbruch der Moderne und der damit verbundenen


steckbrief
Gebirgsgruppe
Tessiner Alpen, Lepontische Alpen
Höchster Gipfel
Pizzo Quadro (2.793 m)
Tourentipps www.bergsteigerdoerfer.org/ campo-vallemaggia
Video https://www.youtube.com/ watch?v=9AiZeH4PnoI
Gastgeber
Locanda Fior di Campo, www.fiordicampo.ch
Agriturismo Munt la Reita, www.muntlareita.ch
Rifugio la Reggia, www.dinodb.ch
Die Hangrutschung hat die Chiesa di Campo in etwas mehr als einem Jahrhundert um 31 Meter in der Horizontale und 7 Meter in der Vertikale verschoben.
Unterwegs auf dem Passo Quadrella.
Abwanderung in die Städte fast verloren gegangen wäre.
Martino Pedrazzini, der Vorsitzende der örtlichen Bürgergemeinde, erklärt: „Die Landschaft ist unsere wichtigste Ressource, die wir ständig pflegen.“ Mit großem Einsatz und viel Leidenschaft werden Wege und Gebäude instandgehalten. Doch dort, wo die Natur sich Terrassen und Karrenwege zurückerobert, entstehen geheimnisvolle Orte, die die Erinnerung an die Vergangenheit lebendig halten.
In Campo trifft man auf elegante Herrenhäuser und religiöse Gebäude, die man in dieser ländlichen, gebirgigen Umgebung kaum erwartet. Diese Kulturlandschaft erzählt vom Unternehmergeist, der die Bewohner*innen über Generationen geprägt hat, sowie von einem tiefverwurzelten Glauben, der im Alltag Trost und Hoffnung spendete. Aufgrund des demografischen Drucks und der Notwendigkeit, neue Einkommensquellen zu erschließen, waren die
Ortschaften über Jahrhunderte hinweg von Abwanderung betroffen – zunächst saisonal, später zunehmend dauerhaft.
Der wirtschaftliche Erfolg der Ausgewanderten und die anhaltende Verbundenheit einiger Familien mit ihrer Heimat ließen herrschaftliche Gebäude entstehen, die damals wie heute Bewunderung hervorrufen. „Sie sind Ausdruck unserer Kultur, kostbare Elemente, die auch heute noch einen großen Reiz ausüben“, erklärt Pedrazzini.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Gemeinde auf eine harte Probe gestellt. Durch ungünstige geologische Faktoren, steigenden artesischen Druck und großflächige Rodungen am Hangfuß von Campo und Cimalmotto wurde ein massiver Hangrutsch ausgelöst. Dieser geologische Prozess zählte über viele Jahre zu den bedeutendsten seiner Art in Europa. Fast 150 Jahre lang waren Inspektionen, umfassende Studien, Gutachten und verschiedene Lösungsansätze nötig, bis 1992 ein zwei Kilometer langer Entwässerungsstollen realisiert werden konnte, der schließlich eine Stabilisierung des Untergrunds sicherstellte.
Doch die Spuren des Hangrutschs sind noch deutlich sichtbar: In etwas mehr als einem Jahrhundert hat sich etwa die Kirche horizontal um 31 m und vertikal um 7 m verschoben, was zu Verformungen und Schäden an Gebäude und Einrichtung führte. Oder, wie Pedrazzini sich erinnert: „Dank des menschlichen Eingriffs hat sich das Phänomen beruhigt. Wer die Auswirkungen verstehen möchte, sollte die schiefe Treppe im Patrizierhaus von Campo hinabsteigen, wo sich auch die Touristeninformation befindet.“
Campo Vallemaggia – eine kleine Welt voller Entdeckungen: Ob im Sommer zu Fuß oder mit dem Fahrrad, im Winter auf Schneeschuhen oder Tourenski – Campo Vallemaggia bietet schier unendliche Möglichkeiten, die alpine Landschaft sowie eine besondere Kultur zu entdecken.
Timo Cadlolo koordiniert seit 2018 den lokalen Entwicklungsplan, der von den Gemeinden des Vallemaggia mit Unterstützung der Regionalpolitik gefördert wird, und beschäftigt sich insbesondere mit der Nachhaltigkeit von Tourismusprojekten. Sein Herz hängt an Campo Vallemaggia, der Heimatgemeinde seiner Großmutter.



























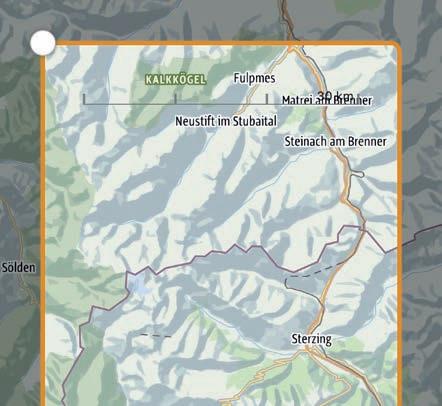





Die Alpenverein-Akademie bietet mit ihrer digitalen Lernplattform ein modernes und qualitätsstarkes Bildungsangebot. Wissbegierige mit Onlinezugang finden auf elearning.alpenverein-akademie.at vielseitig gestaltete Kurse – kostenfrei, orts- und zeitunabhängig.
a strid n ehls
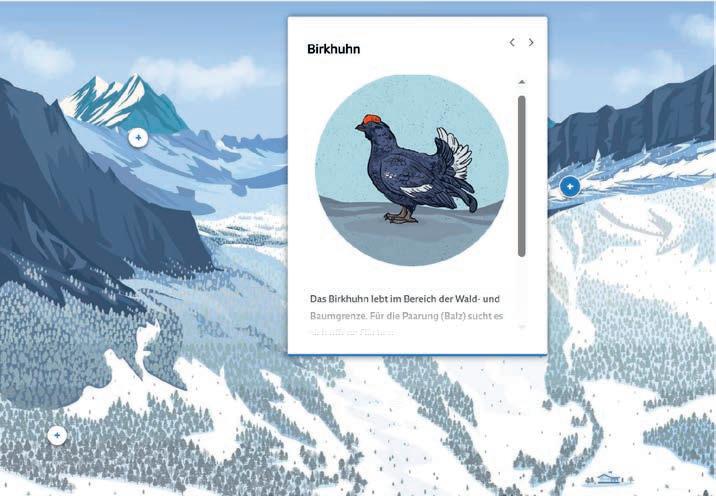
Die Inhalte für das eLearning-Angebot stammen aus den kompetenten Fachabteilungen des Österreichischen Alpenvereins: von Bergsport über Jugend und Naturschutz bis zu Öffentlichkeitsarbeit, Vereinsleitung und Archiv. eLearning eignet sich ideal zum Einstieg in neue Themen, zur Wissensauffrischung oder als Ergänzung zu Präsenzterminen – gelernt wird, wann, wo und wie schnell man möchte.
Für den Einstieg empfehlen sich die RespektAmBerg-Kurse. Etwa „Wildtiere im Winter“, den Manfred Eisner von der Sektion Klagenfurt besonders lobt: „Verständlich aufbereitet, naturgetreu vermittelt – das Wissen ist bei Skitouren, Kinderberglagern oder in der Volksschule bestens einsetzbar.“ Auch für Sportbegeisterte ist einiges dabei: vom Mountainbikecheck über Skitourenbasics bis zum Klettersteigkurs. eLearnings wie
„SicherAmBerg Sportklettern“ sind Teil der Übungsleiter*innen-Ausbildung, können aber auch von Interessierten frei belegt werden.
Die Themenvielfalt reicht von „Gletscherrückgang in der Kunst“ bis zur „Treibhausgas-Bilanzierung“. Besonders praxisnah sind Kurse wie „Recht und Haf-
» Verständlich aufbereitet, naturgetreu vermittelt – das Wissen ist bei Skitouren, Kinderberglagern oder in der Volksschule bestens einsetzbar. «
Manfred Eisner, Sektion Klagenfurt
tung“ oder „Kinderschutz und Gewaltprävention“, die Teilnehmende als „kurzweilig, informativ und sensibilisierend“, „mit wertvollen, verständlichen Tipps, die uns alle betreffen“ beschreiben. Auch die neue Erste-Hilfe-Reihe knüpft hier an – vielleicht ist es Zeit für ein Update? Und interessant: Auch im Hauptverein bildet man sich über eLearnings weiter. Das Projektteam bereitet selbst das trocken anmutende Thema „Softwareschulung“ motivierend und verständlich auf. Denn: Wissen belebt!
Astrid Nehls ist Mitarbeiterin der Alpenverein-Akademie im Österreichischen Alpenverein.
¡ nfo
Anzahl der Kurse: 35
Dauer der Kurse: zwischen 10 und 90 Minuten
Themenfelder: Bergsport, Jugend, Klima, Mensch-Gruppe-Entscheiden, Museum & Archiv, Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation im Verein
Kursabsolvent*innen: 6.500
Zugang: elearning.alpenverein-akademie.at

Hier geht’s zur eLearningPlattform der Alpenverein-Akademie.



Nur 158 Gramm pro Stock – dieser Fizan ist ein technisches Meisterstück aus hochfestem Alu 7001. Das innen liegende Verriegelungssystem sorgt für eine schlanke, nahezu nahtlose Optik – der Stock wirkt wie aus einem Guss. Für Bergsportler*innen, die keine Kompromisse machen: funktional, zuverlässig und ultraleicht. Das im Design abgestimmte Schlauchtuch ist gleich inklusive – praktisch, stylisch und vielseitig einsetzbar. Fizan steht seit Jahrzehnten für Innovation „Made in Italy“. www.fizan.it
79,95 €
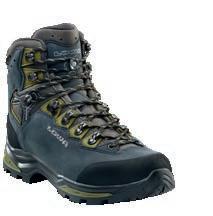

Mit dem MAURIA EVO GTX (Damen) und dem CAMINO EVO GTX (Herren) bietet LOWA zwei bewährte Modelle für klassische Trekkingtouren, Hüttenwanderungen und lange Weitwanderwege. Beide Modelle setzen auf robustes Nubukleder, eine wasserdichte GORETEX-Membran und eine wunderbar dämpfende Zwischensohle für langanhaltenden Gehkomfort. Der flexible Schaft und das LOWA X-LACING®-System sorgen für einen präzisen Sitz, während die Vibram®-Außensohle sicheren Halt auf unterschiedlichstem Untergrund bietet. Durchdachte Details wie die spezielle Damenleistenform beim MAURIA oder die zuverlässige Zwei-Zonen-Schnürung machen diese Modelle zu idealen Begleitern für anspruchsvolle Touren im herbstlichen Gelände. www.lowa.at
290 €
Mit den neuen SCORPIO-Klettersteigsets bietet Petzl durchdachte Ausrüstung für sicheres und komfortables Begehen von Klettersteigen. Herzstück ist der ultrakompakte Falldämpfer, ergänzt durch elastische Arme mit hoher Reichweite und einem kurzen Rastarm für Pausen. Je nach Bedarf stehen vier Varianten mit VERTIGO oder EASHOOK-Karabinern, optional mit Wirbel, zur Auswahl – alle mit leicht bedienbarer Verriegelung und großem Öffnungswinkel. Ergänzend erhältlich: zwei Komplettsets inklusive Gurt und Helm. Technische Anwendungstipps bietet das inkludierte Petzl Accessbook Klettersteig – ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene. www.petzl.com
Warme Softshellhose, die ein vielseitiger Allrounder für Trekking, Wandern und Bergsteigen ist. Für Funktionalität sorgen zwei windabweisende Materialien: ein atmungsaktives Gewebe im Beinbereich kombiniert mit abriebfestem Material mit Cordura-Anteil an Knien und Gesäß. Dank elastischem, teilweise verstellbarem Bund, vorgeformten Knien, integrierten Haken zur Fixierung an den Schuhen und elastischen Beinabschlüssen sitzt die Hose bei jeder Bewegung perfekt. Praktisch: drei Taschen und ein durchdachtes Design. Nicht umsonst wird sie auch von der tschechischen Bergrettung eingesetzt. www.directalpine.eu 169,95 €


Fahrradhandschuhe sind weit mehr als ein modisches Accessoire – sie schützen, stabilisieren und erhöhen den Fahrkomfort spürbar. Der CHIBA BioXCell Super Fly überzeugt dabei mit durchdachter Ergonomie: Die patentierte BioXCellHandballenpolsterung beugt Taubheitsgefühlen und Überlastung vor, indem sie den Druck auf den Ulnarnerv reduziert. Stöße und Vibrationen werden effektiv absorbiert – ideal auf längeren Strecken und ruppigem Untergrund. Das atmungsaktive Obermaterial sorgt für ein angenehmes Klima, während die griffige Innenhand bei Nässe und Schweiß sicheren Halt am Lenker bietet. www.chiba.de

Trockene, frische Schuhe sind nicht nur eine Frage des Komforts – sie tragen maßgeblich zur Langlebigkeit und Hygiene bei. Der Schuhtrockner BORA sorgt zuverlässig für trockene Schuhe, Handschuhe, Stiefel oder sogar Kleidung. Durch sanfte Warmluft werden Nässe und Schweiß entfernt, während gleichzeitig ein desinfizierender Luftstrom mit natürlichen Duftnoten wie Zitrone, Zeder oder Grapefruit für Frische sorgt. In den Sommermonaten kann BORA auch ohne Heizung betrieben werden – mit nur 5 Watt Stromverbrauch pro Modell – ideal zum Belüften. BORA ist in fünf Größen erhältlich und trocknet bis zu zehn Paar gleichzeitig. Eine praktische Lösung für alle, die regelmäßig draußen unterwegs sind und ihre Ausrüstung schonend pflegen möchten. www.oskari.at ab 377,40 €

Wir feiern mit …
… Rudi Arnberger: Der Alpenverein Edelweiss (Wien) feiert Rudi Arnberger, der in diesem Jahr seinen 50. Jahrestag als ehrenamtlicher Wanderguide in der Sektion begeht! Wissend, dass er sein Pulver noch nicht verschossen hat, freuen wir uns auf weitere Tourenschmankerln in den kommenden Jahren. Herzlichen Glückwunsch und danke für 50 glückliche Jahre als Tourenführer!
Wir trauern um …
… Ingeborg Huber aus Hallein. Inge war von 1973 bis 1978 Landesjugendleiter-Stellvertreterin in Salzburg und von 1979 bis Ende 1981 Bundesjugendleiter-Stellvertreterin.
Gesucht
Bergpartnerin. Suche nach einer weiblichen Wanderpartnerin im Raum Villach und Villach Umgebung, die unternehmungslustig ist und gern auch mehrtägige Wanderungen, Klettertouren oder Skitouren unternimmt. Kontakt: 0664/5425106.
Bergpartnerin. M, 60 plus, Weinviertler, Berg- und Naturfreund, sucht Bergpartnerin, schlank, sportlich, reisefreudig und Single, gerne auch aus einem anderen Bundesland. Freue mich auf eine Partnerschaft mit vielen gemeinsamen Berg-, Rad- und Skitouren. Kontakt: dnanitref@gmail.com

Was im Jahr 1875 mit 17 Mitgliedern in Waidhofen an der Ybbs relativ klein begonnen hat, ist mittlerweile zu einer großen Sektion mit Ortsgruppen entlang des Ybbstales und des Erlauftales geworden: Ybbsitz, Opponitz, Lunz am See, Kematen, Hollenstein und Gresten sind die Ortsgruppen des Alpenvereins Waidhofen an der Ybbs. Die 150-Jahr-Feier wurde im Juni gemeinsam mit der feierlichen Eröffnung der sektionseigenen Prochenberg-Hütte (1.123 m) begangen. Die stimmungsvolle Atmosphäre wurde durch festliche Ansprachen vom 1. Vorsitzenden der Sektion Martin Teufel, Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer sowie dem Ybbsitzer Vizebürgermeister Georg Stockner ergänzt. Alle drei hoben in ihren Reden besonders die Bedeutung der Gemeinschaft, das ehrenamtliche Engagement und die Verbundenheit zur alpinen Natur hervor. Wir gratulieren zum 150-jährigen Jubiläum!
aushang

Sammelpass für die Wand: Plakat Bergsteigerdörfer Immer im Blick, welches Bergsteigerdorf noch besucht werden soll: Besuchte Bergsteigerdörfer werden mit einem farbigen Sticker markiert. Ein Stickerbogen mit den Bergsteigerdörfern (Stand 2024) ist inkludiert. Erhältlich im alpenverein.shop um 14,90 €.
Die Österreichische Alpenvereinsjugend setzt ein deutliches Zeichen für mehr Inklusion: Seit kurzem ist ihre Website www.alpenvereinsjugend.at auch in leichter Sprache verfügbar. Damit macht es die Alpenvereinsjugend noch mehr Menschen möglich, sich über ihre Angebote, Werte und Aktivitäten zu informieren –ganz ohne sprachliche Hürden. Leichte Sprache ist ein wichtiger Beitrag zu Barrierefreiheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Die Alpenvereinsjugend zeigt damit einmal mehr, wie ernst sie es mit Vielfalt, Zugänglichkeit und gelebter Inklusion meint.
Im Zuge des autofreien Tages am 22. September und der Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September wollen wir wieder eure autofreien Touren in die Berge vor den Vorhang holen und aufzeigen, wie tolle Unternehmungen trotz oder gerade mit den Öffis möglich sind. Nutzt ihr für eure Anreise in die Berge vielleicht ohnehin ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel? Oder wollt ihr euch den autofreien Tag zum Anlass nehmen, um es mal auszuprobieren? Euer Engagement zum Klimaschutz ist uns was wert: Wir verlosen Öffi-Gutscheine im Gesamtwert von € 1.000.– für eure autofreien Touren mit dem Ziel, andere Bergsportbegeisterte zu motivieren, es euch gleich tun. Schickt uns bis 30. September 2025 Fotos und Berichte eurer Öffi-Touren und nehmt an der Verlosung teil! Alle Informationen zum Gewinnspiel inkl. der Teilnahmebedingungen findet ihr hier: t1p.de/autofrei25
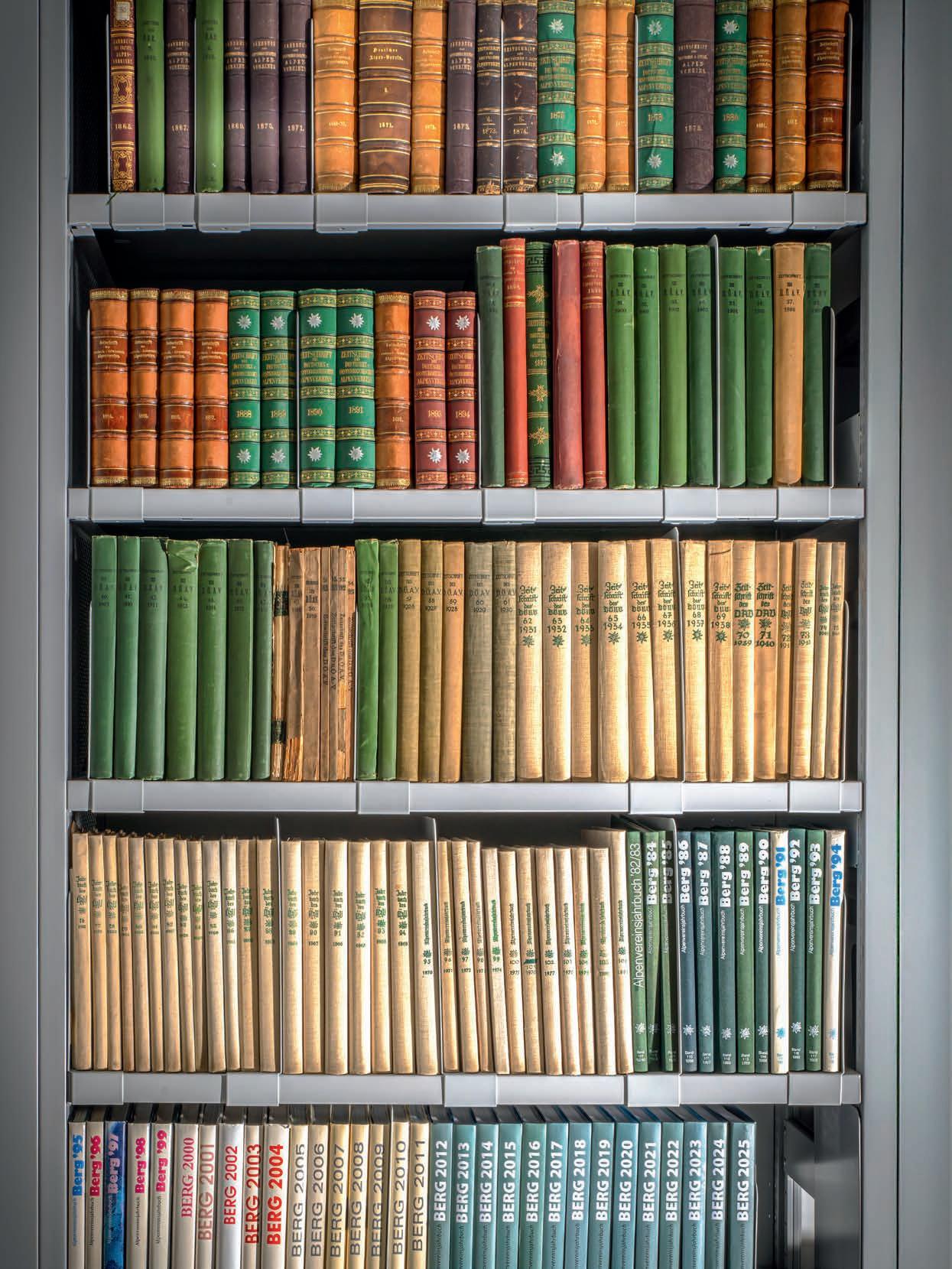
Diese 149 Bände des Alpenvereinsjahrbuches befinden sich im Archiv des Österreichischen Alpenvereins. Band Nummer 1 (nächste Seite) hatte so wie die neue, 150. Ausgabe (S. 91) den Großvenediger zum Thema.
Foto: ÖAV-Archiv/P. Neuner-Knabl
Einmal im Jahr, viel Text, viele Bilder, fester Einband:
Das Alpenvereinsjahrbuch BERG ist kein schnell konsumierbares Medium. Und das ist seine größte Qualität. Während soziale Medien, digitale Plattformen und Bewegtbildformate immer rasanter um Aufmerksamkeit konkurrieren, setzt
BERG bewusst auf Tiefgang, Sorgfalt und Kontinuität. Es ist das Langzeitgedächtnis der Alpenvereine – und erscheint 2025 mit seiner 150. Ausgabe.
g eorg hohenester, e velin s tark
Die Geschichte des Jahrbuchs reicht bis in die Gründungsjahre der Alpenvereine zurück (Oesterreichischer Alpenverein 1862, Deutscher Alpenverein 1869). Der OeAV (Oesterreichischer Alpenverein) brachte 1865 sein erstes „Jahrbuch“ heraus, der DAV (Deutscher Alpenverein) 1870 die erste „Zeitschrift“. Seit 1874, als die beiden Vereine zusammenschlossen, wurde es unter diesem Titel als „Zeitschrift des DuOeAV“ publiziert. In ihr fanden sich neben Tourenberichten auch naturwissenschaftliche und kulturhistorische Beiträge, kartografische Beilagen und Fotografien. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Erscheinung zeitweise, nachdem beide Vereine neu gegründet wurden. ÖAV und DAV produzierten das Jahrbuch zunächst getrennt, aber mit Ausnahme weniger Beiträge inhaltlich identisch, bis sie 1970 als gemein-
Die Inhalte reichen von alpinistischen Reportagen und Porträts bis zu Beiträgen zu Natur und Klimaschutz, Kultur und Wissenschaft. Immer wieder blicken die Artikel über den Tellerrand der Alpenvereine hinaus und beleuchten Entwicklungen in anderen Alpenregionen.
same Herausgeber auftraten. 1983 kam auch der AVS (Alpenverein Südtirol) dazu. Mit der Ausgabe „Berg ’84“ begann eine neue Phase: ein zeitgemäßer Titel, wechselnde Redaktionen, ein offeneres Konzept. Die Jahrbücher wurden zunehmend thematisch fokussierter, mit stärkerer Bildsprache und bewusstem Storytelling. Der Anspruch blieb hoch: fundierte Inhalte, anspruchsvolle Gestaltung, ein Spiegel der alpinen Entwicklung.
Ende der 1990er-Jahre stieß das Jahrbuch an seine Grenzen: hohe Kosten, stagnierende Auflagen, ein gewandeltes Medienverhalten. Zugleich wurde es von vielen als „Seele des Schrifttums im Alpenverein“ bezeichnet. Nach häufig wechselnden Redaktionen wird das Jahrbuch seit dem Band 2012 vom Tyrolia-Verlag in Innsbruck produziert. Redaktionell geprägt wurde es von Anette Köhler, auf die
Axel Klemmer folgte. Das Konzept: Evolution statt Revolution. BERG wurde auf 256 Seiten gestrafft, erhielt klare Rubriken (BergWelten, BergFokus, BergSteigen, BergMenschen, BergWissen, BergKultur) und ein modernes Layout. Der Anspruch: Orientierung bieten, Themenvielfalt mit Stringenz und Tiefgang verbinden. Die Inhalte reichen von alpinistischen Reportagen und Porträts bis zu Beiträgen zu Natur- und Klimaschutz, Kultur und Wissenschaft. Immer wieder blicken die Artikel über den Tellerrand der Alpenvereine hinaus und beleuchten Entwicklungen
in anderen Alpenregionen. Große Bildstrecken renommierter Fotograf*innen ergänzen die Texte. Besonders geschätzt werden auch Beiträge mit historischem Bezug sowie Gespräche mit Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen. Die Kombination aus fundierter Recherche, persönlicher Perspektive und visueller Qualität ist bis heute Markenzeichen des Jahrbuchs. Trotz aller Qualität steht BERG vor der Frage: Wie bleibt ein analoges Jahrbuch im digitalen Zeitalter relevant? Leserumfragen zeigen: Es gibt eine treue Stammleserschaft, die Tiefe und Gestal-
tung schätzt. Doch junge Leser*innen interessieren sich für BERG bisher (noch) nicht. Initiativen wie ein Fotowettbewerb auf Social Media, dessen Siegerbilder das Jubiläumscover zieren, zeigen aber neue Wege auf. Präsentationen aktueller Ausgaben in Alpenvereinssektionen und Veranstaltungen fördern zudem den direkten Austausch.
„Das Jahrbuch ist nicht mehr zeitgemäß, aber zeitlos“, bringt es der aktuelle Redakteur Axel Klemmer auf den Punkt. Es verzichtet auf PR-Sprech, ist informativ, freundlich und kritisch. Es dokumentiert Zeitgeschichte des Alpinismus und bleibt ein wertvolles Traditionswerk. Der dokumentarische Wert ist nicht zu unterschätzen: Wer in älteren Ausgaben blättert, kann Entwicklungen nachvollziehen – von Tourenstilen über Naturschutzdiskurse bis zu gesellschaftlichen Fragen. Damit das so bleibt, braucht es kluge Ideen, neue Impulse und vor allem: Leserinnen und Leser, die Lust auf mehr als einen schnellen Klick haben. Mit seiner 150. Ausgabe beweist BERG, dass gedruckte Alpinliteratur nach wie vor Bedeutung hat: als Sammlerstück, als Quelle der Inspiration, als Ort der Reflexion.
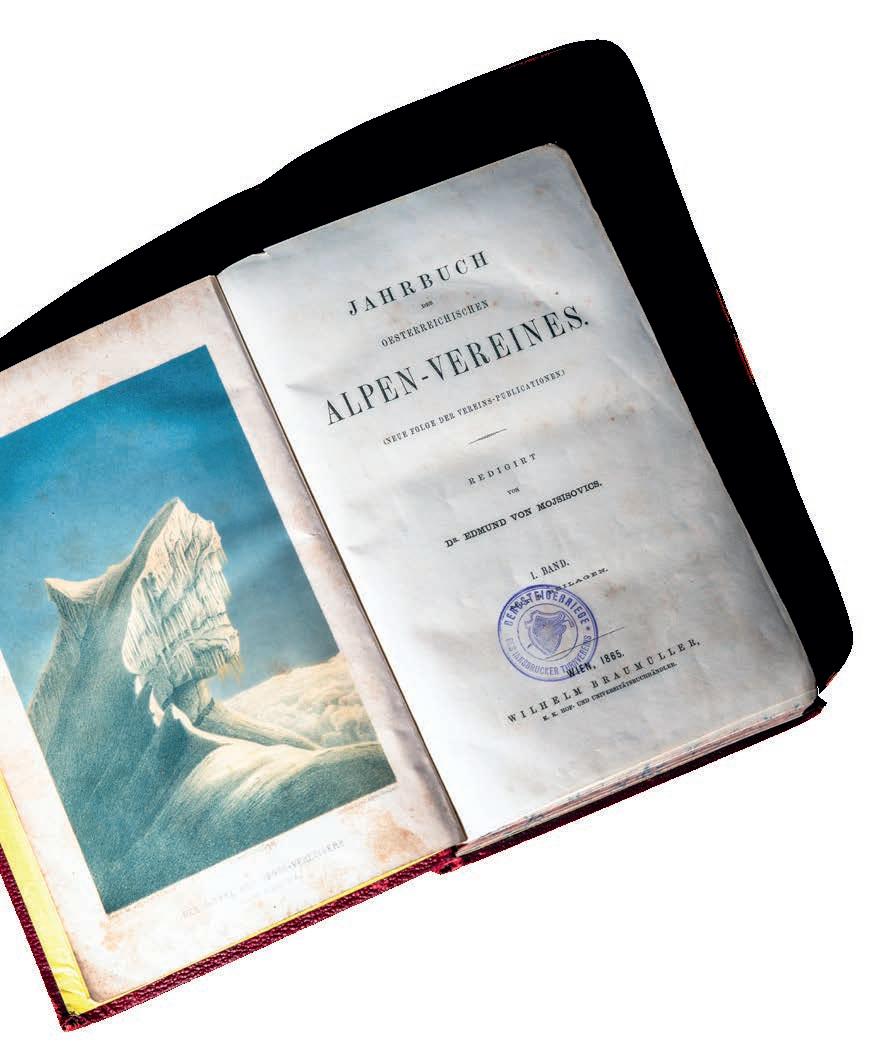
Georg Hohenester war bis Februar 2025 Chefredakteur des Panorama-Magazins im Deutschen Alpenverein und gemeinsam mit Bergauf-Chefredakteurin Evelin Stark Mitglied des Jahrbuchbeirates der Alpenvereine.
» Das Jahrbuch ist nicht mehr zeitgemäß, aber zeitlos. «
Axel Klemmer, Redakteur Alpenvereinsjahrbuch

Bald in Ihrer Alpenvereinssektion erhältlich!
Herausgeber: Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein und Alpenverein Südtirol
Alpenvereinsjahrbuch BERG 2026
Redaktion: Axel Klemmer
Die Jubiläumsausgabe des Alpenvereinsjahrbuchs ist da! Als 1865 der erste Band veröffentlicht wurde, endete gerade die Kleine Eiszeit. Heute, 150 Jahre später, stehen schmelzende Gletscher sinnbildlich für eine neue geologische Ära. Der aktuelle Band widmet sich ganz diesem Wandel – in der Natur, im Denken und im Handeln des Menschen. Im BergFokus stehen die Veränderungen der alpinen Landschaft im Mittelpunkt – und die Rolle des Menschen darin. Der Großvenediger, Protagonist des allerersten Jahrbuchs, kehrt in der Rubrik BergWelten zurück. Berg-
führerinnen und Bergführer diskutieren über den Zustand des Gletschers und die Zukunft des Hochtourengehens. Dazu kommen ein außergewöhnliches Forschungsprojekt im Nationalpark Hohe Tauern sowie ein eindrucksvolles Kapitel alpiner Tourismusgeschichte: das Wirken der Hüttenträger im Virgental.
Zwei einfühlsame Porträts zeigen im BergMenschen-Teil, wie spannend generationenübergreifende Lebensgeschichten sein können. In der Rubrik BergSteigen geht es um überfüllte Viertausender, um Strategien zur naturverträglichen Steu-
erung des Skitourenbooms und um den Siegeszug des E-Mountainbikes.
Das BergWissen fragt: Entwickelt sich die Gams im Klimawandel zur neuen Art? Und zum Abschluss bringt die BergKultur zwei literarische Kostbarkeiten: eine Erzählung von Büchner-Preisträger Clemens Setz – und ein überraschendes Stück Literatur aus der Feder einer Künstlichen Intelligenz.
Alpenvereinsmitglieder beziehen mit diesem Band kostenlos die Alpenvereinskarte Großvenediger, Maßstab 1:25.000. Das Jahrbuch BERG 2026 ist bald in Ihrer Alpenvereinssektion erhältlich.
s usanne g urschler
Kulturjournalistin und Sachbuchautorin
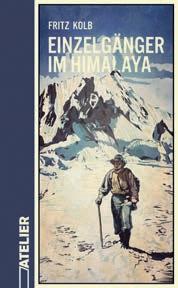
Fritz Kolb
Einzelgänger am Himalaya.
Mit einem Vorwort von Helga Kromp-Kolb, hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Ulrike Schmitzer
Weltbekannt ist die Geschichte des österreichischen Bergsteigers, SA- und NSDAP-Mitglieds Heinrich Harrer, der nach einer Expedition zum Nanga Parbat im Herbst 1939 in Indien interniert wurde, nach Tibet floh und sieben Jahre dort verbrachte. Spätestens die Verfilmung seines Buchs Sieben Jahre in Tibet mit Hollywoodstar Brad Pitt machte Harrer zur Legende. Weitaus weniger bekannt, ja fast vergessen dagegen, ist die Odyssee der Wiener Bergsteiger Fritz Kolb und Ludwig Krenek, die ein ähnliches Schicksal ereilte, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen.
Der Sozialist Fritz Kolb, Vater der Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, und sein Lehrerkollege Ludwig Krenek taten sich mit englischen Bergsteigern zusammen und finanzierten sich die Reise selbst. Da sie als Lehrer nur die Sommermonate frei hatten, fiel diese in die Monsunzeit. Allen Hindernissen zum Trotz wagten sie das Abenteuer und starteten im Sommer 1939 ihre Himalaya-Expedition. Doch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa holte die Bergsteiger ein: Als feindliche Ausländer verhaftet, blieben sie bis 1944 in einem Lager in Britisch-Indien interniert. Kolb begann, die Expeditionserlebnisse aufzuschreiben, und unternahm unter Aufsicht Ausflüge in die Umgebung. Nach der Freilassung – eine Rückkehr nach Österreich war zu dieser Zeit nicht möglich – erhielten beide eine Anstellung als Lehrer. Sie unternahmen Touren im Himalayagebiet, darunter eine zum Mondsichelberg. Dessen Besteigung gelang ihnen aber nicht. Die Abenteuer, Erfolge und Rückschläge, Begegnungen und Eindrücke hielt Fritz Kolb fest. Entstanden ist daraus ein überaus spannendes Buch, das nach seiner Rückkehr in die Heimat 1957 unter dem Titel Einzelgänger im Himalaya erschien und zwei Jahre später ins Englische übersetzt wurde.
In der Edition Atelier ist das längst vergriffene Dokument einer bergsteigerischen Leidenschaft nun neu aufgelegt und mit einem Vorwort von Helga KrompKolb und einem Nachwort der Autorin und Herausgeberin Ulrike Schmitzer in einen persönlichen und historischen Kontext gestellt worden. Gerade in einer Zeit, in der Himalaya-Expeditionen zu Massentouren verkommen und finanziell potente Gipfelstürmer die höchsten Berge der Welt in kürzester Zeit erklimmen, um ihre Vita aufzupeppen, eine wohltuende Lektüre. Sie führt uns eine Art Slow Travelling vor Augen mit Blick für das, was echte Leidenschaft prägt: Nicht allein der Rekord zählt, der Gipfelsieg, sondern das, was man mitnimmt: die Begegnungen, die Erfahrungen, das Sich-Einlassen auf sich selbst und andere – nicht zu kaufen, unbezahlbar. Ein tolles Abenteuerbuch, ein packend erzähltes Zeitdokument!
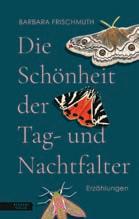
Barbara Frischmuth
Die Schönheit der Tagund Nachtfalter. Erzählungen
Sie war über Jahrzehnte eine der prägenden Stimmen der österreichischen Literatur, eine großartige Schriftstellerin und eine begeisterte Gärtnerin. In Altaussee hatte Barbara Frischmuth sich ein wucherndes Gartenparadies geschaffen, das sie hegte und pflegte und aus dem sie Inspiration und Kraft schöpfte. Neben Romanen, in denen die Natur, die Tiere und Pflanzen immer eine wichtige Rolle spielten, veröffentlichte Barbara Frischmuth auch Bücher zum Thema Natur und Garten. Lesenswert nicht nur für Hobbygärtner*innen! Kurz vor ihrem Tod im März 2025 erschien Frischmuths letztes Werk. Der Erzählband Die Schönheit der Tag- und Nachfalter versammelt vier Geschichten. Sie zeigen allesamt, wie eng verwoben das Schicksal des Menschen mit dem der Natur ist.
Jede der märchenhaften Erzählungen ist einer Insektenfamilie gewidmet – den Libellen, den Käfern, den Schrecken und den Schmetterlingen. Geht es in Die Techniken der Libellen zum Beispiel um Insektenforscher, handelt die längste Erzählung Käfer überall von einem Baby, das von einer Frau adoptiert wird. Es wächst zu einem ganz besonderen Wesen heran: Auserwählt, zwischen den Gattungen zu kommunizieren, gibt sich das Mädchen den Namen Lebia. Lebia chlorocephala aber ist die wissenschaftliche Bezeichnung für den Grünblauen Prunkkäfer.
Wie alle Märchen sind auch die in Die Schönheit der Tag- und Nachtfalter von einer Lehre, einer tieferen Moral getragen. Einmal mehr erweist sich Frischmuth dabei als eine genaue Beobachterin menschlicher Untiefen und natürlicher Prozesse und verwebt diese zu einnehmenden Er-
zählungen. Somit sei die Lektüre empfohlen am begrünten Balkon, im Garten, wo sich vor unser aller Augen die unglaublichsten Metamorphosen ereignen.
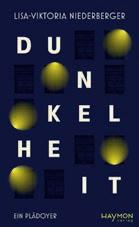
Lisa-Viktoria Niederberger Dunkelheit.
Ein Plädoyer
Die Nacht, die Dunkelheit, sie ist ein Mysterium – und am Verschwinden. Hat es sich der Mensch doch zum Ziel gesetzt, die Nacht zum Tag zu machen, Licht in die dunkelsten Teile der Erde zu bringen. Erst seit Kurzem gelangt das Thema Lichtverschmutzung in die öffentliche Wahrnehmung, stoßen wissenschaftliche Erkenntnisse über die Folgen der „Erhellung“ Debatten über den Schutz der Dunkelheit an. Denn unser Bedürfnis, buchstäblich alles ins Licht zu tauchen, hat schwerwiegende Folgen für uns und für andere Lebewesen auf dem Planeten. Nachtaktive Tiere etwa können sich nicht mehr im Schutz der Dunkelheit bewegen. Die Kulturwissenschaftlerin Lisa-Viktoria Niederberger hat ein Buch über die Dunkelheit geschrieben, das sich dem Thema von verschiedenen Seiten nähert. Ihr Plädoyer ist fundiert recherchiert und mit persönlichen Erfahrungen unterfüttert. So erzählt Niederberger von ihrer frühen Angst vor der Dunkelheit, ihren Schlafstörungen und ihrer Faszination für den Sternenhimmel. Sie beschreibt, wie Menschen immer schon gegen die Dunkelheit ankämpften, wie das künstliche Licht in die Welt kam und alles veränderte: die Arbeitsprozesse, die Tagesabläufe, unser Verhältnis zu Tag und Nacht.
So hell sind viele Orte heute, dass wir die Milchstraße nicht mehr erkennen können, Sterne im gleißenden Kunstlicht ver-
schwinden. Niederberger schreibt von unserer Sehnsucht nach dem Nachthimmel, dem Blick in die Unendlichkeit des Universums, und wie diese Sehnsucht uns – längst touristisch vermarktet – in die Nacht hinaustreibt. Sie führt uns an noch intakte dunkle Orte, wodurch Fauna und Flora gestört und diese immer rarer werdenden Orte in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Verlangen des Menschen nach unberührter Natur, nach dem verlorenen Zauber der Dunkelheit bringt sie in Gefahr, bedeutet vielfach gar ihr Ende.
So wird Dunkelheit zur erhellenden Lektüre für alle, die die Angst vor der Nacht ebenso kennen, wie sie die Faszination des Sternenhimmels vermissen. Ein kulturhistorisch in die Tiefe gehendes Plädoyer, das unser Verständnis für die Bedeutung der Nacht vertieft, sensibilisiert für ihre Bedeutung und die Verluste, die mit ihrer Zerstörung einhergehen.
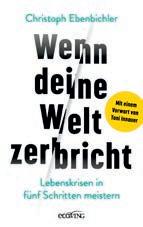
Christoph Ebenbichler Wenn deine Welt zerbricht. Lebenskrisen in fünf Schritten meistern Mit einem Vorwort von Toni Innauer
Was, wenn sportliche Träume zerplatzen und im Training nichts mehr so läuft, wie man es sich wünscht? Was, wenn man mitten in einer Krise steckt? Es frustriert, wenn man etwa nach einer Verletzungspause vergeblich auf Fortschritte wartet und die gewünschte Leistung ausbleibt. Und kämpft man sich endlich einen Schritt voran, lauern schon die nächsten Rückschläge, die einen wieder mental völlig aus der Bahn werfen. Man könnte Bäume ausreißen, doch der Körper sagt Nein. Was also tun, wenn deine Welt zerbricht? Wenn deine Welt zerbricht schenkt Mut zur Selbsthilfe. Sportwissenschaftler
Christoph Ebenbichler teilt darin praktische Tipps, die dabei helfen, wieder Pilot im eigenen Leben zu werden. Krisen als Chance sehen, persönliche Ressourcen kennenlernen, Strategien entwickeln und sich neu orientieren – darum geht es, wenn man sich aus der Negativspirale befreit. Das Selbsthilfe-Buch Ebenbichlers hat auch eine ganz persönliche Komponente: Bei einem Sturz auf einer Skitour verletzt er sich schwer am linken Bein. Vom Sportler zum Patienten geworden, beschäftigt er sich mit grundlegenden Fragen, mit Psyche und Geist, mit Theorie und Praxis. Und er verzeichnet in seinem Werk all die Dinge, die auch ihm den Weg aus der Dunkelheit gewiesen haben.
Ebenbichler hält fünf Schritte fest, die sich in seinem Kampf zurück aus der Negativspirale bewährt haben. Wenn deine Welt zerbricht ist ein Leitfaden aus Theorie und Erfahrung, ein Handbuch gefüllt mit Hilfestellungen bei individuellen Lebenskrisen. Die Lektüre verfolgt einen praktischen Ansatz und stellt Methoden vor, die in jeder noch so individuellen Krise greifen und wieder Zuversicht schenken.
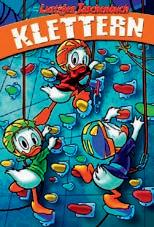
Walt Disney Lustiges Taschenbuch Klettern 01
Aus der Reihe Lustiges Taschenbuch Freizeit
In Entenhausen geht es hoch hinaus! In dieser Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs dreht sich alles ums Kraxeln. Es wird geklettert, was das Zeug hält! Egal ob beim Bouldern in Bodennähe oder schon hoch oben in schwindelerregender Höhe: Junge Kletterfexe finden im Lustigen Taschenbuch Klettern mit den Entenhausenern eine Menge heitere Anregungen für ihren Lieblingssport.
Die „Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins“ erscheinen seit 1875 als Hefte, die den Mitgliedern bis heute kostenlos zugestellt werden. Zwar heißt das Mitgliedermagazin mittlerweile Bergauf, doch es handelt sich nach wie vor um die „Mitteilungen“, die als Sprachrohr für 150 Jahre Vereinsgeschichte dienen. Deren erster Redakteur war der damalige Vereinspräsident Theodor Petersen. Die Zeitschrift erschien sechsmal im Jahr, heute vierteljährlich.
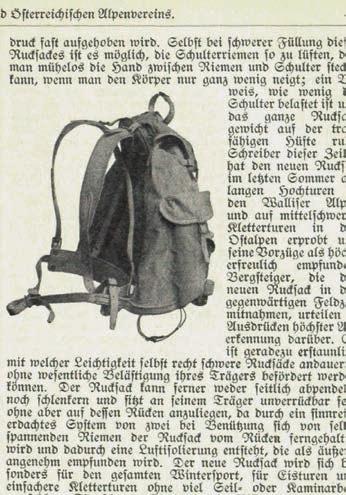
Die Einführung des Hüftgurtes vor über 100 Jahren war eine echte Innovation für bergbegeisterte Alpenvereinsmitglieder. Bis dahin litten viele unter schmerzenden Schultern und unangenehmer Schweißbildung. Abhilfe versprach ein neuartiges Tragesystem: „Durch ein mit dem Rucksack verbundenes Gestell aus hohlen, leichten Stahlröhren, einen Hüftbügel und einen Leibriemen wird das Rucksackgewicht – ähnlich wie bei modernen Militärtornistern – auf die Hüfte übertragen. Der sonst bei schwerer Belastung so lästige Schulterdruck wird dadurch fast aufgehoben. Selbst bei voller Beladung lässt sich der Schulterriemen so weit lüften, dass man mühelos eine Hand zwischen Riemen und Schulter schieben kann – ein Beweis, wie wenig die Schultern belastet und wie gut das Gewicht auf der tragfähigen Hüfte ruht.“ Dass die neue Erfindung zudem „durchaus gediegen und elegant“ war, dürfte dem Absatz des Herstellers in Christiania (heute Oslo) nicht geschadet haben.
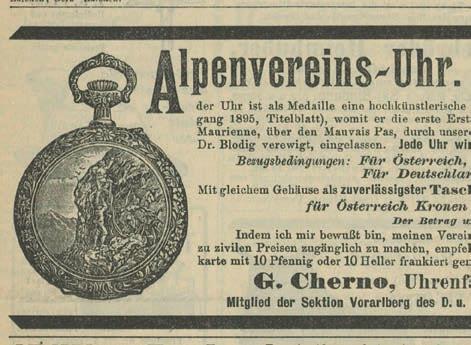
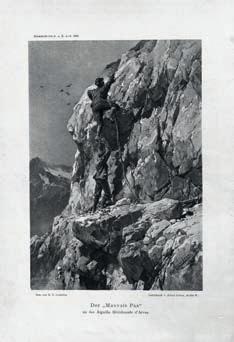
Auf den Anzeigenseiten der Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins war Anfang des 20. Jahrhunderts ein besonderes Angebot zu finden: die Alpenvereins-Uhr. „Die Schale der Uhr ist von ersten Künstlern entworfen und ausgeführt worden. In renommiertem Atelier in Genf ist die Schale in sogenanntem Métal artistique geprägt, in den Deckel der Uhr ist als Medaille eine hochkünstlerische Reproduktion des Bildes von E. T. Compton („Zeitschrift“, Jahrgang
1895, Titelblatt) … eingelassen.“ Mit der besagten „Zeitschrift“ ist die heute als „Jahrbuch“ bekannte jährlich erscheinende Publikation gemeint, deren 150. Band ebenso in diesem Jahr erscheint (s. Seite 88). Das erwähnte Titelbild zeigt „die erste Ersteigung durch Deutsche der Aiguille meridionale d’Arves, in der Maurienne, über den Mauvais Pas“. Dass der Uhrenfabrikant Mitglied der Sektion Vorarlberg des DuOeAV war, durfte in der Anzeige natürlich nicht unbemerkt bleiben.
OeAV goes
Internet, 2000
Ein moderner Verein geht mit der Zeit und wagt sogar die „Erstbesteigung“ des Internets: Im Jahr 1998 war es so weit, dass www.alpenverein.at mit Informationen über Wetter, Hütten, Naturschutz und Jugendthemen online ging und für Mitglieder, die bereits einen Computer zu Hause hatten oder den Weg ins Internetcafé fanden, digitale Inhalte verfügbar machte. Ein Angebot für ein MitgliederInternetpaket (25 Stunden Onlinezeit pro Monat!) gab es 2000 obendrauf.
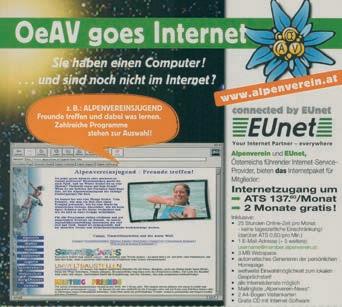
Wer erinnert sich noch an die Zeit, als man den ersten Computer zu Hause hatte und jede Minute im Internet ein halbes Vermögen wert war?
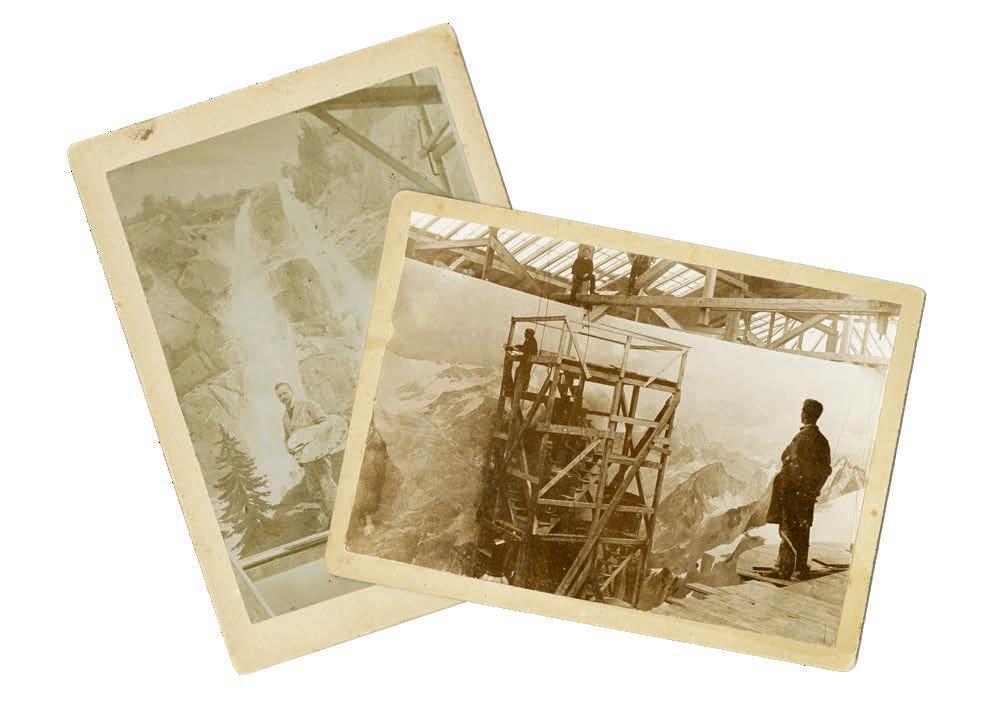
Im
m ichael g uggenberger Historisches Archiv des Alpenvereins
Die Hauptattraktion der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 1897 in Leipzig war eine temporäre Nachbildung der Burgruine Taufers. Wer sie betrat, wähnte sich unmittelbar in den fernen Alpen: „Vorüber an dem verfallenen Thurm der Burg Taufers führt die starke Pforte in den Schloßhof […] dort geleiten echte Alpensöhne den Besucher zur Drahtseilbahn für die Tiroler Bergfahrt“, berichtet das „Blatt der Hausfrau“. Nach dem Blick auf den Latemar konnte man vom Schlern-Wirtshaus aus die Rosengartengruppe bewundern. Von dort führte ein Weg hinab zur Grasleiten-Hütte der Alpenvereinssektion Leipzig und weiter, an der uralten Kirche Santo Stefano in Carisolo vorbei, in die Gletscherwelt der Adamello-Presanella-Alpen.
Dieses Alpen-Diorama (Panorama), das zugleich Fernweh stillte und weckte, umfasste acht monumentale Gemälde mit vorgelagerten dreidimensionalen Objekten und war „von so wunderbarer
Wirkung“, dass Wirklichkeit und Malerei verschwammen. Den Großauftrag dafür hatte Edward Theodore Compton an Land gezogen und mit einem Team an Malern, Bildhauern und Architekten umgesetzt. Mehrere Abzüge eines unbekannten Fotografen dokumentieren im Alpenverein-Archiv die Entstehung des Werkes in intimer Weise. Einer der beiden hier abgebildeten Abzüge zeigt Meister Compton auf einem Gerüst bei der Arbeit an einem der Bergpanoramen, es ist die Vedretta della Lobbia zu erkennen. Sein erst 16-jähriger Sohn Edward Harrison Compton, der ihn hier nur beobachtet, wirkte bereits als Landschaftsmaler mit. Auf dem linken Abzug ist einer der anderen Künstler, wohl Hans Busse (oder Josef Klemm), mit Palette vor dem fotorealistisch dargestellten Nardis-Wasserfall zu sehen.
Ein ähnlich opulentes Großdiorama, „Bergfahrt im Zillerthal“ von Joseph Rummelspacher, wurde übrigens bereits ein Jahr zuvor in Berlin geschaffen.
Atelier Fridolin Arnold, Innsbruck: Porträt von Hans Robert Schmitt, vermutlich späte 1890er Jahre. Foto: OeAV PERS 119.1
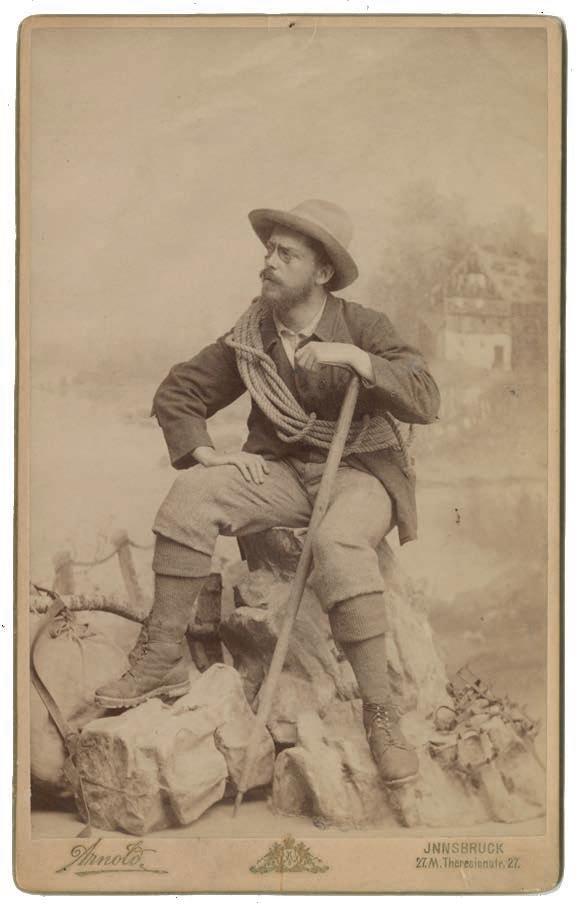
Über ein Bergsteigerporträt aus dem späten 19. Jahrhundert Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 61
a nton holzer
Konzentriert schaut der Alpinist in die Ferne. Was er dort wohl fixiert? Der Herr im Bild gibt sich als gut ausgerüsteter Berggeher zu erkennen: genagelte Bergschuhe, wollene Stutzen, Kniebundhose, helles Hemd, darüber ein Jackett und den Hut auf dem Kopf – Bergbekleidung ganz im Stil seiner Zeit. Um die Schultern hat der Herr gut sichtbar ein Kletterseil geschlungen, mit der linken Hand stützt er sich auf einen Bergpickel. Am Boden, am Fuß des kleinen Felsens, auf dem er sitzt, sind etliche Steigeisen zu sehen, neben seinem rechten Fuß ist ein Lederriemen zu erkennen. Gehört dieser womöglich zum Rucksack? Gleich könnte der Alpinist losgehen, um die nächste Wand zu besteigen. Doch halt, irgendetwas stimmt hier nicht.
Wohin blickt der Alpinist?
Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass unser Protagonist nicht auf einem kleinen Felsvorsprung im Freien sitzt, sondern im fotografischen Atelier. Woran wir das erkennen? An Details: Da ist etwa die leicht sichtbare Retusche, mit der am unteren Bildrand die Übergänge zwischen dem glatten Atelierboden und dem darauf postierten künstlichen Felsblock kaschiert werden. Derartige „Felsbrocken“ fürs Atelier wurden häufig aus imprägniertem Pappmaché gegossen bzw. gebaut. Darauf weist auch die horizontale Gussnaht hin, die in der Mitte des liegenden Felsens unter dem rechten Fuß des Alpinisten sichtbar ist. Und dann ist da noch der Hintergrund. Zu sehen ist eine angedeutete Landschaft, in der ein Bauernhaus steht und ein Zaun, der den Vordergrund vom Hintergrund trennt. Es handelt sich hier um einen auf Tuch gemalten, variablen Hintergrund, der je nach Klientel und gewünschtem Thema für die Porträtsitzung im Atelierraum aufgespannt wurde. Unser Berggeher befindet sich also in einem geschlossenen Atelierraum. Wenn er demonstrativ in die Ferne blickt, ahmt er den Blick des hochalpinen Wanderers nach. In Wirklichkeit aber blickt er auf die Seitenwand des Ateliers, die fast in Greifweite vor ihm liegt.
Gut 125 Jahre nach der Aufnahme findet dieses sorgsam arrangierte Porträt seinen Weg in die Öffentlichkeit.
Kulissen im Atelier
Gestellte Porträts wie dieses, die im Atelier entstanden, aber bildlich eine Szene im Freien suggerieren, waren im späten 19. Jahrhundert, als die private Fotografie noch aufwändig und relativ teuer war, weit verbreitet. Erst in den Jahren nach 1900 kam diese inszenierte „Outdoor-Fotografie“ nach und nach aus der Mode. Denn es wurde nun immer einfacher, Bilder im Freien selbst herzustellen. Wenn wir das Spektrum der im Atelier aufgenommenen Bergszenen überblicken, wird deutlich, dass dieses Genre vor und um 1900 durch und durch männlich geprägt war. Sowohl hinter als auch vor dem Apparat standen in der Regel Männer. Frauen traten damals höchst selten in der Rolle der Alpinistin vor die Atelierkamera. Erst als das Fotografieren im 20. Jahrhundert mobiler wurde, tauchten vermehrt auch Frauen in der Bergfotografie auf.
Gute Ateliers legten Wert auf ein breites Angebot an gemalten Hintergründen. Denn die Wünsche und Vorstellungen der Klienten wollten aufmerksam bedient werden. Hergestellt wurden diese Hintergründe zunächst oft von Theater- und Dekorationsmalern, später wurden diese meist von Händlern für fotografisches Zubehör vertrieben. Dazu gehörten auch zahlreiche Versatzstücke, um den Atelierraum baukastenartig in immer neue Szenerien umbauen zu können: Bänke und Tischchen, Vasen, Vorhänge und Gardinen, Teppiche und Podeste, Säulen und Balustraden – und eben auch zahlreiche bemalte Tuch-Hintergründe mit unter-
schiedlichsten Motiven, in verschiedenen Farben und Rahmungen. Diese wurden, soweit es die Größe des Atelierraums zuließ, auf schwenkbaren Armen befestigt, um dann, je nach Kundenwunsch, wie Türen ausgeklappt zu werden.
Aufgenommen wurde dieses Porträt im Innsbrucker Atelier des Fotografen Fridolin Arnold. Der 1867 geborene, ursprünglich aus Deutschland stammende Lichtbildner hatte in den 1890er Jahren in der MariaTheresien-Straße ein Fotostudio eröffnet. Stolz präsentierte er Namen, Signet und Adresse in vergoldeten Buchstaben auf dem Untersatzkarton. Und wer ist der Porträtierte? Es handelt sich um den aus Wien stammenden Landschaftsmaler, Alpinisten und Forschungsreisenden Hans Robert Schmitt (1870–1899), der zwar nur knapp 30 Jahre alt wurde, der aber dennoch bis heute zahlreiche nach ihm benannte Routen (die sogenannten „Schmittwege“) im alpinen Gelände des Ostalpenraums hinterlassen hat. Er war ein ausgezeichneter Kletterer, dem viele Erstbesteigungen gelangen, und zudem ein begeisterter Publizist, der viel über die Berge und das Klettern schrieb. 1899 verstarb er an einer tropischen Fiebererkrankung während einer Afrikaexpedition.
Die Innsbrucker Porträtaufnahme entstand vermutlich in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre. Gefunden wurden das Porträt und andere Hinterlassenschaften Schmitts Mitte der 1970er Jahre in einer Nische eines ausgeräumten Dachbodens in Graz. Der Finder, Dr. Christoph Neugebauer, damals ein junger Student der Medizin in Graz, erkannte den Wert der kleinen Sammlung und bewahrte sie auf. 2023 schenkte er den Bestand dem Archiv des Alpenvereins. Gut 125 Jahre nach der Aufnahme findet dieses sorgsam arrangierte Porträt seinen Weg in die Öffentlichkeit.
Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker, Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift „Fotogeschichte“, er lebt in Wien. www.anton-holzer.at
Dezember/Jä NN er/ f ebrUar
Wenn der erste Schnee fällt, rückt die Wintervorbereitung in den Fokus: thomas Wanner beleuchtet im kommenden Bergauf das Wärmemanagement im Biwak und analysiert das Thema Absturz. andreas lercher testet aktuelle
Skimodelle, gerhard mössmer gibt Tipps für klassische Frühwintertouren. Ergänzend berichtet dani tollinger über das risk’n’fun-Programm der Alpenvereinsjugend und dessen Bedeutung für junge Menschen in den Bergen. Weitere Themen: Geschichte der Kartographie von philipp ferrara, Besucherlenkung im Winter von georg rothWangl und ein Rückblick auf die Klimastrategie-Aktivitäten des Alpenvereins von BergaufRedakteurin anna praXmarer. Dazu wie immer: ÖffiKolumne, Wegetation und eine Portion Hüttenwissen.
Bergauf #4.2025 erscheint Ende November.
Umgezogen? Bergauf digital lesen oder Beitragsvorschreibung per E-Mail?
Halte deine Daten auf mein.alpenverein.at ganz einfach aktuell!
r ätselhaft Wo sind wir hier? Welche Gebirgsgruppe suchen wir hier? Bergauf verlost fünf Karten unter den richtigen Antworten: Einfach bis 30.09.2025 E-Mail an gewinnspiel@alpenverein.at schicken! Alle Infos zum Gewinnspiel unter t1p.de/bergauf-raetsel


Bergauf. Mitgliedermagazin des Österreichischen Alpenvereins #3.2025, Jg. 80 (150)
Herausgeber und Medieninhaber: Österreichischer Alpenverein, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck Tel. +43/512/59547 www.alpenverein.at ZVR-Zahl: 989190235
Redaktion: Anna Praxmarer, Evelin Stark, redaktion@alpenverein.at
Redaktionsbeirat:
Präsident Dr. Wolfgang Schnabl, Generalsekretär Clemens Matt
Design und Gestaltung: himmel. Studio für Design und Kommunikation, www.himmel.co.at
Korrektorat: Mag. Christoph Slezak
Druck: Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG
Anzeigenannahme:
Werbeagentur David Schäffler, office@agentur-ds.at Tarife: www.bergauf.biz
Die grundlegende Richtung des ÖAV-Mitgliedermagazins wird durch die Satzung des Österreichischen Alpenvereins bestimmt. Abgedruckte Beiträge geben die Meinung der Verfasser*innen wieder. Für unverlangte Sendungen wird keine Haftung übernommen. Retournierung nur gegen beiliegendes Rückporto. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Adressänderungen bitte bei Ihrer Sektion bekanntgeben bzw. direkt unter mein.alpenverein.at ändern. Beiträge in Bergauf sollen nach Möglichkeit geschlechterneutral formuliert oder die Schreibweise mit dem „Gender Star“ (Autor*in) verwendet werden. Bei Texten, deren Urheberschaft klar gekennzeichnet ist, liegt es in der Freiheit der Autor*innen, zu gendern oder nicht.
Gefördert durch die
Online-Ticketrabatt für ÖAV-Mitglieder Code: EOFT25XOEAV Nur ONLINE einlösbar!























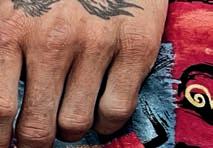







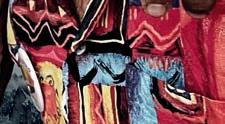














Jetzt auf digitale
Beitragsvorschreibung umstellen!
Schont die Ressourcen mit einem Klick!

Mitgliedermagazin
Bergauf digital lesen oder per Post erhalten?
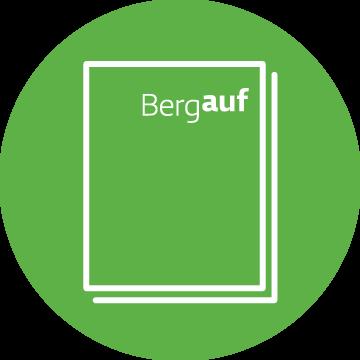
Deine AlpenvereinsMitgliedskarte gibt es auch digital.

Alpenvereinskalender erhalten oder abbestellen?