
7 minute read
Reaktion auf Begegnungen mit Menschen
Wer kennt nicht die Gämsen, die uns im Aufstieg aus Distanz beinahe gleichgültig beobachten, oder die Dohlen, die einem auf dem Gipfel aus der Hand fressen? Gewöhnung ist vor allem dort möglich, wo die Präsenz des Menschen gleichartig, konstant und häufig ist – und damit für die Tiere kalkulierbar.
Reaktion auf Störungen
Unerwartete Störungen hingegen lösen Stress aus: Der Puls erhöht sich (bei Fluchttieren) oder erniedrigt sich (bei Tieren, die sich auf ihre Tarnung verlassen), und Stresshormone werden ausgeschüttet.
• Ein Birkhuhn zum Beispiel verharrt bei der Annäherung eines (potenziellen) Feindes so lange wie möglich regungslos in der schützenden Schneehöhle. Dabei fällt der Puls abrupt von 150 – 200 auf 75 – ihm bleibt vor Angst also förmlich das Herz stehen! Dadurch werden körpereigene Geräusche herabgesetzt und die Umweltwahrnehmung gesteigert. Erst bei sehr geringer Distanz der Gefahrenquelle reagiert es mit einer enormen Zunahme von Herz- und Atemfrequenz als Vorbereitung für einen «Blitzstart».
Weil viele Tiere im Winter ihren Stoffwechsel stark drosseln (um Energie zu sparen), wirken sich häufige Fluchten besonders negativ auf die Energiebilanz der Tiere aus. Mögliche Folgen sind ein geringerer Fortpflanzungserfolg, Krankheit oder der Erschöpfungstod.
• Wenn z. B. ein Birkhuhn die isolierende Schneehöhle blitzartig verlassen muss, verliert es durch Anstrengung und Wärmeverlust überlebenswichtige Energie.
• Auch Fluchten von Hirsch, Gämse oder Steinbock brauchen viel Energie –insbesondere im Hochwinter bei tiefem Schnee.
Bei wiederholter Störung verlassen Wildtiere ihre Einstands-, Futter-, Balz- oder Nistplätze. Dies kann zu Schäden in ihren Zufluchtsorten und zu Konkurrenz mit anderen Tieren führen.
• In vielen Gebieten leben derzeit deutlich mehr Hirsche und Rehe, als der Wald verträgt, sodass es zu Verbissschäden kommt. Dies hat negative Auswirkungen auf die Verjüngung und die Biodiversität des Waldes.
• Das Auerhuhn lebt in lichten, strukturreichen Wäldern, deren Fläche in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen hat (und nun wieder gefördert wird). Regelmässige Störung in diesen selten gewordenen Lebensräumen kann zur Aufgabe von Balzplätzen führen und damit die Fortpflanzung gefährden.
Ausbildung
A. Rosenkranz / J. Meyer / M. Lüthi / F. Zoller
Lebenswelt Alpen
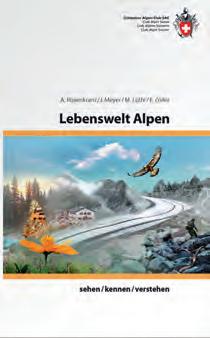
sehen – kennen – verstehen
Das Handbuch liefert umfassende Informationen zur alpinen
Tier- und Pflanzenwelt, zur Geologie und zum Leben der Menschen in den Alpen.
Die Kapitel zu Klimawandel und Bergsport mit Rücksicht auf die Natur regen zum genauen Beobachten und Nachdenken an.
Allgemein verständlich, reich bebildert, illustriert und rucksacktauglich – Lebenswelt Alpen ist dein Begleiter für die (Neu)entdeckung der Alpenwelt.
310 Seiten, 330 Illustrationen
3. Auflage
ISBN: 978-3-85902-425-0
Wie verhalten wir uns rücksichtsvoll?
Beim Wintersport sollten wir eine Schwächung der Wildtiere durch Flucht und Stress möglichst vermeiden und ihre Lebensräume respektieren. Neben der Berücksichtigung von Wildruhezonen und Wildtierschutzgebieten ist hier auch freiwillige Rücksicht wichtig – damit eben auch weniger zusätzliche Verbote notwendig sind.
Trichterprinzip & Co.
Das Trichterprinzip veranschaulicht die Anpassung unseres Bewegungsspielraumes im Gelände, mit welcher wir auf unseren Touren Rücksicht auf Wildtiere nehmen können.
Wildtiere halten sich im Winter dort auf, wo sie Nahrung finden und geschützt sind. Oberhalb der Baumgrenze sind dies nur selten die schneereichen Hänge, sondern felsige und schneefreie Flächen (Schneehuhn, Steinbock, Gämse). In dieser Höhenlage können wir uns weitgehend frei bewegen. Leider wurde das bei der Festlegung gewisser Schutzgebiete zu wenig berücksichtigt.

An der oberen Waldgrenze (Birkhuhn) und im Wald (Auerhuhn, Rothirsch, Gämse) sind dagegen für viele Wildtiere die Lebensbedingungen im Winter vorteilhaft. Je mehr wir uns dem Wald von oben nähern, desto kleiner sollte darum – wie bei einem Trichter – unser Raumanspruch werden.
Im Wald halten wir uns an Wege, Forststrassen und bezeichnete Routen. Bitte nicht entlang der Waldränder laufen sowie Gebüsche und Baumgruppen umgehen.
Weitere Tipps:
• Sich möglichst ruhig verhalten.
• Beim Betreten einer neuen Geländekammer Ausschau halten und allfällige W ildtiere aus der Distanz beobachten. Den Tieren ausweichen und ihnen genügend Zeit lassen, sich in Ruhe zu entfernen.
• Erhöhte Rücksicht in der Dämmerung. Viele T iere sind im Schutz des schwachen Lichtes am Fressen.
• Im Frühjahr während der Balzzeit (Raufusshühner) und Setzzeit (Schalenwild) besondere Rücksicht nehmen.
Wildruhezonen und Wildschutzgebiete
Zum Schutz der Wildtiere haben die Behörden Schutzgebiete ausgeschieden. Diese umfassen heute 12 % des Schweizer Alpenraumes (10 % rechtsverbindlich, 2 % empfohlen) und dürfen im Winter nur auf den 2200 km erlaubten Skirouten und Wegen betreten werden. Es werden zwei Arten von Schutzgebieten unterschieden:
• «Wildruhezonen» werden von den Kantonen (z. B. NW, OW) oder Gemeinden (z. B. in GR, LU) festgelegt. In rechtsverbindlichen Wildruhezonen gilt im Winter ein Betretungsverbot oder eine Einschränkung auf erlaubte Wege und Routen. Daneben gibt es empfohlene Wildruhezonen.
• Eidgenössische Jagdbanngebiete (auch Wildtierschutzgebiete genannt) verbieten neben der Jagd seit 1991 auch Wintersport «ausserhalb von markierten Pisten, Routen und Loipen...». Zudem ist Zelten und Campieren untersagt, und Hunde sind im Wald an der Leine zu führen. In gewissen Wildtierschutzgebieten werden gezielte Abschüsse vorgenommen, um die Bestände zu regulieren.
Naturerlebnisse stärken die Bereitschaft, Natur und Umwelt zu schützen. Als Schützer und Nutzer der Bergwelt unterstützt der SAC das Instrument der Schutzgebiete, diese sollen jedoch verhältnismässig und breit abgestützt sein. Der SAC setzt sich für rücksichtsvollen Bergsport und den freien Zugang zu den Bergen ein. Um bei geplanten Einschränkungen frühzeitig mitwirken zu können, ist es wichtig, dass Bergsporttreibende die Entwicklung in ihrer Region genau verfolgen. Die SAC-Geschäftsstelle ist auf Hinweise angewiesen, leistet gerne fachliche Unterstützung und vermittelt Kontakt zu Behörden.
Schutzgebiete bei Tourenplanung berücksichtigen
Zur Tourenplanung gehört auch, dass wir uns über Schutzgebiete informieren und die Regeln einhalten.
• Im SAC-Tourenportal (www.tourenportal.ch) entsprechen alle Schneeschuhund Skitourenrouten den aktuellen Schutzbestimmungen.
• Die gedruckten Skitourenkarten von Swisstopo zeigen die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung geltenden Wildruhezonen und Wildschutzgebiete inklusive damals erlaubter Routen, und auch die in den Tourenführern des SAC publizierten Routen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erlaubt. Weil sich die Bestimmungen in den letzten Jahren stark geändert haben, müssen wir einen Check mit den neusten Daten machen. Diese finden wir auf: http://map.schneesport.admin.ch.
Die Kampagne «Schneesport mit Rücksicht» steht für ein friedliches Nebeneinander von Mensch und Wildtier. Im Zentrum stehen freiwillige Massnahmen und Eigenverantwortung. Die vier Regeln der Kampagne sind: i Weitere Infos: https://natur-freizeit.ch/schneesport-mit-ruecksicht i Lernunterlagen für unterwegs zu Natur- und Umweltthemen: www.sac-cas.ch/de/envirotools
1. Beachte Wildruhezonen und W ildtierschutzgebiete: Sie bieten Wildtieren Rückzugsräume.
2. Bleibe im Wald auf den bezeichneten Routen und Wegen: So können sich Wildtiere an den Menschen gewöhnen.
3. Meide Waldränder und schneefreie Flächen: Sie sind die Lieblingsplätze der Wildtiere.
4. Führe Hunde an der Leine, insbesondere im Wald: Wildtiere flüchten vor freilaufenden Hunden.
Ausbil dung
E. Landolt / D. Aeschimann / B. Bäumler / N. Rasolofo
Unsere Alpenflora
Ein Pflanzenführer für Wanderer und Bergsteiger Wer hat nicht schon gestaunt, wie vielfältig die Pflanzenwelt in den Alpen ist. Wie heisst diese Blume mit den gelben Blättern? Wer weiss, welche Gräser im rauen Klima über 3000 m überleben können? Welches sind die giftigen Pflanzen? Dieses Werk lässt uns die Vielfalt der Pflanzenwelt in den Bergen entdecken. Es erklärt, wie sich die verschiedenen Arten an die Bedingungen angepasst haben und auf welch vielfältige Art die Fortpflanzung gesichert ist.
488 Seiten, 9. Auflage
ISBN 978-3-85902-406-9
Wetter
Woher kommt das Wetter?
Die Alpen im Westwindgürtel
Das Temperatur- und Druckgefälle zwischen Tropen und Pol treibt den Westwind an. Quer zum Wind liegende Gebirge (Rocky Mountains, Grönland) zwingen den Westwind auf eine Slalomspur. Diese erhält zusätzlichen Schwung durch die thermischen Gegensätze zwischen kanadischer Arktis und Nordatlantik sowie zwischen Sibirien und dem Nordpazifik. Bedingt durch den Slalom der Westwindzone, trifft die Luft bevorzugt aus Südwest bis Nordwest auf die Alpen. Reine Nord- und Südlagen sind seltener.
Hoch- und Tiefdruckgebiete
Der Luftdruck ist ein Mass dafür, wie viel Luft sich über uns befindet. Änderungen des Luftdrucks bedeuten, dass Luft in unser Gebiet zufliesst oder dieses verlässt.
Im Hochdruckgebiet sinkt die Luft ab. Sie erwärmt sich dabei, kann mehr Wasserdampf aufnehmen und die Wolken lösen sich auf. Im Tiefdruckgebiet steigt die Luft auf, kühlt ab und es bilden sich Wolken.
Die Luft fliesst vom Hoch- ins Tiefdruckgebiet. Auf ihrem Weg wird sie durch die Erdrotation abgelenkt, so dass sie eine gekrümmte Bahn beschreibt. Auf der nördlichen Hemisphäre gilt:
• Die Luft verlässt das Hoch im Uhrzeigersinn.
• Die Luft erreicht das Tief im Gegenuhrzeigersinn.
• In Tälern folgt die Luft der Talachse. Die Windrichtung kann dabei bis zu 180 Grad von jener im Gipfelniveau abweichen.
Steigt die Luft auf (z. B. in Fronten, Quellwolken, Tiefdruckgebieten oder wegen der Topografie), kühlt sie sich ab und kann nicht mehr so viel Wasserdampf aufnehmen. Das überschüssige Wasser kondensiert zu Wassertropfen oder gefriert zu Eiskristallen, es entstehen Wolken. Werden die Wassertropfen oder die Eiskristalle so gross, dass sie von den Turbulenzen nicht mehr in der Schwebe gehalten werden, setzt Niederschlag ein.
Fronten
«Fronten» sind Übergänge von Luftmassen unterschiedlicher Temperatur. Sie bringen Wolken und Niederschlag.
Kaltfronten bringen häufig einen Warmfronten kündigen sich mit schnellen Wetterwechsel. An ihrer Zirren, dann immer dichterer und Vorderseite sind selbst im Winter tieferer Schichtbewölkung an. Der Gewitter möglich. Sie werden vom Wetterwechsel erfolgt langsamer.
Wetterelemente
Temperatur
Die Temperatur im Gipfelbereich wird vom Wetterbericht sehr genau vorhergesagt.
• Die Schneefallgrenze liegt 200 bis 500 m unter der Nullgradgrenze, je intensiver der Niederschlag, desto weiter darunter.
• Bei klarem Himmel kühlt die nächtliche Abstrahlung die Schneeoberfläche aus. Nasser Schnee gefriert dabei bis ca. 1300 m unter die Nullgradgrenze tragfähig.
Wind Wind führt nicht nur zu Schneeverfrachtungen, sondern zusammen mit tiefen Temperaturen auch leicht zu Erfrierungen. Der Windchill gibt an, wie kalt sich eine Kombination aus Wind und Temperatur auf trockener, ungeschützter Haut anfühlt.
Nasse Haut kühlt schneller aus, von winddichten Kleidern geschützte langsamer.
Bei schönem Wetter verursachen die Sonneneinstrahlung und die nächtliche Abstrahlung folgende Winde:
Talwind Tagsüber erwärmt die Sonne die Luft über dunklen Südhängen besonders stark, so dass sie dort aufsteigt. Aus dem Tal fliesst Luft nach.
Bergwind In der Nacht kühlt die Luft in Bodennähe stärker ab als in der freien Atmosphäre, einige Meter über dem Gelände. Die an den Berghängen abgekühlte Luft sinkt ihrer höheren Dichte wegen dem Gelände nach ins Tal ab. Sie verdrängt dort die wärmere Luft, die sich einige Meter über dem Talboden weniger abgekühlt hat.
Luftdruck
Wichtiger als der absolute Luftdruck ist seine Veränderung. Am Höhenmesser abgelesene Änderungen von mindestens 20 m zeigen eine Tendenz, ab ca. 50 m weisen sie eindeutig auf einen Wetterwechsel hin (siehe S. 31).
Bewölkung
Nebst der Angabe, welcher Anteil des Himmels von Wolken bedeckt ist, interessiert uns Bergsteiger auch die Höhe der Wolkenbasis. Sie wird manchmal im Wetterbericht angegeben.
Für (praktisch) vollständig wolkenverhangenen Himmel verwenden die Meteorologen zwei Wörter: «stark bewölkt», wenn Niederschläge fallen; «bedeckt», wenn es trocken bleibt.
Niederschlag
Die Niederschlagsmenge wird heute deutlich genauer vorhergesagt als noch vor wenigen Jahren, variiert aber oftmals stark von einem Ort zum anderen. 1 mm Regen entspricht etwa 1 cm trockenem Schnee.


