
3 minute read
Album
Knochen, Samen, Sedimente.
Texte: Angelika Jacobs Fotos: Christian Flierl


Es ist eine Rettungsaktion auf Knien, mit Schaufel, Sieb und blossen Händen. Wo bald an der Zürcherstrasse in Windisch eine neue Grossüberbauung mit Tiefgarage stehen soll, versucht die Kantonsarchäologie Aargau, Überreste des Römerlagers Vindonissa zu bewahren. Dabei kamen ein Gräberfeld aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, eine Strasse, Gebäudereste, Abfallgruben und Latrinen zum Vorschein. Mit dabei waren Forschende und Studierende der Universität Basel im Rahmen eines Feldkurses. Sie suchten auf dem Grabungsgelände nach Knochen und Pfl anzenresten, die auf Tiere und Nutzpfl anzen der Vindonissa-Bewohner schliessen lassen. Parallel dazu entnahmen sie Proben der Sedimente, in denen sich diese Überreste befanden. Das Material gelangt – wie Fundstücke anderer Grabungen auch – an den Fachbereich Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) zur weiteren Analyse. Die Erkenntnisse daraus können das Bild des Alltags in Vindonissa ergänzen.






In etwa 1,3 Metern Tiefe entnehmen die Studierenden Sedimentproben in weissen Plastikboxen. Gut beschriftet und sorgfältig verpackt gelangen diese sogenannten orientierten Blockproben ins Labor, wo die Forschenden sie später mit Kunstharz fi xieren, um das Sediment in seiner originalen Struktur zu erhalten. In einem späteren Schritt werden Anschliffe sowie Dünnschliffe für die mikroskopische Analyse angefertigt. Weitere Bodenproben werden noch am Ort der Grabung mit der «Goldwaschtechnik» über eine Reihe immer engmaschigerer Siebe aufbereitet. Pfl anzen oder Knochenstücke lösen sich so vom Sediment und die leichten, schwimmenden Pfl anzenreste lassen sich vom schweren Material wie Knochen, Keramikscherben oder Kies separieren. Ein Teigschaber hilft, die Probe vorsichtig von den Sieben einzusammeln. (rechts)






Die Forschenden sortieren alle Fundstücke tierischer und pfl anzlicher Herkunft, vom grossen Tierknochen bis zum kleinsten Samenkorn, und bereiten den Transport an die IPNA in Basel vor, wo das Material genauer untersucht wird. Alle Funde bleiben aber im Besitz des Kantons Aargau und gehen schliesslich wieder dorthin zurück.
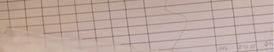


Am Institut studieren die Forschenden Dünnschliffe der gehärteten Blockproben unter dem Mikroskop. Struktur und Zusammensetzung der Ablagerungen geben beispielsweise Einblick in Er eignisse wie Brände, die Vindonissa heim gesucht haben, aber auch weniger Drama tisches wie beispiels weise die Verfüllungen von Gruben oder Latrinen oder die Benutzung von Lehmböden in einem Haus. (links)
Unter einem Binokular analysieren die Archäobotaniker des Teams Samenmaterial verschiedener Ausgrabungen und vergleichen es mit einer Referenzsammlung, um die Pfl anzenarten zu bestimmen. Daraus ergeben sich bei spielsweise Rückschlüsse auf landwirtschaftliche Praktiken.


Ebenso verfügen die Forschenden der IPNA über eine umfangreiche Sammlung von Knochen grösserer und kleinerer Tierarten, die sie als Referenz nutzen. So reichen oft Bruch stücke, um die bei Ausgrabungen freigelegten Knochen einer Tierart zuzuordnen und herauszufi nden, welche Haus- und Wildtiere die Menschen in vergangenen Jahrhunderten nutzten.
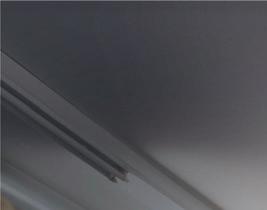
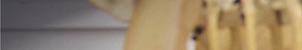



Der Archäobiologisch-geologische Feldkurs fand unter der Leitung von Sabine Deschler-Erb (im Bild), Örni Akeret, Simone Häberle und Christine Pümpin von der Universität Basel statt. Im Rahmen des alljährlichen Kurses lernen Studierende die Techniken und Arbeitsprozesse während und nach einer Ausgrabung kennen. Am Fachbereich IPNA werten die Forschenden Fundmaterial von verschiedensten archäologischen Stätten in der Schweiz und dem Ausland aus.









