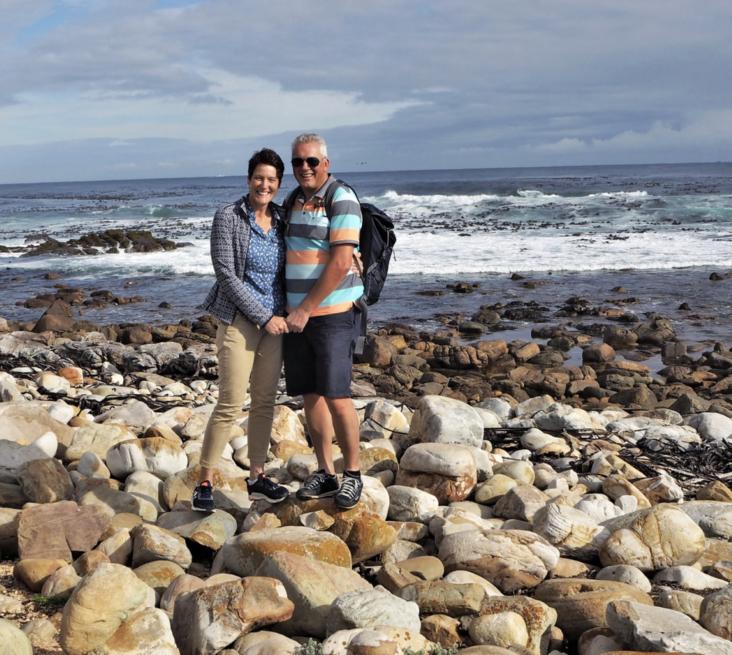8 minute read
Ungetrübter Pistenplausch
Sicher im Schnee
Auf Ski, Snowboard, Schlitten oder zu Fuss: Darauf sollten Wintersportlerinnen und -sportler besonders achten.
Text: Susanne Schmid Lopardo
Skistöcke
Die Stöcke richtig halten
Lassen Sie Ihre Skibindung vor dem Beginn in die Skisaison in einem Fachgeschäft kontrollieren und abgestimmt auf das zent der Verunfallten auf der Piste verletzen sich am Knie. Hauptgrund für die vielen Knieverletzungen ist gemäss einer Studie der Universität Innsbruck (A) die Skibindung, die sich beim Sturz nicht öffnet. Bei Frauen ist das Risiko zwei- bis dreimal so hoch wie bei Männern, weil sie über weniger kräftige Beinmuskeln verfügen. «Beinmuskeln sind wichtig für das Drehmoment und damit das Auslösen der Bindung», erklärt Nathalie Sausgruber, die Leiterin Sportmedizin bei Medbase Luzern. Eine klassische Wintersportverletzung ist der Ski-Daumen. Die
Ursache: Der Daumen wird bei einem Sturz durch den Skistock zurückgerissen und geknickt – oder er landet am Ende unter dem
Stock. Lassen Sie die Schlaufe an konventionellen Stöcken einfach frei hängen und schlüpfen Sie nicht hinein. Oder verwenden Sie Modelle, bei denen die Schlaufe nur eingeklickt
Skibindung Die Bindung richtig einstellen
Gewicht, den Fahrstil und das Alter einstellen. Denn: 41 Prowird, sodass sie sich beim Sturz löst.
Die BFU-Skivignette garantiert korrekte Einstellung und Kontrolle. Handschuhe Das Handgelenk schützen
Tragen Sie beim Snowboarden immer HandgelenkProtektoren. Sie helfen, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Es gibt spezielle Snowboard-Handschuhe, die im Bereich des Handgelenks verstärkt sind. Denn vor allem bei Anfängern ist das Risiko, sich am Handgelenk zu verletzen, relativ gross. Weil Sie sich oft abstützen müssen, kann es zum Bruch am Ende der Speiche kommen. «Es handelt sich um einen typischen Reflex», so Sausgruber. Auch Stauchungen und Prellungen sind typische Snowboardverletzungen, bei 39 Prozent der Fälle treten sie vorab an den oberen Extremitäten auf, bei 30 Prozent bei den unteren Extremitäten.
iMpuls ist die Gesundheitsinitiative der Migros. Erste Hilfe auf der Piste Welche Sofortmassnahmen sind bei einem Ski- oder Schlittelunfall angesagt? Infos dazu auf migros-impuls.ch/unfall
Fahrstil Kontrolliert landen Eine typische SnowboardVerletzung ist der «Snowboarder’s Ankle». Es handelt sich um eine Stauchung des Fuss beziehungsweise Sprunggelenks. Für Expertin Nathalie Sausgruber sind Freestyler in Softboots besonders gefährdet, wenn sie über ein Hindernis oder eine Welle fahren und es zur unerwarteten Landung kommt. Passen Sie deshalb Ihren Fahrstil dem Können an und vermeiden Sie riskante Landungen auf der Piste. Fahren Sie vorausschauend, damit Sie nicht von Bodenwellen überrascht werden.

Langlauftechnik Den Anfängerkurs besuchen
Wenn Sie sich zum ersten Mal auf die schmalen Latten wagen: Buchen Sie gleich einen LanglaufEinsteigerkurs und lernen Sie die korrekte Technik. Zwar sind Verletzungen beim Langlaufen eher selten. Trotzdem kann es durch einen Sturz zu Prellungen, schlimmernfalls auch zu Verletzungen des Sprunggelenks oder des Knies kommen. Vor allem die Anfängerinnen und Anfänger sollten sich zuerst schrittweise mit den eher instabilen Brettern anfreunden.
Helm Den Kopf schützen beim Schlitteln In der Schweiz kommt es gemäss Suva pro Jahr zu rund 7000 Schlittelunfällen. Meistens wird die Geschwindigkeit auf zwei Kufen oder dem Bob unterschätzt, am häufigsten sind Beinverletzungen die Folge, davon betrifft ein Viertel das Knie. Jeder Sechste verletzt sich am Kopf. Mit einem Helm wäre dieser geschützt. Laut einer neuen Erhebung des BFU trägt jedoch nur die Hälfte auf dem Schlitten einen Kopfschutz. Auch wichtig: Wählen Sie für harte Schlittelbahnen einen flexiblen Schlitten, einen sogenannten Rodel. Er lässt sich besser steuern als grosse Holzschlitten. Auch Bobs eignen sich nicht gut für harte Böden, denn sie reagieren zu langsam.

Wandern im Schnee Das passende Schuhwerk wählen
Winterwandern liegt im Trend. Die Risiken einer Verletzung sind grösstenteils dieselben wie bei Wanderungen in schneefreier Landschaft. Unverzichtbar sind deshalb stabile, wasserund kälteresistente Schuhe. Sie müssen so fest sein, dass mit ihnen auch vereiste Hangpassagen zu bewältigen sind. Empfehlenswert sind mittelfeste, schnee und wasserdichte hohe Berg oder Winterbergstiefel mit einer griffigen und vor allem steifen Sohle, die in Eis und Schnee sicheren Halt bieten. Tragen Sie zudem stets Mütze und Handschuhe und beachten Sie Markierungen und Signalisationen. Insbesondere bei Neuschnee oder schlechter Witterung gilt: Informieren Sie sich über Lawinengefahr und den Zeitpunkt der letzten Talfahrt mit der (Seil)Bahn. MM Verletzt? Das können Sie tun
• Das verletzte Bein oder die verletzte Hand erst mal kühlen und hochlagern, um die Schmerzen zu lindern • Wallwurzsalbe oder ein
ArnikaGel einreiben (beides entzündungshemmende Präparate auf pflanzlicher Basis) • Das Gelenk mit einem
Verband stabilisieren
Wann soll ich zum Arzt? Weil Laien das Ausmass einer Verletzung schwer abschätzen können, sollten Sie dringend einen Arzt aufsuchen, wenn: • das Knie oder das Handgelenk deutlich anschwillt • das verletzte Gelenk blockiert ist • spätestens am nächsten
Tag, wenn die Schmerzen bis dann nicht spürbar zurückgegangen sind
Die sieben Schlittelregeln
• Nehmen Sie stets auf andere Rücksicht. • passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise dem
Können an. • Respektieren Sie die
Fahrspur des Vorderen. • Überholen Sie mit genügend Abstand • Halten Sie am Rand an oder steigen Sie dort auf oder ab. • Beachten Sie die Zeichen und Markierungen
Mehr Infos: www.migmag.ch/schlitteln
Nathalie Sausgruber Leiterin Sportmedizin, Fachärztin Allgemeine Innere Medizin FMH, Sportmedizin SGSM von Medbase Luzern Allmend
«Ob der Stock gesund ist, erkenne ich am Geruch»
Christophe Bachmann stellt Bioblüten- und -Waldhonig für das Migros-Label «Aus der Region» her. Wie den meisten Imkern bereitet die Varroamilbe auch ihm die grössten Sorgen. Text: Maude Righi Bilder: Pierre-William Henry
Mit 17 Jahren hatte er bereits den ersten Bienenstock. Der gelernte Landschaftsarchitekt und Naturliebhaber Christophe Bachmann ist heute Imker in Dombresson NE und kümmert sich um Millionen Bienen, die insgesamt 250 Bienenstöcke bevölkern. «Damit alles gut funktioniert, braucht es die Synergie zwischen Biene und Imker», verrät er. Jedes Jahr liefert er ca. 12000 Gläser Bioblüten- und -Waldhonig für das Label «Aus der Region. Für die Region.» an die Genossenschaft Migros.
Christophe Bachmann, welche Eigenschaften muss ein guter Imker haben? Man muss sich für die Umwelt interessieren, die Natur lieben, sich mit Pflanzen auskennen und natürlich die Bienen verstehen. Im Laufe der Zeit habe ich eine wunderbare Beziehung zu ihnen aufgebaut: Am Geruch eines Bienenstocks kann ich erkennen, ob er gesund oder krank ist. Durch Beobachtungen sehe ich, ob alles gut läuft, und der Summton verrät mir, wie es der Bienenkönigin geht. Ich bin mit Leidenschaft Imker, es ist ein erfüllender Beruf.
Wie sieht Ihre Tätigkeit im Alltag aus? Von Januar bis März gibt es viel zu tun: die alten Holzrahmen reinigen, Wachsplatten für die Rahmen anfertigen, die Bienenstöcke reinigen, einzelne Kästen neu streichen, den Honig aufbereiten und den Verkauf abwickeln. Im Frühling bereitet man die Bienenvölker vor, damit sie mit Nektarsammeln beginnen können. Die Honigernte dauert von Mai bis Juli. Im Sommer beginnt die Aufzucht der Königinnen und die Vermehrung der Jungvölker, die im Herbst mit Sirup gefüttert werden, damit sie den Winter gut überstehen. Worin unterscheidet sich eigentlich der Blüten vom Waldhonig? Blütenhonig entsteht im Frühling, wenn der Raps, die Obstbäume und der Löwenzahn blühen. Es ist ein goldgelber, milder und cremiger Nektarhonig. Der Waldhonig stammt aus dem Honigtau. Insekten, etwa die Blattlaus, ernähren sich vom Saft dieser Bäume. Der von ihnen ausgeschiedene Honigtau wird von den Bienen zu ihren Stämmen gebracht, wo ein flüssiger, dunkler und vollmundiger Honig entsteht.
Wie viel Honig erzeugen Sie pro Jahr? Das hängt immer vom Wetter ab, aber im Durchschnitt sind es sieben Tonnen. Die Migros beliefern wir jedes Jahr mit rund 12000 Gläsern zu je 250 Gramm. Sie tragen das Label «Aus der Region. Für die Region.» und sind bio-zertifiziert. Honig besitzt unglaubliche Eigenschaften. Man sagt ihm eine antibakterielle, entzündungshemmende und antioxidative Wirkung nach. Im Winter esse ich jeden Tag Honig. Im Sommer reicht mir sein Duft.
Wie geht es den Bienen aktuell? Am Ende des vergangenen Winters ist die Sterblichkeit von 10 auf 20 Prozent gestiegen, das ist sehr beunruhigend. Die Stämme sind anfälliger als früher. Die Varroamilbe, die in den 80er-Jahren aus Asien kam, und gewisse in der Landwirtschaft eingesetzte Pflanzenschutzmittel dezimieren die Völker. Die Rede ist auch von Wellen, die bei Bienen zu einer gewissen Desorientierung führen, sodass sie ihre Bienenstöcke nicht mehr finden. Wahrscheinlich sind alle diese Faktoren zusammen für die Übersterblichkeit verantwortlich. MM
«Imker ist ein erfüllender Beruf.»
Christophe Bachmann Imker und «Aus der Region»-Produzent

25.1.2021 | 43 Migros Neuenburg Freiburg

Er ist mit Leidenschaft Imker: Christophe Bachmann Was bedeutet Biohonig? Für die Bio-Zertifizierung von Honig gilt ein striktes Anforderungsprofil, vor allem bei der Bekämpfung der aus Asien stammenden Varroamilbe. Die Herstellung von Wachs und Sirup für junge Bienenvölker muss biologisch sein. Die Bienenstöcke müssen sich in natürlicher Umgebung befinden, beispielsweise in der Nähe von Weihern oder Wäldern.

Trotzdem ist es schwierig, einen komplett biologischen Honig herzustellen, da Bienen ja ganz nach Lust und Laune Blütenstaub sammeln. «Im Frühling sind behandelte Rapsfelder das Hauptproblem», weiss Christophe Bachmann. Glücklicherweise sind die anderen Blüten frei von Chemikalien. Der übrige Blütenstaub stammt von Linden- und Ahornbäumen oder auch von Eschen. Sie werden alle nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. LAUFSPORT
Kerzerslauf neu erst im August Nach eingehenden Überlegungen hat das Organisationskomitee beschlossen, den Kerzerslauf dieses Jahres zu verschieben. Anstelle des gewohnten Termins im März soll der Anlass neu am 20., 21. und 22.August stattfinden.
Notwendig macht die Neuansetzung die gesundheitliche Lage aufgrund der Covid19-Pandemie: Die im Bundesratsbeschluss vom 13.Januar verschärften Massnahmen hätten an den ursprünglich geplanten Daten für weitere Einschränkungen und grössere Planungsunsicherheit gesorgt.
Speziell die Verteilung auf drei Tage ermöglicht es im Spätsommer auch, grössere Menschenansammlungen zu vermeiden. Anmeldung und Infos: kerzerslauf.ch
Die Veranstalter hoffen, den Kerzerslauf im August bei idealen Bedingungen durchführen zu können.