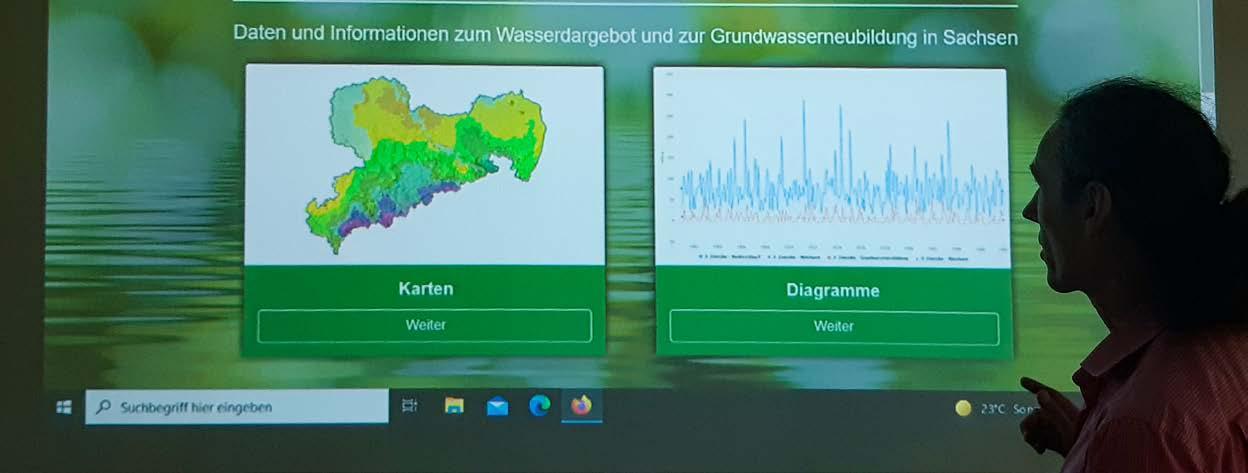4 minute read
4.4.4 Wasserversorgung in dezentralen Gebieten
1) Verwendung als Notwasserfassung oder Reservefassung –
Fassung erhalten inkl. Wartung, sodass versorgungswirksame
Einbindung jederzeit möglich ist; Ausweisung des Verwendungszwecks (Reservefassung, Notwasserfassung) im WVK; ggf. Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnis; WEA-Satz 0,015 EUR/m³ 2) Verwendung als Notwasserfassung oder Reservefassung –
Fassung erhalten, Ventil einbauen für die bedarfsweise Wasserentnahme; wasserrechtliche Erlaubnis anpassen; WEA wird nicht erhoben, wenn die entnommene Wassermenge weniger als 2.000 m³ im Kalenderjahr beträgt (§ 91 Abs. 4 Nr. 7 SächsWG) 3) Verwendung durch anderen Nutzer (Fischzucht, …) – Übergabe der Fassung und Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnis;
WEA-Pflichtiger ist der neue Inhaber 4) Gebietstrockenlegung, z. B. für neue landwirtschaftliche Nutzung – Übergabe der Fassung an den Bevorteilten (z. B. als landwirtschaftliche Drainage) 5) Keine Nachnutzung – Verzicht auf wasserrechtliche Erlaubnis gegenüber zuständiger Wasserbehörde erklären; Alternativen zum Umgang mit der Anlage: Bestehenlassen der Anlage aber Verschluss, (teilweiser) Rückbau der Fassung oder andere Vorkehrungen, die nachteiligen Folgen des Erlöschens der Erlaubnis vorbeugen (s. § 12 Abs. 1 SächsWG – Wasserbehörde kann zum Wohle der Allgemeinheit hierzu Entscheidung treffen).
Die Prüfung der Rohwasserquellen und der Umgang mit nicht mehr benötigten Fassungen sind Teil der eigenständigen Planung und der WVK der Aufgabenträger. Die zur Verwendung als Not- oder Reservefassung begründet vorgesehenen Fassungen sind im Wasserversorgungskonzept aufzuführen.
Der konkrete Umgang mit aufgegebenen Trinkwasserfassungen und der dazugehörigen wasserrechtlichen Erlaubnis ist im Einzelfall mit den zuständigen Wasserbehörden festzulegen. Wasserrechtlich ist ein Teilrückbau soweit geboten, dass der natürliche Abfluss wieder eintritt.
Grundsätze – Leitbild
Zur Erhaltung lebenswerter ländlicher Räume ist eine gesicherte Trinkwasserversorgung als unverzichtbare Grundlage der Daseinsvorsorge unabdingbar. Dazu gehört die Bereitstellung einer angemessenen Wasserversorgungsinfrastruktur im Rahmen der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.
Ziele – Umsetzungsstrategie
Die Wasserversorgung im ländlichen Raum ist auf der Ebene der Wasserversorgungskonzepte umfassend, d. h. unter Berücksichtigung aller Akteure, zu betrachten. Dazu gehört insbesondere die Betrachtung der Sicherstellung der Wasserversorgung in Not- und Krisenzeiten. Die Bereiche mit privater Wasserversorgung sind hier nicht auszusparen. Die private Wasserversorgung ist eine Ausnahmelösung für die Fälle, in denen eine öffentliche Wasserversorgung nach sorgfältiger Prüfung rechtlich zulässig ausscheidet. Zugehörige Anlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu überwachen.
Die Betreiber privater Wasserversorgungsanlagen sollen durch das Gesundheitsamt und die untere Wasserbehörde verstärkt unterstützt und beraten werden.
IST-Zustand – Status quo
Das StaLa verzeichnete im Erhebungsjahr 2019 einen Anschlussgrad von 99,4 % an die öffentliche Trinkwasserversorgung187 . Lediglich 0,6 % bzw. 25.163 Einwohner Sachsens waren 2019 auf eine private Wasserversorgung angewiesen188 (s. auch Kapitel 2.1). Unter privater Wasserversorgung wird nachfolgend die Wasserversorgung verstanden, die nicht durch den öffentlichen Aufgabenträger Wasserversorgung oder einen durch diesen zur Aufgabenerfüllung gebundenen Dritten (§ 43 Abs. 3 SächsWG) erfolgt. Hauptsächlich im ländlichen Raum werden dazu dezentrale kleine Wasserwerke gemäß § 3 Nr. 2 Buchstabe b TrinkwV in der Hand von privaten Wasserversorgungsgemeinschaften und Kleinanlagen zur Eigenversorgung gemäß § 3 Nr. 2 Buchstabe c TrinkwV betrieben.
Die überjährige Trockenperiode seit 2018 hat die besondere Verwundbarkeit der privaten Wasserversorgung aufgezeigt. Während die öffentliche Wasserversorgung durchgängig in der geforderten Qualität und Menge sichergestellt war, ergaben sich regionale Ergiebigkeits- und Qualitätsdefizite insbesondere bei der privaten Eigenwasserversorgung (Hausbrunnen, Quellfassungen). Teilweise bedurfte es einer zeitweisen Notversorgung durch die öffentlichen Aufgabenträger.
Für die Zukunft zeigen Klimaprojektionen angespannte klimatische Wasserbilanzen durch steigende Jahresmitteltemperaturen, häufigere Wetterextreme wie Starkregen und ausgeprägte Trockenperioden auf189. Von einer zunehmenden Betroffenheit insbesondere der privaten Eigenwasserversorgung hinsichtlich Menge und Güte muss ausgegangen werden.
Die Nutzungsansprüche der Verbraucher sowie die fachlichen und rechtlichen Anforderungen an die Betreiber von WVA sind zudem komplexer geworden und können oft durch eine unmittelbare Verwendung des über private Kleinanlagen zur Eigenversorgung gewonnenen Rohwassers nicht mehr befriedigt werden. Viele der Anlagen zur Eigenwasserversorgung entsprechen nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. In Verbindung mit der oft eingeschränkten Schützbarkeit der örtlichen Grundwasservorkommen kann dies zu qualitativen Einschränkungen führen.
Nach einer Erfassung des SMUL unter Einbeziehung der unteren Wasserbehörden und der öffentlichen Aufgabenträger sind zunächst signifikante Kenntnisdefizite den Bestand an Kleinanlagen und deren Status betreffend festzuhalten190. Darüber hinaus wurde deutlich, dass bei der Aufgabenerfüllung durch Dritte, insbesondere bezüglich der Aufgabenwahrnehmung durch private Wasserversorgungsgemeinschaften rechtliche Unsicherheiten bestehen.
Die Erhebungen zeigten zudem, dass in vielen Fällen privater Wasserversorgung Beeinträchtigungen nach Menge und Güte bestehen.
Rechtsgrundlage – Handlungsrahmen
Ausführungen zur Rechtsgrundlage und Ausgestaltung der Wasserversorgung in dezentralen Gebieten sind der Handlungsanleitung „Gemeinsame Handlungsempfehlung des SMEKUL, des SMS und des SMI zur Wasserversorgung im ländlichen Raum“ (digitale Anlage) zu entnehmen.
Handlungsbedarf – Ausführungshinweise
Der Handlungsbedarf ist ausführlich in der Handlungsanleitung „Gemeinsame Handlungsempfehlung des SMEKUL, des SMS und des SMI zur Wasserversorgung im ländlichen Raum“ dargestellt. Die Wasserversorgung in dezentral versorgten Ortslagen ist orientierend an Kapitel III Umsetzungshinweise der Handlungsanleitung durch die Gemeinde/den zuständigen Versorger/die Wasser- und Gesundheitsbehörde zu überprüfen. Bei begründeten Rechts- und/ oder Versorgungslücken sind konsequent entsprechende Anpassungsmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen. Die zuständige
187 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. (2021) 188 Ebd. 189 Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. (2020). Klimawandel 190 Erfassung des Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft mit Abfrage vom 10. September 2018 zu Brunnendörfern und Auswirkungen der Trockenperiode
Behörde hat den Anpassungsprozess unterstützend zu begleiten. Die erforderlichen Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung mit Trinkwasser sowohl im Normalbetrieb als auch in Not- und Krisensituationen sind je nach Versorgungspflicht durch den verpflichteten Wasserversorger oder die Gemeinde zu planen, konzeptionell zu untersetzen und umzusetzen
Der Anlagenbestand an WVA in privater Hand ist zu erfassen und fortschreibend so zu verwalten, dass die vorschriftsmäßige Überwachung sichergestellt werden kann.
Die bestehenden WVK der öffentlichen Aufgabenträger der Wasserversorgung sind insbesondere für die Ortslagen mit überwiegend privater Wasserversorgung zu überprüfen, fehlende Angaben zu Anlagenbestand, dezentral versorgte Einwohnerzahl sind bei der Gemeinde zu erheben.
Insbesondere in Gebieten, in denen die gesetzliche Versorgungspflicht besteht, aber eine Wassergemeinschaft im beiderseitigen Einvernehmen weiterhin als Erfüllungsgehilfe für die Aufgaben der öffentlichen Wasserversorgung agieren möchte, ist die Schaffung von vertraglichen Vereinbarungen und Kooperationen notwendig und im Versorgungskonzept darzustellen.
5 Umsetzung