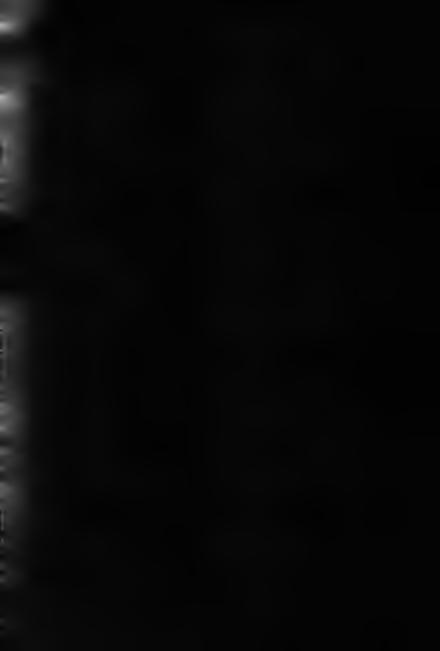97 minute read
Berichte, Fundstücke
M o o r d o r f
Ausschußerbmasse und züchterische Auslese
Der Reichsnährstand sah eine wesentliche Aufgabe in der »Stärkung des Bauernstandes« als »Blutsquell des deutschen Volkes«. Die »große züchterische Aufgabe«, die die »Neubildung deutschen Bauerntums« darstellte, wurde von den Blut- und Boden-Ideologen um den Reichsbauem- führer Darre in dessen Stabsamt im Reichsnährstand (RNS) betrieben. Horst Rechenbach, der Leiter der Hauptabteilung G »Blutsfragen des deutschen Bauerntums« definierte die Aufgabe wie folgt: »Da die natürliche lebensgesetzliche Auslese bei dem heutigen Stand der Zivilisation völlig ausgeschaltet bleibt, muß an ihre Stelle unsere züchterische Arbeit gesetzt werden.«'. Diese »züchterische Arbeit«, der sich Rechenbach »schon früh verpflichtet«2 fühlte, sollte die »Ausschußerbmasse« zurückdrängen und die »rassisch wertvollen Familien« fördern. Das kleine Dorf Moordorf diente Rechenbach als Negativbeispiel für das, was passiert, wenn diese »Ausschußerbmassen« überhandnehmen. Moordorf, das in der Nähe von Aurich in Ostfriesland gelegen ist, bot sich aus mehreren Gründen dafür an. Es wurde erst 1767 gegründet, die Bewerber um eine Siedlerstelle wurden auf viel zu kleinen Parzellen mit schlechten Böden ohne jede Infrastruktur (Kanäle, Schleusen etc.) angesiedelt. Die Folge davon war ständige extreme Armut, hohe Arbeitslosigkeit und Kriminalität.3 Lohnarbeit war bis ins 19. Jahrhundert hinein kaum möglich. Vereinzeltes Tagelöhnen bei reichen M arschbauem und beim Deichbau bildeten oftmals die einzige Erwerbsmöglichkeit. M it Beginn der Industrialisierung in Ostfriesland arbeiteten viele Moordorfer im Emdener Hafen oder auf den Werften. Ein Sozialrebellentum hat sich in den Moordorfer Unterklassen bis in das 20. Jahrhundert hinein erhalten. Moordorfer Arbeiter spielten bei den Arbeitskämpfen in Ostfriesland oft eine entscheidende Rolle. Sie »zeichneten sich durch eine besondere Härte im Arbeitskampf aus«.4 Die SPD-Ortsgruppe war schon vor dem 1. Weltkrieg in Moordorf stark. 1919 schloß sich ein großer Teil der Ortsgruppe dem Spartakus-Bund und später der KPD an. Bei den achtReichstagswahlen ging die KPD sechsmal als stärkste Partei hervor.5 Die KPD-Ortsgruppe in Moordorf (zu der auch Teile der umliegenden Dörfer gehörten) hatte ca. 500 Mitglieder und war damit die stärkste KPD-Landgruppe im Reich. DerRotfront-Kämpfer-Bund hatte mehr als 100 Mitglieder6. Der Widerstand der Moordorfer Bevölkerung vor und nach der »Machtergreifung« der Nazis war breit und konnte erst durch Massen verhaftungen und Einlieferungen in Gefängnisse und Konzentrationslager gebrochen werden. Nach 1933 kam es zu mehreren Verhaftungswellen in Moordorf. Am 6. März 1933 z.B. wurden soviele Menschen verhaftet, daß das Auricher Gefängnis nicht mehr ausreichte. In einem einzigen Prozeß wurden 120 Moordorfer angeklagt, auch danach fanden mehrere Massenprozesse statt. Durch die Einzigartigkeit der sozialen und politischen Verhältnisse weckte Moordorf schon bald das Interesse gerade der »Züchtungsspezialisten« der Nazis. Schon 1935 bewertete Rechenbach Moordorf als »krasses Beispiel für gehäufte Ausschußerbmasse« und als »rein züchterische Aufgabe«. »Es genügt nicht, daß lediglich die schlechtesten Familien entfernt werden, und so das augenblickliche Erscheinungsbild bereinigt wird. Dann steht man nach wenigen Jahrzehnten vor derselben Tatsache von neuem.«1 1940, als Rechenbach die Untersuchung unter dem Titel »Moordorf - ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte und zur sozialen Frage«8 veröffentlichte, faßte er die Gründe für die Studie weiter. Der »Osten, der nach neuen Menschen« rufe, stelle die »notwendige Forderung, den Gedanken der Sied-


lung und der Neubildung deutschen Bauerntums immer wieder im engsten Zusammenhang mit der Rassereinheit und der Erbgesundheit der siedelnden Menschen zu sehen.« (S. 5/6) Die genauste Auswahl der Siedler war nach seiner Meinung für die Siedlung im Osten sehr wichtig. Durch die »erbbiologische Untersuchung«, die von Rcchcnbach und seinen Mitarbeitern an der Moordorfcr Bevölkerung vorgenommen wurde, sollte »die Notwendigkeit blutsmäßiger Auslese bei der Siedlung dar- gestellt werden«. Weiterhin sollte »ein Weg gezeigt werden«, die »unliebsamen Verhältnisse« in M oordorf zu beseitigen. Das »Problem« sei ausschließlich »ein biologisches und daher auch nur so zu lösen«’. Die Untersuchungen für diese Studie begannen ca. 1935. Etwa ein halbes Jahr lang arbeitete daran ein extra vom RNS in Aurich eingestellter Lehrer, der sich während seines Studiums »eingehend mit Rasse- und Erbfragen befaßt hatte10. Nach seinem Ausscheiden wurde eine w eitere Hilfskraft eingestellt, die u.a. die begonnene Arbeit weiterfilhrle und besonders »die Abstam mungsverhältnisse der M oordorfer« untersuchte." Diese beiden trugen »m öglichst vielgestaltige Unterlagen« wie die »Schul-, Gerichts-, Polizei-, W ohlfahrtsakten« zusam men, sichteten diese und leiteten sie nach Berlin weiter. Diese Vorarbeiten wurden zusamm en mit anderen Unterlagen wie Kirchenbüchern und Akten des Gesundheitsamtes Aurich in Rechenbachs Abteilung ausgewertet. Zu der Arbeitsgruppe gehörten neben Rechenbach sein »ärztlicher M itarbeiter«12 Dr. Johannes Schott- k y '\ Dr. Karl Kuchenbäcker14, und wahrscheinlich Dr. Bruno K. Schultz15. Diese vier Personen bildeten gleichzeitig die Spitze der Hauptabteilung Rasse des Rassenamtes des SS-Rasse- und Siedlungs-Hauptam tes.16 In mehreren Besuchen nahmen sie M oordorf in Augenschein und pflegten den Kontakt zu den örtlichen Behörden, wie der Kreisbauem schaft und dem Gesundheitsamt. Bei d ieser »erbbiologischen U ntersuchung« von insgesam t 521 M oordorfcr Fam ilien und deren »Sippenangchöri- gen« wurden die Bcwcrlungskritcricn der »praktischen Erb- und Rassenpflegc«, d.h. der »Eheberatung oder der Gewährung von Ehestandsdarlehen« angewandt. Rc- chenbach ging bei der Beurteilung allerdings über die »Maßsläbe des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« hinaus, indem er nicht nur sogenannte Erbkrankheiten, sondern auch die »kriminelle, soziale oder anderweitige Belastung der einzelnen Familie« mit in die Bewertung einbezog. Er wollte so »ein Bild der Lcbcnsuntüchtigkcit der Dorfbewohner« zeichnen. »Schon die oberflächliche Betrachtung der Zustände in M oordorf legt den Gedanken nahe, daß es weniger die wirtschaftliche Notlage oder die schlechten landwirtschaftlichen Möglichkeiten sind, die M oordorf von Jahrzehnt zu Jahrzehnt imm er mehr absinken ließen, sondern daß die Ursache allen Übels in der Bevölkerung selbst liegen muß. Die erbbiologische Bestandsaufnahme hat diese Vermutung vollauf bestätigt.« (S.69) Die »erbbiologische W ertigkeit« der Moordorfer Bevölkerung war demnach äußerst bedenklich. Eingeleilt in vier Wertklassen von 1 = gut bis 4 = abzulchnen, wurden nur 9,8 als gut bewertet, 20,4 % als durchschnittlich, 16,1 % als bedenklich und 53,7 % als abzulehnen. Die Methodik, mit der Rechenbach zu diesem für die Moordorfer Bevölkerung verheerenden Urteil kam, führte er an keiner Stelle aus. Es wurde nur anhand der Akten geurteilt. Der behauptete Zusam m enhang zwischen der negativen »erbbiologischen Beurteilung« und den sozialen V erhältnissen der U ntersuchten spielt im Verlauf der Untersuchung eine zunehmend größere Rolle. W iederholt wird in diversen Tabellen und Schaubildern die Berufszugehörigkeit und die Einteilung in W ertklassen in Beziehung gesetzt und der »erbbiologische Wert der berufstätigen männlichen Bevölkerung« dargestellt. Wie nicht anders zu erwarten, schneiden die Großbauern (insgesamt 8 Personen) am besten ab, die Angehörigen des Subproleta-


riats werden am schlechtesten beurteilt. Ungelernte Arbeiter (insg. 324) werden zu 84 % in die Wertklassen 3 und 4 eingeordnet, »Händler und Hausierer« (insg. 76) gar zu 90 %. Die Begründung, die Rechenbach dafür liefert, ist bezeichnend: »M it zunehmender beruflicher Selbständigkeit und eigener Verantwortlichkeit nimmt der soziale Wert zu. (...) Die Ursache hierfür liegt in den sozialen Auslesewirkungen, die besonders in dem letzten Jahrhundert sich geltend gemacht haben. Die Differenzierung des modernen Berufslebens hat die Menschen bereits weitgehendst in einzelne erbbiologische Gruppen geschieden. (...) (In Moordorf, U.K.) sind unter den unselbständigen Berufstätigen fast ausschließlich die minderwertigsten des ganzen Dorfes zu finden.« (S. 80) Nach diesem Ergebnis ist es nicht verwunderlich, daß alle möglichen sozialen Lebensäußerungen, in das Wertschema übertragen, das Urteil nur noch bestätigen. Erscheinungen, die bei den Unterklassen in Moordorf - aber nicht nur da - weit verbreitet waren, wie A rbeitslosigkeit, Armut, Alkoholismus, Verschuldung, aber auch Kriminalität und der hohe Grad der Organisierung in der KPD, werden in Beziehung zum »erbbiologischen Wert« gesetzt. Selbstverständlich kom m t Rechenbach auch hier zu dem Ergebnis, diese Erscheinungen seien besonders bei den Menschen, die in die Wertklassen 3 und 4 eingeordnet wurden, vertreten. In einer Charakterisierung der »Kriminellen«, in der der ganze Haß von R echenbach zum Vorschein kommt, heißt es z.B. »die überwiegende Mehrzahl« dieser Kriminellen seien »als gemütsarme, willensschwache, geltungs- und streitsüchtige, brutale, teils auch intellektuell minderbegabte Psychopathen zu bezeichnen«, die außerdem noch »ausgesprochen arbeitsscheu« seien, nur einen »Scheinberuf« als Hausierer ausübten, um »dahinter ein Landstreicher-, Bettler- und Bummlerleben« zu verbergen und bei denen bei einem Drittel »zusätzlich noch Trunksucht nachgewiesen« wurde. (S. 73) Diese Erscheinungen der in die Wertklassen 3 und 4 eingeordneten Personen stellten nach Rechenbach nicht nur für die Gegenwart eine Gefahr dar; die wesentliche Gefahr sieht er in der Zukunft liegen, weil »die Minderwertigen sich stärker fonpflanzen als die leistungsfähigen Schichten des Volkes«. So »wurde auch innerhalb der Moor- dorfer Bevölkerung festgestellt, daß die erbbiologisch unerwünschten und Asozialen sowohl hinsichtlich der Kinderzahl verhältnismäßig als auch absolut weit überwiegen.« (S. 87) Durch Einheiratung in andere »Sippen« und Vermischung mit an sich gutem Erbgut würde dieses negative Erbbild immer weiter verbreitet. Rechenbach führt an, »daß von den beiden schwersten Kri minellen der eine mi 1183 und der andere mit 159 Moordorfer Familien versippt ist, die bis auf die Ursiedler zurückzuführen« seien. (S. 76) Bei der Gründung Moordorfs sei durch die mangelnde Auswahl der Siedler und die Planlosigkeit der Ansiedlung durch die damalige preußische Regierung der Grundstein für die von ihm beklagten Zustände gelegt worden. Moordorf sei für andere ostfriesische »Lebensuntüchtige, Arbeitsscheue und Kriminelle«zwarimmereinOrt großer Anziehung gewesen, allerdings seien diese Zuzüge relativ gering gewesen. Die absolute Mehrzahl der in die Wertklassen 3 und 4 eingestuften Menschen stamme von den schon minderwertigen Ursiedlem ab, deren minderwertiges Erbgut von Generation zu Generation weitergegeben wurde und sich so rasant ausgebreitet habe. Um dies zu belegen, wurden von Rechenbach gesondert diejenigen der438 Familien untersucht, »deren Sippen mit verschiedenen Anteilen auf die 62 Ursiedler zurückzuführen seien. Diese Nachkommen wurden zu 57,3 % als erbbiologisch abzulehnen und zu 17,2 % als bedenklich eingestuft. »Der Keim für die Mißstände in Moordorf ist bereits in jenen Menschen zu suchen, die in den Jahren kurz nach 1765 bis 1770 ihren Fuß auf Moordorfer Grund setzten. Es waren keine Zigeuner, wie bisher vielfach angenommen, also keine Menschen mit


Horst Rechenbach, geb. 11.07.1895 in Straßburg/Elsaß, 1914 Abitur, Fahnenjunker in einem Pionierbataillon, bei Kriegsausbruch Leutnant der Kavallerie. 1918 Oberleutnant. 15.01.-17.05.1919 Führer der 1. Freiwilligenkompanie Pi. I des Ostpreußischen Freikorps. 1919 - 1922 Studium in Königsberg und Göttingen, Landw irtschaftliches Staatsexam en und Tietzuchtinspektorexamen. 1925 Dr. phiL in Göttingen,»die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Landbevölkerung Nordthiiringens«. 1925 - 1931 Fachstudienrat an der landwirtschaftlichen Heeresfachschule in Erfurt. Dort untersuchte er seine Schüler nach erbbiologischen Gesichtspunkten.' Im Dezember 1931 forderte »Reichsführer SS Himmler ihn auf. zur Reichsführung nach München zu kommen, um das Rasse- und Siedlungsamt als stellvertretender Chef aufzubauen.« 1933 Hauptabteilungsleiter der Hauptabteilung G »Blutsfragen des deutschen Bauerntums« im Stabsamt des Reichsbauemführers.2 1934 Chef der Hauptabteilung Rasse des SS-Rasse- und Siedlungsamtes, diesen Posiert behielt er offenbar bis Kriegsende. SS-Standartenführer. Leiter der »Reichsstelle fü r die Auswahl deutscher Bauemsiedler«, lebenslanges Mitglied des Reichsbauernrates. 1936 Leiter des Amtes fü r Blutsfragen des Deutschen Bauerntums im Reichsamt fü r Agrarpolitik und Amtsleiter der Reichsleiter der NSDAP. 1938 SS Oberführer.3 Durch den Machtverlust Darres, seines Freundes und großen Vorbildes, konnte auch Rechenbach seine so hoffnungsvoll begonnene Kariere nicht fortsetzen. 1939 »im Felde« wahrscheinlich beim Heer, Ende 1939 bei Lublin schwer verwundetf 1940 Beförderung zum Major, Leiter einer Abteilung als Siedlungsbeauftragter der Wehrmacht im Stab von Gerneraloberst Fromm im OKH. »Wehr und Pflug im Osten«, die in einer Auflage 1 200 000 an die Truppe verteilt werden sollte. Nach heftiger Intervention Himmlers wurde die bereits gedruckte Broschüre eingestampft. Himmler verwahrte sich dagegen, daß eine Dienststelle des OKH sich überhaupt in Siedlungsfragen einmischte und war insbesondere mit der inhaltlichen Ausrichtung der Broschüre nicht einverstanden. Eine Sonderstellung des Heeres bei der Besiedlung könne es nicht geben, »sondern es wird insgesamt nur eine deutsche Siedlung geben«. Auch die von Rechenbach angesprochene Lehmbauweise der neuen Häuser im Osten, die den deutschen Soldaten nach dem Sieg geschenkt werden sollten, könne man diesen nicht zumuten. Himmler empfahl Rechenbach: »Ich glaube, daß sie fü r die deutsche Siedlung mehr tun würden, wenn Ihre Dienststelle sich so bald wie möglich auflösen würde und Sie im Rahmen einer Sicherungs-Division des Heeres an der Niederkämpfung der Banden im Osten teilnehmen würden.«5 Rechenbach bat daraufhin um seine Versetzung, den Einsatz in einer SicherungsDivision konnte er noch verhindern.6 Er beschwerte sich aber bei Darre Uber die zunehmende Verdrängung der Grundsätze der Neubildung deutschen Bauerntums. »Die Mutlosigkeit unter unserer, a u f den Blutsgedanken eingeschworenen Gefolgschaft ist sehr groß.«7 1943 Reichsamtsleiter im Reichsamt fü r das Landvolk der NSDAP, Hauptaufgabengebiet »Wachstum lind Aufartung des Landvolkes«. Er war als Reichsamtsleiter auch fü r die Auswahl und Betreuung der deutschen Siedler im Wartheland und Jur die Schulung der durchführenden Beamten zuständig.11 Anfang 1943 wurde er zusätzlich Leiter des Reichsbundes Deutscher Diplom-Landwirte. Rechenbach gelang es nach 1945 nur schwer wieder Fuß zu fassen. Er wurde Lehrer an privaten L andw irtschaftsschulen.

In den fünfziger Jahren veröffentlichte er einige Artikel zur Zucht und besonders Zuchtauswahl von Legehühnern in der ».Deutschen W irtschaftsgeßügelzucht«.9 Er galt als Fachmann a u f dem Gebiet der Geflügelzucht und der Vererbung von guten Legeergebnissen. E r übertrug die Fragestellungen und Inhalte, m it denen er die Menschen in M oordorf untersuchte auf die Legehennen, wenn sich auch sein Sprachstil den neuen Verhältnissen angepaßt hatte. Seine These war, daß nicht automatisch das Huhn m it den besten Legeergebnissen zur Zucht geeignet sei, sondern es kom m e b ei der Zucht a u f das Bild der ganzen Fam ilie und a u f die Abstammung an. Rechenbach starb 1968.

, 1 Horst Gies, Zur Entstehung des Rasse- und Siedlungsamtes der SS, in: Paul Kluke zum 60sten Geburtstag, Frankfurt 1968,
S. 127-139, hier S. 134 f. 2 Angaben aus: Die Ahnen deutscher
Bauemführer, Band 16 - Horst Rechenbach, bearb. im Stabsamt des Reichs- ' bauemführers, Berlin 1936, S. 10/11. 3 Die folgenden Angaben sind, soweit nicht anders vermerkt, aus: BDC, PA Horst i Rechenbach. 4 BA, R 16 1/112 PA Rechenbach. Dort befindet sich zwar kein Vermerk über seine Tätigkeit in Lublin, nur in einer Genesungs-Postkarte wird seine Verwundung vermerkt. 5 Brief Himmlers an Rechenbach vom 17.9.1942, BDC, PA Rechenbach. 6 So Andreas Wojak, der Frau Rechenbach gesprochen hat, zu mir. 7 Brief Rechenbach an Darre vom 5.1.1942, j BDC, PA Rechenbach. j 8 Forschungsdienst, Nr. 15/1943, S. 113 und | 190 und Nr. 16/1943, S. 154.
I 9 Z.B.: Die Herdbucharbeit in der Schweiz, in: Deutsche Wirtschaftsgeflügelzucht, Nr. 34,22. Mai 1954. fremdvölkischem Blut, sondern Personen, die, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, asoziale Elemente des eigenen Volkes waren.« Die Untersuchung Rechenbachs über die Moordorfer Bevölkerung blieb für diese offenbar ohne Auswirkungen. Die »züchterische Arbeit« ist in Moordorf glücklicherweise nicht durchgeführt worden. Gegen 67 Moordorfer Einwohner wurden im Zeitraum von 1934 bis 1944 Sterilisationsanträge gestellt, davon wurden 41 (!) abgelehnt. 26 Personen - 15 Männer und 11 Frauen - wurden sterilisiert; 22 wegen »angeborenem Schwachsinn«17, der sozialhygienischen Diagnose des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses«. Damit liegt M oordorf zwar knapp über dpm Reichsdurchschnitt, es ist aber keine vermehrte Zwangssterilisationspraxis, die auf Rechenbachs Studie zurückzuführen wäre, zu entdecken. Dies ist um so verwunderlicher, als die Ärzte im Gesundheitsamt Aurich diese Untersuchung offenbar als Gelegenheit begriffen, ihre gesellschaftssanitären Utopien in Moordorf umzusetzen. 1937 bat Rechenbach das Gesundheitsamt in Aurich »an der Beseitigung der im Orte Moordorf bestehenden Zustände« mitzuarbeiten. »Dem Gesundheitsamt war bei der Lösung des Problems >Moordorf< die Aufgabe gestellt, die als erbbiologisch bedenklich< bzw. erbbiologisch unerwünscht« Bezeichne- ten zu sichten und gegebenenfalls der Unfruchtbarmachung zuzuführen.«1® Den Ärzten des Gesundheitsamtes Aurich war in diesem Zusammenhang die gesetzliche Grundlage der Zwangssterilisation viel zu lasch. Sie beklagten, daß die »Asozialität«, das »gemeinschaftswidrige Verhalten« allein nicht ausreiche, um jemanden sterilisieren zu können, sondern daß diese »A sozialität« nur in Verbindung mit »Schwachsinn« oder einer »Erbkrankheit« als Begründung benutzt werden könne. Somit hätte das Erbgesundheitsgericht keine rechtliche Grundlage gehabt, »bei diesen
Asozialen auf Unfruchtbarmachung zu erkennen«.

Auch hat keine verstärkte - wie auch immer geartete - polizeiliche Verfolgung der Moordorfer Bevölkerung auf Grund der Rechenbach-Studie stattgefunden. Es ist zu vermuten, daß die Lösung des »Problems« Moordorf auf die Zeit nach dem »Endsieg« verschoben wurde. Den Verantwortlichen scheint dabei eine großangelegte Aus- und Umsiedlungsaktion vorgeschwebt zu haben, die endgültig die sozialen, politischen und rassischen »Probleme« in Moordorf »bereinigen« und die »soziale Frage« lösen sollte. Das Beispiel Moordorf sollte nicht nur die »Asozialen-Problematik« erhellen, sondern im wesentlichen verdeutlichen, daß eine Siedlungspolitik ohne die genauste Auswahl der Siedler diejenigen Folgen haben würde, die Rechenbach in Moordorf diagnostizierte. 1940, als diese Untersuchung über Moordorf erschien, wollte Rechenbach in die Auseinandersetzung mit Himmler über die Siedlungspolitik in Polen eingreifen, entsprechende Inhalte abstek- ken und die Kompetenz des Reichsnährstandes und nicht zuletzt seine eigene unter Beweis stellen. Er formulierte im Schlußwort: »Besonders in der heutigen Zeit, in der in den deutschen Ostgebieten neuer Boden der Besiedlung erschlossen wird, ist es notwendig, immer daran zu denken, daß nur bestes Blut den Pflug über das neugewonnene Land führen darf, wenn wir die Grenzgaue dem Reich für immer erhalten wollen.« Die Besiedlung dürfe nicht, wie in »früheren Zeiten«, wegen der »wirtschaftlichen Erfolge« durchgeführt werden, sondern nur die »Neubildung deutschen Bauerntums« gebe dem Reich die »Sicherheit für die Zukunft«, weil durch sie »Bauerund Bäuerin« als »Urquelle kommender gesunder Geschlechter mit dem Boden auf ewig verbunden« seien. (S. 94) Darüber hinaus wollte Rechenbach Kriterien und Methoden vorstellen, mit denen man mit einfachen Paradigmen große Menschenmassen überprüfen konnte. Rechenbach und Schultz arbeiteten beide schon früh an Beurteilungsschemata zur Überprüfung von Menschen. Rechenbach beurteilte Ende der 20er Jahre Heeresschüler nach rassischen Kriterien1’, Schultz arbeitete die Eignungstest für SS-Bewerber nach fast gleichlautenden Kriterien aus.20 Beide arbeiteten ab 1934 im SS-Rasse- und Siedlungs-H auptam t und im Stabsamt des Reichsbauemführers bei der Entwicklung und Durchführung der Auswahl der »Neubauernbewerber« zusammen. Daß diese Untersuchung nicht im Rahmen des Rasseamtes des RuSHA, sondern im Stabsamt des Reichsbauemführers entstand, lag an der geringen Bedeutung des RuSHA Mitte der dreißiger Jahre und an der guten materiellen, finanziellen und personellen Ausstattung des Reichsnährstandes. Ulrich Kimpel, Oldenburg

1 Horst Rechenbach, Schaffung neuen Bauerntums, in ders. (Hg.), Bauemschicksal ist
Volkes Schicksal, Berlin 1935, S. 85 - 102, hier S. 93. 2 Die Ahnen deutscher Bauemführer, Band 16 - Horst Rechenbach, bearbeitet im Stabsamt des Reichsbauemführers, Berlin 1936, S. 10 3 Zum geschichtlichen und sozialen Hintergrund von Ostfriesland allgemein und Moordorf speziell, besonders Poppinga/Barth/
Roth, Ostfriesland - Biographien aus dem
Widerstand, Frankfurt/M. 1977; sowie H.
Schmidt, Politische Geschichte Ostfrieslands,
Pewsum 1975; F.-W. Schaer, Die ländlichen
Unterschichten zwischen Weser und Ems vor der Industrialisierung, in: Niedersächsisches Jahrbuch zur Landesgeschichte, Band 50, 1978, S. 45 - 69; ders., Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Deicharbeiter an deroldenburgisch-ostfriesischen Küste in der vorindustriellen Gesellschaft, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Band 45,1973, S. 115- 144; Onno Poppinga, Pioniere der Wildnis-zursubversiven Geschichte eines ostfriesischen Dorfes, in: Ästhetik und Kommunikation, Nr. 21, Sept. 1975,
S .6 -1 4 . 4 Onno Poppinga, Bauern und Politik, Frankfurt/M., 1975, S. 274. 5 Ebd., S. 277. 6 Poppinga, Pioniere, S. 9. 7 Rechenbach, Schaffung, S. 95/96. 8 Horst Rechenbach, Moordorf - ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte und zur sozialen


Frage, Berlin 1940. Die Studie erschien im
Reichnährstands-Verlag »auf Anregung des
Reichsbauernführers« und wurde finanziert durch den Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft. Seitenzahlen im Text beziehen sich auf diese Ausgabe. 9 So der Landesobmann der Landesbauem- schaft Hannover an den Regierungspräsidenten in Aurich am 22.10.1934, StA Aurich,
Rep. 21 b 1/1874. Den Hinweis auf diesen
Aktenbestand habe ich von Andreas Wojak erhalten. Er gab mir außerdem vorab zwei
Kapitel seiner Dissertation mit dem Titel »Moordorf 1918 - 1950, Dichtungen und
Wahrheiten über eine ungewöhnliche ostfriesische Moorkolonie«, die in einem Bremer Verlag veröffentlicht wird. Ich bedanke mich bei ihm an dieser Stelle. 10 Es handelte sich um einen Hermann Nielsen aus Hamburg, der in einer lOtägigen Schulung im Stabsamt des Reichsbauemführers von Rechenbach in seine spezielle Arbeit eingearbeitet wurde und vier Wochenstunden an der Schule in Moordorf unterrichtete, »um durch die Kinder eine enge Verbindung mit den Familien in Moordorf« zu bekommen.
StA Aurich, Rep. 21 b/1874. 11 Es war ein »Herr Hanssen«, der sich »für
Blutsfragen des Bauerntums stark interessiert« hat und von der Kreisbauemschaft als »Facharbeiter für Blutsfragen« eingestellt wurde. Dort wurden ihm außerdem Aufgaben des Stabsleiters übertragen; er sollte die »Siedlungssachen vorbereiten« und »die
Kartei auf dem Laufenden halten«. StA
Aurich, Rep. 57/95 und Rep 57/96. Zum
Zeitpunkt des Erscheinens der Rechenbach-
Untersuchung war er bereits verstorben. 12 StA Aurich, Rep. 21 b/1874; 13 Johannes Schottky, Dr.med., geb. 17.09.02 in Frankfurt/O., 1928 Staatsexamen, 1930- 33 Assistent in der Psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus Schwabing, München, 1933 Abt.Leiter im Stabsamt des Reichsbauemführers, Abtl. Erbpflege und Gesundheitsführung (erbbiologische Siedlerberatung), Rasseamt im RuSHA, Mitherausgeber von »Volk und Rasse«, Ende 1936 Übernahme der Leitung der Heil- und Pflegeanstalt
Hildberghausen, 1938 Obermedizinalrat und
Direktor der Anstalt, 1942 Habilitation in
Erlangen, 1943 Dozent für Psychiatrie,
Neurologie und Rassenhygiene in Erlangen. 14 Siehe seinen Lebenslauf im Hauptteil dieses Heftes. 15 Bruno K. Schultz, geb. 3.8.01 in Sitzenberg/ Österreich, 1934 - 38 Abt.Leiter im Stabsamt des Reichsbauemführers, 1936 zusätzlich Abt.Leiter der Abt. Rassenforschung im
Rasseamt des RuSHA, 1938 Professor an der
Universität Berlin,ab 1.10.1941 Führungdes
Rasseamtes des RuSHA, ab 1.2.1942 offizieller Leiter des Rasseamtes des RuSHA, 1942
Ord.Professor und Direktor des Institutes für
Rassenbiologie der Karlsuniversität Prag, ab
Sept. 1944 Waffen-SS, nach 1945 Professor an verschiedenen Universitäten, z.B. Münster. 16 Stellenplan des RuSHA, Stand 1.4.1936, BA,
R 161/2038. 17 Wojak, S. 120/121. 18 So der damalige Amtsarzt Dr. Arend Lang in seinem Bericht mit dem programmatischen
Titel »Zur Lösung des Asozialen-Problems durch das Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses (dargestellt an dem Ott Moordorf, Regierungsbezirk Aurich)«, zit. nach
Wojak, S. 114/115. Zu welchem Zweck dieser Bericht geschrieben wurde, ist unklar, eine Veröffentlichung fand meines Wissens nicht statt. Dr. Arend Lang (1909 - 1981),
SS-Hauptsturmführer, 1934 an »leitender
Stelle am Putsch in Wien« beteiligt, von
März 1937 bis September 1938 Amtsarzt beim Gesundheitsamt Aurich, danach »Referent für Erb- und Rassenpflege« beim Hauptgesundheitsamt Wien. Stellung im RuSHA und SS-Ahnenerbe. In den besetzten Niederlande fungierte er als »Sachverständiger in
Angelegenheiten des friesischen Volkstum«.
Nach 1945 zählte Lang zu den bekanntesten
Ostfriesen, allerdings wegen seiner Forschungen Uber die Entwicklung von Seekarten. Er war 15 Jahre lang Lehrbeauftragter an den
Universitäten Göttingen und Berlin. 19 Rechenbach untersuchte in seiner Zeit als
Fachstudienrat an der Landwirtschaftlichen
Heeresfachschule in Erfurt von 1925-1931 seine Schüler nach erbbiologischen Gesichtspunkten. Er »arbeitete ein Beurteilungsschema aus, dessen drei wichtigsten Bestandteile waren: 1. Körperbewertung (mit Noten 1-9), 2. Rassischer Anteil (rein nordisch bzw. fälisch, vorwiegend nordisch-fälische Mischtypen; vorherrschend dinarisch, ostische, ostbaltische Mischtypen; Vermutung nichteuropäisch-fremden Einschlags), 3. Soldatischer und persönlicher Allgemeineindruck im Stehen, Haltung und Bewegung (mit Kategorien von sehr geeignet bis starke Bedenken)«. Aus Horst Gies, Zur Entstehung des
Rasse- und Siedlungsamtes der SS, in Paul


Kluke zum 60sten Geburtstag, Frankfurt/M. 1968. S. 127- 139, hier S. 134. 20 Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf, München 1984, S. 137 f.
D as S S -M a n n s c h a fts h a u s in L u b lin u n d d ie F o rs c h u n g s s tc lle f ü r O s tu n te r k ü n f te
Wie in der DDR und der Sowjetunion hat der Untergang der poststalinistischen Einparteiensysteme auch in Polen einiges interessantes, bislang nicht oder nur schwer zugängliches Aktenmaterial zutage gefördert. So wurde schon Ende 1990 das ehemalige Zentralarchiv des Innenministeriums (Centraine Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn§trznych) an das Archiv der Hauptkommission zur Erforschung der Hitlerverbrechen in Polen, heute Hauptkommission zur Erforschung der Verbrechen gegen das polnische Volk, überstellt. In den Aktenbeständen des Innenministeriums befinden sich Dokumente des Höhren SS- und Polizeiführers in Lublin, Odilo Globocnik, und seiner »Forschungsstelle für Ostunterkünfte«. (Akte Nr. 891/6; die folgenden Zitate sind dieser Akte entnommen.) Die Gründung und der Ausbau eines Globocnik direkt unterstellten Forschungsapparates begann im Februar 1941 auf Anregung des Hauptsturmführers Hanelt, der dann auch die Leitung des Institutes stellvertretend für Globocnik übernahm. In einem Organisationsschema, das vermutlich vonAnfang 1941 stammt, ist das Institut, zu dieser Zeit noch unter dem Namen »SS- Mannschaftshaus«, mit elf Abteilungen verzeichnet: Bauwesen, Vermessungswesen, Geologie, Landwirtschaft, Geschichte, Recht, Philologie, Medizin, Raumplanung, Landschaftsgestaltung und Wirtschaft. Besetzt wurden diese Abteilungen in erster Linie mit »jungen Wissenschaftlern« die selbstverständlich der SS angehörten. Aufgabe des Institutes war die Vorbereitung der Germanisierung des Distriktes, beginnend mit der Gegend um Zamosd, die eine »Vorübung« für die Einbeziehung des gesamten Generalgouvernements in das deutsche Reichsgebiet sein sollte. Zur Erreichung dieses Zieles wollte man auf die enge Zusammenarbeit mit ähnlich ausgerichteten Instituten nicht verzichten. Da hierbei mit der »Empfindlichkeit« mancher Wissenschaftler gerechnet werden mußte, die möglicherweise nicht gerne direkt mit der SS Zusammenarbeiten wollten, wurde das SS- M annschaftshaus im Frühjahr 1942 in »Forschungsstelle für Ostunterkünfte« umbenannt. Die Dokumente hierüber sind besonders interessant, weil sie zum einen Aufschluß über das Verhältnis von Planung und Realisierung der Umsiedlungsm aßnahmen geben (über Ablauf und Folgen derUmsied- lung exisüert in der polnischen Historiographie eine umfangreiche Literatur; nicht des polnischen Mächtige seien auf die Arbeit von Czeslaw Madajczyk »Die Okkupationspolitik N azideutschlands in Polen 1939-1945« Köln 1988, verwiesen), zum anderen auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Siedlungspolitik und dem Massenmord an den Juden hinweisen. Eine der ersten Aufgaben Hanelts als Leiter der Forschungsstelle war die »theoretische Erarbeitung der Judenbereinigung« (Notiz für Brigadeführer, 9. August 1941). Die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, die man selbst erst knapp zwei Jahre zuvor in den Distrikt Lublin abgeschoben hatte, wurde so zur Voraussetzung für das »Siedlungswerk« der SS. Im März 1942 meldete Hanelt: »Diese Arbeit (i.e. die »Planung zur vorläufigen Regelung der Judenfrage«) fand den Abschluß mit der Evakuierung der Juden seit dem 15. III. nach Osten.« (»SS- Mannschaftshaus Lublin«, o.D., beschreibt den Stand des Institutes am 18. März 1942.) Es kann kein Zweifel bestehen, daß auch hier, wie in den meisten deutschen Dokumenten dieser Zeit, mit der »Evakuierung nach Osten« die Vernichtung in den Todes- lagem Majdanek, Sobibör und Beizcc gemeint ist. Gleichzeitig wurde die Erweiterung des Institutes auf dreißig Abteilungen geplant. Man zählte dabei auf die Zuarbeit Konrad

Meyers, von dem erwartet wurde, daß er geeignete Kräfte für den Raumplanungsbereich empfehle oder zur Verfügung stelle. Die Zusammenarbeit mit dem RKF, dem Arbeitgeber Meyers, war in der Folgezeit eng, aber nicht ganz unproblematisch: die von einem der »jungen Wissenschaftler«, Dr. Franz Stanglica, ausgearbeitete Denkschrift »Grundsätzliches zur Raumordnung des Zamoäder Landes« wurde von einem Mitarbeiter des RKF, »Herrn von Schaurodt«, als dessen Arbeit ausgegeben, nachdem das eigene Projekt abgelehnt worden war. (Aktennotiz von Hanelt, 27. Oktober 1942. Vermutlich war Udo v. Schauroth, Mitarbeiter der Planungshauptabteilung des RKF gemeint). Globocnik stützte, vermutlich nach Rücksprache mit der Berliner Behörde Stanglica, und gab den Befehl weiterzuarbeiten. Stanglica und die gesamte Forschungsstelle stützten sich in ihren Arbeiten recht weitgehend auf die Denkschrift Karl Kuchenbäk- kers, »Bodenordnung im Generalgouvernement« vom Februar 1941. (Veröffentlicht von Cz. Madajczyk in Dzieje Najnowsze Polski n, 1959, S. 113 - 140, in der Originalsprache). Kuchenbäcker bemühte sich hier um eine Anpassung der Agrar- und Bevölkerungsstruktur des GG an die Verhältnisse im Reich als Vorstufe zur vollständigen Germanisierung des Gebietes. Im gleichen Sinne sind auch die Raumplanungsentwürfe Stanglicas zu lesen, und ebenso, als Verbindung von sozialökonomischer »Sanierung« und Germanisierung, ist die gewaltsame Umsiedlungspolitik in der »Zamojszczyzna« zu begreifen. Die Beziehungen von Planung und Realisierung waren in diesem Falle unmittelbar: Am 22. März 1943 informierte Hanelt Stanglica, daß alle Raumordnungspläne »in Zukunft vom Gruppenführer unterzeichnet werden und erhalten damit Befehlsinhalt für alle Dienststellen, die damit zu tun haben.« Am 2. April 1943 wurde die »Raumordnung für das Umsiedlungsgebiet Zamo^c Pflugstatt« ausgegeben. Sie enthält eine detaillierte Umgestaltung des von Polen und Krainem meist in Kleinstwirtschaften besiedelten Gebietes zu einem Landstrich, in dem Polen noch einige Landarbeiterkolonien belassen wurden, das aber größtenteils von arrondierten, mittelständischen deutschen Bauernhöfen bestimmt werden sollte. Die nun »überschüssige« polnische Bevölkerung wurde, wie schon in der ersten Umsiedlungsphase, die aufgrund des massiven Widerstandes polnischer Partisanen und Interventionen des Generalgouverneurs Hans Frank im Winter 1942/43 unterbrochen werden mußte, an Ort und Stelle selektiert: Alte Leute, Kinder und sonstige »nicht Arbeitsfähige« wurden in sog. »Rentendörfer« abgeschoben, alle anderen kamen zur Zwangsarbeit ins Reich oder nach Auschwitz. Als Vorbild für dieses Vorgehen haben vermutlich die »Polenreservate gedient«, mit denen Gauleiter Arthur Greiser schon zwei Jahre zuvor im Warthegau experimentiert hatte. Und auch dessen Erfahrungen mit der Koppelung von Umsiedlung und Umgestaltung der Agrar- und Sozialstruktur gingen in die Arbeiten der Forschungsstelle ein: in den hier ziüerten Akten finden sich die »Ergänzungen zu den Planungsgrundsätzen für den Dorfumbau im Reichsgau Wartheland« vom 28. Mai 1943. Eine Publikation der wichtigsten Dokumente aus der Forschungsstelle in den »Teki Archiwalne« ist in Vorbereitung. Michael G. Esch

Z u r F r a g e d e r E c h th e it des Tagebuchs v o n H e rm a n n Voss
In dem Professor Hermann Voss gewidmeten Nachruf hat sich Prof. Dr. Joachim Hermann Scharf mit den gegen den verstorbenen Anatomen erhobenen Vorwürfen auseinandergesetzt. Hier der diesbezügliche Passus des Nekrologs: »Am 20. 9.1985 erhielt der Unterzeichnete einen vertraulichen Brief von DORN, dem ein maschinengeschriebenes »Tagebuch« Vbw ’ aus seiner Posener Dienstzeit beilag. Dem Manuskript war ein Vorwort in polni


scher Sprache (mit - soweit kontrolliert genauer deutscher Übersetzung) aus der
Feder eines polnischen Historikers vorangestellt. Angeblich war dieses maschinenschriftliche Tagebuch bereits 1945 gefunden worden, warum es erst nach 4
Jahrzehnten wieder hervorgeholt wurde, war nicht glaubhaft begründet. Beim Lesen bekam der Unterzeichnete Gänsehaut: der
Text triefte von antipolnischen und antisemitischen Haßtiraden. Doch bald zeigte sich, daß der Text in Fülle familiengeschichtliche Fehler gröbster Art enthielt.
Ehe der Unterzeichnete der Bitte DORNS gemäß das »Tagebuch« am 25.09.1985 an
FANGHÄNEL weitergab, verfaßte er eine
Liste der gröbsten Fehler, die er DORN und
FANGHÄNEL sandte. Da nicht bekannt ist, daß VOSS in den 40er Jahren eine Psychose durchlaufen hat, konnte das Ergebnis der
Durchsicht nur sein: Böswillige plumpe
Verfälschung eines wahrscheinlich handschriftlichen Tagebuches!
Gründe fü r diese Einstufung sind: VOSS konnte nicht Schreibmaschine schreiben.
Der Unterzeichnete erhielt zwischen 1952 und 1986 hunderte Briefe von ihm manu propria, und die wenigen Briefe in Maschinenschrift sind von Sekretärinnen nach
Diktat getippt worden. VOSS’ Frau (EVA
VOSS, f 7.6.1970) stammte aus einer gemischt deutsch-polnischen Familie! Hinzu kommen die nicht gezählten Sachfehler, die nur ein psychisch Schwerkrankeroder eben ein Fälscherohne hinreichende Sachkenntnis gemacht haben kann. Leider waren 1985 bereits alle Sachkompetenten außer VOSS selbst verstorben: BARGMANN, CLARA, FAHRENHOLZ, HERRUNGER, G. HERTWIG, SPANNER u.a. Sie hätten wohl der Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen können. Oft wird gefragt, warum sich VOSS nicht überdas »Tagebuch« geäußert habe. Das entsprach weder seiner psychischen Struktur noch seiner stoischen Philosophie: »Denn Lob und Tadel, Ehrung und Kränkung tangieren mich nicht mehr.« (Brief vom 11.11.1975 an SCHARF). Möge der Rummel um VOSS’ »Tagebuch« eine Randglosse zu seinem Werk bleiben! Wer HERMANN VOSS gekannt hat, wird ihn nicht vergessen können. Die Benutzer seiner Lehrbücher werden seinen Namen noch lange Zeit hindurch nennen, auch wenn sie keine konkreten Vorstellungen mehr von diesem Mann haben. Die Histochemiker deutscher Sprache werden dagegen mit dem Namen VOSS immer seine Pionierleistungen verbinden, vor allem auch die Begründung der Acta histochemica. HERMANN VOSS hat sich um die Histochemie verdient gemacht.« Da Professor Scharf von einem polnischen Historiker spricht und damit wahrscheinlich mich meint, bin ich gezwungen, Stellung zu beziehen. Anfang der fünfziger Jahre habe ich eine Reihe von Artikeln über die Zerstörung der Posener Universität durch die Nazis und über den Aufbau der »Reichsuniversität Posen« verfaßt. Da die geplante Universitäts-Chronik 1939-1945 aus politischen Gründen nicht erscheinen konnte, habe ich von den in Frage kommenden Studien zwei Beiträge separat im »Przegljd Za- chodni«2 veröffentlicht: die Dokumentation »Aus dem Tagebuch eines Professors der >Reichsuniversität Posen<«3 und den Artikel »Die Reichsuniversität Posen«4. Die Dokumentation enthält Auszüge aus dem Tagebuch von Hermann Voss, der es versehentlich in Posen hinterlassen hatte. Dazu habe ich ein längeres Vorwort verfaßt. Die Auszüge wurden in der Originalfassung wiedergegeben, die Einleitung dagegen ist in polnischer Sprache gehalten. In meiner Einleitung habe ich folgende Feststellungen getroffen: Erstens. - Der maschinengeschriebene Text ist vom Inhaber des Lehrstuhls für Anatomie, Prof. Dr. Stefan Rözycki, nach seiner Rückkehr nach Posen im Frühjahr 1945 aufgefunden worden. Auszüge hat er im Juli 1945 in der Zeitschrift »Nowiny Lekar- skie«5 veröffentlicht. Unverständlicherweise behauptet Prof. Scharf, das Tagebuch sei erst nach vier Jahrzehnten hervorgeholt worden.6 Zweitens. - Der maschinengeschriebene Text ist eine Teilabschrift eines viel länge


ren Tagebuchs. Er umfaßt nur den Zeitraum vom 13.10.1932 bis zum 14.8.1942. In der ersten Eintragung weist Voss darauf hin, daß er hiermit den fünften Band seines Tagebuchs beginne. Das Original war womöglich handgeschrieben. So ist Scharfs Behauptung, Voss habe ein handschriftliches Tagebuch geführt, keine neue Entdek- kung. Drittens. - Das Tagebuch enthält umfangreiche Informationen über die Lebensweise des Verfassers, seine Gepflogenheiten, seine politischen Ansichten und seine berufliche Laufbahn. Hermann Voss war kein ausgesprochener Nazi, er bewunderte zwar Hitler, aber er äußerste sich öfters kritisch über die Regierungsmethoden und insbesondere die Partei. Er trat der Partei nur widerwillig bei. Er war konservativ eingestellt und hätte gern die Rückkehr der Ho- henzollern auf den Kaiserthron gesehen. Seine »Bibel« waren die Werke des Schriftstellers Wilhelm Raabe (1831-1910). Voss war ein vorbildlicher Familienvater, seiner Frau ergeben und den Kindern zugetan. Das dem Tagebuch zu entnehmende Bildnis ist höchst positiv, sieht man von seiner mörderischen Einstellung gegenüber Polen, Juden und Kommunisten ab. Hier drängt sich die Frage auf: Worauf beruhen denn die Unwahrheiten, die angeblich von einem Fälscher bei der erst nach dem Kriege erfolgten Niederschrift in das Tagebuch hineinmanipuliert worden sein sollen? Es ist selbstverständlich, daß die zahlreichen Hinweise auf das Familienleben und auf Freunde bzw. Kollegen die beste Quelle für die Feststellung der Authentizität des Tagebuches sind. Für einen Fälscher wäre es wohl wichtig gewesen, alle kritischen Äußerungen über die Nazis zu streichen. Das Fehlen solcher Äußerungen hätte viel besser zu der vom Verfasser gutgeheißenen »Endlösung« gepaßt. Hermann Voss stand mit seiner Einstellung Juden und Polen gegenüber nicht allein. Das für Polen geltende Sonderrecht war auf die Auslöschung der polnischen Nation ausgerichtet. Von der Propaganda wurden alle Polen zu Verbrechern gestempelt. Voss mußte gehört haben, daß Polen beschuldigt wurden, während des Septemberkrieges 58.000 Volksdeutsche ermordet zu haben, obwohl diesbezügliche Hinweise in seinem Tagebuch fehlten. Auch für Polen war eine »Endlösung« vorgesehen, die durch Massenvergasung, Verschleppung nach Sibirien, Einsperrung in »Polenreservate« für Arbeiter und »Eindeutschung« eines geringen Teils der polnischen Bevölkerung realisiert werden sollte. Der erste Schritt zur Versklavung und Vernichtung war die Entehrung.7 Prof. Scharf gibt zu, Hermann Voss habe von der Veröffentlichung des Tagebuchs Kenntnis gehabt. Er begründet das Ausbleiben einer Stellungnahme von Voss mit dessen psychischer Struktur bzw. dessen stoischer Philosophie. Meine Dokumentation erschien nicht in einer juristischen Zeitschrift, sondern - wie schon erwähnt - in der »Westlichen Revue«, die ausschließlich den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland gewidmet war und deshalb in beiden Teilen Deutschlands von interessierten Kreisen aufmerksam gelesen wurde - besonders in diesem Falle, da doch der Text in deutscher Sprache erschien. In der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre war der wis- senschafüiche Austausch zwischen Polen und der DDR bereits ziemlich rege. Auffallend ist, daß die Authentizität des Tagebuchs erst nach dem Tode von Hermann Voss in Frage gestellt wurde. Auf Prof. Scharfs Seite stehen nur Wissenschaftler des Jenaer Gustav-Fischer-Verlags, der die von Voss und Herrlinger verfaßten Lehrbücher herausgegeben hat. Diese basieren auf Untersuchungen an polnischen Leichen, die von der Gestapo geliefert worden waren. Die Publikationen von Rözycki (1945), Pospieszalski (1955) und Goguel8 erregten kein Aufsehen. Dasselbe Schicksal hatten auch die Studien vonLaguna9 und Jankowi- ak10. Erst der auf einer internationalen wissenschaftlichen Tagung in Krakau im April 1985 gehaltene Vortrag von Edmund Chrö- Scielewski wies u.a. darauf hin, daß Hermann Voss und sein Schüler Robert Herrlin-


gcrdas nach dem Krieg bekanntgewordene, im Gustav-Fischer-Verlag Jena erschienene
Anatomie-Taschenbuch aufgrund von Forschungen an Leichen polnischer Gestapo-
Häftlinge verfaßt hatten." Der Historiker
Götz Aly aus West-Berlin nahm sich des ganzen Fragenkomplexes an. Er verfügte auch über Unterlagen, die seinen Vorgängern nicht zugänglich gewesen waren, insbesondere die zeitgenössische deutsche Fachliteratur. Seine Studie fand in beiden Teilen Deutschlands beträchtlichen Widerhall. Dazu trug auch der Umstand bei, daß ein deutscher Historiker in Deutschland über einen deutschen Anatomen sprach. Durch den in dem Sammelband »Biedermann und Schreibtischtäter« veröffentlichten Artikel Alys12 kam der Stein ins Rollen. Im September 1988 kam Dr. Susanne Zimmermann vom Institut für Geschichte der Medizin an der Universität Jena nach Posen, wo das Tagebuch im Westinstitut aufbewahrt wird, um sich von seiner Authenzi- tät zu überzeugen. Schließlich wurde das Tagebuch noch einmal von dem Zahnarzt Jürgen Scholz gründlich auf seine Echtheit untersucht. Die beiden letztgenannten Forscher kamen zu demselben Schluß wie Götz Aly.13 Zu diesen Wissenschaftlern gesellten sich noch weitere hinzu. So schreibt Prof. Au- müller in seiner von der Fachschaft Medizin der Universität Marburg herausgegebenen Studie »Anatomie in der NS-Zeit«: »Nach persönlicher Rücksprache mit dem Herausgeber Götz Aly und dem Medizinhistoriker Prof. Kudlien in Kiel bin ich - auch wegen der zutreffenden Genauigkeit vieler Angaben in den Buch, die nur Anatomen bekannt sein dürften - von seiner Authentizität überzeugt.«14. Hier muß schließlich noch der Direktor des Anatomischen Instituts in Greifswald, Prof. Fanghänel, genannt werden. Er bekam - wie Prof. Scharf in seinem Nachruf für Hermann Voss schreibt - am 25.9.1985 einen Brief von Scharf, in dem dieser die Echtheit des Tagebuchs in Frage stellte. Aber Scharfs Argumente machten auf Fanghänel keinen Eindruck. Auch er hat in der Zeitschrift »Humanitas«15 die Authentizität des Voss-Tagebuchs anerkannt. Von Bedeutung ist das Datum der Zusendung des Tagebuchs an Fanghänel - nämlich der 25.9.1985. Damals war Hermann Voss noch am Leben. Er starb am 19.1.1987. Karo! Marian Pospieszalski, Poznan

1 Acta histochemica 90, Nr. 1-3, Jena 1991. 2 Westliche Revue, hg. v. Westinstitut Posen. 3 Z pami^tnika profesora »Reichsuniversität
Posen«, in: Przeglqd Zachodni 1955,Nr. 1-2,
S. 275-298. 4 Ebd., 1956, Nr. 7-8 5 Stefan Rözycki, Parfstwowy Uniwersytet
Niemiecki w Poznanui (Die deutsche staatliche Universität in Posen), in: Nowiny
Lekarskie (Ärztliche Nachrichten) 1945,
Nr. 3-4, S. 1-8 6 Prof. Scharf behauptet außerdem, er habe von Prof. Dom ein maschinengeschriebenes
Tagebuch mit polnischer Einleitung erhalten. Diese Zusammenstellung ist mir unbekannt. 7 Mit den Nazi-Lügen habe ich mich in der
Studie: Die Frage der58.000 Volksdeutschen, »Documenta Occupationis« Bd. VII, Poznan 1959, auseinandergesetzt: der Text erschien 1981 in englischer Sprache. 8 Rudi Goguel, Über die Mitwirkung deutscher Wissenschaftler am Okkupaüonsregi- me in Polen im zweiten Weltkrieg, untersucht an drei Institutionen der deutschen
Ostforschung, phil. Diss. Humboldt-Universität Berlin, 1964 (nur hektographiert). 9 S. taguna, Morderstwa faszystowsk na- jezdzcöw w Poznaniu w okresie II wojny £wiatowej (Morde der faschistischen Okkupanten in Posen), in: Archiwum Medycy- ny Sqdowej i Kriminalistyki, 1951, Nr. 2. 10 F. Jankowiak, W hitlerowskim zakladzie naukowyn. Przyczynek do dziejöw okupacjin
Poznania 1939-1945 (In einer wissenschaftlichen Anstalt der Nazis), in: Kronika miasta
Poznania 1976. 11 Edmund Chrö^cielewski, Collegium Ana- tomicum Uniwersytetu Poznariskiego w czasie okupacji hitlerowskiej. Miqdzyna- rodowa sesja naukowa w Krakowie 25.- 26.4.1985 pt. Wojna i okupacja a medycyna (Internationale Tagung betr. Krieg und Okkupation im Spiegel der Medizin), Akademia
Medyczna w Krakowie, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, materialy 1986.
12 Das Posener Tagebuch des Anatomen Hermann Voss. Erläutert von Götz Aly, in: Beiträge zurnationalsozialistisehen Gesundheitsund Sozialpolitik, Bd. 4 (1987), S. 15-66. 13 Susanne Zimmermann. Was das Tagebuch des Hermann Voss offenbart, in: Sozialistische Universität, Friedrich-Schiller-Univer- sität, Institut für Geschichte der Medizin,
Jena, Nr. 4,5.12.1988.
Jürgen Scholz, Voss - Handlanger der Nazis oder »Wissenschaftler des Volkes«, in: Der
Articulator. Zeitschrift für kritische Zahnmedizin, Nr. 37, 1991. 14 G. Aumüller, die Anatomie in der NS-Zeit.
Von der Verantwortung der Medizin unter dem Nationalsozialismus, hg. von der Fachschaft Medizin der Universität Marburg. 15 J. Fanghänel, H. Sparu, H. Tham, Die Schatten der Vergangenheit. In: Humanitas. Zeitschrift für Medizin und Gesellschaft, Nr. 9,
Berlin/DDR 1988.
D e r » A n a to m d e r G y n ä k o lo g e n «

Hermann Stieve und seine Erkenntnisse über Todesangst und weiblichen Zyklus

Manchmal genügen wenige Sätze, um jenen inneren Warnton anschlagen zu lassen, den die langjährige Beschäftigung mit den bürokratisch organisierten Greueln von NS-Tätern wohl unverm eidlich herausbildet. Sätze, wie sie nun in den frühen Nachkriegsakten aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) auftauchen, die jahrzehntelang in der DDR nicht zugänglich waren: Am 30. November 1946 suchte ich Herrn Professor Dr. Stieve1 auf, der während der Nazijahre als Leiter des anatomischen Instituts die Hingerichteten zur Sektion bekam. Stieve hat, wie er sagte, sich von vornherein geweigert, die Leichen von politisch Verurteilten zu sezieren. Soweit er sie bekam, hat er sie dem Wilmersdorfer Krematorium zur Verbrennung überstellt. Soweit ihm die Namen bekannt geworden sind, hat er darüber Listen angelegt, diese sind je doch verbrannt. Einzig und allein eine Liste der hingerichteten Frauen ist vorhanden, die Stieve mirmitgegeben hat. Diese worin mehreren Exemplaren da, weil Stieve diese Liste fü r seine wissenschaftlichen Untersuchungen gebraucht hat.2 Die Sätze stammen von Harald Poelchau, dem legendären Berliner Gefängnisgeistlichen, der in Berlin-Plötzensee als beamteter Seelsorger zwischen 1934 und 1945 rund eintausend zum Tode Verurteilte vor ihrer Hinrichtung betreute3. Ende 1946 kam er als Vortragender Rat in die Deutsche Zentralverwaltung für Justiz (DJV) in der Sowjetischen Besatzungszone, die unter der Aufsicht der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) in Berlin- Karlshorst stand. Poelchaus Aufgaben umfaßten unter anderem die Sicherung von Akten und Beweismitteln aus den mitteldeutschen Gefängnisverwaltungen, die für spätere Prozesse gegen ehemalige Beamte und NS-Täter gesammelt wurden4. Er wußte durchaus, mit welcher Art von Tätern er umging. Für Stieves Fall allerdings fand er in seinem Vermerk den beruhigenden Satz, er glaube nicht, daß dieser über die Namenslisten der Frauen hinaus Wesentliches zur Auswertung des Materials beitragen könne3. Ob der frühere Gefängnisgeistliche den Anatomen Hermann Stieve schon vor dem zitierten Gespräch im November 1946 kannte, läßt sich nicht sicher sagen. Süeve ist in seiner Eigenschaft als Institutsdirektor mindestens einmal im Strafgefängnis Plötzensee gewesen, und zwar am 23. Oktober 1942 anläßlich einer Besprechung, die die Verlegung der Hinrichtungen in die Abendstunden betraf. In einem Bericht des zuständigen Generalstaatsanwalts ist nachzulesen, wie entschlossen Stieve an diesem Tag die Annahme von Leichen aus Plötzensee »verweigerte«: Professor Stieve war hiermit (der netten Hinrichtungszeit von 20.00 Uhr - B.O.) einverstanden. Ein späterer Zeitpunkt sei fü r das Anatomische Institut aber nicht tragbar, weil sonst die Bearbeitung der Leichen zu Forschungszyvecken sich zu spät in die Nacht hinaus ausdelmen würde, so daß die beteiligten Ärzte nicht mehr mit

den Verkehrsmitteln nach Hause kommen könnten.6
Ohne jeden Zweifel allerdings kannte Harald Poelchau die meisten Frauen, die in der von Stieve übergebenen Liste verzeichnet waren. Es waren Frauen, mit denen er vor ihrem Tod gesprochen und gebetet hatte’.
Viele von ihnen sind uns heute ein Begriff -
Mildred Hamack und Liberias Schulze-
Boysen zum Beispiel, Marianne Baum und
Hildegard Jadamowitz, Elfriede Scholz und
Emmi Zehden und etliche andere, deren
Biographien sich in der Literatur zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus finden8. Ihre Lebensgeschichten bezeugen ein vielfältiges Spektrum von politischen und individuellen Motiven in der Gegnerschaft zur NS-Diktatur, die sich nicht auf einen gemeinsamen ideologischen Nenner bringen lassen. Gemeinsam ist ihnen nur das Ende, das in allen diesen Fällen auf einen staatlichen Mord durch Hinrichtung hinauslief. Und nach diesem Ende - die
Sektion durch Hermann Stieve, den »Anatomen der Gynäkologen«, wie es 1953 in seinem Nachruf hieß. Stieves maschinenschriftliche Liste enthält insgesamt 182 Namen, die fortlaufend numeriert und mit Angaben über das Alter in Jahren, das Geburtsdatum und den Tag der Hinrichtung versehen sind. Sie beginnt mit lückenhaften Vermerken aus den Jahren 1936 und 1937 und reicht bis zum Dezember 1944. Die Namen sind nicht fortlaufend nach den Hinrichtungsdaten aufgeführt, sondern in mehreren Gruppen jeweils alphabetisch geordnet9. Vermutlich stammt die Liste in dieser Form nicht unmittelbar aus der Institutsarbeit vor 1945, sondern wurde erst nach dem Krieg von Stieve anhand seiner wissenschaftlichen Aufzeichnungen rekonstruiert, nachdem die Leichenbücher des Anatomischen Instituts vernichtet worden waren10. Daß sich bei Stieve nach dem Krieg eher eine umfangreiche Liste von weiblichen Namen anfinden würde als eine, die beispielsweise die männlichen Verurteilten des 20. Juli 1944 verzeichnete, wäre spätestens nach einem Blick auf Stieves wissenschaftliche Veröffentlichungen leicht zu vermuten gewesen. Damit haben sich auch die Beiträge schon einmal beschäftigt". Ich selbst stieß vor Jahren auf den Namen Stieves in einer Veröffentlichung des Anthropologen und Psychotherapeuten Rudolf Bilz12. Wie die Veröffentlichungen Stieves zeigen, beruhten diese 1940 publizierten Ergebnisse auf einem langjährigen Studium der menschlichen Keimdrüsentätigkeit und der weiblichen Geschlechtsfunktionen13. Stieve ging es seit den frühen zwanziger Jahren darum, einen organischen Einfluß psychischer Faktoren auf den weiblichen Zyklus nachzuweisen. Damit befand er sich zu seiner Zeit in einer Vorreiterrolle, setzten doch die damaligen Lehrmeinungen über die weibliche Fruchtbarkeit auf vergleichsweise plumpe Modelle des rein biologischen Funktionierens. Stieves Forschungen hingegen belegten, daß die Empfängnisfähigkeit von Frauen durch ein kompliziertes Gleichgewicht von psychischen und physischen Faktoren bestimmt wird14. Seine Befunde waren nicht allein ihrer wissenschaftlichen Exaktheit wegen bahnbrechend. Sehr wesentlich war auch ihre schiere Zahl. Sie stützten sich, um Romeis’ Nachruf auf Stieve zu zitieren, a u f ein Untersuchungs-. gut, wie es in dieser Zahl, Güte und Vollständigkeit bisher noch keinem Forscher zur Verfügung gestanden hatte15. Die von Stieve 1946 an Poelchau übergebene Liste klärt uns darüber auf, wem der Anatom die Zahl, Güte und Vollständigkeit seines Materials verdankte16. Es sind Frauen, deren Abschiedsbriefe sich hier zitieren ließen, etwa der von Hilde Coppi an ihre Mutter. Ich wollte nicht, ohne ein Kind zur Welt gebracht zu haben, sterben. (...) Ich gehe nun zu meinem großen Hans (dem bereits hingerichteten Ehemann Hans Coppi - B.O.). Der kleine Hans hat - so hoffe ich - das Beste von uns als Erbe mitbekommen. (...) Wir haben uns sehr, sehr lieb gehabt.'1 Hilde und Hans Coppi gehörten der weitverzweigten Widerstandsorganisation um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen


an und wurden 1942/1943 hingerichtet18. Der kleine Hans war im Gefängnis geboren worden, neun Monate vor dem Tod seiner Mutter durch das Fallbeil. Aus derselben Gruppe, die von der Gestapo als »Rote Kapelle« bezeichnet wurde und an der auch viele Frauen unmittelbar beteiligt waren, finden sich auf der Liste außer Mildred Harnack, Libertas Schulze-Boysen und Hilde Coppi weitere Namen, so die von Liane Berkowitz, Cato Bontjes van Beek, Ursula Goetze, Ingeborg Kummerow, Rose Schlösinger, Oda Schottmüller und Marie Terwiel, die zum Teil am selben Tag hingerichtet wurden1’. Im Juli 1949 unterrichtete der Medizinprofessor Maxim Zetkin, stellvertretender Leiter der Hauptverwaltung Gesundheitswesen der Deutschen Wirtschaftskommission für die SBZ (DWK), die Deutsche Verwaltung für Volksbildung (DVV) vom Höhepunkt einer jahrelang schwelenden Auseinandersetzung: Professor Stieve habe angekündigt, daß er nicht mehr lesen werde. E r könne nicht mehr in Berlin arbeiten, weil gegen ihn Vorwürfe erhoben würden, als ob er zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten die Leichen von Frauen benutzt habe, die er zuvor im Leben beobachtet habe oder habe beobachten lassen, wissend, daß und wann sie hingerichtet werden würden. Er werde je den verklagen, der solche Behauptungen verbreite.20 In den Universitätsakten Stieves tauchen die genannten Vorwürfe das erste Mal im Frühjahr 1946 auf. Sie gehen auf Zeitungsberichte zurück, in denen Gerüchte über die Anatomie der Friedrich-Wilhelms-Universität eine Rolle spielten. Zu seiner Verteidigung bezifferte Stieve die Anzahl der im Anatomischen Institut angelieferten Leichen auf »nur« 3.000 in rund zehn Jahren, unter denen keine KZ-Opfer gewesen seien.
Diese Einlassung genügte offenbar zunächst.
Einer schon schärferen Attacke sah sich
Stieve dann im November desselben Jahres ausgesetzt. Nach der Veröffentlichung seiner Arbeit über die Wechselbeziehungen zwischen Keimdrüsen und Nebennierenrinde, die offen die Sektionsergebnisse von 421 gesunden Erwachsenen (188 Frauen, 233 Männern) nach einem plötzlichen Tod durch äußere Gewalteinwirkung beschrieben21, verlangte der Leiter der zuständigen Abteilung in der DVV, der MedizinerTheo- dor Brugsch, von Stieve eine Rechtfertigung. Stieve sah keinen Grund, die Herkunft der Leichen zu verschleiern: Es habe sich zum weitaus überwiegenden Teil um Menschen gehandelt, die in der Strafanstalt Plötzensee hingerichtet worden waren. Sie seien jedoch zum Teil ohne Namensnennung und ohne nähere Angaben überwiesen worden. Er selbst habe, dies betont Stieve besonders, in keinem einzigen Fall einen der Hingerichteten vor seinem Tode überhaupt gesehen, geschweige denn untersucht. Vielmehr sei er zu seinen Informationen immer nur nachträglich oder indirekt aus den Gerichtsakten gelangt22. Dadurch hat Stieve jedoch selbst seine in den folgenden Jahren ständig wiederholte Behauptung, er habe selten die Namen, geschweige denn die Delikte der Sezierten gekannt, widerlegt. An anderer Stelle schrieb er: »(...) alle Frauen, die ich zu untersuchen hatte, hatten ganz schwere Verbrechen begangen, sie erwarteten die schwerste Strafe. (...) Gerade diese Unterschiede zeigen, daß fü r die Störungen in der Tätigkeit der Geschlechtsorgane sicher nicht die Veränderungen in der Umgebung oder die Ernährung verantwortlich waren, (...) sondern fü r diese schweren Störungen kommen ausschließlich psychische Einflüsse in Frage: Die Furcht vor schwerster Strafe, die Todesangst.23 Dementsprechend schwankt auch Stieves Verteidigung in dieser Frage ständig zwischen einer vorgeblichen Unwissenheit über alle entsprechenden Zusammenhänge und der forschen Behauptung, er habe gerade in den poliüschen Fällen besondere Pietät bewiesen. Ich habe stets darauf geachtet, daß alle Leichen von politischen Hingerichteten sofort verbrannt wurden. Daß mir dies in vielen Fällen selbstverständlich nicht mög-


lieh war, bedarf keiner besonderen Erklärung, da ich ja, von Ausnahmen abgesehen, nicht erfuhr, was die Betreffenden begangen haben sollten.24
Wie Stieve das, was er angeblich nicht wußte, natürlich doch erfahren hatte, legte er an anderer Stelle wiederum ohne Umschweife dar: Die Angaben überden Gesundheitszustand der Betreffenden erhielt ich durch den Gefdngnisarzt Dr. Schmidt, die Angaben über den Ablauf der Menstruation und über andere Tatsachen durch einige Aufseherinnen im Frauengefängnis Berlin NO 18, BarnimStraße 10, mit denen ich aber niemals selbst verhandelte, sondern durch den Anatomiediener Pachaly, der bei den Hinrichtungen stets zugegen war, verhandeln ließ.25 Von ähnlicher Qualität ist im übrigen die Schilderung, wie Stieve die Annahme der Leichen von Hingerichteten des 20. Juli 1944 verweigerte. An dem Tag, an dem die Verhandlungen gegen die Männer des 20. Juli begonnen hatten, schreibt Stieve darüber im Jahr 1948, sei der Leichenwagen des Anatomischen und anatomisch-biologischen Instituts in die Strafanstalt Plötzensee bestellt worden. Er habe aus der Zeitung erfahren, daß die gerichtliche Verhandlung an diesem Tage stattfand: Ich fragte daraufhin, um was fü r Leichen es sich handele, worauf Freislermirantwortete: »Um die Leichen des 20. Juli«. D arauf sagte ich, daß ich die Leichen nicht abholen lassen würde; wir hätten genug Leichen im Anatomischen und anatomisch-biologischen Institut.26 Ob dies nicht doch eher darauf zurückzuführen war, daß die angekündigten Leichen männlichen Geschlechts waren, muß zumindest gefragt werden. Eingebettet in den bereits erwähnten Widerspruch zwischen vorgeblicher Unkenntnis und behaupteter Pietät, betrieb Stieve seine Verteidigung jedoch in der Hauptsache mit zwei anderen Argumenten. Eins davon war fachlicher, das zweite politischer Natur. Eine politische Verteidigung hatte Stieve zunächst durchaus nötig. Die Behauptung, er habe dem Nationalsozialismus ablehnend gegenübergestanden und sei deswegen schikaniert und behindert worden, hielt den Tatsachen nicht stand. Schon seine 1935 erfolgte Berufung nach Berlin und die ausgedehnte Publikationstätigkeit Stieves in den dreißiger und frühen vierziger Jahren sprachen augenfällig dagegen. Als sich im September 1946 die Berliner Hochschulgruppe der VVN daranmachte, in einem Flugblatt ein Sündenregister Stieves zusammenzustellen, das ihm in erster Linie die Sektion von einigen namentlich genannten hingerichteten Frauen vorwarP, geriet Stieve in einen beträchtlichen Rechtfertigungszwang. Dagegen wehrte er sich nicht nur mit Tatsachenbehauptungen der zitierten Art, sondern mit verschiedenen Mitteln28. Eins davon war der immer wieder vorgebrachte Hinweis, sowjetische Stellen hätten diese Fragen bereits geklärt und ihn von allen Vorwürfen freigesprochen: Außer von russischen sei er von englischen, amerikanischen und französischen Besatzungsbehörden vernommen worden, »des weiteren von je einer Kommission von Tschechen, Belgiern, Holländern und Norwegern. (...) In keinem Fall ist mir irgend ein Vorwurf gemacht worden, wie ja aus der Tatsache hervorgeht, daß ich in Berlin verblieb und keinem R uf an eine andere Universität in der Westzone gefolgt bin«.29 Tatsächlich legten die Universität und die beteiligten Zentralverwaltungen, offenbar im Einvernehmen mit der SMAD in Karlshorst, von Anfang an einigen Wert auf Stieves Bleiben als Leiter der Anatomie. Sein fachlicher Ruf, von dem unten noch einmal zu sprechen sein wird, war unbestritten. Allerdings trübten die Vorwürfe gegen ihn das Bild ein wenig. So bemerkte etwa Zetkin im Juli 1945, als er von den Rücktrittsabsichten Stieves erfuhr, bedauernd: Es ist so gut wie sicher, daß die Anschuldigungen zumindest nicht ganz unbegründet sind. Trotzdem wäre es nicht richtig, Professor Stieve nicht zu halten. Es hieße das, die ganzen Vorkliniker Berlins des anatomischen Unterrichts zu berauben.30 Um ihn zu »halten«, wurde Stieve kurz


darauf in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Damit gehörte er endgültig in die Reihe derjenigen, die eine DDR- Publikation aus dem Jahre 1987 in großzügiger Weise zu den progressiven Kräften beim antifaschistisch-demokratischen Aufbau der wissenschaftlichen Nachkriegslandschaft in Berlin zählte.31 Allerdings gab es zum Zeitpunkt der Akademie-Aufnahme im m er noch das Problem, daß die SMAD in Karlshorst zwei Publikationen Stieves blockierte, weil darin von Hingerichteten die Rede war. Das verstimmte nicht nur Stieve, sondern erforderte auch eine Reaktion der beteiligten Verwaltungen. U nter dem D atum des 12. August 1949 übermittelte der Vizepräsident der DVV Theodor Brugsch Stieve schriftlich einen Vorschlag des künftigen Ministers für Volksbildung32, Paul Wandel, der nach Brugschs Worten zunächst einmal grundsätzlich jedem Anatomen für Lehre und Forschung das Recht zubilligte, Präparate zu untersuchen, die von Hingerichteten stammten. Allerdings müsse dabei beachtet werden, daß Enthauptete im allgemeinen Kriminelle seien. In Stieves Fall liege das Problem nun leider darin, daß die von ihm benutzten Enthaupteten keine Kriminellen gewesen seien.33 Deshalb wünsche sich die Verwaltung für Volksbildung, heißt es in Brugschs Mitteilung, daß Stieve künftig an dieses heikle Thema nicht mehr herangehe und seine Untersuchungsergebnisse nur dann verwende, wenn es sich wirklich um kriminelle
Menschen handele. Hierbei bleibe ihm dann die wissenschaftliche Verwertung in jeder ihm beliebenden Weise unbenommen:
Nur wenn die Anonymität nicht mehr gewahrt ist und man literarisch die Herkunft der Präparate aufdecken kann, erscheint die Publizistik nicht tragbar.34
Indessen muß die Scheinheiligkeit der politischen Argumentation in dieser Sache niemanden überraschen. Zu wichtig war der neuen Führungsspitze im zweiten deutschen Nachkriegsstaat der Versuch, eine international anerkannte medizinische Kapazität wie Stieve an ihrer bedeutendsten Universität zu halten. Das ließ man sich etwas kosten, moralisch wie finanziell. Stieve erhielt die geforderten Publikationsmöglichkeiten, konnte mit einem Interzonenpaß zu wissenschaftlichen Kongressen reisen und wurde nach seiner Emeritierung mit einem überaus großzügigen Vertrag für die Fortführung seiner Lehrtätigkeit entschädigt.35 Aber das Beklemmendste in diesem Weißwaschverfahren scheint mir noch auf einer anderen Ebene zu liegen. Ich selbst habe alle Leichen, die der Anatomie in der Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft überwiesen wurden, seziert und habe mich dabei bemüht, die erhobenen Befunde firm eine wissenschaftlichen Arbeiten und dadurch zum Wohle der Menschheit zu verwerten.36 Daß diese Verwertungen zum Wohle der Menschheit auf dem Prinzip beruhten, das besondere Schreckmoment der Hinrichtungsangst als konstante Variable im Untersuchungsfeld zu nutzen, wird hier mit keinem Wort mehr erwähnt. Stattdessen findet Stieve zu der beiläufigen Formulierung, der Anatom habe mit der Hinrichtung an sich überhaupt nichts zu tun, er versuche lediglich, aus solchen Ereignissen, die zumTrau- rigsten gehören, was die Geschichte der Menschheit überhaupt kenne, noch Befunde zu erheben, die sonst überhaupt nicht zu erheben seien37. Von dieser kühlen Überlegung - jegliche Gefühlsduselei war ihm verhaßt, heißt es im Nachruf über ihn - fuhrt nur ein winziger Schritt zu der aberwitzigen Logik, die seinerzeit an zur Vergasung besümmten KZ- Opfem medizinische Experimente ausführte, weil sie »ohnehin« sterben würden. Und es ist dieselbe Logik, die heutzutage aus dem Gewebe abgestoßener Embryonen Kosmetika herstellt oder sich für die Freigabe anenzephalischer Säuglinge als Organbanken einsetzt. Ich halte diese Logik weder für typisch deutsch noch für historisch überwunden. Sie ist nicht an die geschichtlich eingrenzbaren und darin zweifelsohne singulären


Verbrechen der nationalsozialistischen Gesellschaft gebunden, bei deren Aufdeckung in beiden deutschen Nachkriegsstaaten so viel versäumt wurde. Vielmehr hat sie dazu beigetragen, eine solche Aufdeckung zu verhindern, und damit hat sie, jenseits einer bloßen rhetorischen Abscheu, der ethischen Reflexion darüber den Boden entzogen. Eben ihre unverminderte Virulenz als (Ver- wertungs-)Logik der modernen experimentellen Wissenschaften war es, die nach dem Krieg den Entschuldigungen der Fachleute solche Plausibilität verlieh. Stieve wußte das, und er verließ sich darauf: (...) Wenn jetzt die Anschauung vertreten wird, daß es ein Verbrechen war, die Leichen von Hingerichteten in der Nazizeit zu sezieren, so müßten alle Anatomen Deutschlands und Österreichs wegen der Ausübung ihrer Berufstätigkeit als Verbrecher hingestellt werden.18 Das wäre, in der Tat, die Konsequenz. Brigitte Oleschinski, Berlin
1 Hermann Stieve (22.5.1886-6.9.1952), Prof.
Dr. med. und Dr. phil, beendete seine medizinische Ausbildung 1912 in München und blieb dort bis zu seiner Habilitation 1917
Assistent an der Anatomischen Anstalt der
Universität. 1918 wechselte er als Prorektor nach Leipzig. Den Ersten Weltkrieg hatte er als Stabs- und Oberstabsarzt der Reserve hauptsächlich in München verbracht. Im Mai 1920 schloß er sich einem Freikorps an, ein
Jahr später dem Stahlhelm Bund der Frontsoldaten; zwischen 1919 und 1929 war er
Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei.
ImApril 1921 kam er als ordentlicher Professor der Anatomie an die Universität Halle, wo er im Frühjahr 1933 zum Rektor und zum
Vorsitzenden der Deutschen Rektorenkonferenz gewählt wurde. Aus diesem Amt schied er im November 1933 wieder aus und folgte 1935 einem Ruf an die Friedrich-
Wilhelms-Universität Berlin, der er als Leiter des Anatomischen und anatomisch-biologischen Instituts bis zu seinem Tode ange- hörte. Er war nicht Mitglied der NSDAP, wurde aber 1934 als Mitglied des Stahlhelm automatisch in den NS Frontkämpferbund übernommen. 2 Aktenvermerk Poelchau, DJ VIV A 1663/46, 4.12.1946, BA Potsdam, P-I/Nr. 2 3 Harald Poelchau hatte selbst während der
Kriegsjahre dem Kreisauer Kreis umHelmuth von Moltke und Peter Yorck von Wartenburg angehört. Er bewegte sich in den Berliner
Gefängnissen unter den Verurteilten des 20.
Juli 1944 als ein Eingeweihter, kannte viele der Angehörigen und vermittelte ihnen Nachrichten und Kontakte oft buchstäblich bis zur letzten Minute. Vgl. u.a. Harald Poelchau,
Die letzten Stunden, Berlin 1949.
Ein umfangreiches Kapitel darüber enthält auch meine (in Kürze abzuschließende) Dissertation über die Gefängnisseelsorger im
Dritten Reich. 4 Verschiedene Unterlagen aus der Tätigkeit der DJV haben sich inzwischen im Bundesarchiv Potsdam angefunden. Ich werde darüber Anfang 1992 in der Zeitschrift für Strafvollzug berichten. 5 Aktenvermerk Poelchau, DJV IV A1663/46, 4.12.1946, BA Potsdam, P-l/Nr. 2 6 BA Koblenz, R 22/1317, fol. 141. 7 Poelchau hat solche Begegnungen in Büchern und Artikeln immer wieder eindringlich geschildert. Vgl. zu den nachfolgend genannten Frauen insbesondere Poelchau, Die letzten Stunden, a.a.O. (Anm. 3), S. 155 ff. 8 Mit einigen Vorbehalten kann hier die Bibliographie »Widerstand« von Ulrich Car- tarius, München 1984 empfohlen werden.
Für die seither stark angewachsene Zahl insbesondere von biographischen Veröffentlichungen siehe vor allem die jährlich erscheinenden Bibliographien der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 9 Dabei handelt es sich um insgesamt sieben
Gruppen. Während die ersten vier Gruppen bis 1941 jeweils nur zwei bis sechs Namen umfassen, enthalten die restlichen drei
Gruppen 26 Namen aus dem Jahr 1942, 70
Namen aus dem Jahr 1943 und 71 Namen aus dem Jahr 1944. Dabei treten in der Zuordnung Fehler auf (zum Beispiel ist Ursula
Goetze unter dem Todesdatum des 5. August 1942 statt 1943 aufgeführt). Auch die
Schreibung der Namen stimmt nicht in allen
Fällen; andererseits sind viele schwierige ausländische Namen orthographisch richtig geschrieben. 10 Der Verbleib dieser Leichenbücher läßt sich aus den Personalunterlagen von Stieve im
Archiv der Humboldt-Universität nicht klären. Stieve behauptet, er habe sich bemüht, die Namen von möglichst vielen der Hinge


richteten nachträglich festzustellen. Dies sei ihm bei einer großen Anzahl von Frauen gelungen, bei denen entsprechende Hinweise in seinen wissenschaftlichen Aufzeichnungen Vorgelegen hätten. 11 Vgl. Götz Aly, Das Posener Tagebuch des
Anatomen Hermann Voss, in: Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und
Sozialpolitik, Bd. 4, Berlin 1987 (im folgenden zitiert als Aly, Posener Tagebuch). 12 Rudolf Bilz, Paläoanthropologie. Der neue
Mensch in der Sicht einer Verhaltensforschung, Frankfurt/Main 1971. 13 Vgl. die umfangreiche Bibliographie im Anhang des Nachrufs von B. Romeis, Anatomischer Anzeiger, Heft 23/24,5. August 1953 (im folgenden zitiert als Romeis, Nachruf). 14 Als zutreffend, durchaus nicht »pseudowissenschaftlich« erforscht und international akzeptiert charakterisiert Götz Aly Stieves
Erkenntnisse, die er mittels Menschenexperimenten der widerwärtigsten Art habe gewinnen können. Vgl. Aly, Posener Tagebuch, a.a.O (Anm. 13), S. 61 f. 15 Romeis, Nachruf, a.a.O. (Anm. 13), S. 419. 16 Daß hingegen die Liste nicht vollständig sein kann, geht aus verschiedenen Indizien hervor: Zum einen gibt es eine Differenz zwischen den angegebenen 182 Namen und der in Stieves Publikationen verwendeten Zahl von 188 sezierten Frauen, die plötzlich durch äußere Gewaltanwendung gestorben seien.
Zum zweiten weisen die Hinrichtungslisten aus Plötzensee zu den auf der Liste genannten Daten häufig mehr weibliche Hingerichtete aus, als S tieve sie aufführt. Drittens nennt
Stieve in verschiedenen später verfaßten Verteidigungsschriften auch die Namen von Frauen, die nicht in der Liste enthalten sind, so den
Namen Elisabeth von Thaddens oder Hella
Hirschs. 17 Abgedruckt in: Du hast mich heimgesucht bei Nacht. Abschiedsbriefe und Aufzeichnungen des Widerstandes, hrsg. Helmut Goll- witzer, Käthe Kuhn und Reinhold Schneider,
Gütersloh 1985. 18 Mit der lange einseitig als kommunistisch etikettierten Hamack/Schulze-Boysen-Orga- nisation beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe im bisherigen Zentralinstitut für Geschichte an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften, die in Kürze neuere Ergebnisse publizieren wird. Vgl. dazu Heinrich Scheel,
Die »Rote Kapelle und der 20. Juli 1944, in:
Zeitschrift für Geschichte 1985; ferner auch die umfangreichen Anmerkungen bei Johan
nes Tuchei, Weltanschauliche Motivationen in der Hamack/Schulze-Boysen-Organisa- tion, in: Kirchliche Zeitgeschichte, Heft 21 1988. 19 Eine andere Gruppe, an deren Aktivitäten einige Frauen beteiligt gewesen waren, die sogenannten »Baum-Gruppe«, wurde 1942 wegen eines Anschlags auf die nationalsozialistische Hetzausstellung »Das Sowjetparadies« hingerichtet. Von ihnen verzeichnet die Stieve-Liste Marianne Baum, Hildegard Jadamowitz, Marianne Joachim, Sala
Kochmann und Hildegard Loewy. 20 Zetkin an DVV, 25.7.1949, Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St. 116. 21 Hermann Stieve, Über Wechselbeziehungen zwischen Keimdrüsen und Nebennierenrinde, in: Das Deutsche Gesundheitswesen, Heft 18/1. Jg., 15. September 1946. 22 Stieve an DVV, 28.11.1946, Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St. 116. 23 Hermann Stieve, Der Einfluß des Nervensystems auf Bau und Leistungen der weiblichen
Geschlechtsorgane des Menschen, Leipzig 1942, S. 57 f. (im folgenden zitiert als Stieve,
Einfluß) Romei würdigt in seinem Nachruf auf Stieve dessen Arbeiten tta. wegen der biographischen Angaben über die von ihm untersuchten Frauen: Zur bereits apostrophierten Zahl, Güte und Vollständigkeit des
Untersuchungsgutes komme als überaus wichtige Ergänzung, daß über jedes Individuum auch genaue anamnetische Angaben vorliegen (ibd. (Anm. 13), S. 419). 24 Hier ist die Formulierung begangen hatten von Stieve handschriftlich in begangen haben sollten geändert 25 Stieve an DVV, 16. August 1948, Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St 116. Damit ist freilich die Frage, ob Stieve tatsächlich, wie Götz Aly annimmt erst Untersuchungen an den lebenden Gefangenen vorgenommen hat um dann die toten zu sezieren, noch nicht geklärt. Stieve hat gerade diesen Punkt in seinen Nachkriegsaussagen mit großer Vehe- menz bestritten. 26 Stieve an DVV, 28. November 1946, Archiv der Humboldt-Universität Berlin, St 116. 27 Die Vorwürfe dieses Flugblatts waren allerdings eher von denunziatorischem Eifer als von sachlichen Anhaltspunkten geprägt. Sie machten es Stieve leicht sich in einem vergleichbar denunziatorischen Ton gegen die
Hetz- und Wühltätigkeit der beteiligten Studenten zu verwahren. Dennoch nahm er sie ernst genug, um sie in einer siebzehnseitigen


Rechtfertigungsschrift Punkt für Punkt zu widerlegen. 28 Stieve scheute auch vor Denunziationen nicht zurück. »Diesen unmöglichen Zuständen muß nunmehr ein Ende gesetzt werden, und ich bitte deshalb, daß gegen die beiden Studenten Dieter Alexander und Klaus Flöricke, gegebenenfalls auch gegen die anderen Studenten, die die Wühlarbeit der beiden durch unwahre Angaben fördern, vorgegangen wird.
Menschen, die das Ansehen der Universität in so gemeiner Weise herabsetzen, müssen vom Studium ausgeschlossen werden.« (ibd.) 29 Stieve an DVV, 16.8.1948, Archiv der Humboldt-Universität Berlin, St. 116. 30 Zetkin an DVV, 25.7.1949, Archiv der Humboldt-Universität Berlin, St. 116. 31 Wissenschaft in Berlin. Von den Anfängen bis zum Neubeginn nach 1945, Berlin (Ost) 1987, S. 676. 32 Obwohl die Gründung der DDR offiziell erst einige Wochen später erfolgte, ist in dem
Schreiben bereits von Wandel als Minister für Volksbildung die Rede (Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St 116). 33 Brugsch an Stieve, 12.8.1949, Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St 116. 34 ibd. Die nach dieser grundsätzlichen Erklärung tatsächlich noch verlangten Änderungen waren übrigens minimal. Am 6. September 1949 übermittelte die Hauptverwaltung
Gesundheit Stieve zwei Vorschläge, die einmal die Einfügung des Wortes kriminell vor der Bezeichnung Strafgefangene Frauen in der Neuausgabe des Aufsatzes über den Einfluß des Nervensystems auf die weiblichen
Geschlechtsorgane (1947) forderten und ihn zum anderen baten, aus politischen Gründen in seinem Vortrag Uber Follikelreifung, Gelbkörperbildung und den Zeitpunkt der Befruchtung (1942) den Autor Belonoschkin sowohl aus seiner Argumentation wie aus dem Literaturverzeichnis zu streichen. 35 Archiv der Humboldt-Universität Berlin, St 116. 36 Stieve an SMAD, 22.4.1949, Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St 116. 37 Stieve an DVV, 16. August 1948, Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St 116. 38 Stieve an SMAD, 22.4.1949, Archiv der
Humboldt-Universität Berlin, St 116. D e r F a ll » E r n a V V azinski« - v o n ric h te r lic h e m V e rs a g e n

Von der Festnahme der »Täterin« (Freitag, 20. Oktober 1944, 17.30 Uhr) und ihrer ersten polizeilichen Vernehmung (unterstützt durch brutale Schläge) bis zur Verurteilung »als Volksschädling« zum Tode vergingen nicht einmal neunzehn Stunden. Am Samstag, 21. Oktober 1944, verkündete in einem in der Braunschweiger Untersuchungshaftanstalt provisorisch als Verhandlungssaal hergerichtetem Raum der Sondergerichtsvorsitzende, Landgerichtsdirektor Dr. Walter Lerche, das Todesurteil. Die Hinrichtung erfolgte, nach Wochen qualvollen Wartens, am 23. November 1944 in Wolfenbüttel. Was hatte Erna Wazinski verbrochen? Laut Urteil des Sondergerichts hatte sie in der Nacht zum Sonntag, dem 15. Oktober 1944, gearbeitet-in dem Rüstungsbetrieb, in den sie dienstverpflichtet war. In dieser Nacht ereignete sich der größte Bombenangriff auf Braunschweig. Als Erna W. nach dem Bombenangriff nach Hause kam, fand sie die meisten Häuser in der Langedammstraße, darunter auch das Haus, in dem sie mit ihrer Mutter wohnte, bis auf den Grund abgebrannt vor. Von der Mutter fehlte zunächst jede Spur. Am Tage darauf half Erna W. dem Sondergerichtsurteil zufolge Bewohnern des ebenfalls abgebrannten Nachbarhauses beim Bergen von Gegenständen. Dabei soll sie - nach dem Sondergerichtsurteil - einige fremde Kleidungsund billige Schmuckstücke an sich genommen haben. Die knapp 19jährige Erna Wazinski war nur eines der 516 Opfer, die die Richter der nationalsozialistischen Justiz unter das Fallbeil der Hinrichtungsstätte des Wolfen- bütteler Gefängnisses brachten (die Hinrichtungsstätte ist seit A pril 1990 als Gedenk- und Dokumentationsstätte hergerichtet, vgl. »Der Weg« 1/1990). Auch gibt es unter den Hingerichteten viel prominentere Persönlichkeiten (etwa unter den hin- gerichteten französischen und belgischen Widerstandskämpfern mehrere Professo
ren und Priester). Und doch läßt sich gerade am Beispiel des Todesurteils gegen Erna Wazinski und der Art der Aufarbeitung dieses Urteils nach 1945 viel Aussagekräftiges über den Zustand unserer Justiz und Gesellschaft ableiten.
Bekenntnis zum Unrechtsgesetz

Die Verhängung der Todesstrafe wegen einer Bagatelle, wie sie Erna Wazinski vorgeworfen wurde, ist so grausam und menschenrechtswidrig, daß man annehmen sollte, nach dem Ende des NS-Terrorregi- mes sei das Urteil schleunigst ersatzlos aufgehoben worden. Die Vermutung täuscht. In den Nachkriegsjahrzehnten wehrte sich die Braunschweiger Justiz hartnäckig gegen jeden Versuch, die Verurteilte zu rehabilitieren und das Versagen der Juristen von 1944 festzustellen. Eine »Umwandlung« der (vollstreckten) Todesstrafe in neun Monate Gefängnis war das äußerste Zugeständnis des Landgerichts Braunschweig. In einem Beschluß des Landgerichts vom 7. Oktober 1965 wurde sogar festgestellt, daß die Hitler’sche »Volksschädlingsverordnung« von 1939 nicht als »schlechthin unverbindlich, weil unsittliches« Gesetzesrecht angesehen werden könne. Die Verordnung sei lediglich darauf gerichtet gewesen, dem »durch Kriegswirren« besonders gefährdeten Eigentum Schutz zu verleihen. Hierzu erwähnte das Landgericht als vorbildlich, daß auch während des Vietnam- Krieges mit Billigung der USA für Reisdiebstähle die T odesstrafe eingeführt worden sei. Das war gewissermaßen ein zweites Todesurteil für Erna Wazinski und eine Ehrenerklärung für die Richter des Sondergerichts. Dementsprechend waren auch die Strafanzeigen gegen die Richter des Sondergerichts und die beteiligten Staatsanwälte erfolglos. Schlimmer noch: diejenigen, die »den Dolch unter der Richterrobe verborgen« gehalten hatten (Worte des Nürnberger Juristenurteils) waren zum Teil nach 1945 wieder in der Braunschweiger Justiz tätig. Der als besonders »scharfer« Richter geltende Sondergerichtsvorsitzende Dr. Walter Lerche, stieg sogar zum Oberlandeskirchenrat und damit in einen der höchsten Posten auf, die die Landeskirche nach dem Amt des Landesbischofs zu vergeben hatte.

Eine Chance fü r die Justiz
Im Jahre 1991, mehr als 46 Jahre nach dem Justizverbrechen von 1944, hat sich der Justiz eine neue Chance geboten, sich von dem Unrecht zu distanzieren. Nachdem gewerkschaftlich organisierte Richter den Fall bereits 1980 der Öffentlichkeit vorgestellt hatten, hat sich im Jahr 1989 ein junger Rundfunkredakteur des Falles angenommen. Ihm gelang es, mehrere Zeitzeugen aufzufinden. Im Zusammenhang mit einer ersten Ausstrahlung seines Hörfunk-Features meldete sich schließlich ein weiterer Zeuge, der bei der angeblichen »Tat« und auch bei der Festnahme von Erna Wazinski anwesend war. Nach seiner verläßlichen Schilderung hat Erna Wazinski - mit seiner Hilfe - in den Trümmern lediglich Sachen geborgen, von denen sie vermutete, daß sie ihrer Mutter gehörten. Auch wurde das polizeiliche Geständnis Ernas offensichtlich durch Ohrfeigen oder Faustschläge erzwungen. Nun hätten die Braunschweiger Justizbehörden tätig werden müssen. Doch nichts geschah. Ich habe mich deshalb verpflichtet gesehen, von mir aus ein Wiederaufnahmeverfahren anzuregen. Inzwischen, mit Beschluß vom 20. März 1991, hat das Landgericht Braunschweig das Todesurteil von 1944 aufgehoben und Erna Wazinski wegen der veränderten Beweislage freigesprochen.
Vergangenheitsentsorgung anstelle von Selbstkritik
Manche werden sich fragen: Was soll ein Verfahren, das das Opfer doch nicht mehr zum Leben erwecken kann? In der Tat macht es wenig Sinn, 46 Jahre danach festzustellen, ob jemand einen Koffer mit wenig wertvollen Sachen entwendet oder nur

verwechselt hat. Ungleich bedeutsamer ist die Frage: Ist damals, im Jahre 1944, nicht wirklich ein Verbrechen begangen worden, verübt allerdings nicht von einem 19jähri- gen Mädchen, sondern von den Volljuristen des Sondergerichts? Haben jene Richter - ob sie es nun mit einem kleinen Diebstahl zu tun hatten oder nicht - nicht Rechtsbeugung und Mord begangen? All diesen Fragen, überhaupt jedweder Kritik an dem Sondergerichtsurteil, sind die Richter des Landgerichts geflissentlich aus dem Wege gegangen. Hätten die Richter diese Fragen gestellt und dahingehend beantwortet, daß ihre Vorgänger von 1944 dem Unrecht und nicht dem Recht dienten, hätte dies eine ganz andere Rehabilitierung des Opfers bedeutet als der jetzt ergangene Freispruch lediglich wegen veränderter Tatsachengrundlage, nicht aufgründ revidierter Rechtsauffassung. Mit einer Feststellung der Nichtigkeit des Todesurteils von 1944 und der von den NS-Richtem begangenen Rechtsbeugung hätte das Landgericht sich zugleich zu der Selbstbesinnung und Selbstreinigung der Justiz bekannt, die seit Jahrzehnten überfällig ist.

Richter in eigener Sache
Der Unmut der Richter angesichts der Zumutung, sich mit der NS-Justiz befassen zu müssen, zeigte sich schon im Vorfeld der Entscheidung. Ich hatte die Beiordnung einer Verteidigerin beantragt, vor allem mit der Begründung, daß (außer der sich völlig passiv verhaltenden Staatsanwaltschaft) nur ein Verteidiger durch Rechtsmitteleinlegung auf eine Überprüfung der bevorstehenden Entscheidung hinwirken könne. Trotz der schwierigen Rechtslage verneinte die Strafkammer aber zunächst jeden Bedarf an der Mitwirkung eines Rechtsanwalts. Damit wollten die Richtereine Überprüfung ihrer Entscheidung in einer weiteren Instanz verhindern. Das Landgericht verkannte die Verfahrenslage so gründlich, daß sich schließlich der Generalstaatsanwalt einschalten mußte. In dem Bestreben, den Fall möglichst geräuschlos und ungestört zu erledigen, verlegte sich die Kammer nun auf eine ungewöhnliche Verteidigerauswahl: gemeldet hatte sich (überdies unter Verzicht auf Gebühren) meine Ehefrau (in ihrer Funktion als Rechtsanwältin), die seit Jahren sowohl mit dem Fall Erna Wazinski als auch mit den Problemen der NS-Sondcrgerichtsbarkeit vertraut ist. Das Landgericht lehnte sie wegen »Befangenheit« mit der Begründung ab, sie habe sich »schon zu lange mit der Sache befaßt«. Bei dem stattdessen bestellten Rechtsanwalt bestand diese Gefahr in der Tat nicht. Er hatte sich bislang weder mit dem Fall Erna Wazinski noch überhaupt mit der NS- Justiz beschäftigt. Sein Engagement beschränkte sich darauf, genau den Antrag zu stellen, der den Richtern in das Konzept paßte. Er erklärte, ihm sei an einer Nichtigkeitserklärung des sondergerichtlichen Urteils nicht gelegen.
Zweierlei Maß - Richter als Verteidiger der NS-Juristen
Der - bei einem Verteidiger ohnehin absurde - Befangenheitsvorwurf muß an die Richter der Strafkammer zurückgegeben werden: ähnlich wie der Sondergerichtsvorsitzende Dr. Walter Lerche, nimmt der Vorsitzende der heutigen Strafkammer, Gerhard Eckels, eine hohe Funktion in der Landeskirche wahr: er ist Präsident der Landessynode der Kirche. Als Richter hatte er nur insoweit in eigener Sache zu entscheiden, als die Kirche und mit ihr die Landessynode mit der Abwehr der Anträge kritischer Christen befaßt sind, die Kirche möge sich von dem einst von ihr so gepriesenen Sondergerichtsvorsitzenden und Oberlandeskirchenrat Lerche distanzieren. Hierzu kann sich die Kirchenleitung aber nicht überwinden. Die Feststellung, daß dem Sondergericht im Jahre 1944 nicht bloß ein (verzeihlicher) Irrtum unterlaufen war, sondern daß es unter Leitung von Dr. Lerche ein mörderisches Terrorurteil gefällt hatte, hätte den Vorwürfen gegen Dr. Lerche Auftrieb gegeben. Hier liegt wohl die Erklärung dafür, daß die Strafkammer jedwe-

des Unwerturteil über das Sondergericht vermeiden wollte. Das Sondergericht Braunschweig hat unter dem Vorsitz von Dr. Lerche mindestens fünfzehn weitere Todesurteile gefällt, überwiegend wegen lächerlich geringfügiger Diebstähle, begangen meist aus Not, zum Beispiel von unterernährten französischen und italienischen Zwangsarbeitem. In ihrem im landeskirchlichen Amtsblatt von 1962 abgedruckten Nachruf auf Dr. Lerche gedachte die Braunschweiger Kirchenregierung ihrem treuen Mitarbeiter »in Dankbarkeit und herzlicher Verehrung«, und es hieß darin: »Das Gedenken an Oberlandeskirchenrat Dr. jur. Lerche wird uns allen ein gesegnetes bleiben.« Es handelt sich nur scheinbar um Vorgänge, mit denen wir nichts mehr zu tun haben. Es geht vielmehr auch um die Justiz von heute, um die Frage, mit welchem juristischen Handwerkszeug und mit welchem Verfassungsverständnis Richter ihr Amt versehen. Deshalb sind Entscheidungen, wie die des Landgerichts Braunschweig vom 20. März 1991 im Fall Erna Wazinski auch innerhalb der Richterschaft nicht unumstritten. Gerade unter den jüngeren Juristen gibt es viele, die die Frage nach den Ursachen für das Versagen der Richter im Dritten Reich zu kritischer Selbstprüfung gebracht hat. Die in der Gewerkschaft ÖTV organisierten Richter und Staatsanwälte haben bei der Deutschen Richterakademie regelmäßige Fortbildungstagungen zur NS-Justiz durchgesetzt. Diese vom niedersächsischen Justizministerium ausgerichteten Tagungen sind ständig ausgebucht. Die Akte Erna Wazinski haben die Richter des Landgerichts Braunschweig mit ihrem trickreichen Vorgehen wieder schließen können. Die Aufgabe der Bewältigung der Justizvergangenheit kann damit noch längst nicht zu den Akten gelegt werden.
Helmut Kramer, Wolfsbüttel
K o lla b o r a tio n u n d E x k u lp a tio n

Gerhard Hirschfeld und Patrick Marsh (Hrsg.): »Kollaboration in Frankreich. Politik, Wirtschaft und Kultur während der nationalsozialistischen Besatzung 19401944«; aus dem Englischen von Hans Günter Holl; S. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 1991; 351 S., 4 6 - DM
Man fragt sich stets aufs Neue, nach welchen Kriterien die deutschen Verlage zeitgeschichtliche Literatur auf den Markt bringen. Da veröffentlicht der S. Fischer Verlag, dessen Lektorat sich immerhin um eine ganze Taschenbuchreihe zur Geschichte des Nationalsozialismus verdient gemacht hat, einen aus dem Englischen übersetzten Sammelband über »Kollaboration in Frankreich«, während die vorliegenden französischen und englischen Standardwerke zu diesem Thema (Serge Klarsfeld, Marrus/Paxton, Alan S. Milward, Robert S. Paxton) in Deutschland beharrlich übersehen werden. Hinzu kommt die beklagenswerte Tatsache, daß die westdeutsche Geschichtswissenschaft nur wenig relevante Arbeiten über die deutsche Okkupation in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges zustande gebracht und insbesondere die »Endlösung der Judenfrage« in Frankreich überhaupt nicht erforscht hat. Stattdessen spekuliert auch die vorliegende Veröffentlichung wohl auf die exkulpatorische Wirkung, die das Thema »Kollaboration« hierzulande ausübt: Die Bereitschaft, mit der »40 Millionen Petainisten« (Amouroux) im Jahre 1940 die deutsche Besatzungsherrschaft hin- nahmen und mit der sich große Teile der französischen Gesellschaft dem Nationalsozialismus verschrieben, scheint die Frage nach den Besatzern und ihren Verbrechen überflüssig zu machen, zumal sich das Bild einer relativ moderaten Verwaltung des besetzten Frankreich hartnäckig hält. In

die gleiche Richtung soll offenbar wirken, daß uns Veröffentlichungen zum Thema der Kollaboration - wie jetzt wieder in dem Klappentext des angezeigten Buches - als Bruch eines in Frankreich angeblich jahrzehntelang gehegten »politischen und gesellschaftlichen Tabus« angekündigt werden. Es ist mir unerfindlich, wie eine so markant plazierte Buchveröffentlichung, die in ihrem Untertitel die »Politik, Wirtschaft und Kultur während der nationalsozialistischen Besatzung 1940-1944« zu behandeln verspricht, die entscheidenden Aspekte der deutsch-französischen Kollaboration unberücksichtigt lassen kann. Weder findet sich ein Beitrag, der zumindest den Forschungsstand zur Geschichte der »Endlösung der Judenfrage« in Frankreich zusammenfassen würde, noch erfährt der Leser etwas Genaueres über Art und Umfang der Rekrutierung französischer Zwangsarbeiter für die deutsche Kriegswirtschaft; die sog. »Arisierung jüdischen Vermögens« wird ebensowenig zum Thema gemacht wie die Verflechtung deutschen und französischen Kapitals oder die Neuordnung der industriellen Beziehungen und des Arbeitsmarktes in Frankreich im Hinblick auf die geplante nationalsozialistische Großraumordnung. Als sei Kollaboration ein Thema nur für Franzosen, beleuchten die Autoren dieses Bandes nicht die Bedingungen der deutschen Okkupation, sondern die Anpassungsbereitschaft einzelner Kreise der französischen Gesellschaft während der Besatzungszeit, wobei die Alltags- oderGe- sellschaftsgeschichte der Kollaboration (so wie sie Henri Amouroux zu schreiben versucht hat) weitgehend ausgeklamm ert bleibt. Der Schwerpunkt des Sammelbandes liegt, mit Aufsätzen zur Kunst, Film- und Theaterarbeit und zur Literatur, auf kulturellem Gebiet. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn nicht Titel und Anspruch des Bandes auf eine breitere Thematik verweisen würden. Diese Erwartung wird vor allem durch die knappe, aber sehr gelungene Einführung von Gerhard Hirschfeld geweckt. Hirschfeld spricht alle wichtigen Fragen und Forschungsdesiderate an; er schlägt zurecht eine Erweiterung und Differenzierung des Begriffs Kollaboration vor und verweist auch auf die Übergänge zwischen Kollaboration und Widerstand. Im Anschluß an die neuere Literatur geht er davon aus, daß die Kollaboration Vichys die verbrecherischen Konsequenzen der deutschen Besatzungsherrschaft in Frankreich, vor allem bei den Maßnahmen gegen Juden, eher verstärkt als abgemildert hat. Der erste Teil des Bandes enthält Aufsätze von D. Pryce-Jones über das besetzte Paris, von H.R. Kedward und P.J. Kingston über das Vichy-Regime und seine Ideologen, von W.D. Halls über die Haltung der französischen Christen und von M. Margairaz über die ökonomische Kollaboration. Die journalistische Skizze von David Pryce- Jones beschäftigt sich unter anderem mit der Judenverfolgung. Richtigerweise wird die »Judenfrage« als Prüfstein der Kollaboration bezeichnet. Gerade bei diesem Thema erweist sich aber, daß das Buch nicht nur nicht auf dem Stand der Forschung ist; es handelt sich hier um eine oberflächliche und konfuse Darstellung, die voller Ungenauigkeiten steckt. Die beiden Studien von Kedward über Philippe Henriot und dessen gegen die Resistance gerichtete Radiopropaganda und von Kingston über die ultrakollaborationi- stischen Gruppierungen um Doriot, Deat und Darnand machen den Band informativ; sie können stellvertretend für eine fehlende Analyse des Vichy-Apparates und der Widersprüche innerhalb des Lagers der Kollaboration gelesen werden. Der Beitrag des französischen Wirtschaftshistorikers Margairaz, der einem größeren Zusammenhang entnommen zu sein scheint, vermittelt leider nur einen unklaren Überblick über die Kollaboration auf ökonomischem Gebiet. Gegenüber der grundlegenden Arbeit von Alan S. Milward (The New Order and the French Economy, 1970) bietet er wenig Neues, zumal überwiegend Fragen der Wirtschaftsorganisation behandelt bzw. die verschiedenen Etappen der


Wirtschaftspolitik Vichys dargestellt werden. Der interessanteste Aspekt wird von Mar- gairaz leider nicht beleuchtet: Würde man dem von ihm zitierten Satz des Finanzministers Bouthillier aus dem Jahr 1941 weiter nachgehen, »das Land könne durch soziale Unruhen in jenes Chaos geraten, das es trotz der militärischen Niederlage verhindert hätte« (S. 109), dann ließe sich vielleicht der Kern der ökonomischen Neuordnung im Innern freilegen und die Kollaboration als eine Fortführung der Klassenkämpfe in Frankreich seit den 30er Jahren verstehen. Ein zweiter Teil von Beiträgen geht auf kulturelle Aspekte ein. Einige dieser Beiträge sind sehr anregend, aber sie stehen doch eher in einem sekundären Zusammenhang zum Thema des Buches. Sarah Wilsons Aufsatz über die »Kollaboration in den schönen Künsten« enthält trotz interessanter Einzelheiten keine eigentliche These; die Autorin widmet sich vorrangig dem Einfluß des Bildhauers Arno Breker auf die Pariser Kunstszene. D er Filmhistoriker Roy Armes hat eine Darstellung der »Französischen Filmarbeit unter der Besatzung« beigesteuert, die ebenfalls aufschlußreiche Details bietet. Der Autor kommt zu dem überraschenden Ergebnis, daß die französischen Spielfilme jener Jahre weitgehend frei von Propaganda gewesen seien. Die Erklärung allerdings, die er dafür anbietet, daß nämlich das Medium Film von jeher keine engen Beziehungen zum Staat unterhalten habe, daß es sich um Unterhaltungskino handelte und daß das Filmemachen als ein kollektiver Vorgang weniger beeinflußbar gewesen sei, erscheint mir nicht überzeugend. Der Beitrag des Mitherausgebers Patrick Marsh über das Theater beschreibt einmal mehr die Blüte des Pariser Theaterlebens während der Okkupationszeit und bringt eher amüsante Beispiele der Theaterzensur, die über Kollaboration wenig besagen. Nebenbei bemerkt: Der Ausschluß von Jüdinnen und Juden aus den künstlerischen Theaterberufen begann nicht erst mit dem Gesetz vom 6. Juni 1942, wie Marsh darstellt, sondern - was jedenfalls die staatlich subventionierten Theater betraf - bereits mit dem sog. Judenstatut der Vichy-Regierung vom 3. Oktober 1940. Schließlich sei auf Colin Nettelbecks Essay über Celine und auf Nicholas Hewitts Studie über Marcel Aym6 hingewiesen. Nettelbecks zusammenfassendes Urteil widersetzt sich jedem Rechtfertigungsversuch: »Daß Celine ein künstlerischer Revolutionär war, entschuldigt jedoch nicht eine reaktionäre, rassistische politische Haltung; man verzeiht C61ine auch nicht seinen Antisemitismus, nur weil er ein großer Schriftsteller war.« (S. 211) Dies kluge Urteil hinterläßt den Leser ratlos, zumal der konstatierte Widerspruch zwischen der ästhetischen Seite, der Innovation der Sprache und des Romangenres durch Celine einerseits und seinem fanatischen Antisemitismus andererseits, der alles in den Schatten stellt, was sonst an Judenfeindlichkeit des Vichy-Regimes zutage trat, von Nettelbeck noch zugespitzt wird: er vermutet nämlich, daß Celines Fremdenhaß derselben Quelle entstammte wie seine sprachliche Innovation (ebd.). Letztlich trägt dieser Aufsatz jedoch wenig zum Buchthema bei. Und dies gilt in noch größerem Maße für die darauffolgende literaturkritische Analyse Margarete Zimmermanns, die den Romanen Brasillachs gewidmet ist, während eine Untersuchung der Arbeit des Journalisten Brasillach und der von ihm redigierten kollaborationistischen Wochenzeitung »Je suis partout« in diesem Zusammenhang vielleicht aufschlußreicher gewesen wäre. Nicholas Hewitt versucht dagegen in seinem Beitrag über »Marcel Ayme und die dunkle Nacht der Besatzung«, der die Ambiguität der Romane Aymes - insbesondere auch der unmittelbar nach der Befreiung Frankreichs geschriebenen Romane - herausstellt, die literarische Form der Kollaboration in Zusammenhang mit der Realität der Besatzung zu bringen - so etwa in einem Exkurs über die Kollaboration und den (von den Deutschen kontrollierten) Schwarzmarkt. Der Sammelband schließt mit einem Aus


blick in das Nachkriegsfrankreich. In Michael Kellys Skizze über »Das Gespenst der
Kollaboration im apris-guerre«, der wiederum überwiegend die Behandlung der
Kollaboration in der Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit zum Gegenstand hat, wird das Jahr 1947 mit der Rückkehr kolla- borationistischer Kräfte in die Politik als
Wendepunkt begriffen. Die weiteren Etappen der Normalisierung werden in Colin Nettelbecks Schlußbeitrag angedeutet. Dessen Titel (»Kurskorrektur: Die Darstellung des Zweiten Weltkriegs in Frankreich ab 1968«) ist irreführend, insofern gerade nicht nur die Zeit nach 1968 berücksichtigt wird; der Beitrag erscheint unstrukturiert, wissenschaftliche Literatur, Romane und Filme werden einbezogen; das durchgehende Interesse Nettelbecks aber gilt dem »gaullistischen Geschichtsmythos« der 50er und 60er Jahre, dem um die Resistance geschmiedeten nationalen Konsens, und seiner Auflösung nach 1968 - und mit dieser Thematik gehört der Aufsatz zu den lohnendsten des ganzen Sammelbandes. Akzeptiert man den überwiegend kulturgeschichtlichen Ansatzpunkt, dann kann das Buch von Hirschfeld und Marsh mit einigem Gewinn gelesen werden. Dem Leser wird gewissermaßen ein Nebeneinstieg in die Geschichte der Kollaboration geboten, und zusammengenommen vermitteln ihm die Beiträge ein recht anschauliches Panorama der französischen Gesellschaft während der Zeit der deutschen Besatzung. Die offenkundigen Mängel des Bandes liegen nicht nur in der Themenbegrenzung; vor allem die zahlreichen Irrtümer und Ungenauigkeiten der Darstellung sind ärgerlich, sie lassen die Kompetenz mancher Autoren in Zweifel ziehen und auf ein mangelndes Lektorat schließen. Jedenfalls dürften sie nicht der von Hans Günter Holl besorgten Übersetzung allein anzulasten sein, die sich über weite Teile hinweg vorzüglich liest. Ahlrich Meyer, Bochum Mechthild Rössler, »Wissenschaft und Lebensraum«. Geographische Ostforschung im Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur Disziplingeschichte der Geographie, Berlin/Hamburg 1990 (= Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte Bd 8); 288 S., 3 9 - DM

Die Geographin Mechthild Rössler ist in den letzten Jahren mehrmals mit Aufsätzen und Vorträgen zur Rolle der Geographie in den Jahren 1933-45 hervorgetreten. Hier liegt nun ihre Dissertation zum Gesamtkomplex der geographischen Ostforschung und ihrer Funktion im Rahmen des deutschen Kolonisationsprogrammes vor. Ausgehend von wissenschaftstheoretischen Überlegungen stellt Rössler den Verlauf der pragmatischen Anpassung der wichtigsten geographischen Forschungseinrichtungen an die deutschen Kriegsziele und die zunehmende Verflechtung von Forschungsinstitutionen und Machtapparat dar. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehört gewiß der Nachweis, daß trotz der Aussonderung jüdischer und kritischer/lin- ker Wissenschaftler von einem personellen oder thematischen Bruch um 1933 in der geographischen Ostforschung, ja in den Geowissenschaften insgesamt, keine Rede sein kann. Schon in der Weimarer Republik standen die Geographen in ihrer überwältigenden Mehrheit, zumal wenn sie sich mit dem europäischen Osten befaßten, der »Le- bensraum«-Programmatik, also der Idee einer Gebietserweiterung nach Osten, sehr nahe. Die territorialen Expansionspläne boten in der Folgezeit eine ganze Reihe von Arbeits- und Eingriffsmöglichkeiten, die von einigen Protagonisten durchaus als solche begriffen und für einen Zentralisie- rungs- und Professionalisierungsschub genutzt wurden. Dies um so mehr, als die Geographie als Schulfach wie auch als Hochschuldisziplin eine deutliche Aufwertung erfuhr. Sie sollte den neuen Machthabern als »Vorreiterin einer neuen Wissenschaftskonzeption« dienen. (S.33)

Zentrales Thema der expansiv ausgerichteten deutschen Geographie war seit langem der B egriff des »L ebensraum es«, den
Friedrich Ratzel um 1900 in die Politische
Geographie eingeführt hatte. Anfangs z.T. mit außereuropäisch-kolonialer Konnota- tion verwendet, verengte (oder präzisierte) sich das »Lebensraum «-Konzept nach dem
Scheitern der deutschen Kolonialaspirationen im Jahre 1917/18 au f den Zugewinn von benachbarten Territorien im europäischen Osten. Im Nationalsozialism us wurde, wie Rössler zeigt, dieses K onzept mit der »älteren« ökonom isch-im perialistischen Zielsetzung verknüpft und ab 1938/ 39 direkt umgesetzt. Die deutschen G eographen hatten an diesem Prozeß m aßgeblichen Anteil, sowohl im Sinne einer ideologisch-propagandistischen Popularisierung des Territorialprogramms, als auch im Sinne einer Mitarbeit in Forschungsinstituten, deren Aufgabe in der theoretisch-pragm atischen Grundlegung und der unm ittelbaren
Vorbereitung der Siedlungspolitik in den unterworfenen G ebieten bestand. D abei gelang den Fachw issenschaftlem selbst die
Einbeziehung des R assengedankens (und, was Rössler übersieht, des eugenischen) mühelos; im A pril 1938 definierte man: »Als geschlossener deutscher Volksboden wird angesehen: das deutsche Volkstum zu 90 % unter Ausschluß der Juden.« (s.S. 66) Im Verlaufe des K rieges w urde die »R aum wissenschaft« w eiter ausgebaut, zum Teil bestanden m ehrere konkurrierende Forschungsstellen nebeneinander. R össler teilt die von ihr untersuchten sieben Institute ein nach: in erster Linie forschungsorientierten (Sektion Landeskunde am EDO, geographische Abteilung an der »R eichsuniversität Posen, Volksdeutsche Forschungsgem einschaften), direkt planenden (RA G , RKF, DAF) und explizit m ilitärischen (Sonderbeauftragter für die erd k u n d lich e F o rschung im R eichsforschungsrat). D iese Aufteilung leuchtet angesichts der engen Verbindungen zum B eispiel des ID O und der Reichsuniversität Posen m it d er jew eiligen Administration nicht recht ein. Als eines der zentralen Forschungs- und Planungsparadigm en stellt R össler die
C hristallersche Theorie der »zentralen
Orte« fest, und dies bei so unterschiedlichen Organisationen wie der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumordnung und dem
Reichskom missar für die Festigung deutschen Volkstums. Das mathematisch orientierte, quantifizierende Modell Walter Chri- stallers wurde in abgewandelter Form zur
Blaupause für die gesamte Siedlungspolitik in den »eingegliederten Ostgebieten«. Als
Vorlage bzw. Paradigma für die Kolonisierung neuer/»neuerschlossener« Gebiete erfreut es sich im übrigen bis heute einiger Beliebtheit. Eine gewisse Schwäche von Rösslers Studie besteht darin, daß die Rezeption des Christaller-Modells in den Arbeiten der Sektion Landeskunde am IDO übersehen wurde; die Darstellung der Tätigkeit und der Bedeutung von Hans Graul als Leiter dieser Sektion und darüber hinaus als Verbindungsmann zwischen administrativer Raum ordnung und institutioneller Raum planung und -forschung im Generalgouvernem ent orientiert sich zu sehr an den Ä ußerungen Grauls aus jüngeren Tagen. W esentlich kritischer behandelt die Autorin die autobiografischen Äußerungen Konrad M eyers, des Chefs der Hauptabteilung Planung und Boden beim RKF, bei dem - in nicht untypischer Ämterhäufung - »alle K om petenzen ... versammelt« waren, die die Bevölkerungs- und Siedlungspolitik im »neuen Ostraum« betrafen. (S. 166) Rössler zeigt darüber hinaus, daß und wie das Chri- staller-M odell (zu dessen eindrucksvoller Biographie hier einiges interessantes Material vorgestellt wird) in modifizierter Form in die Siedlungskonzeption des »Generalplans Ost« einging. D ie Stärke der Studie liegt in der genauen institutionsgeschichtlichen Darstellung der Entwicklung von Raumordnung und -pla- nung in den Jahren 1933-45, ohne daß hierbei die personellen und institutioneilen Kontinuitäten in die Bundesrepublik hinein vergessen würden. Diese sind in der Tat eindrucksvoll: Rössler betont, daß nur »einige wenige G eographen... aus sehr unterschiedlichen G ründen aus der Wissen-


schaftiergemeinde ausgegrenzt« wurden. (S. 209) Wie z.B. Walter Christaller wegen seiner Mitgliedschaft in der KPD nach dem Kriege.
Michael G. Esch, Düsseldorf
Z w a n g s s te rilis a tio n im N a tio n a ls o z ia lis m u s
Die Überlieferung von Akten der Erbgesundheitsgerichte ist überaus uneinheitlich und zersplittert. Zwar sind überraschend häufig personenbezogene Akten erhalten geblieben, sie befinden sich aber nur zum
Teil in staatlichen oder städtischen Archiven. 1 Nicht selten befanden sich die Akten, insbesondere die der ersten Instanz, bis in die achtziger Jahre hinein noch in den Gebäuden von Gesundheitsämtern und Gerichten.
Die 1991 erschienene Monographie von
Monika Daum und Hans-Ulrich Deppe »Zwangssterilisationen in Frankfurt am
Main 1933-1945« basiert auf einem erst 1983 durch informelle Hinweise entdeckten Bestand des Erbgesundheitsgerichts
Frankfurt, der bis dahin in den Kellern des
Stadtgesundheitsamts Frankfurt langsam aber sicher verrottete. Der inzwischen im
Stadtarchiv Frankfurt archivierte Bestand umfaßt (neben Akten mit allgemeinem
Schriftverkehr) personenbezogene Akten, die sich auf 2 828 Menschen beziehen, gegen die in Frankfurt ein Verfahren mit dem Ziel der Zwangssterilisation eingeleitet wurde. Hiervon zogen die Autoren je doch nur 282 Akten für eine nähere EDV- Auswertung heran. Dieses grundsätzlich zulässige, aber im vorliegenden Fall von insgesamt nur 2 838 Personen nicht ganz einsichtige Verfahren führte dazu, daß der Untersuchungszeitraum (entgegen dem Buchtitel!) bereits 1939 beendet wird, weil die Stichprobe für die darauf folgenden Jahre nicht ausreichend Material enthält. Ausgewertet wurden Sozialdaten wie Alter, Familienstand, Anzahl der Kinder, Religion, Staatsangehörigkeit, Schulbildung, Berufsausbildung und Stellung im Erwerbsleben. Die Sozialslruktur der in Frankfurt zwangssterilisierten Menschen wird dadurch erkennbar. Da die gewonnenen Ergebnisse allerdings nicht mit der Sozialstruktur der Gesamtbevölkerung Frankfurts verglichen wurden, können die Autoren nur recht vage Thesen vorlegen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses habe »alle Bevölkerungsgruppen« betroffen, »wenn auch verstärkt Personen in unterer sozialer Stellung« (S. 106). Über einfache Häufigkeitsauszählungen der erfaßten Variablen, die bestenfalls nach Männern und Frauen getrennt sind, kommt die EDV-Auswertung leider nicht hinaus. Spannend wäre zum Beispiel ein Vergleich der Variablen »Schulbildung« mit der Sterilisationsdiagnose »Angeborener Schwachsinn« gewesen. In den vielen Kreuztabellen des Buches werden durchweg unsinnige Prozentangaben verwendet, die sich jeweils nicht auf die Spalte, sondern auf das Gesamtzahl von 282 Personen der Stichprobe beziehen. Dieser Fehler wird dann teilweise im Text weitergeführt (S. 119). Dies führt dann zu so hanebüchenen Aussagen wie: »Es wird deutlich, daß in der Mehrheit der Fälle (30 Prozent) das EOG (Erbgesundheitsobergericht, d.V.) den Beschluß des EG (Erbgesundheitsgericht, d.V.) bekräftigte« (S.122). Tatsächlich hatte jedoch das Erbgesundheitsobergericht 67 von 73 Beschwerden gegen das Urteil der ersten Instanz abgewiesen, also nicht weniger als 86,3 Prozent der Beschwerden. Der eigentliche Wert der Untersuchung liegt in der genauen Darstellung und Analyse des bürokratischen Ablaufs des Zwangssterilisationsverfahrens. Die Autoren weisen nach, daß man sich bei der Erfassung der »Erbkranken« vor allem auf den alten Behördenapparat des Stadtgesundheitsamtes und vor allem des Frankfurter Fürsorgeamtes stützte. Wer Fürsorgeleistungen bezog, lief unmittelbar Gefahr, sterilisiert zu werden. Das Stadtgesundheitsamt Frankfurt durchforstete in den dreißiger Jahren sogar zwanzigtausend bereits abgeschlos


sene Altakten des Fürsorgeamtes nach »Erbkranken« (S. 49). Schon 1934/35 wurden Dienststellen des Fürsorgeamtes wie Krüppelfürsorgc, Trinkerfürsorge, Wandererfürsorge und Pflegeamt in die Räume des Stadlgcsundheitsamts verlegt, um die »gesundheitsfürsorgerischen Maßnahmen« besser in Angriff nehmen zu können. Die Zusammenarbeit funktionierte: Allein die Abteilung Trinkerfürsorge erstattete im Berichtsjahr 1934/35 126 Anzeigen mit dem Ziel der Zwangssterilisation (S. 56). Die Auswertung der 282 herangezogenen Fälle ergab, daß immerhin 45,5 Prozent der in Frankfurt zwangssterilisierten Menschen zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits in Anstalten lebten (S. 100). Nur knapp 30 Prozent der Zwangssterilisierten galten als »uneingeschränkt geschäftsfähig«, die anderen waren entmündigt, noch minderjährig bzw. unter Pflegschaft gestellt. Immerhin 44 Prozent der in Frankfurt Zwangssterilisierten waren unter eine spezielle »Pflegschaft« des Erbgesundheitsgerichts gestellt worden, um das Verfahren möglichst reibungslos durchfuhren zu können (S. 116). Wichtig ist schließlich der Nachweis, daß nur knapp 38 Prozent der Betroffenen bei den Verhandlungen vor dem Frankfurter Erbgesundheitsgericht überhaupt anwesend waren. Die Sterilisationsurteile wurden also in der überwiegenden Mehrzahl nach Aktenlage gefällt, ohne daß die Richter die Betroffenen je zu Gesicht bekamen. Aus der Tatsache, daß das Frankfurter Erbgesundheitsgericht jeden fünften Sterilisationsantrag ablehnte, was deutlich überdem Reichsdurchschnitt liegt, schließen Monika Daum und Hans-Ulrich Deppe etwas vorschnell, daß das Frankfurter Erbgesundheitsgericht »nicht zu den eifrigsten Sterilisationsgerichten zählte« (S. 120). Ein sicherer Beweis wäre hier erst der Vergleich der Sterilisationsquoten verschiedener Großstädte bezogen auf die Zahl derjenigen, die überhaupt von einer Zwangssterilisation bedroht waren. Spannend liest sich das Buch in den Abschnitten, in denen die Reaktionen der Betroffenen geschildert werden und deren zum Teil vehementer, wenn auch individuell gebliebener Widerstand ausführlich dokumentiert wird. Ebenfalls 1991 erschien die Druckfassung einer bereits 1986vonder Universität Ham- burg angenommenen Dissertation von Christiane Rothmaler. Die Autorin untersuchte die Tätigkeit des Erbgesundheitsgerichts Hamburg und die Durchführung des Erbgesundheitsgesetzes in der Hansestadt. Für die Untersuchung wurde eine Zehn-Prozent-Stichprobe der über sechstausend erhaltenen Akten von Hamburger Bürgern ausgewertet, gegen die ein Sterilisationsverfahren eingeleitet wurde. Darüber hinaus wurden Archivalien insbesondere des Staatsarchivs Hamburg und des Bundesarchivs herangezogen. Christiane Rothmaler durchleuchtet systematisch die Erbgesundheitsverfahren von den Anzeigen über die Antragstellung und die Verhandlung vor dem Erbgesundheitsgerichten bis zur Durchführung der Zwangssterilisation. Auf allen Ebenen der Untersuchung gelingt es der Autorin, ihre Ergebnisse quantitativ zu belegen. Obwohl Rothmaler auf einen im Prinzip gleichen Quellenbestand wie die oben besprochene Frankfurter Untersuchung zurückgriff, analysierte sie den Aktenbestand und insbesondere die Gutachten und Urteile sehr viel tiefer. Die Autorin stellte sich der Herausforderung, aus den Aktenangaben auf die soziale Stellung der Probanden zu schließen. Von 391 zuordbaren Fällen stammten 173 aus Arbeitermilieu, 30 aus bäuerlichem Milieu und immerhin 109 aus dem »Subproletariat«. Knapp 80 Prozent der Probanden der Stichprobe konnten so der unteren Unterschicht bzw. der Unterschicht zugeordnet werden (S. 24). Das zentrale Ergebnis der Untersuchung ist der am Beispiel Hamburg konkretisierte Nachweis des sozialrassistischen Kerns der Zwangssterilisationen. Die Autorin zeigt schlüssig auf, daß das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ein Kampfgesetz gegen die Unterschichten war. Rothmaler qualifiziert das Gesetz als eine »sozialtech


nische Maßnahme«, die in erster Linie gegen untere Bevölkerungsschichten gerichtet war (S. 173). Besonders mit den Anzeigen wegen »angeborenem Schwachsinn« und schwerem Alkoholismus« wurde eine gezielte soziale Ausmerze betrieben. Christiane Rothmaler gelingt es, die enge Verbindung der Sozialpolitik mit der Sterilisationspraxis zu enthüllen. Die Autorin zeigt, wie aus der medizinischen Diagnose »erbkrank« im Laufe der Jahre immer deutlicher eine soziale Diagnose wurde. Die zeitliche Dynamik der Praxis der Zwangssterilisationen wurde bisher noch nie so deutlich herausgearbeitet. Der Anteil der Unterschichten an den in Hamburg zwangssterilisierten Menschen wurde Jahr für Jahr größer (S. 217). Die Bereitschaft zu sterilisieren nahm zwar im Laufe der Jahre insgesamt deutlich ab, nahm jedoch dort zu, »wo es um die Ausmerze sozial unliebsamer Gruppen ging« (S. 217). In den Jahren 1940 bis 1943 wurden in Hamburg drei Viertel aller Sterilisationsbeschlüsse mit »Schwachsinn« bzw. »moralischem Schwachsinn« begründet, der Passepartout-Begründung zur Sterilisation aller sozial unangepaßten Menschen. Zwei Drittel der Anzeigen gegen »Erbkranke« kamen direkt aus Hamburger Behörden, nur etwa 30 Prozent der Anzeigen erstattete die freie Ärzteschaft. Meldungen aus der Bevölkerung kamen dagegen nur selten vor (S. 63). Rothmaler weist auf die erhebliche Rolle der Berichte der Fürsorgerinnen bei den Zwangssterilisationen hin (S.78). Die Fürsorgeakte war in den Sterilisationsverfahren die am häufigsten herangezogene Akte, selbst Krankengeschichten wurden weniger oft verwendet. Fürsorgeberichte gingen zum Teil wörtlich in die Sterilisationsbeschlüsse ein. »Subjektive Meinungen, die in einem anderen Kontext geäußert wurden, Gerede, Hörensagen, nachbarlicher Tratsch werden zu »Wissenschaft« umfunktioniert, indem man sie in die eigentlichen Gutachten einbezieht. Es gibt nicht mehr einen ärztlichen Gutachter oder erbbiologische Spezialisten wie Erbgesundheitsgerichtsbeisitzer, sondern viele kleine »Untergutachter«, die ganze »Volksgemeinschaft« wird zur Be- und Verurteilung durch »Fachautoritäten« aufgerufen.« (S. 89). Einen anderen Weg ging Horst Biesold in seiner bereits 1988 veröffentlichten Dissertation mit dem Titel »Klagende Hände«. Das Buch wurde bereits im Band 8 der »Beiträge« ausführlich besprochen. Horst Biesold ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Gehörlosenlehrer tätig und hat in jahrelanger Kleinarbeit nicht weniger als 1 215 während des Nationalsozialismus zwangssterilisierte gehörlose Menschen befragt. »Erbliche Taubheit« war im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ausdrücklich als Sterilisationsgrund aufgeführt; die Gehörlosen gerieten deswegen als Gesamtgruppe in unmittelbare Gefahr, sterilisiert zu werden. Biesold kann das Ausmaß der direkten Gewalt bei den Zwangssterilisationen quantifizieren. Immerhin 393 von 1 215 Befragten gaben an, zwangsweise von der Polizei oder anderen Behörden zur Durchführung der Sterilisation in Kliniken geschleppt worden zu sein. Dem Autor gelingt es immer wieder, die medizinische Absurdität der Zwangssterilisationen aufzuzeigen. So wurde 1940 in Kiel ein Familienvater, der bereits sechs nicht taube Kinder gezeugt hatte, mit der Diagnose »erblicheTaubheit« zwangssterilisiert. Bei 57 von 662 Frauen wurde zusammen mit der Zwangssterilisation eine Zwangsabtreibung durchgeführt, die bei mehr als der Hälfte der Frauen nach dem vierten Schwangerschaftsmonat vorgenommen wurde. Ausführlich wird die Mitwirkung der deutschen Gehörlosenpädagogik an den »rassenhygienischen Maßnahmen« beschrieben. Häufig meldeten die Schulleiter von Taubstummenschulen ihre Schüler (auch ehemalige!) an die Erbgesundheitsgerichte. In einem eigenen Kapitel werden die gesundheitlichen Spätfolgen der Sterilisation geschildert. Mehr als die Hälfte der Befragten gab körperliche Schmerzen an. »Seelische Schmerzen« verneinten nur vier Prozent der Befragten. Trotzdem haben nur


knapp 21 Prozent der 1 215 Befragten Anträge auf Entschädigung im Rahmen der »Wiedergutmachung« gestellt. Ausführlich schildert Biesold die langjährigen Auseinandersetzungen im Bundestag um die Entschädigung von Zwangssterilisierten. Horst Biesold berichtet von erheblichen Schwierigkeiten an die Akten heranzukommen, die meist noch in Gehörlosenschulen lagern. In ein er- leider ungenannt gebliebenen - Schule wurden wenige Tage vor dem angekündigten Besuch des Forschers die Schülerakten aus der Zeit des Nationalsozialismus vernichtet. Die schwierige Quellenlage wurde durch Dokumente, die dem Verfasser aus Privatbesitz von verfolgten Gehörlosen zur Verfügung gesteht wurden, teilweise ausgeglichen. Nicht zuletzt deswegen hat sich der biographische Ansatz als vorteilhaft erwiesen, weil der Autor erst dadurch auf besondere Verfolgungsstrategien aufmerksam gemacht wurde. Zu den spezifischen Schwierigkeiten der Untersuchung gehörte, daß die Interviews in der Deutschen Gebärdensprache durchgeführt werden mußten. Bei einem Forschungsvorhaben über Spätfolgen der Zwangssterilisation und einer Gebärdensprache, die schon den Begriff »Psyche« nicht mehr kennt, sind das nur sehr schwer zu überwindende Hindernisse. Abschließend sei auf die in den letzten Jahren erschienenen autobiographischen Berichte von zwangssterilisierten Menschen hingewiesen. Bereits 1985 erschien unter dem Pseudonym Elisabeth Claasen und dem Titel »Ich, die Steri« der eindrucksvolle Lebensbericht einer 1940 im Alter von dreißig Jahren nach einem Psychiatrieaufenthalt zwangsweise sterilisierten Frau. Unter dem Titel »Ich klage an« veröffentlichte der in Detmold ansässige Bund der » E u thanasie«-G eschädigten und Zwangssterilisierten 1989 eine kleine Broschüre mit Lebensberichten zwangssterilisierter Menschen. Aus den Berichten wird deutlich, daß eine gegen den eigenen Willen durchgeführte Sterilisation sowie die erzwungene Kinderlosigkeit ein lebenslanges Trauma bleiben.

Monika Daum/Hans-Ulrich Deppe, Zwangssterilis a tio n in Fra n kfu rt am Main 1933-1945, Campus Verlag: Frankfurt/New York 1991,199 Seiten, D M 2 8 ,Christiane Rothmaler, Sterilisation nach dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« vom 14. J u l i 1933. Ein e Untersuchung zur Tätigkeit des Erbgesundheitsgerichtes und zur Durchführung des Gesetzes in Hamburg in der Z eit zwischen 1934 und 1944. Matthiesen Verla g : Husum 1991 (= Abhandlungen zurGeschichte d e r Medizin und d e r Naturwissenschaften Heft 60), 2 6 7 Seiten, D M 78,H o rst Bie sold , Klagende Hände. Betroffenheit und Spätfolgen in bezug a u f das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, dargestellt am B e isp ie l d e r »Taubstummen«, Ja r ic k Oberbiel V erla g : Sols-O berbie l 1988, 304 Seiten, D M 64,80. E lisabeth Claasen, Ich, die Steri, PsychiatrieVerla g: Rehburg-Loccum 1985, D M 8,80. B u n d d e r »E u th a n a sie e - G e sc h ä d ig te n und Zwangssterilisierten (H rsg .) , Ic h klage an. Tatsachen- und Erlebnisberichte d e r »Euthanasie•Geschädigten und Zwangssterilisierten, Detmold 1989.
Wolfgang Ayaß, Kassel
1 Für die staatlichen Archive vgl. Heinz
Boberach (Bearb.), Inventar archivalischer
Quellen des NS-Staates. Die Überlieferung von Behörden und Enrichtungen des Reichs, der Länder und der NSDAP. Teil 1: Reichszentralbehörden, regionale Behörden und wissenschaftliche Hochschulen für die zehn westdeutschen Länder sowie Berlin, Mün- chen/London//New York/Paris 1991, S. 240- 242.
D ie fe m in istisc h e T ä te rin n e n d is k u s s io n ?
Lerke Gravenhorst, Carmen Tatschmurat (Hg.), TöchterFragen. NS-Frauen Geschichte & Forum Frauenforschung Bd. 5. Schriftenreihe der Sektion Frauenforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Kore-Verlag Freiburg 1990, 414 Seiten, 46,- DM

Im Januar 1990 fand in Würzburg ein Symposion mit dem Titel »Beteiligung und Widerstand. Them atisierungen des N ationalsozialismus in der neueren Frauenforschung« statt, ausgerichtet von der Frauenakademie München, der Friedrich-Ebert-
Stiftung (Würzburg) und dem Deutschen
Jugendinstitut (München). Beiträge von
Teilnehmerinnen dieses Symposions und eine Reihe weiterer Aufsätze werden in dem vorliegenden Buch präsentiert, das die Herausgeberinnen in drei Abschnitte unterteilt haben. Die Beiträge des ersten Teils befassen sich mit der bisherigen Frauenforschung zum Nationalsozialismus und beziehen Stellung zu der seit einigen Jahren geführten Debatte um die Täterinnen im
Nationalsozialismus. Im Zweiten Teil sind eine Reihe von Einzelstudien versammelt, die ausgewählte Aspekte weiblicher Existenz im Nationalsozialismus untersuchen. (Auto-) biographische Notizen sind Gegenstand des dritten Teils.
Für diejenigen Leserinnen, denen die feministische Täterinnendiskussion neu ist, bietet der erste Teil des Buches einen Überblick über verschiedene diesbezügliche
Positionen. W ährend die profilierten NS-
Forscherinnen Dagmar Reese und Carola
Sachse in einem gemeinsamen Beitrag behaupten, die »Frage nach Beteiligung und
Widerstand durchläuft die Forschung zum
Thema Frauen und Nationalsozialismus wie ein roter Faden« (S. 73), kritisieren andere Autorinnen die mangelnde Themati- sierung der aktiven und passiven Beteiligung von Frauen an nationalsozialistischer
Politik in der Frauenforschung. Angesprochen wird z.B. das Problem, weibliche Geschichtsforschung als Identifikationsstiftung zu betreiben, ferner die Tendenz, die
Frauen als solche als Opfer nationalsozialistischer Politik darzustellen. Daß Handlungen von Frauen, sofern es um Beteiligung geht, mit Anpassung erklärt werden, kritisieren ebenfalls m ehrere Sozialw issen- schaftlerinnen. Über die Kritik an der bisherigen Frauenforschung hinaus werden von einigen Autorinnen Thesen zur Beteiligung oder Täterschaft von Frauen vertreten, die einerseits wiederum grundlegende Fragen feministischer Paradigmenbildung betreffen und andererseits erneut Zugänge zur Tälerinnen- forschung verschütten. Ein Problem besteht beim Ansatz von Lerke Gravenhorst darin, daß sie nach der »Schuld der Gruppe der
Frauen« fragt (S. 31); ähnlich argumentiert
Windaus-Walser, die ein Konzept der »Täterinnenschaft eigener Art von Frauen« entwickeln will (S. 69). A uf diese Weise wird wiederum das Geschlecht zur zentralen
Kategorie erklärt, werden Unterschiede zwischen Frauen negiert. Vor allem jedoch verhindern diese Herangehensweisen die tatsächliche Analyse der Beteiligung von
Frauen, indem sie konkrete Taten in einen abstrakten Gruppenschuldbegriff auflösen.
Ein Grundproblem des ersten Teils dieses
Buches besteht denn auch darin, daß die meisten Autorinnen sich auf empirische
Fakten kaum beziehen. Statt nach jew eiligen Handlungen bestimmter und bestimmbarer Frauen und den mit ihnen verbundenen Interessen zu fragen, werden psycholo- gisierende Mutmaßungen verlautbart:
Gravenhorst etwa schreibt, daß an den überwiegend von Männern in die Welt gebrachten NS-Verbrechen Frauen u. a. deshalb ihren Anteil gehabt hätten, weil »in die
Bildungsprozesse der Persönlichkeit von
Töchtern (...) so viel M ännliches ein- (geflossen)« sei (S. 35). Windaus-Walser will die »Macht der Mütter« thematisieren (S. 69) und Claudia Bernardoni räsonniert, daß die patriarchalische Unterdrückung bei
Frauen Unterlegenheitsgefühle erzeuge, die die deutschen Frauen während des NS auf die Juden hätten projizieren können.
A uf andere Weise wird die Täterinnenforschung verhindert durch die Ausführungen von Carola Sachse und Dagmar Reese. Sie beharren darauf, die Taten von Frauen grundsätzlich am patriarchalischen Geschlechterverhältnis zu messen und übersehen dabei, daß Handlungen und Interessen von Frauen sich nicht allein aus derZugehö- rigkeit zum weiblichen Geschlecht bestimmen. In diesem Sinne wenden sich die Autorinnen dagegen, die Frauen, die als Für-


sorgerinnen, K rankenschwestern, Ä rztinnen und KZ-Aufseherinnen an der nazistischen Sterilisations- und Vemichtungspoli- tik beteiligt waren, als verantwortliche Täterinnen zu benennen, da dabei »die Beurteilung der Befindlichkeit, der Handlungsspielräume und der Verantwortungsmöglichkeiten von Frauen« unberücksichtigt bleibe (S. 74). Wenn sie dann schreiben, daß die Handlungsmöglichkeiten der in den Sozialberufen Tätigen außerdem von der 1933 erfolgten Eliminierung der dem okratischeren Linien der Eugenik geprägt worden seien, fallen sie w eit hinter die Forschungsergebnisse etw a Gisela Bocks zurück, die nachgewiesen hat, daß die Euge- niker jeglicher Couleur sich in ihren wesentlichen B estim m ungen einig w aren. Schließlich behaupten die Forscherinnen, daß Täterinnen und O pfer deshalb nicht eindeutig zu unterscheiden seien, weil Häftlinge der Konzentrationslager auch untereinander gewalttätig agiert hätten. Damit werfen Reese und Sachse Sachverhalte durcheinander, die zu trennen Grundlage jeglicher Forschung zum Nationalsozialismus ist, und betreiben eine Reinwaschung nazistischer Täterinnen, die ihresgleichen sucht.
Differenzierte Ergebnisse versprechen die im zweiten Teil des Buches versammelten
Einzelstudien, die die Herausgeberinnen unter dem Obertitel: »Beteiligung, Schuld,
Verantwortung« präsentieren. In den vorliegenden Beiträgen geht es jedoch überwiegend nicht um konkrete Taten oder politische Überzeugungen, mittels derer Frauen oder Frauenorganisationen etwa an sexistischer oder rassistischer Politik beteiligt waren. Bearbeitet werden stattdessen beispielsweise die weiblichen Lebensentwürfe einer »Alten Kämpferin« oder der Repräsentantinnen des illegalen BDMs in Österreich vor 1938 anhand von (psychoanaly- tisch-tiefenhermeneutischen) Textinterpretationen. Andere Studien stellen Karrieremöglichkeiten für Frauen im Bildungswesen vor (Studentinnen in W ien und Nationalpolitische Erziehungsanstalten für
Mädchen), ohne nach den mit diesen Aufstiegsm öglichkeiten verbundenen Handlungen zu fragen; so werden »Osteinsätze« lediglich erwähnt statt thematisiert. Hingewiesen werden soll allerdings noch auf zwei interessante Aufsätze. Ursula Nienhaus untersucht die Entwicklung der Frauenarbeit bei der Post zwischen 1933-45, wobei sie auch nach der Beteiligung von Frauen am Staatsbetrieb Post fragt. Sie schildert z.B. das frauenpolitische Engagem ent einer Postbeamtin, die einerseits die Öffnung der gehobenen Beamtenlaufbahn für Frauen forderte und andererseits die Entlassung unehelicher Mütter aus dem Postdienst mit bevölkerungspolitischen und berufsständischen Argumentationen durchzusetzen versuchte. Über dieses konkrete Beispiel hinaus trifft sie allgemeine Aussagen etwa über Beamtinnen, die kriegswichtige Telefonleitungen bedienten, mittels Abhören denunzierten oder untergebene Frauen - darunter Zwangsarbeiterinnen - kontrollierten. Bemerkenswert ist außerdem der Beitrag von Elke Reining, vor allem deshalb, weil ihre Untersuchung wenigstens zu einem kleinen Teil die ebenfalls im vorliegenden Buch enthaltenen Ausführungen Hil- traud Schmidt-Waldherrs widerlegt; deren apologetische D arstellung der Em anzipationsbestrebungen bürgerlich-liberaler Frauen bedürfte einer ausführlichen Kritik. Reining analysiert die Kontinuität des hausw irtschaftlichen P flichtunterrichts für Volksschulabsolventinnen in Bremen als ein Beispiel dafür, »weshalb nationalsozialistische Politik bestimmte ideologische Traditionen der bürgerlichen Frauenbewegung übernehmen« konnte. (S. 290) Die 1920 in Brem en eingeführte Hauswirtschaftliche Pflichtberufsfortbildungsschule war vorbereitet, gefordert und konzipiert worden von der bürgerlichen Frauenbewegung Bremens, insbesondere deren Repräsentantin Agnes Heineken, die sich in bezug auf bürgerliche Mädchen für (Bildungs-) Chancengleichheit einsetzte und für Arbeitertöchter hauswirtschaftliche Erziehung propagierte. Ziel und Funktion dieser Pflichtschule, die eine berufsqualifizierende Ausbildung erschwerte oder unmöglich


machte, war nicht allein die Erziehung zu geregelter und unbezahlter Reproduktionsarbeit sondern auch eine arbeitsmarktpolitische Steuerung. Sie diente »als ein Mosaik- steinchen« (S. 289) der Stabilisierung der geschlechtsspezifischen Arbeitsplatz- und Branchenstruktur in der Industrie und sollte außerdem Frauen in haus- und landwirtschaftliche Stellen zwingen. Während die Lehrerin Agnes Heineken 1933 entlassen wurde, wurde die von ihr entwickelte Schulkonzeption samt ihren Inhalten übernommen. Damit sind die lesenswerten Beiträge dieses Buches benannt; der dritte Teil könnte auch den Titel »Der NS und ich« tragen. Gegenstand sind überwiegend Aufsätze, in denen deutsche Sozialwissenschaftlerin- nen von ihrer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus anhand ihrer eigenen Biographie erzählen und über ihre eigene Betroffenheit lamentieren. Die einzelnen Widerwärtigkeiten dieser Ich-bezogenen Befmdlichkeitsschreibe sollen hier nicht ausgebreitet werden; auf die handfesten politischen Positionen, die bei Lerke Gravenhorst bei dieser Nabelschau zutagetreten, ist allerdings noch hinzuweisen. In ihrem Aufsatz mit dem Titel: »Die Wunde Nationalsozialismus und die Sozialwissenschaft als therapeutisches Milieu oder; Der lange Weg zu einem lösenden Sprechen« berichtet sie von ihrer »Verwundung durch den NS« (S. 373), die darin bestehe, daß ihr Vater »für einen führenden Mann des NS-Staates gearbeitet« habe. (S. 373) Auf Seite 377 heißt es dann: »Am Ende des Studiums erwies sich das Thema meiner Diplomarbeit als eine hoch verschlüsselte Benennung meines Problems NS. Zunächst einmal machte ich den Versuch, über Probleme obdachloser Männer zu schreiben. Sie standen in meiner - wirklich sehr subjektiven - Wahrnehmung für die Probleme sozial zerstörter und persönlich-moralisch diskreditierter Männer, der Gruppe, zu der ich meinen Vater zählte. Diese eher intuitive, aber doch bewußte Assoziation hat mich auch später nicht verlassen.«
Insa Meinen, Oldenburg Claudia Koonz: Mütter im Vaterland. Frauen im Dritten Reich. Freiburg. Kore Verlag 1991, 570 Seiten, 50 DM

Bereits die 1986 erschienene Originalausgabe von Claudia Koonzs Buch »Mütter im Vaterland« löste in der Bundesrepublik unter Feministinnen und Historikerinnen heftige Kontroversen aus. Waren Frauen in der Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus bis in die 70er Jahre kein Thema, so rückten sie ab Anfang der 80er Jahre primär als Opfer nationalsozialistischer (Männer-) Politik in das Blickfeld des Interesses. Im Zentrum dieser Opferthese standen allerdings nicht die von Vernichtung und Verfolgung betroffenen Frauen, wie Jüdinnen, Roma und Sinti, Prostituierte, als »asozial« und »minderwertig« Stigmatisierte und Osteuropäerinnen, sondern deutsche Frauen, die ihre in der Weimarer Republik erkämpften Rechte wieder abgeben mußten, als »Gebärmaschinen« degradiert und in der Rüstungsindustrie vemutzt wurden. Claudia Koonz geht von anderen Prämissen aus. Ihr Interesse richtet sich auf die erklärten Nationalsozialistinnen und die Reaktion konfessioneller und bürgerlicher Frauenorganisationen auf den Nationalsozialismus. Sie will versuchen, »das Verhalten der Frauen vor dem Hintergrund konkreter zeit- spezifischer, regionaler oder organisationspolitischer Gegebenheiten zu erklären« (S. 17). Das Material für diese Recherche gewinnt sie primär aus diversen kirchlichen und städtischen Archiven, Dokumente über die Nationalsozialistinnen vor 1933 sind überwiegend der Sammlung von Theodor Abel entnommen, der 1936 einen Aufsatzwettbewerb mit dem Thema: »Warum ich vor 1933 der NSDAP beigetreten bin« veranstaltete. Im Gesamteindruck belegen diese Materialien auf eindrucksvolle Weise, daß die Herausbildung eines frauenpolitischen Kurses innerhalb des nationalsozialistischen Machtapparates sich nicht gradlinig vollzog und von parteipoliti-

sehen Kämpfen innerhalb der Frauenorganisationen begleitet wurde. Dieses Faktum ist deshalb besonders zu betonen, weil sich die Fachhistorie über Jahrzehnte hinweg einig war, daß es in Bezug auf »die Frauen« im Nationalsozialismus außer einer rückständigen »Heim und Herd« Ideologie - die von »den Frauen« zudem begeistert aufgenommen worden sei - nichts zu berichten gäbe. Speziell die Aussagen der Nationalsozialistinnen in den 20er Jahren zeichnen ein Bild jenseits jeglicher »Heimchen am Herd« Ideologie. Die Frauen aus der sog. Kampfzeit der nationalsozialistischen Bewegung begriffen diese für sich als Chance, sowohl der nationalen Sache gegen den Kommunismus zu dienen als auch der Eroberung einer autarken weiblichen Sphäre unter weiblicher Regie. Anders als bei den männlichen Nationalsozialisten, die nach 1933 mit Posten innerhalb der Bürokratie oder Partei versorgt wurden, machte sich ihr Engagement nicht bezahlt, sie wurden in die Bedeutungslosigkeit abgeschoben und durch gemäßigte Nationalsozialistinnen ersetzt. Der frauenpolitische Kurs wurde im Nationalsozialismus von Männern gesetzt und von loyalen dienstbeflissenen Nationalsozialistinnen durchgesetzt. So spannend und materialreich Claudia Koonz die Auseinandersetzung zwischen Frauenorganisationen und dem nationalsozialistischen Staat bzw. der NSDAP beschreibt und durch umfangreiche Zitate belegt, so problematisch sind ihre Interpretationen dieses Materials. Auch wenn Claudia Koonz im Vorwort zur deutschen Ausgabe, in Anlehnung an die Täterinnen - Opfer- Debatte, noch einmal betont, daß »die in den Archiven enthaltenen Unterlagen über die Aktivitäten von Frauen (...) jede Behauptung von einem passiven, unschuldigen Part der Frauen widerlegen)« (S. 18) und ihr Buch dazu beitragen möge, »Aka- demikerinnen und politisch aktive Frauen gleichermaßen dagegen (zu) immunisieren (...), mit »Weiblichkeit« Politik zu machen oder das, was Frauen tun, zu substantialisie- ren« (S. 36), so wenig hält sie dieses selbstgesetzte Postulat in ihrer Untersuchung durch. Wer sich mit weiblicher Sozialgeschichte beschäftigt, hat zugestandener Maßen immer das Problem, Herrschaftsstrukturen vor ihrem patriarchalen Hintergrund zu interpretieren, ohne dabei aus dem strukturellen Opferstatus der Frau automatisch auf ein Bewußtsein von patriarchaler Herrschaft schließen zu können, das den Handlungsmotiven der einzelnen Frauen zugrundeliegen würde. Die Erkenntnis, daß alle Frauen tendenziell Opfer patriarchaler Herrschaftsstrukturen sind, darf daher in der historischen Forschung nicht dazu führen, reale gesellschaftliche Unterschiede zu negieren, Frauen als homogene Masse zu betrachten und ihren Handlungen das Wissen von diesem Opferstatus zu unterstellen. Diesen Fehler begeht Claudia Koonz, indem sie von ihrem Untersuchungssubjekt, überwiegend Mittelschichtsfrauen wie sie selbst anm erkt, auf Frauen überhaupt schließt. So ließen sich »die Frauen« nach Koonz »weder von materieller Not noch von einer entschiedenen weiblichen Führung oder gar Kriegsbegeisterung dazu treiben, massenhaft in die Rüstungsindustrie zu gehen.« (S. 435) Der Zwang zur Lohnarbeit wurde im Nationalsozialismus auch für Frauen nicht aufgehoben, die durchgängige Erwerbstätigenquote von über 30% und die verschärften Arbeitsgesetze ab 1939, denen auch arbeitsbuchpflichtige Frauen unterstanden, belegen dies. Mittelschichtsffauen besaßen in der Regel jedoch kein Arbeitsbuch und waren außerdem von materiellen Zwängen verschont. Diese mangelnde Differenzierung, für die sich etliche weitere Beispiele aufführen lassen, geben bereits erforschte Teilbereiche nationalsozialistischer (Frauen-)Politik falsch wieder. Weit gravierender ist jedoch, daß Claudia Koonz ihren U ntersuchungssubjekten Handlungsmotivationen unterstellt, die durch die Recherche nicht belegt sind. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: »Rückblickend mag man sich fragen, warum die katholischen und evangelischen Frauen ihre Organisationen nicht zu einem wirksa-


men Widerstand nutzten. Der Irrtum der Katholikinnen bestand darin, daß sie im Konkordat eine Absicherung gegen Übergriffe des Staates sahen und der festen Überzeugung waren, sie könnten den Konkurrenzkampf zwischen Kirche und Staat für sich entscheiden«. (S. 342) Aus ihrer eigenen Recherche über die konfessionellen Frauenorganisationen geht eindeutig hervor, daß sich diese Frauenverbände die Frage eines wirkungsvollen Widerstands nicht stellten, da sie zunächst das nationale In-teresse gegen den vermeintlich drohenden Kommunismus verteidigten, sich umstandslos von konvertierten Jüdinnen trennten und sich auch nicht inhaltlich um Form und Ausgestaltung von wohlfahrtspflegerischen Aufgaben mit den Nationalsozialisten stritten, sondern darum, unter wessen Regie diese Arbeit stehen sollte; Dieser Widerspruch zwischen ausgebreitetem Archivmaterial und Interpretationen machen die Lektüre von »Mütter im Vaterland« schwerfällig und ärgerlich, decken doch die Interpretationen wieder zu,-was das Material aufdeckt. Eine Untersuchung, die sich vomimmt, die Handlungen von Täterinnen, Denunziantinnen und Mitläuferinnen zu beschreiben, muß diese dann auch als Subjekte ernst nehmen, d.h. diesen Handelnden auch den entsprechenden Willen unterstellen und nicht »Irrtüm er«, »Mißverständnisse« etc. für ihre Handlungen verantwortlich machen. Die banale Erkenntnis, daß es Unterschiede zwischen reichen und armen, rechten und linken Frauen gibt, und daß diese Unterschiede den Handlungsrahmen für Frauen abgeben, muß sich in der Frauengeschichtsschreibung (leider) erst noch durchsetzen. Auch wenn es richtig ist, daß alle Frauen Opfer patriarchalischer Herrschaft sind, macht dieses Faktum nicht alle Frauen gleich und darf bei einem Thema wie die Erforschung des Geschlechterverhältnisses im Nationalsozialismus nicht dazu führen, die Konturen zwischen Täterinnen und Opfern und zwischen M itläuferinnen und Widerstandskämpferinnen zu verwischen.

Karin Bekaan, Oldenburg