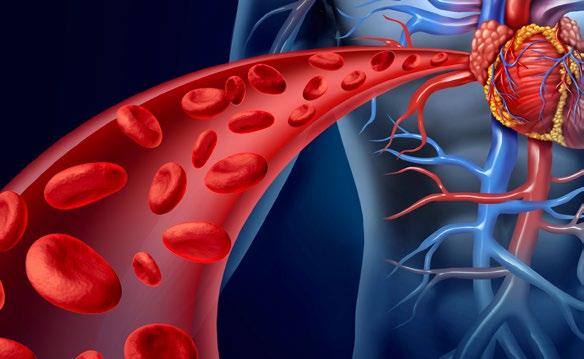
10 minute read
Blutdrucksenker

TEIL 4: SCHMERZMITTEL
SERIE Serie Medikamente, Teil 3:
Blutdrucksenker
Bluthochdruck (Hypertonie) zählt zu den Zivilisationskrankheiten und damit zu den Folgen unseres modernen Lebensstils. Dr. Jens Freese stellt das Krankheitsbild vor und beschreibt die Wirkungen und Nebenwirkungen von blutdrucksenkenden Medikamenten.
DR. RER. NAT. JENS FREESE

Der Autor ist Leiter der Dr. FREESE Akademie und des Dr. FREESE Instituts für Sport- und Ernährungsimmunologie. www.dr-freese.com B etrug die Zahl der Menschen mit systolischen Blutdruckwerten > 140 mmHg im Jahr 2015 weltweit rund 950 Millionen, werden
Hochrechnungen zufolge 2025 etwa 1,5
Milliarden Menschen von Hypertonie betroffen sein, so die alarmierende Einschätzung von Professor Felix Mahfoud vom Universitätsklinikum des Saarlandes auf der Jahrestagung 2019 der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie e.V.
In Deutschland ist jeder dritte Erwachsene Hypertoniker; das entspricht etwa 25 bis 30 Millionen Menschen. Im Alter zwischen 70 und 79 Jahren sind drei von vier Menschen betroffen. Bluthochdruck, in der Fachsprache „arterielle Hypertonie“ genannt, gilt als der zentrale Risikofaktor für den Killer Nr. 1 in unserer Gesellschaft: Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der
Blutdruck steigt, wenn sich die Gefäße dauerhaft verengen. Ab einem oberen (systolischen) Wert von 140 mm Quecksilbersäule (Hg) und/oder einem unteren (diastolischen) Wert von 90 mmHg spricht man medizinisch von Bluthochdruck.
Experten weltweit sind sich daher einig: Eine Blutdrucksenkung ist die wichtigste Maßnahme, um Komplikationen wie Schlaganfall, Demenz, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz vorzubeugen.
Einige klinische Studien schlugen vor einigen Jahren bereits Alarm, dass die Blutdruckempfehlungen einer dringenden Überarbeitung bedürften. 2017 passten die American Heart Association und das American College of Cardiology ihre Empfehlungen zur Hypertoniebehandlung an. Die Interventionsgrenzen und Blutdruckzielwerte wurden in den USA von ≥ 140/90 mmHg auf ≥ 130/80 mmHg abgesenkt. Der Zielkorridor für die Blutdrucksenkung bewegt sich folglich zwischen 120 und 130 mmHg systolisch und zwischen 70 und 80 mmHg diastolisch. Aktuelle Studiendaten demonstrieren, dass bei diesen Werten das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen am niedrigsten ist. Das bestätigen auch Studien mit Naturvölkern. Reihenuntersuchungen bei Ureinwohnern in Papua-Guinea

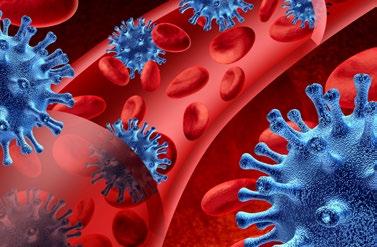
TEIL 5: IMMUNSUPRESSIVA TEIL 1: CHOLESTERINSENKER (2/2022) TEIL 2: OSTEOPOROSEMITTEL (4/2022)
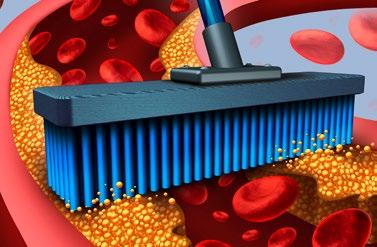



kamen auf Mittelwerte von 116 mmHg systolisch und 70 mmHg diastolisch. Langzeitdaten von indigenen Völkern am Amazonas veranschaulichen, dass Naturmenschen weder an Bluthochdruck leiden noch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben.
In Deutschland wird eine Therapie bereits bei Blutdruckwerten von ≥ 130/90 mmHg empfohlen. Bei Grad 2 und 3 (mittelschwerer und schwerer) Hypertonie soll die medikamentöse Therapie laut führenden Fachgesellschaften unmittelbar beginnen, während bei Grad 1 (milder) Hypertonie Lebensstilmaßnahmen vorzuziehen sind.
WIRKUNGEN UND NEBENWIRKUNGEN
Welche Art von Medikamenten bei Blut- hochdruck eingesetzt werden sollte, war Gegenstand mehrerer großer Studien und daraus resultierender Leitlinien. Das grundlegende Ziel der Behandlung ist die Verhinderung der wichtigen Endpunkte der Hypertonie wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzversagen. Hierfür stehen inzwischen zahlreiche Klassen von Bluthochdruckmitteln (Antihypertensiva) zur Verfügung. Zu den am weitesten verbreiteten Medikamenten gehören Thiaziddiuretika, Kalziumkanalblocker, ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten und Betablocker. Die Therapie mit einem Betablocker wird seit Neuestem Bluthochdruckpatienten mit Herzinsuffizienz, Angina pectoris, Myokardinfarkt oder Vorhofflimmern sowie jüngeren Frauen empfohlen, die schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen.
Neu ist zudem die Empfehlung, dass Patienten von Beginn an eine zweigleisige Wirkstoffkombination zur Blutdrucksenkung erhalten sollten. Vorzugsweise wird zu einer Kombination von ACE-Hemmern oder AT1-Rezeptorblockern geraten. Wenn die duale Therapie keine Wirkung zeigt, wird eine Dreifachkombination aus ACE-Hemmer oder AT1-Rezeptorblocker plus Kalziumantagonist plus Diuretikum empfohlen. Die verschiedenen Klassen von Blutdrucksenkern unterscheiden sich nicht nur durch ihre Wirksamkeit, sondern auch durch ihr Nebenwirkungsprofil. Und diese Nebenwirkungen sollten nicht nur Ärzte kennen, sondern auch Trainer.
NEBENWIRKUNGEN
Mögliche Nebenwirkungen aller Wirkstoffe sind Schwindel, Benommenheit, Blutdruckabfall, Allergien und Magen-Darm-Beschwerden. Zusätzlich können bei den verschiedenen Wirkstoffen folgende weiteren Nebenwirkungen hinzukommen.
• ACE-Hemmer
ACE-Hemmer blockieren die Aktivität des sogenannten Angiotensin-Converting-Enzyms. Dadurch wird weniger Angiotensin II gebildet. Dieses sorgt zum einen für eine Verengung (Vasokonstriktion) der Blutgefäße, zum anderen für die
IM ÜBERBLICK
Nebenwirkungen aller Wirkstoffe:
• Schwindel
Benommenheit
Blutdruckabfall
• Allergien
Hautreaktionen
• Magen-Darm-
Beschwerden (Übelkeit, Durchfall,
Verstopfung)
Risikofaktoren für Bluthochdruck:
• Bewegungsmangel
• Übergewicht
• Stress
• Ungesunde Ernährung
• Übermäßiger
Alkoholkonsum
Hemmung des „Salzhormons“ Aldosteron in den Nebennieren. Denn Aldosteron bremst die Wasser- und Natriumausscheidung in den Nieren und erhöht die Kaliumausscheidung. Dadurch erhöht sich das Flüssigkeitsvolumen in den Gefäßen, wodurch der Blutdruck steigt. Die Hemmung von Aldosteron führt also indirekt zur Blutdrucksenkung. Blutdruck und Wasserhaushalt sind demzufolge eng miteinander gekoppelt. Mögliche Nebenwirkungen sind Wassereinlagerungen in der Haut (Angioödem), ein erhöhter Kaliumspiegel im Blut, Reizhusten und Zinkverluste.
• AT1-Rezeptorantagonisten
AT1-Rezeptorantagonisten hemmen die Wirkung von Angiotensin II am AT1-Rezeptor. Dadurch werden alle Effektororgane, die von diesem Hormon beeinflusst werden, wie Blutgefäße, Hypophysenhinterlappen, Nebennieren und Nieren, stimuliert. In den Blutgefäßen kommt es dadurch zu einer Entspannung (Vasodilatation), in den Nebennieren zu den gleichen Effekten wie bei den ACE-Hemmern.
• Kalziumantagonisten
Wirkstoffe dieser Gruppe hemmen den Einstrom von Ca2+-Ionen. Hierdurch kommt es zu einer Abnahme des peripheren Gefäßwiderstands, d. h., an der glatten Muskulatur der Blutgefäße entspannt sich der Tonus (Vasodilatation). Mögliche Nebenwirkungen sind Hautrötung mit Wärmegefühl, Herzklopfen, Kopfschmerzen, verlangsamte Herzfrequenz, Verengung der Bronchien, Verschlechterung bestehender Durchblutungsstörungen in den Extremitäten, Müdigkeit, Schlafstörungen, sexuelle Funktions- oder Potenzstörungen und eine negative Beeinflussung des Zuckerstoffwechsels.
• Thiaziddiuretika
Thiaziddiuretika sind harntreibende Medikamente, die ebenfalls über die Hemmung der Rückresorption von Natrium und die Ausscheidung von Kalium in den Nieren wirken. Der sich dabei erhöhende osmotische Druck führt zu vermehrter Wasserausscheidung. Mögliche Nebenwirkungen sind Elektrolytstörungen (Magnesium- und Kaliummangel), ein erhöhter Harnsäurespiegel im Blut, eine Verschlechterung des Zuckerstoffwechsels, Mundtrockenheit und Durst.
EINNAHME BESSER ABENDS

Eine aktuelle Studie aus 2020 ergab, dass Blutdrucksenker langfristig besser wirken, wenn man sie abends einnimmt. Von den mehr als 19 000 Studienteilnehmern nahm die Hälfte die Medikamente abends, die andere Hälfte morgens. Über sechs Jahre überprüften Ärzte mindestens einmal im Jahr den Blutdruck der Probanden. Bei der Gruppe mit der abendlichen Einnahme war der durchschnittliche Blutdruck tagsüber und nachts niedriger als in der Morgengruppe. Interessanterweise war das Risiko, an den Komplikationen des Bluthochdrucks zu sterben, in der Gruppe, die ihre Medikamente abends einnahm, um die Hälfte niedriger. Die abendliche Einnahme senkte das Risiko, an Herzgefäßproblemen zu sterben, um 66 Prozent, für Schlaganfälle um 49 Prozent und für Herzinfarkte um 44 Prozent.
Der Blutdruck unterliegt im Tagesverlauf regelmäßigen Schwankungen. Morgens und nachmittags werden infolge des zirkadianen Rhythmus (Tag-Nacht-Rhythmus) hohe Werte gemessen, im Schlaf sinkt der Blutdruck unter 120 mmHg.

EINE FRAGE DES LEBENSSTILS
Die meisten Hochdruckpatienten könnten vollkommen ohne Medikamente auskommen, wenn sie ihren Lebensstil drastisch ändern würden. Liegt der Ruheblutdruck längere Zeit über 140/90 mmHg, sollten lebensstilverändernde Maßnahmen im Vordergrund stehen, wie führende Fachgesellschaften empfehlen. Das bedeutet eine Gewichtsabnahme bei Übergewicht, eine Umstellung der Ernährung (salzmoderate und mediterrane Kost), täglich 6 000–7 000 Schritte, 3 x pro Woche 30 Minuten Muskeltraining, Rauchverzicht, moderater Alkoholkonsum, Entspannung und die Vermeidung weiterer Risikofaktoren wie z. B. Zuckerkrankheit, zu hohe Blutfettwerte etc.
Eine Langzeitstudie mit 36 000 finnischen Teilnehmern hat die vier Säulen eines gesunden Lebensstils in Bezug auf Hypertonie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen identifiziert: Alkoholkonsum von weniger als 50 Gramm pro Woche (etwa fünf kleine Bier), dreimal die Woche Sport (moderat und intensiv), täglich Obst und Gemüse, ein Body-Mass-Index von < 25 – und schon sinkt das Hypertonierisiko auf ein Drittel.
Die gleiche Forschergruppe fand in einer Folgestudie mit 38 000 Finnen und einer Nachbeobachtungszeit von über 14 Jahren zudem heraus: Hypertoniker, die blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, aber keinen gesunden Lebensstil pflegen, haben ein signifikant höheres Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung als Hypertoniker, die keine blutdrucksenkenden Medikamente einnehmen, aber einen gesunden Lebensstil pflegen. Gesundheit könnte so einfach sein! W
NEUE WEGE DER MODERNEN PHYSIOTHERAPIE

Nach einer Verletzung oder einem Unfall ist meist der erste Schritt zur Rehabilitation und Regeneration eine physiotherapeutische Behandlung. Dies umfasst mehrere Maßnahmen, wie z.B. manuelle Therapien, physikalische Anwendungen aber auch aktives Training und Bewegung. Dadurch sollen einerseits Schmerzen gelindert werden, aber andererseits auch die vollständige Beweglichkeit wiederhergestellt werden.Genau diesen Ansatz verfolgt auch Berengar Buschmann, studierter Sportphysiotherapeut und Sportwissenschaftler. Er ist Experte auf dem Gebiet der Rehabilitation sowie Regeneration und betreut Leistungssportler bei Wettkämpfen, aber ebenso in seinem Gesundheitszentrum. Dort verfolgt er und sein Team einen ganzheitlichen Therapieansatz. Doch was das genau bedeutet erklärt er uns am besten selbst:

Lieber Berengar, im Areha Atheltik- & Rehazentrum wird auf einen ganzheitlichen Behandlungsansatz gesetzt. Was kann man sich darunter vorstellen, und welche Rolle spielen dabei Training und Bewegung?

„Bei uns im TEAM AREHA verbinden wir konsequent die Kompetenzen aus Therapie und Training, aus Athletik und Rehabilitation, aus Pro- und Regression von Bewegungsmustern. Hierbei spielt sowohl die Bewegungsqualität als auch die Bewegungsvielfalt eine sehr wichtige Rolle. Neben den therapeutischen Maßnahmen aus der Sportphysiotherapie und Osteopathie, welche für uns ein diagnostisches Fundament darstellen, fi nden auch weitere aktive Trainings- und Rehakonzepte täglichen Einsatz bei uns. Wichtig ist uns dabei die freie funktionelle Bewegung mit ergänzenden gerätegestützten Übungen. Wir betreuen also unsere Athleten und Patienten akut, subakut und langfristig post-operativ, post-traumatisch, sowie auch in der Prävention. Von Prehab zu Rehab, von Pain zu Performance.“

Welche Eigenschaften kennzeichnen einen modernen Therapeuten? Und in welche Richtung könnte sich deiner Meinung nach die Physiotherapie noch weiterentwickeln?



„Meines Erachtens beinhaltet eine „moderne Therapie“ vor allem ausreichende Zeit, Zeit für den Menschen. Man kann im Leben wunderbare Reisen unternehmen, man benötigt aber schlichtweg die Zeit den Reiseweg zu beschreiten. Nimmt man dem Therapeuten seine Zeit, kann er keine weitreichende Reise mit seinem Patienten beschreiten und erleben. Sicherlich ist die „moderne Therapie“ eine gesunde Mischung aus der Physiotherapie und der Osteopathie, wobei manuelle, myofasziale, viszerale und trainingsorientierte Therapien in Verbindung stärker wirken und schneller Erfolg herbeiführen können. In unserer Praxis achten wir zudem auf eine moderne Digitalisierung bspw. mittels einer eigenen Trainings-App mit individualisierten Inhalten für unsere Patienten vor Ort, sowie auch für Athleten in der Ferne.“
Warum ist gezieltes Training in der Therapie wichtig? Und hast du Tipps, wie eine Person mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren kann?
„Es braucht im Durchschnitt sicherlich mehr Bewegung für den Menschen. Viele Patienten binden sich gerne selbst an die Massageliege und wollen geheilt werden. Allerdings verspricht im Grunde nur wirklich das was auf der Trainingsfl äche geschieht einen langfristigen Erfolg. Die höhere Widerstandsfähigkeit des Körpers wird durch angemessenes und an das Niveau und Ziel angepasstes Training erzielt. Die therapeutischen Maßnahmen unterstützen diesen Prozess und legen ein solides Fundament. Es ist sicherlich nicht dienlich ein instabiles oder gehemmtes System mit Training zu „beladen“. Daher setzen wir auf eine ausführliche Diagnostik, das therapeutische Aufl ösen hemmender und gefährdender Kompensationen und bringen den Menschen dann Schritt für Schritt in seine möglichst besten Bewegungsmuster. Die Integration erfolgt am besten durch neue Routinen im Alltag, wie bspw. feste Termine, Trainingspartner, Gruppentrainings, persönliche Challenges, Erinnerungen, fi nanzielle Verbindlichkeiten u.v.m.! Sehr entscheidend ist aber sicherlich auch die entsprechende ehrliche sowie realistische Aufklärung über die persönlichen Folgen und Ziele des Menschen. Das Verständnis für die Maßnahmen ist unabdingbar für einen gemeinsamen Erfolg.“
Ob Studioausstattung, Trainings-/Regenerationsgeräte oder Kleinequipment – wir sind die beste Anlaufstelle für alle Wünsche und Bedürfnisse rund um Functional Training.










