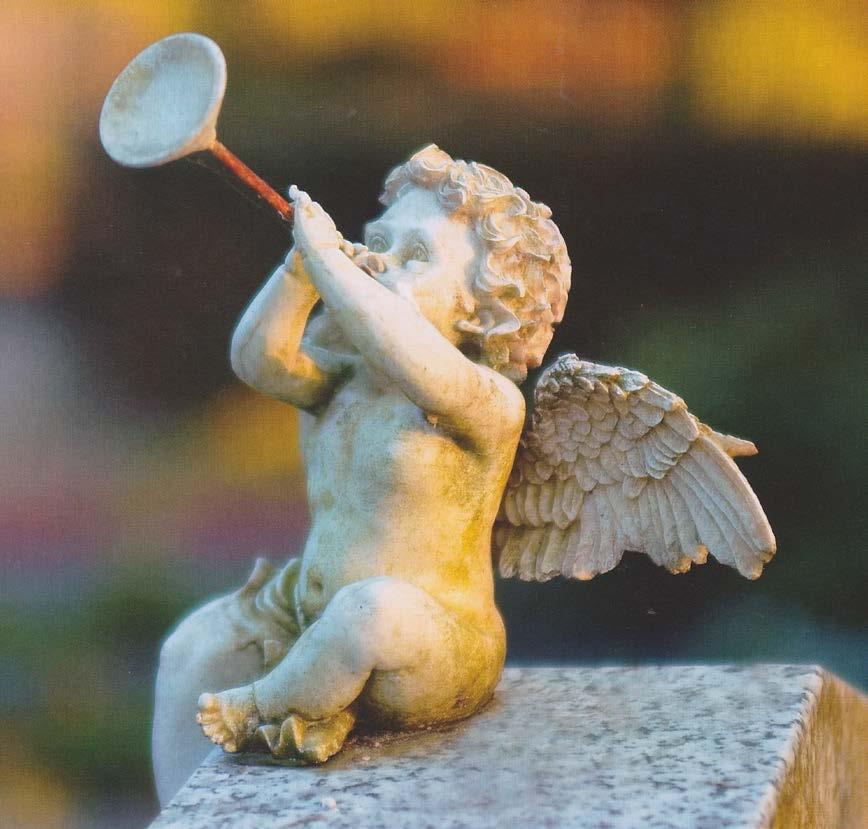12 minute read
Erziehungsziele: Werte und Normen
from MAMPFLA 2020 April
Next Article
Die Erziehungsziele und Erziehungsgrundsätze der Pfadfinderbewegung Teil 3:
Orientierung an Werten und Normen
In der vorletzten Ausgabe der Mampfla sind die Erziehungsziele der Pfadfinder dargestellt worden. In der Letzten war das politische Lernen und die Förderung der Kreativität in der Pfadfinderbewegung unser Thema. In der jetzigen Ausgabe wollen wir uns im dritten Teil grundsätzlich mit der Orientierung an Werten und Regeln befassen.
Ein Charakteristikum pfadfinderischer Selbsterziehung kommt in der Verwirklichung des Grundsatzes einer Orientierung an Werten und Normen zum Ausdruck.
In der Ausrichtung des täglichen Lebens an den pfadfinderischen Verhaltensregeln einerseits, und in der persönlichen Verpflichtung diesen ethnischen Prinzipien gegenüber andererseits, liegt die große selbsterzieherische Wirkung begründet.
Pfadfinderregeln und Pfadfinderversprechen sind aufeinander bezogen; sie sind Wesensmerkmale des Pfadfindens und Basis für eine fortschreitende Selbsterziehung in den Altersstufen (Wichtel, Wölflinge, Guides, Späher, Caravelles, Explorer sowie Ranger und Rover) der pfadfinderischen Erziehungsbewegung.
Was sind Werte und Normen?
Man kann davon ausgehen, dass menschliches Handeln selektiver Art ist, das heißt, es beruht auf bestimmten Auswahlentscheidungen. Ein verantwortliches Tun erfolgt immer auf der Grundlage ausgewählter rationaler Gesichtspunkte. Solche Auswahlaspekte sind Werte bzw. Normen. Sie ermöglichen Überlegungen, aus denen abzuleiten ist, was in einer konkreten Situation angestrebt werden soll und was nicht.
Worte wie Toleranz, Wahrheit, Freiheit, Frieden oder Gerechtigkeit sind zunächst Erkenntnisinhalte. Wenn daraus Folgen für das Handeln abgeleitet werden, so ergeben sich Normen. Wird beispielsweise das Leben als Wert erkannt, so ergibt sich für das Handeln daraus die Norm „Schütze das Leben“. Normen dienen als Richtlinien für das Handeln in konkreten Alltagssituationen.
Pfadfinderische Werte und Normen
Eine Ausrichtung an Werten und Normen existierte bereits zu Beginn der Pfadfinderbewegung. So hat Baden Powell bestimmte pfadfinderische Normen im „Scout Law“ niedergeschrieben. Pfadfinderische Verhaltensregeln und Einstellungen werden auch von der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung definiert.
Wie bereits im ersten Teil unserer Reihe Erziehungsziele und Erziehungsgrundsätze thematisiert wurde, werden in den 1989 durch WOSM herausgegebenem „Fundamental Principles“ als grundlegende Regeln die „Pflicht gegenüber Gott“ – und seiner Schöpfung, die „Pflicht gegenüber Dritten“ (sie schließt eine Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Gesellschaft mit Achtung vor der Würde des Mitmenschen und der Unversehrtheit der Natur“ ein) und die „Pflicht gegenüber sich selbst“ als pfadfinderische Einstellungen beschrieben. Letztlich zielen diese drei Grundsätze der Pfadfinderbewegung auf eine Achtung und Wertschätzung des Lebens. Der zentrale pfadfinderische Wert ist also das Leben. Daraus lassen sich die anderen pfadfinderischen Werte und Normen wie Solidarität, Friede oder Toleranz ableiten.
Ideale sind wie Sterne. Wir können sie zwar nicht erreichen, aber uns an ihnen orientieren. Carl Schwarz
Die Pfadfinderlilie, das weltumfassende Symbol aller Pfadfinder und Pfadfinderinnen zeigt die Richtung im Sinne unserer Grundsätze an.

Pfadfinderregeln
Die Pfadfinderregeln dienen den Pfadfinder innen und Pfadfindern als Orientierungshilfe für ihr Verhalten. Gerade in der Zeit der Selbstfindung (des Erwachsenwerdens) benötigen Heranwachsende Leitlinien, mit denen sie sich identifizieren können. Ethnische Lösungen spielen für die Selbsterziehung junger Menschen eine wichtige Rolle. Der zentrale pfadfinderische Wert ist also das Leben.
Das Pfadfindergesetz der PPÖ:
Der Pfadfinder/Die Pfadfinderin… 1) … sucht den Weg zu Gott. 2) … ist treu und hilft wo er/sie kann. 3) … achtet alle Menschen und sucht sie zu verstehen. 4) … überlegt, entscheidet sich und handelt danach. 5) … lebt einfach und schützt die Natur. 6) … ist fröhlich und unverzagt. 7) … nützt seine/ihre Fähigkeiten. 8) … führt ein gesundes Leben. Die in den Pfadfinderregeln positiv ausgedrückten Forderungen nach:
• Verantwortungsbereitschaft • Pflichterfüllung • Zuverlässigkeit • Hilfs- und Einsatzbereitschaft • Rücksichtnahme • Verständigungswillen • Zuversicht • (selbst)kritischem Denken und Tun • Offenheit
stellen Leitlinien für pfadfinderisches Verhalten dar. Es sind Eigenschaften und Fähigkeiten, um die sich alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen bemühen (sollten). Dabei werden solche Ziele unter anderem durch ein handelndes Lernen, das eine Wertreflexion einschließt, durch den Versuch das pfadfinderische Lebensspiel besonders gut in der Pfadfindergemeinschaft und im Alltag zu spielen, erreicht.
Solche Ziele müssen in Lebenssituationen immer wieder neu angestrebt werden. Beispielsweise ist „Hilfsbereitschaft“ nicht als ein einmal erreichter Zustand zu sehen. Um eine hilfsbereite Haltung und um tätige Solidarität bemühen sich Pfadfinder und Pfadfinderinnen permanent. Für dieses stetige Bemühen, den Pfadfinderregeln gerecht zu werden, tragen wir unser Halstuch.
Einige Pfadfinderregeln besitzen heute eine besondere Aktualität. So sind beispielsweise in der gegenwärtigen konsumorientierten Gesellschaft und bei der heutigen Verknappung des natürlichen Lebensraumes, die eine Entfremdung des Menschen von der Natur zur Folge hat, die Regeln einfach und bewusst zu leben und die Natur zu schützen und zu erhalten von besonderer Bedeutung.

• bereit zu sein, den eigenen Standpunkt immer wieder neu zu überprüfen und ihn gegebenenfalls zu ändern; • offen und sensibel für die Überzeugungen und Meinungen anderer Menschen zu sein und • bereit zu sein, verschiedene Wege zu erproben und Problemlösungen kreativ anzugehen.
Eine zentrale Zielsetzung des Pfadfindens - die Freundschaft zu allen Pfadfindern und das gute Verhältnis zu allen Menschen - wird im dritten Punkt des Pfadfindergesetzes angesprochen.
Diesem Friedensziel widmete Baden-Powell in der World-Brotherhood-Ausgabe von „Scouting for Boys“ ein ganzes Kapitel (vgl. B.-P. 1946, S. 281 ff.).
Durch das Leben der Pfadfinderregeln werden bei jungen Menschen Bewusstseinsprozesse in Gang gebracht, die sich auf eine sinngerechte menschliche Lebensgestaltung im Erwachsenenalter und auf ein politisch verantwortliches Verhalten auswirken.
In den Pfadfinderregeln kommt die eigentliche Bedeutung des Pfadfindens zum Ausdruck: Pfadfinderinnen und Pfadfinder versuchen ständig, die für sie persönlich richtigen Wege im Leben zu finden: Das bedeutet unter anderem, • nicht stehen zu bleiben, sondern permanent an sich zu arbeiten und Möglichkeiten des Weiterkommens zu suchen; • sich mit den gesellschaftlichen Realitäten auseinanderzusetzen und Möglichkeiten zur Mitgestaltung der Demokratie zu finden;

Baden-Powell war ein religiöser Mensch. Als Christ zu leben, bedeutete für ihn, wie ein Christ zu handeln. Ein Pfadfinder ist deshalb „aktiv gut“. Das eigentliche Ziel pfadfinderischer Selbsterziehung sah B.- P. in der alltäglichen Verwirklichung des christlichen Gebots der Nächstenliebe. Die pfadfinderische Regel „ Der Pfadfinder ist Freund aller Menschen und Bruder aller Pfadfinder“ ist mit dem Gebot christlicher Nächstenliebe vergleichbar. Sie schließt auch das pfadfinderische Ziel „Hilfsbereitschaft“ ein. Das tägliche Leben nach dieser Regel auszurichten, bedeutet, dem Nächsten im Geiste der Freundschaft zu begegnen. Dies zeigt sich unter anderem in tätiger Solidarität und im Entgegenbringen von Respekt, Verständnis und Toleranz. Rassische, soziale und konfessionelle Gesichtspunkte sowie politisch-ideologische Gegensätze dürfen dabei keine Rolle spielen. Mit der Pfadfinderbewegung wollte Baden-Powell einen Beitrag zur Verwirklichung dieser christlichen Forderung leisten und auch gleichzeitig mithelfen, dem Ziel eines dauerhaften Friedens zwischen den Menschen und den Völkern auf der Welt näherzukommen.

Das Pfadfinderversprechen
Pfadfinderregeln und Pfadfinderversprechen sind – wie bereits erwähnt – aufeinander bezogen. Nach den Grunderprobungen legt der Neuling vor der Gemeinschaft das Pfadfinderversprechen ab. Aus „Wegweiser“, dem Rankweiler Erprobungsbuch:
Versprechen
Im Versprechen sind die grundlegenden Ideen der Pfadfinderei festgelegt. Diese Werte (=Ideen, Grundlagen) sind für alle Pfadfinder auf der ganzen Welt die gleichen. Das Versprechen ist gar nicht leicht einzuhalten, sondern etwas sehr Ernstes und du bist kein richtiger Pfadfinder, solange du nicht dein Bestes gibst, um stets diesem Versprechen getreu zu leben. Pfadfindertum bedeutet nicht nur Vergnügen, sondern erwartet auch ziemlich viel von dir.

Ich verspreche bei meiner Ehre, dass ich mein Bestes tun will, Gott und meinem Vaterland zu dienen, meinen Mitmenschen zu helfen und nach dem Pfadfindergesetz zu leben.
1)Gott und deinem Land zu dienen a. Als Pfadfinder sollst du einer
Religionsgemeinschaft angehören. b. Du hörst nie auf Gott zu suchen und bist bemüht, dich aktiv mit deinem Glauben auseinanderzusetzen und danach zu leben. c. Du nimmst deine Aufgaben in
Staat und Gesellschaft ernst (z.B. Schulbesuch, Vorbereitung auf die Berufsausbildung, Umweltschutz, Mülltrennung, Einrichtungen der Gemeinschaft erhalten, helfen und nicht zerstören, dir selbst eine Meinung bilden und nicht gedankenlos etwas nachplappern,…).
2)Deinen Mitmenschen zu helfen
a. Hilfsbereitschaft ist ein besonderes Kennzeichen der Pfadfinder. b. Du bemühst dich darauf zu achten, wie es anderen Menschen geht, ob sie deinen Rat oder eine Hilfe brauchen. c. Du versuchst täglich mindestens eine „Gute Tat“ zu tun.
3)Nach unserem Gesetz zu leben
Das Pfadfindergesetz ist eigentlich ein Lebensprogramm für dich. Du wirst in den verschiedenen Abschnitten deines Lebens immer wieder Neues für dich darin entdecken.
Mit der Ablegung des Pfadfinderversprechens wird die offizielle Aufnahme in die Pfadfinderge
meinschaft vollzogen. Damit wird gleichzeitig erklärt, in der Gemeinschaft und für sie Verantwortung zu übernehmen. Die Pfadfindergemeinschaft erwartet vom neuen Mitglied ein pfadfinderisches Verhalten. Diese Erwartungshaltung und das Vertrauen, das die Gemeinschaft und die erwachsenen Leiter und Leiterinnen dem einzelnen Mitglied entgegenbringen, üben eine starke Wirkung auf das selbsterzieherische Bemühen des Individuums aus.

Werterziehung in der Demokratie
Der Weg zur Autonomie führt über die Identifikation mit einer Bezugsperson. Gerade im Wölflings- und teilweise auch im Jungpfadfinderalter ist deshalb die Vorbildwirkung der erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter (bei gleichzeitiger Förderung der Kritikfähigkeit) von entscheidender Bedeutung für die moralische Entwicklung der Kinder. In der folgenden Darstellung soll im Hinblick auf die Förderung demokratischer Werte etwas ausführlicher auf die Bedeutung des „Führens“ (hier im pädagogischen Sinne verwendet!) eingegangen werden. Das Wort „Führen“ hat durch den Nationalsozialismus den pädagogischen Hintergrund im Sinne der Wortbedeutung von Zeigen, Vormachen, Behüten, Begleiten etc. verloren. Durch Zusätze wie Zug-, Bergoder Opernführer etc. wird die ursprüngliche Bedeutung zum Teil wiederhergestellt, was im pfadfinderischen Bereich – Pfad
finderführer – nicht gelungen ist. Das Gehorsamsdenken („Führer wir folgen dir“) spielt in den meisten Pfadfinderverbänden keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
„Gehorsam“ als absolutes Folgen im Sinne einer autoritären Erziehung hat in der Pfadfinderbewegung schon deshalb keinen Platz, da die Kinder und Jugendlichen freiwillig und aus Begeisterung am „pfadfinderischen Spiel“ teilnehmen. Keine Gemeinschaft kommt allerdings ohne Regeln aus. Gruppenmitglieder und „Führer“ („Führerinnen“) orientieren sich bei ihrem Handeln an den vereinbarten Regeln. Soll das Handeln das Ergebnis eines Lernprozesses sein, das auf Einsicht beruht, so bleibt die Auseinandersetzung mit den Pfadfinderregeln in allen Altersstufen eine ständige Aufgabe. Regeln müssen immer wieder von
„Es gibt zwei Arten der Disziplin: eine ist der Ausdruck der Loyalität durch Handeln, die andere ist Unterwerfung aus Furcht vor Bestrafung.“
den Gruppenmitgliedern interpretiert und auch weiterentwickelt werden. Die Pfadfinderbewegung kann dann einen wesentlichen Beitrag zur Weitererziehung leisten, wenn in den Pfadfinderregeln die Werte (Frieden, Umweltschutz etc.) einfach und für alle verständlich formuliert sind, so dass das Handeln im Hinblick auf solche Werte ständig überdacht werden kann.
In der Pfadfinderbewegung treten an die Stelle von Anordnungen und dem Befolgen dieser Anordnungen (Gehorsam) Vereinbarungen und Absprachen und ein an gemeinsam entwickelten Regeln orientiertes und reflektiertes Verhalten.
Zum heutigen Selbstverständnis des „Führers“/ der “Führerin“

Ein Führer-Gefolgschafts-Verhältnis, bei dem der Geführte dem Führer unkritisch nachfolgt beziehungsweise bedingungslos auf ihn „eingeschworen“ wird, hat nichts mit dem pädagogischen Begriff „führen“ zu tun. Menschen sind Individuen und deshalb verschieden; ein „Hinerziehen“ auf ein be- stimmtes Bildungsideal, so wie es der „Führer“ sieht, kann heute nicht mehr Aufgabe pfadfinderischer Erziehung sein. Eine einseitige Orientierung an einem Bildungsideal (wie das ritterliche Bildungsideal) kann die Entscheidungsmöglichkeiten der jungen Menschen einschränken und ein selbstbestimmtes Handeln behindern.
Aufgabe der „Leiterinnen“/ der „Leiter“ ist es, den jungen Menschen Ziele zu zeigen, sie aber nicht zu zwingen, diese anzusteuern. „Führen“, pädagogisch interpretiert, bedeutet, die nötigen Anregungen und Hilfen zu gewähren, damit die Heranwachsenden ihre eigenen Wege finden, sich in dieser Welt (in Familie, Beruf, Gesellschaft etc.) zu verwirklichen; das bedeutet unter anderem auch, ein erfülltes Leben zu leben und Glück zu erfahren. So gesehen, gewinnt der Begriff „Pfad-finder“ („Pfad-finderin“) eine aktuelle Bedeutung. Man kann die pädagogische Tätigkeit des „Führens“ mit einem „Begleiten“ vergleichen; dabei wird bei der Anregung der Kinder und Jugendlichen zu einem gemeinsamen und verantwortungsvollen Handeln, das für die Persönlichkeitsförderung notwendige Sammeln von authentischen Erfahrungen ermöglicht. Nicht der ideologisch verfremdete Begriff „ Führer“ oder der für den erzieherischen Bereich nicht sehr passende Terminus „Leiter“ (er ist eher als Bezeichnung im organisatorischen Bereich geeignet), sondern „Begleiter“ („Begleiterin“) könnte aus dieser Sicht als der heute angemessene Fachausdruck verwendet werden.
Wie schon im Vorwort erwähnt, ist „Begleiten“ seiner Grundtendenz nach ein demokratisches Geschehen; dies zeigt sich in der Achtung des Begleitens (der Begleiterin) vor der Individualität der Kinder und Jugendlichen. Manipulation oder Gewaltausübung jeglicher Art (dazu gehört auch
das Ausüben eines moralischen Drucks) widersprechen dieser Auffassung von pfadfinderischer (Selbst-) Erziehung. Nur in einer demokratischen Umgebung kann sich eine Selbsterziehung zu demokratiefähigen Menschen wirkungsvoll entfalten, denn das Ergebnis von Lernprozessen beruht auch immer auf einem Wahrnehmungslernen. Der Pfadfinderbegleiterin (dem Pfadfinderbegleiter) kommt deshalb die Aufga

Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Toleranz, einfühlendes Verstehen und durch das Ermöglichen eines selbstbestimmten und -verantworteten Denkens und Handelns gekennzeichnet; aufgrund des Vorlebens von demokratischen Werten und Normen ist deshalb für die Entwicklung zur demokratischen Persönlichkeit dieser „sozial-integrative“ Führungsstil von grundlegender Bedeutung.
be zu, Orientierungshilfen – auch über das Vorleben – zu gewähren. Da eine Demokratie als Form des „Miteinander-lebens“ demokratische Persönlichkeiten voraussetzt, kommt als angemessener Führungsstil nur der demokratische in Betracht, denn dieser ist unter anderem durch Wertschätzung, Anerkennung, Anteilnahme, Herzlichkeit,
Pfadfinderisches Begleiten hat eine umfassende Förderung des jungen Menschen zum Ziel. Deshalb darf sich das Befähigen der Kinder und Jugendlichen (im Gruppenleben, auf Lager und Fahrt, im Spiel und in Projekten etc.) nicht einseitig auf ein bestimmtes Wissen und Können beschränken (z.B. auf das Erlernen von Pfad-
findertechniken). Ein wesentlicher Bereich ist im sozialen und politischen Lernen zu sehen (Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, Entwickeln von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, Förderung der Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, Einüben von Konfliktfähigkeit, Erziehung zur Normenflexibilität, zur Toleranz von Andersartigkeit, zur tätigen Solidarität etc.). Selbstbestimmtes und reflektiertes Projekthandeln ist ein Weg zur Förderung solcher Fähigkeiten. Dabei ist Erziehung in der Pfadfinderbewegung immer ein aktives Geschehen und deshalb vor allem Selbsterziehung.
Das Pfadfinden kann nur in dem Maße einen Beitrag zur Förderung von demokratischen Werten und Normen leisten, indem die pädagogisch Verantwortlichen ein Selbstverständnis für ihr Handeln entwickeln, das den angestrebten demokratischen Erziehungszielen entspricht.
Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen. Laotse
Letztlich ist also nicht die Verwendung eines bestimmten Begriffs, sondern das pädagogische Handeln von Bedeutung.
aus Pfadfinden von Hans E. Gerr
Im nächsten Heft werden im vierten und letzten Teil die aktuelle Bedeutung der Wertorientierung als auch Erziehungsziele wie Naturverbundenheit, sinngerechte menschliche Lebensweise, Internationalismus und Frieden beschrieben werden.
Parkverbot Pfadiheim

Um gefährliche Situationen beim Ein- und Ausfahren zu verhindern, ist das Parken beim Pfadiheim für Eltern ab sofort verboten. Es gibt genügend öffentliche Parkplätze in Gehweite. Das Parken beim Pfadiheim ist nur für Leiter/innen und für Ladetätigkeiten gestattet.
Der Elternrat