FAZITGESPRÄCH
Zukunft der Intelligenz
TU-Rektor
Horst Bischof im Interview


FAZITGESPRÄCH
Zukunft der Intelligenz
TU-Rektor
Horst Bischof im Interview

FAZITESSAY
Christian Wabl über den Frieden in einer Welt des Krieges
November 2025 Wirtschaft und mehr. Aus dem Süden.
FAZITTHEMA BILDUNG

Die Grazer Bestattung ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für Sie unter 0316 887-2800 erreichbar.
grazerbestattung.at

Nach dem Abschied im wunderschönen Zeremoniensaal kann die Kremierung gleich in Graz stattfinden – ganz ohne unnötige Transporte.
Sechs verschiedene Bestattungsunternehmen gibt es in Graz. Doch nur die Grazer Bestattung verfügt über ein eigenes Krematorium in Graz und über den wunderschönen Zeremoniensaal. Auch die Aufbahrungshalle in Mariatrost gehört der Grazer Bestattung.
Seit 130 Jahren begleitet die Grazer Bestattung die Menschen in Graz in ihren schwersten Stunden und steht ihnen bei, wenn ein geliebter Mensch stirbt.
Mit günstigen Packages ermöglicht die Grazer Bestattung allen Menschen, sich in Würde von ihren Liebsten zu verabschieden. Die transparenten Angebote bieten Planungssicherheit, Klarheit und persönliche Begleitung – ganz ohne versteckte Kosten. Nur bei der Grazer Bestattung kann man zudem sicher sein, dass die Verstorbenen dank des eigenen Krematoriums direkt in Graz kremiert werden – und nicht im Umland oder in einem Kärntner Krematorium.
Keine Extrakosten
Kund:innen der Grazer Bestattung steht auch die Grazer Feuerhalle mit ihrem
denkmalgeschützten Jugendstil-Zeremoniensaal ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Auch Urnenaufbahrungen sind im würdevollen Zeremoniensaal möglich.
Verabschiedungen in Mariatrost Wie der Zeremoniensaal der Feuerhalle gehört auch die Aufbahrungshalle Mariatrost zur Grazer Bestattung und wird ihren Kund:innen mietfrei zur Verfügung gestellt. Auch Erdbegräbnisse am Friedhof Mariatrost sind bei der Grazer Bestattung – mit oder ohne Aufbahrung in der wunderschönen Basilika – gerne möglich. Sehr beliebt ist zudem die Möglichkeit, eine Verabschiedung in Mariatrost abzuhalten und die Urne anschließend auf einem anderen Friedhof in oder außerhalb von Graz beizusetzen. Wie auch immer Sie sich entscheiden –mit der Grazer Bestattung treffen Sie auf
jeden Fall die richtige Wahl: für erstklassigen Service, menschlichen Umgang, fair kalkulierte Preise und die Gewissheit, den Abschied Ihrer Liebsten in die besten Hände zu legen.
Urnenbeisetzung 1–3 Werktage nach der Verabschiedung
Mit dem Auto & den Öffis erreichbar sowie barrierefrei zugänglich
Ein stiller Ort der Andacht im Schatten alter Bäume
Keine Grabsteinkosten & keine Grabpflege
Von Christian Klepej
Am 14. Oktober dieses Jahres hat der bundesdeutsche Kanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz in Potsdam über Anstrengungen der Bundesregierung, der »Migrationskrise« entgegenzuwirken gesprochen. Dabei ist der mittlerweile allgegenwärtige Sager vom »Stadtbild« entstanden, im übrigens klaren Kontext mit ausreisepflichtigen Menschen, die – um es vorsichtig zu formulieren – nicht nur einen Segen darstellen. Die empörten bis schnappatmigen Reaktionen auf diesen für Merz üblichen »harten Spruch«, auf diese richtige aber auch viel zu schwammige Aussage, sind nicht enden wollend. Einige Funktionäre vom Koalitionspartner SPD und vor allem solche der bekanntlich zur Hysterie neigenden Grünen, werfen nun dem Bundeskanzler – Überraschung! – Rassismus und unmenschliches Verhalten vor. Oft wurden zumindest von dämlichen Linken Nazivergleiche angestellt. Gut, das reisst jetzt niemand von Verstand vom Hocker, wenn nun aber auch SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil bei einem Gewerkschafterkongress in Hannover zur Stadtbilddiskus-
Wir können die Probleme mit Migration nicht mehr weiter ignorieren

sion noch die Wortspende abgab, er wolle in einem Land leben, in dem nicht das Aussehen darüber entscheide, ob einer ins Stadtbild passe, dann zeigt das wieder einmal gut die prekäre und beinahe ausweglose Sitution unserer Demokratien auf. Den Vogel hat Katrin Göring-Eckardt abgeschossen, die ehemalige Grünen-Chefin und »Reala« (das bezeichnet weibliche Anhänger des »realpolitischen Flügels« dieser Partei, den es also irgendwie geben muss) hat auf Twitter (X) ein Bild eines »Döners« gepostet, mit der klaren Botschaft: »Ich hatte heute Stadtbild.« Die Kollegin reduziert also die gesamte neuere Migrationsgeschichte Deutschlands und damit Europas auf einen orientalischen Snack, auf ein Essen, auf Fast-Food. Und entlarvt damit geradezu vorzüglich ihre Pippi-Langstrumpf-Welt, in der diese Migrantismusapologeten leben. Ihr Konter auf eine aus ihrer Sicht »rassistische« Äußerung des konservativen (ich denke, noch darf ich die CDU so zusammenfassen) Parteichefs, besteht in der größtmöglich denkbaren Stereotypisierung aller Zuwanderer. Ihr wurde übrigens auch Rassismus vorgeworfen. Das ist genauso lächerlich, wie es dem Kanzler vorzuwerfen. Die von mir gerade angesprochene Pipi-Langstrumpf-Welt der moralisch gefestigten Linken hat also einen Horizont, der nicht über lustige Besuche beim »Türken ums Eck« oder beim »Italiener in der Seitengasse« (oft auch ein Türke) hinausgeht. Meine beiden letzten direkten Kontakte mit erst wenige Jahre hier lebenden Menschen hingegen waren ein Autor aus Syrien und –nicht der angenehmste Termin – eine persische Ärztin im Zuge einer gesundheitlichen Vorsorgemaßnahme. Mit beiden konnte ich mich wunderbar unterhalten, bei der Ärztin war der charmante Akzent zudem geradezu eine Freude.
Und von solchen Migranten gibt es viele. Wunderbare Menschen mit wunderbaren Fähigkeiten. Die sind nicht das Problem. Die hat Friedrich Merz nicht angesprochen. Wer das Merz unterstellt, noch dazu mit »den üblichen Signalwörtern Solidarität, Respekt und Vielfalt garniert«, wie es Marc Felix Serrao in der NZZ gut zusammengefasst hat, der hat weder Respekt noch echte
Solidaridät für alle Menschen in unseren Landen übrig; ob jetzt mit oder ohne Migrationsgeschichte.
Es sind die immer mehr in Städten und Kommunen herumlungernden, oft ausreisepflichtigen Menschen aus Asien bzw. dem arabischen Raum, die ein Problem darstellen. Die nichts dazu beitragen, sich in diese Gesellschaft positiv zu integrieren, in diese Gesellschaft, die sie in einer zu keiner Zeit der Weltgeschichte dagewesenenen Qualität alimentiert und ihnen Geldgeschenke macht, dass die Hälfte reicht. Und damit unsere Finanzen über alle Schmerzgrenzen hinaus strapaziert! Und es sind auch die vielen kriminellen »Plötzlichhierseienden«, die Menschen ausrauben, verletzen, vergewaltigen oder gar töten. Und es sind diejenigen, die es nicht der Mühe Wert empfinden, die Sprachen unserer Länder zu sprechen, sondern Parallelgesellschaften bilden. Und es sind fragwürdige Anhänger einer Religion, die immer lauter nach einem Kalifat rufen. Wer das nicht sieht, der schadet nicht nur allen Europäern, nein, der schadet vor allem auch allen neuen Mitmenschen, die hier in Friede und Freiheit leben wollen. Das weiß die persische Ärztin, das wissen die oft türkischstämmigen Taxifahrer, das weiß mein albanischstämmiger Kirchenwirt, dem ich jederzeit meine Kinder anvertrauen kann (und schon konnte). Wenn das die Linken nicht endlich begreifen, sehe ich schwarz für unseren Kontinent. Und damit auch für den Kirchenwirt. n
Sie erreichen den Autor unter christian.klepej@wmedia.at

Verlust der Exzellenz
Österreichs Bildungssystem unter Druck!
Hohe Kosten, schwache Leistungen und Überakademisierung bremsen den Standort.

Akademische Intelligenz
TU-Rektor Horst Bischof im Interview über KI in der Lehre, internationale Talente und die Zukunft der technischen Bildung.
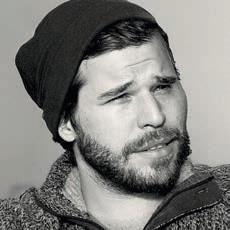
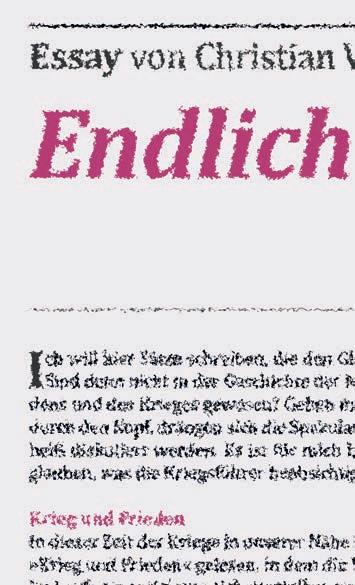
Endlich Frieden!
Christian Wabl über Krieg, Frieden und Menschlichkeit – und darüber, warum jedes Gespräch notwendig sein kann und ist.
Emre Akal inszeniert – sehr frei nach Shakespeare –Romeo und Julia im Grazer Schauspielhaus. Und nicht nur Michael Petrowitsch ist begeistert.
Seite 78
Rubriken
Editorial 3
Politicks 14
Investor 32
Außenansicht 38
Oberdengler 46
Immobilien 68
Alles Kultur 78
Schluss 82

A Tribute to Elli
Elli Bauer macht Graz zur Bühne – klug, musikalisch und urkomisch. Ihre Shows verbinden Tiefgang und Grazer Schmäh.

Bücher aus Gleisdorf
Seit 77 Jahren ist die Buchhandlung Plautz in Gleisdorf für die literarische Nah- und immer öfter auch Fernversorgung zuständig.
Liebe Leser!
Österreichs Bildungssystem steht unter Druck wie selten zuvor. Hohe Kosten, schwache Leistungen, Fachkräftemangel und Überakademisierung bremsen den Standort. Warum Bildung wieder zum zentralen Wettbewerbsfaktor werden muss, und was Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dazu beitragen können, beleuchten wir im Fazitthema dieser Ausgabe.
Im Fazitgespräch spricht TU-GrazRektor Horst Bischof über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Lehre, internationale Talente und die Zukunft technischer Bildung. Ein Interview über Verantwortung, Innovation und kluge Köpfe.
Der Essay »Endlich Frieden!« kommt wieder von Christian Wabl. Er denkt über Krieg, Menschlichkeit und den Wert des Dialogs nach – und darüber, warum jedes Gespräch erster Schritt zu einer friedlicheren Welt sein kann.
In der Fazitbegegnung stellen wir die Grazer Kabarettistin Elli Bauer vor, die mit Witz, Mut und musikalischem Feingefühl das Publikum begeistert.
Zudem blicken wir nach Gleisdorf, wo die Buchhandlung Plautz seit Jahren literarische Nahversorgung auf hohem Niveau bietet. Gutes Lesen! -red-
IMPRESSUM
Herausgeber
Horst Futterer, Christian Klepej und Mag. Johannes Tandl
Medieninhaber & Verleger
Klepej & Tandl OG
Chefredaktion
Christian Klepej Mag. Johannes Tandl
Redaktion
Peter K. Wagner (BA), Mag. Josef Schiffer, Mag. Maryam Laura Moazedi, Dr. Volker Schögler, Mag. Johannes Pratl, Helmut Wagner, Mag. Katharina Zimmermann, Mag. Michael Petrowitsch, Christian Wabl, Peter Pichler (Produktion), Vanessa Fuchs (Organisation)
Lektorat
AdLiteram
Druck
Walstead-Leykam
Vertrieb & Anzeigenleitung
Horst Futterer
Redaktionsanschrift
Schmiedgasse 38/II
A-8010 Graz
Titelfoto von Erwin Scheriau
T. 0316/671929*0. F.*33 office@wmedia.at fazitmagazin.at facebook.com/fazitmagazin
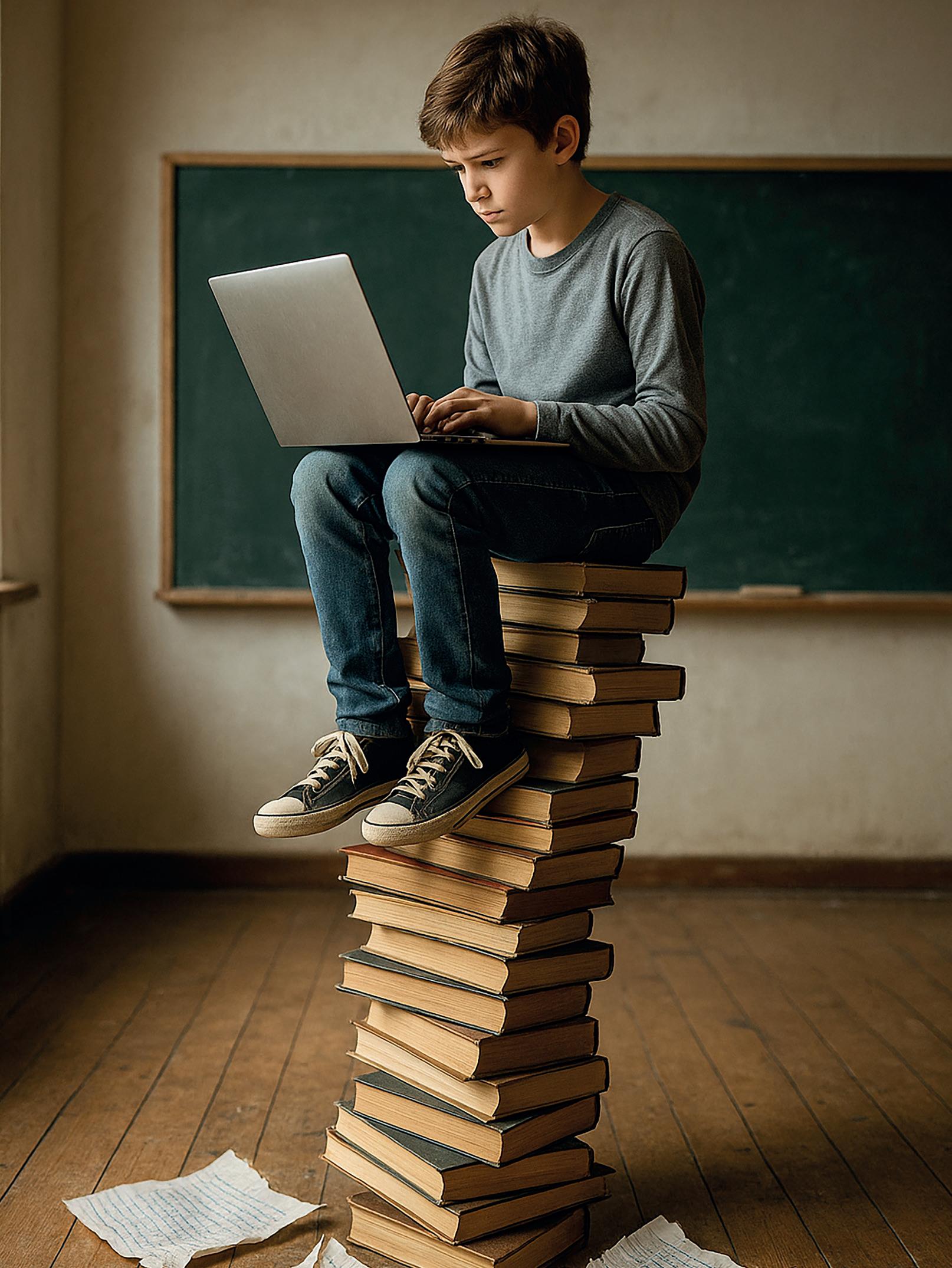
Fazitthema
Von Johannes Roth
Seit Generationen bilden in Österreich Industrie, Forschung und Handwerk ein eng verflochtenes Netzwerk, das nur funktioniert, weil Bildung seine Grundlage ist. Der Bildungssektor bereitet die gesamte wirtschaftliche Wertschöpfung des Landes vor – doch genau dieser Bereich kämpft heute zunehmend mit Nachwuchsmangel und sinkendem Leistungsniveau.
Eine Investition in Bildung bringe immer noch die besten Zinsen, soll Benjamin Franklin gesagt haben – und kaum ein Satz trifft es besser. Denn eine Gesellschaft, die ihre demokratischen Werte auf der Basis solider Allgemeinbildung diskutiert und aushandelt, ist lernfähiger, innovativer und damit letztlich auch produktiver und wohlhabender. Innovation entsteht und gedeiht nur dort, wo Wissen breit verankert ist – und kann nur von gebildeten Menschen weitergetragen und vermarktet werden. Umgekehrt ist das bewusste Vorenthalten von Bildung seit jeher ein Werkzeug der Manipulation. Schon Denker wie John Locke und Immanuel Kant betonten, dass Aufklärung und Bildung den Menschen aus der »selbstverschuldeten Unmündigkeit« befreien – was für autoritäre Herrscher bedeutet, dass Denken, Vergleichen und Fragen gefährlich werden können. Kontrolle über das Bildungssystem ist daher immer auch ein Instrument der Macht.
Drei Jahrhunderte Bildungspolitik
Seit Maria Theresia ist die Bedeutung von Bildung fest im österreichischen Staatswesen verankert. Die Erzherzogin setzte mit einer Reihe von Reformen Maßstäbe, die bis heute nachwirken. Mit der am 6. Dezember 1774 erlassenen »Allgemeinen Schulordnung« legte sie den Grundstein für das moderne Schulsystem und machte Österreich zum Vorreiter: Die Einführung der öffentlichen Staatsschule mit sechsjähriger Schulpflicht wurde weltweit zum Vorbild und bildete die Basis für zahlreiche weitere Reformen, die Österreichs intellektuelles Niveau auch international konkurrenzfähig hielten.
Unter Kaiser Franz Joseph brachte das Reichsvolksschulgesetz von 1869 erstmals eine einheitliche Grundlage für das gesamte Pflichtschulwesen und verlängerte die Schulpflicht auf acht Jahre. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete Otto Glöckel, Präsident des Wiener Stadtschulrates, eine der bedeutendsten Bildungsreformen ein. Sein Ziel war es, allen Kindern – unabhängig von Geschlecht oder sozialem Hintergrund – gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. 1927 führte diese Reform zur Einführung der Hauptschule als Pflichtschule für Zehn- bis Vierzehnjährige.
Mit dem Schulorganisationsgesetz von 1962 wurde das österreichische Schulwesen schließlich grundlegend neu strukturiert: Die Schulpflicht wurde auf neun Jahre erweitert, und für Pflichtschullehrerinnen und -lehrer entstand eine neue Ausbildung an Pädagogischen Akademien. Seither jedoch ist die Bildungspolitik zunehmend zum Spielball parteipolitischer Interessen geworden.
Der Standort verliert an Wissen 60 Jahre später muss man Folgendes festhalten: Das Anbiedern an Zeitgeistpädagogik hat dem Bildungsstandort Österreich ebenso wenig gutgetan wie das ausschließlich ideologisch motivierte ständige Herumdoktern am System. Im PISA-Test scheitert die heimische Jugend vor allem am sinnerfassenden Lesen. Der nationale Bildungsbericht 2024, den das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Auftrag gibt, erkennt wörtlich: »Österreichs Volksschülerinnen und -schüler der vierten Schulstufe liegen im Jahr 2021 mit ihren Lesekompetenzen im mittleren Leistungsbereich der teilnehmenden EU-Länder, wobei sich die Lesefähigkeiten der österreichischen Kinder – wie in weiteren 15 von 22 EU-Ländern – im Vergleich zu 2016 verschlechtert haben.«
Aber es gibt auch gute Nachrichten: »Österreichische 15-/16-jährige Jugendliche liegen mit ihren Lesekompetenzen im Bereich des EU-Schnitts sowie auch im Bereich des OECD-Schnitts. Am Ende der Pflichtschulzeit rangieren Österreichs Jugendliche bei den Mathematikkompetenzen über dem EU-Schnitt sowie auch über dem OECD-Schnitt. Die naturwissenschaftlichen Fähigkeiten von Österreichs Jugendlichen entsprechen dem durchschnittlichen Niveau in der EU und der OECD.«
Durchschnitt als Status quo
Das bedeutet nichts anderes, als dass Österreichs Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich bestenfalls Mittelmaß erreichen – von echter Exzellenz kann keine Rede sein. Gerade in einer industriell geprägten Volkswirtschaft wie Österreich sind jedoch naturwissenschaftliche Kompetenzen und insbesondere die MINT-Fächer entscheidend, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Besonders gefragt sind überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten, die Voraussetzung sind, um das zunehmend zentrale Feld der Digitalisierung zu gestalten.
Die Industriellenvereinigung hat dazu 2022 eine umfassende Studie vorgelegt, die das Kompetenz- und Qualifikationsniveau in Österreich analysiert. Das Ergebnis fällt wenig überraschend aus: IT-Kenntnisse gewinnen in den Unternehmen stetig an Bedeutung – allen voran in den Bereichen IT-Systems & Security sowie Software Engineering & Web Development. Laut der Studie »Qualifikationen für die österreichische Industrie« des Industriewissenschaftlichen Instituts halten 80 Prozent der befragten Betriebe IT-Systems & Security für sehr wichtig, und 84 Prozent erwarten eine weiter steigende Bedeutung von Software Engineering und Webentwicklung.
Es liegt auf der Hand, dass der Fokus auf IT-Systems & Security in Großunternehmen deutlich stärker ausgeprägt ist als in kleinen und mittleren Betrieben. Zugleich zeigen sich markante regionale Unterschiede in der Gewichtung einzelner IT-Disziplinen: In Niederösterreich, der Steiermark und Tirol kommt dem Bereich Software Engineering & Web Development eine besonders hohe Bedeutung zu.
Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel in der IT-Branche gravierend und betrifft nahezu alle Kompetenzfelder. Derzeit fehlen in Österreich insgesamt rund 12.000 IT-Fachkräfte. Besonders groß ist die Lücke im Bereich Software Engineering & Web Development mit bis zu 8.500 fehlenden Expertinnen und Experten. An der Spitze liegt jedoch das Feld IT-Systems & Security mit einem Defizit von rund 5.200 Fachkräften. In den Bereichen Data Science sowie Automatisierung & Artificial Intelligence wurden 2022 bereits Engpässe von 600 bzw. 900 Fachkräften verzeichnet – Zahlen, die sich seither wohl deutlich erhöht haben dürften.
Dennoch ist die IT nur einer von vielen Schauplätzen, an denen es dringendst einer Bildungs- und Qualifikationsoffensive bedürfte. Agenda Austria, Österreichs marktwirtschaftlich orientierter Think Tank, diagnostiziert seit Jahren strukturelle Schwächen: »Österreich gibt sehr viel Geld für Bildung aus – und bekommt
dafür nur mittelmäßige Resultate. In Schulnoten ausgedrückt verdient der Bereich bestenfalls ein ‚Befriedigend‘.«
Ein zentrales Reformfeld sieht die Agenda Austria in der frühen Sprachförderung. »Viele Kinder werden nicht entsprechend abgeholt – das betrifft vor allem jene mit Migrations- oder schwachem sozioökonomischem Hintergrund.« Frühförderung sei damit kein Luxus, sondern Voraussetzung für Integration und Ausbildung. Zugleich kritisiert der Think Tank die mangelnde Effizienz der Mittelverwendung: »Derzeit verpufft viel Geld, weil es nicht bei den Schülern ankommt.«
Kleine Klassen, große Kosten
Dem hält das Bundesministerium für Bildung eine differenzierte Sicht entgegen, wie sie im Bildungsbericht 2024 dargelegt wird: Österreich verzeichne im europäischen Vergleich besonders hohe Bildungsausgaben – vor allem im Pflichtschulbereich. Ursache dafür sei jedoch weniger Luxus als vielmehr die Struktur des Systems: kleinere Klassen, höhere Lehrerzahlen und ein dichtes Netz an Schulen in ländlichen Regionen treiben die Pro-Kopf-Kosten in die Höhe.
Besonders deutlich zeigt sich das bei den Mittelschulen, die im Vergleich zu den AHS-Unterstufen deutlich teurer abschneiden – vor allem aufgrund geringerer Schülerzahlen und engerer Betreuungsverhältnisse. Auch im Volksschulbereich zeigt sich ein kleinteiliges System: Selbst in Städten bestehen zahlreiche Kleinschulen, die den Aufwand pro Kind weiter erhöhen.
Betrachtet man die Bildungsausgaben hingegen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, relativiert sich der Befund: Österreich liegt hier im europäischen Mittelfeld, wobei die Pandemie diese Relation nur kurzfristig verzerrt hat. Auffällig bleibt allerdings die Finanzierungsstruktur: Während in vielen Ländern private Mittel eine größere Rolle spielen, wird das österreichische Bildungswesen nahezu vollständig staatlich getragen – was zwar Chancengleichheit sichert, die öffentliche Hand aber erheblich belastet.
Wenn Bildung zur Standortfrage wird
Laut Agenda Austria könnte Österreich in der Bildungspolitik »eine Platzierung unter den Top 10 weltweit erreichen«, wenn Wettbewerb, Transparenz und Zielorientierung konsequenter gestärkt würden. Für die Steiermark würde das vor allem mehr Vergleichbarkeit zwischen Schulen, klarere Leistungsindikatoren und mehr Verantwortung auf regionaler Ebene bedeuten. Darüber hinaus fordert die Denkfabrik eine aktivere Rolle der Eltern: Wer seine Kinder sprachlich nicht ausreichend fördert, soll zu verpflichtenden Beratungsgesprächen geladen werden – im Extremfall sogar mit finanziellen Konsequenzen. Ein umstrittener, aber folgerichtiger Gedanke, der in vielen Betrieben auf Zustimmung stößt. Denn dort gilt: »Wenn Grundkompetenzen nicht stimmen, ist das kein Schulproblem allein, sondern ein gesellschaftliches.«
Die Kritik der Agenda Austria ist damit mehr als theoretisch – sie bietet eine betriebswirtschaftliche Perspektive auf ein Bildungssystem, das sich zu stark an Strukturen und zu wenig an Ergebnissen orientiert. Bildungspolitik wird so zur Frage von Effizienz und Rendite. Doch diese Sichtweise greift naturgemäß zu kurz: Gute Bildung erschöpft sich nicht in der Vermittlung von Grund-
kompetenzen. Entscheidend ist auch, wie der sogenannte tertiäre Bildungsbereich – also Universitäten und Fachhochschulen – jene Qualifikationen hervorbringt, die Österreichs Industrie und Wirtschaft im internationalen Wettbewerb brauchen.
Überakademisiert und unterfinanziert
In der Betrachtung dieses Segments fällt zunächst auf, wie sehr sich der tertiäre Sektor in den letzten Jahren fragmentiert hat. Das Angebot an Studienrichtungen hat sich ebenso vervielfacht wie die Bildungseinrichtungen selbst, an denen man akademische Würden erwerben kann. War vor einigen Jahren der Erwerb eines akademischen Grades noch auf einige wenige Universitäten beschränkt, hat sich dieses Bild heute grundlegend geändert. Seit 1999 wird im Rahmen des Bologna-Prozesses in fast ganz Europa die höhere Bildung forciert, das Ziel ist die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes. Alleine in der Steiermark buhlen neben den traditionellen Universitäten (Karl-Franzens-
• Historisch stark, aktuell Mittelmaß:
Seit Maria Theresias Schulreform 1774 ist Bildung Kern des Staates – doch heute liegt Österreich bei Lesekompetenz und Naturwissenschaften nur im europäischen Durchschnitt.
• Hohe Ausgaben, geringe Wirkung: Österreich investiert überdurchschnittlich viel in Bildung, erzielt aber nur „befriedigende“ Resultate. Kleine Klassen und viele Kleinschulen treiben die Kosten, ohne die Leistung zu heben.
• Digitalisierung ohne Fachkräfte: Über 12.000 IT-Experten fehlen – allein 8.500 im Software Engineering. Gerade MINT-Kompetenzen entscheiden über Österreichs industrielle Zukunft.
• Überakademisierung wächst: Rund 380.000 Studierende und 21 % Akademikerquote –viele Berufsfelder verlangen heute Studienabschlüsse, wo früher Meistertitel genügten.
• Sprache als Schlüsselkompetenz: Fast 30 % der Bevölkerung haben Migrationshintergrund. Fehlende Deutschkenntnisse und Integrationsprobleme senken das Bildungsniveau und verschärfen den Fachkräftemangel.
Universität, TU Graz und Montanuniversität Leoben) auch die Medizinische Universität, die Pädagogische Hochschule, die private pädagogische Hochschule Augustinum, die Universität für Musik und darstellende Kunst, die FH Joanneum und die FH Campus 02 um Studenten. Das schafft natürlich Konkurrenz auf dem Bildungsmarkt, was die Universitäten schmerzlich spüren, obwohl immer mehr Studierende die Inskriptionsbüros stürmen. In diese Kerbe schlägt auch der Rektor der TU Graz, Horst Bischof, im aktuellen Fazit-Gespräch: »Was wir in Österreich sicher nicht haben, sind zu
wenige Universitäten. Wir haben 22 Universitäten im Universitätsgesetz, dann kommt die IT:U mit einem eigenen Gesetz, und mit den Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten sind wir bei 77 höheren Bildungseinrichtungen. Für ein Land dieser Größe ist das mehr als ausreichend.« Jedes zusätzliche Angebot, so Bischof, ziehe Studierende ab. »Wir sind in einem demografischen Wandel, es werden immer weniger Studierende, und man teilt den Kuchen durch mehr Player.« Im Fall der TU Graz könnten die rückläufigen österreichischen Studierendenzahlen durch Studierende aus dem Ausland, vor allem aus Südosteuropa, kompensiert werden.
Die Überakademisierung und ihre Folgen
Der Wandel im tertiären Bildungsbereich hat auch die Sekundarstufe grundlegend verändert – also jenen Bereich, der junge Menschen auf den Erwerb höherer Bildung vorbereitet. Immer mehr drängen an Universitäten und Fachhochschulen, denn ein akademischer Abschluss gilt längst nicht mehr als Privileg, sondern als Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Damit ist Bildung vom Aufstiegsversprechen zur Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt geworden – mit der Folge einer zunehmenden Überakademisierung. Zu Recht stellt sich die Frage, ob die Angleichungsbemühungen nicht zu weit gegangen sind. Akademische Titel sind heute selbst in Berufen üblich – ja oft notwendig –, die früher mit einer Gesellen- oder Meisterprüfung auskamen.
Das spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktdaten wider: Wer keinen akademischen Abschluss besitzt, hat – besonders im fortgeschrittenen Alter – ein deutlich höheres Risiko, arbeitslos zu werden.
Derzeit studieren rund 380.000 Menschen in Österreich, das entspricht etwas mehr als vier Prozent der Bevölkerung. Noch beeindruckender ist der Anteil der Akademiker insgesamt: Ende 2023 verfügten 21 Prozent der 25- bis 64-Jährigen über einen Hochschul- oder Akademieabschluss. Diese Entwicklung ist Teil eines globalen Trends. Seit den 1970er-Jahren steigt die Zahl der Studienanfänger weltweit, besonders stark zwischen 1990 und 2000 – als der Zugang zu höheren Bildungswegen deutlich erleichtert wurde.
Die Kehrseite dieser Öffnung ist jedoch ein sinkendes Einstiegsniveau, vor allem in den MINT-Fächern. In Österreich wird dieser Effekt durch den intensiven Wettbewerb zwischen den Bildungseinrichtungen etwas abgefedert. Peter Riedler, Rektor der KarlFranzens-Universität Graz, betont dazu im Fazit-Gespräch: »Angesichts der Universitätslandschaft müssen Bildungsinstitute einem klaren, langfristigen Auftrag folgen – und diesen nicht durch immer neue Angebote und Institutionen gefährden.«
Auch für die KF-Uni liegt das Potenzial für künftige Studierende längst nicht mehr nur in Österreich, sondern im internationalen
Mehr Menschen. Mehr Möglichkeiten. Mehr Miteinander.

150.000 Betriebe. 770.000 Beschäftigte. 70 Milliarden Euro Wertschöpfung.
Umfeld. Dabei spielen auch Kooperationen mit anderen Universitäten eine entscheidende Rolle. Für Peter Riedler etwa ist es die TU Graz, mit der die KF-Uni eng kooperiert. »Das größte Potenzial kommt aus Südostasien. Unser Image, die geografische Nähe sowie unsere deutsch- und englischsprachigen Ausbildungsformen kommen uns zugute. Interessanterweise entschließen sich etwa viele Studierende aus Bangladesch für das englischsprachige Computational Social Systems Masterstudium, das wir gemeinsam mit der Technischen Universität Graz anbieten.« Dennoch, so Riedler, könne man nicht wirklich steuern, wer an seiner Uni studieren solle. »Studenten entscheiden oft sehr kurzfristig, was sie wo studieren wollen.« Man könne nur weiterhin für gute Sichtbarkeit sorgen und den Nachwuchs aktiv und gezielt über Messen, Veranstaltungen und Forschungsaufenthalte ansprechen.
Verlust an Sprache, Verlust an Zukunft
Nachwuchs aus Österreich ist für die traditionellen heimischen Universitäten also nur mehr bedingt Thema, vielerorts scheint man resigniert zu haben. Dabei geht es auch um den Elefanten im Raum, den niemand so recht ansprechen will. Das sinkende Bildungsniveau der Primar- und in der Folge der Sekundarstufe durch einerseits die mangelnde Integration von Schülern mit Migrationshintergrund und andererseits durch die Schulreformjahre der letzten Dekade, die deutliche Spuren hinterlassen haben.
Die standardisierte, kompetenzorientierte Matura sollte Vergleichbarkeit schaffen – stattdessen klagen viele Betriebe über sinkendes Niveau. Das wird schon bei jenen spürbar, die gleich nach der Matura in den Arbeitsmarkt eintreten. »Wir bekommen Maturanten, die formell alles bestanden haben, aber in den Grundlagen schwach sind«, sagt eine Personalchefin aus Graz, die nicht genannt werden möchte. »Die Motivation ist da, das Wissen nicht«, sagt sie. Natürlich habe das auch mit der Migration zu tun. Die wirkt sich erheblich aus: Fast 30 Prozent der Bevölkerung haben Migrationshintergrund, in vielen Familien wird einfach nicht mehr Deutsch gesprochen – mit fatalen Auswirkungen für den Unterricht. Dabei sind noch nicht einmal jene Brennpunktschulen beleuchtet, in denen es Klassen gibt, in denen ausschließlich fremdsprachige Kinder sitzen oder die deutschsprechenden Kinder eine verschwindende Minderheit darstellen.
Sie in ein Bildungssystem zu überführen, das einst geeignet war, 32 Nobelpreisträger hervorzubringen, ist eine schwierige bis unlösbare Aufgabe. Bildung muss wieder als Wert an sich erkannt werden, um die Nachfrage am Arbeitsmarkt decken zu können. Gelingt das nicht und gibt man dem Zeitgeist einer Gen Z nach, wird man hierzulande bald niemanden mehr finden, der komplexere Aufgaben lösen will und lösen kann.

Wir haben vor der Wahl versprochen, dass wir kein Spital schließen wollen.
Landeshauptmann Mario Kunasek

Landesbudget:
Gemischte Gefühle: Während Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und LH-Stv. Manuela Khom (ÖVP) bei der Präsentation des Landesbudgets 2026 Zuversicht zeigen, blickt Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) deutlich ernster – denn Stabilität ist noch lange keine Sanierung.
Defizitstabilisierung statt Sanierung Spätestens seit der Präsentation des steirischen Landeshaushalts 2026 im ehrwürdigen Rittersaal des Landhauses ist klar, dass die schwarz-blaue Landesregierung kein Sparwunder vollbracht hat, sondern bestenfalls ein politisch dekoriertes Durchwursteln. Einige Alibiaktionen im Sozialbereich, die sich vor allem gegen Ausländer richten, ein paar Einschnitte in der Kultur – das mag auf den ersten Blick nach Disziplin klingen, ändert aber nichts daran, dass das Defizit im Gesundheitsund Pflegebereich neuerlich um satte 137 Millionen Euro steigt.
Landeshauptmann Mario Kunasek zeigte sich – wie erwartet – sehr zufrieden mit dem Haushalt, weil es gelungen sei, die jahrelange Dynamik steigender Ausgaben zu durchbrechen und erstmals alle Ressorts der Landesregierung gleichermaßen von der neuen Budgetdisziplin zu erfassen.
Auch LH-Stv. Manuela Khom äußerte sich positiv: Mit dem Landesbudget 2026 konnte man die Ausgabensteigerungen deutlich bremsen und das Zero-Base-Budgeting habe Doppelgleisigkeiten beseitigt und die Kostensteigerungen in Gesundheit, Soziales und Personal erstmals seit Jahren abgeflacht.
Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) dürfte das anders sehen. Er hat zwar versucht, die Ausgabenfreude seiner Regierungskollegen zu zügeln. Doch am Ende blieb er der brave Kassenwart einer Koalition, in der die FPÖ das Sagen hat –und in der echtes Sparen als unpatriotisch gilt, sobald es die eigene Wählerklientel betrifft. Bei der Budgetpräsentation meinte er daher mit spürbarem Sarkasmus, dass man an seinem Ressortbudget (Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft, Finanzen) sehen könne, was möglich gewesen wäre. Ehrenhöfer ging nämlich selbst mit gutem Beispiel voran: Seine Ausgaben betragen
zwar nur rund fünf Prozent des gesamten Landeshaushalts, die von ihm geplanten Einsparungen von 56,7 Millionen Euro machen jedoch mehr als die Hälfte der gesamten Kürzungen über sämtliche Ressorts hinweg aus. Zwar schrumpft das Defizit im Regelhaushalt von 300 auf 144 Millionen Euro, das Gesamtergebnis ist mit einem Abgang von 835 Millionen Euro dennoch ernüchternd. Von nachhaltiger Finanzierbarkeit kann keine Rede sein.
Das Ergebnis ist ein Haushalt, der niemandem wirklich wehtut. Der Finanzlandesrat musste wohl ein Budget vorlegen, das garantiert keinen Schatten auf das erste Landeshauptmannjahr von Mario Kunasek wirft.
Gesundheitslandesrat Karl-Heinz Kornhäusl (ÖVP) durfte hingegen erleben, dass Vernunft im Spitalsbereich von der FPÖ weder gewollt noch mehrheitsfähig ist. Sein Defizit steigt um 130 Millionen Euro – nicht nur wegen des medizinisch-technischen Fortschritts, sondern auch als Folge eines FPÖ-Dogmas, das jeden Spitalsstandort für „sakrosankt“ erklärt. Der Preis für diese Symbolpolitik ist ein System, das immer teurer, aber nicht besser wird.
Im Kulturbereich treffen die Kürzungen vor allem das Universalmuseum Joanneum (UMJ). Die Steiermark-Schau wird ersatzlos gestrichen. Darüber hinaus muss das UMJ künftig Schließtage einlegen, und bei geplanten Einsparungen von 3,2 Millionen Euro werden wohl auch die nicht beamteten Mitarbeiter zittern. Die freie Kulturszene hat übrigens rechtzeitig lautstark protestiert und blieb von sämtlichen gebotenen Einschnitten verschont.
Im Agrarressort kommt Simone Schmiedtbauer (ÖVP) weitgehend ungeschoren davon. Ihre Ausgaben sinken von 543 auf 535 Millionen Euro – das ist kaum mehr als eine statistische Delle.
Im doppelt so teuren Sozialbereich schafft FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer gerade einmal Einsparungen von zehn Millionen Euro. Gekürzt wird vor allem dort, wo es sich im FPÖ-Wording als „patriotisch“ verkaufen lässt – also bei Leistungen für

Ausländer. Auf echte Reformen, die auch Wählerstimmen kosten könnten, lässt sich der Soziallandesrat nicht ein. Innerhalb seines Globalbudgets will Amesbauer die Ausgaben für Asylwerber in der Grundversorgung von 76 auf 51 Millionen Euro senken und begründet das mit erwarteten niedrigeren Antragszahlen sowie einem noch nicht kommunizierten neuen Gesetz, das die Grundversorgung regeln soll.
In Summe gibt das Land inzwischen mehr als 80 Prozent seines Budgets für Soziales, Gesundheit und Personal aus. Beim Personal will Landeshauptmann Mario Kunasek zwar künftig nur mehr zwei von drei Abgängen nachbesetzen. Doch von einer echten Sanierung, wie sie mit Hilfe auf öffentliche Haushalte spezialisierten Beratungsfirmen durchaus erreichbar wäre, will man trotz der hohen Ausgaben nichts wissen.
Dabei wäre ein Engagement von „Roland Berger“, deren Experten bereits die Haushalte von Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen saniert haben, durchaus anzuraten. Einen echten Turnaround würden aber wohl auch „Alvarez & Marsal“, „AlixPartners“, „PwC – Business Recovery Services“ oder die „Boston Consulting Group –Turn Public Sector“ schaffen.
Die Steiermark steht finanziell an einem Punkt, an dem kosmetische Eingriffe längst nicht mehr reichen. Trotzdem verkauft die Regierung den Steirerinnen und Steirern die bloße Stabilisierung eines viel zu hohen Defizits als Sanierung – denn für echte Strukturreformen fehlt den Regierungsspitzen der Mut.
Kopftuchverbot – Symbolpolitik oder Integrationsauftrag
Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) verteidigt das geplante Kopftuchverbot für unter 14-Jährige gegen Kritik von Verfassungsexperten, der Gleichbehandlungsanwaltschaft und der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). Diese sehen in dem Gesetz eine Ungleichbehandlung muslimischer Mädchen, da andere religiöse Symbole wie
MIT JOHANNES TANDL

Kreuze in Klassenzimmern nicht betroffen sind. Bereits 2020 war ein ähnliches Gesetz vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden.
Plakolm verweist darauf, dass man aus dem damaligen Urteil gelernt habe und nun ergänzende Maßnahmen umsetze, um Mädchen zu stärken und patriarchalen Strukturen entgegenzuwirken. Gezielte Projekte zur Burschenarbeit und Mädchenförderung sollen mit insgesamt fünf Millionen Euro unterstützt werden. Damit will das Ministerium verhindern, dass traditionelle Rollenmuster und Abhängigkeiten verfestigt werden. Als Beispiel gilt die Initiative „Heroes“, bei der junge Männer geschult werden, Gleichaltrige für Themen wie Ehre, Religion und Gleichberechtigung zu sensibilisieren. Auch das Frauenzentrum des Integrationsfonds soll künftig stärker gefördert werden.
Die Ministerin sieht die ablehnenden Reaktionen islamistischer Influencer als Beleg dafür, dass das Gesetz einen sen-
Integrationsministerin Claudia Plakolm verteidigt das geplante Kopftuchverbot als Maßnahme zur Stärkung junger Mädchen und zur Förderung von Integration.
siblen Punkt treffe. Kritiker werfen der Regierung hingegen vor, Symbolpolitik zu betreiben, die gesellschaftlich mehr spalte als integriere.
Integrationsexpertin Emina Saric hält verpflichtende Maßnahmen grundsätzlich für geeignet, um Emanzipationsprozesse zu fördern. Viele Frauen würden erst durch Integrationskurse Selbstvertrauen und Eigenständigkeit entwickeln, wenn die Teilnahme verpflichtend sei.
Das Gesetz soll noch im laufenden Schuljahr in Kraft treten. Schulleitungen müssen dann Gespräche mit betroffenen Schülerinnen führen, Eltern einbinden und gegebenenfalls Jugendhilfe und Bildungsdirektion informieren. Als letzte Konsequenz sind Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro vorgesehen. Lehrervertreter warnen jedoch vor zusätzlicher Bürokratie und sehen dringlichere Herausforderungen im Bildungsbereich, etwa bei der digitalen Überforderung oder der Gesundheitsprävention.

Die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit nach Artikel 12 der Grundrechtecharta der Europäischen Union ist kein bloßes Bürgerrecht, sondern ein Fundament der europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Sie garantiert nicht nur Demonstrationen auf der Straße, sondern auch den Zusammenschluss von Unternehmen, Gewerkschaften, NGOs und politischen Parteien – also genau jene Vielfalt organisierter Interessen, die den europäischen Pluralismus trägt.
Juristisch wurzelt Artikel 12 GRC in Artikel 11 EMRK und entfaltet dieselbe Tragweite. Der EuGH hat in mehreren Leitentscheidungen verdeutlicht, dass diese Freiheit zu den »tragenden Pfeilern der demokratischen Gesellschaft« zählt. In der Rechtssache Schmidberger (2003) wurde sogar eine Autobahnblockade durch Umweltaktivisten als zulässige Ausübung der Versammlungsfreiheit anerkannt – trotz Behinderung des freien Warenverkehrs. In den Fällen Viking und Laval (2007) bestätigte der EuGH, dass auch Streiks und kollektive Aktionen von Gewerkschaften grundrechtlich geschützt sind, solange sie verhältnismäßig bleiben und die Binnenmarktfreiheiten nicht unverhältnismäßig einschränken.
In wirtschaftspolitischer Hinsicht bildet Artikel 12 das Rückgrat der europäischen Sozialpartnerschaft. Die Freiheit, Verbände zu gründen, ermöglicht Tarifautonomie, Mitbestimmung und sozialen Ausgleich. Ohne sie gäbe es keine Kammern, keine Gewerkschaften, keine Unternehmerverbände – und keinen institutionalisierten Dialog zwischen Kapital und Arbeit. Der EuGH betonte jüngst im Verfahren Kommission / Ungarn (2020), dass auch das Recht von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), finanzielle Mittel zu erhalten, integraler Bestandteil der Vereinigungsfreiheit ist. Einschränkungen, die zivilgesellschaftliches Engagement faktisch ersticken, verletzen daher die Charta. Gesellschaftlich ist Artikel 12 GRC ein Gradmesser für den Zustand der Demokratie. Von Klimaprotesten bis zur europäischen Parteienförderung: Wo Menschen sich frei zusammenschließen dürfen, entsteht Innovation und Vertrauen. Wo diese Freiheit eingeschränkt wird, schrumpft der demokratische Raum – und mit ihm das Vertrauen in Staat und Markt.
Fazit: Die Vereinigungsfreiheit ist somit weit mehr als juristische Rhetorik: Sie ist das institutionelle Rückgrat einer offenen, resilienten und wirtschaftlich starken Union.
Dr. Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt und Universitätslektor in Graz. Er ist spezialisiert auf Bau-, Immobilien-, Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht. ak-anwaltskanzlei.at

LH-Stv. Manuela Khom und VP-Klubobmann Lukas Schnitzer starten eine Offensive für mehr Bürgernähe. Bei Abgeordneten-Sprechtagen will die Steirische Volkspartei zuhören, anpacken und Lösungen finden.
Der Landtagsklub der Steirischen Volkspartei will mit neuen Abgeordnetensprechtagen Nähe zeigen, zuhören und handeln. Politik soll wieder persönlicher werden – mit offenen Ohren für die Anliegen der Steirerinnen und Steirer.
Herr Schnitzer, was steckt hinter der Aktion?
Unser Anspruch ist klar: Wir machen Politik für die Menschen –mit ihnen gemeinsam. Die Volkspartei ist in allen Regionen verwurzelt. Diese Nähe ist keine Show, sondern Teil unseres Selbstverständnisses. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass unsere Mandatare Zeit für die Anliegen der Menschen haben – persönliche Gespräche statt Anonymität.
Wie läuft das ab?
Ab Ende Oktober finden in allen Bezirken verstärkt Sprechtage statt – in Büros, Wirtshäusern oder an Treffpunkten. Ziel ist, zuzuhören, Anliegen aufzunehmen und Lösungen zu suchen. Kein Problem ist zu groß, keine Sorge zu klein.
Warum braucht es so eine Aktion, wenn Ihre Funktionäre ohnehin laufend in Kontakt mit den Menschen stehen?
Natürlich sind unsere Funktionärinnen und Funktionäre täglich unterwegs. Aber in Zeiten, in denen Politik oft als zu weit weg wahrgenommen wird, wollen wir bewusst ein Zeichen setzen:
Die Steirerinnen und Steirer sollen wissen, dass sie einen direkten Draht zu Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom und zu uns haben. Sich um Sorgen und Unsicherheiten zu kümmern, ist ureigenste Aufgabe von Politik.
Welche Themen werden im Vordergrund stehen?
Wir geben keine Themen vor. Die Menschen bestimmen, worüber gesprochen wird – von Teuerung über Pflege bis Verkehr oder Sicherheit. Wichtig ist: Alle Anliegen werden von Manuela Khom und der Steirischen Volkspartei ernst genommen.
Wie fließen die Rückmeldungen in die politische Arbeit ein?
Alle Anregungen werden gesammelt und in die Arbeit des Landtagsklubs eingebracht. Wiederkehrende Probleme werden auf Landesebene aufgegriffen. Politik lebt vom Vertrauen – und das entsteht, wenn man sich Zeit nimmt, zuhört und handelt.
Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung
Am 15. September bekam die Merkur Versicherung die Auszeichnung verliehen, das Steirische Landeswappen zu führen. Die Auszeichnung würdigt die Verdienste des Unternehmens um die steirische Wirtschaft und Gesellschaft. „Die Überreichung des Steirischen Landeswappens ist Auszeichnung, Anerkennung und Vertrauensbeweis, in erster Linie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Merkur Versicherung zu dem machen, was sie ist: ein Unternehmen, das durch gesellschaftliche Verantwortung und Zusammenhalt seit 227 Jahren erfolgreich in der Region verankert ist. Unser Ziel ist es, auch mit Blick auf den Wirtschaftsstandort, diesen Weg weiterzugehen“, freut sich der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung.
Grazer Airport startet Winterflugplan

Das Highlight des am 26. Oktober startenden Winterflugplans ist die neue Flugverbindung mit der British Airways Tochter BA Euroflyer nach London Gatwick ab 21. November. Aber auch die Direktflüge zu weiteren Metropolen sowie Badedestinationen und die zahlreichen Flüge zu den großen Flugdrehkreuzen haben großes Potenzial für Reisefreuden. „Seit langer Zeit können wir auch im Winter wieder Istanbul mit dem Zielflughafen Sabiha Gökçen anbieten“, freut sich GF Wolfgang Grimus. „Damit stehen unseren Fluggästen auch im Winter insgesamt sechs Umsteigeflughäfen zur Verfügung. Im Winter Sonne tanken ist ein Traum, der leicht Wirklichkeit wird. Teneriffa, Antalya, Gran Canaria und Hurghada stehen wöchentlich bzw. zweimal pro Woche am Plan. Infos: www.graz-airport.at/flugplan




Die Mitarbeiter:innen der Gesundheitsdrehscheibe nehmen sich Zeit, hören zu und helfen beim nächsten Schritt. graz.at/ gesundheitsdrehscheibe





Gerade im technischen Bereich, wie beim Grazer Unternehmen Anton Paar, ist engagierter Nachwuchs stark gefragt.
Trotz konjunkturell schwieriger Rahmenbedingungen bleibt die Entwicklung am steirischen Lehrstellenmarkt stabil. Das zeigen aktuelle Zahlen der WKO Steiermark, die bei der Gala „Stars of Styria“ präsentiert wurden.
In der Steiermark absolvieren derzeit 14.928 Jugendliche eine Lehre – rund 3.717 davon in Graz, verteilt auf 978 Betriebe. Bei der feierlichen Auszeichnung am 7. und 8. Oktober ehrte die WKO Graz gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Politik 241 neue Stars of Styria – darunter 140 Lehrabsolventinnen und -absolventen, 40 Meisterinnen und Meister sowie 61 Ausbildungsbetriebe.
„Diese Auszeichnung ist ein kräftiges Zeichen der Wertschätzung für alle, die in Ausbildung und damit in die Zukunft investieren“, betonte WKO-Regionalstellenobmann-Stv.in Natalie Moscher-Tuscher. Gemeinsam mit WKO-Vizepräsidentin Gabriele Lechner, WKO-Dir. Karl-Heinz Dernoscheg und Regionalstellenleiter Viktor Larissegger überreichte sie die Urkunden. Demografischer Wandel schmälert Nachwuchs
Die Verantwortlichen warnten vor den Folgen des demografischen Wandels: Aufgrund schwacher Geburtenjahrgänge ist die Zahl der unter 25-Jährigen weiter rückläufig. „Wir stehen mitten in einem demografischen Tsunami“, so Moscher-Tuscher. Umso wichtiger sei es, junge Menschen frühzeitig für technische und handwerkliche Berufe zu begeistern. Mit Initiativen wie dem Talentcenter der WKO, das jährlich über 8.000 Jugendliche bei der Berufsorientierung unterstützt, will die Kammer den Fachkräftemangel abfedern. „Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist die duale Ausbildung unser größter Stabilitätsfaktor“, unterstrich Lechner. Die Veranstaltung „Stars of Styria“, unterstützt von Raiffeisen, Uniqa und Energie Steiermark, zeigte eindrucksvoll, dass die Lehrlingsausbildung weiterhin als Erfolgsmodell gilt – und dass die jungen Fachkräfte von heute die Wirtschaft von morgen prägen.

Einer der renommiertesten Krisenexperten, Martin Zechner, gab beim Clubabend am 14. Oktober sein Wissen rund um Krisenmanagement an die Mitglieder des Steirischen Presseclubs weiter. „Gute Krisenkommunikation ist eine Frage der Haltung“, so eine der Botschaften des Abends. So könne mit einer offensiven Kommunikationspolitik die Dauer der Krise entscheidend verkürzt werden. „In den letzten Jahren beschäftigen wir uns verstärkt mit Reputationskrisen“, so der Experte. Dafür braucht es zeitnahe Reaktion, Authentizität sowie Lösungs- und nicht Problemorientierung. Und trotz aller Stressfaktoren gelte es auch, Folgendes nicht aus den Augen zu verlieren: „Eine Krise hat immer auch positive Aspekte und bietet Chancen zur Veränderung.“

Am 7. Oktober wurde der Merkur Campus wiederum zum Schauplatz einer Begegnung von Kunst, Gesundheit und Wohlbefinden. Unter dem Titel „Ins Bild träumen – Seele und Körper stärken“ präsentierte H. W. Ötscherer rund 30 seiner Landschaftsgemälde. Ötscherer, der mit seinem Künstlernamen an sein Aufwachsen vor dem Ötscher erinnert, verbindet in seinen Bildern die Kraft der Natur mit einer tiefen inneren Ruhe. Er malt in Acryl und schafft mit seinen Werken wahre Energiequellen für Körper, Geist und Seele. Zahlreiche Kunstinteressierte nutzten die Gelegenheit, die Werke in entspannter Atmosphäre zu erleben. Für das kulinarische Wohl sorgte das Team des Arravané. Die Werke sind bis zum 13. November am Merkur Campus zu sehen.

Unter dem Motto „Graz baut aus“ wurde 2025 das Öffi-Netz in Graz weiter ausgebaut und parallel dazu auch die Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Energie und Telekommunikation verbessert. Am 3. November startet mit dem zweigleisigen Ausbau der Linie 1 in der Hilmteichstraße nun ein weiteres Verkehrsprojekt. Vize-Bgm.in Judith Schwentner: „Mit dem zweigleisigen Ausbau der Linie 1 schaffen wir schnellere und verlässlichere Verbindungen für tausende Fahrgäste. Gleichzeitig sorgen neue Rad- und Gehwege sowie mehr Grün für mehr Sicherheit und Lebensqualität entlang der Hilmteichstraße. Die Menschen in Mariatrost profitieren doppelt: von besserer Mobilität und von sauberem Wasser durch den neuen Speicherkanal.“

EBSCON 2025 in Graz: „Creative Destruction“
Unter dem diesjährigen Leitmotiv „Creative Destruction“ diskutierten am 8. Oktober im Messecongress Graz internationale Top-Speaker und Experten aus Industrie, Think Tanks und Start-ups mit knapp 350 Teilnehmern aus 23 Nationen auf der EBSCON 2025 darüber, welche „alten Systeme“ und „alten Technologien“ abgelöst werden und wie das künftig „Neue“ am Horizont zu erkennen ist. Der steirische LR Willibald Ehrenhöfer und die Kärntner LH-Stv.in Gaby Schaunig betonten in ihren Eröffnungs-Statements die Entwicklungsmöglichkeiten und das Entstehen eines gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraums durch den Koralmtunnel und andererseits die großen Chancen, die sich durch innovative Entwicklungen in der Branche am Standort ergeben.

Die Trüffelweine 2025 sind gekürt
Auch heuer suchten die Genusshauptstadt Graz und die Wein Steiermark beim 8. Internationalen Trüffelfestival wieder die besten Weinbegleiter zur Edelknolle. Getreu dem Motto „Steirischer Wein trifft Graz-Trüffel“ wurden die Siegerweine 2025 von einer prominenten Jury gekürt: Weingut Lambauer / 2022 / Südsteiermark DAC/ Ried Gaisriegl Riesling; Weingut Pfeifer Daniel − Eruption / 2022 / Vulkanland Stmk DAC / Ried Schemming Chardonnay; Weingut Edi Tropper / 2021 / Vulkanland Steiermark DAC / Ried Buchberg (Straden) Grauburgunder. „Die Trüffelweine 2025 zeigen, wie wunderbar der steirische Wein und die Grazer Trüffel zusammenpassen. Ich gratuliere den Gewinnern herzlich“, betonte Stadtrat Günter Riegler bei der Eröffnung des Festivals.

Sie übernehmen ein breites Ressort von Kultur bis Familie. Wo wollen Sie als neue Stimme in der Stadtregierung Akzente setzen?
Ob Familien, Kulturschaffende oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen – ich werde für alle meine Stimme erheben. Die geplanten Budgetkürzungen der Linkskoalition treffen Jugend und Familie besonders hart. Hier ist Kampfgeist gefragt. Noch ist nichts beschlossen – also werde ich, wie mein Vorgänger Günter Riegler, lästig sein und das Bestmögliche herausholen.
Sie betonen Zuhören und Handeln im Sinne der Menschen. Wie wollen Sie in der aktuellen Konstellation gestalten – und wo ziehen Sie Grenzen gegenüber der KPÖ?
Mir ist Eigenverantwortung wichtig – das Zutrauen, das Leben selbst zu gestalten. Das unterscheidet mich wohl am meisten von der KPÖ. In Kuba habe ich erlebt, wie unfrei ein kommunistisches System ist. Ich bin sozial, aber ich stehe für Hilfe zur Selbsthilfe und für Rechtsansprüche statt Almosen. Wenn Bürgermeisterin Kahr und Stadtrat Krotzer 15 Millionen Euro anhäufen, um die Not zu lindern, die sie durch Kürzungen selbst verursachen, ist das nicht meine Vorstellung von Politik. Was Graz fehlt, ist eine Vision.
Bildung und Wissenschaft sind Zukunftsfelder. Wie kann Graz hier bestehen, wenn die KPÖ kürzt?
Diese Kürzungen sind ein schwerer Fehler. Bildung, Wissenschaft, Jugend und Familie sind die Basis jeder modernen Stadt. Man kann nur hoffen, dass die Grazer das erkennen – und 2026 für einen Kurswechsel sorgen.

Die Landeshauptstadt Graz feiert einen bedeutenden Fortschritt in ihrer Bildungsstrategie: Mit der International Baccalaureate-(IB)-Zertifizierung der Volksschule Leopoldinum in der Smart City wird erstmals in Österreich eine öffentliche Volksschule Teil des weltweit anerkannten International-Baccalaureate-Programms. StR. Kurt Hohensinner begrüßt den Schritt als „doppelten Turbo für Bildungsqualität und Wirtschaftsstandort“: „Bildung ist ein zentraler Standortfaktor. Internationale Unternehmen und zuziehende Fachkräfte brauchen verlässliche, hochwertige Bildungsangebote für ihre Kinder. Gerade in einer Stadt mit Global Playern wie AVL List oder Infineon ist ein international anschlussfähiges Schulangebot von besonderer Bedeutung.“

Vielfalt und Emotion auf der Grazer Herbstmesse
Fünf Tage lang – vom 2. bis 6. Oktober 2025 – zeigte sich die Grazer Herbstmesse von ihrer besten Seite: laut, bunt, emotional und voller Lebensfreude. Der große Relaunch ist gelungen – und das mit großem Erfolg: Zigtausende Besucher und Besucherinnen strömten begeistert durch das Eingangsfoyer West der Halle A, entdeckten frische Themenwelten, trafen alte Bekannte und ließen sich von der besonderen Stimmung mitreißen. „Wir wollten wieder dieses Kribbeln spürbar machen, das eine echte Messe ausmacht – Begegnungen, Erlebnisse, Emotionen. Und das ist uns gelungen“, sagt MCG-Geschäftsführer Martin Ullrich. „Die Stimmung war unglaublich positiv – vom ersten Messetag bis zum letzten Abend. Das war ein Aufbruch, der Mut macht.“


Ball im Zeichen des Miteinanders und der Vielfalt
Rund 800 Gäste feierten beim All in One Ball im Grazer Congress am 4. Oktober einen Abend voller Tanz, Begegnung und gelebter Inklusion. Auf fünf Tanzflächen sorgten Shows, Performances und Live Acts für Bewegung, Emotion und Gänsehautmomente. Unter den Ehrengästen waren Werner Kogler, Daniela Gmeinbauer, Kurt Hohensinner, Claudia Unger, Isabella Essl und Aglaia Szyszkowitz. Der Ball wurde von der Tanzschule Conny & Dado sowie dem Verein Dance and make a Difference organisiert und stand ganz im Zeichen von Miteinander, Vielfalt und Dankbarkeit – besonders gegenüber jenen, die im Ehrenamt und Sozialbereich tagtäglich dafür arbeiten, dass es allen Menschen gut geht. Ein Abend, der zeigte, wie Inklusion tanzen kann – Schritt für Schritt, Takt für Takt.
Spendenaktion für Caritas-Marienstüberl
Seit Anfang des Jahres gilt in Österreich das Pfandsystem. Pro PET-Flasche und Getränkedose werden 0,25 Euro Pfand eingehoben. Das Universitätsklinikum Graz startet nun gemeinsam mit Saubermacher eine Sammelaktion für den guten Zweck. Patienten, Mitarbeiter und Besucher können ihre Gebinde bis Ostern direkt am LKH-Campus einwerfen und damit ihren Pfandbetrag spenden. Der Erlös kommt dem Marienstüberl der Caritas in Graz zugute. Gemeinsam wollen die Partner heuer auch die Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ unterstützen. Saubermacher-Gründer Hans Roth: „Ich bin sehr dankbar für diese gemeinsame Initiative mit dem LKH-Univ. Klinikum Graz. Denn seit jeher ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.“

(v.l.) Feierliche Eröffnung des größten PV-Parks der Energie Steiermark: Vorstand Martin Graf, Bgm.in Waltraud Walch, Vorstand Werner Ressi sowie Enery-CEO Richard König
In Dobl-Zwaring bei Graz wurde am 1. Oktober der größte Photovoltaik-Park der Energie Steiermark eröffnet. Die Anlage liefert ab sofort grünen Strom für mehr als 6.000 Haushalte im Bezirk GrazUmgebung.
Auf dem 20 Hektar großen Areal werden jährlich über 22 Mio. KWh Sonnenstrom produziert. Damit können mehr als 6.300 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart werden. Eine agrarische Doppelnutzung ist Teil des PV-Parks: Mehr als 100 Schafe haben unter den Paneelen eine neue Weidefläche gefunden. Die Energie Steiermark investierte mit dem Partner-Unternehmen Enery rund 13 Mio. Euro in das Vorzeige-Projekt, das in nur einem Jahr Bauzeit umgesetzt werden konnte.
Sonnenstrom-Offensive
„Die Energie Steiermark investiert in den nächsten Jahren rund 5,5 Mrd. Euro in den Ausbau Erneuerbarer Energie und die Stromnetze. Unsere SonnenstromOffensive sieht vor, in den kommenden Jahren 300 MW Leistung zu installieren. Damit könnten über 100.000 Haushalte über die Sonne versorgt werden“, so das Vorstands-Team Martin Graf und Wer-
ner Ressi. „Angesichts der erfolgreichen Umsetzung unserer Projekte gehen wir davon aus, dass wir die Klimaziele des Landes punktgenau erreichen werden“. „Dabei geht es nicht nur um die Frage der Nachhaltigkeit, sondern vor allem um die Unabhängigkeit von Importen und die Versorgungssicherheit“, so Graf und Ressi.
Zukunftsweisende Lösung
Richard König, CEO Enery Development, und Enery COO Lukas Nemec freuen sich über die partnerschaftliche Kooperation: „Wir haben an der Entwicklung das Agro-PV Projekt Dobl seit 2020 gearbeitet und freuen uns mit dem Kooperationspartner Energie Steiermark die Anlage zu eröffnen.“ In der Gemeinde Dobl-Zwaring findet die Anlage positiven Zuspruch. „Wir sind überzeugt, dass der PhotovoltaikPark eine äußerst zukunftsweisende Lösung für unsere Gemeinde, für das Klima und die Zukunft unserer Kinder ist“, erklärt Bgm.in Waltraud Walch.

Manfred Geiger, Direktor der BKS Bank-Direktion Steiermark
Die BKS Bank veranstaltet im Oktober die Investmentwochen. Was steckt hinter diesem Format?
Damit setzen wir ein Zeichen für den individuellen Vermögensaufbau. In Zeiten hoher Inflation und von Unsicherheiten möchten wir unsere Kunden ermutigen, über das klassische Sparen hinauszudenken. Schon kleine, regelmäßige Beträge in Investmentfonds oder ETFs können langfristig eine solide Basis schaffen. Besonders junge Erwachsene profitieren vom Startdepot und attraktiven Einstiegsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie: Diese Veranlagungen sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten.
Welche Rolle spielt persönliche Beratung dabei?
Eine zentrale. Unsere Kunden wünschen sich Begleitung auf Augenhöhe. Vom ersten Depot bis zur langfristigen Anlagestrategie. Wir nehmen uns Zeit für individuelle Gespräche und zeigen, wie sich Chancen am Kapitalmarkt nutzen lassen. Bei Veranstaltungen oder Webinaren teilen wir unser Wissen und laden zum Austausch ein.
Wie fügt sich das in Ihre langfristige Strategie ein?
Wir verbinden Tradition mit Zukunft. Der Weltspartag ist nach wie vor ein fester Bestandteil, doch mit den Investmentwochen haben wir ein Format geschaffen, das der heutigen Zeit gerecht wird. Dabei stehen Sicherheit, Renditechancen und Nachhaltigkeit im Fokus, um ein stärkeres Bewusstsein für den Kapitalmarkt zu schaffen.
Von Peter K. Wagner und Johannes Tandl mit Fotos von Erwin Scheriau

Horst Bischof, Rektor der TU Graz, über künstliche Intelligenz in der Lehre, internationale Talente und die Zukunft der technischen Bildung.


Mittig auf dem massiven Schreibtisch steht ein Lego-Modell, das von Studierenden gebaut wurde, links daneben ein Häferl der Freiwilligen Feuerwehr und dahinter ein Bierkrug mit dem Logo von Sturm Graz. Der Blick an die Wand verrät jedoch langsam, dass wir uns im Büro des Rektors der TU Graz befinden – und das nicht nur aufgrund der unzähligen Bücher im Regal.
Über siebzig gebundene Dissertationen stehen dort wie Trophäen, daneben noch mehr Diplom- und Masterarbeiten.
»Wenn Professoren sagen, Dissertationen seien schwer zu betreuen, zeige ich gerne auf meine Wand«, sagt Horst Bischof, Rektor der Technischen Universität Graz, und lächelt.
Es ist Oktober und nur wenige Tage sind vergangen, seit er eine Erstsemestrigenvorlesung hinter sich gebracht hat – Thema:
Künstliche Intelligenz. »Das macht mir noch immer Spaß, das Vorlesen«, sagt er. Die Frage, die er seinen Studierenden stellte, treibt auch ihn um – und ist eine von vielen, die wir ihm in der kommenden Stunde stellen werden: Warum soll man überhaupt noch studieren, wenn es KI gibt?


Was wir in Österreich sicher nicht haben, sind zu wenige Universitäten.
Horst Bischof
Herr Rektor, die KI gilt als größter Gamechanger der aktuellen Zeit. Wie geht gerade die TU Graz damit um? Wir stimmen dem zu hundert Prozent zu, dass KI der Gamechanger in allen Bereichen wird. Die Frage ist, wie bringe ich das Thema KI in jedes Studium hinein? Universitäre Prozesse sind aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt die schnellsten. Hätten wir den konventionellen Weg gewählt, hätte das wahrscheinlich drei, vier Jahre gedauert. Wir haben uns für folgendes entschieden: Wir starten jetzt im Herbst mit einem Erweiterungsstudium »Artificial Intelligence Engineering« – zwei Semester, offen für alle Studiengänge außer Informatik, die haben das ohnehin in ihrem Studium. Voraussetzung ist ein technischer Bachelor.
Was lernt man da konkret?
Gewisse Grundinformatik, dann Grundlagen der künstlichen Intelligenz und – ganz wichtig – ein großes Projekt im eigenen Fach. Wenn ich etwa Maschinenbauer bin, dann geht es also um ein KI-Projekt im Maschinenbau. Da lernt man zum Beispiel, wie eine Maschine mit modernen KI-Methoden designt werden kann. Das ist mehr als »ChatGPT« – mehr als das, was der Normalsterbliche verwendet. Wir haben bereits 130 Anmeldungen für den ersten Durchlauf.
Welche Regulierungen gibt es bezüglich KI für die Studierenden?
Wir haben seit etwa zwei Jahren Leitlinien für die Lehre. Die sagen im Wesentlichen: Bitte verwende es, aber deklariere es, wenn du es verwendest. Der Lehrende muss am Anfang der Lehrveranstaltung sagen, was erlaubt ist und was nicht. Transparenz ist wichtig. Man muss die Verwendung von KI zitieren, wenn man sie in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet. Es verändern sich eben auch Aufgabenstellungen. Statt »Schreib mir eine Seminararbeit zum Thema XY« heißt es jetzt »Schreib mir eine Seminararbeit zum Thema XY mithilfe von ChatGPT, finde die Fehler und korrigiere sie«.
Es gibt eine Diskussion darüber, ob man das Programmieren überhaupt noch lernen muss, weil das sowieso die KI übernimmt. Wie sehen Sie das?
Die »Vibe-Coding-Plattformen« [Anmerkung: Entwicklerwerkzeuge, die KI nutzen, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und zu vereinfachen.] sind mittlerweile fantastisch. Ich bin als mäßiger Programmierer mit KI um den Faktor fünf bis sechs schneller als ohne. Microsoft sagt, gute Programmierer sind um den Faktor zwei schneller. Die Frage ist, wenn unsere Erstsemestrigen nur noch mit diesen Plattformen programmieren lernen, werden sie jemals gute Programmierer, die dann die Fehler der KI finden? Das ist das Spannungsfeld, das wir lösen müssen. Wir müssen pädagogische Zugänge finden – die haben wir noch nicht, aber die hat glaube ich, noch niemand gefunden.
Sie müssen Menschen ja so ausbilden, dass Absolventen einem Unternehmen in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit mehr bringen, als jedermann durch die Befragung der KI kann.
Genau, darum geht es. Ich hatte auf der Kunstuniversität Graz Schulungen und Vorträge zu KI und auch dort gibt es ein großes Thema: Der typische Absolvent bzw. die typische Absolventin dort wird kein Star, das werden nur die wenigsten, sondern landet in einem Orchester als Begleitmusiker. Das kann die KI mittlerweile auch sehr gut.
Wie steht es um die technische Infrastruktur für KI-Forschung?
Wir haben innerhalb der Universitäten eine Plattform namens »Academic AI«. Das ist eine geschlossene Azure-Plattform [Anmerkung: Cloud-Computing-Dienstleistung von Microsoft.], bei der die Daten im Ökosystem bleiben. Es gibt einen ChatGPT-Zugang plus ein paar andere Tools, aber in einem geschlossenen System – die Daten verlassen den Server also nicht und der Server sitzt nicht in den USA. Wir zahlen als Universität dafür sehr wenig, eine geringe Grundgebühr plus Tokengebühren, weil sich alle Universitäten zusammengeschlossen haben, um es den Mitarbeitenden und – derzeit noch nur im Rahmen von Kursen – auch Studierenden anbieten zu können.
KI ist das eine Thema, das höhere technische Bildungseinrichtungen in Österreich beschäftigt – das andere ist der Wettbewerb und die allgemein sinkenden Studierendenzahlen. Mit der »IT:U« in Linz gibt es seit 2022 eine weitere digital orientierte Universität. Welche Auswirkungen hat das für die TU Graz?
Man muss dazusagen, dass die IT:U ja keine technische Universität im strengeren Sinn ist. Sie hat sich der Transformationsforschung verschrieben. Was wir in Österreich sicher nicht haben, sind zu wenige Universitäten. Wir haben 22 Universitäten im Universitätsgesetz, dann kommt die IT:U mit einem eigenen Gesetz, und mit den Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten sind wir bei 77 höheren Bildungseinrichtungen. Für ein Land dieser Größe ist das mehr als ausreichend.
Der Kuchen wird also kleiner?
Natürlich! Jedes zusätzliche Angebot zieht Studierende ab. Wir sind in einem demografischen Wandel, es werden immer weniger Studierende, und man teilt den Kuchen durch mehr Player. Wir haben rückläufige österreichische Studierendenzahlen und kompensieren das durch Studierende aus dem Ausland.
Woher kommen die?
Schwerpunkt bei der TU Graz ist Südosteuropa. Unsere stärkste Gruppe – wenn ich Ex-Jugoslawien zusammennehme – kommt von
Fazitgespräch
dort. Danach Deutschland, dann Italien. Wir haben viele Formate entwickelt, wie wir ausländische Studierende zu uns bringen. Im südosteuropäischen Raum haben wir das Format der Student Ambassadors: Leute, die hier studieren, schicken wir zurück in ihre Schulen und auf Bildungsmessen, damit sie dort über uns erzählen. Das wirkt tatsächlich, aber es braucht Aufwand.
Wie steigert man das Interesse an MINT-Fächern?
Wir haben viele Initiativen. Wir fangen sehr früh an – wir haben einen eigenen Kindergarten, die »Nanoversity«, wo Professorinnen und Professoren hingehen und Vorträge für Kinder halten. Dann unser MINKT-Labor [Anmerkung: Das K in MINKT steht für Kunst.], wo ganze Schulklassen hinkommen. Mir ist wichtig: ganze Klassen, nicht nur die Interessierten. Die Interessierten kommen sowieso zur Langen Nacht der Forschung. Im MINKT-Labor hatten wir im Vorjahr 4.000 Schülerinnen und Schüler zu Besuch.
Viele Kinder schlagen aus Angst vor der Mathematik andere Wege ein – gehen zum Beispiel eher an eine FH, um etwas Technisches studieren, als an die TU Graz. Wie nimmt man diese Angst?
Das ist eine Frage der Ausbildung an der Schule. Am Montag habe ich einen Preis verliehen für »Math Explorer«. Dahinter stecken Absolventinnen und Absolventen der TU Graz, die sich dem Ziel verschrieben haben, Mathematik populärer zu machen. Sie haben eine Art Escape Room entwickelt, wo man spielerisch mathematische Probleme lösen muss, um rauszukommen. Es gibt heute so sensationelle Onlinetutorials, dass man auch Gebiete begreifen kann, die ein Lehrer nicht vermitteln konnte. Mich ärgert, wenn der Ö3-Mo-
derator sagt, »Ah, Mathematikmatura, oje!« Er verbreitet diese Angst vor Mathematik öffentlich und bedient Klischees. Dabei geht ohne Mathematik gar nichts.
Ohne Spezialisierung auch nicht. Die TU Graz hat sich zu dieser bekannt. Wohin geht die Reise?
Unser Fokus liegt primär auf dem Masterbereich. Meine Idealkonstellation wäre: Wir holen alle hervorragenden Masterstudierenden, die woanders hervorragend ausgebildet wurden. Deswegen lehren wir die Masterstudiengänge auf Englisch – da wollen wir Zuzug haben. Ein Masterstudium dauert zwei Jahre, das heißt, die Absolventinnen und Absolventen stehen in zwei Jahren schon dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
Kommen auch FH-Bachelors auf die TU Graz, um Ihren Master zu machen?
Das ist zwar kein Massenprogramm, aber auch das gibt es immer wieder. Was wir eher haben, sind Doktoratsstudierende, die von der FH kommen. Wir haben ja Kooperationsabkommen mit der »FH Joanneum« oder der »FH Campus 02«, um das zu ermöglichen.
Aber der Doktor ist – wahrscheinlich auch durch Bologna verursacht – sehr forschungsorientiert, oder? Früher hat man ihn gemacht, um seine eigene Bildungskarriere zu krönen.
Das Doktoratsstudium war bei uns an der TU Graz immer schon forschungsorientiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Doktorarbeit, typischerweise eingebettet in ein großes Forschungsprojekt, sehr oft gemeinsam mit Firmen oder gesponsert von Förderorganisati-

onen. Im Doktoratsstudium lernt man das Innovieren. Das sind die Leute, die dann in einer Firma neue Produkte entwickeln. Ich sage immer: In der Diplomarbeit lernt man heute, ein bisschen in die Forschung reinzuschnuppern. Im Doktoratsstudium lernt man, was echte Innovationen sind, also wie man etwas wirklich Neues macht. Und diese Leute brauchen die Firmen, weil wir auf neue Produkte angewiesen sind. Wir müssen weiterkommen, und genau dazu bilden wir die Leute im Doktorat aus.
Wie würden Sie das Leitbild der TU Graz in Bezug auf einen USP Ihrer Bildungseinrichtung definieren?
Wir haben einen globalen »Footprint«, sind aber regional transformativ unterwegs. Wir verstehen uns sehr international, sind in der internationalen Forschungscommunity verankert, aber wollen im regionalen Ökosystem tätig sein.
Ein gutes Beispiel dafür ist das »Virtual Vehicle«, ein großes Forschungszentrum, in dem Wissenschaft und Industrie gemeinsam an der Mobilität der Zukunft arbeiten. Was bedeutet es, dass die K2-Förderung nicht verlängert wurde und das Land über Joanneum Research einspringen musste?
Das Virtual Vehicle war das erste K2-Zentrum, das durch diesen Prozess gegangen ist. Es gibt nur mehr K1-Zentren – also weniger Fördermittel. Im Virtual Vehicle arbeiten fast 300 Personen und das hochqualitativ. Man hat daher nach Mitteln und Wegen gesucht, es in dieser Größe zu erhalten. Der Weg, den man gefunden hat, ist ein Zuschuss des Bundes, der über das »Joanneum Research« eingebracht wird.


Ist es vernünftig, das Virtual Vehicle in dieser Größe zu erhalten? Rechtfertigen die erzielten Ergebnisse diesen Aufwand? Unbedingt! Es ist eines der absolut erfolgreichsten Zentren, weil es mit Abstand die meisten EU-Projekte aller Zentren eingeworben hat – momentan laufen dort etwa 20 EU-Projekte. Für jeden Euro, den das Land reinsteckt, kommen drei Euro an Fördermitteln zurück. Das Virtual Vehicle ist nicht nur im Automotive-Bereich tätig, sondern auch im Rail- und Aviationbereich.
Wie geht es der TU Graz mit der Drittmittelfinanzierung in wirtschaftlich angespannten Zeiten?
Wenn ich so über die TU Graz generell drüberschaue, haben wir leichte Steigerungen in den Drittmitteln. In einzelnen Bereichen sehen wir Unterschiede. Institute, die mit Rail zu tun haben, boomen. Institute im Automotive-Bereich und im Maschinenbau leiden deutlich. Unsere Philosophie ist ein Drittelmodell: Ein Drittel kommt aus Fördertöpfen für Grundlagenforschung, ein Drittel aus anwendungsorientierter Forschungsförderung und ein Drittel als reine Auftragsforschung.
Was bringt die europäische Universitätsallianz »Unite!«, deren Teil die TU Graz ja ist?
Unite! bekommt Finanzierung aus dem Erasmus-Topf, hat also einen starken Lehrefokus. Der Vorteil bei unserem Netzwerk ist, es sind alles technisch orientierte Universitäten – Darmstadt, KTH Stockholm, Aalto, Lissabon, Turin, um nur einige zu nennen. Wir sprechen also dieselbe Sprache und haben dieselben Zielsetzungen. In der Forschung gibt es keine explizite Finanzierung, aber es


Von den arbeitsplatznahen Ausbildungen des AMS Steiermark profitiert auch Ihr Unternehmen:
Gemeinsam schulen wir Ihre künftige Fachkraft direkt im eigenen Betrieb. Wir beraten Sie dazu gerne!














Horst Bischof wurde am 26. März 1967 in Saanen in der Schweiz geboren und wuchs in der Obersteiermark auf. Nach der Matura am Borg-Murau studierte er Informatik an der TU Wien, wo er 1990 diplomierte und 1993 promovierte. 1998 habilitierte er sich dort mit einer Arbeit über »Neural Vision Modules«. 2004 wurde an der TU Graz Professor, ab 2011 war er Vizerektor für Forschung. Seit Oktober 2023 ist er Rektor. Bischof hat über 720 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne, eine Stieftochter und eine Enkeltochter.

Was uns wichtig ist, wir fördern unternehmerisches Denken während des Studiums.
Horst Bischof
macht trotzdem Sinn. Wir haben ein millionenschweres EU-Projekt namens »GreenChips-EDU«. Das haben wir in eineinhalb Wochen aufgestellt – normalerweise braucht man dafür Monate. Ich kenne die Partner, greife zum Telefon, und es läuft.
Gibt es Dinge, die man sich von den Allianzpartnern abschauen kann? Das »Product Innovation Project«, das Christian Ramsauer [Anmerkung: Leiter des Instituts für Innovation und Industrie Management] seit etwa 15 Jahren federführend betreut, hat seine Wurzeln tatsächlich in Aalto. Das Konzept funktioniert so: Eine Firma gibt eine Problemstellung. Sie wollen etwa eine Innovation für den Kofferraum eines Autos oder ein Navigationssystem für Fußgänger entwickeln. Wir stellen dann interdisziplinär zusammengesetzte Teams aus Studierenden zusammen, die über ein Semester hinweg ein Produkt für diese Firma entwickeln. Das endet dann oft damit, dass entweder ein Patent oder gar ein Spinoff entstehen oder dass die Firmen die Studierenden direkt engagieren.
Wohin zieht es Absolventen nach dem Studium an der TU Graz? Früher war es klar, dass Absolventinnen und Absolventen zu gewissen Leitunternehmen gehen. Heute ist es auch üblich geworden, dass sie zu Spinoffs gehen oder Projekte als erste Jobs annehmen. Technikabsolventen sind da viel offener als solche anderer Studien, weil sie die Gewissheit haben, dass sie immer einen Job finden werden. Was uns wichtig ist, wir fördern unternehmerisches Denken während des Studiums. Nicht zuletzt durch die Studierenden-Teams.
Wir haben einen Pokal vom Racing-Team im Empfangsraum entdeckt. Meinen Sie das damit?
Genau. Wir haben aber nicht nur das Racing-Team, wir haben mittlerweile 16 Studierenden-Teams. Gestern war tatsächlich das Racing-Team da – wir sind in der Weltrangliste auf Platz fünf von sieben- bis achthundert Teams weltweit, die FH Joanneum ist derzeit als Zweiter sogar noch besser als wir platziert. Wir haben auch ein Raketen-Team. Das sind 80 Studierende, die Raketen bauen, die drei Kilometer hoch fliegen können. Bei der letzten Weltmeisterschaft sind wir Zweiter geworden. Unser Robotik-Team ist aktuell sogar amtierender Weltmeister. Von uns bekommen diese Teams 5.000 bis 15.000 Euro, wir wollen sie auch bewusst fördern. Sie müssen selbst aber viel mehr Geld aufstellen. Das Racing-Team hat ein Budget von 200.000 Euro und greift da auf 15 bis 20 Sponsoren zurück, die es selbst organi-
sieren muss. Diese Studierenden lernen also, Geld aufzutreiben, einen Businessplan zu erstellen und Projekte umzusetzen. Und genau so entsteht schon im Studium das, was wir fördern wollen, nämlich unternehmerisches Denken.
Die TU Graz will bis 2030 klimaneutral sein. Was heißt das konkret? Wir haben als erste österreichische Universität eine Roadmap zur Klimaneutralität mit über 60 Maßnahmen entwickelt. Wir bauen etwa Photovoltaik auf all unseren Dächern aus. Bei Dienstreisen »incentivieren« wir Bahnfahrten und haben einen Malus auf Flugreisen eingeführt – innereuropäisch sind das 100 Euro, außerhalb 200 Euro. Dafür kostet die Bahnreise nur die Hälfte. Das wurde von uns so kalibriert, dass es budgetneutral ist. Wir verbieten nichts, aber die Leute denken nach. Muss ich fliegen oder geht es auch anders? Wir haben zudem Anschubfinanzierungen für grüne Themen, damit in diesem Bereich mehr Forschung passiert, und mit der Bundesimmobiliengesellschaft haben wir in einem »Memorandum of Understanding« festgehalten, dass wir bei Neubauten an der TU Graz innovative Lösungsansätze für nachhaltiges Bauen umsetzen werden.
Da kommen wir wieder zum Thema KI – die künstliche Intelligenz frisst enorm viel Strom. Braucht die TU Graz nicht einen eigenen Supercomputer für KI-Forschung?
Es gibt den »Vienna Scientific Cluster« für ganz Österreich, das ist ein klassischer Rechner. Der neue heißt »Musica« und wird noch im dieses Jahr eröffnet. Parallel habe ich stark dafür gekämpft, dass wir die »AI Factory« nach Österreich bekommen. Das ist ein Hochleistungsrechner, der am selben Standort aufgebaut wird wie Musica. Damit kann man etwa bei der Kühlung/Abwärme Synergien nutzen. Natürlich braucht das Ding jede Menge Strom, wobei bei Musica und AI Factory die Abwärme ins Wiener Fernwärmesystem fließt. Das ist zumindest ein Ansatz für Nachhaltigkeit.
Sie haben den Erstsemestrigen ja erst kürzlich eine Vorlesung zum Thema KI gehalten. Was war die Conclusio Ihres Vortrags?
Ich habe am Ende gefragt: Was erwarte ich von einem Absolventen, einer Absolventin der TU Graz? Natürlich, dass sie alle Tools, auch KI, beherrschen – aber ebenso die Grundlagen ihres Fachs. Eine Absolventin muss KI-Fehler erkennen und korrigieren können. Genau darauf bereiten wir sie vor.
Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch!

Mitte Oktober hat der Nationalrat den Beschluss gefasst, dass der Investitionsfreibetrag (IFB) zeitlich befristet erhöht wird: So berechtigen Investitionen, die zwischen 1. November 2025 und 31. Dezember 2026 getätigt werden, zu einem IFB von 20 %, einschlägige Maßnahmen, welche dem Bereich „Ökologisierung“ zuzurechnen sind, sogar von 22 %. Das entspricht einer deutlichen steuerlichen Attraktivierung von Investitionen, lag bisher der IFB-Satz bei 10 % bzw. 15 %. Alle anderen Bestimmungen um den IFB – insbesondere die Begünstigungsfähigkeit der Investitionen, die Höchstgrenze von 1 Mio € Anschaffungs- oder Herstellungskosten pro Wirtschaftsjahr und Betrieb sowie die Geltendmachung von Teil-Anschaffungs- und Herstellungskosten – bleiben grundsätzlich unberührt. Der befristet erhöhte IFB steht auch zu, wenn eine Investition nach dem begünstigten Zeitraum endet, allerdings nur dann, wenn der IFB bereits für die auf den begünstigten Zeitraum entfallenden aktivierten Teilbeträge geltend gemacht wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die Ansprüche auf den befristet erhöhten IFB nicht erst zeitverzögert nach dem begünstigten Zeitraum geltend gemacht werden, sondern spätestens für das Jahr 2026.
Hinsichtlich der Höchstgrenze und damit verbundener (beschränkender) Aliquotierungsbestimmungen ist erfreulicherweise auch eine Verschiebung von Teilbeträgen in vorherige oder nachgelagerte Zeiträume vorgesehen.
Fazit: Wer vor Investitionen steht, sollte demnach eine Verschiebung der Anschaffung bzw. Herstellung in den begünstigten Zeitraum erwägen.

Japan scheint die lange Deflationsphase endlich hinter sich zu lassen. Ob daraus ein nachhaltiger Aufschwung entstehen wird, hängt aber maßgeblich davon ab, ob die Lohnsteigerungen durch Produktivitätszuwächse getragen werden – und ob die kleinen Unternehmen des Landes mitziehen können. Ein gutes Zeichen ist jedenfalls, dass die Investitionen schon seit 2022 kräftig steigen.
NGeidorfgürtel
ach fast drei Jahrzehnten der Deflation erlebt Japan seit 2022 eine Phase anhaltend steigender Preise. Was zunächst auf teure Rohstoffe und einen schwachen Yen zurückgeführt wurde, hat sich inzwischen zu einem strukturellen Phänomen entwickelt – angetrieben von kräftigen Lohnzuwächsen und einer erstarkten Inlandsnachfrage. Laut einer aktuellen Analyse des internationalen Kreditversicherers Coface könnte diese Entwicklung den lang ersehnten Wende-
punkt für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt markieren.
Nach dem Platzen der Spekulationsblase Anfang der 1990er-Jahre fiel Japan in eine „Bilanzrezession“. Unternehmen und Haushalte tilgten Schulden statt zu investieren oder zu konsumieren – die Preise stagnierten oder sanken. „In den vergangenen Jahrzehnten kam es zwar vereinzelt zu Inflationsschüben, diese waren jedoch meist temporär und durch externe Schocks wie Ölpreise oder Steuer-
erhöhungen bedingt – ohne nachhaltige Impulse aus der Binnenwirtschaft“, erklärt Junyu Tan, Asien-Volkswirt bei Coface.
Seit 2022 zeigt sich ein anderes Bild: Die Inflation liegt konstant über dem ZweiProzent-Ziel der Bank of Japan. Was als kostengetriebene Preissteigerung begann, hat sich zu einer nachfrageorientierten Dynamik entwickelt. Besonders der Dienstleistungssektor gibt steigende Kosten an Konsumenten weiter, während am Arbeitsmarkt hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft. Das Resultat: kräftige Lohnsteigerungen – 3,6 Prozent im Jahr 2023, 5,1 Prozent 2024 und 5,3 Prozent 2025, die höchsten Zuwächse seit über drei Jahrzehnten. „Diese Entwicklung markiert einen Paradigmenwechsel für japanische Gewerkschaften – weg vom Fokus auf Arbeitsplatzsicherheit, hin zu einer stärkeren Orientierung auf angemessene Löhne“, so Tan. Ob die neue Inflationsdynamik dauerhaft trägt, hängt entscheidend davon ab, ob Unternehmen ihre höheren Löhne durch Produktivitätssteigerungen kompensieren können. Nach Jahren der Zurückhaltung verzeichnen Japans Firmen seit 2022 ein deutliches Investitionsplus: durchschnittlich 9,1 Prozent jährlich, für 2025 wird ein weiteres Plus von 6,7 Prozent erwartet. Besonders gefragt sind Automatisierung und arbeitsentlastende Technologien, aber auch Forschung in Zukunftssektoren wie Halbleiter und grüne Energie. Ohne entsprechende Produktivitätsgewinne, warnt Coface, könnte der Reflationsprozess ins Stocken geraten.
Während große, exportorientierte Konzerne – vor allem in der Automobil- und Elektromaschinenbranche – vom schwachen Yen und der globalen Nachfrage profitieren, geraten kleine und mittlere Unternehmen zunehmend unter Druck. Ihre Margen und Preissetzungsspielräume reichen oft nicht aus, um steigende Löhne auszugleichen. Entsprechend wächst die Zahl der Insolvenzen, wenn auch auf moderatem Niveau. Langfristig wird diese Marktbereinigung jedoch zu einer effizienteren Wirtschaftsstruktur führen.
IV-Steiermark-GF Christoph Robinson fordert angesichts der anhaltend schwachen Industriekonjunktur tiefgreifende Reformen: „Wir brauchen endlich eine echte Rosskur bei Staatsausgaben, Regulierung und Bürokratie.“

Eine konjunkturelle Trendwende lässt in der steirischen Industrie weiter auf sich warten. Laut der aktuellen IV-Steiermark-Konjunkturumfrage, an der im dritten Quartal 42 Betriebe mit rund 38.000 Beschäftigten teilgenommen haben, saldieren sämtliche Indizes negativ. Das Geschäftsklima bleibt damit deutlich unter dem Österreichschnitt.
„Wir brauchen endlich eine echte Rosskur bei Staatsausgaben, Regulierung und Bürokratie“, fordert IV-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Robinson. „Dass wir seit Monaten keine Trendwende schaffen, liegt an der Trägheit unseres Standorts und an nicht mehr wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen.“
Knapp die Hälfte der Betriebe bewertet ihre Lage nur als durchschnittlich. Der Auftragsbestand stagniert (Saldo -7), die Auslandsaufträge rutschen nach einer kurzen Erholung erneut ins Minus. 20 Prozent der Unternehmen beurteilen die Exportlage
als schlecht. „Für ein exportorientiertes Land ist das ein Dämpfer – und ein Weckruf. Österreich darf sich Chancen wie das Mercosur-Abkommen nicht länger verwehren“, so Robinson.
Auch der Ausblick bleibt ernüchternd: Produktionstätigkeit (-15) und Beschäftigtenstand (-19) deuten auf anhaltende Zurückhaltung hin. Nur ein Prozent der Betriebe plant derzeit, Personal aufzubauen. Für das Frühjahr 2026 erwarten sogar 33 Prozent eine weitere Verschlechterung der Geschäftslage – der Index fällt auf -26 Punkte.
Robinson fordert daher ein entschlosseneres Handeln der Politik: „Von Aufatmen kann keine Rede sein. Die wirtschaftliche Lage muss endlich Causa prima der Landespolitik werden. Nur mit Reformen und einem zukunftsorientierten Budget schaffen wir wieder Spielräume für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung.“
Der steirische Maschinenbauer Binder+Co zog zur ersten Jahreshälfte 2025 eine gemischte Bilanz: Umsatz und Auftragseingang liegen auf Vorjahresniveau, doch das Ergebnis leidet unter starkem internationalem Druck.
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen setzt das Unternehmen auf Innovation, Nachhaltigkeit und das Bekenntnis zum Standort Österreich. Das Wirtschaftsklima bleibt weiterhin angespannt. Die Bauindustrie erholt sich nur schleppend, die US-Zollpolitik sorgt weiter für Unsicherheit und der Konkurrenzdruck aus Asien wächst.
Wirtschaftlich herausforderndes Umfeld Besonders im Bereich Umwelttechnik drückte eine schwächelnde Glasproduktion auf die Nachfrage nach Recyclinganlagen. Etwas positiver verlief die Entwicklung im Segment Aufbereitungstechnik: Die italienische Tochter Comec-Binder profitierte von einer
Erholung im Baurohstoffbereich. Auch Binder+Co USA konnte an die Vorjahre anschließen, wenngleich sich die Investitionsfreude in Nordamerika abschwächt. Im asiatischen Markt behauptet sich das Joint Venture Statec Binder mit seinen Verpackungsanlagen trotz lokalem Konkurrenzdruck erfolgreich. Mit über 40 Prozent Umsatzanteil bleibt Asien einer der wichtigsten Absatzmärkte des Unternehmens.
Standort Gleisdorf als Zukunftsbasis Während viele Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern, bekennt sich Binder+Co klar zu Österreich. In den Standort Gleisdorf mit 354 Mitarbeitern wird laufend investiert – in moderne Infrastruktur, Energieeffizienzprojekte und ein
neues Sozialgebäude. „Unser Standort ist ein zentraler Teil unserer Identität“, betont Vorstandsvorsitzender Jörg Rosegger, der seit 1993 im Unternehmen tätig ist. Gemeinsam mit Mario Stockreiter (Finanzen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung) und Peter Gradwohl (Produktion, F&E) bildet er das Führungstrio, das den Innovationskurs konsequent weiterführen will.
Technologische Schwerpunkte Binder+Co setzt gezielt auf smarte Lösungen für Recycling- und Aufbereitungsprozesse – von Glas und Metall bis hin zu Bauschutt. Auf der Bauma in München präsentierte das Unternehmen eine KI-gestützte Sortiermaschine, die im Baustoffrecycling deutlich höhere Ausbeuten erzielt. Darüber hinaus ist Binder+Co Partner im EU-geförderten Projekt „CDW-Life Circle“ in Brescia, das eine vollständige Wiederverwertung von Bauschutt anstrebt. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Innovationsmotor im europäischen Umwelttechniksektor. Künstliche Intelligenz ist bei Binder+Co längst Teil des Alltags – nicht nur in Produkten wie „b-connected“ oder „Clarity“, sondern zunehmend auch in internen Prozessen. Ziel ist es, Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette zu steigern. Die hohe Qualifikation und geringe Fluktuation der Belegschaft gelten dabei als zentrale Erfolgsfaktoren.
Das Führungstrio von Binder+Co (v. li.), Peter Gradwohl, Jörg Rosegger und Mario Stockreiter, setzt auf Innovation und hält am Standort Gleisdorf fest.

Forderung nach fairen Rahmenbedingungen Um die industrielle Basis in Österreich zu sichern, fordert Binder+Co von der Politik fairere Wettbewerbsbedingungen. Das Unternehmen sieht Handlungsbedarf bei den hohen Lohnnebenkosten sowie bei ungleichen Umwelt- und Produktionsauflagen gegenüber asiatischen Konkurrenten. „Wir brauchen ein Level Playing Field, um mit europäischen Qualitätsstandards international bestehen zu können“, heißt es seitens des Vorstands. Trotz heftigen Gegenwinds bleibt Binder+Co auf Kurs. Das Unternehmen setzt auf technologische Führerschaft, nachhaltige Prozesse und eine klare Branchenfokussierung. Der Standort Österreich bildet dabei das Rückgrat der Strategie – und soll es auch bleiben. „Wir investieren in Innovation, Menschen und Nachhaltigkeit – nicht in Verlagerung“, betont Rosegger. Mit dieser Haltung positioniert sich Binder+Co als Beispiel dafür, wie industrielle Wertschöpfung in Europa künftig erfolgreich bestehen kann.

Vereint in der Initiative für die neue Wirtschaftsregion „AREA SÜD“: (v.l.) Sebastian Schuschnig und Willibald Ehrenhöfer mit ÖBBVorständin Manuela Waldner, WK Präsident Jürgen Mandl (Kärnten) und WK Präsident Josef Herk (Steiermark).
Rund eineinhalb Monate, bevor die Koralmbahn ihren regulären Betrieb aufnimmt, haben die Wirtschaftskammern Steiermark und Kärnten in Wien die neue Region „AREA SÜD“ präsentiert. Das Ziel der Initiative ist es, den durch die historische Bahnverbindung entstehenden Ballungsraum als gemeinsamen Wirtschaftsstandort über die Grenzen hinaus zu vermarkten.
Bei der Veranstaltung im Justizcafé über den Dächern des Parlaments diskutierten am 29. September Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über die Chancen des Projekts. Unter ihnen befanden sich ÖBB-Vorständin Manuela Waldner (in Vertretung von CEO Andreas Matthä) sowie die Landesräte Willibald Ehrenhöfer (Steiermark) und Sebastian Schuschnig (Kärnten). Die beiden WKO-Präsidenten Josef Herk und Jürgen Mandl betonten bei der Tagung die gewaltigen Möglichkeiten des neuen Wirtschaftsraumes: „Wir wollen den Süden Österreichs als Vorzeigestandort in Europa etablieren.“
Dachmarke für den Süden Österreichs
Die Koralmbahn verkürzt die Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt künftig auf 45 Minuten und schafft den zweitgrößten Ballungsraum Österreichs nach Wien. Die so genannte „AREA SÜD“ umfasst ein Drittel der österreichischen Fläche mit 1,8 Mio. Einwohnern, 150.000 Betrieben und 770.000 Beschäftigten, die insgesamt eine Wirtschaftsleistung von 70 Mrd. Euro erbringen. Die WKOStudien prognostizieren einen starken Impuls für die Standortentwicklung. Die Dachmarke „AREA SÜD“, initiiert von den Kammern, soll internationales Marketing, strategischen Austausch und ein gemeinsames Forderungspaket auf Bundesebene fördern. Josef Herk bekräftigte die Chancen: „Die Koralmbahn schafft einen Ballungsraum von internationaler Größe. Unsere Agenda umfasst Arbeitsmarkt, Infrastruktur, Innovation und Vermarktung unter dem gemeinsamen Label.“ Der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer betont: „Die Kooperation in Wirtschaft und Forschung muss weiter intensiviert werden, um die Sichtbarkeit Südösterreichs zu steigern.“ Auch sein Amtskollege Sebastian
Schuschnig (Kärnten) ist überzeugt: „Die Koralmbahn ist Impuls für Wirtschaft, Verkehr und Tourismus. Die AREA SÜD fördert die notwendige Zusammenarbeit.“
Maßnahmenpaket für Nutzung der Synergien
Eine Umfrage unter 1.085 Unternehmen in beiden Ländern unterstreicht die Akzeptanz des Projekts: 90 Prozent bewerten die Kooperation positiv oder überwiegend positiv. Als größte Chancen gelten höhere Arbeitskräftemobilität (61 %), bessere Erreichbarkeit (59 %) und wirtschaftlicher Bedeutungsgewinn (52 %). Mehrheitlich wird von den Unternehmen eine engere Zusammenarbeit in Wirtschaft, Bildung, Verwaltung und Gesundheit gefordert. Politische Maßnahmen sollten den Infrastrukturausbau vorantreiben: 67 % fordern Breitband, Photovoltaik und Pumpspeicherkraftwerke; 57 % eine Vereinheitlichung von Landesgesetzen; 51 % einen gemeinsamen Markenauftritt. Basierend darauf haben die Kammern eine Maßnahmenagenda erarbeitet, die über den Kernraum hinausgeht. Dringende Infrastrukturprojekte sind ein neuer Bosruck-Eisenbahntunnel, der Ausbau von Güterverkehrszentren, die Güterverkehrsstraße zur Wörthersee-Umfahrung, der viergleisige Bahnausbau Graz–Bruck/Mur sowie Lärmschutz entlang der Wörthersee-Trasse.
Die Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember 2025 könnte den Süden Österreichs nachhaltig stärken, sofern die Forderungen umgesetzt werden. Experten warnen jedoch: Ohne flankierende Maßnahmen wie Deregulierung und Energiewende könnte das Potenzial ungenutzt bleiben. Die Initiative „AREA SÜD“ markiert einen Meilenstein in der regionalen Kooperation und könnte auch bald Vorbild für andere Regionen sein.

Am 22. Oktober wurde das 8. Internationale Trüffelfestival eröffnet. Bis zum 2. November erwartet die Besucher ein umfassendes Angebot: von Trüffelwanderungen, dem Internationalen Trüffelmarkt im Paradeishof bis hin zu kulinarischen Trüffel-Highlights in 25 Partnerbetrieben der Genusshauptstadt. „Das Trüffelfestival ist längst ein Fixpunkt im kulinarischen Kalender von Graz. Als Wirtschaftsstadtrat sehe ich in diesen Veranstaltungen nicht nur einen kulinarischen Höhepunkt, sondern auch einen Impuls für den Tourismus und die lokale Wirtschaft. Es verbindet internationale Spitzenprodukte mit regionaler Qualität und zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig unsere Gastronomieszene ist“, freut sich StR Kurt Hohensinner.



Bei der jüngsten Aufsichtsratssitzung der Knapp AG wurde der Vorsitz an die nächste Generation der Gründerfamilie übergeben. Herbert und Günter Knapp, die seit Gründung des Aufsichtsrats im Jahr 2009 die Verantwortung für dessen Vorsitz bzw. die Stellvertretung im Aufsichtsrat getragen haben, übergeben diese Funktionen nun an die nächste Generation der Gründerfamilie. Beide bleiben dem Unternehmen weiterhin auch als Mitglieder des Aufsichtsrats verbunden. Mit Tanja Knapp und Sigrid Hofmann übernehmen zwei Enkelinnen des Firmengründers Günter Knapp die Leitung des Aufsichtsrats. Beide sind seit Jahren Teil des Gremiums – Tanja Knapp seit 2012, Sigrid Hofmann seit 2015 – und haben sich über viele Jahre hinweg in ihre neuen Rollen hineinentwickelt.
Steiermärkische zeichnet Ideen von morgen aus
Im feierlichen Ambiente der Schlossbergsäle wurden am 13. Oktober die besten Projekte des „#weltvonmorgenFördertopfs“ prämiert. Insgesamt wurden 165 Projekte eingereicht – davon 37 in der Kategorie „Attraktive Lebensräume“ und 128 in der Kategorie „Gesellschaftliche Verantwortung“. „Zum 200-jährigen Jubiläum wollten wir bewusst nach vorne schauen. Er ist Ausdruck unseres Gründungsgedankens, der heute aktueller ist denn je: gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie viel Potenzial in mutigen Ideen steckt – und wie wichtig es ist, diesen Ideen eine Bühne zu geben”, beschreibt Georg Bucher, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse, die Idee hinter dem Fördertopf.
Die Stadt Leoben erhöht heuer den Heizkostenzuschuss für Sozialcard-Besitzer von 80 auf 90 Euro, um Menschen mit geringem Einkommen gezielt zu entlasten. Damit setzt die Stadt ein Signal für soziale Unterstützung in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir als Stadt dort helfen, wo Unterstützung am dringendsten gebraucht wird. Niemand soll im Winter frieren müssen“, betont Bgm. Kurt Wallner. Die Antragstellung beginnt am 20. Oktober und erfolgt gestaffelt nach den Anfangsbuchstaben des Nachnamens, um eine geordnete Abwicklung zu ermöglichen. Der Zuschuss wird automatisch ausbezahlt, wenn eine gültige Sozialcard (bis mind. 31. Dezember 2025) vorliegt.

Familie Hartlieb (3. und 4. v. l.) aus Heimschuh erhielten die Auszeichnung zur Ölmühle des Jahres 2026
Strahlende Siegergesichter waren das sichtbare Ergebnis der Champions-League der besten Kernöle. Viele landwirtschaftliche Betriebe überzeugten auch heuer mit Kürbiskernölen von hervorragender Qualität, aber Stockerlplätze konnte es nur drei geben. Den Titel „Ölmühle des Jahres“ holte sich die Ölmühle Hartlieb aus Heimschuh.
Leidenschaft für das Grüne Gold Aus den Top 20 Kürbiskernölen – ermittelt aus mehr als 500 Ölen – kürte eine 70-köpfige Jury aus Spitzenköchen und Prominenz die Kürbiskernöl-Champions 2025/26 in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg. Den begehrten Titel „Kürbiskernöl-Champion 2024/25“ holte sich erstmals die Familie Raidl aus Ottendorf an der Rittschein. Platz 2 ging an Andrea Wechtitsch und Franz Vollmaier aus Gündorf/St. Johann im Saggautal, Platz 3 holten sich Daniel Brauchart und Julia Schubert aus St. Peter im Sulmtal. LKPräs. Andreas Steinegger und LRin Simone Schmiedtbauer gratulieren den Preis-
trägern: „Unsere Top-Produzenten sind wahre Botschafter des steirischen Kürbiskernöls. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Qualitätsbewusstsein tragen sie das grüne Gold der Steiermark weit über die Grenzen Österreichs hinaus und zeigen, was heimische Landwirtschaft leisten kann.“
Verarbeitungsbetriebe im Fokus Zum fünften Mal wurde beim Kürbiskernöl-Championat auch die „Ölmühle des Jahres“ vor den Vorhang geholt, um die besonderen Leistungen der heimischen Ölmühlen ins Rampenlicht zu stellen. Denn ein gutes Kürbiskernöl kommt nur dann in die Flasche, wenn alle Arbeitsschritte perfekt durchgeführt werden: Die Arbeit am Feld, die Ernte, die Trocknung und Lagerung der Kerne sowie das schonende Rösten und das achtsame Verpressen in der Ölmühle. Die Ölmühle Hartlieb aus Heimschuh belegte den ersten Platz bei der Kür zur Ölmühle des Jahres 2026. Platz 2 erreichte die Ölmühle Schmuck aus Deutschlandsberg. Der dritte Platz ging an die Ölmühle Pronnegg aus Saggau.

Martin Palz, GF Wein Steiermark
Am 5. November erfolgt die Junker-Präsentation, welche Rolle spielt er für den Steirischen Wein?
Der Junker steht als Vorbote des neuen Jahrganges für jugendliche Frische und ist im Gegensatz zu den gereiften Weinen frech, aber für jeden zugänglich. Insofern eine klare Einladung an junge Menschen, in die Welt des Steirischen Weines einzutauchen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Leicht, trocken, fruchtbetont ist der Junker der Botschafter für Steirischen Wein schlechthin!
Was lässt sich bereits jetzt über den neuen Weinjahrgang aussagen?
In den Kellern gärt es zwar noch kräftig, aber die ersten Eindrücke sind groß + artig, ausgestattet mit allen Tugenden, die den Steirischen Wein ausmachen. Vollreife und gesunde Trauben mit hoher Intensität, v.a. bei den aromatischen Rebsorten, Frische und Lebendigkeit bei Säure und Phenolen und für alle Kalorienbewussten weniger Alkohol als zuletzt.
Inwiefern trägt das DAC-Herkunftssystem zur Etablierung des Steirischen Weins außerhalb Österreichs bei?
Die Herkunft macht unsere Weine unverwechselbar und bietet zudem die Möglichkeit zwischen Qualitäten zu differenzieren, um international vergleichbar zu sein. Die Dreistufigkeit ist die Anpassung an ein etabliertes System, in dem Riedenweine die höchste und wertigste Stufe einnehmen, während Gebiets- und Ortsweine die preiswerte und ausdrucksstarke Basis bilden.
Von Peter Sichrovsky

DDas Momentum-Institut hat eine vergleichende Statistik veröffentlicht, in welchem Land auf welchem Wege die wohlhabende Oberschicht zu ihrem Vermögen kam. Inwieweit wurde Reichtum selbst erwirtschaftet, durch Firmengründungen, Übernahme von Unternehmen, Entwicklung und Verkauf von Erfindungen, Investitionen oder andere kreative Methoden. Oder ob das Vermögen durch Erbschaft übernommen werden konnte. Das Ergebnis ist erschreckend für Österreich, das Land erreicht einen negativen Spitzenplatz. Von elf Ländern, über die das Verhältnis von Erben und Selbstschaffen veröffentlicht wurde, steht Österreich an erster Stelle mit dem höchsten Prozentsatz des Wohlstands durch Erben. An letzter Stelle steht das Vereinigte Königreich mit dem geringsten Prozentsatz. Nur ganze 16 Prozent der finanziellen Oberklasse in Österreich haben nach dieser Studie ihren Wohlstand selbst aufgebaut. 84 Prozent haben das Vermögen geerbt. Am anderen Ende der Tabelle stehen das Königreich, die Niederlande
und die Vereinigten Staaten. In Großbritannien konnten 89 Prozent der Wohlhabenden innerhalb einer Generation den Wohlstand erarbeiten. Nur elf Prozent der Besitzenden in Großbritannien ist durch Erbschaft reich geworden.
In der Spitzengruppe der Erbgesellschaft kommt nach Österreich unser Nachbar Deutschland auf Platz zwei mit 75 Prozent Reichtum durch Erbschaft, gefolgt von Spanien mit 74 Prozent. Auf der kreativen Seite, am anderen Ende der Liste, stehen vor dem Königreich die Niederlande mit 77 Prozent Reichtum durch Eigeninitiative und die USA mit 73 Prozent. Dazwischen liegen Italien, Frankreich, Schweden und die Türkei, die immer noch einen Erbanteil von 42 Prozent hat, wesentlich geringer als Österreich.
Wie könnte man diese Liste interpretieren? Tatsache ist, dass bei enormen Bildungsausgaben, die den Österreichern zur Verfügung stehen, das wirtschaftlich-kreative Element im Vergleich zu anderen Ländern verschwindend gering ist. Es geht dabei nicht um absolute Zahlen, sondern um das Verhältnis zwischen Verdienen und Erben. Es geht auch nicht um eine Neiddebatte. Der Kinder- und Enkelgeneration erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer sei es gegönnt, am Erfolg ihrer Familie teilzuhaben. Nur drängt sich der Verdacht auf, dass es um fehlenden Mut, Eigeninitiative und unzureichende Bedingungen gehen könnte, ein Vermögen innerhalb einer Generation aufzubauen. Das eventuell fehlende Talent kann keine Erklärung sein. Es ist nicht anzunehmen, dass Begabung die Ursachen für die Unterschiede zwischen den europäischen Länder untereinander und zur USA sind.
Das Problem der fehlenden Wirtschaftsentwicklung – mit Österreich an letzter Stelle in Europa, bis vor einem Jahr sogar mit einem negativen Wirtschaftswachstum – wird allerdings mit geplanten Sparprogrammen nicht einfach verschwinden. Einsparungen werden vielleicht das Budget entlasten. Ankündigungen wie Pensionsreform, weniger Kindergeld und geringere Werbeausgaben der Ministerien haben wenig Einfluss auf Neugründun-
gen von Unternehmen, Finanzierung von Startups und finanzielle Unterstützung von Übernahmen existierender Firmen, um sie zu modernisieren.
Wer sagt es ihnen also, wer spricht mit den Verantwortlichen in der Regierung, die anscheinend von einer lebendigen, innovativen und flexiblen Ökonomie nur sehr wenig Ahnung haben? Wenn Österreich im »AT Kearny Index«, der Reihung der Länder für Investitionen internationaler Konzerne, irgendwo vergessen unter ferner liefen liegt, sollte das die verantwortlichen Regierungsmitglieder erschrecken; tut es jedoch nicht.
Eine Familie hat zwei Möglichkeiten, eine problematische finanzielle Situation zu stabilisieren. Sie gibt weniger aus, fährt nicht auf Urlaub, sucht eine billigere Wohnung oder verschiebt den Kauf eines neuen Autos. Die andere Möglichkeit – die erstere nicht ausschließt – ist die Suche nach einem besser bezahlten Job. Das ist mit Aufwand verbunden, mit mehr Aufwand als bloße Reduzierung der Ausgaben. Es benötigt Mut, Fantasie, Geduld, Hartnäckigkeit, eine größere Flexibilität und Bereitschaft bezüglich Ort und Arbeitsbedingungen und in manchen Fällen eine zusätzliche Ausbildung. Alles komplexer, komplizierter und risikoreicher als bloße Einsparung. Nur wer erklärt es der Regierung? n
Sie erreichen den Autor unter peter.sichrovsky@wmedia.at
Ich will hier Sätze schreiben, die den Glauben an die Möglichkeit des Friedens stärken. Sind denn nicht in der Geschichte der Menschheit immer abwechselnd Zeiten des Friedens und des Krieges gewesen? Gehen mir dann die Ursachen, Erklärungen und Anlässe durch den Kopf, drängen sich die Spekulationen auf, wie sie in den Gasthäusern und Cafés heiß diskutiert werden. Es ist für mich befremdlich, wie so viele ganz genau zu wissen glauben, was die Kriegsführer beabsichtigen und welche Strategien sie verfolgen.
Krieg und Frieden
In dieser Zeit der Kriege in unserer Nähe habe ich den berühmten Roman von Leo Tolstoi »Krieg und Frieden« gelesen, in dem die Veränderungen in Ansichten und Eigenschaften im Laufe eines Krieges sich darstellen, und stelle solche Veränderungen auch bei meinen Bekannten und Freunden fest. Wie schnell man, als ob es sich um ein Fußballspiel handelte, gezwungen wird, eindeutig Partei zu ergreifen. Die Entstehungsgeschichte scheint dann nicht besonders bedeutsam. Die Grausamkeit des Krieges scheint die Sichtweise und Möglichkeiten, friedlich aus dem Konflikt auszusteigen, zu verhindern. Dass der Krieg sich nicht nur auf dem Schlachtfeld abspielt, sondern auch auf den Alltag Auswirkungen hat und natürlich auch auf die Zeit nach dem Krieg, weiß man. »Nie wieder«, heißt es dann und hat es schon geheißen.
Mein Großvater ist als Bauernsohn und Erbe eines Hofes in den Ersten Weltkrieg gezogen und hat sich danach nie mehr zurechtgefunden. Er ist desertiert und fand keinen Weg zurück in ein normales Leben. Was sein Onkel nutzte, um ihm sein Erbrecht zu rauben. Der Kampf um das Erbe ist ein bekannter Streitpunkt und Anlass von innerfamiliären Kriegserklärungen. Alles, was im Laufe des Familienlebens seelisch oder materiell ungerecht geschehen ist, wird dann beim Erben eingebracht, ausgekämpft und soll ausgeglichen werden. Die Erbfolgekriege waren historisch oft bestimmend für die Aufteilung der Länder. Da half auch das »Tu felix Austria nube« nicht viel.
Geht es einem besser, wenn man weiß, warum und wie ein Krieg beginnt und zustande kommt? Schläft man dann ruhiger ein und ist dann selbst weniger streitlustig und »friedlicher«? Ich würde gern dabei sein und zuhören, wie im Kriegsfall verhandelt und »gedealt« wird. Wer welche Interessen offen oder versteckt einbringt und welche Bedeutung die unzähligen Opfer haben, die im Kampf um Gebiete und Interessen ihr Leben lassen müssen.
Religionskriege
Wenn man durch das Palten-Liesing-Tal fährt und bei Rottenmann eine beeindruckende Burg sieht, wird einem erst bei einer Führung durch diese bewusst, welch bedeutende Rolle diese vor 500 Jahren für ein friedliches Zusammenleben in der Steiermark gespielt hat oder besser hätte. Der damalige Burgherr Hans Hoffmann hatte Religionsfreiheit ausgehandelt. Man stelle sich vor, wie eine solche sich auf das Geistesleben in der Steiermark ausgewirkt hätte. Andere haben dieses Übereinkommen zunichte gemacht. Johannes Kepler, der mit dem Burgherrn befreundet war, musste – wie viele Protestanten – das Land verlassen. Die Luther-Bibel musste versteckt werden. Dreißig Jahre Religionskrieg hätten vermieden werden können. Was zeigt, wie Glaube, Macht und Besitz miteinander verbunden sind.
Die Geschichte ist eine wechselhafte Folge dessen, was man Zeitgeist nennt. Seit Jahrtausenden wechselt dieser und bringt Verheerungen oder Zeiten des Friedens. Deshalb sollte man auch nicht jene verachten oder lächerlich machen, die an den Frieden, friedliche Bemühungen und an Verträge glauben, die den Frieden sichern und für eine solche Lösung arbeiten.
Die Argumente derer, die sich für Abrüstung und Frieden einsetzen, und derer, die für Aufrüstung, Wirtschaftskrieg und Waffengang plädieren, stehen sich in heftigen Diskussionen gegenüber. Letztendlich entscheidet über Krieg oder Frieden, welche Stimmen sich durchsetzen und die Macht haben, sie umzusetzen.

Christian Wabl, geboren 1948 in Graz, Studium der Kunst und Lehramt Deutsch an der Universität von Amsterdam sowie Studien in den Sprachwissenschaften, Hebräisch und Philosophie. Er ist Mitbegründer mehrerer Alternativschulen und arbeitete lange bildungspolitisch in der Grünen Akademie Steiermark.
Wie ein friedliches Zusammenleben durch ein Ereignis in eine kriegerische Stimmung umkippen kann, zeigen Erbschaftsstreitigkeiten.
Krieg und Frieden im Wirtshaus Wenn sich die Gemüter erhitzen, wächst selbst im Wirtshaus ein aggressiver Diskussionsstil und können Meinungsunterschiede durchaus zu Handgreiflichkeiten führen, wodurch sogar harmlose Konflikte ein fatales Ende nehmen. So kennzeichnet den zum Faschismus neigenden Charakter eines Menschen oder einer Gruppe die Art, wie er oder sie mit dem Gegner umgehen. Der Faschist glaubt, die Widersprüche und Gegner durch deren Vernichtung ausschalten und beenden zu können. Die jüngste Geschichte hat gezeigt, wohin so ein Zeitgeist führen kann. Ob es jetzt um Ausgrenzungen in sprachlicher, nationaler oder rassischer Art handelt, spielt dann irgendwann keine Rolle mehr. Ist das menschliche Maß und Mitgefühl einmal durch die zunehmende Brutalisierung verloren gegangen, zeigt der Krieg sein schrecklichstes Gesicht. Und wer hätte 1939 gedacht, dass man sechs Jahre später wieder aufatmen und sagen darf, was man denkt.
Zwischendurch: Die Poesie in dunklen Zeiten Es ist schwer, angesichts der Unmenschlichkeiten des Krieges Gedichte zu lesen, zu schreiben oder Erwartungsvolles zu singen oder zu summen. Mir aber geht immer öfter die Melodie des alten Volksliedes »Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün und lass uns an dem Bache die kleinen Veilchen wieder blüh’n«. Neben »Abendstille überall, nur am Bach die Nachtigall singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal« das Lieblingslied meiner Kindheit.
Nachkriegskinder und Friedensapostel
Die nach dem Großen Krieg Geborenen blieben bisher von einem Waffengang im eigenen Land verschont. Verschont auch von der Angst vor dem Krieg, der zu großer Aufrüstung und Militarisierung der Bevölkerung führt. Der Zeitgeist war gnädig mit uns, und ich bin einer dieser Generation, und wir träumten davon, wünschten uns, dass die Zeiten des Krieges endlich vorbei seien. Noch immer herrscht hier in unserem Land Waffenruhe und besteht die Hoffnung, dass die zunehmende Unzufriedenheit nicht zur Durchsetzung jener Prinzipien führt, die untergegangen sind, aber noch immer in manchen Köpfen nachhallen. Die Beschreibung dessen, wie es die betroffenen Menschen im Falle eines Krieges trifft, beschreibt Leo Tolstoi in seinen Meisterwerk »Krieg und Frieden«. Dort wird auch einsichtig, wie ein Krieg das Denken und den Charakter der Menschen verändert. Und darüber möchte ich schreiben. Dieses ritualisierte Anklagen des Krieges und der Verteidiger der Aufrüstung wegen eines drohenden und kommenden Krieges, wo dann den »Erzfeinden« die bösesten Absichten unterstellt werden, wird ja auch begleitet von einem tiefen Gefühl der Ohnmacht, Angst und der Frage: »Wo anfangen?« Dann stellt sich die Frage: »Auf wen hören die Kriegsführer? Nach welchen Kriterien befehlen sie den Einsatz von Waffen und Opfern von Menschenleben?«
Diese Frage, was tun? Was gegen den Krieg tun? Ich bin überzeugt, dass nur die Einsicht in die tiefen Wurzeln von Krieg und die notwendigen Erkenntnisse und Bedingungen für den Frieden das Gewicht zugunsten des Friedens ausschlagen lassen könnte. Dafür bedarf es aber vorerst auch des Glaubens, dass der Friede auch wirklich möglich ist. Und nicht nur durch Abschreckung, so wie das zurzeit propagiert wird. An einem Bürgerkrieg wie dem zwischen Weiß und Schwarz, so, wie er in Südafrika geführt wurde und wie er durch die feste Entschlossenheit eines Nelson Mandela nicht zu einem tragischen Blutbad geführt hat, lässt sich erkennen, wie so ein Bewusstsein von einem einzelnen Menschen wirksam seinen Ausgang finden kann. Auch wenn der Frieden und die Ruhe durch soziale Verwerfungen immer wieder zu Unruhen führt und den inneren Frieden des Landes bedroht, hat es immerhin gezeigt, was möglich ist und dass nicht nur ein bewaffneter Kampf gegen eine herrschende Elite Veränderungen und Verbesserungen ermöglicht. Die Widersprüche in den bisher real existierenden Gesellschaftssystemen werden die Bedrohung durch Aufstände erst dann beseitigen, wenn eine Zufriedenheit für alle, ein akzeptables Zusammenleben und das Recht auf ein solches anerkannt und ermöglicht wird.
Erbschaftskriege, Rosenkrieg, Nachbarschaftskriege Wie ein friedliches Zusammenleben durch ein Ereignis in eine kriegerische Stimmung umkippen kann, zeigen Erbschaftsstreitigkeiten. Im Stück »Erben« zeigen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters im Bahnhof, wie so ein Streit um das Erbe aussieht. Man hört dort die üblichen Sätze und Gedanken zu dem, was es zu verteilen gilt. Gut recherchiert, wobei man nicht weiß, inwieweit die Fälle nur die Verallgemeinerung dessen beschreiben, was die Erben überhaupt erleben können. Es geht auch, und ich will das auch nicht nacher-
zählen, nicht nur um den Krieg um das Haus und den wertvollen Schmuck der Oma. Sondern die Trauerrede von Pia Hierzegger, in der sie Vorschläge für Gesetze machte, die Frieden stiften können. Wenn die Schauspieler das, was sie vorspielen, mit den tatsächlichen Ereignissen und Erlebnissen so in Verbindung bringen können, dann besteht Hoffnung.
Nur wir, die wir an eine echte Demokratie glauben und wissen, dass nur eine Volksvertretung, die Gesetze, Steuergesetze, Bankengesetze und entsprechende Regeln für den Markt erlässt, den Entwicklungen entgegenwirken kann, können uns vor dieser für jedermann offensichtlichen Entwicklung retten und die großen und kleinen Kriege beenden oder zumindest im Zaum halten. Reden wir miteinander, damit diese den Alltag bestimmenden Tatsachen grundsätzlich so vielen Menschen wie möglich klar werden.
Das gelobte und versprochene Land Als ich vor Jahrzehnten Israel besuchte, wo mir bewusst wurde, dass man dieses Land nicht ohne Geschichtskenntnis besuchen sollte, sagte mir ein namhafter linker Soziologieprofessor, dass er sich öffentlich nur für die Zweistaatenlösung aussprechen muss, aber dass diese nicht möglich sei. Dieser nationalstaatliche Lösungsvorschlag brachte bisher nur Krieg, Vertreibung und Unglück zwischen den Völkern. Am Beginn eines Krieges steht immer ein menschenfeindlicher Gedanke, egal, ob er durch religiöse Begründungen oder andere Motive und Interessen entsteht.
Eine dem amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln zugeschriebene prophetische Einsicht zeigt Befürchtungen und Entwicklungen auf:
»In Friedenszeiten schlägt die Macht des Geldes Beute aus der Nation und in Zeiten der Feindseligkeiten konspiriert sie gegen sie. Sie ist despotischer als eine Monarchie, unverschämter als eine Autokratie, selbstsüchtiger als eine Bürokratie. Sie verleumdet alle als Volksfeinde, die ihre Methoden in Frage stellen und Licht auf ihre Verbrechen werfen. Aktiengesellschaften sind inthronisiert worden, und eine Zeit der Korruption an höchsten Stellen wird folgen, und die Geldmacht des Landes wird danach streben, ihre Herrschaft zu verlängern, indem sie die Vorurteile des Volkes ausspielt, bis der Reichtum in den Händen von wenigen angehäuft und die Republik vernichtet ist.«
Am Höhepunkt einer solchen Entwicklung gehen heute Millionen in den USA auf die Straße, rufen »No kings« und verteidigen die Grundpfeiler der amerikanischen demokratischen Verfassung. Ein gewisser Punkt scheint überschritten mit einem Mann an der Spitze des Staates, der mit Geld und Waffen drohend an seinem eigenen goldenen Triumphbogen arbeitet. Wenn einmal klar geworden ist, dass Geld ein Tauschmittel ist, wie das Geldsystem funktioniert, dann kann bleibend an einen dauerhaften Frieden gedacht werden. In den USA und in der ganzen schönen Welt herrscht dann Frieden. Endlich wieder normale Zeiten! Es kann nicht, so lehrt auch die Geschichte, ewig so weitergehen, die Mächtigen haben das Maß überstrapaziert, ein gewissen Maß an Zumutbarem überschritten und ihren wahren Charakter und ihre Absichten überdeutlich gezeigt. Die Machthaber arbeiten nicht mehr heimlich, sondern offen und werden auch zunehmend vorgeführt.
Frieden beginnt mit einem Vertrag Seien wir also Realisten. Es gibt den Krieg, aber es gibt auch den Frieden. Beide Zustände haben ihre Bedingungen und ihre Voraussetzungen. Im Krieg herrscht das Recht des Stärkeren. Im Frieden ist es das Ziel, eine gerechte Ordnung anzustreben und sich möglichst daran zu halten. Das geht ja hier einigermaßen, das lässt doch hoffen. Frieden beginnt mit einem Vertrag, und um so einen Vertrag zu schließen, müssen wir reden, Gesetze machen, Verfassungen schreiben, an die sich alle halten müssen. In letzter Zeit erlebe ich viel, was mich zuversichtlich stimmt. Es gab wohl noch nie so viele Menschen, die den Frieden wirklich wollen und sich auch dessen bewusst sind, was es für ihn braucht. Vielleicht bin ich auch aufmerksamer geworden, nicht so verfangen in einer Idee, mehr auf den Augenblick achtend. Auch wenn Sie mich belächeln, wenn ich sage, es wird bald und endlich Frieden geben: Ihr Lächeln könnte der Anfang eines Friedensgesprächs sein. n
Reden wir miteinander, damit diese den Alltag bestimmenden Tatsachen grundsätzlich so vielen Menschen wie möglich klar werden.

Elli Bauer (38) wurde in Graz als eines von zwei Kindern eines schottisch-österreichischen Lehrerehepaars geboren. Sie ist tief verbunden mit dem Bezirk Jakomini, wo sie auch den Kindergarten und die Volksschule besuchte. Nach der Matura im GIBS studierte sie Sozialarbeit an der Fachhochschule Joanneum. Zweisprachig aufgewachsen empfindet sie sowohl Deutsch wie auch Englisch als Muttersprache. Die Kabarettistin tritt mit dem neuen Programm übrigens am 16. Dezember im Grazer Orpheum auf. ellibauer.at
Volker Schögler trifft auf Elli Bauer
Graz ist quasi Ringo Starr. Eine Erkenntnis, die ich Bauer verdanke. Genauer Elli Bauer, Kabarettistin aus Graz, die gerade ihr drittes Programm »fAngst« spielt – nächstes Mal am 16. Dezember in Graz – das bereits auf dem besten Weg ist, Kult zu werden. Sie ist eine scharfe Beobachterin, ausgestattet mit überschwänglicher Phantasie und fast erschreckendem, jedenfalls betörendem Mut zur Ehrlichkeit, auch gegenüber sich selbst.
Mit starker Bühnenpräsenz und großem musikalischen Können zieht sie das Publikum vom Anfang bis zum Ende in ihren Bann. Insbesondere den Bewohnern des Bezirks Jakomini ist sie auch durch den Dokumentarfilm »Im Jakotop« aus dem Jahr 2022 bekannt. Als Tochter einer Schottin und eines Grazers ist sie eine seltene Mischung, die nicht nur sowohl Deutsch als auch Englisch zu ihren Muttersprachen zählt, sondern auch in der Lage ist, delikate Vergleiche zwischen ihren Herkunftsländern zu ziehen und authentisch über die Bühne zu bringen. Oder als ehemalige Chorsängerin überzeugend vor Augen und Ohren zu führen, welche oft gewünschten englischen Lieder sich wirklich nicht für Hochzeiten eignen. I still haven‘t found what I‘m looking for; I don‘t know how to love him; I‘ll be watching you Nun zu meiner Lieblingsfrage: Wie ist man zu der Person geworden, die man ist? Oder: Wie wird man Kabarettistin? Im Jahr 2013 tritt Elli Bauer spontan beim »Grazer Kleinkunstvogel« an und gewinnt knapp nicht – um dann sechs Jahre lang nicht mehr aufzutreten. In dieser Zeit ist sie wahrhaft vielgleisig unterwegs, hat bereits zehn Jahre im steirischen Landesjugendchor »CantAnima« hinter sich, ebenso ein FH-Studium (Sozialarbeit), betreut schon zwölf Jahre lang Kinder in Sommercamps, unterrichtet Hip-Hop-Tanz, ist einige Jahre als Native Speaker Teamlehrer im »Gibs« (Graz International Bilingual School) und lernt schließlich bei einer Theatergruppe Christine
Teichmann kennen, mit der sie als Liedermacherin auftritt. Doch dann wächst der Wunsch, »endlich alleine etwas zu machen«. Um nicht wehmütig auf die zu blicken, die sie hätte sein können, fasst Elli Bauer mit über 30 einen Entschluss: »Jetzt oder nie, ich will nicht mit 80 sagen müssen, ich habe es nicht probiert.« Motiviert von den Gewinnen der »Ennser Kleinkunstkartoffel« und dem »Freistädter Frischling« 2018 hat sie zugleich auch das Glück, von einer Künstleragentur namens »vermutlich Elke« angesprochen und unter Vertrag genommen zu werden. So macht sie sich 2019 als Kabarettistin selbstständig, wird aber auch mit dem Pech konfrontiert: Denn 2020 bricht bekanntlich eine Pandemie aus, die zu mehreren Lockdowns, zu Ausgangssperren und Beschränkungen bei Veranstaltungen führt. Unerschrocken baut sie diesen Abschnitt danach in ihr Programm ein, wenn sie sinngemäß auf der Bühne bekennt: »Was macht eine Kabarettistin in so einer Zeit? Sie geht mit Mitte dreißig wieder heim zu Mama und Papa wohnen.« In Elli Bauers Programmen ist ihr gesellschaftskritischer Ansatz meisterhaft abgefedert mit blitzgescheitem Aberwitz, mit Körperkomik und einer wohltuend unaufdringlichen Authentizität. Durchsetzt mit staubtrockenem Humor hat sie ihre eigene Sprache gefunden, die sie unverwechselbar macht.
Und weil sie auch tough ist, lässt sie eine Städterin die in Österreich untypische Unlust am Wandern im Lied (»I kann im Wåld net scheißen«) begründen. Auffällig vielfältig ist auch ihr Publikum, ein Anzeichen dafür, dass ihre Auftritte nicht für irgendeine bestimmte Ecke bestimmt sind oder aus einer solchen kommen, sondern einfach Daseinswirklichkeiten widerspiegeln. Wie etwa den Umstand, dass Wien, Salzburg und Innsbruck international bekannter sind als Graz. Deswegen Ringo Starr. n
Von der Kunst, sich selbst im Weg zu stehen. Und es zu merken
Wer im Sturm des 21. Jahrhunderts noch glaubt, mit alter Kommandotonlogik durchzukommen, hat das Navigationsgerät auf den »Modus Titanic« gestellt. Führungskräfte sind heute weniger Feldherren als Lotsen auf bewegter See. Die Frage lautet dabei nicht nur »Was tun?«, sondern auch: »Wer sein?« Denn wer Menschen durch stürmische Zeiten leiten will, muss zunächst sich selbst verstehen.
Das Innenleben als zentraler Kompass Führung in Zeiten von »VUCA«, »BANI« oder »PUMO«* beginnt nicht beim Strategiepapier, sondern vor dem Badezimmerspiegel. Stimmige authentische Führung entsteht nicht nur aus Managementmethoden, sondern auch aus Selbsterkenntnis. Das »Inside-out«-Prinzip lautet: Erst sich selbst führen, dann andere. Wer glaubt, Führung sei nur Technik, unterschätzt die Wirkung des eigenen Auftretens oder der eigenen Haltung und Verhaltens. Echtheit ist heute kein »Nice-to-have«, sondern die Voraussetzung, um Vertrauen zu schaffen, oder anders gesagt: Wer sich selbst nicht führen kann, sollte sich auch mit dem Führen anderer zurückhalten.
Demut als Wettbewerbsvorteil

Carola Payer betreibt in Graz die »Payer und Partner Coaching Company«. Sie ist Businesscoach, Unternehmensberaterin und Autorin. payerundpartner.at
Die Beförderungsfalle kennt jeder: Je höher die Karriereleiter, desto mehr Räume muss man betreten, in denen andere schon länger zu Hause sind. Wer dann noch glaubt, alle Antworten parat zu haben, erntet bestenfalls Augenrollen. Demut ist also keine moralische Tugend, sondern eine Überlebensstrategie. Je größer das Spielfeld, desto weniger kennt man jeden Winkel. Erfolgreiche Führungskräfte kultivieren daher Demut – nicht als moralische Zierde, sondern als pragmatische Haltung. Zuhören, Fragen stellen, Ratschläge annehmen: Wer das kann, erweitert seinen Horizont und gewinnt Respekt. Abraham Lincoln machte es vor, als er politische Rivalen in sein Kabinett holte – und aus Gegnern Verbündete schmiedete.
Stärke durch Offenheit
In einer Welt, in der jeder Auftritt potenziell im Netz landet, wirkt es sicherer, Distanz zu wahren. Doch Menschen folgen Menschen, nicht perfekten Fassaden. Persönliche Geschichten, klar benannte Werte und auch das Eingeständnis von Unsicherheit – all das macht Führung nahbar. Wichtig ist dabei Maß und Kontext: Offenheit inspiriert, wenn sie klug dosiert ist. Wichtig ist nur, nicht in die »Oversharing-Falle« zu tappen. Niemand
»Führung ohne Mut ist wie ein Espresso ohne Koffein: Hübsch anzusehen, aber ohne aktive Energie.«
CAROLA PAYER
möchte in der Montagsrunde intime Beziehungsdramen hören – eine Anekdote über den eigenen Karriereumweg reicht völlig.
Mut als Motor
Wer führt, muss auch Neues wagen. Mut heißt dabei nicht Draufgängertum, sondern Verantwortung übernehmen – sichtbar und glaubwürdig. Führung ohne Mut ist wie ein Espresso ohne Koffein: Hübsch anzusehen, aber ohne aktive Energie. Mut heißt nicht, unbedacht ins Chaos zu galoppieren, sondern sichtbar für ein Ziel einzustehen, auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Heute reicht es schon, wenn eine Führungskraft klar sagt: »Wir probieren das – und wenn es schiefgeht, stehe ich dafür gerade.« Diese Art von Rückendeckung wirkt auf Teams stärker als jede Bonusregelung.
Kontrolle teilen
Einer der größten Trugschlüsse der Führung lautet, alles unter Kontrolle zu haben. In Wirklichkeit lähmt übertriebene Steuerung das eigene Team und führt zu endlosen Schleifen. Besser ist es, Verantwortung zu teilen mit klaren Erwartungen, aber auch mit Vertrauen. Quasi nach dem Prinzip: »Augen auf, Hände weg«: Immer informiert bleiben, aber Freiraum geben. Wer so vorgeht, schafft nicht nur Effizienz, sondern auch Motivation. Wer alles selbst entscheiden will, blockiert sein Team und

sich gleich mit. Die Kunst liegt darin, Verantwortung zu delegieren, ohne sich in Bedeutungslosigkeit aufzulösen. Klingt für einige riskant – ist aber der einzige Weg, Innovation am Leben zu halten.
Das Montagsprotokoll für Chefs
Was also tun, wenn Montagmorgen wieder der Kalender explodiert und die To-do-Liste länger ist als die Rede zur Lage der Nation? Drei einfache Schritte:
1. Selbstinventur: Ehrlich prüfen, wo man selbst blockiert, statt die Schuld auf »die Strukturen« zu schieben. Wo stehe ich selbst im Weg? Ehrliche Selbstreflexion spart später viele Umwege.
2. Vertraute Skeptiker suchen: Ein kleines Beratergremium, das sich traut, »blöde Fragen« zu stellen, ist Gold wert. Wer darf mir widersprechen? Ein kleiner Kreis kritischer Begleiter hilft, Betriebsblindheit zu vermeiden.
3. Nicht verhandelbare Regeln definieren: Ob Sport, Familienzeit oder das Recht auf Feierabendbier – wer seine eigenen Grenzen nicht schützt, wird auch die der anderen nicht respektieren. Was ist für mich unverhandelbar? Eigene Prioritäten schützen vor Dauerstress – und machen auch das Team resilienter.
Menschlichkeit schlägt Management
Die gute Nachricht: Man muss kein Superheld sein, um eine Organisation erfolgreich zu führen. Es reicht, Mensch zu bleiben – mit Demut, Mut, Verletzlichkeit und der Bereitschaft, andere groß werden zu lassen. Die schlechte Nachricht: Das klingt einfacher, als es ist. Denn Selbsterkenntnis ist kein Wochenendseminar, sondern Schwerstarbeit. Wer es aber schafft, sich selbst mit einem Augenzwinkern zu führen, hat schon die halbe Miete. Die andere Hälfte kommt von jenen, die bereit sind, diesem Chef zu folgen – nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und das ist, in Zeiten von Dauerkrisen und permanenten »Transformationsprozessen«, die eigentliche Kunst der Führung. Und so gilt: Die Kunst der Führung beginnt innen – und wirkt nach außen. Wer bei sich selbst anfängt, hat die besten Chancen, auch andere erfolgreich mitzunehmen. n
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie beim Online-Infoabend zum »SELFagilguide« am 20. November 2025 um 19 Uhr. Anmeldung per Mail unter office@payerundpartner.at
* VUCA ist ein Akronym für Volatility (Volatilität), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit). BANI ist ein Akronym, das die heutigen herausfordernden Zeiten beschreibt: Brittleness (Brüchigkeit), Anxiousness (Ängstlichkeit), Non-linearity (Nichtlinearität) und Incomprehensibility (Unbegreiflichkeit). PUMO ist ein Akronym für Polarized (polarisiert), Unthinkable (undenkbar), Metamorphic (metamorph), Overheated (überhitzt).
Unsere Steiermork ist überfüllt mit Geisterfohrern und wir wissen wie gfährlich die schon auf der Autobahn san



Liebe Steirer und Innen! Liebe Freunde, es grüßt Euch Sepp Oberdengler zur Rundschau im Oktober. Auf einmal is es Herbst. Zwischen Regen, Kälte, Nebel und Frost blinzelt uns die Sonne manches Mal zu und dann strohlt unser Steirerland in tausend Farben. Der Schilcher hat länger braucht fürs Reifen umso besser für die Qualität.
Bei uns Steirern setzt die Reife hoffentlich auch bald ein, denn es gibt an Haufen Probleme zu stemmen und unsere Steiermork ist überfüllt mit Geisterfohrern und wir wissen wie gfährlich die schon auf der Autobahn san.
Vernünftige internationale Nachkriegseinrichtungen müssen grod erkennen, dass 80 Johre Frieden net gut getan haben. Der russische »Gröfaz 2.0« spielt Katz und Maus mit da Wölt. Die politische Rechte is im Vormarsch, und man find ka Rezept dagegen. Strukturen hobn sich überlebt, Reformen föhln. Politiker kummen aus ihren Komfortzonen net heraus. Hobn wir in 80 Johren Frieden vagessen, wie es zum Schrecken und zum Leidn da beiden letzten Kriege kommen is? Das die Rechten olles besser wissn ist eh klor, aber wenn sie an die Mocht kommen und am Futtertrog sitzen, ist das wohrscheinlich wieda ganz anders.
Ich glaub an uns, an unser Land. An unsere positiven Kräfte und die Vernunft oller Verantwortlichen, egal von wölcher Partei. Aber wozu diese rechte Ongstmacherei? Warum Zynismus und die Vereinnahmung von kulturellen- und neuerdings auch christlichen Werten? Erzbi-
schof Lackner sei Dank, die Kirche losst sich des net gefallen. Und mia? Geht es uns wirklich so schlecht, das wir uns davon beeinflussen lassen? Wir stinken mit vollen Hosn, anstott das wir zufrieden wärn, und unseren Beitrag zur Demokratie leisten. Lernt da Mensch wirklich nix?
Es war doch letztlich immer scho so. Zerstören, Aufbauen und retour. Dos wos uns von den Viechern unterscheidet – sich seines Daseins denkend bewusst zu sein, sich frei entscheidn können –, das geben viel zu viele nur zu gern wieder an rechte Vereinnahmer ab. Warum? Aus Ongst? Weil es uns vielleicht zu guat geht? Aus Hoffnungslosigkeit? Oder weil Geld net stinkt?
Liebe Freunde, ich sehne mich nach den alten Gasthäusern, dem Reden, dem Dischgariern, nach einem horten Arbeitstag. Nach dem Streiten, dem gemeinsamen Feiern und so weiter. Diese »Fine Dining«- und »Social Media»-Vereinsamung tut uns net guat und mocht uns letztlich zu bloßen Spielbällen für Populisten. Unsere Jugend hat das Zeig, das Staffelholz zu übernehmen.
Dazu müssen mir ihr ober die beste Bildung bieten, müssen Vertrauen und Vorbild sein. Glauben wir an unsere gemeinsame positive Kraft, alles andere führt nur dorthin, wo wir schon einmal worn. Und des kann keiner wollen! Eich olles Gute und bis zur nächsten Rundschau. Euer Sepp Oberdengler.
PS. Und aufpassen! Der Teif’l schloft net!
Sie möchten Sepp Oberdengler im Radio hören? Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es nach den Kirchenglocken um 12.15 auf Radio Steiermark eine neue Folge. Auch als Podcast. Die aktuelle Programminformation finden Sie auf steiermark.orf.at
Die Grazer Bestattung bringt die Natur auf den Friedhof. So vereint sie Komfort und Service des Urnenfriedhofs mit dem Wunsch nach einer Ruhestätte unter Bäumen.
Mit Blick auf das Bestattungswesen in Graz kann man als Kunde leicht die Übersicht verlieren. Immer wieder drängen seit der Liberalisierung des Marktes neue externe Anbieter in die Stadt, wo die Grazer Bestattung die Menschen seit 130 Jahren in ihren schwersten Stunden begleitet.
Seit 130 Jahren im Hier und Jetzt In Graz gibt es mittlerweile sechs verschiedene Bestattungsunternehmen. Doch nur die Grazer Bestattung verfügt über ein eigenes Krematorium in Graz und über den wunderschönen Zeremoniensaal am Urnenfriedhof. Auch die Aufbahrungshalle in Mariatrost gehört der Grazer Bestattung. So kann man sich eben auch nur bei der Grazer Bestattung sicher sein, dass die Verstorbenen dank
des eigenen Krematoriums direkt in Graz kremiert werden und nicht unnötig herumgeführt und im Umland oder einem Kärntner Krematorium kremiert werden. Als langjähriger Partner aller 14 Grazer Friedhöfe arbeitet die Grazer Bestattung bei den Verabschiedungen eng und vertrauensvoll mit allen Pfarren und Religionsgemeinschaften zusammen.
Den Wald auf den Friedhof bringen – nicht die Urne in den Wald.
Seit einiger Zeit schon steigt die Nachfrage nach naturnahen Bestattungsformen. Für alle, die sich einen ganz besonderen Ort der Erinnerung mitten in Graz wünschen, bietet die Grazer Bestattung darum Rasen- und Baumbestattungen im Waldbereich des Urnenfriedhofs an. Hier ruhen die Urnen im Einklang


mit der Natur – in einer friedvollen Umgebung, die von den Mitarbeiter:innen der Grazer Bestattung liebevoll gepflegt wird.
Wunderschön, sicher und komfortabel. Baumbestattungen schaffen nicht nur ein einzigartiges, friedliches Ambiente, sie bieten auch klare Vorteile: keine Kosten für Grabsteine, keine Grabpflege. Die Urne wird zu Füßen eines Baumes beigesetzt, an einem Ort des bleibenden Gedenkens. Auf Wunsch kann bei einer Baumbestattung auch eine Namensnennung auf einer steinernen Stele erfolgen. Der Waldbereich des Grazer Urnenfriedhofs vereint somit Naturverbundenheit und Komfort: Auf sicheren Wegen ganzjährig barrierefrei zu Fuß, mit Rollstuhl oder Gehhilfe zugänglich, öffentlich und mit
dem eigenen Auto erreichbar, verfügt er über Toiletten und ausreichend Parkplätze und bietet zudem Platz für Kerzen.
Naturgräber im gepflegten Waldbereich Während die Asche der Verstorbenen langsam in den Kreislauf der Natur zurückkehrt, bleiben die Bäume – im Gegensatz zum Wald – vor Windschäden und Schädlingen wie dem Borkenkäfer geschützt. Die Baumbestattungen schaffen so einen geschützten und gepflegten Raum unter alten Bäumen –mitten in der Stadt. Wer sich bei einem Herbstspaziergang selbst von der würdevollen Schönheit des Parkfriedhofs überzeugen will – die Mitarbeiter:innen der Grazer Bestattung stehen bei allen Fragen oder Reservierungswünschen jederzeit gerne zur Verfügung.

Berufschancen beim Tag der Lehrberufe
Über 1.000 Jugendliche informierten sich am 4. Oktober beim „Tag der Lehrberufe“ am Grazer Hauptplatz. StR Kurt Hohensinner unterstützt die Initiative: „Der Informationstag zeigt, wie vielfältig Karriere mit Lehre gemacht werden kann und bietet den Jugendlichen praktische Einblicke in die Berufswelt.“ 225 Lehrberufe kann man in Österreich erlernen, in der Steiermark zählt man derzeit laut AMS rund 950 offene Lehrstellen. Aktuell gibt es in der Region Graz/Graz-Umgebung rund 2.000 arbeitslose Menschen unter 25 Jahren. „Unsere Kraftanstrengung muss sein, hier gegenzusteuern. Das tun wir auch mit diesen Veranstaltungen, die ein bestmögliches Matching von jungen Menschen und der richtigen Lehrausbildung zum Ziel haben“, so Hohensinner.


Die ungarische Botschafterin in Österreich, Edit Szilágyiné Bátorfi, stattete mit Honorarkonsul Rudi Roth ihren Antrittsbesuch in Graz bei LH Mario Kunasek, LT-Präs. Gerhard Deutschmann und Bischof Wilhelm Krautwaschl ab. Grund ihres Besuches war es, die starken wirtschaftlichen und ausgezeichneten Beziehungen zwischen der Steiermark und Ungarn zu stärken und zu vertiefen, auch bei einem anregenden Gespräch mit dem ICS-GF Karl Hartleb. Als Wirtschaftsfaktor liegt Ungarn mit über 500.000 Winternächtigungen bereits an 2. Stelle aller Auslandsbesucher in der Steiermark. Zum Abschluss erfolgte eine Kranzniederlegung bei der ungarischen Gedenkstätte beim Grazer Dom mit András Molnár, Obmann des Grazer Ungarischen Vereins.
Neuer Spar express-Shop in Graz eröffnet
Der neue Spar express bei der SOCAR-Tankstelle in der Plüddemanngasse bietet ein modernes Einkaufserlebnis mit Supermarktpreisen – täglich geöffnet Mo bis Sa 05:00–23:00 Uhr, So & Feiertage 06:00–22:00 Uhr. „Der neue Spar express bietet frisches Gebäck, Snacks und Produkte des täglichen Bedarfs – praktisch, schnell und preiswert“, sagt Spar-Steiermark-GF Christoph Holzer. Das moderne Shopkonzept mit hellen Farben, offener Raumgestaltung und hochwertigen Spar-Markenprodukten sorgt für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Zum Sortiment gehören BioGebäck, Obst, Gemüse, Kaffee sowie regionale Produkte. Mit 16 Standorten in der Steiermark bietet Spar express verlässliches Einkaufen auch außerhalb üblicher Öffnungszeiten – flexibel, bequem und zu Supermarktpreisen.
Grazer Wechselseitige expandiert nach Zypern
Die Grazer Wechselseitige Versicherung AG hat 100 % der Anteile an der Prime Insurance Company Ltd. in Nikosia übernommen und steigt damit erstmals als Erstversicherer in den zypriotischen Markt ein. Seit 2. Oktober firmiert das Unternehmen unter dem Namen Grawe Insurance Company (Cyprus) Ltd. Die Prime Insurance ist seit 26 Jahren am Markt aktiv und betreut rund 41.000 Kunden und Kundinnen in den Sparten Lebens-, Kranken- und Sachversicherung. Mit der Grawe Cyprus als 19. Versicherungstochter stärkt die Versicherungsgesellschaft ihre Präsenz in 13 Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas und setzt einen weiteren Schritt in ihrer internationalen Wachstumsstrategie und damit ein klares Zeichen für nachhaltiges Wachstum.

Am 26. September wurden die beiden neuen Forschungsgebäude der Montanuniversität bei einem feierlichen Festakt eröffnet.
Mit einem Festakt feierte die Montanuniversität Leoben die Eröffnung von gleich zwei zukunftsweisenden Gebäuden: des Hauses der Digitalisierung und des Chemiezentrums. Im Anschluss an die Eröffnungszeremonien präsentierten Forschende neueste Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung, Robotik, Chemie und Analytik.
Beide Universitätsneubauten markieren einen entscheidenden Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der Universität und unterstreichen ihre Rolle als führende Forschungsstätte im Bereich nachhaltiger Technologien und digitaler Transformation.
Innovationsmotor für Digitalisierung
Das Haus der Digitalisierung fungiert als zentrale Plattform für Forschung, Lehre und Kooperation in den Bereichen Robotik, Automation, Künstliche Intelligenz und High Performance Computing. Es beherbergt Lehrstühle wie Industrielogistik, Informationstechnologie, Automation sowie Metallkunde. Architekt Peter Scherzer schuf einen modernen Bau, der durch flexible Arbeitsbereiche und hochmoderne Infrastruktur die enge Vernetzung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft fördert. Vizerektor Thomas Prohaska betont die Bedeutung des Hauses als „zentralen Innovations-
motor für Digitalisierung und Industrie 4.0 am Standort Leoben“.
Forschung an nachhaltigen Technologien
Das neue Chemiezentrum, ein umfassend modernisiertes Gebäude mit 2.700 Quadratmetern Labor- und Forschungsfläche, vereint die Lehrstühle für Allgemeine und Analytische Chemie sowie für Physikalische Chemie. Hier werden neue Methoden in der Material- und Energieforschung entwickelt – von der Korrosionsanalyse bis zur Brennstoffzellentechnologie. Vizerektor Helmut Antrekowitsch sieht darin „eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung“, die Leobens Position als international sichtbaren Forschungsstandort stärkt. LR Willibald Ehrenhöfer hob bei der Eröffnung die Bedeutung beider Einrichtungen als Impulsgeber für Wirtschaft, Innovation und junge Talente hervor.

Vizepräsident der WKO Steiermark
Sie gelten als leidenschaftlicher Unternehmer. Wie wirkt sich das derzeit extrem herausfordernde Umfeld auf Ihre Motivation aus?
Natürlich sind die Zeiten fordernd – keine Frage. Die letzten Jahre waren für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ein echter Härtetest. Aber gerade in solchen Phasen merkt man, wie wichtig Unternehmergeist, Zusammenhalt und Optimismus sind. Als Unternehmer muss man Lösungen suchen und Chancen erkennen.
Wie schafft es die WKO, noch mehr Nähe zu den Unternehmen herzustellen?
Die Wirtschaftskammer Steiermark ist schon sehr präsent – das zeigen über 100.000 Servicefälle pro Jahr. Wir müssen dort sein, wo die Unternehmer sind: in den Betrieben, in den Regionen, bei Veranstaltungen, bei den Menschen selbst. Das heißt: zuhören, verstehen, unterstützen – und nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, bzw. vor allem dann, wenn es Probleme und Herausforderungen zu meistern gilt.
Was braucht es, um wieder wirtschaftlichen Optimismus und Investitionsfreude zu entfachen?
Zuerst einmal braucht es ein ehrliches Bekenntnis dazu, dass Leistung wieder etwas wert sein muss. Wer arbeitet, wer Verantwortung trägt, wer Arbeitsplätze schafft, der darf nicht das Gefühl haben, bestraft zu werden. Die Lohnnebenkosten müssen runter, die Bürokratie muss deutlich entschlackt werden, und bei der Energiepolitik braucht es endlich realistische und leistbare Rahmenbedingungen.
Das Service für Unternehmen (SfU) des AMS Steiermark ist der zentrale Partner für Betriebe in allen Personalfragen. Ziel ist es, Unternehmen bei Personalsuche, Stellenvermittlung, Qualifizierung und strategischer Personalentwicklung umfassend zu unterstützen. Die Angebote sind darauf ausgerichtet, den Anforderungen des steirischen Arbeitsmarktes gerecht zu werden und Betriebe zukunftsfit zu machen.
Mit wenigen Klicks bietet allejobs. at den größten Überblick zu rund 150.000 freien Stellen und Lehrstellen. Rund 85 Prozent der offenen Stellen werden mit Hilfe des AMS Steiermark innerhalb von drei Monaten besetzt. Im Zentrum der SfU-Leistungen steht die rasche und passgenaue Vermittlung von Arbeitskräften. Unternehmen profitieren von Vorauswahlen, Jobmessen sowie digitalen Tools wie dem eAMS-Konto oder dem virtuellen Vermittlungsformat 360. ams.at.
Arbeitsplatznahe Ausbildungen Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, liegt ein Fokus auf arbeitsplatznahen Ausbildungen. Wenn Bewerber_innen nicht alle Qualifikationen mitbringen, begleitet das AMS praxisnahe Schulungen direkt im Betrieb. Die Inhalte werden gemeinsam mit dem
Unternehmen abgestimmt. Während der Ausbildungsphase entstehen keine Lohnoder Lohnnebenkosten.
Neben der Vermittlung setzt das SfU auf Beratung. Die Impulsberatung für Betriebe (IBB) unterstützt Unternehmen durch externe Berater_innen bei der Weiterentwicklung ihrer Personalstrategien. Themen wie Weiterbildung, Arbeitszeitflexibilisierung, Arbeitsplatzsicherung, Chancengleichheit oder ökologischer Strukturwandel stehen zur Auswahl. Ergänzend fördert das AMS Impuls-Qualifizierungsverbünde zur gezielten Weiterbildung von Beschäftigten.
Zahlreiche Fördermöglichkeiten
Ob Lehrlingsausbildung oder das Programm „Frauen in Handwerk und Technik“ (FiT): Die Fördermöglichkeiten reichen von Lohnkostenzuschüssen bis zur Qualifizierungsförderung für Beschäftigte.
Das AMS übernimmt sämtliche Kosten für Beratung, Förderinformationen und Personalsuche – unabhängig von der Unternehmensgröße.
Das SfU ist mit 20 Standorten in der Steiermark vertreten und bietet persönliche Betreuung vor Ort. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit digitaler und vernetzter gestaltet – mit Betriebsbesuchen und individuellen Beratungsterminen.
Innovative Lösungen für Herausforderungen
Ein Newsletter informiert laufend über Themen wie Ausländer_innenbeschäftigung, Förderungen und Stellenvermittlung. Anmeldung unter: www.ams. at/newsletter
Das Service für Unternehmen versteht sich als aktiver Mitgestalter eines modernen Arbeitsmarktes. Durch die enge Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben, Bildungseinrichtungen und Sozialpartnern entstehen innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Angebote garantiert, dass Unternehmen auch in Zeiten des Wandels wettbewerbsfähig bleiben. Darüber hinaus bietet das AMS branchenspezifische Analysen und Arbeitsmarktprognosen, um strategische Entscheidungen fundiert treffen zu können.
Das AMS-Service für Unternehmen 20-mal in der Steiermark – auch ganz in Ihrer Nähe!
Elisabeth Pascottini, stv. Abteilungsleiterin, und Helge Röder, Abteilungsleiter Service für Unternehmen (SfU)

Alle Kontaktdaten finden Sie online:

Mit einer festlichen Gala feierte das Autohaus Gaberszik am 3. Oktober sein 100-jähriges Bestehen – ein seltenes Jubiläum in einer Branche, die sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert hat. Prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gratulierten dem Grazer Traditionsbetrieb, der seit vier Generationen für Kontinuität, Innovation und Kundennähe steht.
Ein Unternehmen mit Geschichte
Gegründet wurde das Autohaus 1925 von August Gaberszik, der den Grundstein für eines der ältesten Familienunternehmen im steirischen Fahrzeughandel legte. Heute führen seine Enkelinnen
Maria und Sonja Gaberszik den Betrieb – und blicken auf eine bewegte Unternehmensgeschichte zurück. „Dieses Jubiläum ist nicht unser Verdienst allein – es ist das gemeinsame Werk unserer Kundinnen und Kunden, unseres Teams, unserer Partner und unserer Familie“, sagte Maria Gaberszik in ihrer Ansprache. Ihre Schwester Sonja ergänzt: „Wir blicken dankbar zurück, aber auch voller Zuversicht nach vorne. Gemeinsam mit der nächsten Generation wollen wir die Geschichte von Mut, Zusammenhalt und Unternehmergeist weiterschreiben.“

Die nächste Generation steht bereit: Julia und Markus Gaberszik (Mitte) traten mit ihren Müttern auf die Bühne –als Zeichen für Kontinuität und Zukunftsorientierung.
Landeswappen als Zeichen der Anerkennung
Ein markanter Höhepunkt der Feier war die Überreichung des Steirischen Landeswappens, das Klubobmann Marco Triller in Vertretung des Landeshauptmanns an die beiden Unternehmerinnen übergab. Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen, die durch jahrzehntelange Leistung, Verantwortung und Innovationskraft einen besonderen Beitrag für die Region leisten. „Das Landeswappen ist für uns nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Verpflichtung, weiterhin für Qualität, Verantwortung und die Steiermark einzustehen“, erklärte Maria Gaberszik sichtlich bewegt.

Große Freude über die Auszeichnung mit dem steirischen Landeswappen: Klubobmann Marco Driller (li.) und AltLH Hermann Schützenhöfer gratulieren Maria und Sonja Gaberszik.
Lob aus Politik und Wirtschaft Zahlreiche Wegbegleiter würdigten die Unternehmerfamilie. LH a.D. Hermann Schützenhöfer hob in seinem Grußwort den Wert von Ehrlichkeit und Bodenständigkeit hervor: „Das Autohaus Gaberszik zeigt, dass Tradition und Innovation kein Widerspruch sind, sondern die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.“ Auch Stadtrat Günther Riegler fand klare Worte: „Wirtschaft ist Mut, Vertrauen und Zusammenhalt – genau das zeigt Gaberszik seit 100 Jahren. Dieses Jubiläum ist ein Beweis, dass man mit Leidenschaft und Durchhaltevermögen alles schaffen kann.“ WK-Präsident Josef Herk gratulierte ebenso wie Ford-Österreich-Chef Andreas Oberascher, der Familie Gaberszik als „vorbildlichen Partner und starken Botschafter der Marke Ford in Österreich“ lobte. Ohne Betriebe wie diesen, so Oberascher, wäre die Marke hierzulande nicht so stark verankert.
Soziale Verantwortung
Neben Rückblick und Feierlaune setzte das Autohaus auch ein soziales Zeichen: Im Rahmen des Jubiläums übergab die Familie Gaberszik mehr als zwei Tonnen Lebensmittel an die Caritas Steiermark – eine symbolträchtige Geste regionaler Verantwortung. „Erfolg bedeutet für uns nicht nur wirtschaftliches Wachstum, sondern auch gesellschaftliches Engagement“, so Sonja Gaberszik. „Gerade in Zeiten wie diesen wollen wir einen Beitrag leisten, wo Hilfe gebraucht wird.“
Die rasante Verbreitung generativer KI verändert die Arbeitswelt – und sie tut es nicht zufällig, sondern systematisch. Eine neue Harvard-Studie zeigt: Seit Unternehmen ChatGPT & Co in großem Stil einsetzen, verlieren vor allem Berufseinsteiger an Boden. Während SeniorJobs weitgehend stabil bleiben, schrumpft die Zahl der Junior-Positionen spürbar. KI ersetzt zunehmend jene Routineaufgaben, die einst als Sprungbrett ins Berufsleben galten.

Die Forscher Seyed Hosseini und Guy Lichtinger analysierten 62 Millionen Lebensläufe und knapp 200 Millionen Stellenausschreibungen von 285.000 US-Firmen zwischen 2015 und 2025. Ihr Befund ist eindeutig: Seit 2023 ist in Unternehmen, die generative KI aktiv integrieren, die Zahl der Juniorstellen um rund zehn Prozent gesunken – Seniorstellen blieben unverändert.
Als „GenAI-Adopter“ gelten Firmen, die eigene „GenAI-Integrator“-Jobs ausgeschrieben haben – also Positionen, die den KIEinsatz in den Alltag bringen. Rund 10.600 Unternehmen er-
GenAI steht für Generative Artificial Intelligence – also generative Künstliche Intelligenz. Sie erzeugt eigenständig neue Inhalte: Texte, Bilder, Musik, Videos oder Programmcode. Bekannte Beispiele sind ChatGPT, Claude, Gemini oder DALL·E. Anders als frühere KI-Systeme analysiert GenAI nicht nur Daten, sondern schafft Neues – etwa Marketingtexte, Softwarecode oder Designs. Damit verändert sie Arbeitsprozesse in vielen Branchen und ersetzt zunehmend Routineaufgaben, besonders in Einstiegsjobs.
füllen dieses Kriterium, knapp vier Prozent der Stichprobe, aber sie beschäftigen 17 Prozent aller beobachteten Arbeitnehmer. Es sind meist große, technologieorientierte Häuser mit gut ausgebildeten Belegschaften.
Der Bruch kommt abrupt: Ab 2023, also nach der breiten Einführung von ChatGPT, stagniert die Zahl der Junior-Jobs –während jene der Seniors weiter steigt. Besonders betroffen sind Berufe mit hoher KI-Exponierung: Forschung, Datenanalyse, Marketing, Text- und Programmierarbeit. Wo Routineintelligenz gefragt war, springt nun GenAI ein. In weniger betroffenen Branchen bleibt alles beim Alten. Bemerkenswert: Es geht nicht um Kündigungen, sondern um ausbleibende Einstellungen. Unternehmen drosseln ihre Nachwuchsrekrutierung, weil sie erwarten, dass viele Tätigkeiten bald automatisierbar sein werden. Sie handeln vorausschauend –und nehmen eine Lücke am unteren Ende der Karriereleiter in Kauf. Das Ergebnis: weniger Chancen für junge Akademiker, mehr Stabilität für erfahrene Mitarbeiter. Die Forscher sprechen von einer „seniority-biased technological change“ – also einer technologischen Entwicklung, die nicht nach Ausbildung, sondern nach Hierarchie unterscheidet. Während frühere Innovationswellen vor allem ungelernte oder mittlere Qualifikationen verdrängten, trifft GenAI die Basis der Wissensarbeit: jene, die gerade erst einsteigen. Das könnte langfristig tiefer wirken als jede Rationalisierungswelle zuvor – weil der Einstieg ins Erwerbsleben über Einkommen, Aufstieg und gesellschaftliche Teilhabe entscheidet. Auch wenn die Daten vor allem große US-Konzerne abbilden, ist der Trend klar. Die Forscher räumen ein, dass „stille“ KI-Nutzung in der Statistik kaum erfasst ist – was die beobachteten Effekte eher unterschätzt. Doch erstmals lässt sich empirisch belegen, wie stark der Einsatz generativer KI die Personalstruktur verändert. Ob das ein kurzfristiges Anpassungsphänomen bleibt oder eine neue Logik der Arbeitswelt einleitet, ist offen. Fest steht: Die rasante Diffusion von GenAI verdrängt nicht die „mittleren“ Jobs, sondern die Einstiegschancen. Das eigentliche Risiko liegt also nicht im Ersatz menschlicher Arbeit, sondern im Wegbrechen des Lernraums, in dem Kompetenzen entstehen. Wenn die unteren Sprossen der Karriereleiter verschwinden, gerät am Ende auch die Spitze ins Wanken.
Die renommierte Trophäe „Goldene Tanne 2025“ ging im Rahmen der Tagung der selbstständigen SPAR-Kaufleute in Lech (Vbg.) für die Steiermark an die engagierte Unternehmerin Barbara Reiß, die zwei SPARMärkte in Stainz und Preding führt.
Mit der „Goldenen Tanne“ setzt SPAR ein Zeichen für unternehmerische Leistung, Kontinuität und regionale Stärke –Werte, die Barbara Reiß seit vielen Jahren vorbildlich verkörpert.
Bedeutender Arbeitgeber Bewertet wurden von der Jury neben wirtschaftlichen Erfolgskennzahlen auch die Qualität der Feinkost-, Brot- sowie Obstund Gemüseabteilungen sowie die Umsetzung jährlich wechselnder Themenschwerpunkte. Barbara Reiß ist seit 16 Jahren selbstständige Kauffrau. 2009 übernahm sie den SPAR-Markt in Stainz, 2020 folgte der Standort in Preding. Heute beschäftigt sie 94 Mitarbeiter und zählt damit zu den bedeutenden Arbeitgebern der Region. „Für mich und mein Team ist der Gewinn der ‚Goldenen Tanne‘ eine ganz besondere Auszeichnung. Ohne die
Barbara Reiß (in Weiß) freut sich mit den SPAR-Spitzen und den Kolleginnen über die Auszeichnung mit der „Goldenen Tanne 2025“.

tägliche Leistung meines großartigen Teams wäre dieser Erfolg nicht möglich“, sagt Reiß.
Unternehmergeist und Verantwortung
Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland, würdigt ihre Vorbildrolle: „Barbara Reiß steht beispielhaft für Unternehmergeist, Teamorientierung und Verantwortungsbewusstsein. Ihr Engagement zeigt, wie Nahversorgung und regionale Wertschöpfung erfolgreich gelebt werden können.“
Von den insgesamt 1.418 SPAR-Märkten in Österreich werden 664 von selbstständigen Kaufleuten geführt – sie gelten als wichtige Säulen des regionalen Handels. In der Steiermark betreiben 125 selbstständige Kaufleute SPAR-Standorte. Sie stehen für Kundennähe, individuelle Servicekultur und starke lokale Verankerung. Durch ihre unternehmerische Verantwortung sichern sie nicht nur Nahversorgung, sondern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen.
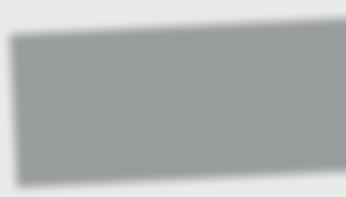











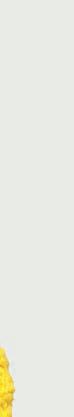

WKO-Präs. Josef Herk eröffnete das neue Center of Excellence gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft.
Um den Herausforderungen durch Digitalisierung und technologischen Wandel zu begegnen, hat die WKO Steiermark mit dem „Center of Excellence“ in Graz das größte Bildungs-Infrastrukturprojekt ihrer Geschichte realisiert.
Das neue WIFI-Technikzentrum in der Körblergasse bei der WKO Steiermark löst die veralteten Werkstätten ab und startet nun in den Vollbetrieb. „Ein wahrer Meilenstein für die berufliche Qualifizierung“, betonen WKO-Präsident Josef Herk, Direktor Karl-Heinz Dernoscheg, WIFI-Kurator Markus Kohlmeier und Institutsleiter Martin Neubauer. Der von ATP Architekten Ingenieure entworfene Bildungscampus umfasst 14.300 m² Bruttogeschossfläche und bietet moderne Werkstätten für viele Branchen.
Investition in die Zukunft
Nach dem ersten Bauabschnitt 2024, der ein breites Ausbildungsangebot für technische Handwerkssparten umfasst, sind nun auch Mobilitäts-, Metalltechnik und das Gastronomie-Ausbildungszentrum eingezogen. „Wir verfügen jetzt über Österreichs modernstes Berufsausbildungszentrum“, erklärt Kohlmeier stolz. Die Baukosten für das Gebäude liegen bei 46,6 Millionen Euro inklusive einer Projekterweiterung um ein nachhaltiges Energiekonzept. Damit ist es gelungen, ein zukunftsfittes Gebäude zu errichten, dabei den Budgetpfad einzuhalten und die Kostensteigerungen während der Bauphase konnten weitestgehend aufgefangen werden. „Eine Investition der steirischen Wirtschaft in ihre Zukunft“, betonen Herk und Dernoscheg.
Verbesserte Erreichbarkeit
Das Zentrum deckt sowohl Zukunftsfelder wie Elektrotechnik als auch klassische Kernkompetenzen wie Gastronomie und Kfz-Technik ab. Im Jahr 2026 startet die Tagungsreihe „WIFI Excellence“ mit Fachtagungen zu Themen wie KI und Schweißtechnik. Ein neues Parkhaus mit 650 Stellplätzen sowie vergrößerte Fahrradabstellplätze und ÖPNV-Anbindungen erhöhen die Erreichbarkeit. WIFI-Kunden nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel der Graz Linien vor und nach Kursen kostenlos.

BKS Bank lud zur Reihe „Wirtschaft im Umbruch“
Die Weltwirtschaft steht vor einem tiefgreifenden Wandel und ist geprägt von technologischen Innovationen und neuen Herausforderungen. Für Anleger ergeben sich daraus weitreichende strategische Fragestellungen. Unter dem Motto „Wirtschaft im Umbruch – Perspektiven, Chancen und Entscheidungen“ lud die BKS Bank in der ersten Oktoberwoche zu einer Veranstaltungsreihe in Velden, Graz und Wien. Auf dem Podium diskutierten renommierte Experten wie Ökonom Guntram Wolff vom Bruegel-Institut, Danai-Margarita Budas und Igor Sekardi von der Industriellenvereinigung sowie der Kapitalmarktexperte Alois Wögerbauer über aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Kapitalmarkt und den Wirtschaftsstandort Österreich.

Auf Einladung der Merkur Versicherung trafen sich Anfang August begeisterte Golfer aus der Versicherungsbranche zum traditionellen Charity-Turnier am Golfclub Murhof in Frohnleiten in der Steiermark. „Golf verbindet nicht nur Menschen, sondern hilft dabei, gemeinsame Werte mit Leben zu füllen. Es ist schön, dass auch heuer so viele Unterstützer unserer Einladung gefolgt sind, ganz im Zeichen von Partnerschaft und Sport“, freut sich Vorstand Markus Spellmeyer. In diesem Jahr gehen die Erlöse des Turniers über den Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel an Familien in den Bezirken Graz-Umgebung und Salzburg-Umgebung und tragen dazu bei, den finanziellen Aufwand für die Betreuung ihrer behinderten Kinder zu mildern.

Scheckübergabe mit (v.l.) Bgm.in Eva Schmidinger, Hansi Papst, SPAR-Kauffrau Dagmar Papst und SPAR-SteiermarkGF Christoph Holzer
Die Gemeinde Pernegg an der Mur setzt ein starkes Zeichen für die regionale Nahversorgung: Am 9. Oktober hat Dagmar Papst hier ihren neuen SPARSupermarkt eröffnet.
Nur 200 Meter vom bisherigen Standort entfernt entstand in der Jobstmanngasse ein moderner Nahversorger mit 400 m² Verkaufsfläche, ergänzt durch ein 40 m² Café als Treffpunkt im Ortszentrum. Die Gemeinde übernahm als Bauherrin bewusst Verantwortung für eine nachhaltige Versorgungslösung. Das neue Gebäude bietet klimafreundliche Infrastruktur mit Photovoltaikanlage, zwei öffentlichen E-Ladestationen, CO₂-Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung und stromsparender LED-Beleuchtung.
Zeichen für regionale Versorgung
Die Kundschaft erwartet ein freundlicher Frische-Marktplatz direkt beim Eingang, ein breites Sortiment für den täglichen Bedarf sowie eine neu gestaltete Feinkost mit persönlicher Bedienung. Die größere Fläche ermöglicht mehr Auswahl – insbesondere an regionalen Produkten. Trotz modernem Ausbau bleibt der Markt übersichtlich, gut erreichbar und persönlich geführt. „Mit diesem neuen Standort setzen wir ein klares Zeichen für die regionale Versorgung“, betont Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland. „Besonders hervorzuheben ist das Engagement von Dagmar Papst. Sie kennt ihre Kundschaft und schafft einen Ort, an dem Menschen sich wohlfühlen.“
Ein herzlicher Ort der Begegnung Für Dagmar Papst ist die Eröffnung ein Herzensprojekt: „Wir freuen uns, die Menschen nun auf größerer Fläche mit frischen Lebensmitteln, regionalen Produkten und herzlichem Service zu begleiten. Das Café soll ein Ort sein, an dem man gerne bleibt – ob für den Kaffee am Morgen oder den Plausch zwischendurch.“ Auch Bürgermeisterin Eva Schmidinger unterstreicht die Bedeutung für die Gemeinde: „Wir sichern Einkaufskomfort, Arbeitsplätze und einen Ort der Begegnung. Das stärkt unser Miteinander und verkürzt Wege.“



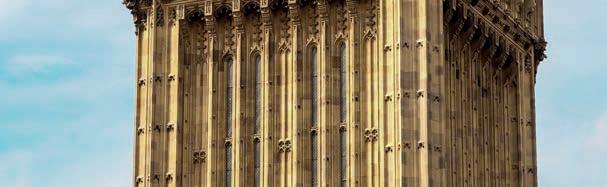
Zürich
und mehr als 200 weitere Ziele über Drehkreuze erreichen.

Spatenstich für GWS-Wohnprojekt in Leoben
In der Judendorfer Straße 56 in Leoben entsteht ein neues, gefördertes Wohnprojekt der GWS, Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen, mit 22 modernen Mietwohnungen samt Kaufoption. Damit wird das Wohnangebot in Leoben gezielt erweitert, um unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen attraktive, leistbare und zukunftssichere Wohnmöglichkeiten zu bieten. „Leoben setzt auf den Ausbau hochwertiger und leistbarer Wohnangebote. Mit dem neuen GWS-Projekt wird dieser Weg konsequent fortgeführt: Es schafft zeitgemäßen Wohnraum für Menschen, die in Leoben leben, arbeiten oder sich neu ansiedeln möchten“, zeigt sich Bgm. Kurt Wallner über das neue Wohnbauprojekt äußerst erfreut.

Im feierlichen Ambiente des Schlossbergsaals hat die Steiermärkische Sparkasse gemeinsam mit dem traditionsreichen Leykam Buchverlag den „Schreiberei“-Literaturpreis verliehen. Die Jury (Schriftstellerin Maria Hofer und Imogena Doderer, die Leiterin des Literaturressorts und ORF-Redakteurin) kürte Sibylle Reuters Roman „Zerbrichmeinnicht“ zum Besten von insgesamt 56 Werken. Reuter erzählt in ihrem Debütroman von der existenziellen Erfahrung, sich von den Eltern zu lösen. Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl überreichte den Preis und betonte: „Literatur ist nicht nur Unterhaltung und Zerstreuung. Sie kann uns helfen, über den Tellerrand zu schauen, unseren Blick zu schärfen und Themen kreativ und innovativ zu verhandeln.“

SPÖ-Schwarz:
LH Kunasek muss endlich handeln

Der Rechnungshofbericht belegt Führungsflucht in der steirischen Landesregierung, erklärt SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz, denn LH Kunasek verweigere die gesetzliche Pflicht zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung und ducke sich weg. Schwarz kritisiert weiter: „Statt Lösungen baut die Regierung den Führungsapparat weiter aus — sogar eine neue Ebene! Kein Plan für die Spitäler, Versorgung wird ignoriert. Die Steirer verdienen ein funktionierendes Gesundheitssystem! Das Missverhältnis zwischen Bürokratie und Praxis zeigt falsche Prioritäten. Wir hinterfragen das im Ausschuss.“ Die steirische SPÖ beantragt die Prüfung des Gesundheitsfonds: „Wo verschwindet das Geld, während die Versorgung leidet? Strukturen müssen geändert werden — jetzt handeln!“

Der Traktor rollt selbstständig aus der Werkshalle, biegt ab und nimmt die Arbeit auf dem Feld auf – ohne Fahrer, gesteuert von intelligenter Software. Was aussieht wie ein Blick in die Zukunft, ist bei AVL in Steyr bereits Gegenwart: Das Grazer Technologieunternehmen hat ein System entwickelt, das Landmaschinen autonom macht. „Wir wollen eine Lösung bieten, die sich rasch integrieren lässt, sicher ist und sich für reale Anwendungen eignet – vom Weinbau bis zur Obsternte“, erklärt Sandro Perla-Steinhuber, Software-Funktionsentwickler bei AVL. Ein entscheidender Vorteil: „Das System ist mit unterschiedlichster Hardware kompatibel und lässt sich flexibel in neue wie bestehende Maschinen einbetten“, so der Techniker.
Mit einem Kick-off-Meeting an der Montanuni Leoben fiel der Startschuss für das Forschungsprojekt Phobos – Phosphorrückgewinnung und Bindemittelbereitstellung als ökonomische Stoffverwertung. Das Projekt wird im Rahmen der FFG-Ausschreibung „Rohstoffe 2024“ gefördert. Unter der Leitung von Zlatko Raonic arbeitet ein Team der Montanuniversität, bestehend aus Klaus Doschek-Held, Christoph Gatschlhofer (Thermoprozesstechnik) und Johanna Irrgeher sowie Shaun Lancaster an der Umsetzung des Projekts. Das Forschungsprojekt soll zur Reduktion von CO₂Emissionen beitragen, die nachhaltige Versorgung mit dem strategischen Rohstoff Phosphor fördern und Kosteneinsparungen in der Baustoffindustrie ermöglichen.
Mit einem festlichen Abend setzte die Gady Family heuer am 26. September ein besonderes Zeichen der Wertschätzung für ihre jungen Fachkräfte. Im Beisein von LH-Stv.in Manuela Khom sowie der stolzen Eltern wurden die jungen Absolventen in der Gady Family Firmenzentrale für ihre erfolgreichen Lehrabschlüsse geehrt. „Die duale Ausbildung ist nicht nur für die Gady Family, sondern für alle Betriebe von großer Bedeutung“, betonte Eigentümer Philipp Gady. Derzeit bildet das Unternehmen 79 Jugendliche in neun Lehrberufen aus. Als besondere Überraschung erhielten alle Nachwuchsfachkräfte erstmals den Gady Leistungs-Award – eine Auszeichnung, die nicht nur die erbrachte Leistung würdigt, sondern auch das Engagement junger Menschen ins Zentrum rückt.


Seit über zwei Jahrzehnten macht der Trigos – der bedeutendste Preis für verantwortungsvolles Wirtschaften – Vorreiter der heimischen Wirtschaft sichtbar, die mit unternehmerischem Mut und Innovationsgeist zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Die ausgezeichneten Initiativen stammen aus allen Regionen und stehen für die Vielfalt und Stärke nachhaltigen Unternehmertums in Österreich. Aus 155 Einreichungen wurden 19 herausragende Projekte nominiert – sieben davon konnten die hochkarätige Experten-Jury im besonderen Maße überzeugen und erhielten die begehrte TrigosTrophäe. Die Nominierten und Gewinner wurden in Wien am 2. Oktober mit einem inspirierenden Gala-Event in der Markterei im ehemaligen Wasserbaulabor gefeiert.

BUSINESS VIRTUALCARDS

JETZT NEU: Virtuelle Business Kreditkarten für Ihre Projekte und Mitarbeiter:innen.



120 virtuelle Karten GRATIS bei Abschluss bis 31.12.2025*
* Angebot gültig für (Neu-)Kund:innen mit George Business bis 31.12.2025. Das Angebot umfasst nur das monatliche Entgelt für den Virtualcard Manager (12 Euro für 120 Karten). Andere Entgelte sind nicht umfasst. Nähere Informationen finden Sie auf www.steiermaerkische.at. Preisbasis: 01.07.2025.





Vorstandsvorsitzender Georg Bucher und Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl präsentieren die Ergebnisse der aktuellen Sparstudie der Steiermärkischen Sparkasse. Den Kunden der Steiermärkischen Sparkasse geht es um Vertrauen, Sicherheit und neue Wege beim Vermögensaufbau.
Auch in wirtschaftlich fordernden Zeiten bleibt das Sparen für die Kunden der Steiermärkischen Sparkasse ein Fixpunkt im Alltag.
Laut aktueller Sparstudie halten 76 Prozent das Zurücklegen von Geld für „sehr“ oder „ziemlich wichtig“ – ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Im Durchschnitt werden monatlich 328 Euro gespart, etwas mehr als im Bundesschnitt. Das klassische Sparbuch bleibt mit 80 Prozent Nutzung die beliebteste Form, gefolgt von Girokonto und Lebensversicherungen. Deutlich dynamischer entwickelt sich die Wertpapierveranlagung. Bereits 40 Prozent der Befragten investieren in Aktien oder Fonds. Das Volumen der Wertpapierdepots in der Steiermärkischen Sparkasse ist seit 2015 um fast 93 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro gestiegen. „Sparen bleibt ein wichtiger Anker im Alltag, doch die Vielfalt der Sparformen nimmt zu“, sagt Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl. Vorstandschef Georg Bucher ergänzt, wer Vermögen sichern wolle, müsse „neue Wege gehen – Wertpapiere bieten hier eine sinnvolle Ergänzung“.
Hinter dem Sparverhalten stehen klare Motive: 84 Prozent wollen für Notfälle vorsorgen, 70 Prozent für die Zukunft absichern, 68 Prozent sparen für Konsumwünsche. Auffällig bleibt der Nachholbedarf bei der Finanzbildung – nur ein Drittel schätzt sein Wissen als gut ein. Initiativen wie der Finanzerlebnispark FLiP im CoSA Graz sollen das ändern.

Kreislaufwirtschaft wirkt in der Bauwirtschaft
Die Reduktion der Abfälle um 15 Prozent bis Ende 2026: Das ist das ambitionierte Ziel des Baustoffherstellers Wienerberger im Rahmen seines Nachhaltigkeitsprogramm 2023 − 2026. Möglich macht das ein maßgeschneidertes „Zero-Waste-Konzept“ des Entsorgungsunternehmens Saubermacher. Grundlage bildet eine fundierte Situationsanalyse und eine stabile Datenbasis. Unternehmensinterne „Zero Waste Ambassadors“ zeigen, wie Abfälle im Betrieb vermieden und Wertstoffe in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Mit dem geplanten weltweiten Rollout ergibt sich ein enormes wirtschaftliches Einsparungspotenzial. Im Fokus stehen dabei betriebliche Arbeitsabläufe sowie die transparente Darstellung unterschiedlicher Abfallströme.

Die RLB Steiermark beteiligt sich mit zehn Prozent an der CMTA AG, einem der führenden Technologieanbieter für den digitalen institutionellen Anleihehandel in Europa. Diese Beteiligung markiert den Beginn einer langfristig angelegten, strategischen Partnerschaft mit dem Ziel, Kapitalmarktprozesse effizienter und zugänglicher zu gestalten – für professionelle Investoren wie Emittenten gleichermaßen. „Mit der RLB gewinnen wir einen strategischen Partner, der gemeinsam mit uns das Ziel verfolgt, einen besseren Kapitalmarkt für unser gesamtes Netzwerk zu schaffen. Wir freuen uns auf eine enge, nachhaltige Zusammenarbeit und den gemeinsamen Ausbau unserer Plattform sowie auf die Erschließung neuer Märkte“, so Christoph Müller, CEO der CMTA AG.









































































































































































Erfolg für Saubermacher bei Trigos Steiermark
Mit dem eigens für die Ski WM 2025 entwickelten „Circular WM Konzept“ zählt Saubermacher zu den Top 3 Klimaschutzinitiativen beim diesjährigen Trigos Steiermark. Gemeinsam mit dem ÖSV entwickelten Saubermacher und Gassner, ein Unternehmen der Gruppe, ein zielgruppenspezifisches Maßnahmenpaket, um die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften in Saalbach 2025 besonders ressourcenschonend zu gestalten. Durch Bewusstseinsbildung, konsequente Abfallvermeidung und -trennung sowie den Einsatz smarter E-LKW wurden die Umweltauswirkungen deutlich reduziert. Dabei lag das mögliche Einsparpotenzial bei 182 t CO₂-Emissionen. Saubermacher Gründer Hans Roth und Team nahmen die Auszeichnung bei der TRIGOS Gala in der Alten Universität Graz entgegen.

In der GV der Vereinigung Öffentlicher Mandatare in der Steiermark wurde der ehemalige LT-Abg. Wolfgang Kasic einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt und folgt in dieser Funktion auf Ridi Steibl. In seiner Antrittsrede betonte Kasic, wie wichtig der gesellschaftliche Zusammenhalt sei, besonders die Zusammenarbeit zwischen ehemaligen und aktiven Mandataren. „Pointierte und kritische Auseinandersetzungen im Parlament sind notwendig, allerdings nicht unter der Gürtellinie“, sagte Kasic. Geplant sind politische Diskurse, wirtschaftspolitische sowie kulturelle und gesellschaftspolitische Veranstaltungen. Als Stellvertreter wurden neu der Präsident des Bundesrates, Peter Samt, sowie die Bundesrätin und frühere LT-Präs. Gabriele Kolar, gewählt.

Steirische Jungwinzer 2025 gekürt
Die Steiermärkische Sparkasse kürte zum 24. Mal die besten Nachwuchstalente des steirischen Weinbaus. Bei der Prämierungsfeier am 16. Oktober in den Schlossbergsälen wurden die Jungwinzer des Jahres 2025 geehrt – ein starkes Zeichen für die Förderung der nächsten Winzergeneration. Insgesamt nahmen 60 Betriebe mit 175 Weinen in sechs Kategorien teil. Die Bewertung erfolgte durch eine Fach- und Finaljury mit Experten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Zu den Siegern zählen Kevin Weiner (Welschriesling), Josef Pöltl (Weißburgunder) und Florian Adam-Lieleg (Sauvignon Blanc). Mit dem Wettbewerb stärkt die Steiermärkische Sparkasse ihre Partnerschaft mit der Wein Steiermark und fördert nachhaltig die Zukunft des heimischen Weinbaus.

Auszeichnungen für
Die LK Steiermark hat die Bäuerlichen Unternehmerinnen 2025 gekürt. Unter dem Motto „Gestalterinnen in der Landwirtschaft“ überzeugten die Finalistinnen mit Innovationsgeist und unternehmerischem Denken. Den Sieg in der Kategorie Urproduktion holte sich Heidi Kaufmann-Ferstl aus Trofaiach, gefolgt von Veronika Almer (Birkfeld) und Bernadette Pieber (Naas). In der Kategorie Diversifizierung gewann Andrea Wiedner aus St. Kathrein am Offenegg vor Sophie Bretterklieber (Lannach) und Sabine Rinnhofer (Hönigsberg). Den Sonderpreis „Die Sozialen“ erhielten Grete Kirchleitner und Johanna Aust für ihr langjähriges Engagement. Insgesamt bewarben sich 32 Bäuerinnen um den Titel – ein starkes Zeichen für die Innovationskraft in der steirischen Landwirtschaft.


Der Cube Sat „W-Cube“ ist nach vier Jahren Betrieb am 1. Oktober wie geplant in der Erdatmosphäre verglüht. Der Minisatellit, initiiert von der ESA und unter maßgeblicher Beteiligung von Joanneum Research, sendete als erster weltweit ein 75-GHz-Signal (W-Band) mit dual-zirkularer Polarisation aus dem Weltraum. Die erfolgreiche Mission im niedrigen Erdorbit bewies die Funktion von W-Band (75 GHz) und Q-Band (37,5 GHz) als Zubringerkanäle (Feeder Links) für Satelliteninternet. Diese Hochfrequenzen ermöglichen deutlich höhere Datenraten als heutige Frequenzbereiche und sind entscheidend für die nächste Generation globaler Breitband-Satellitensysteme. Die Erkenntnisse fließen direkt in die Konzeption künftiger Hochleistungs-Satellitenkommunikationssysteme ein.

Neues Gesundheitszentrum Leoben eröffnet
Mit der Eröffnung der neuen Primärversorgungseinheit (PVE) Leoben im Dienstleistungszentrum Vordernberger Straße setzt die Stadt einen wichtigen Schritt für eine moderne, wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Drei Ärztinnen, Pflegekräfte und Therapeutinnen bieten dort ab sofort eine ganzheitliche Betreuung. Betrieben wird die Einrichtung von den Barmherzigen Brüdern Graz. Bürgermeister Kurt Wallner spricht von einem „Meilenstein für die Gesundheitsversorgung in Leoben“, Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betont die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit. Die Stadt reagiert damit auf den drohenden Ärztemangel und stärkt nachhaltig die medizinische Infrastruktur in der Region.
Bankkunden in Europa erleben mit der Instant-Payment-Verordnung eine Erneuerung. Bekanntlich sind seit 9. Oktober SEPA-Echtzeitüberweisungen in der EU verpflichtend. Bei Raiffeisen ist die Umstellung der Instant-PaymentVerordnung sehr positiv verlaufen. Die Bankengruppe war auf die Neuerungen im Zahlungsverkehr bestens vorbereitet. Bereits seit 2017 werden Express- und Echtzeitüberweisungen im Electronic Banking angeboten. „Unser Anspruch ist es, über die gesetzlichen Anforderungen hinaus unseren Kunden so viel Komfort wie möglich im digitalen Zahlungsverkehr zu ermöglichen und neue Standards zu setzen. Technologie ist nur dann ein Fortschritt, wenn sie Vertrauen schafft“, erklärt RLB-Vorstandsdirektorin Ariane Pfleger.





























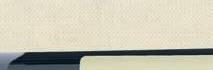





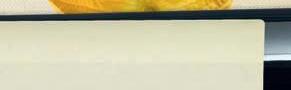
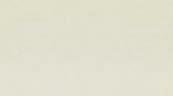








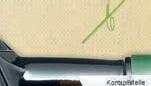




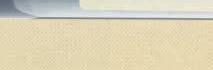





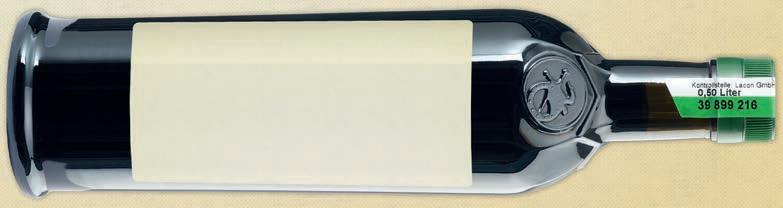






















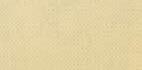

































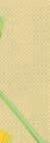





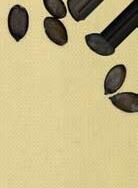







Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, lud LT-Präs. Gerald Deutschmann gemeinsam mit LH Mario Kunasek zum feierlichen Landhausfest im Zeichen der Volkskultur in das Grazer Landhaus. Anlass war das 120-jährige Bestehen des Steirischen Volksliedwerks – einer Institution, die seit 1905 das musikalische Kulturerbe der Steiermark bewahrt und weiterträgt. „Volkslied und Volksmusik sind längst nicht nur ein Stück Tradition – sie sind Teil unserer Identität, sie verbinden Generationen, Regionen und Menschen über Grenzen hinweg. Das Volksliedwerk hat es über mehr als ein Jahrhundert hinweg verstanden, diese Werte zu bewahren und gleichzeitig in die Zukunft zu tragen“, betonte Deutschmann in seiner Eröffnungsrede.
Drohende Verschlechterungen in der Gesundheitsversorgung aufgrund fehlender Finanzierung, beunruhigen die steirische SPÖ. Klubobmann Hannes Schwarz nimmt die blau-schwarze Landesregierung in die Pflicht: „Dass Blau-Schwarz einen Sparkurs im Gesundheitswesen fährt, merken wir schon länger. Wenn die Ankündigung des Finanzlandesrats hält, im kommenden Landesbudget über 300 Mio. Euro strukturell einzusparen, dann stehen die großen Einschnitte bevor. Das wäre eine enorme Verschlechterung der Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer, die monatlich hohe Abgaben zahlen und daher Anspruch auf die beste Gesundheitsversorgung haben.“ Die SPÖ will daher im Landtag eine Anfrage zum aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen KAGes und Bundesregierung stellen.


Sie suchen noch einen gemütlichen Ort für Ihre Weihnachtsfeier? Ein Lokal mit einem tollen Ambiente, hervorragender Küche und außergewöhnlichem Flair?
Ob romantisch zu zweit, mit Freunden im kleinen Kreis, oder für Ihre Firma von 2 – 80 Personen. Hier finden Sie für jede Gelegenheit genau das!

FH Joanneum eröffnet Gesundheitscampus
Ein neuer, zusätzlicher Standort des Instituts Gesundheits- und Krankenpflege wurde von der FH Joanneum in der Kapfenberger Innenstadt etabliert. Gestartet wird mit 70 Studienanfängerinnen und -anfängern. An der Eröffnungsfeier nahmen Vertreter aus der Politik, dem Gesundheitswesen und der FH Joanneum teil. LR Willibald Ehrenhöfer erklärte: „Mit dem FH-Gesundheitscampus in Kapfenberg setzen wir den Ausbau der Studienplätze für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe konsequent fort und tragen dem steigenden Bedarf an Pflegekräften Rechnung. Wir haben darüber hinaus erstmals ein entsprechendes Ausbildungsangebot außerhalb von Graz geschaffen. Das Projekt ist damit ein wichtiger Impuls zur Stärkung der Region und der Kapfenberger Innenstadt.“
Wer im kommenden Jahr einen Trip nach London plant, kann ab sofort von Ende März bis in den Oktober die Flüge zwischen Graz und London Gatwick buchen und die Vorfreude so richtig auskosten. Die neue Verbindung von British Airways/BA Euroflyer startet am 21. November 2025 – und ist schon jetzt auch für den Sommerflugplan 2026 buchbar. „Wir erhalten zahlreiche Anfragen von Reisebüros, Unternehmen und Privatpersonen – umso erfreulicher, dass die Sommerflüge nun freigeschaltet sind“, so Wolfgang Grimus, GF des Flughafen Graz. Geflogen wird – wie im Winter – dreimal wöchentlich, jeweils montags, mittwochs und freitags. Damit können Steirerinnen und Steirer ihren Sommertrip nach London zu Big Ben, Tower Bridge oder Buckingham Palace schon jetzt fix planen.












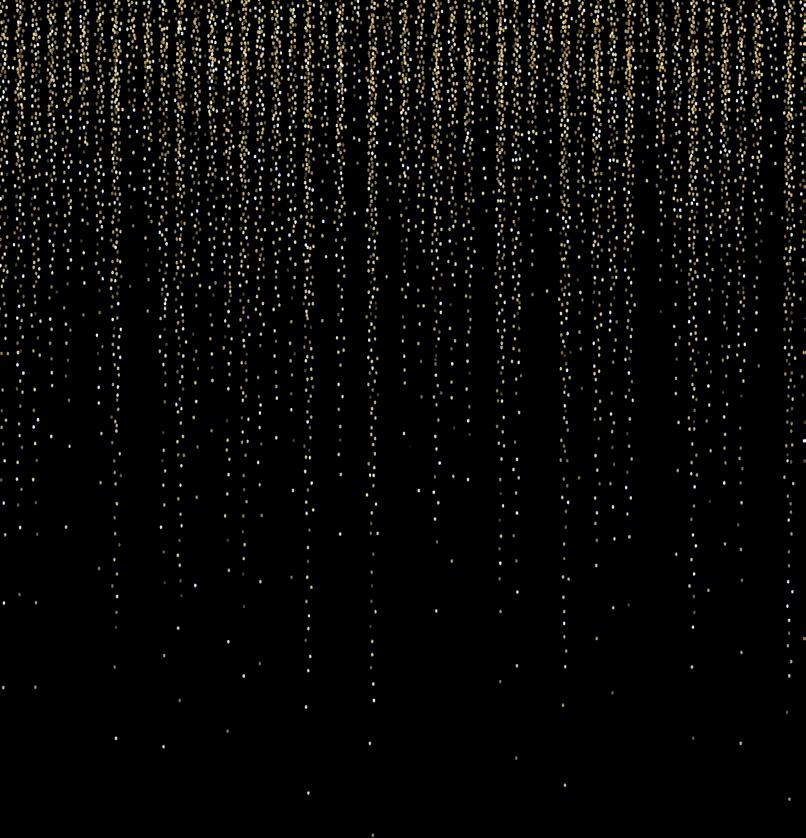





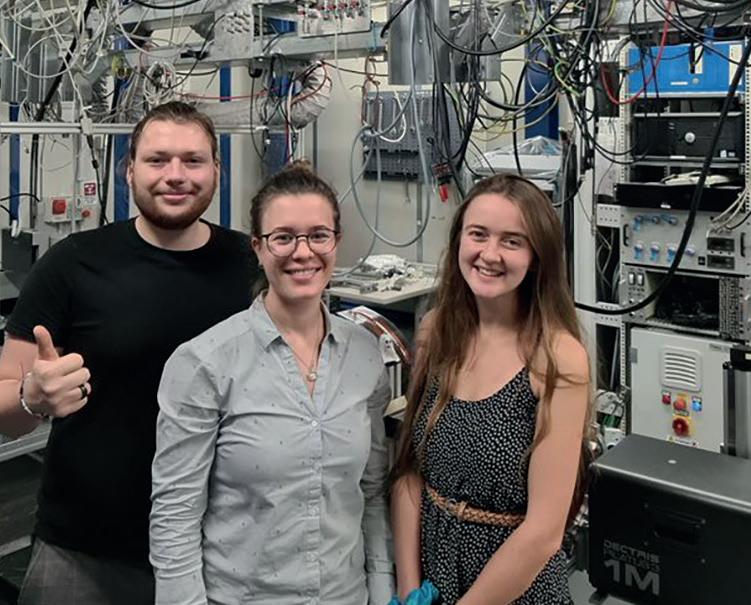
Montanuni erforscht Superkondensatoren
Forschende der Montanuniversität Leoben haben mithilfe von Synchrotronstrahlung eine zentrale Wechselwirkung in Superkondensatoren aufgedeckt und deren Einfluss auf den Transport der Ladungsträger beschrieben – eine Erkenntnis, die den Weg zu leistungsfähigeren Energiespeichern ebnet. Die Arbeit entstand im Rahmen der Dissertation von Malina Seyffertitz am Lehrstuhl für Physik in Kooperation mit der Cambridge University. „Wir wollten verstehen, was im Inneren eines Superkondensators während des Ladens- und Entladens im Detail passiert und wie sich die Ionen als Ladungsträger in den Nanometer-kleinen Poren der Elektroden verhalten“, erklärt der Betreuer Oskar Paris. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht.








Beim Landesjungbauerntag wurde David Tischler als neuer Obmann gewählt und folgt damit auf Bernd Brodtrager, der das Amt zwei Jahre innehatte. Tischler möchte sich mit einem engagierten Team für die Anliegen der rund 4.000 jungen Landwirtinnen und Landwirte in der Steiermark einsetzen. Der scheidende Obmann Brodtrager zog eine positive Bilanz seiner Amtszeit: „Wir haben vieles erreicht und wichtige Projekte auf den Weg gebracht – von der Jungbauern-Restlbox bis hin zum Transparenzteller. Besonders stolz bin ich auf die Jungbauern-Hofgespräche und die vielen inhaltlichen Initiativen, die wir gestartet haben.“ LK-Präsident Steinegger gratulierte dem neuen Obmann sowie den beiden neu gewählten Beiräten in seiner erfrischenden Rede.
Spatenstich für Kläranlage Gössendorf
In Gössendorf fiel der Startschuss für eines der größten Umweltprojekte der Stadt Graz: die Erweiterung und Sanierung der Kläranlage. Bis 2029 wird die Kapazität von derzeit 500.000 auf 815.000 Einwohnerwerte erhöht. Neben einem zusätzlichen Belebungsbecken werden auch zentrale Anlagenteile erneuert und die Gasspeicherkapazität auf 4.000 m³ erweitert. Ziel ist es, die Energieautarkie von rund 90 % zu halten und jährlich rund 900 Tonnen CO₂ einzusparen. Die Stadt investiert dafür rund 83 Millionen Euro. Bgm.in Elke Kahr betont die Bedeutung einer verlässlichen Abwasserentsorgung, Vize-Bgm.in Judith Schwentner spricht von einem „Investitionsprojekt in sauberes Wasser und eine intakte Umwelt“.





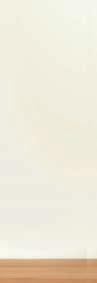



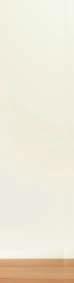

Ennstal Milch setzt auf die Zusammenarbeit mit rund 250 kleinstrukturierten Bio-Milchviehbetrieben, einen davon bewirtschaftet Viktoria Gewessler in Bad Mitterndorf.
Die Ennstal Milch und SPAR feiern das 30-jährige Jubiläum ihres partnerschaftlichen Erfolgsmodells für regionale Wertschöpfung und biologisch produzierte Lebensmittel.
Seit 1995 ist die steirische Molkerei in Stainach-Pürgg Partner von Spar Naturpur und zählt damit zu den Pionieren der BioBewegung in Österreich. Schon früh wurde der Wandel hin zu ökologischer Landwirtschaft aktiv mitgestaltet. Die Bio-BergbauernVollmilch gehörte zu den ersten Produkten der Marke und ist bis heute im Sortiment vertreten.
Trendige Bio-Kaffeegetränke
Über die Jahre wurde die Zusammenarbeit kontinuierlich vertieft. Heute beliefert die Ennstal Milch SPAR mit einem breiten Angebot an hochwertigen Bio-Milchprodukten. Besonders erfolgreich ist das Bio-Eiskaffee-Sortiment, das im Ennstal hergestellt wird und sich zu einem ganzjährigen Trendgetränk entwickelt hat. Die

Range umfasst Bio-Espresso, Bio-Cappuccino, Bio-Latte Macchiato sowie neu den veganen Bio-Kaffee-Shot – ein stark aufgebrühter Espresso ohne Zuckerzusatz. Der Fokus liegt auf natürlichem Geschmack und dem Verzicht auf künstliche Süßstoffe.
Kleinstrukturierte Biobetriebe
Die Basis der Produktion bilden rund 250 kleinstrukturierte BioMilchviehbetriebe aus der Region, deren Milch innerhalb eines Radius von 50 Kilometern verarbeitet wird. Eine von ihnen ist die junge Bio-Bäuerin Viktoria Gewessler aus Bad Mitterndorf, die betont, wie wichtig Weidehaltung und Tierwohl für die Qualität der Milch sind.
Mit inzwischen rund 1.300 Produkten ist SPAR Natur pur heute die größte Bio-Marke im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Die Partnerschaft mit der Ennstal Milch zeigt, wie nachhaltig orientierte Kooperationen ökonomischen Erfolg, regionale Entwicklung und verantwortungsvolle Produktion verbinden können – und das seit drei Jahrzehnten: ein starkes Beispiel dafür, wie Bio-Landwirtschaft, regionale Betriebe und Handel gemeinsam Zukunft gestalten können.

Vertriebsmanager
Wir haben spannende Jobs für Menschen, die unsere Energiezukunft mitgestalten wollen.

Der Steirische Junker 2025 ist da!
Am 24. Oktober beginnt wieder die Junkerzeit. Der Steirische Junker 2025 präsentiert sich frisch, fruchtig und jugendlich – als Vorbote des neuen Jahrgangs Rund 100 Junker-Winzer laden am 5. November zur großen Junkerpräsentation in die Grazer Stadthalle, wo die neuen Junker-Botschafter vorgestellt werden. Die Lese 2025 brachte ideale Bedingungen: warme Tage, kühle Nächte und harmonische Reife. „Qualität und Ertrag stimmen uns heuer besonders optimistisch“, so Wein-Steiermark-Obmann Stefan Potzinger. „Was kann man vom heurigen Jahrgang erwarten? Sehr viel – sowohl Qualität als auch Ertrag stimmen mich optimistisch. Wir steuern auf eine sehr gute Ernte zu, Leichtigkeit und Frische sind zurück in den steirischen Weinen“, ergänzt GF Martin Palz.


Steirerinnen punkten bei Austrian Skills 2025
Julia Gschwandtner aus Salzburg ist Österreichs beste Floristin 2025 und löst das Ticket für World Skills 2026 in Shanghai. Vize-Staatsmeisterin Leonie Schweighofer (Weiz) fährt zu EuroSkills 2027 nach Düsseldorf. Ihre Namensvetterin Anna Schweighofer landet auf Platz 3. „Extrem knapp – ein Wahnsinn!“, so Gschwandtner. „Ein toller Wettbewerb, der gezeigt hat, wie stark unsere jungen Talente sind. Die Aufgaben waren bereits auf die WorldSkills in Shanghai ausgerichtet – entsprechend hoch war das Niveau. Hier geht es nicht nur um Routine, sondern um Spontaneität, Kreativität und Präzision“, erklärt LIM Johann Obendrauf. Er richtete den Wettbewerb gemeinsam mit Expertin Petra Hütter aus, welche die heimischen Talente seit Jahren auf die Bewerbe vorbereitet.
Die Kärntner Industrie steht vor einer massiven Transformation: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Automatisierung verändern viele Produktionsprozesse grundlegend. Der Strombedarf der energieintensivsten Industriebetriebe wird sich laut einer Studie bis 2040 verdoppeln, der Wasserstoffbedarf steigt bis 2030 ebenfalls stark an. „Ohne ein leistungsfähiges Stromübertragungsnetz ist die Energiewende nicht möglich“, betont René Haberl, Vorstand der Treibacher Industrie AG und Mitglied des Vorstandes der IV Kärnten. „Netzengpässe sind schon heute Realität. Ein Aufschub der geplanten 380-kV-Leitung würde die Wettbewerbsfähigkeit Kärntens empfindlich schwächen mit Folgen für Investitionen, Arbeitsplätze und den Wohlstand der Region.“

„Alle ab jetzt gesetzten Maßnahmen sind förderfähig“, erklärt Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer.
Nach einer umfassenden Evaluierung mit Experten, Wirtschaft und Sozialpartnern hat die steirische Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer einen Fahrplan für die Wiederaufnahme der Wohnbau- und Heizungsförderungen vorgestellt.
Unser Ziel ist ein sozial treffsicheres, effizientes und zukunftsfittes Fördersystem“, betont Schmiedtbauer. Ab sofort können Sanierungen und Heizungstausch wieder gefördert werden. Die Bundesförderungen starten im November mit jährlich 360 Mio. Euro. Alle ab jetzt gesetzten Maßnahmen sind förderfähig. „Das gibt Planungssicherheit und Impulse für die Wirtschaft“, so Schmiedtbauer.
Sanierungsoffensive für Ortskerne Ab Jänner 2026 wird die „Sanierungsoffensive zur Belebung von Ortskernen“ neu aufgelegt, mit zinsgünstigen Darlehen für den Kauf und die Sanierung von Gebäuden in Innenstädten. „Wir wollen die Herzen unserer Gemeinden stärken“, so Schmiedtbauer. Die Eigenheimförderung für Neubauten und Sanierungen startet mit bis zu 80.000 Euro Darlehen, einem Baukastensystem und einem Bonus für Jungfamilien. Ab dem zweiten Quartal 2026
führt die Steiermark den „Sanierungspass“ ein, der „Kleine Sanierung“ und „Umfassende energetische Sanierung“ kombiniert. Dieses Modell belohnt schrittweise thermisch-energetische Sanierungen mit steigenden Fördersätzen. „Wir machen Sanieren attraktiver“, erklärt Schmiedtbauer.
Erfolge und Ausblick
Trotz des Antragsstopps im Frühjahr läuft der geförderte Wohnbau erfolgreich: Derzeit entstehen etwa 1.800 geförderte Wohnungen, und rund 2.400 Mietwohnungen wurden thermisch saniert. „Wegen Erfolgs geschlossen, war das ehrliche Fazit. Jetzt starten wir voll durch“, so Schmiedtbauer. Die Umsetzung beginnt nach dem Budgetbeschluss im Dezember, Details zu Förderrichtlinien folgen. Das Fördersystem soll Wohnqualität verbessern, Eigentumsbildung fördern und Arbeitsplätze sichern – für die Menschen und die Zukunft der Steiermark.

Hans
Schaffer,
Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau
Die ÖWG Wohnbau feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Welche Werte prägen die Genossenschaft bis heute?
Ein zentrales Thema ist seit jeher die Leistbarkeit von Wohnraum. Daran hat sich in 75 Jahren nichts geändert. Nach dem Krieg stand die Linderung der Wohnungsnot im Vordergrund, heute sind es Quartiersentwicklung, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz – stets getragen von einem hohen Qualitätsverständnis.
Wie begegnet die ÖWG Wohnbau den steigenden Grundstücks-, Bau- und Energiekosten sowie den demografischen Veränderungen?
Wir verfügen über einen großen Bestand an unbebauten Grundstücken und erweitern diesen laufend. Dank unserer Erfahrung im Baumanagement können wir Projekte kostenschonend umsetzen. Zudem arbeiten wir seit Jahren mit verlässlichen Partnern zusammen. Ein Schwerpunkt liegt auf der energetischen Qualität unserer Gebäude – etwa durch die Gründung einer eigenen Bürgerenergiegemeinschaft.
Welche Rolle sehen Sie in Zukunft für die ÖWG Wohnbau als gemeinnützigen Wohnbauträger?
Wir wollen auch weiterhin ein verlässlicher Partner für leistbares Wohnen bleiben – nicht nur beim Neubau, sondern ebenso bei der Sanierung. Bestehende Gebäude werden von uns instandgehalten und im Zuge von Modernisierungen nachhaltig auf aktuelle Energiestandards gebracht.
Mag.(FH) Elke Raich
RE/MAX for all e.raich@remax-for-all.at
0664 424 17 67


Daniel Harg
RE/MAX for all d.harg@remax-for-all.at
0664 18 73 385
Der aktuelle RE/MAX ImmoSpiegel zeigt: Zum Halbjahr 2025 wurde ein Drittel mehr an Einfamilienhäusern verkauft als im Jahr zuvor – bei stabilen Preisen. Auch die Eigentumswohnungen zogen deutlich an.
In der Steiermark wurden 2.879 Wohnungen verkauft – ein Plus von 21,2 %. Graz glänzt mit 1.433 Verbücherungen (+ 34,9 %). Der Durchschnittspreis liegt in Graz bei 3.242 €/m², was einem Plus von 42,7 % seit 2015 entspricht. Landesweit bleibt die Steiermark – wenn auch stabil - mit 2.849 €/m² klar unter dem Österreichschnitt (4.300 €/m²). Dies sorgt für Preisattraktivität. Doch die Nachfrage trifft auf begrenztes Angebot. Besonders neue oder generalsanierte Wohnungen
fehlen. Ohne Investitionen droht ein Rückgang des Bestands – und damit steigende Preise.
Das aktuelle Zinsniveau, temporäre Gebührenbefreiungen bei Grundbucheintragungen, inflationsbedingte Lohnanpassungen, ein gewisser psychologischer Gewöhnungseffekt sowie Preiskorrekturen der Vorjahre haben offenbar dazu geführt, dass sich viele nun wieder an Immobilientransaktionen heranwagen. Dazu kommt: Neubau ist aufgrund der gestiegenen Bau-
kosten für viele schwer leistbar. Die Folge: Immer mehr weichen auf Bestandsimmobilien aus – und passen diese schrittweise an die eigenen Bedürfnisse an. Wie im Vorjahr hat sich RE/ MAX auch im ersten Halbjahr 2025 deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Alles deutet darauf hin: RE/MAX steuert in Österreich auf das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte zu.
Jetzt informieren und passende Möglichkeiten entdecken!



Persönliche Beratung im An- und Verkauf sowie umfassendes Service bei Ihren Immobilienentscheidungen haben bei uns erste Priorität. Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung: von der sorgfältigen Bewertung über die Erarbeitung und Umsetzung eines Verkaufskonzeptes bis zur problemlosen Abwicklung des Kaufvertrages.
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Sandra Kielhauser
E-Mail:sandra.kielhauser@rlbstmk.at
Tel.: 0316/8036-22704oder Mobil 0664/627 51 03
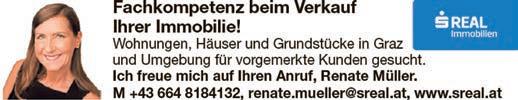



Stolz auf 75 Jahre ÖWG-Erfolgsgeschichte: (v.l.) Claudia Nutz, Hans Schaffer, Andreas Pötsch und Christian Krainer
GRAZ-PUNTIGAM: Wow trifft Wohlfühlen: Reihenhaus mit vielen Extras, Wfl. ca. 114,4 m², Gfl. ca. 218 m², Balkon = 8,14 m², Terrasse = 28,74 m², Doppelcarport, Keller, HWB: 23,6 kWH/m2a, Klasse A, RE/MAX for all, Mag. (FH) Elke Raich, 0664/42 41 767, Kaufpreis 499.500,- Euro, www.remax.at/1606-16594


Seit ihrer Gründung im April 1950 hat sich die Österreichische Wohnbaugenossenschaft (ÖWG Wohnbau) im Verlauf eines Dreivierteljahrhunderts zu einem der bedeutendsten Bauträger Österreichs entwickelt.
Als größter gemeinnütziger Wohnbauträger der Steiermark und fünftgrößter des Landes betreut ÖWG heute über 33.000 Wohneinheiten, beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und realisiert jährlich ein Neubau- und Sanierungsvolumen von rund 135 Mio. Euro. Zum Jubiläum 2025 werden 75 Bäume in Grazer ÖWGAnlagen gepflanzt – ein Symbol für nachhaltiges Wachstum.
Unternehmerische Weitsicht
GRAZ-LIEBENAU: Modernes Penthouse mit Luxus-Elementen, Wfl. ca. 79,55 m², Balkon = 6,75 m², Terrasse = 36,31 m², Garage, Kellerabt., HWB: 45,3 kWH/m2a, Klasse B, RE/MAX for all, Mag. (FH) Elke Raich, 0664/42 41 767, Kaufpreis 499.500,- Euro, www. remax.at/1606-16608
Die Geschichte des Unternehmens begann mit ersten Projekten in Graz und Wien. Schon früh setzte ÖWG Maßstäbe: mit der Etablierung einer Planungsabteilung in den 1970er-Jahren und der Gründung der Tochter ÖWGES. Seither prägen Innovationsgeist und unternehmerische Weitsicht die Entwicklung. „Wir haben das genossenschaftliche Modell weiterentwickelt und unsere Kunden in den Mittelpunkt gestellt“, betont Vorstandsdirektor Christian Krainer.
ÖWG Wohnbau ist bekannt für Pionierprojekte wie das Rondo in Graz, das nachhaltige Wohnbauprojekt am Sternäckerweg oder die Quartiersentwicklung auf den Reininghausgründen. Mit dem flexiblen Wohnkonzept „Kiubo“, das 2021 auf der Architekturbiennale vorgestellt wurde, gelang der Schritt in eine neue Wohnbauära. Das modulare Prinzip wurde mehrfach ausgezeichnet und ist aktuell auf der Expo in Japan vertreten.
FAZIT Immobilien wirken
Anzeige Foto: ÖWG / Martin Schönbauer
Dienstleistungen und Nachhaltigkeit
Neben gefördertem und freifinanziertem Wohnbau bietet die Unternehmensgruppe heute auch Dienstleistungen rund um Objektmanagement und Gebäudeservice an. Über die Tochtergesellschaft „Hausmeisterei“ werden mehr als 8.300 Wohnungen betreut – seit 2025 auch extern. „Unser Blick richtet sich nach vorn: Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft sind die Leitlinien für die kommenden Jahrzehnte“, so Krainer. „Wohnungen sollen für Menschen da sein, nicht für Profit.“
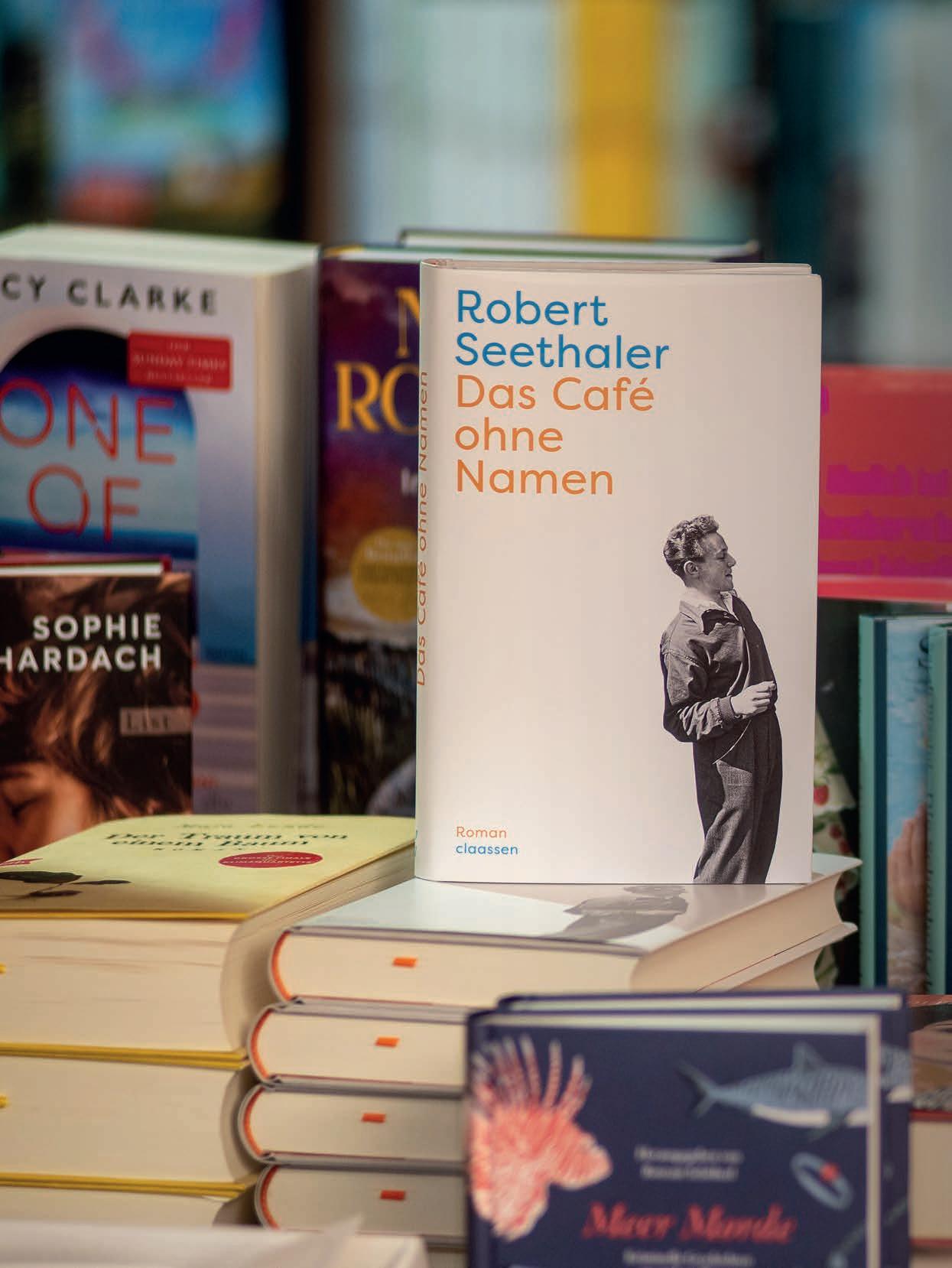

Best of Fazitportrait
Von Volker Schögler mit Fotos von Heimo Binder
Seit genau 75 Jahren ist die Buchhandlung
Plautz in der Stadt Gleisdorf für die literarische Nahversorgung zuständig und hat sich einen so guten Ruf erarbeitet, dass Kunden sogar aus der nahen Landeshauptstadt anreisen.
Der Wohlfühlatmosphäre des oststeirischen Hauses kann sich kaum ein Bücherwurm entziehen.
Es gibt Orte, an denen man sich wohlfühlt, ohne genau zu wissen warum. Nicht dazu gehören Gerichte, Aufbahrungshallen oder Zahnarztpraxen – auch wenn sie allesamt notwendig sind. Dazu gehören Kaffeehäuser mit angeschlossener Konditorei, Kaffeehäuser ohne angeschlossene Konditorei oder Buchhandlungen, egal ob mit oder ohne. Das Beste wäre natürlich ein Kaffeehaus mit Buchhandlung, doch das gibt es nur in Triest. Aber auch in Gleisdorf in der Oststeiermark gibt es so einen Ort zum Wohlfühlen: Die Buchhandlung Plautz, die schon von außen besticht. Mit seiner frischen roten Fassade und seinen weißen Fensterbalken sieht das alte Haus aus wie aus dem Märchenland, jedenfalls so, wie man sich eine idealisierte Buchhandlung vorstellt. Ein Knusperhäuschen, das zum Eintreten regelrecht einlädt. Doch in seinem Inneren wartet keine böse Hexe, sondern im Gegenteil, der nette Herr Schwarz. Claus Schwarz (64) ist der Neffe von Helga Plautz, der Tochter von Karl Plautz, der die Buchhandlung 1948 gegründet hat. Ihr jahrzehntelanges Engagement für eine Leseförderung, die nach ihren Vorstellungen schon ab frühester Jugend gepflegt werden sollte, ist in der Buchhandelslandschaft österreichweit Legion. Nach wie vor liegt daher ein Schwerpunkt des erstaunlich umfangreichen Sortiments der Buchhandlung Plautz auf Kinder- und Jugendliteratur.
Leitbetrieb von Gleisdorf
Die 300 Quadratmeter große Verkaufsfläche – plus 200 Quadratmeter Büro und Lager – ist ständig mit 30.000 Büchern gefüllt. »Jeden Tag werden 200 bis 250 Kilogramm Bücher angeliefert«, so Claus Schwarz, »das werden geschätzt etwa 400 Bücher sein.« Im Durchschnitt tragen sechzig bis siebzig Kundenbestellungen pro Tag ihren Teil zum Umsatz bei, der, wie in der Branche üblich, zwar nicht kommuniziert wird, aber jedenfalls im siebenstelligen Bereich liegt. Das ist auch das Verdienst des insgesamt neunzehnköpfigen Teams, das bei Herausrechnung der Teilzeitanstellungen


Manche Kunden bestehen sogar darauf, das Porto zu bezahlen.
Claus Schwarz, Buchhändler
noch immer dreizehn Mitarbeitern entspricht. Nicht zuletzt deshalb wird das traditionsreiche Unternehmen zu den Leitbetrieben von Gleisdorf gezählt. Die Stadt hat rund 12.000 Einwohner, aber mit den Umlandgemeinden ein Einzugsgebiet von 20.000 bis 22.000 Personen. »Aber auch bei Grazern ist die Buchhandlung beliebt«, weiß Petra Schaller, die seit 2021 Geschäftsführerin ist. Am Tag des Interviews gab es knapp 200 zahlende Kunden, also mindestens 200 Buchverkäufe, noch ohne jene an diverse Bibliotheken, Rechnungs- und Onlinekunden.
Lockdown als Onlinebooster
Das Onlinegeschäft in der Buchhandlung Plautz hat sich in der Corona-Zeit entwickelt und macht heute rund 15 Prozent des Umsatzes aus. Schwarz: »In den drei Jahren der Pandemie mussten wir insgesamt 16 Wochen unser Verkaufslokal schließen. Zum Glück hatten wir bereits im Jahr 2019 einen Onlineshop geplant und im November 2019 im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft auch installiert. Als daraufhin 2020 der erste Lockdown kam, hatten wir den modernsten Internetshop im österreichischen Buchhandel.« Für eine vorausschauende und innovative Vorgehenssweise vor allem in Servicebereich ist die Buchhandlung Plautz seit langem bekannt – nicht umsonst wurde sie unter anderem im Jahr 2017 vom Bundeskanzleramt zur »Buchhandlung des Jahres« gekürt oder vom AVJ, der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, als kinderfreundlichste Buchhandlung Österreichs mit dem Kinderbuchhandlungspreis ausgezeichnet. In der Gleisdorfer Buchhandlung ist man stolz darauf, die Lockdownphase ohne Kurzarbeit und ohne Förderungen bewältigt zu haben. Ein eigener Tonbanddienst wurde eingerichtet, eine »Click & Collect«-Station, Bilder im Netz sowie online und telefonische Beratung stellten viele Kunden zufrieden, und zugestellt wurden die Bücher persönlich. Schwarz: »Das habe ich oft mit dem Fahrrad gemacht, genauso wie mein Großvater damals, als man sich noch kein Auto leisten konnte.« Onlinebuchtrailer, Autoreninterviews und das intensive Bespielen der Auslagen entwickelten sich zu einem wichtigen Bestandteil der Werbung von Plautz. Für die Auslagen gab es sogar einige Preise, so etwa vom Diogenes Verlag. Dass die im Onlineshop bestellten Bücher versandkostenfrei zugestellt werden, ist eine Folge der entsprechenden Vorgehensweise und Geschäftspolitik von Amazon, dem natürlichen Feind aller Buchhandlungen. Dieser Onlinehändler und auf Bestseller konzentrierte, unpersönliche Fachmarktket-
ten holten sich bereits vor mehr als zehn Jahren nach Einschätzung des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels 10 bis 20 Prozent des Umsatzes, heute sind es wesentlich mehr. Buchhändler wie Claus Schwarz schätzen den Abgang auf 40 bis 50 Prozent. Im positiven Sinne schätzen sie aber auch die Solidarität ihrer Kunden, die in kleineren Städten und Gemeinden möglicherweise größer ist als in Metropolen. Schwarz: »Manche Kunden bestehen sogar darauf, das Porto zu bezahlen. In der Lockdownzeit haben wir sicher viele Kunden von Amazon gewonnen.«
Zur Kundschaft zählt die Buchhandlung ferner vier Universitäten, mehrere Büchereien und seit einem halben Jahr auch die Nationalbibliothek. Besonders wichtig erscheint dem Gleisdorfer Betrieb die Versorgung verschiedener Bibliotheken. So wird etwa eine langjährige Kooperation mit Kindergärten und Schulen gepflegt. »Durch den Generationenwechsel bei den Lehrern geht dieser langjährige Bezug zu uns als Buchhandlung leicht verloren, daher bemühen wir uns dranzubleiben«, so Geschäftsführerin Petra Schaller. Als eine der größten eigentümergeführten Buchhandlungen Österreichs leistet sich Plautz etwas, das mangels Kostendeckung nicht mehr viele Buchhandlungen machen: Es werden Büchertische zur Verfügung gestellt. Etwa für die Pädagogische Hochschule, die Kirchlich Pädagogische Hochschule, die Elementarpädagik, den ORF Steiermark/Hör-und Seebühne, den Steiermarkhof oder auch einmal pro Monat für Lesungen in der Steiermärkischen Landesbibliothek. Insgesamt werden zwischen 70 und 80 Institutionen mit Büchern von dem oststeirischen Unternehmen beliefert.
Noch besserer Wohlfühlort
Claus Schwarz, der ab 2005 die Geschäftsführung innehatte und seit 2015 Eigentümer ist, weiß, wie wichtig der kontinuierliche Kontakt mit den Kunden ist. Die sich wiederum des Slogans »Buy local« (daheim einkaufen) immer mehr bewusst zu werden scheinen. Schaller: »Gerade im Handel kann es nur miteinander funktionieren. Die Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen und wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserem Service punkten. Aber natürlich muss es auch für uns passen. Wenn wir in der Gesellschaft nicht zusammenhalten, wird es bald keinen Handel mehr geben und man wird durch leere Innenstädte ohne jegliches Flair spazieren.« Die Buchhandlung Plautz ist ein gutes Bei-
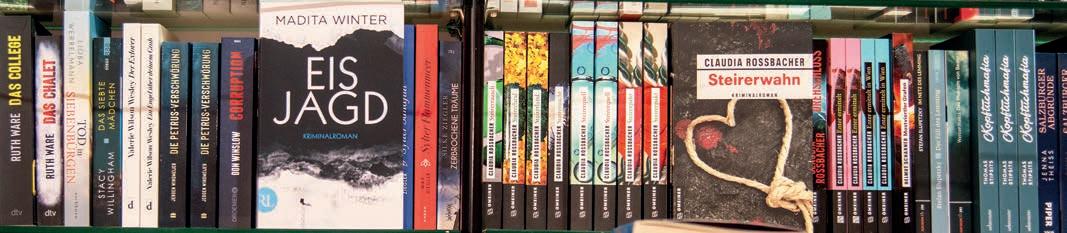



Ohne Schulbuchaktion würde es die Vielfalt der Buchhandlungen nicht geben.
Claus Schwarz, Buchhändler
spiel dafür, dass es einer gehörigen Portion Unternehmergeistes bedarf, mit Risiko- und Investitionsbereitschaft, einem Sensorium für Entwicklungen und einem klaren Ziel. Erst kürzlich investierte Claus Schwarz über 100.000 Euro in einen Umbau, im Laufe der Geschäftsentwicklung wurden die Papierhandlung und eine Filiale aufgegeben, weil sich die Marktbedingungen geändert hatten, um schließlich – nicht zuletzt mit Hilfe einer Feng-Shui-Expertise – einen Wohlfühlort zu einem noch besseren Wohlfühlort zu machen. Dazu ist es auch notwendig, neben Fenstern und Türen in andere Welten, sprich Bücher, sogenannte Nonbooks, sprich Geschenkartikel, anzubieten. Vom Booklight über Schreibwaren und Spiele bis zu Artikel für anlassbezogene Bereiche, wie zum Beispiel Taufkerzen. Noch wichtiger aber ist es, Aktivitäten zu setzen. Und das macht die Buchhandlung Plautz. Jedes Jahr werden vier bis sechs Lesungen mit Gastautoren im Haus organisiert. So waren schon Illja Trojanow, Franzobel, Judith Taschler, Alex Beer, Konstantin Wecker oder Martin Walker in Gleisdorf. Betreut werden aber auch Großveranstaltungen mit mehreren hundert Gästen, zum Beispiel mit der Stadt Gleisdorf im »Forum Kloster« mit Autoren wie Paul Lendvai oder Christian Wehrschütz. »Lesegenuss nach Ladenschluss« ist eine weitere Spezialität des Hauses: Vier- bis fünfmal pro Monat können fünf bis zehn Personen die Buchhandlung nach 18 Uhr für jeweils 20 Euro für sich allein nutzen, schmökern und sich an Sekt, Wein, anderen Getränken und Prosciuttojausen laben. Dafür sind engagierte Mitarbeiter notwendig, die insbesondere viel Lesearbeit in ihrer Freizeit erledigen, um die Kunden unmittelbar und gut beraten zu können, denn kompetente Beratung ist eine der herausragenden Stärken dieser Buchhandlung; neben
zahlreichen weiteren Veranstaltungen, die sich etwa unter dem Motto »Kids & Books« gezielt an Eltern mit Kindern richten.
50 Jahre Schulbuchaktion
Von großer wirtschaftlicher Bedeutung für Buchhandlungen, so auch für Plautz, ist die Schulbuchauslieferung. Durch die Schulbuchaktion, die 1972 unter dem damaligen Bundeskanzler Kreisky als familien- und bildungspolitische Leistung eingeführt wurde, werden Schülerinnen und Schüler an österreichischen Schulen seit mehr als 50 Jahren unentgeltlich mit den notwendigen Unterrichtsmitteln, genauer den Schulbüchern, ausgestattet. Wenn man so wie Plautz an mehr als 60 Schulen die Bücher ausliefert, ist das zwar ein gutes Geschäft, aber auch beinharte Knochenarbeit. Es müssen fast 100.000 Bücher transportiert werden, das sind rund 70 Tonnen. Dafür mietet Claus Schwarz jedes Jahr extra zwei Lagerhallen und einige Kleintransporter an und er muss sechsstellige Beträge vorfinanzieren. Der Organisationsaufwand ist gewaltig und umfasst etwa auch die Bestellungen der einzelnen Schulklassen und die zeitgerechten Meldungen an die Verlage, die ihre Auflagen danach richten. Das System hat sich offenbar bewährt. Schwarz: »Der Staat verdient nicht nur die zehn Prozent Mehrwertsteuer zurück, die Spediteure und die Verlage bekommen Aufträge und für uns Buchhändler zahlt es sich auch aus. Man muss sagen, ohne Schulbuchaktion würde es die Vielfalt der Buchhandlungen nicht geben.« Apropos Vielfalt: Neben lauschigen, gemütlichen Leseecken und einem Kinderspielbereich mit Rutsche und buchaffinem Spielzeug gibt es in der Buchhandlung Plautz auch eine Kaffeebar und der Kaffee ist gratis. Diesbezüglich hat sie dem Antico Caffè San Marco in Triest etwas voraus. n
Buchhandlung Plautz GmbH
8200 Gleisdorf, Sparkassenplatz 2 Telefon +43 3112 2485
plautz.at
Dieses Fazitportrait erschien erstmals im Juni 2023.


Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf diese Welt ausüben möchten.
Dame Jane Goodall, 1934–2025, britische Verhaltens- und Primatenforscherin
Schauspielhaus
Romeo und Julia überzeugen – trotz ihrer nicht sonderlich klasse Familien – am Grazer Schauspielhaus. Ein prachtvolles
Highlight in Schwarzweiß, das es ob seiner versteckten Opulenz lohnt, ein zweites Mal besucht zu werden.

Franz Solar und Luisa Schwab
Von Michael Petrowitsch
Der deutsche Regisseur Emre Akal war schon einmal mit Elfriede Jelineks Klimastück »Sonne/Luft« in Graz. Damals empfanden wir die animierte Weltraummission mehr als gelungen. Jetzt setzt er ausgerechnet mit einem Allerweltsklassiker einen drauf. Und wie! Was tun mit William Shakespeares »Romeo und Julia«, wird er sich im stillen Kämmerlein gefragt haben. Und herausgekommen ist ein Geschenk, das wir beseelt anzunehmen haben.
Genialer Tüftler
Schon durch die vom genialen Tüftler Enik entworfene Soundstruktur sind wir akustisch beglückt angekommen. Zudem überzeugt die Sprachstruktur. Es gibt nur wenig gesprochenes Wort in der Inszenierung. Die Reduktion ist jedoch so fein und subtil, dass das umwerfende Ensemble und die nachgerade gesamtkunstwerkliche Inszenierung das Publikum über eineinhalb Stunden an den Sessel schraubt. So eine Verinnerlichung der Spielfiguren mit dem Bühnenbild erlebt man selten. Es gemahnt zuweilen an einen Trickfilm aus vordigitaler Zeit, an Puppenbühnen, an Traumwandlung.
Mantra usw.
Ein donnerndes, ritualisierendes Mantra stülpt sich über alles und erinnert sich und den »Zu-Schauer« an die Basis und unerschütterlichen Grundfesten al-

ler schweinischen, heteronormativen Patriarchatsysteme: »Zwei Familien von gleichem Stand – wo alter Hass setzt neue Wut in Brand, wo Bürgerkrieg ist höchstes Bürgerglück, zwei Häuser, die niemals Frieden heißen, Ahnen, Eltern, Feinde voller Wut.«
Permanenter Wechsel
Die Kostüme sind so ein bisschen und irgendwie Klaus Nomi und ein bisschen und irgendwie Hugo Ball beim Dada-Auftritt im Cabaret Voltaire. Das ist besonders schön bei Franz Solar und Julia Schwab (als Mutter, famos!) anzusehen. Das ganze Bühnenbild ist in Schwarzweiß hingedichtet, die beiden verfeindeten Familien in ihrer erbärmlichen Verkrustetheit bewegen sich in Zeitlupe, am schnellsten tut die Drehbühne ihren Dienst. Selbige bringt durch ihren permanenten Wechsel das zu Erzählende voran. Die hinderliche Familialstruktur vermögen Romeo und Julia (Mario Lopatta und Luiza Montero) bekanntlich nicht zu brechen. Durch geschickte Farbwahl jedoch bricht Kostümbildnerin Lara Roßwag die geniale Bühnenbild(-ein-)gebung von Mehmet & Kazim Akal. Nämliche ist nicht der einzige Grund, den Abend ein zweites Mal erleben zu sollen.
Es gibt einfach zu viel zu entdecken, das gerade in der gezielten, präzisen Verlangsamung, in der stillen Bewegung, im Hingehauchten vor dem Erkennen als Publikum unterzugehen droht. Hingehen, bevor es nichts mehr zu sehen gibt! n
Die Tragödie von Romeo & Julia durchaus frei nach William Shakespeare Aktuelle Termine 29./31.10., 6./8./22.11 sowie 5./16.12.
schauspielhaus-graz.at
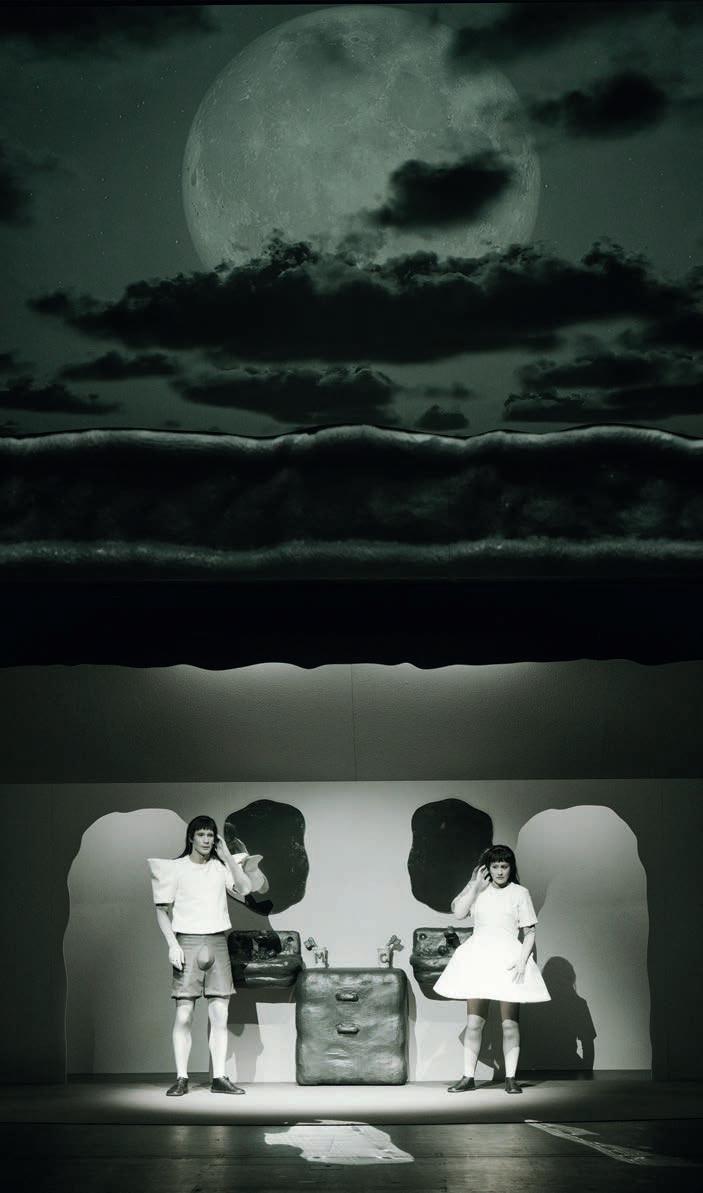
Opernhaus
Harald Schmidt beehrte zweimal die Oper Graz. Diesmal als Hausmeister und Conférencier mit Vorliebe für Wohnraumbeschaffung im Moskauer Umland.
Harald Schmidt

Von Michael Petrowitsch

Rezension
Werner Schandor: Die Sterne sehen heut’ sehr anders aus. Über Genderfolklore und Medienklischees. Edition tobak, 2025, 176 Seiten, ca. 20 Euro
Late-Night-Legende Harald Schmidt frönte seiner Leidenschaft für das Musiktheater und führte durch Dimitri Schostakowitschs temporeiche Operette, in der junge Paare von einem Leben in den modernen Wohnblocks von Tscherjomuschki vor den Toren Moskaus träumen. Doch Korruption, Bürokratie und Chaos machen ihre Hoffnungen zunichte. Mit eingängigen Melodien, beißendem Witz und einem Hauch von Romantik entlarvt Schostakowitsch die Kluft zwischen Propaganda und Realität. Ein musikalisches Feuerwerk, das mit Humor und Ironie die gesellschaftlichen Missstände seiner (und auch unserer) Zeit seziert. Es war brillant, zeitlos und unterhaltsam. Eine konzertante Aufführung in russischer Sprache mit deutschen Übertiteln, in der Schmidt als korrupter Hausmeister überraschte, und auch fleißig Russisch parlierte. Komm bald wieder, Harald. n
Der Grazer Germanist und Hochschullektor Werner Schandor legt in seiner Essaysammlung »Die Sterne sehen heut’ sehr anders aus« eine fundierte Kritik am Gendern in der deutschen Sprache vor. Dass er auch PR-Experte ist, erkennt man an den pointierten Aussagen und mehr oder minder offenen Spitzen gegen die politischen Kräfte hinter dem »Neusprech«.
Von Josef Schiffer
In den politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre hat das Thema eine zunehmend prominente Rolle einzunehmen begonnen und sorgt auf beiden Seiten für erhitzte Gemüter. Dabei begann das Phänomen von der breiten Öffent-
lichkeit weitgehend unbemerkt, als sich seit den Neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Amerika ausgehend an den heimischen Universitäten der Trend ausbreitete, das weibliche Geschlecht in Texten »sichtbar« zu machen. Zunächst im Unibetrieb aus freien Stücken verwendet, wurde Gendern in Seminar- und Ab-
schlussarbeiten bald ein verpflichtendes Kriterium und sorgte oft für Unmut. In welcher Form das geschehen solle, unterlag selbst bald ideologischen Erwägungen. So wurde das berüchtigte Binnen-I nacheinander von Gendergap, Sternchen und Doppelpunkt abgelöst, um die sexuelle Diversität und »nonbinäre« Personen abzubilden.
Scharfsinnige Essays
Schandor bezweifelt in seinen durchaus scharfsinnigen Essays, die im Verlauf mehrerer Jahre entstanden sind − auch wenn einzelne Passagen wie jene über das Männerleid etwas wehleidig rüberkommen −, die Hintergründe der vorgeblich edlen Motive für das Gendern, denn damit mache man weniger die Geschlechter sichtbar als das eigene Bemühen um die »gerechte« Sprache. Die feministische Kritik am Patriarchat und der einseitigen Bevorzugung der Männer wird damit selbst zu einer autoritären Haltung, mit politischer Korrektheit die Gesellschaft zu »verbessern«. Aber dieser vorgeblich wohlgemeinte Schuss geht nach hinten los, so

Werner Schandor
Schandor, denn in der Bevölkerung gibt es eine weitaus überwiegende Ablehnung von Gendervorgaben in amtlichen Formularen, Gesetzestexten und Medien. In eine Ecke mit erzkonservativen oder gar völkischen Weltanschauungen will sich der Autor aber keinesfalls stellen lassen, denn Anliegen wie »Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt von Lebensentwürfen und Antirassismus« seien unbedingt zu unterstützen. Schandor argumentiert auf vielen Ebenen intelligent gegen die Auswüchse des sprachlichen Genderns. Da von dessen völligem Verschwinden jedoch nicht auszugehen ist, gibt Schandor immerhin versöhnlich Tipps, wie man geschlechtergerecht formuliert, ohne die Sprache zu verhunzen. n

Jetzt Menschen mit Behinderung direkt und schnell helfen!
Deine Spende ist steuerlich absetzbar! FA-Registrierungsnummer: SO31950
Allmonatliche Finalbetrachtungen von Johannes Tandl

Antisemitismus war lange das Monopol der Rechten. Er war dumpf, völkisch und aggressiv. Heute trägt er andere Kleider – akademische, aktivistische und moralische. Er spricht von Gerechtigkeit und Unterdrückung, von Kolonialismus und Kapital. Und doch bleibt sein Kern derselbe: die uralte Obsession, das Böse in der Welt mit dem Jüdischen zu identifizieren – heute halt als »Kritik an Israel« codiert. Der linke Antisemitismus ist kein Zufall. Karl Marx schrieb 1844, das praktische Wesen des Juden sei der Schacher – ein Satz, der Kapitalismuskritik und Judenfeindlichkeit dauerhaft miteinander verband. In der Folge wurde der Jude zum Symbol des entfremdeten Marktes, des globalen Kapitals, des kalten Geldes. Noch heute finden sich in manchem »antikapitalistischen« Diskurs dieselben Bilder – nur modernisiert: »Finanzeliten«, »globale Player«, »Zinsgewinner«. Man spricht nicht von Juden, aber man meint sie. Seit den Neunzehnsechzigerjahren verlagert sich die Bühne. Der »reiche Händler« wird
Linker Antisemitismus.
Die moralische Tarnkappe des Hasses
als Projektionsfläche vom Staat Israel ersetzt. In der Sprache der postkolonialen Linken gilt der jüdische Staat als Außenposten des Westens, als Unterdrücker der Entrechteten. Antizionismus wird zum moralischen Code, in dem sich der jahrhundertealte Hass neu formiert. Natürlich darf man Israels Politik kritisieren – wie jede andere. Doch wer Israel dämonisiert, ihm allein das Existenzrecht abspricht oder seine Bürger weltweit haftbar macht, überschreitet eine Grenze, die nichts mehr mit Politik zu tun hat.
Linker Antisemitismus ist besonders tückisch, weil er sich als Mitgefühl tarnt. Wer Israel verurteilt, sieht sich auf der Seite der Opfer. Doch in Wahrheit kehrt sich die Moral um. Die Nachfahren derer, die den Juden einst ihre Menschlichkeit absprachen, erklären sie heute zu Tätern. Aus historischer Verantwortung wird moralische Entlastung. Der Hass kommt nicht mehr im Zorn, sondern im Namen der Gerechtigkeit.
Und weil diese Haltung intellektuell daherkommt, gilt sie vielen als diskursfähig. Universitäten, NGOs und Kulturhäuser übernehmen den Code des »Dekolonialismus« – und merken nicht, wie schnell er kippt. Wo Machtverhältnisse zum alleinigen Maßstab werden, müssen die Juden zwangsläufig wieder auf der falschen Seite stehen: zu mächtig, zu westlich, zu weiß, zu privilegiert. Dass jüdische Studierende sich heute an europäischen Unis wieder fürchten müssen, ist das Symptom einer moralischen Verwilderung, die sich selbst für Aufklärung hält. Noch gefährlicher ist, dass sich diese Haltung längst in Medien, Feuilletons und politischen Stiftungen eingenistet hat – also in jenen Räumen, die sich selbst als Korrektiv der Gesellschaft verstehen.
Der Unterschied zu rechtem oder islamistischem Judenhass liegt allein im Tonfall. Dort kommt er mit Fahne, hier mit Hashtag. Dort im Namen der »Patrioten«, hier im Namen der Gerechtigkeit. Aber in der Logik ist er identisch. Er sucht Sündenböcke, konstruiert Schuld, erklärt das Jüdische zum Störfaktor einer heilen Welt. Und er folgt derselben psychologischen
Versuchung: Wer sich moralisch überlegen fühlt, braucht keinen Zweifel – Juden als Feindbilder reichen da völlig. Linker Antisemitismus ist darum nicht harmloser, sondern heute sogar gefährlicher. Schließlich befindet er sich nicht am extremistischen Rand, sondern in der Mitte der Gesellschaft und des moralischen Diskurses. Weil er sich in wohlmeinenden Worten versteckt und im Brustton der Empörung argumentiert. Der rechte Antisemitismus schreit, der linke flüstert – und wird gerade deshalb oft überhört. Wer den Hass wirklich bekämpfen will, muss auch diesen Ton erkennen. Antisemitismus ist keine politische Meinung, sondern eine Denkform. Und diese Denkform kennt keine Himmelsrichtung. Sie findet nur immer neue Sprachen, um sich selbst zu verbergen. Denn am Ende ist es gleichgültig, ob jemand die Juden im Namen des Volkes, des Propheten oder der Gerechtigkeit verachtet. Das Ergebnis bleibt immer dasselbe: Ausgrenzung, Entmenschlichung und Gewalt. Antisemitismus hat viele Gesichter, aber immer dasselbe Ziel – die Auslöschung dessen, was an die eigene Schuld erinnert. n
Sie erreichen den Autor unter johannes.tandl@wmedia.at

Gemeinsam für noch mehr betriebliche Gesundheitsförderung im Einsatz: 1. Reihe v.l. Fachgruppenobfrau Daniela Gmeinbauer, SVS-Direktor Günther Bauer, WKO-Vizepräsidentin Gabi Lechner, BVAEB-Direktorin Christa Hörzer, PVA-Vorsitzende Christine Korp, Fachgruppenobfrau Ingrid Karner. 2. Reihe v.l. AUVA-Unfallverhütungsdienst Christoph Mandl, Fachgruppenobmann Klaus Friedl, Ärztekammer-Präsidialreferentin Neshat Quitt
Mit dem Förderpreis „fit im job“ werden steirische Betriebe ausgezeichnet, die sich besonders für die körperliche und geistige Gesundheit ihrer Teams engagieren. Prämiert werden innovative Gesundheitsprojekte in vier Kategorien. In den Kategorien 1 und 2 (Kleinst- und Kleinbetriebe) wird jeweils ein Förderpreis vergeben. In den Kategorien 3 und 4 erfolgt eine Unterteilung in „BGF-Preis“ für klassische Gesundheitsprojekte und einen „BGM-Preis“ für die Integration von BGF in das betriebliche Managementsystem.
Die Gewinner:innen werden mit einem Award, einer Urkunde und einer Plakette ausgezeichnet. Zusätzlich erhalten die Preisträger:innen der Kategorien 1 und 2 einen Geldpreis von jeweils 500 Euro vom Gesundheitsressort des Landes Steiermark.



