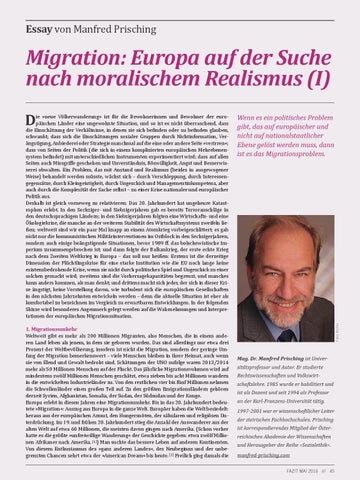Essay von Manfred Prisching
Migration: Europa auf der Suche nach moralischem Realismus (I) ie »neue Völkerwanderung« ist für die Bewohnerinnen und Bewohner der europäischen Länder eine ungewohnte Situation, und so ist es nicht überraschend, dass die Einschätzung der Verhältnisse, in denen sie sich befinden oder zu befinden glauben, schwankt; dass sich die Einschätzungen sozialer Gruppen durch Nichtinformation, Verängstigung, Anbiederei oder Strategie manchmal auf die eine oder andere Seite »verirren«; dass von Seiten der Politik (die sich in einem komplizierten europäischen Mehrebenensystem befindet) mit unterschiedlichen Instrumenten experimentiert wird; dass auf allen Seiten auch Missgriffe geschehen und Unverständnis, Böswilligkeit, Angst und Besserwisserei obwalten. Ein Problem, das mit Anstand und Realismus (beides in ausgewogener Weise) behandelt werden müsste, wächst sich – durch Verschleppung, durch Interessengegensätze, durch Kleingeistigkeit, durch Ungeschick und Managementinkompetenz, aber auch durch die Komplexität der Sache selbst – zu einer Krise nationaler und europäischer Politik aus. Deshalb ist gleich vorneweg zu relativieren: Das 20. Jahrhundert hat ungeheure Katastrophen erlebt. In den Sechziger- und Siebzigerjahren gab es bereits Terroranschläge in den deutschsprachigen Ländern; in den Siebzigerjahren folgten eine Wirtschafts- und eine Ökologiekrise, die manche an der weiteren Stabilität des Wirtschaftssystems zweifeln ließen; weltweit sind wir ein paar Mal knapp an einem Atomkrieg vorbeigeschlittert; es gab nicht nur die kommunistischen Militärinterventionen im Ostblock in den Sechzigerjahren, sondern auch einige beängstigende Situationen, bevor 1989 ff. das bolschewistische Imperium zusammengebrochen ist; und dann folgte der Balkankrieg, der erste echte Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa – das soll nur heißen: Erstens ist die derzeitige Dimension der Flüchtlingskrise für eine starke Institution wie die EU noch lange keine existenzbedrohende Krise, wenn sie nicht durch politisches Spiel und Ungeschick zu einer solchen gemacht wird; zweitens sind die Vorhersagekapazitäten begrenzt, und manches kann anders kommen, als man denkt; und drittens macht sich jeder, der sich in dieser Krise ängstigt, keine Vorstellung davon, wie turbulent sich die europäischen Gesellschaften in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden – denn die aktuelle Situation ist eher als komfortabel zu bezeichnen im Vergleich zu erwartbaren Entwicklungen. In der folgenden Skizze wird besonderes Augenmerk gelegt werden auf die Wahrnehmungen und Interpretationen der europäischen Migrationssituation. 1. Migrationsumkehr Weltweit gibt es mehr als 200 Millionen Migranten, also Menschen, die in einem anderen Land leben als jenem, in dem sie geboren wurden. Das sind allerdings nur etwa drei Prozent der Weltbevölkerung, insofern ist nicht die Migration, sondern der geringe Umfang der Migration bemerkenswert – viele Menschen bleiben in ihrer Heimat, auch wenn sie von Elend und Gewalt bedroht sind. Schätzungen der UNO zufolge waren 2013/2014 mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Das jährliche Migrationsvolumen wird auf mindestens zwölf Millionen Menschen geschätzt, etwa sieben bis acht Millionen wandern in die entwickelten Industrieländer zu. Von den restlichen vier bis fünf Millionen nehmen die Schwellenländer einen großen Teil auf. Zu den größten Emigrationsländern gehören derzeit Syrien, Afghanistan, Somalia, der Sudan, der Südsudan und der Kongo. Europa erlebt in diesen Jahren eine Migrationsumkehr. Bis in das 20. Jahrhundert bedeutete »Migration«: Auszug aus Europa in die ganze Welt. Europäer haben die Welt besiedelt: heraus aus der europäischen Armut, den Hungersnöten, der säkularen und religiösen Unterdrückung. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert stieg die Anzahl der Auswanderer aus der alten Welt auf etwa 60 Millionen, die meisten davon gingen nach Amerika. (Schon vorher hatte es die größte »unfreiwillige Wanderung« der Geschichte gegeben: etwa zwölf Millionen Afrikaner nach Amerika. [1]) Man suchte das bessere Leben auf anderen Kontinenten. Von diesem Enthusiasmus des »ganz anderen Landes«, des Neubeginns und der unbegrenzten Chancen zehrt etwa der »American Dream« bis heute. [2] Freilich ging damals die
Wenn es ein politisches Problem gibt, das auf europäischer und nicht auf nationalstaatlicher Ebene gelöst werden muss, dann ist es das Migrationsproblem.
Foto: Archiv
D
Mag. Dr. Manfred Prisching ist Universitätsprofessor und Autor. Er studierte Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre. 1985 wurde er habilitiert und ist als Dozent und seit 1994 als Professor an der Karl-Franzens-Universität tätig. 1997-2001 war er wissenschaftlicher Leiter der steirischen Fachhochschulen. Prisching ist korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Herausgeber der Reihe »Sozialethik«. manfred-prisching.com FAZIT MAI 2016 /// 45