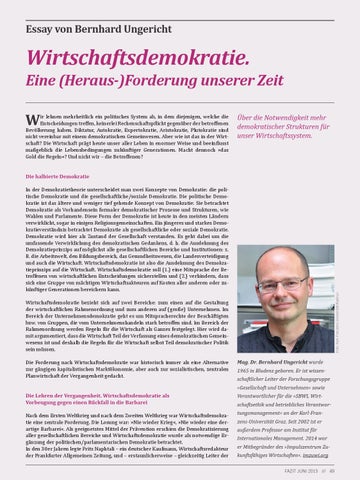Essay von Bernhard Ungericht
Wirtschaftsdemokratie.
Eine (Heraus-)Forderung unserer Zeit W
ir lehnen mehrheitlich ein politisches System ab, in dem diejenigen, welche die Entscheidungen treffen, keinerlei Rechenschaftspflicht gegenüber der betroffenen Bevölkerung haben. Diktatur, Autokratie, Expertokratie, Aristokratie, Plutokratie sind nicht vereinbar mit einem demokratischen Gemeinwesen. Aber wie ist das in der Wirtschaft? Die Wirtschaft prägt heute unser aller Leben in enormer Weise und beeinflusst maßgeblich die Lebensbedingungen zukünftiger Generationen. Macht dennoch »das Gold die Regeln«? Und nicht wir – die Betroffenen?
Über die Notwendigkeit mehr demokratischer Strukturen für unser Wirtschaftssystem.
Die halbierte Demokratie
Wirtschaftsdemokratie bezieht sich auf zwei Bereiche: zum einen auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenordnung und zum anderen auf (große) Unternehmen. Im Bereich der Unternehmensdemokratie geht es um Mitspracherechte der Beschäftigten bzw. von Gruppen, die vom Unternehmenshandeln stark betroffen sind. Im Bereich der Rahmenordnung werden Regeln für die Wirtschaft als Ganzes festgelegt. Hier wird damit argumentiert, dass die Wirtschaft Teil der Verfassung eines demokratischen Gemeinwesens ist und deshalb die Regeln für die Wirtschaft selbst Teil demokratischer Politik sein müssen.
Foto: Karl-Franzens-Universität/Kastrun
In der Demokratietheorie unterscheidet man zwei Konzepte von Demokratie: die politische Demokratie und die gesellschaftliche/soziale Demokratie. Die politische Demokratie ist das ältere und weniger tief gehende Konzept von Demokratie: Sie betrachtet Demokratie als Vorhandensein formaler demokratischer Prozesse und Strukturen, wie Wahlen und Parlamente. Diese Form der Demokratie ist heute in den meisten Ländern verwirklicht, sogar in einigen Religionsgemeinschaften. Ein jüngeres und starkes Demokratieverständnis betrachtet Demokratie als gesellschaftliche oder soziale Demokratie. Demokratie wird hier als Zustand der Gesellschaft verstanden. Es geht dabei um die umfassende Verwirklichung des demokratischen Gedankens, d. h. die Ausdehnung des Demokratieprinzips auf möglichst alle gesellschaftlichen Bereiche und Institutionen: z. B. die Arbeitswelt, den Bildungsbereich, das Gesundheitswesen, die Landesverteidigung und auch die Wirtschaft. Wirtschaftsdemokratie ist also die Ausdehnung des Demokratieprinzips auf die Wirtschaft. Wirtschaftsdemokratie soll (1.) eine Mitsprache der Betroffenen von wirtschaftlichen Entscheidungen sicherstellen und (2.) verhindern, dass sich eine Gruppe von mächtigen Wirtschaftsakteuren auf Kosten aller anderen oder zukünftiger Generationen bereichern kann.
Die Forderung nach Wirtschaftsdemokratie war historisch immer als eine Alternative zur gängigen kapitalistischen Marktökonomie, aber auch zur sozialistischen, zentralen Planwirtschaft der Vergangenheit gedacht.
Mag. Dr. Bernhard Ungericht wurde
Die Lehren der Vergangenheit. Wirtschaftsdemokratie als Vorbeugung gegen einen Rückfall in die Barbarei
Verantwortlicher für die »SBWL Wirt-
Nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg war Wirtschaftsdemokratie eine zentrale Forderung. Die Losung war: »Nie wieder Krieg«, »Nie wieder eine derartige Barbarei«. Als geeignetstes Mittel der Prävention erschien die Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche und Wirtschaftsdemokratie wurde als notwendige Ergänzung der politischen/parlamentarischen Demokratie betrachtet. In den 30er Jahren legte Fritz Naphtali – ein deutscher Kaufmann, Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und – erstaunlicherweise – gleichzeitig Leiter der
1965 in Bludenz geboren. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Forschungsgruppe »Gesellschaft und Unternehmen« sowie schaftsethik und betriebliches Verantwortungsmanagement« an der Karl-Franzens-Universität Graz. Seit 2002 ist er außerdem Professor am Institut für Internationales Management. 2014 war er Mitbegründer des »Impulszentrum Zukunftsfähiges Wirtschaften«. imzuwi.org FAZIT JUNI 2015 /// 49