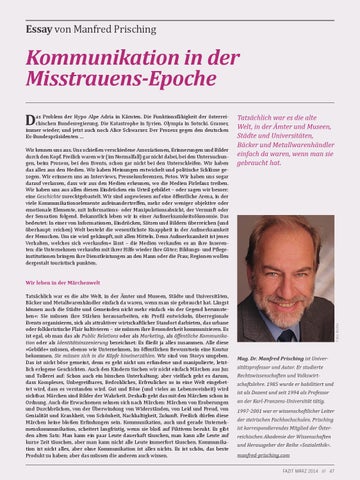Essay von Manfred Prisching
Kommunikation in der Misstrauens-Epoche D
as Problem der Hypo Alpe Adria in Kärnten. Die Funktionsfähigkeit der österreichischen Bundesregierung. Die Katastrophe in Syrien. Olympia in Sotschi. Grasser, immer wieder; und jetzt auch noch Alice Schwarzer. Der Prozess gegen den deutschen Ex-Bundespräsidenten …
Wir kennen uns aus. Uns schießen verschiedene Assoziationen, Erinnerungen und Bilder durch den Kopf. Freilich waren wir (im Normalfall) gar nicht dabei, bei den Untersuchungen, beim Prozess, bei den Events, schon gar nicht bei den Unterschleifen. Wir haben das alles aus den Medien. Wir haben Meinungen entwickelt und politische Schlüsse gezogen. Wir erinnern uns an Interviews, Pressekonferenzen, Fotos. Wir haben uns sogar darauf verlassen, dass wir aus den Medien erkennen, wo die Medien Firlefanz treiben. Wir haben uns aus allen diesen Eindrücken ein Urteil gebildet – oder sagen wir besser: eine Geschichte zurechtgebastelt. Wir sind angewiesen auf eine öffentliche Arena, in der viele Kommunikationselemente aufeinandertreffen, mehr oder weniger objektive oder emotionale Elemente, mit Informations- oder Manipulationsabsicht, der Vernunft oder der Sensation folgend. Bekanntlich leben wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das bedeutet: In einer von Informationen, Eindrücken, Sätzen und Bildern überreichen (und überhaupt: reichen) Welt besteht die wesentlichste Knappheit in der Aufmerksamkeit der Menschen. Um sie wird gekämpft, mit allen Mitteln. Denn Aufmerksamkeit ist jenes Verhalten, welches sich »verkaufen« lässt – die Medien verkaufen es an ihre Inserenten: die Unternehmen verkaufen mit ihrer Hilfe wieder ihre Güter; Bildungs- und Pflegeinstitutionen bringen ihre Dienstleistungen an den Mann oder die Frau; Regionen wollen dergestalt touristisch punkten.
Tatsächlich war es die alte Welt, in der Ämter und Museen, Städte und Universitäten, Bäcker und Metallwarenhändler einfach da waren, wenn man sie gebraucht hat.
Tatsächlich war es die alte Welt, in der Ämter und Museen, Städte und Universitäten, Bäcker und Metallwarenhändler einfach da waren, wenn man sie gebraucht hat. Längst können auch die Städte und Gemeinden nicht mehr einfach »in der Gegend herumstehen«: Sie müssen ihre Stärken herausarbeiten, ein Profil entwickeln, überregionale Events organisieren, sich als attraktiver wirtschaftlicher Standort darbieten, das urbane oder folkloristische Flair kultivieren – sie müssen ihre Besonderheit kommunizieren. Es ist egal, ob man das als Public Relations oder als Marketing, als öffentliche Kommunikation oder als Identitätsinszenierung bezeichnet: Es fließt ja alles zusammen. Alle diese »Gebilde« müssen, ebenso wie Unternehmen, im öffentlichen Bewusstsein eine Kontur bekommen. Sie müssen sich in die Köpfe hineinerzählen. Wir sind von Storys umgeben. Das ist nicht böse gemeint, denn es geht nicht um erfundene und manipulierte, letztlich erlogene Geschichten. Auch den Kindern tischen wir nicht einfach Märchen aus Jux und Tollerei auf: Schon auch ein bisschen Unterhaltung; aber vielfach geht es darum, dass Komplexes, Unbegreifbares, Bedrohliches, Erfreuliches so in eine Welt eingebettet wird, dass es verstanden wird. Gut und Böse (und vieles an Lebensweisheit) wird sichtbar. Märchen sind Bilder der Wahrheit. Deshalb geht das mit den Märchen schon in Ordnung. Auch die Erwachsenen sehnen sich nach Märchen: Märchen von Eroberungen und Durchbrüchen, von der Überwindung von Widerständen, von Leid und Freud, von Genialität und Krankheit, von Schönheit, Nachhaltigkeit, Zukunft. Freilich dürfen diese Märchen keine bloßen Erfindungen sein. Kommunikation, auch und gerade Unternehmenskommunikation, scheitert langfristig, wenn sie bloß auf Fiktivem beruht. Es gibt den alten Satz: Man kann ein paar Leute dauerhaft täuschen, man kann alle Leute auf kurze Zeit täuschen, aber man kann nicht alle Leute immerfort täuschen. Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts. Es ist schön, das beste Produkt zu haben; aber das müssen die anderen auch wissen.
Foto: Archiv
Wir leben in der Märchenwelt
Mag. Dr. Manfred Prisching ist Universitätsprofessor und Autor. Er studierte Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre. 1985 wurde er habilitiert und ist als Dozent und seit 1994 als Professor an der Karl-Franzens-Universität tätig. 1997-2001 war er wissenschaftlicher Leiter der steirischen Fachhochschulen. Prisching ist korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Herausgeber der Reihe »Sozialethik«. manfred-prisching.com Fazit März 2014 /// 47