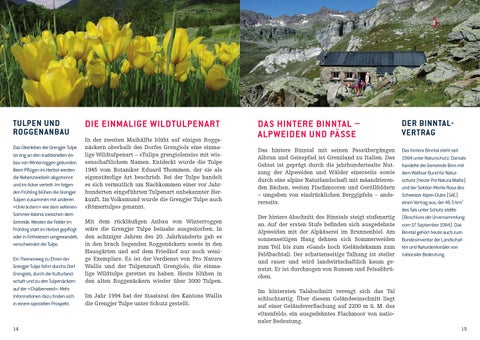TULPEN UND ROGGENANBAU Das Überleben der Grengjer Tulpe ist eng an den traditionellen Anbau von Winterroggen gebunden. Beim Pflügen im Herbst werden die Nebenzwiebeln abgetrennt und im Acker verteilt. Im folgenden Frühling blühen die Grengjer Tulpen zusammen mit anderen «Unkräutern» wie dem seltenen Sommer-Adonis zwischen dem Getreide. Werden die Felder im Frühling statt im Herbst gepflügt oder in Fettwiesen umgewandelt, verschwindet die Tulpe. Ein Themenweg zu Ehren der Grengjer Tulpe führt durchs Dorf Grengiols, durch die Kulturlandschaft und zu den Tulpenäckern auf der «Chalberweid». Mehr Informationen dazu finden sich in einem speziellen Prospekt.
14
DIE EINMALIGE WILDTULPENART In der zweiten Maihälfte blüht auf einigen Roggenäckern oberhalb des Dorfes Grengiols eine einmalige Wildtulpenart – «Tulipa grengiolensis» mit wissenschaftlichem Namen. Entdeckt wurde die Tulpe 1945 vom Botaniker Eduard Thommen, der sie als eigenständige Art beschrieb. Bei der Tulpe handelt es sich vermutlich um Nachkommen einer vor Jahrhunderten eingeführten Tulpenart unbekannter Herkunft. Im Volksmund wurde die Grengjer Tulpe auch «Römertulpe» genannt. Mit dem rückläufigen Anbau von Winterroggen wäre die Grengjer Tulpe beinahe ausgestorben. In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts gab es in den brach liegenden Roggenäckern sowie in den Hausgärten und auf dem Friedhof nur noch wenige Exemplare. Es ist der Verdienst von Pro Natura Wallis und der Tulpenzunft Grengiols, die einmalige Wildtulpe gerettet zu haben. Heute blühen in den alten Roggenäckern wieder über 3000 Tulpen. Im Jahr 1994 hat der Staatsrat des Kantons Wallis die Grengjer Tulpe unter Schutz gestellt.
DAS HINTERE BINNTAL – ALPWEIDEN UND PÄSSE
DER BINNTALVERTRAG
Das hintere Binntal mit seinen Passübergängen Albrun und Geisspfad ist Grenzland zu Italien. Das Gebiet ist geprägt durch die jahrhundertealte Nutzung der Alpweiden und Wälder einerseits sowie durch eine alpine Naturlandschaft mit mäandrierenden Bächen, weiten Flachmooren und Geröllfeldern – umgeben von eindrücklichen Berggipfeln – andererseits.
Das hintere Binntal steht seit 1964 unter Naturschutz. Damals handelte die Gemeinde Binn mit dem Walliser Bund für Naturschutz (heute Pro Natura Wallis) und der Sektion Monte Rosa des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) einen Vertrag aus, der 46.5 km2 des Tals unter Schutz stellte (Beschluss der Urversammlung vom 17. September 1964). Das Binntal gehört heute auch zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung.
Der hintere Abschnitt des Binntals steigt stufenartig an. Auf der ersten Stufe befinden sich ausgedehnte Alpweiden mit der Alpkäserei im Brunnenbiel. Am sonnenseitigen Hang dehnen sich Sommerweiden zum Teil bis zum «Gand» hoch (Geländekamm zum Feldbachtal). Der schattenseitige Talhang ist steiler und rauer und wird landwirtschaftlich kaum genutzt. Er ist durchzogen von Runsen und Felsabbrüchen. Im hintersten Talabschnitt verengt sich das Tal schluchtartig. Über diesem Geländeeinschnitt liegt auf einer Geländeverflachung auf 2200 m ü. M. das «Oxenfeld», ein ausgedehntes Flachmoor von nationaler Bedeutung.
15